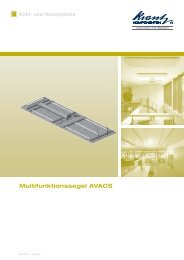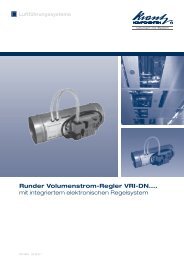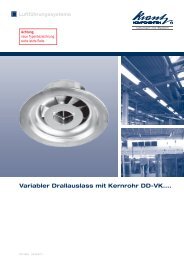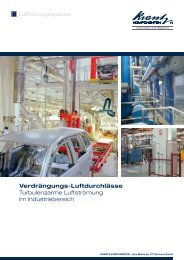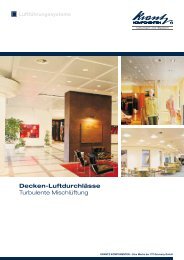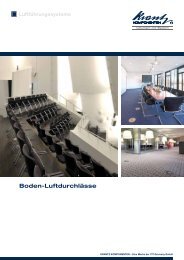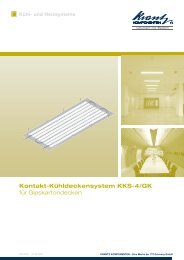Hygiene und OP bei KRANTZ KOMPONENTEN im Fokus
Hygiene und OP bei KRANTZ KOMPONENTEN im Fokus
Hygiene und OP bei KRANTZ KOMPONENTEN im Fokus
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Hygiene</strong> <strong>und</strong> <strong>OP</strong> <strong>bei</strong> <strong>KRANTZ</strong> <strong>KOMPONENTEN</strong> <strong>im</strong> <strong>Fokus</strong><br />
TAV-<strong>OP</strong>-Decke ist <strong>und</strong> bleibt das System der Wahl - von Dr. Helmut Franzen<br />
Es waren überwiegend Architekten, Fachplaner, Technische Gebäudeausrüster <strong>und</strong> Technische Leiter von<br />
Krankenhäusern, aber auch eine <strong>OP</strong>-Schwester, die der Einladung von <strong>KRANTZ</strong> <strong>KOMPONENTEN</strong> zu<br />
ihrem ersten Krankenhaus-Symposium am 29. <strong>und</strong> 30. April 2013 in Aachen folgten. Namhafte Referenten<br />
beleuchteten das Thema „<strong>Hygiene</strong> <strong>und</strong> <strong>OP</strong> <strong>im</strong> <strong>Fokus</strong>“ unter hygienischen <strong>und</strong> lüftungstechnischen<br />
Aspekten sowie aus verschiedenen Blickwinkeln. Über 80 Teilnehmer erhielten somit eine „360 OR -<br />
Betrachtung, wie der Vortrag eines Referenten lautete.<br />
In seiner Begrüßungsrede hob Dr. Klaus Hermsdorf, Geschäftsführer Vertrieb/Technik YIT Germany<br />
GmbH, die große Bedeutung von Lüftungs-, Kl<strong>im</strong>a-, Kälte- <strong>und</strong> Kryotechnik für alle Ausprägungen von<br />
Kliniken <strong>und</strong> Hochsicherheitslaboren hervor. Da<strong>bei</strong> geht es nicht nur um die Bedingungen <strong>im</strong> jeweiligen<br />
Prozessumfeld, sondern auch um die Prozesse selbst. YIT <strong>und</strong> künftig wieder Caverion ist als führender<br />
Technologiekonzern der Technischen Gebäudeausrüstung auf der ganzen Breite der Biologie- <strong>und</strong><br />
Ges<strong>und</strong>heitstechnik erfolgreich tätig.<br />
Als Kernkompetenzen von <strong>KRANTZ</strong> <strong>KOMPONENTEN</strong> definierte Dr. Helmut Franzen, Leiter dieses YIT<br />
Produktbereiches, die kontrollierte Luftführung <strong>im</strong> Raum <strong>und</strong> die Behaglichkeit. Mit Luftführungs-, Kühl-,<br />
Heiz- <strong>und</strong> Reinraumsystemen wird ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt. Da<strong>bei</strong> verfügt <strong>KRANTZ</strong><br />
<strong>KOMPONENTEN</strong> über ein komplettes Produktangebot für Krankenhäuser, einschließlich einer neuen <strong>OP</strong>-<br />
Decke mit konstruktiven <strong>und</strong> funktionalen Alleinstellungsmerkmalen. Die vielen Besonderheiten <strong>und</strong><br />
Sehenswürdigkeiten von Aachen, dem Ort der Veranstaltung, blieben ebenfalls nicht unerwähnt.<br />
Professor Dr.med. Dipl-Ing. Hans-Martin Seipp, Leiter des Studiengangs<br />
KrankenhausTechnikManagement an der Technischen Hochschule Mittelhessen, analysierte die gesetzlichen<br />
<strong>und</strong> normativen Anforderungen für die Reinraumtechnik <strong>im</strong> <strong>OP</strong>. Das Infektionsschutzgesetz, das<br />
Medizinproduktegesetz, das Ar<strong>bei</strong>tsschutzgesetz <strong>und</strong> das Strahlenschutzgesetz sind hier maßgebend.<br />
Da<strong>bei</strong> verweisen die Gesetze auf „die allgemein anerkannten Regeln der Technik“, wie sie in Normen<br />
(DIN, EN, ISO) <strong>und</strong> in Deutschland z. B. auch in VDI-Richtlinien <strong>und</strong> Richtlinien des Robert-Koch-Institutes<br />
dokumentiert sind. Für die Reinraumbereiche in Kliniken gilt insbesondere die DIN 1946 Teil 4. Danach ist<br />
für den gesamten <strong>OP</strong>-Bereich eine mechanische Be- <strong>und</strong> Entlüftung erforderlich. Für die Raumklasse 1a<br />
mit den höchsten hygienischen Anforderungen sind <strong>OP</strong>-Decken der Größe 3,2 m x 3,2 m mit dreistufiger<br />
Filterung der Zuluft (F7/F9/H13) <strong>und</strong> Turbulenzarmer Verdrängungsströmung (TAV) vorgeschrieben. Damit<br />
wird die beste Infektionsprävention für Patienten <strong>und</strong> <strong>OP</strong>-Teams <strong>und</strong> gleichzeitig eine gute Behaglichkeit<br />
erzielt. Mikroorganismen, Partikel aller Art <strong>und</strong> chirurgischer Rauch werden rasch abgeführt. Die in <strong>OP</strong>`s<br />
auftretenden Wärmelasten können von <strong>OP</strong>-Decken mit TAV-Strömung sicher beherrscht werden. Laut<br />
Professor Seipp stellen Infektionen <strong>im</strong> Krankenhaus für Patienten ein nach wie vor großes Erkrankungsrisiko<br />
dar, das zu über 30 % durch ein effektives <strong>Hygiene</strong>management vermeidbar wäre.<br />
In Vertretung des kurzfristig verhinderten Dr. med. Tobias Hirsch, Assistenzarzt am Universitätsklinikum<br />
Bochum, referierte Dipl.-Ing. Helmine Hubert, Ges<strong>und</strong>heitsamt Wetterau-Kreis, zu dem Thema „Luftübertragene<br />
bakterielle Belastungen <strong>im</strong> <strong>OP</strong>“ <strong>und</strong> stellte die Ergebnisse exper<strong>im</strong>enteller Untersuchungen der<br />
Technischen Hochschule Mittelhessen an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen vor.<br />
Da<strong>bei</strong> wurden folgende Systemalternativen untersucht:<br />
<strong>OP</strong> ohne RLT-Anlage<br />
<strong>OP</strong>-Stützstrahl-Decke (SSD) mit turbulenter Mischlüftung<br />
<strong>OP</strong>-TAV-Decke mit turbulenzarmer Verdrängungsströmung mit/ohne Strömungsstabilisatoren
Als Messmethode wurden Sed<strong>im</strong>entationsplatten an drei verschiedenen Positionen <strong>im</strong> <strong>OP</strong> aufgestellt <strong>und</strong><br />
die Koloniebildenden Einheiten (KBE) ausgezählt. Die Messungen fanden <strong>bei</strong> 277 Operationen mit einer<br />
mittleren Schnitt-Naht-Zeit von 59,6 min statt. Die positiven Effekte der mechanischen <strong>OP</strong>-<br />
Lüftungssysteme gegenüber <strong>OP</strong>´s ohne RLT-Anlage wurden einwandfrei festgestellt, ebenso der Verdünnungseffekt<br />
durch höhere Luftwechselraten (gleiche Zuluftmenge in kleinerem <strong>OP</strong>) <strong>und</strong> der klar<br />
positive Einfluss von Strömungsstabilisatoren <strong>bei</strong> TAV-Decken. Bei allen TAV-Decken-Varianten waren die<br />
gemessenen KBE-Zahlen um Faktoren kleiner als <strong>bei</strong> der Stützstrahl-Decke. Nur die TAV-Decken konnten<br />
den Ke<strong>im</strong>eintrag auch <strong>bei</strong> längeren <strong>OP</strong>-Zeiten auf konstant niedrigem Niveau halten. Bei gut ausgeführten<br />
TAV-Systemen kann der Ke<strong>im</strong>eintrag auf Werte unter 1 KBE/h begrenzt werden.<br />
In ihrem zweiten Beitrag stellte Dipl.-Ing. Helmine Hubert, Ges<strong>und</strong>heitsamt Wetterau-Kreis, die Frage, ob<br />
die aerogene Belastung von außerhalb des Schutzbereichs angeordneten Instrumententischen ein unterschätztes<br />
Risikopotential darstelle. Als Messmethode wurden wiederum Sed<strong>im</strong>entationsplatten an drei<br />
verschiedenen Positionen <strong>im</strong> <strong>OP</strong> (<strong>OP</strong>-Feld, Instrumententisch, Abluftbereich) aufgestellt <strong>und</strong> die<br />
Koloniebildenden Einheiten (KBE) ausgezählt. Die Messungen wurden in fünf Kliniken <strong>und</strong> sechs <strong>OP</strong>-<br />
Sälen mit unterschiedlichen Lüftungskonzepten <strong>und</strong> Deckensystemen <strong>bei</strong> kleinen, mittleren <strong>und</strong> großen<br />
<strong>OP</strong>´s durchgeführt. Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass der Instrumententisch <strong>und</strong> damit die<br />
Instrumente selbst ein höheres Risiko des Ke<strong>im</strong>eintrags darstellen können als das <strong>OP</strong>-Feld selbst. Vor<br />
allem die <strong>OP</strong>-Decken mit TAV-Strömung <strong>und</strong> Strömungsstabilisatoren schnitten auch <strong>bei</strong> dieser Untersuchung<br />
wieder besser ab als die Stützstrahldecken. Der Positionierung der Instrumententische <strong>und</strong> dem<br />
Schutz der Instrumente muss also besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.<br />
Dr. med. Samer El-Safadi, Assistenzarzt (Gynäkologe) am Universitätsklinikum Gießen <strong>und</strong> Marburg,<br />
befasste sich mit dem Auftreten von Partikeln in <strong>OP</strong>´s als Risiko für die Bildung von Granulomen <strong>und</strong><br />
Adhäsionen. Als mögliche Partikelquellen identifizierte er den <strong>OP</strong>-Raum, die <strong>OP</strong>-Instrumente, <strong>OP</strong>-<br />
Kleidung, <strong>OP</strong>-Abdecktücher, Nahtmaterial, Bauchtücher, Tupfer, Verbandstoffe etc. Exper<strong>im</strong>entelle<br />
Untersuchungen mit Bauchtüchern ergaben hohe direkte Partikelbelastungen <strong>und</strong> große Unterschiede<br />
zwischen verschiedenen Fabrikaten. Eine entsprechende Auswahl der Fabrikate <strong>und</strong> gezielte Vorwaschungen<br />
ermöglichen eine deutliche Reduzierung der Risiken aus dieser Partikelquelle.<br />
Professor Linus Hofrichter, Partner <strong>bei</strong> sander.hofrichter architekten Ludwigshafen, stellte Konzeptplanungen<br />
von <strong>OP</strong>-Abteilungen für mehrere Krankenhaus-Projekte vor. Am Beispiel des Neubaus des<br />
Siloah Krankenhauses, Klinikum Region Hannover (Planungs- <strong>und</strong> Bauzeit: 2007 – 2013) erläuterte er die<br />
räumliche Strukturierung des <strong>OP</strong>-Bereiches mit insgesamt neun <strong>OP</strong>´s. Da<strong>bei</strong> treffen die ambulanten <strong>und</strong><br />
stationären Patienten in getrennten Patientenaustauschzonen ein, bevor sie in die Einleitzone gebracht<br />
werden. Die U-förmig angeordneten <strong>OP</strong>´s gruppieren sich r<strong>und</strong> um diese zentrale Einleitung. Die<br />
Rüstzonen umschließen wiederum die <strong>OP</strong>´s. Weitere <strong>OP</strong>-Konzeptplanungen für folgende Bauvorhaben<br />
wurden vorgestellt: Krankenhaus St. Marienwörth Bad Kreuznach (Planungs- <strong>und</strong> Bauzeit: 2005 – 2013),<br />
das Evangelische Krankenhaus Bad Dürkhe<strong>im</strong> (Planungs- <strong>und</strong> Bauzeit: 2005 – 2012), das Kreiskrankenhaus<br />
Grünstadt (Planungs- <strong>und</strong> Bauzeit: 2003 – 2008), die Stadtklinik Frankenthal (Planungs- <strong>und</strong> Bauzeit:<br />
2008 – 2015), das Uniklinikum Tübingen CRONA Zentral-<strong>OP</strong> (Planungs- <strong>und</strong> Bauzeit: 2009 – 2013) <strong>und</strong><br />
die Glantalklinik Meisenhe<strong>im</strong> (Planungs- <strong>und</strong> Bauzeit: 2007 – 2013).<br />
Die ganzheitliche „360 OR Betrachtung“ ist <strong>im</strong> <strong>OP</strong> der richtige Systemansatz für Laurent Vermeersch,<br />
Leiter Vertrieb Europa TRILUX Medical. Patienten, Betreiber, Ärzte <strong>und</strong> Pfleger werden ebenso einbezogen<br />
wie Architektur, Design <strong>und</strong> Workflows. Die klinische <strong>und</strong> die chirurgische Betrachtung kommen<br />
hinzu. Ebenso wichtig für das menschliche Wohlbefinden sind Licht <strong>und</strong> Farben. All dies wird in Form<br />
eines <strong>OP</strong>-Design-Konzeptes in einer 3D-S<strong>im</strong>ulation visualisiert <strong>und</strong> damit für die Beteiligten „erfahrbar“<br />
gemacht. Die genaue Kenntnis der Abläufe <strong>im</strong> <strong>OP</strong> zu kennen <strong>und</strong> zu verstehen, ist Voraussetzung für eine<br />
2 / 5
opt<strong>im</strong>ale Systemgestaltung. Aus klinischer Sicht geht es auch um „State of the art“. Das Konzept muss<br />
mindestens den aktuellen technischen Stand widerspiegeln. Schließlich sollen die Umfeld- <strong>und</strong> Technik-<br />
Bedingungen eine hohe chirurgische Effizienz ermöglichen <strong>und</strong> die Wirtschaftlichkeit positiv beeinflussen.<br />
Das gilt analog auch für <strong>OP</strong>-Pfleger <strong>und</strong> -Helfer. Mit Organisation <strong>und</strong> Technik sind körperlich überfordernde<br />
<strong>und</strong> auf Dauer ges<strong>und</strong>heitsgefährdende Ar<strong>bei</strong>ten zu vermeiden, wie sie z. B. <strong>bei</strong>m Bewegen von<br />
Patienten auftreten können. Modulare Räume, intelligente Lösungen, <strong>OP</strong>-Integration <strong>und</strong> <strong>Hygiene</strong> bieten<br />
weitere Ansatzpunkte <strong>im</strong> Rahmen der „360 OR Betrachtung“ für ganzheitliche Systemlösungen. Die Betreiber<br />
von Krankenhäusern sind zunehmend auch an energieeffizienten Lösungen interessiert. Es ist<br />
erwiesen, dass Patienten, die sich wohlfühlen, schneller ges<strong>und</strong>en. Mit Design <strong>und</strong> Technik kann das<br />
Wohlbefinden <strong>und</strong> die Behaglichkeit <strong>im</strong> Krankenhaus verbessert <strong>und</strong> die Entspannung gefördert werden.<br />
Im Ergebnis verringern sich die Verweilzeiten der Patienten.<br />
Für Anika Stein, Assistenzärztin am Universitätsklinikum Gießen, erschließt die „Opt<strong>im</strong>ierung von<br />
Organisationsprozessen <strong>im</strong> <strong>OP</strong>“ wesentliche Qualitäts- <strong>und</strong> Effizienzpotentiale. Sie sagt: „Geplante <strong>OP</strong>-<br />
Zeit verursacht fixe Kosten, unabhängig davon, ob sie für Operationen verwendet wird oder nicht.“ Um der<br />
Planung möglichst nahe zu kommen, muss man die Prozesse verstehen <strong>und</strong> beschreiben, um sie<br />
opt<strong>im</strong>ieren <strong>und</strong> in der Praxis beherrschen zu können. Sie kennt die vielfältigen ablaufbedingten Probleme<br />
aus ihrer beruflichen Erfahrung. Bei der organisatorischen Opt<strong>im</strong>ierung geht es erst einmal um die<br />
Prozesszeiten selbst, insbesondere um den Abbau von Fehl- <strong>und</strong> Leerlaufzeiten. Im zweiten Schritt kann<br />
dann der Leistungsprozess verdichtet werden, z. B. durch Prozessintegration <strong>und</strong> Parallelprozesse. So<br />
kann z. B. die nächste <strong>OP</strong> schon vor dem Ende der laufenden <strong>OP</strong> vorbereitet werden. Die gemeinsame<br />
Festlegung von Prozesszeiten <strong>im</strong> Team Chirurgie, Anästhesie <strong>und</strong> <strong>OP</strong>-Pflege ist ein weiterer Ansatz für<br />
eine bessere Planung <strong>und</strong> Zeiteinhaltung. Wichtig: Die erste <strong>OP</strong> eines Tages ist am besten planbar <strong>und</strong><br />
muss verbindlich zum festgelegten Zeitpunkt beginnen. Die Bedingungen für die Einhaltung des Startpunktes<br />
sind <strong>im</strong> Detail festzulegen. Zusätzliche Räume für Regionalanästhesien sowie die Anbindung der<br />
Ein- <strong>und</strong> Ausleitung direkt an den <strong>OP</strong>-Saal ermöglichen weitere Zeiteinsparungen. In der Organisationsstruktur<br />
plädiert Anika Stein für eine schrittweise Auflösung der parallelen, funktionalen Gliederung hin zu<br />
übergreifender Prozessverantwortung mit organisatorischer Weisungsbefugnis auf allen Ebenen des<br />
Krankenhauses, d. h. Installation von Prozessverantwortlichen mit klar definierten Aufgaben <strong>und</strong><br />
Kompetenzen, z. B. Klinikmanager, <strong>OP</strong>-Koordinator, Intensiv-Koordinator. Aufnahmearzt <strong>und</strong> Belegungsmanager.<br />
Die Vorstellung der neuen Zu- <strong>und</strong> Umluft-<strong>OP</strong>-Decken von <strong>KRANTZ</strong> <strong>KOMPONENTEN</strong> übernahm Robert<br />
Busse, Produktmanager Reinraum. Sie erfüllen voll umfänglich die Anforderungen der DIN 1946 Teil 4,<br />
Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden <strong>und</strong> Räumen des Ges<strong>und</strong>heitswesens, für Raumklasse Ia <strong>und</strong><br />
einen Schutzbereich von 3 m x 3 m Größe, <strong>und</strong> ar<strong>bei</strong>ten mit einer Turbulenzarmen Verdrängungsströmung<br />
(TAV). Für eine zentrale Aufbereitung von Außen- <strong>und</strong> Fortluft bietet <strong>KRANTZ</strong> <strong>KOMPONENTEN</strong> die Zuluft-<br />
<strong>OP</strong>-Decke <strong>OP</strong>-Z an. Für eine dezentrale Aufbereitung des Umluftvolumenstroms direkt <strong>im</strong> <strong>OP</strong> steht der<br />
Typ <strong>OP</strong>-U zur Verfügung. Die neuen <strong>KRANTZ</strong>-<strong>OP</strong>-Decken zeichnen sich aus durch eine konsequent<br />
modulare Bauweise mit modularen Geweberahmen <strong>und</strong> variablen Fixpunkten für eine flexible, schnelle<br />
Montage <strong>und</strong> einfache Reinigung. Das größte Bauteil ist 1,6 m x 1,6 m. Eine spezielle aktive Leuchtendurchführung<br />
ermöglicht die Aufrechterhaltung einer gerichteten TAV-Strömung um das Stativ herum. Es<br />
gibt keine Einschränkungen <strong>bei</strong> der Positionierung von Deckenversorgungseinheiten um die <strong>OP</strong>-Decke.<br />
Das zum Patent angemeldete Mischkammer-System zur Vermischung aufbereiteter Außenluft mit der<br />
Umluft erzielt eine hervorragende Temperaturhomogenität über die gesamte Austrittsfläche der <strong>OP</strong>-Decke.<br />
Sie bietet die Möglichkeit, mit relativ hohen Temperaturdifferenzen zu ar<strong>bei</strong>ten <strong>und</strong> aufgr<strong>und</strong> der damit<br />
großen Kühlleistung auf dezentrale Kühler verzichten zu können. Dies ist nicht nur ein Kostenvorteil,<br />
sondern auch eine hygienisch <strong>und</strong> energetisch günstige Lösung. Strömungsgünstige Leuchten mit<br />
geringer Wärmeentwicklung sind für eine möglichst ungestörte TAV-Strömung sehr wichtig. Längere<br />
3 / 5
Strömungsstabilisatoren wirken sich ebenfalls positiv aus. Als beste Variante für die Absaugung der Umluft<br />
hat sich die Eckabsaugung heraus gestellt. <strong>KRANTZ</strong> <strong>KOMPONENTEN</strong> bietet eine komplette Deckensystem-Lösung<br />
aus einer Hand.<br />
Der Leiter der YIT Forschung <strong>und</strong> Entwicklung, Detlef Makulla, stellte die 1000 m² große Laborhalle vor.<br />
Hier finden sich Leistungsprüfstände für Kühldecken, Deckenkühlkonvektoren, Induktionsgeräte,<br />
Fassadengeräte inkl. Außenkl<strong>im</strong>a-S<strong>im</strong>ulationskammer, Messräume für Raumströmungsuntersuchungen,<br />
ein Filterprüfstand, ein Hallraum mit 200 m³ (170 t) auf Federn gelagert <strong>und</strong> eine Freifläche für projektbezogene<br />
Versuchsaufbauten. Diese Möglichkeiten werden genutzt für Produkt- <strong>und</strong> Systementwicklungen<br />
sowie projektbezogene Untersuchungen, <strong>bei</strong> Bedarf auch vor Ort. In besonderen Fällen werden auch<br />
CFD-S<strong>im</strong>ulationen flankierend eingesetzt. Der für die Entwicklung der neuen <strong>OP</strong>-Decken von <strong>KRANTZ</strong><br />
<strong>KOMPONENTEN</strong> eingesetzte Versuchsraum wurde von Detlef Makulla ausführlich vorgestellt. Er<br />
demonstrierte die einwandfreie Funktion der TAV-Strömung mit Hilfe von Strömungsvisualisierung.<br />
Christian Backes, Produktleiter HOWATHERM Kl<strong>im</strong>atechnik, befasste sich in seinem Vortrag mit den<br />
Anforderungen der DIN 1946 Teil 4 an die Komponenten der Luftförderung <strong>und</strong> der zentralen Luftaufbereitung<br />
unter dem Aspekt der <strong>Hygiene</strong> <strong>im</strong> Krankenhaus. Nach seiner Auffassung sind RLT-Geräte für<br />
<strong>OP</strong>-Abteilungen bevorzugt <strong>im</strong> darüber gelegenen Stockwerk oder in unmittelbarer Nähe anzuordnen. Im<br />
<strong>OP</strong>-Saal muss ein permanenter Überdruck zu den Vorräumen aufrecht erhalten werden. Materialien von<br />
Lüftungsanlagen dürfen weder ges<strong>und</strong>heitsgefährdende Stoffe emittieren noch einen Nährboden für<br />
Mikroorganismen bieten. Spritzbare Fugendichtmassen sind zu min<strong>im</strong>ieren. Flexible Luftleitungen sind nur<br />
für den Anschluss von Luftdurchlässen mit max<strong>im</strong>al 1 m Länge zulässig. Klappen müssen mindestens die<br />
Leckverlustklasse 2 bzw. <strong>bei</strong> erhöhten (luftdichten) Anforderungen die Leckverlustklasse 4 nach DIN EN<br />
1751 erfüllen. Als dritte Filterstufe sind mindestens Schwebstofffilter der Klasse H 13 mit Differenzdrucküberwachung<br />
einzusetzen. Die Ausführung der <strong>Hygiene</strong> RLT-Geräte muss gr<strong>und</strong>sätzlich mindestens den<br />
Anforderungen der VDI 6022 (<strong>Hygiene</strong>anforderungen), VDI 3803 (Bauliche <strong>und</strong> technische Anforderungen),<br />
DIN EN 13053 (Leistungsanforderungen) <strong>und</strong> DIN EN 13779 (Allgemeine Anforderungen)<br />
<strong>und</strong> darüber hinaus der DIN 1946 Teil 4 entsprechen. Demnach müssen <strong>im</strong> Luftstrom liegende Oberflächen<br />
sendz<strong>im</strong>irverzinkt <strong>und</strong> beschichtet ausgeführt werden. Dichtungen müssen reversierbar befestigt,<br />
d. h. dürfen nicht geklebt werden. Die Kondensatableitung hat über Kondensatwannen mit allseitigem<br />
Gefälle zum Ablaufstutzen zu erfolgen. Filterkammern in den RLT-Geräten sind so auszuführen, dass sie<br />
gut zu reinigen <strong>und</strong> die Luftfilter jederzeit leicht erreichbar sind. Die Konstruktion der Filterrahmen <strong>und</strong><br />
deren Halterung müssen eine sichere <strong>und</strong> beschädigungsfreie Montage <strong>und</strong> Demontage ermöglichen.<br />
Wärmeübertrager sind so zu gestalten, dass sie einfach zu reinigen <strong>und</strong> zu desinfizieren sind. Als Umluft<br />
für die Wärmerückgewinnung darf nur Abluft aus demselben Raum <strong>und</strong> aus funktionell dazugehörenden<br />
Nebenräumen verwendet werden. Eine Querkontamination zwischen <strong>OP</strong>-Räumen ist auf jeden Fall zu<br />
vermeiden.<br />
Praktische Erfahrungen aus periodischen hygienischen <strong>und</strong> lufttechnischen Überprüfungen in <strong>OP</strong>´s konnte<br />
Dipl.-Ing. Klemens Gramsch, Leiter Service YIT Erfurt, <strong>bei</strong>steuern. DIN 1946 Teil 4 (Stand 12.2008)<br />
fordert hier eine technische <strong>und</strong> hygienische Prüfung. Die technische Prüfung bezieht sich auf das<br />
komplette RLT-Gerät, die Prüfung der Schwebstofffilter auf Dichtsitz <strong>und</strong> Leckage <strong>und</strong> den Strömungsrichtungsnachweis<br />
unter <strong>OP</strong>-Bedingungen <strong>und</strong> außerhalb der Nutzungszeit, <strong>und</strong> dies spätestens nach drei<br />
Jahren. Im Rahmen der hygienischen Prüfung hat für Raumklasse Ia eine Visualisierung der Strömung <strong>im</strong><br />
Schutzbereich mit <strong>und</strong> ohne Leuchten, eine Prüfung der Luftströmungsrichtung <strong>und</strong> <strong>bei</strong> Räumen der<br />
Klasse Ib mit turbulenter Mischlüftung eine Erholzeitmessung zu erfolgen. Bei einer Vielzahl von Überprüfungen<br />
wurden leider diverse technische Mängel festgestellt.<br />
4 / 5
Dipl.-Ing. Klaus Dederichs, Partner der CARPUS+PARTNER AG, zeigte die Bedeutung des Risikomanagements<br />
für Krankenhäuser auf <strong>und</strong> empfahl dringend eine technische „Due Diligence“, d. h. eine<br />
sorgfältige Analyse <strong>und</strong> Beurteilung des technischen Zustandes. Da<strong>bei</strong> ist die Sichtung der Bestandsunterlagen<br />
der erste Schritt. Ihm folgen die Beurteilung des aktuellen baulichen <strong>und</strong> statischen Zustandes sowie<br />
des Zustandes der gesamten technischen Gebäudeausrüstung. Die Ergebnisse werden in einem<br />
Begehungs- <strong>und</strong> Zustandsbericht zusammengefasst. In einem Workshop mit allen Beteiligten werden die<br />
aus der technischen Due Diligence resultierenden Aufgabenstellungen definiert. Wichtig sind die klare<br />
Beschreibung der zukünftigen Schutzziele <strong>und</strong> das Erkennen aller denkbaren Gefahrenpotentiale, Störgrößen<br />
<strong>und</strong> Schadensszenarien. Für die einzelnen Szenarien werden Risikoanalysen durchgeführt <strong>und</strong> in<br />
einer Gefährdungs-/Verw<strong>und</strong>barkeits-Matrix dargestellt. Am Ende steht ein detailliertes Sicherheitskonzept.<br />
Zum Abschluss des Krankenhaus-Symposiums wagte Sahra Amirie, Fraunhofer Institut für Software <strong>und</strong><br />
Systemtechnik (ISST) Dortm<strong>und</strong>, einen Blick auf den „<strong>OP</strong> der Zukunft“ <strong>und</strong> stellte dazu das Fraunhofer-<br />
Projekt „Hospital Engineering“ in Duisburg vor. Da<strong>bei</strong> konzentriert sich das ISST auf die Informationslogistik<br />
in Krankenhäusern, <strong>bei</strong> der es gr<strong>und</strong>sätzlich darum geht, die richtigen Informationen zur richtigen<br />
Zeit am richtigen Ort in der richtigen Menge der richtigen Person bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen.<br />
Das Forschungsprojekt „Hospital Engineering“ wird von vier verschiedenen Fraunhofer Instituten, zur Zeit<br />
acht regionalen Kliniken, sieben Industriepartnern, der Medecon Ruhr <strong>und</strong> den Städten Bochum, Dortm<strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> Essen getragen. Hinzu kommen viele weitere Partner <strong>und</strong> Interessierte. Die Forschungs- <strong>und</strong> Anwendungsfelder<br />
beziehen sich auf<br />
Prozessopt<strong>im</strong>ierung<br />
Patientensicherheit<br />
Informationslogistik <strong>und</strong><br />
Kostentransparenz<br />
Die besonderen Herausforderungen <strong>im</strong> <strong>OP</strong> liegen in den Bereichen Kostenintensität, Planungssicherheit<br />
<strong>und</strong> K<strong>und</strong>en-/Patientenorientierung. Es geht darum, Fehler durch intelligente Systeme zu min<strong>im</strong>ieren, neue<br />
K<strong>und</strong>en/Patienten durch innovative Behandlungsmethoden zu gewinnen <strong>und</strong> das Personal durch Ar<strong>bei</strong>tserleichterungen<br />
zu motivieren. Ziel ist das kostentransparente, effiziente <strong>und</strong> k<strong>und</strong>enorientierte Krankenhaus.<br />
Auch Sahra Amirie fordert wie Anika Stein eine zentrale Kontrolle <strong>und</strong> ein zentrales Monitoring durch<br />
einen <strong>OP</strong>-Manager. Spezielle Ziele sind der mobile <strong>OP</strong>-Tisch, die stressfreie <strong>OP</strong>, die Zeiterfassung <strong>und</strong><br />
Ressourcenopt<strong>im</strong>ierung mit Hilfe von RFID´s <strong>und</strong> insbesondere die Erhöhung der Patientensicherheit z. B.<br />
durch Vermeidung von Verwechslungen.<br />
Insgesamt traf das Krankenhaus-Symposium die Erwartung der Teilnehmer <strong>und</strong> wurde positiv bewertet.<br />
Die Fortsetzung des Symposiums <strong>im</strong> Jahr 2014 steht <strong>bei</strong> <strong>KRANTZ</strong> <strong>KOMPONENTEN</strong> bereits auf der<br />
Agenda.<br />
Dr. Helmut Franzen<br />
Aachen, 13.05.2013<br />
5 / 5