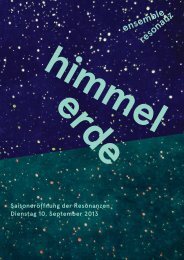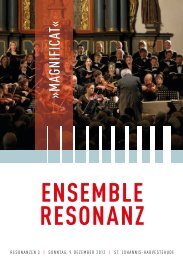Die Welle, Die zur Wucht Wurde - Ensemble Resonanz
Die Welle, Die zur Wucht Wurde - Ensemble Resonanz
Die Welle, Die zur Wucht Wurde - Ensemble Resonanz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
| Salon | E l B p H i l H a R M o n i E<br />
Kinder mit Streicherklängen, denn Elfi-<br />
Konzerte gibt es auch für Schwangere.<br />
Offenbar kann man gar nicht früh genug<br />
anfangen. „Unser Hauptproblem ist es,<br />
neues Publikum an klassische Musik heran<br />
zu führen“, sagt der Generalintendant.<br />
„Man muss den Humus aufbereiten. Noch<br />
ist er da. Es haben sich schon Fan-Clubs<br />
gebildet, auf Facebook hat die Elbphilharmonie<br />
schon über viertausend Freunde. Ich<br />
bin zuversichtlich. Es gibt Milliarden Chinesen,<br />
die sind verrückt nach dieser Musik,<br />
Millionen Japaner und Koreaner die sich<br />
dafür begeistern.“<br />
<strong>Die</strong> Planung der Architekten war noch<br />
gar nicht abgeschlossen, da wurde der<br />
Bauauftrag schon an Hochtief erteilt<br />
Vor dem Fall: Projektkoordinator Hartmut Wegener und Ole von Beust<br />
„Hochtief hat schlecht gebaut“, sagt die Hamburg Regierung<br />
6 Cicero 2.2012<br />
Künstler muss er nicht begöschen. „Ich bekam Angebote von<br />
den besten Orchestern der Welt, die fragten, wann sie hier auftreten<br />
können. Sie waren <strong>zur</strong> Eröffnung 2010 schon gebucht, dann<br />
für 2012. Zweimal habe ich einen Termin genannt. Den Fehler<br />
werde ich nicht wiederholen. Ich will mich nicht lächerlich machen.“<br />
Christoph Lieben-Seutter, ein Impresario Wiener Schule,<br />
betrachtet das Problem mit nonchalanter Ironie. „Ich lerne. Ich<br />
habe jetzt auf dieses Pferd gesetzt und will dabei sein, wenn es läuft.<br />
Das ist eine offene Wette. Mein Vertrag endet 2015.“ Termine für<br />
die Elbphilharmonie schreibt er mit Bleistift in den Kalender und<br />
trägt sie parallel für die Laeiszhalle ein. Das System funktioniert.<br />
*<br />
Einst stand hier der Kaiserspeicher, und wenn Schlag zwölf<br />
am weithin sichtbaren Turm der Zeitball fiel, stellten die Kapitäne<br />
danach ihre Uhren. <strong>Die</strong> Zeit ging darüber hinweg, Turm und<br />
Lagerhaus, im Krieg schwer mitgenommen, wurden abgerissen.<br />
1966 setzte der Architekt Werner Kallmorgen den Kaispeicher A<br />
an seine Stelle, ein resolutes Statement der Moderne, pragmatisch,<br />
eckig, gut, gegründet auf 1111 Pfählen aus Stahlbeton, tief in den<br />
Elbschlick gerammt. Doch als die Container aufkommen, wird<br />
er nicht mehr gebraucht. Der Kaispeicher A steht leer, soll einem<br />
Bürokomplex Platz machen, dem „MediaCityPort“. Dann platzt<br />
die Internetblase, man ist wieder offen für neue Ideen.<br />
Eine solche Idee hat der Projektentwickler Alexander Gérard.<br />
Warum nicht ein Zeichen der Hochkultur dorthin setzen, wo bisher<br />
Kakaosäcke gelagert wurden, fragt sich der gelernte Architekt.<br />
Gemeinsam mit seiner Frau, der Kunsthistorikerin Jana Marko,<br />
spinnt er die Idee eines Konzerthauses an der Kaizunge, als Kontrapunkt<br />
<strong>zur</strong> HafenCity, dem neuen Stadtteil aus der Retorte. <strong>Die</strong><br />
leblose, dicht aneinander gereihte Parade von Kontor- und Wohnhäusern<br />
in der handelsüblichen Ästhetik maximierter Geschossflächenzahl<br />
ödet ihn an.<br />
Warum nicht an diesem exponierten Platz etwas Geniales schaffen,<br />
das Stadt und Hafen verbindet, etwas das weit über die Grenzen<br />
der Stadt hinaus strahlt, ein weltweit sichtbares Signal, wie die<br />
Oper in Sydney oder das Guggenheim Museum in Bilbao? Wer<br />
könnte so etwas realisieren? Vor zehn Jahren, im Dezember 2001,<br />
reisen sie nach Basel, gewinnen die Architekten Jacques Herzog und<br />
Pierre de Meuron für ihre Idee und erteilen ihnen den Auftrag, ein<br />
Konzept für diesen Bau zu entwerfen. Ein Coup.<br />
Herzog & de Meuron spielt in der ersten Liga, ein globales Unternehmen<br />
mit 250 Mitarbeitern, nicht gerechnet die rund hundert<br />
Spezialisten vor Ort an weltweit mehr als 40 Baustellen. Für<br />
die Kunsthalle Tate Modern in London erhielten sie den Pritzker-Preis,<br />
der als Nobelpreis für Architekten gilt. Sie brachten die<br />
Allianz-Arena in München zum Glühen, bauten das Nationalstadion<br />
in Peking, ein Nest für die Olympischen Sommerspiele 2008.<br />
Und nun entwickeln sie für Hamburg die Vision einer architektonischen<br />
Lichtgestalt, eine gläsern schimmernde Riesenwelle, auf<br />
den Mauern eines alten Kaispeichers schwebend, mit einem Konzertsaal<br />
in ihrem Innern, der seinesgleichen sucht.<br />
Der kühne Plan erregt Aufsehen. <strong>Die</strong> New York Times erkennt<br />
eine „glückselige Balance zwischen Form und Klang“. Aber Glückseligkeit<br />
rechnet sich nicht. Wir sind in Hamburg. Ein Hotel<br />
und Luxuswohnungen sollen den Bau finanzieren, private Spenden<br />
sicher stellen, dass dem Steuerzahler keine Kosten entstehen.<br />
Nein, wirklich keine Kosten. Noch sind wir im Bereich der Utopie.<br />
Fotos: roland Magunia/ddp iMages/dapd, VolkMar sChulz/keystone pressedienst