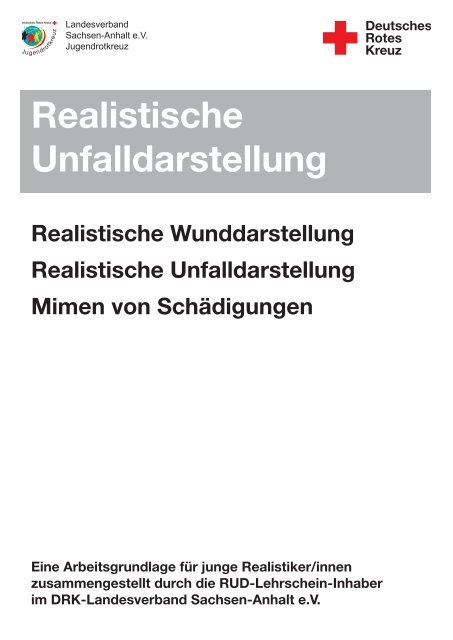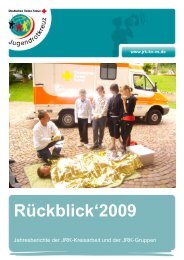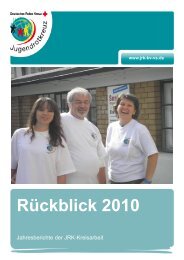Realistische Unfalldarstellung
Realistische Unfalldarstellung
Realistische Unfalldarstellung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landesverband<br />
Sachsen-Anhalt e.V.<br />
Jugendrotkreuz<br />
<strong>Realistische</strong><br />
<strong>Unfalldarstellung</strong><br />
<strong>Realistische</strong> Wunddarstellung<br />
<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong><br />
Mimen von Schädigungen<br />
Eine Arbeitsgrundlage für junge Realistiker/innen<br />
zusammengestellt durch die RUD-Lehrschein-Inhaber<br />
im DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Impressum<br />
Titel: Arbeitshilfe RUD/RWD<br />
Herausgeber: DRK-Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- Referat Jugendrotkreuz / Wasserwacht (JRK/WW)<br />
Rudolf-Breitscheid-Straße 6, 06110 Halle<br />
Redaktion: Ref. JRK/WW<br />
Vorliegende Fassung vom Oktober 2006<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 2/49 -
Inhalte der Arbeitshilfe<br />
Inhalte Seite<br />
Abschnitt 1 Allgemeines<br />
1.1 Sinn und Zweck der RUD/RWD 4<br />
1.2 Aufgabe der RUD/RWD 4<br />
1.3 Ziele der RUD/RWD 4<br />
1.4 Grundsätze der RUD/RWD 5<br />
1.5 Geschichtliches zur RUD/RWD 5<br />
1.5.1 Theater und Wunddarstellung 5<br />
1.6 Grenzen der RUD/RWD 7<br />
Abschnitt 2 Das Schminken<br />
2.1 Schminkmaterialien 8<br />
2.2 Schminkgerätschaften 10<br />
2.3 Wichtige Hinweise 11<br />
2.4 Weitere Hilfsmittel 12<br />
2.5 Mögliche Gefahren 12<br />
2.6 Hygiene 13<br />
Abschnitt 3 Das Mimen<br />
3.1 Allgemeines 15<br />
3.2 Grundlegendes 15<br />
3.3 Konkrete Schminktechniken und Darstellungen für ausgewählte Verletzungen 19<br />
3.3.1 Schnitt-, Riss- und Platzwunden 19<br />
3.3.2 Schürfwunden 20<br />
3.3.3 Gelenkverletzung und Knochenbruch 20<br />
Verstauchung 20<br />
Arm- und Handgelenkbruch 21<br />
Bein- und Knöchelbruch 21<br />
Schlüsselbeinbruch 22<br />
Rippenbruch 23<br />
Knochenbrüche 23<br />
3.3.4 Verletzung durch Fremdkörper 24<br />
3.3.5 Fingerkuppenverletzung 25<br />
3.3.6 Schock 25<br />
3.3.7 Verbrennungen 27<br />
3.3.8 Gehirnerschütterung 28<br />
3.3.9 Bewusstlosigkeit 29<br />
3.3.10 Schädelbasisbruch 29<br />
Arbeitsblatt 30<br />
Abschnitt 4 Die Unfallsituation<br />
4.1 Das Herstellen einer realistischen Lage 31<br />
4.2 Beispielhafte Unfallsituationen 32<br />
4.2.1 Verkehrsunfälle 32<br />
4.2.2 Unfälle in Industrie und Gewerbe 34<br />
4.2.3 Unfälle in Haus und Hof 35<br />
Abschnitt 5 Sicherheits- und Rechtsfragen<br />
5.1 Allgemeines 38<br />
5.2 RUD-Leiter 39<br />
5.3 Haftung / Versicherung 40<br />
Abschnitt 6 Planung von Übungen<br />
6.1 Planung von Übungen 41<br />
6.2 Aufbau des Schadensgebietes 42<br />
6.3 RUD-Einsatzplan 44<br />
Abschnitt 7 Materialien und weitere Ergänzungen<br />
7.1 Musterhafte Befüllung eines RUD-Koffers 46<br />
7.2 Materialrezepte 47<br />
7.3 Verzeichnis aller Arbeitsmittel für RUD 48<br />
7.4 Firmen, die RUD-Materialien anbieten 49<br />
7.5 Literaturhinweise und Quellennachweise 49<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 3/49 -
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 4/49 -
<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong> (RUD) / <strong>Realistische</strong> Wunddarstellung (RWD)<br />
Abschnitt 1: Allgemeines<br />
1.1 Sinn und Zweck der RUD/RWD<br />
1.2 Aufgabe der RUD/RWD<br />
1.3 Ziele der RUD/RWD<br />
1.4 Grundsätze der RWD/RUD<br />
1.5 Geschichtliches zur RWD/RUD<br />
1.6 Grenzen der RUD/RWD<br />
1.1 Sinn und Zweck der RWD/RUD<br />
Durch die <strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong> soll der Versuch unternommen werden, die Sanitätsausbildung<br />
so wirklichkeitsnah wie möglich zu gestalten! Die <strong>Realistische</strong> Wunddarstellung ist aus<br />
der Sanitätsausbildung nicht mehr wegzudenken. Es besteht ein sehr großer Unterschied in der Ausbildung,<br />
wenn gesagt wird -" Stellen Sie sich vor ... !",oder wenn man eine sehr realitätsnahe Situation darstellen<br />
kann. Als Ausbilder muss ich mir die Fragen stellen:<br />
• Wie weit reicht die Vorstellungskraft der Auszubildenden?<br />
• Hat der Auszubildende schon mal einen kritischen Unfall erlebt, damit er überhaupt in der Lage<br />
ist, sich verschiedene Verletzungen vorzustellen?<br />
• Wie hoch sind die Kenntnisse der Auszubildenden in Anatomie, damit man auch genau weiß, wo<br />
sich die Verletzung befindet?<br />
• Wie kann ich nur mit Vorstellungskraft die Adrenalinausschüttung bei den Auszubildenden erreichen?<br />
Alle diese Fragen kann auch ein Ausbilder nicht beantworten. Sollte ein solcher Mensch nun in die Lage<br />
kommen, Erste Hilfe leisten zu müssen, so wird er wahrscheinlich versagen! Auch wenn sein Kopf voll<br />
mit Wissen ist, so wird ihn der Nervus Vagus wohl doch einen Strich durch die Rechnung machen. Die<br />
Adrenalinausschüttung bewirkt ein Zittern der Hände, das sich bis zu den Ohren fortsetzt und dies führt<br />
zu einer Blockade nicht nur im Denken sondern auch im Handeln. Eben dies ist Grund dafür, die <strong>Realistische</strong><br />
Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong> in die Sanitätsausbildung aufzunehmen. Doch die <strong>Realistische</strong><br />
Wunddarstellung ist schon sehr alt, denn ganz am Anfang war William Shakespeare, aber zu dieser Geschichte<br />
später.<br />
1.2 Aufgabe der RUD/RWD<br />
Die <strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong>, kurz RUD genannt, hat die Aufgabe, Notfallgeschehen möglichst wirklichkeitsgetreu<br />
wiederzugeben und das Verhalten von Verletzten darzustellen.<br />
In fast jedem Kreisverband existieren Jugendrotkreuz-Aktionskreise „<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong>" oder<br />
sog.„Mimtrupps". Sie werden durch speziell geschulte Referenten des Landesverbandes auf ihre Aufgaben<br />
vorbereitet. Die RUD ist ein Standbein des Jugendrotkreuzes und unentbehrlich für die Arbeit des<br />
Gesamtverbandes.<br />
1.3 Ziele der RUD/RWD<br />
Ziele der wirklichkeitsgetreuen Darstellung von Notfallsituationen ist es, die Helfer auf echte Notfälle vorzubereiten,<br />
so dass sie befähigt sind<br />
• Situationen und Verletzungen richtig zu erkennen<br />
• bestehende oder sich entwickelnde Gefahren richtig einzuschätzen<br />
• eine der Situation und Verletzung angepasste richtige Hilfeleistung durchzuführen<br />
• das Zusammenspiel mehrerer Helfer zu üben<br />
• die Ängste der Helfer abzubauen<br />
Die <strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong> ist eine unentbehrliche Hilfe bei der Aus- und Weiterbildung in fast allen<br />
Bereichen der Rotkreuzarbeit.<br />
• Jugendrotkreuz-Gruppenstunden<br />
• Erste Hilfe-Ausbildung<br />
• Sofortmaßnahmen am Unfallort<br />
• Sanitätsausbildung<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 5/49 -
• Übungen<br />
• Wettbewerbe<br />
• Ärztekongresse<br />
• Instruktorentagungen<br />
• Ausbildungen aller Art<br />
• Fortbildungen aller Art<br />
Sehr gute Kenntnisse in der Ersten Hilfe und ein Mindestalter von 14 Jahren (Mime) und 16 Jahre<br />
(Schminker) sind Grundvoraussetzung für die Mitarbeit in den RUD-Aktionskreisen/RUD-Trupps.<br />
Die RUD/RWD-Ausbildung umfasst das Kennen lernen der zum Schminken notwendigen Materialien<br />
und deren Eigenschaften. Zunächst werden einfache Verletzungen geschminkt und die Verhaltensweisen<br />
der Verletzten eingeübt.<br />
Nach Abschluss einer Jugendleiterausbildung und einer RUD-Ausbildung erfolgt die Ausbildung zum<br />
„RUD-Leiter" (Mindestalter 18 Jahre). Hier liegt der Schwerpunkt auf der Vorbereitung und der Durchführung<br />
von RUD -Einsätzen (Mindestalter 16 Jahre).<br />
Nach abgeschlossenen Lehrgängen besteht die Möglichkeit sich zum Referenten/Lehrscheininhaber für<br />
"<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong>“ ausbilden zu lassen.<br />
1.4 Grundsätze der RWD/RUD<br />
Es gibt acht Grundsätze welche bei der <strong>Realistische</strong>n Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong> immer zu beachten<br />
sind!<br />
• Auf mögliche Allergien gegen bestimmte Schminkmittel bei den Darstellern und<br />
Mimen ist in jedem Fall zu achten.<br />
• Keine Darsteller einsetzen, bei denen reale Verstümmlungen vorhanden sind.<br />
• Keine tatsächlich vorhandenen Verletzungen zur Darstellung nutzen.<br />
• Kinder werden i. d. R. nicht zur Darstellung herangezogen.<br />
• Keine tierischen Produkte und Nahrungsmittel zur Anwendung bringen.<br />
• Darsteller nicht in tatsächliche Gefahr bringen, ein interessantes Umfeld wirkt zwar gut, aber<br />
nicht um jeden Preis. Die Verantwortung hierfür liegt nicht beim Darsteller, sondern beim Ausbilder.<br />
• Die Möglichkeiten zur Darstellung sind nur für entsprechende Ausbildungen gestattet und nicht<br />
für Schockeffekte zu missbrauchen.<br />
• Die Darsteller müssen die Möglichkeit haben, nicht benötigte Kleidung oder Ausrüstung an einem<br />
sicheren Ort ablegen zu können.<br />
1.5 Geschichtliches zur RWD/RUD<br />
1.5.1 Theater und Wunddarstellung<br />
Am Anfang war William Shakespeare, bekanntlich englischer Dichter. Es klingt absurd, und es mag im<br />
Blick auf den Ausbildungsaspekt auch nicht ganz zutreffen, aber es wird die Begebenheit glaubwürdig<br />
berichtet, dass anlässlich der Uraufführung von Shakespeares „Macbeth“ auf dem Globe Theatre in London<br />
zahlreiche der zuschauenden Damen ohnmächtig wurden, da die Akteure zu viel Blut vom Schlachter<br />
geholt und verwendet hatten. Sicherlich, das Drastische, das faszinierend Abstoßende lag im Geschmack<br />
der Zeit, lag im Trend, und wie heute, so gab man sich dem schaurig-schönen Nervenkitzel<br />
gern hin. Nichts anderes geschieht in Horrorfilmen, in den Episoden vom Rächer oder Mörder mit der<br />
Kettensäge oder anderen Fabeln, in denen das Unmögliche möglich wird. Aber die Grenzen des Möglichen<br />
sind auch bestimmt durch die Physiologie des Menschen. Kaum einer bringt mehr als acht bis neun<br />
Liter Blut zusammen, und aus einer normalen Arterienverletzung spritzen diese nicht einmal. Zwar kann<br />
der Eindruck des Geschehens gewaltig vergrößert werden, wenn Blut auf eine nasse Bodenbeschaffenheit<br />
trifft, wenn einige Spritzer in eine Pfütze laufen, aber auf sieben Liter kommt man da auch nicht, allenfalls<br />
auf eine starke Blutung, und vorsichtshalber wird man wohl ein volumenfüllendes Mittel, eine Infusion,<br />
anhängen. Doch diese biologisch natürlichen Grenzen geraten oft außer Sichtweite. Je größer<br />
der Effekt, desto besser war die Darbietung.<br />
Dieses Bestreben ist „normal" und scheint in der Natur des Menschen zu liegen. So war es beispielsweise<br />
bei den hoch- und spätmittelalterlichen Fastnachts-, Oster- und Passionsspielen auch nicht anders.<br />
Je blutrünstiger der Gekreuzigte dargestellt wurde, je mehr Blut von der Stirn floss, wenn sich die Domen<br />
bis zum Schädelknochen bohrten, desto begeisterter war das schaulustige Publikum. Der Zuschauer<br />
scheint sich kaum verändert zu haben. Noch immer will er das Ohr sehen, das Petrus dem Diener des<br />
Hohepriesters abgeschlagen hat.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 6/49 -
Bei einer Wunddarstellung kommt es beinahe ebenso auf den Effekt an, jedoch nicht in der Hinsicht,<br />
dass ein religiöses Geschehen dargestellt werden soll, sondern vielmehr soll ein erster Eindruck vermittelt<br />
werden.<br />
Folgende Situation:<br />
Ein Ahnungsloser kommt an einen Ort, der ihm unter Umständen bekannt ist. Er findet dort eine<br />
Lage vor, auf die er nicht vorbereitet ist, einen blutüberströmten Menschen, der sich nicht nur eine<br />
Kopfverletzung zugezogen hat, sondern ebenso Verletzungen an den Extremitäten.<br />
Die Reaktion des Ankommenden:<br />
erhöhter Puls, erhöhte Adrenalinausschüttung, ein Kribbeln, welches sich vom Bauch bis zu den<br />
Ohren hinaufzieht, Zittern der Hände.<br />
Seine Aufgabe ist es aber, unter solchen Bedingungen eine qualifizierte Erste Hilfe zu leisten,<br />
bzw. den Verunfallten zu retten.<br />
Gemeinsamkeiten von Wunddarstellung und Theater<br />
Grundsätzlich handelt es sich bei den Anlässen, bei denen die <strong>Realistische</strong> Wunddarstellung eingebracht<br />
wird, um nichts anderes als um ein Theaterspiel.<br />
Die Darsteller - sind die Mimen, sie sind Schauspieler, Akteure welche eine bestimmte Rolle zu<br />
verkörpern haben.<br />
Die Spieleiter - sind die Gruppen- oder Einheitsführer.<br />
Die Maskenbildner - sind die Schminker, von deren Können der Erfolg dieses „Schauspiels" abhängt,<br />
ob die Situation eindeutig erkannt wird.<br />
Die Zuschauer - sind die Handelnden.<br />
Es existiert ein „Drehbuch“, denn es muss eine bestimmte vorgeschriebene Handlung erfolgen. Und wer<br />
ist der Drehbuchautor? Immer der Ausbilder. Er setzt die Lage fest, er bestimmt den äußeren Ablauf. Er<br />
stellt sich Fragen, die etwa wie folgt lauten könnten:<br />
• Welches Ziel will ich erreichen?<br />
• Welches Personal steht mir zur Verfügung?<br />
• Welches Material steht mir zur Verfügung?<br />
• Für wen führe ich diese Ausbildung durch?<br />
• Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung?<br />
Ausgehend von Erfahrungen der Britischen Armee im zweiten Weltkrieg trugen zunächst Berufsschauspieler<br />
als Mimen dazu bei, Sanitäter an den Anblick von Verletzungen zu gewöhnen (1942 - 1944). Sie<br />
bildeten mit Hilfe der im Theater üblichen Schminkmaterialien Wunden nach, die bei Einsatzübungen in<br />
realitätsnahen Situationen zur Anwendung kamen. In Großbritannien, Dänemark und der Schweiz wurden<br />
1944 (später auch in Frankreich und Schweden) erste Unterlagen erstellt bzw. Hilfsmittel entwickelt,<br />
die sich speziell auf die möglichst naturgetreue Darstellung von Wunden beziehen bzw. hierbei Verwendung<br />
finden.<br />
In der Bundesrepublik Deutschland wurden nach anfänglicher Verwendung von angebundenen Verletzungskarten<br />
(bis ca. 1950) seit etwa 1951 zunächst Moulagen in Form von Gummiattrappen angeboten,<br />
die am Körper aufgeklebt wurden. 1954 erschienen dann erstmals, herausgegeben vom Jugendrotkreuz,<br />
"Blätter<br />
über <strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong>". Seit 1955 wurde dann vom DRK in mehreren Auflagen die Broschüre<br />
"<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong>" (Dr. Gerlach/Stoeckel) herausgegeben, ergänzt im Jahre 1968 durch<br />
die "Arbeitsmappe <strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong>" (Körner). Wegen schlechter Erfahrungen mit dem bis<br />
dahin bekannten unzulänglichen Materialangebot (Verletzungskarten, Moulagen) wurde 1964 der<br />
Schminkkasten "Mehlem 64" entwickelt, der nach zahlreichen Verbesserungen und Ergänzungen zwischen<br />
1965 und 1985 bis heute gebräuchlich ist.<br />
Eine Abwandlung zu diesem Schminkkasten stellt der Schminkkoffer "Bavaria 91" dar, der sich durch ein<br />
leicht erweitertes Material- und Zubehörangebot auszeichnet.<br />
Auch im DRK der ehemaligen DDR wurde die realistische Darstellung von Unfallsituationen als ein Mittel<br />
zur Verbesserung des Ausbildungsniveaus und der psychischen Belastbarkeit der Helfer genutzt. Die<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 7/49 -
Informationen zur Verletzung waren auf Geschädigtenkarten (verbale Beschreibung mit oder ohne bildliche<br />
Darstellung) zusammengefasst und später mit verschiedenen Schminkmaterialien und der ebenso<br />
wichtigen schauspielerischen Darstellung gegeben. Die vielen individuellen Initiativen von Rotkreuz Helfern<br />
erhielten Anfang der 60'er Jahre durch die Broschüre "Die realistische <strong>Unfalldarstellung</strong> - Eine Anleitung<br />
für DRK-Lehrkräfte" eine einheitliche Form. Das Schminksortiment "RU/K Sortiment DRT' der Firma<br />
Coloran und die Dia-Reihe "<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong>" standen für die laut Rahmenlehrplan 22<br />
Stunden umfassende Ausbildung als Unterrichtsmittel zur Verfügung.<br />
Eine andere Richtung erhielt die RUD mit dem Vorschlag von Herrn Werner Stammberger 1973 zur Herstellung<br />
von Wundmoulagen. Diese dünnen Gummiapplikationen wurden maschinell produziert und mit<br />
Hand bemalt. Sie kamen in Verbindung mit den bis dahin üblichen Schminkmaterialien zum Einsatz und<br />
sollten dazu beitragen, in kurzer Zeit mit möglichst geringem Aufwand viele Verletzte als Darsteller vorzubereiten.<br />
Bis 1990 wurden ca. 3000 kleinflächige und 4000 großflächige Moulagensätze produziert.<br />
Vervollständigt wurde die Unterrichtsmittelpalette im Jahre 1988 durch die Herausgabe des Handbuches<br />
"<strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong>", worauf auch heute noch viele Realistiker gerne zurückgreifen.<br />
Im Jahre 1984 wurde im DRK der Bundesrepublik Deutschland damit begonnen, für die Ausbildung<br />
in <strong>Realistische</strong>r <strong>Unfalldarstellung</strong> bundeseinheitliche Ausbildungsunterlagen zu erstellen.<br />
Die realistische Wirkung der Wunden setzt gewisse Kenntnisse in der Anatomie des menschlichen Körpers<br />
voraus. Immer wieder werden offene Frakturen an Körperstellen geschminkt, an denen sich solche<br />
Verletzungen gar nicht ereignen können. Frakturen sind nur dort glaubhaft, wo sich auch Knochen befinden.<br />
Zwar sieht jede Verletzung anders aus und Knochen können sich verschieben, aber kaum in dem<br />
oft dargestellten Maße. Ähnlich verhält es sich mit den dargestellten Stich-, Pfählungs- oder Schussverletzungen.<br />
Her ist darauf hinzuweisen, dass schon Hohlorgane die Richtung des Projektils so verändern<br />
können, dass sich der Ausschuss an einer ganz anderen Stelle befindet als vermutet wird, unter Umständen<br />
auch gar kein Ausschuss vorhanden ist. Um sich einen Einblick in diese Wirkung zu verschaffen,<br />
ist ein Blick in die verschiedenen Bereiche der Gerichtsmedizin zu empfehlen.<br />
1.6 Grenzen der RUD/RWD<br />
Jede <strong>Realistische</strong> Wunddarstellung findet ihre Grenzen, wenn Situationen dargestellt werden sollen,<br />
welche nicht darstellbar sind. Wir haben nicht die Mittel und Möglichkeiten wie in Filmstudios! Unter solchen<br />
Umständen muss erst die situative Darstellung von Verbrennungen verstanden werden. Der Ausbilder,<br />
welcher eine Verbrennung so darstellt, dass ein Mime als lebendige Fackel über den Übungsplatz<br />
läuft, handelt grob fahrlässig! Selbst wenn es sich um einen professionellen Stuntman handeln sollte, so<br />
ist dies aus Sicherheitsgründen zu untersagen. Auch kann der Ausbilder in einem solchen Fall die Verantwortung<br />
für möglicherweise auftretende Verletzungen nicht übernehmen. Es kann also nicht jede vorkommende<br />
oder denkbare Verletzung dargestellt werden. Dies ist auch nicht unbedingt notwendig. Die<br />
Ziele sollten so formuliert sein, dass das Mögliche erreicht wird und das Unmögliche nicht als Mangel<br />
erscheint.<br />
Vielfalt schafft Abwechslung und ein breites Ausbildungsspektrum, aber nicht um jeden Preis !<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 8/49 -
Die <strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong><br />
Abschnitt 2: Das Schminken<br />
Als Grundmaterial zum Schminken von Verletzungen wird der Schminkkasten "Westfalen" verwendet.<br />
http://www.jrk-bayern.de/html/rud/ausstattung.html<br />
2.1 Schminkmaterialien<br />
2.2 Schminkgerätschaften<br />
2.3 Wichtige Hinweise<br />
2.4 Weitere Hilfsmittel<br />
2.5 Mögliche Gefahren<br />
2.6 Hygiene<br />
2.1 Schminkmaterialien<br />
Abschminke<br />
Nach dem Abreiben mit trockenen Papiertüchern wird Abschminke zum Entfernen der Fettschminke<br />
benutzt. Für Aquacolor ist sorgfältiges Waschen ausreichend.<br />
Aceton<br />
Zum Angleichen von Glatzanrändern an die Haut. Löst Glatzan auf. Achtung Aceton ist ein<br />
Lösungsmittel! Auf gute Belüftung des Raumes achten.<br />
Aquacolor–Nassschminke<br />
Feine Nassschminke (079 für Verbrennungen, 099 für Zyanose), die mit einem feuchtem<br />
Schwamm aufgetragen wird. Nach dem Trocknen mit einem sauberen, trockenen Frottierhandtuch<br />
abreiben und mit Fixierspray versiegeln.<br />
Blutpasten<br />
Zum Ausfüllen der Wunden.<br />
Color - Spray<br />
Farbspray in Sprühdose zum Einfärben von Haut und Gela-Fixhaut bei Verbrennungen.<br />
Farbpasten<br />
Hell- und dunkelrote Farbpasten als Wundfüller.<br />
Fingernägel<br />
Werden auf den Finger aufgeklebt und mit Blutpaste unterlegt.<br />
Fixierspray<br />
Spray zum Fixieren von Aquacolor - Nassschminke.<br />
Gela -Fixhaut<br />
Gelantineähnliches Präparat, das wasserdicht verpackt (in Original Verpackung oder Mastix Flasche)<br />
im heißen Wasserbad verflüssigt wird, und im flüssigen Zustand mit dem Plastik-Mundspatel<br />
auf der Haut verteilt wird. Je nach Verarbeitung auf der Haut für zwei und drei Verbrennungen.<br />
sowie für Verätzungen geeignet. (Darf mit Wasser nicht in Berührung kommen!)<br />
Glassplitter-Beutel<br />
Beutel mit biegsamen "Glassplittern" aus Kunststoff für Fremdkörperverletzungen keine Verletzungsgefahr.<br />
Als "Fremdkörper" immer ungefährliche, stumpfe, nach Möglichkeit biegsame Gegenstände<br />
verwenden. Insbesondere die Glassplitter sind gut mit Tuplast anzukleben.<br />
Glatzan-L<br />
Flüssiger Kunststoff zur Herstellung von Kunststoffglatzen und anderen flexiblen Kunststoffteilen,<br />
wie z.B. Brandblasen etc.:<br />
Achtung lösungsmittelhaltig, nur in gut durchlüfteten Räumen verwenden!<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 9/49 -
Gummi-Milch<br />
Flüssiges Latexpräparat zur Herstellung von Wunden. Hierzu zunächst dunkelrote Farbpaste dünn<br />
auf der Haut verstreichen, anschließend Gummimilch mit einen Gummiporenschwamm in mehreren<br />
Schichten auftragen (zwischendurch kurz antrocknen lassen!), anschließend nach dem Trocknen<br />
die so entstandene Gummihaut antönen (Schminkpalette-Gummiteint) und "aufreißen".<br />
Trocknungsvorgang kann mit einem Fön beschleunigt werden.<br />
Gummi-Porenschwamm<br />
Spezialschwamm zum Auftragen der Gummimilch. Nach Gebrauch sofort auswaschen!<br />
Hydro-Fixblut<br />
Alkoholhaltiges, schnell trocknendes und mit Wasser abwaschbares Blut. Mit dem Stoppel-<br />
schwamm aufgetragen entsteht eine Schürfwunde.<br />
IEW-Spezial-Filmblut<br />
Langsam fließendes, aus fast allen Materialien auswaschbares "Blut".<br />
Knochenstücke<br />
Knochenstücke aus Kunststoff, um offene Knochenbrüche darzustellen.<br />
Leere Mastix-Flasche<br />
Flaschen mit integriertem Pinsel z.B. für Blut. Bei Verwendung für Gela-Fixhaut Pinsel vorher entfernen.<br />
Make-up (in Tuben Nr. 1 - 4)<br />
Zum Antönen von Schminkkitt.<br />
Mastix<br />
Harzhaltiges Klebemittel für alle Glatzanteile.<br />
Mastix- Entferner<br />
Spezieller Entferner für Mastix.<br />
Medizinischer Mastix<br />
Besonders milder Mastix, auch bei empfindlicher Haut.<br />
Medizinischer Mastix-Entferner<br />
Entferner für medizinischen Mastix.<br />
Nägel<br />
Künstliche Nägel, um Fremdkörper in Wunden zu schminken.<br />
Plastici<br />
Weiche, sehr feine Modelliermasse zum Modellieren von Verletzungen aller Art. Empfiehlt sich<br />
wegen des Preises vor allem für kleine, sehr sauber ausgearbeitete Verletzungen. Die Haftfähigkeit<br />
wird erhöht, wenn zunächst Mastix dünn auf die Haut aufgetragen wird (kurz antrocknen<br />
lassen). Lässt sich mit Haargel glätten.<br />
Schminkkitt<br />
Preiswerte Modelliermasse, bestens geeignet, um großflächig arbeiten zu können. Wird mit<br />
Vaseline glatt gestrichen.<br />
Schminkpalette<br />
Make-up Palette mit sechs Hauttönen, zum Angleichen der modellierten Verletzung an die Haut,<br />
und sechs Farben.<br />
071 Schwarz/Verbrennungen, 099 blauviolett/Zyanose, altrot/Hämatome, 079 hellrot/<br />
Verbrennungen, 074 Weißgrau/Verätzungen, 070 Weiß/Verätzungen.<br />
Schminkpalette-Gummiteint<br />
Make-up Palette mit Farben wie oben, allerdings in spezieller Konsistenz zum Antönen von Gummiplastiken<br />
aus Gummimilch und Glatzan.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 10/49 -
Schockpaste (in Tube)<br />
Zum Schminken eines Schocks.<br />
Siegeler (Flexible Sealor)<br />
Spezieller Siegeler zum Versiegeln von modellierten Verletzungen aus Plastici, Spezial-<br />
plastik und Schminkkitt. Wird mit einem Nagellack-Pinsel aufgetragen, nachdem die Verletzung<br />
modelliert wurde (vorher kein Make-up, Blut etc. verwenden!). Nach ca. sieben Minuten Trocknungszeit<br />
mit dem Schminken fortfahren. Eignet sich bestens für Wettbewerbe und Leistungsvergleiche,<br />
da oftmals auf ein Nachschminken verzichtet werden kann. Auch bei größerer Wärme<br />
(Sommer, Scheinwerfer) empfiehlt sich die Anwendung des Siegelers.<br />
Achtung: Nicht in Augennähe verwenden!<br />
Spezialplastik<br />
Weiche, sehr feine Modelliermasse zum Modellieren von Verletzungen aller Art. Empfiehlt sich<br />
wegen des Preises vor allem für kleine, sehr sauber ausgearbeitete Verletzungen. Die Haftfähigkeit<br />
wird erhöht, wenn zunächst Mastix dünn auf die Haut aufgetragen wird (kurz antrocknen lassen).<br />
Lässt sich mit Haargel glätten. Ist bei Verletztendarstellern mit heller Haut auch ohne<br />
Make-up kaum sichtbar.<br />
Trockenpuder TPO<br />
Trockenpuder, das reichlich mit der Puderquaste auf die geschminkten Stellen aufgetragen wird,<br />
um die Fettschminke wischfest zu machen. Nicht gebundenes Puder mit dem Puderpinsel abreiben.<br />
Ein vorsichtiges Tupfen mit einem leicht feuchten Schwamm nach Entfernen des nicht gebundenen<br />
Puders erhöht die Wischfestigkeit des gebundenen Puders.<br />
Tuplast<br />
Hautkleber zum Ankleben von Fremdkörpern wie z.B. "Glasscherben". Tuplast nach dem Trocknen<br />
mit Hydro-Fixblut überdecken (IEW-Blut löst u. U. Tuplast!).<br />
Theater-Blutkapseln TF<br />
Kleine Gelatine-Kapseln zur Anwendung im Mund. Erst unmittelbar vor der Anwendung in den<br />
Mund nehmen!<br />
TV-Paint-Stick (lW)<br />
Make-up in Drehhülse. Farbton 1 W ist die ideale Schockfarbe. Mit Schminkschwamm gleichmäßig<br />
dünn auftragen, dabei Hals und Ohren nicht aussparen.<br />
Vaseline (gelb)<br />
Dose Vaseline zum Glattstreichen von Schminkkitt.<br />
2.2 Schminkgerätschaften<br />
Plastik-Mundspatel<br />
Modellierspatel zum Verarbeiten der Gela-Fixhaut.<br />
Puderpinsel<br />
Weicher Pinsel zum Entfernen des nicht gebundenen Transparentpuders von der Haut.<br />
Puderquaste<br />
Quaste zum Auftragen des Transparentpuders auf die Haut.<br />
Pumpsystem<br />
Dient zur Darstellung von spritzenden Schlagaderverletzungen.<br />
IEW- Blut nur sehr stark mit Wasser verdünnt einfüllen (1:4).<br />
Schminkschwämme<br />
Runde feinporige Schwämme zum Auftragen von Make-up. Diese nicht verwenden für Gummimilch<br />
und Hydro-Fixblut.<br />
Regel: Ein Schwamm pro Verletztendarsteller; ein Schwamm pro Farbe!(Aus hygienischen<br />
Gründen).<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 11/49 -
Den Schwamm vor Gebrauch leicht anfeuchten, um ein gleichmäßiges Auftragen zu erreichen.<br />
Waschhinweise:<br />
1. Schwämme nach Gebrauch mit Wasser und Seife kurz auswaschen,<br />
evtl. länger in Seifenwasser einlegen.<br />
2. Schwämme mit Seifenwasser auf dem Herd auskochen.<br />
(Oder Kochwäsche 90-95° C in der Waschmaschine)<br />
Spatel<br />
Zahnarztspatel in zwei Formen haben sich als ideale Hilfsmittel zum Modellieren<br />
erwiesen:<br />
a) Dentalanrührspatel,<br />
b) Heidemannspatel,<br />
beide aus rostfreien Edelstahl.<br />
Stoppelschwamm<br />
Spezialschwamm zum Schminken von Schürfwunden (ursprünglich von Bartstoppeln). Hierzu an<br />
einer Kante sehr dünn Hydro-Fixblut auftragen, anschließend vorsichtig über die Haut reiben und<br />
trocknen lassen.<br />
2.3 Wichtige Hinweise<br />
Schwämme<br />
Für jede zu schminkende Person und jede Farbe ist ein sauberer Schwamm zu verwenden. Der<br />
Schwamm muss feucht (nicht nass) sein um eine gleichmäßige Einfärbung der Haut oder Wunde<br />
zu erreichen. Schwämme können bei 90° C gewaschen werden.<br />
Spatel<br />
Die Spatel sind nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen.<br />
Entkleiden eines Verletztendarstellers<br />
Bei einer möglichen Entkleidung eines Verletztendarstellers ist darauf zu achten, dass der Verletztendarsteller<br />
vorher darauf aufmerksam gemacht wird. Des weiteren sollte man bei einer eventuellen<br />
Entkleidung männliche Verletztendarsteller wählen.<br />
Der Verletztendarsteller sollte entsprechende Kleidung, z.B. Badehose, tragen.<br />
Zyanose<br />
Bei einer Zyanose muss man bei einer eventuellen Entkleidung des Verletztendarstellers alle<br />
sichtbaren Körperteile einfärben.<br />
Make-up oder Farbpasten<br />
Bei dem Auftragen von Make-up oder Farbpasten ist ein feuchter Schwamm zu verwenden. Es ist<br />
darauf zu achten, dass das Make-up oder die Farbpaste gleichmäßig verteilt wird und alle sichtbaren<br />
Körperstellen eingefärbt werden, z.B. beim Schock, Ohren und den Hals.<br />
Hautglanz Gelee<br />
Hautglanz Gelee wird zur Darstellung der Kaltschweißigkeit mit einem Schwamm auf der Stirn und<br />
unterhalb der Nase aufgetragen. Auch bei Verbrennungen (2-3) wird Hautglanz Gelee aufgetragen.<br />
Gela Fix Haut<br />
Angebrochene Packungen Gela Fix Haut können in einem geschlossenem Behälter, z.B. Mastixflasche<br />
wieder erhitzt werden.<br />
Wichtig: Gela Fix Haut darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.<br />
Siegeler<br />
Die Anwendung von Siegeler ist nur erforderlich, wenn die Wunden längere Zeit halten sollen oder<br />
starker Wärme ausgesetzt sind. Um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen kann ein Fön verwendet<br />
werden.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 12/49 -
2.4 Weitere Hilfsmittel für die RWD und RUD<br />
Hilfsmittel RUD Hilfsmittel RWD<br />
Decken Ruß Lack<br />
Wandfarbe/rote Farbe Stückchen Messer<br />
Waffen eigene Moulagen Mull<br />
Helme Creme Binden<br />
Brille Folie Skalpell<br />
Benzin Wasserbehälter Küchentücher<br />
Rauchpulver Zellstoff Babyöl<br />
Alte Sachen Spritzen leere Gefäße<br />
Autowrack Faschingsschminke Kanülen<br />
Fahrräder Schläuche Plastikei<br />
Mopeds Zerstäuber Gips<br />
Schaufensterpuppen Steine/Dreck Brausepulver<br />
Stromkabel - Korken Pinzette<br />
Elektrische Geräte Strick Haarklemmen<br />
Leiter Sicherheitsnadeln Holzleim<br />
Knallkörper Spiegel Perücken<br />
Inliner Make-up Paletten Blechsplitter<br />
Skateboards künstl. Körperteile<br />
Holz Kugelschreiber<br />
Grill+ Zubehör Silikonpräparate<br />
Stühle/Tische Styropor<br />
Bonbon/Kaugummi Glyzerin<br />
Absperrband Wachs<br />
Megaphon Tapetenleim<br />
Taschenlampen Handschuhe<br />
Telefon Gelatine<br />
Funkmaterial Bürsten<br />
Kabeltrommel Handtuch<br />
Recorder Kondome/Luftballons<br />
Hammer Schreibzeug<br />
Müll Strümpfe<br />
Müllbeutel Kreide<br />
Ausweichmöglichkeit für Kitt:<br />
200 g Tapetenleim + 1 EL Salz + 2 Liter heißes Wasser + 1 EL Make-up nach Bedarf vermengen<br />
bis es eine glatte, geschmeidige Masse ergibt. Haltbarkeit ca. 2 Monate, luftdicht bis 1 Jahr<br />
Große Blutlache für 10 Liter Blut:<br />
100 g rotes Farbpulver werden soviel Alkohol, Optal oder Brennspiritus zugegeben, dass ein dicker<br />
Brei entsteht. Das ist notwendig, damit die Farboberfläche zerstört wird. Dieser Farbbrei wird<br />
mit 1000 g 8-prozentigern Celluloseschleim (Wandfarbe) gut vermischt. Diese Farb-Cellulosemischung<br />
wird nun mit Wasser im Verhältnis 1:4 verdünnt.<br />
2.5 Mögliche Gefahren<br />
Man kann die Gefahren in drei Gruppen aufteilen:<br />
a) Chemische Einwirkung (Schminkmaterial)<br />
b) Mechanische Einwirkung (Schminkwerkzeuge, Requisiten, unsachgemäße Erste Hilfe und<br />
Witterungseinflüsse<br />
c) Psychische Überlastung bei Darstellern und auch bei Helfern (Zuschauer)<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 13/49 -
Ursache Wirkung Abhilfe bzw. Vorbeugung<br />
Gruppe a)<br />
Gruppe b)<br />
Chemikalien Allergie nicht schminken<br />
nicht geschminkt werden<br />
Chemikalien Porenverschluss Vaselineschicht<br />
Chemikalien Rückstände Seife<br />
Austrocknung der Haut Hautcreme<br />
Geschliffene Werkzeuge Entzündung durch Stumpfe Spatel aus<br />
Hautverletzungen Holz oder Ähnlichem<br />
Scharfkantige Fremd- Entzündung durch weiche bzw. entschärfbare<br />
körper Hautverletzungen Materialien wählen (Plexiglas, Blei,<br />
Alu, Löt. Draht, Holz m. Alufolie)<br />
Sturz auf oder mit Wunden, Verstauchungen Situationen vorher auf Gefahren<br />
Requisiten Brüche, Gehirnerschütterung abprüfen<br />
Rauchgase Verminderung der Sauerstoff- Situation vorher auf Gefahren<br />
Dämpfe aufnahme, Krämpfe abprüfen und Einsatz ggf.<br />
abbrechen<br />
Reale:<br />
Abbindung Blutung, Nervensch. Einsatz sofort abbrechen!!!<br />
Reanimation innere Verletzung<br />
Herzstillstand<br />
Sturz bei Rettung nicht hilflos einschnüren<br />
lassen<br />
Kälte/ Hitze RUD der Witterung anpassen<br />
c) Hineinsteigern in Schock Labile Mitglieder nicht<br />
realen Unfallhergang darstellen lassen<br />
Vorher die Form einer<br />
Realfallmeidung festigen<br />
Die psychischen Faktoren kann man nur durch ständige Beobachtung der Beteiligten in den Griff bekommen<br />
oder behalten!<br />
2.6 Hygiene<br />
Wer macht sich schon die Arbeit, den Schminkkoffer nach einem RUD-Einsatz zu säubern? Bleibt nicht<br />
meistens nur eine(r) übrig die/der "immer die/der Dumme" ist, und irgendwann einmal diese Arbeit endgültig<br />
leid ist und sich schließlich niemand mehr darum kümmert?!<br />
Dabei ist doch die Sauberkeit der Schminkmaterialien, Pinsel, Schwämme, Spatel, Altkleider von<br />
besonderer Wichtigkeit für die Gesundheit all derer, die mit der RUD in Kontakt kommen.<br />
Schließlich hat jeder ein besonderes Interesse an der eigenen Gesundheit. Viel zu selten beachtet wurde<br />
bisher der Aspekt Hygiene in der RUD.<br />
"Die Hygiene ist die Lehre von der Verhütung von Krankheiten und der Erhaltung und Festigung<br />
der Gesundheit. Sie entwickelt Grundsätze für den Gesundheitsschutz und vorbeugende<br />
Maßnahmen für die Allgemeinheit und den Einzelnen."<br />
Die Hygiene ist allerdings nicht nur "bloße Sauberkeit", sie umfasst ebenfalls die Desinfektion von Materialien,<br />
Arbeitsmitteln und Hände. Allerdings ist Sauberkeit der erste Schritt zur Hygiene. Im Rahmen der<br />
Körperpflege ist zunächst vor dem Schminken eines neuen Verletztendarstellers das Händewaschen von<br />
Bedeutung, einhergehend mit einer vorhergehenden Handdesinfektion (z.B. mit Sterilum). Zum Abtrocknen<br />
sollten Einmalhandtücher verwendet werden. Aber nicht nur Handhygiene allein ist wichtig, sondern<br />
sie kann nur bei gleichzeitiger Materialhygiene wirksam sein. Dies meint zuallererst die äußere Sauberkeit<br />
der RUD Koffer, Schminkkästen, Farbpaletten, Dosen usw.. Ein weiterer Aspekt ist allerdings die<br />
"Frische" der verwendeten Fettschminke, denn Fettschminke kann auch "ranzig" werden und sollte dann<br />
nicht mehr benutzt werden. Ein vermischen der Farbtöne in den Farbtiegeln sollte vermieden werden,<br />
ebenso sollte ein Schwamm oder Pinsel o. ä. nicht für mehrere Farbtöne verwendet werden. Grundsätz-<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 14/49 -
lich gilt die Regel einen Schwamm/ Pinsel o. ä. für eine Farbe. Es sollte dringend davon abgeraten werden<br />
einen Schwamm zum Schminken mehrerer Verletztendarsteller zu benutzen, da sich hierbei Krankheitserreger<br />
schnell verbreiten können. Deshalb lässt sich unsere Regel erweitern:<br />
Ein Schwamm pro Farbe und Verletztendarsteller. Beim Kauf von Schwämmen sollte man nicht nur auf<br />
eine ausreichende Anzahl, sondern auch auf das überstehen einer Kochwäsche achten. Gute Schwämme,<br />
wie etwa die Schminkschwämme von Kyrolan, lassen sich bei 90°C Kochwäsche gut reinigen. Sie<br />
können so mehrmals benutzt werden. Das Waschen allein reicht jedoch nicht aus: Man sollte zwingend<br />
ein Desinfektionsmittel zugeben. Auch Quasten sollten ähnlich sorgfältig wie die Schwämme behandelt<br />
werden. Für Pinsel und Spatel dagegen genügt nach dem Waschen eine kurze Desinfektion völlig. Werden<br />
Altkleider benutzt, so sind diese vor dem Gebrauch unbedingt zu waschen! Neben der selbstverständlichen<br />
Sauberkeit des "Arbeitsplatzes" sollte auch folgende Regel Beachtung finden: Während des<br />
Schminkens/ Darstellens nicht essen oder trinken, kein Alkohol, nicht rauchen, ggf. Handschuhe benutzen,<br />
nur Einmalhandtücher verwenden. Wegen der vielfach in den Schminkmaterialien enthaltenen Lösungsmittel<br />
sollte auf eine gute Belüftung des Arbeitsraumes geachtet werden.<br />
Vorschriften zur Hygiene am Arbeitsplatz:<br />
a) Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene Verordnung) vom 10.Mai 1988<br />
b) Technische Regeln für Gefahrstoffe -Friseurhandwerk- September 1992<br />
In dieser heißt es unter der Rubrik Hygiene u. a.:<br />
In Arbeitsräumen dürfen Beschäftigte nicht essen, trinken oder rauchen. Arm und Handschmuck<br />
(in der RUD auch Ohrschmuck) darf bei der Arbeit nicht getragen werden, da unter<br />
dem Schmuck durch Einwirkung von Feuchtigkeit oder Chemikalien die Entstehung von<br />
krankhaften Hautveränderungen besonders begünstig wird.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 15/49 -
Die <strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong><br />
Abschnitt 3: Das Mimen<br />
3.1 Allgemeines<br />
3.2 Grundlegendes für die Darstellung von Verletzungen und das Verhalten der Mimen<br />
3.3 Konkrete Schminktechniken und Darstellungen für ausgewählte Verletzungen<br />
3.3.1 Schnitt-, Riss- und Platzwunde<br />
3.3.2 Schürfwunden<br />
3.3.3 Gelenkverletzung und Knochenbruch<br />
3.3.3.1 Arm- und Handgelenkbruch (offen)<br />
3.3.3.2 Bein- und Knöchelbruch (geschlossen)<br />
3.3.3.3 Schlüsselbeinbruch<br />
3.3.3.4 Rippenbruch<br />
3.3.3.5 Offener Knochenbruch<br />
3.3.4 Verletzungen durch Fremdkörper<br />
3.3.5 Fingerkuppenverletzung<br />
3.3.6 Schock<br />
3.3.7 Verbrennung<br />
3.3.8 Gehirnerschütterung<br />
3.3.9 Bewusstlosigkeit<br />
3.3.10 Schädelbasisbruch<br />
3.1 Allgemeines<br />
Bei der realistischen <strong>Unfalldarstellung</strong> kommt es neben dem Schminken von Verletzungen auch auf das<br />
verletzungsbedingte richtige Verhalten des Mimen an. Dazu gehört, dass der Mime zunächst einmal die<br />
Hemmschwelle, sich schauspielerisch zu betätigen, überwindet. Schauspielerisches Talent ist zwar wünschenswert,<br />
aber nicht unbedingt erforderlich. Der Mime muss sein ganzes Verhalten den Verletzungen<br />
anpassen. Er muss so empfinden, so fühlen und so reagieren können wie ein tatsächlich Verletzter.<br />
Schulung des Mimen:<br />
Jeder Mime muss auf seine Aufgabe hin geschult werden. Grundsätzlich ist für die Schulung ein Arzt,<br />
Möglichst Notarzt, hinzuzuziehen. Aufgrund seiner Erfahrung kann der Arzt wertvolle Hinweise über<br />
das Aussehen der Wunde und das Verhalten eines Verletzten geben. Ggf. kann man sich auch der Mitarbeit<br />
eines erfahrenen Rettungssanitäters/Rettungsassistenten bedienen. Die Leistung des Mimen ist<br />
abhängig von einer möglichst realistischen Darstellung der Situation. Nur dadurch ist das Empfinden,<br />
Fühlen und Reagieren gegenüber einem Helfer möglich.<br />
Der Mime darf sich nicht so in die Rolle des Verletzten hineinsteigern, dass seine Gesundheit gefährdet<br />
wird. Z.B. können bei der Darstellung von Brustkorbverletzungen und Schock Hyperventilation und/oder<br />
Kreislaufschädigungen auftreten.<br />
Erkennt der Mime eine Gefahr für sich oder seine Gesundheit, die sich aus einer Darstellung oder<br />
Situation ergibt, hat er sofort die Darstellung abzubrechen und darauf hinzuweisen.<br />
Schiedsrichter und Betreuer sollten beim Einsatz von Mimen unbedingt auf deren Sicherheit achten und<br />
Gefahren schon im Vorhinein abwehren.<br />
3.2 Grundlegendes für die Darstellung von Verletzungen und das Verhalten der Mimen<br />
Folgende Verletzungen können grundlegend dargestellt werden:<br />
• Schmerz<br />
• Verwirrtheit, Desorientiertheit<br />
• Bewusstseinseintrübung<br />
• Bewusstlosigkeit<br />
• Schock<br />
• Zustand nach Brustkorbverletzungen oder -erkrankungen mit Atemnot<br />
• Zustand nach stumpfen Bauchverletzungen oder Erkrankungen des Bauches<br />
• Atemstillstand<br />
• Verschiedene Zustände nach Vergiftung (Krämpfe, Bewusstseinseintrübung Euphorie)<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 16/49 -
• Unterkühlung<br />
• Verbrennungen<br />
• alle Knochenbrüche und Gelenkverletzungen (außer Beckenbruch)<br />
• Bedrohliche Blutung<br />
In Anpassung an die Verletzung und die Situation müssen u. U. zum Ausdruck gebracht werden:<br />
• Angst<br />
• Atemnot<br />
• Apathie<br />
• Bewusstseinsstörung<br />
• Bewusstlosigkeit<br />
• Erregung<br />
• Frieren<br />
• Unruhe<br />
• Hilflosigkeit<br />
• Schmerz<br />
• Unwohlsein<br />
• Unzufriedenheit<br />
Erläuterungen zu<br />
• Angst / Hilflosigkeit<br />
Durch das Gespräch mit dem Helfer können Angst und Hilflosigkeit ausgedrückt werden. Der<br />
Mime wird den Helfer<br />
o um seine Hilfe bitten<br />
o fragen, was verletzt ist<br />
o fragen, was er zu tun gedenkt<br />
o bitten, ihm zu sagen, was weiter geschehen soll.<br />
Im Einzelnen wären ggf. darzustellen:<br />
o ängstlich geweitete Augen<br />
o unruhiger Blick<br />
o Zittern<br />
o Suche nach Körperkontakt<br />
o stockende, leise Sprache<br />
Der Mime hat die Aufgabe, durch sein Verhalten ständig neue Anforderungen an den Helfer zu<br />
stellen:<br />
o Er hat Durst.<br />
o Die Lagerung ist unbequem.<br />
o Der Verband drückt.<br />
o Der Verletzte beauftragt den Helfer, seinen Angehörigen eine Nachricht zu überbringen.<br />
• Schmerz<br />
Die Schmerzäußerung muss nicht durch jeden gleich dargestellt werden. Sie richtet sich nach<br />
der Mentalität des Einzelnen, sowie nach der Art und der Schwere der Verletzung und darf nicht<br />
übertrieben werden.<br />
Im Einzelnen wären ggf. darzustellen:<br />
Akustisch Optisch<br />
Schreien Mimik<br />
Jammern - ängstlich<br />
Wimmern - verkniffen<br />
Sprache klingt - geweitete Augen<br />
- zaghaft / ängstlich - Ausdrucksloser Blick<br />
- verbissen teilnahmslos<br />
- durch die Zähne hilfesuchend<br />
- hektisch unruhig<br />
- unkontrolliert Abwesender Blick<br />
- kraftlos, leise Bewegungen wirken<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 17/49 -
- kaum verständlich - unbeherrscht<br />
- schleppend<br />
- unruhig / unkontrolliert<br />
Einnahme einer Schonhaltung<br />
Bewegungsunfähigkeit<br />
Ist verkrampft<br />
zittert<br />
Ergänzende Hinweise zum verletzungsgerechten Verhalten der Mimen<br />
Schmerzensäußerungen<br />
Die Äußerung und das Zeigen von Leid und Schmerz ist von verschiedenen Faktoren abhängig:<br />
von der Größe und der Schwere des Schmerzes, des Leides, des Schadens, von der äußeren<br />
Situation des Leidenden:<br />
o ist er allein oder ist er zusammen mit anderen,<br />
o ist er hilflos, kann er sich noch helfen,<br />
o ist er selbst schuld an dem Geschehenen oder ist er Opfer eines unverschuldeten Ereignisses<br />
o von der Person des Verletzen: Charakter, Alter, Reife und Erziehung<br />
o kleine Kinder schreien schneller, Jugendliche sind schneller hilflos, alte Leute haben<br />
häufig große Angst, Frauen sind tapferer, Männer sind zwar wagemutiger, aber sie ertragen<br />
Schmerz schlechter<br />
o auch die Nationalität spielt eine Rolle: Südländer zeigen ihren Schmerz schneller, deutlicher,<br />
dramatischer als Nordländer oder Bergbewohner<br />
o von der Art der Hilfe: kommt sie rasch, zweckmäßig und wird sie von vertrauenserweckenden<br />
Personen geleistet, dann ist der Schmerz leichter zu ertragen<br />
Zeitlicher Ablauf der Reaktionen<br />
Beim Eintreten einer Notfallsituation spielen sich in der Regel folgende Reaktionen nacheinander<br />
ab:<br />
o Erstaunen, Erschrecken: Der Patient realisiert den Unfall im ersten Moment eigentlich<br />
nicht, er staunt oder erschrickt, dass etwas passiert ist<br />
o Angst : Es ist etwas passiert, man weiß noch nicht genau, was; langsam kommt vielleicht<br />
der Schmerz, vor allem aber zuerst die Angst<br />
o Abwehr: Der Patient wehrt sich gegen den Eingriff in seine persönliche Integrität, er<br />
schämt sich, er will nicht auffallen<br />
o Hilflosigkeit : Nachdem der Patient realisiert hat, was geschehen ist, fühlt er sich hilflos<br />
und allein gelassen<br />
o Schmerz: Erst jetzt zeigen sich beim Verunglückten Schmerzreaktionen.<br />
o Das weitere Verhalten hängt dann von verschiedenen inneren und äußeren Umständen<br />
ab: z. B. versucht sich der Patient selbst zu helfen oder er verfällt in eine Apathie, da er<br />
keine Hilfe mehr erhofft oder weil der Schmerz schon sehr groß ist<br />
Die Reaktionen des Verunglückten auf die Hilfeleistung<br />
Die Reaktionen des Verunglückten auf die Hilfeleistung sind verschieden. Weniger differenzierte<br />
Menschen, d. h. Leute mit geringerer Intelligenz und solche, die nicht sehr kritisch sind, nehmen<br />
jede Form von Hilfe dankbar an. Differenzierte Menschen sind in einer Unfallsituation empfindlicher<br />
und wehren sich, wenn etwas nicht ganz gut geht, schneller und womöglich intensiver.<br />
Die Reaktionen bei konkreten Verletzungen<br />
Bewusstlosigkeit:<br />
Das Verhalten des Mimen bei Bewusstlosigkeit in allen denkbaren Formen ist von großer Bedeutung.<br />
Deshalb soll er das äußere Bild der Bewusstseinsstörungen kennen, soweit sie in der RUD darstellbar<br />
sind.<br />
1. Die Ohnmacht<br />
Sie ist eine Folge von Sauerstoffmangel im Gehirn bei erhaltenen Schutzreflexen. Der Patient<br />
sinkt zu Boden und ist zunächst nicht mehr ansprechbar.<br />
Nach wenigen Minuten weicht die Ohnmacht einer Benommenheit oder Verwirrtheit, das volle<br />
Bewusstsein ist nach korrekter Erste-Hilfe-Leistung bald wiederhergestellt.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 18/49 -
2. Die leichte oder oberflächliche Bewusstlosigkeit<br />
Sie tritt ein als Folge eines Schocks nach Blutverlust, nach Vergiftungen oder auch bei leichter<br />
Form von Gewalteinwirkung auf den Schädel- verbunden mit Schmerzempfindung. Ihre Kennzeichen<br />
sind verminderte Ansprechbarkeit, Benommenheit, zusammenhangslose Antworten<br />
und Konzentrations- Schwierigkeiten.<br />
3. Die tiefe Bewusstlosigkeit:<br />
Sie ist entweder als Folge des zuvor beschriebenen Zustands oder einer plötzlichen starken<br />
Gewalteinwirkung auf den Schädel anzusehen. Grundsätzlich müssen hierbei alle Schutzreflexe<br />
als erloschen angesehen werden. Erstickungsgefahr ist im Verzug. Die Atmung wird ungenügend.<br />
Bei der Annahme einer Gehirnerschütterung gelten als charakteristische Merkmale die<br />
Erinnerungslücke nach dem langsam wiederkehrenden Bewusstsein und das freie Intervall vor<br />
dem erneuten plötzlichen Aussetzen des Bewusstseins (ausgelöst durch Hirndruck als Folge<br />
von Schwellung oder Blutung im Gehirn bei Schädelbasisbruch). Während des freien Intervalls<br />
stellt der Verunglückte häufig Fragen nach dem Unfallgeschehen und dem Grund seines Zustands<br />
und reagiert im Gespräch mit dem Helfer nur sehr mangelhaft, er ist schlecht ansprechbar.<br />
Während einer tiefen Bewusstlosigkeit können jedoch starke Schmerzreize auch Reaktionen<br />
hervorrufen. Allgemein herrscht ein Zustand völliger Erschlaffung am ganzen Körper.<br />
4. Der Scheintod<br />
Er ist die tiefste Form der Bewusstlosigkeit, verbunden mit Atemstillstand und Reflexlosigkeit,<br />
aber erhaltener Herzaktion.<br />
Ziel seiner Darstellung ist die Freilegung der Atemwege durch den Helfer.<br />
Alle Erscheinungsbilder der Bewusstlosigkeit haben oft fließende Übergänge und können rasch<br />
wechseln. Sie lassen sich durch einen ernsthaften und erfahrenen Darsteller in Anpassung an seinen<br />
angenommen Unfallhergang sehr eindrucksvoll wiedergeben.<br />
Schmerzempfindlichkeit<br />
Ganz allgemein kann gesagt werden, dass der Kopf, vor allem die Sinnesorgane, die Extremitäten,<br />
vor allem Hände und Füße schmerzempfindlicher sind als der Stamm, das heißt Brust, Bauch<br />
und Rücken. Schmerzempfindliche Gewebe sind eigentlich nur die Haut, die Schleimhäute, die<br />
Knochenhaut, das Brustfell und das Bauchfell. Besonders bei Verbrennungen oder chemischen<br />
Schädigungen der Haut ist eine große oberflächliche Verletzung viel schmerzhafter als eine kleine<br />
tiefgehende. Die Schmerzensäußerungen des Darstellers müssen natürlich sein. Weder Übertreibungen<br />
noch passives Verhalten dienen der Zielsetzung der RUD, d. h. Gewöhnung an den<br />
Ernstfall: Der Verunglückte spricht über den Schmerz und über die Ursachen oder die möglichen<br />
Folgen der Verletzung, er schreit nicht nur „..au, au...“ oder stößt tierische Laute aus.<br />
Je nach Temperament oder Charakter des Verletzten äußert sich der Schmerz auch in einem<br />
Kraftwort oder in Unzufriedenheit gegenüber dem Helfenden.<br />
Entscheidend ist, dass der Darsteller auf die Helfermaßnahmen eingeht. Die Retter müssen auf<br />
Grund des Verhaltens des Verunglückten laufend Beurteilungen vornehmen können. Nur so können<br />
sich die Helfer weiter ausbilden. Der Mime muss sich in die Rolle des Leidenden hinein vertiefen<br />
und dann gemäß seinem Temperament, seinem Alter und seinem Geschlecht reagieren.<br />
Es sollte darauf geachtet werden, besonders wenn Verbrennungen mit Flüssigklebstoff dargestellt werden,<br />
dass der Mime an den betreffenden Körperstellen keine zu starke Behaarung aufweist. Ist das der<br />
Fall, so scheidet die Person als Mime schon generell aus, da eine starke Behaarung und die Darstellung<br />
einer Verbrennung nur dann realistisch wirken, wenn die Haare zumindest angebrannt werden können.<br />
Dies ist jedoch aus einsichtigen Gründen nicht möglich. Was für die Verbrennung gilt, gilt in jedem Fall,<br />
wenn Kitt auf die Haut gebracht wird, da die Haare nicht geschminkt werden können. An der geschminkten<br />
Stelle werden sich demnach keine Haare befinden und die ganze Darstellung unrealistisch aussehen<br />
lassen.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 19/49 -
3.3 Konkrete Schminktechniken und Darstellungen für ausgewählte Verletzungen<br />
3.3.1 Schnitt-, Riss- und Platzwunde<br />
3.3.2 Schürfwunden<br />
3.3.3 Gelenkverletzung und Knochenbruch<br />
3.3.3.1 Verstauchung<br />
3.3.3.2 Arm- und Handgelenkbruch (offen)<br />
3.3.3.3 Bein- und Knöchelbruch (geschlossen)<br />
3.3.3.4 Schlüsselbeinbruch<br />
3.3.3.5 Rippenbruch<br />
3.3.3.6 Offener Knochenbruch<br />
3.3.4 Verletzungen durch Fremdkörper<br />
3.3.5 Fingerkuppenverletzung<br />
3.3.6 Schock<br />
3.3.7 Verbrennung<br />
3.3.8 Gehirnerschütterung<br />
3.3.9 Bewusstlosigkeit<br />
3.3.10 Schädelbasisbruch<br />
3.3.1 Schnitt-, Riss- und Platzwunde<br />
Schminktechnik<br />
Am Beispiel Kryolan / Grimas- Material<br />
Siehe: Handbuch „<strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong>“, S. 67 - 110<br />
• ein kirschkerngroßes Stück Modelliermasse weich kneten, zu einer Rolle mit schmalen Enden<br />
• formen und auf die Haut auflegen<br />
• Modelliermasse mit dem Daumen / Modellierholz breit andrücken, ein glatter Übergang zur Haut<br />
ist wichtig (Daumen / Modellierholz) zuvor leicht mit Abschminke bestreichen<br />
• mit Schminkschwamm und Aquacolor Nassschminke den Angleich an den Hauttyp Vornehmen<br />
und „narben“<br />
• eine der Wund entsprechende Wundöffnung einschneiden<br />
• bei Schnittwunden eine längliche Wundöffnung (glatte Wundränder)<br />
• bei Risswunden gezackte Wundränder leicht anheben<br />
• bei Platzwunden eine klaffende Wundöffnung/Wundgrund/Wundrand mit dunkelroter Aquacolor<br />
Nassschminke versehen, etwas Filmblut in die Wunde geben; die Fließrichtung des Blutes ergibt<br />
sich aus der Körperhaltung des Mimen<br />
o soll der Eindruck erweckt werden, dass das Blut fließt, kann Brausepulver in das Wundbett<br />
geben werden. Anschließend flüssiges Blut hinzugeben.<br />
• Ggf. situationsbedingte Verschmutzung schminken, Wunde leicht verschmiert darstellen<br />
• Bei Wunden im Gesicht: Brausepulver nicht in die Augen bringen!<br />
Darstellung:<br />
• der Schmerz ist je nach Art, Ausmaß und Ort der Wunde unterschiedlich stark darzustellen.<br />
• Ggf. lehnt der Betroffene eine Versorgung durch den Arzt ab : „Ist doch halb so schlimm, ist ja<br />
schon wieder in Ordnung...“<br />
• Schonhaltung<br />
Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen Schmerzäußerungen (s. o.)<br />
Verletzten setzen oder legen Bei sachgerechter u. vorsichtiger Erster Hilfe Verminderung<br />
Keimfreie Wundbedeckung<br />
und deren Befestigung<br />
d. Schmerzäußerung (Gestik, Mimik, Akustik)<br />
Betreuung Ggf. Zeigen der Beruhigung<br />
Schonhaltung;<br />
Bei unvorsichtiger und unsachgemäßer Erster Hilfe<br />
z.B. bei Wundberührung oder Anstoßen reagiert der Mime<br />
durch verstärkte Schmerzäußerung<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 20/49 -
3.3.2 Schürfwunden<br />
Schminktechnik<br />
Am Beispiel Schminkkasten Mehlem<br />
Siehe: Handbuch <strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong> DDR 1988, S. 62 – 65<br />
• Make-up Paste auf die Haut auftragen und leicht verstreichen oder in Schürfrichtung ausstreifen<br />
(Kamm, Bürste), dabei ist der Unfallhergang zu beachten<br />
• Sand, Erde, Staub oder dergleichen aufstreuen und andrücken<br />
• Oberfläche mit Blut tropfenweise tränken und in Schürfrichtung ausstreifen,<br />
• Blut darf nicht fließen<br />
• Austritt von Blutplasma darstellen, z.B. mit Glyzerin besprühen oder mit Haar-Styling-Gel betupfen<br />
Darstellung:<br />
• Schürfwunden verursachen einen brennenden Wundschmerz, der je nach Art, Ausmaß und Ort<br />
der Wunde, dem Alter des Verletzten (z.B. Kinder), unterschiedlich stark darzustellen ist. Fallweise<br />
lehnt der Betroffene eine Versorgung durch den Arzt/Helfer ab: „Ist doch halb so schlimm,<br />
ist ja schon wieder in Ordnung...“<br />
• Schonhaltung<br />
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen Schmerzäußerungen (s. o.)<br />
Verletzten setzen oder legen Bei sachgerechter u. vorsichtiger Erster Hilfe<br />
Verminderung der Schmerzäußerung (Gestik, Mimik, Akustik)<br />
Keimfreie Wundbedeckung<br />
Schonhaltung<br />
und deren Befestigung<br />
Bei unvorsichtiger u. unsachgemäßer Erster Hilfe<br />
z.B. bei Wundberührung oder Anstoßen reagiert<br />
der Mime durch verstärkte Schmerzäußerung<br />
Betreuung Ggf. Zeigen der Beruhigung<br />
3.3.3 Gelenkverletzung und Knochenbruch<br />
Siehe: Handbuch für den Sanitätsdienst, S. 90 – 98<br />
3.3.3.1 Verstauchung<br />
Schminktechnik<br />
Am Beispiel Schminkkasten Mehlem<br />
• Modelliermasse auf die betreffende Stelle aufbringen<br />
• nach außen hin zur umgebenden Haut mit Vaseline verstreichen, so dass eine Schwellung<br />
entsteht<br />
• mit Make-up versehen<br />
• von der Mitte her nach außen hin einen leichten Bluterguss mit roter Paste schminken<br />
• die violette Verfärbung des Blutergusses tritt erst nach einiger Zeit ein. Zunächst wird vor allem<br />
eine Schwellung zu sehen sein (evtl. mit geringer Rotverfärbung).<br />
• Erst später dringt das Blut in die Haut und verfärbt sie.<br />
• Ggf. mit Schaumstoffschwämmchen „narben“<br />
Alternative: Ausformungen der Bekleidung (z.B. Strumpf im Knöchelbereich) zur Darstellung einer<br />
Schwellung und/oder einer abnormen Lage<br />
Darstellung:<br />
• Schon- und Entlastungshaltung einnehmen<br />
• eine eingeschränkte Bewegung ist unter Schmerzen möglich<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 21/49 -
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen Hinweis auf Schmerzen und Bewegungseinschränkung im verletzten<br />
Gelenk geben<br />
Kühlung Verminderung der Schmerzäußerung<br />
Ruhigstellung Nach sachgerechter Ruhigstellung: Verminderung der Schmerzäußerung<br />
(Gestik, Mimik, Akustik)<br />
Betreuung bei jeder stärkeren oder unvorsichtigen Bewegung verstärkte<br />
Schmerzdarstellung und Abwehrhaltung einnehmen<br />
3.3.3.2 Arm- / Handgelenkbruch geschlossen<br />
Schminktechnik<br />
am Beispiel Schminkkasten Mehlem<br />
Siehe: Handbuch für den Sanitätsdienst, S. 95<br />
• Durch Schminken einer „Schwellung an der vorgegebenen Stelle (siehe Verstauchung)<br />
• Siehe: Handbuch <strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong> DDR 1988, S. 115<br />
Ggf. Stufenbildung schminken<br />
Alternative: Durch Ausformung der Bekleidung<br />
Darstellung und Verhalten des Mimen<br />
Darstellung:<br />
• Der Verletzte hält seinen gebrochenen Arm mit der gesunden Hand am Körper (Schonhaltung).<br />
• Schmerzäußerung<br />
• Eine Bewegung des Armes ist nicht möglich und wird vermieden.<br />
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen Schmerzenäußerung (s. o.)<br />
Verletzten setzen oder legen Verminderung der Schmerzäußerung<br />
Kühlung „Zähne zusammenbeißen“<br />
Ruhigstellung<br />
Bei behutsamer, sachgerechter Ruhigstellung: Verminderung<br />
z.B. mit * Dreiecktüchern der Schmerzäußerung (Gestik, Mimik, Akustik)<br />
Betreuung Bei unsachgemäßer Hilfe, vor allem bei Bewegungen (grobes<br />
Anfassen o. ä.) kurze, laute Schmerzäußerung; bei ausdrücklicher<br />
Aufforderung durch den Helfer, den Arm zu bewegen, aufstöhnen:<br />
"Es geht nicht", o. ä.; Bewegung muss durch den<br />
Helfer unbedingt vermieden werden (ggf. Ausdruck stärkster<br />
Schmerzen - Aufschrei)<br />
* Cramerschienen * Kammernschienen * Sam- Splint<br />
3.3.3.3 Bein- / Knöchelbruch geschlossen<br />
Schminktechnik<br />
am Beispiel Schminkkasten Mehlem<br />
Schminken einer Schwellung z.B. beim Knöchelbruch (siehe Verstauchung)<br />
Beim Oberschenkelbruch tritt in der Regel ein Schock u. a. durch Blutung ins Gewebe auf. Bei<br />
anderen Brüchen ist ein Schock meist unwahrscheinlich. Der Schock entsteht durch Blutung ins<br />
Oberschenkelgewebe; hier sind bis zu zwei Litern Blutverlust möglich.<br />
Siehe: Handbuch für den Sanitätsdienst, S. 96 - 100<br />
Siehe: Handbuch <strong>Realistische</strong> Wund und <strong>Unfalldarstellung</strong> DDR 1988, S.<br />
Alternative: Durch Ausformung der Bekleidung zur Andeutung einer Schwellung und der abnormen<br />
Lage<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 22/49 -
Darstellung:<br />
• Der Mime äußert Schmerzen im Bruchbereich<br />
• Vermeidung jeglicher Bewegung des verletzten Beines<br />
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen Schmerzäußerung (s. o.)<br />
Kühlung Verminderung der Schmerzäußerung<br />
Ruhigstellung<br />
Z. B. mit Dreiecktüchern, Cramerschienen,<br />
Sam-Splint, Kammernschienen; Umpolsterung<br />
mit Decken o. ä.<br />
Mimik: verkniffenes Gesicht, Zähne<br />
zusammenbeißen. Bei jeder stärkeren Bewegung<br />
im Bruchbereich oder beim Anstoßen ist<br />
sofort verstärkt Schmerz darzustellen und eine<br />
Abwehrhaltung einzunehmen, ggf. kurze,<br />
laute Schmerzäußerung<br />
Betreuung Nach sachgerechter Ruhigstellung:<br />
Verminderung der Schmerzäußerung (Gestik,<br />
Mimik, Akustik); bei ausdrücklicher Aufforderung<br />
durch den Helfer, das Bein zu bewegen,<br />
ist dies mit dem Ausdruck von Schmerz zu vermeiden.<br />
Äußerungen wie: "Das tut so weh!“ o.<br />
ä.; Bewegung muss durch den Helfer<br />
unbedingt vermieden werden (ggf. Ausdruck<br />
stärkster Schmerzen – Aufschrei)<br />
Wärmeerhaltung / Zudecken<br />
Ggf. Überheben und Lagerung auf der Trage<br />
Ggf. Schockbekämpfung<br />
Verminderung der Schockdarstellung<br />
(s. Schock)<br />
Betreuung<br />
3.3.3.4 Schlüsselbeinbruch<br />
Schminktechnik<br />
am Beispiel Schminkkasten Mehlem<br />
"Zähne zusammen beißen", Schmerz-<br />
Äußerung vorübergehend etwas verstärken,<br />
bei jeder stärkeren Bewegung im Bereich der<br />
Bruchstelle und unvorsichtigem und unzweckmäßigem<br />
Anfassen/Heben ist verstärkt<br />
Schmerz zu äußern und darzustellen<br />
Schwellung bzw. Stufenbildung schminken<br />
In der Realität kommt es nur sehr selten zu einer Schwellung bzw. Stufenbildung. Daher ist<br />
der Schwerpunkt bei der Darstellung dieser Verletzung auf das Mimen zu legen.<br />
Darstellung:<br />
• Der Verletzte lässt die verletzte Schulter nach vorn und unten hängen<br />
• Er äußert Schmerzen im Schulterbereich.<br />
• Der Verletzte kann Auskunft über den Unfallhergang geben.<br />
• Schonhaltung<br />
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen und ggf. setzen oder Schmerzäußerung (s. o.)<br />
legen<br />
Kühlung Verminderung der Schmerzäußerung<br />
Ggf. Ruhigstellung Bei und nach behutsamer sachgerechter Ruhigstellung<br />
Verminderung der Schmerzäußerung<br />
(Gestik, Mimik, Akustik ); bei jeder<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 23/49 -
Betreuung<br />
3.3.3.5 Rippenbruch<br />
Schminktechnik<br />
am Beispiel Schminkkasten Mehlem<br />
stärkeren Bewegung im Bereich der Bruchstelle,<br />
bei unvorsichtigem und unzweckmäßigem<br />
Anfassen / Heben oder beim Anstoßen ist verstärkt<br />
Schmerz zu äußern und darzustellen und<br />
eine Abwehrhaltung einzunehmen<br />
Hämatom = Bluterguss<br />
Auf das Schminken eines Hämatoms zur Darstellung eines Rippenbruchs kann verzichtet werden,<br />
da bei unverletzter Haut Hämatome (einige Minuten nach dem Unfall) zumeist nicht zu sehen sind.<br />
Daher ist der Schwerpunkt bei der Darstellung dieser Verletzung auf das Mimen zu legen.<br />
� Ggf. im Bereich der Rippen Prellmarken mit roter Farbe schminken<br />
Darstellung:<br />
• Der Verletzte kann über den Unfallhergang klare Auskünfte geben.<br />
• Der Verletzte hält sich die verletzte Seite.<br />
• Die Atmung ist flach.<br />
• Bei stärkerem Durchatmen tritt ein stechender Schmerz auf, der deutlich lokalisiert werden kann.<br />
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen Schmerzäußerung, vor allem beim Atmen (s. o.)<br />
Lagerung mit erhöhtem Oberkör- Bei wunschgemäßer Lagerung: nach Wunsch des Betroffepernen,<br />
(i. d. R. ist eine Lagerung mit sonst zur verletzten Seite<br />
hin erhöhtem Oberkörper zur verletzten Seite für den Verletzten<br />
(Mimen) angenehm, atmungserleichternde Sitzhaltung);<br />
Verminderung der Schmerzdarstellung (Gestik, Mimik,<br />
Akustik); bei flacher Lagerung auf dem Rücken ist die<br />
Darstellung der Atemnot zu verstärken. Der Mime soll versuchen,<br />
sich aufzurichten bzw. den Wunsch äußern, sich aufrichten<br />
zu wollen.<br />
Betreuung<br />
3.3.3.6 Knochenbrüche<br />
Schminktechnik<br />
am Beispiel Kryolan- / Grimas-Material<br />
Siehe: Handbuch für den Sanitätsdienst Seite 94 ff.<br />
• Modelliermasse anmodellieren<br />
• Übergänge mit Öl glatt streichen<br />
• Abpudern<br />
• Knochenstück oder Schaumstoffstückchen an der<br />
• vorgesehenen der Bruchstelle in die<br />
• Modelliermasse einbringen<br />
• Blutung anschminken, dabei den sichtbaren „Knochen" nur am Rand einfärben<br />
Siehe Handbuch <strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong>, DDR 1988, S. 111 ff<br />
Schminktechnik<br />
am Beispiel Schminkkasten Mehlem<br />
• Knochenstück in entsprechender Größe abschrägen und mit Heftpflaster / doppelseitigem<br />
Klebeband aufkleben<br />
• Wulst aus Modelliermasse rings um das Knochenstück legen und nach außen hin zur umgeben<br />
den Haut verstreichen, dabei auf nahtlosen Übergang achten.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 24/49 -
• Kleine Knochenstücke können direkt in die Modelliermasse eingearbeitet werden.<br />
• Die ganze Fläche und einen Teil der Haut mit Make-up-Paste versehen, glätten und "narben".<br />
• Ggf. mit roter Farbpaste ein leichtes Hämatom schminken<br />
• Um den herausragenden Knochen herum eine Wundöffnung formen und mit roter Blutpaste aus<br />
legen<br />
• Etwas Brausepulver in die Wunde geben und mit Blut tränken, Fließrichtung beachten.<br />
• Ggf. Schockanzeichen schminken<br />
Darstellung:<br />
• Angaben über starke Schmerzen im Bereich der Bruchstelle machen (Schmerzäußerung)<br />
• Schonhaltung einnehmen<br />
• Ggf. Schock<br />
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen und beruhi- Schmerzäußerung (s. o.)<br />
gen<br />
Sterile Wundbedeckung<br />
Ruhigstellung, z. B. Cramerschiene, Bei und nach behutsamer sachgerechter Ruhigstellung<br />
Sam-Splint etc.<br />
Verminderung der Schmerzäußerung (Gestik, Mimik, Akustik<br />
); "Zähne zusammen beißen"<br />
Ggf. Überheben auf die Trage und Leichte Schmerzäußerung bei behutsamen Überheben;<br />
Vakuummatratze<br />
Bei jeder Berührung der Wunde oder Bewegung der<br />
Bruchstelle verstärkt Schmerzen äußern und darstellen<br />
Ggf. Schockbekämpfung<br />
Betreuung<br />
3.3.4 Verletzung durch Fremdkörper<br />
Schminktechnik<br />
am Beispiel Schminkkasten Mehlem<br />
• Den präparierten Fremdkörper mit Heftpflaster, je nach Art und Beschaffenheit, auf die Haut<br />
kleben<br />
Siehe Handbuch für den Sanitätsdienst, S. 111 f<br />
• Einen kleinen Ring aus Modelliermasse um den Splitter anbringen und zur Haut hin glatt<br />
streichen (nahtloser Übergang)<br />
Siehe Handbuch <strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong>, DDR 1988, S. 126 ff<br />
• Make-up-Paste auftragen und mit einem Schaumstoffschwämmchen narben.<br />
• Eine kleine Wundöffnung um den Splitter anbringen.<br />
• Wenig Blut in die Wunde geben.<br />
• Bei größeren Fremdkörpern die Wundumgebung ggf. etwas violett tönen, um den Umfang der<br />
inneren Gewebezerstörung darzustellen<br />
Alternative:<br />
Den Fremdkörper durch Pflaster befestigen und anschließend mit Blutpaste umgeben. Zur Unterstützung<br />
des Fremdkörpers ein Kügelchen aus Modelliermasse so unter dem Fremdkörper anbringen,<br />
dass er sich aufrichtet.<br />
Darstellung:<br />
• Schonhaltung einnehmen<br />
• Angabe von Schmerzen im Bereich der Verletzung<br />
• Ggf. Schock<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 25/49 -
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen und beruhigen, hinsetzen<br />
oder hinlegen<br />
Schmerzäußerung (s. o.)<br />
Behutsame, keimfreie Wundbedeckung; Bei behutsamer, sachgerechter Erster Hilfe:<br />
Verminderung der Schmerzdarstellung (Gestik,<br />
Mimik, Akustik);<br />
Umpolsterung des Fremdkörpers möglichst Mime äußert verstärkt Schmerzen, wenn der<br />
unter Vermeidung von Bewegungen am Fremdkörper bewegt oder durch den Verband<br />
Fremdkörper<br />
Druck auf den Fremdkörper ausgeübt wird<br />
Schockbekämpfung<br />
Betreuung<br />
(siehe Schock)<br />
3.3.5 Fingerkuppenverletzung<br />
Schminktechnik<br />
von den Teilnehmern zu wählendes Material<br />
Es sind verschiedene Arten der Wunddarstellung möglich z.B.<br />
1. durch das Modellieren einer Wunde auf der Fingerkuppe mit Modellierkitt<br />
2. durch das Aufkleben eines künstlichen Fingernagels zur Darstellung einer Verletzung des<br />
Nagelbettes<br />
Die Teilnehmer schminken auf der Grundlage der bisher erlernten Schminktechniken eine Fingerkuppenverletzung<br />
selbständig.<br />
Darstellung:<br />
• Je nach Verletzung der Fingerkuppe bzw. des Nagelbettes unterschiedlich starke Schmerzen<br />
äußern<br />
• Berührungsangst<br />
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen und beruhigen, hin- Schmerzäußerung (s. o.)<br />
setzen oder hinlegen<br />
Behutsame, keimfreie Wundbedeckung Bei behutsamer sachgerechter Erster Hilfe<br />
Verminderung der Schmerzdarstellung (Gestik,<br />
Mimik, Akustik);<br />
Bei unvorsichtiger und unsachgemäßer Erster<br />
Hilfe sowie bei Wundberührung oder Anstoßen<br />
mit verstärkter Schmerzdarstellung bzw. Wegziehen<br />
des/der Fingers/Hand<br />
reagieren<br />
Betreuung<br />
3.3.6 Schock (Volumenmangelschock)<br />
Schminktechnik<br />
am Beispiel Kryolan / Grimas-Material<br />
• Gesicht bis zum Haaransatz einschließlich Hals und Ohren gleichmäßig mit Aquacolor- oder<br />
Supracolor- Schminke einfärben<br />
• Den Übergang vom Auge zur Nase mit wenig grauer Schminke "schattieren".<br />
• Den Übergang von der Nase zum Mund ebenfalls mit wenig grauer Schminke schattieren, um<br />
dem Gesicht einen "verfallenen" Ausdruck zu geben.<br />
• Die Lippen und Ohrläppchen ggf. mit wenig blauer Farbschminke leicht schminken.<br />
• Mit einer Zerstäuberflasche dem Mimen eine Wasser-Glycerinmischung, die den Schweiß dar<br />
stellen soll, auf die Stirn sprühen. Nicht in die Augen sprühen!<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 26/49 -
Siehe Handbuch für den Sanitätsdienst, S. 63 ff<br />
Alternative: Styling-Gel auftupfen, um so den Schweiß darzustellen<br />
Siehe Handbuch <strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong>, DDR 1988, S. 176 f<br />
Hinweis: Bei vielen Verletzungsarten kann ein Schock auftreten. Dementsprechend müssen bei<br />
Verletzungen, bei denen ein Schock auftritt, auch die Schockanzeichen geschminkt und dargestellt<br />
werden. Es sind Schockformen möglich, bei denen andere Schmink- und Darstellungstechniken<br />
notwendig werden.<br />
Darstellung:<br />
• Der Verletzte ist in aller Regel ansprechbar.<br />
• Äußerungen und Verhalten deuten auf Angst hin, die Augen sind ggf. erweitert oder unruhig; die<br />
Sprache ist leise, die Aussprache träge<br />
• Ggf. Darstellung von Apathie<br />
• Auf Fragen der Helfer kann er keine klaren Antworten geben, Fehlreaktionen und Desorientiert<br />
heit<br />
• Unterbleibt die Schockbekämpfung(Hilfeleistung) ist die Teilnahmslosigkeit zu verstärken<br />
• Anzeichen von Frieren darstellen (zittern)<br />
Hinweis: Bei der Darstellung eines "Schocks" ohne das Vorliegen von Verletzungen ist auch ein<br />
unruhiges Umherlaufen des Mimen möglich.<br />
Beginn der Hilfeleistung<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen und beruhigend auf<br />
ihn einwirken<br />
Der Mime wird bei beruhigendem Ansprechen<br />
durch den Helfer etwas ruhiger. Bei Unterbleiben<br />
dieser Hilfemaßnahme unverminderte Darstellung.<br />
Wird der Mime nicht angesprochen, ist die Angstdarstellung<br />
zunächst zu verstärken.<br />
Später Übergang in Apathie und Teilnahmslosigkeit<br />
(ggf. starrer Blick).<br />
Atem- und Pulskontrolle<br />
Blutstillung oder Ruhigstellung von Knochenbrüchen<br />
Ggf. Schocklage Verbesserung des Zustandes mimen; bei Unterbleiben<br />
der Hilfemaßnahmen unverminderte Darstellung.<br />
Werden bei der Herstellung der Schocklage die<br />
Beine nur mit den Fersen aufgelegt und nicht weiter<br />
unterpolstert, so hat der Mime nach kurzer Zeit<br />
Schmerzen darzustellen.<br />
Wärmeerhaltung Kältezittern vermindern, bei Unterbleiben der<br />
Wärmeerhaltung das Kältezittern verstärken<br />
Je nach Ausbildungsstand der Helfer werden weitere<br />
Maßnahmen vorbereitet und durchgeführt,<br />
z.B. Sauerstoffgabe und Infusionen. Diese Maßnahmen<br />
verbessern i. d. R. den Zustand des Verletzten<br />
erheblich. Die Maßnahmen werden nur<br />
angedeutet, führen beim Mimen aber zu einer<br />
deutlichen Verbesserung seines Zustandes (entsprechende<br />
Darstellung)<br />
Betreuung Der Mime bleibt, solange er betreut wird, verhältnismäßig<br />
ruhig. Unterbleibt die Betreuung oder<br />
wird sie unterbrochen, wird die Unruhe, Angst verstärkt<br />
dargestellt, später Übergang in Apathie.<br />
Weitere Atem- und Pulskontrollen<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 27/49 -
3.3.7 Verbrennungen<br />
Schminktechnik<br />
am Beispiel verschiedener Materialien;<br />
Handbuch für den Sanitätsdienst, S. 113 ff<br />
• Die betreffende Stelle mit entsprechender Paste / Schminke färben oder mit rotem Colorspray<br />
einsprühen, so dass eine leichte Rötung entsteht.<br />
Dieser Schminkschritt entspricht einer Verbrennung ersten Grades, die immer zu schminken ist.<br />
• Blasenbildung<br />
Variante 1:<br />
o Ggf. Schockanzeichen schminken<br />
o Mit gelber Vaseline eine Brandblase darstellen.<br />
o Mit Sprühverband oder Alleskleber (UHU)<br />
o die Vaseline überziehen<br />
o Mit weißem Puder abpudern<br />
o Bei Notwendigkeit: Farbangleich<br />
Siehe Handbuch <strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong>, DDR 1988, S. 131-159<br />
Variante 2:<br />
o Mit gelber Vaseline eine Brandblase darstellen<br />
o Mit dünnen Zellstofffetzen belegen und leicht andrücken<br />
o Bei Notwendigkeit: Farbangleich<br />
Variante 3:<br />
o Eine ca. daumennagelgroße Fläche mit Alleskleber bedecken und kurz antrocknen lassen<br />
o Mittels einer Einwegspritze (2m1) ohne Kanüle Styling-Gel o. ä. unter den Alleskleber<br />
spritzen<br />
o Mit weißem Puder abpudern<br />
o Bei Notwendigkeit: Farbangleich<br />
Variante 4:<br />
o Gelafixhaut warm auftragen und mit Spachtel verteilen<br />
o Nach dem Erstarren Farbgestaltung mit Supracolor-Teintschminke durchführen<br />
• Bei Vorhandensein tiefergehender Gewebezerstörungen:<br />
Variante 1:<br />
o Die geschminkte Brandblase nach dem Trocknen aufreißen und mit dunkelroter bis<br />
schwarzer Paste/Schminke auslegen<br />
o Dieser Schminkschritt entspricht Verbrennungen dritten Grades.<br />
o Je nach Ursache der Verbrennung "Russschmiere" oder Asche auftragen<br />
Variante 2:<br />
o Collodium mit Pinsel zügig auf die vorbereitete Fläche auftragen<br />
o Nach kurzer Trockenzeit den Collodiumfilm mit entsprechend eingefärbten Fingern aufreißen<br />
Variante 3:<br />
o Alleskleber auf einer feuerfesten, mit Vaseline bestrichenen Unterlage entzünden, solange<br />
brennen lassen, bis sich Blasen bilden<br />
o Unverzüglich auf die vorbereitete Hautfläche auflegen und anmodellieren, hierbei auf<br />
Temperatur des Klebers achten<br />
Darstellung:<br />
• Starke bis sehr starke Schmerzdarstellung<br />
• Je nach Umfang der Verbrennung Schockdarstellung<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 28/49 -
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen Starke Schmerzdarstellung, bei sehr starken<br />
Verbrennungen auch Schreien<br />
Schreiend hin- und her- oder weglaufen<br />
Ggf. Verletzten am Weglaufen hindern<br />
und Kleiderbrände löschen<br />
Kaltwasseranwendung Schmerzlinderung äußern und darstellen; bei Unterbrechung<br />
der Kaltwasseranwendung Schmerzäußerung<br />
wieder verstärken<br />
Nach der Kaltwasseranwendung erfolgt Verstärkt Schmerz darstellen, wenn der Verband zu<br />
die sterile Wundbedeckung<br />
Wärmeerhaltung<br />
(Decke unterlegen; zudecken)<br />
Ggf. Schocklage<br />
Je nach Ausbildungsstand der Helfer werden<br />
weitere Maßnahmen vorbereitet und<br />
durchgeführt, z.B. Sauerstoffgabe/Infusionen.<br />
Die Maßnahmen werden<br />
nur angedeutet.<br />
Betreuung<br />
3.3.8 Gehirnerschütterung<br />
fest angelegt wird.<br />
Kältezittern vermindern.<br />
Verstärkung d. Schmerzdarstellung, wenn die Decke<br />
auf den Wunden liegt<br />
Diese Maßnahmen verbessern i. d. R.<br />
den Zustand des Verletzten erheblich.<br />
Schminktechnik<br />
Eine Gehirnerschütterung kann nach einer Gewalteinwirkung auf den Kopf (ohne jede äußere Verletzung)<br />
auftreten.<br />
Siehe Handbuch für den Sanitätsdienst, S. 76 f<br />
Es kann je nach Unfallsituation aber auch eine Schürfwunde, eine Platzwunde ein Hämatom am<br />
Kopf oder Blässe geschminkt werden, die jeweils eine Gewalteinwirkung auf den Kopf andeuten.<br />
Darstellung:<br />
• Der Betroffene klagt über Kopfschmerz, die Reaktionen sind ggf. träge<br />
• Zeitweise ist dem Betroffenen unwohl, ggf. Brechreiz darstellen<br />
• Der Betroffene ist nicht voll ansprechbar. Das Erinnerungsvermögen ist lückenhaft oder fehlt, vor<br />
allem bezogen auf den Unfallhergang: "Was ist passiert, wo bin ich hier?" usw.<br />
• Später Übergang in Bewusstlosigkeit ist möglich<br />
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen und wenn Bewusstsein<br />
vorhanden je nach Wunsch hinlegen<br />
Auf Befragen des Helfers kann der Verletzte<br />
sich an das Unfallgeschehen nicht erinnern<br />
(Erinnerungslücke).<br />
Erste Hilfe bei Erbrechen Ggf. Brechreiz darstellen (in Intervallen)<br />
Ständige Betreuung und Beobachtung ggf. ist später Bewusstlosigkeit darzustellen<br />
Bei Bewusstlosigkeit: Ansprechen, Atemkontrolle,<br />
Seitenlagerung<br />
Wärmeerhaltung<br />
(Decke unterlegen; zudecken)<br />
Betreuung<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 29/49 -
3.3.9 Bewusstlosigkeit<br />
Darstellung:<br />
Siehe Handbuch für den Sanitätsdienst, S. 30 ff<br />
• Der Betroffene ist nicht ansprechbar<br />
• Völlige Entspannung (Muskelerschlaffung)<br />
Beginn der Hilfeleistung:<br />
Maßnahmen Verhalten des Mimen<br />
Verletzten ansprechen Keine Reaktion;<br />
Der Mime hat, um eigene Verletzungen zu vermeiden,<br />
darauf zu achten, dass, die Glied-<br />
maßen bei unsachgemäßer Seitenlagerung<br />
nicht gewaltsam verdreht werden, der Hals<br />
nicht gewaltsam übermäßig überstreckt wird,<br />
evtl. Brille vorher entfernt wird. Wenn der Mime<br />
Schmerzen verspürt, muss der Mime den<br />
Helfer aufmerksam machen.<br />
Atemkontrolle Deutlich atmen<br />
Seitenlagerung Körper locker lassen (Verletzungsgefahr<br />
beachten)<br />
Ständige Beobachtung<br />
(Atem- und Pulskontrolle)<br />
Wärmeerhaltung<br />
(Decke unterlegen; zudecken)<br />
3.3.10 Schädelbasisbruch<br />
Schminktechnik:<br />
am Beispiel verschiedener Materialien<br />
Siehe Handbuch für den Sanitätsdienst, S. 79<br />
• Sehr geringe Blutung aus Nase/Mund und/oder Ohr (auf gleicher Gesichtshälfte darzustellen);<br />
Fließrichtung des Blutes muss der Lage des Verletzten angepasst sein<br />
Siehe Handbuch <strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong>, DDR 1988, S. 116 ff<br />
• Ggf. sind Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung im Bereich des Kopfes zu schminken (Schürf-<br />
wunde, Platzwunde o. ä.)<br />
• In Ausnahmefällen können, insbesondere wenn zusätzliche Verletzungen vorhanden sind,<br />
Schockanzeichen geschminkt werden.<br />
Hinweis: Ein Monokel- oder Brillenhämatom (Bluterguss um ein Auge oder beide Augen)<br />
wird nicht geschminkt, da dieses Anzeichen unter Umständen erst Stunden nach der Gewalteinwirkung<br />
auftritt.<br />
Verhalten des Mimen<br />
Es kann sowohl eine Bewusstlosigkeit als auch eine Gehirnerschütterung dargestellt werden.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 30/49 -
RUD-Ausbildung<br />
Arbeitsblatt für Gruppenarbeit<br />
Gruppe:........... Arbeitsraum:............................................<br />
Thema Ihrer Gruppe: Vorbereitung einer realistischen <strong>Unfalldarstellung</strong><br />
mit einem Verletzten<br />
Verletzungen: .........................................................<br />
Ihre Aufgabe: • Schminken Sie gemeinsam die o. g.<br />
Verletzung(en) an einem Gruppenmitglied.<br />
• Besprechen und üben Sie die dazugehörenden<br />
Maßnahmen des Helfers und das Verhalten des<br />
Mimen<br />
• Präsentieren Sie die situationsgerechte<br />
Darstellung<br />
Aufgabe der Arbeitsgleich zu anderen Verletzungen<br />
anderen Gruppen:<br />
Präsentation: jede Gruppe bestimmt<br />
• Mimen<br />
• Ersthelfer<br />
• Moderator.<br />
Stellen Sie die vorgegebenen Verletzungen und<br />
die vorbereitete Darstellung vor. Die Verletzungen,<br />
die Schminktechnik, die Darstellung und die<br />
Maßnahmen sowie das richtige Verhalten der<br />
Mimen werden den Teilnehmern erklärt. Dabei<br />
sollten die Sicherheitsaspekte große Beachtung<br />
finden. Danach wird die Situation durch die Gruppe<br />
im Gesamtablauf einschließlich der Hilfeleistung<br />
dargestellt.<br />
Zeit der Gruppenarbeit: ca. 60 Minuten<br />
Zeit der Präsentation: ca. 15 Minuten<br />
Diskussion und Besprechung: ca. 15 Minuten<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 31/49 -
Die <strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong><br />
Abschnitt 4: Die Unfallsituation<br />
4.1 Das Herstellen einer realistischen Lage<br />
4.2 Beispielhafte Unfallsituationen<br />
4.2.1 Verkehrsunfälle<br />
4.2.2 Unfälle in Industrie und Gewerbe<br />
4.2.3 Unfälle in Haus und Hof<br />
4.1 Das Herstellen einer realistischen Lage<br />
Um eine möglichst realistische Situation zu schaffen, reicht es nicht immer aus, eine Verletzung entsprechend<br />
darzustellen. Der Mime muss so eingewiesen werden, dass er sich beim Eintreffen der Helfer so<br />
verhält, wie es ein Realverletzter in einer solchen Situation tun würde. Schreien, Stöhnen, Fluchen, Röcheln<br />
oder ein schmerzverzerrtes Gesicht verleihen der Situation eine völlig neue und ganz bestimmt<br />
ungewohnte Note, welche der Helfer erst einmal bewältigen muss. Ein künstlich auf die Verletzung abgestimmtes<br />
Umfeld wirkt nicht nur besser auf den Ersthelfer, es soll ihm auch ermöglichen, ohne Hilfe<br />
einer vorgelesenen Lage auf den Hergang des Unfalls bzw. auf die Schwere und die Entstehung der<br />
vorgefundenen Verletzung zu schließen.<br />
Es ist einfach unsinnig, bei einer Ausbildung, im Hörsaal oder Unterrichtsraum eine Granatsplitterverletzung<br />
oder ein Trauma darzustellen, dass durch Einwirken von Kriegswaffen entstanden ist. Nicht nur,<br />
dass diese Darstellung unglaubwürdig ist, diese Unglaubwürdigkeit verleitet auch den Auszubildenden<br />
dazu, unter dem Vorbehalt- „Tun wir mal so als ob !"- zu handeln. Das Handeln wird immer relativ sein,<br />
da der Schüler nicht wirklich gefordert ist. Er durchschaut die Situation zu leicht und das Überbrechen,<br />
d.h. der erste Schreck, setzt nicht ein. Dabei spielt es keine Rolle, dass beim zweiten Hinsehen jeder<br />
erkennen kann, der Verletzte ist gar nicht verletzt! Doch selbst wenn das Umfeld stimmig ist, gibt es<br />
Kleinigkeiten, die auch den vorbeikommenden Laien ein höhnisch mitleidiges Lächeln entlocken.<br />
Aus welchem Grund aber und warum geschieht so etwas?<br />
Lage 1<br />
Ein Mime liegt mit einer Halsverletzung am Boden. Aus der A. carotis spritzt das Blut, auf dem Untergrund<br />
hat sich bereits eine größere Blutlache gebildet. Eigentlich hätte das Spritzen schon etwas<br />
nachlassen müssen, aber der Mime meint es gut mit seinen Ersthelfern. Der Schock ist gut zu<br />
erkennen, fahles Gesicht, dunkle Augenlider, dunkle Lippen und leicht blaue Ohrläppchen. Unklar<br />
ist jedoch, wie der Unfall und die Verletzung entstanden ist. Der Hemdkragen ist weit nach unten<br />
gebogen, die Hemdknöpfe sind offen, denn es soll ja nichts schmutzig werden.<br />
So liegt sicherlich kein Verletzter. Auch wenn die Arbeit des Schminkers hervorragend ist, niemand<br />
reißt sich nur um eine Verschmutzung zu vermeiden, den Hemdkragen runter, fällt hin und<br />
blutet langsam vor sich hin.<br />
Lage 2<br />
Da liegt ein Verwundeter mit einer offenen Bauchverletzung. Die Darmschlingen sind aus der<br />
Bauchdecke herausgetreten, der Mann hat soeben das Bewusstsein verloren. Die Hände sind<br />
sauber, der Schock hat eingesetzt und auf dem Boden befindet sich eine Blutlache. Ein vorbeigehender<br />
Passant sieht, die Knöpfe der Jacke sind bis auf einen geschlossen. Aus der kleinen Öffnung<br />
treten die Darmschlingen heraus.<br />
Aus welchen Gründen auch immer, es scheint ein vereinbartes Zeichen zwischen Ausbildern und<br />
Lehrgangteilnehmern zu sein, dass die Darmschlingen durch Hemd und Jacke treten und offen<br />
sichtbar liegen.<br />
Auch dies ist unrealistisch, ebenso wie die sauberen Hände des Verletzten. Diese müssten blutverschmiert<br />
sein, weil jeder versucht, sich bei einer solchen Verletzung den Bauch zu halten, durch Gegendruck<br />
versucht die Schmerzen zu lindern und vielleicht sogar durch Zurückdrängen des Darms die<br />
Öffnung zu schließen.<br />
Irrationalismen sind hier am Werk, wofür jedoch der Ausbilder und der Mime Rechnung zu tragen haben.<br />
Auch hier muss sich der Mime so verhalten wie es die meisten Verletzten tun. Da hilft auch keine Recht-<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 32/49 -
fertigung in der Art :"Keine Verletzung ist wie die andere". Das stimmt zwar, dies gilt jedoch nur für das<br />
Aussehen einer Wunde aber nicht für das Verhalten eines Menschen.<br />
Zwei Fälle die verdeutlichen, dass auch der Verletzte selber „stimmen" muss.<br />
4.2 Beispielhafte Unfallsituationen<br />
Die folgende Beispielsammlung ist als Anregung gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.<br />
Jede Unfallsituation muss für sich allein geplant und detailliert ausgearbeitet werden. Der aufmerksame<br />
Übungsleiter wird bei jeder Neubearbeitung auch immer wieder Verbesserungen herausfinden.<br />
4.2.1 Verkehrsunfälle<br />
Unfälle auf der Straße sind häufig. Als Vorteil kann gelten, dass meist nur wenige Verletzte (ein<br />
bis vier, selten mehr) beteiligt sind. Fast alle Arten von Verletzungen können vorkommen und viele<br />
Situationen können mit geringem Aufwand an Hilfsmitteln gut gestellt werden.<br />
Zu bedenken ist allenfalls die Wetterabhängigkeit. Verkehrsbehinderung, Mitteilung an die Polizei.<br />
Einholung einer Bewilligung etc.<br />
Von entscheidender Bedeutung ist die folgende Überlegung:<br />
Bei einer wirklichen Großkatastrophe (Flugzeugabsturz- Eisenbahnunglück – Massenkarambolage<br />
– Gebäudeeinsturz – Hotelbrand etc.) muss stets eine Gruppe von Führungskräften nur die organisatorischen<br />
Aufgaben erfüllen, d.h. die Gesamtsituation unter Kontrolle bringen und die einzelnen<br />
Helfer zum Einsatz führen.<br />
Der einzelne Helfer wird sich dann meist nur um einen Verletzten kümmern können. Für ihn bedeutet<br />
es keinen Unterschied, ob der Verletzte nur ein einziger ist oder einer unter vielen. Aus diesem<br />
Grunde soll das „Üben der Ersten Hilfe am Verletzten “ auf das Einzelbeispiel oder die<br />
kleinere Situation beschränkt bleiben.<br />
Situationen und deren Vorbereitung<br />
Motorrad oder Moped<br />
- Batterie ausbauen, evtl. Treibstoff entleeren<br />
- Motorrad umlegen, freilaufende Räder drehen lassen<br />
- Lenkstange kann verdreht werden<br />
- Evtl. kann altes Vorderrad verbogen provisorisch montiert werden<br />
- Fahrer in Fahrrichtung vorne auslegen<br />
- Persönliche Requisiten (Helm, Brille, Handschuhe) auslegen<br />
- Roten alten Radschlauch zwischen die Speichen wickeln<br />
- Sattel verstellen und Scheinwerfer daneben legen<br />
Blechschaden am Auto<br />
- Außenspiegel verdrehen<br />
- Scheinwerferglas und –fassung , Bremslicht – und Blinkerabdeckung wegschrauben<br />
und durch defekte ersetzen<br />
- Evtl. Fassung herunterhängen lassen<br />
- Kofferraumdeckel und Motorhaube leicht öffnen<br />
- verbogene Zierleisten und Frontziergitter (vom Autoabbruch) am unbeschädigten Auto<br />
befestigen<br />
Achsenbruch am Auto<br />
- Lenkrad vollständig nach links oder rechts einschlagen<br />
- Auto mit Wagenheber seitlich vorne oder hinten anheben (Wagen mit Handbremse,<br />
Gang, Holzkeil oder Stein sichern)<br />
- ein Rad abschrauben<br />
- Wagen wieder herunterlassen. so dass die Radnabe tiefer liegt als bei normal befestigtem<br />
Rad<br />
- Abgeschraubtes Rad an die Nabe schräg anlehnen<br />
- Raddeckel daneben legen, evtl. - verbeulten Deckel aus dem Autoabbruch verwenden<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 33/49 -
- eine ähnliche Wirkung erzielt man, wenn der Wagen auf einer Seite angehoben wird und<br />
das Reserverad an der tiefsten Stelle der Gegenseite angelehnt wird<br />
- fährt man den Wagen mit einem Rad auf eine Borasteinkante; so kann man sich das<br />
Anheben mit dem Wagenheber sparen<br />
- die Luft aus einem Reifen kann abgelassen werden<br />
Glasschaden am Auto<br />
- eine Scheibe Sekuritglas (vom Autoabbruch) wird in eine Decke gewickelt und darin zerschlagen<br />
- die Scherben klebt man auf durchsichtige Folie<br />
- dann legt man die präparierten Glasstücke auf den unteren Rand der Windschutzscheibe<br />
- Türfenster herunterkurbeln<br />
- einige Sekuritstucke zwischen die Gummileisten stecken<br />
- restliche Sekuritscherben auf dem Boden verstreuen<br />
Motorschaden und Vergaserbrand<br />
- Motorhaube etwas öffnen und in dieser Stellung fixieren (Holzunterlage)<br />
- für Motorschaden unter dem Motor etwas Wasser ausgießen (kein Öl wegen Rutschgefahr<br />
und Verschmutzung)<br />
- für Vergaserbrand zwei bis drei Esslöffel Rauchpulver auf einem Stück Blech unter dem<br />
Motorraum abbrennen<br />
- einige Stücke Gummi (aus einem alten Autoreifen mit Fasereinlage) in Altöl-<br />
Petrolgemisch (1:1) verbrennen ergibt den passenden Geruch<br />
Vorsicht :<br />
Rauchpulver kann unbedenklich unter dem Auto verbrannt werden, weil es nur glimmt.<br />
Dagegen ist mit der offenen Flamme beim Gummibrand Vorsicht geboten.<br />
Brems- und Schleuderspuren<br />
- Nachzeichnen mit Gummi-Schuhabsatz, angekohltem Holz, Ruß oder am besten mit<br />
einem Gummistück oder ganzem Abfallreifen<br />
- in der Wiese mit Holzpfahl oder ähnlichem Hilfsmittel Spuren bis zum Unfallauto nachziehen<br />
- Beschädigungen von schleudernden Autos an Bäumen oder Unterholz müssen evtl. mit<br />
dem Förster abgesprochen werden<br />
Präparierung von Fahrzeugen<br />
Unfall mit Pkw<br />
- Hier kann nur mit Requisiten aus dem verwendeten Auto gearbeitet werden. Gelände so<br />
auswählen, dass ein Absturz angenommen werden kann, wobei das Fahrzeug im Graben<br />
oder hinter Gebüsch zu liegen kommt und evtl. nicht mehr gesehen wird.<br />
- Brems- und Absturzspuren anlegen (Straße. Straßenrand. Böschung etc.).<br />
- Verletzte auf der abfallenden Böschung inmitten von Requisiten auslegen (Koffer, Handtaschen,<br />
Ski etc.).<br />
- Die Lage des Fahrzeugs evtl. durch Rauch oder Bengalfeuer markieren und dadurch<br />
auch die Größe des Unfalles andeuten.<br />
Unfall mit Lkw<br />
- Ladebrücke leicht ankippen<br />
- Bordwand herunterklappen<br />
- Ladegut verstreuen (Kisten. Bretter etc.)<br />
- Präparation des Lastwagens teilweise ähnlich wie beim Pkw<br />
Neugierige, Gaffer<br />
- Gut auf ihre Aufgaben vorbereiten (Kinder möglich)<br />
- nur widerstrebend oder gar nicht zur Hilfeleistung bereit sein<br />
- Wohlgemeinte „Ratschläge“ erteilen lassen<br />
- im Wege stehen<br />
- wenn die Gaffer von den Rettern Aufträge entgegengenommen haben, diese ausführen,<br />
sich aber unbeholfen anstellen oder noch einmal fragen<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 34/49 -
4.2.2 Unfälle in Industrie und Gewerbe<br />
Unfälle in Industrie und Gewerbe sind für den Übungsablauf die dankbarsten, weil der Phantasie<br />
und den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt sind.<br />
Vorteile dieser Unfallsituation:<br />
- Anzahl der Verletzten ist variabel, vom Einzelunfall über Massenunfall bis hin zum Katastrophenfall<br />
- Große Abwechslungsmöglichkeiten, begrenzt allerdings auf die im Ort vorhandenen<br />
Gewerbe- und Industriebetriebe<br />
- Die Führungskräfte lernen bei Übungen die Werkanlagen für den Ernstfall kennen.<br />
- Überraschungsmomente können gut eingebaut werden: Gruppen der Helfer gehen an<br />
einen befohlenen Ort, auf dem Weg dorthin werden sie vom „Unfall" nebenan überrascht.<br />
- Teilweise wetterunabhängig<br />
- Schwierigkeiten: Zugang zu Betrieben<br />
- Fehlende Fachkenntnisse aus der entsprechenden Branche<br />
Einbindung von Maschinen:<br />
- Anlage wenn möglich noch laufen lassen (Bewegung, Geräusch)<br />
- Schutzvorrichtungen nicht verwenden (sonst wirkt der Unfall unglaubwürdig)<br />
- der Unfall ist entstanden, weil der Arbeiter die Vorrichtungen nicht verwendet hat!<br />
- Sicherheit für die Retter beachten<br />
- sofern Maschinen vorhanden: Pfeifende oder schleifende Geräusche<br />
Explosionen:<br />
- vor allem als Überraschung verwenden<br />
- Explosionszeitpunkt muss gut gewählt werden<br />
- im Freien Knallkörper und Rauchpulver (weißer oder schwarzer Rauch) verwenden<br />
- im Inneren von Fabrikhallen, größeren Kellern Blitzlichtpulver mit Elektrozünder<br />
zur Verbrennung bringen<br />
- etwas Rauchpulver kann ebenfalls verwendet werden (Luftprobleme beachten)<br />
- Splitter, Schutt, zerstörte Gegenstände, ausgehängte Türen und klirrendes Glas vervollständigen<br />
die Situation<br />
- Einstürze von Stapelmaterial sind glaubhafte Situationen<br />
- Abstürze des Lagerpersonals von Gestellen und Leitern mit einbauen<br />
- Personen werden eingeklemmt oder teilweise begraben<br />
- Sekundärunfalle können gut eingebaut werden: Ein Nachbargestell stürzt noch um oder<br />
herunterfallende Gegenstände gefährden die Retter<br />
- im Inneren von Räumen: Kein Licht, versperrte Zugänge, verschlossene Türen<br />
Verbrennungen, Verätzungen, Vergiftungen<br />
Übungsmaßnahme muss besonders gut mit dem Charakter des Betriebes übereinstimmen.<br />
Elektrounfall<br />
- Verbrennungs-Situationen am Arbeitsplatz mit Camping-Gasfeuer darstellen<br />
- hierbei keine Verbrennungen ohne offenes Feuer oder glühende Gegenstände usw.<br />
darstellen<br />
- Augenverätzungen mit Gips-Spritzer andeuten (Darsteller muss Augen schließen, mit<br />
kleinem, harten Bürstchen spritzen. Vorsicht!)<br />
Bei einem Stromunfall ähnlich vorgehen wie bei einer Explosion.<br />
- Trafostation und Verteileranlage braucht nicht ausgeschaltet zu werden.<br />
- Verletzte in genügender Distanz einsetzen. In jedem Fall Hauselektriker einbeziehen,<br />
wenn die Elektroanlage ausgeschaltet werden kann. Absperrgitter teilweise entfernen.<br />
- Hauptschalter der Anlage, wenn möglich auf ´Ein` stellen (Anlage anderswo stromlos<br />
machen, damit die Helfer die Anlage ausschalten können.<br />
- Am Strom hängender Mime muss die Bedingungen bezüglich Spannung und Erde erfüllen.<br />
- Elektriker einbeziehen!<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 35/49 -
- Ausschaltmöglichkeiten etwas schwieriger gestalten (z.B. fest installierte Maschine und<br />
Sicherungen im Verteilerkasten mit Vierkantschloss).<br />
Unfälle auf Baustellen<br />
Bauplätze (Hoch- und Tiefbau) und von der Art her ähnliche Anlagen wie Kiesgruben, Ruinen usw.<br />
sind sehr geeignete Übungsobjekte.<br />
- Die Zahl der Verletzten ist variabel.<br />
- Es braucht weniger auf Sauberkeit und auf vorhandene Einrichtung Rücksicht genommen<br />
werden. Einsatz von Knall und Rauch ist gut möglich.<br />
- Bergungs- und Transportfragen gewinnen an Bedeutung.<br />
- Sekundärunfälle können gut eingebaut werden.<br />
Abstürze:<br />
- Spektakuläre Abstürze möglich: Freier Fall durch eine Etage, in der sich Retter aufhalten<br />
- Auf den unteren Stockwerken Matten, Stroh auslegen!<br />
- Als Sekundärunfall sehr wirkungsvoll<br />
- Gebrochene Gerüstbretter. Absperrungen<br />
- Ausziehbare Leiter liegt auseinander genommen am Boden<br />
- Absturz in Silos oder an Kieswänden<br />
- In allen Fällen die Arbeitsutensilien des Arbeiters (Werkzeug, Farbe. Geräte usw.) zur<br />
Untermalung der Situation verwenden.<br />
Einstürze:<br />
- vor allem im Straßen- und Tiefbau<br />
- Eingedrückte Verstrebungen im Schacht mit den gleichen Hilfsmitteln darstellen wie die<br />
richtigen Verspießungen (geknickte Balken und Bretter überdecken die Halterungen)<br />
- Richtige Verschüttungen sind möglich. Der Darsteller liegt in einer Röhre, die durch<br />
Schutt komplett zu gedeckt wird.<br />
- Gerüsteinsturz im Hochbau kann mit wenigen Gerüstelementen wirkungsvoll dargestellt<br />
werden.<br />
4.2.3 Unfälle in Haus und Hof<br />
Haushaltunfälle sind häufig und besonders für die teilnehmenden Helfer aus prophylaktischen<br />
Gründen lehrreich. Haushalte gibt es überall. Mit wenig Aufwand werden Situationen dargestellt.<br />
Es können aber nur ein bis zwei Verletzte dargestellt werden.<br />
Verbrühungen am Kochherd<br />
- Wasser (oder andere Flüssigkeit. -. B. Suppe) am Boden ausschütten (Dampfschwaden<br />
erwünscht)<br />
- alte, verbeulte Pfanne auf den Boden fallen lassen<br />
- für Direktspiel geeignet<br />
Unfall beim Treppensteigen<br />
- Inhalt einer Einkaufstasche ausleeren<br />
- Teppiche auf der Treppe oder unten verschieben<br />
- evtl. Unfallursache darstellen (loser Teppich, Bananenschale, ungenügendes Geländer<br />
usw.)<br />
- nur bezüglich Geräusche als Direktspiel geeignet<br />
Sturz beim Lampenmontieren<br />
- Küchenstuhl stehend, daneben am Boden liegend ein Fußschemel<br />
- Küchenlampe mit abgeschraubtem Schirm<br />
- Glühbirne oder Leuchtstoffröhre am Boden zerschellen<br />
- Teppich verrutschen oder Ecke umklappen<br />
- Unfall ist geeignet für Direktspiel: Das Herunterfallen des Fußschemels und das Zerschlagen<br />
der alten Glühlampe, verbunden mit dem Schrei und dem Stöhnen der Hausfrau<br />
ist sehr wirkungsvoll<br />
Unfälle mit elektrischen Geräten<br />
- siehe auch Niederspannungs-Unfall<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 36/49 -
- die Übungsanlage muss elektrotechnisch in Ordnung sein: Scheinbar stromführender<br />
Leiter –Metallgehäuse-Mensch-Erde= Stromkreis geschlossen (Elektriker einbeziehen!)<br />
- Kurzschlüsse können mit dem Elektrozünder wirkungsvoll dargestellt werden:<br />
- Elektrozünder (im Haushalt aber ohne zusätzliches Blitzlichtpulver) in der Hand halten<br />
und unauffällig mit einer Monozelle (1,5-Volt-Satterie.) zünden<br />
- im leicht verdunkelten Raum sehr wirkungsvoll<br />
Gartenunfälle<br />
- schwere Schnittverletzung mit Elektro- oder Motorrasenmäher, Sense oder Axt<br />
- Abstürze beim Pflücken (Leiter nicht unbedingt wegnehmen, besser schräg stellen,<br />
- abgerissenen Ast neben den Verunglückten legen, Pflückgut verstreuen)<br />
- Sonnenstich und Hitzschlag möglich<br />
- Verbrennungen am Feuer (Gartengrill)<br />
Vergiftungen<br />
- Kind hat Arzneimittel, Pflanzenschutzmittel usw. erwischt<br />
- falsch angeschriebene Verpackungen führen zu Vergiftungen<br />
- Angebrochene Packungen hinstellen<br />
- Offensichtliche Diskrepanz zwischen Verpackung und Inhalt darstellen (Flaschenart, Geruch,<br />
Farbe, Etikettierung fehlerhaft)<br />
- Vergiftungen nicht erst im Stadium der Bewusstlosigkeit beginnen (Unwohlsein, Erbrechen<br />
usw.).<br />
Kohlenmonoxydvergiftung<br />
- kalte Jahreszeit: in geschlossener oder fast ganz geschlossener Garage arbeitet Autobastler<br />
bei laufendem Motor<br />
- Abgase durch Schlauch (alter Staubsaugerschlauch aus Metall) ins Freie leiten<br />
- Wirkungsvoll: Helfer tritt durch die Verbindungstüre zum Haus in die Garage, trifft den<br />
Patienten bewusstlos unter dem Wagen oder über den Motor gebeugt; das Wagenende<br />
ist also direkt beim Garagentor, dadurch ist der „Auspuffschlauch“ kurz und unsichtbar<br />
- Auspuffschlauch evtl. bei einer Kfz-Werkstatt ausleihen<br />
Der gestörte Unterricht<br />
Überraschende Unfallereignisse<br />
- Vereinslokal oder Unterrichtsraum: ein Teilnehmer oder ein Kursleiter spült ein Glas aus<br />
- Glas im Ausguss zerschlagen, vorher etwas Blut auf die vorpräparierte Schnittwunde an<br />
der Innenhand gießen (Ampulle = leere Haarshampoo-Einportionen Beutel)<br />
- mit nassen Händen schmerzverzerrt dem Publikum zuwenden<br />
Jemand muss etwas vom Büchergestell herunterholen<br />
- er rutscht aus, fällt herunter (höchstens ca. ein Meter)<br />
- akustische Untermalung erwünscht (Blumenvase oder „Klirrbleche")<br />
- Fußverstauchung = Nylonsocken vorher in die Socken des Darstellers am äußeren Knöchel<br />
stecken<br />
Sekundärzwischenfall zu den beiden oben beschriebenen Szenen:<br />
- eine Person fällt in Ohnmacht<br />
Stromausfall bei einer Veranstaltung<br />
- Plötzlich geht das Licht aus (es müssen aber noch Lichtquellen vorhanden sein, z.B.<br />
Kerzen, einzelne Wandlampe oder ähnlich)<br />
- die (eingeweihte) Kellnerin ruft nach dem Wirt oder ein (vorher eingeweihter) Samariter/<br />
Elektriker will den Schaden beheben<br />
- der „Sicherungskasten“ wird geöffnet, das Licht flackert einige Male:<br />
- Licht von außen oder effektiv im Kasten wieder ein- und ausschalten<br />
- Plötzlich ein Knall (Elektrozünder an Batterie zünden, in größeren Räumen evtl. zusätzlich<br />
etwas Blitzlichtpulver)<br />
- „Elektriker“ stürzt vom Stuhl, Werkzeug fällt herunter usw.<br />
- passende Verletzungen wahlweise<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 37/49 -
Der unterbrochene Patrouillenlauf<br />
- die Helfergruppe erhält den Auftrag, vom Posten A zum Posten B zu gehen (vorgeschrieben<br />
Route)<br />
- auf dem Weg dorthin kommt sie an einem „geeigneten“ Haus vorbei (alter Keller, Ruine,<br />
Werkgebäude, Neubau noch unvollendet)<br />
- im Gebäude wird mit Blitzlichtpulver eine „Explosion“ dargestellt, gleichzeitig hinter dem<br />
Gebäude ein Knallkörper gezündet (gute Koordination) und aus einem oder mehreren<br />
Fenstern Rauchpulver abgebrannt<br />
- ein Fensterladen fällt auf die Straße, Scheiben gehen in Brüche (Abfallglas oder „Klirrbleche“)<br />
- Verletzte stürzen aus der Haustüre ins Freie (entsprechend präpariert)<br />
- im Innern des Hauses entsprechende Explosionsrequisiten und weitere Verunglückte<br />
(Die Schiedsrichter dürfen sich zu Beginn nicht zeigen!)<br />
Die Betriebsbesichtigung<br />
- Helfergruppe bei einer Betriebsbesichtigung: Lärm aus Nachbarräumen von herunterstürzendem<br />
Material (Klirrbleche. Abfallglas, div. weiteres Material), laute Schreie<br />
- ungefähre vermutete Unfallplatzangabe durch den (eingeweihten) Firmenführer oder<br />
durch Personal (das ebenfalls eingeweiht ist)<br />
- Zusammengestürzte Lagerstelle mit einigen verunglückten Arbeitern<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 38/49 -
<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong><br />
Abschnitt 5: Sicherheits- und Rechtsfragen<br />
5.1 Allgemeines<br />
5.2 Der RUD-Leiter<br />
5.3 Haftung/Versicherung<br />
5.1 Allgemeines<br />
Um die Sicherheit der Mimen, Helferinnen und Helfer zu gewährleisten, ist es sicherlich ratsam, bei größeren<br />
Übungen eine geeignete und verantwortungsbewusste Person als Sicherheitsbeauftragte einzusetzen.<br />
Dieser hat für die Sicherheit aller Beteiligten Sorge zu tragen. Er hat u. a. darauf zu achten, dass<br />
Mimen nicht<br />
• von herabrutschenden oder einstürzenden Massen gefährdet werden<br />
• von Abhängen, wie z. B. Steinbrüchen/Sandgruben o. dergleichen herabstürzen können<br />
• durch Rauchentwicklung gesundheitliche Schäden davontragen<br />
• infolge Witterungseinflüsse (Regen/ Kälte) gesundheitlich gefährdet sind<br />
Größere Requisiten, wie z. B. Fahrzeuge müssen so gesichert werden, dass kein Personen- oder Sachschaden<br />
entstehen kann.<br />
Gefahrenstellen, wie z. B. abschüssiges Gelände, Abhänge oder dergleichen sind durch Absperrungen<br />
und Aufstellen von Warnschildern zu sichern.<br />
Durch das Einatmen von Dämpfen/Rauchpulver kommt es häufig zu einer akuten Atemnot und damit<br />
verbunden zu schweren Schädigungen der Atemorgane.<br />
Rauchpulver darf deshalb nur im Freien verwendet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass weder Mimen<br />
noch Helfende in die „Rauchzone" gelangen können (Windrichtung beachten).<br />
Durch das Einsetzen eines Sicherheitsbeauftragten wird der RUD-Leiter jedoch nicht von seiner Aufsichts-<br />
und Sorgepflicht der ihm anvertrauten Mimen entbunden.<br />
Sicherheit geht vor!<br />
Der Sicherheit für Darsteller, Retter und Zuschauer muss bei der RUD besonders große Beachtung geschenkt<br />
werden. Gefahrenquellen sind:<br />
o ungenügende persönliche Ausrüstung der Darsteller und Retter (Witterungsschutz, Arbeitskleider,<br />
Schuhwerk, Taschenlampen usw.)<br />
o unvorhergesehene Reaktionen der Retter auf die Unfallsituation (Sprung ins Wasser, um<br />
Hilfe zu leisten, gefahrvolle Klettertouren, um ins Haus zu gelangen, Eingriff in die Anlag-<br />
ge, die den Unfall verursacht hat usw.)<br />
o Sekundärgefahren bei der Rettung:<br />
Einsturz von Aufbauten oder Verstrebungen,<br />
Überfahren der Absicherung auf der Straße,<br />
Ausrutschen der Helfer mit Gefährdung des Verletzten<br />
Maßnahmen der Übungsleiter, um dieser Unfallgefahr zu begegnen, sind:<br />
o Übungsanlagen nur so groß wählen, dass sie in allen Einzelheiten und in jeder Phase<br />
durch Schiedsrichter überwacht werden können<br />
o für Einzelheiten bei der Planung und der Durchführung Fachleute einbeziehen (Elektriker,<br />
Bauflachleute, Polizisten, Rettungsspezialisten)<br />
o eingehende Orientierung der Mitwirkenden bezüglich Ausrüstung, Verhalten usw.<br />
o sehr gute Planung bezüglich Zeitablauf, Wetter, Material und Personal<br />
o peinlich genaue Instruktion der Schiedsrichter über ihre Aufgabe auch als „Sicherheitsbeauftragte“<br />
– Kompetenzen klar regeln -)<br />
Überwachung<br />
Es muss eine persönliche Überwachung der Sicherheitsaspekte durch den Übungsleiter bei kleinen<br />
Übungen erfolgen. Bei größeren Übungen ist dafür ein Fachmann/eine Fachfrau extra abzustellen.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 39/49 -
Die dargelegten Aspekte beziehen sich primär auf die Sicherheit von Personen, sie gelten aber sinngemäß<br />
auch für Materialschäden (Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verschmutzung). Es liegt in der<br />
Natur der Sache, dass dort, wo unter schwierigen Bedingungen RUD betrieben wird, ein erhöhtes Unfallrisiko<br />
besteht. Es gehört zur Pflicht des Übungsleiters, alles daran zu setzen, Gefahrenquellen möglichst<br />
auszuschalten.<br />
5.2 RUD-Leiter<br />
Dem Leiter einer RUD-Gruppe kommt eine besondere Verantwortung hinsichtlich der Aufsichtspflicht<br />
gegenüber seiner Gruppe zu.<br />
Die besondere Verantwortung ergibt sich dadurch, dass dem Gruppenleiter<br />
a) Personen unter 18 Jahren, also Jugendliche, oftmals auch Kinder anvertraut sind und<br />
b) bei RUD-Ausbildungen und Einsätzen häufig Gefährdungen für die anvertrauten Personen be-<br />
stehen. Daher sollen hier einige wichtige Rechtsfragen aufgezeichnet werden.<br />
Im § 1 des Jugendschutzgesetzes vom 23.Juli 2002 wird ausdrücklich zwischen erziehungsbeauftragten<br />
Personen und personensorgeberechtigten Personen unterschieden. So ist nach BGB Personensorgeberechtigte/r<br />
wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person die Personensorge zusteht (i. d. R. Eltern<br />
oder ggf. Vormund).<br />
Erziehungsbeauftragte/r ist eine Person über 18 Jahren, die aufgrund einer Vereinbarung mit den Personensorgeberechtigten<br />
Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder mit Zustimmung der Personensorgeberechtigten<br />
im Rahmen der Jugendhilfe betreut.<br />
Dieser Sachverhalt trifft auch auf RUD-Gruppenleiter zu und bedeutet, dass Gruppenleiter unter 18 Jahren<br />
keine Erziehungsbeauftragten sein können.<br />
Nach § 2 Jugendschutzgesetz sind Erziehungsbeauftragte auch verpflichtet, ihre Berechtigung auf Verlangen<br />
darzulegen. Dies muss nicht durch einen Ausweis geschehen, sondern kann durch Darlegen des<br />
Trägers und seiner Funktion als Gruppenleiter auf Verlangen geschehen.<br />
Ein Gruppenleiter ist also als Erziehungsbeauftragter den ihm anvertrauten Kindern und Jugendlichen<br />
gegenüber im Rahmen des Jugendschutzgesetzes weisungsbefugt. Daher sind Kenntnisse über die<br />
wichtigsten Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes für einen Gruppenleiter unerlässlich.<br />
Im Wesentlichen bedeutet dies jedoch, dass der Gruppenleiter dafür zu sorgen hat, dass die ihm Anvertrauten<br />
keiner sittlichen, körperlichen oder gesundheitlichen Gefährdung ausgesetzt sein dürfen bzw.<br />
bereits bei der Planung von Ausbildungen und Übungen ausgeschlossen werden. Die Aufsichtspflicht<br />
beginnt mit der Übernahme der Anvertrauten an der Unterkunft o. ä. und endet zur vorgesehenen, den<br />
Eltern bekannten Zeit, am vorgesehenen, den Eltern ebenfalls bekannten Ort.<br />
Ein früheres Entlassen der Anvertrauten ist nicht zulässig, genauso wenig das Ausschließen von Gruppenmitgliedern<br />
aus der Gruppe bei auftretenden Differenzen.<br />
Ein Gruppenmitglied kann grundsätzlich nicht abgehalten werden, die Gruppe zu verlassen, schon gar<br />
nicht mit Gewaltanwendung. Jedoch ist eine eingehende Belehrung unter Zeugen erforderlich. Ggf. sind<br />
die Eltern zu benachrichtigen.<br />
Der Gruppenleiter muss aber auch wissen, dass er für Schäden, die die ihm anvertrauten Personen anrichten,<br />
immer dann haften muss, wenn er seiner Aufsichtspflicht nicht gerecht wird, bzw. diese Pflicht<br />
verletzt hat.<br />
Nur wenn der Schaden auch durch ordnungsgemäße Aufsicht nicht hätte verhindert werden können, ist<br />
ein Ausschluss von der Haftung gegeben.<br />
Hierzu ist der § 832 BGB (Haftung des Aufsichtspflichtigen) von Bedeutung.<br />
(1) Wer Kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen ihres<br />
geistigen oder körperlichen Zustandes der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des Schadens<br />
verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein,<br />
wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt, oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung<br />
entstanden sein würde.<br />
(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht durch Vertrag<br />
übernimmt."<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 40/49 -
5.3 Haftung / Versicherung<br />
Alle Landesverbände haben für ihre aktiven Mitglieder Versicherungen abgeschlossen und zwar<br />
a) Unfallversicherungen die Schäden bis zu einer bestimmten Höhe, weiche durch Unfall auf dem<br />
Weg zum und vom Dienst eintreten und solche, die im Dienst passieren, gedeckt.<br />
b) Haftpflichtversicherungen, die die im Dienst von RK-Mitgliedern verursachten Schäden gegen<br />
über Dritten decken.<br />
Die Versicherungen gelten i. d. R. auch für vorübergehend beim DRK tätige Mitarbeiter, also auch für<br />
Schüler o. ä., die in Übungen ggf. eingesetzt werden. Ist dies jedoch nicht der Fall, muss eine gesonderte<br />
Versicherung abgeschlossen werden.<br />
Es ist allerdings zu beachten, dass grob fahrlässig oder gar vorsätzlich herbeigeführte Schäden i. d. R.<br />
von der Haftung ausgeschlossen sind und das DRK in solchen Fällen Regressansprüche (Rückforderung<br />
der Versicherungsleistung) an den Verursacher richten kann.<br />
Bei allen Schadensereignissen ist die Versicherung umgehend, i. d. R. über den DRK-Kreisverband, zu<br />
benachrichtigen. Entsprechende Formulare sind beim Kreisverband vorhanden.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 41/49 -
Die <strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong><br />
Abschnitt 6: Planung von Übungen<br />
6.1 Planung von Übungen<br />
6.2 Aufbau des Schadensgebietes<br />
6.3 RUD-Einsatzplan<br />
6.1 Planung von Übungen<br />
Ziel von Übungen und Ausbildungsveranstaltungen mit RUD Beteiligung ist es, die Helferinnen und Helfer<br />
so realitätsnah wie möglich mit Unfallsituationen und den damit verbundenen physischen und psychischen<br />
Belastungen vertraut zu machen, damit sie im Ernstfall ihren Aufgaben gewachsen sind.<br />
Daher wird vor allem das Fachwissen der Einsatzkräfte situationsbezogen überprüft und vertieft sowie<br />
die Zusammenarbeit mehrerer Einsatzkräfte ggf. unterschiedlicher Aufgabenbereiche geübt.<br />
Die RUD spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn vom Aufbau der Situation und der richtigen Darstellung<br />
von Verletzungen wird es u. a. abhängen, ob die Übung die Einsatzkräfte zu einem Lernerfolg<br />
führt und damit motivierende Wirkung hat oder nicht bzw. für die Übungsleitung der tatsächliche Ausbildungsstand<br />
und die Einsatzfähigkeit der Helferlinnen ersichtlich wird.<br />
Wegen der großen, der RUD zukommenden Verantwortung ist eine detaillierte Planung durch den<br />
RUD-Leiter notwendig. Diese Planung gliedert sich in zwei Schritte:<br />
1. die allgemeine Einsatzvorplanung<br />
2. die Erstellung von RUD-Einsatzplänen<br />
zu 1. Die allgemeine Einsatzvorausplanung<br />
In der Planungsphase, vor allem von Übungen, wo mit einem größeren RUD-Einsatz zu rechnen<br />
ist, hat sich der RUD-Leiter die für seinen Einsatz erforderlichen Informationen zu beschaffen,<br />
bzw. sind diese dem RUD-Leiter zugänglich zu machen.<br />
Der RUD-Leiter sammelt alle für ihn wichtigen Informationen und trägt sie in seinen Planungsbogen<br />
ein. Nachfolgend aufgeführte Informationen sind zu beschaffen:<br />
o Wer ist Veranstalter der Übung bzw. Ausbildung und wie ist diese Veranstaltung betitelt?<br />
o Wer hat die Übungsleitung bzw. wer ist der Ansprechpartner für den RUD-Leiter?<br />
o Wer ist verantwortlicher RUD-Leiter? Dieses ist der Übungsleitung mitzuteilen<br />
o Wer trägt die Kosten des RUD-Einsatzes?<br />
o Wie hoch werden voraussichtlich die Kosten sein?<br />
o Wie soll abgerechnet werden?<br />
o Ist ein Kostenlimit festgesetzt?<br />
o Welche Übungsziele bzw. Ausbildungsziele werden verfolgt? Diese Frage ist besonders<br />
für die Gestaltung der Situation und die Auswahl der Verletzungen von Bedeutung.<br />
o Welches Schadensereignis soll dargestellt werden?<br />
� Wie ist die Schadenslage entstanden?<br />
� Wie entwickelt sich die Schadenslage im Verlauf der Übung?<br />
o Wo soll die Übung stattfinden?<br />
o Wann soll die Übung stattfinden?<br />
o Sind alle notwendigen Absprachen mit Haus- und Grundstückseigentümer bzw. beteiligten<br />
Institutionen, Firmen und Behörden getroffen worden, oder muss dies noch geschehen?<br />
o Wurden bestimmte Auflagen gemacht?<br />
o Wenn ja, welche?<br />
o Welches Material bzw. welche Requisiten werden zur Situationsdarstellung benötigt?<br />
o Welche Requisiten sind vorhanden?<br />
o Welche Requisiten sind von der Übungsleitung zu beschaffen, welche durch die<br />
RUD-Gruppe?<br />
o Wer baut die Situation auf, vor allem bei großen Requisiten und durch wen werden sie<br />
ggf. gesichert?<br />
o Wie viel Mimen sollen eingesetzt werden?<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 42/49 -
o Wird ein bestimmtes Alter der Mimen verlangt und ist ein bestimmter, von den darzustellenden<br />
Verletzungen abhängiger Ausbildungsstand der Mimen erforderlich?<br />
o Welche Verletzungen sollen geschminkt und dargestellt werden?<br />
o Passen die Verletzungen zur Situation?<br />
o Wo werden die Mimen geschminkt?<br />
o Es ist zu prüfen, ob die angebotenen Räume zum Schminken geeignet sind.<br />
o Wann und durch wen erfolgt die Verpflegung der Mimen oder muss sich die RUD-<br />
Gruppe selbst verpflegen?<br />
o Wie gelangen die Mimen zum Einsatzort und wieder zurück (Abschminken)?<br />
o Wenn die Mimen nach dem Schminken transportiert werden müssen, ggf. die Verletzung<br />
vorschminken und erst am Einsatzort fertig schminken<br />
o Es muss an die Bedeckung der Polster im Transportfahrzeug z. B. mit Plastikplane gedacht<br />
werden.<br />
o Welche Wetterbedingungen sind zu erwarten?<br />
o Entsprechende Bekleidung der Mimen ist vorzusehen.<br />
o Bei kühlem Wetter/Boden sind Unterlagen für die Mimen vorzusehen.<br />
o Bei kaltem Wetter dürfen die Mimen nicht zu lange im Freien liegen, es müssen Fahrzeuge<br />
(Bus) oder Gebäude vorhanden sein, in denen sich die Mimen bis zum Einsatz<br />
aufhalten können.<br />
o Bestehen für die Mimen besondere Gefährdungen und wie sind sie zu beseitigen?<br />
o Sicherheitsbestimmungen: Werden ausreichend Sicherheitsbeauftragte, Leitungsgehilfen<br />
und Schiedsrichter eingesetzt?<br />
o Wann ist der Mimeneinsatz beendet, wohin werden die Mimen im Verlauf der Übung gebracht?<br />
o Wo wird abgeschminkt?<br />
zu 2. Die Erstellung von RUD-Einsatzplänen<br />
Nachdem in der Planungsphase alle wichtigen Sachverhalte ermittelt und festgelegt sind,<br />
kann die detaillierte Einsatzplanung vom RUD-Leiter vorgenommen werden.<br />
Dies geschieht mit Hilfe des Planungsbogen RUD-Einsatzplan für jeweils kleine überschaubare<br />
Übungsabschnitte. Dabei wird im RUD-Einsatzplan noch folgendes im Einzelnen aufgeführt:<br />
o Jeder Plan erhält eine fortlaufende Nummer<br />
o Veranstaltungstitel, Datum, Übungsleiter und RUD-Leiter werden eingetragen<br />
- Die Übungslage<br />
- Art des Unfalls<br />
- Zustandekommen des Unfalls<br />
- Nachträgliche Entwicklung des Schadensgeschehens<br />
- Wo und wann treffen sich die Mimen<br />
- Schminkort und Schminkbeginn<br />
- Verletzungen, Mimen, Schminker (namentlich)<br />
- Besondere Schminkmaterialien sind vorhanden oder noch zu beschaffen?<br />
- Verpflegung der Mimen, wann und wo<br />
- Wie erfolgt der Transport zum Einsatzgebiet<br />
- Rücktransport der Mimen<br />
6.2 Aufbau des Schadensgebietes<br />
Zunächst wird eine Auflistung der benötigten Requisiten vorgenommen. Größere Requisiten sollten<br />
nummeriert werden, damit sie in der Lageskizze überschaubar eingezeichnet werden können. Danach ist<br />
zu klären, wer die Requisiten beschafft, wer sie aufbaut und ggf. für die Sicherung bzw. Absicherung<br />
verantwortlich ist.<br />
Welches Material und welche Requisiten zum Situationsaufbau benötigt werden, ist aus der Lagebeschreibung,<br />
also der Unfallsituation abzuleiten.<br />
Es ist von Vorteil, wenn man zur Situation passende Unfallbilder, oder aus vorherigen Übungen vorhandene<br />
Zeichnungen oder Bilder zur Verfügung hat und danach den Situationsaufbau vornehmen kann.<br />
Auf jeden Fall wird die Situationsgestaltung vorher in Skizzen festgelegt.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 43/49 -
Lageskizze<br />
Zu jedem Situationsabschnitt ist eine detaillierte Lageskizze zu erstellen, worin alle beim Aufbau<br />
einer Unfallsituation notwendigen Details ggf. farbig eingezeichnet werden.<br />
Die Verletzten und größeren Requisiten werden nummeriert in die Lageskizze eingezeichnet.<br />
- Nummer der Lageskizze<br />
- Umfang, Begrenzung und Aussehen des Schadensgebietes<br />
- Standort und Bau der Requisiten<br />
- Lage und Nummer der Verletzten<br />
- Gebäude, Ein- und Ausgänge und die Stockwerke<br />
- Zu- und Abfahrtswege<br />
- Gefahrenstellen werden mit einem Zeichen besonders kenntlich gemacht.<br />
Nunmehr ist alles aus dem RUD-Einsatzplan zu ersehen. Es empfiehlt sich, wenn dies möglich ist, einzelne<br />
Situationen vorab schon einmal zu üben, damit am Einsatztag ein reibungsloser Ablauf sichergestellt<br />
ist und nach der Lageskizze ohne Probleme gearbeitet werden kann. Besondere Bedeutung gewinnt<br />
eine solche Skizze bei Wettbewerben und Treffen, wenn eine gleiche Situation mehrmals aufgebaut<br />
werden muss. So kann für die Einsatzkräfte immer die gleiche Ausgangslage geschaffen werden.<br />
Bei Übungen kann mit Hilfe der Lageskizze u. U. auch der Verlauf der Hilfeleistung verfolgt und leichter<br />
beurteilt werden. Wird vom RUD-Leiter eine eigene Übung geplant, so ist in Eigenverantwortung immer<br />
in der beschriebenen Weise vorzugehen.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 44/49 -
<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong> Deutsches Rotes Kreuz<br />
RUD - Einsatzplan<br />
Art der Veranstaltung<br />
Übungsleitung Datum<br />
RUD- Leiter Übungsbeginn<br />
Übungsort<br />
Treffpunkt der Mimen Uhrzeit<br />
Schminkort Schminkbeginn<br />
Übungslage<br />
Verletzungen Mimen Schminker<br />
Transport der Mimen<br />
zum Einsatzort<br />
Uhrzeit<br />
zurück zum Abschminken Uhrzeit<br />
Prüfung der richtigen Darstellung durch<br />
Verpflegung Ort Uhrzeit<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 45/49 -
<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong> Deutsches Rotes Kreuz<br />
Requisiten<br />
Skizze<br />
Material vorhanden zu beschaffen<br />
durch<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 46/49 -
<strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong><br />
Abschnitt 7: Materialien und weitere Ergänzungen<br />
7.1 Musterhafte Befüllung eines RUD-Koffers<br />
7.2 Materialrezepte<br />
7.3 Verzeichnis über alle Materialien und Gerätschaften<br />
7.4 Firmen, die RUD-Materialien vertreiben<br />
7.1 Musterhafte Befüllung eines RUD-Koffers<br />
(nach Schminkkoffer „BAVARIA 91“ - nicht mehr bestellbar<br />
Inhaltsverzeichnis:<br />
1 Color-Spray schwarz<br />
1 Color-Spray rot<br />
4 Schwämmchen<br />
2 Modellierkitt<br />
2 Flaschen Blut 200 ml<br />
1 Dose Sand<br />
1 Spatel weiß<br />
1 Rolle Leukosilk<br />
1 Schere, rostfrei<br />
1 Tube Farbentferner<br />
1 Beutel "Nägel u. Fingernägel"<br />
1 Beutel Glassplitter<br />
2 Knochenstücke<br />
2 Modellierspatel<br />
1 Blut-Pumpsystem für Schlagader-Verletzung<br />
4 Tuben Make-up-Paste sortiert, zur Hauttönung<br />
1 Tube Schockpaste<br />
2 Tuben Blutpaste<br />
1 Tube UHU<br />
1 Pack Papierhandtücher<br />
1 kleine Seife<br />
1 Dose Abschminke<br />
2 Dosen Vaseline<br />
3 leere Dosen für diverses Material<br />
1 Dose mit Wattebällchen<br />
2 Dosen Puder<br />
Farbpasten:<br />
2 Dosen weiß<br />
2 Dosen rot<br />
1 Dose blau<br />
2 Dosen dunkelrot<br />
2 Dosen schwarz<br />
1 Begleitheft RUD<br />
1 Notizblock<br />
1 Kugelschreiber<br />
1 Inhaltsverzeichnis<br />
1 Anleitung für das Nummernschloss des Koffers<br />
1 Arbeitsmappe für die <strong>Realistische</strong> <strong>Unfalldarstellung</strong><br />
Weitere Tipps unter: http://www.jrk.brk.de/html/rud/ausstattung.html<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 47/49 -
7.2 Materialrezepte<br />
Für alle jene, die ihr Material selbst herstellen wollen, gelten die nachfolgenden Verarbeitungshinweise:<br />
a) Modellier - Kitt (hautfarbig)<br />
Man erhält 2 kg Kitt-Masse aus:<br />
Plastillin weiß 1500 g<br />
Plastillin rosa 250 g<br />
Plastillin terracotta 150 g<br />
Vaseline - gelb 100 g<br />
Trockenfarbe Ultramarinblau ca. 4 g<br />
Vaseline wird bei ca. 80° C in einer Schmelzpfanne verflüssigt, dann wird langsam Plastillin in<br />
kleinen Stücken dazugegeben. Temperatur auf 105° C erhöhen und das Ultramarinblau einrühren.<br />
Temperatur vermindern und rühren, bis keine Blasen mehr aufsteigen.<br />
Masse erkalten lassen und in Stücke ausformen.<br />
b) Make up - Paste (hautfarbig)<br />
Plaka-Casein-Farben oder Casein-Tempera-Farben der Grundtöne weiß, gelb, ocker werden in<br />
unterschiedlichen Teilmengen gemischt, bis die gewünschte hautähnliche Farbe entsteht.<br />
Danach werden 60 g ATRIX-Hautcreme im Wasserbad bei ca. 80° C verflüssigt.<br />
In die verflüssigte Atrix werden 35 g der vorher gemischten Farbmasse heiß eingerührt und die<br />
gut gerührte heiße Masse in kleine Dosen gegossen.<br />
c) Schock - Paste (fahlgelb)<br />
Plaka-Casein-Farben oder Casein-Temperara-Farben der Grundtöne weiß, gelb, ocker werden in<br />
Unterschiedlichen Teilmengen gemischt, bis der gewünschte fahlgelbe Schock-Ton entsteht<br />
(wenig Schwarz untermischen).<br />
Weitere Verarbeitung wie bei der Make-up-Paste.<br />
d) Vaseline – Farbpasten<br />
e) Blut<br />
Die reinen Farbtöne heilrot, dunkelrot, schwarz, weiß und blau werden folgendermaßen hergestellt:.<br />
Man füllt ein Gefäß zur Hälfte mit gelber Vaseline, gibt das gewünschte Farbpulver hinzu<br />
und spachtelt gründlich durch. Größere Mengen lassen sich besser verarbeiten durch Einrühren in<br />
warmverflüssigte Vaseline. Das Mischungsverhältnis der Farben ist aus der Fibel über <strong>Realistische</strong><br />
<strong>Unfalldarstellung</strong> – neue Auflage -zu ersehen.<br />
Gleichermaßen sind in der Fibel zwei bereits bewährte Rezepte zur Herstellung von Schminkblut<br />
beschrieben, von denen das eine auf Öl-Basis, das andere auf Wasser-Basis beruht. Durch Verwendung<br />
besonderer Farbstoffe konnte eigens für den Schminkkasten „Mehlem“ eine Blutflüssigkeit<br />
entwickelt werden, die keinen Bodensatz bildet und besonders lagerfähig ist.<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 48/49 -
7.3 Verzeichnis, der in der <strong>Realistische</strong>n <strong>Unfalldarstellung</strong> verwendeten Materialien, Werkzeuge,<br />
Requisiten und Hilfsmittel:<br />
1. Inhalt des Schminkkastens „Mehlem“:<br />
2 Dosen mit Vaseline<br />
2 Dosen mit Puder<br />
3 leere Dosen für diverses Material:<br />
z.B. Fremdkörper, Sand, Asche usw.<br />
2 Spatel (Kunststoff)<br />
2 Modellierhölzer<br />
1 Schere, rostfrei, 13 cm<br />
1 Tube UHU<br />
1 Tube Blutpaste<br />
2 Flaschen „Flüssiges Blut“ a 200 ml<br />
1 Beutel mit Nägel und Fingernägel<br />
1 Beutel mit 5 „Glas-Splittern"<br />
1 Tube Farbentferner<br />
2. Zusätzliches Material:<br />
1 Beutel mit Blechsplitter und Plexiglassplitter<br />
1 Beutel mit Knochenstücken und Holzsplittern<br />
1 Dose weißer Kunstholzleim (wasserlöslich)<br />
1 Dose Sand, Erde, Straßenstaub<br />
(evtl. Sägemehl)<br />
Bindfaden, Schnur, Wollgarn etc.<br />
1 Dose Handwaschpaste<br />
1 Dose Puder (hautfarbig)<br />
1 Dose Gips<br />
1 Flasche Glycerin Wasserlösung (4:1)<br />
Schweizer Watte-Binden, Fließ-Tücher,<br />
3. zusätzliches Material:<br />
Sicherheitsnadeln<br />
1 Gipsbecher mit Gipslöffel<br />
1 Farbspachtel<br />
1 spitze Nagelschere<br />
Lappen zum Abschminken<br />
Handtuch oder Papierhandtücher<br />
Pumpsystem für Spritzblutungen<br />
4. Requisiten und Hilfsmittel:<br />
Pkw-Teile zum Ausiegen:<br />
Radkappe-Spiegel-Blinkerglas<br />
Scheinwerfer-Nummernschild-Ersatz<br />
Auspuffrohr-Zierleisten<br />
Wagenheber-Holzklotz zum Pkw-Aufbocken<br />
1 alte Sekuritscheibe zum Zerschlagen und<br />
Auflegen auf Frontscheibe<br />
Feuerlöscher<br />
1 altes Fahrrad<br />
1 roter Fahrradschlauch<br />
Schwarze Farbe für „Bremsspuren“<br />
1 Arbeitsmantel<br />
2 x 200 g Modellierkitt<br />
4 Tuben Make-up-Paste, sortiert z. Hautönung<br />
4 Schwämmchen<br />
1 Wattebällchen<br />
1 Rolle Leukosilk 5 m x 1 cm<br />
2 Tuben Schockpaste<br />
Farbpasten<br />
2 Dosen weiß<br />
2 Dosen hellrot<br />
2 Dosen blau<br />
2 Dosen dunkelrot<br />
2 Dosen schwarz<br />
Trockenfarben-Reserve zur<br />
Herstellung der Vaseline-Pasten<br />
1 Flasche Wasser<br />
1 Flasche Benzin (zum Ansengen)<br />
einige halbierte Eierschalen<br />
1 Päckchen Brausepulver<br />
1 Schminkstift-violett<br />
l Fläschchen Collodium<br />
Schweizer Watte-Binden, Fließ-Tücher,<br />
(oder Tempo-Tücher)<br />
1 Zerstäuber-Flasche<br />
1 kleine Holzraspel<br />
1 schmales Küchenmesser<br />
1 Rasierklinge<br />
1 kleiner Wassertopf<br />
1 Blechschere (Gipsschere)<br />
Hammer, Zange, Nägel, Säge etc.<br />
1 Wolldecke<br />
einige alte Hemden, Hosen, Jacken<br />
einige alte Mützen oder Hüte<br />
2 linke Schuhe<br />
Polsterwatte<br />
Zeitungspapier<br />
Zündhölzer<br />
Rauchpulver (weiß)<br />
Blech-Unterlage für Rauchpulver<br />
Karbid (für schwarzen Rauch)<br />
(nur im Freien verwenden!)<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 49/49 -
7.4 Firmen, die RUD-Materialien vertreiben<br />
Die in dieser Arbeitshilfe benannten Materialien können bei den hier genannten Firmen bestellt werden.<br />
Die benannten Schminkkästen ´Mehlem` und ´Bavaria 91` können so nicht mehr geordert werden.<br />
Leichner Kosmetik GmbH<br />
Gartenstraße 12<br />
89179 Beimerstetten<br />
Kryolan GmbH<br />
Papierstraße 10<br />
13409 Berlin<br />
Firma Quaste<br />
Andrea Wackershauser<br />
Auf der Halle 10<br />
75045 Walzbachtal<br />
DRK-Service GmbH<br />
Linzer Str. 21<br />
53604 Bad Honnef<br />
Tel.: 07348 20191-0<br />
Fax: 07348 20191-20<br />
Email: info@polyco.com<br />
www.Leichner-Kosmetik.de<br />
Tel.: 030 499 892 - 0<br />
Fax: 030 491 49 94<br />
www.kryolan.de<br />
Tel.: 07203 922378<br />
Fax: 07203 922379<br />
E-Mail: info@quaste.com<br />
www.quaste.de<br />
Tel.: 030 - 479004-0<br />
Fax: 030 - 479004-25<br />
E-Mail: info@drkservice.de<br />
www.drkservice.de<br />
www.rotkreuzshop.de<br />
7.5 Literaturhinweise und Quellennachweise<br />
Handbuch für die „<strong>Realistische</strong> Unfall-Darstellung“, Deutsches Rotes Kreuz, Generalsekretariat Berlin,<br />
Berlin 1996<br />
Handbuch "<strong>Realistische</strong> Wund- und <strong>Unfalldarstellung</strong>", Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen der<br />
DDR, Berlin 1988<br />
Grimas / Haarlem, Make-up voor professional en hobby, Grimas 1992<br />
Dr.med. Hanns Ger lach; Dr.med. Walter Stoeckel, <strong>Realistische</strong> Unfall-Darstellung, DRK Bonn 1976,<br />
9.Auflage<br />
Walter Kaiser, Die realistische <strong>Unfalldarstellung</strong>, Eine Anleitung für die DRK-Lehrkräfte, DRK in der DDR<br />
Kryolan Theather-Schminkfibel, Kryolan GmbH Berlin 1990, 4.Auflage<br />
Ingeborg Becker, Verzauberte Gesichter, Schminken für Kinderfeste + Spiele, Brunnen-Reihe Kinder-<br />
Programm 223, Christophorus-Verlag Freiburg<br />
Bild-Kurs-Buch, Schminktechniken: Grundanleitung zum Schminken in Theater, beim Ballet und im Karneval<br />
- für Kinder und Erwachsene, XENOS-Verlagsgesellschaft mbH<br />
Hrsg. Kurt Roth, Klaus E.R.Lindemann, Hobbythek, Jean Pütz, Christine Niklas: Schminken, pflegen,<br />
schönes Haar, Sanfte Kosmetik und Sonnenkosmetik, ISBN: 3-8025-6177-5<br />
RUD-Arbeitsunterlagen der DRK-Landesverbände Nordrhein, Westfalen-Lippe und Baden Württemberg<br />
RUD-Arbeitshilfe<br />
Jugendrotkreuz im DRK-LV Sachsen-Anhalt e.V.<br />
- 50/49 -