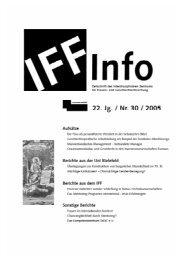IFF-Info Nr. 27, 2004 - IFFOnzeit
IFF-Info Nr. 27, 2004 - IFFOnzeit
IFF-Info Nr. 27, 2004 - IFFOnzeit
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Organisation und mit den ihr eigenenMitteln abbaubar ist (Gleichstellungsprogramme,Qualifizierungsmaßnahmenetc.).Die zweite Position betont vor allemdie Parallelität zwischen gesellschaftlichenStrukturen und Organisationsmustern.Organisationen geltenin ihren Grundvoraussetzungenund Strukturen als von Männern geprägtund dominiert, mit entsprechendenAusschlussmechanismenund informellen Steuerungsinstrumenten,um Frauen in untergeordnetenPositionen zu halten. Organisationerscheint damit als Fortsetzunggesellschaftlicher Strukturenund wird im Zusammenhang mitProduktions- und Reproduktionsverhältnissengesehen. 13In der dritten Position erscheintOrganisation weder als dem Geschlechtgegenüber neutral, nochtritt Geschlecht als allgegenwärtigesStrukturmerkmal auf, sondern vielmehrwird Organisation als Prozesshandelnder Akteurinnen und Akteuresichtbar gemacht, auch in ihrerAmbivalenz und Widersprüchlichkeit.Geschlecht (gender) erscheintdamit als sozial konstruiert und konstruierend,nicht definitorisch gekoppeltan Biologie (sex) und auchnicht automatisch verknüpft mitGeschlechterkategorien (sex category)(West/Zimmermann 1987). Organisationenwerden definiert als Prozesshandelnder AkteurInnen, denenweitgehende Autonomie über ihrHandeln zugemessen wird. Der Zusammenhangzwischen Geschlechtund Organisation erscheint als doinggender while doing organization. 14Geschlecht kommunizierenGeschlechtersprachforschung:Dominanz, Differenz, DekonstruktionAn ähnlichen Theorielinien entlangentwickelte sich die Geschlechtersprachforschung.Dabei prägte inden siebziger Jahren die „Dominanz-Hypothese“den Diskurs. ImAnschluss an Sprachregelungen, diestrenge Trennungen zwischen Männernund Frauen kennen, wie siebeispielsweise in einigen afrikanischenSprachen vorzufinden sind,widmete frau sich der Frage, obauch in westlichen IndustrieländernStile und Sprechweisen von Frauenund Männern unterschieden werdenkönnen. Die traditionelle Soziolinguistikhatte Hinweise darauf geliefert,dass es Präferenzen für bestimmtesprachliche Eigenarten in Abhängigkeitvon Klasse und Geschlechtgab. Sprachsoziologischschlossen sich Studien an, die aufdie unterschiedliche Wertigkeit derBeiträge von Männern bzw. Frauenhinwiesen (Senta Trömel-Plötz:„Gewalt durch Sprache“). Der weiblicheSprechstil wurde als demmännlichen unterlegen betrachtet,die männliche Sprechweise als dominierendhervorgehoben.Der „Dominanz-Hypothese“schloss sich die Phase der Differenz-Gedankenan, es wurden diekommunikativen Vorteile betont,die die Besonderheiten des „weiblichen“Sprechstils haben könnten,also etwa der „kooperative“ im Vergleichzum „kompetitiven“ Stil. DieVerständigung zwischen Männernund Frauen erscheint aus dieser Perspektiveschwierig bis unmöglich(Deborah Tannen: „Du kannstmich einfach nicht verstehen“) - eineSichtweise, die derzeit in zweifelhafterRatgeberliteratur fröhlicheUrständ’ feiert.Eine stärker an traditionellenWissenschaftskulturen ausgerichteteFrauenforschung, wie sie in denneunziger Jahren entstand, nahmeine Abkehr von der Annahmezweier geschlechtsspezifischerSprachstile vor. In genaueren Untersuchungenhatte sich die Grundhypotheseder nachweisbaren Verschiedenheitvon Frauen- und Männerspracheals unhaltbar erwiesen.Das Interesse verlagerte sich nunzunehmend auf den Kontext vonKommunikation, wobei weniger dasgesellschaftlich von vornherein„Gegebene“ beleuchtet wurde.Geschlechtsidentität wurde nun alsErgebnis von Kommunikation betrachtet.Damit ist die „Wort“-Ebenein den Analysen verlassen wordenzugunsten der Analyse von Sequenzen,komplexeren sprachlichenGebilden. Im Zuge dieser Verlagerungdes Interessenfokus gerietenauch Männer und Männlichkeit stärkerins Blickfeld der Untersuchungen.Im Deutschen bürgerte sichder Begriff „Gender“ ein (vgl. zusammenfassendBaron 2001).Poststrukturalistische feministischeOrganisationstheorieWährend die frühe feministischeOrganisationstheorie Körper undSexualität primär unter dem Aspektder Gewalt betrachtete, suchen feministischepoststrukturalistischenAnsätze nach umfassenderen Antwortenauf die Frage, wie Körperund Sexualität ihren Ausdruck findenin den Bildern und Realitätenvon Organisationshandeln. Leonard(2002) skizziert eine solche Herangehensweiseauf der Ebene der Metaphernfeministischer Organisationstheorie,die sie im historischenKontext darstellt.Das Projekt der Moderne: Metaphernvon OrganisationSie beschreibt das Projekt der Moderneals Neuordnung von Raum,Zeit und Sexualität. Diese wird vomEntstehen neuer Metaphern begleitetund vorangetrieben. Der Kolonialismusfußte auf einer neuen Raumordnung,die die natürliche Umweltin Form von Landkarten abbildeteund einen visuellen, abstrakten Zugangzur Umgebung favorisierte.Für die Ordnung der Geschlechter<strong>Info</strong> 21.Jg. <strong>Nr</strong>.<strong>27</strong>/<strong>2004</strong>21