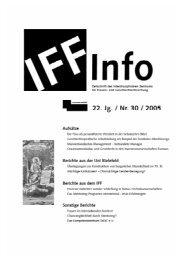IFF-Info Nr. 27, 2004 - IFFOnzeit
IFF-Info Nr. 27, 2004 - IFFOnzeit
IFF-Info Nr. 27, 2004 - IFFOnzeit
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kerstin Petersente dazu, dass der Ansatz der Betroffenheitoder Solidarität in eine „bewussteParteilichkeit“ (vgl. Tatschmurat1996) überführt worden ist.Der Ansatz der „bewussten Parteilichkeit“meint, dass sich eine Frauemphatischer als ein Mann in die Situationeiner anderen Frau hineinversetzenkann, die in einer Gewaltsituationwar oder ist. Auch wenndie Beraterin in einer anderen, z.B.finanziellen Situation als die Ratsuchendeist (und sich so ein anderesHilfssystem aufbauen kann), sokann sie als Frau die Gewaltsituationdoch eher nachvollziehen, da in dieserGesellschaft immer noch potenziellalle Frauen von Gewalt bedrohtsind. Eine parteiliche Haltung wurdeweiterhin als unumgänglich begriffen,da vom Prinzip her die Differenzenunter Frauen nicht der geteiltengesellschaftlichen Machtlosigkeitund dem Ausgeliefertsein anGewaltverhältnisse von Frauen insgesamtüberwiegen (vgl. Tatschmurat1996). „Die `Betroffenheit´ lässtsich dann überführen in eine bewussteParteilichkeit, (Hervorhebungim Original) (...). Aus diesergemeinsamen Betroffenheit, der imPrinzip geteilten Machtlosigkeit unddem Ausgeliefertsein an Gewaltverhältnisse(wenn auch aus hierarchischunterschiedlichen gesellschaftlichenPositionen heraus),aber auch aus dem unterschiedlichgroßen Aktionsradius der je konkretenFrau und der verfügbaren Ressourcenresultiert Parteilichkeit auchin der feministischen Sozialen Arbeit.“(Tatschmurat 1996, S. 13)Einen weiteren Einfluss auf dieDiskussion hatten die Thesen überdie Dominanzkultur von BirgitRommelspacher (1995) und die vonChristina Trümmer-Rohr (1989)initiierte Debatte über Mittäterschaftder Frau im Patriarchat.Durch deren Thesen wurde deutlich,dass eine gesellschaftliche Einbindungund Mitverantwortung derFrauen an den existierenden Lebensverhältnissenbesteht, ohne dabeidie gesellschaftliche Vormachtstellungdes Mannes oder die realeGewaltausübung von Männern zuleugnen. Um die Gewalttätigkeitenvon Frauen nicht ausblenden odertabuisieren zu müssen, hilft eineSicht auf die Eingebundenheit vonFrauen in patriarchale Logik undAktion (vgl. Kavermann 1997).3.2.1. Die feministische parteilicheHaltung der PädagoginAls professionelle Haltung ist Parteilichkeiteine politische, d.h. patriarchatskritischeund auf gesellschaftlicheVeränderung angelegtePerspektive. Die Umsetzung derHaltung geschieht in der direktenArbeit mit dem Klientel. Dabei wirddie Geschlechterhierarchie als zentraleKategorie von Frauenunterdrückungbenannt, die es u.a. mitden Mitteln der professionellen Sozialarbeitabzubauen gilt. Ziel parteilicherFrauen- und Mädchenarbeitist die Selbstbestimmung undAutonomie der einzelnen Frau oderdes Mädchens bei gleichzeitigempolitischem Engagement für das gesellschaftlicheZiel der Chancengleichheit.Eine wichtige Anforderungan die parteiliche Haltung derPädagogin ist, dass sie bei professionellerHilfestellung keine Lösungenvorgibt. Des Weiteren ist einwichtiger Bestandteil dieser parteilichenHaltung, Widersprüche imweiblichen Lebenszusammenhangaufzudecken, die sie als Beraterinnicht auflösen kann, zu thematisierenund auch auszuhalten. Diesesbesagt auch, dass Frauen und Mädchenvon der Pädagogin weder idealisiertnoch als bedürftige Opfer gesehenwerden sollen (vgl. Hartwig/Weber 2000). Von Anfang an hat diefeministische Theorie darauf hingewiesen,dass Parteilichkeit auf keinenFall eine völlige Identifikationz.B. zwischen Beraterin und Projektnutzerinbedeutet. Die Identifikationkann sicher immer nur eineTeilidentifikation sein, d. h., sich aufdas Erkennen von Gemeinsamkeitenund Trennendem beziehen (vgl.Mies 1984). Sollte dieses nicht geschehen,läuft professionelle Hilfeauf der einen Seite Gefahr, Mädchenund Frauen auf ihre Geschlechtszugehörigkeitzu reduzierenund sie in ihrer Individualität mitihren biografischen, kulturellen, sozialenetc. Erfahrungen nicht ernstzu nehmen. Auf der anderen Seitedroht seitens der Beraterin die Beschränkungder eigenen Wahrnehmung,in dem nur das Gemeinsameund Verbindende angesprochenwird. So sollte sich jede Fachfrau ihreseigenen Standorts bewusst bleiben,damit sie sich der Ratsuchendenals ernstzunehmende Gesprächspartnerinanbieten kann (vgl.Hartwig/Weber 2000).Ursula Müller entwickelte für diesePerspektive und Standortbestimmungden Begriff „Blick von derSeite“ (vgl. Müller 1991), der vonder feministischen Parteilichkeitsdiskussionaufgenommen wurde.Die Umsetzung des „Blickes vonder Seite“ findet in der Form statt,dass die Fachfrau sich den ratsuchendenFrauen und Mädchen solidarischzur Seite stellt, dabei aberfür die subjektive Situation der Frauoder des Mädchens wachsam ist unddie einwirkenden Faktoren und deneigenen Standpunkt nicht aus denAugen verliert (vgl. Kavermann1997).3.2.2. Denkanstöße aus demDiskurs der (De-)Konstruktionvon Geschlecht auf die ParteilichkeitsdiskussionDas Postulat der Parteilichkeit istnoch immer ein wichtiger Bezugspunktder feministischen Mädchen-50