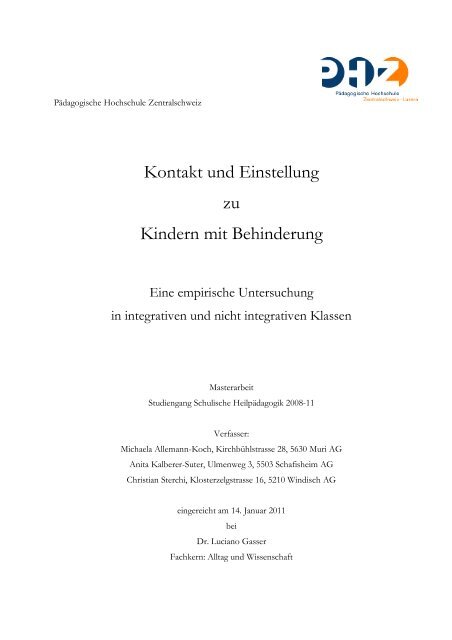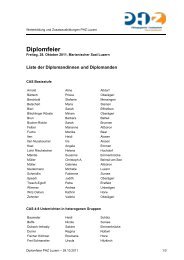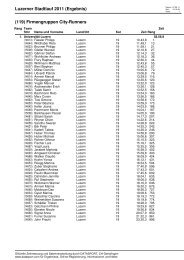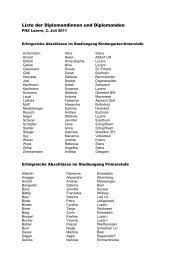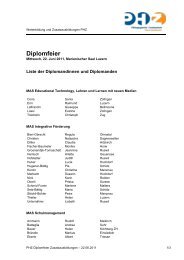Kontakt und Einstellung zu Kindern mit Behinderung
Kontakt und Einstellung zu Kindern mit Behinderung
Kontakt und Einstellung zu Kindern mit Behinderung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz<br />
<strong>Kontakt</strong> <strong>und</strong> <strong>Einstellung</strong><br />
<strong>zu</strong><br />
<strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong><br />
Eine empirische Untersuchung<br />
in integrativen <strong>und</strong> nicht integrativen Klassen<br />
Masterarbeit<br />
Studiengang Schulische Heilpädagogik 2008-11<br />
Verfasser:<br />
Michaela Allemann-Koch, Kirchbühlstrasse 28, 5630 Muri AG<br />
Anita Kalberer-Suter, Ulmenweg 3, 5503 Schafisheim AG<br />
Christian Sterchi, Klosterzelgstrasse 16, 5210 Windisch AG<br />
eingereicht am 14. Januar 2011<br />
bei<br />
Dr. Luciano Gasser<br />
Fachkern: Alltag <strong>und</strong> Wissenschaft
Abstract<br />
<strong>Kontakt</strong>möglichkeiten zwischen <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong> im gemeinsamen Unterricht<br />
erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Vorurteile abgebaut bzw. verhindert werden <strong>und</strong> sich die<br />
soziale Stellung von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong> in integrativen Regelklassen verbessert.<br />
Diese Arbeit überprüft die <strong>Kontakt</strong>hypothese sowie die Theorie sozialer Vergleichsprozesse <strong>und</strong><br />
untersucht <strong>mit</strong>tels Einzelinterviews <strong>Einstellung</strong>en, <strong>Kontakt</strong>häufigkeit, <strong>Kontakt</strong>qualität <strong>und</strong> den<br />
<strong>Kontakt</strong>wunsch von integrativ <strong>und</strong> nicht integrativ beschulten Kindergarten- <strong>und</strong> Primarschul-<br />
kindern im Kontext von fiktiv geschilderten schulischen, sozialen <strong>und</strong> sportlichen Ausschluss-<br />
situationen <strong>mit</strong> behinderten <strong>Kindern</strong>.<br />
Die Ergebnisse zeigen, unabhängig von der Schulform, eine hohe Bereitschaft von Primarschul-<br />
kindern, ein körperlich- bzw. geistig behindertes Kind in einer Gruppensituation ein<strong>zu</strong>schliessen.<br />
Bezüglich <strong>Kontakt</strong>häufigkeit <strong>und</strong> <strong>Kontakt</strong>qualität konnten keine nennenswerten Unterschiede<br />
- 1 -<br />
Abstract<br />
zwischen integrativen <strong>und</strong> nicht integrativen Klassen festgestellt werden. Primarschulkinder unter-<br />
scheiden in schulischen <strong>und</strong> sportlichen Settings deutlicher nach <strong>Behinderung</strong>sform als Kinder-<br />
gartenkinder. Mittelstufenkinder <strong>mit</strong> einem differenzierten <strong>Kontakt</strong>wunsch stellen ihre moralischen<br />
Überlegungen über die Gruppenziele. Bezüglich der Bedeutung von Fre<strong>und</strong>schaft lassen sich keine<br />
schlüssigen Aussagen machen.<br />
Schlüsselbegriffe: Soziale Stellung von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>, <strong>Einstellung</strong>en, Vorurteile,<br />
<strong>Kontakt</strong>hypothese, Theorie der sozialen Vergleichsprozesse, integrierte bzw. nicht integrierte Klassen,<br />
Ausschlusssituationen
Inhaltsverzeichnis<br />
- 2 -<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Erster Teil: Theorie...................................................................................................................3<br />
1 Einleitung.......................................................................................................................3<br />
2 Darstellung der inhaltlichen Problematik......................................................................6<br />
3 Soziale Stellung von behinderten <strong>Kindern</strong> in der Schule...............................................7<br />
4 Definition <strong>und</strong> Funktion von Vorurteilen......................................................................9<br />
4.1 Vorurteil........................................................................................................................10<br />
4.2 <strong>Einstellung</strong>en <strong>und</strong> Werte..............................................................................................13<br />
5 Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion...............................................................................15<br />
5.1 Die <strong>Kontakt</strong>hypothese als Mittel <strong>zu</strong>r Reduktion von Vorurteilen...............................15<br />
5.2 Empirische Bef<strong>und</strong>e <strong>zu</strong>r <strong>Kontakt</strong>hypothese................................................................18<br />
5.3 Auswirkungen von <strong>Kontakt</strong>erfahrungen......................................................................19<br />
5.4 Möglichkeiten <strong>zu</strong>r <strong>Einstellung</strong>sveränderung..............................................................20<br />
5.5 Fre<strong>und</strong>schaft als besondere Qualität von <strong>Kontakt</strong>......................................................23<br />
6 Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse.....................................................................29<br />
6.1 Gegenüberstellung der <strong>Kontakt</strong>hypothese <strong>und</strong> der Theorie sozialer<br />
Vergleichsprozesse.......................................................................................................31<br />
Zweiter Teil: Empirische Untersuchung................................................................................34<br />
7 Vorgehen <strong>und</strong> Methoden.............................................................................................34<br />
7.1 Fragestellungen............................................................................................................34<br />
7.2 Stichprobe.....................................................................................................................38<br />
7.3 Forschungsinstrument.................................................................................................39<br />
7.4 Ablauf <strong>und</strong> Durchführung der Untersuchung.............................................................41<br />
8 Ergebnisse....................................................................................................................44<br />
9 Diskussion....................................................................................................................73<br />
9.1 Darstellung <strong>und</strong> Interpretation der Ergebnisse...........................................................74<br />
9.2 Schlussfolgerungen....................................................................................................100<br />
9.3 Folgerungen für die Praxis.........................................................................................102<br />
9.4 Kritische Anmerkungen <strong>zu</strong>r Methode........................................................................103<br />
9.5 Ausblick......................................................................................................................104<br />
Literaturverzeichnis...............................................................................................................105<br />
Dritter Teil: Anhang..............................................................................................................109<br />
Anhang A: Erhebungsinstrument...............................................................................................................110<br />
Anhang B: Verwendete Bilder <strong>zu</strong> den Interviews....................................................................................139<br />
Anhang C: Tabellenverzeichnis...................................................................................................................141<br />
Anhang D: Abbildungsverzeichnis.............................................................................................................144<br />
Anhang E: Untersuchungen E bis H.........................................................................................................145<br />
Anhang F: Interdependenz der unabhängigen Variablen.......................................................................159
Erster Teil: Theorie<br />
1 Einleitung<br />
- 3 -<br />
Erster Teil: Theorie<br />
Die Schule als Spiegelbild einer pluralistischen Gesellschaft steht vor grossen Herausforderungen.<br />
Wie soll die Schule der Zukunft aussehen? Die allgemeine Pädagogik <strong>und</strong> insbesondere auch die<br />
Heilpädagogik befinden sich in einem gesellschaftlichen <strong>und</strong> politischen Spannungsfeld. Befürworter<br />
der Integrationspädagogik sehen die Zukunft in einer Weiterentwicklung der traditionellen Schule <strong>zu</strong><br />
einer „Schule der Vielfalt“, basierend auf der Umset<strong>zu</strong>ng einer Pädagogik der Vielfalt, wie sie <strong>zu</strong>m<br />
Beispiel Annedore Prengel (2006) postuliert. Diese inklusive Pädagogik versteht sich „als Pädagogik<br />
der intersubjektiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten Verschiedenen“ (Prengel 2006, S. 62).<br />
Sie sieht in der Verschiedenheit der Kompetenzen kein gr<strong>und</strong>sätzliches Problem, sondern eine<br />
Entwicklungschance für alle Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler.<br />
Johann Amos Comenius (1592-1670) hat seine im Jahr 1657 erstmals veröffentlichte pädagogische<br />
Hauptschrift <strong>mit</strong> den Worten „Die vollständige Kunst, alle Menschen alles <strong>zu</strong> lehren“ (Comenius,<br />
2007) untertitelt. Da<strong>mit</strong> hat er das Ziel einer inklusiven Pädagogik <strong>und</strong> Didaktik vermutlich erstmals<br />
„visionär“ umrissen. Auch Kinder <strong>mit</strong> körperlichen <strong>und</strong> geistigen <strong>Behinderung</strong>en sind primär<br />
Kinder <strong>mit</strong> ganz normalen Bedürfnissen <strong>und</strong> vielen Fähigkeiten. Eine wichtige Aufgabe für die<br />
Schule der Zukunft sehen Befürworter der Integrationspädagogik darin, Kinder <strong>zu</strong>m Zusammen-<br />
leben <strong>und</strong> <strong>zu</strong>r Mitgestaltung gemeinsamer Vorhaben <strong>zu</strong> befähigen <strong>und</strong> die gesellschaftliche Teilhabe<br />
aller <strong>zu</strong> ermöglichen.<br />
Diesen Bestrebungen stehen die Integrationskritiker gegenüber. Schlagworte, wie Heterogenität 1 ,<br />
Integration <strong>und</strong> Inklusion 2 , erregen die Gemüter <strong>und</strong> heizen Debatten in den Medien, in politischen<br />
Kreisen, in den Lehrerkollegien <strong>und</strong> in der Bevölkerung an. Nach wie vor ist die Angst vor der<br />
Verschiedenheit in Schulklassen gross, insbesondere in Be<strong>zu</strong>g auf die gemeinsame Erziehung <strong>und</strong> den<br />
Gemeinsamen Unterricht 3 von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong>. Sie scheint auch nicht durch<br />
Studien aus den Köpfen vertrieben werden <strong>zu</strong> können, die aufzeigen, dass durch die Integration von<br />
1 In dieser Arbeit wird die Heterogenität als die Verschiedenheit der Individuen in der Gruppe betrachtet. Sie zeigt sich im schulischen Alltag<br />
sowohl auf der körperlichen, sozialen, kulturellen, wie auch auf der kognitiven Ebene. Durch die Integration erfolgt eine gewünschte erhöhte Heterogenität,<br />
die „als bereichernd favorisiert“ gilt (Heinzel & Prengel, 2002, S. 11).<br />
2 Integrative Schulen versuchen, „das Leben <strong>und</strong> Lernen in der Gemeinschaft von behinderten <strong>und</strong> nicht behinderten Menschen <strong>zu</strong> ermöglichen<br />
<strong>und</strong> durch didaktische <strong>und</strong> methodische Massnahmen professionell <strong>zu</strong> unterstützen“ (B<strong>und</strong>schuh et al., 2007, S. 137). „Mit der Erklärung von Salamanca<br />
der UNESCO von 1994 hat der Begriff ,Inklusion’ Eingang in die internationale Diskussion um die Weiterentwicklung der Integration<br />
gef<strong>und</strong>en. ,Inklusive Schulen’ betonen die Einbindung in die Gemeinschaft <strong>und</strong> das Schulumfeld, sie sind barrierefrei, unterstützen die Zusammenarbeit<br />
auf allen Ebenen, haben ein gemeinsames Curriculum <strong>und</strong> treten für die Gleichhabechancen ein“ (B<strong>und</strong>schuh et al., 2007, S. 139).<br />
3 ,Gemeinsamer Unterricht’ ist in den letzten 30 Jahren <strong>zu</strong> einem Fachbegriff geworden, der in den folgenden Ausführungen beibehalten <strong>und</strong> gross<br />
geschrieben wird. Gemeint ist, Schüler <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong> lernen gemeinsam in einer Integrationsklasse. Dieser Unterricht ist hoch differenziert<br />
<strong>und</strong> individualisiert <strong>und</strong> orientiert sich an Konzepten wie ,Projektunterricht’, ,Wochenplanunterricht’, ,Gesprächskreise’, ,freie Tätigkeit’,<br />
,Altersdurchmischung’, ,Lernen am gemeinsamen Gegenstand’ <strong>und</strong> letztlich auch einer übergeordneten demokratischen Pädagogik, die die Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler stückweise auch in die Planungsprozesse einbezieht (Heimlich, 2007).
- 4 -<br />
Einleitung<br />
<strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en die „begabten“ Mitschüler in ihrer Lernentwicklung, wie auch bezüglich<br />
sozialer <strong>und</strong> emotionaler Faktoren nicht benachteiligt werden (vgl. Bless & Klaghofer 1991, Bless 2007).<br />
In der schweizerischen Bildungspolitik steht diesen Befürchtungen der Anspruch der schulischen<br />
Integration gegenüber. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren<br />
(EDK, 2007) hat an ihrer Jahresversammlung vom 25./26. Oktober 2007 in Heiden ein Konkordat<br />
<strong>zu</strong>r Sonderpädagogik verabschiedet <strong>und</strong> empfahl den Kantonen den Beitritt. Mit dem Beitritt von<br />
Basel-Stadt im Mai 2010 als 10. Kanton kam das Konkordat <strong>zu</strong> Stande. In der Zwischenzeit sind<br />
zwei weitere Kantone (BL <strong>und</strong> UR) beigetreten. Die EDK hat die Inkraftset<strong>zu</strong>ng für die Kantone,<br />
welche es ratifiziert haben, auf den 1. Januar 2011 festgesetzt. Das Konkordat bildet einen erstmals<br />
in dieser Form vorliegenden gesamtschweizerischen Rahmen für die Schulung von <strong>Kindern</strong> <strong>und</strong><br />
Jugendlichen <strong>mit</strong> besonderem Bildungsbedarf. In diesem Konkordat heisst es: „Integrative Lösungen<br />
sind separierenden Lösungen vor<strong>zu</strong>ziehen, unter Beachtung des Wohles <strong>und</strong> der Entwicklungs-<br />
möglichkeiten des Kindes oder des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des schulischen<br />
Umfeldes <strong>und</strong> der Schulorganisation“ (Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im<br />
Bereich der Sonderpädagogik, Art 2; Gr<strong>und</strong>sätze, b).<br />
Dass eine Schule, die Heterogenität akzeptiert <strong>und</strong> als Chance für mehr Leistung <strong>und</strong> Gerechtigkeit in<br />
Schule <strong>und</strong> Gesellschaft versteht (Cloerkes, 2007), nicht einfach politisch verordnet werden kann, zeigt<br />
die jüngste Entwicklung im Kanton Zürich. Dort wurde das kantonale Sonderpädagogik-Konzept<br />
nach der Vernehmlassungsphase aufgr<strong>und</strong> ernüchternder Rückmeldungen durch die einzelnen Schulen<br />
im Juni 2010 <strong>zu</strong>rückgezogen. Die Ablehnung sei vor allem auf die Angst vor einer Überforderung der<br />
Schule <strong>und</strong> der Lehrpersonen <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen. Man tue sich vielerorts schwer <strong>mit</strong> der Umset<strong>zu</strong>ng des<br />
an sich unbestrittenen Integrationsgedankens in der Zürcher Volksschule (Bernet 2010).<br />
Die Integrationsforschung konnte in den letzten Jahren nachweisen, dass sich Kinder <strong>mit</strong> Lern-<br />
behinderungen in Be<strong>zu</strong>g auf schulische Kompetenzen in integrativen Klassen positiv entwickeln<br />
können (Bless 2007). Andererseits zeigen Studien <strong>zu</strong>r soziometrischen Stellung, dass diese Kinder<br />
meist wenig Akzeptanz <strong>und</strong> Wertschät<strong>zu</strong>ng von ihren Klassenkameraden ohne <strong>Behinderung</strong> erfahren<br />
<strong>und</strong> deshalb eher ausgeschlossen werden (Bless 2000, Eckhart 2006, Huber 2006). Genau dieser<br />
Aspekt, nämlich die Art <strong>und</strong> Weise des sozialen Umgangs, ist jedoch entscheidend, wenn es um die<br />
Bewertung von gelungener Integration geht.<br />
Hier setzt unsere Arbeit ein. Sie beschäftigt sich im Folgenden <strong>mit</strong> Fragestellungen <strong>zu</strong>r sozialen<br />
Interaktion zwischen <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong> in verschiedenen Kontexten. Welche<br />
Faktoren beeinflussen das ein- oder ausschliessende Verhalten von <strong>Kindern</strong>? Sind es früh erworbene<br />
<strong>Einstellung</strong>en bzw. Stereotypen oder <strong>Kontakt</strong>erfahrungen? Wie konstruieren sich Kinder subjektive
- 5 -<br />
Einleitung<br />
Wirklichkeiten, wenn sie in schulischen, sportlichen oder die Freizeit betreffenden Situationen vor<br />
die Entscheidung gestellt werden, ob alle gleich <strong>zu</strong> behandeln sind (Ausschluss ist unfair) oder ob<br />
der Anspruch besteht, dass die Gruppe gut funktioniert <strong>und</strong> die persönlichen Ziele erreicht werden?<br />
Unterscheidet sich dabei das Ausschlussverhalten in Be<strong>zu</strong>g auf verschiedene <strong>Behinderung</strong>sformen<br />
(geistig bzw. körperlich)? Unterscheidet sich an Schweizer Schulen die Integrationsbereitschaft von<br />
<strong>Kindern</strong> verschiedener Altersstufen (Kindergarten, Unter- <strong>und</strong> Mittelstufe) in integrativ bzw. nicht<br />
integrativ beschulten Klassen? Welche spezifischen <strong>Kontakt</strong>erfahrungen wirken sich auf die <strong>Einstellung</strong><br />
der Kinder gegenüber Kameraden <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en aus? Lassen sich aus den Erkenntnissen<br />
Folgerungen für die Praxis ziehen?<br />
Die vorliegende Arbeit ist eingebettet in ein vom Schweizerischen Nationalfonds finanziertes<br />
Forschungsprojekt, das am Institut für Schule <strong>und</strong> Heterogenität (ISH) der Pädagogischen Hoch-<br />
schule Luzern unter dem Titel „Entwicklung moralischer Urteile <strong>zu</strong>m Ausschluss behinderter<br />
Kinder in integrativen <strong>und</strong> nicht integrativen Schulklassen” durchgeführt wird 4 .<br />
Wir verwenden normalerweise die Formulierung „Kinder <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>“, da sie uns geeignet<br />
erscheint, um aus<strong>zu</strong>drücken, dass die <strong>Behinderung</strong> ein Merkmal <strong>und</strong> nicht die ganze Person meint.<br />
Wenn stellenweise doch von behinderten <strong>Kindern</strong> gesprochen wird, erfolgt dies aus Gründen der<br />
besseren Lesbarkeit.<br />
Aus demselben Gr<strong>und</strong> wird mehrheitlich die männliche Form verwendet, die weibliche Form ist<br />
selbstverständlich <strong>mit</strong> eingeschlossen.<br />
Bei der verwendeten Literatur haben wir uns vor allem auf deutschsprachige Publikationen <strong>und</strong><br />
Forschungen konzentriert.<br />
4 Näheres <strong>zu</strong>m Forschungsprojekt siehe unter: www.fe.luzern.phz.ch/ish/ish-projekte/umgang-<strong>mit</strong>-heterogenitaet-in-schule-<strong>und</strong>unterricht/entwicklung-moralischer-urteile-<strong>zu</strong>m-ausschluss-behinderter-kinder-in-integrativen-<strong>und</strong>-nicht-integrativen-schulklassen/
2 Darstellung der inhaltlichen Problematik<br />
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile:<br />
- 6 -<br />
Darstellung der inhaltlichen Problematik<br />
• Erörterung der theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>zu</strong>r sozialen Stellung von behinderten <strong>Kindern</strong> in der<br />
Schule, <strong>zu</strong>r Vorurteilsproblematik <strong>und</strong> <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion (Kapitel 3 bis 6).<br />
• Empirische Untersuchung <strong>mit</strong>tels Einzelinterviews <strong>zu</strong> moralischen Urteilen in Ausschluss-<br />
situationen, <strong>zu</strong> <strong>Kontakt</strong>en zwischen behinderten <strong>und</strong> nicht behinderten <strong>Kindern</strong> allgemein,<br />
sowie <strong>zu</strong> ihrer <strong>Einstellung</strong> [<strong>Kontakt</strong>wunsch] (Kapitel 7).<br />
• Anhang: Erhebungsinstrument, Untersuchungen <strong>zu</strong> Emotions<strong>zu</strong>schreibung / Empathie /<br />
Wissen / <strong>Kontakt</strong>wunsch, Interdependenz der unabhängigen Variablen sowie Verzeichnisse<br />
der Tabellen <strong>und</strong> Abbildungen<br />
Wie bereits in der Einleitung angesprochen, stehen den Befürwortern integrativer Schulungsformen<br />
diejenigen gegenüber, die die Integration von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en ablehnen. Maikowski <strong>und</strong><br />
Podlesch (2002) führen dies auf die weit verbreiteten Vorurteile gegenüber Menschen <strong>mit</strong> geistiger<br />
<strong>Behinderung</strong> <strong>zu</strong>rück. Im ersten Teil der theoretischen Ausführungen werden deshalb die Entstehung<br />
<strong>und</strong> Bedeutung von <strong>Einstellung</strong>en, Vorurteilen <strong>und</strong> Stereotype im Allgemeinen erörtert.<br />
In einem zweiten Schritt werden kontakttheoretische Überlegungen angestellt. Gr<strong>und</strong>lage dieser<br />
Ausführungen sind Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion. Es wird aufgezeigt, wie sich Allports einfache<br />
<strong>Kontakt</strong>hypothese (1954, deutsche Überset<strong>zu</strong>ng 1971) im Laufe der letzten Jahrzehnte innerhalb der<br />
sozialpsychologischen Forschung entwickelt hat (Aronson et al. 2004) <strong>und</strong> welche Bedeutung diese<br />
Erkenntnisse für die Praxis der Zukunft haben könnten.<br />
Im Gegensatz da<strong>zu</strong> steht die Theorie sozialer Vergleichsprozesse von Festinger (1954), die von Frey<br />
et al. (2001) erweitert wurde. Sie fokussiert die Anpassungsprozesse des Individuums bezüglich einer<br />
Gruppe. Ziel des Vergleichs ist die Verringerung der Diskrepanz zwischen sich <strong>und</strong> der Gruppe.<br />
Sollte dies nicht gelingen, resultiert der Ausschluss aus der Gruppe.<br />
In unserer empirischen Untersuchung wird unter anderem analysiert, inwiefern eine Gruppenziel-<br />
vorgabe (eine gute Note erreichen, beim Seilziehen gewinnen, im Zirkus möglichst viel Spass haben)<br />
eine Rolle spielt, ob ein behindertes Kind in die Gruppe aufgenommen wird oder nicht.
- 7 -<br />
Soziale Stellung von behinderten <strong>Kindern</strong> in der Schule<br />
3 Soziale Stellung von behinderten <strong>Kindern</strong> in der Schule<br />
Soziale Integration von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong> in inklusiven <strong>und</strong> integrativen Schulen<br />
Die amerikanische Hirnforscherin Naomi Eisenberger stellte in ihren Studien fest, dass soziale<br />
Ausgren<strong>zu</strong>ng <strong>und</strong> körperlicher Schmerz neurologisch im Zusammenhang stehen: „Wer beim Sport<br />
(dort Ballspiel) von seinen Mitspielern ignoriert wird, ,fühlt’ dies in der gleichen Hirnregion (dem Gyrus<br />
cinguli), in der auch körperlicher Schmerz repräsentiert <strong>und</strong> realisiert wird“ (zit. nach Huber, 2006, S. 11).<br />
Die soziale Integration in der Schule hat demnach für das Wohlbefinden aller Kinder eine zentrale<br />
Bedeutung <strong>und</strong> es besteht weitgehend Konsens darüber, dass die Entwicklung eines positiven Sozial-<br />
verhaltens ein zentrales pädagogisches Ziel ist. Heterogene Lerngruppen bieten eine Vielfalt von<br />
Lernanregungen <strong>mit</strong> sozialen <strong>und</strong> emotionalen Entwicklungsanreizen.<br />
„Der gemeinsame Unterricht von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> unterschiedlichen Lern- <strong>und</strong> Leistungsvorausset<strong>zu</strong>ngen<br />
hat in den vergangenen Jahren <strong>zu</strong> Kontroversen geführt. Befürchtungen <strong>und</strong> Erwartungen stehen<br />
sich diametral gegenüber“ (Eckhart, 2006, S. 162). Einerseits gibt es Untersuchungen <strong>zu</strong>r sozio-<br />
metrischen Stellung von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong>en in inklusiven Schulen. Die deutsche<br />
Integrationspädagogik sucht im internationalen Zusammenhang den Anschluss an das von Boban<br />
<strong>und</strong> Hinz (2005) entwickelte Konzept der Inklusion, das eine Weiterentwicklung des integrativen<br />
Ansatzes darstellt. Maikowski <strong>und</strong> Podlesch (1988) haben beispielsweise in der Fläming-Gr<strong>und</strong>schule<br />
Berlin 5 während dreier Jahre in drei Integrationsklassen eine soziometrische Befragung durchgeführt.<br />
Im Vergleich <strong>zu</strong> integrativen Regelklassen verfügten die behinderten Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler an<br />
der Fläming-Gr<strong>und</strong>schule Berlin über ein dichteres soziales Beziehungsnetz. Obwohl sie anfänglich<br />
eine weniger gute Statusposition hatten, veränderte sich die Stellung von Jahr <strong>zu</strong> Jahr positiv. Auch<br />
ausserhalb der Schule kam es <strong>zu</strong> vermehrten Freizeitkontakten.<br />
Andererseits stehen Ergebnisse aus der Schweizer Nationalfonds-Untersuchung „IntSep“ 6 (Eckhart, 2006)<br />
diesen Bef<strong>und</strong>en gegenüber. Sie zeigen, dass sich im integrativen Unterricht tolerantes Verhalten<br />
<strong>und</strong> ein wertschätzendes Zusammenleben nicht automatisch entwickeln. Im Gegenteil: Gr<strong>und</strong>schul-<br />
kinder <strong>mit</strong> Schulleistungsschwächen werden von ihren Mitschülern häufig abgelehnt, stehen so<strong>mit</strong><br />
am Rand des sozialen Klassengefüges. Wenn Kinder sowohl Schulleistungsschwächen als auch<br />
Migrationshintergr<strong>und</strong> haben, verschlechtert sich die soziometrische Stellung <strong>zu</strong>sätzlich. Zwar<br />
werden schulleistungsschwache Kinder auch in der Schweiz immer häufiger integriert unterrichtet,<br />
5 Inklusive Schule besonderer pädagogischer Prägung <strong>mit</strong> Gemeinsamem Unterricht von behinderten <strong>und</strong> nichtbehinderten <strong>Kindern</strong>.<br />
6 Zu IntSep siehe: www.unifr.ch/spedu/uploads///dokumente/forschung/projektesnf/intsep%20ueberblick.pdf
- 8 -<br />
Soziale Stellung von behinderten <strong>Kindern</strong> in der Schule<br />
doch wirklich „integriert” sind sie nicht, denn „eine echte Integration in Be<strong>zu</strong>g auf ihre sozialen<br />
Beziehungen scheint (…) vielerorts ausser Reichweite“ (Eckhart, 2005, S. 180).<br />
In einem umfassenden Überblick von Bless (2000) wurden die oben erörterten Bef<strong>und</strong>e <strong>zu</strong>r sozio-<br />
metrischen Stellung bestätigt. Eine weitere Bestätigung findet sich in einer deutschschweizerischen<br />
Untersuchung von Haeberlin et al. (1999). Ebenfalls kritisch beleuchtet Huber (2006) die soziale<br />
Stellung von behinderten Schülern in einer aktuelleren empirischen Untersuchung <strong>zu</strong>r sozialen<br />
Integration von Schülern <strong>mit</strong> sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB) im Gemeinsamen Unter-<br />
richt. Er kommt in seiner Evaluationsstudie <strong>zu</strong>m Schluss, „dass die Wirkung des Gemeinsamen<br />
Unterrichts auf die soziale Integration von Schülern <strong>mit</strong> SFB nicht so eindeutig <strong>zu</strong> sein scheint, wie<br />
es die Bef<strong>und</strong>e deutscher Schulversuche <strong>und</strong> die integrationspädagogische Theoriebildung vermuten<br />
lassen“ (Huber, 2008, S. 12).<br />
Was lässt sich dieser eher ernüchternd stimmenden Bilanz entgegenstellen? Was verhindert denn die<br />
wertschätzende Kooperation zwischen den <strong>Kindern</strong> innerhalb einer Lerngruppe, wie sie eine Schul-<br />
klasse darstellt? Krampen (1993, S. 130) hält in seinem Forschungsüberblick fest: „Unterricht in<br />
heterogenen Gruppen erhöht die <strong>Kontakt</strong>möglichkeiten zwischen unterschiedlichen Schülern <strong>und</strong><br />
kann im Laufe der Zeit <strong>zu</strong> einem Abbau von Vorurteilen <strong>und</strong> anderen Interaktionsbarrieren führen,<br />
bzw. deren Entstehung verhindern helfen“.<br />
Bevor <strong>Kontakt</strong>möglichkeiten thematisiert werden, setzen wir uns im folgenden Kapitel <strong>mit</strong> Vorurteilen,<br />
<strong>Einstellung</strong>en <strong>und</strong> Werten auseinander.
4 Definition <strong>und</strong> Funktion von Vorurteilen<br />
- 9 -<br />
Definition <strong>und</strong> Funktion von Vorurteilen<br />
Wer möchte nicht gerne „vorurteilsfrei“ an Menschen <strong>und</strong> Dinge herangehen, in der inneren<br />
Überzeugung, dass Vorurteile einseitig, falsch <strong>und</strong> unfair sind? Vorurteile gehören <strong>zu</strong>m Leben. Für<br />
die amerikanischen Sozialpsychologinnen Werth <strong>und</strong> Mayer (2008) sind Vorurteile keineswegs nur<br />
schlecht, sie sind sogar notwendig. Das Wort „Vor-Urteil“ sagt es schon, dass es bereits in unserem<br />
Gedächtnis gespeicherte <strong>und</strong> da<strong>mit</strong> schnell abrufbare Urteile sind, die erlauben, Informationsver-<br />
arbeitung <strong>zu</strong> vereinfachen. „Wir müssen über Dinge, die vermutlich auf die grosse Mehrheit einer<br />
Gruppe <strong>zu</strong>treffen (z. B. dass die meisten Menschen in England englisch sprechen), nicht bei jeder<br />
Begegnung wieder neu nachdenken, um <strong>zu</strong> entscheiden, wie wir beispielsweise unser Gegenüber<br />
ansprechen sollen. Wir brauchen nur das Vor-Urteil ab<strong>zu</strong>rufen. Unter Zeitdruck oder bei hoher<br />
Komplexität des Sachverhalts ist dies besonders nützlich“ (Werth & Mayer 2008, S. 378).<br />
Dass der Begriff des Vorurteils trotz der oben ausgeführten positiven Aspekte für die psychische<br />
Ökonomie auch eine äusserst negativ behaftete Seite hat, hängt da<strong>mit</strong> <strong>zu</strong>sammen, dass die Konsequenzen<br />
von Vorurteilen äusserst verheerende Folgen haben können. Sie reichen beispielsweise vom Hass <strong>und</strong><br />
der Benachteiligung oder Verfolgung von Fremdgruppen (z.B. Schwarze in USA in den 50-er-Jahren)<br />
bis hin <strong>zu</strong>m Völkermord an den Armeniern Anfang des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts, den Juden im zweiten<br />
Weltkrieg, den Tutsi <strong>und</strong> Hutu 1994 in Ruanda <strong>und</strong> dem Massaker von Srebrenica 1995.<br />
Auch Diskriminierungen im Alltag können für den einzelnen Menschen materielle Nachteile <strong>und</strong><br />
psychische Folgen haben. Die soziale Ungerechtigkeit betrifft <strong>zu</strong>m Beispiel Ausländer, Behinderte<br />
oder Übergewichtige, sei es im Berufsleben wie auch in der Schule.<br />
Die Tatsache, dass in unserer Leistungsgesellschaft Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en nicht den sozialen<br />
Normen entsprechen, beeinflusst die <strong>Einstellung</strong>en ihrer einzelnen Mitglieder. Cloerkes (2007) sieht<br />
die Reduzierung sozialer Teilhabe von Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en als Konsequenz einer Gesellschaft,<br />
die sich ausschliesslich am Ges<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Vollhandlungsfähigen orientiert. Wertvorstellungen einer<br />
Gesellschaft bestimmen demnach <strong>Einstellung</strong>en <strong>und</strong> Verhaltensweisen.<br />
Cloerkes fasst verschiedene Studienergebnisse der letzten 30 Jahre <strong>zu</strong>sammen <strong>und</strong> kommt <strong>zu</strong>m Schluss,<br />
dass die Art der <strong>Behinderung</strong> sowie die kulturell bedingte soziale Reaktion den grössten Einfluss auf<br />
die <strong>Einstellung</strong>en <strong>und</strong> das Verhalten haben. An dieser Stelle ist an<strong>zu</strong>merken, dass Cloerkes dem<br />
Nutzen von <strong>Einstellung</strong>sstudien kritisch gegenübersteht, weil seiner Meinung nach die unterschied-<br />
lichen Ebenen der <strong>Einstellung</strong> <strong>und</strong> des tatsächlichen Verhaltens in den verschiedenen Studien teilweise<br />
vermischt würden. Er plädiert für eine strikte Trennung zwischen dem, was sich in den Köpfen<br />
abspielt (<strong>Einstellung</strong>, Vorurteil, Wert, Stigma) <strong>und</strong> der Ebene des gezeigten Verhaltens. Er sieht nur<br />
einen begrenzten Zusammenhang zwischen den beiden Ebenen <strong>und</strong> dieser erlaube keine Vorhersagen.
- 10 -<br />
Definition <strong>und</strong> Funktion von Vorurteilen<br />
In Untersuchen <strong>zu</strong> Vorurteilen gegenüber <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en von Helmut v. Bracken (1981)<br />
zeigte sich, dass grosse Teile der Bevölkerung die geistige <strong>Behinderung</strong> für die schwerste halten, die<br />
jemand treffen kann. Viele Menschen reagieren <strong>mit</strong> Entsetzen, Angst <strong>und</strong> Abscheu auf geistig<br />
Behinderte. Es kann sogar so weit gehen, dass Menschen der Auffassung sind, es sei besser, dass<br />
Geistigbehinderte früh sterben. In den letzten 30 Jahren wurden viele weitere Untersuchungen<br />
gemacht. Klauss (1996) stellte Mitte der 90-er Jahre fest, dass sich das Wissen über <strong>Behinderung</strong>en<br />
in der Zwischenzeit verändert hat. Die Auffassung, dass Menschen <strong>mit</strong> geistiger <strong>Behinderung</strong> früh<br />
sterben sollen, wird nun <strong>zu</strong>rückgewiesen. Wocken (2000) stellt dem gegenüber, dass weiterhin mehr<br />
als 50% der Befragten an diesem Paradigma festhalten, obwohl bereits mehr als 75% die gemeinsame<br />
Beschulung von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne geistige <strong>Behinderung</strong> befürworten. Er kommt aufgr<strong>und</strong><br />
dieser Ergebnisse <strong>zu</strong>m Schluss, dass Ambivalenz das vorherrschende Merkmal darstelle, also weder<br />
krasse Behindertenfeindlichkeit noch gewachsene Behindertenfre<strong>und</strong>lichkeit aus<strong>zu</strong>machen sei.<br />
Cloerkes kommentiert dieses Fazit <strong>mit</strong> folgendem Statement: „Das kann man nun als Teil-Entwarnung<br />
angesichts verbreiteter Befürchtungen vor einer ,neuen Behindertenfeindlichkeit’ werten oder<br />
auch – bei Skepsis gegenüber Methoden der <strong>Einstellung</strong>sforschung – als enttäuschend, wenn man<br />
die vergleichsweise hohe öffentliche Aufmerksamkeit in Rechnung stellt, die Behindertenfragen<br />
heute <strong>zu</strong>kommt“ (Cloerkes, 2007, S. 106).<br />
Die Bedeutsamkeit des Wissens darüber, was Vorurteile genau sind, wie sie entstehen, wie <strong>und</strong> wann<br />
sie <strong>zu</strong>r Anwendung kommen <strong>und</strong> was sie aufrechterhält, scheint zentral, um als Heilpädagoginnen <strong>und</strong><br />
Heilpädagogen, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, wie auch als Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler verantwortungsvoll<br />
<strong>mit</strong> den eigenen Vorurteilen um<strong>zu</strong>gehen <strong>und</strong> der Diskriminierung wirksam <strong>zu</strong> begegnen. Es muss<br />
davon ausgegangen werden, dass dies ein komplexes Unterfangen ist, über lange Zeiträume angelegt<br />
sein muss <strong>und</strong> neben der Hoffnung auf echte Anerkennung <strong>und</strong> Gleichberechtigung auch ein<br />
mögliches Scheitern dieses Vorhabens <strong>mit</strong> einbezieht.<br />
4.1 Vorurteil<br />
Vorurteile können sowohl positiv als auch negativ konnotiert sein. Im Grossteil der Fälle wird der Begriff<br />
allerdings für negative <strong>Einstellung</strong>en gegenüber Fremdgruppen verwendet. Markowetz (2007, S. 289)<br />
umschreibt das Vorurteil als „eine unkritische, ungeprüfte oder nur durch Minimalinformationen abge-<br />
sicherte, affektiv geladene <strong>und</strong> irrationale Übernahme bzw. Produktion einer Meinung, Erwartung oder<br />
Auffassung gegenüber einzelnen Personen, Gruppen, Verhältnissen, Institutionen, Produktionen,<br />
Ereignissen oder Objekten, die sich schnell <strong>zu</strong> einem stabilen, nur schwer veränderbaren Urteil<br />
verfestigt.“ Vorurteile weisen eine kognitive (Stereotyp), eine affektive (Stereotypakzeptierung) sowie<br />
eine Verhaltenskomponente (Diskriminierung) auf (Werth & Mayer, 2008).
- 11 -<br />
Definition <strong>und</strong> Funktion von Vorurteilen<br />
In der Literatur <strong>und</strong> im allgemeinen Sprachgebrauch sind oft verschiedene, synonym verwendete<br />
Ausdrücke an<strong>zu</strong>treffen, z. B. Stereotyp, Stereotypakzeptierung, Diskriminierung, <strong>Einstellung</strong>, Wert<br />
<strong>und</strong> Stigma. Sie können als Ausdrucksformen von sozialer Distanz <strong>und</strong> Nähe <strong>zu</strong> Menschen <strong>mit</strong><br />
<strong>Behinderung</strong>en angesehen werden <strong>und</strong> sollen – um den Begriff des Vorurteils etwas präziser<br />
umschreiben <strong>zu</strong> können – nachfolgend erläutert werden.<br />
Stereotyp (stereotypes Wissen, kognitive Komponente)<br />
Der Begriff wurde 1922 von Lippmann (2003) geprägt <strong>und</strong> in die Sozialpsychologie eingeführt.<br />
Er beschrieb die Diskrepanz zwischen der komplexen Aussenwelt <strong>und</strong> den kleinen, vereinfachten<br />
Bildern in unseren Köpfen, die er als „Stereotypen“ bezeichnet (Aronson et al., 2004). Das Prinzip<br />
der Stereotypisierung dient der Vereinfachung der Sichtweise auf die Welt, nach Allport ist es das<br />
“Gesetz der geringsten Anstrengung“ (Allport, 1971, S. 183ff).<br />
Ein Stereotyp stellt die Basis von Vorurteilen dar, ist aber noch kein Vorurteil (Werth & Mayer, 2008).<br />
Die Stereotypisierung ist nicht a priori wertend oder <strong>mit</strong> negativen Emotionen verb<strong>und</strong>en. „Ein<br />
Stereotyp ist die kognitive Komponente einer voreingenommenen <strong>Einstellung</strong> <strong>und</strong> ist definiert<br />
als eine Verallgemeinerung über eine Gruppe, wobei nahe<strong>zu</strong> allen Mitgliedern identische Merk-<br />
male <strong>zu</strong>geordnet werden, ohne Rücksicht auf bestehende Variationen unter den Mitgliedern“<br />
(Aronson et al., 2004, S. 526). Ein Beispiel aus dem Alltag soll dies verdeutlichen: „Von Frauen<br />
wird gesagt, sie können schlecht parkieren.“<br />
Markowetz spricht im Zusammenhang von Stereotypen gegenüber Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en<br />
von „parzellierten <strong>und</strong> reduktionistischen Bildern über Behinderte (…), die als ‚hilfreiche Wahrheiten’<br />
gehandelt werden. Obwohl sich diese bei objektiver Überprüfung als Halb- oder Unwahrheiten<br />
nachweisen lassen, werden sie nicht oder nur kurzfristig korrigiert“ (Markowetz 2007, S. 290).<br />
In unseren durchgeführten Interviews im Bereich „Wissen über <strong>Behinderung</strong>“ wird nach möglichen<br />
Ursachen körperlicher bzw. geistiger <strong>Behinderung</strong> gefragt. Gibt das befragte Kind <strong>zu</strong> Protokoll,<br />
„die Eltern des behinderten Kindes sind auch behindert“, steckt dahinter vermutlich der Stereotyp<br />
„behinderte Kinder haben behinderte Eltern“.<br />
Die Motivation, vorurteilsfrei <strong>zu</strong> handeln, spielt für die Stereotypanwendung eine wichtige Rolle. Ist<br />
eine Person gewillt vorurteilsfrei <strong>zu</strong> handeln, müssen weitere Vorausset<strong>zu</strong>ngen gegeben sein, da<strong>mit</strong><br />
sie dies willentlich kontrollieren kann. In einem ersten Schritt muss sie sich bewusst werden, dass sie<br />
von einem Vorurteil beeinflusst wird <strong>und</strong> sie muss ausserdem über die nötigen Kontroll- bzw.<br />
Selbstregulationskompetenzen verfügen (Werth & Mayer, 2008).<br />
In einem Experiment aus dem Jahre 1997 haben K<strong>und</strong>a <strong>und</strong> Oleson folgendes herausgef<strong>und</strong>en:<br />
Personen, die <strong>mit</strong> Argumenten konfrontiert werden, die ihre Stereotype stark in Frage stellen, neigen
- 12 -<br />
Definition <strong>und</strong> Funktion von Vorurteilen<br />
da<strong>zu</strong>, sie <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>weisen, <strong>mit</strong> der Begründung, dass sie die Ausnahmen darstellen, welche die Regel<br />
bestätigen. Da<strong>mit</strong> wird die Stereotypisierung noch verstärkt (1997, beschrieben nach Aronson et al., 2004).<br />
Stereotypakzeptierung (stereotype Überzeugung, affektive Komponente)<br />
Werth & Mayer (2008) bezeichnen die positive oder negative Empfindung gegenüber Personen<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer Zugehörigkeit <strong>zu</strong> einer Fremdgruppe <strong>mit</strong> dem Begriff der Stereotypakzeptierung<br />
bzw. stereotyper Überzeugung. Sie legen Wert darauf, diese verschiedenen Komponenten <strong>zu</strong><br />
differenzieren. Um nämlich von einem „echten Vorurteil“ sprechen <strong>zu</strong> können ist die affektive<br />
Komponente <strong>zu</strong>sätzlich <strong>zu</strong>m stereotypen Wissen notwendig.<br />
• Kognitive Komponente: Von Frauen wird gesagt, sie können schlecht parkieren.<br />
• Affektive Komponente: Ich finde, Frauen können schlecht parkieren.<br />
Die affektive Komponente kann <strong>zu</strong> Fanatismus führen <strong>und</strong> ist Gr<strong>und</strong> dafür, warum auch ganz<br />
vernünftig denkende Menschen teilweise nicht in der Lage sind, ein Vorurteil <strong>zu</strong> revidieren<br />
(Werth & Mayer, 2008). Für Cloerkes (2007) ist die affektive Komponente der Kern einer sozialen<br />
<strong>Einstellung</strong> gegenüber Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>.<br />
Diskriminierung (Verhaltenskomponente, behaviorale Komponente)<br />
„Diskriminierung bezeichnet den Ausdruck von Vorurteilen in ungerechtfertigt negativem oder<br />
schädlichem Verhalten gegenüber Personen aufgr<strong>und</strong> ihrer Zugehörigkeit <strong>zu</strong> einer Fremdgruppe“<br />
(Werth & Mayer, 2008, S. 380). Weitreichende Folgen der Diskriminierung können z. B. eingeschränkte<br />
soziale Teilhabe, Isolation <strong>und</strong> Rollenverlust nach sich ziehen <strong>und</strong> allgemein die Identität von<br />
Menschen bedrohen.<br />
Stigma<br />
Der Begriff Stigma ist gemäss Markowetz (2007) ein Sonderfall eines sozialen Vorurteils gegenüber<br />
einem Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong> <strong>und</strong> schreibt dieser Person negative, sogar diskreditierende Eigen-<br />
schaften <strong>zu</strong>. Stigmatisierende Bezeichnungen können z. B. „Krüppel“, „Behinderter“ <strong>und</strong> „Spastiker“<br />
sein (Speck, 2008). Das Stigma haftet gleichsam als negatives Merkmal an der Person, andere Merk-<br />
male wie ihr Charakter oder ihr Bildungsniveau können das Stigma nicht ersetzen. „Was eine solche<br />
stigmatisierte Person von der normalen her am deutlichsten <strong>und</strong> stärksten erfährt, ist die Nicht-<br />
Akzeptierung, das Vermissen von normalem Respekt <strong>und</strong> normaler Beachtung (Speck, 2008, S. 223).<br />
Die Folgen von Stigmatisierungen können Diskriminierungen <strong>mit</strong> den oben beschriebenen Folge-<br />
erscheinungen sein.
4.2 <strong>Einstellung</strong>en <strong>und</strong> Werte<br />
- 13 -<br />
Definition <strong>und</strong> Funktion von Vorurteilen<br />
Cloerkes, als Vertreter der Soziologie, beruft sich auf eine Definition aus dem Jahr 1962 von Krech,<br />
Crutschfield & Ballachey: „Eine <strong>Einstellung</strong> ist ein stabiles System von positiven oder negativen<br />
Bewertungen, gefühlsmässigen Haltungen <strong>und</strong> Handlungstendenzen in Be<strong>zu</strong>g auf ein soziales<br />
Objekt“ (1962, zitiert nach Cloerkes, 2007, S. 104). Er gibt dem Begriff „<strong>Einstellung</strong>“ gegenüber<br />
dem Begriff „Vorurteil“ den Vor<strong>zu</strong>g 7 , da er ihm neutraler erscheint <strong>und</strong> er die durchgängige<br />
Existenz von Vorurteilen gegenüber behinderten Menschen nicht als bewiesen ansieht.<br />
Markowetz (2007) stellt fest, dass Stigma wie auch Vorurteile auf der <strong>Einstellung</strong>sebene wirksam<br />
werden <strong>und</strong> ihren Ausdruck im konkreten Verhalten gegenüber Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong> haben.<br />
„<strong>Einstellung</strong>en beziehen sich auf konkrete soziale Objekte <strong>und</strong> sind abhängig von der Haltung der<br />
<strong>Einstellung</strong>sträger <strong>zu</strong> abstrakten Konstrukten (z. B. Ges<strong>und</strong>heit, Schönheit, körperliche Unversehrtheit).<br />
<strong>Einstellung</strong>serwerb <strong>und</strong> <strong>Einstellung</strong>sänderung hängen von gesellschaftlichen Norm- <strong>und</strong> Wert-<br />
vorstellungen ab. Sie stehen hinter den <strong>Einstellung</strong>en <strong>und</strong> definieren bewusst oder unbewusst die<br />
Voreingenommenheit gegenüber Behinderten“ (Markowetz, 2007, S. 291).<br />
Auch für Cloerkes (2007) stehen hinter den <strong>Einstellung</strong>en Werte. Sie stellen für ihn die entscheidende<br />
Variable in jeder Analyse des Verhältnisses zwischen Menschen <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong> dar.<br />
Je nachdem, worauf sich eine <strong>Einstellung</strong> bezieht, werden die Begriffe Vorurteil, Selbstwertgefühl<br />
<strong>und</strong> Wertvorstellungen unterschieden. Das Vorurteil bezieht sich auf die <strong>Einstellung</strong> gegenüber<br />
sozialen Gruppen, beispielsweise Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en. Das Selbstwertgefühl bezieht sich auf<br />
die <strong>Einstellung</strong>en gegenüber der eigenen Person. Wertvorstellungen beziehen sich auf <strong>Einstellung</strong>en<br />
gegenüber abstrakten Dingen, wie <strong>zu</strong>m Beispiel der Chancengerechtigkeit (Werth & Mayer, 2008).<br />
Die Mehrheit der <strong>Einstellung</strong>stheoretiker unterscheidet bei <strong>Einstellung</strong>en ebenfalls eine kognitive,<br />
eine affektive <strong>und</strong> eine behaviorale Komponente, unabhängig davon, ob die <strong>Einstellung</strong> positiv oder<br />
negativ ist. Wird in unserer empirischen Studie, bzw. im Moralinterview, <strong>zu</strong>m Ausschluss von <strong>Kindern</strong><br />
<strong>mit</strong> geistiger oder körperlicher <strong>Behinderung</strong> gefragt, ob ein behindertes Kind in die Gruppe, die<br />
schwere Mathematikaufgaben lösen muss, aufgenommen werden soll, so werden auf der kognitiven<br />
<strong>Einstellung</strong>sebene Vor- <strong>und</strong> Nachteile abgewogen. Wird das Kind gefragt, ob es gut oder schlecht<br />
sei, dass das behinderte Kind ein- oder ausgeschlossen wird, beeinflussen positive oder negative<br />
Aspekte auf der affektiven <strong>Einstellung</strong>sebene den Entscheid. Mit der Entscheidung, ob das Kind<br />
7 In der vorliegenden Masterarbeit geben wir ebenfalls – im Sinne von Cloerkes <strong>und</strong> Markowetz – dem Begriff „<strong>Einstellung</strong>“ gegenüber dem<br />
Begriff „Vorurteil“ den Vor<strong>zu</strong>g.
- 14 -<br />
Definition <strong>und</strong> Funktion von Vorurteilen<br />
selbst ein- oder ausschliesst, kommt der behaviorale Aspekt – im Sinne von Annäherung oder<br />
Vermeidung – <strong>zu</strong>m Tragen.<br />
All diese Ausführungen zeigen, dass Vorurteile, Stereotype, Stigma, Werte <strong>und</strong> <strong>Einstellung</strong>en auf<br />
unterschiedliche Weise <strong>und</strong> in unterschiedlicher Ausprägung unterschwellig aber auch offen im<br />
menschlichen Zusammenleben allgegenwärtig wirken. Erlaubt die Komplexität der oben ausgeführten<br />
Sachverhalte eine optimistische Sichtweise auf die Veränderbarkeit von <strong>Einstellung</strong>en? Die Sichtweise<br />
des Sozialpsychologen Aronson ist ermutigend, indem er sich auf Henry David Thoreaus (1817-1862)<br />
Aussage beruft: „Es ist nie <strong>zu</strong> spät, unsere Vorurteile auf<strong>zu</strong>geben“ (Aronson et al., 2004, S. 516).
5 Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
5.1 Die <strong>Kontakt</strong>hypothese als Mittel <strong>zu</strong>r Reduktion von Vorurteilen<br />
- 15 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
Wären Vorurteile rein kognitiv, dann liessen sich Stereotype durch Wissensver<strong>mit</strong>tlung <strong>und</strong> durch<br />
Neubildung von Assoziationen verändern. Da jedoch die affektive Komponente das entscheidende<br />
Merkmal des Vorurteils darstellt, ist <strong>mit</strong> logischer Argumentation <strong>und</strong> Sachwissen nicht dagegen<br />
an<strong>zu</strong>kommen. Ein immer wieder diskutiertes Mittel ist ein vermehrter <strong>Kontakt</strong> zwischen „verfeindeten“<br />
Gruppen (Werth & Mayer, 2008).<br />
Allport gilt als geistiger Vater der Vorurteilsforschung. In seinem 1954 erschienenen Standardwerk<br />
„Die Natur des Vorurteils“ (deutsche Überset<strong>zu</strong>ng 1971) definiert er den Begriff aus etymologischer<br />
Sicht. Es ist interessant, dass er dabei im Laufe der Geschichte einen Bedeutungswandel feststellt.<br />
Ursprünglich bedeutete das lateinische Wort praejudicum das, was vorausgeht (praecedens), ein Urteil,<br />
das auf vorangegangen Erfahrungen <strong>und</strong> Entscheidungen basiert (Allport, 1971). Zunehmend<br />
begann sich der Begriff <strong>zu</strong> verändern, bis er schliesslich in Allports berühmte <strong>und</strong> wohl kürzeste<br />
Definition des Vorurteils mündete: „Von anderen ohne ausreichende Begründung schlecht denken“<br />
(Allport 1971, S. 20, Hervorh. i. Orig.). Nach Allports Definition scheint hinter dem Vorurteil eine<br />
Art Denkfehler <strong>zu</strong> liegen, der <strong>zu</strong> einem unreflektierten Fehlurteil, gar <strong>zu</strong> einer Vorverurteilung führen<br />
kann. Allport weist aber über das rein negative Denken hinaus. Es gibt auch das Umgekehrte,<br />
wonach Menschen ohne ausreichende Begründung gut von anderen denken. Gemäss Allport ist<br />
das ethnische Vorurteil aber meist negativ.<br />
In seinem viel zitierten Klassiker <strong>zu</strong>r Vorurteilsproblematik beschreibt er verschiedene <strong>Kontakt</strong>arten<br />
<strong>und</strong> -bedingungen, von deren Ausprägungen die <strong>Kontakt</strong>wirkung ab<strong>zu</strong>hängen scheint. Er unterscheidet<br />
quantitative Aspekte von <strong>Kontakt</strong>, Status-, Rollen- <strong>und</strong> Persönlichkeitsaspekte <strong>und</strong> verschiedene<br />
<strong>Kontakt</strong>bereiche. Er weist da<strong>mit</strong> auf die Vielfalt des Problems hin <strong>und</strong> macht deutlich, dass die<br />
<strong>zu</strong>künftige Forschung noch weiter jede einzelne Variable in Kombination <strong>mit</strong> anderen untersuchen<br />
sollte.<br />
Allport war der Meinung, dass Intergruppenkontakt nur unter bestimmten Bedingungen <strong>zu</strong> einer<br />
Vorurteilsreduktion führen kann bzw. sich Vorurteile <strong>und</strong> Feindseligkeiten eher noch verstärken,<br />
wenn diese nicht gegeben sind. Er formuliert drei besonders wichtige Bedingungen, unter denen<br />
eine wesentlich positivere <strong>Kontakt</strong>wirkung erwartet werden darf:<br />
• Statusgleichheit: Durch <strong>Kontakt</strong> wird die Vorurteilsreduktion gefördert, wenn die inter-<br />
agierenden Personen den gleichen Status haben, d.h. wenn zwischen ihnen kein Hierarchie-<br />
gefälle besteht.
- 16 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
• Kooperation <strong>und</strong> Anstreben gemeinsamer, übergeordneter Ziele: „Einzig jene Art von<br />
<strong>Kontakt</strong>, die Leute da<strong>zu</strong> bringt, gemeinsam etwas <strong>zu</strong> tun, scheint eine Chance <strong>zu</strong>r Änderung<br />
von <strong>Einstellung</strong>en <strong>zu</strong> haben.“ (Allport 1971, S. 281, Hervorh. i. Orig.). Allport sieht hier die<br />
grösste Chance <strong>zu</strong>r Änderung, weil die gemeinsame Aufgabe Solidarität stiftet <strong>und</strong> diese<br />
Bedingung, im Gegensatz <strong>zu</strong>r Statusgleichheit, auf der Interaktionsebene liegt.<br />
• Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch Autoritäten/Institutionen: „Die Wirkung des Vorurteilsabbaus ist<br />
sehr viel grösser, wenn der <strong>Kontakt</strong> durch die öffentlichen Einrichtungen unterstützt wird<br />
(das heisst durch Gesetz, Sitten <strong>und</strong> örtliche Atmosphäre) <strong>und</strong> vorausgesetzt, der <strong>Kontakt</strong> führt<br />
<strong>zu</strong>r Entdeckung gemeinsamer Interessen <strong>und</strong> der gemeinsamen Menschlichkeit beider Gruppen“<br />
(Allport, 1971, S. 285f.).<br />
Die Kooperation <strong>und</strong> das Anstreben gemeinsamer, übergeordneter Ziele würden für die Schule<br />
bedeuten, dass gemeinsame Unternehmungen <strong>und</strong> gemeinsame Interessen mehr bewirken, als der<br />
blosse <strong>Kontakt</strong> <strong>mit</strong> gleichem Status. Der Transfer <strong>zu</strong> Feusers „Gemeinsames Lernen am gemeinsamen<br />
Gegenstand“ (Feuser, 1998, S. 19ff.) liegt nahe. Auch Aronsons (Aronson et al. 2004) beschriebene<br />
Form kooperativen Lernens, nämlich die „Jigsaw-Methode“ 8 , hat sich als wirkungsvoll erwiesen, um<br />
Vorurteile unter Schülern, die <strong>zu</strong>m Beispiel aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher ethnischer Herkunft bestehen,<br />
<strong>zu</strong> reduzieren. In unseren durchgeführten Interviews im Bereich „<strong>Kontakt</strong> <strong>zu</strong> behinderten <strong>Kindern</strong>“<br />
werden die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler <strong>zu</strong> gemeinsamen Aktivitäten innerhalb <strong>und</strong> ausserhalb der<br />
Schule <strong>und</strong> <strong>zu</strong>r Häufigkeit des <strong>Kontakt</strong>s befragt.<br />
„Ganz wesentlich scheint <strong>zu</strong> sein, dass der <strong>Kontakt</strong> unter die Oberfläche dringt, um Vorurteile wirksam<br />
<strong>zu</strong> ändern“ (Allport, 1971, S. 281). Die Intensität, die Emotionalität des <strong>Kontakt</strong>es ist wichtig. Es ist<br />
<strong>zu</strong> erwarten, dass Fre<strong>und</strong>schaften zwischen <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong>en eine zentrale<br />
Bedeutung erhalten (vgl. Kapitel 5.5).<br />
Ein weiterer, wichtiger Aspekt, den Allport aufzeigt, ist das Alter der Kinder. Bei Allport (1971)<br />
kommt es in der Vorpubertät, ungefähr im Alter von zehn Jahren, <strong>zu</strong>m ethnozentrischen Höhepunkt,<br />
indem Fremdgruppen gegenüber der Eigengruppe klar abgelehnt werden. Kinder im ersten <strong>und</strong><br />
zweiten Schuljahr wählen gemäss Allport häufig ein Kind anderer Rasse oder ethnischer Gruppen-<br />
<strong>zu</strong>gehörigkeit als Spielkameraden oder Banknachbarn. Diese Fre<strong>und</strong>lichkeit verschwindet meistens<br />
8 1971 hat Aronson in Austin (Texas) eine wirkungsvolle Unterrichtsmethode entwickelt, um Probleme zwischen Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
unterschiedlicher Ethnien <strong>zu</strong> lösen, ihre Vorurteile ab<strong>zu</strong>bauen, ihr Selbstbewusstsein <strong>zu</strong> stärken <strong>und</strong> um Verantwortung <strong>zu</strong> lernen. Jedes Mitglied<br />
der Gruppe erhält einen Teil des Unterrichtsstoffes um diesen <strong>zu</strong> bearbeiten <strong>und</strong> ver<strong>mit</strong>telt ihn anschliessend den anderen Gruppen<strong>mit</strong>gliedern.<br />
So<strong>mit</strong> kann der Lerninhalt nur erarbeitet werden, wenn jedes Mitglied seinen Teil da<strong>zu</strong> beiträgt, so<strong>zu</strong>sagen wie ein Puzzleteil (engl. jigsaw). So<strong>mit</strong><br />
ist jeder Schüler hinsichtlich der Erarbeitung des gesamten Unterrichtsstoffs von den anderen Gruppen<strong>mit</strong>gliedern abhängig. Verglichen <strong>mit</strong><br />
Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen in traditionellen Klassen zeigten Jigsaw-Schüler eine Vorurteilsreduktion <strong>und</strong> gleichzeitig eine erhöhte Sympathie für<br />
ihre Gruppenkameraden. Gleichzeitig verbesserten sich auch die Schulleistungen <strong>und</strong> das Selbstwertgefühl (Aronson et al., 2004).
- 17 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
in der 5. Klasse. Im 12. Schuljahr wird die Differenzierung dann wieder grösser, das Vorurteil ist<br />
weniger radikal. Da wir in unserer Arbeit Kinder des Kindergartens, der 2./3. <strong>und</strong> 5./6. Klasse<br />
<strong>zu</strong> ihren <strong>Kontakt</strong>verhalten befragt haben, ist Allports These bezüglich des Alters überprüfbar<br />
(vgl. Kapitel 9, Fragestellung 4).<br />
In den letzten Jahren hat die Forschung viele weitere Studien <strong>zu</strong> den Bedingungen der <strong>Kontakt</strong>hypo-<br />
these durchgeführt, wie sie Allport beschrieben <strong>und</strong> als unabdingbar bezeichnet hat. Haben sich die<br />
drei Bedingungen (Statusgleichheit, Kooperation <strong>und</strong> Anstreben gemeinsamer, übergeordneter Ziele,<br />
Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch Autoritäten/Institutionen) bestätigt?<br />
Werth <strong>und</strong> Mayer (2008) fassen den aktuellen Forschungsstand <strong>zu</strong> den Bedingungen der <strong>Kontakt</strong>-<br />
hypothese <strong>zu</strong>sammen, indem sie eine aktuelle Meta-Analyse von Pettigrew <strong>und</strong> Tropp (2006)<br />
beschreiben, die über 500 Studien <strong>zu</strong>m Thema Intergruppenkontakt auswertet. Einerseits zeigt sich,<br />
dass optimale Bedingungen die Vorurteilsreduktion im Intergruppenkontakt zwar deutlich verbessern,<br />
andererseits scheinen diese Bedingungen aber nicht zwingend notwendig <strong>zu</strong> sein. Sympathie <strong>und</strong><br />
Vertrautheit <strong>mit</strong> der Fremdgruppe erhöhen sich bereits dadurch, dass man ihr vermehrt ausgesetzt<br />
ist. Werth <strong>und</strong> Mayer kommen <strong>zu</strong> folgendem Schluss: „Entscheidend für den positiven Effekt von<br />
<strong>Kontakt</strong> ist die Reduktion von Angst-, Bedrohungs- <strong>und</strong> Unsicherheitsgefühlen, dahingehend, wie<br />
man sich gegenüber Fremdgruppen<strong>mit</strong>gliedern verhalten soll, wie man von diesen wahrgenommen<br />
<strong>und</strong> ob man von diesen akzeptiert werden wird. Durch den vermehrten <strong>Kontakt</strong> wird demnach die<br />
bedeutsame affektive Komponente von Vorurteilen beeinflusst“ (Werth <strong>und</strong> Mayer 2008, S. 417).<br />
Auch Elliot Aronson kommt in seinem Standardlehrbuch „Sozialpsychologie“ <strong>zu</strong>m Schluss, dass<br />
sich Vorurteile nur durch <strong>Kontakt</strong>e verändern lassen. „Jahrzehntelange Forschung hat Allports frühe<br />
Forderung untermauert, dass diese Bedingungen erfüllt sein müssen, bevor der <strong>Kontakt</strong> <strong>zu</strong> einer<br />
Abnahme in den Vorurteilen zwischen Gruppen führen kann“ (Aronson et al., 2004, S. 518). Er<br />
erweitert jedoch die <strong>Kontakt</strong>bedingungen nach Allport (Statusgleichheit, Kooperation <strong>und</strong> Anstreben<br />
gemeinsamer, übergeordneter Ziele, Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch Autoritäten/Institutionen) um weitere drei<br />
Bedingungen:<br />
1. Gegenseitige Abhängigkeit (z.B. gemeinsame Kooperation in Notsituationen)<br />
2. zwangloser <strong>Kontakt</strong> (z.B. Kooperation auf freiwilliger Basis ohne Zielvorgabe)<br />
3. vielfältiger <strong>Kontakt</strong> (z.B. <strong>Kontakt</strong>möglichkeiten <strong>mit</strong> verschiedenen Personen aus der Fremdgruppe)<br />
In diesem Zusammenhang zeigt Aronson auf, dass die „Macht sozialer Normen“ genutzt werden<br />
kann, um Vorurteile <strong>zu</strong> reduzieren: Wenn ein Chef eine Norm von Akzeptanz <strong>und</strong> Toleranz schafft,<br />
werden die Gruppen<strong>mit</strong>glieder ihr eigenes Verhalten verändern, um der Norm <strong>zu</strong> entsprechen.<br />
Bezogen auf den schulischen Kontext kann daraus geschlossen werden, dass Lehrpersonen <strong>zu</strong>r
- 18 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
Vorurteilsreduktion beitragen können. Wenn es ihnen gelingt, ein integrationsfre<strong>und</strong>liches Lehr-<br />
<strong>und</strong> Lernklima der Akzeptanz <strong>und</strong> Toleranz <strong>zu</strong> schaffen, leisten sie in ihrer Alltagsarbeit einen<br />
wichtigen Beitrag <strong>zu</strong>r Veränderung von Stereotypen (Aronson, 2004).<br />
5.2 Empirische Bef<strong>und</strong>e <strong>zu</strong>r <strong>Kontakt</strong>hypothese<br />
Die <strong>Kontakt</strong>wirkung zwischen Menschen <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong> wurde vor allem in zwei gross-<br />
angelegten Sek<strong>und</strong>äranalysen (je über 200 analysierte Studien) von Cloerkes <strong>und</strong> Yuker untersucht.<br />
Cloerkes (2007) bestätigt nach eigener Analyse bei fast 60% der Studien die <strong>Kontakt</strong>hypothese. Er<br />
zieht jedoch folgendes Fazit: „Zwischen <strong>Kontakt</strong> <strong>mit</strong> behinderten Menschen <strong>und</strong> den <strong>Einstellung</strong>en<br />
gegenüber Behinderten existiert eine Kausalbeziehung. Fraglich ist allerdings, ob <strong>Kontakt</strong> in dem<br />
Masse <strong>zu</strong> einer positiven Haltung gegenüber Behinderten führen kann, wie dies oft erwartet wird“<br />
(Cloerkes 1997, S. 126). Er gibt ausserdem <strong>zu</strong> bedenken, dass die <strong>Kontakt</strong>variable in vielen Studien<br />
durch wenig differenzierte Fragestellungen (z. B. „Kennen Sie einen Behinderten? Begegnen Sie<br />
regelmässig einem Behinderten?“) mangelhaft operationalisiert sei.<br />
Bei Yuker (1988) fallen die Resultate ambivalent aus. Einerseits wird mehrheitlich von positiven<br />
Auswirkungen (51%) berichtet, andererseits zeigte sich, dass bei r<strong>und</strong> 10% der untersuchten Fälle<br />
sogar negative <strong>Einstellung</strong>en entstanden. 39% der <strong>Einstellung</strong>en blieben unverändert.<br />
Beide Untersuchungen deuten darauf hin, dass minimale positive Tendenzen aus<strong>zu</strong>machen sind. Die<br />
Ergebnisse lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres auf die Situation in integrativen Schweizer Schul-<br />
klassen übertragen. Unser Forschungsvorhaben prüft deshalb die <strong>Kontakt</strong>hypothese erneut, indem<br />
sie Kindergarten- <strong>und</strong> Primarschulkinder <strong>zu</strong> ihren <strong>Kontakt</strong>erfahrungen <strong>und</strong> <strong>Einstellung</strong>en befragt.<br />
Eine Schulklasse stellt aufgr<strong>und</strong> ihrer individuellen Zusammenset<strong>zu</strong>ng eine besondere <strong>Kontakt</strong>-<br />
situation dar. Wie sieht es <strong>mit</strong> den <strong>Einstellung</strong>en von Schulkameraden gegenüber behinderten<br />
Mitschülern („peers“) aus? In Studien, die auf soziometrischen Verfahren basieren (vgl. Breitenbach &<br />
Ebert 1997, Haeberlin et al. 2003), wurden in den letzten Jahren Daten erhoben, die insgesamt <strong>zu</strong><br />
ambivalenten Aussagen kommen. Sie reichen von positiven bis <strong>zu</strong> negativen Rückwirkungen auf die<br />
<strong>Einstellung</strong>en der Schüler ohne <strong>Behinderung</strong>. Wichtig für einen positiven Effekt ist die bereits<br />
erwähnte Bedeutung der qualitativen <strong>Kontakt</strong>bedingungen.<br />
Unterscheiden sich die <strong>Einstellung</strong>en der Schüler je nachdem, ob der <strong>Kontakt</strong> <strong>zu</strong> einem Kind <strong>mit</strong><br />
geistiger bzw. körperlicher <strong>Behinderung</strong> stattfindet? Bei Schülern <strong>mit</strong> persönlichen <strong>Kontakt</strong>en <strong>zu</strong><br />
geistig behinderten Peers fand Stürmer (1977) positive <strong>Einstellung</strong>en, wogen gelegentliche, unge-<br />
wollte Begegnungen sich negativ auswirken. Bei <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> Körperbehinderungen sind die
- 19 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
Wirkungen schulischer <strong>Kontakt</strong>e günstiger als bei <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> Lernbehinderungen. Genau umge-<br />
kehrt sieht es bei Freizeitkontakten aus (Marenbach 1985).<br />
In der bereits im Kapitel 5.1 erwähnten Meta-Analyse von Pettigrew <strong>und</strong> Tropp (2006) gelten sorgfältig<br />
strukturierte <strong>Kontakt</strong>programme als besonders effektiv. Die Ergebnisse sind deutlich erfolgver-<br />
sprechender als Informationsprogramme oder unstrukturierte <strong>Kontakt</strong>e. Diese Ergebnisse sind<br />
gute Gr<strong>und</strong>lagen, um bereits die an vielen Schulen realisierten <strong>Kontakt</strong>programme (regelmässig<br />
stattfindende Projektwochen, Theaterprojekte, Pausenaktivitäten usw.) weiter aus<strong>zu</strong>bauen.<br />
5.3 Auswirkungen von <strong>Kontakt</strong>erfahrungen<br />
Der Gr<strong>und</strong>gedanke <strong>zu</strong>r integrierten Beschulung von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong> geht davon<br />
aus, dass möglichst frühzeitige <strong>und</strong> direkte <strong>Kontakt</strong>e <strong>zu</strong> einer positiven <strong>und</strong> akzeptierenden Haltung<br />
im Leben führen. Cloerkes (2007) spricht von drei theoretischen Annahmen, die der <strong>Kontakt</strong>hypothese<br />
<strong>zu</strong> Gr<strong>und</strong>e liegen <strong>und</strong> aus denen er zwei Thesen ableitet, auf die sich wiederum die meisten Arbeiten<br />
aus der Behindertenforschung stützen:<br />
Annahme 1: Durch <strong>Kontakt</strong> <strong>und</strong> Informationen können falsche „Voraus-Urteile“ korrigiert werden.<br />
Annahme 2: Der Mangel an Vertrautheit <strong>mit</strong> körperlich <strong>und</strong> geistig behinderten Menschen ist gemäss<br />
der „Gleichgewichtstheorie“ von Heider (1977) charakteristisch dafür, dass die nichtvertraute Situation<br />
als bedrohlich <strong>und</strong> der Energieaufwand ihn aus<strong>zu</strong>halten, als hoch empf<strong>und</strong>en wird. <strong>Kontakt</strong> stellt ein<br />
Mittel dar, Fremdheit in Vertrautheit um<strong>zu</strong>wandeln.<br />
Annahme 3: Es besteht eine ausgeprägte Tendenz, Personen <strong>zu</strong> mögen, <strong>mit</strong> denen durch Interaktion<br />
oder Nähe ein <strong>Kontakt</strong> besteht. Homans (1968, S. 125f) beschreibt dies folgendermassen: „Wenn<br />
sich die Häufigkeit der Interaktion zwischen zwei oder mehr Personen erhöht, so wird auch das<br />
Ausmass ihrer Zuneigung füreinander <strong>zu</strong>nehmen <strong>und</strong> vice versa“.<br />
Aufgr<strong>und</strong> dieser Annahmen formuliert Cloerkes (2007, S. 146) folgende Thesen:<br />
„1. Personen, die über <strong>Kontakt</strong>e <strong>mit</strong> Behinderten verfügen, werden günstigere <strong>Einstellung</strong>en<br />
gegenüber Behinderten zeigen als Personen, die keine derartigen <strong>Kontakt</strong>e haben oder hatten.<br />
2. Je häufiger <strong>Kontakt</strong> <strong>mit</strong> Behinderten bestanden hat, umso positiver wird die <strong>Einstellung</strong> des<br />
Betreffenden sein.“<br />
Cloerkes bemängelt, dass die qualitativen Aspekte des <strong>Kontakt</strong>s in der Forschung <strong>zu</strong> wenig Beachtung<br />
finden <strong>und</strong> hält fest, dass die Häufigkeit des <strong>Kontakt</strong>s <strong>mit</strong> behinderten Personen, nicht allein-<br />
entscheidend sei, sondern wichtige Nebenbedingungen wie die <strong>Kontakt</strong>intensität (Freude am <strong>Kontakt</strong>
- 20 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
<strong>und</strong> positive Gefühle beim Zusammensein <strong>mit</strong> Behinderten) <strong>und</strong> die Freiwilligkeit (Möglichkeit des<br />
Ausweichens in andere Beziehungen muss gewährleistet sein) eine zentrale Rolle spielen.<br />
Ursprüngliche <strong>Einstellung</strong>en – positive wie negative – haben die Tendenz sich <strong>zu</strong> verstärken.<br />
Deshalb sind positive <strong>Kontakt</strong>erlebnisses in der frühesten Kindheit von entscheidender Bedeutung.<br />
5.4 Möglichkeiten <strong>zu</strong>r <strong>Einstellung</strong>sveränderung<br />
Cloerkes (2007) skizziert, diskutiert <strong>und</strong> bewertet kritisch mögliche Strategien <strong>zu</strong>r Veränderung der<br />
sozialen Reaktion auf Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>. Es sind dies:<br />
- Informationsstrategien<br />
- <strong>Kontakt</strong><br />
- Simulation des Behindertseins bzw. Rollenspiel<br />
- Einwirkung auf persönlichkeitsspezifische Merkmale (individuelle Psychotherapie,<br />
Gruppentherapie „sensitivity training“, Training von Selbst-Einsicht etc.)<br />
- Zulassen von „originären Reaktionen“ (ursprüngliche, affektive, spontane Reaktionen)<br />
- Kombinationen verschiedener Strategien <strong>und</strong> Veränderung des normativen Kontextes<br />
Er stützt sich dabei auf Sek<strong>und</strong>äranalysen empirischer Untersuchungen <strong>und</strong> kommt <strong>zu</strong>m Schluss,<br />
dass eine gezielt einsetzbare <strong>und</strong> erfolgreiche Strategie <strong>zu</strong>r <strong>Einstellung</strong>sveränderung gegenüber<br />
behinderten Menschen noch nicht existiert.<br />
In dieser Arbeit werden exemplarisch die Informationsstrategien <strong>und</strong> die Strategien <strong>zu</strong>m <strong>Kontakt</strong><br />
erörtert, da von Interesse ist, ob sich diese als wirksame Methoden <strong>zu</strong>r <strong>Einstellung</strong>sveränderung im<br />
Kontext Schule erweisen. Es ist an<strong>zu</strong>nehmen, dass dort Informationsstrategien eingesetzt werden.<br />
Ob sie die gewünschten <strong>Einstellung</strong>sveränderungen nach sich ziehen?<br />
Informationsstrategien<br />
Dem Bemühen, dass man durch die Macht der Medien, also durch breit angelegte Informations-<br />
kampagnen, das Wissen über <strong>Behinderung</strong>en erweitern <strong>und</strong> daraus folgend, falsche Vorstellungen,<br />
negative <strong>Einstellung</strong>en <strong>und</strong> Verhaltensweisen erfolgreich beeinflussen kann, wird in der Literatur<br />
ein grosser Stellenwert eingeräumt (Cloerkes, 2007). Dahinter liegen populäre Annahmen, „<strong>zu</strong>m<br />
einen die vom Vorurteil als ,Voraus-Urteil’, <strong>zu</strong>m anderen das sogenannte ,Konsistenztheorem’“<br />
(Cloerkes, 2007, S. 138).<br />
Die Annahme des Vorurteils als „Voraus-Urteil“ (vgl. Allport, 1971, S. 20) geht davon aus, dass<br />
<strong>Einstellung</strong>en bzw. Vorurteile gelernt werden, aber nicht durch reale Erfahrungen <strong>mit</strong> dem Be<strong>zu</strong>gs-<br />
objekt, sondern durch unreflektiertes „Voraus-Urteil“, das durch genaue Prüfung <strong>und</strong> durch<br />
Wissens<strong>zu</strong>wachs revidiert werden kann.
- 21 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
Das Konsistenztheorem besagt, dass Menschen die drei Ebenen, die <strong>Einstellung</strong>en auszeichnen,<br />
nämlich die kognitive, affektive <strong>und</strong> die behaviorale Komponente in Übereinstimmung bringen<br />
wollen. Da<strong>mit</strong> sei die Reaktion auf das <strong>Einstellung</strong>sobjekt einheitlich <strong>und</strong> <strong>mit</strong> dem beobachtbaren<br />
Verhalten kongruent. Diese Annahme stützt letztlich die Vorstellung, dass es genügt, eine der<br />
Ebenen <strong>zu</strong> beeinflussen, die dann die gesamte <strong>Einstellung</strong>, bzw. auch das Verhalten verändert.<br />
Im Kapitel 4 wurde dargelegt, dass die affektive Komponente bei <strong>Einstellung</strong>sveränderungen gegen-<br />
über Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en zentral ist. Cloerkes ist überrascht, dass trotz dieser Tatsache<br />
kognitiven Strategien in der Werbung den Vor<strong>zu</strong>g gegeben wird. Er geht sogar noch einen Schritt<br />
weiter <strong>und</strong> wirft der Behindertenforschung vor, dass sie nicht vom „Irrglauben abrücken wolle, viel<br />
,Sachwissen’ sei ein sicherer Indikator für positive <strong>Einstellung</strong>en“ (Cloerkes, 2007, S. 139).<br />
Hier sei ein Beispiel aus der Teaser-Plakatkampagne 2009 der Schweizerischen Invalidenversicherung<br />
(IV) angefügt: „Behinderte liegen uns nur auf der Tasche“ (Stereotyp, kognitive Komponente) <strong>und</strong><br />
„Ich finde, Behinderte bringen unserer Gesellschaft keinen Nutzen“ (Stereotypakzeptierung, affektive<br />
Komponente). Mit diesen Provokationen versuchte die IV Vorurteile gegenüber Menschen <strong>mit</strong><br />
<strong>Behinderung</strong>en <strong>zu</strong> reduzieren, indem sie diesen Stereotypen kurze Zeit später folgenden Zusatz in<br />
anderer Farbe beifügte: „wenn wir ihre Fähigkeiten nicht nutzen“. Allerdings zeigte sich, dass für<br />
viele Behindertenorganisationen da<strong>mit</strong> eine Grenze überschritten <strong>und</strong> befürchtet wurde, dass solche<br />
Kampagnen Vorurteile eher noch zementieren könnten. Die Kampagne wurde daraufhin frühzeitig<br />
abgebrochen.<br />
Ein weiteres Problem in Be<strong>zu</strong>g auf die Beeinflussung der kognitiven Komponente ist das Prinzip<br />
der „selektiven Wahrnehmung“. Sie besagt, dass Menschen nur dann bereit für Veränderungen in<br />
ihrem Denken sind, wenn es ihnen Nutzen stiftet. Allport stellt treffend fest: „(…) Propaganda für<br />
Toleranz wird selektiv wahrgenommen. Jene, die sie nicht in ihr Inneres aufnehmen wollen, haben<br />
keine Schwierigkeiten, das <strong>zu</strong> vermeiden. Jene aber, die sie aufnehmen, haben es meistens nicht<br />
nötig“ (Allport, 1971, S. 489f). Cloerkes (2007) befürchtet, dass aufgr<strong>und</strong> selektiver Wahrnehmung<br />
sich bereits existierende ungünstige <strong>Einstellung</strong>en gegenüber Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en noch<br />
verstärken könnten. Er verstärkt dies, indem er anfügt, dass empirische Untersuchungen über die<br />
Darstellung behinderter Menschen in den Medien zeigen, dass sie mehrheitlich in negativen denn in<br />
positiven Kontexten gezeigt werden.<br />
Informationskampagnen über <strong>Behinderung</strong>en <strong>und</strong> Behinderte haben ihre Berechtigung als ergänzende<br />
Massnahme. Sie dürfen in ihrer Wirkungsmöglichkeit nicht überschätzt <strong>und</strong> die Gefahr gegenteiliger<br />
Effekte nicht unterschätzt werden (Cloerkes, 2007).<br />
Ein erfolgreiches aktuelleres Beispiel, das eher auf der affektiven Verhaltensebene an<strong>zu</strong>setzen<br />
versuchte, ist die Sendereihe „Üsi Badi“ des Schweizer Fernsehens, die im Juli <strong>und</strong> August 2010
- 22 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
ausgestrahlt wurde. Es standen sechs Menschen <strong>mit</strong> geistiger <strong>Behinderung</strong> im Mittelpunkt, die den<br />
Sommer in einer Badi verbrachten <strong>und</strong> dem Bademeister halfen, Gäste bewirteten <strong>und</strong> den<br />
Kioskbetrieb unterstützten. Gleichzeitig thematisierte Radio DRS 1 verschiedene Aspekte des<br />
Zusammenlebens <strong>mit</strong> Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>. Die Sendung war sehr erfolgreich <strong>und</strong> erhielt<br />
Mitte Oktober 2010 den Zürcher Fernsehpreis. Die Jury begründete ihren Entscheid da<strong>mit</strong>, dass es<br />
der Doku-Serie gelungen sei, ein wichtiges soziales Anliegen <strong>zu</strong> transportieren, in dem sie <strong>mit</strong> grosser<br />
Sorgfalt Liebenswürdigkeit <strong>und</strong> Respekt vor Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong> ein unverfälschtes Unter-<br />
haltungsformat <strong>zu</strong> gestalten wusste. Am 12. November 2010 startet unter dem Label „SF bi de Lüt“<br />
erneut eine Doku-Serie über Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>: „Schloss Biberstein“. Auch sie hat <strong>zu</strong>m<br />
Ziel, Menschen <strong>mit</strong> einer <strong>Behinderung</strong> authentisch, ohne falsche Sentimentalität <strong>zu</strong> Wort kommen<br />
<strong>zu</strong> lassen <strong>und</strong> dem Zuschauer Einblicke in ihren Lebensalltag <strong>zu</strong> gewähren. Der Redaktionsleiter,<br />
Tom Schmidlin, erhofft sich, eine Zuschauerzahl von 500 000 <strong>zu</strong> erreichen.<br />
Wie eingangs dieses Kapitels erwähnt, sieht Cloerkes noch keine gezielt einsetzbare, erfolgssichere<br />
Strategie <strong>zu</strong>r <strong>Einstellung</strong>sveränderung. Das ist einerseits ernüchternd <strong>und</strong> wenig ermutigend. Anderer-<br />
seits sieht er die besten Perspektiven in einer „konsequenten <strong>und</strong> sorgfältig geförderten sozialen<br />
Integration behinderter Menschen“ (Cloerkes, 2007, S. 157). Er schlägt <strong>zu</strong>dem vor, die Rahmen-<br />
bedingungen der sozialen Reaktion auf Menschen <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong> stärker in den Forschungsfokus<br />
<strong>zu</strong> nehmen. Als eine der wichtigsten dieser Rahmenbedingungen für den Abbau negativer Ein-<br />
stellungen <strong>und</strong> Handlungstendenzen betont er die „Stärkung der Handlungskompetenz behinderter<br />
Menschen“ (Cloerkes, 2007, S. 153). Durch die fachgerechte Ver<strong>mit</strong>tlung von Kenntnissen über die<br />
Mechanismen der Vorurteilsprozesse <strong>und</strong> der komplexen Interaktionsdynamik sollen Menschen <strong>mit</strong><br />
<strong>Behinderung</strong> unterstützt <strong>und</strong> gestärkt werden, sich selber kompetent <strong>und</strong> aktiv für eine Situations-<br />
verbesserung ein<strong>zu</strong>setzen. Cloerkes bezeichnet als wesentliche Vorausset<strong>zu</strong>ng, da<strong>mit</strong> <strong>Einstellung</strong>s-<br />
veränderungen stattfinden können, die „Beeinflussung der <strong>Einstellung</strong>sentwicklung“ in der frühen<br />
Kindheit wie auch die Wichtigkeit, dass Änderungsstrategien nicht isoliert auf Behinderte bezogen,<br />
sondern in ein Gesamtkonzept im Umgang <strong>mit</strong> „Verschiedenheit“ eingeb<strong>und</strong>en werden sollten<br />
(Cloerkes, 2007).<br />
Dies alles stellt letztlich einen „(heil-)pädagogischen Imperativ“ dar, den es für uns – entgegen aller<br />
pessimistisch wirkenden Perspektiven auf der Basis eines reflektierten Menschenbildes – um<strong>zu</strong>setzen<br />
gilt. Die innere Haltung beeinflusst die heilpädagogische Arbeit entscheidend.
5.5 Fre<strong>und</strong>schaft als besondere Qualität von <strong>Kontakt</strong><br />
- 23 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
Fre<strong>und</strong>schaft ist eine qualitativ hohe Form des <strong>Kontakt</strong>es <strong>und</strong> deshalb für die vorliegende Arbeit<br />
von Bedeutung.<br />
Alisch & Wagner (2006), zwei deutsche Erziehungs- <strong>und</strong> Sozialwissenschaftler <strong>mit</strong> Forschungs-<br />
schwerpunkt Kinderfre<strong>und</strong>schaften, geben in ihrem Buch „Fre<strong>und</strong>schaften unter <strong>Kindern</strong> <strong>und</strong><br />
Jugendlichen“, das aus einem Symposium über Kinderfre<strong>und</strong>schaften in Dresden hervorgegangen<br />
ist, einen rudimentären Überblick <strong>zu</strong> dieser Thematik. Im folgenden Abschnitt wird auf diese Quelle<br />
Be<strong>zu</strong>g genommen.<br />
Der Fre<strong>und</strong>schaftsforschung liegt eine Vielfalt theoretischer Ansätze <strong>zu</strong> Gr<strong>und</strong>e. In den 70-er Jahren<br />
war das Attraktionsgesetz nach Byrne bedeutsam (Alisch & Wagner, 2006). Es besagt, dass eine Person<br />
umso attraktiver erscheint, je grösser die wahrgenommene Ähnlichkeit der <strong>Einstellung</strong>en ist. In den<br />
letzten Jahren trat dieses Attraktions-Paradigma in den Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> wurde vielfach kritisiert.<br />
Ihm wird vorgeworfen, dass der Austausch von <strong>Einstellung</strong>sinformationen nicht am Anfang einer<br />
Beziehungsbildung stehe <strong>und</strong> dass Variablen wie Alter, Geschlecht sowie Bildungsniveau nicht <strong>zu</strong>m<br />
Tragen kämen. Auch nonverbales Verhalten werde <strong>zu</strong> wenig einbezogen.<br />
Die Ähnlichkeitshypothese bildet seit Jahrzehnten ein wichtiges Standbein der Fre<strong>und</strong>schaftsforschung.<br />
Sie beruft sich auf die einfache Aussage, dass Fre<strong>und</strong>e einander ähnlich seien. Ähnlichkeitsmerkmale<br />
können sein: Geschlecht, Rasse, ökonomischer Hintergr<strong>und</strong>, Leistung, Aggression, sozialer Rück<strong>zu</strong>g<br />
<strong>und</strong> soziometrischer Status (Alisch & Wagner, 2006). Einen interessanten Untersuchungsansatz<br />
innerhalb des schulischen Kontextes (9- <strong>und</strong> 10-jährige Kinder) verfolgten Kupersmidt et al. (1995).<br />
Sie interessierten sich dafür, ob sich Fre<strong>und</strong>schaften zwischen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern aus dem<br />
Anteil ähnlicher Merkmale vorhersagen lassen. Sie fanden heraus, je mehr ähnliche Merkmale<br />
übereinstimmten, desto höher war die Wahrscheinlichkeit einer Fre<strong>und</strong>schaftsbildung. Besonders<br />
bedeutsam erscheint, dass sich diese Bef<strong>und</strong>e nur für Fre<strong>und</strong>schaften im schulischen Kontext<br />
bestätigen liessen. Sie waren geringer bei Fre<strong>und</strong>schaften in der Freizeit <strong>und</strong> bei besten Fre<strong>und</strong>en<br />
waren diese Zusammenhänge so gut wie nicht vorhanden.<br />
Auch die Ähnlichkeitsforschung steht <strong>mit</strong>tlerweile in der Kritik. Unter anderem werden ihr vorge-<br />
worfen <strong>zu</strong> statisch vor<strong>zu</strong>gehen <strong>und</strong> entwicklungspsychologische Faktoren <strong>zu</strong> wenig ein<strong>zu</strong>beziehen.<br />
Die Austauschtheorie geht von der Annahme aus, dass die Kosten-Nutzen-Bilanz stimmen muss.<br />
Vereinfacht gesagt ist eine Beziehung dann stabil „wenn für beide Partner (Fre<strong>und</strong>e) die Belohnungen<br />
die Kosten übertreffen“ (Alisch & Wagner, 2006, S. 87). In diesem theoretischen Ansatz ist eine<br />
Parallele <strong>zu</strong>m integrativen Konzept sozialer Vergleichsprozesse nach Frey et al. <strong>zu</strong> erkennen<br />
(vgl. Kapitel 6).
- 24 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
Ein wichtiger theoretischer Ansatz innerhalb der Fre<strong>und</strong>schaftsforschung bildet die Bindungstheorie<br />
nach Kerns (1994), der sich auf den Begründer der Bindungstheorie von John Bowlby (Julius et al., 2009)<br />
beruft. Diese Theorie sieht in der Sicherheit der Mutterbindung eine wesentliche Vorausset<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong>r<br />
Erreichung von Fre<strong>und</strong>schaftszielen <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>schaftsqualität. Die innerhalb der Mutter-Kind-<br />
Beziehung erlernten Fertigkeiten werden vom heranwachsenden Kind auch in anderen Beziehungen<br />
eingesetzt. Es werden Arbeitsmodelle bezüglich der Erwartungen über Sozialverhalten anderer<br />
gespeichert. Das Kind interpretiert Erfahrungen <strong>mit</strong> anderen <strong>und</strong> lässt frühere Interaktionsmuster<br />
wieder aufleben, indem es sich Beziehungen aussucht, die seine Erwartungen bestätigen. Wenn eine<br />
Mutter ihr Kind beispielsweise früh <strong>zu</strong>rückweist, sucht sich das Kind später ebenfalls Partner, die es<br />
<strong>zu</strong>rückweisen, da es dieses früh erlernte <strong>und</strong> seinen Erwartungen entsprechende „Modell“ bestätigt<br />
haben möchte.<br />
Es überträgt seine Bindungserfahrungen auch auf die Lehrpersonen, das bedeutet, dass diese in der<br />
Lage sein sollten, die Bindungsbedürfnisse des Kindes wahr<strong>zu</strong>nehmen <strong>und</strong> angemessen darauf <strong>zu</strong><br />
reagieren. Gerade im Falle von Verhaltensauffälligkeiten ist dieses Hintergr<strong>und</strong>wissen für Lehr-<br />
personen bedeutsam. Gr<strong>und</strong>sätzlich sind Bindungsmuster veränderbar, sei es durch Reflexion oder<br />
durch positive, neue Bindungserfahrungen, die dem Kind einerseits in therapeutischen <strong>und</strong> anderer-<br />
seits in pädagogischen Settings ver<strong>mit</strong>telt werden können (Julius, 2001).<br />
Die Hypothesen, dass sicher geb<strong>und</strong>ene Kinder mehr soziale Kompetenz besitzen als unsicher<br />
geb<strong>und</strong>ene, sowie die Annahme, dass sich daraus ihre Fre<strong>und</strong>schaften reibungsloser gestalten, als<br />
diejenigen unsicher geb<strong>und</strong>ener Kinder, liessen sich teilweise bestätigen (vgl. Sroufe & Fleeson 1986,<br />
Park & Waters 1989).<br />
Obwohl die Bindungstheorie <strong>zu</strong> wichtigen Aspekten wie <strong>zu</strong>m Beispiel Bindung <strong>zu</strong> Vater <strong>und</strong><br />
Geschwistern, sowie weitere Dimensionen der Eltern-Kind-Beziehung vorläufig nicht auf<strong>zu</strong>zeigen<br />
vermag, veranlasst der aktuelle Forschungsstand Alisch & Wagner <strong>zu</strong> folgender, vielversprechender<br />
Aussage: „Eine differenzierte Bindungstheorie, die Komponenten anderer Ansätze integriert, könnte<br />
in ihrer Erklärungskraft anderen Theorien deutlich überlegen sein“ (Alisch & Wagner, 2006, S. 89).<br />
Auswirkungen von Fre<strong>und</strong>schaft<br />
Fre<strong>und</strong>schaften wirken sich auf verschiedenen Ebenen aus (Alisch & Wagner 2006):<br />
• Auf kognitiver Ebene bieten Fre<strong>und</strong>e Rückhalt bei Fehlern <strong>und</strong> Misserfolgen. Lernprozesse<br />
können dadurch positiv unterstützt werden. Die Hilfe leistungsstärkerer Fre<strong>und</strong>e trägt <strong>zu</strong> einer<br />
Verbesserung der Leistung bei.
- 25 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
• Auf sozialer Ebene erleichtern Fre<strong>und</strong>e die Anpassung bei Schuleintritt <strong>und</strong> Schulwechsel,<br />
fördern die Moralentwicklung <strong>und</strong> Kooperation, sind hilfreich beim Aufbau eines positiven<br />
Selbstbildes <strong>und</strong> erleichtern eine Perspektivenübernahme.<br />
• Auf emotionaler Ebene steigern Fre<strong>und</strong>e allgemeines Wohlbefinden <strong>und</strong> Sicherheitsgefühl,<br />
ermöglichen bessere Stressbewältigung <strong>und</strong> regulieren Gefühle.<br />
• Auf gesellschaftlicher Ebene sind Fre<strong>und</strong>schaften von Jugendlichen besonders bedeutsam. Sie<br />
erleichtern den Übergang von der Kindheit ins Erwachsensein, tragen bei <strong>zu</strong>r Neuorientierung<br />
<strong>und</strong> sozialen Sicherheit.<br />
Qualitätsstufen innerhalb des Fre<strong>und</strong>schaftsverständnisses<br />
Der Amerikaner Selman hat auf Gr<strong>und</strong> seiner Forschung fünf Entwicklungsstufen des Fre<strong>und</strong>-<br />
schaftsverständnisses definiert (Alisch & Wagner 2006). Die verschiedenen Entwicklungsstufen sind<br />
qualitativ unterschiedlich, integrieren aber die jeweils vorangegangene Stufe hierarchisch. Die Abfolge<br />
der Entwicklungsstufen ist invariant, was empirisch gut belegt ist (vgl. Keller & Wood 1989,<br />
Krappmann 1990, Valtin 1991).<br />
• 3 bis 7 Jahre: „Enge Fre<strong>und</strong>schaft als momentane physische Interaktion“. Fre<strong>und</strong>e sind Kinder,<br />
<strong>mit</strong> denen man gerade spielt <strong>und</strong> die in der Nähe wohnen. Gemeinsame Aktivität <strong>und</strong> räumliche<br />
Nähe sind tragend. Das Denken ist egozentrisch <strong>und</strong> verhindert eine Perspektivenübernahme.<br />
Konflikte entstehen auf dieser Stufe nicht aus der Unvereinbarkeit zweier Parteien, sondern<br />
weil materielle Dinge (Spielzeug) nicht verfügbar sind. Konflikte werden auf physischem Wege<br />
gelöst, durch körperliche Gewalt oder Abwendung.<br />
• 4 bis 9 Jahre: „Enge Fre<strong>und</strong>schaft als einseitige Hilfestellung“. Jetzt werden die eigene Perspektive<br />
<strong>und</strong> die des Fre<strong>und</strong>es voneinander unterschieden, aber noch nicht aufeinander bezogen. Ein<br />
Fre<strong>und</strong> soll den eigenen Wünschen <strong>und</strong> Bedürfnissen nachkommen. Konflikte lassen sich nur<br />
einseitig lösen, indem man entweder <strong>mit</strong> konflikterzeugendem Verhalten aufhört oder sich<br />
entschuldigt.<br />
• 6 bis 12 Jahre: „Enge Fre<strong>und</strong>schaft als Schönwetter-Kooperation“. Die Perspektivenübernahme<br />
gelingt noch nicht durchgängig, schliesst aber Wünsche <strong>und</strong> Gefühle ein. Die Einhaltung von<br />
Abmachungen wird wichtig, deren Verlet<strong>zu</strong>ng wird geahndet. Um Konflikte bei<strong>zu</strong>legen, müssen<br />
sich beide Partner bemühen. Ein Konflikt wird dann als bereinigt betrachtet, wenn jede Partei<br />
<strong>zu</strong>friedengestellt ist.<br />
• 9 bis 15 Jahre: „Enge Fre<strong>und</strong>schaft als intimer gegenseitiger Austausch“. Jetzt kann die Fre<strong>und</strong>-<br />
schaftsbeziehung aus der Perspektive eines Aussenstehenden betrachtet werden. Akzeptanz,<br />
Loyalität, Verpflichtung werden wichtig. Konfliktlösungen haben <strong>zu</strong>m Ziel, dass jeder auch an
- 26 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
Stelle des anderen <strong>mit</strong> der Lösung <strong>zu</strong>frieden ist. Dies trägt letztlich da<strong>zu</strong> bei, die Beziehung <strong>zu</strong><br />
stärken.<br />
• ab 12 Jahre: „Enge Fre<strong>und</strong>schaft als Autonomie, Verlässlichkeit <strong>und</strong> Unterstüt<strong>zu</strong>ng“. Dem<br />
Fre<strong>und</strong> wird <strong>zu</strong>gestanden, dass er sich auch in anderen sozialen Beziehungen weiterentwickeln<br />
kann. Probleme des Fre<strong>und</strong>es können die Beziehung nur dann belasten, wenn sie nicht auf<br />
Sensibilität <strong>und</strong> Verständnis des Fre<strong>und</strong>es stossen.<br />
Bigelow et al. (1996, nach Alisch & Wagner 2006) haben bei Befragungen 6- bis 13-jähriger Kinder<br />
festgestellt, dass sich etwa ab dem 9. Lebensjahr das männliche vom weiblichen Fre<strong>und</strong>schafts-<br />
verständnis unterscheidet. Während Jungs häufiger gemeinsame Aktivitäten, wie organisierte Spiele<br />
oder Sport als Gr<strong>und</strong> für eine Fre<strong>und</strong>schaft angeben, führen Mädchen Themen wie Treue, Loyalität,<br />
altruistisches Verhalten als Gründe für Fre<strong>und</strong>schaften an. Für Jungs wie auch für Mädchen scheint<br />
<strong>Kontakt</strong> wichtig <strong>zu</strong> sein, wenn auch in verschiedenen Qualitäten. Wie Kinder die Qualität einer<br />
Fre<strong>und</strong>schaft beschreiben, hat Uhlendorff (2006, nach Alisch & Wagner, 2006, S. 98ff) eindrucksvoll<br />
festgehalten: „Fragt man Kinder in der <strong>mit</strong>tleren Kindheit nach ihren Fre<strong>und</strong>en, dann berichten sie<br />
meistens nicht nur von einem oder zwei besten Fre<strong>und</strong>en, sondern von mehreren. Krappmann,<br />
Uhlendorff <strong>und</strong> Oswald (1999) zeigten, dass ausführlich interviewte Kinder (N=928) im Durchschnitt<br />
mehr als drei beste Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> zwei bis drei gute Fre<strong>und</strong>e benennen. Die Kinder gaben an, mehr<br />
beste Fre<strong>und</strong>e als gute Fre<strong>und</strong>e, mehr gute Fre<strong>und</strong>e als ,nur’ Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> mehr ,nur’ Fre<strong>und</strong>e als<br />
Spielkameraden <strong>zu</strong> haben. Dieses Ergebnismuster war stabil für Mädchen <strong>und</strong> Jungs, für Zweit-,<br />
Dritt-, Viert- <strong>und</strong> Fünftklässler.“<br />
Die Studie zeigt, dass sich die guten <strong>und</strong> besten Fre<strong>und</strong>schaften tatsächlich qualitativ von den anderen<br />
Gleichaltrigenbeziehungen abheben: Bei 90% aller beschriebenen „besten Fre<strong>und</strong>schaften“ <strong>und</strong> bei<br />
71% aller „guten Fre<strong>und</strong>schaften“ gaben die Kinder an, sich <strong>zu</strong> mögen. In den Kategorien „nur<br />
Fre<strong>und</strong>e“ <strong>mit</strong> 57% <strong>und</strong> „Spielkameraden“ <strong>mit</strong> 48% ist das deutlich weniger der Fall. Die Kinder<br />
hatten <strong>mit</strong> ihren „besten“ <strong>und</strong> „guten Fre<strong>und</strong>en“ mehr Geheimnisse, sie vertrugen sich besser,<br />
munterten sich häufiger auf, verteidigten sich eher <strong>und</strong> hatten mehr Spass als <strong>mit</strong> „nur Fre<strong>und</strong>en“<br />
oder <strong>mit</strong> „Spielkameraden“. Nicht alle Kinder haben enge Fre<strong>und</strong>schaften, wenn man als Kriterium<br />
eine gegenseitige Fre<strong>und</strong>esnennung heranzieht. Etwa 30% aller befragten Kinder hatten keine enge<br />
Fre<strong>und</strong>schaft innerhalb ihrer Schulklassen.<br />
Fre<strong>und</strong>schaftsfördernde <strong>Kontakt</strong>bedingungen<br />
„Gr<strong>und</strong>bedingung für Entstehung <strong>und</strong> Aufrechterhaltung einer Fre<strong>und</strong>schaft ist die Gelegenheit da<strong>zu</strong>“<br />
(Alisch & Wagner, 2006, S. 130). Schulischer <strong>Kontakt</strong> erfüllt gr<strong>und</strong>sätzlich diese Gr<strong>und</strong>bedingung.<br />
Forschungsergebnisse von Wehner (2005, S. 409ff) machen jedoch deutlich, dass Fre<strong>und</strong>schaften
- 27 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
bei der Entstehung <strong>und</strong> Erhaltung unterstützt werden müssen. Fre<strong>und</strong>schaften können nicht allein<br />
betrachtet werden, sondern als eingebettet in das gesamte Beziehungs- <strong>und</strong> Umgebungsgefüge der<br />
Kinder. <strong>Kindern</strong> kann diese Unterstüt<strong>zu</strong>ng in erster Linie von den Eltern geboten werden. Doch<br />
auch der Schule kommt entscheidende Bedeutung <strong>zu</strong>. Wer im Unterricht neben wem sitzt, ob<br />
Aufgaben kooperativ <strong>zu</strong> lösen sind, wer dabei <strong>mit</strong> wem <strong>zu</strong>sammenarbeiten kann oder muss, sind<br />
Beispiele für Gestaltungsspielräume, die Lehrpersonen nutzen können, um <strong>Kindern</strong> <strong>Kontakt</strong>- <strong>und</strong><br />
Interaktionsmöglichkeiten <strong>zu</strong> bieten <strong>und</strong> so<strong>mit</strong> Fre<strong>und</strong>schaftsschliessungen <strong>zu</strong> begünstigen. Die<br />
Schule schafft demnach im besten Fall qualitativ gute <strong>Kontakt</strong>bedingungen, wie sie auch Allport<br />
bzw. Aronson als Mittel <strong>zu</strong>r erfolgreichen Vorurteilsreduktion beschreiben. Es ist an<strong>zu</strong>nehmen, dass<br />
auf diesem Boden eine qualitativ hohe <strong>Kontakt</strong>form wie sie die Fre<strong>und</strong>schaft darstellt, überhaupt<br />
erst wächst.<br />
Für die Vertiefung der Fre<strong>und</strong>schaft spielt allerdings der ausserschulische Kontext eine bedeutendere<br />
Rolle. In einer Untersuchung von Hirsch <strong>und</strong> DuBois (1989) gaben 77% an, mehr über Schulfre<strong>und</strong>e,<br />
die sie auch in der Freizeit trafen, <strong>zu</strong> wissen. Weit voneinander entfernt wohnen erwies sich als<br />
Hindernis <strong>zu</strong>r Vertiefung von Fre<strong>und</strong>schaften. 46% kam auch mindestens einmal pro Woche <strong>mit</strong><br />
Fre<strong>und</strong>en aus der Nachbarschaft <strong>zu</strong>sammen, die ihre Schule besuchten.<br />
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es für Kinder wichtig ist, eine Auswahl Gleichaltriger<br />
(Kinder <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong>!) in der Nachbarschaft <strong>zu</strong> haben, einen gemeinsamen Schulweg<br />
<strong>zu</strong> teilen <strong>und</strong> auch dieselbe Schule <strong>zu</strong> besuchen. So können <strong>Kontakt</strong>e aufgebaut <strong>und</strong> allenfalls <strong>zu</strong><br />
Fre<strong>und</strong>schaften weiterentwickelt werden.<br />
In unseren durchgeführten Interviews im Bereich „<strong>Kontakt</strong> <strong>zu</strong> behinderten <strong>Kindern</strong>“ befragten wir<br />
Kindergartenkinder sowie Schüler der 2./3. Klasse <strong>und</strong> der 5./6. Klasse. Folgende drei Fragestellungen<br />
bzw. ihre Antworten werden in dieser Arbeit als mögliche Indikatoren für Fre<strong>und</strong>schaft definiert:<br />
• Könntest du dir vorstellen, <strong>mit</strong> einem geistig- bzw. körperlich behinderten Kind befre<strong>und</strong>et <strong>zu</strong><br />
sein?<br />
• Würdest du ein geistig- bzw. körperlich behindertes Kind <strong>zu</strong> dir nach Hause einladen?<br />
• Würdest du ein geistig- bzw. körperlich behindertes Kind <strong>zu</strong> deiner Geburtstagsparty einladen?<br />
Es ist von Interesse, die Ergebnisse der Befragungen <strong>mit</strong> den erläuterten Entwicklungsstufen nach<br />
Selman (1984) <strong>zu</strong> vergleichen. Daraus können allenfalls Schlüsse gezogen werden, ob innerhalb der<br />
befragten Klassen überhaupt qualitativ hochstehendere Beziehungen (Fre<strong>und</strong>schaften) zwischen<br />
<strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong> auf den verschiedenen Altersstufen möglich bzw. vorhanden<br />
sind. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass dies theoretische Konstrukte bleiben werden, da<br />
nicht von der Entscheidung („Würdest du…“) auf die reale Handlung geschlossen werden kann.
- 28 -<br />
Konzepte <strong>zu</strong>r sozialen Interaktion<br />
Von hohem Interesse ist die Frage, ob jene Kinder, die über einen qualitativ guten <strong>Kontakt</strong> in Be<strong>zu</strong>g<br />
auf die Fre<strong>und</strong>schaft verfügen die gleichen sind, die auch in der komplexen Situation <strong>mit</strong> Zielvorgabe<br />
(eine gute Note erreichen, beim Seilziehen gewinnen, im Zirkus möglichst viel Spass haben) Kinder<br />
<strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en einschliessen.
6 Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse<br />
- 29 -<br />
Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse<br />
Die bisherigen theoretischen Erörterungen basieren auf kontakthypothetischen Gr<strong>und</strong>annahmen.<br />
Diesen steht die Theorie sozialer Vergleichsprozesse gegenüber, die von anderen Annahmen ausgeht.<br />
Sie ist eine empirisch gut untersuchte Theorie innerhalb der Sozialpsychologie, die 1954 von Festinger<br />
begründet <strong>und</strong> sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt wurde. Im Folgenden wird auf das „Integrative<br />
Konzept sozialer Vergleichsprozesse“ nach Frey et al. (2001) Be<strong>zu</strong>g genommen. Dieses komplexe<br />
Modell, welches das Verhalten von einzelnen Personen in Gruppen vorhersagen <strong>und</strong> erklären soll,<br />
befasst sich ebenfalls <strong>mit</strong> der Interaktion zwischen Individuum <strong>und</strong> Gruppe, kommt jedoch <strong>zu</strong><br />
anderen Schlüssen als die <strong>Kontakt</strong>hypothese. Die zentrale Gr<strong>und</strong>annahme dieser Theorie besteht<br />
darin, dass Menschen ihre Fähigkeiten <strong>und</strong> Meinungen bewerten, indem sie sich <strong>mit</strong> einer Be<strong>zu</strong>gs-<br />
gruppe vergleichen. Dieser Vergleich hat <strong>zu</strong>m Ziel, die Diskrepanz zwischen einer Gruppe <strong>und</strong> sich<br />
selber <strong>zu</strong> verkleinern. Wenn dies nicht gelingt, so droht der Ausschluss aus der Gruppe.<br />
Informeller Gruppendruck<br />
In Gruppen herrscht ein Konfor<strong>mit</strong>ätsdruck, der sie gegen aussen als homogenes Gebilde erscheinen<br />
lässt (Frey et al., 2001). Dieser Druck bezieht sich auf individuelle <strong>und</strong> soziale Identitäten: Meinungen,<br />
Fähigkeiten, Fertigkeiten, Emotionen <strong>und</strong> soziale Position. Nach Haeberlin et al. (1999) werden<br />
Interaktionen durch eine Kosten-Nutzen-Rechnung bestimmt. Die Interaktion <strong>mit</strong> einem Schüler<br />
wird immer dann vermieden, wenn der Nutzen (positive Effekte) aus der Interaktion geringer ist als<br />
die eigenen Bemühungen. Petillon (1978) <strong>und</strong> Haeberlin et al. (1999) stellen fest, dass im Schulbereich<br />
die Wahrnehmung der anderen Schüler vorwiegend auf Schulleistungen <strong>und</strong> auf schulkonformes<br />
Verhalten kanalisiert wird. Das hätte gemäss diesen Ausführungen schwerwiegende Folgen für Kinder<br />
<strong>mit</strong> körperlicher bzw. geistiger <strong>Behinderung</strong> sowie für Kinder <strong>mit</strong> Verhaltensauffälligkeiten.<br />
In unseren durchgeführten Interviews <strong>zu</strong> moralischen Ausschlusssituationen (schulische, sportliche<br />
<strong>und</strong> soziale Gruppenaktivitäten) würden gemäss dieser Theorie nur dann Kinder <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en<br />
integriert, wenn die Gruppe einen Nutzen – auch rein moralischer Art – sieht.<br />
Verhaltensstrategien bei Diskrepanzen<br />
Frey et al. (2001) formulieren in ihrem „Integrativen Konzept sozialer Vergleichsprozesse“ vier<br />
Verhaltensstrategien. Huber (2006) fasst sie in seiner empirischen Untersuchung <strong>zu</strong>sammen. Im<br />
folgenden Abschnitt wird auf diese Quelle (Huber, 2006) Be<strong>zu</strong>g genommen. Die vier Verhaltens-<br />
strategien kommen als mögliche Anpassungsstrategien <strong>zu</strong>m Tragen, sobald das Individuum in einem<br />
Punkt von der Gruppe abweicht. Es stellt sich die Frage, inwieweit diese Strategien auch für Kinder<br />
<strong>mit</strong> geistiger oder körperlicher <strong>Behinderung</strong> anwendbar sind <strong>und</strong> deshalb werden im Anschluss an<br />
die Beschreibung der einzelnen Strategien Überlegungen da<strong>zu</strong> angestellt.
- 30 -<br />
Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse<br />
1. Änderung der eigenen Person. Eine Anpassung ist umso wahrscheinlicher, je höher der<br />
Konfor<strong>mit</strong>ätsdruck verspürt wird, je geringer die Wahrscheinlichkeit ist, in eine Alternativ-<br />
gruppe <strong>zu</strong> wechseln <strong>und</strong> je attraktiver die Be<strong>zu</strong>gsgruppe erscheint.<br />
Kinder <strong>mit</strong> geistiger bzw. körperlicher <strong>Behinderung</strong> sind mehrheitlich nicht in der Lage, ihr<br />
Verhalten willentlich <strong>zu</strong> verändern. Huber (2006, S. 48) spricht sogar von einer „gerade<strong>zu</strong><br />
zynischen Verhaltensstrategie, die den wahrgenommenen Konfor<strong>mit</strong>ätsdruck in keiner Weise<br />
verringern kann“.<br />
2a) Veränderung der Position der anderen Gruppen<strong>mit</strong>glieder. Wenn eine Veränderung der eigenen<br />
Person nicht möglich ist, besteht im Prinzip die Alternative, dass sich die anderen Gruppen-<br />
<strong>mit</strong>glieder anpassen, also ihre Positionen verändern.<br />
Auch diese Strategie scheint unrealistisch <strong>zu</strong> sein, denn die Gruppen<strong>mit</strong>glieder werden ihre<br />
eigenen Fähigkeiten nicht den geistig- oder körperbehinderten <strong>Kindern</strong> anpassen wollen.<br />
2b) Behauptung der eigenen Person. Die Behauptung der eigenen Person kann nur stattfinden,<br />
wenn der Konfor<strong>mit</strong>ätsdruck der Be<strong>zu</strong>gsgruppe nicht <strong>zu</strong> gross ist oder wenn es eine Alternativ-<br />
gruppe gibt.<br />
Diese Strategie kommt Kinder <strong>mit</strong> geistiger bzw. körperlicher <strong>Behinderung</strong> eher nicht in Frage,<br />
denn der Konfor<strong>mit</strong>ätsdruck steigt für diese Schüler je grösser der sonderpädagogische Förder-<br />
bedarf ist. Im integrativen Unterricht ist <strong>zu</strong>dem ein Ausweichen auf eine Alternativgruppe<br />
nicht realisierbar.<br />
3. Verlassen der Gruppe. Wenn die Gruppen<strong>mit</strong>glieder nicht bereit sind, ihre Position <strong>zu</strong> verändern,<br />
oder wenn keine Alternativgruppe <strong>zu</strong>r Verfügung steht <strong>und</strong> der Selbstwert durch die Änderung<br />
der eigenen Person bedroht ist, wird die Gruppe verlassen.<br />
Kinder <strong>mit</strong> geistiger bzw. körperlicher <strong>Behinderung</strong> könnten theoretisch die Klasse wechseln,<br />
meistens stehen sie jedoch nach kurzer Zeit vor denselben Problemen. Eine Umteilung in eine<br />
Sonderschule würde den Konfor<strong>mit</strong>ätsdruck vermindern, steht dem Integrationsgedanken aber<br />
entgegen.<br />
4. Ausschluss aus der Gruppe. Wenn die Gruppenidentität gefährdet ist <strong>und</strong> die Gruppe vermutet,<br />
dass sich die Person nicht anpassen wird, sowie wenn eine Gruppe die Attraktivität der Person<br />
gering achtet, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Person ausschliesst.<br />
Gerade für Kinder <strong>mit</strong> geistiger bzw. körperlicher <strong>Behinderung</strong> ist eine willentliche Anpassung an<br />
die Klassennorm schwierig <strong>und</strong> deshalb ist gemäss der Theorie der Sozialen Vergleichsprozesse<br />
eine isolierte, ungünstige soziale Position innerhalb ihrer Klasse <strong>zu</strong> vermuten.
- 31 -<br />
Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse<br />
Festinger (1954) formulierte als letzte Strategie für den Schutz des Selbstwertes einer Person:<br />
Umlenken des Vergleiches auf eine andere Vergleichsdimension.<br />
Gemeinsamer Unterricht, wie <strong>zu</strong>m Beispiel Lernen am gemeinsamen Gegenstand (Feuser, 1998) der<br />
ein zentraler Baustein eines funktionierenden integrativen Unterrichts darstellt, ermöglicht es, den<br />
Fokus auf andere Werte <strong>zu</strong> lenken. So<strong>mit</strong> kommt – wie bereits beschrieben – der Lehrperson eine<br />
wichtige Aufgabe im Rahmen eines Umlenkungsprozesses <strong>zu</strong>. Allerdings gilt es <strong>zu</strong> bedenken, dass<br />
die Art <strong>und</strong> Weise, wie ein solcher Prozess in die Praxis übertragen werden kann, aus der Forschung<br />
nicht eindeutig hervorgeht.<br />
6.1 Gegenüberstellung der <strong>Kontakt</strong>hypothese <strong>und</strong> der Theorie sozialer Vergleichsprozesse<br />
Die <strong>Kontakt</strong>hypothese entspricht einer normativen Haltung. Sie entspricht einem integrations-<br />
pädagogischen, optimistischen Ansatz <strong>und</strong> versucht durch die Berücksichtigung von günstigen<br />
Bedingungen nach Allport <strong>und</strong> Aronson (Statusgleichheit, Kooperation <strong>und</strong> gemeinsame Ziele,<br />
Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch Autoritäten/Institutionen, gegenseitige Abhängigkeit, zwangloser sowie viel-<br />
fältiger <strong>Kontakt</strong>) negative <strong>Einstellung</strong>en, Stereotypen oder gar Vorurteile <strong>zu</strong> verändern. Gemäss<br />
Werth <strong>und</strong> Mayer (2008), die sich auf eine aktuelle Meta-Analyse von Pettigrew <strong>und</strong> Tropp (2006)<br />
stützen, sind dabei für den positiven Effekt von <strong>Kontakt</strong> <strong>zu</strong>dem „die Reduktion von Angst-,<br />
Bedrohungs- <strong>und</strong> Unsicherheitsgefühlen entscheidend, dahingehend, wie man sich gegenüber<br />
Fremdgruppen<strong>mit</strong>gliedern verhalten soll, wie man von diesen wahrgenommen <strong>und</strong> ob man von<br />
diesen akzeptiert werden wird“. Hier geht es also um die Beeinflussung der affektiven Komponente,<br />
die bei der Vorurteilsreduktion entscheidend wirkt.<br />
Die <strong>Kontakt</strong>hypothese geht bezogen auf die Fragestellungen in dieser Arbeit davon aus, dass unter<br />
oben genannten Bedingungen, <strong>Kontakt</strong>e zwischen <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong>en bestenfalls<br />
<strong>zu</strong> einer nachhaltigen Verhaltensänderung führen, die das vielfältige Miteinander selbstverständlich<br />
möglich macht.<br />
Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse entspricht einem sozialpsychologischen Ansatz. Sie setzt<br />
ihren Fokus auf das Motiv, dass Menschen ihre Fähigkeiten <strong>und</strong> Meinungen bewerten <strong>und</strong> sich <strong>mit</strong><br />
einer Be<strong>zu</strong>gsgruppe vergleichen. Dieser Vergleich hat <strong>zu</strong>m Ziel, die Diskrepanz zwischen einer<br />
Gruppe <strong>und</strong> sich selber <strong>zu</strong> verkleinern. Es geht um eine Maximierung des eigenen Selbstwertes <strong>und</strong><br />
darum, dass Interaktionen erst dann stattfinden, wenn die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt. Bezogen<br />
auf die Integration von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> geistiger bzw. körperlicher <strong>Behinderung</strong> in Regelklassen stimmt<br />
diese Theorie eher nüchtern <strong>und</strong> pessimistisch. So<strong>mit</strong> sind Kinder <strong>mit</strong> <strong>Behinderung</strong>en meist von<br />
Anfang an auf dem Verliererposten, weil die Diskrepanz zwischen ihnen <strong>und</strong> der in Klassen definierten
- 32 -<br />
Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse<br />
<strong>und</strong> vom Schulsystem vorgegebenen Normen gross ist. Die von Frey et al. (2001) in ihrem Integra-<br />
tiven Konzept der sozialen Vergleichsprozesse vorgeschlagenen Verhaltensstrategien <strong>zu</strong>r Reduktion<br />
dieser Diskrepanz sind für jene Kinder mehrheitlich nicht anwendbar. Aus integrationspädagogischen<br />
Ansätzen lässt sich für den Umgang <strong>mit</strong> Heterogenität eine integrationsfördernde Wirkung vorher-<br />
sagen, aus der Theorie sozialer Vergleichsprozesse leitet sich eher integrationshemmende Wirkung<br />
ab (Huber, 2006).<br />
Einerseits hinterlässt Hubers Studie Irritation <strong>und</strong> Verunsicherung, da die Forschung <strong>mit</strong>tlerweile<br />
davon ausgeht, dass heterogene Lerngruppen für die soziale Integration förderlich sind. Ein genauer<br />
Blick auf den Inhalt seiner Untersuchung scheint uns deshalb angebracht.<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Untersuchung<br />
Huber (2006) hat in seiner empirischen Untersuchung folgende fünf integrationspädagogische<br />
Gr<strong>und</strong>annahmen für eine soziale Integration von Schülern <strong>mit</strong> Sonderförderbedarf (SFB) kritisch<br />
untersucht <strong>und</strong> folgende Widersprüche festgestellt:<br />
• Gr<strong>und</strong>annahme 1: Soziale Integration von Schülern <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne SFB ist vergleichbar.<br />
Es besteht ein Widerspruch (Huber, 2006, S. 311 ff): „Das Risiko für soziale Ausgren<strong>zu</strong>ng ist<br />
für Schüler <strong>mit</strong> SFB doppelt so hoch wie für ihre Klassenkameraden ohne SFB. Im Falle<br />
starker sozialer Ablehnung deutet sich eine verschärfte Situation an, in der Schüler <strong>mit</strong> SFB<br />
r<strong>und</strong> 5,5 Mal häufiger betroffen sind.“<br />
• Gr<strong>und</strong>annahme 2: Soziale Integration verläuft nicht über Schülermerkmale, die Schüler <strong>mit</strong><br />
SFB benachteiligen.<br />
Es besteht ein Widerspruch: Schaut man, welche Kriterien <strong>zu</strong> einer Integration führen<br />
(Intelligenz, Schulleistungen, sportlich-faires Verhalten), so sind das jene Merkmale, <strong>mit</strong> denen<br />
SFB-Schüler schwächer ausgestattet sind.<br />
• Gr<strong>und</strong>annahme 3: Normabweichungen führen nicht <strong>zu</strong> sozialer Ausgren<strong>zu</strong>ng.<br />
Es besteht ein Widerspruch: Normabweichungen ziehen auch im Gemeinsamen Unterricht<br />
soziale Ausgren<strong>zu</strong>ngen nach sich.<br />
• Gr<strong>und</strong>annahme 4: Mit wachsender Heterogenität einer Schulklasse verbessert sich die soziale<br />
Integration von Schülern <strong>mit</strong> SFB.<br />
Es besteht ein Widerspruch <strong>zu</strong> Feusers integrationspädagogischer These „Abschied <strong>zu</strong> nehmen<br />
vom Dogma der ,Homogenität’ <strong>zu</strong>gunsten grösstmöglicher Heterogenität der Lerngruppen“<br />
(Huber, 2006, S. 313): „Durch ausgeprägte Heterogenität der Lerngruppe verstärkt sich die<br />
Ausbildung sozialer Hierarchien.“
- 33 -<br />
Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse<br />
• Gr<strong>und</strong>annahme 5: Unterrichtsbezogene Faktoren können soziale Integration von Schülern <strong>mit</strong><br />
SFB beeinflussen.<br />
Verdacht auf Widerspruch (Huber, 2006, S. 313 f): „Für unterrichtsbezogene Faktoren im<br />
Allgemeinen <strong>und</strong> das Lernen am Gemeinsamen Gegenstand im Besonderen waren keine<br />
signifikanten Effekte auf die soziale Integration von Schülern <strong>mit</strong> SFB nachweisbar. (...)<br />
Einschränkend muss hier jedoch die vergleichsweise grobe Erhebung unterrichtsbezogener<br />
Faktoren erwähnt werden (...)“. Huber sieht die Chance für eine mögliche <strong>und</strong> gute soziale<br />
Integration, wenn gute Schulleistungen <strong>und</strong> Intelligenz sowie Motivation-, Selbst- <strong>und</strong> Sozial-<br />
kompetenz vorliegen. Die Chancen stehen schlecht bei aggressiv-draufgängerischem Verhalten<br />
<strong>und</strong> sozialem Rück<strong>zu</strong>g. Dem stellt die Integrationspädagogik gegenüber, dass Gemeinsamer<br />
Unterricht einer veränderten <strong>und</strong> individualisierten Leistungsbewertung folgen muss, um die<br />
soziale Integration, die für das Lernen <strong>und</strong> das Selbstkonzept zentral sind, <strong>zu</strong> ermöglichen.<br />
Es ist kritisch fest<strong>zu</strong>halten, dass in Hubers Evaluationsstudie (Huber, 2009) wichtige Komponenten<br />
wie Unterrichtsgestaltung, mehrperspektivisches Leistungsverständnis 9 <strong>und</strong> Kompetenz der Lehr-<br />
personen nicht untersucht wurden.<br />
Es stehen sich demnach widersprüchliche Theorien gegenüber. Huber kommt <strong>zu</strong>m ernüchternden<br />
Schluss, dass sich „die theoretischen Ansätze einer vornehmlich normativ ausgerichteten Integrations-<br />
pädagogik im Falle der sozialen Integration nicht <strong>mit</strong> der alltäglichen Situation im Gemeinsamen<br />
Unterricht decken. Sozial integriert ist, wer dem Sinn <strong>und</strong> Zweck der Gruppe <strong>und</strong> ihrem Werte-<br />
system am ehesten entspricht. Ausgegrenzt wird, wer davon abweicht“ (Huber, 2006, S. 325).<br />
Hubers Untersuchungen stellen <strong>zu</strong>dem in einer Schule, die das Leistungsprimat hoch hält, dem<br />
Gemeinsamen Unterricht ein schlechtes Zeugnis aus. „Innere Separation“ sei leider nach wie vor<br />
aktueller den je. Trotzdem will Hubers empirische Studie die Axiome der Integrationspädagogik<br />
nicht widerlegen, sondern aufzeigen, dass wichtige Ziele bis <strong>zu</strong>m heutigen Zeitpunkt noch nicht<br />
verwirklicht werden konnten.<br />
9 „Nur ein Mehrperspektivisches Leistungsverständnis (Prengel 1999) kann die notwendige Balance zwischen den Zielen der Forderung konventioneller<br />
Leistungen <strong>und</strong> der Offenheit für schöpferisches Tun ermöglichen. Integrationspädagogik hat <strong>zu</strong> dieser Problematik, die im Prinzip in jeder<br />
pädagogischen Situation enthalten ist, einen weiterführenden Beitrag geleistet, sie hat belegt, dass individuell angepasste Leistungsförderung den<br />
verschiedenen <strong>Kindern</strong> auf ihren verschiedenen Leistungsniveaus optimale Leistungssteigerung ermöglichen kann“ (Annedore Prengel im Beitrag<br />
,Zur Dialektik von Gleichheit <strong>und</strong> Differenz in der Bildung, Impulse der Integrationspädagogik’, in: Eberwein & Knauer, 2009, S. 146.).
Literaturverzeichnis<br />
- 105 -<br />
Literaturverzeichnis<br />
Alisch, L. & Wagner, J. (Hrsg.). (2006). Fre<strong>und</strong>schaften unter <strong>Kindern</strong> <strong>und</strong> Jugendlichen. Interdisziplinäre<br />
Perspektiven <strong>und</strong> Bef<strong>und</strong>e. Weinheim: Juventa Verlag.<br />
Allport, G. (1971). Die Natur des Vorurteils. Köln: Kiepenheuer&Witsch.<br />
Aronson E., Wilson T. D., & Akert R. M. (2004). Sozialpsychologie. München: Pearson Studium.<br />
Bächtold, A., Coradi, U., Hildbrand, J. & Strasser, U. (1990). Integration ist lernbar - Erfahrungen <strong>mit</strong><br />
schulschwierigen <strong>Kindern</strong> im Kanton Zürich. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.<br />
Bernet, W. (2010). Die “Schule für alle” braucht Zeit, der Umgang <strong>mit</strong> den Gedanken der Integration<br />
nach dem Rück<strong>zu</strong>g des Sonderpädagogischen Konzepts. NZZ, Neue Zürcher Zeitung, 2010 (21. Juni.),<br />
11.<br />
Bigelow, B.J., Tesson, G., & Lewko, J.H. (1996). Learning the rules: The anatomy of children’s relationships.<br />
New York: Guilford Press.<br />
Bless, G. & Klanghofer, R. (1991). Begabte Schüler in Integrationsklassen: Untersuchungen <strong>zu</strong>r<br />
Entwicklung von Schulleistungen, sozialen <strong>und</strong> emotionalen Faktoren. Zeitschrift für Pädagogik 1991<br />
(37), 215-223.<br />
Bless, G. (2000). Schulische <strong>und</strong> ausserschulische Integration behinderter Menschen unter psychologischen<br />
Aspekten. Lernbehinderungen. In: J. Borchert (Hrsg.), Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie.<br />
(S. 440-453). Göttingen, Bern: Hogrefe.<br />
Bless, G. (2007). Zur Wirksamkeit der Integration; Forschungsüberblick praktische Umset<strong>zu</strong>ng einer integrativen<br />
Schulform, Untersuchungen <strong>zu</strong>m Lernfortschritt. Bern: Haupt.<br />
Boban, I. & Hinz, A. (2005). Index für Inklusion. Lernen <strong>und</strong> Teilhabe in der Schule für Vielfalt entwickeln.<br />
Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität.<br />
Bracken, H.v. (1981). Vorurteile gegen behinderte Kinder, ihre Familien <strong>und</strong> Schulen. Berlin: Marhold.<br />
Breitenbach, E. & Ebert, H. (1997). Verändern Formen schulischer Kooperation die <strong>Einstellung</strong><br />
von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern gegenüber <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> geistiger <strong>Behinderung</strong>? Behindertenpädagogik<br />
BHP, 1997 (36), 53-67.<br />
Buholzer, A. (2006). Förderdiagnostisches Sehen, Denken <strong>und</strong> Handeln – Gr<strong>und</strong>lagen, Erfassungsmodell <strong>und</strong><br />
Hilfs<strong>mit</strong>tel. Donauwörth: Auer.<br />
B<strong>und</strong>schuh, K., Heimlich, U. & Krawitz, R. (2007). Integration/Inklusion In: K. B<strong>und</strong>schuh,<br />
U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), Wörterbuch Heilpädagogik. (S. 136-139). Bad Heilbrunn: Julius<br />
Klinkhardt.<br />
Cloerkes, G. (1997). Soziologie der Behinderten: Eine Einführung. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.<br />
Cloerkes, G. (2007). Soziologie der Behinderten: Eine Einführung. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.<br />
Neue Auflage.<br />
Comenius, J. A. (2007). Grosse Didaktik. Die vollständige Kunst, alle Menschen alles <strong>zu</strong> lehren. Stuttgart:<br />
Klett-Cotta.<br />
Eckhart, M. (2005). Anerkennung <strong>und</strong> Ablehnung in Schulklassen; <strong>Einstellung</strong>en <strong>und</strong> Beziehungen von Schweizer<br />
<strong>Kindern</strong> <strong>und</strong> Immigrantenkindern. Bern: Haupt.<br />
Eckhart, M. (2006). Anerkennung <strong>und</strong> Ablehnung in Schulklassen. Analysen <strong>zu</strong>r soziometrischen<br />
Stellung schulleistungsschwacher Kinder. In: Der Berufsverband der Heilpädagogen (BHP) e.V.<br />
(Hrsg.), Heilpädagogik in Praxis, Forschung <strong>und</strong> Ausbildung. Aktuelle Beiträge <strong>zu</strong>m Profil einer Handlungswissenschaft,<br />
(S. 162-169). Berlin: BHP-Verlag.
- 106 -<br />
Literaturverzeichnis<br />
Festinger, L. (1954). A Theory of social comparison process. Human Relations, 1954 (7), 117-140.<br />
Feuser, G. (1998). Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Didaktisches F<strong>und</strong>amentum<br />
einer allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In: A. Hildeschmidt & I. Schnell (Hrsg.), Integrationspädagogik<br />
auf dem Weg <strong>zu</strong> einer Schule für alle. (S. 10-35). Weinheim, München: Juventa-Verlag.<br />
Forschungsprojekt http://www.fe.luzern.phz.ch/ish/ish-projekte/umgang-<strong>mit</strong>-heterogenitaet-inschule-<strong>und</strong>-unterricht/entwicklung-moralischer-urteile-<strong>zu</strong>m-ausschluss-behinderter-kinder-inintegrativen-<strong>und</strong>-nicht-integrativen-schulklassen/<br />
(besucht am 8. Dezember 2010)<br />
Frey, D., Dauenheimer D., Parge, O. & Haisch J. (2001). Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse.<br />
In: D. Frey & M. Irle, (Hrsg.), Kognitive Theorien. Band 1. (S. 81-121). Bern: Hans Huber Verlag.<br />
Haeberlin U., Bless G., Moser U. & Klaghofer R. (1999). Die Integration von Lernbehinderten Bern: Paul<br />
Haupt.<br />
Haeberlin U., Bless G., Moser U. & Klaghofer R. (2003). Die Integration von Lernbehinderten. Bern: Paul<br />
Haupt.<br />
Heider, F. (1977). Psychologie der interpersonalen Beziehungen. Stuttgart: Klett.<br />
Heimlich, U. (2007). Gemeinsamer Unterricht. In: K. B<strong>und</strong>schuh, U. Heimlich & R. Krawitz<br />
(Hrsg.), Wörterbuch Heilpädagogik. (S. 100-104). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.<br />
Heinzel, F. & Prengel, A. (Hrsg.). (2002). Heterogenität, Integration <strong>und</strong> Differenzierung in der Primarstufe.<br />
Opladen: Vs-Verlag.<br />
Hirsch, B.J., & DuBois, D.L. (1989). The school-nonschool ecology of early adalescent friendships.<br />
In: D. Belle (Ed.), Children’s social network and social support. (pp. 260-274). New York: wiley.<br />
Homans, G.C. (1968). Theorie der sozialen Gruppe. Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag.<br />
Huber C. (2006). Soziale Integration in der Schule?! Marburg: Tectum.<br />
Huber, C. (2008). Jenseits des Modellversuchs: Soziale Integration <strong>und</strong> Inklusion. Soziale Integration<br />
von Schülern <strong>mit</strong> sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht – Eine Evaluationsstudie.<br />
Heilpädagogische Forschung, 2008 (34), 2-14.<br />
Huber, C. (2009). Gemeinsam einsam? Empirische Bef<strong>und</strong>e <strong>und</strong> praxisrelevante Ableitungen <strong>zu</strong>r<br />
sozialen Integration von Schülern <strong>mit</strong> sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen<br />
Unterricht. Zeitschrift für Heilpädagogik, 2009 (7), 242-248.<br />
IntSep. http://www.unifr.ch/spedu/uploads///dokumente/forschung/projektesnf/intsep%20<br />
ueberblick.pdf (besucht am 7. November 2008)<br />
Julius, H. (2001). Bindungstheoretisch abgeleitete, schulische Interventionen für verhaltensgestörte<br />
Kinder. Heilpädagogische Forschung Band XXVII, 2001 (4), 175-188.<br />
Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B. & Kissgen, R. (Hrsg.). (2009). Bindung im Kindesalter – Diagnostik <strong>und</strong><br />
Interventionen. Göttingen: Hogrefe.<br />
Keller, M. & Wood, P. (1989). Development of friendship reasoning: A study of interindividual<br />
differences in intraindividual change. Developmental Psychology, 1989 (25), 820-826.<br />
Kerns, K. A. (1994). A developmental model of the relations between mother-child attachment and<br />
friendship. In: E. Erber, & R. Gilmour (Eds.), Theoretical frameworks for personal relationships.<br />
(pp. 129-156). Hillsdale, NJ: Erlbaum.<br />
Klauss, T. (1996). Ist Integration leichter geworden? Zur Veränderung von <strong>Einstellung</strong>en für<br />
Realisierung von Leitideen. Geistige <strong>Behinderung</strong>, 1996 (35), 56-68.
- 107 -<br />
Literaturverzeichnis<br />
Krampen, G. (1993). Wirkung von Unterricht in der leistungsmässig heterogenen Gruppe auf<br />
Leistung, Schulangst, Schulfreude <strong>und</strong> auf den Sozialkontakt zwischen den Schülern.<br />
In: R. Olechowski & E. Persy (Hrsg.), Frühe schulische Auslese (Reihe des Ludwig Boltzmann-Instituts für<br />
Schulentwicklung, (Bd. 7, S. 121-135). Frankfurt/Main: Lang.<br />
Krappmann, L. (1990). Friendship conception and friendship performance of six- trough fifteenyear<br />
old children. Paper presented at the IV. European Conference on Developmental Psychology, Stirling<br />
/Scotlan, 1990 (August)<br />
Krappmann, L., Uhlendorff, H., & Oswald, H. (1999). Qualities of children’s friendships in middle<br />
childhood in East- and West-Berlin. In: R.K. Silbereisen, & A. v. Eye (Eds.), Growing up in times of<br />
socialchange. (pp. 91-106). Berlin, New York : de Gruyter.<br />
Kupersmidt, J.B., DeRosier, M.E., & Patterson, C.P. (1995). Similarity as the basis for children’s<br />
friendships: The roles of sociometric status, aggressive and withdrawn behaviour, academic achievement<br />
and demographic characteristics. Journal of social and Personal relationships, 1995 (12), 439-452.<br />
Maikowski, R. & Podlesch, W. (1988). Zur Sozialentwicklung behinderter <strong>und</strong> nichtbehinderter<br />
Kinder. In: Projektgruppe Integrationsversuch (Hrsg.), Das Fläming-Modell. (S. 232-250). Weinheim:<br />
Beltz.<br />
Maikowski, R. & Podlesch, W. (2002). Zur Sozialentwicklung von <strong>Kindern</strong> <strong>mit</strong> <strong>und</strong> ohne <strong>Behinderung</strong>.<br />
In: H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), Integrationspädagogik, (S. 226-238). Weinheim <strong>und</strong> Basel:<br />
Beltz.<br />
Marenbach, J. 1985). Gruppendynamik zwischen Körperbehinderten <strong>und</strong> Nichtbehinderten. Soziometrie in der<br />
Begegnung <strong>mit</strong> Körperbehinderten. Berlin: Marhold.<br />
Markowetz, R. (2007). Vorurteile. In: K. B<strong>und</strong>schuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), Wörterbuch<br />
Heilpädagogik. (S. 289-293). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.<br />
Park, K.A., & Waters, E. (1989). Security of attachment and preschool friendships. Child Development,<br />
1989 (60), 1076-1081.<br />
Pettigrew,T.F., & Tropp, L.R. (2006). A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory. Journal of<br />
Personality and Social Psychology, 2006 (90), 751-783.<br />
Prengel, A. (2006). Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit <strong>und</strong> Gleichberechtigung in interkultureller, feministischer<br />
<strong>und</strong> integrativer Pädagogik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.<br />
Prengel, A. (2009). Zur Dialektik von Gleichheit <strong>und</strong> Differenz in der Bildung, Impulse der Integrationspädagogik.<br />
In: H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), Integrationspädagogik. (S. 140- 147). Weinheim <strong>und</strong><br />
Basel: Beltz.<br />
Prengel, A. (Hrsg.). (1999). Vielfalt durch gute Ordnung im Anfangsunterricht. Opladen: Leske <strong>und</strong> Budrich.<br />
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, (EDK). (2007). Medien<strong>mit</strong>teilung vom<br />
2. 11. 2007, Konkordat Sonderpädagogik (pdf). http://www.edk.ch/dyn/12441.php<br />
(besucht am 8. Dezember 2010)<br />
Selman, R.L. (1984). Die Entwicklung des sozialen Verstehens. Entwicklungspsychologische <strong>und</strong> klinische<br />
Untersuchungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.<br />
Speck, O. (2008). System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Gr<strong>und</strong>legung. München: Ernst Reinhardt<br />
Verlag.<br />
Sroufe, L.A., & Fleeson, J. (1986). Attachment and the construction of relationships.<br />
In: W.W. Hartup, & Z. Rubin (Eds.), Relationships and development. (pp. 51-77). Hillsdale, NJ: Erlbaum.<br />
Stürmer, R. (1977). <strong>Einstellung</strong>en von Schülern gegenüber geistig behinderten <strong>Kindern</strong>. Heilpädagogische<br />
Forschung, 1977 (7), 27-55.
- 108 -<br />
Literaturverzeichnis<br />
Uhlendorff, H. (2006). Fre<strong>und</strong>schaften unter <strong>Kindern</strong> im Gr<strong>und</strong>schulalter. In: L. Alisch & J. Wagner<br />
(Hrsg.), Fre<strong>und</strong>schaften unter <strong>Kindern</strong> <strong>und</strong> Jugendlichen. Interdisziplinäre Perspektiven <strong>und</strong> Bef<strong>und</strong>e. (S. 95-105).<br />
Weinheim: Juventa Verlag.<br />
Valtin, R. (1991). Mit den Augen der Kinder. Fre<strong>und</strong>schaft, Geheimnisse, Lügen, Streit <strong>und</strong> Strafe.<br />
Reinbek: Rowohlt.<br />
Wehner, K. (2005). Wo<strong>zu</strong> Kinder Fre<strong>und</strong>e brauchen. Gruppendynamik <strong>und</strong> Organisationsberatung,<br />
2005 (4), 409-426.<br />
Werth, L. & Mayer, J. (2008). Sozialpsychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.<br />
Wocken, H. (2000). Der Zeitgeist: Behindertenfeindlich? In: F. Albrecht, A. Hinz & V. Moser<br />
(Hrsg.), Perspektiven der Sonderpädagogik. (S. 283-306). Neuwied: Luchterhand.<br />
Yuker, H.E. (1988). The effects of contract on attitudes toward disabled persons. Some empirical<br />
generalisations. In: H.E. Yuker, Attitudes toward persons with disabilities, (S. 262-274). New York: Springer.