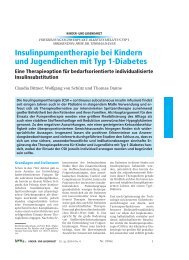Intrathekale Baclofentherapie - Palliativmaßnahme bei ... - Auf der Bult
Intrathekale Baclofentherapie - Palliativmaßnahme bei ... - Auf der Bult
Intrathekale Baclofentherapie - Palliativmaßnahme bei ... - Auf der Bult
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
LeitthemaMonatsschr Kin<strong>der</strong>heilkd 2009DOI 10.1007/s00112-009-2038-2© Springer Medizin Verlag 2009W. Voss 1 · D. Gad 2 · K.-H. Mücke 3 · H.-J. Christen 21Sozialpädiatrisches Zentrum Hannover, Kin<strong>der</strong>krankenhaus auf <strong>der</strong> <strong>Bult</strong>, Hannover2Abteilung Allgemeine Kin<strong>der</strong>heilkunde und Neuropädiatrie,Kin<strong>der</strong>krankenhaus auf <strong>der</strong> <strong>Bult</strong>, Hannover3Abteilung Pädiatrische Intensivmedizin und Kin<strong>der</strong>anästhesie,Kin<strong>der</strong>krankenhaus auf <strong>der</strong> <strong>Bult</strong>, Hannover<strong>Intrathekale</strong><strong>Baclofentherapie</strong><strong>Palliativmaßnahme</strong> <strong>bei</strong> spastischenund dystonen BewegungsstörungenDie Lebensqualität schwer behin<strong>der</strong>terKin<strong>der</strong> mit spastischen und dystonenBewegungsstörungen ist häufigdurch Schmerzen, Schlafstörungenund Unruhezustände gemin<strong>der</strong>t.Nicht selten liegen Ernährungsstörungen,Kontrakturen sowie Pflegehin<strong>der</strong>nissevor. Dank entscheiden<strong>der</strong>Fortschritte in <strong>der</strong> pädiatrischenNeurorehabilitation (Physiotherapie,Hilfsmittel und Orthesen, orale Spasmolytika,Botulinumtoxin, orthopädischeOperationen) konnte nicht nurdie Lebenserwartung, son<strong>der</strong>n auchdie Lebensqualität <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> mitschwersten Bewegungsstörungen inden vergangenen 20 Jahren erheblichverbessert werden.Das Spektrum <strong>der</strong> Maßnahmen, mit welchensowohl die Lebenserwartung vonKin<strong>der</strong>n mit schwersten Bewegungsstörungenerhöht als auch <strong>der</strong>en Lebensqualitätverbessert werden können, wird erweitertdurch die intrathekale <strong>Baclofentherapie</strong>,die seit den 1980er Jahren alsBehandlungsoption <strong>bei</strong> schwerer Spastikund Dystonie bekannt ist, bisher jedochvergleichsweise wenig Anwendung fand[23, 28].Baclofen wirkt agonistisch an GABA-B-Rezeptoren und vermag, über die Stimulationdes inhibitorischen NeurotransmittersGABA (γ-Aminobuttersäure) aufspinaler Ebene Spastik zu min<strong>der</strong>n. Einmöglicher Effekt auf Dystonie wird seinerWirkung auf zentrale GABA-A-Rezeptorenzugeschrieben [1].> Bei intrathekalerBaclofenapplikationsind bis zu 1000-fachgeringere Dosen effektivBaclofen wird nach oraler Einnahme gutresorbiert, passiert aber die Blut-Hirn-Schranke sehr schlecht. Bei vielen Patientenmit ausgeprägter Spastik ist dieBehandlung mit oralem Baclofen unzureichend[19]. Bei Dosen von 3–5 mg/kgKörpergewicht (KG) ist mit bedeutsamenNebenwirkungen wie Müdigkeit und Verwirrtheitzu rechnen [18]. Die intrathekaleApplikation von Baclofen bildet eine attraktiveAlternative, da mit einer 100- bis1000-fach geringeren Dosis hohe Liquorkonzentrationenerreicht werden und diegenannten Nebenwirkungen minimiertwerden können. Baclofen ist zur intrathekalenApplikation ab dem 6. Lebensjahrzugelassen [26].Im Jahr 1984 erfolgte die Erstbeschreibung<strong>der</strong> Anwendung von intrathekalemBaclofen (ITB) <strong>bei</strong> Spastik spinaler Ursache<strong>bei</strong> Erwachsenen [28], 1985 folgte einBericht über ein 4-jähriges Kind mit hypoxischemHirnschaden nach Submersionsunfall[11]. Eine Doppelblindstudie überdie Wirkung einer intrathekalen Baclofenbolusgabe<strong>bei</strong> Kin<strong>der</strong>n wurde 1991 publiziert[2]. Im Jahr 2000 veröffentlichtedie American Academy for Cerebral Palsyand Developmental Medicine eine systematischeAnalyse <strong>der</strong> Evidenz <strong>der</strong> Wirksamkeit<strong>der</strong> ITB-Behandlung <strong>der</strong> Spastik<strong>bei</strong> Zerebralparese [7]. Weitere Studienbefassten sich mit Beobachtungen <strong>bei</strong>Kin<strong>der</strong>n mit akuter traumatischer o<strong>der</strong>hypoxischer Hirnschädigung im Rahmen<strong>der</strong> Akutrehabilitation [18] und <strong>bei</strong> Zerebralparese[3, 8, 22, 29].Die nachfolgende Auswertung beziehtsich darüber hinaus auch auf Kin<strong>der</strong> mitprogredienten Enzephalopathien undneurodegenerativen Erkrankungen.Tab. 1 Alter und Gewicht <strong>der</strong> Patientenzum Zeitpunkt <strong>der</strong> TestungTestungPatienten (gesamtn=51)Alter [Jahre] 1,5–17,5 (Median 7,3)Geschlecht [männlich/weiblich]32/19Gewicht [kg] 9,5–64 (Median 22,3)Widmung. Herrn Dr. Hofmann gewidmet inAnerkennung seines unermesslichen Verdienstesum das Wohl behin<strong>der</strong>ter Kin<strong>der</strong>. Ohne seinEngagement und seine Kompetenz wäre dievorliegende Studie nicht möglich gewesen.Monatsschrift Kin<strong>der</strong>heilkunde 2009 |
Leitthema52 PatientenTestung<strong>bei</strong> 51 PatientenTestung<strong>bei</strong> 1 Patientnicht möglich43 Testungenmit Effekt8 Testungenohne Effekt37 PatientenPumpenimplantation6 PatientenKeine Implantation20 PatientenLangzeitbetreuungin eigenerInstitution9 PatientenLangzeitbetreuungin auswärtigerInstitution3 PatientenPumpenexplantation5 PatientenverstorbenAbb. 1 9 PatientenkollektivMethodikPatientenDie Indikation für eine intrathekale Baclofentestungund mögliche Pumpenimplantationbildeten schwere Bewegungsstörungen(Tetraspastik und/o<strong>der</strong> Dystonie),systematisch quantifiziert mit dem GM-FCS („gross motor function classificationsystem“) [27] mit erheblicher Beeinträchtigung<strong>der</strong> Lebensqualität. Diese bestand inF vegetativer Entgleisung,F dystonen Bewegungsstürmen,F Schmerzen,F Gelenkkontrakturbildung,F Unruhephasen undF daraus resultierenden Problemen <strong>bei</strong>Pflege, Transfer und Lagerung.Weitere Eingangsvoraussetzung war <strong>der</strong>fehlende o<strong>der</strong> nicht ausreichende Wirkungsnachweisoraler Spasmolytika undeiner Botulinumtoxintherapie. | Monatsschrift Kin<strong>der</strong>heilkunde 2009Mit diesen Auswahlkriterien wurdeim Zeitraum von 2001–2007 <strong>bei</strong> 52 Kin<strong>der</strong>nund Jugendlichen eine intrathekaleBaclofentestung in Betracht gezogen und<strong>bei</strong> 51 Kin<strong>der</strong>n im Alter von 1,5–17,5 Jahren(Median 7,3 Jahre) durchgeführt (<strong>bei</strong>einer Patientin wegen ausgeprägter Skoliosewar die Testung technisch nicht möglich)(. Abb. 1, . Tab. 1).Die individuellen Therapieziele wurdenvor <strong>der</strong> Testung im Behandlungsteam(Ärzte, Physiotherapeuten, Pfleger)zusammen mit den Angehörigen/Betreuernfestgelegt (. Tab. 2).TestungVor <strong>der</strong> Implantation einer Baclofenpumpewurde <strong>bei</strong> jedem Patienten die Wirkungdes intrathekal verabreichten Baclofensauf <strong>der</strong> Intensivstation unter kontinuierlicherÜberwachung <strong>der</strong> Vitalparametergetestet. Unter Allgemeinanästhesiewurde von lumbal ein Spinalkatheterbis auf Höhe <strong>der</strong> oberen Brustwirbelsäule(BWS) eingeführt und an <strong>der</strong> Austrittsstelleeinige Zentimeter unter <strong>der</strong> Hautdurchgeführt, um das Infektionsrisiko zuminimieren.Die Testungen erfolgten mittels Dauerinfusioneiner Baclofenlösung. Die Dosisvariierte initial zwischen 50 und 100 µg/Tag und wurde <strong>bei</strong> täglicher Evaluationdes Patienten entsprechend Effekt undNebenwirkung bis maximal 2000 µg/Taggesteigert. Zur Beurteilung <strong>der</strong> Therapiezieleerfolgten vor und während <strong>der</strong> Testungphysiotherapeutische Befun<strong>der</strong>hebungeninklusive Videodokumentation.Ein negatives Testergebnis lag vor,wenn Nebenwirkungen den Nutzen <strong>der</strong>ITB-Behandlung überstiegen o<strong>der</strong> dieWirkung auf die Spastik o<strong>der</strong> Dystonieausblieb. Als maximaler Zeitraum fürden Verbleib des Katheters wurden 21 Tagevorgesehen. Zur Infektionsprophylaxeerhielten die Patienten während <strong>der</strong> TestungCefotaxim i.v.
Zusammenfassung · AbstractImplantationBei 37 positiv getesteten Patienten (. Abb.1)wurden programmierbare Turbinenpumpenimplantiert. Die Operation erfolgte 4–6 Wochen nach <strong>der</strong> Testung, um das Risikoeiner Infektion und eines Liquorlecks zuminimieren. Ein Silikonkatheter wurde unterBildwandlerkontrolle von lumbal bis aufHöhe <strong>der</strong> oberen BWS vorgeschoben undanschließend vom Rücken zur im mediolateralenBauchraum subkutan implantiertenPumpe verlegt und diese an den Faszien<strong>der</strong> Bauchmuskulatur fixiert. Zur Infektionsprophylaxeerhielten die Patienten perioperativeinmalig Cefotaxim i.v.LangzeitbehandlungVon den im Zeitraum 2001 bis Ende 2007mit einer Baclofenpumpe versorgten 37 Patientenwurden 20 mit regelmäßiger Vorstellungin unserer Tagesklinik, stationärund im Sozialpädiatrischen Zentrum betreut(Beobachtungszeitraum von 2 Monatenbis zu 6 Jahren) (. Abb. 1). Weitere9 Patienten wurden in an<strong>der</strong>en Institutionenim Langzeitverlauf versorgt, in denensie auch ihre Pumpennachfüllungen erhielten.Informationen über <strong>der</strong>en Langzeitverlaufwurden über regelmäßige Telefonkontaktemit den Eltern eingeholt.Bei den von uns versorgten Patientenerfolgten die perkutan durchgeführtenPumpennachfüllungen im Rahmen einertagesklinischen Vorstellung. Da<strong>bei</strong> umfasstendie <strong>Auf</strong>füllintervalle einen Zeitraumvon 14 Tagen bis zu 6 Monaten. Bei je<strong>der</strong>Vorstellung wurden eine genaue Anamneseüber das zwischenzeitliche Befinden desPatienten erhoben und eine klinisch-neurologischeUntersuchung durchgeführt.Gegebenenfalls erfolgte eine Neuprogrammierung<strong>der</strong> Pumpe zur Optimierung desBehandlungseffektes. Bei Verdacht auf unzureichendeWirkung o<strong>der</strong> Komplikationenund Nebenwirkungen wurden diePatienten akut im Rahmen einer stationärenBehandlung versorgt.Monatsschr Kin<strong>der</strong>heilkd 2009© Springer Medizin Verlag 2009W. Voss · D. Gad · K.-H. Mücke · H.-J. Christen<strong>Intrathekale</strong> <strong>Baclofentherapie</strong>. <strong>Palliativmaßnahme</strong> <strong>bei</strong> spastischenund dystonen BewegungsstörungenZusammenfassungNutzen und Risiken <strong>der</strong> intrathekalen <strong>Baclofentherapie</strong>(ITB-Therapie) als <strong>Palliativmaßnahme</strong><strong>bei</strong> Kin<strong>der</strong>n mit schwerster Behin<strong>der</strong>ungwurden dokumentiert und bewertet,klinische Daten <strong>der</strong> Patienten, Therapieeffektesowie Nebenwirkungen und Komplikationenwurden analysiert. Über einen Spinalkathetermit Baclofen getestet wurden 51Kin<strong>der</strong> mit schwerster Spastik o<strong>der</strong> Dystonie<strong>bei</strong> einem heterogenen Spektrum von Erkrankungendes zentralen Nervensystems(ZNS). Bei 37 Patienten mit positivem Testergebniserfolgte die Implantation einer Baclofenpumpe.Bei 30 von ihnen wurden dieangestrebten Therapieziele in vollem Umfangerreicht. Die Behandlung war nebenwirkungsarm,sodass Abbrüche nicht erfor<strong>der</strong>lichwurden. Chirurgisch revisionsbedürftigeKomplikationen betrafen 6 <strong>der</strong> 37 Patientenund waren überwiegend durch Funktionsstörungendes Pumpenkatheters verursacht. DieITB-Therapie ist eine bedeutsame Maßnahmezur Verbesserung <strong>der</strong> Lebensqualität behin<strong>der</strong>terKin<strong>der</strong> mit schweren spastischenund dystonen Bewegungsstörungen. EineAbstimmung mit den Angehörigen über dieTherapieziele und eine vorangehende Testungdienen <strong>der</strong> optimalen Patientenselektionfür diese logistisch aufwändige und invasiveTherapieoption.SchlüsselwörterBaclofen · <strong>Intrathekale</strong> <strong>Baclofentherapie</strong> ·Spastik · Dystonie · PalliativmedizinIntrathecal baclofen treatment. A palliative procedure for severespasticity and dystoniaDOI 10.1007/s00112-009-2038-2AbstractIn the present study, benefits and risks of intrathecalbaclofen treatment (ITB) as a palliativetherapeutic procedure for children withsevere disability were assessed and evaluated.Clinical data of patients, treatment effects,adverse events, and complications were analyzed.Fifty-one children with severe spasticityor dystonia due to a heterogeneous spectrumof disor<strong>der</strong>s of the central nervous systemwere initially tested for baclofen efficacyusing a spinal catheter. In 37 children withpositive testing, a baclofen pump was implanted.In 30 out of 37 patients, targets ofthe therapeutic intervention were completelyachieved. With ITB, only a few minor adverseevents were reported, which did not lead toany interruption in treatment. In six of 37 patients,surgical revision of the baclofen pumpsystem was necessary, mostly due to catheterdysfunction. ITB is an important palliativeprocedure to improve quality of life in severelydisabled children and adolescents withspasticity and dystonia. Prerequisites for optimalpatient selection for this laborious andinvasive therapeutic option include baclofentesting prior to the implantation of the pumpsystem and the presetting of individual therapeutictargets together with the patient’scaregivers.KeywordsBaclofen · Intrathecal baclofen treatment ·Spasticity · Dystonia · Palliative medicineErgebnisseKollektivübersichtBei 51 Patienten wurde vor <strong>der</strong> Entscheidungüber eine Implantation einer Bac-Monatsschrift Kin<strong>der</strong>heilkunde 2009 |
LeitthemaTab. 2Tab. 3Grun<strong>der</strong>krankungHaupttherapiezieleZielePatienten (gesamt n=51)Behandlung von Schmerzen 51Unruhe 46Schlafstörungen 13Vegetativen Krisen 6Verbesserung von Pflege 24Kontrakturprophylaxe 22Sitzfähigkeit 15Lagerung 11Opisthotonus 6Gewicht 6Greifen/Manipulieren 3Beurteilung anhand <strong>der</strong> subjektiven Einschätzung von Angehörigen/BetreuernHäufigkeit verschiedener Grun<strong>der</strong>krankungen im PatientenkollektivPatientengesamt(n=51)Patientenmit Testeffekt(n=43)Zerebralparese, davon 23 19 4Asphyxie 5 3 2Periventrikuläre Leukomalazie (Zustand nach4 4 0Frühgeburt)Hirnfehlbildung 2 2 0Unklare frühkindliche Enzephalopathie mit Epilepsie 2 2 0Pränatale Hirnschädigung 1 1 0Postmeningitische Enzephalopathie 3 3 0Posttraumatische Enzephalopathie 1 0 1ALTE 1 1 0Unklare Ätiologie 4 3 1Hypoxische Hirnschädigung durch a 15 13 2Submersionsunfall 8 7 1Erstickungsunfall durch Bolus 2 2 0Stromunfall 1 0 1Narkosezwischenfall 1 1 0Hämolytisch-urämisches Syndrom 1 1 0Status epilepticus 2 2 0Stoffwechselerkrankungen, davon 7 6 1Metachromatische Leukodystrophie 3 3 0Krabbe-Leukodystrophie 1 1 0Pelizaeus-Merzbacher-Leukodystrophie 1 1 0Zitrullinämie 1 1 0Mukopolysaccharidose Sanfilippo 1 0 1Infektiöse ZNS-Erkrankung (>2 Jahre) 2 2 0Dystone Syndrome 3 2 1“neurodegeneration with brain iron accumulation“ 1 1 0Hereditäre Dystonie unklarer Genese 2 1 1Hirntumor 1 1 0Patientenohne Testeffekt(n=8)ALTE „apparent life threatening event“, ZNS zentrales Nervensystem a Im Rahmen <strong>der</strong> Frührehabilitation 9/15Patientenlofenpumpe eine intrathekale Testungdurchgeführt. Ein positiver Testeffekt war<strong>bei</strong> 43 von 51 Patienten zu verzeichnen(. Abb. 1), sodass <strong>bei</strong> ihnen die Indikationfür eine Pumpenimplantation gestelltwurde. Bei 6 dieser 43 Patienten wurde seitens<strong>der</strong> Eltern o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>er betreuen<strong>der</strong>Ärzte die Entscheidung für diese Maßnahmerevidiert. Somit erhielten schließlich37 Patienten eine intrathekale <strong>Baclofentherapie</strong>.Für die Langzeitbeurteilung<strong>der</strong>en Effektes (Beobachtungszeitraum1–72 Monate, Median 25 Monate) konnten29 Patienten einbezogen werden. Vonden mit Baclofenpumpe versorgten Patientenverstarben zwischenzeitlich 5 ohneersichtlichen Zusammenhang mit dieserBehandlungsmaßnahme. Bei 3 Patientenwurde die Pumpe explantiert.Das Alter <strong>der</strong> 51 getesteten Patientenvariierte zwischen 1,5 und 17,5 Jahren, ihrGewicht betrug minimal 9,5 kg und maximal64 kg (. Tab. 1).Die häufigsten Grun<strong>der</strong>krankungen(. Tab. 3) waren Zerebralparesen (23/51Patienten), gefolgt von hypoxischen Hirnschädigungen,meist im Rahmen von Unfällenim Kleinkindalter (15/51 Patienten).An neurometabolischen Erkrankungenlitten 7 Patienten.Die Tetraspastik bildete <strong>bei</strong> <strong>der</strong> Mehrzahl<strong>der</strong> Patienten das dominierende neurologischeSymptom, <strong>bei</strong> 11/51 Patientenbestand eine gemischte dyskinetisch-spastischeSymptomatik (. Tab. 4). Unter einerreinen Dystonie litten 3 Patienten. DerSchweregrad <strong>der</strong> Bewegungsstörung nachGMFCS entsprach mit einer Ausnahme(Stufe IV) <strong>der</strong> höchsten Stufe V. Die ausgeprägteSpastizität hatte <strong>bei</strong> 46/51 Patientenzu Kontrakturen und <strong>bei</strong> 37/51 Patientenzu einer Wirbelsäulenskoliose geführt(. Tab. 5). Eine behandlungsbedürftigeEpilepsie hatten 31/51 Patienten,über ein Gastrostoma ernährt wurden40/51 Patienten.TestungHierzu wurden Dosen von 37–2000 µg/Tag verabreicht. Die Testungen dauerteninklusive Vor- und Nachbeobachtungsphasezwischen 7 und 24 Tagen (Median16 Tage). Die Verweildauer des intraspinalenKatheters variierte zwischen 5 und21 Tagen (Median 14 Tage). Leichtere Nebenwirkungen,wie vorübergehende Müdigkeitsowie Verstärkung <strong>der</strong> Obstipationund Blasenentleerungsstörungen (ohnedie Notwendigkeit einer Katheterisierung),standen im Vor<strong>der</strong>grund und traten<strong>bei</strong> fast allen getesteten Patienten auf.In Einzelfällen wurden bedeutsame Vigilanz-,Atemregulations- und Herz-Kreis- | Monatsschrift Kin<strong>der</strong>heilkunde 2009
lauf-Störungen beobachtet, die durch intensivmedizinischeMaßnahmen raschund effektiv beherrschbar waren.Nach Absetzen des intrathekalen Baclofensund Entfernung des Testkatheterswurden die Patienten mindestens72 h überwacht. Ein Baclofenentzug mitSymptomen <strong>der</strong> vegetativen Dysregulation(wie Hyperthermie, Tachykardie undarterielle Hypotonie) musste <strong>bei</strong> 14/51 Patientenbehandelt werden. Nach einer katheterassoziiertenEnterokokkenmeningitis<strong>bei</strong> einem Patienten mit blandem Verlauferhielten alle nachfolgenden Patientenwährend <strong>der</strong> Testung Cefotaxim. Bei den28 danach getesteten Patienten traten keineInfektionen mehr auf.Tab. 4Tab. 5NebendiagnoseNeurologische Symptomatik im PatientenkolletivNeurologische SymptomatikPatienten gesamt(n=51)Nebendiagnosen im PatientenkolletivPatienten gesamt(n=51)Patienten mit Testeffekt(n=43)Tetraspastik 36 31 5Dystonie 3 2 1Gemischt dyskinetisch-spastischesSyndrom11 9 2Bis auf einen implantierten Patienten mit GMFCS Stufe IV, hatten alle einen GMFCS Stufe VPatienten mit Testeffekt(n=43)Epilepsie 31 25 6Kontrakturen 46 40 6Skoliose 37 31 6Gastrostoma <strong>bei</strong> ausgeprägterSchluckstörung40 33 7Patienten ohneTesteffekt (n=8)Patienten ohneTesteffekt (n=8)E Bei 43/51 Patienten war<strong>der</strong> Testeffekt positiv.Dies äußerte sich nicht nur in einer effektivenMin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Spastik, son<strong>der</strong>nauch in frühzeitig zu beobachtenden Verbesserungen<strong>der</strong> Lebensqualität, erkennbaran einer Min<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Schmerzenund Unruhezustände, einer Kupierung<strong>der</strong> vegetativen Krisen und einer Verbesserung<strong>der</strong> Pflegemöglichkeiten. Beson<strong>der</strong>shervorzuheben ist <strong>der</strong> Effekt <strong>bei</strong> Patientenmit dem äußerst quälenden Symptomeines Opisthotonus (n=7), <strong>der</strong> in allenFällen auf diese Weise wirksam behandeltwerden konnte. Bei 8/51 Patienten bestandkeine bedeutsame Min<strong>der</strong>ung desMuskeltonus, zudem waren gravierendedosisabhängige Nebenwirkungen des Baclofenszu verzeichnen, sodass eine Pumpenimplantationnicht in Frage kam.PumpenimplantationSie erfolgte <strong>bei</strong> allen 37/51 Patienten unterVerwendung von programmierbarenbatteriebetriebenen Turbinenpumpen.Der jüngste Patient war 18 Monate altmit einem Gewicht von 9,5 kg. Postoperativverblieben die Patienten für 3–5 Tagezur ersten Einstellung <strong>der</strong> Pumpe auf<strong>der</strong> Intensivstation. Die weitere Optimierung<strong>der</strong> Pumpeneinstellung konnte aufeiner Normalstation erfolgen. Die stationäreBehandlungsdauer im Rahmen <strong>der</strong>Baclofenpumpenimplantation betrug 8–23 Tage.Tab. 6BaclofendosisBeurteilung <strong>der</strong> ITB-Wirkung aWirkung: Therapieziel Patienten (gesamtn=37)Erreicht 30Teilweise erreicht 3Nicht erreicht 4ITB intrathekales Baclofena Anhand <strong>der</strong> subjektiven Einschätzung von Angehörigen/Betreuernund BehandlungsteamDie optimalen Baclofendosen lagen zwischen45 und 1800 µg/Tag (. Abb. 2). Patientenmit einer Dystonie benötigten in<strong>der</strong> Regel höhere Dosierungen. Einige Patientenprofitierten von einer im Tagesverlaufvariablen Baclofendosis (. Abb. 3).Vereinzelt kam es vor, dass die benötigteBaclofendosis nach <strong>der</strong> Implantation zunächstniedriger war als <strong>bei</strong> <strong>der</strong> Testung.We<strong>der</strong> die Ausgangsdosierung noch dieim Verlauf erfor<strong>der</strong>lichen individuellenDosisanpassungen ließen sich durch unterschiedlichesKörpergewicht o<strong>der</strong> Altererklären (. Abb. 4).BehandlungseffektDer Effekt <strong>der</strong> ITB-Therapie entsprach<strong>bei</strong> 30/37, also ungefähr 3/4 aller Patientenmit Baclofenpumpe auch im Langzeitverlaufin vollem Umfang den Erwartungenauf Grundlage <strong>der</strong> vorausgegangenen Testung,also den vorab formulierten Therapiezielen(. Tab. 2, 6). Lediglich <strong>bei</strong> 4/37Patienten wurde das Therapieziel verfehlt.Tab. 7 Komplikationen <strong>bei</strong> insgesamt37 Patienten aKomplikationenKatheterdislokation/-dekonnektion3Katheterknick 1Pumpentorsion 1Pumpentaschenserom 2Pumpentascheninfektion 1Meningitis im Zusammenhang1mitTestunga z. T. mehrere Komplikationen/PatientIn Teilbereichen profitierten 3/37. Die Einteilunganhand <strong>der</strong> GMFCS-Klassifikationblieb <strong>bei</strong> allen Patienten gleich. Bemerkenswerterweisebesserte sich die Spastizität<strong>bei</strong> 2 Patienten mit hypoxischer Hirnschädigungim Laufe einiger Monate sodeutlich, dass eine Nachfüllung <strong>der</strong> Pumpenicht mehr erfolgte bzw. diese explantiertwurde.PumpenkomplikationenPatienten (n)Komplikationen bezüglich Pumpe o<strong>der</strong>Katheter traten <strong>bei</strong> 6/37 Patienten auf(. Tab. 7). Am häufigsten waren eineKatheterdekonnektion bzw. -dislokationo<strong>der</strong> eine Katheterabknickung. Bei einemPatienten kam es zu einer Pumpentorsion.Bei 2 Patienten war ein Pumpentaschenseromzu verzeichnen. Insgesamt war <strong>bei</strong>6/37 Patienten eine Revision mit 7 operativenEingriffen erfor<strong>der</strong>lich (. Tab. 8).In diesem Zusammenhang erfolgte einePumpenexplantation aufgrund einesPumpentaschenseroms mit Infektion. Ei-Monatsschrift Kin<strong>der</strong>heilkunde 2009 |
LeitthemaBaclofendosis (µg/Tag)Dosis (µg/h)Baclofendosis (µg/Tag)20001800160014001200100016141210800600400200864200 10 20 30 40 50 60 70Körpergewicht (kg)01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 242000180016001400120010008006004002000ne intrathekale Infektion war <strong>bei</strong> keinem<strong>der</strong> 37 Patienten mit Baclofenpumpe zuverzeichnen.BaclofennebenwirkungenUhrzeit0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Alter (Jahre)Abb. 2 9 Tägliche intrathekaleBaclofendosisund KörpergewichtAbb. 3 9 Variable Baclofendosisim Tagesverlauf<strong>bei</strong> 12-jähriger Patientinmit metachromatischerLeukodystrophieAbb. 4 9 Tägliche intrathekaleBaclofendosisund AlterHauptnebenwirkung <strong>der</strong> intrathekalenBaclofenlangzeittherapie war die Verstärkungeiner häufig schon vorbestehendenObstipation. Weitere Nebenwirkungenbestanden in passagerer Vigilanzmin<strong>der</strong>ung<strong>bei</strong> Dosiserhöhung und rezidivierendemHarnverhalt (. Tab. 9).> Die befürchteteAnfallsprovokation durchBaclofen trat nicht aufEine Anfallsprovokation als befürchteteNebenwirkung von Baclofen wurde we<strong>der</strong><strong>bei</strong> 25/37 antiepileptisch behandeltenPatienten beobachtet noch <strong>bei</strong> jenen, diezuvor keine epileptischen Anfälle erlittenhatten.LangzeitverlaufEin Wirkungsverlust war auch im Langzeitverlaufvon bis zu 6 Jahren <strong>bei</strong> keinemPatienten zu verzeichnen, <strong>bei</strong> dem dasTherapieziel in vollem Umfang erreichtworden war (30/37). Der Behandlungseffektkonnte auch <strong>bei</strong> Patienten mit progredientenneurodegenerativen Erkrankungen,wie metachromatischer Leukodystrophie,durch mehrfache Dosisanpassungerhalten werden.Von 37 Patienten mit Baclofenpumpeverstarben 5 im Beobachtungszeitraumvon bis zu 6 Jahren (. Tab. 10). Für ihrenTod war kein Zusammenhang mit <strong>der</strong> intrathekalen<strong>Baclofentherapie</strong> ersichtlich.DiskussionDie vorliegende Anwendungsbeobachtungbelegt die Wirksamkeit <strong>der</strong> ITB-Therapie als <strong>Palliativmaßnahme</strong> für Kin<strong>der</strong>und Jugendliche mit schweren spastischenund dystonen Bewegungsstörungenund bestätigt somit die Ergebnisse vergleichbarerStudien [2, 5] und Übersichten[1]. Bei 3/4 <strong>der</strong> von uns mit dieser Methodebehandelten Kin<strong>der</strong> wurden die zuvorim Einvernehmen mit den Eltern/Betreuernformulierten Therapieziele vollständigerreicht, mit deutlicher Verbesserung<strong>der</strong> Lebensqualität. Dieser positive Effektwar in <strong>der</strong> Regel auch über einen Zeitraumvon bis zu 6 Jahren zu verzeichnen. Wenngleichdie ITB-Therapie erst ab dem 6. Lebensjahrzugelassen ist, ist sie in Einzelfällenauch <strong>bei</strong> jüngeren Patienten als Therapieoptionin Betracht zu ziehen. Der jüngstePatient, dem von uns eine Baclofenpumpeimplantiert wurde, war 1,5 Jahre alt undwog 9,5 kg.Frühere Studien über die Anwendungvon ITB <strong>bei</strong> Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichenbefassten sich mit <strong>der</strong> Wirksamkeit <strong>bei</strong>Zerebralparese und akut-hypoxischeno<strong>der</strong> -traumatischen Hirninsulten [3, 8, 18,22, 29]. In Ergänzung zu den positiven Erfahrungenin <strong>der</strong> Literatur konnte mit denhier vorgestellten Ergebnissen die Wirksamkeitdieser Therapieoption auch <strong>bei</strong>Patienten mit progredienten neurodegenerativenErkrankungen (u. a. Metachro- | Monatsschrift Kin<strong>der</strong>heilkunde 2009
matische Leukodystrophie, Morbus Krabbe,Zitrullinämie) belegt werden.Die Therapieziele waren Min<strong>der</strong>ungvon Schmerzen, Unruhezuständen undSchlafstörungen sowie die Pflegeerleichterungentsprechend <strong>der</strong> Literatur [14]. Siewurden nur <strong>bei</strong> 4 von 37 Patienten nichterreicht, obwohl die vorangegangene Testungdies hatte erwarten lassen. Erklärungenfür die Therapiemisserfolge warennicht zu eruieren.E Die Dosisfindung für Baclofen mussnach den vorliegenden Erfahrungenganz individuell erfolgen.Für die optimale Behandlungsdosis, diedie sehr weite Spanne von 45–1800 µg/Tag umfasste, waren keine Gesetzmäßigkeitenmit Bezug auf Grun<strong>der</strong>krankung,Alter, Gewicht o<strong>der</strong> Behandlungsdauer zueruieren.Die ITB-Therapie erwies sich in unserenErfahrungen als nebenwirkungsarm.Nebenwirkungen waren niemals soausgeprägt, dass sie zu einem Behandlungsabbruchführten. Wie auch in <strong>der</strong> Literaturberichtet [1], kam es zu vegetativenStörungen (Obstipation, Harnverhalt) undpassagerer Vigilanzmin<strong>der</strong>ung. Exazerbationo<strong>der</strong> Neumanifestation einer Epilepsiewurden im Einklang mit Literaturberichtennicht beobachtet [6, 12]. GravierendeNebenwirkungen wie Atemregulationsstörungo<strong>der</strong> Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungwaren nur im Rahmen <strong>der</strong> Testung inEinzelfällen zu verzeichnen.> Eine spezielle Technik <strong>der</strong>Kathetereinlage und eineantibiotische Prophylaxemin<strong>der</strong>n das InfektionsrisikoTab. 8Notwendige Maßnahmen zur Behebung von Komplikationen <strong>bei</strong> 6/37 Patienten aRevisionenPatienten (n)Revisionen gesamt, davon 6Revision <strong>der</strong> Katheter-/Pumpenlage 5Wundrevision im Bereich <strong>der</strong> Pumpentasche 1Pumpenexplantation wegen Pumpentaschenserom mit Infektion 1a Bei einem Patienten erfolgten 2 Eingriffe, sodass insgesamt 7 Revisionen vorgenommen wurdenTab. 9 Nebenwirkungen im Rahmen<strong>der</strong> intrathekalen <strong>Baclofentherapie</strong>NebenwirkungenPatienten(gesamt n=37)Obstipation 37Kurzzeitige Müdigkeit 11nach DosiserhöhungHarnverhalt 2Episode mit Bradypnoe 1und BradykardieIm Spiegel <strong>der</strong> Literatur ist diese invasive Behandlungsmaßnahmemit vielfältigen undnicht seltenen Komplikationen behaftet, namentlichInfektionen, Liquorleck und Katheterproblemenwie Dekonnektion, Brucho<strong>der</strong> Dislokation [1, 20]. Aus diesem Grundwird die ITB-Therapie im Unterschied zuErwachsenen <strong>bei</strong> Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichennoch mit relativ großer Zurückhaltungangewandt (nach Auskunft <strong>der</strong> Pumpenherstellungsfirma<strong>der</strong>zeit in Deutschlandetwa 100 Implantationen <strong>bei</strong> Kin<strong>der</strong>npro Jahr). Im Vergleich mit an<strong>der</strong>en Fallserien[13] war in unserer Klientel eine relativniedrige Komplikationsrate zu verzeichnen.16% <strong>der</strong> Patienten mit implantierter Baclofenpumpewaren von Komplikationen mitchirurgischer Revisionsbedürftigkeit betroffen.Diese resultierten überwiegend ausKatheterfunktionsstörungen (z. B. Dislokation,Dekonnektion). Eine ZNS-Infektiontrat nur <strong>bei</strong> einem Patienten im Rahmen<strong>der</strong> Testung auf. Zur Minimierung des Infektionsrisikoshaben sich eine spezielleTechnik <strong>der</strong> Kathetereinlage mit Untertunnelung<strong>bei</strong> Testung sowie die perioperativeantibiotische Prophylaxe bewährt.In <strong>der</strong> praktischen Anwendung ist diegeringe therapeutische Breite des Medikamentszu beachten. Dosissteigerungensollten insbeson<strong>der</strong>e <strong>bei</strong> ambulanter Versorgungnur in sehr kleinen Schritten vorgenommenwerden. Bei einer Überdosierungkommt es zu schwerer Muskelhypotonie,Schwäche, Ateminsuffizienz undBewusstseinsstörung [9, 10]. Umgekehrtist <strong>bei</strong> plötzlicher Unterbrechung <strong>der</strong> Medikamentenzufuhrdas Risiko einer gefährlichenEntzugssymptomatik zu beachten,die sich in einem sepsisähnlichenund lebensbedrohlichen Krankheitsbildäußern kann [17, 30].Von den 37 Kin<strong>der</strong>n mit Baclofenpumpeverstarben 5 im Beobachtungszeitraumvon bis zu 6 Jahren, ohne dass ein Zusammenhangmit dieser Therapie evident war.Dennoch besteht eine beson<strong>der</strong>e Verantwortungin <strong>der</strong> Anwendung einer invasivenMethode, da im Todesfall Fragennach einer möglichen MitverursachungTab. 10 Todesursachen <strong>der</strong> verstorbenenPatienten mit implantierterBaclofenpumpeTodesursachenPatienten (n)Tumorprogression 1Verdacht auf Stoffwechselkrise1<strong>bei</strong> ZitrullinämieKrankheitsprogression <strong>bei</strong> 2unklarer EnzephalopathieUnklar 1gestellt werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit<strong>der</strong> ausführlichen und vertrauensvollenAbstimmung mit den Eltern undihres eindeutigen Votums für diese Therapieoption.In <strong>der</strong> Literatur finden sich nurwenige Angaben zur Mortalität von Kin<strong>der</strong>nund Jugendlichen mit Baclofenpumpe.Vloeberghs et al. [29] berichteten über 2Todesfälle 1 1/2 Jahre nach Pumpenimplantationin einer Untersuchungsserie von 63Kin<strong>der</strong>n. Campbell et al. [8] beobachteten4 Todesfälle unter 21 Kin<strong>der</strong>n, ohne dass in<strong>bei</strong>den Studien kausale Zusammenhängezur Therapie erkennbar waren.Die Indikation für die ITB-Behandlungergibt sich weniger aus <strong>der</strong> Grun<strong>der</strong>krankungals vielmehr aus ihrer Symptomatik,d. h. aus <strong>der</strong> Schwere von Spastik/Dystonie, (GMFCS Stufe IV o<strong>der</strong> V), sowiedurch eine gravierende Beeinträchtigung<strong>der</strong> Lebensqualität <strong>bei</strong> Pflegehin<strong>der</strong>nissenund Schmerzen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>. AlternativeBehandlungsmöglichkeiten (oralemedikamentöse Therapie, Botulinumtoxin,Hilfsmittelversorgung, Physiotherapieund orthopädisch-chirurgische Intervention)sind vorab zu prüfen [15]. An<strong>der</strong>weitigbehandelbare Ursachen vonschwerer Spastik/Dystonie wie gastroösophagealerReflux, Hüftluxation o<strong>der</strong> Frakturmüssen ausgeschlossen sein.E Wichtige Grundlage für einegute Compliance ist eine exakteund realistische Formulierung<strong>der</strong> Therapieziele gemeinsammit Eltern/Betreuern.Monatsschrift Kin<strong>der</strong>heilkunde 2009 |
LeitthemaFür ihre Operationalisierung sind verschiedeneMessinstrumente verfügbar,die die Lebensqualität <strong>der</strong> schwer behin<strong>der</strong>tenKin<strong>der</strong> qualitativ und quantitativabbilden (Canadian Occupational PerformanceMeasure (COPM) [4], Care andComfort Hypertonicity Questionnaire(CCHQ) [25], Caregivers Priorities andChild Health Index of Life with Disabilities(CPCHILD) [24]). Für die vorliegendeAnwendungsbeobachtung ist kritischanzumerken, dass <strong>der</strong>artige Messinstrumentezur standardisierten Erfassungdes Therapieeffektes erst im Verlauf Anwendungfanden und deshalb hier nochnicht in die Auswertung einbezogen werdenkonnten. Nach unseren vorläufigenErfahrungen sind die MessinstrumenteCOPM und CCHQ gut geeignet, um dieLebensqualität vor, während und nach<strong>der</strong> Testung und <strong>der</strong> Implantation sowieim Langzeitverlauf zu erfassen. Ferner wäreim Design zukünftiger Studien wünschenswert,detailliert den Gewichtsverlauf<strong>der</strong> Patienten und ihren Body-Mass-Index vor und unter ITB-Therapie zu dokumentieren.Positive Effekte <strong>der</strong> ITB-Therapie auf die oral-motorische Funktionund den Ernährungsstatus <strong>der</strong> Patientenwurden berichtet [5, 21].Die intrathekale Baclofentestung vorPumpenimplantation dient dem Nachweisvon Wirksamkeit und Verträglichkeit dieserBehandlungsmaßnahme [1, 16]. Notwendigkeitund Nutzen <strong>der</strong> intrathekalenBaclofentestung werden in <strong>der</strong> Literaturkontrovers diskutiert [1]. Testmodalitätenumfassen einmalige Bolusgabe nach Lumbalpunktion,wie<strong>der</strong>holte Bolusgaben übereinen Spinalkatheter o<strong>der</strong> kontinuierlicheApplikation über einen Spinalkatheter mitsukzessiver Dosissteigerung. In <strong>der</strong> vorliegendenAnwendungsbeobachtung wurdebewusst <strong>der</strong> Modus <strong>der</strong> aufwändigenTestung mit kontinuierlicher intrathekalerBaclofengabe über bis zu 14 Tage gewählt,da die Klientel überwiegend aus Kin<strong>der</strong>nmit lang bestehen<strong>der</strong> Spastik o<strong>der</strong> mit progredientverlaufenden Erkrankungen bestand.Wir kamen zu dem Ergebnis, dasssich diese Vorgehensweise bewährt hat.So erwiesen sich auf Grundlage <strong>der</strong> Testergebnissenur 4 von 37 Kin<strong>der</strong>n als Therapieversager.An<strong>der</strong>erseits wurden 8 Patientenals Non-Respon<strong>der</strong> identifiziert,denen somit die Pumpenimplantation erspartblieb. Neben <strong>der</strong> Präzisierung <strong>der</strong>Indikationsstellung bietet dieses Vorgehenden Vorteil, die Eltern mit dem Nutzenund den Risiken dieser Behandlungsmaßnahmevertraut zu machen und damitihre Entscheidungsgrundlage zu festigen.Demgegenüber wird <strong>bei</strong> Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichenmit akuter Schädigung desZNS die zeitnahe Implantation im Rahmen<strong>der</strong> Frührehabilitation ohne vorherigeTestung favorisiert [18].> Die ITB-Therapie solltein den Händen einesmultidisziplinären TeamsliegenDie Anwendung <strong>der</strong> ITB-Therapie bildetauch mit Rücksicht auf die Multimorbidität<strong>der</strong> Patienten eine große logistischeHerausfor<strong>der</strong>ung. Aus diesem Grund solltedie Durchführung dieser <strong>Palliativmaßnahme</strong>in den Händen eines multidisziplinärenTeams liegen, in dem folgendeQualifikationen vertreten sind: Pädiater,Neuropädiater, Kin<strong>der</strong>-/Neurochirurg,Kin<strong>der</strong>anästhesist, Physiotherapeut.Im Sinne hoher Ergebnisqualität sollte einehinreichend große jährliche Fallzahl<strong>bei</strong> Anwendung dieser Methodik erreichtwerden, um auf dem Boden kontinuierlicherpraktischer Erfahrung die Anwendungsroutinenzu optimieren (z. B. 5 Implantationen/Jahr).Bezüglich <strong>der</strong> Strukturqualitätwird die Langzeitversorgung<strong>der</strong> Patienten optimal realisiert, wenn siein einem engen räumlichen und logistischenVerbund von SozialpädiatrischemZentrum, vollstationärem Bereich undTagesklinik erfolgt.Diese Erfahrungen und Überlegungenzum Qualitätsmanagement bilden den Inhalteines Konsensuspapiers, das im Verbundaus 5 Institutionen in Deutschlandausgear<strong>bei</strong>tet wird.Fazit für die PraxisDie Indikation für die ITB-Behandlungbesteht <strong>bei</strong> gravieren<strong>der</strong> Beeinträchtigung<strong>der</strong> Lebensqualität infolgeschwerer Spastik o<strong>der</strong> Dystonie. Es handeltsich da<strong>bei</strong> um eine Supplementärtherapieim Verbund mit an<strong>der</strong>en Maßnahmen(orale medikamentöse Therapie,Botulinumtoxin, Hilfsmittelversorgung,Physiotherapie und orthopädisch-chirurgischeIntervention).Wichtig ist eine exakte und realistischeFormulierung <strong>der</strong> Therapieziele gemeinsammit Eltern/Betreuern.Die intrathekale Baclofentestung dientdem Nachweis von Wirksamkeit und Verträglichkeitund kann die Eltern mit Nutzenund Risiken <strong>der</strong> Behandlung vertrautmachen. Bei Kin<strong>der</strong>n mit akuter Schädigungdes ZNS ist die zeitnahe Implantationauch ohne Testung sinnvoll.Die Anwendung <strong>der</strong> ITB-Therapie stellteine große logistische Herausfor<strong>der</strong>ungdar. Kritische Patientenselektion, sorgfältigeIndikationsstellung, Testung, Pumpenimplantation,langfristige Nachsorgeund Beherrschung von Komplikationenerfor<strong>der</strong>n ein multidisziplinäres und erfahrenesBehandlungsteam.KorrespondenzadresseDr. W. VossSozialpädiatrisches Zentrum Hannover,Kin<strong>der</strong>krankenhaus auf <strong>der</strong> <strong>Bult</strong>Janusz-Korczak-Allee 8, 30173 Hannovervoss@hka.deDanksagung. Der „Notgemeinschaft zur Unterstützungvon Studenten im Lande Nie<strong>der</strong>sachsen e.V.“danken wir für die großzügige und nachhaltige Unterstützung<strong>der</strong> vorliegenden Studie. Frau Prof. Dr. OlgaKordonouri, Kin<strong>der</strong>krankenhaus auf <strong>der</strong> <strong>Bult</strong>, Hannover,sei für die redaktionelle Mitar<strong>bei</strong>t an dem Manuskriptgedankt.Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autorweist auf folgende Beziehung/en hin: Herr Dr. Vossund Frau Dr. Gad wurden von <strong>der</strong> Firma Medtronic mit<strong>der</strong> Übernahme von Reisekosten für die Teilnahme anFachtagungen unterstützt.Literatur1. Albright AL (2007) Intrathecal baclofen for childhoodhypotonia. Childs Nerv Syst 23:971–9792. Albright AL, Cervi A, Singletary J (1991) Intrathecalbaclofen for spasticity in cerebral palsy. JAMA20(265):1418–14223. Awaad Y, Tayem H, Munoz S et al (2003) Functionalassessment following intrathecal baclofen therapyin children with spastic cerebral palsy. J Child Neurol18:26–344. Barry MJ, Albright L (1996) Use of the Canadian occupationalperformance measure as an outcomemeasure for intrathecal baclofen therapy. PediatrPhys Ther 8:183–1845. Bjornson KF, McLaughlin JF, Loeser JD et al (2003)Oral motor, communication, and nutritional statusof children during intrathecal baclofen therapy:a descriptive pilot study. Arch Phys Med Rehabil84:500–506 | Monatsschrift Kin<strong>der</strong>heilkunde 2009
6. Buonaguro V, Scelsa B, Curci D et al (2005) Epilepsyand intrathecal baclofen therapy in children withcerebral palsy. Pediatr Neurol 33:110–1137. Butler C, Campbell S (2000) AACPDM TreatmentOutcomes Committee review panel: evidence ofthe effects of intrathecal baclofen for spastic anddystonic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol42:634–6458. Campbell WM, Ferrel A, McLaughlin JF et al (2002)Long-term safety and efficacy of continuous intrathecalbaclofen. Dev Med Child Neurol 44:660–6659. Chapple D, Johnson D, Connors R (2001) Baclofenoverdose in two siblings. Pediatr Emerg Care17:110–11210. Darbari FP, Melvin JJ, Piatt JH Jr et al (2005) Intrathecalbaclofen overdose followed by withdrawal:clinical and EEG features. Pediatr Neurol 33:373–37711. Dralle D, Muller H, Zierski J, Klug N (1985) Intrathecalbaclofen for spasticity. Lancet 2:100312. Gilmartin R, Bruce D, Storrs BB et al (2000) Intrathecalbaclofen for management of spastic cerebralpalsy: multicenter trial. J Child Neurol 15:71–7713. Gooch JL, Oberg WA, Grams B et al (2003) Complicationsof intrathecal baclofen pump in children.Pediatr Neursurg 39:1–614. Gooch JL, Oberg WA, Grams B et al (2004) Care giverassessment of intrathecal baclofen in children.Dev Med Child Neurol 46:548–55215. Heinen F, Schrö<strong>der</strong> AS, Dö<strong>der</strong>lein L et al (2009)Therapiekurven-CP Motorik. Monatsschr Kin<strong>der</strong>heilkd157:789–79416. Hoving MA, Van Raak EPM, Palmans LJ et al (2007)Intrathecal baclofen in children with spastic cerebralpalsy: a double-blind, randomized, placebo-controlled,dose-finding study. Dev Med ChildNeurol 49:654–65917. Kao LW, Amin Y, Kirk MA, Turner MS (2002) Intrathecalbaclofen withdrawal mimicking sepsis. JEmerg Med 24:423–42718. Kluger G, Lütjen S, Granel M (2003) Die intrathekale<strong>Baclofentherapie</strong> (ITB) <strong>bei</strong> Kin<strong>der</strong>n mitschwerer Spastik und/o<strong>der</strong> Dystonie: 15 Jahre Erfahrung<strong>bei</strong> 68 Patienten. Neuropadiatr Klin Prax1:18–2419. Knutsson E, Lindblom U, Martensson A (1974)Plasma and cerebrospinal fluid levels of baclofen(Lioresal) at optimal therapeutic responses in spasticparesis. J Neurol Sci 23:473–48420. Kolanski K, Logan LR (2007) A review of the complicationsof ITB in patients with CP. NeuroRehabilitation22:383–39521. McCoy AA, Fox MA, Schaubel DE, Ayyangar RN(2006) Weight gain in children with hypertoniaof cerebral origin receiving intrathecal baclofentherapy. Arch Phys Med Rehabil 87:1503–150822. Murphy NA, Irwin MC, Hoff C (2002) Intrathecal baclofentherapy in children with cerebral palsy: efficacyand complications. Arch Phys Med Rehabil83:1721–172523. Narayan RK, Loubser PG, Jankovic J et al (1991) Intrathecalbaclofen for intractable axial dystonia.Neurology 41:1141–114224. Narayanan UG, Fehlings D, Weir S et al (2006) Initialdevelopment and validation of the CaregiverPriorities and Child Health Index of Life with Disabilities(CPCHILD). Dev Med Child Neurol 48:804–81225. Nemer MR, Blasco PA, Russman BS, O’Malley JP(2006) Validation of a care and comfort hypertonicityquestionnaire. Dev Med Child Neurol 48:181–18726. Novartis Pharma (2006) Lioresal intrathecal, Gebrauchsinformationund Fachinformation. NovartisPharma, Nürnberg27. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S et al (1997) Developmentand reliability of a system to classifygross motor function in children with cerebral palsy.Dev Med Child Neurol 39:214–22328. Penn RD, Kroin JS (1984) Intrathecal baclofen alleviatesspinal cord spasticity. Lancet 1:107829. Vloeberghs M, Keetley R, Morton R (2005) Intrathecalbaclofen in the management of spasticitydue to cerebral palsy. Pediatr Rehabil 8:172–17930. Zuckerbraun NS, Ferson SS, Albright AL, Vogeley E(2004) Intrathecal baclofen withdrawal: emergentrecognition and management. Pediatr Emerg Care20:759–764Monatsschrift Kin<strong>der</strong>heilkunde 2009 |