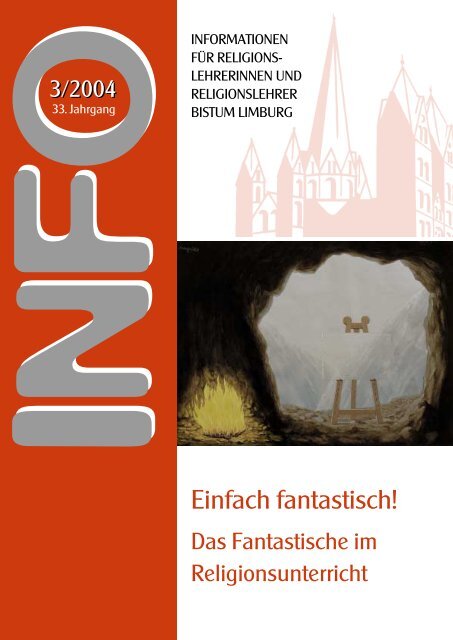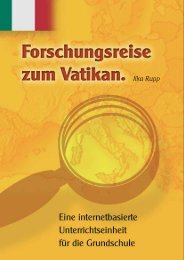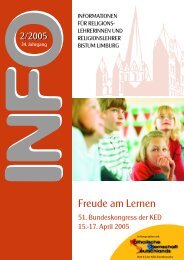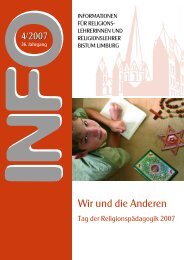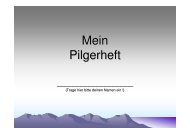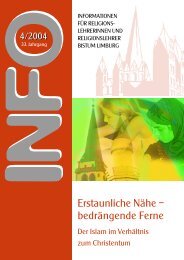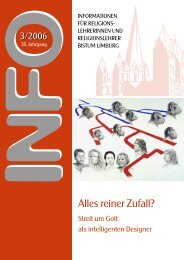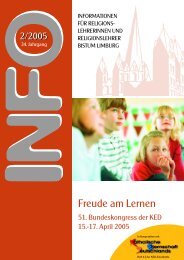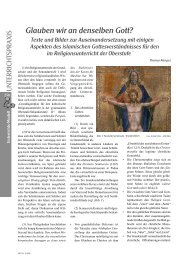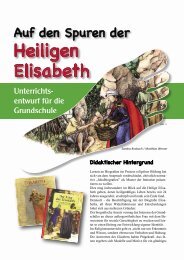Einfach fantastisch! - service.bistumlimburg.de - Bistum Limburg
Einfach fantastisch! - service.bistumlimburg.de - Bistum Limburg
Einfach fantastisch! - service.bistumlimburg.de - Bistum Limburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
INFO<br />
3/2004<br />
33. Jahrgang<br />
INFORMATIONEN<br />
FÜR RELIGIONS-<br />
LEHRERINNEN UND<br />
RELIGIONSLEHRER<br />
BISTUM LIMBURG<br />
<strong>Einfach</strong> <strong>fantastisch</strong>!<br />
Das Fantastische im<br />
Religionsunterricht
EDITORIAL<br />
R. Magritte • „Die Beschaffenheit <strong>de</strong>s Menschen“ Foto: akg-images © VG Bild-Kunst<br />
In meinem außer(lehr)planmäßigen Repertoire für <strong>de</strong>n Religionsunterricht, insbeson<strong>de</strong>re<br />
in <strong>de</strong>r 5. und 6. Klasse, hat das Stichwort „Fantasie“, <strong>de</strong>m ganze Unterrichtseinheiten<br />
gewidmet waren, eine große Rolle gespielt. Wie <strong>de</strong>nn nicht. Aber<br />
Achtung! Wir müssen die in Computerspielen, im Internet, <strong>de</strong>n Medien überhaupt<br />
so nie dagewesene Industrialisierung <strong>de</strong>r Fantasiewelten registrieren. Diese „Längeren<br />
Gedankensspiele“, wie <strong>de</strong>r Experte Linus Hauser sie nennt, gehören inzwischen<br />
zur Realität <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>rwelten. Fantasy produziert Futter im Übermaß. Pädagogen<br />
raten zur Diät. Zu viel Spielschrott im Kin<strong>de</strong>rzimmer, zu viel Comic in <strong>de</strong>r<br />
Glotze? Mag sein.<br />
Dennoch: Was wäre unser Kopf ohne das kontrafaktische Produktionsmittel Fantasie?<br />
Was wären wir ohne jene Län<strong>de</strong>r hinter <strong>de</strong>m Mond o<strong>de</strong>r hinter <strong>de</strong>r Wand aus<br />
Reisbrei, durch die man sich hindurch essen muss, um zu <strong>de</strong>n Schlaraffen zu kommen?<br />
Das Thema Fantasie bil<strong>de</strong>t einen didaktischen Son<strong>de</strong>rfall. In <strong>de</strong>r Schule<br />
haben wir nicht immer die Möglichkeit, Erfahrungen, über die wir dort re<strong>de</strong>n, an<br />
Ort und Stelle selbst zu machen. Was eine Mahlzeit ist, davon verschaffen wir uns<br />
einen Begriff, wenn wir essen. Dann können wir immer noch darüber re<strong>de</strong>n. Re<strong>de</strong>n<br />
müssen wir aber auch über Mord, Krieg und Grausamkeit, geben uns aber doch<br />
wohl besser damit zufrie<strong>de</strong>n, solche Erfahrungen nicht gemacht zu haben.<br />
Bei <strong>de</strong>r Fantasie ist das an<strong>de</strong>rs. Hier können wir durchaus jene beson<strong>de</strong>re Realität<br />
hereinlassen, über die wir dann sprechen. Das hat <strong>de</strong>n Vorteil, dass es auch gemeinsame<br />
Erfahrungen sind, die wir reflexiv verhan<strong>de</strong>ln. Reflexion ist aber immer<br />
wichtig. Wir beugen uns zurück und fragen: Was haben wir da gemacht? Was ist<br />
das für eine Realität, die es nur in unserer Fantasie gibt? Für <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
ist ein entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Reflexionspunkt dann erreicht, wenn es um die Unterscheidung<br />
zwischen <strong>de</strong>m Schlaraffenland und <strong>de</strong>m<br />
Paradies geht. Von weitem betrachtet und wenn man<br />
die ausgepinselten Fixierungen anschaut, gibt es ja gewisse<br />
Familienähnlichkeiten.<br />
Dass die eschatologischen Bil<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Bibel, insbeson<strong>de</strong>re<br />
die aus <strong>de</strong>r Apokalyptik, mit jener kontrafaktischen<br />
Produktionskraft Fantasie etwas zu tun haben,<br />
liegt auf <strong>de</strong>r Hand. Die kontrafaktische Begabung, die<br />
sich in <strong>de</strong>r Fantasie äußert, hat etwas mit dieser göttlichen<br />
Verwandtschaft zu tun. Nun kommt es aber darauf<br />
an, die spielerische Fantasie von jener notwendigen zu<br />
unterschei<strong>de</strong>n, die wir brauchen, um <strong>de</strong>n Anbruch <strong>de</strong>s<br />
Reiches Gottes zu realisieren. Spielen<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rn ist<br />
die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Unterscheidung sehr geläufig. Da<br />
heißt es entwe<strong>de</strong>r „im Spiel“ o<strong>de</strong>r „in echt“. Wenn <strong>de</strong>r<br />
liebe Gott zum großen Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Osterhasen, wenn<br />
das Schlaraffenland nur ein an<strong>de</strong>rer Name für das Paradies<br />
ist, dann sind zwar nicht alle Katzen grau, aber alle Blüten gleich bunt. O<strong>de</strong>r<br />
sind die Erzählungen von <strong>de</strong>r Auferweckung Jesu auch nur ein Produkt unserer<br />
Fantasie? So wie die Sakramentalien und Sakramente unserer Heilsgeschichte <strong>de</strong>n<br />
selbst gebastelten Produkten unserer Symboldidaktik ähneln und doch einen Qualitätssprung<br />
ums Ganze machen müssen, so kommt es auch hier auf die Kunst <strong>de</strong>r<br />
Unterscheidung an. Es gibt Fantasien, die sind mehr als Fantasien. Davon hängt im<br />
Religionsunterricht alles ab.<br />
Dr. Eckhard Nordhofen<br />
– Dezernent –
BEITRÄGE<br />
Der HERR DER RINGE und die HARRY-POTTER-Romane in<br />
philosophisch-theologischer Perspektive / Linus Hauser 144<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
Halloween zwischen Brauchtum und<br />
„Verbrauchertum“ / Ute Lonny-Platzbecker 156<br />
Jona bekommt Religionsunterricht. Gott will das Leben –<br />
Gott sen<strong>de</strong>t Jona. Freiarbeit für das 3./4. Schuljahr / Susanne Heil 166<br />
Manieren in Kirchenräumen? –<br />
Kleiner römisch-katholischer Knigge / August Heuser 181<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
Rezensionen 185<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
Zur Person 194<br />
Katholische Religion in <strong>de</strong>r Weiter-Bildung 194<br />
„Hauptsache gesund?“ – CD-ROM zur Pränataldiagnostik 201<br />
Katharina Kasper-Stiftung: „Leben wählen – in seiner Vielfalt!“<br />
Interview mit Dr. Ursula Rieke 202<br />
Katholische Kirche zum möglichen Kopftuch-Verbot 203<br />
Stellenanzeige „Haus am Dom“, Frankfurt am Main 204<br />
INFO online 206<br />
Stiftung DEY 207<br />
INFO Einzelheftbestellung 208<br />
„Was sagt mir ‘Gott’?“ 209<br />
Das Wesentliche fin<strong>de</strong>n 209<br />
Veranstaltungen 209<br />
SONSTIGES<br />
Übersicht <strong>de</strong>r Autoren/-innen und Rezensenten/-innen 217<br />
Adressen Dezernat und Ämter 218<br />
Impressum<br />
Verlag:<br />
Verlag <strong>de</strong>s Bischöflichen Ordinariats<br />
<strong>Limburg</strong><br />
Roßmarkt 12, 65549 <strong>Limburg</strong><br />
Herausgeber:<br />
Dezernat Schule und Hochschule im<br />
Bischöflichen Ordinariat <strong>Limburg</strong><br />
Roßmarkt 12, 65549 <strong>Limburg</strong><br />
Fon 06431/295-235<br />
Fax 06431/295-237<br />
www.schule.<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
schule@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
Schriftleitung:<br />
Dipl.-Theol. Martin W. Ramb<br />
m.ramb@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
Redaktion:<br />
Franz-Josef Arthen, Christa Kuch,<br />
Bernhard Merten, Martin E. Musch-<br />
Himmerich, Martin W. Ramb, Franz-<br />
Günther Weyrich<br />
Offizielle Äußerungen <strong>de</strong>s Dezernates Schule<br />
und Hochschule wer<strong>de</strong>n als solche gekennzeichnet.<br />
Alle übrigen Beiträge drücken die<br />
persönliche Meinung <strong>de</strong>r Verfasser/-innen aus.<br />
Nachdruck, elektronische o<strong>de</strong>r photomechanische<br />
Vervielfältigung nur mit beson<strong>de</strong>rer<br />
Genehmigung <strong>de</strong>r Redaktion.<br />
Bei Abbildungen und Texten, <strong>de</strong>ren Urheber<br />
wir nicht ermitteln konnten, bitten wir um<br />
Nachricht zwecks Gebührenerstattung.<br />
Buchbesprechungen:<br />
Rezensionsexemplare bitte direkt an<br />
die Redaktion sen<strong>de</strong>n. Besprechung<br />
und Rücksendung nicht verlangter<br />
Bücher kann nicht zugesagt wer<strong>de</strong>n.<br />
Redaktionsanschrift:<br />
Bernhard Merten, Altheimstraße 18<br />
60431 Frankfurt am Main<br />
Fon 069/515057<br />
Layout:<br />
Ute Stotz, Kommunikations-Design,<br />
Westerwaldstr. 14, 56337 Ka<strong>de</strong>nbach<br />
Fon 0 26 20 / 95 35 39<br />
Druck:<br />
JVA Diez, <strong>Limburg</strong>er Straße 122<br />
65582 Diez<br />
Fon 06432 /609 -3 40, Fax -3 43<br />
INFO erscheint vierteljährlich und kostet<br />
9.60 EUR im Jahr (inkl. Versandkosten),<br />
Einzelheft: 1.60 EUR (zzgl. Versandkosten).<br />
Religionslehrer/-innen, Pastorale Mitarbeiter/-innen<br />
und Geistliche, die im Bereich<br />
<strong>de</strong>r Diözese <strong>Limburg</strong> arbeiten, erhalten<br />
INFO kostenlos zugesandt.<br />
Beilagenhinweis:<br />
Der Gesamtauflage ist je eine Einladung<br />
zum „Tag <strong>de</strong>r Religionspädagogik“ und<br />
ein Flyer von „Christ in <strong>de</strong>r Gegenwart“<br />
<strong>de</strong>s Verlages Her<strong>de</strong>r beigefügt.<br />
Wir bitten um freundliche Beachtung.<br />
© Verlag <strong>de</strong>s Bischöflichen Ordinariats,<br />
<strong>Limburg</strong>/Lahn 2004<br />
ISBN 3-921221-30-7<br />
ISSN 0937-8162 (print)<br />
ISSN 1617-9234 (online)<br />
INHALT
BEITRÄGE<br />
144<br />
Der HERR DER RINGE und die HARRY-POTTER-Romane<br />
in philosophisch-theologischer Perspektive Linus Hauser<br />
1. Phantastik als literarische Reaktion<br />
auf das Unheimatliche <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>rne<br />
Kultursoziologen gehen soweit,<br />
dass sie <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r Religion unter<br />
soziologischem und sozialpsychologischem<br />
Gesichtspunkt an <strong>de</strong>n Begriff<br />
<strong>de</strong>r Heimat bin<strong>de</strong>n. Sie <strong>de</strong>finieren Religion<br />
„als eine kognitive und normative<br />
Struktur, die es <strong>de</strong>m Menschen<br />
ermöglicht, sich im<br />
Universum ‘zu Hause’ zu fühlen“<br />
1 . Aufgrund <strong>de</strong>r Pluralisierung<br />
<strong>de</strong>s Alltagslebens und<br />
<strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Möglichkeiten<br />
<strong>de</strong>r Lebenslauf-Wahl<br />
in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Gesellschaft<br />
entwickelt sich aus <strong>de</strong>r sozialen<br />
Heimatlosigkeit eine weitergehen<strong>de</strong><br />
„’Heimatlosigkeit’<br />
im Kosmos“ 2 . Sozialpsychologisch<br />
ergibt sich aus dieser<br />
Heimatlosigkeit im Kosmos<br />
auch das Problem, dass es keine<br />
Instanz mehr zu geben scheint,<br />
die in <strong>de</strong>r Lage ist, die Antwort<br />
auf die Theodizee, nämlich die<br />
Antwort auf <strong>de</strong>n Sinn von Leid<br />
und Bösem zu geben.<br />
Die Phantastik <strong>de</strong>s 19.<br />
und 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts3 , ich<br />
<strong>de</strong>nke hier etwa, um nur einige<br />
berühmte Namen und Titel<br />
zu nennen, an Alfred Kubin<br />
(1877-1959) DIE ANDERE SEITE<br />
(1909), Gustav Meyrink (1886-1932)<br />
DER GOLEM (1915), Leo Perutz<br />
(1884-1957) DER MEISTER DES JÜNGS-<br />
TEN TAGES (1921), Howard Phillips<br />
Lovecraft (1890-1935) BERGE DES<br />
WAHNSINNS (1931), Hermann Kasack<br />
(1896-1966) DIE STADT HINTER DEM<br />
STROM (1947) o<strong>de</strong>r auch – postmo<strong>de</strong>rn<br />
metaliterarisch – Umberto Eco<br />
(*1932) DAS FOUCAULTSCHE PENDEL<br />
(1988) und Christoph Ransmayr<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
(*1954) DIE LETZTE WELT (1988) reflektieren<br />
diese Situation.<br />
Die Unheimlichkeit, die – mit Samuel<br />
Beckett (1906- 1989) gesprochen –<br />
Losigkeit in einer Welt, in <strong>de</strong>r je<strong>de</strong>r nur<br />
noch seinen Verwaiser 4 zu suchen<br />
scheint, wird in <strong>de</strong>r Phantastik anschaulich.<br />
Die Handlungsorte dieser Art von<br />
Phantastik sind prinzipiell mit Schiff,<br />
Flugzeug o<strong>de</strong>r Straßenbahn erreichbar.<br />
Der Herr <strong>de</strong>r Ringe: Die Gefährten © Cinetext<br />
Sie sind kein Nirgendwo, kein negatives<br />
Utopien, das es nicht gibt, son<strong>de</strong>rn die<br />
an<strong>de</strong>re Seite einer realen Stadt o<strong>de</strong>r<br />
Landschaft, also die real existieren<strong>de</strong>,<br />
aber meist verdrängte an<strong>de</strong>re Seite unserer<br />
Lebensalltäglichkeit. Die gewohnte<br />
Wahrnehmung dieser nur scheinbar vertrauten<br />
Orte erweist sich aber als trügerisch,<br />
die an<strong>de</strong>re Seite ihrer Wirklichkeit<br />
wird sichtbar. Es zeigt sich, dass die an<strong>de</strong>re<br />
Seite die wahre Realität birgt: Die<br />
gewohnten, tragfähig scheinen<strong>de</strong>n Be-<br />
griffe, die unseren Lebensalltag fundieren,<br />
wer<strong>de</strong>n dann als Verdrängungen und<br />
Lebenslügen entlarvt und zerbrechen.<br />
2. Fantasy umspielt die Welt <strong>de</strong>r<br />
Phantastik<br />
Innerhalb dieses durch sie vorausgesetzten<br />
Krisenhorizontes <strong>de</strong>r Phantastik<br />
reagiert die Fantasy auf ihre<br />
Weise ‚positiv’ auf die Krise.<br />
Fantasy setzt die Weltwahrnehmung<br />
<strong>de</strong>s Phantastischen voraus,<br />
„umspielt“ 5 diese Weltwahrnehmung<br />
und wird damit<br />
auch leicht zum literarischen<br />
Sedativ.<br />
Die weltbildhaften Plausibilitäten<br />
und Dogmen <strong>de</strong>r Zeit<br />
wer<strong>de</strong>n in einen imaginären<br />
Kontext gestellt bzw. <strong>de</strong>r vorausgesetzte<br />
reale Kontext dieser<br />
Welt als okkult unterfüttert<br />
erwiesen und so eine Gegenrealität<br />
aufgebaut, die aber<br />
prinzipiell mit heroischen Mitteln<br />
und ohne <strong>de</strong>n spontaneitätshemmen<strong>de</strong>nReflexionsfaktor<br />
durch Schwert und Magie<br />
bewältigt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Hier haben wir – unter philosophisch-theologischerPerspektive<br />
– das Spezifikum <strong>de</strong>r Fantasy<br />
gegenüber <strong>de</strong>r Phantastik,<br />
die sie als ihre Gattung vom Weltgefühl<br />
her voraussetzt.<br />
In <strong>de</strong>n trivialen Formen von Fantasy<br />
kann <strong>de</strong>shalb vieles <strong>de</strong>r für viele<br />
Menschen epochalen Unordnung <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>rne geordnet wer<strong>de</strong>n. Der Boom<br />
standardisierter Fantasyschmöker belegt<br />
die Beliebtheit dieses Rezeptes.<br />
Mit Schwert und Magie, Sword and<br />
Sorcery, kann in literarischen, filmischen<br />
o<strong>de</strong>r Rollenspiel- und Computergame-Gegenwelten<br />
übersichtlich ge-
macht wer<strong>de</strong>n, was in <strong>de</strong>r lebensalltäglichen<br />
Realität nicht gelingt.<br />
Romane aus <strong>de</strong>r Fe<strong>de</strong>r etwa von<br />
Robert Ervin Howard (1906-1936),<br />
John Jakes (*1932), Lin Carter (1930-<br />
1988) o<strong>de</strong>r Fritz Leiber (1910-1992),<br />
<strong>de</strong>m Erfin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s literarischen Terminus<br />
Sword and Sorcery, bieten seriell<br />
Fluchtliteratur an.<br />
Große Fantasy-Literatur, ich <strong>de</strong>nke<br />
hier beispielsweise an Eric Rücker Eddisons<br />
(1882-1945) DER WURM OURO-<br />
BOROS (1926), Fletcher Pratts (1897-<br />
1956) DIE EINHORNQUELLE (1948) o<strong>de</strong>r<br />
Brian Wilson Aldiss’ (*1925) DER MA-<br />
LACHIA-GOBELIN, hat sich diesem Bedürfnis<br />
gegenüber immer gesperrt, auch<br />
wenn sie unfreiwillig diese Bedürfnisse<br />
bedient.<br />
Um welche Bedürfnisse es sich in<br />
philosophisch-theologischer Perspektive<br />
hier han<strong>de</strong>lt, kann durch <strong>de</strong>n Bezug<br />
auf die Begriffe <strong>de</strong>s Mythischen, <strong>de</strong>s<br />
Religiösen, <strong>de</strong>s Neomythischen und <strong>de</strong>s<br />
Standpunktes <strong>de</strong>r Religion <strong>de</strong>utlich gemacht<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
3. Mythen mil<strong>de</strong>rn Angst<br />
Geschichten erfin<strong>de</strong>t man, Mythen<br />
wer<strong>de</strong>n vom Menschen nicht bewusst<br />
erfun<strong>de</strong>n. Geschichten erweisen<br />
sich manchmal als Mythen. Ein<br />
Mythos, so wur<strong>de</strong> einmal festgestellt,<br />
muss nicht gelesen wer<strong>de</strong>n, damit er<br />
wirkt. Er kann erzählt wer<strong>de</strong>n, er kann<br />
verfilmt wer<strong>de</strong>n, er kann in <strong>de</strong>r bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Kunst o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Musik verarbeitet<br />
wer<strong>de</strong>n. Der Mythos kann trivialisiert<br />
wer<strong>de</strong>n und wirkt noch immer.<br />
Die ODYSSEE, die Lie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r ED-<br />
DA, Hermann Melvilles (1819-1891)<br />
MOBY DICK (1851) o<strong>de</strong>r Mary Wollstonecraft<br />
Shelleys (1797-1851) FRAN-<br />
KENSTEIN ODER DER MODERNE PROME-<br />
THEUS (1818) sind beste Beispiele dafür.<br />
Dies gilt auch für <strong>de</strong>n tolkienschen<br />
HERRN DER RINGE, <strong>de</strong>r vielen<br />
Menschen, wie die bei<strong>de</strong>n vorher genannten<br />
Romane, nur als Filmfassung<br />
und Merchandiseartikel zugänglich<br />
ist und auch für die rowlingschen<br />
HARRY-POTTER-Romane.<br />
Harry Potter und die Kammer <strong>de</strong>s Schreckens © Warner-Cinetext<br />
Mythen sind immer eine Ausgestaltung<br />
von Grundmustern menschlichen<br />
Existierens durch Symbole, von <strong>de</strong>nen<br />
her erst eine explizite begriffliche Sinngebung<br />
und ein explizites begriffliches<br />
Verstehen <strong>de</strong>r eigenen Existenz möglich<br />
ist.<br />
Im Mythos gestalten sich Symbole<br />
zu einer systematischen Auslegung <strong>de</strong>r<br />
eigenen Lebenswirklichkeit in anschaulicher<br />
Form. Im Mythos wird wahre<br />
Realität im Sinne <strong>de</strong>r Wahrheit über die<br />
eigene unübersichtliche Lebensrealität<br />
thematisch. 6 Dies geschieht spezifisch<br />
so, dass diese Wahrheit von ihrem Ursprung<br />
her als unvor<strong>de</strong>nkliche Kondition<br />
menschlichen Lebens in <strong>de</strong>n Blick<br />
genommen wird, die das Hier und Heute<br />
bestimmt und damit die heutigen<br />
Probleme bewältigbarer und, weil als<br />
zum Menschen gehörig erfahren, ertragbarer<br />
macht.<br />
So steht – philosophisch betrachtet –<br />
am Beginn <strong>de</strong>s Mythos das Bewusstsein<br />
radikaler Endlichkeit und das Interesse<br />
an <strong>de</strong>ren Bewältigung. Wenn man<br />
nach einem empirisch durch Evolutionsbiologie<br />
und Frühgeschichte abgesicherten<br />
Begriff vom Anfang <strong>de</strong>s<br />
Menschseins sucht 7 , stößt man mit Hans<br />
Blumenberg auf die Verbindung <strong>de</strong>s<br />
„Absolutismus <strong>de</strong>r Wirklichkeit“ 8 mit<br />
<strong>de</strong>r „Angst“ 9 .<br />
Absolutismus <strong>de</strong>r Wirklichkeit be<strong>de</strong>utet,<br />
dass <strong>de</strong>r Mensch in keiner Weise<br />
am Beginn seines Menschseins über<br />
die Bedingungen seiner Wirklichkeit<br />
mental verfügt. Er ist hineingeschleu<strong>de</strong>rt<br />
in einen Kosmos von Unbegreiflichkeiten,<br />
die begriffen wer<strong>de</strong>n müssen,<br />
geworfen in ein Meer von Meinbarem,<br />
das vermeint wer<strong>de</strong>n muss, damit<br />
nicht aus prinzipiell je<strong>de</strong>r Richtung Todbringen<strong>de</strong>s<br />
kommen kann.<br />
Angst ist die Reaktion auf dieses zunächst<br />
ganz unbestimmte Chaos von Gefahren.<br />
So ist die Angst strukturell eine<br />
„Intentionalität <strong>de</strong>s Bewusstseins ohne<br />
Gegenstand“ 10 . Am Uranfang fürchtet<br />
sich <strong>de</strong>r Mensch gleichsam vor allem.<br />
Um nun diese Hilflosigkeit angesichts<br />
<strong>de</strong>r Bedrohung aus allen Richtungen<br />
zu beherrschen, muss aus <strong>de</strong>r<br />
Angst „Furcht“ 11 wer<strong>de</strong>n. Die Angst<br />
muss eine Richtung auf ein benennbares<br />
Bedrohliches bekommen. Aus <strong>de</strong>r<br />
Vielfalt <strong>de</strong>r Wirklichkeit müssen einzelne<br />
Bedrohungen ausgeson<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n,<br />
damit <strong>de</strong>r Rest <strong>de</strong>r Wirklichkeit<br />
nicht mehr bedrohlich ist, son<strong>de</strong>rn in<br />
<strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>ssen gerät, was verfügbar<br />
wird. In mythischen Denkweisen<br />
kann so das Angsterregen<strong>de</strong> als ein<br />
Furchtbares bearbeitet und handhabbar<br />
gemacht wer<strong>de</strong>n. Die radikale Endlichkeit<br />
<strong>de</strong>s Menschen lässt diesen die Welt<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
BEITRÄGE<br />
145
BEITRÄGE<br />
146<br />
mit Furchterregen<strong>de</strong>m und mit Mächten,<br />
die das Furchterregen<strong>de</strong> bewältigen<br />
helfen, bebil<strong>de</strong>rn.<br />
Mythen sind keine empirischen Allgemeinbegriffe,<br />
die etwas verallgemeinerbar<br />
über die Welt aussagen, und sie<br />
sind auch keine formalen Strukturen,<br />
die sich unabhängig von Gedankengehalten<br />
abbil<strong>de</strong>n lassen. Mythen sind<br />
vielmehr Sätze über empirische Allgemeinbegriffe.<br />
Sie sind Sätze, in <strong>de</strong>nen<br />
das Subjekt sich selbst in seinem Weltsein<br />
zum Thema macht. Das mythische<br />
Denken lebt auf einer Metaebene und<br />
funktioniert gera<strong>de</strong> dadurch, dass es<br />
diese im Alltag übersieht. Im Lebensalltag<br />
<strong>de</strong>nkt man nicht an die eigene<br />
Einbindung in diese Metaebenen-Welt<br />
<strong>de</strong>s Mythischen. Der Alltag bedarf fester<br />
Bindung an überschaubare und beherrschbare<br />
Sachverhalte, um ertragen<br />
zu wer<strong>de</strong>n.<br />
4. Der Heros in tausend Gestalten<br />
Vor allem in Anlehnung an Joseph<br />
Campbells (1904-1987) Werk über <strong>de</strong>n<br />
HEROS IN TAUSEND GESTALTEN (1949)<br />
will ich Grundmuster einer umfassen<strong>de</strong>n<br />
mythologischen Erzählung, <strong>de</strong>n<br />
„Monomythos“ 12 , herausarbeiten.<br />
Es war also am Anfang das reine Unbestimmte,<br />
das wir uns nicht vorstellen<br />
können. Es war weiterhin das unvor<strong>de</strong>nklich<br />
Göttliche, das wir uns ebenfalls<br />
nicht vorstellen können. Das reine<br />
Unbestimmte und das unvor<strong>de</strong>nklich<br />
Göttliche sind dabei vielleicht dasselbe<br />
gewesen.<br />
Wir bewegen uns hier im Raum <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>m Denken nicht mehr Zugänglichen.<br />
Wir können nur Bil<strong>de</strong>r fin<strong>de</strong>n, um das<br />
Un<strong>de</strong>nkbare in eine Bildwelt zu fassen.<br />
Unsere symbolische Schöpfungserzählung<br />
soll uns das Schöpfungsgeschehen<br />
nahe bringen und doch zugleich<br />
<strong>de</strong>n bildhaften Charakter <strong>de</strong>r Erzählung<br />
<strong>de</strong>utlich machen.<br />
Am Anfang – um nun fortzufahren –<br />
(an <strong>de</strong>m es noch keine Zeit gab, in <strong>de</strong>r<br />
etwas hätte anfangen können) gab es<br />
<strong>de</strong>n Himmel. Aber nicht <strong>de</strong>n Himmel<br />
als gestaltete Sphäre, son<strong>de</strong>rn als Nicht-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Ort, an <strong>de</strong>m später ein Himmel geschaffen<br />
wird.<br />
Am Anfang gab es das Wasser (o<strong>de</strong>r<br />
auch statt<strong>de</strong>ssen das Feuer), aber nicht<br />
das heute gekannte Wasser, son<strong>de</strong>rn das<br />
Wasser als <strong>de</strong>n Nicht-Raum <strong>de</strong>r möglichen<br />
Er<strong>de</strong> und <strong>de</strong>s möglichen Wassers.<br />
Himmel und Wasser sind hier Symbole<br />
für das Chaotische <strong>de</strong>s Anfangs.<br />
Später wer<strong>de</strong>n durch Schöpfung in<br />
diese Nicht-Sphären Himmel und Er<strong>de</strong><br />
als unsere Lebenssphären eingetragen.<br />
Im Nicht-Ort ‚Himmel’ wird dann<br />
<strong>de</strong>r Raum <strong>de</strong>s Himmels geschaffen. Im<br />
Nicht-Ort ‚Wasser’wird dann <strong>de</strong>r Raum<br />
<strong>de</strong>r Er<strong>de</strong> geortet. Irgendwann taucht<br />
dann in einer Son<strong>de</strong>rrolle unter <strong>de</strong>m Geschaffenen<br />
<strong>de</strong>r Mensch auf.<br />
Mit <strong>de</strong>m Menschen wird aktive<br />
geistige Bewegung im Kosmos freigesetzt.<br />
Aus <strong>de</strong>m Heilen <strong>de</strong>s noch ganz<br />
<strong>de</strong>m Anfang verbun<strong>de</strong>nen ersten Seins<br />
wird durch <strong>de</strong>n Menschen aber auch etwas<br />
Beschädigtes. Es kommt zu einem<br />
Sün<strong>de</strong>nfall.<br />
Gegenüber <strong>de</strong>m in die gefallene<br />
Schöpfung hin sich erstrecken<strong>de</strong>n, damit<br />
aber auch überschaubareren Vergangenen<br />
soll nun – so die Hoffnung <strong>de</strong>r<br />
jetzt leben<strong>de</strong>n Menschen – alles besser<br />
wer<strong>de</strong>n, obwohl sich vielleicht an<strong>de</strong>rerseits<br />
nicht zu viel än<strong>de</strong>rn soll gegenüber<br />
<strong>de</strong>n früheren Monaten o<strong>de</strong>r Jahren.<br />
Auch das Neue macht Angst. Doch<br />
will ‚ich’aus meinen Fehlern lernen und<br />
vergangene Schicksalsschläge durch<br />
bessere Planung umgehen o<strong>de</strong>r sie zumin<strong>de</strong>st<br />
mil<strong>de</strong>rn.<br />
Wird aber das überschaubare Vergangene<br />
als zumin<strong>de</strong>st etwas schlechter<br />
als das erhoffte Zukünftige gesehen,<br />
so ist dies bei <strong>de</strong>r Betrachtung <strong>de</strong>r unvor<strong>de</strong>nklichen<br />
Zeiten <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />
an<strong>de</strong>rs. Hier wird dann wie<strong>de</strong>r eine<br />
edle, paradiesische Vorzeit be<strong>de</strong>utsam,<br />
die besser war als alles, was danach<br />
kam. Ein Gol<strong>de</strong>nes Zeitalter soll bestan<strong>de</strong>n<br />
haben, von <strong>de</strong>m man jetzt nur<br />
noch eine blasse Ahnung hat. Doch diese<br />
Ahnung ist wichtig.<br />
Diese Ahnung gibt mir nicht nur das<br />
Gefühl einer Katastrophe in <strong>de</strong>r unvor<strong>de</strong>nklichen<br />
Zeit, in <strong>de</strong>r das Gol<strong>de</strong>ne<br />
Zeitalter zerbrach. Diese Ahnung gibt<br />
mir zugleich das Gefühl, dass diese edle<br />
Zeit wie<strong>de</strong>rkommen könnte, dass<br />
<strong>de</strong>m exitus aus <strong>de</strong>m Paradies ein reditus<br />
in es folgen könnte.<br />
Ist nach vielen Schritten in <strong>de</strong>r mythischen<br />
Entwicklung das vernunftbegabte<br />
Menschenwesen da, dann muss<br />
es sich in seiner radikalen Endlichkeit<br />
in <strong>de</strong>m spiegeln, was zunächst als Gegenbild<br />
von radikaler menschlicher Endlichkeit<br />
erscheint, nämlich im Titanen,<br />
im Halbgott, im Heros in tausend Gestalten.<br />
Dieser wie<strong>de</strong>rum beginnt als Kind<br />
schon seinen seltsamen und be<strong>de</strong>utungsvollen<br />
Eigenweg zu gehen. Unter<br />
seltsamen Umstän<strong>de</strong>n wird er gezeugt,<br />
geboren und wächst heran. Dann als<br />
noch jugendlicher Held muss er <strong>de</strong>n<br />
Aufbruch wagen.<br />
Damit wird er zur I<strong>de</strong>ntifikationsfigur<br />
für alle, die ins Erwachsenendasein<br />
treten wollen. Er wird aber auch<br />
zur I<strong>de</strong>ntifikationsfigur für alle diejenigen,<br />
die aus ihren gewohnten Rollen<br />
herauswollen, um einen Neuanfang zu<br />
wagen. Und er wird schließlich auch<br />
zum Symbol für epochale Aufbrüche.<br />
Um <strong>de</strong>n Aufbruch wagen zu können,<br />
bedarf es eines äußeren Anlasses.<br />
Gleichgültig, ob <strong>de</strong>r Held in familiärer<br />
Geborgenheit aufwächst, selten in einer<br />
ganz normalen, mehr in einer heiligen<br />
o<strong>de</strong>r aber extrem ver<strong>de</strong>rbten, entwe<strong>de</strong>r<br />
in einer sehr hochgestellten o<strong>de</strong>r<br />
in einer sehr armen Familie o<strong>de</strong>r gar in<br />
<strong>de</strong>r Wildnis und Einsamkeit, manchmal<br />
von Göttern o<strong>de</strong>r von Tieren großgezogen.<br />
Auf je<strong>de</strong>n Fall muss es später zu<br />
einer Erschütterung <strong>de</strong>s kindlichen Zustan<strong>de</strong>s<br />
und zu einem Berufungserlebnis<br />
kommen.<br />
Da nun <strong>de</strong>r Aufbruch ins Weite, Heroische<br />
und Erwachsene Angst macht,<br />
muss <strong>de</strong>r Held um seine Berufung als<br />
Held ringen und schließlich durch alle<br />
Angst hindurch zur Akzeptanz <strong>de</strong>s Auftrages<br />
kommen.<br />
Endlich bricht <strong>de</strong>r Held auf, meist<br />
gestützt auf ein Wesen, das die Blüte<br />
seiner Jahre, die Zeiten <strong>de</strong>r Hel<strong>de</strong>nhaftigkeit<br />
hinter sich hat und nun als Ratgeber<br />
dient. Erst durch diesen Ratgeber<br />
kann <strong>de</strong>r Held seine Mission ganz be-
greifen und erhält Hilfsmittel in Form<br />
von Waffen o<strong>de</strong>r magischen Kräften.<br />
Nach einer letzten Krise entschei<strong>de</strong>t sich<br />
dann <strong>de</strong>r Held endgültig zum Aufbruch.<br />
Nun beginnt <strong>de</strong>r zweite Akt im Hel<strong>de</strong>nleben.<br />
Der Held verlässt seine Heimat<br />
und zieht fort in das unbekannte<br />
Land. In Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit seltsamen<br />
und verwirren<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r auch mit<br />
feindlichen Mächten gewinnt <strong>de</strong>r Held<br />
Einsicht in sein Selbst.<br />
Auf einmal wird aus <strong>de</strong>r glatten<br />
kindhaft-jugendlichen Person ein reifer<br />
Mensch, <strong>de</strong>r seine lichten und seine<br />
schattenhaften Seiten erkennen<br />
kann. Oft begegnet ihm dann eine Gegenfigur,<br />
die exemplarisch genau die<br />
dunklen Seiten realisiert hat, gegen<br />
die <strong>de</strong>r Held in sich ankämpft. Diesen<br />
Antihel<strong>de</strong>n zu überwin<strong>de</strong>n, gehört wesentlich<br />
zur Selbstwerdung <strong>de</strong>s Hel<strong>de</strong>n<br />
hinzu.<br />
In <strong>de</strong>r unbekannten Gegend, die <strong>de</strong>r<br />
Heros aufsuchen muss, um sich zu fin<strong>de</strong>n,<br />
gibt es einen Ort, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r einen<br />
Seite Ziel <strong>de</strong>s Hel<strong>de</strong>n ist und auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren<br />
Seite aber auch die Bün<strong>de</strong>lung<br />
<strong>de</strong>s Wi<strong>de</strong>rstands gegen sein Ziel. Der<br />
Held kann diesen gefährlichsten Ort<br />
nur erreichen, wenn er sich selber auch<br />
mit seinen dunklen Seiten anerkennt<br />
und sich so einem Kampf auf Leben<br />
und Tod, das heißt einem Kampf um<br />
seine I<strong>de</strong>ntität aussetzt. Dieser Kampf<br />
auf Leben und Tod geht an die Grenzen<br />
seines Menschseins.<br />
In irgen<strong>de</strong>iner Weise stirbt <strong>de</strong>r ‚alte’<br />
Held in seiner Kindlichkeit, und <strong>de</strong>r erwachsene<br />
Held wird geboren. Dann<br />
kann <strong>de</strong>r Held zu seinem Ziel gelangen<br />
und <strong>de</strong>n gefährlichsten Ort seiner Mission<br />
erreichen.<br />
Da <strong>de</strong>r Held zu sich gefun<strong>de</strong>n hat,<br />
erwachsen gewor<strong>de</strong>n ist und die Realität<br />
in ihrer Wi<strong>de</strong>rständigkeit erkennt,<br />
kann es hier endlich zum Wesentlichen,<br />
<strong>de</strong>m Entscheidungskampf kommen.<br />
Zwar hat <strong>de</strong>r Held schon auf Leben und<br />
Tod gekämpft, doch war dieser Kampf<br />
ein Kampf um das eigene Erwachsenwer<strong>de</strong>n.<br />
Erst im Erwachsenendasein<br />
kann aber das Wesentliche anstehen,<br />
nämlich <strong>de</strong>r Entscheidungskampf. Jetzt<br />
muss <strong>de</strong>r Held aus <strong>de</strong>r Ferne zurück-<br />
kommen können und seine alte Welt<br />
neu in <strong>de</strong>n Blick nehmen.<br />
Weil er aber ein Held ist, ein mit<br />
göttlichen Mächten umgebenes Wesen<br />
und kein Durchschnittsmensch, ist dieses<br />
Inbesitznehmen <strong>de</strong>s Vertrauten,<br />
Heimatlichen, Familiären ein Akt, <strong>de</strong>r<br />
die ganze Welt selbst betrifft. Deswegen<br />
geht es im Entscheidungskampf um das<br />
Schicksal <strong>de</strong>r/seiner Welt. Dieser Entscheidungskampf<br />
geht wie<strong>de</strong>rum an<br />
die Grenze seiner Kräfte. Erst wenn alles<br />
verloren scheint und unter Aufbietung<br />
all seiner Kampfesmoral gelingt<br />
ihm die Rettung seines Universums.<br />
Dann ist diese Welt, die <strong>de</strong>r Held<br />
wie<strong>de</strong>r neu betritt/schafft, zumin<strong>de</strong>st<br />
anfänglich eine geheilte Welt gewor<strong>de</strong>n.<br />
Alles wird jetzt wie<strong>de</strong>r geordnet,<br />
und die Unordnung, die in dieser Welt<br />
bestan<strong>de</strong>n hat, wird aufgehoben. Der<br />
klassische Mythos allerdings macht<br />
immer wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>utlich, dass es diese<br />
Hel<strong>de</strong>n letztlich nicht gibt.<br />
Zwar gibt es Hel<strong>de</strong>n, die in ihrer<br />
Welt Gutes wirken und das Böse besiegen,<br />
aber diese Hel<strong>de</strong>n en<strong>de</strong>n selbst<br />
wie<strong>de</strong>rum oft tragisch. So hat im klassischen<br />
Mythos je<strong>de</strong>r Held seine Achillesferse,<br />
seine verwundbare Stelle. Damit<br />
wird im klassischen Mythos daran<br />
erinnert, dass <strong>de</strong>r Mensch niemals ein<br />
Held ist, <strong>de</strong>r die menschlichen Grenzen<br />
übersteigen kann. Auch Hel<strong>de</strong>n sind<br />
und bleiben radikal endlich.<br />
5. Religiosität und Fantasy:<br />
Die Geneigheit, nicht endlich sein<br />
zu wollen<br />
Eine philosophisch-anthropologische<br />
Sicht <strong>de</strong>s Menschen ent<strong>de</strong>ckt <strong>de</strong>ssen<br />
radikale Endlichkeit.<br />
Radikal heißt dabei, dass es keinen<br />
menschlichen Aspekt gibt, <strong>de</strong>r nicht<br />
durch diese Endlichkeit geprägt ist.<br />
Die Endlichkeit prägt das Menschsein<br />
an seiner Basis, gleichsam wurzelhaft.<br />
Je<strong>de</strong>r Tag ist ein Abschiednehmen. Ein<br />
mo<strong>de</strong>rnes Sprichwort sagt: ‚Heute ist<br />
<strong>de</strong>r erste Tag vom Rest <strong>de</strong>ines Lebens!’<br />
Radikal endlich sind wir auch<br />
in <strong>de</strong>m, was wir tun. Alles was wir tun,<br />
hat nicht nur seine Grenzen am Gegenstand,<br />
über <strong>de</strong>n wir nicht ganz verfügen,<br />
o<strong>de</strong>r an <strong>de</strong>n Mitmenschen, die<br />
an<strong>de</strong>res wollen. Radikal endlich ist<br />
unser Tun auch darin, dass wir nur ‚etwas’<br />
tun können und dafür ‚an<strong>de</strong>res’<br />
lassen müssen. So schleppen wir in<br />
unserer radikalen Endlichkeit auch<br />
unsere ausgeschlossenen Lebensmöglichkeiten<br />
als Lei<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>n Modalitäten<br />
mit uns wie einen Schatten herum.<br />
Alles wird aber in Frage gestellt durch<br />
<strong>de</strong>n letzten Schatten, <strong>de</strong>r auf uns fällt,<br />
durch <strong>de</strong>n Tod. Wir geraten vor das<br />
Nichts <strong>de</strong>s Grabes und haben diese Erfahrung<br />
<strong>de</strong>s Nichts zu <strong>de</strong>uten. 13<br />
Alle Menschen haben dieser Situation<br />
gegenüber die Geneigtheit, nicht<br />
endlich sein zu wollen. Als Theologe<br />
bezeichne ich diese Geneigheit als Religiosität.<br />
Religiosität, man kann sie atheistisch<br />
mit Ernst Bloch als Hoffnung<br />
o<strong>de</strong>r mit Jean-Paul Sartre als Lei<strong>de</strong>nschaft<br />
für das Absur<strong>de</strong> bezeichnen, ist<br />
überall dort gegeben, wo Menschen<br />
sich über ihre Endlichkeit (die noch<br />
nicht in ihrer Radikalität begriffen<br />
sein muss) Gedanken machen und dabei<br />
auch ihre Geneigtheit, nicht endlich<br />
zu sein, thematisieren. Religiosität<br />
gehört zu je<strong>de</strong>m weltanschaulichen<br />
Standpunkt. Mit ihr – als großer Anfrage<br />
an die Grenzen <strong>de</strong>s Menschen<br />
hinsichtlich ihrer Überwindbarkeit –<br />
muss sich je<strong>de</strong>r weltanschauliche<br />
Standpunkt auseinan<strong>de</strong>rsetzen. Der<br />
Standpunkt <strong>de</strong>r Religion behauptet die<br />
reale Aufhebung <strong>de</strong>r radikalen Endlichkeit<br />
durch eine transze<strong>de</strong>nte Realität,<br />
<strong>de</strong>r Atheismus behauptet die Unhintergehbarkeit<br />
von Endlichkeit.<br />
Bei<strong>de</strong> Standpunkte haben zweierlei<br />
gemeinsam: Sie behaupten die Radikalität<br />
<strong>de</strong>r Endlichkeit und sie erleben die<br />
menschliche Geneigtheit, Endlichkeit<br />
als aufgehoben anzusehen.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r menschlichen Religiosität<br />
gibt es in je<strong>de</strong>r Weltanschauung<br />
die Ten<strong>de</strong>nz, nicht nur das eigene<br />
Credo als bewusst ergriffenen Standpunkt<br />
zu vertreten, son<strong>de</strong>rn auch Längere<br />
Gedankenspiele zu pflegen. Was<br />
sind Längere Gedankenspiele?<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
BEITRÄGE<br />
147
BEITRÄGE<br />
148<br />
Je<strong>de</strong>r Mensch hat Tagträume. Diese<br />
Tagträume können kürzer o<strong>de</strong>r länger<br />
sein. Als Längere Gedankenspiele gelingt<br />
es dabei, Tagträumen möglicherweise<br />
die Erlebnisebene <strong>de</strong>r alltäglichobjektiven<br />
Realität durch eine subjektive<br />
Realität so zu überlagern, dass diese<br />
objektive Realität aus <strong>de</strong>m Blick gerät.<br />
Es eröffnet sich <strong>de</strong>r Weg in eine Scheinwelt,<br />
die qua Längerem Gedankenspiel<br />
stetig ausgebaut wird. Oftmals dienen<br />
dabei mediale Vorlagen als Erschließungshilfen<br />
und als Hilfen für <strong>de</strong>n Ausbau<br />
von Längeren Gedankenspielen.<br />
Romane und Filme haben heute diese<br />
Funktion. Das Fernsehen bietet diese<br />
Erschließungshilfen im wahrsten Sinne<br />
<strong>de</strong>s Wortes in Serie an.<br />
Mystery-Serien im Fernsehen wie<br />
PRETENDER, PROFILER und manchmal<br />
auch AKTE X setzen mehr auf das parapsychologische<br />
Interesse. Mit ANGEL –<br />
JÄGER DER FINSTERNIS, BUFFY – IM BANN<br />
DER DÄMONEN, ZAUBERHAFTE HEXEN, IM-<br />
MORTAL – DER UNSTERBLICHE, THE CROW<br />
o<strong>de</strong>r WITCHBLADE wird das ganze Feld<br />
von Längeren Gedankenspielen über<br />
Unsterblichkeit und Jenseits, Gutes und<br />
Böses, ungewöhnliche irdische und außerirdische,<br />
dieseitige und jenseitige Lebensformen<br />
und magische, körperliche<br />
o<strong>de</strong>r parapsychische Kräfte beackert.<br />
Das Längere Gedankenspiel kann<br />
als „beglücken<strong>de</strong>r Spaziergang“ 14 durch<br />
eine schöne Scheinwelt ‚verwen<strong>de</strong>t’<br />
wer<strong>de</strong>n. Diese Art von ausgestalteten<br />
Tagträumen ist je<strong>de</strong>m Menschen vertraut<br />
und – so sie nicht übertrieben wird –<br />
entspannend und sinnvoll.<br />
Längere Gedankenspiele dienen<br />
nicht nur als Austragungsort von Phantasien<br />
über die Möglichkeit, Lottomillionär<br />
zu wer<strong>de</strong>n. Sie dienen in Zeiten<br />
metaphysischer Orientierungsnot auch<br />
als Suche nach Haltbarkeit in einem unübersichtlichen<br />
Kosmos nach Kopernikus,<br />
Darwin, Freud und Gates. In diesem<br />
Kontext gewinnt die Fantasy ihre<br />
metaphysische Be<strong>de</strong>utung.<br />
In einem Kosmos, in <strong>de</strong>m Magie als<br />
reale Handlungsmöglichkeit existiert<br />
und in <strong>de</strong>m Verstorbene aus ihrer Sphäre<br />
wie<strong>de</strong>rkehren können, ist die Frage<br />
nach <strong>de</strong>r eigenen radikalen Endlichkeit<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
zumin<strong>de</strong>st gemil<strong>de</strong>rt. Unsere Religiosität,<br />
unsere Geneigtheit, nicht endlich<br />
zu sein, lässt die Geneigtheit entstehen,<br />
sich an Fantasy zu erfreuen. Die schlichteste<br />
Mil<strong>de</strong>rungsform eigener Endlichkeit<br />
im Fantasysektor ist <strong>de</strong>r Traum, ein<br />
Held o<strong>de</strong>r eine großer Magier zu sein,<br />
aber <strong>de</strong>nnoch im Prinzip ein sterblicher<br />
Mensch zu bleiben. Der mil<strong>de</strong> Gedankenspieler<br />
kann sich an Schwert-und-<br />
Magie-Romanen ergötzen.<br />
Auch ein Gandalf und ein Aragorn<br />
können bei <strong>de</strong>r Tolkienlektüre diesem<br />
Bedürfnis entsprechen.<br />
Längere Gedankenspiele reichen allerdings<br />
noch weiter – sie beziehen sich<br />
auch auf das Metaphysische. Über das<br />
Jenseits und die Grenzen <strong>de</strong>s Menschlichen<br />
gibt es nicht nur ernste Glaubenszeugnisse,<br />
son<strong>de</strong>rn auch Phantasien, die<br />
durchaus auch ihre Existenzberechtigung<br />
haben. Längere Fantasy-Gedankenspiele<br />
können aber auch in <strong>de</strong>n Bereich<br />
<strong>de</strong>s Neomythischen führen.<br />
6. Fantasy und Neomythen<br />
Mythen verweisen auch dann, wenn<br />
sie gera<strong>de</strong> das Scheitern je<strong>de</strong>r Anstrengung<br />
<strong>de</strong>s Menschen, zur Vollendung aus<br />
eigener Kraft zu gelangen, thematisieren,<br />
auf <strong>de</strong>n Zustand <strong>de</strong>s Heils, das gera<strong>de</strong><br />
in dieser letzten gedanklichen<br />
Wen<strong>de</strong> auf die radikale Endlichkeit <strong>de</strong>s<br />
Menschen aufscheint. Der Mythos stellt<br />
in dieser Hinsicht eine Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>m Menschsein und <strong>de</strong>ssen<br />
durch radikale Endlichkeit bedingte<br />
Grenzen dar.<br />
Die Vereitelung vollen<strong>de</strong>t gelingen<strong>de</strong>n<br />
Lebens für mythische Hel<strong>de</strong>n illustriert<br />
<strong>de</strong>r antike Mythos von Tithonos.<br />
Tithonos ist in <strong>de</strong>r griechischen Sagentradition<br />
<strong>de</strong>r Geliebte <strong>de</strong>r Morgenröte.<br />
Einst bat er Zeus um Unsterblichkeit<br />
und vergaß dabei, zugleich um ewige<br />
Jugend zu bitten. Als Tithonos alt und<br />
grau wird, mei<strong>de</strong>t Eos sein Lager, ernährt<br />
ihn aber weiter mit Nektar und<br />
Ambrosia und legt endlich <strong>de</strong>n immer<br />
mehr schrumpfen<strong>de</strong>n Gemahl in eine<br />
Wiege. Dort schrumpft er weiter, bis er<br />
zu einer Zika<strong>de</strong> wird.<br />
Im klassischen Mythos bedarf es<br />
<strong>de</strong>s weiteren noch eines von überirdischen<br />
Mächten zur Verfügung gestellten<br />
Mittels, etwa eines Zauberringes,<br />
freier durch Götter gewährter Wünsche<br />
o<strong>de</strong>r eines Butts, damit <strong>de</strong>r Mensch<br />
versuchen kann, übermenschlich zu<br />
wer<strong>de</strong>n und sich seiner Endlichkeit zu<br />
entledigen, wie es Tithonos versucht<br />
hat. Im Neomythos 15 sieht dies an<strong>de</strong>rs<br />
aus. In ihm spiegelt sich die Situation<br />
von Menschen <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne, die über<br />
die wissenschaftsfundierte Technik<br />
selbst zu kosmischen Schöpfern und<br />
Vernichtern zu wer<strong>de</strong>n scheinen.<br />
Ein Neomythos fundiert thematisch<br />
o<strong>de</strong>r unthematisch ein<br />
Menschenbild, das nicht mehr<br />
auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r durch alle<br />
Hochreligionen und sonstigen<br />
Weltanschauungen vertretenen<br />
Anthropologie akzeptiert wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Der Mensch wird im<br />
Neomythischen nicht mehr als<br />
radikal endlich begriffen. Endlichkeit<br />
könne als etwas <strong>de</strong>m<br />
Menschen nicht wesenhaft Anhaften<strong>de</strong>s<br />
durch eigene Fähigkeiten<br />
abgestreift wer<strong>de</strong>n.<br />
Dieses neue Bild vom Menschen ist<br />
mythisch, weil es wie je<strong>de</strong>r Mythos eine<br />
bildhafte Form <strong>de</strong>r Ausgestaltung<br />
von fundamentalen Lebenssituationen<br />
in Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit menschlicher<br />
Endlichkeit ist.<br />
Dieses neue Bild vom Menschen ist<br />
nicht nur mythisch, son<strong>de</strong>rn neomythisch<br />
zu nennen, weil es das Bewusstsein<br />
<strong>de</strong>r radikalen menschlichen Endlichkeit,<br />
das <strong>de</strong>r ‚klassische’ Mythos in<br />
sich entfaltet 16 , negiert.<br />
In <strong>de</strong>m zweibändigen Romanwerk<br />
DAS BUCH RAGUEL (1991) <strong>de</strong>r ungarischen,<br />
esoterischen Autorin Mária Orsi<br />
Szepes (*1908) wird geschil<strong>de</strong>rt, wie<br />
aus einem Durchschnittsmenschen eine<br />
übermenschliche, <strong>de</strong>r Endlichkeit enthobene<br />
Person, die ihr Wissen an<strong>de</strong>ren<br />
Wesen mitteilt, wird. Auf <strong>de</strong>n letzten<br />
Seiten <strong>de</strong>s Romans schreibt Szepes:<br />
„Sie, die sieben Schüler, hatten<br />
sich, <strong>de</strong>m göttlichen I<strong>de</strong>enfa<strong>de</strong>n fol-
gend, über ihr Menschsein erhoben,<br />
hatten bereits auf dieser Er<strong>de</strong> die<br />
himmlische Essenz <strong>de</strong>r unendlichen<br />
Freu<strong>de</strong> gekostet. Sie kannten keine<br />
Furcht, weil sie um die Unendlichkeit<br />
wußten. Und in <strong>de</strong>r göttlichen Heiterkeit<br />
dieser erkämpften, erworbenen Seligkeit<br />
verstan<strong>de</strong>n sie endlich <strong>de</strong>n Messias,<br />
<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Tiefe <strong>de</strong>r Jahrtausen<strong>de</strong><br />
also zu ihnen sprach: Mein Reich ist<br />
nicht von dieser Welt.“ 17<br />
Fin<strong>de</strong>n sich solche Allmachtsphantasien<br />
bei Tolkien und Rowling?<br />
7. Tolkiens mythenstiften<strong>de</strong> Qualität<br />
Betrachten wir, nach diesem Einstieg,<br />
zunächst Tolkiens mythenstiften<strong>de</strong><br />
Qualität.<br />
John Ronald Reuel Tolkiens (1892-<br />
1973) Werk lässt sich in <strong>de</strong>n Bereich<br />
<strong>de</strong>r Fantasy einordnen. Eine Welt wird<br />
geschaffen, in <strong>de</strong>r Magie und ritterliches<br />
Hel<strong>de</strong>ntum ihren Platz haben.<br />
Märchenhafte Rassen bevölkern diese<br />
Welt. Eingebettet ist <strong>de</strong>r Kosmos, in<br />
<strong>de</strong>m etwa DER KLEINE HOBBIT (1937)<br />
und DER HERR DER RINGE (1954f) spielen<br />
in einen metaphysischen Zusammenhang,<br />
<strong>de</strong>n DAS SILMARILLION (ab<br />
1916; 1977 publiziert) umschreibt.<br />
Es besteht weiterhin auf <strong>de</strong>n ersten<br />
Blick ein – gegenüber allen metaphysischen<br />
Orientierungsaufgaben <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne<br />
– übersichtlicher Kosmos mit<br />
festen Werten, die feststehen<strong>de</strong> Rollen<br />
von Gut und Böse, Held und Magier<br />
uvm. ermöglichen. Die ganze Handlung<br />
hat darüber hinaus ein Happy End.<br />
Auf <strong>de</strong>n ersten Blick scheint Tolkiens<br />
Werk schlicht gestrickte Weltflucht-Fantasy<br />
zu sein. So wird auch<br />
gern von ihr Gebrauch gemacht.<br />
Sehen wir uns einige literarische Figuren<br />
Tolkiens etwas genauer an. Es<br />
gehört zu vielen Fantasyromanen und<br />
-filmen, dass <strong>de</strong>m muskelbepackten<br />
Hel<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m Magier ein kleiner<br />
Clown, oftmals mit diebischen Fähigkeiten<br />
beigesellt wird, ein Mausling<br />
(Fritz Leiber), <strong>de</strong>r das schlaue, anarchische<br />
und hinterlistige Element repräsentiert.<br />
Der Herr <strong>de</strong>r Ringe – Die Rückkehr <strong>de</strong>s Königs – Gollum © Cinetext<br />
Wie<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>n ersten Blick betrachtet,<br />
scheint dies genau <strong>de</strong>r Rolle<br />
<strong>de</strong>r Hobbits zu entsprechen.<br />
Im Kleinen Hobbit wird Bilbo explizit<br />
von <strong>de</strong>n Zwergen als chronisch beschmunzelbarer<br />
Meisterdieb 18 engagiert.<br />
Nur <strong>de</strong>r weise Gandalf scheint hier<br />
von vornherein weiter gesehen zu haben.<br />
Bilbos Leistung als Meisterdieb<br />
wird dann allerdings in <strong>de</strong>n Schatten gestellt<br />
durch seine Leistung, uneigennützig<br />
und ohne Machtinteressen Frie<strong>de</strong>n<br />
zwischen Menschen und Zwergen zu<br />
stiften. Um in diesem Stil Großes zu bewirken,<br />
bleibt Bilbo schon in einer <strong>de</strong>utlichen<br />
Distanz zu <strong>de</strong>nen, die die weltgeschichtlichen<br />
Rollen spielen o<strong>de</strong>r gigantische<br />
Reichtümer erwerben wollen.<br />
Wenn er sich sagt, dass es bei allem<br />
darauf ankomme, ein einfacher Hobbit<br />
zu bleiben, so sagt er auf seine Hobbitart,<br />
es komme darauf an, seine radikale<br />
Endlichkeit zu akzeptieren.<br />
Bilbo betreibt seine Politik vorausschauend<br />
und konsequent, weil er das<br />
rechte Maß kennt. Das legendäre Arkenjuwel<br />
entnimmt er heimlich <strong>de</strong>m<br />
Drachenschatz und benutzt es, um<br />
Frie<strong>de</strong>n zwischen Zwergen und Menschen<br />
und Elben zu stiften. Für sich<br />
selbst wird er am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Romans nur<br />
ein kleines Vermögen als Lohn akzeptieren.<br />
Sein Gegenspieler bei <strong>de</strong>r Suche<br />
nach <strong>de</strong>m Arkenjuwel, <strong>de</strong>r Zwerg Thorin<br />
Eichenschild, verfälllt <strong>de</strong>n Reichtümern,<br />
die sie <strong>de</strong>m Drachen abgenommen<br />
haben, und stirbt, weil er <strong>de</strong>n Arkenstein<br />
besitzen will. Er nimmt das<br />
Juwel, um das aller Streit sich drehte,<br />
mit in sein Grab.<br />
Diese Hobbitrolle <strong>de</strong>s maßvollen<br />
Lebens wird im HERRN DER RINGE noch<br />
weiter ausgebaut. Der Leser <strong>de</strong>s HERRN<br />
DER RINGE hat <strong>de</strong>n Eindruck, dass alle<br />
an<strong>de</strong>ren Akteure ihre Rollen zu spielen<br />
haben und entsprechen<strong>de</strong>n Zwängen ausgeliefert<br />
sind. Die Last <strong>de</strong>r Maßstäbe,<br />
die an ritterliche Hel<strong>de</strong>n und Zauberer,<br />
an Elben und Zwerge in <strong>de</strong>rlei Erzählungen<br />
angelegt wer<strong>de</strong>n, bin<strong>de</strong>t diese<br />
Figuren. Der Autor verleiht diesen literarischen<br />
Figuren gleichsam keine<br />
Freiheit.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
BEITRÄGE<br />
149
BEITRÄGE<br />
150<br />
Was aber sind Hobbits – bzw. spezieller<br />
gefragt: Was sind die Beutlins<br />
für Hobbits? Hobbits im allgemeinen<br />
sind in <strong>de</strong>r Märchentradition nicht so<br />
leicht einordbar wie Zwerge.<br />
Wir erleben die Hobbits als kleine<br />
Wesen, die in einer für sie übermächtigen<br />
und oft unverständlichen Welt ihr<br />
Bestes geben und ihr Ziel <strong>de</strong>r „Behaglichkeit“<br />
19 verfolgen. Sie verleugnen<br />
sich we<strong>de</strong>r selbst und ihren Lebensstil,<br />
noch eifern sie einem großen Ziele<br />
nach. Die Hobbits sind wie Symbole<br />
<strong>de</strong>s biblischen Satzes, dass man wer<strong>de</strong>n<br />
solle wie die Kin<strong>de</strong>r. Der Durchschnittshobbit<br />
ist allerdings durch diese<br />
Behaglichkeitsten<strong>de</strong>nz, zu <strong>de</strong>r es auch<br />
gehört, dass alles so bleiben solle wie<br />
immer, ein kleiner Spießbürger.<br />
In <strong>de</strong>r mütterlichen Linie <strong>de</strong>r Beutlins,<br />
über Bilbos Mutter Belladonna<br />
Tuk, vererbt sich aber ein abenteuerlustiges<br />
Moment. So ist – wie die an<strong>de</strong>ren<br />
Hobbits es wahrnehmen – „bei ihnen<br />
nicht alles hobbitmäßig“ 20 .<br />
Bilbo und Frodo erfüllen – zunächst<br />
wi<strong>de</strong>rwillig, wie Frodo, <strong>de</strong>r lieber zu<br />
Hause bliebe, als <strong>de</strong>n Ring <strong>de</strong>r Macht<br />
vernichten zu helfen – ihre Pflicht an<br />
<strong>de</strong>m Ort, an <strong>de</strong>n sie das Schicksal stellt,<br />
und sie sind immer wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Lage,<br />
auch in extremen Situationen ein kleines<br />
bisschen Spaß zu haben.<br />
Beutlins wollen leben und nicht als<br />
irgendwelche literarische Funktionsträger<br />
agieren – auf diese Weise nutzen sie<br />
das zum Wesen aller Hobbits gehörige<br />
Vermögen, „rasch und lautlos zu verschwin<strong>de</strong>n“<br />
21 . Sie belegen <strong>de</strong>n literarischen<br />
Ort, an <strong>de</strong>m die Eigenfreiheit literarischer<br />
Figuren auch im feststehendsten<br />
Mythos ausgelebt wer<strong>de</strong>n kann. Sie<br />
existieren im Schwebezustand zwischen<br />
<strong>de</strong>n sonst verteilten Rollenklischees.<br />
Held, böser Zauberer, guter Zauberer,<br />
Grabunhold u.ä zu sein, ist nicht nur anstrengend,<br />
son<strong>de</strong>rn macht auch unfrei.<br />
Hobbits können sich viel erlauben. In<br />
dieser Hinsicht gleicht ihnen nur noch<br />
<strong>de</strong>r fast unverwüstliche Tom Bombadil.<br />
Immer wie<strong>de</strong>r stößt man bei <strong>de</strong>n<br />
Beutlins auf das Gespür für das rechte<br />
Maß. Der Austritt aus <strong>de</strong>m Verhängnis<br />
<strong>de</strong>r Macht, die <strong>de</strong>r Ring ausstrahlt, ge-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Der Herr <strong>de</strong>r Ringe – Die zwei Türme – Sam und Frodo © Cinetext<br />
lingt Frodo auf zweierlei Weise: Er tötet<br />
<strong>de</strong>n Kannibalen und Ringbesitzer<br />
Gollum nicht, als er ihm <strong>de</strong>n Ring<br />
nimmt, und später ist er in <strong>de</strong>r Lage –<br />
wenn auch wi<strong>de</strong>rwillig –, <strong>de</strong>n Ring freiwillig<br />
an Frodo weiter zu geben. Eine<br />
Fähigkeit, die <strong>de</strong>r weise und mächtige<br />
Gandalf sich nicht zutraut.<br />
Frodo setzt diese Verhaltensweisen<br />
fort. Er verzichtet ebenfalls darauf,<br />
Gollum zu töten, weil er in ihm <strong>de</strong>n gefallenen<br />
Bru<strong>de</strong>r im Ringtragen sieht.<br />
Es stellt sich heraus, dass nur diese<br />
Tat die Möglichkeit eröffnet, <strong>de</strong>n Ring<br />
zu zerstören. Angesichts <strong>de</strong>s verzehren<strong>de</strong>n<br />
Feuers am Orodruin schafft<br />
Frodo es nicht, <strong>de</strong>n Ring zu vernichten.<br />
Gollum opfert sich unfreiwillig in seiner<br />
Verzweiflung über <strong>de</strong>n Verlust <strong>de</strong>s<br />
Ringes und beißt Frodo <strong>de</strong>n Ringfinger<br />
ab und fällt in das Feuer.<br />
Wie alle, die eine große Aufgabe<br />
haben, schlid<strong>de</strong>rt aber auch Frodo in<br />
Rollenzwänge. Er ist <strong>de</strong>r Ringträger<br />
und vollbringt heroische Aufgaben, die<br />
ihn zu einer herausgehobenen Figur<br />
machen. Mehrere Male im Roman verklärt<br />
ihn die Macht <strong>de</strong>s Ringes zu einer<br />
übergroßen Gestalt.<br />
Als Frodo Gollum durch einen Eid<br />
auf <strong>de</strong>n Ring zum Gehorsam verpflich-<br />
tet, scheint es Sam, „als sei sein Herr<br />
gewachsen und Gollum geschrumpft:<br />
ein großer, strenger Schatten, ein mächtiger<br />
Herr, <strong>de</strong>r seine Pracht in einer<br />
grauen Wolke verhüllt, und zu seinen<br />
Füßen ein kleiner, winseln<strong>de</strong>r Hund“ 22 .<br />
Angesichts <strong>de</strong>s Schicksalsfeuers und<br />
kurz vor seinem Versagen als Ringträger,<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Ring nicht vernichten will,<br />
erlebt Sam Frodo und Gollum noch<br />
einmal als in sich spannungsreiche Protagonisten<br />
bzw. Antagonisten.<br />
„Dann plötzlich, wie damals an <strong>de</strong>n<br />
Säumen <strong>de</strong>s Emyn Muil, sah Sam diese<br />
bei<strong>de</strong>n Gegner mit an<strong>de</strong>ren Augen. Ein<br />
zusammengekauertes Geschöpf, kaum<br />
mehr als <strong>de</strong>r Schatten eines Lebewesens,<br />
jetzt völlig vernichtet und besiegt,<br />
und <strong>de</strong>nnoch von abscheulichem Gelüste<br />
und Raserei erfüllt; und vor ihm<br />
stand, unbeugsam, für Mitleid jetzt unerreichbar,<br />
eine in Weiß geklei<strong>de</strong>te Gestalt,<br />
aber an ihrer Brust hielt sie ein<br />
Feuerrad. Aus <strong>de</strong>m Feuer sprach eine<br />
befehlen<strong>de</strong> Stimme.“ 23<br />
Auch Saruman erfasst <strong>de</strong>n auf Rache<br />
an ihm verzichten<strong>de</strong>n Frodo, wenn<br />
er ihn als „weise und grausam“ 24 bezeichnet.<br />
Kurz vor <strong>de</strong>r Vernichtung <strong>de</strong>s Ringes<br />
wird Frodo mit seinem letzten
Scheitern als stromlinienförmiger Heilbringer<br />
konfrontiert. Er bläst sich<br />
auch auf – ein echter mythischer Held<br />
hat nicht nur Lichtseiten, son<strong>de</strong>rn er<br />
ist auch verstrickt in düstere Schicksale<br />
und erweist gera<strong>de</strong> in höchster<br />
heroischer Höhe seine radikale Endlichkeit.<br />
Einer aber unter <strong>de</strong>n Hobbits ist<br />
gänzlich unspektakulär. Sam ist <strong>de</strong>r unbefangene,<br />
nicht in irgendwelche unguten<br />
Lei<strong>de</strong>nschaften verstrickte, unbeirrbare<br />
Freund <strong>de</strong>s Ringträgers Frodo.<br />
Sam spielt keine mythologische Rolle.<br />
Er ist we<strong>de</strong>r Zauberer noch Held,<br />
noch Bösewicht, noch unbeteiligtes Volk.<br />
Er ist nur <strong>de</strong>r wohlwollen<strong>de</strong> Freund,<br />
<strong>de</strong>m je<strong>de</strong>r Eigennutz fremd ist – wenn<br />
man von seiner Neugier auf Elben und<br />
leben<strong>de</strong> Bäume und <strong>de</strong>m Vergnügen<br />
am Gartenbau absieht.<br />
Es geht im Roman fast unter, dass<br />
Sam für kurze Zeit zum Ringträger<br />
wird, als Frodo von <strong>de</strong>r Spinne Kankra<br />
scheinbar umgebracht wur<strong>de</strong>. Für kurze<br />
Zeit nur ringt er mit <strong>de</strong>r Versuchung<br />
ein mächtiger Gärtner zu wer<strong>de</strong>n. Doch<br />
Sam lebt wohlwollend und pflichtbewusst.<br />
„Nein, entwe<strong>de</strong>r hier sitzen, bis sie<br />
kommen und mich auf <strong>de</strong>r Leiche <strong>de</strong>s<br />
Herrn töten und Ihn bekommen; o<strong>de</strong>r<br />
Ihn nehmen und gehen.’ Er holte tief<br />
Luft. ‚ Dann heißt es: Ihn nehmen!’.“ 25<br />
Es ist ein Leichtes für ihn, <strong>de</strong>n Ring<br />
wie<strong>de</strong>r an Frodo zurückzugeben. Sam<br />
ist <strong>de</strong>r solidarisch mit Frodo mitwan<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>,<br />
abenteuerlustige Freund, <strong>de</strong>r<br />
immer wie<strong>de</strong>r darauf gestoßen wird,<br />
wie unsinnig eine Welt <strong>de</strong>r Machtgelüste<br />
ist.<br />
Augustinus bestimmt das Böse als<br />
Abkehr vom unvergänglichen Guten<br />
und als Hinwendung zu <strong>de</strong>n wan<strong>de</strong>lbaren<br />
Gütern dieser Welt („Sed malum sit<br />
aversio eius ab incommutabili bono, et<br />
conversio ab mutabilia bona.“ 26 ).<br />
Er fragt, woher dieses Interesse an<br />
<strong>de</strong>r Wan<strong>de</strong>lbarkeit und die Abkehr vom<br />
unvergänglichen Guten komme. „Der<br />
Wille wird also bewegt, wenn er sich<br />
vom unwan<strong>de</strong>lbaren zum wan<strong>de</strong>lbaren<br />
Gut abwen<strong>de</strong>t, und die Frage ist naheliegend,<br />
woher in ihm diese Bewegung<br />
entsteht … Von Gott kann diese Bewegung<br />
nicht ausgehen. Woher kommt sie<br />
aber? Wenn du mich so fragst, und ich<br />
dir zur Antwort geben muß, ich weiß es<br />
nicht, wird dich das vielleicht traurig<br />
machen, aber es ist die Wahrheit. Das<br />
Nichts kann man nicht wissen.“ 27<br />
Wen<strong>de</strong>t sich also <strong>de</strong>r Mensch vom<br />
höchsten Gut, von Gott ab, dann ist seine<br />
Freiheit davon innerlich bestimmt.<br />
Daher ist <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>r charakterisiert als<br />
„incurvatus in seipsum“, als in sich<br />
selbst zusammengekrümmt, also als<br />
nicht mehr geradlinig auf Gott als das<br />
höchste Gut ausgerichtet.<br />
Sam ist i<strong>de</strong>al gefasst <strong>de</strong>r Mensch,<br />
<strong>de</strong>r das Wohlwollen Gottes ent<strong>de</strong>ckt<br />
hat und nutzt. Er lebt in <strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong> Gottes,<br />
die ihn kaum noch zusammengekrümmt<br />
sein lässt. Durch seine Integration<br />
in <strong>de</strong>n Herrschaftsbereich Gottes<br />
ist ihm die Versuchung, zu sein wie<br />
Gott, d.h. hier: dann faktisch zu wer<strong>de</strong>n<br />
wie <strong>de</strong>r Herr von Mordor, fremd. In<br />
dieser Hinsicht ist – wie man pointiert<br />
sagen könnte – Sam nahezu konkupiszenzfrei.<br />
Solcherlei ‚Hel<strong>de</strong>n’ in Anführungszeichen<br />
eignen sich nicht zur I<strong>de</strong>ntifikation<br />
für Leser, die neomythische Allmachtsphantasien<br />
pflegen wollen.<br />
8. O<strong>de</strong>r wird vom HERRN DER RINGE<br />
nur ein neomythischer Gebrauch<br />
gemacht?<br />
Alle Akteure <strong>de</strong>s tolkienschen Romanwerkes<br />
sind radikal endlich. Dies<br />
gilt auch z.B. für die Ents, <strong>de</strong>ren Wäl<strong>de</strong>r<br />
vernichtet wer<strong>de</strong>n, und die Elben,<br />
die nicht nur in einer an<strong>de</strong>ren Raumzeitdimensioniertheit<br />
leben, son<strong>de</strong>rn<br />
auch miterleben müssen, dass aus Elbenfolter,<br />
Gehirnwäsche und einem<br />
gentechnischen Experiment <strong>de</strong>r Ork<br />
und später <strong>de</strong>r orkische Uruk-hai entstan<strong>de</strong>n.<br />
Orks sind Mischwesen, <strong>de</strong>nen je<strong>de</strong>s<br />
mitmenschliche Gefühl und <strong>de</strong>r Anspruch<br />
auf eine allgemeine Menschenvernunft<br />
und eine entsprechen<strong>de</strong> Wür<strong>de</strong><br />
fehlt. Sie sind <strong>de</strong>r <strong>de</strong>rbste Spiegel,<br />
<strong>de</strong>n Tolkien <strong>de</strong>n reinen Elben vorhält,<br />
und ein Einbruch <strong>de</strong>r Phantastik in die<br />
scheinbar heile Fantasywelt.<br />
Eine <strong>de</strong>r Romanpassagen, die sich<br />
mir bleibend eingeprägt haben, ist ein<br />
Gespräch zwischen zwei Orks, die sich<br />
erinnern, dass einer ihrer Kollegen von<br />
<strong>de</strong>r Spinne Kankra gefangen und verschleppt<br />
wur<strong>de</strong>.<br />
„Erinnerst du dich an <strong>de</strong>n alten Ufthak?<br />
Wir hatten ihn seit Tagen vermißt.<br />
Dann fan<strong>de</strong>n wir ihn in einem Winkel;<br />
aufgehängt war er, aber er war hellwach<br />
und starrte. Wie wir lachten! Vielleicht<br />
hatte sie ihn vergessen, aber wir rührten<br />
ihn nicht an – es hat keinen Zweck, sich<br />
mit Ihr (<strong>de</strong>r Spinne, L.H.) einzulassen.“<br />
28 So han<strong>de</strong>ln gentechnische Mischwesen.<br />
Auf diese Weise spiegelt sich die<br />
Ambivalenz unserer durch wissenschaftsfundierte<br />
Technik geprägten<br />
Welt auch im Romanwerk Tolkiens.<br />
Das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt entwickelt<br />
nicht nur romantische Vorstellungen<br />
über das Genie und Neue Mythologie,<br />
son<strong>de</strong>rn auch eine Begriffswelt,<br />
die mit Termini wie Dégenération,<br />
Entartung und Rassenhygiene umschrieben<br />
wird.<br />
Francis Galton (1822 - 1911), <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>n Terminus Eugenik einführt,<br />
schreibt in seinem Buch HEREDITARY<br />
GENIUS (1892), dass es „gut praktikabel“<br />
sein wer<strong>de</strong>, „eine hochtalentierte<br />
Menschenrasse durch geschickte<br />
Heiraten über mehrere aufeinan<strong>de</strong>r<br />
folgen<strong>de</strong> Generationen zu produzieren“<br />
29 .<br />
Der Terminus „Rassenhygiene“<br />
wird 1895 durch Alfred Ploetz (1860-<br />
1940) entwickelt. Rassenhygiene habe<br />
sich um die Verbesserung <strong>de</strong>r Erbanlagen<br />
<strong>de</strong>r menschlichen Rasse zu<br />
kümmern, damit die menschliche<br />
Gesellschaft sich weiter entwickeln<br />
könne.<br />
Es ist wie ein Kommentar zum<br />
Ethos <strong>de</strong>r Orks – auch zum Umgang<br />
untereinan<strong>de</strong>r – wenn Ploetz schreibt:<br />
„Der Kampf ums Dasein muss in<br />
voller Schärfe erhalten bleiben,<br />
wenn wir uns rasch vervollkommnen<br />
sollen, das bleibt Dictum.“ 30<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
BEITRÄGE<br />
151
BEITRÄGE<br />
152<br />
Max von Gruber (1853-1927),<br />
Ordinarius an <strong>de</strong>r Universität München<br />
und Direktor <strong>de</strong>s dortigen Hygienischen<br />
Instituts, einer <strong>de</strong>r führen<strong>de</strong>n<br />
Rassehygieniker Deutschlands,<br />
<strong>de</strong>r in München heute noch durch die<br />
Max-von-Gruber-Straße geehrt wird,<br />
bringt 1919 <strong>de</strong>n neomythischen Duktus<br />
dieser eugenischen Gedankenwelt<br />
zum Ausdruck: „Die Erfolge <strong>de</strong>r<br />
Pflanzen- und Tierzüchter dagegen<br />
lehren, wie außeror<strong>de</strong>ntlich Großes<br />
in einer kurzen Spanne Zeit durch<br />
zielbewußte Fortpflanzungsauslese<br />
erreicht wer<strong>de</strong>n kann, so daß kein<br />
Zweifel übrigbleibt, daß, wenn ähnlich<br />
in <strong>de</strong>n menschlichen Gesellschaften<br />
vorgegangen wer<strong>de</strong>n könnte,<br />
in kurzer Zeit Geschlechter erzielt<br />
wer<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>n, die an Gesundheit<br />
und Tüchtigkeit Göttern glichen.“ 31<br />
Alexan<strong>de</strong>r Tille (1866-1912) verabschie<strong>de</strong>t<br />
sich vom Gedanken einer<br />
durch eine gemeinschaftliche Vernunft<br />
verbun<strong>de</strong>nen Menschheit zugunsten<br />
einer Orkvernunft in seinem<br />
Manifest VON DARWIN ZU NIETZSCHE.<br />
EIN BUCH ENTWICKLUNGSETHIK (1895) 32<br />
und entwirft <strong>de</strong>n Gedanken einer<br />
schrankenlosen völkischen gentechnischen<br />
Kultur: „Wir erbärmlichen<br />
Menschenkindlein haben uns aus allerhand<br />
Schwachheiten ein Moralchen<br />
zusammengebraut. Du große<br />
Natur hast eine an<strong>de</strong>re Moral, darum<br />
bist du nach unserem Moralchen unmoralisch.“<br />
33<br />
Diesem Programm entspricht<br />
Hitlers Standpunkt. Der evolutionistische<br />
Vulgärphilosoph Hitler entwirft<br />
das Bild einer Menschheit, die<br />
vor einem Evolutionssprung steht.<br />
„Die ganze Schöpferkraft aber wird<br />
sich in <strong>de</strong>r neuen Menschenspielart<br />
konzentrieren. … Gottmensch und<br />
Massentier möchte ich die bei<strong>de</strong>n<br />
Spielarten nennen.“ 34<br />
Von Tolkien her betrachtet wer<strong>de</strong>n<br />
– ohne dass dies bewusst geschehen<br />
sein muss – aus <strong>de</strong>n arierzüchten<strong>de</strong>n<br />
SS-Or<strong>de</strong>nsburghochzuchten Orkhöhlen.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Es spielt sich in Tolkiens<br />
heroischen Landschaften<br />
und durch die<br />
heroischen Guten und<br />
Bösen vor <strong>de</strong>n Augen <strong>de</strong>s<br />
Lesers und vor <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>s<br />
Gott wohlgefällig leben<strong>de</strong>n<br />
Sam ein großes Welttheater<br />
ab, das durchaus<br />
dieser Welt zugehörig ist<br />
und Allmachtsphantasien<br />
abwehrt.<br />
9. Harry Potter – ein<br />
neomythischer Held<br />
wi<strong>de</strong>r Willen? 35<br />
Das von Campbell<br />
herausgearbeitete Schema<br />
und die zum Mythos<br />
gemachten Bemerkungen<br />
lassen sich auch auf Joanne<br />
Kathleen Rowlings<br />
(*1966) Harry-Potter-Kosmos<br />
(1997ff) beziehen.<br />
Die Grundi<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r als Heptalogie<br />
geplanten Harry-Potter-Romanfolge besteht<br />
darin, dass je<strong>de</strong>r Band aus einem<br />
Schuljahr <strong>de</strong>s Zauberlehrlings Harry<br />
Potter erzählt, <strong>de</strong>r mit seinen Freun<strong>de</strong>n<br />
Ron Weasley und Hermine Granger an<br />
<strong>de</strong>r Magierschule Hogwarts unterrichtet<br />
wird und dabei zugleich einen<br />
Kampf mit <strong>de</strong>m Rassisten Lord Vol<strong>de</strong>mort<br />
führen muss. Kosmisch wird diese<br />
Lehrzeit, weil sie einen Kampf betrifft,<br />
<strong>de</strong>r bis in die geschichtliche Vorzeit<br />
<strong>de</strong>r Schule zurückreicht.<br />
Die Geschichte Harry Potters übergreift<br />
die Geschichte <strong>de</strong>r zauberbegabten<br />
Menschen. Vor tausend Jahren wur<strong>de</strong><br />
Hogwarts von <strong>de</strong>n damals machtvollsten<br />
Hexen und Zauberern begrün<strong>de</strong>t,<br />
die eine Einteilung in vier Häuser<br />
vornahmen (IV,185f.). Je<strong>de</strong>s dieser Häuser<br />
symbolisiert eine bestimmte Zugangsweise<br />
zur magischen Macht<br />
(IV,249) und ist nach <strong>de</strong>n Grün<strong>de</strong>rn benannt.<br />
Der Stallgeruch dieser Häuser<br />
entspricht typischen charakterlichen<br />
Ausgangssituationen <strong>de</strong>r Hogwarts-<br />
Schüler und gestaltet diese weiter: Die<br />
namengeben<strong>de</strong>n Gründungsfiguren sind<br />
Harry Potter und die Kammer <strong>de</strong>s Schreckens © Warner-Cinetext<br />
Helga Huffelpuff, Godric Gryffindor,<br />
Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin.<br />
Wie viele Ursprungsmythen von<br />
Gemeinschaften beginnt alles mit einem<br />
paradiesischen Stadium, in <strong>de</strong>m<br />
sich ein Sün<strong>de</strong>nfall ereignet. Slytherin<br />
will die Aufnahmekandidaten exklusiv<br />
auf Abkömmlinge aus reinrassigen<br />
Zaubererfamilien eingrenzen, Mischlinge<br />
dagegen sollen ausgegrenzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Dieser Plan scheitert und beschwört<br />
<strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong> Dauerkonflikt<br />
herauf. Wie bei Tolkien sehen wir hier<br />
einen Bezug auf eines <strong>de</strong>r wesentlichen<br />
ethischen Probleme <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne:<br />
die Kombination von Elite<strong>de</strong>nken<br />
mit <strong>de</strong>m Gedanken eines durch <strong>de</strong>n<br />
Elitestatus verbun<strong>de</strong>nen Rechtes <strong>de</strong>r<br />
Rassenauslese.<br />
Ein zukünftiger Erbe sollte in einer<br />
späteren Epoche seine Mission mit Hilfe<br />
<strong>de</strong>s Schreckens o<strong>de</strong>r Monsters in<br />
Salazar Slytherins Geheimkammer vollen<strong>de</strong>n<br />
und die „Schlammblüter“ aus <strong>de</strong>r<br />
Schule und damit <strong>de</strong>m Zugriff auf Magie<br />
ausschließen (II,157-159). Mit diesem<br />
Entschluss ist eine Geschichte <strong>de</strong>r<br />
Sün<strong>de</strong> im Zaubererreich in Gang
Harry Potter und die Kammer <strong>de</strong>s Schreckens © Warner-Cinetext<br />
gesetzt. Der ehemalige Schulsprecher<br />
TomVorlost Riddle (später: Lord Vol<strong>de</strong>mort)<br />
versucht, <strong>de</strong>n Auftrag Salazar<br />
Slytherins zu übernehmen. Mit einer<br />
Elite von Spösslingen rassereiner Zaubererfamilien<br />
unternimmt er einen<br />
Putsch. Dabei ist <strong>de</strong>r Vatermör<strong>de</strong>r Vol<strong>de</strong>mort<br />
selbst nicht rasserein. Um so<br />
mehr hasst er die väterliche Muggelherkunft<br />
und versucht, sich mit neuem<br />
Namen eine neue I<strong>de</strong>ntität zu verschaffen.<br />
Der Name Riddles stellt ein Anagramm<br />
Vol<strong>de</strong>morts dar: „TOM VOR-<br />
LOST RIDDLE – IST LORD VOLDE-<br />
MORT" (II,323).<br />
Ebenso wie Vol<strong>de</strong>mort ist Harry<br />
Potter eine Schlüsselfigur in einem<br />
letztlich kosmischen Konflikt. Kosmisch<br />
ist dieser Konflikt, weil es um<br />
die Ausein<strong>de</strong>ran<strong>de</strong>rsetzung über die<br />
Alternative einer durch schwarze<br />
o<strong>de</strong>r durch weiße Magie beherrschten<br />
bzw. nur mitgestalteten Welt geht,<br />
und damit zugleich um die Frage, ob<br />
Muggels als Sklaven gehalten wer<strong>de</strong>n<br />
dürfen.<br />
Vol<strong>de</strong>mort, einst hochbegabter<br />
Schüler und Schulsprecher in Hog-<br />
warts, hat sich <strong>de</strong>r schwarzen Magie<br />
hingegeben (II,339) und sich – wie etwa<br />
Darth Va<strong>de</strong>r in STAR WARS 36 – <strong>de</strong>r<br />
dunklen Seite <strong>de</strong>r Macht zugewandt<br />
und seine Begabung auf das hemmungslose<br />
Streben nach Macht<br />
(IV,25) gerichtet. Sein Plan, die weißmagische<br />
Zaubererwelt zu vernichten,<br />
scheitert an Harry Potter (I,64; IV,151-<br />
153). Das Baby Harry Potter ist durch<br />
die Liebe <strong>de</strong>r Mutter, die für ihr Kind<br />
in <strong>de</strong>n Tod geht, geschützt (IV,227f.).<br />
Der zu Harry Potter gesprochene To<strong>de</strong>sfluch<br />
„Avada kedavra“ (IV,220-<br />
239.657.666), mit <strong>de</strong>m das Baby getötet<br />
wer<strong>de</strong>n soll, prallt von Harry ab<br />
und richtet sich auf Vol<strong>de</strong>mort. Liebe<br />
wird auf diese Weise zu einer kosmischen<br />
Macht (II,322.325). Vol<strong>de</strong>morts<br />
Existenz beschränkt sich, nach<strong>de</strong>m<br />
er aus seinem „Körper gerissen"<br />
ist, zunächst darauf, „weniger als ein<br />
Geist, weniger als das kläglichste Gespenst"<br />
(IV,682) zu sein. Zunächst ist<br />
<strong>de</strong>r nachtodlich weiterexistieren<strong>de</strong><br />
Vol<strong>de</strong>mort nahezu machtlos und<br />
schattenhaft, ein Teil seiner Kräfte ist<br />
hingegen an Harry haften geblieben.<br />
Der Devitalisierung auf <strong>de</strong>r einen Seite<br />
entspricht ein Vitalitätszuwachs auf<br />
<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren. Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s vierten Ban<strong>de</strong>s<br />
wird dieses Ungleichgewicht auf<br />
kannibalistische Weise wie<strong>de</strong>r ausgeglichen.<br />
Auch aufgrund dieser Transfers<br />
von „power“ bestehen zwischen<br />
Harry und Vol<strong>de</strong>mort „merkwürdige<br />
Ähnlichkeiten“ (II,326.342f; vgl.<br />
I,32-35; II,204-208), so dass Harry an<br />
<strong>de</strong>r schwarzen Seite <strong>de</strong>s Magierreiches<br />
und damit an <strong>de</strong>ren Schattenseiten<br />
und Verführungen teilhat. Die Romanbän<strong>de</strong><br />
beschreiben, wie Vol<strong>de</strong>mort<br />
immer mehr an neuer Existenzmacht<br />
gewinnt.<br />
Eine blitzförmige Narbe auf Harrys<br />
Stirn erinnert an <strong>de</strong>n To<strong>de</strong>sfluch. Sie ist<br />
Symbol <strong>de</strong>s Lei<strong>de</strong>ns und <strong>de</strong>r Macht in<br />
einem. An<strong>de</strong>re Zauberer erkennen Harry<br />
an ihr. Wenn sie schmerzt, ist ein<br />
Auftritt Vol<strong>de</strong>morts zu erwarten (IV21-<br />
32, 153, 628, 73 7f.). Als Vol<strong>de</strong>mort im<br />
Körper seines Sklaven Quirrell Harry<br />
angreift (I: 320, 324), ist es Harrys<br />
nackte Hautoberfläche als ganze, die<br />
ihn vor <strong>de</strong>r Vernichtung bewahrt. Die<br />
schützen<strong>de</strong> Mutterliebe ist ihm auf die<br />
Haut geschrieben, und Quirrell verbrennt.<br />
Vol<strong>de</strong>mort ist danach wie<strong>de</strong>r<br />
„so schwach wie zuvor“ (IV,684). Mit<br />
<strong>de</strong>m vierten Band kann Harry Potter<br />
aber doch durch Vol<strong>de</strong>mort berührt<br />
wer<strong>de</strong>n (IV, 682).<br />
Anzunehmen ist, dass es einen Endkampf<br />
geben wird, in <strong>de</strong>m Potter und<br />
Vol<strong>de</strong>mort auf <strong>de</strong>r gleichen Realitätsebene<br />
ihre Kräfte messen müssen. Neomythische<br />
Fantasybedürfnisse an kosmischer<br />
Macht und <strong>de</strong>r Traum, selbst<br />
zaubern zu lernen, mögen durch diese<br />
kosmischen Kämpfe durchaus befriedigt<br />
wer<strong>de</strong>. Der im meist nahezu unfreiwilligen<br />
Siegen lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Harry Potter<br />
ist aber – von seiner literarischen<br />
Konstruktion her verstan<strong>de</strong>n – kein neomythischer<br />
Held, <strong>de</strong>r seine radikale<br />
Endlichkeit abstreifen wird. Er wird<br />
gera<strong>de</strong> immer endlicher, um Vol<strong>de</strong>mort<br />
besiegen zu können.<br />
Die kosmische Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Liebe<br />
wird dann die ausschlaggeben<strong>de</strong><br />
Macht sein. Die Liebe sperrt sich <strong>de</strong>m<br />
neomythischen Denken.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
BEITRÄGE<br />
153
BEITRÄGE<br />
154<br />
Anmerkungen<br />
01 Berger/Berger/Kellner, 1987, 72.<br />
02 Berger/Berger/Kellner, 1987, 159.<br />
03 Vgl. dazu etwa Freund, 1995; Ruthner, 1995; Rottensteiner,<br />
1987; Frenschkowski, 1999.<br />
04 Beckett, 1972.<br />
05 Frenschkowski, 1999, 43.<br />
06 Auf diese Weise wer<strong>de</strong>n Ereignisse begreifbar als<br />
„eine strukturierte Menge von teils gegenwärtigen,<br />
teils überlieferten Systemen, die weitgehend übereinan<strong>de</strong>r<br />
in mannigfaltigen Beziehungen stehen und<br />
in <strong>de</strong>ren Umkreis sich eine Gemeinschaft von Menschen<br />
zu irgen<strong>de</strong>inem Zeitpunkt bewegt“ (Hübner,<br />
1986, 195).<br />
07 Vgl. dazu auch: Colpe (1987, 33-61, 34) schreibt zu<br />
diesen ätiologischen Fragen sehr richtig: „Eine symbolische<br />
Form, in welchen Phänomene zu fassen<br />
wären, die in historischer Zeit und in weiten Kulturbereichen<br />
als ‚Heilige’ bestimmt wer<strong>de</strong>n dürfen,<br />
kann als Mittel o<strong>de</strong>r prägen<strong>de</strong> Kraft an allen Bezügen<br />
menschlichen Lebens beteiligt gewesen sein,<br />
seit es ein solches auf <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong> gibt. Das ist wahrscheinlich,<br />
aber nicht mehr, weil diese Aussage auf<br />
zwei Voraussetzungen beruht, <strong>de</strong>ren Verifizierung<br />
durch irgen<strong>de</strong>ine Art von Nachweis nicht möglich<br />
ist. Die erste Voraussetzung besteht darin, daß zusammen<br />
mit <strong>de</strong>r Hominisation aus <strong>de</strong>m bloß additiven<br />
Zusammenleben <strong>de</strong>r frisch entstan<strong>de</strong>nen Menschen<br />
nur dadurch (die Urzelle) eine(r) Gesellschaft<br />
entstand, daß eine reflektive Transformation <strong>de</strong>r<br />
zoologischen Naturwüchsigkeit stattfand, durch<br />
welche Instinkt zur Erfahrung wur<strong>de</strong>; an<strong>de</strong>rs gesagt:<br />
Nur dadurch, daß die bloß zeichenhafte Natürlichkeit<br />
<strong>de</strong>r Individuen und ihres instinktiven Zusammenfin<strong>de</strong>ns<br />
in eine symbolhaltige Nicht-mehr- o<strong>de</strong>r<br />
Mehr-als-Natürlichkeit, d.h.: Vergemeinschaftung<br />
o<strong>de</strong>r Vergesellschaftung überging, in <strong>de</strong>r Erfahrungen<br />
<strong>de</strong>rgestalt gemacht wur<strong>de</strong>n, daß man sie wie<strong>de</strong>rholen,<br />
be<strong>de</strong>nken, korrigieren und ausdrücken<br />
konnte. Die zweite Voraussetzung ist, daß bei diesem<br />
Vorgang eine Regelhaftigkeit entstand, als <strong>de</strong>ren<br />
Komplement o<strong>de</strong>r auch Gegensatz das Regelfrem<strong>de</strong>,<br />
Anormale, Außergewöhnliche nicht nur<br />
ständig bewußt blieb, son<strong>de</strong>rn auch je<strong>de</strong>rzeit stattfin<strong>de</strong>n<br />
konnte“.<br />
08 Blumenberg, 1981, 9.<br />
09 Blumenberg, 1981, 10. Vgl. auch: „Der Bereich, in<br />
<strong>de</strong>m das Wissen verlässlicher Voraussagen von<br />
künftigen Ereignissen und beson<strong>de</strong>rs von angestrebten<br />
Handlungsresultaten ermöglicht, ist bei <strong>de</strong>n<br />
‚Naturvölkern’ gering und umfasst auch bei uns erst<br />
einen Teil <strong>de</strong>r Lebenswirklichkeit. Weit größer ist das<br />
Gebiet <strong>de</strong>s Unbekannten und Unvorhersehbaren,<br />
<strong>de</strong>m man ratlos und ohnmächtig gegenübersteht.<br />
Hier ist die Domäne <strong>de</strong>r Magie, und an sie klammert<br />
sich <strong>de</strong>r Mensch, wenn er die Unzulänglichkeit seines<br />
Wissens und seiner rationalen Metho<strong>de</strong>n anerkennen<br />
muss. Das gilt nicht nur für die ‚Primitiven’,<br />
son<strong>de</strong>rn weitgehend auch noch für die ‚Zivilisierten’<br />
…“ (Tobisch, 1986, 62).<br />
10 Blumenberg, 1981, 10.<br />
11 Blumenberg, 1981, 11.<br />
12 Campbell, 1999, 36.<br />
13 Vgl. dazu Welte, 1990.<br />
14 Schmidt, 1979, 253.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
15 Vgl. dazu ausführlich Hauser, 2003.<br />
16 Man <strong>de</strong>nke hier nur an die Paradieseserzählung<br />
<strong>de</strong>s Alten Testaments, an Ödipus, Orest, Odysseus<br />
uvm.<br />
17 Szepes, 1991, 570f.<br />
18 Tolkien, 1974, 34.<br />
19 Tolkien, 1974, 7.<br />
20 Tolkien, 1974, 8.<br />
21 Tolkien, 1974, 8.<br />
22 Tolkien, 1977, II/258.<br />
23 Tolkien, 1977, III/249.<br />
24 Tolkien, 1977, III/338.<br />
25 Tolkien, 1977, II/394.<br />
26 Augustinus, <strong>de</strong> libero arbitrio, II, XIX, 53.<br />
27 Augustinus, <strong>de</strong> libero arbitrio, II, XIX, 54, zit. nach A.<br />
Augustinus, Der freie Wille, Pa<strong>de</strong>rborn 1961, 107.<br />
28<br />
Tolkien, 1977, II/404.<br />
29 Galton, 1892, 1 (Übersetzung L.H.).<br />
30 Ploetz, 1895, 147.<br />
31 Zit. nach Gilbhard, 1994, 19f.<br />
32 Vgl. zu Tille, Conrad-Martius, 1955, 214-282.<br />
33<br />
Tille, 1895, 120. Ich entnehme diesen Hinweis Conrad-Martius,<br />
1955, 219f.<br />
34 Rauschning, 1940, 231f.<br />
35 Zit. im Folgen<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Bandzahl im Text. Beson<strong>de</strong>rs<br />
beziehe ich mich im Folgen<strong>de</strong>n auf Herzog,<br />
2001 (siehe dort auch die ausführlichen Literaturhinweise<br />
zu Rowling).<br />
36 Vgl. dazu Hauser, 1999.<br />
Prof. Dr. Lic. theol. Linus Hauser ist<br />
Professor im Fachbereich 04: Geschichte<br />
und Kulturwissenschaften.<br />
Institut für Katholische Theologie <strong>de</strong>r<br />
Justus-Liebig-Universität Gießen.<br />
Literatur<br />
Aldiss, B.W.: Der Malacia-Gobelin. – München. 1978.<br />
Augustinus, A.: Der freie Wille. – Pa<strong>de</strong>rborn. 1961.<br />
Beckett, S.: Der Verwaiser. – Frankfurt. 1972.<br />
Berger, P.L./ Berger, B./ Kellner, H.: Das Unbehagen in<br />
<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rnität. – Frankfurt/New York. 1987.<br />
Birk, W.: Fantasy in: Erster Deutscher Fantasy Club e.V.<br />
(Hg.) Fantasia 1 – Passau. 1978, 52.<br />
Blumenberg, H.: Arbeit am Mythos – Frankfurt. 1981.<br />
Colpe, C. (Hg.): Die wissenschaftliche Beschäftigung mit<br />
‚<strong>de</strong>m Heiligen’ und ‚Das Heilige’ heute, in: Kamper, D./<br />
Wulf, C. (Hg.): Das Heilige. Seine Spur in <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne –<br />
Frankfurt am Main. 1987, 33-61.<br />
Conrad-Martius, H.: Utopien <strong>de</strong>r Menschenzüchtung.<br />
Der Sozialdarwinismus und seine Folgen – München.<br />
1955.<br />
Cornelius, C.: Harry Potter – geretteter Retter im Kampf<br />
gegen dunkle Mächte. Religionspädagogischer Blick<br />
auf religiöse Implikationen, archaisch-mythologische<br />
Motive und supranaturale Elemente – Münster. 2003.<br />
Donaldson, S.R.: Lord Fouls Fluch. – München. 1977<br />
(=1977a).<br />
Donaldson, S.R.: Die Macht <strong>de</strong>s Steins. – München.<br />
1977.<br />
Donaldson, S.R.: Die letzte Walstatt. – München. 1981.<br />
Donaldson, S.R.: Das verwun<strong>de</strong>te Land. – München.<br />
1984.<br />
Donaldson, S.R.: Der einsame Baum. – München. 1984.<br />
Donaldson, S.R.: Im Bann <strong>de</strong>s weißen Gol<strong>de</strong>s. – München.<br />
1985.<br />
Eddison, E.R.: Der Wurm Ouroboros. – München. 1962.<br />
Frenschkowski, M.: Religionswissenschaftliche Prolegomena<br />
zu einer Theorie <strong>de</strong>r Phantastik, in: Freund, W./<br />
Lachinger, J./ Ruthner, C. (Hg.): Der Demiurg ist ein Zwitter.<br />
Alfred Kubin und die <strong>de</strong>utschsprachige Phantastik –<br />
München. 1999, 37-57.<br />
Freund, W.: Krisen – Chaos – Katastrophen. Die phantastische<br />
Ezählliteratur von Kubin bis Kasack, in: Le<br />
Blanc, T./ Twrsnick (Hg.), Traumreich und Nachtseite. Die<br />
<strong>de</strong>utschsprachige Phantastik zwischen Déca<strong>de</strong>nce und<br />
Faschismus – Wetzlar. 1995, 86-107.<br />
Galton, F.: Hereditary Genius. An Inquiry into its Laws<br />
and Consequences – London/New York 1892 (Internetedition<br />
auf: http://www.mugu.com/galton/in<strong>de</strong>x. html).<br />
Gilbhard, H.: Die Thule-Gesellschaft. Vom okkulten<br />
Mummenschanz zum Hakenkreuz – München. 1994.<br />
Gockel, H.: Mythos und Poesie. Zum Mythosbegriff in<br />
Aufklärung und Frühromantik – Frankfurt am Main.<br />
1981.<br />
Gray, T.: Educational Experience and Belief in Paranormal<br />
Phenomena, in: Harrold, F.B./Eve, R.A.: Cult Archaeology<br />
and Creationism. Un<strong>de</strong>rstanding Pseudoscientific<br />
Beliefs about the Past – Iowa City (Iowa) 1995, 21-33.<br />
Haggard, H.R.: Sie. – München. 1984.<br />
Hauser, L.: Kritik <strong>de</strong>r neomythischen Vernunft. Bd.1:<br />
Menschen als Götter <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong>. 1800-1945 – Pa<strong>de</strong>rborn.<br />
2003.<br />
Hauser, L.: Ein Neomythos kehrt zurück. Anfragen an<br />
die Kult-Serie "Star Wars", in: Her<strong>de</strong>r-Korrespon<strong>de</strong>nz<br />
53(1999) 412-416.<br />
Hauser, L.: Mythen und Neomythen. Fantasy-Literatur in<br />
theologischer Perspektive, in: zur <strong>de</strong>batte. Themen <strong>de</strong>r<br />
Katholischen Aka<strong>de</strong>mie in Bayern, Heft 7(2003) 6f.<br />
Hauser, L.: Die Herausfor<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Religionspädagogik<br />
durch Neomythen. Sciencefiction und neue Formen<br />
<strong>de</strong>r Religiosität, in: Schreijäck, T. (Hg.): Christwer<strong>de</strong>n im
Kulturwan<strong>de</strong>l. Analysen, Themen und Optionen für Religionspädagogik<br />
und Praktische Theologie. Ein Handbuch<br />
– Freiburg i.Br./Basel/Wien. 2001, 457-476.<br />
Herzog, M.: Tod in Hogwarts? Thanatologische Bemerkungen<br />
zum Harry-Potter-Universum, in: Rheinisches<br />
Jahrbuch für Volkskun<strong>de</strong> 34(2001f) 213-245.<br />
Hudson, L.: East is East and West is West? A Regional<br />
Comparison of Cult Belief Patterns, in: Harrold, F.B./Eve,<br />
R.A.: Cult Archaeology and Creationism. Un<strong>de</strong>rstanding<br />
Pseudoscientific Beliefs about the Past – Iowa City (Iowa).<br />
1995, 49-67.<br />
Hübner, K.: Die Wahrheit <strong>de</strong>s Mythos – München. 1985.<br />
Pratt, F.: Die Einhornquelle – München. 1979.<br />
Rauschning, H.: Gespräche mit Hitler – Zürich/New York.<br />
1940.<br />
Rottensteiner, F.: Vorwort. Zweifel und Gewißheit. Zu Traditionen,<br />
Definitionen und einigen notwendigen Abgrenzungen<br />
in <strong>de</strong>r phantastischen Literatur, in: Ders.<br />
Anzeige<br />
(Hg.): Die dunkle Seite <strong>de</strong>r Wirklichkeit. Aufsätze zur<br />
Phantastik – Frankfurt am Main. 1987, 7-20.<br />
Rowling, J.K.: Harry Potter und <strong>de</strong>r Stein <strong>de</strong>r Weisen. –<br />
Hamburg. 1998.<br />
Rowling, J.K.: Harry Potter und die Kammer <strong>de</strong>s Schreckens.<br />
– Hamburg. 1999.<br />
Rowling, J.K.: Harry Potter und <strong>de</strong>r Gefangene von Askaban.<br />
– Hamburg. 1999.<br />
Rowling, J.K.: Harry Potter und <strong>de</strong>r Feuerkelch. – Hamburg.<br />
2000.<br />
Ruthner, C.: Jenseits <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne. Abriß und Problemgeschichte<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschsprachigen Phantastik 1890-1930,<br />
in: Le Blanc, T./Twrsnick (Hg.): Traumreich und Nachtseite.<br />
Die <strong>de</strong>utschsprachige Phantastik zwischen Déca<strong>de</strong>nce<br />
und Faschismus – Wetzlar. 1995, 65-85.<br />
Szepes, M.: Der Berg <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>pten. (Das erste Buch Raguel)<br />
– München. 1991.<br />
Szepes, M.: Weltendämmerung. (Das zweite Buch Raguel)<br />
– München. 1991.<br />
Schlegel, F.: Kritische Ausgabe. (Behler, E.: Hg. unter Mitwirkung<br />
von Anstett, J.-J./Eichner, H.) – München/Pa<strong>de</strong>rborn/Wien.<br />
1958ff.<br />
Schmidt, A.: Berechnungen II, in: Ders.: Aus julianischen<br />
Tagen. – Frankfurt. 1979, 243-255.<br />
Tille, A.: Von Darwin zu Nietzsche. Ein Buch Entwicklungsethik<br />
– Leipzig. 1895.<br />
Tobisch, E.: Wie rational ist Magie?, in: Lenk, H. (Hg.): Zur<br />
Kritik <strong>de</strong>r wissenschaftlichen Rationalität. – Freiburg im<br />
Breisgau/München. 1986, 55-74.<br />
Tolkien, J.R.R.: Der kleine Hobbit. – München. 1974.<br />
Tolkien, J.R.R.: Der Herr <strong>de</strong>r Ringe. (3 Bän<strong>de</strong>.) – Stuttgart.<br />
1977.<br />
Welte, B.: Das Licht <strong>de</strong>s Nichts. – Düsseldorf. 1990.<br />
Tagungshäuser im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong><br />
Karlsheim Kirchähr<br />
Die Jugendbegegnungsstätte <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s <strong>Limburg</strong>.<br />
Die beson<strong>de</strong>re Atmosphäre <strong>de</strong>s historischen Pfarrhauses<br />
und <strong>de</strong>r alten Kirche im romantischen Gelbachtal.<br />
56412 Kirchähr, Post Gackenbach<br />
Fon 0 64 39 / 70 23 – Fax 0 64 39 / 70 16<br />
karlsheim@t-online.<strong>de</strong><br />
www.tagungshaeuser.org<br />
Wilhelm-Kempf-Haus<br />
Tagen im Zentrum <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s<br />
Der Ort für Tagungen, Bildungsveranstaltungen,<br />
Ausstellungen, Kultur (mit Gymnastikhalle)<br />
65207 Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Fon 06127 / 7 70 – Fax 06127 / 7 72 57<br />
sekretariat@wilhelm-kempf-haus.<strong>de</strong><br />
www.tagungshaeuser.org<br />
Haus Nothgottes im Rheingau<br />
Tagen, entspannen, zur Ruhe kommen, sich besinnen ...<br />
in <strong>de</strong>r Atmosphäre eines alten Klosters, mit interessanter Geschichte,<br />
idyllisch gelegen inmitten von Wald, Wiesen und Weinbergen ...<br />
65385 Rü<strong>de</strong>sheim-Nothgottes<br />
Fon 0 67 22 / 4 06 60 – Fax 0 67 22 / 40 66 20<br />
haus.nothgottes@t-online.<strong>de</strong><br />
www.tagungshaeuser.org<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
BEITRÄGE<br />
155
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
156<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Halloween zwischen Brauchtum<br />
und „Verbrauchertum“<br />
Ein Unterrichtsentwurf für die Jahrgangsstufe 7/8<br />
1. Einleitung<br />
Spätestens ab Mitte Oktober, häufig<br />
aber schon <strong>de</strong>utlich früher, wer<strong>de</strong>n sie<br />
nicht mehr zu übersehen sein: Die allgegenwärtigen<br />
Kürbismasken aus allen<br />
er<strong>de</strong>nklichen Materialien, Spinnennetze<br />
in <strong>de</strong>n Schaufenstern, Totenköpfe<br />
und an<strong>de</strong>re Gruselkostüme und -accessoires<br />
kün<strong>de</strong>n von einem Brauch, <strong>de</strong>r<br />
sich spätestens seit <strong>de</strong>r Jahrtausendwen<strong>de</strong><br />
auch hierzulan<strong>de</strong> mehr und<br />
mehr etabliert. Am 31. Oktober feiert<br />
Deutschland Halloween.<br />
Angesichts dieser Entwicklung<br />
kommen verschie<strong>de</strong>ne Fragen auf: Wo<br />
liegt <strong>de</strong>r Ursprung dieses Festes? Besitzt<br />
es einen bestimmten (heidnischen<br />
o<strong>de</strong>r religiösen) Sinngehalt? Auf welchem<br />
Weg und durch welche Einflüsse<br />
gelangte dieser Brauch nach Deutschland,<br />
und in welcher Form prägt er sich<br />
hier aus? Wie verhält sich <strong>de</strong>r neue<br />
Brauch zu angestammten (christlichen)<br />
Traditionen im zeitlichen Umfeld von<br />
Halloween – Allerheiligen, Allerseelen,<br />
St. Martin? Vor <strong>de</strong>m Hintergrund einer<br />
von diesen Fragestellungen ausgehen<strong>de</strong>n<br />
skizzenhaften Standortbestimmung<br />
soll schließlich ein Unterrichtsentwurf<br />
vorgestellt wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r eine kritische<br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>m aufkommen<strong>de</strong>n<br />
Halloween-Trend im Religionsunterricht<br />
<strong>de</strong>r Jahrgangsstufe 7/8 anzielt.<br />
2. Halloween und seine Wurzeln<br />
Der Begriff „Halloween“ geht zurück<br />
auf das alte Wort „hallowed“ für<br />
„holy/ saint = heilig“. „All Hallows’<br />
Evening“ – zusammengezogen zu Hallowe’en<br />
= Halloween – meint <strong>de</strong>n Vorabend<br />
zum „All Hallows’ Day“, <strong>de</strong>m<br />
Allerheiligentag, <strong>de</strong>r im Jahr 835 von<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Papst Gregor IV. für die<br />
Gesamtkirche auf <strong>de</strong>n<br />
1. November festgelegt<br />
wur<strong>de</strong>. Die Begriffsklärung<br />
hilft jedoch bei <strong>de</strong>r<br />
Frage nach <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung<br />
<strong>de</strong>s Festes nicht<br />
weiter, <strong>de</strong>nn ein Zusammenhang<br />
zwischen <strong>de</strong>n<br />
zunächst in Irland belegtenKalen<strong>de</strong>rbräuchen<br />
an Halloween und<br />
<strong>de</strong>m christlichen Totenge<strong>de</strong>nkkult<br />
an Allerheiligen/Allerseelen<br />
besteht<br />
ursprünglich nicht. 1<br />
2.1. Das keltische<br />
Samhain-Fest<br />
am 1. November<br />
Umstritten ist aber<br />
auch die meist vorgebrachte<br />
Erklärung, die<br />
Ursprünge von Halloween<br />
seien bei <strong>de</strong>m<br />
heidnisch-keltischen<br />
„Samhain-Fest“ zu suchen,<br />
<strong>de</strong>m keltischen<br />
Neujahrsfest zum 1. November, das<br />
<strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>s Winters markierte und<br />
zugleich als Erntefest galt. Die Quellenlage<br />
zu diesem Kult ist äußerst dürftig,<br />
so dass eine Vielzahl <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Samhain-Fest<br />
in Verbindung gebrachten Rituale<br />
bloß Gegenstand von Vermutungen<br />
ist. 2 So soll das Fest von am Vorabend<br />
auf <strong>de</strong>n Hügeln entzün<strong>de</strong>ten großen<br />
Leuchtfeuern geprägt gewesen<br />
sein, die am Neujahrstag böse Geister<br />
fernhalten sollten. Auch sei <strong>de</strong>r Brauch<br />
<strong>de</strong>s Orakels – oft mit Hilfe <strong>de</strong>r Feuerasche<br />
– fest mit <strong>de</strong>m Samhain-Tag verbun<strong>de</strong>n.<br />
Altirischen Sagas <strong>de</strong>s 9. bis 12.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts zufolge stan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />
Ute Lonny-Platzbecker<br />
Gruselige Halloween-Masken © KNA-Bild, Foto: M. Nowak<br />
Nacht zu Samhain die Pforten <strong>de</strong>r „An<strong>de</strong>rswelt“<br />
offen, durch die Geistwesen<br />
ebenso wie die Seelen Verstorbener in<br />
die Menschenwelt Eintritt erhielten. 3<br />
Daher habe man in dieser Nacht – etwa<br />
durch Essens- und Getränkegaben – die<br />
übernatürlichen Kräfte wie Hexen, Dämonen<br />
und Geister besänftigen müssen.<br />
Eine gruselige Maskera<strong>de</strong> soll je<br />
nach Deutung <strong>de</strong>r Abschreckung böser<br />
Mächte gedient haben o<strong>de</strong>r aber dazu,<br />
dass sich die Toten bei ihrem Besuch in<br />
<strong>de</strong>r Menschenwelt heimisch fühlen.<br />
Tatsächlich fallen <strong>de</strong>r Vorabend<br />
zum Samhain-Fest und Halloween<br />
zeitlich zusammen, die angeblich vor-
gefun<strong>de</strong>nen Bräuche sind aber zumeist<br />
erst für das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt o<strong>de</strong>r<br />
später belegt, sodass nicht einmal sicher<br />
davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n kann,<br />
dass es sich beim Samhain-Fest wirklich<br />
um einen heidnischen Totenkult<br />
gehan<strong>de</strong>lt hat.<br />
2.2. Allerheiligen und Allerseelen –<br />
Christliche Überlagerung<br />
heidnischer Bräuche?<br />
Der zeitliche Zusammenhang zwischen<br />
<strong>de</strong>m keltischen Samhain-Fest<br />
und <strong>de</strong>m seit <strong>de</strong>m 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt ebenfalls<br />
auf <strong>de</strong>n 1. November festgelegten<br />
Allerheiligentag ist jedoch nicht durch<br />
ein Umfunktionieren heidnischen Totenkults<br />
erklärbar. 4 Vielmehr beginnt<br />
im Christentum schon im 4. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
die Verehrung <strong>de</strong>r Märtyrer, im 7.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt entsteht das Allerheiligenfest<br />
in österlicher Zeit, 5 bevor es<br />
schließlich auf <strong>de</strong>n heutigen Termin<br />
verlegt wird. Möglicherweise bot die<br />
sterben<strong>de</strong> Natur <strong>de</strong>s beginnen<strong>de</strong>n Winters,<br />
durch die die ewige Welt <strong>de</strong>r Heiligen<br />
sichtbar wird, eine passen<strong>de</strong> Hintergrundfolie<br />
zur Deutung <strong>de</strong>s Allerheiligenfestes,<br />
nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Zusammenhang<br />
mit <strong>de</strong>m österlichen Fest verblasst<br />
war. 6<br />
Das festliche Ge<strong>de</strong>nken aller verstorbenen<br />
Gläubigen am Allerseelentag<br />
wur<strong>de</strong>, nach<strong>de</strong>m im Christentum schon<br />
seit mehreren Jahrhun<strong>de</strong>rten feste Tage<br />
mit <strong>de</strong>m Gebet für die Verstorbenen<br />
verbun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n, 7 im Jahre 998 von<br />
Abt Odilo von Cluny für die ihm unterstehen<strong>de</strong>n<br />
Klöster auf <strong>de</strong>n 2. November<br />
ausgerufen. Dieser Allerseelentag, <strong>de</strong>r<br />
die Gläubigen zum einen mit <strong>de</strong>r (eigenen)<br />
Vergänglichkeit konfrontierte,<br />
zum an<strong>de</strong>ren aber auch – beson<strong>de</strong>rs<br />
durch die Lehre von <strong>de</strong>r Reinigung <strong>de</strong>r<br />
Seelen Verstorbener im Fegefeuer – eine<br />
Verbindung zwischen Leben<strong>de</strong>n und<br />
Toten markierte, fand im ganzen<br />
Abendland eine rasche Ausbreitung. In<br />
Verbindung mit <strong>de</strong>m vorangehen<strong>de</strong>n<br />
Allerheiligentag wird dieses Fest nicht<br />
nur zum zentralen Totenge<strong>de</strong>nken, son<strong>de</strong>rn<br />
rückt zugleich die Lehre vom<br />
kommen<strong>de</strong>n Gottesreich, Buße und<br />
Feier im Bonner Münster © KNA-Bild, Foto: E. Rebmann<br />
Weltgericht in <strong>de</strong>n Mittelpunkt <strong>de</strong>r liturgischen<br />
Betrachtungen. Durch die<br />
Vorstellung, die Leben<strong>de</strong>n könnten<br />
durch gute Werke <strong>de</strong>n Verstorbenen<br />
helfen und zu ihrer endgültigen Erlösung<br />
beitragen, etablieren sich entsprechen<strong>de</strong><br />
Messopfer, Gebete, Opfer und<br />
Fasten als feste <strong>de</strong>n Allerseelentag prägen<strong>de</strong><br />
Bräuche. 8 Diese sind jedoch geprägt<br />
von <strong>de</strong>r christlichen Eschatologie<br />
und untrennbar mit <strong>de</strong>r christlichen<br />
Lehre verbun<strong>de</strong>n und somit keineswegs<br />
auf Elemente eines heidnischen<br />
Totenkultes, wie er <strong>de</strong>m Samhain zugeordnet<br />
wird, zurückzuführen, die dann<br />
nur christlich überlagert wor<strong>de</strong>n seien.<br />
Festzuhalten bleibt, dass die ausgelassenen<br />
Feiern zum Jahresen<strong>de</strong> am<br />
Vorabend zu Allerheiligen – <strong>de</strong>m „All<br />
Hallows’ Evening“ – im irischen<br />
Brauchtum erhalten blieben und sich<br />
mit <strong>de</strong>r gefeierten Verbun<strong>de</strong>nheit von<br />
Leben<strong>de</strong>n und Verstorbenen verban<strong>de</strong>n.<br />
Ein inhaltlicher Zusammenhang<br />
zwischen Halloween und <strong>de</strong>n Festtagen<br />
Allerheiligen und Allerseelen besteht<br />
offensichtlich nicht.<br />
2.3. Export nach Amerika –<br />
Halloween geriert zum Kürbisfest<br />
Das heidnische Erbe wur<strong>de</strong> durch<br />
irische Auswan<strong>de</strong>rer nach Amerika exportiert<br />
und dort im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt in<br />
eigener Ausprägung rasch populär. Mit<br />
Bezug auf die irische Legen<strong>de</strong> vom<br />
Hufschmied und Trinker Jack, <strong>de</strong>r einen<br />
Pakt mit <strong>de</strong>m Teufel schließt, woraufhin<br />
seine Seele nach <strong>de</strong>m Tod we<strong>de</strong>r<br />
im Himmel noch in <strong>de</strong>r Hölle Aufnahme<br />
fin<strong>de</strong>t und <strong>de</strong>r seither als Untoter<br />
mit einer ausgehöhlten Rübe (o<strong>de</strong>r<br />
Zwiebel), die ihm als Laterne dient, ruhelos<br />
umherstreift, wird in Amerika <strong>de</strong>r<br />
ausgehöhlte, mit einer Fratze versehene<br />
Kürbis (anstelle <strong>de</strong>r Steckrübe) – die<br />
„Jack O’ Lantern“ – zum Markenzeichen<br />
von Halloween. Untrennbar verbun<strong>de</strong>n<br />
mit <strong>de</strong>m neu importierten<br />
Brauch sind die Umzüge von als Gespenster,<br />
Vampire, Hexen und an<strong>de</strong>re<br />
Gruselgestalten, maskierten Kin<strong>de</strong>rn,<br />
die mit <strong>de</strong>m Ausruf „Trick or Treat“<br />
(Süßigkeit o<strong>de</strong>r Streich) Gaben for<strong>de</strong>rnd<br />
von Haus zu Haus ziehen. 9 Teilweise<br />
gerieten die Halloween-Streiche<br />
jedoch zu Vandalismus, so dass sich<br />
das Fest heute in Amerika für Jugendliche<br />
und Erwachsene eher als von Grusel-<br />
und Horrorfilmen begleitete Grusel-Kostüm-Party<br />
gestaltet, für die<br />
kommerzielle Anbieter das nötige Ambiente<br />
bereithalten.<br />
Der von Ethnologen ohnehin umstrittene<br />
keltische Ursprung <strong>de</strong>s Festes<br />
o<strong>de</strong>r gar ein Bezug zum Allerheiligenfest<br />
fehlen <strong>de</strong>m amerikanischen Halloween-Fest<br />
gänzlich.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
157<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
158<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
2.4. Halloween in Deutschland –<br />
Amerikanischer Reimport mit<br />
kommerziellem Hintergrund<br />
Obwohl in Deutschland leben<strong>de</strong><br />
Amerikaner Halloween bereits seit einigen<br />
Jahrzehnten auch hierzulan<strong>de</strong><br />
feiern, 10 verbreitet sich dieser Brauch<br />
in <strong>de</strong>utlich amerikanisierter Ausprägung<br />
unter <strong>de</strong>n Deutschen selbst erst<br />
seit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 90er Jahre. Beson<strong>de</strong>rs<br />
seit <strong>de</strong>r Jahrtausendwen<strong>de</strong> ist ein<br />
regelrechter Boom erkennbar, <strong>de</strong>r sich<br />
vor allem in einem unüberschaubaren<br />
kommerziellen Angebot<br />
– von Deko- und Kostüm-Artikeln<br />
über Bücher, Bastelanleitungen,<br />
Spiele, Vi<strong>de</strong>os,<br />
DVDs, CDs u.a. bis hin zu Kürbisrezepten<br />
und ausgemachten<br />
Halloween-Spezialitäten reichend<br />
– sowie in privaten o<strong>de</strong>r<br />
organisierten Feiern nie<strong>de</strong>rschlägt.<br />
Vereinzelt erst greifen<br />
auch Kin<strong>de</strong>rgruppen <strong>de</strong>n<br />
Brauch <strong>de</strong>s „Trick or Treat“ auf,<br />
<strong>de</strong>r jedoch bei <strong>de</strong>n Adressaten<br />
häufig noch auf Unkenntnis<br />
o<strong>de</strong>r aber Ablehnung stößt.<br />
Wie lässt sich das Aufkommen<br />
dieses Trends erklären? 11<br />
Voraussetzung für die Übernahme<br />
dieses neuen Brauchs ist dabei<br />
offenbar neben <strong>de</strong>m durch<br />
die zunehmen<strong>de</strong> Globalisierung<br />
in allen Lebensbereichen<br />
engeren Kontakt zur amerikanischen<br />
Kultur die Vertrautheit<br />
einzelner Elemente <strong>de</strong>s Festes.<br />
12 Auch steigern offenbar<br />
<strong>de</strong>r bloße Spaßcharakter <strong>de</strong>r Feiern, das<br />
Fallen gesellschaftlicher Konventionen<br />
sowie <strong>de</strong>r unverbindliche Charakter die<br />
Attraktivität von Halloween gera<strong>de</strong> für<br />
die jüngere Generation, die <strong>de</strong>n Bezug zu<br />
christlich-religiös verwurzelten Traditionen<br />
und Bräuchen häufig verloren<br />
hat und zum Träger einer neu entstehen<strong>de</strong>n<br />
Event-Kultur geriert. 13 Unverkennbar<br />
sind aber auch <strong>de</strong>r nicht geringe<br />
Einfluss <strong>de</strong>r Medien bei <strong>de</strong>r Etablierung<br />
von Halloween sowie das damit<br />
unverhohlen verbun<strong>de</strong>ne kommerzielle<br />
Interesse.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Mit <strong>de</strong>r zunehmen<strong>de</strong>n Umstellung<br />
auf Kabelfernsehen bzw. Empfang über<br />
Satellit verschieben sich die Sehgewohnheiten<br />
<strong>de</strong>utscher Fernsehzuschauer<br />
im Laufe <strong>de</strong>r 90er Jahre hin zu <strong>de</strong>n<br />
Privatsen<strong>de</strong>rn, die ihrem Publikum eine<br />
Vielzahl amerikanischer Serien wie ‚BE-<br />
VERLY HILLS’ o<strong>de</strong>r ‚DIE SIMPSONS’ präsentieren,<br />
in <strong>de</strong>nen jahreszeitlich passend<br />
auch Halloween thematisiert wird.<br />
Hier erreicht auch John Carpenters<br />
Horrorfilm „HALLOWEEN“ von 1978<br />
das <strong>de</strong>utsche Publikum, zu<strong>de</strong>m läuft<br />
Verklei<strong>de</strong>tes Kind mit Kürbiskopf © KNA-Bild, Foto: B. Esser<br />
1994 in <strong>de</strong>utschen Kinos Tim Burtons<br />
„NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS“ mit<br />
Jack O’ Lantern als Hauptfigur. Seit<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 90er sen<strong>de</strong>n die Privatsen<strong>de</strong>r<br />
am 31. Oktober vorzugsweise Horrorund<br />
Gruselfilme, und es spricht für die<br />
Dominanz <strong>de</strong>r visuellen Medien, wenn<br />
Halloween in Deutschland vorwiegend<br />
als gruseliger Partyspaß wahrgenommen<br />
wird. 14 Zugleich floriert das „Geschäft<br />
mit <strong>de</strong>r Gänsehaut“ 15 und Einzelhändler,<br />
Konsumgüterindustrie und<br />
Event-Veranstalter haben Halloween<br />
fest für sich vereinnahmt, beschert es<br />
ihnen doch außerhalb <strong>de</strong>r üblichen Termine<br />
einen neuen Umsatzboom. 16<br />
3. Religionspädagogische<br />
Überlegungen<br />
3.1. Warum Halloween im<br />
Religionsunterricht?<br />
Der Auffassung, beim „Halloweenfest<br />
[ginge] ... es also – wie beim Allerheiligenfest<br />
– um eine tiefverwurzelte<br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>n<br />
Mächten <strong>de</strong>s To<strong>de</strong>s“ 17 , muss<br />
nach <strong>de</strong>r bisherigen Bestandsaufnahme<br />
wi<strong>de</strong>rsprochen wer<strong>de</strong>n.<br />
Entsprechen<strong>de</strong> Ansätze<br />
beim als Ursprung vermuteten<br />
keltischen Samhain-Fest sind<br />
letztlich nicht ausreichend belegt,<br />
spielen aber bei <strong>de</strong>r Wahrnehmung<br />
<strong>de</strong>s Festes heute je<strong>de</strong>nfalls<br />
keine signifikante Rolle<br />
mehr. 18 Wenn ein religiöser<br />
Hintergrund von Halloween<br />
eher Spekulation als nachweisbar<br />
ist, warum soll sich <strong>de</strong>r Religionsunterricht<br />
überhaupt mit<br />
dieser – von manchen Unterrichten<strong>de</strong>n<br />
eher ungeliebten – Thematik<br />
auseinan<strong>de</strong>rsetzen?<br />
Zunächst sollte es durchaus<br />
im Sinne <strong>de</strong>s RU sein, seine<br />
Mitverantwortung bei <strong>de</strong>r Erziehung<br />
<strong>de</strong>r Schüler/-innen zu<br />
mündigen, selbstverantwortlichen<br />
Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Gesellschaft<br />
wahrzunehmen, in<strong>de</strong>m<br />
ihnen die historischen und kulturellen<br />
Hintergrün<strong>de</strong> eines neu aufkommen<strong>de</strong>n,<br />
z.T. pseudo-religiös präsentierten<br />
Brauchs vor Augen geführt<br />
wer<strong>de</strong>n. Auch sollten die Schüler/-innen<br />
<strong>de</strong>n Einfluss von Medien und das<br />
gezielte Interesse von Marketing-Strategen<br />
bei <strong>de</strong>r Etablierung von Halloween<br />
exemplarisch kennen lernen und<br />
kritisch beurteilen können. Bei <strong>de</strong>r Betrachtung<br />
<strong>de</strong>r konkreten Ausformung<br />
<strong>de</strong>s Brauchs in ihrem unmittelbaren<br />
Umfeld können die Schüler/-innen<br />
schließlich selbst untersuchen, ob ein<br />
quasi-religiöser Gehalt bzw. Elemente
<strong>de</strong>s angeblich keltischen Ursprungs bei<br />
<strong>de</strong>r Feier von Halloween überhaupt<br />
(noch) eine Rolle spielen.<br />
Es ist für eine Gesellschaft prägend,<br />
wie sie das Thema Tod und Endlichkeit<br />
<strong>de</strong>s Menschen angeht 19 , daher sollte es<br />
zu <strong>de</strong>nken geben, wenn die an Allerheiligen/Allerseelen<br />
gepflegten Bräuche<br />
vielen Jugendlichen inhaltsleer gewor<strong>de</strong>n<br />
sind und sie statt<strong>de</strong>ssen eine Spaß-<br />
Feier mit gruseligen Untoten bevorzugen.<br />
Insofern kann die Thematisierung<br />
von Halloween Chance sein, die Schüler/-innen<br />
anhand <strong>de</strong>r zeitlich darauf<br />
folgen<strong>de</strong>n christlichen Feste mit <strong>de</strong>m<br />
Kern <strong>de</strong>r Lehre von Tod, Auferstehung<br />
und Erlösung zu konfrontieren und ihnen<br />
ein Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>r bleiben<strong>de</strong>n Verbun<strong>de</strong>nheit<br />
mit <strong>de</strong>n eigenen Verstorbenen<br />
zu präsentieren. Auch die Konkurrenz<br />
zwischen <strong>de</strong>n traditionellen St. Martin-<br />
Feiern zu Ehren eines Heiligen, <strong>de</strong>ssen<br />
Han<strong>de</strong>ln auch für Heutige noch Vorbildcharakter<br />
hat, und <strong>de</strong>n scheinbar<br />
mehr und mehr attraktiveren, weil gruseliger<br />
und „cooler“ wirken<strong>de</strong>n, aber<br />
auch von klaren Interessensgruppierungen<br />
vorangetriebenen Halloween-<br />
Festen, die z.T. bereits im Kin<strong>de</strong>rgarten<br />
vorbereitet wer<strong>de</strong>n, sollte von <strong>de</strong>n<br />
Schüler/-innen wahrgenommen und kritisch<br />
bedacht wer<strong>de</strong>n. Exemplarisch<br />
können sie <strong>de</strong>n Wert angestammter Traditionen<br />
erkennen und ggf. I<strong>de</strong>en zu ihrer<br />
„Wie<strong>de</strong>rbelebung“ einbringen.<br />
3.2. Eine Unterrichtssequenz für die<br />
Jahrgangsstufe 7/8<br />
Um eine kritische Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>m Phänomen Halloween zu<br />
erreichen, sollte die vorgeschlagene,<br />
etwa 7-8 Unterrichtsstun<strong>de</strong>n umfassen<strong>de</strong><br />
Sequenz in <strong>de</strong>r Jahrgangsstufe 7/8<br />
durchgeführt wer<strong>de</strong>n. Den Schüler/-innen<br />
wird Halloween – vielleicht schon<br />
aus eigenen Aktivitäten – bekannt sein,<br />
sie verfügen aber auch bereits über ausreichend<br />
kritisches Urteilsvermögen,<br />
um etwa <strong>de</strong>n Einfluss von Medien und<br />
Werbung bei <strong>de</strong>r Etablierung <strong>de</strong>s Festes<br />
zu analysieren.<br />
Als Einstieg bietet sich die Präsentation<br />
eines ausgehöhlten Kürbis-<br />
Feier im Bonner Münster © KNA-Bild, Foto. E. Rebmann<br />
ses mit Geisterfratze – in natura, als<br />
Foto, Sticker, Keramikartikel o.ä. –<br />
an, um in einer offenen Spontanphase<br />
Assoziationen <strong>de</strong>r Schüler/-innen und<br />
damit ihr Vorwissen zum Thema<br />
„Halloween“ zu sammeln. Dieses<br />
Vorwissen aufgreifend, sollen in <strong>de</strong>n<br />
folgen<strong>de</strong>n (ca. 1-2) Unterrichtsstun<strong>de</strong>n<br />
anhand eines Fragebogens (M 1)<br />
Informationen zum Thema in Partnerarbeit<br />
im Internet recherchiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Dazu erhalten die Schüler/-innen<br />
aufgrund <strong>de</strong>r Fülle <strong>de</strong>r Internet-Seiten<br />
zum Thema „Halloween“ in je<strong>de</strong>m<br />
Fall hilfreiche Adressen, 20 außer<strong>de</strong>m<br />
muss bei <strong>de</strong>r Ergebnissammlung (insbeson<strong>de</strong>re<br />
zu <strong>de</strong>n Fragen 1-3 bzw. 7)<br />
immer wie<strong>de</strong>r auf die schlechte Quellenlage<br />
verwiesen wer<strong>de</strong>n, so dass<br />
<strong>de</strong>n Schüler/-innen <strong>de</strong>utlich wird,<br />
dass viele <strong>de</strong>r im Internet vorzufin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Informationen reine Spekulation<br />
sind. 21<br />
Die Sammlung <strong>de</strong>r Arbeitsergebnisse<br />
kann sich anschließend über mehrere<br />
Unterrichtsstun<strong>de</strong>n erstrecken und<br />
immer wie<strong>de</strong>r Anlass bieten, einzelne<br />
Aspekte zu vertiefen.<br />
Zur Vertiefung <strong>de</strong>r Ergebnisse <strong>de</strong>r<br />
Recherche zu <strong>de</strong>n Fragen 4-6 sowie zur<br />
Vorbereitung <strong>de</strong>r Besprechung von Frage<br />
7 könnte z.B. in einer Unterrichtsstun<strong>de</strong><br />
in arbeitsteiliger Gruppenarbeit<br />
ein Vergleich <strong>de</strong>r Bräuche zu Halloween<br />
mit <strong>de</strong>nen heimischer Feste wie<br />
Karneval und St. Martin angestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
22 Dabei können die Schüler/-innen<br />
auf ihr Vorwissen zurückgreifen, aber<br />
auch Lexika, Religionsbücher und das<br />
Internet zur Hilfe nehmen.<br />
Als Eingangsimpuls zur Erörterung<br />
<strong>de</strong>r letzten Frage könnte eine kurze<br />
Film-Sequenz aus einer amerikanischen<br />
Serie, die Halloween-Bräuche darstellt<br />
(z.B. DIE SIMPSONS), präsentiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Dabei wer<strong>de</strong>n die Schüler/-innen<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
159<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
160<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
bald erkennen, dass die amerikanische<br />
und damit neuerdings auch <strong>de</strong>utsche<br />
Art, Halloween zu begehen, von einem<br />
– ohnehin nur vermuteten – Totenkult<br />
weit entfernt ist. Vielmehr stehen Party-Spaß<br />
und gruselige Verkleidung sowie<br />
das Fallen von Konventionen im<br />
Vor<strong>de</strong>rgrund <strong>de</strong>s Vergnügens, wobei<br />
das Herumgeistern von Toten in Horrorfilmen<br />
ebenso wie die teils morbi<strong>de</strong><br />
Verkleidung Teil einer Gruselkulisse<br />
sind, die aber keineswegs mit einer Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>m Thema Tod<br />
o<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Verhältnis zu Verstorbenen<br />
einhergeht. 23<br />
Daraus ergeben sich zwei weitere<br />
Fragestellungen, die in 2-3 folgen<strong>de</strong>n<br />
Unterrichtsstun<strong>de</strong>n behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n<br />
können. Zum einen: Wenn es nicht <strong>de</strong>r<br />
Ursprung <strong>de</strong>s Festes ist, <strong>de</strong>r es bei uns<br />
hat lebendig wer<strong>de</strong>n lassen, wie ist<br />
das Auftreten <strong>de</strong>s neuen Brauchs dann<br />
zu erklären? Welche Be<strong>de</strong>utung spielen<br />
in diesem Zusammenhang die Medien?<br />
Zum an<strong>de</strong>ren: Wenn Tod und<br />
Verstorbene für das Halloween-Fest<br />
schlichte Schreck-Kulisse sind, welchen<br />
Hintergrund haben dann die unmittelbar<br />
zeitlich folgen<strong>de</strong>n christlichen<br />
Ge<strong>de</strong>nkfeste Allerheiligen und<br />
Allerseelen? Welche Be<strong>de</strong>utung hat<br />
solches Totenge<strong>de</strong>nken – auch für die<br />
Leben<strong>de</strong>n?<br />
Um <strong>de</strong>n Boom <strong>de</strong>r Halloween-Feiern<br />
zu erklären kann zunächst zwar auf<br />
die darin enthaltenen bekannten Elemente,<br />
die sich im Vergleich mit heimischen<br />
Bräuchen bereits herausgestellt<br />
haben, verwiesen wer<strong>de</strong>n, doch hilft<br />
die Sichtung aktueller Zeitschriften,<br />
Werbeprospekte u.ä. exemplarisch, die<br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Medien und das große<br />
kommerzielle Interesse an <strong>de</strong>r Etablierung<br />
dieses Brauchs kritisch zu beleuchten.<br />
24 Die für diese Sequenz beispielhaft<br />
herausgegriffenen Artikel<br />
(M 2 a/b) können <strong>de</strong>n Schüler/-innen<br />
bei ausreichen<strong>de</strong>r Selbstständigkeit im<br />
Sinne <strong>de</strong>s ent<strong>de</strong>cken<strong>de</strong>n Lernens ohne<br />
konkrete Fragestellungen vorgelegt wer<strong>de</strong>n.<br />
Eine Analyse ergibt etwa folgen<strong>de</strong><br />
Ergebnisse: Der von <strong>de</strong>r Überschrift<br />
über das Foto bis zu <strong>de</strong>n Veranstaltungstipps<br />
ansprechend aufgemachte Artikel<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
über Halloween fin<strong>de</strong>t sich an exponierter<br />
Stelle <strong>de</strong>r Tageszeitung (Seite 3<br />
springt beim Aufschlagen direkt ins<br />
Auge), während <strong>de</strong>r kleinere, mit einer<br />
negativen Schlagzeile überschriebene<br />
Artikel zum Martinsfest im Lokalteil<br />
zu fin<strong>de</strong>n ist. Der erste Artikel ist im<br />
Grundton durchweg positiv, hebt <strong>de</strong>n<br />
kommerziellen Nutzen und <strong>de</strong>n Spaß<br />
<strong>de</strong>r Halloween-Feiern hervor. Am En<strong>de</strong><br />
sieht <strong>de</strong>r Artikel Halloween in überlegener<br />
Position in <strong>de</strong>r – auch kommerziellen<br />
– Konkurrenz mit angestammten<br />
christlichen Bräuchen wie<br />
Allerheiligen und St. Martin und hebt<br />
„Zeitgeist-Pfarrer“ hervor, die sich<br />
<strong>de</strong>m neuen Trend nicht verschließen.<br />
Die kleine angehängte Statistik sowie<br />
die Hinweise auf „Grusel-Partys“ run<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>n Artikel ab. Der zweite Artikel<br />
dagegen schlägt einen resignieren<strong>de</strong>n<br />
Ton an und lässt die Vertreter <strong>de</strong>s Martinsbrauchs,<br />
Wolfgang von <strong>de</strong>r Ruhren<br />
und seine Frau, als liebenswerte Anhänger<br />
einer verblassen<strong>de</strong>n Tradition<br />
erscheinen. Während die „Alten“ über<br />
zunehmen<strong>de</strong> Respektlosigkeit klagen,<br />
verlieren die „Jungen“ (Schulen, Kin<strong>de</strong>rgärten)<br />
das Interesse und nur „neue<br />
I<strong>de</strong>en“ scheinen <strong>de</strong>n Erhalt <strong>de</strong>s Martinszugs<br />
überhaupt gewährleisten zu<br />
können. Das Medium Tageszeitung<br />
selbst positioniert <strong>de</strong>n „alten Brauch“<br />
im Hintergrund, es fehlen Anregungen<br />
zu einer kreativen Belebung <strong>de</strong>r Tradition<br />
und Hinweise auf Veranstaltungen.<br />
Dieser feststellbare Mangel könnte<br />
von <strong>de</strong>n Schüler/-innen als Impuls<br />
aufgegriffen und in ein Unterrichtsgespräch<br />
folgen<strong>de</strong>n Inhalts mün<strong>de</strong>n:<br />
Wieso verliert St. Martin an Attraktivität,<br />
soll <strong>de</strong>m entgegengewirkt wer<strong>de</strong>n<br />
und wenn ja, wie? 25<br />
Für die diese Sequenz abschließen<strong>de</strong><br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung<br />
<strong>de</strong>s christlichen Brauchtums an<br />
Allerheiligen und Allerseelen können<br />
je nach Lerngruppe und Möglichkeiten<br />
verschie<strong>de</strong>ne Impulse gegeben wer<strong>de</strong>n.<br />
Um die Erfahrungswelt <strong>de</strong>r Schüler/<br />
-innen einzubeziehen bietet sich als<br />
Eingangsimpuls die Betrachtung eines<br />
Fotos von einem Grabbesuch an diesen<br />
Festtagen an (vgl. M 3). Im offenen Un-<br />
terrichtsgespräch können die Schüler/<br />
-innen eigene Erlebnisse von Grabbesuchen<br />
einfließen lassen und erste Vermutungen<br />
über die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Ge<strong>de</strong>nkfeiern<br />
an Allerheiligen und Allerseelen<br />
anstellen. Diese können in verschie<strong>de</strong>ner<br />
Weise aufgegriffen und vertieft<br />
wer<strong>de</strong>n: Die Schüler/-innen wer<strong>de</strong>n<br />
aufgefor<strong>de</strong>rt, in ihrem (familiären)<br />
Umfeld nach Allerheiligen- bzw. Allerseelen-Brauchtum<br />
und <strong>de</strong>ssen Be<strong>de</strong>utung<br />
zu fragen. 26 Diese Informationen<br />
wer<strong>de</strong>n mit Lexikonartikeln 27 verglichen<br />
und ergänzt. Die zusätzliche Lektüre<br />
von M 4 kann dabei <strong>de</strong>n Zusammenhang<br />
zwischen <strong>de</strong>r persönlichen<br />
Be<strong>de</strong>utsamkeit <strong>de</strong>s Totenge<strong>de</strong>nkens als<br />
Verbun<strong>de</strong>nheit mit <strong>de</strong>n eigenen Wurzeln<br />
und geliebten Verstorbenen einerseits<br />
und <strong>de</strong>r christlichen Botschaft von <strong>de</strong>r<br />
über <strong>de</strong>n Tod hinaus reichen<strong>de</strong>n Liebe<br />
Gottes an<strong>de</strong>rerseits ver<strong>de</strong>utlichen. In einer<br />
abschließen<strong>de</strong>n Stun<strong>de</strong> könnte <strong>de</strong>r<br />
Ortspfarrer zu Gast sein und mit <strong>de</strong>n<br />
Schüler/-innen die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Feste<br />
Allerheiligen und Allerseelen erörtern.<br />
Dabei sollten diese auch darüber nach<strong>de</strong>nken,<br />
wie sie selbst das Ge<strong>de</strong>nken an<br />
Verstorbene gestalten möchten und welche<br />
Be<strong>de</strong>utung dies für ihr Leben hat.<br />
Zur kontrastieren<strong>de</strong>n persönlichen<br />
Vertiefung <strong>de</strong>r Thematik seien interessierten<br />
Kollegen und Kolleginnen<br />
abschließend zwei Romane empfohlen:<br />
Auf <strong>de</strong>r einen Seite <strong>de</strong>r Roman<br />
„HALLOWEEN“ <strong>de</strong>s amerikanischen<br />
Autors Stewart O´Nan 28 , in <strong>de</strong>m die<br />
Geister dreier Jugendlicher, die in <strong>de</strong>r<br />
Halloween-Nacht bei einem Verkehrsunfall<br />
ums Leben kamen, ein<br />
Jahr später die Schauplätze <strong>de</strong>s Geschehens<br />
und die Überleben<strong>de</strong>n heimsuchen.<br />
Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite <strong>de</strong>r europäische<br />
Roman „ALLERSEELEN“ <strong>de</strong>s<br />
Hollän<strong>de</strong>rs Cees Nooteboom 29 , in <strong>de</strong>m<br />
<strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>r Arthur Daane Jahre<br />
nach <strong>de</strong>m tragischen Tod seiner Frau<br />
und seines Sohnes rastlos mit <strong>de</strong>r<br />
Filmkamera durch das Berlin <strong>de</strong>r<br />
neunziger Jahre streift – und in Begegnung<br />
und Gespräch mit an<strong>de</strong>ren<br />
die metaphysische Dimension geschichtlicher<br />
Ereignisse und persönlicher<br />
Erinnerung ent<strong>de</strong>ckt.
4. Materialanhänge<br />
M 1 – Fragebogen zum<br />
Thema Halloween<br />
– Übersetzt bzw. erklärt <strong>de</strong>n Begriff<br />
„Halloween“!<br />
– Fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Ursprung <strong>de</strong>r „Jack O’<br />
Lantern“ genannten Kürbislaterne,<br />
die zum Wahrzeichen von Halloween<br />
gewor<strong>de</strong>n ist, heraus!<br />
– In welchem Fest wird <strong>de</strong>r Ursprung<br />
<strong>de</strong>r Halloween-Feiern vermutet?<br />
Beschreibt hiermit verbun<strong>de</strong>ne<br />
Bräuche und ihre Be<strong>de</strong>utung!<br />
– Schaut in <strong>de</strong>n Geschäften eurer<br />
Umgebung und im Internet nach,<br />
was zum Thema „Halloween“<br />
zum Kauf angeboten wird! (Wenn<br />
vorhan<strong>de</strong>n, könnt ihr gern ein<br />
paar beispielhafte Artikel mitbringen.)<br />
– Welche Fest-Angebote an Halloween<br />
gibt es in eurer Stadt/Gemein<strong>de</strong><br />
in Kin<strong>de</strong>rgärten, Schulen,<br />
Kneipen, Restaurants, Discos<br />
usw.?<br />
– Übersetzt und erklärt „Trick or<br />
Treat“!<br />
– Vergleicht die heutigen Halloween-<br />
Feiern und -Bräuche mit <strong>de</strong>n vermuteten<br />
Ursprüngen <strong>de</strong>s Festes!<br />
Sucht Zusammenhänge und Unterschie<strong>de</strong>!<br />
Hilfreiche Internetadressen für die Bearbeitung<br />
<strong>de</strong>s Fragebogens:<br />
– www.halloween-im-rheinland.<strong>de</strong>.<br />
– www.religioeses-brauchtum.<strong>de</strong>.<br />
– www.zzzebra.<strong>de</strong><br />
– www.blin<strong>de</strong>-kuh.<strong>de</strong><br />
– www.usembassy.<strong>de</strong>/usa/<br />
feiertage-halloween.htm.<br />
M 2 a/b – Halloween und St. Martin<br />
in <strong>de</strong>n Medien, ein Beispiel<br />
Vergleiche hierzu Anlagen auf Seiten<br />
164 und 165.<br />
M 3 – Bil<strong>de</strong>r zum Fest Allerheiligen/<br />
Allerseelen, Angehörige beim Grabbesuch<br />
M 4 – Allerseelen 2003<br />
Joh 17:24 Vater, ich will, dass alle,<br />
die du mir gegeben hast, dort bei mir<br />
sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit<br />
sehen, die du mir gegeben hast,<br />
weil du mich schon geliebt hast vor <strong>de</strong>r<br />
Erschaffung <strong>de</strong>r Welt. 26 Ich habe ihnen<br />
<strong>de</strong>inen Namen bekannt gemacht und<br />
wer<strong>de</strong> ihn bekannt machen, damit die<br />
Liebe, mit <strong>de</strong>r du mich geliebt hast, in<br />
ihnen ist und damit ich in ihnen bin.<br />
© epd-Bild<br />
© epd-Bild<br />
Im Evangelium <strong>de</strong>s Allerseelentages<br />
lesen wir das geistliche Testament<br />
Jesu. Es spricht von <strong>de</strong>r Kraft und <strong>de</strong>r<br />
Verheißung <strong>de</strong>r Liebe <strong>de</strong>s Vaters und<br />
Jesu. Jesus hat seines Vaters Liebe gelebt<br />
und verkün<strong>de</strong>t. Er hat sie in seine<br />
Jünger eingepflanzt und hat so sich<br />
selbst in die Jünger eingepflanzt. Diese<br />
Verbindung stirbt nicht. Sie lebt über<br />
die Stun<strong>de</strong> <strong>de</strong>s To<strong>de</strong>s fort, und Jesus<br />
will sie offensichtlich sehr bewusst und<br />
intensiv seinem Vater als Bitte und seinen<br />
Jüngern als Verheißung und Hoffnung<br />
ans Herz legen. Unser Glaube erkennt<br />
in dieser Botschaft Jesu die Ankündigung<br />
<strong>de</strong>r Teilhabe an <strong>de</strong>m neuen<br />
Leben in <strong>de</strong>r Auferstehungsherrlich-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
161<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
162<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
keit, die <strong>de</strong>m österlichen Jesus zuteil<br />
wird.<br />
Was Auferstehung von <strong>de</strong>n Toten<br />
wirklich ist, – was ewiges Leben ist, ...<br />
ich weiß es nicht. Ich versuche aber immer<br />
wie<strong>de</strong>r, mich dahin vorzu<strong>de</strong>nken.<br />
Vor kurzem war ich bei einem Besuch<br />
in meiner Heimatstadt auch am<br />
Grab meiner Groß- und Urgroßeltern<br />
auf <strong>de</strong>m „alten Friedhof“. Dieser alte<br />
Friedhof ist „mein“ Friedhof. Nahe bei<br />
meinem Elternhaus gehörte er zum<br />
Spielgebiet meiner Kindheit. Unser<br />
Grab dort habe ich regelmäßig gepflegt.<br />
Heute hat <strong>de</strong>r Friedhof etwas<br />
Verwunschenes an sich. Er ist nicht<br />
mehr eine „Gebrauchsanlage“, son<strong>de</strong>rn<br />
eher ein Friedhofs-Park. Unser altes<br />
Grab steht in einem Efeufeld, – sein<br />
Steinkreuz aus weichem Sandstein<br />
oben auf <strong>de</strong>m Sockel mit <strong>de</strong>n Namen<br />
war schon zu meiner Zeit arg angewittert<br />
und ist vor Jahren entfernt wor<strong>de</strong>n.<br />
Wie ich so vor <strong>de</strong>m Grab <strong>de</strong>r Großund<br />
Urgroßeltern stehe, schießt es mir<br />
durch <strong>de</strong>n Kopf: Auf diesem Friedhof<br />
wächst Gottes Ewigkeit auf mich zu.<br />
Mein spontaner Eindruck hier: Auf <strong>de</strong>m<br />
alten Friedhof sind die Toten endlich<br />
zur Ruhe gekommen. Die Gefährten ihres<br />
Lebens sind alle gestorben, – die<br />
erste Generation danach: ebenfalls verstorben,<br />
– die zweite Generation: es leben<br />
wohl nur noch wenige. Die lebhafte<br />
Erinnerung verblasst. Der Abschied<br />
vom Leben <strong>de</strong>r Heutigen ist gewachsen.<br />
Sie haben Abschied genommen<br />
und auch wir haben nach langen Jahren<br />
endlich Abschied genommen. Sie ruhen<br />
in Frie<strong>de</strong>n und wir lassen sie in Ruhe,<br />
– in dieser Ruhe <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns Gottes.<br />
Ich habe we<strong>de</strong>r die Großeltern, geschweige<br />
<strong>de</strong>nn die Urgroßeltern gekannt.<br />
Und doch sind sie mir vertraut<br />
durch dieses Grab. Es ist seltsam ..., das<br />
alte Grab spricht eine stille Sprache:<br />
„Wir ruhen in Gott.“ In<strong>de</strong>m es das sagt,<br />
fragt es mich gleichzeitig: „... und wo<br />
ruhst du?“ Im Evangelium gibt Jesus<br />
die Antwort einer Einladung: „Wo ich<br />
bin, da wer<strong>de</strong>t auch ihr sein.“ Dieser<br />
weite Blick aus <strong>de</strong>r Zeit in die Ewigkeit<br />
öffnet mir auch die Augen für mein<br />
Heute. Wo Er ist, da bin ich. Wo ich bin,<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
da ist immer auch Er. Mit Ihm bin ich<br />
schon heute in <strong>de</strong>r Herrlichkeit. Mit mir<br />
ist Er heute im Alltag meines Lebens.<br />
Abt Albert Altenähr OSB (Text für die Kirchen-Zeitung<br />
Aachen, 2.11.03, gekürzt; Quelle: www.abtei-Kornelimuenster.<strong>de</strong>)<br />
Vorschläge für Aufgabenstellungen<br />
zu M 4:<br />
– Fasse die Kernaussage je<strong>de</strong>s Absatzes<br />
in einem Satz/einer These zusammen!<br />
– Überlege: Welche Rolle spielt die<br />
Pflege <strong>de</strong>s Grabes eines Angehörigen<br />
für das Abschied Nehmen?<br />
– Formuliere die Botschaft <strong>de</strong>s Grabes<br />
bzw. <strong>de</strong>r Verstorbenen, „Wir ruhen<br />
in Gott ... und wo ruhst du?“,<br />
mit eigenen Worten. Wie verän<strong>de</strong>rt<br />
diese ‚Botschaft’ und damit das Ge<strong>de</strong>nken<br />
<strong>de</strong>r Toten <strong>de</strong>n Blick auf das<br />
eigene Leben?<br />
Anmerkungen<br />
01 Vgl. Döring, A.: „...und entzün<strong>de</strong>ten Feuer auf Hügeln“.<br />
Historische Notizen zum Halloween-Fest.<br />
Landschaftsverband Rheinland, Amt für Rheinische<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Bonn (September 2001), 3. Nachzulesen<br />
unter www.halloween-im-rheinland.<strong>de</strong>.<br />
02 So zeichnet <strong>de</strong>r „Kaufhof“ 2003 in ganzseitigen Anzeigen<br />
unter <strong>de</strong>r Fragestellung: Wie ist Halloween<br />
entstan<strong>de</strong>n? ein recht <strong>de</strong>tailliertes Bild, das mit <strong>de</strong>r<br />
Quellenlage kaum in Einklang zu bringen ist. (Beinahe<br />
wortgleich fin<strong>de</strong>n sich die hier aufgegriffenen<br />
Ausführungen unter: www.itshalloweenagain.<strong>de</strong>/<br />
history.html). Gesicherte Zeugnisse liegen nach Döring<br />
zumeist erst aus <strong>de</strong>m 18. und 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
vor. Vgl. Döring, A.: a.a.O. 1ff.; vgl. auch: Pöhlmann,<br />
M.: Kürbis, Karneval, Kommerz – Halloween in<br />
Deutschland, in: Materialdienst <strong>de</strong>r EZW 10/2002,<br />
305f.; Becker-Huberti, M.: Gruselig grinsen<strong>de</strong> Geister<br />
grüßen grässliche Grufties, in: Glauben leben. Zeitschrift<br />
für Frauen in Kirche und Or<strong>de</strong>n, 77. Jahrgang,<br />
Oktober 2002. Nachzulesen auf <strong>de</strong>r vom Erzbistum<br />
Köln eingerichteten Website: www.religioeses-brauch<br />
tum.<strong>de</strong>/herbst/halloween.html.<br />
03 Ebendieser Aspekt wird in <strong>de</strong>r angloamerikanischen<br />
Literatur sowie in <strong>de</strong>n zahlreichen Internet-Infos<br />
zum Samhain-Fest als Hintergrund von Halloween<br />
hervorgehoben und fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>nn auch seinen Nie<strong>de</strong>rschlag<br />
in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Gruselfilmen, in <strong>de</strong>nen<br />
Untote durch die Halloween-Nacht spuken.<br />
04 Vollmundig formuliert etwa <strong>de</strong>r „Kaufhof“ in oben<br />
bereits erwähnter Anzeige: „Mittlerweile ist Allerheiligen<br />
ein christlicher Brauch gewor<strong>de</strong>n. Bis dahin war<br />
es allerdings ein langer harter Kampf. ... Um die<br />
Gläubigen vor Sün<strong>de</strong>n zu bewahren, wur<strong>de</strong>n die alten<br />
Bräuche einfach christianisiert. Im Jahre 837 verfügte<br />
Papst Gregor IV., dass an Samhain ebenfalls<br />
Tote geehrt wer<strong>de</strong>n sollten. So setzte man für <strong>de</strong>n<br />
1. November Allerheiligen an und am darauf folgen<strong>de</strong>n<br />
Tag Allerseelen. Dies hatte zur Konsequenz, dass<br />
sich die einfachen Menschen nicht umstellen mussten<br />
und man sagen konnte, man habe erfolgreich<br />
die heidnischen Bräuche bekämpft.“ Diese exemplarisch<br />
für eine Flut von Infos aus <strong>de</strong>m Internet u.ä. stehen<strong>de</strong>n<br />
Ausführungen zeugen von einer Unkenntnis<br />
historischer Quellenlage ebenso wie von einem<br />
<strong>de</strong>n religiösen Sinngehalt missachten<strong>de</strong>n, vorurteilsbela<strong>de</strong>nen<br />
Kirchenbild, das zu kommerziellen Zwecken<br />
gern zum Einsatz gebracht wird.<br />
05 Anlass war die jährliche Begehung <strong>de</strong>r Kirchweihe<br />
<strong>de</strong>s Pantheon in Rom zu Ehren <strong>de</strong>r Jungfrau Maria<br />
und aller Heiligen. Die Anordnung <strong>de</strong>s Festes für die<br />
Gesamtkirche durch Papst Gregor IV. und die damit<br />
verbun<strong>de</strong>ne Terminverlegung sei u.a. mit Rücksicht<br />
auf die Bedürfnisse von Rompilgern geschehen. Vgl.<br />
Döring, A.: a.a.O. 3.<br />
06 Vgl. ebd.; vgl. auch: Becker-Huberti, M.: Von <strong>de</strong>r Einheit<br />
<strong>de</strong>r Leben<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>n Toten – Allerheiligen und<br />
Allerseelen. www.religioeses-brauchtum.<strong>de</strong>/winter/<br />
allerheiligen.<br />
07 Aus <strong>de</strong>m 2. Jahrhun<strong>de</strong>rt gibt es Zeugnisse etwa für<br />
ein beson<strong>de</strong>res Ge<strong>de</strong>nken am Jahrestag <strong>de</strong>s Begräbnisses<br />
(vgl. Döring, A.: a.a.O. 3). Seit <strong>de</strong>m Mittelalter<br />
sind in <strong>de</strong>r Westkirche jährliche Ge<strong>de</strong>nktage<br />
für alle Verstorbenen als Sammelfest etwa am<br />
Pfingstmontag o<strong>de</strong>r am Montag nach <strong>de</strong>m Dreifaltigkeitssonntag<br />
belegt. Vgl. Becker-Huberti, M.: Allerheiligen<br />
und Allerseelen.<br />
08 Zu diesen Bräuchen zählen auch das traditionelle<br />
Schmücken <strong>de</strong>r Gräber am Allerheiligentag, das<br />
Aufstellen eines „ewigen Lichtes“ sowie eine feierliche<br />
Prozession <strong>de</strong>r Gläubigen auf <strong>de</strong>n Friedhof am<br />
Allerseelentag. Mancherorts prägen Zuwendungen<br />
für Arme, Or<strong>de</strong>nsleute o<strong>de</strong>r Patenkin<strong>de</strong>r (sog. Seelspitzbrot,<br />
Seelenzopf o<strong>de</strong>r Allerseelenbrötchen), aber<br />
auch Heischegänge <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Tag. Auch abergläubische<br />
Bräuche, u.a. geprägt von <strong>de</strong>m Volksglauben,<br />
an Allerseelen stiegen die Seelen aus <strong>de</strong>m<br />
Fegefeuer zur Er<strong>de</strong> auf und fän<strong>de</strong>n für kurze Zeit<br />
Ruhe von ihren Qualen, etablierten sich in früheren<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rten. Vgl. dazu vor allem: Becker-Huberti,<br />
M.: Allerheiligen und Allerseelen. Döring, A.: a.a.O. 3f.<br />
09 Der Versuch, dieses Gabenheischen auf die heidnische<br />
Vorstellung zurückzuführen, die Leben<strong>de</strong>n<br />
müssten Gaben für die in <strong>de</strong>r Nacht zu Samhain umherziehen<strong>de</strong>n<br />
Geistwesen bereitstellen, übersieht,<br />
dass es sich beim Gabenheischen um eine vielfältige,<br />
beson<strong>de</strong>rs von Kin<strong>de</strong>rn und Jugendlichen getragene<br />
und mit einer Reihe von Festterminen (so etwa<br />
St. Martin o<strong>de</strong>r auch Allerseelen) verbun<strong>de</strong>ne Tradition<br />
han<strong>de</strong>lt. Vgl. hierzu auch: Döring, A.: a.a.O. 3f.<br />
10 So fin<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r Burg Frankenstein in Darmstadt,<br />
angeregt durch in Deutschland stationierte amerikanische<br />
Soldaten, seit 1976 großangelegte Halloweenpartys<br />
statt, die zumeist große Besucherströme<br />
anlocken.<br />
11 Mit dieser Frage beschäftigen sich u.a. folgen<strong>de</strong>, unter<br />
www.halloween-im-rheinland.<strong>de</strong> nachzulesen<strong>de</strong><br />
Beiträge, auf die sich die folgen<strong>de</strong>n Ausführungen<br />
stützen: Röckel, M.: Halloween boomt! – Warum gera<strong>de</strong><br />
jetzt? Landschaftsverband Rheinland, Amt für<br />
Rheinische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Bonn (September 2001);<br />
Fischer, H.: Lust auf Horror! ebd.; Dafft, G.: Das Geschäft<br />
mit <strong>de</strong>r Gänsehaut. Die Vermarktung von Halloween.<br />
ebd.; Deak, A.: Von <strong>de</strong>r amerikanischen Walpurgisnacht<br />
zum rheinischen Kürbisbrauch. Halloween<br />
in <strong>de</strong>n Medien. ebd.; Langensiepen, F.: Halloween<br />
Alaaf! Wie die Rheinlän<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Horrorbrauch<br />
prägen. Ebd.
12 So ist das Feiern von Kostümpartys fester Bestandteil<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Karneval bzw. Faschings, wobei<br />
im Kölner Geisterzug ebenfalls das Gespensterhafte<br />
und Gruselige betont wird. Der Tanz gruseliger Gestalten<br />
um lo<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Feuer ist kennzeichnend für die<br />
Walpurgisnacht und Heischegänge von Kin<strong>de</strong>rn<br />
kennen wir von St. Martin ebenso wie Fackelzüge,<br />
wozu vor allem früher auch gern ausgehöhlte Kürbisse<br />
verwen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n.<br />
13 Diese fin<strong>de</strong>t ihren Ausdruck u.a. auch in Massenveranstaltungen<br />
wie <strong>de</strong>m Christopher Street Day o<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r Berliner Love Para<strong>de</strong>.<br />
14 A. Deak macht diese Dominanz auch am Verschwin<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>s noch bis in die 80er Jahre verwen<strong>de</strong>ten,<br />
durchaus passen<strong>de</strong>n Vergleichs von Halloween mit<br />
<strong>de</strong>r als Motiv in Goethes Faust bekannten Walpurgisnacht<br />
aus und konstatiert bissig: „Ob die jüngeren<br />
Journalisten Goethe gelesen haben o<strong>de</strong>r nicht,<br />
soll hier nicht weiter thematisiert wer<strong>de</strong>n – es<br />
scheint zumin<strong>de</strong>st, dass Faust keine direkte Assoziation<br />
mehr darstellt. ... Präsent sind weiterhin <strong>de</strong>r<br />
Grusel und <strong>de</strong>r Horror, aber nicht in <strong>de</strong>r Angst vor<br />
<strong>de</strong>n Untoten, die in dieser Nacht umherschweifen,<br />
son<strong>de</strong>rn im Geiste <strong>de</strong>s John Carpenter.“ Deak, A.:<br />
a.a.O. 5f.<br />
15 So <strong>de</strong>r Titel <strong>de</strong>s o.g. Beitrags von G. Dafft, <strong>de</strong>r an konkreten<br />
Beispielen das kommerzielle Interesse und<br />
die Vermarktung von Halloween untersucht.<br />
16 Offenbar rentieren sich die massiven Werbeaktionen,<br />
die mittlerweile mit Halloween in Deutschland<br />
verbun<strong>de</strong>n sind. Naturgemäß ist das kommerzielle<br />
Interesse am zeitlich eng folgen<strong>de</strong>n, traditionsreichen<br />
St. Martinsfest am 11. November sehr viel geringer,<br />
was mit einer geringeren (medialen) Präsenz<br />
einhergeht.<br />
17 So A. Dinter: Halloween. Neue Form eines religiös<br />
geprägten Festes im Kin<strong>de</strong>ralltag, in: Religion heute<br />
55/ September 2003, 144. Schon <strong>de</strong>r Untertitel, <strong>de</strong>r<br />
bei Halloween von einem „religiös geprägten Fest“<br />
spricht, scheint an <strong>de</strong>r Wirklichkeit <strong>de</strong>r hierzulan<strong>de</strong><br />
aufkommen<strong>de</strong>n Bräuche vorbeizugehen. Tatsächlich<br />
erkennt die Autorin selbst in Kin<strong>de</strong>rzeichnungen<br />
zu Halloween, die ihrer Meinung nach in Form<br />
von Totenköpfen u.ä. die To<strong>de</strong>sthematik aufgreifen,<br />
die „Gestalten entsprechen<strong>de</strong>r Grusel- und Horrorfilme“<br />
(ebd. 145) wie<strong>de</strong>r, was wie<strong>de</strong>rum eher als ein<br />
Beleg für die eben auch stark medial geprägte Kin<strong>de</strong>rwelt,<br />
nicht aber für eine tatsächliche Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>m Thema Tod gewertet wer<strong>de</strong>n<br />
kann.<br />
18 Die häufigsten, bei <strong>de</strong>r Umfrage <strong>de</strong>s Amtes für rheinische<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> in Bonn genannten Assoziationen<br />
sind dagegen: Kürbisse, Amerika, Geisterparty,<br />
Grusel, Geister/Gespenster, Verkleidung, Kommerz,<br />
Horror, Hexen, Süßes/Saures. Vgl. unter www.<br />
halloween-im-rheinland.<strong>de</strong>.<br />
19 Diese Thematik spielt u.a. eine Rolle beim Umgang<br />
mit Sterben<strong>de</strong>n und Trauern<strong>de</strong>n, aber auch mit<br />
Kranken und Behin<strong>de</strong>rten, um nur wenige Bereiche<br />
anzu<strong>de</strong>uten.<br />
20 Vgl. die unter M 1 angegebenen Webseiten. Der Fragebogen<br />
versteht sich als Vorschlag und sollte ggf.<br />
von <strong>de</strong>r Schülergruppe nach <strong>de</strong>r Besprechung <strong>de</strong>s<br />
eigenen Vorwissens ergänzt o<strong>de</strong>r variiert wer<strong>de</strong>n.<br />
21 Exemplarisch könnten auch einzelne Seiten kritisch<br />
untersucht wer<strong>de</strong>n, die zunächst sehr informativ<br />
wirken, auf <strong>de</strong>n zweiten Blick aber doch eher auf z.T.<br />
im Dienste einer antikirchlichen Haltung verwen<strong>de</strong>ten<br />
Spekulationen und Fehlinformationen beruhen.<br />
Hierzu bieten sich z.B. folgen<strong>de</strong> Adressen an:<br />
www.itshalloweenagain.<strong>de</strong>, http://www.wikipedia.org<br />
Den kritischen Umgang mit <strong>de</strong>r Fülle von ungefilterten<br />
Informationen im Internet gilt es, in allen Unterrichtsfächern<br />
im Dienste einer Erhöhung <strong>de</strong>r Medienkompetenz<br />
<strong>de</strong>r Schüler/-innen einzuüben.<br />
22 Eine mögliche Aufgabenstellung hierzu könnte folgen<strong>de</strong>rmaßen<br />
lauten: Eure Brieffreundin Patricia<br />
aus Amerika wandte sich mit folgen<strong>de</strong>r Bitte an<br />
euch: „Wir sollen im Unterricht <strong>de</strong>utsche Feste und<br />
Bräuche vorstellen. Meine Freundin Jennifer und ich<br />
haben uns St. Martin (alternativ: Karneval) ausgesucht.<br />
Könnt ihr uns etwas über die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s<br />
Festes und St. Martins-Bräuche schreiben? Wie lässt<br />
sich das Fest mit Halloween vergleichen, das wir hier<br />
ganz groß feiern und <strong>de</strong>shalb gut kennen? Danke<br />
für eure Hilfe, eure Patricia.“ Formuliert einen Brief<br />
an Patricia, in <strong>de</strong>m ihr ihre Fragen beantwortet.<br />
23 Im Gegenteil scheint es so zu sein, dass die persönliche<br />
Betroffenheit vom Tod (eines Angehörigen) gera<strong>de</strong>zu<br />
ausgeschaltet sein muss, um <strong>de</strong>n Spaßcharakter<br />
<strong>de</strong>r Feiern nicht zu stören. So erwähnt A. Stillger<br />
folgen<strong>de</strong>s Beispiel: „Problematisch wird das<br />
Ganze jedoch, wenn dieser stille Vertrag, durch <strong>de</strong>n<br />
sich die Parteien locker mit <strong>de</strong>m Tod auseinan<strong>de</strong>rsetzen<br />
können, durch persönliche Erlebnisse zerstört<br />
wird. So beschreibt eine Kölnerin zum Beispiel,<br />
dass die ‚herumlaufen<strong>de</strong>n Leichen’ sie ständig an<br />
einen persönlichen To<strong>de</strong>sfall in <strong>de</strong>r Familie erinnerten.“<br />
Stillger, A.: Halloween – Die Motive und Einstellungen<br />
<strong>de</strong>r Teilnehmer. Landschaftsverband Rheinland,<br />
Amt für Rheinische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Bonn (September<br />
2001), 4. Nachzulesen unter www.halloween<br />
-im-rheinland.<strong>de</strong>.<br />
24 Aktuelle Beispiele können von <strong>de</strong>n Schüler/-innen<br />
in <strong>de</strong>n Unterricht mit eingebracht und ggf. in Kleingruppen<br />
analysiert wer<strong>de</strong>n. Je nach Selbstständigkeit<br />
und Vorkenntnissen <strong>de</strong>r Schüler/-innen sollten<br />
ihnen hierzu hilfreiche Leitfragen zur Hand gegeben<br />
wer<strong>de</strong>n (z.B. zu Größe, Anordnung, Menge und<br />
farblicher u.a. Gestaltung von Artikeln o<strong>de</strong>r Werbung<br />
zu Halloween). Die hier vorgeschlagene Sequenz<br />
stützt sich auf die exemplarische Analyse<br />
zweier Artikel <strong>de</strong>rselben Ausgabe <strong>de</strong>r West<strong>de</strong>utschen<br />
Zeitung vom 25.10.2003, die darüber hinaus<br />
ver<strong>de</strong>utlichen, wie sehr ein kommerzielles Interesse<br />
zur Etablierung <strong>de</strong>s einen Brauchs, aber ein Mangel<br />
an kommerziellem Nutzen auch zum Verfall <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren<br />
beitragen kann.<br />
25<br />
Etwa nach <strong>de</strong>m Motto: Was hat „Halloween“, was<br />
St. Martin nicht hat?<br />
26<br />
Alternativ könnten auch Vertreter <strong>de</strong>r Kirchengemein<strong>de</strong><br />
befragt wer<strong>de</strong>n.<br />
27 Möglicherweise auch mit Informationen aus <strong>de</strong>m<br />
Internet wie unter www.religioeses-brauchtum.<strong>de</strong>.<br />
28<br />
Stewart O´Nan: Halloween. Roman – Rowohlt Verlag.<br />
Reinbek. 2004.<br />
29 Cees Nooteboom: Allerseelen. Roman – Suhrkamp<br />
Verlag. Frankfurt a.M. 2000.<br />
Ute Lonny-Platzbecker ist Studienrätin<br />
für Katholische Religon, Deutsch und<br />
Biologie am Gutenberg Gymnasium in<br />
Bergheim/Erft, zur Zeit im Erziehungsurlaub.<br />
Literaturhinweise und Internetlinks<br />
Dinter, A.: Halloween. Neue Form eines religiös geprägten<br />
Festes im Kin<strong>de</strong>ralltag, in: Religion heute 55/September<br />
2003, 144-147.<br />
Döring, A.: „...und entzün<strong>de</strong>ten Feuer auf Hügeln“. Historische<br />
Notizen zum Halloween-Fest. Landschaftsverband<br />
Rheinland, Amt für Rheinische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong><br />
Bonn (September 2001). Nachzulesen unter www.hallo<br />
ween-im-rheinland.<strong>de</strong>.<br />
Becker-Huberti, M.: Gruselig grinsen<strong>de</strong> Geister grüßen<br />
grässliche Grufties. In: Glauben leben. Zeitschrift für<br />
Frauen in Kirche und Or<strong>de</strong>n, 77. Jahrgang, Oktober<br />
2002. Nachzulesen auf <strong>de</strong>r vom Erzbistum Köln eingerichteten<br />
Website: www.religioeses-brauchtum.<strong>de</strong>.<br />
Becker-Huberti, M.: Von <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>r Leben<strong>de</strong>n mit<br />
<strong>de</strong>n Toten – Allerheiligen und Allerseelen. Nachzulesen<br />
unter www. religioeses-brauchtum.<strong>de</strong>.<br />
Dafft, G.: Das Geschäft mit <strong>de</strong>r Gänsehaut. Die Vermarktung<br />
von Halloween. Landschaftsverband Rheinland,<br />
Amt für Rheinische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Bonn (September<br />
2001). Nachzulesen unter www.halloween-im-rheinland.<strong>de</strong>.<br />
Deak, A.: Von <strong>de</strong>r amerikanischen Walpurgisnacht zum<br />
rheinischen Kürbisbrauch. Halloween in <strong>de</strong>n Medien.<br />
Landschaftsverband Rheinland, Amt für Rheinische<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Bonn (September 2001). Nachzulesen<br />
unter www.halloween-im-rheinland.<strong>de</strong>.<br />
Fischer, H.: Lust auf Horror! Landschaftsverband Rheinland,<br />
Amt für Rheinische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Bonn (September<br />
2001). Nachzulesen unter www.halloween-im-rhein<br />
land.<strong>de</strong>.<br />
Langensiepen, F.: Halloween Alaaf! Wie die Rheinlän<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>n Horrorbrauch prägen. Landschaftsverband Rheinland,<br />
Amt für Rheinische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Bonn (September<br />
2001). Nachzulesen unter www.halloween-im-rhein<br />
land.<strong>de</strong>.<br />
Pöhlmann, M.: Kürbis, Karneval, Kommerz – Halloween<br />
in Deutschland, in: Materialdienst <strong>de</strong>r EZW 10/2002,<br />
305-307.<br />
Röckel, M.: Halloween boomt! – Warum gera<strong>de</strong> jetzt?<br />
Landschaftsverband Rheinland, Amt für Rheinische<br />
Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Bonn (September 2001). Nachzulesen<br />
unter www.halloween-im-rheinland.<strong>de</strong>.<br />
Stillger, A.: Halloween – Die Motive und Einstellungen<br />
<strong>de</strong>r Teilnehmer. Landschaftsverband Rheinland, Amt für<br />
Rheinische Lan<strong>de</strong>skun<strong>de</strong> Bonn (September 2001).<br />
Nachzulesen unter www.halloween-im-rheinland.<strong>de</strong>.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
163<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
164<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Anlage zu M 2 a/b – Halloween und St. Martin in <strong>de</strong>n Medien<br />
INFO 33 · 3/2004
INFO 33 · 3/2004<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
165<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
DER PROPHET JONA<br />
166<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Vor- und Nachname:<br />
Klasse:<br />
Jona<br />
bekommt<br />
Religionsunterricht<br />
Werkstatt Religion zum Thema:<br />
Gott will das Leben<br />
– Gott sen<strong>de</strong>t Jona<br />
Zusammengestellt von Susanne Heil
Ziel:<br />
Susanne Heil<br />
Thema: Jona bekommt Religionsunterricht – Gott will das Leben<br />
• Die Jonageschiche zur historischen<br />
Situation <strong>de</strong>s Spätju<strong>de</strong>ntums in Beziehung<br />
setzen.<br />
• Jona als Typus, nicht als historische<br />
Person kennen lernen.<br />
• Erkennen, dass sich Jona so verhält,<br />
wie es viele Menschen gegenüber<br />
Gott tun wür<strong>de</strong>n.<br />
• Erkennen, dass die Jonageschichte<br />
<strong>de</strong>n Gläubigen einen Spiegel vorhalten<br />
möchte, wie Gott ist und <strong>de</strong>nkt.<br />
• Wahrnehmen, dass Gott die Menschen<br />
mit all ihren Schwächen liebt<br />
und allen eine Chance zum Neuanfang<br />
gibt.<br />
• Die Jonageschichte unter <strong>de</strong>m Aspekt<br />
kennen lernen, dass Gott das leben<br />
will und zum Leben verhilft.<br />
• Hören, dass Gott Menschen verän<strong>de</strong>rt<br />
1. Um einen Überblick zu bekommen,<br />
hören wir zunächst die ganze<br />
Jona-Erzählung.<br />
2. Die näheren Umstän<strong>de</strong>, die Beson<strong>de</strong>rheiten<br />
und Einzelheiten erarbeiten<br />
die Kin<strong>de</strong>r sich selbst.<br />
3. Alle Stationen müssen von je<strong>de</strong>m<br />
Kind bearbeitet wer<strong>de</strong>n.<br />
4. Bei <strong>de</strong>r Angabe von alternativen<br />
Arbeitsvorschlägen kann ausgewählt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
5. Je<strong>de</strong>s Kind benötigt eine Mappe<br />
DIN A4. Mit <strong>de</strong>m vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Material muss sorgsam umgegangen<br />
wer<strong>de</strong>n. Wenn gleichzeitig<br />
mehrere Kin<strong>de</strong>r Arbeitsgeräte und<br />
Material brauchen, einigt man sich<br />
friedlich und einlenkend darauf,<br />
Gott will das Leben – Gott sen<strong>de</strong>t Jona<br />
Freiarbeit für das 3./4. Schuljahr<br />
Struktur und Form:<br />
• 7 Stationen.<br />
• Experten.<br />
• Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.<br />
• Walfisch auf <strong>de</strong>n Arbeitsblättern.<br />
• 2 Stun<strong>de</strong>n um die Geschichte kennen<br />
zu lernen. Dazu Erzählung über<br />
die Entstehung <strong>de</strong>r Jonageschichte<br />
auf einem Erzählteppich. (Comic aus<br />
Exodus 4 und Kees <strong>de</strong> Kort Diaserie).<br />
• 8 Stun<strong>de</strong>n zur Bearbeitung <strong>de</strong>r Blätter.<br />
• Regeln bekannt geben und vergrößert<br />
aufhängen.<br />
• Max. zwei Wahlmöglichkeiten, eher<br />
eine!<br />
• Kin<strong>de</strong>r bringen einen beliebigen<br />
Ordner mit.<br />
• Kennzeichnen <strong>de</strong>r Stationen zur bibl.<br />
Geschichte und sachkundliches zum<br />
Hintergrund <strong>de</strong>r Jonageschichte.<br />
Damit Werkstattarbeit gelingt ...<br />
wer Erster ist. Alle sollen die Möglichkeit<br />
haben, in <strong>de</strong>r Werkstattzeit<br />
je<strong>de</strong>n Arbeitsauftrag auszuführen.<br />
06. Es gibt für je<strong>de</strong> Station Experten<br />
aus <strong>de</strong>r Klasse.<br />
07. Je<strong>de</strong> Expertin, je<strong>de</strong>r Experte erarbeitet<br />
zunächst das von <strong>de</strong>r Lehrerin<br />
festgelegte Arbeitsblatt und<br />
lässt es von dieser kontrollieren.<br />
Die an<strong>de</strong>ren Kin<strong>de</strong>r können dann<br />
bei Fragen zuerst bei <strong>de</strong>n Experten<br />
Hilfe suchen. Erst , wenn man sich<br />
absolut keinen Rat mehr weiß, geht<br />
man zur Lehrerin.<br />
08. Manche Arbeitsaufträge können<br />
nur mit mehreren Kin<strong>de</strong>rn erledigt<br />
wer<strong>de</strong>n. Dafür ist es nötig, dass<br />
man sich Partner/-innen durch Ansprechen<br />
sucht o<strong>de</strong>r, wenn man ge-<br />
Literatur<br />
Hans Freu<strong>de</strong>nberg (Hg): Freiarbeit mit Religionsunterricht<br />
praktisch. Materialeien für die Grundschule. Band 1:<br />
3. und 4. Schuljahr – Göttingen: Va<strong>de</strong>nhoeck & Ruprecht.<br />
Eugen Chrost: Gott will das Leben – Gott sen<strong>de</strong>t Jona.<br />
Materialien zur Freiarbeit im RU mit einer Jonadatei für<br />
das 3. und 4. Schuljahr – Heinsberg: Agentur Dieck.<br />
fragt wird, sich einer Gruppe anschließt.<br />
Es ist wichtig, dass man<br />
auf je<strong>de</strong>n Fall jeman<strong>de</strong>n fin<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r<br />
mitmacht. (Ein freundlicher Umgang<br />
mit <strong>de</strong>n Klassenkammera<strong>de</strong>n/<br />
-innen ist selbstverständlich. Wir<br />
behan<strong>de</strong>ln die an<strong>de</strong>ren so, wie wir<br />
es selbst von an<strong>de</strong>ren erwarten!)<br />
09. Die Werkstattmappe wird sorgfältig<br />
und sehr or<strong>de</strong>ntlich geführt. Wenn<br />
ein Auftrag erledigt wur<strong>de</strong>, überprüft<br />
man nochmals, ob alles gut<br />
erledigt wur<strong>de</strong>, und hakt dann auf<br />
<strong>de</strong>m Kontrollblatt die Aufgabe ab.<br />
10. Es ist äußerst wichtig, dass man vor<br />
<strong>de</strong>r Bearbeitung einer Station <strong>de</strong>n<br />
ganzen Text liest, <strong>de</strong>r zu <strong>de</strong>r Station<br />
gehört!<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
DER PROPHET JONA<br />
167<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
DER PROPHET JONA<br />
168<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Materialliste und<br />
Kontrollblatt<br />
Station Seite Titel Material erledigt<br />
Deckblatt<br />
Werkstattarbeit, Materialliste, Kontrollblatt<br />
1 1 und 2 Jona erhält einen Auftrag von Gott und flüchtet Leeres, gelochtes Blatt<br />
2<br />
1 und<br />
DIN A3 Blatt<br />
Jona im Fisch<br />
3 1 Das Gesetz <strong>de</strong>s Königs ------<br />
4 1 „An Zion angenabelter Jona“<br />
Beispiel Kalligramm<br />
DIN A3 Blätter<br />
Farbkopien<br />
2 Originale<br />
5 1 u. 2 Jona ist enttäuscht Leere, gelochte Blätter<br />
6<br />
1, 2, 3, 4<br />
+ Zusatzblatt<br />
mit Text<br />
7 1 Das Jonaspiel<br />
Juda und seine Nachbarn Atlas<br />
Das assyrische Reich -------<br />
Das babylonische Reich -------<br />
� Die Gefangenen kehren in<br />
ihre Heimat zurück<br />
� Krieg ist grausam<br />
(selbstgefun<strong>de</strong>ner Text )<br />
Texte<br />
Gedichte<br />
Lie<strong>de</strong>r<br />
Zeitungen<br />
gelochte Blätter<br />
Textthemen:<br />
Vertreibung<br />
Unterdrückung<br />
Verschleppung von Menschen<br />
Grausamkeiten<br />
Leben in <strong>de</strong>r Frem<strong>de</strong><br />
Gefühle von Menschen in <strong>de</strong>r Frem<strong>de</strong><br />
Gottvertrauen<br />
Würfel<br />
Spielfiguren<br />
Kärtchen<br />
Karton<br />
Beispielkarten<br />
Leere, gelochte Blätter<br />
Übersicht
Station 1<br />
Seite 1<br />
Du benötigst:<br />
• Wachsmal-, Bunt- o<strong>de</strong>r Filzstifte o<strong>de</strong>r Wasserfarben mit<br />
Pinsel und Wasser (Seite 2 ), ein gelochtes Zeichenblockblatt.<br />
Aufgaben:<br />
• Schreibe einen Tagebucheintrag Jonas über das, was in<br />
<strong>de</strong>r Bibelstelle beschrieben ist!<br />
• Was glaubst Du, wie sich Jona fühlt, als er <strong>de</strong>n Auftrag<br />
bekommt, die Menschen in Ninive zu warnen?<br />
• Versuche, die Gefühle von Jona in einem Bild darzustellen<br />
(Seite 2)!<br />
Jona erhält einen Auftrag<br />
von Gott und flüchtet<br />
Eigentlich wollte ich heute Morgen in Ruhe meinen Garten genießen,<br />
Eines Tages sprach Gott zu Jona:<br />
„Jona, gehe in die Stadt Ninive. Denn die Einwohner dort<br />
sind böse und schlecht. Warne die Einwohner. Wenn sie<br />
sich nicht bessern, wer<strong>de</strong>n sie bald von mir bestraft.“<br />
Jona bekam Angst. Er glaubte, er könnte <strong>de</strong>n Auftrag Gottes<br />
nicht erfüllen, und die Menschen in Ninive könnten ihn<br />
vielleicht töten.<br />
Jona flüchtete vor <strong>de</strong>m Auftrag Gottes.<br />
Er lief zum Hafen und suchte sich ein Schiff aus, um damit<br />
nach Tarschisch zu fliehen. Im Schiff legte er sich in <strong>de</strong>n<br />
Rumpf, um zu schlafen.<br />
aber _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
DER PROPHET JONA<br />
169<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
DER PROPHET JONA<br />
170<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
So fühlte sich Jona, als er <strong>de</strong>n Auftrag Gottes bekam, die Stadt Ninive zu warnen:<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Jona erhält einen Auftrag<br />
von Gott und flüchtet<br />
Station 1<br />
Seite 2
Station 2<br />
Seite 1<br />
Du benötigst:<br />
• Blei- o<strong>de</strong>r Filzstift<br />
• DIN A3 Blatt<br />
Jona im Fisch<br />
Aufgaben:<br />
• Schreibe Jonas Gebet mit <strong>de</strong>inen eigenen Worten!<br />
Es kann auch nur ein Teil <strong>de</strong>s Gebetes sein, <strong>de</strong>r dir beson<strong>de</strong>rs<br />
gefällt o<strong>de</strong>r wichtig ist.<br />
• Schreibe „<strong>de</strong>in“ Jona-Gebet auf ein DIN A3 Blatt!<br />
Gestalte einzelne Worte o<strong>de</strong>r Textteile als Textbild<br />
(Kalligramm)!<br />
Achte darauf, gut lesbar und groß genug zu schreiben<br />
(siehe Beispiel)!<br />
Ich rief zu <strong>de</strong>m Herren in meiner Angst,<br />
und er hörte mich.<br />
Ich schrie um Hilfe,<br />
als <strong>de</strong>r Tod mich packte,<br />
und du hast mein Schreien gehört.<br />
Du hast mich ins Meer geworfen,<br />
ganz tief hinein.<br />
Die Fluten schlugen über mir zusammen.<br />
Schlingpflanzen schnürten mir die Kehle zu.<br />
Du hast mich aus <strong>de</strong>r Tiefe herausgezogen,<br />
heraus aus <strong>de</strong>m tiefen Totenloch,<br />
Herr, mein Gott.<br />
Jona 2,3-7 in Auswahl<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
DER PROPHET JONA<br />
171<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
DER PROPHET JONA<br />
172<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Das Gesetz <strong>de</strong>s Königs<br />
Station 3<br />
Seite 1<br />
Aufgaben:<br />
• Lies <strong>de</strong>n Text gut durch !<br />
• Überlege: Wie könnte das Gesetz lauten? Was will <strong>de</strong>r König damit erreichen ?<br />
• Schreibe das Gesetz <strong>de</strong>s Königs auf und berücksichtige diese Stichworte: kein Essen und Trinken – Säcke als Zeichen <strong>de</strong>r<br />
Buße anziehen – zu Gott rufen – umkehren – Gott um Verzeihung bitten ...!<br />
Jonas drohte <strong>de</strong>n Leuten von Ninive: Noch vierzig Tage, und Ninive ist zerstört!<br />
Die Leute von Ninive erschraken. Sie wollten ihr Leben än<strong>de</strong>rn. Sie fasteten. Sie zogen Bußgewän<strong>de</strong>r an. Auch <strong>de</strong>r König<br />
stieg von seinem Thron. Er zog seinen kostbaren Königsmantel aus und legte ein Trauergewand an. Für die Stadt erließ er<br />
folgen<strong>de</strong>s Gesetz:<br />
„Im Namen <strong>de</strong>s Königs:<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _„“
Station 4<br />
Seite 1<br />
Du benötigst:<br />
• Klebestift, Stift<br />
Aufgaben:<br />
• Beschreibe das Jona- Bild von Ernst Alt mit <strong>de</strong>inen Worten!<br />
Nutze dazu die Rückseite!<br />
• Klebe dann das Bild ein!<br />
• Das Bild heißt: „ An Zion angenabelter Jona“.<br />
Was be<strong>de</strong>utet <strong>de</strong>iner Meinung nach <strong>de</strong>r Titel ?<br />
„An Zion angenabelter Jona“<br />
Tipp:<br />
„Zion“ = 1. Der Tempelberg in Jerusalem<br />
2. Wohnung Gottes<br />
3. Ort <strong>de</strong>r Hoffnung auf eine neue Zeit<br />
Klebe hier das Farbild ein:<br />
„An Zion angenabelter Jona im Fischbauch“<br />
von Ernst Alt<br />
(siehe: Exodus. Religionsunterricht, Bd. 4, S. 107<br />
– Düsseldorf-München. 1985.)<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
DER PROPHET JONA<br />
173<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
DER PROPHET JONA<br />
174<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Aufgabe:<br />
• Jona ärgert sich darüber, dass Gott<br />
die Bewohner von Ninive nicht bestraft.<br />
Er weiß aber auch, dass die<br />
Bewohner sich zum Guten geän<strong>de</strong>rt<br />
haben.<br />
Schreibe die Gedanken von Jona in<br />
die Denkblase!<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Jona ist enttäuscht<br />
Station 5<br />
Seite 1<br />
Jona war enttäuscht, als er merkte, dass die Stadt Ninive nicht zerstört wur<strong>de</strong>.<br />
Keiner wür<strong>de</strong> ihm mehr glauben: Denn Gott hatte Ninive für ihre bösen Taten<br />
nicht bestraft, so wie Jona es gepredigt hatte.<br />
Mü<strong>de</strong> von seiner langen Reise sucht er einen Platz zum schlafen. Er war sehr<br />
heiß. Gott hatte für Jona einen Rizinusstrauch wachsen lassen, so dass er etwas<br />
Schatten hatte. Jetzt konnte Jona in Ruhe einschlafen.<br />
Als Jona erwachte, war <strong>de</strong>r Rizinusstrauch eingegangen. Jona war sehr wütend<br />
darüber und schimpfte mit Gott.<br />
Gott sprach:<br />
„Ist es richtig, dass du wütend bist, weil <strong>de</strong>r Rizinusstrauch eingegangen ist,<br />
obwohl du nichts dafür getan hast, dass er gewachsen und gediehen ist?<br />
Und du ärgerst dich, weil ich die Stadt Ninive nicht zerstöre, mit mehr als<br />
12.000 Menschen und all <strong>de</strong>n Tieren?<br />
( nach Jona 4,1-11)
Station 5<br />
Seite 2<br />
Jona ist enttäuscht<br />
Aufgabe:<br />
• Hast Du dich auch schon einmal geärgert, weil jemand an<strong>de</strong>res nicht bestraft wur<strong>de</strong>?<br />
• Versuche, dies in einer Geschichte aufzuschreiben!<br />
( Erfin<strong>de</strong> eine Geschichte, falls es dir selbst noch nicht wie Jona ergangen ist!)<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
Aufgabe:<br />
• Das Leben <strong>de</strong>r Bewohner Ninives hat sich geän<strong>de</strong>rt. Bevor Jona nach Ninive kam, haben die Menschen nicht nach <strong>de</strong>m<br />
Willen Gottes gelebt. Nach <strong>de</strong>r Predigt von Jona lebten sie, wie es Gott gefällt.<br />
• Versuche das Leben <strong>de</strong>r Bewohner Ninives vor und nach <strong>de</strong>r Predigt von Jona in einem Bild aufzumalen!<br />
vorher nachher<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
DER PROPHET JONA<br />
175<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
DER PROPHET JONA<br />
176<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Juda und seine Nachbarn<br />
Juda, das Land <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n, war klein. Die Nachbarlän<strong>de</strong>r waren groß und stark.<br />
Oft überfielen die starken Nachbarn das kleine Juda.<br />
Aufgabe:<br />
• Gestalte die Karte farbig!<br />
– Markiere die Städte rot,<br />
– Zeichne die Wüstenlandschaft gelb,<br />
– Kennzeichne das Wasser blau:<br />
Meere,<br />
Seen,<br />
Flüsse.<br />
– Male das fruchtbare Land grün!<br />
Schaue dazu in einen Atlas:<br />
Mesopotamien = Zweistromland,<br />
Land Israel,<br />
Land um <strong>de</strong>n Jordan,<br />
Ägypten: Nil und Nil<strong>de</strong>lta.<br />
Station 6<br />
Seite 1
Station 6<br />
Seite 2<br />
Ninive, die böse Stadt<br />
Das assyrische Reich<br />
Ninive war die Hauptstadt <strong>de</strong>s neuassyrischen Reiches. Sein König galt als ein beson<strong>de</strong>rs grausamer Herrscher.<br />
„Der Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r benachbarten Völker wird durch jährlich stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Feldzüge gebrochen, in <strong>de</strong>nen eine neue Waffengattung,<br />
die zum ersten Mal in <strong>de</strong>r Geschichte erscheint, die Entscheidung bringt, die Reiterei. In Furcht versetzt wer<strong>de</strong>n<br />
die Völker durch die grausamen Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Unterwerfung: Pfählen und Schin<strong>de</strong>n, Massenhinrichtungen, Deportation“<br />
Aufgabe:<br />
• Suche Assyrien und die Hauptstadt dieses Reiches auf <strong>de</strong>iner Karte (siehe Seite 1)!<br />
• Wann wur<strong>de</strong> die Hauptstadt zerstört ? (siehe Seite 3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
• Wie haben die Assyrer ihre besiegten Fein<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lt ? (Betrachte das Bild oben!)<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
• Versuche die Gefühle <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n zu beschreiben, wenn sie an die Assyrer und an Ninive dachten!<br />
aus: dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Band 1<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
DER PROPHET JONA<br />
177<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
DER PROPHET JONA<br />
178<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Die Herrschaft <strong>de</strong>r Assyrer dauerte nicht ewig. 612 v.Chr. kamen die Babylonier und eroberten Assyrien und Ninive.<br />
Aber <strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n ging es auch unter <strong>de</strong>n neuen Herrschern nicht viel besser. Wie<strong>de</strong>r war Krieg. Wie<strong>de</strong>r kamen frem<strong>de</strong> Soldaten.<br />
587 v. Chr. eroberten sie Juda und zerstörten Jerusalem:<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Das babylonische Reich<br />
(Informationsblatt)<br />
– Die Stadt wur<strong>de</strong> geplün<strong>de</strong>rt und abgebrannt,<br />
– die Tempel nie<strong>de</strong>rgerissen,<br />
– die Königsfamilie und die Fürsten ermor<strong>de</strong>t,<br />
– das Land verbrannt,<br />
– <strong>de</strong>r letzte König von Juda, Ze<strong>de</strong>kia, musste mit vielen<br />
tausend Ju<strong>de</strong>n in die Gefangenschaft. Er ist blind.<br />
Soldaten haben ihm die Augen ausgestochen und<br />
– seine Söhne wur<strong>de</strong>n ermor<strong>de</strong>t.<br />
Babylonische Tontafel<br />
mit Bericht von <strong>de</strong>r Eroberung Jerusalems.<br />
Station 6<br />
Seite 3<br />
Einem Gefangenen wer<strong>de</strong>n die Augen ausgestochen.
Station 6<br />
Seite 4<br />
Auch die Babylonier wur<strong>de</strong>n besiegt. Die Perser besetzten als neue Herren Babylonien. – Ein Wun<strong>de</strong>r geschah!<br />
Der persische König Kyrus ließ alle nach Babylonien verschleppten<br />
Völker frei. Auch die gefangenen Ju<strong>de</strong>n durften<br />
nach 50-jähriger Gefangenschaft nach Jerusalem heimkehren.<br />
Sehnsüchtig hatten sie in <strong>de</strong>r Frem<strong>de</strong> diesen Tag herbeigewünscht:<br />
„An <strong>de</strong>n Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn<br />
wir an Zion ( = Jerusalem) dachten.“<br />
Die Gefangenen kehren in<br />
die Heimat zurück<br />
(Psalm 13,7)<br />
Einerseits freuten sich die Heimkehrer: endlich nach Hause! An<strong>de</strong>rerseits kamen sie in ein total verarmtes Land. Die Fel<strong>de</strong>r<br />
um Jerusalem waren verbrannt, alles verwüstet, die Häuser zerstört. Es gab keinen König und keinen Tempel mehr!<br />
Nur ein Gedanke gab <strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n jetzt noch Kraft:“ Wir sind Gottes auserwähltes Volk! Wir sind gut! Die an<strong>de</strong>ren Völker sind<br />
böse! Von ihnen muss man sich fernhalten!“<br />
Die an<strong>de</strong>ren Völker hatten Israel so viel Leid angetan, die Assyrer und Babylonier, die Ägypter und die Perser. Gott hatte diese<br />
Völker verstoßen! Von ihnen musste man sich abkapseln! Nur Israel hat Gott sein Heil versprochen.<br />
Aufgabe:<br />
• Die Gefühle <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n nach ihrer Heimkehr sind sehr gespalten:<br />
Einerseits freuen sie sich, weil ... An<strong>de</strong>rerseits sind sie ...<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<br />
• Auch heute gibt es grausame Kriege. Suche zu Hause in <strong>de</strong>r Zeitung, in Büchern, Gedichten o<strong>de</strong>r Lie<strong>de</strong>rn Beispiele, in <strong>de</strong>nen<br />
nachfolgen<strong>de</strong> Themen vorkommen: Vertreibung – Unterdrückung – Verschleppung von Menschen– Gottvertrauen –<br />
Grausamkeiten – Leben in <strong>de</strong>r Frem<strong>de</strong> – Gefühle von Menschen in <strong>de</strong>r Frem<strong>de</strong><br />
• Schreibe einen Text ab und/o<strong>de</strong>r klebe ihn auf ein Blatt, welches Du dann dazuheftest!<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
DER PROPHET JONA<br />
179<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
DER PROPHET JONA<br />
180<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Das Jonaspiel<br />
Du benötigst:<br />
• 4 Mitspieler o<strong>de</strong>r Mitspielerinnen<br />
• Karton<br />
• Würfel<br />
• Farbstifte<br />
• Bil<strong>de</strong>r zur Jona-Erzählung<br />
• Blankokärtchen<br />
Viel Spaß Spaß !<br />
Aufgaben:<br />
• Suche Dir drei an<strong>de</strong>re Kin<strong>de</strong>r, die diese Aufgabe noch nicht gelöst haben!<br />
• Denkt Euch nun einen Spielverlauf zur Jona-Erzählung (Start bis Ziel) aus und übertragt ihn auf <strong>de</strong>n Karton!<br />
Plant auch Umwege und Abkürzungen ein!<br />
• Bil<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Jona-Geschichte machen euer Spiel farbiger!<br />
• Legt die Aufgabenfel<strong>de</strong>r innerhalb Eures Spielfel<strong>de</strong>s fest!<br />
• Schreibt die Aufgaben auf Kärtchen!<br />
• Denkt Euch Spielregeln aus und schreibt sie auf!<br />
• Spielt Euer Spiel probeweise durch und achtet dabei auf Verbesserungsmöglichkeiten!<br />
Station 7<br />
Seite 1<br />
Diese Werkstatt wur<strong>de</strong> zusammengestellt und gestaltet von:<br />
Susanne Heil, ©, Im Valler 43, 65594 Runkel, Fon: 06482-5428, Fax: 06482-6271, E-Mail: susanne.heil@web.<strong>de</strong>
Manieren in Kirchenräumen?<br />
– Kleiner römisch-katholischer Knigge –<br />
Der Knigge hat ausgedient. Spätestens<br />
mit <strong>de</strong>r achtundsechziger Generation<br />
ist er als repressiv seiner Be<strong>de</strong>utung<br />
enthoben wor<strong>de</strong>n. Seit<strong>de</strong>m konnte<br />
man die Suppe auch mit <strong>de</strong>r Gabel löffeln<br />
und beim Opernbesuch <strong>de</strong>n Jogging-Anzug<br />
tragen. Ob man im Bun<strong>de</strong>stag<br />
o<strong>de</strong>r im Klassenzimmer Kaugummi<br />
kaute, war ebenso Privatsache wie <strong>de</strong>r<br />
Turnschuh im Ballsaal o<strong>de</strong>r die Baseball-Mütze<br />
im Klassenzimmer. Die guten<br />
alten Benimm-Regeln hatten spätestens<br />
seit 1968 aufgehört<br />
zu existieren.<br />
Es brauchte also nicht<br />
zu wun<strong>de</strong>rn, wenn<br />
man zum Bun<strong>de</strong>stagspräsi<strong>de</strong>nten<br />
„Sie<br />
Arschloch“ sagen<br />
o<strong>de</strong>r im Gerichtssaal<br />
<strong>de</strong>n nackten Hintern<br />
zeigen durfte.<br />
Manieren und Benehmen<br />
haben wie<strong>de</strong>r<br />
Konjunktur. Das<br />
Buch MANIEREN von<br />
Asfa-Wossem Asserate<br />
1 , das in vielen Auflagen<br />
erschienen ist<br />
und über die Herkunft<br />
und die Be<strong>de</strong>utung von bestimmten<br />
Regeln <strong>de</strong>s menschlichen<br />
Miteinan<strong>de</strong>rs spricht, hat das Nach<strong>de</strong>nken<br />
über Manieren und Benehmen<br />
wie<strong>de</strong>r verstärkt. Im Saarland und in<br />
an<strong>de</strong>rn Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>rn wur<strong>de</strong> sogar<br />
darüber nachgedacht, „Manieren“ als<br />
Unterrichtsfach einzuführen. Wenn es<br />
dazu auch nicht kommen muss, so ist<br />
unter Pädagogen doch einsichtig und<br />
ausgemacht, dass das Erlernen von<br />
Manieren für die Zukunftschancen<br />
von Schülerinnen und Schülern ebenso<br />
wichtig ist, wie die Kenntnis <strong>de</strong>r<br />
Regeln <strong>de</strong>r Rechtschreibung und Zeichensetzung.<br />
Bei all <strong>de</strong>m muss man<br />
freilich nicht an die statischen Benimmregeln<br />
alten Schlags <strong>de</strong>nken.<br />
Auch in <strong>de</strong>r Kirche gelten seit alters<br />
her Verhaltensregeln. Diese wer<strong>de</strong>n<br />
heute noch bisweilen öffentlich beim<br />
Besuch <strong>de</strong>s Papstes, bei Besuchen von<br />
Bischöfen und bei Begegnungen mit<br />
Priestern im Raum <strong>de</strong>r Öffentlichkeit<br />
praktiziert. Anre<strong>de</strong>n und Gesten unterschei<strong>de</strong>n<br />
sich von <strong>de</strong>n Anre<strong>de</strong>n und<br />
Gesten im Alltag. Gera<strong>de</strong> in Sü<strong>de</strong>uropa<br />
hat man dafür noch ein gutes Gespür.<br />
Besucht man Kirchen und gera<strong>de</strong> die<br />
großen Kathetralen in Sü<strong>de</strong>uropa, dann<br />
weiß auch <strong>de</strong>r gebil<strong>de</strong>te Nor<strong>de</strong>uropäer<br />
und die gebil<strong>de</strong>te Nor<strong>de</strong>uropäerin, dass<br />
sie nicht in je<strong>de</strong>r Kleidung Einlass fin<strong>de</strong>n.<br />
Kurze Hosen, ärmellose Klei<strong>de</strong>r,<br />
tiefe Dekolletierung, eine Kappe auf<br />
<strong>de</strong>m Kopf wer<strong>de</strong>n im Kirchenraum<br />
nicht gedul<strong>de</strong>t. Man bekommt meistens<br />
einen Plastiküberhang, <strong>de</strong>r die Blöße<br />
ver<strong>de</strong>ckt. Man mag über solche Sittenstrenge<br />
lachen o<strong>de</strong>r gar verärgert sein,<br />
aber je<strong>de</strong>r Ort hat seine spezifische<br />
Kleidung. Das gilt für <strong>de</strong>n Strand, für<br />
die Schule o<strong>de</strong>r das Theater.<br />
Da schulischer Unterricht nicht nur<br />
Sachzusammenhänge bespricht, gehört<br />
auch das Verhalten zum Gegenstand<br />
<strong>de</strong>s Unterrichts. So gehören Inhalt und<br />
Verhalten im Religionsunterricht, im<br />
August Heuser<br />
Ethikunterricht o<strong>de</strong>r im Deutschunterricht<br />
eng zueinan<strong>de</strong>r. Darüber ist jeweils<br />
zu re<strong>de</strong>n. So gehört zum Lesenlernen<br />
auch das Lesenkönnen, insbeson<strong>de</strong>re<br />
in <strong>de</strong>r Öffentlichkeit. So gehört<br />
es zur Überlegung ethischer und sittlicher<br />
Sachverhalte, sich selbst sittlich<br />
benehmen zu können. So gilt auch für<br />
<strong>de</strong>n Religionsunterricht, dass seine Inhalte<br />
eine Ausdrucksform haben, die<br />
auch ein/e Schüler/-in schon kennen<br />
und beherrschen muss. Die Praxisprobe<br />
für diese Kenntnisse<br />
ist das Benehmen<br />
im Kirchenraum.<br />
Da Kirchenräume<br />
nach römisch-katholischem<br />
Verständnis Sakralräume<br />
sind – Kin<strong>de</strong>r<br />
kennen <strong>de</strong>n Begriff<br />
Gotteshaus –, d.h.<br />
Räume, in <strong>de</strong>nen das<br />
Heilige anwesend ist<br />
(gemeint ist <strong>de</strong>r Gottessohn<br />
Jesus Christus<br />
in Gestalt <strong>de</strong>s Brotes),<br />
gibt es einige in<br />
<strong>de</strong>r Tradition gewachsene<br />
Benimmregeln,<br />
<strong>de</strong>ren Einhaltung so<br />
sinnvoll o<strong>de</strong>r unsinnig sind, wie die<br />
Einhaltung solcher gesellschaftlichen<br />
Regeln auch. Die Kirche als Lernort<br />
<strong>de</strong>s Glaubens ist nicht nur ein Lernort<br />
für Bil<strong>de</strong>r und Gegenstän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Frömmigkeit<br />
o<strong>de</strong>r Zeichen <strong>de</strong>s Glaubens, sie<br />
ist auch Lernort <strong>de</strong>s Verhaltens im Kirchenraum.<br />
Wenn es daheim o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r<br />
Schule Verhaltensvorschriften gibt und<br />
wenn diese zu befolgen sind – auch<br />
dann wenn sie zunächst nicht immer<br />
einsichtig gemacht wer<strong>de</strong>n können,<br />
wie etwa Tischsitten o<strong>de</strong>r Verhaltensregeln<br />
im Klassenraum und auf <strong>de</strong>m<br />
Schulhof –, so gilt dies auch für die<br />
Verhaltensregeln in einer Kirche. Einige<br />
davon seien hier wie<strong>de</strong>r einmal genannt:<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
181<br />
Unterrichts-Baustein
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
182<br />
Unterrichts-Baustein<br />
1. Die Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Raumes<br />
Der Kirchenraum hat als Gotteshaus<br />
eine eigene Wür<strong>de</strong>. Mit dieser Wür<strong>de</strong><br />
ist Kaugummikauen und Bonbonlutschen<br />
nicht zu vereinbaren.<br />
2. Kleidung<br />
Die Wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Raumes for<strong>de</strong>rt eine<br />
angemessene Kleidung.<br />
3. Hüte und Mützen<br />
Die Tradition auch unserer gesellschaftlichen<br />
Benimmregeln sieht<br />
vor, dass Männer wie Knaben ihre<br />
Mützen in geschlossenen Räumen<br />
und beim Grüßen sowie im Gespräch<br />
abzunehmen haben. Dies ist<br />
ein Gestus <strong>de</strong>r Höflichkeit, Achtung<br />
und Wertschätzung. Für das Verhalten<br />
im Kirchenraum gilt: Knaben<br />
und Männer nehmen Kappen,<br />
Mützen und Hüte vor Betreten <strong>de</strong>s<br />
Kirchenraumes ab. Mädchen und<br />
Frauen können Mützen, Hüte und<br />
Kopftücher auf <strong>de</strong>m Kopf lassen.<br />
Seine ursprüngliche Be<strong>de</strong>utung hat<br />
diese Regel in <strong>de</strong>m Brauch, dass im<br />
Ju<strong>de</strong>ntum und in unserer Gesellschaft<br />
Frauen ihre Haare zu verhüllen<br />
hatten. Haare galten nämlich als<br />
Sexualsymbole. So musste früher<br />
ein junges Mädchen im heiratsfähigen<br />
Alter und eine Frau eine Haube<br />
tragen. Wir sagen noch heute von<br />
<strong>de</strong>r Hochzeit „Sie kommt unter die<br />
Haube“. Dieser Brauch hat sich, si-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
cher auch aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Praktikabilität,<br />
durchgehalten. Eine Frau<br />
darf auch im geschlossenen Raum<br />
ihren Hut auflassen. Diese Regeln<br />
gelten übrigens, was die Frauen angeht,<br />
in <strong>de</strong>n drei großen Weltreligionen<br />
gleich.<br />
4. Das Kreuzzeichen<br />
Das Kreuzzeichen machen und dabei<br />
zu sprechen „Im Namen <strong>de</strong>s Vaters<br />
und <strong>de</strong>s Sohnes und <strong>de</strong>s Heiligen<br />
Geistes“ ist einer <strong>de</strong>r Grundvollzüge<br />
<strong>de</strong>s katholischen Betens. Auch<br />
die evangelische Kirche kennt diese<br />
Eröffnungs- und Schlussformel <strong>de</strong>s<br />
Betens. Sie lässt allerdings das Zeichen<br />
<strong>de</strong>s Bekreuzigens aus. Für katholische<br />
Christinnen und Christen<br />
ist dieses Zeichen ein Segenszeichen<br />
für <strong>de</strong>n ganzen Körper, <strong>de</strong>r sich ganz<br />
in das Gebet hineinstellt.<br />
5. Weihwasser nehmen<br />
Beim Eintritt in eine Kirche nimmt<br />
eine katholische Christin und ein<br />
katholischer Christ mit <strong>de</strong>n Fingerkuppen<br />
<strong>de</strong>s Zeige- und Mittelfingers<br />
Weihwasser und macht das<br />
Kreuzzeichen. Damit ge<strong>de</strong>nkt er seiner<br />
Taufe, die ihm Zugang zur Kirche<br />
als Gemeinschaft ermöglicht<br />
hat. Dieser Gestus wird beim Verlassen<br />
<strong>de</strong>r Kirche wie<strong>de</strong>rholt. Dabei<br />
erinnern sie sich an ihre Aufgabe als<br />
Getaufte in <strong>de</strong>r Welt.<br />
6. Der gemessene Schritt<br />
Schnelles Gehen und Rennen ist in<br />
<strong>de</strong>r Kirche nicht gerne gesehen. Es<br />
gilt <strong>de</strong>r gemessene Schritt, wie je<strong>de</strong><br />
Bewegung dort maßvoll und stilvoll<br />
sein soll. Somit wird auch durch die<br />
körperliche Bewegung <strong>de</strong>utlich: Wir<br />
sind an einem sakralen Ort.<br />
7. Die Kniebeuge<br />
Mit <strong>de</strong>r Kniebeuge in Richtung Tabernakel<br />
und Ewiges Licht macht<br />
<strong>de</strong>r Christ und die Christin <strong>de</strong>utlich,<br />
dass sie <strong>de</strong>n Kirchenraum als Gotteshaus<br />
bzw. als Ort <strong>de</strong>r Anwesenheit<br />
Jesu Christi im Sakrament <strong>de</strong>s<br />
Altares verstehen und dies im Glau-<br />
ben bekennen. Die Kniebeuge bzw.<br />
das sich auf <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n werfen ist in<br />
vielen Kulturen <strong>de</strong>m obersten Herrn<br />
als Zeichen <strong>de</strong>r Unterwerfung <strong>de</strong>s<br />
Knechtes und <strong>de</strong>r Anerkennung <strong>de</strong>s<br />
Herren vorbehalten.<br />
8. Knien<br />
Im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Kniebeuge<br />
steht auch das Knien. Das<br />
Knien ist Zeichen <strong>de</strong>r Ehrfurcht,<br />
Demut und Unterwerfung. Weil das<br />
Gebet in Demut zu vollziehen ist,<br />
ist die ursprüngliche Haltung <strong>de</strong>s<br />
Gebetes das Knien. Insbeson<strong>de</strong>re<br />
bei <strong>de</strong>r Hl. Messe während <strong>de</strong>r<br />
Wandlung ist das Knien ein angemessenes<br />
Zeichen <strong>de</strong>r Anbetung<br />
und Verehrung.<br />
9. Schweigen<br />
Zu Schweigen ist ein Zeichen <strong>de</strong>s<br />
Respektes und <strong>de</strong>r Achtung. Deshalb<br />
gilt im Kirchenraum immer auch das<br />
Schweigegebot. Es ist nicht nur Achtung<br />
und Rücksichtnahme auf die,<br />
die sich in diesem Raum konzentrieren<br />
und die in diesem Raum beten<br />
wollen. Es ist Zeichen <strong>de</strong>r grundsätzlichen<br />
Achtung vor Gott.<br />
10. Hän<strong>de</strong>falten<br />
Während <strong>de</strong>s Gottesdienstes ist das<br />
Hän<strong>de</strong>falten ein wichtiger Gestus.
Zwei Formen <strong>de</strong>s Hän<strong>de</strong>faltens sind<br />
zu unterschei<strong>de</strong>n: Es gibt das Übereinan<strong>de</strong>rschlagen<br />
und Ineinan<strong>de</strong>rschieben<br />
<strong>de</strong>r Finger und das wür<strong>de</strong>volle<br />
Aneinan<strong>de</strong>rlegen <strong>de</strong>r Hän<strong>de</strong>.<br />
Bei<strong>de</strong> Handhaltungen sind im Gottesdienst<br />
und beim Gebet gleichberechtigt<br />
möglich.<br />
11. Das Gebet<br />
Für einen kurzen Zeitraum möge <strong>de</strong>r<br />
katholische Kirchenbesucher und die<br />
katholische Kirchenbesucherin im<br />
Gebet verharren. Als Gebet empfiehlt<br />
sich ein kurzes Stoßgebet<br />
o<strong>de</strong>r das Vaterunser. Von Alters her<br />
wur<strong>de</strong> im privaten Gebet mit <strong>de</strong>m<br />
Vaterunser auch das Gegrüßet seist<br />
Du, Maria verbun<strong>de</strong>n.<br />
12. Kerzenanzün<strong>de</strong>n<br />
Kerzenanzün<strong>de</strong>n ist in <strong>de</strong>r Kirche<br />
kein Spaß. Es ist Zeichen <strong>de</strong>s gläubigen<br />
Gebetes und <strong>de</strong>r Hoffnung auf<br />
Gebetserhörung bei Gott. Es ist häufig<br />
verbun<strong>de</strong>n mit einer kleinen<br />
Spen<strong>de</strong>, die ausdrückt, dass <strong>de</strong>r Beter<br />
und die Beterin bereit sind, auch<br />
materiell Gutes zu tun. Die Kerzenspen<strong>de</strong><br />
drückt also auch <strong>de</strong>n eigen<br />
Willen aus, Gutes zu tun.<br />
13. Grüß Gott<br />
Der verbindliche Gruß unter Christen<br />
ist das in Süd<strong>de</strong>utschland noch<br />
immer vorherrschen<strong>de</strong> „Grüß Gott“.<br />
Hierin erweist sich das Gemeinschaftsgefühl<br />
unter Christen, die<br />
bei <strong>de</strong>r Begegnung miteinan<strong>de</strong>r einen<br />
Segensgruß aussprechen. Hinter<br />
<strong>de</strong>r säkularen Formel „Guten<br />
Tag“ steht zwar auch immer ein Segensgruß,<br />
das Woher und Wohin<br />
dieses Segens bleibt jedoch unausgesprochen<br />
und beliebig. Übrigens<br />
galt noch vor fünfzig Jahren in katholischen<br />
Kreisen bei einer Begegnung<br />
mit einem Priester <strong>de</strong>r Gruß:<br />
„Gelobt sei Jesus Christus“.<br />
Einige dieser Regeln sind Kin<strong>de</strong>rn<br />
und Jugendlichen bekannt, an<strong>de</strong>re sind<br />
vor <strong>de</strong>m Kirchenbesuch zu besprechen<br />
und evtl. einzuüben. Die Kniebeuge im<br />
Klassenraum o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Kirche einzuüben,<br />
kann ebenso Freu<strong>de</strong> machen wie<br />
das Einüben <strong>de</strong>s Kniens auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n<br />
o<strong>de</strong>r auf einer Kniebank. Für Kin<strong>de</strong>r<br />
sind solche Bewegungen neu, und sie<br />
machen dabei eine neue Erfahrung.<br />
Hier könnten die Demutshaltungen an<strong>de</strong>rer<br />
Religionen besprochen wer<strong>de</strong>n,<br />
so z.B. das Knien und Nie<strong>de</strong>rwerfen<br />
<strong>de</strong>r Muslime, eine Haltung, die es übrigens<br />
auch bei Katholiken gibt. Im gesellschaftlichen<br />
Kontext wäre hier auch<br />
<strong>de</strong>r Diener bzw. das Kopfnicken bei <strong>de</strong>r<br />
Begrüßung anzusprechen. Aber auch<br />
<strong>de</strong>r Knicks bzw. <strong>de</strong>r Hofknicks, <strong>de</strong>n<br />
Mädchen vielleicht aus <strong>de</strong>r TV-Übertra-<br />
gung von „Traumhochzeiten“ kennen,<br />
könnte hier einmal versucht wer<strong>de</strong>n.<br />
Auch <strong>de</strong>r Umgang mit einem Hut<br />
kann für Mädchen wie für Jungen durchaus<br />
eine spannen<strong>de</strong> Übung sein. Dabei<br />
könnte auch über die Kopfbe<strong>de</strong>ckung<br />
bei Muslimen und Ju<strong>de</strong>n gesprochen<br />
wer<strong>de</strong>n. Ebenso witzig wie interessant<br />
wäre die Übung, mit einem Teller auf<br />
<strong>de</strong>m Kopf elegant durch <strong>de</strong>n Klassenraum<br />
o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Sporthalle zu laufen.<br />
Ein Wettspiel wäre hier sicher eine lustige<br />
Sache.<br />
Das Kreuzzeichen sollte je<strong>de</strong>s Kind<br />
im Religionsunterricht lernen. Das ist<br />
für viele Kin<strong>de</strong>r gar nicht so leicht und<br />
setzt damit auch einen gewissen Ehrgeiz<br />
voraus. Die meisten Kin<strong>de</strong>r aber wollen<br />
dieses Zeichen, wenn es <strong>de</strong>nn einmal<br />
vorgeführt wur<strong>de</strong>, kennenlernen. In diesem<br />
Zusammenhang sollten aber auch<br />
die bei<strong>de</strong>n Grundgebete eines katholischen<br />
Christen o<strong>de</strong>r einer katholischen<br />
Christin kennengelernt wer<strong>de</strong>n, Vaterunser<br />
und Gegrüßet seist Du, Maria.<br />
Bei<strong>de</strong> Gebete gehören noch immer<br />
zum „Ausstattungsrepertoire“ katholischer<br />
Frömmigkeit.<br />
Die Handhaltung beim Gebet ist ein<br />
Zeichen von äußerer und innerer Stimmigkeit.<br />
Sie drückt Gelassenheit und<br />
Disziplin gleichermaßen aus. Sowohl<br />
im Christentum wie im Ju<strong>de</strong>ntum und<br />
im Islam gibt es weitere solche Gebets-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
183<br />
Unterrichts-Baustein
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
184<br />
Unterrichts-Baustein<br />
haltungen. Der Priester am Altar benutzt<br />
auch die Orantenhaltung, d.h. die<br />
nach oben erhobenen Arme und Hän<strong>de</strong>.<br />
Auch die vor <strong>de</strong>r Brust übereinan<strong>de</strong>r<br />
geschlagenen Hän<strong>de</strong> zeigen eine Gebets-<br />
bzw. Ehrfurchtshaltung.<br />
Das Thema Gesten und Körperhaltungen<br />
lässt über die Wie<strong>de</strong>rgewinnung<br />
und <strong>de</strong>n angemessenen Gebrauch <strong>de</strong>r<br />
alten, rudimentär noch immer bekannten,<br />
körpersprachlichen Zeichen in <strong>de</strong>r<br />
Kirche, eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten<br />
<strong>de</strong>r großen Religionen erkennen<br />
und damit auch das Kennenlernen <strong>de</strong>r<br />
Weltreligionen sinnvoll miteinan<strong>de</strong>r<br />
verbin<strong>de</strong>n. Was auf diese Weise körpersprachlich<br />
mit Freu<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Bewegung<br />
eingeübt und gelernt wird, bleibt<br />
für Schülerinnen und Schüler eher haften,<br />
als die nur kognitiv erfassten Gemeinsamkeiten<br />
<strong>de</strong>r großen monotheistischen<br />
Religionen.<br />
Die lebhafte Diskussion um das Buch<br />
von Asfa-Wossen Asserate in <strong>de</strong>n vergangenen<br />
Monaten hat gezeigt, wie<br />
wesentlich die Kenntnis eines Verhaltensrepertoires<br />
in unserer Gesellschaft<br />
heute immer noch für junge Menschen<br />
wie für Erwachsene sein kann. Dabei<br />
wur<strong>de</strong> festgestellt, dass Freundlichkeit,<br />
Höflichkeit, Respekt usw. verbindliche<br />
äußere Zeichen brauchen, um aus ihrer<br />
beliebigen Deutbarkeit herausgenommen<br />
zu wer<strong>de</strong>n. Sie sind, wie es das in<br />
Gruppen überall gibt, Benehmensstandards,<br />
die <strong>de</strong>utlich machen, zu welcher<br />
Klein- o<strong>de</strong>r Großgruppe man gehört<br />
o<strong>de</strong>r gehören möchte. Gera<strong>de</strong> im Kontext<br />
<strong>de</strong>r multikulturellen Gesellschaft<br />
Deutschlands sind diese Gesten <strong>de</strong>r Zugehörigkeit<br />
und <strong>de</strong>s Zugehörigkeitsge-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
fühls notwendig, um sich miteinan<strong>de</strong>r<br />
verständlich machen zu können und<br />
um neben <strong>de</strong>r abstrakten Verfassung<br />
weitere Standards <strong>de</strong>r Verständigung<br />
und <strong>de</strong>r Gemeinsamkeit herzustellen.<br />
Im Kontext <strong>de</strong>s Glaubens signalisieren<br />
Manieren Standards <strong>de</strong>r Gemeinsamkeit<br />
auf <strong>de</strong>r Ebene religiöser<br />
Überzeugungen und <strong>de</strong>r gestisch-ästhetischen<br />
Darstellung <strong>de</strong>s Glaubens.<br />
Sie wirken verschie<strong>de</strong>nen Nivellierungs-<br />
und Banalisierungsten<strong>de</strong>nzen<br />
o<strong>de</strong>r wie Michael N. Ebertz sagt, „Relativierungsgeneratoren“<br />
entgegen, die<br />
<strong>de</strong>r Behauptung Nahrung geben, alles<br />
sei gleich o<strong>de</strong>r gleich gültig und Glaube<br />
sei mehr o<strong>de</strong>r weniger Privatsache.<br />
Wie Manieren – ob gute o<strong>de</strong>r schlechte –<br />
nicht Privatsache sind, son<strong>de</strong>rn immer<br />
Ausdruck <strong>de</strong>s allgemeinen, gesellschaftlichen<br />
und kulturellen Stan<strong>de</strong>s<br />
unserer Gesellschaft, im kleinen auch<br />
von Schule, so sind sie auch Ausdruck<br />
<strong>de</strong>r Handlungsdimension von Glauben<br />
und seiner Wirksamkeit im gesellschaftlichen<br />
Leben. Es muss <strong>de</strong>shalb<br />
schon nach<strong>de</strong>nklich stimmen, wenn die<br />
religiösen Manieren wenig geachtet<br />
wer<strong>de</strong>n. Die Frage ist dann, ob damit<br />
auch die Sache, um die es geht, keine<br />
Achtung mehr erfährt.<br />
Anmerkung<br />
1 Asserate, Asfa-Wossen: Manieren (Die An<strong>de</strong>re Bibliothek;<br />
226) – Frankfurt am Main. 2003.<br />
Alle Fotos: © KNA-Bild<br />
Prof Dr. August Heuser ist Direktor <strong>de</strong>s<br />
Dommuseums in Frankfurt am Main.<br />
Besuchen Sie auch INFO-Online im Internet: www.ifrr.<strong>de</strong>
Rezensionen<br />
Hauser, Linus<br />
KKrriittiikk d<strong>de</strong>err NNeeoommyytthhii-sscchheenn<br />
VVeerrnnuunnfftt<br />
Band 1: Menschen als Götter <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong> (1800-<br />
1945). – Pa<strong>de</strong>rborn: Verlag F. Schöningh. 2004.<br />
513 S., € 98.00 (ISBN 3-506-77602-9)<br />
Universitäts-Theologie soll ja letztlich <strong>de</strong>n<br />
Zeitgenossen, also auch <strong>de</strong>n Religionslehrer/-innen,<br />
helfen, Leben und Beruf reflektierter zu bewältigen.<br />
Dies tut jene lei<strong>de</strong>r nur zu wenig. Doch<br />
hier haben wir einen Fall, wo aka<strong>de</strong>mische Studien<br />
keine Glasperlenspiele bleiben, son<strong>de</strong>rn einen<br />
praktikablen Ertrag an <strong>de</strong>n „Endverbraucher“<br />
weitergeben: Mitte <strong>de</strong>r 70er-Jahre hatte <strong>de</strong>r Frankfurter<br />
Religionsphilosoph Hermann Schrödter eine<br />
seit langem überfällige und tragfähige Begriffsbestimmung<br />
von „Religion“ vorgenommen<br />
(Religion als das „Bewusstsein <strong>de</strong>r radikalen<br />
Endlichkeit und <strong>de</strong>ren reale Überwindung“). Sein<br />
Schüler Hauser, heute Theologie-Professor an<br />
<strong>de</strong>r Uni Gießen, weist nun mit seinem breit angelegten<br />
Werk in Fortentwicklung dieses Ansatzes<br />
darauf hin, dass es etwa ab <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
bis in unmittelbare Gegenwart eine immer breiter<br />
wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong> pseudoreligiöse Ten<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>s Zeitgeistes<br />
gibt, die radikale Endlichkeit <strong>de</strong>s Menschen<br />
zu verdrängen, zu leugnen o<strong>de</strong>r gar durch menschliches<br />
Han<strong>de</strong>ln selbst überwin<strong>de</strong>n zu wollen. Solches<br />
neuzeitliche Bewusstsein prägt sich aus in<br />
„religionsförmige Neomythen“. Diese <strong>de</strong>finiert<br />
Hauser als ein „Sich-beziehen auf Endlichkeit<br />
ohne Bewusstsein ihrer Radikalität und im Bewusstsein<br />
<strong>de</strong>r realen Aufhebung <strong>de</strong>rselben durch<br />
das Han<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>s Menschen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rer endlicher<br />
Mächte“ (S. 55). Hauser präsentiert dann im<br />
Hauptteil seines Buches auf <strong>de</strong>r Grundlage jahrelanger<br />
Materialstudien eine Tour d´ Horizon neomythischer<br />
Strömungen von <strong>de</strong>r europäischen<br />
klassischen Literatur und Philosophie <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
über die Romantik, das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
bis zur realpolitisch katastrophalen „Ariosophie“<br />
Hitlers.<br />
Die Darstellungen bestechen durch präzise philosophische<br />
Analyse und zugleich durch bewun<strong>de</strong>rnswerte<br />
Detailarbeit <strong>de</strong>r unterschiedlichsten<br />
Medien und Text-Gattungen aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>s<br />
vagabundieren<strong>de</strong>n Quasireligiösen: So wer<strong>de</strong>n etwa<br />
hochkomplexe Philosophien und poetische<br />
Texte <strong>de</strong>r Goethe- und Romantikzeit, Berichte<br />
über Spiritismus und Okkultismus aus <strong>de</strong>m 19.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt, Publikationen nordisch-rassistischer<br />
Esoteriker <strong>de</strong>s frühen 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts präsentiert<br />
und irritieren zunächst auf <strong>de</strong>n ersten Blick<br />
Kulturbeflissene <strong>de</strong>s „Niveau-Milieus“. Doch<br />
weist Hauser völlig richtig darauf hin, dass gera<strong>de</strong><br />
solche seltsam-verquasten Lehren u.a. geschichtliche<br />
Katastrophen heraufbeschworen haben<br />
(etwa: Nationalsozialismus) und auch gera<strong>de</strong><br />
heute immer größere Teile <strong>de</strong>r Bevölkerung in<br />
Bereiche neureligiöser Alltagsmythen abdriften<br />
und sich daraus ihre „Patchwork-Privatreligion“<br />
zusammenbasteln; übrigens wird damit auch erschreckend<br />
erfolgreich das große Geld gemacht<br />
(Beispiel: „Scientology“).<br />
Um Hausers gedanklichen Duktus zu veranschaulichen,<br />
seien einige herausragen<strong>de</strong> Stationen<br />
<strong>de</strong>r oben skizzierten Entwicklung genannt: Ein initiales<br />
Schlüsselereignis ist sicher Goethes Sturmund-Drang-Hymnus<br />
„Prometheus“ (S. 184 ff),<br />
<strong>de</strong>r diesen Leitmythos im Lichte <strong>de</strong>r „geistigen<br />
Gewalten“ <strong>de</strong>r heidnischen Antike, <strong>de</strong>s in die Kritik<br />
geratenen Christentums und <strong>de</strong>r technikbegeisterten<br />
Aufklärung als neuzeitlichen Auftakt<br />
zum Programm <strong>de</strong>s sich selbst formen<strong>de</strong>n und<br />
schaffen<strong>de</strong>n Menschen gestaltet („hier sitz ich,<br />
forme Menschen nach meinem Bil<strong>de</strong> ...“), das in<br />
<strong>de</strong>r gegenwärtigen Bio-Ethik technisch-praktisch<br />
umgesetzt wird. Eine weitere wichtige Entwicklungslinie<br />
beginnt im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt mit einem<br />
trivialisierten Verständnis <strong>de</strong>r Darwinschen Evolutionstheorie.<br />
Der materialistische Philosoph<br />
Ludwig Büchner ( S. 193 ff) etwa (<strong>de</strong>r Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />
bekannteren Dichters Georg) will <strong>de</strong>n evolutiven<br />
Entwicklungsprozess <strong>de</strong>r prometheischen Menschheit<br />
so verstehen, dass „bei <strong>de</strong>n im Fortschritt begriffenen<br />
Völkern eine Steigerung <strong>de</strong>s geistigen<br />
Vermögens stattfin<strong>de</strong>n“ wird, wodurch diese sich<br />
schließlich titanenhaft „zu Göttern o<strong>de</strong>r Beherrschern<br />
<strong>de</strong>r Er<strong>de</strong>“ entwickeln wer<strong>de</strong>n. Schließlich<br />
sei als letztes Beispiel die Gedankenwelt benannt,<br />
aus <strong>de</strong>r Hitler mit katastrophaler Wirkkraft<br />
seine I<strong>de</strong>en nahm: kosmischer „Nordismus“ und<br />
„Ariosophie“, in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r prometheisch-titanische<br />
Mensch in ein rassistisches Deutemuster gepresst<br />
wird (S. 332 ff). Zu Beginn <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
in großen Bevölkerungskreisen rezipierte Esoteriker<br />
(also keine versponnenen „Einzeltäter“ !)<br />
entwarfen eine unsägliche „geschichtsphilosophische<br />
Metaphysik“, eine „Glacial-Kosmogonie“,<br />
nach <strong>de</strong>r in unvor<strong>de</strong>nklichen Zeiten durch<br />
einen Urknall aus Eis und Feuer weite Teile <strong>de</strong>r<br />
Welt überflutet wur<strong>de</strong>n und wo sich im Rahmen<br />
eines sozialdarwinistischen „survival of the fittest“<br />
nur eine starke, gesun<strong>de</strong> Rasse am Leben erhalten<br />
konnte, freilich bedroht von Resten min<strong>de</strong>rwertiger<br />
Rassen, die es – aus evolutiven Interessen<br />
– zu vernichten galt. In nationalsozialistischen<br />
Kreisen wur<strong>de</strong> dieser Neomythos auf das<br />
Kontrastpaar Arier – Ju<strong>de</strong> übertragen und nahm<br />
seinen furchtbaren Lauf. Der prometheische<br />
Arier hat schließlich das Ziel, sich in einem Endsieg<br />
über an<strong>de</strong>re Rassen zum Herren <strong>de</strong>r Welt<br />
aufzuschwingen: „Er ist <strong>de</strong>r Prometheus, auf <strong>de</strong>ssen<br />
lichter Stirne <strong>de</strong>r göttliche Funke hervorsprang<br />
und <strong>de</strong>n Menschen so <strong>de</strong>n Weg zum Beherrscher<br />
<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Wesen dieser Er<strong>de</strong> emporsteigen<br />
ließ. (...) Wer <strong>de</strong>n Nationalsozialismus nur<br />
als politische Bewegung versteht, weiß fast<br />
nichts von ihm. Er ist mehr noch als Religion: Er<br />
ist <strong>de</strong>r Wille zur neuen Menschenschöpfung“,<br />
schreibt Hitler und entspricht damit passgenau<br />
<strong>de</strong>r Hauserschen Definition von Neomythos. Der<br />
Herrenmensch schickt sich an, seine Endlichkeit<br />
hinter sich zu lassen und als Neugott seine Allmachtsphantasien<br />
zu träumen, ja zu realisieren.<br />
Gera<strong>de</strong> für diese Epoche ist es Hauser gar nicht<br />
hoch genug anzurechnen, dass er vor Hitlers eher<br />
unbekannter pseudoreligiöser Gedankenwelt <strong>de</strong>n<br />
Vorhang weggezogen hat, gab es doch unglücklicherweise<br />
nur zu lange die Neigung, sich „geistesgeschichtlich“<br />
mit <strong>de</strong>m Phänomen <strong>de</strong>s Nationalsozialismus<br />
(fast) nicht zu befassen.<br />
Man darf schon gespannt sein auf <strong>de</strong>n zweiten<br />
Band <strong>de</strong>r Hauserschen „Kritik“ . In diesem will er<br />
sich gegenwärtigen Neomythen breiter Bevölkerungsschichten<br />
zuwen<strong>de</strong>n. Im Zeichen eines nicht<br />
mehr kämpferischen Atheismus’, son<strong>de</strong>rn vielmehr<br />
einer „beruhigten Endlichkeit“ sind dies<br />
u.a. die Konsum- und Leistungsi<strong>de</strong>ologie als Ersatzreligion,<br />
UFO-Glauben auch und gera<strong>de</strong> in<br />
sogenannten technischen Eliten (60% <strong>de</strong>r Studieren<strong>de</strong>n<br />
glauben an UFOs !), die Präastronautik eines<br />
Erich von Däniken (<strong>de</strong>m 30% <strong>de</strong>r Bevölkerung<br />
zustimmen !), <strong>de</strong>r milliar<strong>de</strong>nschwere Psycho-Konzern<br />
„Scientology“ (durch therapeutische<br />
Prozesse zur Selbstvergottung), die UFO-<br />
Sekte „Fiat Lux“ (Gott rettet Auserwählte per<br />
UFO in immaterielle Welten, ähnlich die Selbstmordsekte<br />
„Heavens Gate“) o<strong>de</strong>r die Vorstellung,<br />
als yogischer Flieger, die menschliche Endlichkeit<br />
überwin<strong>de</strong>nd, durch <strong>de</strong>n Kosmos zu surfen<br />
(Transzen<strong>de</strong>ntale Meditation). Aber auch schon<br />
in Theorie und Praxis Salonfähiges wie Weltanschuungen<br />
werten/unwerten Lebens mit Selektion<br />
<strong>de</strong>s Kranken (Eugenik, Euthanasie) o<strong>de</strong>r<br />
Klonexperimente esoterischer und aka<strong>de</strong>mischer<br />
Wissenschaftler sollen beleuchtet wer<strong>de</strong>n.<br />
Abschließend schreibt Hauser, sei von uns allen<br />
danach zu fragen, ob und in welchem Maße<br />
wir aus <strong>de</strong>n geistes- und realgeschichtlichen Verirrungen<br />
gelernt haben. Ganz in diesem Sinne<br />
sind Hausers „Kritiken“ wichtige Warnhinweise<br />
und Lernhilfen für uns als für die Zukunft <strong>de</strong>r<br />
Kirche Engagierte, als Religionslehrer/-innen und<br />
damit schließlich auch für unsere Schüler/-innen.<br />
Gustav Schmiz<br />
Leonhardt, Annette (Hg.)<br />
WWiiee ppeerrffeekktt mmuussss<br />
d<strong>de</strong>err MMeennsscchh sseeiinn??<br />
Behin<strong>de</strong>rung, molekulare Medizin und Ethik. Mit<br />
Beiträgen von Wolfgang van <strong>de</strong>r Daele, Wolfgang<br />
Frühwald, Elke Holinski-E<strong>de</strong>r, Hans-Georg<br />
Koch, Anton Leist, Peter Oberen<strong>de</strong>r, Jens Georg<br />
Reich, Wolfgang Schlosser, Eberhard Schockenhoff,<br />
Otto Speck. – München-Basel: Ernst Reinhardt<br />
Verlag. 2004. 214 S. mit 3 Abb., € 24.90<br />
(ISBN: 3-497-01658-6)<br />
Der von Annette Leonhardt, Professorin für<br />
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik an<br />
<strong>de</strong>r Ludwig-Maximilians-Universität München,<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
185
LITERATUR & MEDIEN<br />
186<br />
herausgegebene Sammelband dokumentiert eine<br />
Veranstaltungsreihe zum Thema „Ethik – Molekulare<br />
Medizin – Behin<strong>de</strong>rung“. Wie erklärt sich<br />
die Kombination dieser sehr unterschiedlichen<br />
Themen? Je besser die Möglichkeiten <strong>de</strong>r Biomedizin<br />
wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>sto mehr kommt die Frage auf,<br />
ob Menschen mit Behin<strong>de</strong>rungen überhaupt noch<br />
geboren wer<strong>de</strong>n sollten. Schon heute wer<strong>de</strong>n in<br />
<strong>de</strong>r sogenannten „zivilisierten Welt“ 95% <strong>de</strong>r<br />
Embryonen abgetrieben, bei <strong>de</strong>nen genetische<br />
Schä<strong>de</strong>n pränatal diagnostiziert wer<strong>de</strong>n. Macht<br />
es nicht Sinn, diese Metho<strong>de</strong> bei künstlichen Befruchtungen<br />
zu nutzen und nur gesun<strong>de</strong> Embryonen<br />
einzupflanzen? Wie ist <strong>de</strong>r umgekehrte Weg<br />
zu beurteilen, dass behin<strong>de</strong>rte Eltern die Möglichkeiten<br />
<strong>de</strong>r Pränataldiagnostik nutzen, um<br />
selbst behin<strong>de</strong>rte Kin<strong>de</strong>r zu bekommen, wenn<br />
z.B. taubstumme Eltern auch taubstumme Kin<strong>de</strong>r<br />
wollen, wie dies in Amerika geschehen ist? Kann<br />
man aus <strong>de</strong>r Absicht, vor <strong>de</strong>r Geburt eines Menschen<br />
Krankheiten und Behin<strong>de</strong>rungen zu verhin<strong>de</strong>rn,<br />
schließen, dass Menschen mit Behin<strong>de</strong>rungen<br />
nach ihrer Geburt diskriminiert wer<strong>de</strong>n?<br />
Die Antworten auf diese und weitere Fragen<br />
fallen so vielfältig aus, wie die unterschiedlichen,<br />
vertretenen Fachrichtungen von <strong>de</strong>r Gesundheitsökonomie<br />
über die Politik bis zu Theologie und<br />
Biologie. Wer sich allerdings die Mühe macht, die<br />
einzelnen Artikel unter systematischen Gesichtspunkten<br />
zu betrachten, <strong>de</strong>r wird reich belohnt.<br />
Zum Beispiel taucht immer wie<strong>de</strong>r die Frage<br />
auf, ob die Selektion behin<strong>de</strong>rten Lebens vor <strong>de</strong>r<br />
Geburt eine Diskriminierung von Menschen mit<br />
Behin<strong>de</strong>rungen nach <strong>de</strong>r Geburt zur Folge hat.<br />
Wolfgang Frühwald erinnert in diesem Zusammenhang<br />
an die Kränkungen <strong>de</strong>r menschlichen<br />
Eigenliebe, die Siegmund Freud 1917 ent<strong>de</strong>ckt<br />
hat. Danach hatte Kopernikus Ent<strong>de</strong>ckung, dass<br />
die Er<strong>de</strong> nicht <strong>de</strong>r Mittelpunkt <strong>de</strong>s Sonnensystems<br />
war, eine gewaltige, bewußtseinsverän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong><br />
Wirkung. Ebenso die darwinische Lehre, die<br />
die vom Hochmut geschaffene Schei<strong>de</strong>wand zwischen<br />
Mensch und Tier nie<strong>de</strong>rriss. Schließlich die<br />
Psychoanalyse selbst, die das erhabene Gefühl<br />
<strong>de</strong>s Menschen an sein Triebleben band. Diesen<br />
Kränkungen fügt nach Frühwald die Biotechnologie<br />
eine weitere hinzu, weil sie Leib und Leben<br />
unter die Verfügbarkeit <strong>de</strong>s Menschen selbst stelle.<br />
In dieselbe Richtung argumentiert <strong>de</strong>r Moraltheologe<br />
Eberhard Schockenhoff. Er weist auf<br />
die Bitterkeit und Ausweglosigkeit für einen<br />
Menschen mit Behin<strong>de</strong>rung hin, wenn er sich vor<br />
Augen führt, dass er wahrscheinlich nie geboren<br />
wor<strong>de</strong>n wäre, wenn es zu seiner Zeugungszeit bereits<br />
die Möglichkeiten <strong>de</strong>r PID gegeben hätte.<br />
Der Heilpädagoge Otto Speck sieht die Konsequenzen<br />
schon jetzt. Immer öfters komme es vor,<br />
dass mit Blick auf Behin<strong>de</strong>rte konstatiert wür<strong>de</strong>,<br />
dass das heute nicht mehr sein müsse. Und <strong>de</strong>r<br />
Sprachforscher Horst-Dieter Schlosser zeigt am<br />
Begriff <strong>de</strong>s Wunschkin<strong>de</strong>s, wie sich <strong>de</strong>r Wan<strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>r Mentalitäten im Wan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r Sprache ausdrückt.<br />
Erfüllte früher das natürlich geborene und<br />
damit mehr o<strong>de</strong>r weniger zufällige Wunschkind<br />
<strong>de</strong>n Kin<strong>de</strong>rwunsch <strong>de</strong>r Eltern, so beinhaltet heute<br />
<strong>de</strong>r Begriff das künstliche gezeugte, gezielt gemachte<br />
Kind. In Kontrast zu diesen Überlegun-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
gen zeigt <strong>de</strong>r Berliner Soziologe Wolfgang van<br />
<strong>de</strong>r Daele anhand von Umfragenergebnissen,<br />
dass die Selektion Behin<strong>de</strong>rter vor <strong>de</strong>r Geburt<br />
nicht zwingend zur Diskriminierung nach <strong>de</strong>r Geburt<br />
führt. Mehr noch: Es fällt auf, dass selbst<br />
80% <strong>de</strong>r Eltern von Menschen mit Beeinträchtigungen<br />
die Möglichkeiten <strong>de</strong>r Pränataldiagnostik<br />
und eine Abtreibung nach entsprechen<strong>de</strong>r Diagnose<br />
für vertretbar halten. Während sich in manchen<br />
Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>rn die Abtreibungsrate von<br />
Kin<strong>de</strong>r mit Trisomie 21 auf die 100% zugeht,<br />
wächst gleichzeitig die Toleranz gegenüber diesen<br />
Kin<strong>de</strong>rn im wirklichen Leben. Immer mehr<br />
Menschen sprechen sich dafür aus, diese Menschen<br />
in ihren Familien zu belassen und integrativ<br />
zu erziehen, statt sie in „Anstalten“ unterzubringen.<br />
Dagegen belegen die Umfragen, dass<br />
das Selbstkonzept, das Betreuer von Menschen<br />
mit Behin<strong>de</strong>rungen haben, viel <strong>de</strong>fizitorientierter<br />
ist, als dies bei <strong>de</strong>n Betroffenen selbst und <strong>de</strong>m<br />
allgemeinen Umfeld <strong>de</strong>r Fall ist. Es scheint dann<br />
nur konsequent, wenn <strong>de</strong>r Gesundheitsökonomiker<br />
Peter Oberen<strong>de</strong>r for<strong>de</strong>rt, dass <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r<br />
von seinem Recht auf Nichtwissen Gebrauch<br />
macht, dann auch für die bei sich o<strong>de</strong>r bei dritten<br />
auftreten<strong>de</strong>n Schä<strong>de</strong>n haften müsse, wenn sie<br />
sonst verhin<strong>de</strong>rbar gewesen wären.<br />
Damit ist eines klar: Die Beiträge dieses Ban<strong>de</strong>s<br />
geben keine abschließen<strong>de</strong> Antwort auf die<br />
Frage seines Titels. Sie brauchen es nicht, weil<br />
die Wirklichkeit viel vielschichtiger ist, als es eine<br />
Überschrift provokativ auf <strong>de</strong>n Punkt zu bringen<br />
versucht. Die Stärke diese Ban<strong>de</strong>s ist es, diese<br />
Vielschichtigkeit <strong>de</strong>m Leser vor Augen zu<br />
führen. Caspar Söling<br />
Korczak, Janusz<br />
DDaass RReecchhtt d<strong>de</strong>ess KKiinn-d<strong>de</strong>ess<br />
aauuff AAcchhttuunngg uunndd<br />
FFrrööhhlliicchhee PPääddaaggooggiikk<br />
Aus <strong>de</strong>m Poln. v. Nora Koestler und Esther Kinsky.<br />
Hg. u. bearb. v. Friedhelm Beiner (GTB 940). –<br />
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 2002. 159 S.,<br />
€ 9.90 (ISBN 3-579-00940-0)<br />
„Lasst uns Achtung haben, wenn nicht Demut,<br />
vor <strong>de</strong>r hellen, klaren, unbefleckten, heiligen Kindheit“<br />
(S. 44), schreibt Korczak als Schlusssatz<br />
seiner Gedanken zu „Das Recht <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s auf<br />
Achtung“. Beim Lesen dieses Wortes, fällt mir<br />
spontan die folgen<strong>de</strong> Begebenheit ein: Während<br />
Jesus „seine Jünger ... (lehrte)“ (Mk 9,31), „stellte<br />
(er) ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme<br />
und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind um<br />
meinetwillen aufnimmt, <strong>de</strong>r nimmt mich auf“<br />
(Mk 9,36-37). Den Jüngern, lebenserfahrenen<br />
und reifen Männern, die miteinan<strong>de</strong>r darüber<br />
sprachen, „wer von ihnen <strong>de</strong>r Größte sei“ (Mk<br />
9,34), antwortete Jesus mit einer symbolischen<br />
Geste: Der Größte ist <strong>de</strong>r Kleinste, <strong>de</strong>r wahre Erwachsene<br />
im Himmelreich ist das Kind. Nicht die<br />
Kin<strong>de</strong>r sollen wer<strong>de</strong>n wie die Erwachsenen, son<strong>de</strong>rn<br />
die Erwachsenen wie die Kin<strong>de</strong>r.<br />
Wenn auch einerseits bei <strong>de</strong>n Griechen und<br />
Römern kranke, verkrüppelte Kin<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r uner-<br />
wünschte Mädchen erbarmungslos ausgesetzt o<strong>de</strong>r<br />
getötet wur<strong>de</strong>n (vgl. S. 28), so fan<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rerseits<br />
die Kleinen als Symbol von Schönheit und göttlicher<br />
Präsenz eine hohe I<strong>de</strong>alisierung: „Maxima <strong>de</strong>betur<br />
puero reverentia“ (<strong>de</strong>m Kind gebührt höchste<br />
Achtung), sagte Juvenal (60-140 n. Christus).<br />
Kin<strong>de</strong>r brauchen Bezugspersonen, die emotionale<br />
Wärme und Geborgenheit schenken. Janusz<br />
Korczak – Arzt, Pädagoge, Kin<strong>de</strong>rfreund – erkannte:<br />
Das Kind sucht Wegbahner, Menschen, die die<br />
Wirklichkeit <strong>de</strong>r Welt nicht überspringen, <strong>de</strong>r<br />
Härte <strong>de</strong>s Lebens nicht ausweichen. Die Fruchtbarkeit<br />
dieser Erfahrung spiegelt sich in <strong>de</strong>m Bemühen,<br />
die Vielglie<strong>de</strong>rigkeit und <strong>de</strong>n Beziehungsreichtum,<br />
die Verwobenheit aber auch die Eigenständigkeit<br />
<strong>de</strong>s geheimnisvollen Wachsens <strong>de</strong>s<br />
Kin<strong>de</strong>s anzuerkennen. Für ihn ist Erziehung ein<br />
begrenzt planbares Geschehen; es kennzeichnet<br />
sich – an Autorität zwar gebun<strong>de</strong>n – immer als eine<br />
von Liebe getragene Praxis.<br />
In <strong>de</strong>m gerafften Abriss von 36 Seiten kündigt<br />
sich die Weite <strong>de</strong>s Horizonts, die Tiefe <strong>de</strong>r Einsicht<br />
in das Pädagogisch–Eigentliche, die Vielfarbigkeit<br />
von Welt, Kind und Erziehung an. Eine<br />
vorurteilslose Hinwendung und Offenheit zum<br />
Kind charakterisieren die Einstellung und Leitlinie<br />
Korczaks. In <strong>de</strong>r spannungsvollen Einheit<br />
von Reflexion und Engagement (wie<strong>de</strong>r)ent<strong>de</strong>ckt<br />
<strong>de</strong>r aufmerksame Leser manches verkümmerte<br />
Problembewusstsein, verschie<strong>de</strong>ne vergessene<br />
o<strong>de</strong>r gar verdrängte Wahrheiten als unerlässliche<br />
Wege, um die Vieldimensionalität kindlicher Erziehung<br />
verstehen und för<strong>de</strong>rn zu können. Die<br />
kindliche Erziehung ist für ihn gebun<strong>de</strong>n an „(d)as<br />
Recht <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>s auf Achtung“; auf diese Weise<br />
soll es zu einem geglückten Menschsein entwickelt,<br />
ermutigt und ermächtigt wer<strong>de</strong>n. „Eine neue<br />
Generation wächst heran, eine neue Welle erhebt<br />
sich. Sie kommen mit ihren Fehlern und Vorzügen;<br />
schafft ihnen Bedingungen, unter <strong>de</strong>nen<br />
sie besser aufwachsen können“ (S. 43).<br />
Dem Gütersloher Verlagshaus gebührt Dank,<br />
dass es in <strong>de</strong>mselben Band, auch die „Fröhliche<br />
Pädagogik“ veröffentlicht. Die Untertitel „Meine<br />
Ferien“ und „Radioplau<strong>de</strong>reien <strong>de</strong>s Alten Doktors“<br />
(S. 45) kennzeichnen die leichte, aber ernstzunehmen<strong>de</strong><br />
Art, unterschiedliche Erziehungssituationen<br />
zu beschreiben und allgemeingültige<br />
Erkenntnisse neu zu erhellen. Je<strong>de</strong>s Verstehen<br />
von Erziehung ist gebun<strong>de</strong>n an ein Verstehen <strong>de</strong>s<br />
Kin<strong>de</strong>s in einer bestimmten Situation. Der kindliche<br />
Mensch reift als Individualität, geprägt durch<br />
Anlage und Umwelt. Erziehung als Hilfe zum<br />
vollen Menschwer<strong>de</strong>n und Bildung als Frucht <strong>de</strong>r<br />
Erziehung vollziehen sich in <strong>de</strong>r Achtung <strong>de</strong>s<br />
kindlichen Menschen. „Wann wird jener Moment<br />
<strong>de</strong>r Freimütigkeit eintreten, da das Leben <strong>de</strong>r Erwachsenen<br />
und das <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r gleichwertig nebeneinan<strong>de</strong>r<br />
stehen wer<strong>de</strong>n?“ (S. 100). Janusz<br />
Korczak kennt die Vielfarbigkeit <strong>de</strong>r Wirklichkeit,<br />
die sich ihm über eine Vielfalt von Zugangsweisen<br />
erschließt.<br />
Da das Kind als Dasein stets mit an<strong>de</strong>rem Dasein<br />
lebt, nimmt die Erziehung die Gestalt eines<br />
Einordnungsprozesses in die gesellschaftlichen<br />
Formen und Strukturen, Gruppen und Institutionen<br />
an. Korczaks „Fröhliche Pädagogik“<br />
macht vertraut mit Spielregeln und Gesetzen, mit
Sitte und Brauchtum, verknüpft zugleich <strong>de</strong>n Willen<br />
zur Anpassung mit <strong>de</strong>m Mut zum Wi<strong>de</strong>rstand<br />
und vermittelt sachliches Han<strong>de</strong>ln mit gleichzeitigem<br />
Schärfen <strong>de</strong>s Unterscheidungsvermögens.<br />
Bewusst wird das Kind bestärkt in seinem<br />
ursprünglichen Wissenwollen, aber auch <strong>de</strong>r Sinn<br />
<strong>de</strong>s Scheiterns bleibt im Blickfeld.<br />
Mit diesen ausgewählten Aspekten ist gleichsam<br />
das offene Koordinatensystem ange<strong>de</strong>utet, das<br />
Janusz Korczaks Pädagogik kennzeichnet. Die<br />
recht unterschiedlichen Aussagen schließen sich<br />
nicht zu einem run<strong>de</strong>n Gesamtbild. Diese heilsame<br />
Einsicht lässt auf <strong>de</strong>m unabschließbaren Weg<br />
unentwegten Fragens, Denkens und Han<strong>de</strong>lns<br />
mutig und zuversichtlich weitergehen.<br />
Dietmar Höffe<br />
Sedmak, Clemens<br />
TThheeoollooggiiee iinn nnaacchhtt-hheeoollooggiisscchheerr<br />
ZZeeiitt<br />
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag. 2003. 212 S.,<br />
€ 24.80 (ISBN 3-7867-2411-3)<br />
„Die These dieses Buches lautet, dass wir in<br />
nachtheologischer Zeit leben [, ...] einer Zeit, in<br />
<strong>de</strong>r die Parameter, die die Sache <strong>de</strong>r Theologie als<br />
plausibel o<strong>de</strong>r relevant o<strong>de</strong>r glaubwürdig erscheinen<br />
ließen, fragwürdig und fragil gewor<strong>de</strong>n sind.<br />
Wir können nicht mehr Theologie betreiben, ‚als<br />
ob’ alles in Ordnung wäre.“ (7) Religion braucht<br />
– so die Situationsanalyse <strong>de</strong>s Autors – heute keine<br />
theologische Rechtfertigung mehr. Anything<br />
goes, weil und solange es Spaß macht, gut tut,<br />
funktioniert, nicht weil und solange es vor <strong>de</strong>r<br />
Vernunft geprüft wird. Theologie wird als argumentative<br />
Vergewisserung <strong>de</strong>s Glaubens nicht<br />
nur in Wissenschaft und Gesellschaft, son<strong>de</strong>rn in<br />
<strong>de</strong>r Kirche selbst zunehmend überflüssig.<br />
Angesichts dieser Krise plädiert Sedmak dafür,<br />
Theologie ‚in nachtheologischer Zeit’ mit<br />
Blick nach vorn zu treiben: sich auf das Zentrum<br />
christlicher Theologie zu konzentrieren, herauszuarbeiten,<br />
was sie von an<strong>de</strong>ren Wissenschaften<br />
unterschei<strong>de</strong>t, was sie ihnen voraus hat und inwiefern<br />
sie im wissenschaftlichen Diskurs unverzichtbar<br />
ist. Gegen die landläufige Einschätzung<br />
ist er davon überzeugt, dass Theologie in inhaltlicher<br />
wie in wissenschaftstheoretischer Hinsicht<br />
keineswegs überflüssig o<strong>de</strong>r überholt ist. Denn<br />
Theologie habe gegenüber an<strong>de</strong>ren ‚Weltbewältigungsdisziplinen’<br />
<strong>de</strong>n entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Vorteil,<br />
dass sie konstitutiv auf das Dreieck Tradition –<br />
Gemeinschaft – Praxis bezogen ist. Diesen dreifachen<br />
Bezug wertet Sedmak also nicht als Nachteil<br />
<strong>de</strong>r eingeengten Perspektive, <strong>de</strong>r freiheitsberauben<strong>de</strong>n<br />
und wissenschaftsfrem<strong>de</strong>n Gebun<strong>de</strong>nheit,<br />
son<strong>de</strong>rn als Fähigkeit, im Diskurs über<br />
Sinn- und Grundsatzfragen inhaltlich und formal<br />
eine echte Kontrastperspektive zu bieten, <strong>de</strong>ren<br />
Umsetzbarkeit und Gemeinschaftsfähigkeit bereits<br />
erprobt wur<strong>de</strong>. Theologie habe darüber hinaus<br />
das (methodische und epistemische) Instrumentarium,<br />
‚stumme’ Theologien, also unreflektierte<br />
Voraussetzungen, Standpunkte und Interessen<br />
an<strong>de</strong>rer Perspektiven herauszuarbeiten und<br />
auf ihren wissenschaftstheoretischen Status, ihre<br />
Handlungsrelevanz und Gemeinschaftstauglichkeit<br />
hin zu überprüfen. Anstatt sich in je neuen<br />
und komplizierteren Kombinationen von Althergebrachtem<br />
zu versuchen, solle Theologie sich<br />
auf diese Stärken besinnen und sie im interdisziplinären<br />
Diskurs geltend machen.<br />
Den konstitutiven Anwendungsbezug <strong>de</strong>r<br />
Theologie macht Sedmak nicht nur ‚nach außen’,<br />
son<strong>de</strong>rn zugleich ‚nach innen’stark: Denn eigentlich<br />
sei Theologie genuin Theopragmatik, da sie<br />
aus einer Praxis erwachse und auf eine Transformation<br />
von Praxis in Richtung und gemäß <strong>de</strong>r<br />
fundamentalen Praxis Jesu – <strong>de</strong>m Mo<strong>de</strong>ll gelungenen<br />
menschlichen Lebens schlechthin – hinarbeite.<br />
Daher votiert er dafür, handlungs- und urteilsorientiert<br />
Theologie zu betreiben, konkret zu<br />
bleiben, ‚regional’ zu <strong>de</strong>nken, sich an <strong>de</strong>n Partikularitäten<br />
<strong>de</strong>s menschlichen Lebens abzuarbeiten,<br />
Abschied zu nehmen von <strong>de</strong>n großen Systemtheorien,<br />
<strong>de</strong>n abstrakt-allgemeinen Entwürfen.<br />
Nur so bleibe Theologie vermittelbar, umsetzbar<br />
und (daher) im Wettkampf <strong>de</strong>r Sinnentwürfe<br />
relevant. Nur so folge man <strong>de</strong>m Beispiel<br />
Jesu, <strong>de</strong>r sinnenfällig, konkret und symbolträchtig<br />
gehan<strong>de</strong>lt, nicht aber kompliziert und<br />
fußnotengespickt gedacht, geschrieben, theologisiert<br />
habe. Nur so könne Theologie zeigen, dass<br />
und „wie die Gott-Re<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Re<strong>de</strong> von allem,<br />
was uns angeht, zusammenhängt“ (170).<br />
Sedmaks Schlüsselwort lautet: Handlungsbezug.<br />
Handlungsbezug als epistemischer Vorteil<br />
<strong>de</strong>r Theologie, Handlungsbezug als Orientierung<br />
und Maßstab theologischer Abhandlungen,<br />
Handlungsbezug als Brücke zwischen Glauben<strong>de</strong>n<br />
und Nichtglauben<strong>de</strong>n, zwischen uns heute<br />
und Jesus damals. Ungeheuer wortreich, gespickt<br />
mit Anspielungen und Belesenheitszeugnissen,<br />
mit Ausflügen in verschie<strong>de</strong>ne Nebenschauplätze<br />
und etlichen Wie<strong>de</strong>rholungen buchstabiert er dieses<br />
Schlüsselwort durch. Nicht immer ist es<br />
leicht, in <strong>de</strong>n Windungen und Wendungen <strong>de</strong>s<br />
Buches <strong>de</strong>n roten Fa<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Argumentation im<br />
Auge zu behalten.<br />
Seine Überzeugung, <strong>de</strong>r Bezug auf Tradition,<br />
Gemeinschaft und Praxis sei ein entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r<br />
Vorteil <strong>de</strong>r Theologie, ist hochinteressant. Und in<br />
<strong>de</strong>r Tat hat die Theologie im Vergleich zu an<strong>de</strong>ren<br />
Wissenschaften breite Kompetenz und epistemischen<br />
Vorsprung auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r methodischen<br />
Selbstreflexion und <strong>de</strong>r Hermeneutik erworben,<br />
ein Pfund, mit <strong>de</strong>m sie viel stärker wuchern<br />
könnte und sollte. Ähnliches gilt für ihre inhaltliche<br />
Kompetenz in anthropologischen und<br />
ethischen Fragen, insofern sie Welt und Mensch<br />
‚aus <strong>de</strong>r Perspektive Gottes’ und ‚im Angesicht<br />
<strong>de</strong>s To<strong>de</strong>s’zu beurteilen sucht. Tatsächlich gibt es<br />
auch in <strong>de</strong>r Theologie zu viele abgehobene Theorien,<br />
zu viele Fußnoten und zu wenig Handlungskompetenz.<br />
Sedmak hat daher grundsätzlich Recht, wenn<br />
er für mehr Handlungsrelevanz votiert, schließlich<br />
geht es darum, als Christ zu leben und nicht<br />
nur zu <strong>de</strong>nken. Doch dieses Votum ist in <strong>de</strong>r von<br />
ihm vertretenen Ausschließlichkeit min<strong>de</strong>stens<br />
einseitig. Denn die lokale Theopragmatik, die er<br />
for<strong>de</strong>rt und ausführlich beschreibt, ist nicht mehr<br />
transformierte Theologie, son<strong>de</strong>rn christliche<br />
Praxis. Theologie aber hat nicht die Aufgabe,<br />
christliche Existenz zu ersetzen o<strong>de</strong>r sich in<br />
‚Theopraxis’ aufzulösen. Auch ‚in nachtheologischer<br />
Zeit’ bleibt sie Theologie. Dabei ist ihr<br />
Fächer- und Metho<strong>de</strong>nreichtum (einschließlich<br />
<strong>de</strong>rjenigen theologischen Arbeit, die gar kein unmittelbar<br />
handlungsleiten<strong>de</strong>s Interesse hat) nicht<br />
zu überwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Übel, son<strong>de</strong>rn Ausweis ihrer<br />
wissenschaftlichen und wissenschaftstheoretischen<br />
Stärke. Julia Knop<br />
Wabbel, Daniel Tobias (Hg.)<br />
IImm AAnnffaanngg wwaarr<br />
((kk))eeiinn GGootttt<br />
Naturwissenschaftliche und theologische Perspektiven.<br />
– Düsseldorf: Patmos Verlag. 2004.<br />
290 S., € 24.90 (ISBN 3-491-72477-5)<br />
Der 1973 geborene und in Gelsenkirchen leben<strong>de</strong><br />
Schriftsteller Tobias D. Wabbel, <strong>de</strong>r 2002<br />
einen Band „SETI – die Suche nach <strong>de</strong>n Außerirdischen“<br />
herausgab und nach eigenen Angaben<br />
gegenwärtig an einem Wissenschafts-Thriller arbeitet,<br />
ist Herausgeber <strong>de</strong>s vorliegen<strong>de</strong>n Ban<strong>de</strong>s.<br />
Der Band enthält nach einem kurzen Vorwort <strong>de</strong>s<br />
Herausgebers 23 Beiträge, von <strong>de</strong>nen 11 Originalbeiträge<br />
sind; die übrigen 12 sind Wie<strong>de</strong>r-Abdrucke,<br />
<strong>de</strong>r Fundort in <strong>de</strong>n Werken <strong>de</strong>r Autoren<br />
wird aber nirgendwo angegeben, ein nicht akzeptabler<br />
Mangel.<br />
Unter <strong>de</strong>n Beiträgern haben die 18 Naturwissenschaftler<br />
(etliche Physiker, Astronomen, Biologen,<br />
ein Bewusstseinsforscher, ein Raumfahrttechniker,<br />
ein Wissenschaftsredakteur) <strong>de</strong>utlich<br />
das Übergewicht. Von ihnen gehen jedoch überhaupt<br />
nur 8 auf das Thema „Im Anfang war (k)ein<br />
Gott“ ein: Die Annahme eines – recht unterschiedlich<br />
gedachten – Schöpfer-Gottes bejahen <strong>de</strong>r Direktor<br />
<strong>de</strong>s Vatikanischen Observatoriums George<br />
V. Coyne SJ („Ursprünge und Schöpfung“), <strong>de</strong>r<br />
Physiker Frank J. Tipler („Ein Designer-Universum!“),<br />
<strong>de</strong>r Physiker und Fernsehautor David<br />
Peat, <strong>de</strong>r die Metaphern von Gott als digitale Informationen<br />
erzeugen<strong>de</strong>m Supercomputer und<br />
Gott als Künstler mit Intention, Liebe und Mitgefühl<br />
für das Entstehen<strong>de</strong> kontrastiert („Schöpfer<br />
und Schöpfung“), und <strong>de</strong>r Raumfahrttechniker<br />
Ulrich Walter („...weil euer Gott im Himmel<br />
ist!“). Die Möglichkeit Gottes halten offen <strong>de</strong>r<br />
Bewusstseinsforscher Donald D. Hoffmann<br />
(„Kann man Gott abschreiben?“) sowie <strong>de</strong>r Wissenschaftsredakteur<br />
Ulf von Rauchhaupt („Die<br />
Gottesformel“). Ablehnend äußern sich die naturalistisch<br />
argumentieren<strong>de</strong>n Biologen Richard<br />
Dawkins („Die Unwahrscheinlichkeit Gottes“)<br />
und Franz Wuketits („Evolution: Schöpfung ohne<br />
Schöpfer“). Die übrigen 10 naturwissenschaftlichen<br />
Beiträge tragen zum Thema <strong>de</strong>s Ban<strong>de</strong>s<br />
kaum etwas bei, sind eher Füllmaterial. So<br />
schreibt z.B. Bill Napier über Riesenkometen,<br />
Rupert Sheldrake über seine Theorie <strong>de</strong>r morphogenetischen<br />
Fel<strong>de</strong>r, Ian Tattersall über die<br />
Evolutionsgeschichte <strong>de</strong>s homo sapiens usw. usw.<br />
Banal und kurzschlüssig ist <strong>de</strong>r Text <strong>de</strong>s Roman-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
187
LITERATUR & MEDIEN<br />
188<br />
ciers Douglas Preston („Steine werfen wir, keine<br />
Quarks“), <strong>de</strong>r die Existenz Gottes und seine völlige<br />
Unerkennbarkeit annimmt und dann meint:<br />
„Vielleicht konstruieren wir eines Tages einen<br />
Computer, <strong>de</strong>r Gott versteht“. Zur Sache kommen<br />
<strong>de</strong>r differenzieren<strong>de</strong> Beitrag <strong>de</strong>s englischen<br />
Philosophen Roger Tigg („Gottes Platz in <strong>de</strong>r<br />
Wissenschaft“), <strong>de</strong>r Kreatianisten ebenso wie<br />
Naturalisten und Wissenschaftsimperialisten kritisiert<br />
und auf <strong>de</strong>n größeren Reichtum <strong>de</strong>r mehrdimensionalen<br />
Realität verweist, sowie die drei<br />
theologischen Beiträge von Gerd Theißen („Evolution“)<br />
mit einigen Aspekten zu Schöpfungsglaube<br />
und Evolutionslehre, von Hans Küng<br />
(„Existiert Gott?“) und vom amerikanischen<br />
Theologen und Direktor <strong>de</strong>s Georgetown Center<br />
for the Study of Science and Religion John<br />
F.Haught („Ist das Universum wirklich alles?“),<br />
<strong>de</strong>r eine treffen<strong>de</strong> Kritik <strong>de</strong>s Naturalismus liefert<br />
und für eine geschichtete Erklärung plädiert.<br />
Lei<strong>de</strong>r fehlen ansonsten wirklich gründliche<br />
Beiträge zur Sache, die es in gut lesbarer Form<br />
von Philosophen (wie Georg Scherer, Bela Weissmahr<br />
o<strong>de</strong>r Hans Dieter Mutschler) und von Theologen<br />
(wie Karl Rahner, Karl Schmitz-Moormann,<br />
Ulrich Lüke, Ian Barbour, John Polkinghorne,<br />
Keith Ward o<strong>de</strong>r Philip Clayton) durchaus<br />
gibt. Der größte Mangel <strong>de</strong>s äußerlich attraktiv<br />
aufgemachten Ban<strong>de</strong>s liegt darin, dass nirgends<br />
die Struktur, <strong>de</strong>r Sinn und die weitreichen<strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung<br />
<strong>de</strong>s theologischen Schöpfungsbegriffs<br />
herausgearbeitet wer<strong>de</strong>n. Hans Kessler<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Menke, Karl-Heinz<br />
DDaass KKrriitteerriiuumm d<strong>de</strong>ess<br />
CChhrriissttsseeiinnss<br />
Grundriss <strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong>nlehre. – Verlag F. Pustet.<br />
2003. 240 S., € 24.90 (ISBN 3-7917-1729-4)<br />
Die Unzeitgemäßheit <strong>de</strong>s Wortes „Gna<strong>de</strong>“ ist<br />
offensichtlich. Sie hat ihren Grund nicht zuletzt<br />
in <strong>de</strong>r herkömmlichen gna<strong>de</strong>ntheologischen Reflexion<br />
selbst, sofern diese oftmals ohne <strong>de</strong>n Blick<br />
auf die Erfahrbarkeit <strong>de</strong>r gemeinten Wirklichkeit<br />
zu immer subtileren begrifflichen Distinktionen gelangte.<br />
Dem gegenüber will <strong>de</strong>r Bonner Dogmatiker<br />
Karl-Heinz Menke mit seinem „Grundriss <strong>de</strong>r<br />
Gna<strong>de</strong>nlehre“ wie<strong>de</strong>r die in das Zentrum <strong>de</strong>r christlichen<br />
Existenz verweisen<strong>de</strong> Sache <strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong>nlehre<br />
freilegen, in<strong>de</strong>m er sie unter <strong>de</strong>r Frage nach<br />
<strong>de</strong>m „Kriterium <strong>de</strong>s Christseins“ neu thematisiert.<br />
In <strong>de</strong>r Einführung seines Werkes (13-23) bietet<br />
er dazu einige grundsätzliche, an K. Rahner<br />
orientierte Hinweise. Der Begriff <strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong> bezeichnet<br />
<strong>de</strong>mnach nicht zuerst eine Wirkung im<br />
Menschen, son<strong>de</strong>rn das Geschehen <strong>de</strong>r Selbstmitteilung<br />
Gottes an <strong>de</strong>n Menschen in Jesus Christus.<br />
Dieses Christusereignis fin<strong>de</strong>t seine Universalisierung<br />
in <strong>de</strong>m vom Auferstan<strong>de</strong>nen gesandten<br />
Hl. Geist. Gna<strong>de</strong> ist <strong>de</strong>mnach da, „wo ein<br />
Mensch ... in <strong>de</strong>r Kraft <strong>de</strong>s Hl. Geistes Christus<br />
bzw. das Ereignis <strong>de</strong>r Inkarnation mitvollzieht bzw.<br />
darstellend abbil<strong>de</strong>t“ (19). Entsprechend geht es<br />
<strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong>nlehre um das von Christus ermöglichte<br />
„Gott-Mensch-Verhältnis als solches“. Dieses<br />
ist zugleich <strong>de</strong>r Gegenstand <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>m<br />
„Kriterium <strong>de</strong>s Christseins“. In seinem Werk geht<br />
M. dieser Frage in drei Kapiteln nach.<br />
Das erste Kapitel (24-75), das sich <strong>de</strong>r „Entstehung<br />
einer ‚Lehre‘ über die Gna<strong>de</strong>“ widmet,<br />
beginnt mit Augustinus, weil dieser die Gna<strong>de</strong>nlehre<br />
„nachhaltiger geprägt [hat] als die Heilige<br />
Schrift“ (24). Augustins Gna<strong>de</strong>nlehre wird in <strong>de</strong>ssen<br />
Biographie gleichsam verortet und auf ihre<br />
philosophischen Voraussetzungen und das damit<br />
implizierte Verständnis von Freiheit und Erlösung<br />
hin befragt. In Anschluß an G. Greshake wird<br />
diesem Ansatz sodann die Position <strong>de</strong>s „ersten<br />
‚Befreiungstheologen’“ (42) Pelagius, <strong>de</strong>r Freiheit<br />
und Gna<strong>de</strong> <strong>de</strong>zidiert geschichtlich zu <strong>de</strong>nken vermag,<br />
gegenübergestellt. Ein präzise orientieren<strong>de</strong>r<br />
Vergleich bei<strong>de</strong>r Ansätze anhand verschie<strong>de</strong>ner<br />
Grundthemen <strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong>nlehre, ein Ausblick<br />
auf die Lehrsysteme von Pelagianismus und Semipelagianismus<br />
sowie eine Diskussion <strong>de</strong>r Erklärungsmo<strong>de</strong>lle<br />
für <strong>de</strong>n Siegeszug <strong>de</strong>r augustinischen<br />
Gna<strong>de</strong>nlehre schließen das Kapitel ab.<br />
Das zweite Kapitel (76-155) führt die Linie<br />
„von <strong>de</strong>r augustinischen Gna<strong>de</strong>nlehre zur lutherischen<br />
Rechtfertigungslehre“ weiter. Ausgehend<br />
von <strong>de</strong>r noch ganz augustinisch geprägten Position<br />
<strong>de</strong>s Anselm von Canterbury leitet die Darstellung<br />
über <strong>de</strong>n Versuch <strong>de</strong>s Thomas v. Aquin, „in<br />
Treue zu Augustinus <strong>de</strong>n Augustinismus zu überwin<strong>de</strong>n“<br />
(88), hin zu Luthers Rechtfertigungslehre,<br />
wie dieser sie in <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit<br />
Wilhelm v. Ockham auf <strong>de</strong>r Grundlage seines<br />
persönlichen Erlebens formuliert hat. Die Positionen<br />
von Thomas und Luther erscheinen dabei<br />
als zwei verschie<strong>de</strong>ne „Denkformen“, die „mit<br />
ihrer jeweils unterschiedlichen Sichtweise im<br />
Recht“ sind, <strong>de</strong>ren Aussagen sich aber nicht einfach<br />
in die je an<strong>de</strong>re Denkform transferieren lassen<br />
(119). Die Antwort <strong>de</strong>s Konzils von Trient auf<br />
Luther wird orientiert an grundlegen<strong>de</strong>n Begriffen<br />
<strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong>nlehre dargestellt, wobei sich eine<br />
Art „Grunddifferenz zwischen lutherischer und<br />
römisch-katholischer Konfession ... zweifellos<br />
im Themenfeld von Evangelium und Gesetz,<br />
Glaube und Werken, von Rechtfertigung und Kirche“<br />
feststellen läßt (134). M. veranschaulicht<br />
dies biographisch an Ignatius v. Loyola und Luther.<br />
Das Kapitel schließt ab mit einem Blick in<br />
die weitere Geschichte <strong>de</strong>r protestantischen Rechtfertigungslehre<br />
und mit einer Reflexion auf die<br />
„kriterielle Funktion <strong>de</strong>r Rechtfertigungslehre“<br />
(151). Diese „bin<strong>de</strong>t die Gna<strong>de</strong>nlehre an das Christusereignis“<br />
und richtet <strong>de</strong>n Blick auf die Adressaten<br />
<strong>de</strong>r Selbstmitteilung Gottes (154).<br />
Das dritte Kapitel (156-207) behan<strong>de</strong>lt unter<br />
<strong>de</strong>m Titel „Gna<strong>de</strong>nlehre als Frage nach <strong>de</strong>m Kriterium<br />
<strong>de</strong>s Christseins“ zunächst unterschiedliche<br />
Versuche einer Verhältnisbestimmung von<br />
Gna<strong>de</strong> und menschlicher Freiheit in <strong>de</strong>n nachtri<strong>de</strong>ntinischen<br />
Streitigkeiten <strong>de</strong>r Barockscholastik,<br />
in <strong>de</strong>m sg. Zwei-Stockwerke-Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Neuthomismus,<br />
bei <strong>de</strong>ssen Kritikern A. Rosmini und M.<br />
Blon<strong>de</strong>l sowie bei H. <strong>de</strong> Lubac, K, Rahner und in<br />
<strong>de</strong>r Enzyklika „Humani Generis“. Den Ansatz<br />
zur Lösung <strong>de</strong>r in diesen Mo<strong>de</strong>llen erkennbaren<br />
Aporien sieht M. bei Th. Pröpper, <strong>de</strong>r das Verhältnis<br />
von Gna<strong>de</strong> und Freiheit nicht mehr als<br />
„Grund-Folge-Verhältnis“, son<strong>de</strong>rn als „Bestim-<br />
mungsverhältnis“ <strong>de</strong>nkt (182) und so zu einem<br />
„Zugleich von Gott und Mensch, von Gna<strong>de</strong> und<br />
Freiheit“ gelangt (183). In einem zweiten Schritt<br />
wird speziell die geschichtliche Vermitteltheit <strong>de</strong>r<br />
Gna<strong>de</strong> christologisch und ekklesiologisch reflektiert<br />
sowie mit Blick auf verschie<strong>de</strong>ne Konzepte<br />
christlicher Praxis und die darin angelegten Gefahren<br />
diskutiert. Der Bogen spannt sich hierbei<br />
von <strong>de</strong>r politischen und Befreiungstheologie über<br />
die integrierte Gemein<strong>de</strong>, das Opus Dei bis hin<br />
zur Tiefenpsychologie.<br />
Im Schlußwort (208-215) skizziert M. ausgehend<br />
von E. Levinas Phänomenologie <strong>de</strong>s „An<strong>de</strong>ren“<br />
und Th. Pröppers gna<strong>de</strong>ntheologischer<br />
Kategorie <strong>de</strong>s „Bestimmungsverhältnisses“ seinen<br />
eigenen Lösungsansatz mit Hilfe <strong>de</strong>s Gedankens<br />
<strong>de</strong>r „inklusiven Stellvertretung“ (214): Christus<br />
tritt im Rechtfertigungsgeschehen so an die<br />
Stelle <strong>de</strong>s Sün<strong>de</strong>rs, „dass er nicht nur <strong>de</strong>ssen Besserung,<br />
Umkehr o<strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rgutmachung evoziert...,<br />
son<strong>de</strong>rn die Bestimmung seiner Freiheit<br />
wird“. Diese Stellvertretung ist inklusiv, weil sie<br />
zugleich Sendung und Berufung <strong>de</strong>s Menschen in<br />
die konkrete Verantwortung ist. Das Kriterium<br />
wahren Christseins liegt entsprechend „in <strong>de</strong>r je<br />
größeren Bereitschaft zum Mitvollzug <strong>de</strong>r inkarnatorischen<br />
Bewegung von oben nach unten an<br />
die Stelle <strong>de</strong>s von Levinas bezeichneten An<strong>de</strong>ren“<br />
(213 f).<br />
Der vorliegen<strong>de</strong> „Grundriss <strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong>nlehre“<br />
bietet in anregen<strong>de</strong>r und gut lesbarer Form eine<br />
am aktuellen Diskussionsstand orientierte Einführung<br />
in die Thematik. Behan<strong>de</strong>lte Quellen und<br />
wissenschaftliche Literatur kommen dabei ausführlich<br />
zu Wort. Ein Literaturverzeichnis (217-<br />
232) eröffnet <strong>de</strong>n Weg zu weiteren Studien. Insbeson<strong>de</strong>re<br />
Religionslehrerinnen und -lehrern,<br />
die sich heute um eine Vermittlung dieses ebenso<br />
schwierigen wie notwendigen Themas bemühen,<br />
sei dieses Werk <strong>de</strong>shalb empfohlen.<br />
Norbert Witsch<br />
Laboa, Juan María (Hg.)<br />
MMöönncchhttuumm iinn OOsstt<br />
uunndd WWeesstt<br />
Historischer Atlas. Mit einem Vorwort von Karl<br />
Suso Frank OFM. Aus <strong>de</strong>m Italienischen übersetzt<br />
von Franziska Dörr. – Regensburg: Verlag<br />
Schnell & Steiner. 2003. 272 S. m. 457 überw.<br />
farb. Abb. u. zahlr. Karten. Großformat. € 49,80<br />
(ISBN 3-7954-1497-0)<br />
Das Mönchtum übt seit jeher eine große Faszination<br />
auf die Menschen aus. Die Gleichmäßigkeit<br />
<strong>de</strong>s alltäglichen Lebens-, Gebets- und Arbeitsrhythmus,<br />
die Ortsstabilität, aber auch die<br />
kulturschaffen<strong>de</strong> Kraft und die Spannung zwischen<br />
Weltflucht und Weltbewältigung ziehen<br />
sich durch alle Formen mönchischen Lebens hindurch.<br />
Der vorliegen<strong>de</strong> Historische Atlas, von einem<br />
internationalen Autorenteam unter Leitung<br />
<strong>de</strong>s spanischen Kirchenhistorikers Juan María<br />
Laboa zusammengestellt, geht <strong>de</strong>n regional und<br />
zeitlich unterschiedlichen Realisierungen <strong>de</strong>s<br />
Mönchtums nach.
Am Beginn steht dabei <strong>de</strong>r Blick auf außerchristliches<br />
Mönchtum. Zum Hinduismus, Buddhismus<br />
und Jainismus gehört das (zumin<strong>de</strong>st zeitweise)<br />
Leben als Mönch, wie sich bestimmte Formen<br />
<strong>de</strong>r Zurückgezogenheit auch bei <strong>de</strong>n antiken<br />
Philosophen, in Ägypten und im Manichäismus<br />
fin<strong>de</strong>n. Vom Alten Testament her wuchsen <strong>de</strong>m<br />
Mönchtum die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Wüste als Ort <strong>de</strong>r<br />
Gotteserfahrung und die von Jesus aufgegriffene<br />
asketische Bewegung zu. Zum wichtigen Anreger<br />
<strong>de</strong>s späteren Mönchtums wur<strong>de</strong> Origenes. In<br />
seiner Heimat Ägypten entstan<strong>de</strong>n dann die bei<strong>de</strong>n<br />
Grundformen <strong>de</strong>s Mönchtums, die Eremiten<br />
(Einsiedler) und Koinobiten (in Gemeinschaft<br />
Leben<strong>de</strong>). In <strong>de</strong>r Wüste zu leben, be<strong>de</strong>utete dabei<br />
die innere Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>m Dämonischen,<br />
die Bekämpfung <strong>de</strong>r eigenen Leiblichkeit<br />
durch radikale Askese und erste Formen eines<br />
Lebens unter einer gemeinsam befolgten Regel.<br />
Vorgestellt wer<strong>de</strong>n die uns heute teilweise skurril<br />
anmuten<strong>de</strong>n lokalen Ausprägungen, wie die syrischen<br />
Säulenheiligen o<strong>de</strong>r die Felsenklöster Kappadoziens.<br />
Für das europäische Mönchtum prägend wur<strong>de</strong>n<br />
Johannes Cassian, Hieronymus, Martin von<br />
Tours und die Mönche von Lérins. Von Augustinus<br />
ging das gemeinsame Leben <strong>de</strong>r Kleriker<br />
mit ihrem Bischof aus – Verbindung von Askese<br />
und Seelsorge. Ein Wan<strong>de</strong>rmönchtum kannte die<br />
ganz um Klöster zentrierte irische Kirche. Die<br />
Mönche und Nonnen, die von <strong>de</strong>n britischen Inseln<br />
auf <strong>de</strong>n Kontinent kamen, wur<strong>de</strong>n zu Trägern<br />
<strong>de</strong>r Christianisierung und Zivilisierung. Die<br />
Zusammenfassung langer Erfahrungen fin<strong>de</strong>t<br />
sich in <strong>de</strong>r Regel <strong>de</strong>s hl. Benedikt, die seit karolingischer<br />
Zeit zur Musterregel <strong>de</strong>s abendländischen<br />
Mönchtums wur<strong>de</strong>. Im 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
übernahmen die großen Klosterzentren die Führung.<br />
Von Cluny ging eine Akzentuierung <strong>de</strong>r Liturgie<br />
und <strong>de</strong>s Totenge<strong>de</strong>nkens aus. In Mittelitalien<br />
entstan<strong>de</strong>n mehrere Eremitenkongregationen.<br />
Im Orient hatte je<strong>de</strong> Region ihre eigenen klösterlichen<br />
Gebräuche. Basilius <strong>de</strong>r Große hatte mit<br />
seinen Regeln einen großen Einfluss, aber auch<br />
Athanasius, Pachomius und Theodor Studites.<br />
Die Mönche <strong>de</strong>s Ostens waren an <strong>de</strong>n großen<br />
theologischen Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen beteiligt,<br />
wie <strong>de</strong>m Bil<strong>de</strong>rstreit. Selbst unter islamischer<br />
Herrschaft konnten sich einige Klöster erhalten.<br />
Wie eine Zusammenfassung <strong>de</strong>s orientalischen<br />
Mönchtums wirken die nationalen Klöster in <strong>de</strong>r<br />
Mönchsrepublik Athos. Der Atlas stellt die mystisch-kontemplativen<br />
und organisatorischen Beson<strong>de</strong>rheiten<br />
<strong>de</strong>s bulgarischen, serbischen, armenischen,<br />
georgischen, italisch-griechischen, russischen,<br />
byzantinischen und rumänischen<br />
Mönchtums vor sowie be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Persönlichkeiten,<br />
wie Gregorios Palamos und Sergej von Radonesch.<br />
Gera<strong>de</strong> das orthodoxe Mönchtum hat<br />
über Bücher wie die „Philokalia“ und die „Aufrichtigen<br />
Erzählungen eines russischen Pilgers“<br />
und Institutionen wie die Starzen auch im Westen<br />
eine große Ausstrahlung erreicht.<br />
In einem letzten Teil wird <strong>de</strong>r gegenwärtige<br />
Stand <strong>de</strong>s Mönchtums vorgestellt. Dabei wer<strong>de</strong>n<br />
auch monastische Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s zweiten Jahrtausends<br />
eingeführt, wie die Kartäuser, die Zisterzienser,<br />
die Trappisten und eremitische Bewe-<br />
gungen. Heute gibt es ein nach wie vor einflussreiches,<br />
wenn auch zahlenmäßig abnehmen<strong>de</strong>s<br />
Mönchtum in <strong>de</strong>n orthodoxen Kirchen. In <strong>de</strong>r katholischen<br />
Kirche gibt es Mönche und Nonnen in<br />
allen Teilen <strong>de</strong>r Welt. Kleine Ansätze zum<br />
Mönchtum kennen auch die anglikanische Kirche<br />
und die Kirchen <strong>de</strong>r Reformation. Beachtenswert<br />
ist, dass Mönche sowohl <strong>de</strong>n ökumenischen als<br />
auch <strong>de</strong>n interreligiösen Dialog pflegen.<br />
Der mit 456 fast ausschließlich vierfarbigen<br />
Bil<strong>de</strong>rn illustrierte Band gibt somit einen ausgezeichneten<br />
Querschnitt durch die Geschichte <strong>de</strong>s<br />
Mönchtums. Er besticht durch die Vielfalt <strong>de</strong>r<br />
vorgestellten Traditionen. Lobenswert ist, dass<br />
beson<strong>de</strong>rs die reiche Tradition <strong>de</strong>r orthodoxen<br />
Kirchen so ausführlich zu Wort kommt. Scha<strong>de</strong>,<br />
dass die Geschichte im zweiten Jahrtausend vor<br />
allem für die Ostkirchen und weniger für das<br />
abendländische Mönchtum zu Wort kommt. Sechs<br />
Seiten für die Zisterzienser, die am Vorabend <strong>de</strong>r<br />
Reformation immerhin etwa 1500 Klöster umfassten,<br />
sind einfach zu wenig. Auch benediktinische<br />
Reformen <strong>de</strong>s Spätmittelalters, wie die<br />
Bursfel<strong>de</strong>r, Kastler o<strong>de</strong>r Melker Reform, kommen<br />
nicht vor. Trotz dieser Ungleichgewichte kann<br />
<strong>de</strong>r Band mit seinen knappen und präzisen Texten<br />
sowie <strong>de</strong>n brillanten Bil<strong>de</strong>rn als eine sehr gute<br />
Einführung in eine alte und manchmal fremdartig<br />
wirken<strong>de</strong> Lebensform nur empfohlen wer<strong>de</strong>n.<br />
Joachim Schmiedl<br />
Gruber, Siegfried<br />
22000000 JJaahhrree GGee-sscchhiicchhttee<br />
d<strong>de</strong>err KKiirrcchhee<br />
Verheißung und Realität. Hg. v. Dr. Josef Ruf. –<br />
Donauwörth: Auer Verlag. 2003. 152 S. m. 53<br />
Farbfolien, € 29.90 (ISBN 3-403-03677-4)<br />
Die Darstellung Grubers glie<strong>de</strong>rt sich in 17<br />
Kapitel, entfaltet in 75 Themen: vom „Anfang <strong>de</strong>r<br />
Kirche – Jesus Christus“ (15) bis zum 5.10.1995<br />
„75. Der Papst vor <strong>de</strong>r UNO“ (143). Die Überschriften<br />
zeigen, dass auch noch anno 2003 die<br />
Darstellung <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Gottesvolkes<br />
männlich dominiert ist. „28. Päpstin Johanna“ (67)<br />
und „33. Hil<strong>de</strong>gard von Bingen (1098-1179)“<br />
(75) sind bemerkenswerte Ausnahmen. Lt. <strong>de</strong>n<br />
Themenüberschriften machten (heilige) Männer<br />
geistlichen Stan<strong>de</strong>s Geschichte. Der pauschale<br />
Hinweis <strong>de</strong>s Autors in „Zur Konzeption“ (13 f.)<br />
auf nicht namentlich bekannte „Zeugen Jesu, die<br />
im Verborgenen und oft am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Gesellschaft,<br />
eben ‘an<strong>de</strong>rs als die Vielen’, seine<br />
Menschlichkeit und Liebe zu leben versuchten“<br />
(13), ist we<strong>de</strong>r einer schwachen Nicht-Heldin<br />
noch einem nichtkanonisierten Heiligen <strong>de</strong>s Gottesvolkes<br />
Trost. S. G. „will vor allem die wichtigsten<br />
Wen<strong>de</strong>marken <strong>de</strong>r Kirchengeschichte in<br />
<strong>de</strong>n Blick nehmen. Dabei orientiert er sich weithin<br />
an <strong>de</strong>n Lehrplänen <strong>de</strong>r mittleren und höheren<br />
Schulen (beson<strong>de</strong>rs in Bayern)“ (14). Ein legitimes<br />
Auswahlkriterium. Ist das auch ein versteckter<br />
Hinweis zur Zielsetzung <strong>de</strong>r Veröffentlichung:<br />
fachwissenschaftliches Repetitorium<br />
zur Unterrichtsvorbereitung? – Der einer<br />
kirchengeschichtlichen Publikation zugrun<strong>de</strong>liegen<strong>de</strong><br />
Kirchen-Begriff o<strong>de</strong>r die Option für eine<br />
bestimmte Metapher stellt entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Weichen<br />
<strong>de</strong>r Ausführungen. S. G. gibt keine klare Auskunft.<br />
Seine Ausführungen dazu sind mir zu vage.<br />
Einem Kapitel vorangestellt ist jeweils „Historische<br />
Perspektive“, allgemeine Ausführungen<br />
und Fragen zu einer Epoche. Es folgt dann in <strong>de</strong>r<br />
Regel „Zeitgeschichtlicher Rahmen“, getrennt in<br />
„Weltpolitik“ und „Christentum“. Wo en<strong>de</strong>t und<br />
beginnt die sog. Weltgeschichte und die Geschichte<br />
<strong>de</strong>s Volkes Gottes in <strong>de</strong>r Welt? 8 – für altern<strong>de</strong><br />
Augen schwer lesbare – Landkarten (aufgelistet<br />
11), die <strong>de</strong>m Her<strong>de</strong>r Atlas zur Kirchengeschichte<br />
von 1970 entnommen wur<strong>de</strong>n, verorten<br />
die dargestellten Geschehnisse eines Kapitels.<br />
Warum wer<strong>de</strong>n die Karten nicht auch auf<br />
Folien angeboten, um z.B. mit Hilfe <strong>de</strong>r Karten<br />
„Die christlichen Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s 1. und 2. Jahrhun<strong>de</strong>rts“<br />
(17) und „Kirchliche Organisation und<br />
antiorthodoxe Bewegungen in <strong>de</strong>r Kirche bis zur<br />
Mitte <strong>de</strong>s 5. Jh.“ (33) die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r heutigen<br />
Türkei für das Christentum zu ver<strong>de</strong>utlichen? Mit<br />
und an <strong>de</strong>n Folienkarten könnten die Schüler arbeiten,<br />
Fragen stellen, Folgerungen ziehen.<br />
– Die <strong>de</strong>m Buchtext beigegebenen 53 Folien<br />
(aufgelistet 8-10) sind vom Autor nicht didaktisch<br />
erschlossen. Welche Funktion haben die auch<br />
im Text in Kleinstformat abgedruckten Folien-<br />
Bil<strong>de</strong>r zu erfüllen? Welche Fragen und/o<strong>de</strong>r Antworten<br />
kann/soll das Bild bei <strong>de</strong>n Betrachtern<br />
auslösen? Der mit <strong>de</strong>n Folien Arbeiten<strong>de</strong> muss<br />
über große kunsthistorische Kenntnisse verfügen.<br />
Eine Recherche zu <strong>de</strong>n altbekannten Fragen<br />
– quis, quid, ubi, cur, quomodo, quando? – erleichtert<br />
nicht <strong>de</strong>r geführte „Bildnachweis und<br />
Copyright“ (151). Die untertitelten Folien illustrieren.<br />
In <strong>de</strong>r Regel visualisieren sie nicht. Auch<br />
in <strong>de</strong>r Kirchengeschichtsschreibung sagt ein Bild<br />
oft mehr als 1000 Worte. Viele Folien sind überflüssig,<br />
da wenig aussagekräftig – z.B. „6. Bildnis<br />
Konstantins I., d. Großen“ – o<strong>de</strong>r weil sie<br />
auch im Geschichtsunterricht verwen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n<br />
o<strong>de</strong>r zur Ansicht kommen könnten – z.B. „44.<br />
Zwischen Nationalismus und Kommunismus,<br />
Hitler und Stalin“. S. 121 erscheint singulär ganzseitig<br />
ein vielen Lesern nicht völlig unbekannter<br />
Mann mit Bart – ohne Bezug zu S. 120 „60. Geplante<br />
Arbeitersiedlung von Arnold Staub“. Eine<br />
Bildunterschrift ist nicht zu lesen. Warum erscheint<br />
K. Marx nicht auf Folie? Diese passte<br />
dann zu S. 118 „59. Texte aus <strong>de</strong>m ‘Kommunistischen<br />
Manifest’ und ‘Rerum novarum’“, die<br />
auszugsweise ohne genauere Quellenangabe zitiert<br />
wer<strong>de</strong>n. – Schwierigkeiten habe ich mit <strong>de</strong>n<br />
Kapitelüberschriften <strong>de</strong>s Autors – nicht nur mit<br />
<strong>de</strong>r 3.: „Christen bringen <strong>de</strong>m Abendland eine<br />
neue Kultur“ (31). Dem Leser müsste ein wechselseitiger,<br />
mühsamer und langsamer Verschmelzungs-<br />
o<strong>de</strong>r Verwandlungsprozess in <strong>de</strong>n ersten<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rten nach <strong>de</strong>r Zeitenwen<strong>de</strong> zu einer<br />
neuen kulturellen Lebensform signalisiert wer<strong>de</strong>n.<br />
– Der Autor fügt seinem darstellen<strong>de</strong>n Text<br />
neben <strong>de</strong>n Folienbil<strong>de</strong>rn passim auch einige etwas<br />
längere Quellentexte (aufgelistet 11) bei. Er<br />
ist um Kontrastierungen bemüht: z.B. „65. Texte<br />
aus <strong>de</strong>r Enzyklika ‘Mit brennen<strong>de</strong>r Sorge’ und<br />
<strong>de</strong>m Passauer <strong>Bistum</strong>sblatt 1940“ (128 f.). Sie<br />
können Fragen auslösen. Bei aller positiven Be-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
189
LITERATUR & MEDIEN<br />
190<br />
wertung <strong>de</strong>r angebotenen Textpassagen kann<br />
nicht übersehen wer<strong>de</strong>n, dass nicht nachgeprüft<br />
wer<strong>de</strong>n kann, woraus <strong>de</strong>r Autor zitiert. So z.B.<br />
auch in „56. Text zur Säkularisierung in Bayern<br />
aus <strong>de</strong>m Jahre 1803“ die „Anordnung <strong>de</strong>s Kurfürsten<br />
Maximilian III. Joseph von Bayern (1803)“<br />
(112). Auf welche Textausgaben beziehen sich<br />
die angegebenen Seitenzahlen bspw. auch bei <strong>de</strong>n<br />
Passagen aus „Mater et magistra“ und „Populorum<br />
progressio“ (124)? In „30. Romanik: St.<br />
Michael in Hil<strong>de</strong>sheim“ lese ich mir bislang Unbekanntes:<br />
„Der Bau bleibt <strong>de</strong>r irischen Wirklichkeit<br />
verhaftet, ganz im Gegensatz zur Gotik“<br />
(69). Der vorliegen<strong>de</strong> kirchengeschichtliche Aufriss<br />
von S. G. will“ die Entwicklung <strong>de</strong>r Kirche aus<br />
ökumenischer Perspektive“ (14) betrachten. Das ist<br />
eine nicht völlig eingelöste Absichtserklärung. Die<br />
Ausführungen im 11. Kapitel „En<strong>de</strong> und Anfang –<br />
Reformation und Reform“ (88) sind mager. Dürftig<br />
ist die Würdigung <strong>de</strong>r Theologie M. Luthers (92 f.).<br />
Die Lektüre von „47. Das Konzil von Trient“ (96,<br />
Fortsetzung 98) hätte ich mir schenken können. Es<br />
wird zu wenig tri<strong>de</strong>ntinische Theologie geboten.<br />
Das gleichen auch nicht „46. Texte aus <strong>de</strong>r Gemeinsamen<br />
Erklärung <strong>de</strong>r Kirchen zur Rechtfertigungslehre<br />
Luthers (1997 und 1999)“ (95) aus.<br />
Ich stoße mich an <strong>de</strong>r mangeln<strong>de</strong>n formalen<br />
Genauigkeit <strong>de</strong>r Publikation. So z.B.: Die Überschriften<br />
im Inhaltsverzeichnis (3-7) sind nicht<br />
immer mit <strong>de</strong>nen im folgen<strong>de</strong>n Textteil i<strong>de</strong>ntisch.<br />
Im 1. Kapitel fehlt <strong>de</strong>r 1. thematische Unterglie<strong>de</strong>rungspunkt.<br />
Fußnote 1 (15) fin<strong>de</strong>t keine Entsprechung<br />
im Text <strong>de</strong>s Autors. Auf fehlen<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r<br />
mangelhafte Quellenangaben <strong>de</strong>s Autors wies ich<br />
bereits hin. Störend ist <strong>de</strong>r Seitenumbruch. Um<br />
je<strong>de</strong>s Unterthema mit einer neuen Seite beginnen<br />
zu können, wird passim <strong>de</strong>r darstellen<strong>de</strong> Text von<br />
S. G. zwei Seiten weiter (z.B. 117-119) o<strong>de</strong>r auf<br />
<strong>de</strong>r vorausgegangenen Seite (z.B. 143-142) fortgesetzt.<br />
Ein „Verzeichnis“ <strong>de</strong>r Päpste (144-147)<br />
und eine tabellarische „Übersicht“ (148-150) <strong>de</strong>r<br />
Konzilsorte, <strong>de</strong>ren Zeit, Päpste, Kaiser, Hauptthemen<br />
<strong>de</strong>r Konzile und Weltgeschichtliche Ereignisse,<br />
(entnommen aus: A. Henze, Das große<br />
Konzilienbuch, Stuttgart 1962, 303-306), beschließen<br />
die Darstellung. Lei<strong>de</strong>r ist kein Verzeichnis<br />
<strong>de</strong>r vom Autor konsultierten fachwissenschaftlichen<br />
Literatur angegeben.<br />
Siegfried Gruber stellt aus einer positiven, nicht<br />
aber unkritischen Grundoption die Geschichte <strong>de</strong>r<br />
Weggemeinschaft ‘Kirche’ dar. Seine Sprache ist<br />
sachlich und knapp. Der Autorentext ist von Jahreszahlen<br />
weitgehend entlastet. Bernhard Jendorff<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
TTaasscchheennlleexxiikkoonn<br />
ÖÖkkuummeennee<br />
I. A. <strong>de</strong>r Arbeitsgemeinschaft<br />
Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) hg. v.<br />
Harald Uhl gemeinsam mit Athanasios Bas<strong>de</strong>kis,<br />
Dagmar Heller, Klaus Lefringhausen, Konrad Raiser,<br />
Barbara Rudolph, Dorothea Sattler, Hans-Jörg<br />
Urban und Klaus Peter Voß. Redaktion: Dirk Ra<strong>de</strong>macher<br />
und Winfried Rottenecker. – Pa<strong>de</strong>rborn:<br />
Bonifatius Verlag / Frankfurt: Verlag O. Lembeck.<br />
2003. 299 S., € 12.00 (ISBN 3-87476-420-6=Lembeck<br />
/ 3-89710-240-4=Bonifatius)<br />
In <strong>de</strong>r Dynamik zum Ökumenischen Kirchentag<br />
in Berlin entstan<strong>de</strong>n, informiert dieses Gemeinschaftswerk<br />
durchweg grundsoli<strong>de</strong> über zentrale<br />
Stichworte im ökumenischen Beziehungsfeld –<br />
von „Abendmahl“ bis „Zölibat“, „von afrikanisch<br />
initiierte Kirchen“ und „Aka<strong>de</strong>mien“ bis zu „Weltweiten<br />
Christlichen Gemeinschaften“ und „Zentralkomitee<br />
<strong>de</strong>r Deutschen Katholiken“. Weiterführen<strong>de</strong><br />
Literaturhinweise, ein übersichtliches<br />
Glossar am En<strong>de</strong> helfen zur Orientierung und Weiterarbeit.<br />
Keine Frage: So ist ein soli<strong>de</strong>s Instrument<br />
zur Erstinformation entstan<strong>de</strong>n, das <strong>de</strong>n<br />
gegenwärtigen Ertrag theologischer Forschung<br />
und <strong>de</strong>n Status quo christlicher Kirchen trefflich<br />
dokumentiert (und z.B. in <strong>de</strong>r Sek II gut zu nutzen<br />
ist). Freilich: schon hier stockt <strong>de</strong>r Atem <strong>de</strong>s<br />
Rezensenten. Denn von welchen Kirchen ist wie<br />
die Re<strong>de</strong>? Dominant ist zweifellos, typisch<br />
<strong>de</strong>utsch, das Zwiegespräch zwischen römischkatholisch<br />
und evangelisch-reformatorisch. Gewiss<br />
wird auch die Orthodoxie genannt und mit<br />
einem eigenen Stichwort bedacht, <strong>de</strong>nn sie ist in<br />
Deutschland nur eine Min<strong>de</strong>rheit. Aber verstehe<br />
ich „Ökumene“ weltweit, dann ist die Orthodoxie<br />
we<strong>de</strong>r nur ein Juniorpartner <strong>de</strong>r Westkirchen,<br />
noch bloß ein Stichwort unter Anglikanern,<br />
Baptisten und an<strong>de</strong>ren. Die Frage also, in<br />
welcher Perspektive welche Ökumene wie artikuliert<br />
und situiert wird, spielt merkwürdigerweise<br />
in <strong>de</strong>m ganzen Taschenlexikon systembil<strong>de</strong>nd<br />
überhaupt keine Rolle.<br />
Gewiss: es gibt ein eigenes Stichwort „Methodologie“,<br />
aber die Hermeneutik <strong>de</strong>s Ganzen bleibt<br />
(je<strong>de</strong>nfalls mir) völlig unklar – und entsprechend<br />
die Auswahl und Prioritätensetzung <strong>de</strong>r Stichworte.<br />
Warum z.B. fehlt Mystik? Warum ein<br />
Stichwort zu „Deutscher Evangelischer Kirchentag“,<br />
aber keines zu „Katholikentagen“? Wie steht<br />
es mit <strong>de</strong>m Bezug zu Ju<strong>de</strong>ntum und Islam? Sollen<br />
die asiatischen Religionen vorkommen o<strong>de</strong>r nicht?<br />
Über solche Grundsatzentscheidungen wür<strong>de</strong> ich<br />
als Leser gerne informiert, um dieses Taschenlexikon<br />
in Anlage und Durchführung besser würdigen<br />
und nutzen zu können. Zu fragen bleibt auch,<br />
ob ein harmonistischer Grundzug im Ganzen die<br />
Fe<strong>de</strong>r führt. Die Frage z.B. nach <strong>de</strong>n nichttheologischen<br />
Faktoren <strong>de</strong>r immer noch bestehen<strong>de</strong>n<br />
Trennung <strong>de</strong>r Kirchen, <strong>de</strong>r immer noch behin<strong>de</strong>rten<br />
ökumenischen Prozesse, die Fragen also nach<br />
Macht, Angst, I<strong>de</strong>ntität etc. kommen nicht vor.<br />
Welcher Vorbegriff von „Ökumene“ liegt eigentlich<br />
zugrun<strong>de</strong>: ein zwischenkirchliches, ein westliches<br />
Problemfeld seit Reformation und Gegenreformation?<br />
Aber selbst dann: warum kein Stichwort<br />
zu „Aufklärung“, „Menschenrechten“, zu<br />
„Ökumene“ im altkirchlichen Sinn – im Blick also<br />
auf die gesamte bewohnte Er<strong>de</strong>, ihre religiöse<br />
Sehnsucht, ihre religionsgeschichtliche und religionstheologische<br />
Vielfalt, ihre Einigungssehnsucht<br />
ad intra und ad extra (und darin nach <strong>de</strong>m<br />
Beitrag <strong>de</strong>r römischen Kirche und <strong>de</strong>r Kirchen <strong>de</strong>r<br />
Reformation)? Warum übrigens ein eigenes Stichwort<br />
„Trinität“, aber nicht „Christologie“?<br />
Gewiss: wir dürfen uns freuen, dass die „Charta<br />
Oecumenica“, auf <strong>de</strong>m Berliner Kirchentag einvernehmlich<br />
verabschie<strong>de</strong>t, schon hier ein Stichwort<br />
erhält. Aber nach welchen Proportionen<br />
wer<strong>de</strong>n welche Stichworte verteilt, welche vergessen<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Platzmangel geopfert? Fazit also:<br />
eine grundsoli<strong>de</strong> Handreichung, eine gute und<br />
hilfreiche Sammlung von Basisinformationen –<br />
gera<strong>de</strong> für Gemein<strong>de</strong>arbeit, Religionsunterricht<br />
o<strong>de</strong>r persönliche Vertiefung sehr zu empfehlen.<br />
Für die Weitung <strong>de</strong>s christlichen Gesamthorizontes<br />
freilich, für ein spannungsreiches, kreatives<br />
und auch provokatives Ökumene-Verständnis, das<br />
sich <strong>de</strong>n Lebens- und Überlebensfragen <strong>de</strong>r<br />
Menschheit, <strong>de</strong>r Welt im ganzen stellt, blieb eine<br />
Chance eher ungenutzt. Ob die Zeit dafür noch<br />
nicht reif ist, ob die inspirativen und konspirativen<br />
Kräfte noch nicht stark genug sind? Ob sich<br />
auch in diesem Taschenlexikon schon eine wachsen<strong>de</strong><br />
Kluft dokumentiert zwischen <strong>de</strong>nen, die im<br />
innerkirchlichen Sinn noch ökumenisch engagiert<br />
sind und sich an Theologien und Kirchenleitungen<br />
orientieren, und jenen an<strong>de</strong>ren, die ein<br />
nach- und überkirchliches Christentum im Dienst<br />
<strong>de</strong>r einen Welt suchen, bezeugen und erarbeiten?<br />
Warum bleibt, bei allem Respekt vor solch einer<br />
gemeinschaftlichen Arbeitsleistung und ihrem<br />
empfehlenswerten Produkt, doch eine Art Enttäuschung<br />
und Traurigkeit, weil „man(n)“ und<br />
„frau“ wie<strong>de</strong>r einmal unter sich blieb in ökumenisch<br />
engagierten und erfahrenen Fachzirkeln und<br />
Spezialgremien? Gewiss: dass solch ein Gemeinschaftswerk<br />
überhaupt entstehen konnte, ist lebhaft<br />
zu begrüßen; aber ist das Glas nun halbvoll<br />
o<strong>de</strong>r halbleer? Kommen diese westlich innerchristlichen<br />
Ökumene-Bestrebungen global und weltweit<br />
gesehen nicht irgendwie zu spät und immer<br />
nur hinterher? Lexikalisch wird dann abgelegt, was<br />
einvernehmlich in <strong>de</strong>n ökumenischen Gremien<br />
längst ausgemen<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n konnte. Aber die inspirieren<strong>de</strong>,<br />
die konspirieren<strong>de</strong> Kraft? Das Christologische<br />
„für euch“ und „für alle“?<br />
Gotthard Fuchs<br />
Gerber, Uwe/Höhmann, Peter/<br />
Jungnitsch, Reiner<br />
RReelliiggiioonn uunndd<br />
RReelliiggiioonnssuunntteerrrriicchhtt<br />
Untersuchung zur Religiosität Jugendlicher an<br />
berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schulen (Darmstädter Theologische<br />
Beiträge zu Gegenwartsfragen; Bd. 7). –<br />
Frankfurt u.a.: Verlag Peter Lang. 127 S. zahlr. Tabellen,<br />
€ 22.00 (ISBN 3-631-39247-8)<br />
Die Ausführungen <strong>de</strong>s vorliegen<strong>de</strong>n Ban<strong>de</strong>s<br />
basieren auf gesamt drei Befragungswellen unter<br />
Jugendlichen an berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schulen in <strong>de</strong>n<br />
Jahren 1998, 1999 und 2000, jeweils in <strong>de</strong>n Eingangsklassen<br />
<strong>de</strong>s Religionsunterrichts. Insgesamt<br />
kamen knapp 6.500 schriftlich beantwortete<br />
Fragebögen zurück. Damit hat die Untersuchung<br />
eine gute empirische Basis. Methodisch wur<strong>de</strong><br />
bei <strong>de</strong>r Auswertung gründlich gearbeitet, insbeson<strong>de</strong>re<br />
durch die Begleitung von Peter Höhmann,<br />
<strong>de</strong>r die Arbeitstelle für Sozialforschung<br />
und Statistik bei <strong>de</strong>r Kirchenverwaltung <strong>de</strong>r<br />
EKHN leitet.<br />
Der Beitrag von Uwe Gerber, <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r TH<br />
Darmstadt und <strong>de</strong>r Universität Basel lehrt, geht
von einer soziokulturellen Analyse <strong>de</strong>s Jugendalters<br />
aus. Die Verän<strong>de</strong>rung unserer Arbeitsund<br />
Produktionsstrukturen, <strong>de</strong>r Einfluss <strong>de</strong>r Informationstechnologie<br />
auf das Selbstverständnis<br />
junger Menschen, die Mo<strong>de</strong>rnisierungsschübe<br />
unserer Kultur führen bei Jugendlichen<br />
zu <strong>de</strong>m Streben, Erleichterung durch Orientierung,<br />
Events, Fun-Ereignisse und Begegnungsnähe<br />
zu wünschen. Nicht ein grundlegen<strong>de</strong>r Erlösungsgedanke<br />
steht hier im Vor<strong>de</strong>rgrund, son<strong>de</strong>rn<br />
<strong>de</strong>r Wunsch nach Reduktion <strong>de</strong>r Komplexität<br />
unseres Lebens im Luhmannschen Sinne.<br />
Von hier ist es dann nicht mehr weit zu einer<br />
wellnessorientierten Religiosität. Die herausfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong><br />
Fragestellung bleibt somit: Wo hat<br />
<strong>de</strong>r Religionsunterricht <strong>de</strong>n Ort, <strong>de</strong>r das offenbaren<strong>de</strong><br />
Heilshan<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>s biblischen Gottes zur<br />
Sprache bringt?<br />
Reiner Jungnitsch, katholischer Religionspädagoge,<br />
versucht eine religionspädagogische<br />
Grundlegung <strong>de</strong>s Faches in 10 Thesen. Das Beharren<br />
<strong>de</strong>s herkömmlichen Religionsunterrichts<br />
auf <strong>de</strong>r Heranbildung einer I<strong>de</strong>ntität wird in Frage<br />
gestellt, da sich heutige Jugendliche durch<br />
multiple I<strong>de</strong>ntitäten auszeichnen. Vielmehr wird<br />
<strong>de</strong>r Schwerpunkt auf die Schärfung <strong>de</strong>r Wahrnehmungs-<br />
und Deutungskompetenz bezüglich <strong>de</strong>r<br />
Mitwelt und <strong>de</strong>r eigenen Existenz gelegt. Es geht<br />
im weitesten Sinne um eine Lebensführungskompetenz<br />
auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>s christlichen Menschenbil<strong>de</strong>s.<br />
Bemerkenswert ist im Beitrag von Peter<br />
Höhmann <strong>de</strong>r Aufweis, dass religiöse und säkulare<br />
Weltbil<strong>de</strong>r sich nicht mehr – wie in <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />
– schroff gegenüberstehen, son<strong>de</strong>rn<br />
in unterschiedlicher Weise miteinan<strong>de</strong>r verwoben<br />
sind, so dass sich religiöse und nichtreligiöse<br />
Menschen zwar durch ihren Glauben, nicht<br />
aber in ihren Werten, die sie formulieren, unterschei<strong>de</strong>n.<br />
Der Reiz dieser Veröffentlichung liegt darin,<br />
dass auf soli<strong>de</strong>r empirischer Basis ein mehrdimensionaler<br />
Blick auf die Situation Jugendlicher<br />
geworfen wird und <strong>de</strong>r Nachweis gelingt, warum<br />
es lohnt, einen qualitätsvollen Religionsunterricht<br />
an berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schulen anzubieten.<br />
Andreas von Erdmann<br />
Kießling, Klaus<br />
ZZuurr eeiiggeenneenn SSttiimmmmee<br />
ffiinnd<strong>de</strong>enn<br />
Religiöses Lernen an berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schulen<br />
(Reihe Zeitzeichen; Bd. 16). – Ostfil<strong>de</strong>rn: Schwabenverlag<br />
2004. 524 S., € 30.00 (ISBN 3-7966-<br />
1152-4)<br />
Der Autor, stellvertreten<strong>de</strong>r Leiter <strong>de</strong>s Instituts<br />
für berufsorientierte Religionspädagogik an<br />
<strong>de</strong>r Uni Tübingen, legt mit dieser Habilitation eine<br />
Studie vor, die wegweisen<strong>de</strong>n Charakter in<br />
diesem Bereich haben wird. Dass diese Arbeit<br />
von „höchster Dringlichkeit“ ist, betont A. Biesinger<br />
in seinem außeror<strong>de</strong>ntlich loben<strong>de</strong>n Geleitwort,<br />
weil bislang „die religions-didaktische<br />
Theoriebildung zu <strong>de</strong>m in diesem bildungspoli-<br />
tisch wichtigen Rahmen stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n religiösen<br />
Lernen erschreckend unterrepräsentiert“ ist (23).<br />
Was K. hier darlegt, ist sowohl eine aktuelle<br />
qualitative Erhebung zum RU an berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Schulen (Teil 1), als auch eine kritische Sichtung<br />
<strong>de</strong>r empirischen Zugänge zum RU <strong>de</strong>r letzten 100<br />
Jahre sowie eine breitgefächerte didaktische Reflexion<br />
zur Theorie religiösen Lernens (Teil 2 ).<br />
Den Kern bil<strong>de</strong>t eine empirische Untersuchung in<br />
Form von 140 dokumentierten Gesprächen mit<br />
Religionslehrkräften und Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nster<br />
Berufsfel<strong>de</strong>r. Die thesenhaften<br />
Schlussfolgerungen aus diesen facettenreichen<br />
Statements wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Praktiker weniger überraschen<br />
als eher bestätigen und zur Genugtuung<br />
beitragen, dass dieses wenig beachtete kirchliche<br />
Arbeitsfeld nun einer eingehen<strong>de</strong>n wissenschaftlichen<br />
Prüfung unterzogen wur<strong>de</strong>.<br />
Im dritten Teil entwickelt K. Kriterien für <strong>de</strong>n<br />
interdisziplinären Dialog zwischen Pädagogik<br />
und Theologie, rückgreifend auf das vorausblicken<strong>de</strong><br />
Denken Karl Rahners. In stringenter Fortführung<br />
umreißt <strong>de</strong>r vierte Teil die Konturen einer<br />
zukunftsfähigen Religionsdidaktik, die „diakonisch-mystagogische<br />
Lern- und Lehrwege in<br />
einer kulturell pluralen Welt“ beschreibt. Darin<br />
geht es um theoretische wie unterrichtspraktische<br />
Antworten auf Fragen wie: „Wie spielt theologisch<br />
qualifiziertes religiöses Lernen mit beruflichem<br />
Lernen zusammen? Wie hängen Menschenwür<strong>de</strong><br />
– im Sinne <strong>de</strong>r Gottebenbildlichkeit<br />
– und Arbeit zusammen? Welche Rolle kommt<br />
Menschen-Bil<strong>de</strong>rn im Berufs- und Alltagsleben<br />
zu?“ (28).<br />
Die theoretischen Anteile dieser opulenten Arbeit<br />
(„ein Entwurf, <strong>de</strong>r seinesgleichen sucht“,<br />
Biesinger, 24) referieren und verarbeiten konstruktiv<br />
<strong>de</strong>n <strong>de</strong>rzeitigen Diskussionsstand, sind<br />
daher höchst informativ und dürfen wohl als Meilenstein<br />
für dieses religionspädagogische Teilgebiet<br />
gelten. Die Gesprächsprotokolle sind in ihrer<br />
gespiegelten Vitalität naturgemäß <strong>de</strong>r etwas „lesbarere“<br />
Part, wenngleich sie von einer geschärften<br />
Beobachtung und einer psychologisch-geschulten<br />
Analyse zeugen.<br />
Wenn die Differenziertheit und Breite <strong>de</strong>s<br />
Werkes <strong>de</strong>m Leser auch notgedrungen die investierte<br />
Mühe <strong>de</strong>s Autors umgekehrt anteilig abverlangen,<br />
so wird diese Mühe durch die vielerlei<br />
Einsichten und Impulse sattsam aufgewogen.<br />
Dem Praktiker „nützt“ das Buch zwar nur bedingt<br />
für <strong>de</strong>n nächsten Unterricht, doch wie <strong>de</strong>r<br />
RU in <strong>de</strong>r Berufsschule neu gesehen, begrün<strong>de</strong>t<br />
und gestaltet wer<strong>de</strong>n kann, dazu weist es gangbare<br />
Wege. Für die Unterrichten<strong>de</strong>n dürften zu<strong>de</strong>m<br />
beson<strong>de</strong>rs die Ausführungen über Schulseelsorge<br />
und Supervision von zentralem Interesse<br />
sein. Ein Buch also, das als wissenschaftlicher<br />
Beitrag ein „schmerzliches Forschungs<strong>de</strong>fizit“<br />
schließt, die allgemeine Fachdidaktik<br />
nachdrücklich auf das Stiefkind Berufsschule<br />
hinweist, zugleich eine praxisorientierte Reflexion<br />
ist, <strong>de</strong>r es um die engsten Beteiligten in diesem<br />
Prozess geht – und das alles in einer <strong>de</strong>nnoch<br />
zuträglichen Sprachgestalt darbringt.<br />
Reiner Jungnitsch<br />
Nowell, Irene<br />
EEvvaass ssttaarrkkee TTööcchhtteerr<br />
Frauen im Alten Testament. –<br />
Darmstadt: Primus Verlag. 2003. 184 S., € 24.90<br />
(ISBN 3-98678-479-X)<br />
Frauen in <strong>de</strong>r Bibel sind bevorzugter Gegenstand<br />
feministischer Theologie. Diese legt Frauenschicksale<br />
frei und erkennt in ihnen Gestaltungen<br />
weiblichen Lebens, die lange unter <strong>de</strong>n Sedimenten<br />
männlich dominierter Auslegungstradition<br />
verschüttet waren. Während die Literaturwissenschaftlerin<br />
Magda Motté dieses Thema in einem<br />
interdisziplinären Forschungsprojekt („Esthers<br />
Tränen, Judiths Tapferkeit“, Darmstadt 2003. vgl.<br />
Rezension in INFO 1/2004, S. 45) angeht und die<br />
Nachwirkungen biblischer Frauengestalten in <strong>de</strong>r<br />
mo<strong>de</strong>rnen Literatur untersucht, sind Zielsetzung<br />
und Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r hier anzuzeigen<strong>de</strong>n Veröffentlichung<br />
beschei<strong>de</strong>ner.<br />
Nowells Buch verdankt sein Zustan<strong>de</strong>kommen<br />
<strong>de</strong>r Lehrtätigkeit <strong>de</strong>r Verfasserin, die als Or<strong>de</strong>nsschwester<br />
die Ausbildung in einem Benediktinerinnenkloster<br />
leitet und auf eine reiche Erfahrung<br />
als Collegelehrerin, in <strong>de</strong>r Erwachsenenbildung<br />
und als Exerzitienleiterin zurückblickt. Deshalb<br />
richtet sich ihre Veröffentlichung an einen weiteren<br />
Leserkreis, <strong>de</strong>m sie auf eine anschaulich-erzählen<strong>de</strong><br />
Weise die Vielfalt biblischer Frauengestalten<br />
nahe bringen möchte: die „Geschichten<br />
von Königinnen und Sklavinnen, von Mör<strong>de</strong>rinnen<br />
wie von Frauen, die missbraucht wur<strong>de</strong>n, von<br />
Müttern und Ehefrauen, von Schwestern und verschwägerten<br />
Frauen“. Sie erkennt in ihnen Mo<strong>de</strong>lle,<br />
die Einblicke in an<strong>de</strong>re Lebensverhältnisse<br />
vor Augen führen, dadurch heutige Lebenssituationen<br />
<strong>de</strong>utlicher wer<strong>de</strong>n lassen und Sprachmuster<br />
bieten, Beziehungen zu Gott in Worte zu<br />
fassen.<br />
Der Geschichte Israels von <strong>de</strong>n Patriarchen bis<br />
zu <strong>de</strong>n Königen folgend, porträtiert die Autorin<br />
bekannte und weniger bekannte Namen: Frauen<br />
im Umkreis <strong>de</strong>r Patriarchen wie Sara, Hagar, Rebekka,<br />
Lea, Rahel, Dina und Tamar; Frauen zur<br />
Zeit <strong>de</strong>s Stämmebun<strong>de</strong>s wie Rahab, Debora und<br />
Delila; Frauen zur Zeit <strong>de</strong>r Königsherrschaft wie<br />
Rut, Batseba, Isebel, aber auch namenlos überlieferte<br />
Frauengestalten wie die Mäg<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Patriarchen,<br />
die Mutter <strong>de</strong>s Mose o<strong>de</strong>r Pharaos Tochter.<br />
Eva, das Urbild <strong>de</strong>r Frau im Alten Testament,<br />
fin<strong>de</strong>t entsprechend <strong>de</strong>r Entstehungszeit <strong>de</strong>r biblischen<br />
Schöpfungserzählung ihren Platz in <strong>de</strong>r<br />
Königszeit. Über historische Sachverhalte greift<br />
die Verfasserin auch hinaus, wenn sie unter „Evas<br />
starken Töchtern“ die Weisheit zur Sprache<br />
bringt, die in <strong>de</strong>n einschlägigen Büchern im Bild<br />
<strong>de</strong>r Frau verkörpert wird.<br />
Der Wert von Irene Nowells Buch liegt vor allem<br />
in <strong>de</strong>r didaktischen Aufbereitung <strong>de</strong>s komplexen<br />
Stoffes, <strong>de</strong>n sie acht Kapiteln zuordnet.<br />
Je<strong>de</strong>m Kapitel stellt sie die relevanten Bibelperikopen<br />
als Lektürevorschläge voran. Die Texte<br />
selbst wer<strong>de</strong>n nach einer kurzen Einführung unter<br />
einer thematischen Überschrift abgedruckt und so<br />
kommentiert, dass Schwerpunkte <strong>de</strong>s Inhalts <strong>de</strong>utlich<br />
und Verständnisschwierigkeiten geklärt wer-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
191
LITERATUR & MEDIEN<br />
192<br />
<strong>de</strong>n. Anstöße zur Glaubensvertiefung und zum religiösen<br />
Leben schließen die einzelnen Kapitel ab.<br />
Irene Nowell verfügt über ein breites Bibelwissen,<br />
erinnert an vergessene Texte und Themen<br />
und vermag überraschen<strong>de</strong> Querverbindungen zu<br />
ziehen. Doch bleibt ihre Art <strong>de</strong>r erzählen<strong>de</strong>n Vergegenwärtigung<br />
vergangenen Geschehens für <strong>de</strong>n<br />
an <strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnen Bibelwissenschaften geschulten<br />
Leser teilweise unbefriedigend. Das gilt auch<br />
für die Schule, weil Nowells Metho<strong>de</strong> zu Fragen<br />
und Diskussionen führt, in <strong>de</strong>nen sich auch <strong>de</strong>r<br />
erfahrene Lehrer leicht verhed<strong>de</strong>rt. Die Geschichten<br />
von <strong>de</strong>r Geburt und Rettung <strong>de</strong>s Mose<br />
beispielsweise sind keine Historie, son<strong>de</strong>rn fiktionale<br />
Erzählungen mit legen<strong>de</strong>nhaften Zügen,<br />
die auch nur als solche angemessen interpretiert<br />
wer<strong>de</strong>n können. Eine sorgfältigere Beachtung <strong>de</strong>r<br />
literarischen Gattungen und <strong>de</strong>r Entstehungsumstän<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Texte wäre aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>r Theologie<br />
und <strong>de</strong>r Schule notwendig. Allerdings hat Irene<br />
Nowell auch weniger das Fach Religion an <strong>de</strong>utschen<br />
Schulen im Blick. Ihr Anliegen ist allgemeiner:<br />
die Hinführung zur Bibellektüre und das<br />
Gespräch über biblische Frauenschicksale. Solches<br />
hat seinen Ort in biblischen Arbeitskreisen<br />
und Gesprächsrun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Erwachsenenbildung.<br />
Für die Leiter und Leiterinnen dieser Veranstaltungen<br />
kann das Buch als hilfreicher Leitfa<strong>de</strong>n<br />
empfohlen wer<strong>de</strong>n. Rüdiger Kal<strong>de</strong>wey<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Menn-Hilger, Christoph<br />
DDiiee 1100 GGeebboottee hheeuuttee<br />
Infos – Materialien – Provokationen.<br />
Arbeitsmaterialien für die Sekundarstufe.<br />
– Mühlheim / Ruhr: Verlag an <strong>de</strong>r Ruhr. 2003.<br />
82 S., ill. Mappe Format DIN A 4., € 18,60 (ISBN 3-<br />
86072-774-5)<br />
Der „Einband“ einfache Wellpappe, <strong>de</strong>r Inhalt<br />
82 in Schnellhefter zusammengefasste Blätter<br />
(Kopiervorlagen), einfach aber praktisch. Schließlich<br />
kommt es ja auf <strong>de</strong>n Inhalt an. Kann man<br />
aber zu <strong>de</strong>n in unzählige Variationen vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Unterrichtsentwürfen über die 10 Gebote einen<br />
neuen hinzufügen, ohne zu wie<strong>de</strong>rholen? Man<br />
kann. Gera<strong>de</strong> die gegenwärtige Situation – weitgehend<br />
fehlen<strong>de</strong> Bindung an eine Kirche, geringes<br />
religiöses Wissen, verän<strong>de</strong>rte soziale Verhältnisse<br />
und Lebensbedingungen, Medienvielfalt<br />
und technisierte Umwelt – for<strong>de</strong>rt entsprechen<strong>de</strong><br />
Reaktionen heraus. So ist klar, warum immer wie<strong>de</strong>r<br />
„alte Themen“ neu dargestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die hier vorliegen<strong>de</strong> Materialsammlung geht<br />
beson<strong>de</strong>rs konsequent vor. Allein 21 Arbeitsblätter<br />
stellen sich <strong>de</strong>r grundsätzlichen Frage nach<br />
<strong>de</strong>m Sinn o<strong>de</strong>r Unsinn von Verboten und Geboten.<br />
Zunächst wer<strong>de</strong>n, wie auch bei <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n<br />
Bearbeitung <strong>de</strong>r einzelnen Gebote, Informationen<br />
als Diskussionsgrundlage angeboten. Vorgegebene<br />
Ergebnisse wer<strong>de</strong>n peinlichst vermie<strong>de</strong>n.<br />
Die sollen die Schülerinnen und Schüler<br />
mit Hilfe <strong>de</strong>r bisweilen sogar provokativen Texte<br />
selbst ermitteln. Und die erarbeiteten Ergebnisse<br />
müssen nicht immer einheitlich o<strong>de</strong>r im Sinne<br />
herkömmlicher Moralauffassungen sein. Wohl<br />
aus diesen Grün<strong>de</strong>n hat <strong>de</strong>r Autor auf Lehrerbegleitmaterial<br />
verzichtet. Dies soll, aus <strong>de</strong>r Sicht<br />
<strong>de</strong>s Rezensenten, nicht negativ gesehen wer<strong>de</strong>n.<br />
Je<strong>de</strong>s einzelne Blatt stellt eine abgeschlossene<br />
Einheit dar. So kann <strong>de</strong>r Lehren<strong>de</strong> frei entschei<strong>de</strong>n,<br />
welche Themen in welcher Reihenfolge behan<strong>de</strong>lt<br />
wer<strong>de</strong>n sollen. Die nicht allzu umfangreichen<br />
Informationstexte, ergänzt durch bildliche<br />
Darstellungen, meist Zeichnungen, sind von<br />
hohem Informationswert und, wo es sich um neueste<br />
Erkenntnisse und Daten han<strong>de</strong>lt, höchst aktuell.<br />
Internet-Benutzung wird für die Unterrichtsgestaltung<br />
als selbstverständlich angesehen.<br />
Dies unterstreicht neben Hinweisen innerhalb<br />
<strong>de</strong>r Materialien eine ganze Seite mit Internetadressen.<br />
Interessant sind die Arbeitsaufgaben<br />
und Fragestellungen zu je<strong>de</strong>m Arbeitsblatt.<br />
Ganz bewusst fin<strong>de</strong>t da die konkrete Lebensumwelt<br />
unserer Jugendlichen ihren Platz. So ist<br />
es nicht verwun<strong>de</strong>rlich, wenn <strong>de</strong>n „Toten Hosen“<br />
(Song: De 10 Gebote) o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n „Prinzen“ (Song:<br />
Ich wär so gerne Millionär) je eine eigene Seite<br />
gewidmet wird. O<strong>de</strong>r, um ein an<strong>de</strong>res Beispiel zu<br />
nennen, wenn Steuerhinterziehung, unerlaubtes<br />
Kopieren von CD’s und Schwarzfahren im Zusammenhang<br />
mit Stehlen thematisiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Beim 6. Gebot steht nicht die Sexualität, son<strong>de</strong>rn<br />
Probleme in <strong>de</strong>r Partnerschaft im Vor<strong>de</strong>rgrund<br />
(Themen: Dann lasse ich mich eben schei<strong>de</strong>n; <strong>de</strong>r<br />
organisierte Seitensprung). Die Ausbeutung <strong>de</strong>r<br />
dritten Welt durch die erste Welt fin<strong>de</strong>t man auf<br />
<strong>de</strong>m Arbeitsblatt: Indirektes Töten. Dann überrascht<br />
auch nicht, wenn beim 4. Gebot auftaucht:<br />
Du sollst <strong>de</strong>ine Kin<strong>de</strong>r ehren.<br />
Die unkomplizierte, altersgerechte Sprache ist<br />
ein großer Vorteil für die Schülerinnen und Schüler.<br />
Vor allem aber die Art und Weise, wie die einzelnen<br />
Themen angegangen wer<strong>de</strong>n, kommen einem Religionspädagogen,<br />
<strong>de</strong>r mitten im mo<strong>de</strong>rnen Leben<br />
steht, sehr entgegen. Wer sich bisher mehr im konventionellen<br />
Raum bewegt hat, kann durch dieses<br />
Projekt wertvolle und hilfreiche Impulse erhalten<br />
in Richtung auf up-to-date-Sein. Helmut Bahr<br />
Bihler, Elsbeth<br />
SSyymmbboollkkrreeiiss HHaauuss ––<br />
SSttaaddtt –– SStteeiinnee<br />
Arbeitsblätter für die Grundschule (Reihe: Kreativer<br />
Religionsunterricht). – <strong>Limburg</strong>-Kevelaer: Lahn-<br />
Verlag. 2002. 87 S., ill., Format DIN A 4, € 13.90<br />
(ISBN 3-7840-3261-1)<br />
Im Anschluss an die fünf Bän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Reihe<br />
„Symbole <strong>de</strong>s Lebens – Symbole <strong>de</strong>s Glaubens“<br />
(1992 – 1997) und vier Arbeitshefte zu <strong>de</strong>n Symbolen<br />
„Licht“, „Weg“, „Baum/Kreuz“ und „Himmel<br />
und Er<strong>de</strong>“ stellt Elsbeth Bihler nun ein weiteres<br />
Heft mit konkreten Arbeitsblättern für <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
in <strong>de</strong>r Grundschule bereit. Diese<br />
Arbeitshilfe widmet sich verschie<strong>de</strong>nen Themen,<br />
die in Verbindung zu <strong>de</strong>n Symbolen „Haus“,<br />
„Stadt“ und „Stein“ stehen.<br />
Die ersten Arbeitsblätter stellen <strong>de</strong>n Stein als<br />
Gegenstand in seiner vielfältigen Erscheinungsweise<br />
vom Kieselstein, Felsen bis hin zum E<strong>de</strong>l-<br />
stein dar. Darauf folgen Arbeitsblätter, die sich<br />
damit beschäftigen, was man mit Steinen alles<br />
tun kann: Bauen, künstlerisch gestalten, aber auch<br />
zerstören. In diesen Bereich eingearbeitet ist das<br />
Symbol „Mauer“. Die weiteren Arbeitsblätter erklären<br />
die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Steins in seiner Symbolik<br />
als Schuldstein und als Ge<strong>de</strong>nkstein und greifen<br />
die biblische Thematik <strong>de</strong>r „lebendigen Steine“<br />
auf, aus <strong>de</strong>nen das Haus Gottes, die Kirche<br />
gebaut ist. Nach <strong>de</strong>m Symbol Stein beschäftigen<br />
sich Arbeitsblätter mit <strong>de</strong>r Symbolik <strong>de</strong>s Hauses<br />
und menschlicher Behausungen, darin eingebettet<br />
das Thema Gastfreundschaft und „Haus Gottes“.<br />
Dem Haus schließt sich das Symbol Tür und<br />
Tor an, auch mit seiner adventlichen Dimension.<br />
Die abschließen<strong>de</strong>n Arbeitsblätter beinhalten <strong>de</strong>n<br />
Symbolkreis „Stadt/Dorf“.<br />
Das Arbeitsheft besteht wie<strong>de</strong>rum aus <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n<br />
Hauptteilen Arbeitsblätter (mit Geschichten,<br />
Rätseln, Bastel- und Ausmalvorlagen, biblischen<br />
Texten, Lie<strong>de</strong>rn usw.) und Kommentarteil (Gestaltungsvorschläge,<br />
Anregungen und Erläuterungen<br />
zu je<strong>de</strong>m Arbeitsblatt). Hier fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Leser u.a.<br />
Stilleübungen, Bastelvorschläge, I<strong>de</strong>en zur Verklanglichung,<br />
Spiele, Tänze usw. Die Arbeitsblätter<br />
sind für <strong>de</strong>n Religionsunterricht geeignet<br />
und können auch in <strong>de</strong>r Katechese und Gemein<strong>de</strong>arbeit<br />
eingesetzt wer<strong>de</strong>n. Das Heft bietet eine<br />
umfassen<strong>de</strong> Materialsammlung zur Erschließung<br />
<strong>de</strong>r genannten Symbole im Religionsunterricht<br />
<strong>de</strong>r Grundschule. Durch die große thematische<br />
Bandbreite sind die Einsatzmöglichkeiten sehr<br />
zahlreich. Die Materialien sind durchgehend<br />
übersichtlich und ansprechend gestaltet.<br />
Der Kommentar bietet vielfältige methodischdidaktische<br />
Anregungen, die einen abwechslungsreichen,<br />
lebensnahen, ganzheitlichen und fächerübergreifen<strong>de</strong>n<br />
Religionsunterricht im Blick haben.<br />
Die Bereitstellung <strong>de</strong>s Heftes im Religionspädagogischen<br />
Amt o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Schulbibliothek<br />
ist wünschenswert. Gabriele Hastrich<br />
Bihler, Elsbeth<br />
SSyymmbboollkkrreeiiss WWüüssttee ––<br />
WWaasssseerr –– BBoooott<br />
Arbeitsblätter für die Grundschule. – <strong>Limburg</strong>-Kevelaer:<br />
Lahn-Verlag. 2003. 80 S., ill., Format: DIN A 4,<br />
€ 12.90 (ISBN 3-7840-3263-X)<br />
Diese Arbeitshilfe widmet sich verschie<strong>de</strong>nen<br />
Themen, die in Verbindung zu folgen<strong>de</strong>n Symbolen<br />
stehen:<br />
– Symbolkreis Wüste<br />
– Symbol Wasser: Tropfen/Regen, Eis/Schnee,<br />
Quelle, Fluss, See/Teich/Meer, Brunnen, Waschen/Reinigung,<br />
Taufe,<br />
– Symbolkreis Boot/Schiff.<br />
Die ersten Arbeitsblätter beschreiben die Wüste<br />
in ihren Gefahren und Chancen sowie das Leben<br />
mit und in <strong>de</strong>r Wüste. Biblische Wüstengeschichten<br />
und Wüstenerfahrungen wer<strong>de</strong>n im<br />
weiteren Verlauf auf diesem Hintergrund vorgestellt.<br />
Das Bild vom Wasser in <strong>de</strong>r Wüste und<br />
<strong>de</strong>r Oase bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Übergang zum Symbol „Wasser“.<br />
Die Erscheinungsweisen <strong>de</strong>s Wassers als
Tropfen, Quelle, Fluss, See und Meer, Eis und<br />
Schnee wer<strong>de</strong>n beschrieben und seine Lebensnotwendigkeit<br />
vorgestellt bis hin zum Symbol<br />
<strong>de</strong>s Brunnens und <strong>de</strong>m Sakrament <strong>de</strong>r Taufe. Die<br />
letzten Arbeitsblätter widmen sich <strong>de</strong>n Symbolen<br />
„Boot“ und „Schiff“ in ihrer realen Erscheinungsweise<br />
und ihrer Be<strong>de</strong>utung für unser Leben<br />
und unseren Glauben.<br />
Das Arbeitsheft besteht wie<strong>de</strong>rum aus <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n<br />
Hauptteilen „Arbeitsblätter“ (mit Geschichten,<br />
Rätseln, Bastel- und Ausmalvorlagen, Lie<strong>de</strong>rn<br />
usw.) und „Kommentar“ (Gestaltungsvorschläge,<br />
Anregungen und Erläuterungen zu je<strong>de</strong>m<br />
Arbeitsblatt).<br />
Die Auswahl <strong>de</strong>r biblischen Texte und <strong>de</strong>r<br />
Themen geschah nach <strong>de</strong>n Richtlinien für Katholischen<br />
Religionsunterricht an Grundschulen. Die<br />
Arbeitsblätter sind für <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
geeignet und können auch in <strong>de</strong>r Katechese und<br />
Gemein<strong>de</strong>arbeit eingesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Das Heft bietet eine umfassen<strong>de</strong> Materialsammlung<br />
zur Erschließung <strong>de</strong>r genannten Symbole<br />
im Religionsunterricht <strong>de</strong>r Grundschule.<br />
Durch die große thematische Bandbreite sind die<br />
Einsatzmöglichkeiten sehr zahlreich. Die Materialien<br />
sind durchgehend übersichtlich und ansprechend<br />
gestaltet. Der Kommentar bietet vielfältige<br />
methodisch-didaktische Anregungen, die einen<br />
abwechslungsreichen, lebensnahen, ganzheitlichen<br />
und fächerübergreifen<strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
im Blick haben.Die Bereitstellung <strong>de</strong>s Heftes<br />
im Religionspädagogischen Amt o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Schulbibliothek<br />
ist empfehlenswert. Gabriele Hastrich<br />
MMuusseeeenn iinn HHeesssseenn<br />
Ein Führer zu 350 hessischen<br />
Museen. Hg. Hessischer Museumsverband<br />
e.V., Kassel. – Kassel: Verlag Winfried<br />
Jenior, Kassel. 2004. 272 S., ill., € 9.80 (ISBN<br />
3-934377-71-8)<br />
Für Planung und Durchführung von Klassenfahrten,<br />
Wan<strong>de</strong>rungen und Ausflügen nach Nah<br />
und Fern unentbehrlich ist <strong>de</strong>r neue hessische<br />
Museumsführer, <strong>de</strong>r Informationen zu 350 hessischen<br />
Museen auf 272 Seiten bereithält. Er hält<br />
damit umfangreiches Material über die breite<br />
Museumslandschaft Hessens vor. Die Leserin<br />
und <strong>de</strong>r Leser erhalten einen Überblick über Heimat-<br />
und Regionalmuseen, städtische und staatliche<br />
Sammlungen, Erlebnis- und Spezialmuseen,<br />
Ge<strong>de</strong>nkstätten und museal genutzte Klöster, Burgen<br />
und Schlösser.<br />
Die Glie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Ban<strong>de</strong>s ist rasch zu durchschauen:<br />
Die Museen sind nach ihren Standorten<br />
geglie<strong>de</strong>rt und innerhalb ihrer Standorte, z.B.<br />
Frankfurt und Kassel, in alphabetischer Reihenfolge<br />
ihrer Namen notiert.<br />
Zu je<strong>de</strong>m Museum ist ein kenntnisreicher Text<br />
verfasst, <strong>de</strong>r gute Auskünfte über die Bestän<strong>de</strong>,<br />
<strong>de</strong>ren Eigenheiten und Highlights nennt. Wesentlich<br />
ist jedoch für <strong>de</strong>n Gebrauchswert <strong>de</strong>s Buches<br />
auch die genauen Informationen zu <strong>de</strong>n aufgeführten<br />
Museen, wie Adresse, Telefon- und Faxnummer,<br />
E-Mail und Internetadresse, sowie die<br />
Öffnungszeiten.<br />
Die Beschreibung <strong>de</strong>r Sammlungsbestän<strong>de</strong> ist<br />
<strong>de</strong>m Zweck <strong>de</strong>s Buches gemäß angemessen, informativ<br />
und nutzer- und besucherfreundlich. Die<br />
Sprache <strong>de</strong>s Buches ist verständlich und einfühlsam.<br />
Was auffällt, ist, dass alle Museen vom Heimatmuseum<br />
bis zum kunsthistorischen Museum<br />
von Weltrang gleich behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n. Der Museumsführer<br />
versagt sich Wertungen, stellt aber auch<br />
immer einige wenige Objekte <strong>de</strong>r Sammlung heraus.<br />
Die vielen guten Abbildungen machen Lust,<br />
bald eines <strong>de</strong>r aufgeführten Museen zu besuchen.<br />
Auf einer Karte von Nordhessen und einer von Südhessen<br />
sind die Standorte <strong>de</strong>r Museen zur Orientierung<br />
gut vermerkt. Ein Sach- und Personenregister<br />
hilft bei <strong>de</strong>r Erschließung <strong>de</strong>s Museumsführers.<br />
Der Band ist zwar kein Museumsführer im engen<br />
Sinne, wohl aber ein Kompendium <strong>de</strong>r Hessischen<br />
Museumslandschaft, die für viele <strong>de</strong>r Leserinnen<br />
und Leser <strong>de</strong>s Buches überraschend breit gefächert<br />
ist. Das Buch ist ein schöner Anreiz, mit einer<br />
Schulklasse im Religionsunterricht (Stichwort<br />
Kirche und Kloster, 10 Einträge), im Kunstunterricht<br />
(Stichwort Kunst, 60 Einträge) o<strong>de</strong>r im Sachkun<strong>de</strong>unterricht<br />
(fast alle Einträge) einen Museumsbesuch<br />
zu wagen. Mit seinen vielen sachgemäßen<br />
Informationen macht es <strong>de</strong>n Weg, über die eigenen<br />
Schulgrenzen hinaus neue Lernorte zu ent<strong>de</strong>cken,<br />
leicht. Der Blick in das Buch macht <strong>de</strong>n<br />
Reichtum <strong>de</strong>r hessischen Museumslandschaft bewusst<br />
und lässt erkennen, dass auch im ländlichen<br />
Raum immer ein Museum vor <strong>de</strong>r Schultür liegt.<br />
Der Besuch <strong>de</strong>r Hessischen Museen, das Lernen<br />
vor Ort und mit an<strong>de</strong>ren Inhalten wird für alle Beteiligten<br />
von hohem Gewinn sein und insbeson<strong>de</strong>re<br />
von Schülerinnen und Schülern dankbar aufgenommen<br />
wer<strong>de</strong>n. Meistens können Führerinnen<br />
und Führer in <strong>de</strong>n Museen telefonisch gebucht wer<strong>de</strong>n.<br />
Für die Lehrerin und <strong>de</strong>n Lehrer empfiehlt sich<br />
freilich vorab immer eine Stippvisite. Wie im Vorwort<br />
<strong>de</strong>s Buches zu lesen, fin<strong>de</strong>t sich eine aktuelle<br />
Ergänzung zu <strong>de</strong>n Angaben im Buche auf <strong>de</strong>r Internet-Seite<br />
<strong>de</strong>s Hessischen Museumsverban<strong>de</strong>s unter<br />
www.museen-in-hessen.<strong>de</strong>. Also dann, kundig machen<br />
und ins Museum gehen! August Heuser<br />
Hagemann, Waltraud/<br />
Hirsch, Elke<br />
LLeebbeenn mmiitt d<strong>de</strong>err<br />
ZZuukkuunnfftt iimm RRüücckkeenn<br />
Ju<strong>de</strong>n und Christen erinnern sich. Primarstufe<br />
und Sekundarstufe I (Lernen kreativ). – Düsseldorf:<br />
Patmos Verlag. 2003. 122 S., ill., 2 farb. Overhead-Folien,<br />
Format DIN A 4. € 19.90 (ISBN 3-<br />
491-73442-8)<br />
Theodor W. Adornos pädagogische Prämisse,<br />
dass <strong>de</strong>r Anfang aller Erziehung die Verhin<strong>de</strong>rung<br />
eines neuen Auschwitz sein müsse, weist in<br />
einer Zeit, in <strong>de</strong>r Menschen immer häufiger auf<br />
Grund <strong>de</strong>r Reiz- und Informationsüberflutung<br />
zum Schutzschild <strong>de</strong>s Vergessens greifen, auf die<br />
biblisch-jüdische Erinnerungskultur zurück, in<br />
<strong>de</strong>ren Tradition sich auch das Christentum immer<br />
wie<strong>de</strong>r erinnern lassen muss, dass es ja selbst<br />
eine „Erinnerungs- und Erzählgemeinschaft“<br />
(J. B. Metz) ist. Erinnern ist lebensnotwenig, Gedächtnisverlust<br />
hat unabsehbare psychische und<br />
geschichtliche Folgen. Erinnern ist ein aktiver<br />
und dynamischer Prozess, <strong>de</strong>r für <strong>de</strong>n Einzelnen<br />
und für Gruppen Sinn und Kontinuität stiftet,<br />
Hoffnung weckt und Kraft zum Um<strong>de</strong>nken und zur<br />
Neugestaltung <strong>de</strong>s täglichen Lebens gibt, also<br />
überhaupt erst lebenswerte Zukunft eröffnet. Die<br />
bei<strong>de</strong>n Autorinnen <strong>de</strong>s vorliegen<strong>de</strong>n Ban<strong>de</strong>s betonen<br />
daher <strong>de</strong>n wesentlichen Beitrag, <strong>de</strong>n die jüdisch-christliche<br />
Erinnerungskultur in schulpädagogischen<br />
Zusammenhängen leisten kann, um <strong>de</strong>m<br />
„Immer-so-weiter“ <strong>de</strong>r letztlich lebensbedrohen<strong>de</strong>n,<br />
scheinbar sachzwanghaften ökonomischen<br />
und politischen Plausibilitäten entgegenzuwirken.<br />
In sechs unterrichtlichen Themenkreisen wird<br />
die Struktur und Konkretion <strong>de</strong>s Erinnerns für<br />
Schüler/-innen <strong>de</strong>r Klassen 1 bis 6 praktisch ausgebreitet:<br />
„Die Unterrichtsgefüge 1 bis 3 lassen<br />
die Kin<strong>de</strong>r und Jugendlichen die Beziehung zum<br />
lebendigen Ju<strong>de</strong>ntum als eine grundlegen<strong>de</strong> und<br />
unabdingbare Konsequenz aus <strong>de</strong>n Leid- und Gewalterfahrungen<br />
während <strong>de</strong>r NS-Zeit erleben.“(5)<br />
Themenkreis 1 rückt dabei <strong>de</strong>n Gott Israels und<br />
<strong>de</strong>n Gott <strong>de</strong>r Christen (Ich bin da, wo Menschen<br />
leben) in <strong>de</strong>n Blickpunkt, Themenkreis 2 (Zelte<br />
Gottes unter <strong>de</strong>n Menschen) ist letztlich auf die<br />
Achtung aller Gotteshäuser, in <strong>de</strong>nen gebetet, gelernt<br />
und gefeiert wird, ausgerichtet, Unterrichtsgefüge<br />
3 (Oasen <strong>de</strong>r Zeit) nimmt Impulse <strong>de</strong>s Sabbats<br />
für die Gestaltung und Heiligung <strong>de</strong>s christlichen<br />
Sonntags auf. Der Themenkreis 4 „Leben<br />
im Angesicht <strong>de</strong>r Vergangenheit“ will „durch erinnern<strong>de</strong>s<br />
Lesen und Erzählen, durch Betrachten<br />
von Bil<strong>de</strong>rn, I<strong>de</strong>ntifizieren mit <strong>de</strong>n han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n<br />
Personen und empathisches Nacherleben von Risikosituationen“<br />
(5) <strong>de</strong>n Schüler/-innen die Lei<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r jüdischen Opfer während <strong>de</strong>r NS-Zeit vergegenwärtigen<br />
und so Perspektiven für ihr weiteres<br />
Han<strong>de</strong>ln gewinnen helfen. Die Themenkreise 5<br />
und 6 (Es darf kein Gras darüber wachsen; Zeig <strong>de</strong>in<br />
Gesicht) schließlich sollen für die Schüler/-innen<br />
Handlungsfel<strong>de</strong>r in ihrem näheren und weiteren<br />
gesellschaftlichen Umfeld sichtbar wer<strong>de</strong>n lassen<br />
(z.B. Gewalt und Rassismus an <strong>de</strong>r eigenen Schule).<br />
Durch sämtliche unterrichtlichen Zusammenhänge<br />
läuft eine Erzählung mit <strong>de</strong>m Titel „Eine beson<strong>de</strong>re<br />
Freundschaft“, die mit <strong>de</strong>n Schüler/-innen<br />
auch als Ganzschrift gelesen wer<strong>de</strong>n kann. Für alle<br />
Themenkreise gilt, dass das Kernthema „Erinnern“<br />
immer einen beson<strong>de</strong>ren Stellenwert hat, und zwar<br />
im hebräischen Sinne, mit einer Offenheit für zukünftige<br />
Entwicklungen nach vorne. Weiterhin for<strong>de</strong>rt<br />
diese Erinnerung zum Dialog zwischen <strong>de</strong>n Religionen<br />
auf und berücksichtigt die persönlichen Erfahrungen<br />
<strong>de</strong>r Schüler/-innen im Lebensraum Schule<br />
und an<strong>de</strong>rswo. Darüber hinaus geben die Autorinnen<br />
eine Reihe praktischer Anregungen auch für<br />
schulpastorale (z.B. Gottesdienste) und projektorientierte,<br />
fächerübergreifen<strong>de</strong> Aktivitäten.<br />
Das vorliegen<strong>de</strong> Lernmo<strong>de</strong>ll ist somit nicht nur<br />
im Blick auf die in fast allen Lehrplänen vorgeschriebene<br />
Beschäftigung mit <strong>de</strong>m Ju<strong>de</strong>ntum<br />
eine vorbildliche Anleitung, sie setzt auch Maßstäbe<br />
hinsichtlich zeitgemäßer schul- und religionspädagogischer<br />
Erfor<strong>de</strong>rnisse und Initiativen.<br />
Daher: Uneingeschränkt empfehlenswert!<br />
Martin Musch-Himmerich<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
193
INFOS & AKTUELLES<br />
194<br />
Zur Person<br />
Ordinariatsrat Hans Wie<strong>de</strong>nbauer 75<br />
Seinen 75. Geburtstag feierte am<br />
24. Juli Ordinariatsrat Hans Wie<strong>de</strong>nbauer.<br />
Der gebürtige Frankfurter<br />
wur<strong>de</strong> am 13. März 1955 in <strong>Limburg</strong><br />
zum Priester geweiht. Seine Kaplansjahre<br />
führten ihn nach Siershahn, Königstein<br />
und Flörsheim St. Gallus.<br />
Von 1963 bis 1969 war Hans Wie<strong>de</strong>nbauer<br />
Pfarrvikar <strong>de</strong>r neu errichteten<br />
Pfarrei St. Josef in Flörsheim, von<br />
1969 bis November 1976 <strong>de</strong>ren erster<br />
Pfarrer. Von 1970 bis 1976 war er zugleich<br />
Bezirks<strong>de</strong>kan im Bezirk Main-<br />
Taunus. In dieser Zeit hat er zusammen<br />
mit <strong>de</strong>m verstorbenen Rektor<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
August Groß, Wicker, das Amt für<br />
Katholische Religionspädagogik Main-<br />
Taunus in seinem Pfarrzentrum aufund<br />
ausgebaut. Von 1976 bis 1981<br />
war er Pfarrer <strong>de</strong>r Pfarrei St. Josef in<br />
Frankfurt-Höchst und in dieser Zeit<br />
zugleich Betriebsseelsorger für die<br />
Mitarbeiter <strong>de</strong>r Höchst AG.<br />
Am 1. August 1980 übernahm<br />
Hans Wie<strong>de</strong>nbauer – in <strong>de</strong>r Nachfolge<br />
von Ordinariatsrat Walter Kinkel –<br />
zunächst nebenamtlich, ab 1. Februar<br />
1981 hauptamtlich die Leitung <strong>de</strong>s<br />
Amtes für Katholische Religionspädagogik<br />
in Frankfurt am Main, die er<br />
bis Juli 1993 innehatte. Diese Berufung<br />
war verbun<strong>de</strong>n mit seiner Ernen-<br />
Katholische Religion in <strong>de</strong>r Weiter-Bildung<br />
Zum aktuellen Konzept <strong>de</strong>s Pädagogischen Zentrums<br />
Nachqualifizierung im Pädagogischen<br />
Zentrum „weiter-gebil<strong>de</strong>t“<br />
Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet<br />
das Pädagogische Zentrum in Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
im<br />
Auftrag <strong>de</strong>r Bistümer<br />
im Lan<strong>de</strong> Hes-<br />
sen (<strong>Limburg</strong>, Mainz<br />
und Fulda) und mit<br />
Zustimmung <strong>de</strong>s HessischenKultusministeriums<br />
die Möglichkeit,<br />
im Rahmen einerberufsbegleiten<strong>de</strong>nWeiterbildungsmaßnahme<br />
die fachliche<br />
Qualifikation<br />
zur Erteilung <strong>de</strong>s katholischenReligionsunterrichts<br />
an Primar-<br />
und Sekundarschulennachzuholen.<br />
Orientiert am jeweils<br />
konkreten Bedarf, bereiten die<br />
Lehrgänge interessierte Kollegen und<br />
Kolleginnen auf die Staatliche Abschlussprüfung<br />
zum Erwerb <strong>de</strong>r Fakultas<br />
im Fach Katholische Religionslehre<br />
vor. Diese ist wie<strong>de</strong>rum fachliche Voraussetzung<br />
für die dann reguläre Ver-<br />
Kultusministerium<br />
Hessen<br />
<strong>Bistum</strong><br />
Mainz<br />
Amt für<br />
Lehrerausbildung<br />
Weiterbildung<br />
im Pädagogischen Zentrum<br />
<strong>Bistum</strong><br />
<strong>Limburg</strong><br />
<strong>Bistum</strong><br />
Fulda<br />
leihung <strong>de</strong>r Missio canonica durch das<br />
jeweilige <strong>Bistum</strong>.<br />
nung zum Ordinariatsrat. In dieser<br />
Zeit war er zugleich Vertreter <strong>de</strong>s Bischofs<br />
bei <strong>de</strong>n mündlichen Prüfungen<br />
für das Fach Katholische Religion an<br />
<strong>de</strong>r Johann Wolfgang Goethe-Universität,<br />
Frankfurt am Main.<br />
1993 wur<strong>de</strong> er als Vizeoffizial an<br />
das Bischöfliche Offizialat nach <strong>Limburg</strong><br />
berufen, nach<strong>de</strong>m er bereits seit<br />
1982 Diözesanrichter gewesen ist.<br />
Diese Aufgabe versah Wie<strong>de</strong>nbauer<br />
bis Oktober 2001 und blieb darüber<br />
hinaus bis Juli 2003 weiterhin als Diözesanrichter<br />
am Offizialat tätig.<br />
Paul Platzbecker<br />
Bedarfsorientierung meint in diesem<br />
Zusammenhang aber auch, die speziellen<br />
Wünsche, Möglichkeiten und Grenzen<br />
<strong>de</strong>r Teilnehmen<strong>de</strong>n wie die <strong>de</strong>r beteiligten<br />
Institutionen wahrzunehmen<br />
und konzeptionell<br />
zu berücksichtigen.<br />
Aus diesem<br />
Grund ist <strong>de</strong>r Be-<br />
reich <strong>de</strong>r Weiterbildung<br />
auf <strong>de</strong>r<br />
Basis gründlicher<br />
Evaluationen abgeschlossenerKurse<br />
nunmehr revidiert<br />
wor<strong>de</strong>n. D.h.<br />
unter <strong>de</strong>r Fe<strong>de</strong>rführung<br />
<strong>de</strong>s PädagogischenZentrums<br />
wur<strong>de</strong> in<br />
Absprache mit <strong>de</strong>n<br />
Schulabteilungen<br />
<strong>de</strong>r drei Bistümer<br />
das Konzept einer<br />
gemeinsam getragenen berufsbegleiten<strong>de</strong>n<br />
Nachqualifizierung im Fach
Katholische Religion vorangetrieben<br />
und u.a. unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r Erfor<strong>de</strong>rnisse<br />
<strong>de</strong>r Hessischen Lehrpläne<br />
weiterentwickelt. Dieser vergleichbare<br />
Mo<strong>de</strong>lle berücksichtigen<strong>de</strong> Revisionsprozess<br />
suchte zugleich die enge Zusammenarbeit<br />
mit <strong>de</strong>n unterstützen<strong>de</strong>n<br />
staatlichen Behör<strong>de</strong>n, vor allem <strong>de</strong>m<br />
hessischen Amt für Lehrerausbildung<br />
(AfL; bisher: HeLP). Denn für die „res<br />
mixta“ <strong>de</strong>s Religionsunterrichts gibt<br />
dieses nicht nur die allgemeinen, formalen<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen an <strong>de</strong>n Erwerb<br />
<strong>de</strong>r staatlichen Fakultas vor, son<strong>de</strong>rn<br />
unterstützt die Maßnahmen auch in finanzieller<br />
Hinsicht.<br />
Erste Erfahrungen mit <strong>de</strong>r überarbeiteten<br />
Form <strong>de</strong>r Weiterbildung liegen<br />
mit <strong>de</strong>m zu En<strong>de</strong> gehen<strong>de</strong>n Kurs für die<br />
Grundschule (Grundschuldidaktikkurs,<br />
kurz: GDK) nun vor. Nach ihrer kritischen<br />
Auswertung sind sie u.a. maßgebend<br />
für <strong>de</strong>n im Herbst diesen Jahres<br />
beginnen<strong>de</strong>n Kurs für die weiterführen<strong>de</strong>n<br />
Schulen (kurz: WKR). Anlass<br />
genug, das revidierte Konzept <strong>de</strong>r Weiterbildung<br />
im Folgen<strong>de</strong>n zu skizzieren.<br />
Warum ist Weiterbildung nötig?<br />
Der Religionsunterricht an hessischen<br />
Schulen wird zumeist von Kolleginnen<br />
und Kollegen erteilt, die in Studium<br />
und Referendariat für diese anspruchsvolle<br />
Tätigkeit gut ausgebil<strong>de</strong>t<br />
wur<strong>de</strong>n. Dies ist <strong>de</strong>r gewünschte und angestrebte<br />
Regelfall. Doch lei<strong>de</strong>r ist dieser<br />
nicht in ausreichen<strong>de</strong>r Zahl eingetreten,<br />
um <strong>de</strong>n <strong>de</strong>rzeitigen und künftigen<br />
Bedarf an Religionsunterricht zu<br />
<strong>de</strong>cken. Dies gilt für die unterschiedlichen<br />
Schulformen wie für die Regionen<br />
Hessens natürlich in unterschiedlichem<br />
Maße. Verlässliche Zahlen, die<br />
hier ein mittel- und langfristiges Planen<br />
erlaubten, sind lei<strong>de</strong>r nur schwer zu eruieren.<br />
Sicher scheint, dass allgemein die<br />
Neueinstellungen hinter <strong>de</strong>r Zahl <strong>de</strong>r in<br />
<strong>de</strong>n Ruhestand versetzten Religionslehrer<br />
zurückbleiben. Das nahe liegen<strong>de</strong><br />
Werben um Studienanfänger vermag da<br />
lei<strong>de</strong>r kaum Entlastung zu versprechen.<br />
Zugleich wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Primarstufe<br />
sowie in <strong>de</strong>n Sekundarstufen nicht we-<br />
10. WKR-Kurs Foto: Paul Platzbecker<br />
nige Lehrer/-innen gesetz- und verordnungswidrig<br />
mit <strong>de</strong>r Erteilung von Religionsunterricht<br />
von ihren jeweiligen<br />
Schulleitungen beauftragt, ohne dass<br />
sie dafür hinreichend qualifiziert sind<br />
und ohne dass sie eine kirchliche Unterrichtserlaubnis<br />
erhalten haben. Dieser<br />
von manchen Schulleitungen ge<strong>de</strong>ckte<br />
und gedul<strong>de</strong>te Missstand kann<br />
durch die Möglichkeit <strong>de</strong>r Nachqualifizierung<br />
im Einzelfall behoben wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Teilnehmen<strong>de</strong>n, ihre Voraussetzungen<br />
und Motive<br />
Gemäß <strong>de</strong>r Ausschreibung im Amtsblatt<br />
<strong>de</strong>s Hessischen Kultusministeriums<br />
ist die Teilnahme an zwei Bedingungen<br />
geknüpft: Die eine ist <strong>de</strong>r Erwerb<br />
<strong>de</strong>r „1. und 2. Staatsprüfung für<br />
das Lehramt an Schulen in Hessen“, die<br />
an<strong>de</strong>re das „Bestehen eines unbefristeten<br />
Beschäftigungsverhältnisses o<strong>de</strong>r<br />
eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses<br />
mit Übernahmegarantie in<br />
<strong>de</strong>n hessischen Schuldienst“ 1 .<br />
Dies erinnert <strong>de</strong>utlich an das biblische<br />
Motto: „Wer hat, <strong>de</strong>m wird gegeben“.<br />
Das PZ bietet <strong>de</strong>nnoch einen Weg<br />
auch für weitere, beson<strong>de</strong>rs engagierte<br />
Kollegen und Kolleginnen, zu diesem<br />
staatlicherseits klar <strong>de</strong>finierten Kreis<br />
dazu zu stoßen. In freilich begrenzter<br />
Zahl können sich auch solche Interessierte<br />
in kirchlichen Diensten o<strong>de</strong>r mit<br />
befristeter Anstellung an einer staatli-<br />
chen Schule als ´kirchliche Teilnehmer´<br />
2 nachqualifizieren. Nach bestan<strong>de</strong>ner<br />
Abschlussprüfung erhalten sie<br />
ein <strong>de</strong>m staatlichen Zeugnis gleichwertiges<br />
kirchliches Zertifikat, das dann<br />
auf Antrag in ersteres gleichsam ´umgetauscht´<br />
wer<strong>de</strong>n kann. 3<br />
Die Öffnung <strong>de</strong>s potentiellen Teilnehmerkreises<br />
ist insofern sinnvoll, als<br />
staatliche und kirchliche Teilnehmer<br />
ein gleichermaßen erstaunliches Engagement<br />
mitbringen, das ihrer Entscheidung<br />
zur Weiterbildung vorausgeht<br />
und diese mit trägt. Denn Nach-Qualifizierung<br />
heißt ja auch: An<strong>de</strong>rs als Studienanfänger<br />
kennen die Interessenten<br />
die Schul- und Unterrichtswirklichkeit<br />
bereits zu Genüge. Sie wissen, auf was<br />
sie sich einlassen. Wieso investieren sie<br />
aber Zeit – und dies sind immerhin ca.<br />
190 Stun<strong>de</strong>n im GDK und ca. 290<br />
Stun<strong>de</strong>n im WKR bei lediglich 1 o<strong>de</strong>r 2<br />
Stun<strong>de</strong>n Unterrichtsentlastung pro Woche<br />
4 – kostbare Zeit, die ihnen in ihrem<br />
zunehmend belasten<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Alltagsgeschäft mehr und mehr an<strong>de</strong>rswo<br />
abverlangt wird? Woher die Energie,<br />
die doch möglicherweise bereits<br />
durch die zahlreichen aktuellen Reformanstrengungen<br />
im hessischen Schulwesen<br />
absorbiert wird? Wieso sich einer<br />
Maßnahme anschließen, die doch<br />
angesichts <strong>de</strong>s zunehmen<strong>de</strong>n Relevanzverlustes<br />
<strong>de</strong>s christlichen Glaubens –<br />
auch in unseren Schulen – „kontrafaktisch“<br />
und damit keinesfalls „erfolg-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
195
INFOS & AKTUELLES<br />
196<br />
von links: Dieter Wagner, <strong>Bistum</strong> Fulda; Dr. Klaus Dorn, Universität Marburg Foto: Paul Platzbecker<br />
versprechend“ ist? Wenn laut ´PISA´<br />
die Alphabetisierung unserer Kin<strong>de</strong>r<br />
schon schwierig genug ist, warum dann<br />
noch die Alphabetisierung in einer religiösen<br />
Sprache, die ohnehin von immer<br />
weniger Menschen verstan<strong>de</strong>n wird?<br />
Sicher spielt hier <strong>de</strong>r verständliche<br />
Wunsch, seine beruflichen Chancen zu<br />
steigern, eine legitime Rolle – und dies<br />
ist im Einzelfall auch greifbar –, doch allein<br />
ist dies kein ausreichen<strong>de</strong>s Movens,<br />
sich <strong>de</strong>n nicht zu unterschätzen<strong>de</strong>n Belastungen<br />
einer Ausbildung zu unterziehen,<br />
die eben <strong>de</strong>n u.U. in voller Stun<strong>de</strong>nzahl<br />
ausgeübten Beruf „begleitet“.<br />
Vor allem die im Glauben Engagierten<br />
machen mit<br />
Sabine Tischbein, Direktorin <strong>de</strong>s Pädagogischen<br />
Zentrums, verweist hier auf<br />
die Erfahrung mit <strong>de</strong>n vergangenen und<br />
<strong>de</strong>rzeitigen Kursen, die vielmehr zeige,<br />
dass Umfang und Zielsetzung <strong>de</strong>r Kurse<br />
eo ipso zu einer Auswahl von engagierten<br />
Menschen führt, für die tatsächlich –<br />
wie es im Syno<strong>de</strong>nbeschluss heißt – Religiosität<br />
und Glaube nicht nur „mögliche<br />
Gegenstän<strong>de</strong>“ eines anvisierten Unterrichts<br />
sind, son<strong>de</strong>rn die bereits ihren<br />
eigenen Standort bestimmen und die<br />
Motivation tragen. So sind die Interessenten<br />
in <strong>de</strong>n meisten Fällen bereits in<br />
ihren Gemein<strong>de</strong>n tätig und versuchen<br />
mitunter, auch pastorale Anliegen in ihren<br />
Schulen zu tragen. Mit <strong>de</strong>r Anmel-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
dung zur Nachqualifizierung haben sie<br />
für sich selbst, für ihre Schüler, ihre Kollegen<br />
und auch für ihre Familien eine<br />
weitere, verbindliche Positionsbestimmung<br />
vorgenommen, die im Zeitalter<br />
wohlfeiler Beliebigkeiten einerseits und<br />
schärfer wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Kosten-Nutzen-Kalkulationen<br />
an<strong>de</strong>rerseits alles an<strong>de</strong>re als<br />
selbstverständlich ist<br />
Gera<strong>de</strong> weil sie die schulische Wirklichkeit<br />
in ihren Möglichkeiten, Grenzen<br />
und Wi<strong>de</strong>rsprüchen kennen, teilen viele<br />
im Zuge <strong>de</strong>r Funktionalisierungs- und<br />
Optimierungsprozesse, die schulische<br />
Bildung mehr und mehr prägen, die<br />
christliche Auffassung von „Bildung“ in<br />
einem weiteren und stets offenen Ver-<br />
ständnis. M.a.W. sie, die ihre konkreten<br />
Schüler ja schon vor Augen haben, wollen<br />
die Re<strong>de</strong> von <strong>de</strong>ren ganzheitlicher<br />
Erziehung offenbar radikal ernst nehmen<br />
und sie für die häufig vernachlässigte Dimension<br />
<strong>de</strong>r Religion öffnen, sensibilisieren,<br />
ihre humanisieren<strong>de</strong>, heilen<strong>de</strong><br />
und wirklichkeitsverän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Kraft freilegen<br />
und erfahrbar machen. Offenbar<br />
bewegt sie gera<strong>de</strong> in unserer Zeit die<br />
Faszination lebendiger Religion, mit <strong>de</strong>r<br />
sie am immer wichtiger wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Lernort Religionsunterricht nun an<strong>de</strong>re<br />
bewegen und <strong>de</strong>ren Leben för<strong>de</strong>rn und<br />
bereichern möchten. Kurzum: das sich in<br />
<strong>de</strong>n Bildungsauftrag integrieren<strong>de</strong>, diesen<br />
gleichzeitig (kritisch) überbieten<strong>de</strong><br />
und letztlich unverrechenbare „Mehr“<br />
<strong>de</strong>s Glaubens steht ganz offensichtlich in<br />
Zusammenhang mit <strong>de</strong>m „Mehr“ an Belastungen,<br />
das sich die Kollegen und<br />
Kolleginnen gemeinsam zutrauen. Eine<br />
Haltung, die darüber hinaus in kurzer<br />
Zeit eine ganz beson<strong>de</strong>re und recht intensive<br />
Gruppendynamik erzeugt, in <strong>de</strong>r<br />
sich unterschiedlichste Charaktere aus<br />
<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nsten Schulformen kennen<br />
und anerkennen lernen und sich in<br />
zunehmen<strong>de</strong>m Maße im Verlauf <strong>de</strong>s<br />
Kurses nicht nur bei <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>de</strong>r Abschlussprüfungen gegenseitig unterstützen,<br />
wie die Erfahrung <strong>de</strong>s vergangenen<br />
WKR u.a. auch für die als Referentin<br />
fungieren<strong>de</strong> Sabine Tischbein eindrucksvoll<br />
gezeigt hat.<br />
stehend: Dr. Anton van Hooff, <strong>Bistum</strong> Mainz Foto: Paul Platzbecker
So sind es Begriffe wie das „Gruppengefühl“,<br />
das „Lernklima“, die allgemeine<br />
„Offenheit und Kooperationsbereitschaft<br />
zwischen Teilnehmern und<br />
Referenten“ etc., die in <strong>de</strong>r Auswertung<br />
<strong>de</strong>s noch aktuellen GDK immer wie<strong>de</strong>r<br />
als beson<strong>de</strong>rs positive Aspekte hervorgehoben<br />
wur<strong>de</strong>n. Dass „Wort und Tat<br />
meist im Einklang“ waren, fasst eine<br />
Teilnehmerin ihre diesbezüglichen Eindrücke<br />
zusammen.<br />
Ohne die Zustimmung <strong>de</strong>r Schulleitung<br />
geht es nicht<br />
Führt eine solche Motivation zur<br />
Entscheidung für eine Weiterbildung, so<br />
muss die jeweilige Schulleitung in<strong>de</strong>s<br />
zustimmen. 5 Dadurch ist gewährleistet,<br />
dass <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n Teilnehmern „subjektiv“<br />
empfun<strong>de</strong>nen Notwendigkeit katholischen<br />
Religionsunterrichtes immer<br />
auch ein „objektiv“ festgestellter Bedarf<br />
entspricht und sie bei ihrem Ansinnen<br />
mit <strong>de</strong>r für sie wichtigen Unterstützung<br />
ihrer Schulleitung rechnen dürfen.<br />
Wie ist aber <strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>ren Erwartungshaltung,<br />
<strong>de</strong>n Möglichkeiten<br />
und Grenzen <strong>de</strong>r Interessenten und Interessentinnen<br />
konzeptionell zu begegnen?<br />
Wie kann ihnen, die sie ein<br />
Großteil ihrer persönlichen Ressourcen<br />
bereits in Beruf und Familie einbringen,<br />
<strong>de</strong>r Schritt zu einer weiteren<br />
Belastung ermöglicht und erleichtert<br />
wer<strong>de</strong>n?<br />
Die Herausfor<strong>de</strong>rung und die konzeptionelle<br />
Antwort<br />
Die Konzeptionierung <strong>de</strong>r Weiterbildung<br />
sieht sich damit gleich mehrfachen<br />
Herausfor<strong>de</strong>rungen ausgesetzt.<br />
Denn wie können zu<strong>de</strong>m Lehrer und<br />
Lehrerinnen aus ganz Hessen in einem<br />
zentralen Lehrgang über eine längere<br />
Perio<strong>de</strong> hinweg geschult wer<strong>de</strong>n - und<br />
dies in Zeiten sich verknappen<strong>de</strong>r Mittel?<br />
Wie kann dieser eine Kurs die beson<strong>de</strong>ren<br />
„Prägungen“ und Anliegen<br />
<strong>de</strong>r einzelnen Bistümer berücksichtigen?<br />
Wie können Kollegen und Kolleginnen<br />
in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Schulformen<br />
<strong>de</strong>r weiterführen<strong>de</strong>n Schulen zu-<br />
Burghard Förster, <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> im Gespräch mit Kursteilnehmerinnen Foto: Paul Platzbecker<br />
sammen und <strong>de</strong>nnoch für sich selbst jeweils<br />
effektiv nachqualifiziert wer<strong>de</strong>n?<br />
Wie kann bei einer berufsbegleiten<strong>de</strong>n<br />
Maßnahme <strong>de</strong>r Grad zwischen Überfor<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>r Teilnehmer einerseits<br />
und <strong>de</strong>n fachlich notwendigen Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
an<strong>de</strong>rerseits gefun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n?<br />
Und schließlich: Wie kann die Balance<br />
zwischen fachwissenschaftlicher<br />
Theorie und unterrichtspraktischer Übersetzung<br />
gehalten wer<strong>de</strong>n?<br />
Bei <strong>de</strong>r Beantwortung dieser Fragen<br />
konnte im Zuge <strong>de</strong>r Weiterentwicklung<br />
<strong>de</strong>s Konzeptes auf die Erfahrungen <strong>de</strong>s<br />
Pädagogischen Zentrums mit <strong>de</strong>m<br />
Schwerpunkt seiner Arbeit – <strong>de</strong>n Fortbildungsveranstaltungenverschie<strong>de</strong>nster<br />
Art – zurückgegriffen wer<strong>de</strong>n. Denn<br />
einerseits resultiert aus dieser mehr als<br />
zwei Jahrzehnte währen<strong>de</strong>n Institutsarbeit<br />
eine Vertrautheit mit <strong>de</strong>r schulischen<br />
Wirklichkeit, <strong>de</strong>ren Belange und<br />
<strong>de</strong>rzeitigen Verän<strong>de</strong>rungen das Pädagogische<br />
Zentrum orientierend begleitet.<br />
An<strong>de</strong>rerseits versteht sich das Institut<br />
seit jeher als Nahtstelle zu Forschung<br />
und Wissenschaft, <strong>de</strong>ren Interessen<br />
und Ergebnisse es in die Schulwelt<br />
übersetzen hilft.<br />
Sinnvolle Metho<strong>de</strong>nvernetzung<br />
Wie nun sieht das überarbeitete<br />
Konzept <strong>de</strong>r Weiterbildung aus? In einem<br />
ersten Herangehen lässt es sich als<br />
Kombination dreier bekannter Metho-<br />
<strong>de</strong>n allgemeiner Erwachsenenbildung<br />
beschreiben:<br />
• <strong>de</strong>m Präsenzlernen,<br />
• <strong>de</strong>m Fernstudium,<br />
• <strong>de</strong>m e-Learning.<br />
Es wur<strong>de</strong> versucht, diese Metho<strong>de</strong>n<br />
so miteinan<strong>de</strong>r zu verknüpfen, dass die<br />
jeweiligen Nachteile ausgeglichen und<br />
die jeweiligen Stärken gebün<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n.<br />
So stellt sich bei reinem Präsenzlernen<br />
bekanntlich die Frage, wie die<br />
Zeiten zwischen <strong>de</strong>n zentralen Präsenzphasen<br />
effektiv genutzt wer<strong>de</strong>n können,<br />
beim Fernstudium die Frage nach<br />
<strong>de</strong>r persönlichen Betreuung und <strong>de</strong>m<br />
kontinuierlichen Austausch <strong>de</strong>r Teilnehmer<br />
untereinan<strong>de</strong>r. Beim in vielen<br />
Bereichen <strong>de</strong>r Erwachsenenbildung immer<br />
populärer wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n e-Learning<br />
setzt sich aufgrund einer hohen Abbrecherquote<br />
die Erkenntnis durch, dass das<br />
klassische, auf personale Begegnung<br />
beruhen<strong>de</strong> Lernen nicht in völlige Virtualität<br />
hinein aufgelöst wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Die drei Lernsäulen<br />
Dies berücksichtigend, ist das Konzept<br />
von GDK und WKR in einem<br />
zweiten Herangehen im Sinne vernetzter<br />
Möglichkeiten mit drei didaktischen<br />
Bausteinen zu beschreiben:<br />
• Studienblöcke,<br />
• Regionale Studienzirkel,<br />
• Selbststudium.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
197
INFOS & AKTUELLES<br />
198<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Aktuelle<br />
und<br />
zukünftige<br />
Kurse:<br />
Grundschuldidaktikkurs – 13. GDK<br />
Beginn: Voraussichtlich im September<br />
2005.<br />
Dauer: ca. ein Schuljahr.<br />
Kosten: ca. € 60.- für<br />
Studienmaterialien.<br />
Entlastung: 1 Stun<strong>de</strong> pro Woche<br />
(bei unbefristetem Arbeitsverhältnis).<br />
Weiterbildungskurs für die<br />
weiterführen<strong>de</strong>n Schulen – 12. WKR<br />
Aktuell: Im September 2004 startet<br />
<strong>de</strong>r 11. WKR mit einer Dauer<br />
von zwei Jahren.<br />
Zukünftig: Interessent/-innen an<br />
weiterführen<strong>de</strong>n Schulen<br />
(Haupt-, Real-, För<strong>de</strong>r-, Gesamtschule,<br />
Gymnasium)<br />
wen<strong>de</strong>n sich hinsichtlich<br />
eines möglichen Folgekurses<br />
(12. WKR) an das PZ.<br />
Informationen und Kontakt:<br />
Informationen: Ausführliche Info-<br />
Mappen zu GDK und WKR<br />
sind postalisch o<strong>de</strong>r über<br />
Homepage beim Institut zu<br />
beziehen.<br />
Ausschreibung: Achten Sie auf die<br />
Ausschreibung <strong>de</strong>s 13. GDK<br />
im Frühjahr 2005 im Amtsblatt<br />
<strong>de</strong>s Hessischen Kultusministeriums!<br />
(Betr.: Termine,<br />
Formulare…).<br />
Anmeldung: Modalitäten, Adressen<br />
und Formulare sind beim<br />
PZ zu erfragen.<br />
Studienleiter: Dr. Paul Platzbecker<br />
Fon: 06127/77249<br />
E-Mail: Paul.Platzbecker@<br />
pz-hessen.<strong>de</strong><br />
Sekretariat: Frau Lore Koller<br />
Fon: 06127/77283<br />
Fax: 06127/77246<br />
Unterrichtserfahrung<br />
Theologie<br />
In <strong>de</strong>n jeweils mit <strong>de</strong>m Schuljahr<br />
beginnen<strong>de</strong>n Kursen wer<strong>de</strong>n die drei<br />
Bausteine auf didaktisch sinnvolle<br />
Weise eng miteinan<strong>de</strong>r verzahnt.<br />
Grundlegend ist das Selbststudium, in<br />
<strong>de</strong>m anhand von Studienmaterialien<br />
die Lehrveranstaltungen <strong>de</strong>r Kurse vorund<br />
nachbereitet wer<strong>de</strong>n. Als zentrale<br />
Lehrveranstaltungen sind im einjährigen<br />
GDK vier drei- bzw. viertägige, im<br />
zweijährigen WKR sechs einwöchige<br />
Studienblöcke vorgesehen. In diesen<br />
wer<strong>de</strong>n die theologischen und religionspädagogischen<br />
Grundlagen mit <strong>de</strong>r<br />
Gesamtgruppe erarbeitet und vertieft.<br />
Als zentraler Veranstaltungsort hat sich<br />
das Wilhelm-Kempf-Haus bewährt, das<br />
sich bei <strong>de</strong>n Teilnehmern als nahezu<br />
i<strong>de</strong>aler Lernort dauerhafter Wertschätzung<br />
erfreut. Flankiert wer<strong>de</strong>n diese<br />
mehrtägigen Präsenzblöcke von monatlich<br />
stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n ca. dreistündigen<br />
Studienzirkeln, die als Kleingruppen<br />
auf regionaler, diözesaner Ebene (Fulda,<br />
<strong>Limburg</strong>, Mainz) jeweils nachmittags<br />
stattfin<strong>de</strong>n und in ihrer Zusammensetzung<br />
über die gesamte Kursdauer<br />
bestehen bleiben. Aufgabe <strong>de</strong>r Studienzirkel<br />
ist es, das Selbststudium <strong>de</strong>r<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand<br />
<strong>de</strong>r angesprochenen Studienmaterialien<br />
zu begleiten und so auch in <strong>de</strong>n<br />
Eigener<br />
Glaube<br />
WKR<br />
Fachdidaktik<br />
Religionspädagogik<br />
„Zwischenzeiten“ die Präsenzblöcke<br />
entsprechend vor- bzw. nachzubereiten.<br />
Die angesprochene schwierige Balance<br />
zwischen Theorie und Praxis<br />
bzw. die unterrichtspraktische Umsetzbarkeit<br />
<strong>de</strong>r Kernthemen steht im Vor<strong>de</strong>rgrund<br />
<strong>de</strong>r Studienzirkel: Ihre Leiter<br />
sind Vertreter aus <strong>de</strong>n Schulabteilungen<br />
<strong>de</strong>r beteiligten Bistümer. Die Studienzirkel<br />
sind <strong>de</strong>r Ort, an <strong>de</strong>m im intensiven<br />
Gespräch mit erfahrenen Religionspädagogen<br />
aus <strong>de</strong>n drei Bistümern<br />
wie <strong>de</strong>r Teilnehmen<strong>de</strong>n untereinan<strong>de</strong>r<br />
die Gelegenheit geboten wird,<br />
das bisher Gehörte zu erörtern und miteinan<strong>de</strong>r<br />
zu vertiefen. Dabei bil<strong>de</strong>t sich<br />
im Kursverlauf stets ein diözesanes Kolorit<br />
aus, das bei <strong>de</strong>n zentralen Veranstaltungen<br />
zunehmend befruchtend wirkt.<br />
Gelebter Glaube und Fachwissenschaft<br />
begegnen sich<br />
Herausfor<strong>de</strong>rung und Ziel <strong>de</strong>r Kurse<br />
ist es, innerhalb <strong>de</strong>r zur Verfügung<br />
stehen<strong>de</strong>n Zeit die Voraussetzungen zu<br />
schaffen für eine theologisch und pädagogisch<br />
verantwortliche Erteilung <strong>de</strong>s<br />
katholischen Religionsunterrichts in<br />
<strong>de</strong>r jeweiligen Schulform. Dabei sollen<br />
in <strong>de</strong>r Weiterbildung Theologie, eigener<br />
Glaube, Weitergabe <strong>de</strong>s Glaubens
stets auf <strong>de</strong>m konkreten Hintergrund<br />
<strong>de</strong>r Lebenswelt <strong>de</strong>r Schülerinnen und<br />
Schüler angemessen zur Sprache gebracht<br />
wer<strong>de</strong>n. Diese Elemente stehen<br />
in <strong>de</strong>r aktuellen Konzeption nicht isoliert<br />
nebeneinan<strong>de</strong>r, son<strong>de</strong>rn ergänzen<br />
sich gegenseitig und bil<strong>de</strong>n gleichgewichtete<br />
Pole eines Bezugsfel<strong>de</strong>s; sie<br />
durchdringen sich und halten sich ständig<br />
in Spannung.<br />
Von <strong>de</strong>n Teilnehmern immer wie<strong>de</strong>r<br />
bewusst gesucht und erlebt wird die<br />
Konfrontation <strong>de</strong>s eigenen gelebten<br />
Glaubens mit <strong>de</strong>r fachwissenschaftlichen<br />
Reflexion. Klar ist, dass die damit<br />
verbesserte theoretische Fundierung<br />
sich mehr o<strong>de</strong>r weniger unmittelbar<br />
fachdidaktisch in die Unterrichtspraxis<br />
hinein wen<strong>de</strong>n lassen muss. Denn reine<br />
fachwissenschaftliche Kompetenz ohne<br />
fachdidaktische Umsetzungsfähigkeit<br />
wäre leblos, genauso wie eine unterrichtspraktische<br />
Metho<strong>de</strong>nkenntnis<br />
ohne theologische Fundierung bekanntlich<br />
leer und wirkungslos wäre.<br />
Nicht wenige Teilnehmer nutzen die<br />
Möglichkeit, über eine befristete kirchliche<br />
Unterrichtserlaubnis bereits während<br />
<strong>de</strong>s Kurses erste praktische Erfahrungen<br />
zu sammeln, die sie dann befruchtend<br />
in ihre Weiterbildung einbringen<br />
können.<br />
Freilich wird die Balance zwischen<br />
fachwissenschaftlichem „Input“ und<br />
unterrichtspraktischem „Output“ für die<br />
einzelnen Schulformen unterschiedlich<br />
ausgestaltet. Während im Grundschuldidaktikkurs<br />
<strong>de</strong>r Schwerpunkt auf <strong>de</strong>r<br />
praktischen Seite eines handlungs-orientierten<br />
und performativen Unterrichtes<br />
liegt, steigt <strong>de</strong>r Anteil kognitiver<br />
Gehalte in <strong>de</strong>n einzelnen Schulformen<br />
<strong>de</strong>r Sekundarstufe.<br />
Die für alle Kurse neu zur Disposition<br />
gestellte Auswahl <strong>de</strong>r Kursinhalte<br />
orientierte sich zum einen an <strong>de</strong>n einzelnen<br />
fachwissenschaftlichen Bereichen<br />
<strong>de</strong>r biblischen, <strong>de</strong>r systematischen<br />
und praktischen Theologie und zum an<strong>de</strong>ren<br />
sehr viel <strong>de</strong>utlicher an <strong>de</strong>n Vorgaben<br />
<strong>de</strong>r Hessischen Lehr- und Rahmenpläne<br />
für Katholische Religion an <strong>de</strong>n<br />
Grund- und Sekundarschulen bzw.<br />
weiterführen<strong>de</strong>n Schulen. Ferner wur-<br />
<strong>de</strong>n Aufgaben und Zielvorgaben einschlägiger<br />
kirchlicher und religionspädagogischer<br />
Verlautbarungen mit eingearbeitet.<br />
Birgit Heuser-Kempf, Leiterin <strong>de</strong>s<br />
Dezernats Weiterbildung beim AfL,<br />
hebt beson<strong>de</strong>rs die Bemühungen hervor,<br />
mit <strong>de</strong>nen beim Pädagogischen<br />
Zentrum die jeweiligen Inhalte thematisch<br />
und chronologisch in verbindliche<br />
Curricula übersetzt wur<strong>de</strong>n.<br />
Diese auch für die Studienzirkel gelten<strong>de</strong>n<br />
und von <strong>de</strong>n Teilnehmern als<br />
recht anspruchsvoll empfun<strong>de</strong>nen<br />
Curricula garantieren eine sinnvolle<br />
Verzahnung von Selbststudium, regionalen<br />
Zirkeln und gemeinsamen<br />
Präsenzblöcken, so dass eine effektive<br />
Lernprogression für alle lan<strong>de</strong>sweit<br />
verstreuten Teilnehmer gleichermaßen<br />
möglich wird. Während das<br />
Curriculum für <strong>de</strong>n GDK linear strukturiert<br />
ist, erscheint es im WKR modular<br />
differenziert. M.a.W. hier sind<br />
um <strong>de</strong>n Skopus <strong>de</strong>s WKR, <strong>de</strong>m<br />
Haupt- und Realschulbereich, schulformspezifische<br />
Module für Gymnasial-<br />
und Berufschullehrer mit zusätzlichen<br />
Unterrichtseinheiten und Studienmaterialien<br />
angeordnet. So wird<br />
ein gemeinsames und sich wechselseitig<br />
befruchten<strong>de</strong>s Lernen unter Berücksichtigung<br />
<strong>de</strong>r jeweiligen Schulformspezifika<br />
möglich.<br />
Erfahrene Religionspädagogen als<br />
Referenten<br />
Referenten, die dieses Curriculum<br />
in Studienblöcken und -zirkeln mit umsetzen,<br />
sind im Grundschulbereich neben<br />
einem Vertreter <strong>de</strong>r Katholischen<br />
Theologie an <strong>de</strong>r Philipps-Universität<br />
in Marburg vor allem erfahrene Religionspädagogen<br />
aus <strong>de</strong>n drei Bistümern,<br />
die damit zugleich spezifische diözesane<br />
Anliegen mit einfließen lassen. So<br />
wer<strong>de</strong>n beispielsweise das Grundschulprojekt<br />
<strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s <strong>Limburg</strong>,<br />
Schulpastorale Anliegen <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s<br />
Mainz o<strong>de</strong>r die Kirchenraumpädagogik<br />
aus <strong>de</strong>m <strong>Bistum</strong> Fulda in <strong>de</strong>n Kursen<br />
<strong>de</strong>s Pädagogischen Zentrums über ihre<br />
jeweiligen Diözesen hinaus einer weitaus<br />
größeren und interessierten Zielgruppe<br />
bekannt gemacht.<br />
Im Kurs für die weiterführen<strong>de</strong>n<br />
Schulen schaut das Pädagogische Zentrum<br />
auf eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit<br />
mit <strong>de</strong>n drei hessischen<br />
Universitäten zurück – allen voran <strong>de</strong>m<br />
Seminar für Katholische Theologie an<br />
<strong>de</strong>r Universität Frankfurt. Hier haben<br />
sich engagierte Dozenten immer wie<strong>de</strong>r<br />
auf die beson<strong>de</strong>ren Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>de</strong>r Weiterbildung eingelassen und<br />
auch die staatlich anerkannten Abschlussprüfungen<br />
für das PZ abgenommen.<br />
Denn am En<strong>de</strong> steht die vom<br />
„Morgenlob“ im Meditationsraum <strong>de</strong>s Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod Foto: Paul Platzbecker<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
199
INFOS & AKTUELLES<br />
200<br />
hessischen Prüfungsamt approbierte<br />
Erweiterungsprüfung, die aus einem<br />
schriftlichen und einem mündlichen<br />
Teil besteht. 6<br />
Die ange<strong>de</strong>utete Vernetzung <strong>de</strong>r drei<br />
didaktischen Grundpfeiler <strong>de</strong>r Lehrgänge<br />
wird nicht zuletzt durch neue<br />
Möglichkeiten <strong>de</strong>r elektronischen Kommunikation<br />
unterstützt. Mit <strong>de</strong>m Schlagwort<br />
„e-Learning“, <strong>de</strong>m „elektronischen<br />
Lernen“, verbin<strong>de</strong>n sich auch für die<br />
Weiterbildung im Pädagogischen Zentrum<br />
neue Gestaltungsmöglichkeiten,<br />
die <strong>de</strong>n Material- und Informationsaustausch<br />
in <strong>de</strong>n zeitlich begrenzten Kursen<br />
optimieren und beschleunigen.<br />
Reale plus virtuelle Kommunikation,<br />
o<strong>de</strong>r:<br />
die Erweiterung <strong>de</strong>r Möglichkeiten<br />
Die seit einem Jahr eingeführte virtuelle<br />
e-Learning Plattform „Quickplace“<br />
ist selbst eine „res mixta“ – d.h.<br />
ein Ausweis einer gelungenen und intensiven<br />
staatlich-kirchlichen Zusammenarbeit.<br />
Konkret be<strong>de</strong>utet dies: Dem<br />
Pädagogischen Zentrum ist vom Amt<br />
für Lehrerausbildung eine Internetplattform<br />
zur Verfügung gestellt wor<strong>de</strong>n, die<br />
vom AfL nun auch dauerhaft technisch<br />
„administriert“ bzw. betreut wird. Der<br />
virtuelle Kursraum wur<strong>de</strong> dabei vom<br />
AfL zunächst grob vorstrukturiert und<br />
dann vom PZ für die Erfor<strong>de</strong>rnisse <strong>de</strong>r<br />
Weiterbildung konkret zugeschnitten<br />
und inhaltlich ausgestaltet. Dr. Rüdiger<br />
Schnause, <strong>de</strong>r stellvertreten<strong>de</strong> Leiter <strong>de</strong>s<br />
Dezernats Weiterbildung im AfL und<br />
zugleich technischer Manager <strong>de</strong>r Plattform,<br />
lobt <strong>de</strong>n innovativen Mut, mit <strong>de</strong>m<br />
das Pädagogische Zentrum die Möglichkeiten<br />
<strong>de</strong>r neuen Kommunikationstechnologie<br />
aufgenommen und in kurzer Zeit<br />
für seine Belange umgesetzt habe. Aus<br />
seiner Sicht hat <strong>de</strong>r aktuelle GDK damit<br />
so etwas wie einen „Pilotcharakter“ auch<br />
für an<strong>de</strong>re Weiterbildungsmaßnahmen<br />
<strong>de</strong>s AfL angenommen. 7<br />
Im Detail gestaltet sich die online-<br />
Unterstützung in etwa wie folgt: Nach<br />
anfänglicher intensiver Einweisung erhalten<br />
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
<strong>de</strong>r Lehrgänge durch einen persönli-<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Arbeitskreis mit Dr. B. Lob, <strong>Bistum</strong> Mainz Foto: Paul Platzbecker<br />
chen Co<strong>de</strong> Zugang zu einem geschlossenen<br />
virtuellen Raum, <strong>de</strong>r ihnen für die<br />
Kursdauer verfügbar bleibt. In diesem<br />
wer<strong>de</strong>n zum einen alle organisatorischen<br />
Informationen (Anmel<strong>de</strong>modalitäten,<br />
Termine, Prüfungsabsprachen<br />
etc.) zwischen <strong>de</strong>r Kursleitung, <strong>de</strong>n Referenten<br />
und Teilnehmern interaktiv<br />
ausgetauscht und zum an<strong>de</strong>ren alle relevanten<br />
Studienmaterialen (Studien- und<br />
Materialbriefe, Skripte etc.) zur Verfügung<br />
gestellt. Das Gleiche gilt für ausgesuchte<br />
Unterrichtsmaterialien, Verlautbarungen,<br />
Internet-Adressen etc. sowie<br />
ein religionspädagogisches Glossar,<br />
das exklusiv von <strong>de</strong>n Teilnehmern – je<strong>de</strong>rzeit<br />
und von je<strong>de</strong>m Ort aus – genutzt<br />
wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Wenn auch die persönliche Begegnung<br />
zwischen allen Beteiligten <strong>de</strong>r<br />
Weiterbildung weiterhin im Vor<strong>de</strong>rgrund<br />
stehen wird, so wird doch gera<strong>de</strong><br />
diese immer kostbarer wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong> gemeinsame<br />
Lernzeit in <strong>de</strong>n Präsenzblöcken<br />
durch die zusätzliche Nutzung <strong>de</strong>s<br />
elektronischen Mediums effizienter<br />
ausgestaltet. Von daher ist <strong>de</strong>r hier mit<br />
Vorsicht beschrittene „e-Lernweg“ zwar<br />
kein neuer „Heilsweg“ in <strong>de</strong>r Erwachsenenbildung,<br />
<strong>de</strong>nnoch muss das mit<br />
seiner Nutzung eingeläutete En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
„Serienbriefes“ keinesfalls bedauert wer<strong>de</strong>n.<br />
So sparen die hier längst nicht ausgeschöpften<br />
technischen Möglichkei-<br />
ten zweifelsohne Zeit und Kosten – ein<br />
im Ansatz seltener Ausweg aus <strong>de</strong>r <strong>de</strong>rzeitigen<br />
Zwickmühle sich leeren<strong>de</strong>r<br />
Kassen.<br />
Ferner ist die Tatsache, dass die Teilnehmer<br />
gewissermaßen „en passant“ eine<br />
Lernmetho<strong>de</strong> beherrschen lernen, <strong>de</strong>r<br />
sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch<br />
weiterhin bei ihrer beruflichen Weiterqualifizierung<br />
begegnen wer<strong>de</strong>n, ein<br />
mehr als begrüßenswerter Nebeneffekt.<br />
„Ich wünsche mir weitere, so gut organisierte,<br />
intensive Weiterbildungen,“<br />
schreibt eine Teilnehmerin ins Stammbuch<br />
<strong>de</strong>s zu En<strong>de</strong> gehen<strong>de</strong>n GDK – und<br />
dies lässt für <strong>de</strong>n beginnen<strong>de</strong>n WKR<br />
berechtigt hoffen.<br />
Diese Einschätzung kann natürlich<br />
nicht vergessen machen, was auch am<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Referendariats zu erinnern<br />
bleibt: Die eigentliche Entwicklung<br />
zum Religionslehrer beginnt erst nach<br />
<strong>de</strong>r Abschlussprüfung in <strong>de</strong>r konkreten<br />
Bewährung. Dennoch wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n<br />
Lehrgängen <strong>de</strong>s Pädagogischen Zentrums<br />
die wichtigsten Voraussetzungen<br />
und Grundlagen gelegt; darüber<br />
hinaus erhalten die Absolventinnen<br />
und Absolventen weitere, wichtige berufsbegleiten<strong>de</strong><br />
Impulse – und dies<br />
nicht nur in <strong>de</strong>n religionspädagogischen<br />
Fortbildungen <strong>de</strong>s PZ, die ja allen<br />
Lehrern und Lehrerinnen in Hessen<br />
offen stehen.
Ähnliches gilt für das überarbeitete<br />
Konzept <strong>de</strong>r Weiterbildung selbst.<br />
Auch wenn es sich gera<strong>de</strong> selbst „weitergebil<strong>de</strong>t“<br />
hat: In seiner jetzigen Form<br />
bleibt es offen, noch weiter optimiert<br />
und weiter flexibel auf konkrete Erfor<strong>de</strong>rnisse<br />
in <strong>de</strong>r Zukunft reagieren zu<br />
können. So versteht das Pädagogische<br />
Zentrum seinen Beitrag zur Sicherung<br />
<strong>de</strong>s Religionsunterrichtes.<br />
Anmerkungen<br />
1 Siehe Amtsblatt <strong>de</strong>s hessischen Kultusministeriums<br />
vom 17. Mai 2004, Nr.5/04. S.334. Die Interessent/<br />
-innen können natürlich auch aus an<strong>de</strong>ren Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>rn<br />
stammen; ihre Examina müssen in Hessen<br />
lediglich anerkannt sein.<br />
2 Wer als „kirchliche/-r Teilnehmer/-in“ aufgenommen<br />
wird, entschei<strong>de</strong>t auf Antrag die Schulabteilung <strong>de</strong>s<br />
jeweiligen <strong>Bistum</strong>s.<br />
3 Die Möglichkeit <strong>de</strong>r Anerkennung <strong>de</strong>s kirchlichen<br />
Zeugnisses als staatliche Fakultas setzt <strong>de</strong>n erfolgreichen<br />
Abschluss <strong>de</strong>s 1. und 2. Staatsexamens voraus.<br />
4 Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern <strong>de</strong>r Weiterbildung,<br />
die in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis<br />
stehen, wird als Entlastung gemäß <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n<br />
Pflichtstun<strong>de</strong>nverordnung (ABl. 8/99, S.684)<br />
im GDK eine Stun<strong>de</strong>, im WKR bis zu zwei Stun<strong>de</strong>n<br />
pro Woche für die Dauer <strong>de</strong>s Kurses auf die Pflichtstun<strong>de</strong>nzahl<br />
angerechnet.<br />
5 Auf <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Ausschreibung beigefügten Anmel<strong>de</strong>bogen<br />
muss die Schulleitung ihr Einverständnis erklären<br />
und damit die Freistellung <strong>de</strong>r Interessentinnen<br />
und Interessenten im Hinblick auf die Seminarveranstaltungen<br />
garantieren.<br />
6 Die Teilnehmer <strong>de</strong>s GDK erhalten nach einer schriftlichen<br />
Hausarbeit die Möglichkeit, in einem 20-minütigen<br />
Kolloquium ihre erworbenen theologischen<br />
und religionspädagogischen Kenntnisse unter Beweis<br />
zu stellen. Die Abschlussprüfung im WKR besteht<br />
aus einer Abschlussarbeit und einem einstündigen<br />
Kolloquium, das sich wie das <strong>de</strong>s GDK an die<br />
Verordnung über die Ersten Staatsprüfungen für die<br />
Lehrämter von 1995 hält.<br />
7 Siehe die breit angelegte, aktuelle Weiterbildungsmaßnahme,<br />
durch die hessische Grundschullehrer/<br />
-innen für <strong>de</strong>n Haupt- und Realschulbereich weiterqualifiziert<br />
wer<strong>de</strong>n. Siehe Amtsblatt vom 17. Mai<br />
2004, Nr. 5/04. S.331.<br />
Dr. Paul Platzbecker (geb. 1966) ist<br />
Studienleiter am Pädagogischen Zentrum<br />
<strong>de</strong>r Bistümer im Lan<strong>de</strong> Hessen,<br />
Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod.<br />
„Hauptsache gesund?“ – CD-ROM zur Pränataldiagnostik<br />
Auf Anfragen vieler Lehrerinnen<br />
und Lehrer haben DDr. Caspar Söling,<br />
langjähriger Persönlicher Referent <strong>de</strong>s<br />
Bischofs von <strong>Limburg</strong>, und Dipl. Theol.<br />
Stefan Herok, Leiter <strong>de</strong>s Amtes für Katholische<br />
Religionspädagogik in Wiesba<strong>de</strong>n,<br />
die Austellung „Lichtinsel“, die<br />
einen emotionalen Zugang zum Thema<br />
Pränataldiagnostik eröffnet, in verschie<strong>de</strong>ne<br />
Powerpointpräsentationen<br />
umgesetzt. Die Präsentation eignet sich<br />
zum unkomplizierten Einsatz in <strong>de</strong>r<br />
Schule und im Erwachsenenbildungsbereich.<br />
Darüber hinaus informieren<br />
zahlreiche Hintergrundtexte über Metho<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Pränataldiagnostik und hinterfragen<br />
ihre gesellschaftliche Be<strong>de</strong>utung.<br />
Natürlich fehlen auch kirchliche<br />
Stellungnahmen zum Thema nicht. Abgerun<strong>de</strong>t<br />
wird das Multimediapaket mit<br />
Internetlinks zu wichtigen Beratungsinstitutionen.<br />
Maßgeblich unterstützt wur<strong>de</strong> das<br />
CD-Projekt durch die Katharina Kasper-<br />
Stiftung <strong>de</strong>r Dernbacher Schwestern.<br />
Wie dringlich die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>m Thema Pränatale Diagnostik<br />
ist, beweist <strong>de</strong>r Eindruck Frankfurter<br />
Humangenetiker, die sich immer<br />
öfters als „Baby-TÜV“ empfin<strong>de</strong>n. Je<strong>de</strong><br />
Schwangere wird heute routinemäßig<br />
beim Arzt mit einem Ultraschallge-<br />
rät untersucht. Manche Frauen nutzen<br />
die Pränataldiagnostik (PND) gezielt,<br />
um ihr Kind auf eine Behin<strong>de</strong>rung zu<br />
prüfen. Junge Mütter kommen, um ihr<br />
Kind bereits im Mutterbauch durchchecken<br />
zu lassen. Soziologen sprechen<br />
von einer „Schwangerschaft auf Probe“.<br />
Wie bei <strong>de</strong>r Ausstellung „Lichtinsel“<br />
ist es auch bei <strong>de</strong>r Umsetzung auf CD-<br />
ROM Ziel <strong>de</strong>r Autoren, für eine differenzierte<br />
und problemorientierte Betrachtungsweise<br />
und Bewertung <strong>de</strong>s<br />
Themas Pränataldiagnostik zu sensibilisieren.<br />
Thematisiert wird die ethische<br />
Verantwortung von Wissenschaftlern<br />
und Ärzten. Gleichzeitig geht es darum,<br />
wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Eltern von <strong>de</strong>r gesellschaftlich<br />
verordneten Bür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Verantwortung<br />
für ein perfekt(ioniert)es Kind zu<br />
entlasten, in<strong>de</strong>m durchbuchstabiert wird,<br />
was die Wür<strong>de</strong> je<strong>de</strong>s einzelnen Menschen<br />
be<strong>de</strong>utet und in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Wert eines<br />
Lebens mit Behin<strong>de</strong>rungen vor Augen<br />
geführt wird.<br />
Mit einem ausführlichen Begleitheft<br />
erscheint die CD-ROM in <strong>de</strong>r Reihe<br />
„Religion betrifft uns“, Heft Juni<br />
2004, ISSN 0936-5141, Preis 9.95 €,<br />
und kann über <strong>de</strong>n Buchhan<strong>de</strong>l bezogen<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
„Religion betrifft uns“ erscheint<br />
beim Verlag Bergmoser + Höller in Aa-<br />
chen und bietet auf jeweils 26 - 30 Seiten<br />
aktuelle, lehrplanbezogene Themen für<br />
die Sekundarstufe II und höhere Klassen<br />
<strong>de</strong>r Sekundarstufe I mit Sachinformationen,<br />
Text- und Bildmaterial, Unterrichtsverlauf<br />
sowie farbigen Folien.<br />
Zu beziehen ist die neue CD-ROM für<br />
2.50 € plus Versandkosten beim<br />
Dezernat Schule und Hochschule im<br />
Bischöflichen Ordinariat<br />
Roßmarkt 12, 65549 <strong>Limburg</strong><br />
Fax: 06431/295-237<br />
E-Mail: schule@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
Internet http://schule.<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
201
INFOS & AKTUELLES<br />
202<br />
Katharina Kasper-Stiftung<br />
„Leben wählen – in seiner Vielfalt!“<br />
Unter <strong>de</strong>m Titel „Hauptsache gesund?<br />
Pränataldiagnostik – Behin<strong>de</strong>rung –<br />
Menschenbild“ wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m Katholikentag<br />
in Ulm eine in ihrer Art einzigartige<br />
Multimedia-CD <strong>de</strong>r Öffentlichkeit<br />
vorgestellt. Das Multimediapaket<br />
für Schule und Erwachsenenbildung<br />
will über Chancen und Risiken <strong>de</strong>r Pränatalen<br />
Diagnostik informieren. Die vielfach<br />
im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> zu sehen gewesene<br />
Ausstellung „Lichtinsel“ wur<strong>de</strong><br />
z.B. als Powerpointpräsentation umgesetzt.<br />
Maßgeblich unterstützt wur<strong>de</strong> das<br />
CD-Projekt durch die Katharina Kasper-Stiftung<br />
<strong>de</strong>r Dernbacher Schwestern.<br />
Dr. med. Ursula Rieke als ärztliche<br />
Leiterin, erläutert im Gespräch mit „INFO“<br />
die Arbeit <strong>de</strong>r noch jungen Stiftung.<br />
Frau Dr. Rieke, mit Hilfe <strong>de</strong>r Katharina<br />
Kasper-Stiftung wur<strong>de</strong> die CD-ROM<br />
„Hauptsache gesund“ u.a. für <strong>de</strong>n Einsatz<br />
in <strong>de</strong>r Schule produziert. Was versprechen<br />
Sie sich davon?<br />
Die nach<strong>de</strong>nklichen Impulse <strong>de</strong>r<br />
„Lichtinsel“ können über die CD-ROM<br />
auf technisch einfache Weise z.B. im<br />
Biologie- o<strong>de</strong>r Religionsunterricht direkt<br />
als Themeneinstieg verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n.<br />
Darüber hinaus bietet die Multimedia-<br />
CD ausreichen<strong>de</strong> Hintergrundinformationen<br />
zur pränatalen Medizin, die sich<br />
Lehrer/-innen ansonsten mühselig zusammensuchen<br />
müssten. So lässt sich<br />
ein fundierter und gleichzeitig lebendiger<br />
Unterricht gestalten.<br />
Wie hat man sich die Arbeit <strong>de</strong>r Katharina<br />
Kasper-Stiftung konkret vorzustellen?<br />
Wir sind eine bischöfliche Stiftung<br />
öffentlichen Rechts und haben uns <strong>de</strong>r<br />
Thematik <strong>de</strong>r Annahme <strong>de</strong>s Lebens in<br />
seiner Vielfalt – insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>s Lebens<br />
mit Behin<strong>de</strong>rung verschrieben.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Interview mit Dr. med. Ursula Rieke<br />
Dabei stützt sich unsere Arbeit im Prinzip<br />
auf fünf Säulen: An erster Stelle<br />
sind die bei<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llprojekte, hier in<br />
Dernbach und Frankfurt zu nennen, wo<br />
wir vor Ort eine psychosoziale Beratung<br />
im Kontext pränataler Medizin anbieten.<br />
Darüber hinaus stehen wir über<br />
eine telefonische Hotline Schwangeren<br />
und Eltern für Beratung und Vermittlung<br />
rund um Fragen zur Pränataldiagnostik<br />
und zum Umgang mit Behin<strong>de</strong>rung<br />
zur Verfügung. Diese „erste Hilfe“<br />
steht selbstverständlich auch medizinischem<br />
Fachpersonal und Beratungsstellen<br />
zur Information offen. Des Weiteren<br />
möchten wir Mitarbeiter/-innen<br />
an Beratungsstellen durch Qualifizierungs-<br />
und Fortbildungsangebote in ihrer<br />
Arbeit unterstützen. Die Einbeziehung<br />
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern und <strong>de</strong>r Aufbau<br />
eines ehrenamtlichen Helfernetzwerks<br />
sollen nach und nach aufgebaut<br />
wer<strong>de</strong>n. Damit unsere Arbeit auch bekannt<br />
wird, brauchen wir schließlich<br />
eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen<br />
ja einen Perspektivenwechsel im<br />
Blick auf Menschen mit Behin<strong>de</strong>rung<br />
erreichen – getreu unserem Motto „Leben<br />
wählen – in seiner Vielfalt!“. Die<br />
Schulen sind da ein beson<strong>de</strong>rs wichtiges<br />
Aktionsfeld.<br />
Der Religionsunterricht ist neben <strong>de</strong>m<br />
Ethik- und Biologieunterricht ein Ort,<br />
an <strong>de</strong>m bioethische Fragestellungen im<br />
Zentrum stehen. Haben Sie bereits I<strong>de</strong>en,<br />
wie Sie sich hier für ihr Anliegen<br />
einsetzen wollen?<br />
Ich <strong>de</strong>nke hier z.B. an Fortbildungsangebote<br />
für Lehrerinnen und Lehrer,<br />
die im Grun<strong>de</strong> ja i<strong>de</strong>ale Multiplikatoren<br />
für das Anliegen <strong>de</strong>r Stiftung sind.<br />
Das könnte dann so aussehen, dass wir<br />
zu unseren Fortbildungen einla<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r<br />
aber, dass wir bei Lehrerfortbildungen<br />
Katharina Kasper-Stiftung<br />
Die 2002 gegrün<strong>de</strong>te Katharina Kasper-Stiftung<br />
mit Sitz in Dernbach hat<br />
sich <strong>de</strong>n Schutz <strong>de</strong>s ungeborenen Lebens,<br />
insbeson<strong>de</strong>re die Ermutigung<br />
zur Annahme von Kin<strong>de</strong>rn mit Behin<strong>de</strong>rungen<br />
zum Ziel gesetzt. Zur Erfüllung<br />
<strong>de</strong>s Stiftungszweckes unterstützt<br />
die Stiftung schwangere Frauen<br />
und ihre Familien vor und nach <strong>de</strong>r<br />
Geburt eines Kin<strong>de</strong>s mit Behin<strong>de</strong>rung.<br />
Stiftungsvorsitzen<strong>de</strong> ist Sr. M. Christeta<br />
Hess <strong>de</strong>r Armen Dienstmäg<strong>de</strong> Jesu<br />
Christi. Die ärztliche Leiterin liegt<br />
bei Dr. med. Ursula Rieke.<br />
Kontakt:<br />
Katharina Kasper-Stiftung<br />
Katharina-Kasper-Str. 12<br />
56428 Dernbach<br />
Fon 02602/949480<br />
www.katharina-kasper-stiftung.<strong>de</strong><br />
zum Thema „Bioethik/Behin<strong>de</strong>rung“,<br />
z.B. im Pädagogischen Zentrum <strong>de</strong>r Bistümer<br />
im Lan<strong>de</strong> Hessen in Naurod o<strong>de</strong>r<br />
im Institut für Lehrerfort- und weiterbildung<br />
in Mainz über die Arbeit <strong>de</strong>r<br />
Katharina Kasper-Stiftung informieren.<br />
Worin liegt das innovative Potential<br />
<strong>de</strong>r Stiftung? Beratungseinrichtungen<br />
gibt es doch eine ganze Menge, auch im<br />
<strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong>. Kommen Sie sich da<br />
nicht ins Gehege?<br />
Nein, ganz im Gegenteil – wir füllen<br />
vielmehr eine Lücke. Eine klassische<br />
Schwangerenkonfliktberatung wird
von uns ja gera<strong>de</strong> nicht angeboten. Statt<br />
<strong>de</strong>ssen beschränken wir uns in unserer<br />
Arbeit auf die Auswirkungen <strong>de</strong>r pränatalen<br />
Medizin und auf <strong>de</strong>n Umgang<br />
mit Behin<strong>de</strong>rung – dies geschieht in direkter<br />
Anbindung an Pränatalzentren<br />
und in enger Kooperation mit Gynäkologen<br />
und Kin<strong>de</strong>rärzten bzw. in aufsuchen<strong>de</strong>r<br />
Tätigkeit. In diesem Zusammenhang<br />
initiieren wir mo<strong>de</strong>llhafte Beratungsangebote<br />
und möchten die Erfahrungen<br />
für alle Beratungsstellen im<br />
Rahmen unserer Hotline und unserer<br />
fachlich hochwertigen Qualifizierungsangebote<br />
weitergeben.<br />
Wenn Sie 5 Jahre vorausblicken könnten,<br />
wo wür<strong>de</strong>n sie dann die Stiftung<br />
gerne sehen?<br />
Ich wür<strong>de</strong> mir wünschen, dass <strong>de</strong>r<br />
Name <strong>de</strong>r Stiftung mit Fachkompetenz<br />
und Kooperationsbereitschaft rund um<br />
pränatale Medizin und mit <strong>de</strong>r Annah-<br />
me <strong>de</strong>s Lebens auch mit erwarteter Behin<strong>de</strong>rung<br />
in Verbindung gebracht wird.<br />
Auch wünsche ich mir eine gesellschaftliche<br />
und politische Bewegung,<br />
die sich gegen <strong>de</strong>n vermeintlichen Anspruch<br />
auf ein gesun<strong>de</strong>s Kind einsetzt.<br />
Frau Dr. Rieke, ich danke Ihnen für das<br />
Gespräch.<br />
Die Fragen stellte Martin W. Ramb<br />
Katholische Kirche zum möglichen Kopftuch-Verbot<br />
Verbot ist möglich, wenn es als politisches<br />
Zeichen gegen Verfassungswerte<br />
gebraucht wird – Religion darf nicht aus<br />
öffentlichem Raum verbannt wer<strong>de</strong>n.<br />
Wiesba<strong>de</strong>n (KNA) – Die katholische<br />
Kirche in Hessen hält ein Verbot<br />
<strong>de</strong>s muslimischen Kopftuchs für Lehrerinnen<br />
an öffentlichen Schulen unter<br />
bestimmten Umstän<strong>de</strong>n für gerechtfertigt.<br />
Ein Verbot sei dann legitim<br />
und angemessen, wenn das Kopftuch<br />
als sozusagen politisches Zeichen<br />
gebraucht wer<strong>de</strong>, mit <strong>de</strong>m insbeson<strong>de</strong>re<br />
für ein Menschen- und Frauenbild<br />
geworben wer<strong>de</strong>, das <strong>de</strong>n Werten<br />
<strong>de</strong>r Verfassung wi<strong>de</strong>rspreche,<br />
heißt es in einer am Mittwoch in<br />
Wiesba<strong>de</strong>n vorgelegten Stellungnahme<br />
<strong>de</strong>s Kommissariats <strong>de</strong>r katholischen<br />
Bischöfe im Lan<strong>de</strong> Hessen. Sie<br />
wur<strong>de</strong> in eine Anhörung <strong>de</strong>s Innenausschusses<br />
und <strong>de</strong>s Kulturpolitischen<br />
Ausschusses <strong>de</strong>s Landtags zu<br />
46. <strong>Limburg</strong>er Kreuzwoche<br />
Tag <strong>de</strong>r Religionspädagogik 2004<br />
Dienstag, 14. September 2004<br />
Mehr unter: www.schule.<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>m von <strong>de</strong>r CDU-Mehrheitsfraktion<br />
unlängst in das Parlament eingebrachten<br />
Entwurf für ein „Gesetz zur Sicherung<br />
<strong>de</strong>r staatlichen Neutralität“ eingebracht.<br />
In seiner Stellungnahme betont<br />
das Kommissariat, das die Bischöfe<br />
bei <strong>de</strong>n politischen Stellen in <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>shauptstadt<br />
vertritt, die Frage, ob es<br />
sich beim muslimischen Kopftuch<br />
letztlich nur um ein religiöses o<strong>de</strong>r<br />
vielmehr um ein politisches Erkennungsmerkmal<br />
han<strong>de</strong>le, könne nicht<br />
von kirchlicher Seite beantwortet<br />
wer<strong>de</strong>n. Dies sei vielmehr eine Frage<br />
<strong>de</strong>s Islam einerseits und <strong>de</strong>s Staates<br />
an<strong>de</strong>rerseits.<br />
Ausdrücklich wird in <strong>de</strong>r Stellungnahme<br />
hervorgehoben, es gebe<br />
keinen rechtlichen Grund, religiöse<br />
Erkennungsmerkmale allein wegen<br />
ihrer religiösen Aussagekraft im<br />
Schulbereich und allgemein im öffentlichen<br />
Dienst zu verbieten. Die<br />
Erstaunliche Nähe –<br />
bedrängen<strong>de</strong> Ferne:<br />
Der Islam im Verhältnis<br />
zum Christentum<br />
Referentin:<br />
Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Dres<strong>de</strong>n<br />
Religion als solche brauche nicht und<br />
dürfe nicht aus <strong>de</strong>m öffentlichen<br />
Raum verbannt wer<strong>de</strong>n. Ein an<strong>de</strong>res<br />
Vorgehen wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>m in Deutschland<br />
gewachsenen Verhältnis von Staat<br />
und Religion wi<strong>de</strong>rsprechen.<br />
Der Gesetzentwurf <strong>de</strong>r CDU-<br />
Fraktion zielt an<strong>de</strong>rs als die in Nie<strong>de</strong>rsachsen,<br />
Ba<strong>de</strong>n-Württemberg und im<br />
Saarland bereits beschlossenen Kopftuch-Verbote<br />
auf ein Verbot nicht nur<br />
für Lehrerinnen, son<strong>de</strong>rn für alle hessischen<br />
Beamtinnen. Nach Angaben<br />
<strong>de</strong>r Fraktion wird sich <strong>de</strong>r Landtag in<br />
Wiesba<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Sommerpause in<br />
zweiter Lesung mit <strong>de</strong>m Gesetzentwurf<br />
befassen.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
203
INFOS & AKTUELLES<br />
204<br />
Stellenanzeige: Bischöfliches Ordinariat <strong>Limburg</strong><br />
Geschäftsführung „Haus am Dom“<br />
Das <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> errichtet in<br />
Frankfurt am Main das neue „Haus am<br />
Dom“. Hierfür wird <strong>de</strong>r/die Geschäftsführer/-in<br />
zum 01.01.2005 gesucht.<br />
Mit <strong>de</strong>m „Haus am Dom“ will das<br />
<strong>Bistum</strong> ein Forum <strong>de</strong>r kulturellen Zeitgenossenschaft<br />
eröffnen. Es beherbergt<br />
wichtige kirchliche Einrichtungen. Darüber<br />
hinaus dient es <strong>de</strong>m interreligiösen<br />
Dialog und <strong>de</strong>m Gespräch mit <strong>de</strong>n<br />
bestimmen<strong>de</strong>n Kräften <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s, mit<br />
Parteien und Gewerkschaften, mit <strong>de</strong>r<br />
Wirtschaft, mit Literaten, Künstlern und<br />
Intellektuellen.<br />
Wir erwarten:<br />
- Hochschulabschluss im Bereich<br />
Geistes- wie auch Naturwissenschaften;<br />
Promotion<br />
- Gute Kontakte zu wissenschaftlichen<br />
Institutionen und Personen<br />
Vorausgesetzt wer<strong>de</strong>n:<br />
- engagierte und aktive Mitgliedschaft<br />
in <strong>de</strong>r katholischen Kirche<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
- Führungskompetenz, Einfühlungsvermögen,<br />
Kreativität, konzeptionelles<br />
Denken<br />
- Kooperation mit <strong>de</strong>n im Haus angesie<strong>de</strong>lten<br />
Institutionen <strong>de</strong>r Stadtkirche<br />
Frankfurt und <strong>de</strong>m <strong>Bistum</strong> als<br />
Träger<br />
- Administrative und kaufmännische<br />
Fähigkeiten, sowie eine hohe kommunikative<br />
Kompetenz<br />
Aufgaben:<br />
- Umsetzung <strong>de</strong>s i<strong>de</strong>enpolitischen<br />
Auftrags <strong>de</strong>s Hauses in sozialen,<br />
politischen und kulturellen Themenfel<strong>de</strong>rn<br />
- Repräsention nach außen, Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Organisations- und Projektentwicklung<br />
- Koordination <strong>de</strong>r im Haus angesie<strong>de</strong>lten<br />
kirchlichen Einrichtungen<br />
- Organisation und Marketing <strong>de</strong>s Tagungs-<br />
und Veranstaltungsbetriebs<br />
- Hausmanagement/Technische- und<br />
Servicedienstleistungen<br />
Die Stelle ist als Son<strong>de</strong>rlaufbahn<br />
ausgewiesen.<br />
Bei gleicher Qualifikation wer<strong>de</strong>n<br />
Schwerbehin<strong>de</strong>rte bevorzugt berücksichtigt.<br />
Das <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> strebt eine Erhöhung<br />
<strong>de</strong>s Frauenanteils an. Frauen sind<br />
<strong>de</strong>shalb beson<strong>de</strong>rs aufgefor<strong>de</strong>rt, sich zu<br />
bewerben.<br />
Bewerbung:<br />
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, <strong>de</strong>ren<br />
vertrauliche Behandlung wir zusagen,<br />
bis zum 30.09.2004 mit <strong>de</strong>n üblichen<br />
Unterlagen (Lichtbild, Lebenslauf, Zeugniskopien,<br />
Referenzen) an das:<br />
<strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong><br />
Dezernat Personal<br />
Roßmarkt 4, 65549 <strong>Limburg</strong><br />
o<strong>de</strong>r alternativ:<br />
<strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong><br />
Dezernat Schule und Hochschule<br />
z.H. Herrn Dr. Eckhard Nordhofen<br />
Roßmarkt 12, 65549 <strong>Limburg</strong><br />
Besuchen Sie auch INFO-Online im Internet: www.ifrr.<strong>de</strong>
Anzeige<br />
100 Jahre<br />
Glaubens-Kunst von <strong>de</strong>n Ottonen und<br />
Byzanz über die Staufer, Renaissance<br />
und Barock bis zum Art Déco:<br />
Erstmals seit fast 20 Jahren wird in diesem neuen ‘Blauen Buch’ <strong>de</strong>r Stand<br />
<strong>de</strong>r Forschung zum <strong>Limburg</strong>er Stift und Dom zusammenfassend dargestellt.<br />
Der Autor, <strong>de</strong>r Historiker Dr. Matthias Theodor Kloft, Frankfurt a.M., teilt<br />
dabei auch zahlreiche neue Erkenntnisse mit.<br />
Kloft widmet sich <strong>de</strong>n stilgeschichtlichen Fragestellungen ebenso wie <strong>de</strong>n<br />
Motiven <strong>de</strong>r Auftraggeber. Großzügige Stiftungen ließen die jeweiligen Vorstellungen<br />
einer sich ständig wan<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Gesellschaft in die Baumaßnahmen,<br />
die Ausstattungsstücke und auch in ihre Bewahrung einfließen. Kloft<br />
stellt sie uns als Zeugnisse einer lebendigen Glaubens- und auch politischen<br />
Geschichte wie auch als be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Kunstwerke vor.<br />
Allein schon die 200 Farbbil<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Buches halten selbst für Kenner einige<br />
Überraschungen bereit. So wird augenfällig, dass <strong>de</strong>r <strong>Limburg</strong>er Dom und<br />
Domschatz nicht nur für die Kunst <strong>de</strong>s Mittelalters steht, son<strong>de</strong>rn<br />
„Glaubens-Kunst“ hoher Qualität aus nahezu allen Epochen zeigen kann.<br />
Stichworte zur Geschichte: Bis 1803 war <strong>de</strong>r Dom die Kirche eines Kanonikerstifts<br />
in <strong>de</strong>r Erzdiözese Trier. Dieses Stift war bereits vor 940, in <strong>de</strong>r Zeit<br />
Kaiser Ottos d. Großen, zur Sicherung <strong>de</strong>s Gedächtnisses an seinen Stifter<br />
gegrün<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n. Rund 300 Jahre später, gegen 1235, wur<strong>de</strong> die Pfarrei<br />
<strong>Limburg</strong> in <strong>de</strong>n Dom verlegt. Der heutige Bau wur<strong>de</strong> hauptsächlich in <strong>de</strong>n<br />
Jahren zwischen 1175 und 1235 errichtet und verbin<strong>de</strong>t staufisch-spätromanische<br />
mit frühgotisch-französischen Formen. Die Wandmalereien <strong>de</strong>s 13.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts, die man überwiegend im Pfarrbereich <strong>de</strong>r Kirche antrifft, wur<strong>de</strong>n<br />
1975-1991 restauriert. Die im Dommuseum verwahrten Stücke aus<br />
<strong>de</strong>m Trierer Kirchenschatz, darunter die berühmte byzantinische „Staurothek“<br />
und <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Trierer Ekbertwerkstatt um 980 verzierten „Petrusstab”<br />
schenkte <strong>de</strong>r Herzog von Nassau 1827 <strong>de</strong>m damals neu gegrün<strong>de</strong>ten<br />
<strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong>. Im Domschatz befin<strong>de</strong>n sich aber auch Stücke aus <strong>de</strong>m<br />
Barock bis hin zu Kostbarkeiten <strong>de</strong>s Art-Déco <strong>de</strong>r 1930er Jahre.<br />
Der mo<strong>de</strong>rate Preis für diesen reichhaltigen Bildband ist <strong>de</strong>m großen Engagement<br />
aller Beteiligten, beson<strong>de</strong>rs auch <strong>de</strong>m <strong>Bistum</strong> zu verdanken.<br />
Dom und Domschatz in<br />
LIMBURG a. d. L.<br />
Von Matthias Theodor Kloft.<br />
107 Seiten, 220 Abb., davon 200<br />
farbig. 27 x 21 cm, fa<strong>de</strong>ngehefteter<br />
Pappband in <strong>de</strong>r Reihe<br />
DIE BLAUEN BÜCHER.<br />
ISBN 3-7845-4825-3<br />
EUR 14,80<br />
Kurztext:<br />
Seit 1985 ist dies die erste zusammenfassen<strong>de</strong><br />
Darstellung von<br />
Geschichte und Kunst <strong>de</strong>s <strong>Limburg</strong>er<br />
Doms, darüber hinaus teilt <strong>de</strong>r<br />
Autor zahlreiche neue Erkenntnisse<br />
mit. Kloft schil<strong>de</strong>rt auch <strong>de</strong>n Wan<strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>r Interessen <strong>de</strong>r Stifter vor<br />
<strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r<br />
Kirchengeschichte.<br />
Angesichts <strong>de</strong>r reichhaltigen<br />
Ausstattung mit 200 Farbbil<strong>de</strong>rn ist<br />
<strong>de</strong>r Preis <strong>de</strong>s Buches, das seit 1979<br />
angekündigt war, beson<strong>de</strong>rs günstig.<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
205
INFO<br />
Suche<br />
mit Google ©<br />
www.ifrr.<strong>de</strong><br />
www.ifrr.<strong>de</strong><br />
Editorial<br />
Beiträge<br />
Beiträge<br />
UnterrichtspraxisUnterrichtspraxis<br />
Literatur<br />
INFOEditorial<br />
& Medien<br />
INFO online jetzt unter unter: :<br />
www.ifrr.<strong>de</strong><br />
www.ifrr.<strong>de</strong><br />
Literatur &<br />
Medien<br />
Archiv<br />
Archiv<br />
Kontakt<br />
Kontakt<br />
Impressum<br />
Impressum<br />
Home<br />
Tag <strong>de</strong>r Religionspädagogik und Jugendarbeit 2002<br />
„Kooperation von Staat und Kirche im Bereich Bildung /<br />
Joachim Jacobi<br />
Der HERR DER RINGE und die HARRY-POTTER-Romane in<br />
„Unterschie<strong>de</strong> erkennen und Unterschie<strong>de</strong> bejahen!” -<br />
philosophisch-theologischer Perspektive<br />
Ein Gespräch zwischen Linus Prof. Hauser em. Dr. Hartmut von Hentig<br />
und Dr. Eckhard Nordhofen<br />
Halloween zwischen Brauchtum und „Verbrauchertum“<br />
„Was ist schief an Ute Pisa? Lonny-Platzbecker<br />
- Sieben Thesen / Thomas Ruster<br />
Sie suchen einen bestimmten Artikel,<br />
von <strong>de</strong>m Sie nicht wissen, in welcher<br />
Ausgabe er erschienen ist?<br />
Sie interessieren sich für die Themen<br />
<strong>de</strong>r aktuellen o<strong>de</strong>r einer zurückliegen<strong>de</strong>n<br />
Ausgabe?<br />
Sie möchten Ihren Religionsunterricht<br />
durch originelle unterrichtspraktische Hilfen<br />
beleben?<br />
Sie sind neugierig, wie die sog. Populär-<br />
Kultur und Ihr Religionsunterricht in einen<br />
fruchtbaren Dialog treten können?<br />
Sie suchen anregen<strong>de</strong> theologische<br />
und religionspädagogische Literatur?<br />
INFO 4/2002<br />
INFO 3/2004<br />
Was ist schief an Pisa?<br />
<strong>Einfach</strong> <strong>fantastisch</strong>!<br />
Das Fantastische im<br />
Religionsunterricht<br />
Gott will das Leben – Gott sen<strong>de</strong>t Jona.<br />
Susanne Heil<br />
Manieren in Kirchenräumen?<br />
August Heuser<br />
PDF<br />
Sie möchten sich fortbil<strong>de</strong>n und suchen<br />
eine Veranstaltung?<br />
Sie wollen ein Themenheft bestellen<br />
o<strong>de</strong>r die Zeitschrift abonnieren?<br />
Sie wollen einfach auf <strong>de</strong>m Laufen<strong>de</strong>n<br />
bleiben, was rund um <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> passiert?<br />
Dies und vieles mehr bietet Ihnen INFO<br />
online. Unter www.ifrr.<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>n Sie im<br />
Internet die neue Online-Ausgabe <strong>de</strong>r<br />
„Informationen für Religionslehrerinnen<br />
und Religionslehrer“ im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong><br />
– Besuchen Sie uns im World Wi<strong>de</strong> Web!
I. Zielsetzung<br />
Die Stiftung DEY för<strong>de</strong>rt charakterlich<br />
geeignete Kin<strong>de</strong>r, Jugendliche,<br />
Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> und Stu<strong>de</strong>nten/-innen<br />
aus katholischen Familien, die eine hohe<br />
Begabung intellektueller o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rer<br />
Art besitzen, i<strong>de</strong>ell und materiell. Durch<br />
ihre För<strong>de</strong>rung will die Stiftung DEY zur<br />
Heranbildung qualifizierten katholischen<br />
Nachwuchses in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nsten<br />
Bereichen unserer Gesellschaft<br />
beitragen.<br />
II. För<strong>de</strong>rungskriterien<br />
Für eine Bewerbung müssen folgen<strong>de</strong><br />
Kriterien gleichzeitig erfüllt sein:<br />
katholische Konfession<br />
beson<strong>de</strong>re Begabung und fachliche<br />
Qualifikation<br />
kirchliches Engagement<br />
charakterliche Eignung<br />
III. För<strong>de</strong>rungsleistungen<br />
Zuwendungen durch einmalige<br />
o<strong>de</strong>r periodische Geldleistungen<br />
Unterstützung beim Ergreifen<br />
bestehen<strong>de</strong>r Bildungsmöglichkeiten<br />
und bei <strong>de</strong>r Erschließung neuer<br />
Bildungswege<br />
Ermöglichung menschlicher Kontakte<br />
innerhalb <strong>de</strong>s geför<strong>de</strong>rten Kreises<br />
IV. För<strong>de</strong>rungsdauer<br />
Die För<strong>de</strong>rung wird zunächst für die<br />
Dauer eines Kalen<strong>de</strong>rjahres gewährt.<br />
Eine Verlängerung <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rung kann<br />
vom Stipendiaten, von <strong>de</strong>r Stipendatin<br />
ggf. beantragt wer<strong>de</strong>n. Vor <strong>de</strong>r Entscheidung<br />
über eine weitere För<strong>de</strong>rung<br />
wird u.a. durch eine Leistungskontrolle<br />
(Arbeitsbericht) festgestellt, ob dies<br />
gerechtfertigt ist. Eine Verlängerung wird<br />
jeweils für <strong>de</strong>n Zeitraum eines weiteren<br />
Jahres gewährt.<br />
Anträge sind zu richten an:<br />
Bischöfliches Ordinariat<br />
Kuratorium <strong>de</strong>r Stiftung DEY<br />
z. Hd. Herrn Dr. Eckhard Nordhofen<br />
Rossmarkt 12<br />
65549 <strong>Limburg</strong>/Lahn<br />
V. Bewerbungs- und<br />
Auswahlverfahren<br />
Es gilt das Prinzip <strong>de</strong>r Selbstbewerbung.<br />
Der standardisierte Bewerbungsbogen<br />
kann mit einem formlosen Schreiben<br />
bei <strong>de</strong>r Stiftung angefor<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen<br />
müssen bis spätestens 31.12. für das<br />
Folgejahr vorliegen.<br />
Die Bewerbung soll folgen<strong>de</strong> Unterlagen<br />
enthalten:<br />
Bewerbungsbogen<br />
ausführlicher Lebenslauf<br />
Zusammenstellung <strong>de</strong>r bisherigen<br />
Ausbildungs- und Studienschwerpunkte<br />
ggf. eine Darstellung <strong>de</strong>s<br />
Dissertationsvorhabens<br />
Abschlusszeugnisse bzw. sonstige<br />
Qualifikationen und Nachweise<br />
Referenz durch einen Priester<br />
und/o<strong>de</strong>r Pastorale Mitarbeiter/-in<br />
Bewerber/-innen, die in die engere<br />
Wahl einbezogen wer<strong>de</strong>n, bittet die<br />
Stiftung zu einem Gespräch.<br />
Die endgültige Entscheidung über einen<br />
För<strong>de</strong>rungsantrag trifft das Kuratorium.<br />
Das Bemühen um eine möglichst faire,<br />
umfassen<strong>de</strong> Beurteilung <strong>de</strong>r Persönlichkeit<br />
eines je<strong>de</strong>n Bewerbers, einer je<strong>de</strong>n<br />
Bewerberin kennzeichnet das Auswahlverfahren<br />
<strong>de</strong>r Stiftung; dazu gehört ein<br />
differenziertes Verständnis von Begabung.<br />
Auf generalisieren<strong>de</strong> Metho<strong>de</strong>n<br />
zu ihrer Bestimmung wird bewusst<br />
verzichtet. Im Vor<strong>de</strong>rgrund steht die<br />
individuelle Bewertung von Eignung,<br />
Leistungsfähigkeit und –bereitschaft mit<br />
Blick auf das jeweils angestrebte<br />
Bildungs- bzw. Ausbildungsziel.<br />
Das Kuratorium erwartet, dass <strong>de</strong>r/die<br />
Bewerber/-in darüber informiert, ob<br />
von einer an<strong>de</strong>ren Einrichtung eine<br />
För<strong>de</strong>rung beantragt wur<strong>de</strong> bzw.<br />
bereits geleistet wird.<br />
Grün<strong>de</strong> für die Aufnahme o<strong>de</strong>r die<br />
Ablehnung wer<strong>de</strong>n nicht mitgeteilt.<br />
Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in<br />
die För<strong>de</strong>rung besteht nicht.<br />
BISTUM LIMBURG<br />
Die unselbstständige<br />
Stiftung DEY mit <strong>de</strong>m Sitz<br />
in <strong>Limburg</strong> an <strong>de</strong>r Lahn<br />
geht zurück auf eine<br />
Schenkung <strong>de</strong>r<br />
Geschwister Dey aus <strong>de</strong>m<br />
Jahr 1987
Bestell-Liste<br />
Themen <strong>de</strong>r Hefte 1980 – 2004<br />
Die nachfolgen<strong>de</strong>n Hefte können, solange <strong>de</strong>r Vorrat reicht, nachbestellt wer<strong>de</strong>n:<br />
Jahrgang 1980<br />
Heft 1/2: *Audiovisuelle Medien<br />
Heft 3: * Die Bibel im Religionsunterricht<br />
Heft 4: Jesus Christus – Gott wird Mensch o<br />
Jahrgang 1981<br />
Heft 1/2: Beten in <strong>de</strong>r Schule o<br />
Heft 3: Im Dialog o<br />
Heft 4: Für euch und für alle o<br />
Jahrgang 1982<br />
Heft 1/2: Religiöse Erziehung in <strong>de</strong>r Eingangsstufe o<br />
Heft 3: Religionsunterricht in <strong>de</strong>r Primarstufe o<br />
Heft 4: * Religionsunterricht<br />
Jahrgang 1983<br />
Heft 1: * Katholische Soziallehre<br />
Heft 2/3:* Nehmet einan<strong>de</strong>r an ...<br />
Heft 4: * Das Reich Gottes ist nahe ... (Mk 1.15)<br />
Jahrgang 1984<br />
Heft 1/2:* Maria<br />
Heft 3: * Das Kirchenjahr<br />
Heft 4: * Lebenswege – Glaubenswege<br />
Jahrgang 1985<br />
Heft 1/2:* 750 Jahre <strong>Limburg</strong>er Dom<br />
Heft 3: * Theologie <strong>de</strong>r Befreiung<br />
Heft 4: Armuts-Bewegungen o<br />
Jahrgang 1986<br />
Heft 1/2: Kirche im Aufbruch o<br />
Heft 3: Christen und Ju<strong>de</strong>n o<br />
Heft 4: Mit Wi<strong>de</strong>rsprüchen leben o<br />
Jahrgang 1987<br />
Heft 1/2:* Christen und Muslime<br />
Heft 3: * Christen und New Age<br />
Heft 4: Christen und Schöpfung o<br />
Jahrgang 1988<br />
Heft 1: Afrika begegnen – MISEREOR ‘88 o<br />
Heft 2/3: Schule und Leben o<br />
Heft 4: Mystik und Politik o<br />
Jahrgang 1989<br />
Heft 1/2: Brennpunkt: Religionsunterricht o<br />
Heft 3: * Sakramente im Religionsunterricht<br />
Heft 4: * Der lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Mensch – Der lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Gott<br />
Jahrgang 1990<br />
Heft 1: * Paulus – Der Lehrer<br />
Heft 2/3:* Religion und Musik<br />
Heft 4: * Impulse für die Kirche<br />
Jahrgang 1991<br />
Heft 1/2: *Prophetinnen und Propheten im<br />
Religionsunterricht<br />
Heft 3: Mitwelt – Schöpfung o<br />
Heft 4: Neue Re<strong>de</strong> von Maria o<br />
Jahrgang 1992<br />
Heft 1/2:* Herausfor<strong>de</strong>rung Islam<br />
Heft 3: * Biotechnik und Ethik<br />
Jahrgang 1993<br />
Heft 1: Qumran Essener Jesus o<br />
Heft 2/3:* Sterben / Tod / Eschatologie<br />
Heft 4: Religionsunterricht und Literatur o<br />
Jahrgang 1994<br />
Heft 1: * Fundamentalismus in Gesellschaft<br />
und Kirche<br />
Heft 2: * Von Gott re<strong>de</strong>n im Religionsunterricht<br />
Heft 3: Kirchengeschichte im Religionsunterricht o<br />
Heft 4: Das Erste Tesament und die Christen o<br />
Jahrgang 1995<br />
Heft 1: „Wenn die Kirche zur Schule geht ...“ o<br />
Heft 2: „Ich wer<strong>de</strong> von meinem Geist ausgießen<br />
über alles Fleisch“ (Apg 2,17) o<br />
Heft 3: Gespeicherte Erinnerung –<br />
Das Museum als Lernort o<br />
Heft 4: „Ich war hungrig; und ihr ...“ (Mt 25,35; 42)<br />
Vom Umgang mit <strong>de</strong>r Armut o<br />
Anzahl Anzahl<br />
Jahrgang 1996<br />
Heft 1: „Ihr seid zur Freiheit berufen ...“ (Gal 5,13)<br />
Er-löst! o<br />
Heft 2: „Er stellte ein Kind in ihre Mitte ...“ (Mt 18,1) o<br />
Heft 3: „... und spielte vor ihm allezeit.“ (Spr. 8,30 b) o<br />
Heft 4: Konfessionalität <strong>de</strong>s Religionsunterrichts o<br />
Jahrgang 1997<br />
Heft 1: * „Und vergib uns unsere Schuld.“ (Mt 6,12)<br />
Heft 2: * Alternativ leben<br />
Heft 3: Mit mehr Sinn(en) leben o<br />
Heft 4: „Typisch Mädchen?“<br />
Mädchenerziehung in <strong>de</strong>r Schule o<br />
Jahrgang 1998<br />
Heft 1: „Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!“<br />
(Ez 18,32) o<br />
Heft 2: „Vergesst mir die Berufsschüler nicht“ o<br />
Heft 3: Gemeinschaft <strong>de</strong>r Heiligen. Große Gestalten <strong>de</strong>s<br />
<strong>Bistum</strong>s und ihre Wirkung in unserer Zeit o<br />
Heft 4: * Ju<strong>de</strong>n – Muslime – Christen.<br />
Die drei Kin<strong>de</strong>r in Abrahams Schoß<br />
Jahrgang 1999<br />
Heft 1: Gottes Er<strong>de</strong> – Zum Wohnen gemacht.<br />
Unsere Verantwortung für die Schöpfung o<br />
Heft 2: En<strong>de</strong>? Apokalyptische Visionen in<br />
Vergangenheit und Gegenwart o<br />
Heft 3: Begegnungen mit <strong>de</strong>m Buddhismus o<br />
Heft 4: Jugendliche I<strong>de</strong>ntität–Christlicher Glaube o<br />
Jahrgang 2000<br />
Heft 1: * Heiliges Jahr 2000<br />
Heft 2: * RU online. Neue Medien im Religionsunterricht<br />
Heft 3: Kirchenraum als Lernort o<br />
Heft 4: „Schwarz greift ein“. Vom kritischen Verhältnis<br />
kirchlicher Religiosität zur „civil religion“<br />
Jahrgang 2001<br />
o<br />
Heft 1: Erinnerung für die Zukunft.<br />
Kirchengeschichte im Religionsunterricht o<br />
Heft 2: * Religionsunterricht – Da steckt Musik drin<br />
Heft 3: Chancen sehen – Der Religionsunterricht <strong>de</strong>r<br />
Zukunft o<br />
Heft 4: * Auf <strong>de</strong>r Suche nach einer lebendigen<br />
Mystik<br />
Jahrgang 2002<br />
Heft 1: In <strong>de</strong>r Spur <strong>de</strong>s Auferstan<strong>de</strong>nen –<br />
leiblich auferstehen o<br />
Heft 2: „Das wäre ja gelacht!“ Humor und<br />
Komik im Religionsunterricht o<br />
Heft 3: Perspektivenwechsel – Behin<strong>de</strong>rung mit<br />
an<strong>de</strong>ren Augen sehen o<br />
Heft 4: Was ist schief an PISA? o<br />
Jahrgang 2003<br />
Heft 1: * Der achte Schöpfungstag?<br />
Heft 2: „Nimm und lies!“ o<br />
Heft 3: Zeit für die Zeit o<br />
Heft 4: Der Sinn für die Fülle o<br />
Jahrgang 2004<br />
Heft 1: Ars moriendi – Ars vivendi o<br />
Heft 2: Philosophieren mit Kin<strong>de</strong>rn im<br />
Religionsunterricht o<br />
Heft 3: <strong>Einfach</strong> <strong>fantastisch</strong>! Das Fantastische<br />
im Religionsunterricht o<br />
* Diese Ausgaben sind vergriffen.<br />
je Ausgabe € 1.60<br />
INFO<br />
Name<br />
Vorname<br />
Schule<br />
Straße<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon<br />
Bitte ausfüllen, kopieren<br />
und faxen an:<br />
06431/295-237<br />
o<strong>de</strong>r per Post sen<strong>de</strong>n an:<br />
Dezernat<br />
Schule und Hochschule<br />
Bischöfliches Ordinariat<br />
<strong>Limburg</strong><br />
Dipl.-Theol. Martin W. Ramb<br />
Postfach 1355<br />
65533 <strong>Limburg</strong>
„Was sagt mir ‘Gott’?“<br />
Wochenzeitschrift „Christ in <strong>de</strong>r<br />
Gegenwart“ sucht unter Schülerinnen<br />
und Schülern nach Antworten<br />
Zum letzten großen Tabu in unserer<br />
Kultur wur<strong>de</strong>: Gott. Doch ist „Gott“ zugleich<br />
das spannendste Rätsel. Die Wochenzeitschrift<br />
Christ in <strong>de</strong>r Gegenwart<br />
lädt Religionslehrer/-innen mit ihren<br />
Schülerinnen und Schülern ab <strong>de</strong>r zehnten<br />
Jahrgangsstufe ein, auf die Frage zu<br />
antworten: „Was sagt mir ‚Gott’?“<br />
Die Antworten wer<strong>de</strong>n in Christ in<br />
<strong>de</strong>r Gegenwart bzw. auf <strong>de</strong>r Homepage<br />
www.christ-in-<strong>de</strong>r-gegenwart.<strong>de</strong> veröffentlicht.<br />
Das Wesentliche fin<strong>de</strong>n<br />
Meditation – Besinnung – Exerzitien<br />
im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong><br />
Juli bis Dezember 2004<br />
Unter <strong>de</strong>m Motto „Das Wesentliche<br />
fin<strong>de</strong>n“ ist eine Übersicht <strong>de</strong>r<br />
Exerzitienangebote <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s <strong>Limburg</strong><br />
für die Monate Juli bis Dezember<br />
2004 erschienen.<br />
Das Angebot reicht von Ignatianischen<br />
Exerzitien über Exerzitien in Gemeinschaft,<br />
Meditation/Besinnung, Re-<br />
Veranstaltungen Soweit<br />
PÄDAGOGISCHES<br />
<strong>de</strong>r Bistümer im Lan<strong>de</strong> Hessen<br />
Unter allen Einsendungen wer<strong>de</strong>n<br />
drei Religionsklassen/Kurse ausgelost,<br />
in <strong>de</strong>nen je<strong>de</strong>r Beteiligte einschließlich<br />
<strong>de</strong>r Lehrerin, <strong>de</strong>s Lehrers Gutscheine für<br />
Bücherkäufe erhält:<br />
1. Preis im Wert von 30 € je Person<br />
2. Preis im Wert von 20 € je Person<br />
3. Preis im Wert von 15 € je Person<br />
Die Verlosung fin<strong>de</strong>t Anfang Dezember<br />
2004 statt. Alle bis dahin eingegangenen<br />
Antworten wer<strong>de</strong>n für die<br />
Auslosung berücksichtigt. Die Aktion<br />
„Was sagt mit, ‚Gott’?“ wird über <strong>de</strong>n<br />
Termin hinaus weitergeführt.<br />
gelmäßig Meditationsangebote, Kurse<br />
zum Thema „Rhythmus – Atmen – Bewegung“,<br />
Tagesveranstaltungen bis hin<br />
zu Tagen <strong>de</strong>r Vorbereitung auf Advent<br />
und Weihnachten.<br />
Falls keine beson<strong>de</strong>re Zielgruppe<br />
angegeben ist, richten sich die Angebote<br />
an alle Interessierten je<strong>de</strong>n Alters.<br />
Anmeldungen zu <strong>de</strong>n einzelnen Veranstaltungen<br />
erfolgen zumeist direkt bei<br />
<strong>de</strong>n jeweiligen Veranstaltern, bei <strong>de</strong>nen<br />
auch ausführlichere Programme erhältlich<br />
sind. Die entsprechen<strong>de</strong>n Adres-<br />
Nähere Informationen, Anregungen,<br />
Unterrichtsentwürfe für drei Schulstun<strong>de</strong>n<br />
sowie die Dokumentation <strong>de</strong>r<br />
Aktion sind zu fin<strong>de</strong>n unter www.<br />
christ-in-<strong>de</strong>r-gegenwart.<strong>de</strong>.<br />
Kostenlose Son<strong>de</strong>rdrucke und Ausgaben<br />
von Christ in <strong>de</strong>r Gegenwart zur<br />
Initiative können bei <strong>de</strong>r Redaktion bestellt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Einsen<strong>de</strong>adresse:<br />
„Christ in <strong>de</strong>r Gegenwart“<br />
Hermann-Her<strong>de</strong>r-Str. 4<br />
D-79104 Freiburg i. Br.<br />
cig@her<strong>de</strong>r.<strong>de</strong><br />
Fon 0761/2717-276; Fax -243<br />
sen, Fon- und Fax-Nummern, z. T. auch<br />
E-Mail-Anschriften sind auf einer eigenen<br />
Übersichtsseite <strong>de</strong>s Faltblattes<br />
enthalten.<br />
Bezug <strong>de</strong>s Faltblattes:<br />
Diözese <strong>Limburg</strong>, Referat Exerzitien,<br />
Roncalli-Haus, Friedrichstraße 26-28,<br />
65185 Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Fon: 0611/174-124<br />
Fax: 0611/174-122<br />
E-Mail: t.schumacher@roncallihaus.<strong>de</strong><br />
nicht an<strong>de</strong>rs angegeben, fin<strong>de</strong>n alle Kurse im<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod, statt.<br />
PZ 01/2004<br />
03.09.2004, 09.00 Uhr, bis 04.09.2004, 18.00 Uhr<br />
Präsentation mit PowerPoint<br />
Grundlagen<br />
Dr. Helga Jarei<br />
Leher/-innen aller Schularten und Fächer<br />
Eigenkostenanteil: 35.00 €<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
209
INFOS & AKTUELLES<br />
210<br />
PZ 02/2004<br />
20.09.2004, 14.30 Uhr, bis 22.09.2004, 13.00 Uhr<br />
Religion im Film –<br />
Filme im Religionsunterricht<br />
Vom Fantasy Epos („Herr <strong>de</strong>r Ringe“) bis zur<br />
Tragikomödie („Mann ohne Vergangenheit“)<br />
Prof. Dr. Reinhold Zwick, Münster;<br />
Franz Günther Weyrich, Wetzlar<br />
Deutsch-, Ethik-, Philosophie-, Religionslehrer/-innen <strong>de</strong>r Sek I und Sek II<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 03/2004<br />
23.09.2004, 14.30 Uhr, bis 25.09.2004, 13.00 Uhr<br />
„Ringen mit Jakob“ o<strong>de</strong>r: Biblische<br />
Überlieferungen ins Spiel bringen<br />
Eine Einführung ins Bibliodrama<br />
Gerhard Hielscher, <strong>Limburg</strong>; Irmgard Kaspar, Hadamar<br />
Ethik- und Religionslehrer/-innen an Grundschulen, 5. und 6. Klassen, Sek II<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 04/2004<br />
29.09.2004, 14.00 Uhr, bis 01.10.2004, 13.00 Uhr<br />
„Und je<strong>de</strong>m Anfang wohnt ein Zauber<br />
inne ...“ (Hermann Hesse)<br />
Vom Zauber und <strong>de</strong>n Herausfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s<br />
Anfangens im Religionsunterricht<br />
Eva-Maria Bauer, Rottenburg<br />
Religionslehrer/-innen an Grundschulen<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 05/2004<br />
06.10.2004, 14.30 Uhr, bis 08.10.2004, 13.00 Uhr<br />
Mathematische Mo<strong>de</strong>llierung.<br />
Was Schildkröten und Schuhsohlen gemeinsam haben<br />
Dr. Martin Bracke, Kaiserslautern, u.a.<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Mathematik und Naturwissenschaften<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 06/2004<br />
08.10.2004, 10.00 Uhr, bis 09.10.2004, 18.00 Uhr<br />
„Ängstlicher Riese und mutige Maus“<br />
Möglichkeiten szenischer Umsetzung von<br />
Bil<strong>de</strong>r- und Kin<strong>de</strong>rbüchern<br />
Elke Mai-Schrö<strong>de</strong>r, Frankfurt<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Klassen 1-5<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 07/2004<br />
11.10.2004, 10.00 Uhr, bis 12.10.2004, 13.00 Uhr<br />
Religionspädagogik unterrichten<br />
ohne Religion?<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Begegnung mit religiösen Ten<strong>de</strong>nzen<br />
Dr. Rainer Möller, Koblenz; OR Jürgen Weiler, Mainz<br />
In Kooperation mit <strong>de</strong>m ILF Mainz<br />
Religionslehrer/-innen an Fachschulen für Sozialpädagogik<br />
Eigenkostenanteil: 20.00 €<br />
PZ 08/2004<br />
13.10.2004, 14.30 Uhr, bis 15.10.2004, 13.00 Uhr<br />
Stimme – Stimmung – Stimmbildung<br />
Stimmbildung für Sprechberufler<br />
Sigrid Ratmann, Hünstetten<br />
Lehrer/-innen aller Schularten und Fächer; Erzieher/-innen<br />
Eigenkostenanteil: 45.00 €<br />
PZ 09/2004<br />
03.11.2004, 14.30 Uhr, bis 05.11.2004, 13.00 Uhr<br />
Wahrnehmen und Bewegen als<br />
Grundlage für Lernen und Verhalten<br />
Wahrnehmungsstörungen und ihre Auswirkungen auf<br />
Lernen und Verhalten (ADS; ADSH; LRS; Dyskalkulie)<br />
Dorothea Beigel, Wetzlar<br />
Erzieher/-innen; Lehrer/-innen an Grundschulen und Sek I<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 10/2004<br />
10.11.2004, 14.30 Uhr, bis 12.11.2004, 13.00 Uhr<br />
Erbacher Hof, Mainz<br />
Schulpastoral an meiner Schule ?!<br />
Impulse – Konzepte – weitere Schritte<br />
Dr. Brigitte Lob, <strong>Bistum</strong> Mainz; Klemens Rasche, <strong>Bistum</strong><br />
<strong>Limburg</strong>; Wolfgang Ritz, <strong>Bistum</strong> Fulda; N.N.<br />
Lehrer/-innen aller Schulformen sowie in <strong>de</strong>r Schule Tätige mit Interesse<br />
an schulpastoralem Wirken<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 11/2004<br />
17.11.2004, 14.30 Uhr, bis 19.11.2004, 13.00 Uhr<br />
Kloster Salmünster, Bad So<strong>de</strong>n-Salmünster<br />
Angst vor Gewalt<br />
Möglichkeiten gezielter Gewaltprävention<br />
Stefan Werner, Bingen<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Sek I und Berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schulen<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 12/2004<br />
19.11 2004, 18.00 Uhr, bis 20.11.2004, 18.00 Uhr<br />
Spiritualität und Konfliktfähigkeit<br />
Modul 1<br />
Beginn einer Seminarreihe zur spirituellen Dimension<br />
in Kommunikation und Konflikten am Arbeitsplatz<br />
Dr. Isol<strong>de</strong> Macho-Wagner, Idstein; Thomas Wagner, <strong>Limburg</strong>
Lehrer/-innen aller Schularten; Erzieher/-innen; Eltern<br />
Modul 2: PZ 24/2004; Modul 3: PZ 40/2004;<br />
Modul 4: PZ 45/2004; Modul 5: PZ 51/2004<br />
Es können nur Anmeldungen für alle fünf Module<br />
berücksichtigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Eigenkostenanteil für Modul 1-5: 195.00 €<br />
PZ 13/2004<br />
22.11.2004, 14.30 Uhr, bis 24.11.2004, 13.00 Uhr<br />
Präsentation als Prüfungsform in Latein<br />
Vorbereitung auf die neue Abiturprüfungsform<br />
Thomas Martin, Amöneburg<br />
Lateinlehrer/-innen<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 14/204<br />
22.11.2004, 14.30 Uhr, bis 24.11.2004, 13.00 Uhr<br />
Hessen im Umbruch<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges und Weimarer Republik<br />
Dr. Thomas Lange, Darmstadt; Markus Müller-Henning, Oestrich-<br />
Winkel; Dr. Reinhard Neebe, Marburg; Ulrich Kirchen, Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Geschichts-, Gemeinschaftskun<strong>de</strong>lehrer/-innen <strong>de</strong>r Sek I und Sek II<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 15/2004<br />
24.11.2004, 10.00 Uhr, bis 26.11.2004, 13.00 Uhr<br />
Schwierige Schüler – schwierige Klassen<br />
Berufsbezogene Selbsterfahrung mit <strong>de</strong>r<br />
Psychodrama-Metho<strong>de</strong><br />
Hessisches Lan<strong>de</strong>sinstitut für<br />
Pädagogik (HeLP),<br />
Fachbereich Kath. Religionslehre<br />
Astrid Reinhatdt, Gießen<br />
Lehrer/-innen aller Fächer und Schularten<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
PZ 16/2004<br />
29.11.2004, 14.30 Uhr, bis 01.12.2004, 13.00 Uhr<br />
Einblicke in die integrative Gestaltpädagogik<br />
Sr. Cecilie Leimgruber; Martin Kläsner, Marienstatt<br />
Lehrer/-innen aller Schularten<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
Bitte beachten Sie PZ 35/2O04: Lehrgang mit Zertifikat<br />
PZ 17/2004<br />
01.12.2004, 14.30 Uhr, bis 03.12.2004, 13.00 Uhr<br />
Systemisch-lösungsorientierte Supervision<br />
in pädagogischen Handlungsfel<strong>de</strong>rn<br />
Praxisbezogenes Seminar<br />
Monika Bohn, Oberursel<br />
Erzieherinnen; Lehrer/-innen aller Schularten<br />
Eigenkostenanteil: 35.00 €<br />
PZ 18/2004<br />
03.12.2004, 10.00 Uhr, bis 04.12.2004, 18.00 Uhr<br />
Erzählwerkstatt<br />
Spielerisch Geschichten erzählen<br />
Thomas Hofmeister-Höfener, Sen<strong>de</strong>nhorst<br />
Erzieher/-innen und (Religions)Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Grundschulen und Sek I<br />
Eigenkostenanteil: 30.00 €<br />
Weitere IInnffoorrmmaattiioonneenn zu <strong>de</strong>n KKuurrsseenn fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r Homepage <strong>de</strong>s Pädagogischen Zentrums: wwwwww..ppzz--hheesssseenn..d<strong>de</strong>e ab ca. 2 Monate<br />
vor Kursbeginn.<br />
SScchhrriiffttlliicchhee AAnnmmeelldduunnggeenn wer<strong>de</strong>n umgehend erbeten, spätestens jedoch bis vviieerr Wochen vor Lehrgangsbeginn an: PPääddaaggooggiisscchheess ZZeenn-ttrruumm<br />
d<strong>de</strong>err BBiissttüümmeerr iimm LLaannd<strong>de</strong>e HHeesssseenn,, WWiillhheellmm--KKeemmppff--HHaauuss,, 6655220077 WWiieessbbaad<strong>de</strong>enn--NNaauurroodd.. Fon: 0 61 27 / 7 72 83; Fax: 0 61 27 / 7 72 46; E-Mail:<br />
anmeldung@pz-hessen.<strong>de</strong>. Anmeldung auch über die Homepage: www.pz-hessen.<strong>de</strong>, entsprechen<strong>de</strong>n Kurs anklicken, dann auf „Anmeldung<br />
zu diesem Kurs“.<br />
Die Lehrgänge sind gemäß Erlass <strong>de</strong>s Hessischen Kultusministeriums vom 01.07.1997 – Nr. V B 3.1-960/500-200 – in Verbindung mit Erlass<br />
vom 17.07.2003 Nr. VII-7-95.b.03-02 als Fortbildungsveranstaltung anerkannt.<br />
Die Unterrichtsbefreiung für die Teilnahme an <strong>de</strong>n Lehrgängen erfolgt bei 1-3tägigen Veranstaltungen durch die Schulleitung, bei 4und<br />
mehrtägigen Veranstaltungen durch das Staatliche Schulamt (vgl. Erlass <strong>de</strong>s HKM v. 01.07.1997 – B V 3.1-960-500 –200–) bzw. bei<br />
<strong>de</strong>n Katholischen Schulen in Freier Trägerschaft durch <strong>de</strong>n Schulträger.<br />
01.-05. November 2004<br />
Tagungsstätte Weilburg (HeLP)<br />
Compassion – Werteerziehung in <strong>de</strong>r<br />
Schule<br />
Berufsschullehrerwoche<br />
Prof. Dr. Lothar Kuld, Weingarten; Dr. Stefan Gönnheimer,<br />
Kirchzarten<br />
Religionslehrer/-innen an Berufsschulen<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
211
INFOS & AKTUELLES<br />
212<br />
15.-17. November 2004 (Beginn: Montags 15.00 Uhr)<br />
Karlsheim, Kirchähr<br />
Kontaktstudium <strong>de</strong>r Universität Frankfurt<br />
(Fachbereich Katholische Theologie)<br />
Interkulturelle Begegnung und Dialog<br />
– Das Volk <strong>de</strong>r Mapuche in Chile<br />
Prof. Dr. Fernando Diaz, Temuco / Santiago <strong>de</strong> Chile,<br />
Beauftragter <strong>de</strong>r Bischofskonferenz für die indigenen<br />
Pastoral beim Volk <strong>de</strong>r Mapuche in Chile<br />
Lehrer/-innen aller Schulformen mit <strong>de</strong>m Fach Katholische Religion<br />
AAnnmmeelldduunnggeenn aann:: HHeessssiisscchheess LLaannd<strong>de</strong>essiinnssttiittuutt ffüürr PPääddaaggooggiikk ((HHeeLLPP)),, SSeerrvviicceesstteellllee WWeeiillbbuurrgg FFaaxx:: 0066447711 // 332288119911,, iimm IInntteerrnneett üübbeerr<br />
wwwwww..hheellpp..bbiilldduunngg..hheesssseenn..d<strong>de</strong>e per Faxformular (in allen Schulen vorhan<strong>de</strong>n) o<strong>de</strong>r anfor<strong>de</strong>rn über aa..sscchhmmaacckkeerr@@hheellpp..hheesssseenn..d<strong>de</strong>e.<br />
Fon: 0 69 / 38 98 92 21 o<strong>de</strong>r 0 69 / 41 11 05.<br />
Bitte mel<strong>de</strong>n Sie sich unbedingt rechtzeitig an, da es schwierig ist, die Veranstaltung im Programm zu behalten, wenn 5 Wochen vor<br />
Lehrgangsbeginn noch nicht genügend Anmeldungen vorliegen.<br />
Für die Zentralen Fortbildungen im Fach Katholische Religion wird <strong>de</strong>r Veranstalter ab 0011.. JJaannuuaarr 22000055 nicht mehr HeLP, son<strong>de</strong>rn AAffLL<br />
((AAmmtt ffüürr LLeehhrreerrbbiilldduunngg)) heißen.<br />
Ab <strong>de</strong>m 0011.. JJaannuuaarr 22000055 wer<strong>de</strong>n sich aller Voraussicht nach die Internet- und E-Mail-Adressen än<strong>de</strong>rn. Aktuelle Informationen dazu unter:<br />
hhttttpp::////lleerrnneenn..bbiilldduunngg..hheesssseenn..d<strong>de</strong>e//rreelliiggiioonn kkaatthh//<br />
Katholische Aka<strong>de</strong>mie<br />
Rabanus Maurus,<br />
Frankfurt am Main<br />
– Öffentliche Tagungen – Auswahl –<br />
Tagung Nr. 405 017<br />
01.09.2004, 19.00 Uhr<br />
Liebighaus, Schaumainkai 71, Frankfurt am Main<br />
Kunst und Religion:<br />
„Der frem<strong>de</strong> Bräutigam“<br />
Christus-Johannes-Gruppe, Oberschwaben um 1320<br />
Tagung Nr. 405 229<br />
11.09.2004, 14.00–18.00 Uhr<br />
Dominikanerkloster, Kurt-Schumacher-Str. 23, Frankfurt<br />
am Main<br />
Ewiger Frie<strong>de</strong> auf Er<strong>de</strong>n ?<br />
Kant zur Aktualität <strong>de</strong>r Überwindung <strong>de</strong>s Krieges<br />
Aka<strong>de</strong>mietag zum „Kant-Jahr“<br />
Prof. Dr. phil. Bruno Schoch, Hess. Stiftung für Frie<strong>de</strong>ns- und<br />
Konfliktforschung; Prof. Dr. phil. Dr. theol. Matthias Lutz-<br />
Bachmann, Univ. Frankfurt; Prof. em. Dr. jur. Reinhard Steiger,<br />
Univ. Gießen<br />
Kosten: 6.00 €; ermäßigt: 4.00 €<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
15.-17. November 2004 (Beginn: Montags 15.00 Uhr)<br />
Kloster Frauenberg, Fulda<br />
„ Kommt, wir gehen in eine Kirche !“<br />
Seminar zur Kirchenpädagogik<br />
OSR Dieter Wagner, Fulda<br />
Religionslehrer/-innen <strong>de</strong>r Klassen 1-7<br />
08.-10. Dezember 2004<br />
Tagungsstätte Weilburg (HeLP)<br />
Das neue Lehrerbildungsgesetz<br />
Didaktisches Forum<br />
Fachleiter <strong>de</strong>r hessischen Ausbildungsseminare für Evangelische und<br />
Katholische Religion<br />
Tagung Nr. 405 050<br />
15.09.2004, 19.00-20.00 Uhr<br />
Ikonen-Museum, Brückenstr. 3-7, Frankfurt am Main<br />
Ikonenbegegnungen: „Schule <strong>de</strong>s Lei<strong>de</strong>ns“<br />
Gottesmutter, Erweicherin <strong>de</strong>s bösen Herzens<br />
Tagung Nr. 405 234<br />
Zentrale Erwachsenenbibliothek, Zeil 17-21, Frankfurt<br />
am Main<br />
Heilige Texte aus Bibel und Koran<br />
Lesungen und Gespräch.<br />
In Kooperation mit <strong>de</strong>r Evang. Stadtaka<strong>de</strong>mie und<br />
<strong>de</strong>r Kath. Erwachsenenbildung<br />
22.09.2004, 19.30 Uhr<br />
Thema ARBEIT: Samina Khan / Yuval Lapi<strong>de</strong><br />
13.10.2004, 19.30 Uhr<br />
Thema FAMILIE: Mechthild Nauck / Esther Ellrod-<br />
Freimann / Mehmet Soyhun<br />
24.11.2004, 19.30 Uhr<br />
Thema SEXUALITÄT: Sawsan Chahrrour / Roberto<br />
Fabian<br />
Tagung Nr. 405 240<br />
25.09.2004, 10-00-20.00 Uhr<br />
Dompfarrsaal, Domplatz 14, Frankfurt am Main<br />
Bibel und Kriminalroman.<br />
Eine Wahlverwandtschaft<br />
In Kooperation mit <strong>de</strong>r Kath. Erwachsenenbildung<br />
und <strong>de</strong>r „Wen<strong>de</strong>ltreppe“, Frankfurt am Main
Zuzanna Hrasova, Univ. Münster; Hil<strong>de</strong> Ganzmüller und<br />
Jutta Wilkesmann, Die „Wen<strong>de</strong>ltreppe“, Frankfurt am Main;<br />
Annette Döbrich, Autorin, Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Kosten: 15.00 €; ermäßigt: 10.00 €<br />
Tagung Nr. 405 241<br />
28.09.2004, 18.00-21.00 Uhr<br />
Karmeliterkloster (Dormitorium), Münzgasse 9,<br />
Frankfurt am Main<br />
Pflüget ein Neues (1) (Hosea 10, 12)<br />
Kirche und Religionsgemeinschaften in Frankfurt<br />
nach <strong>de</strong>m 2. Weltkrieg.<br />
Zwischen Restauration und Aufbruch. Der <strong>de</strong>utsche<br />
Protestantismus nach 1945 und seine Geschichte in<br />
Frankfurt am Main.<br />
Die evangelische Kirche und das Stuttgarter Schuldbekenntnis.<br />
In Kooperation mit <strong>de</strong>r Ev. Aka<strong>de</strong>mie Arnoldshain,<br />
<strong>de</strong>m Institut für Stadtgeschichte und <strong>de</strong>m Referat für<br />
Weltanschauungsfragen im Bischöflichen Ordinariat<br />
<strong>Limburg</strong>.<br />
Prof. Dr. Jochen Christoph Kaiser, Univ. Marburg;<br />
Vier Zeitzeugen: u.a. Frohlin<strong>de</strong> Balser<br />
Eintritt frei<br />
Tagung Nr. 405 018<br />
13.10.2004, 19.00 Uhr<br />
Stä<strong>de</strong>l, Schaumainkai 63, Frankfurt am Main<br />
Kunst und Religion: „Du sollst dir kein Bildnis<br />
noch irgend ein Gleichnis machen“.<br />
Arnulf Rainer, Schwarze Zumalung (1960)<br />
Tagung Nr. 405 051<br />
13.10.2004, 19.00-20.00 Uhr<br />
Ikonen-Museum, Brückenstr. 3-7, Frankfurt am Main<br />
Ikonenbegegnungen: „Das Retterkind “<br />
Christus Immanuel<br />
Tagung Nr. 405 019<br />
03.11.2004, 19.00 Uhr<br />
Stä<strong>de</strong>l, Schaumainkai 63, Frankfurt am Main<br />
Kunst und Religion: „Unendlichkeit“<br />
Gustav Courbet: Die Welle (um 1869)<br />
Tagung Nr. 405 052<br />
17.11.2004, 19.00-20.00 Uhr<br />
Ikonen-Museum, Brückenstr. 3-7, Frankfurt am Main<br />
Ikonenbegegnungen: „Kopflos“<br />
Johannes <strong>de</strong>r Täufer<br />
Tagung Nr. 405 243<br />
19.11.2004, 11.00 Uhr, bis 21.11.2004, 12.30 Uhr<br />
Ev. Aka<strong>de</strong>mie Arnoldshain, Martin-Niemöller-Haus,<br />
61389 Schmitten<br />
Frauen, Männer und das Patriarchat Gottes<br />
Gen<strong>de</strong>rperspektiven auf Anthropologie und Theologie<br />
<strong>de</strong>r jüdischen, christlichen und muslimischen Tradition.<br />
Kooperation mit <strong>de</strong>r Ev. Aka<strong>de</strong>mie Arnoldshain,<br />
CIBEDO und Deutsche Muslim Liga<br />
Tagung Nr. 405 242<br />
30.11.2004, 18.00-21.30 Uhr<br />
Karmeliterkloster (Dormitorium), Münzgasse 9,<br />
Frankfurt am Main<br />
Pflüget ein Neues (2) (Hosea 10, 12)<br />
Kirchen und Religionsgemeinschaften in Frankfurt<br />
am Main nach <strong>de</strong>m 2. Weltkrieg<br />
Zwischen Restauration und Aufbruch: Katholische<br />
Kirche in Frankfurt am Main zwischen Kriegsen<strong>de</strong><br />
und <strong>de</strong>m 2. Vatikanischen Konzil.<br />
Dr. Matthias Th. Kloft, Frankfurt;<br />
Zeitzeugen: u.a. Dr. hc. Ernst Gerhardt<br />
Eintritt frei<br />
Tagung Nr. 405 020<br />
01.12.2004, 19.00 Uhr<br />
Liebighaus, Schaumainkai 71, Frankfurt am Main<br />
Kunst und Religion: „Flügelschlag“<br />
Giovanni Pisano: Engelspietà (um 1300)<br />
Tagung Nr. 405 053<br />
03.12.2004, 19.00-20.00 Uhr<br />
Ikonen-Museum, Brückenstr. 3-7, Frankfurt am Main<br />
Ikonenbegegnungen: „Der himmlische Besuch“<br />
Verkündigung<br />
Tagung Nr. 405 304<br />
07.12.2004, 17.30-21.30 Uhr<br />
Archäologisches Museum, Karmelitergasse 1, Frankfurt<br />
am Main<br />
Die Entstehung <strong>de</strong>r Geburt Jesu im Kontext<br />
antiker Religiosität<br />
Prof. Dr. theol. Dr. phil. Manfred Clauss, Univ. Frankfurt; Dr. Ingeborg<br />
Zetsche, Oberursel<br />
Kosten: 6.00 €, ermäßigt 4.00 €<br />
Tagung Nr. 405 021<br />
12.12.2004 (3. Advertssonntag),15.00 Uhr<br />
Liebighaus, Schaumainkai 71, Frankfurt am Main<br />
Kunst und Religion: Kin<strong>de</strong>r führen Kin<strong>de</strong>r<br />
„Weihnachten im Liebighaus“<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
213
INFOS & AKTUELLES<br />
214<br />
Tagung Nr. 405 022<br />
19.12.2004, 15.00 Uhr<br />
Stä<strong>de</strong>l, Schaumainkai 63, Frankfurt am Main<br />
Bibelschule Königstein<br />
Programm 2004<br />
Ursulinenkloster St. Angela, Gerichtstr. 19, 61462 Königstein<br />
1. o<strong>de</strong>r 2.12.2004<br />
Kirche und Israel<br />
Grundlegen<strong>de</strong>s zum Mt-Jahr<br />
Teilnehmergebühr: 23.00 €<br />
RHEINLAND - PFALZ<br />
ILF<br />
M A I N Z<br />
ILF-Nr. 22.109<br />
29.09.-01.10.2004<br />
Robert Schumann Haus, Trier<br />
„Dass wir sterben müssen“<br />
Fächerverbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Arbeiten zum Thema „Tod“.<br />
StR’ Lydia Willems, Pluwig; StR’ Andrea Wohlers, Saarburg;<br />
StR Christoph Hil<strong>de</strong>brandt, Saarburg<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Fächer Religion, Deutsch, Bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst,<br />
Biologie <strong>de</strong>r Sekundarstufe I<br />
ILF-Nr.: 22.107<br />
04.-06.10.2004<br />
Kloster Johannisberg, Geisenheim<br />
Der interreligiöse Dialog<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
Institut für Lehrerfort- und<br />
-weiterbildung (ILF),<br />
Mainz<br />
ÜÜbbeerrrreeggiioonnaallee<br />
VVeerraannssttaallttuunnggeenn<br />
Kunst und Religion: Blickpunkt: „Heilige<br />
Familie“<br />
Otto Dix: Die Familie <strong>de</strong>s Künstlers (1927)<br />
Zu je<strong>de</strong>r Veranstaltung gibt die Aka<strong>de</strong>mie einen eigenen Tagungsprospekt heraus, aus <strong>de</strong>m Interessenten das <strong>de</strong>taillierte Programm,<br />
<strong>de</strong>n Ort und die Kosten <strong>de</strong>r jeweiligen Veranstaltung ersehen können.<br />
Dieses, das Gesamtprogramm und weitere Informationen erhalten Sie bei: Katholische Aka<strong>de</strong>mie Rabanus Maurus, Eschenheimer Anlage<br />
21, 60318 Frankfurt am Main. Fon: 0 69 / 15 01-300; Fax: 0 69 / 29 80 28 65; E-Mail: info a KARM.<strong>de</strong>; Internet: www.KARM.<strong>de</strong><br />
10.-11.12.2004<br />
Die Kindheitsevangelien<br />
Teilnehmergebühr: 50.00 €<br />
Über die Kurse:<br />
Neues Testament im Jahr 2005<br />
und<br />
Altes Testament<br />
erteilt Interessenten die Bibelschule Königstein<br />
(Anschrift s.u.) Auskünfte.<br />
AAuusskküünnffttee erteilt: BBiibbeellsscchhuullee KKöönniiggsstteeiinn ee..VV..,, UUrrssuulliinneennkklloosstteerr SStt.. AAnnggeellaa,, GGeerriicchhttssttrr.. 1199,, 6611446622 KKöönniiggsstteeiinn,,<br />
Fon: 06174/9381-0; Fax: 06174/9381-55; E-Mail: Bibelschule.Koenigstein@gmx.<strong>de</strong><br />
Das Gespräch zwischen <strong>de</strong>n Religionen aus<br />
theologischer und religionspädagogischer Sicht.<br />
Pfr’ Heike Bosien, Stuttgart; Prof. Dr. Armin Greiner, München;<br />
StD Antonius Schulte, Mainz<br />
Fachleiter/-innen <strong>de</strong>r Fächer kath. u. evang. Religion an Gymnasien<br />
ILF-Nr. 22.108<br />
11.-12.10.2004<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n Naurod<br />
Begegnung mit religiösen Traditionen<br />
Zum Unterricht in Religion/Religionspädagogik in<br />
Lernfel<strong>de</strong>rn und Modulen<br />
StD i.K. Jürgen Weiler, Mainz; Schulreferent Dr. Rainer Möller,<br />
Koblenz.<br />
Religionslehrer/-innen an Berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schulen in <strong>de</strong>n Bildungslehrgängen<br />
für Sozialassistenz und Sozialpädagogik<br />
ILF-Nr. 22.581<br />
11.-12.10.2004<br />
Haus <strong>de</strong>r Familie, Vallendar<br />
Philosophieren mit Kin<strong>de</strong>rn<br />
Dr. Kristina Calvert, Hamburg; Ruth Lieberich, Düngenheim;<br />
N.N.<br />
Lehrer/-innen aller Schularten
ILF-Nr.: 22.103<br />
03.-05.11.2004<br />
Herz-Jesu-Kloster, Neustadt<br />
Krippe und Stern. Hirten und Engel<br />
Advent und Weihnachten in <strong>de</strong>r Grundschule<br />
FL Norbert Wolf, Mainz; FL’ Sabine Stümpert, Gensingen<br />
Lehrer/-innen an Grundschulen<br />
ILF-Nr.: 22.106<br />
09.11.2004 – Ganztägige Veranstaltung<br />
Erbacher Hof, Mainz<br />
Edith Stein und Simone Weil<br />
Philosophie und Religion im Denken und Leben<br />
zweier Frauen<br />
Patricia Rehm, Mainz; Jörg Bayer, Mainz<br />
Lehrer/-innen für Religion, Philosophie und Ethik an Gymnasien<br />
ILF-Nr.: 22.102<br />
10.-13.11.2004<br />
Haus Maria Rosenberg, Waldfischbach<br />
„So eine Lehrerin möchte ich auch sein.“<br />
OR Hubert Ries, Trier<br />
Lehrer/-innen aller Schularten<br />
Überregional interessieren<strong>de</strong><br />
Veranstaltungen <strong>de</strong>r Ämter für<br />
Katholische Religionspädagogik<br />
in <strong>de</strong>n Bezirken<br />
Frankfurt<br />
22.09.2004, 08.30-13.00 Uhr<br />
Gemein<strong>de</strong>haus St. Hedwig, Elsterstr. 18, Frankfurt am<br />
Main-Griesheim<br />
AG Höchst und West<br />
So wur<strong>de</strong> Bibel<br />
Eine Lernstraße mit 10 Stationen<br />
Christa Kuch, RPA Bad Homburg<br />
ILF-Nr.: 22.101<br />
15.-16.11.2004<br />
Robert-Schumann-Haus, Trier<br />
„Nicht nur ein Wort – es ist euer Leben!“<br />
Dialogischer Bibelunterricht mit <strong>de</strong>m Werk<br />
„Meine Schulbibel“<br />
OD Franz W. Niehl, Trier; StD Michael Zimmer, Saarbrücken<br />
Lehrer/-innen von Grundschulen und Sek I<br />
ILF-Nr.: 22.104<br />
24.-26.11.2004<br />
Forum Vinzenz Pallotti, Vallendar<br />
„Stört mir die Liebe nicht !“<br />
Aspekte einer verantwortlichen Sexualpädagogik<br />
P. Siegfried Mo<strong>de</strong>nbach SAC, Vallendar; Mitarbeiter/-innen<br />
<strong>de</strong>s pädagogischen Teams von Haus Wasserburg<br />
Religions- und Ethiklehrer/-innen <strong>de</strong>r Sekundarstufe I und II; Fachkräfte<br />
in <strong>de</strong>r Jugendarbeit<br />
ILF-Nr. 22.105<br />
06.-O8.12.2004<br />
Herz-Jesu-Kloster, Neustadt<br />
Schönheitsfehler <strong>de</strong>r Schöpfung ?<br />
Krankheit und Behin<strong>de</strong>rung in Spielfilmen<br />
Franz Günther Weyrich, Wetzlar<br />
Religionslehrer/-innen <strong>de</strong>r Sek I und II, auch an<strong>de</strong>re interessierte<br />
Lehrer/-innen<br />
AAnnmmeelldduunnggeenn erfolgen sscchhrriiffttlliicchh – d.h. bis spätestens 3 Wochen vor Kursbeginn – mit <strong>de</strong>r ggeellbbeenn AAnnmmeelld<strong>de</strong>ekkaarrttee (erhältlich beim<br />
Schulleiter o<strong>de</strong>r beim ILF Mainz) üübbeerr IIhhrree SScchhuulllleeiittuunngg an das ILF Mainz.<br />
AAnnsscchhrriifftt:: ILF Mainz, Postfach 24 50, 55014 Mainz; Kötherhofstr. 4, 55116 Mainz, Fon: 0 61 31 / 28 45 - 0; Fax: 0 61 31 / 28 45 25;<br />
http://www.ilf.bildung-rp.<strong>de</strong><br />
07.10.2004, 8.30-13.00 Uhr<br />
Haus <strong>de</strong>r Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 21,<br />
Frankfurt am Main<br />
AG Süd und Ost<br />
Ich will singen, spielen, danken <strong>de</strong>m Herrn<br />
Biblische Spiellie<strong>de</strong>r und Geschichten mit<br />
Instrumenten gestalten<br />
Christiane Sturm, Frankfurt am Main<br />
12.10.2004, 08.30-13.00 Uhr<br />
RPA <strong>de</strong>r EKHN, Rechneigrabenstr. 10, Frankfurt<br />
am Main<br />
Oekumenischer Studientag<br />
AG Sekundarstufe I<br />
Lernen in Israels Gegenwart<br />
Ulrich Schwermer, Ev. Arbeitskreis Kirche und Israel;<br />
Gregor Weigand, Kath. Projektgruppe Kirche und Synagoge<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
215
INFOS & AKTUELLES<br />
216<br />
17.11.2004, 08.30-13.00 Uhr<br />
Evang. Kirche Nie<strong>de</strong>r-Erlenbach, Zur Charlottenburg 1,<br />
Frankfurt am Main-Ni<strong>de</strong>r-Erlenbach<br />
AG Nord<br />
„Zeig uns Deine Kirche !“<br />
Wir erkun<strong>de</strong>n zwei verschie<strong>de</strong>ne Kirchen (alt – neu;<br />
evangelisch – katholisch)<br />
Hans-Josef Heun, Frankfurt am Main; Pfr. Jürgen Ackermann,<br />
Frankfurt am Main<br />
23.11.2004. 09.30-16.00 Uhr<br />
Winfriedhaus, Am Brunnengarten 9, Frankfurt am<br />
Main-Kalbach<br />
Studientag für Religionslehrer/-innen an<br />
Son<strong>de</strong>rschulen<br />
Abschied nehmen und Trauerarbeit<br />
Begleitung in schwierigen Lebenssituationen im<br />
Religionsunterricht<br />
Dr. Thomas Holzbeck, Wiesba<strong>de</strong>n<br />
25.11.2004, 9.30-13.30 Uhr<br />
Allianz-Haus, Theodor-Stern-Kai 16, Frankfurt<br />
am Main<br />
AG Gymnasien<br />
„Saints and the City“<br />
Die Heiligen im Dom, in St. Leonhard und in <strong>de</strong>r<br />
Allianz – eine gute Versicherung ?<br />
Prof. Dr. August Heuser, Dommuseum Frankfurt am Main<br />
14.10.; 04.11.; 18.11.2004, jew. 15.00-17.00 Uhr<br />
Haus <strong>de</strong>r Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 21,<br />
Frankfurt am Main<br />
Seminar für Religionslehrer/-innen aller Schularten<br />
Interne Kompetenzen nutzen:<br />
Kollegiale Beratung einüben<br />
Birgit Menzel, Studienseminar Frankfurt am Main<br />
Weiterführung <strong>de</strong>s Seminars ist möglich.<br />
Hochtaunus<br />
Konferenzraum, Bischof-Ketteler-Haus, Dorotheenstr. 9,<br />
Bad Homburg<br />
Metho<strong>de</strong>nwerkstatt Grundschule<br />
1. Termin: 11.10.2004, 15.00-17.00 Uhr<br />
Spielerische Leistungsmessung<br />
2. Termin: 08.11.2004, 15.00-17.00 Uhr<br />
„Christus, das Licht kommt an die Welt“ Eine Unterrichtsreihe<br />
zum Thema Weihnachten im 3. Schuljahr<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
3. Termin: 15.11.2004, 15.00-17.00 Uhr<br />
Freiarbeit im RU <strong>de</strong>r Grundschule<br />
Leitung: Christa Kuch<br />
Main-Taunus<br />
09.09.2004, 13.30-16.00 Uhr<br />
Gartenlabyrinth in Hofheim-Marxheim<br />
Das Gartenlabyrinth – arbeiten, spielen,<br />
lernen, tanzen ... im Labyrinth<br />
07.10.2004<br />
Bezirksamt Main-Taunus, Vinzenzhaus, Hofheim<br />
Schule und Gemein<strong>de</strong> –<br />
Das Grundschulprojekt<br />
02.-13.11.2004<br />
GTZ Eschborn<br />
Ausstellung „Frie<strong>de</strong>n braucht Fachleute“<br />
Ein Unterrichtsprojekt für die Klassen 9-13<br />
Anmeldung für Führungen: Kath. Bildungswerk<br />
Main-Taunus. Fon 06192 / 29 03 30<br />
04.12.2004, 10.00-16.00 Uhr<br />
Bezirksamt Main-Taunus, Vinzenzhaus, Hofheim<br />
Theater im Religionsunterricht – ein Praxistag<br />
Rhein-Lahn / Westerwald<br />
(Rheinland-pfälzischer Bereich <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s <strong>Limburg</strong>)<br />
ILF-Nr.22.703<br />
17.-29.11.2004; jeweils 19.00-21.30 Uhr<br />
Katholisches Bezirksamt, Montabaur<br />
Vom (Vor-)lesen zum Vortragen.<br />
Aufbaumodul: Sprechen in großen Räumen mit und<br />
ohne Mikrofon<br />
Katrin Wolf, Chefmo<strong>de</strong>ratorin, Ransbach-Baumbach<br />
Religionslehrer/-innen; Mitarbeiter/-innen in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>arbeit<br />
ILF-Nr. 22.705<br />
23.09.2004, 14.30-18.30 Uhr<br />
Priesterhaus Berg Moriah, Simmern<br />
Symbole im Religionsunterricht.<br />
Erschließung <strong>de</strong>s Symbols „WEG“<br />
Tatjana Blumenstein, Mannheim<br />
Religionslehrer/-innen
ILF-Nr. 22.702<br />
30.09.2004<br />
Museum für Mo<strong>de</strong>rne Kunst, Frankfurt am Main<br />
Religionspädagogische Exkursion<br />
Geson<strong>de</strong>rte Einladung erfolgt<br />
Prof. Dr. August Heuser, Frankfurt am Main<br />
Religionslehrer/-innen<br />
ILF-Nr. 22.704<br />
05.10.2004, 14.30-18.30 Uhr<br />
Priesterhaus Berg Moriah, Simmern<br />
Der Religionsunterricht in <strong>de</strong>r Grundschule<br />
Neuere Ansätze und Metho<strong>de</strong>n, aufgezeigt am<br />
Lehrbuchkonzept von Fragen – Suchen – Ent<strong>de</strong>cken<br />
Dr. Barbara Ort, Bamberg<br />
Religionslehrer/-innen an Grundschulen<br />
ILF-Nr. 22.709<br />
06.10.2004, 18.00-21.00 Uhr<br />
Pfarrzentrum, Großer Saal, Montabaur<br />
Film-Bistro<br />
Gemeinsam neuere Kurzfilme und Spielfilme kennen<br />
lernen, diskutieren, essen, trinken.<br />
Franz-Günther Weyrich, Wetzlar<br />
Lehrer/-innen und Interessierte<br />
Wiesba<strong>de</strong>n<br />
06.10.2004<br />
wiesba<strong>de</strong>ner Religionslehrertag<br />
Islam im Religionsunterricht<br />
Schulstufenbezogene Impulse für Unterrricht und<br />
Besuch einer Moschee<br />
27.11.2004<br />
Tod als Thema für einen lebensfrohen RU<br />
In Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>m Deutschen<br />
Katecheten-Verein<br />
N.N.<br />
Aula <strong>de</strong>r Elly-Heuss-Knapp-Schule, Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Kritisch-besinnliches Weihnachtskabarett<br />
Nähere Angaben unter www.roncallihaus.<strong>de</strong>, dann<br />
Amt für Religionspädagogik<br />
NNäähheerree AAuusskküünnffttee bei <strong>de</strong>n angegebenen ÄÄmmtteerrnn.. –<br />
AAnnsscchhrriifftteenn uunndd TTeelleeffoonnnnuummmmeerrnn ssiieehhee SSeeiitteenn 221188<br />
uunndd 221199 ..<br />
Unsere Autorinnen und Autoren:<br />
Prof. Dr. Lic. theol. Linus Hauser<br />
August-Bebel-Str. 7, 48282 Ems<strong>de</strong>tten<br />
Gem. Ref’. Susanne Heil, Im Valler 43, 65594 Runkel<br />
Dommuseumsdirektor Prof. Dr. August Heuser<br />
Rauenthaler Weg 1, 60529 Frankfurt am Main<br />
StR’ Ute Lonny-Platzbecker<br />
Grebertstr. 2 b, 65307 Bad Schwalbach<br />
Dr. Eckhard Nordhofen, Postfach 13 55, 65533 <strong>Limburg</strong><br />
Dr. Paul Platzbecker, Grebertstr. 2 b, 65307 Bad Schwalbach<br />
Dipl.-Theol. Martin W. Ramb<br />
Im Silbertal 5, 56203 Höhr-Grenzhausen<br />
Dr. Ursula Rieke, c/o Katharina Kasper-Stiftung<br />
Katharina-Kasper-Str. 12, 56428 Dernbach<br />
Unsere Rezensentinnen und Rezensenten:<br />
OStR. i. R. Helmut Bahr, Auf <strong>de</strong>r Au 22, 56132 Dausenau<br />
Dipl.-Theol. Andreas von Erdmann<br />
Schreyerstr. 22, 61476 Kronberg<br />
OR Dr. Gotthard Fuchs, Steubenstr. 17, 65189 Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Lehrerin Gabriele Hastrich, Kantstr. 6, 57627 Hachenburg<br />
Museumsdirektor Prof. Dr. August Heuser<br />
Rauenthaler Weg 1, 60529 Frankfurt am Main<br />
Prof. Dr. Dietmar Höffe<br />
Moselweißer Str. 122-128, 56073 Koblenz<br />
Prof. (em.) Dr. Bernhard Jendorff, Sandfeld 18 C, 35396 Gießen<br />
Dipl.-Theol. Dipl.-Religionspäd. Reiner Jungnitsch<br />
Eichenweg 3, 64839 Münster<br />
OStDir i. K. Rüdiger Kal<strong>de</strong>wey<br />
Ottweiler Str. 127, 66113 Saarbrücken<br />
Prof. (em.) Dr. Hans Kessler, So<strong>de</strong>ner Weg 43, 65812 Bad So<strong>de</strong>n<br />
Dipl.-Theol. Julia Knop, Röhlsdorfstr. 23, 53225 Bonn<br />
Martin E. Musch-Himmerich<br />
Kesselbachstr. 6, 65232 Taunusstein<br />
Prof. P. Dr. Joachim Schmiedl, Berg Sion 1, 56179 Vallendar<br />
OStR. Dr. Gustav Schmiz<br />
Am Wei<strong>de</strong>nbusch 1, 65817 Eppstein-Bremthal<br />
Dr. Dr. Caspar Söling, Josef-Egenolf-Str. 2, 65594 Dehm<br />
PD Dr. Norbert Witsch, Südring 98, 55128 Mainz<br />
INFO 33 · 3/2004<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
217
SONSTIGES<br />
218<br />
Dezernat Schule und Hochschule<br />
im Bischöflichen Ordinariat <strong>Limburg</strong> (Stand: 01.08.2004)<br />
Roßmarkt 12 · 65549 <strong>Limburg</strong> · Postfach 1355 · Fon: 06431/295-235 · Fax: 06431/295-237<br />
E-Mail: schule@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong> · Internet: www.schule.<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
Dezernatsleitung Dr. Eckhard Nordhofen (-234)<br />
Sekretariat Sabrina Gilles (-424), Jutta Stähler (-235)<br />
Abteilung Kultur<br />
Leitung Dr. Eckhard Nordhofen (-234)<br />
Diözesanarchiv Martina Wagner M.A. (06431/2007-16)<br />
Diözesanbibliothek Dr. Stephanie Hartmann (06431/2007-19)<br />
Diözesanmuseum Dr. Gabriel Hefele (-443)<br />
Dommuseum Frankfurt Prof. Dr. August Heuser (069/133761-84)<br />
Haus am Dom N.N.<br />
Katholische Aka<strong>de</strong>mie Rabanus Maurus Dr. Ansgar Koschel (069/1501-301)<br />
Verlag Dipl.-Theol. Martin W. Ramb (-434)<br />
Zugeordnet:<br />
Hochschulen Dr. Eckhard Nordhofen (-234)<br />
Musisches Internat / Domsingknaben Klaus Knubben (06433/887-15)<br />
Pädagogisches Zentrum <strong>de</strong>r Bistümer im Lan<strong>de</strong> Hessen Sabine Tischbein (06127/772-84)<br />
St. Hil<strong>de</strong>gard-Schulgesellschaft mbH Dr. Gerhard Reichelt (06431/997-350)<br />
Dipl.-Theol. Andreas von Erdmann (06431/997-354)<br />
St. Johannes-Schulgesellschaft mbH P. Franz Koll SSCC (02621/9682-11)<br />
Abteilung Katholische Schulen<br />
Leitung Dipl.-Theol. Andreas von Erdmann (-431)<br />
Abteilung Religionspädagogik<br />
Leitung Gerhard Hielscher (-430)<br />
Referat I Dipl.-Theol. Andreas von Erdmann (-431)<br />
Berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Schulen<br />
Referat II N.N. (-438)<br />
Aus-, Fort- und Weiterbildung / Missio canonica / Schulpastoral<br />
Referat III Gerhard Hielscher (-430)<br />
Ämter für kath. Religionspädagogik / Gymnasien, Gesamtschulen /<br />
Schulbücher, Medien / Religionspädagogische Biblio- und Mediothek / Elternarbeit<br />
Referat IV Dipl.-Theol. Martin W. Ramb (-434)<br />
Schriftleitung „INFO“ / Stiftung DEY / Grundsatzfragen / Hochschulkontakte<br />
Referat V Dipl.-Theol. Katharina Sauer (-360)<br />
Grund-, Haupt-, Real- und Son<strong>de</strong>rschulen / Ganztagsschulen<br />
Biblio- und Mediothek Rosemarie Hansel (-435)<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag bis Donnerstag 10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr. Während <strong>de</strong>r Ferien nach Absprache.<br />
Fragen zu Missio canonica Marianne Roos (-460)<br />
Montag bis Donnerstag 13.30-15.30 Uhr<br />
INFO 33 • 3/2004
Ämter für Katholische Religionspädagogik<br />
in <strong>de</strong>n Bezirken (Stand: 01.08.2004)<br />
Die nachfolgen<strong>de</strong> Organisationsübersicht gibt noch nicht<br />
<strong>de</strong>n endgültigen Stand <strong>de</strong>r Neustrukturierung wie<strong>de</strong>r.<br />
Bezirk Frankfurt am Main<br />
Eschenheimer Anlage 20 (Dienstgebäu<strong>de</strong>)<br />
Eschenheimer Anlage 21<br />
60318 Frankfurt am Main (Postanschrift)<br />
Fon: 069/15011-50; Fax: 069/5975503<br />
E-Mail: relpaed.ffm@gmx.<strong>de</strong><br />
www.kath.<strong>de</strong>/bistum/limburg/kma/hdv/rpa/in<strong>de</strong>x.htm<br />
Peter Eberhardt (-78)<br />
Sabine Christe (-77)<br />
Ute Schüßler-Telschow (-77)<br />
Sekretariat: Rita Merkel, Waltraud Schäfer (-79)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Biblio- und Mediothek:<br />
Mo 14.00-18.00 Uhr; Di 12.30-16.30 Uhr;<br />
Mi 16.00-18.00 Uhr; Do 9.00-12.00 Uhr und<br />
12.30-16.30 Uhr; Fr 9.00-12.00 Uhr;<br />
Während <strong>de</strong>r Schulferien auf Anfrage.<br />
Bezirke Hochtaunus / Main-Taunus<br />
Bischof-Ketteler-Haus<br />
Dorotheenstr. 9-11, 61348 Bad Homburg<br />
Fon: 06172/6733-0; Fax: 06172/6733-40<br />
E-Mail: kuch@kath-bezirksamt-hochtaunus.<strong>de</strong><br />
Internet: www.kath-bezirksamt-hochtaunus.<strong>de</strong><br />
Dipl.-Päd. Christa E. Kuch (-22)<br />
Sekretariat: Hei<strong>de</strong>marie Behrens (-21)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Biblio- und Mediothek:<br />
Di - Do 12.30-16.00 Uhr und nach Vereinbarung.<br />
Während <strong>de</strong>r Schulferien geschlossen.<br />
Vincenzstr. 29, 65719 Hofheim<br />
Fon: 06192/2903-10; Fax: 06192/2903-26<br />
E-Mail: relpaed.mt@bistum-limburg.<strong>de</strong><br />
Internet: www.kbzamt-mt.<strong>de</strong><br />
Dipl.-Theol. Wolfgang Bentrup (-15)<br />
Christiane Krüger-Blum (-18)<br />
Sekretariat: Heidrun Garkisch (-16)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Biblio- und Mediothek:<br />
Di und Do 12.00-16.00 Uhr und nach Vereinbarung.<br />
Bezirk <strong>Limburg</strong><br />
Franziskanerplatz 3, 65589 Hadamar<br />
Fon: 06433/88 1-0 / 88 1-45; Fax: 06433/88 1-46<br />
Franz-Josef Arthen (-44)<br />
Sekretariat: Gabi Heun (-45)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Biblio- und Mediothek:<br />
Mo und Mi 9.30-11.30 Uhr; Di und Do 13.30-16.30 Uhr<br />
Bezirke Westerwald / Rhein-Lahn<br />
Auf <strong>de</strong>m Kalk 11, 56410 Montabaur<br />
Fon: 02602/6802-0; Fax: 02602/6802-25<br />
Andreas Kollas (-28)<br />
Josef Weingarten ( - 23)<br />
Sekretariat: Gisela Roos ( - 22)<br />
Biblio- und Mediothek: Rita Kurtenacker ( - 27)<br />
Eva-Margaret Kern (-27)<br />
Öffnungszeiten:<br />
Mo - Fr 10.00-12.00 Uhr; Mo und Do 14.30-16.30 Uhr<br />
Während <strong>de</strong>r Schulferien geschlossen.<br />
Bezirke Wetzlar / Lahn-Dill-E<strong>de</strong>r<br />
Kirchgasse 4, 35578 Wetzlar<br />
Fon: 06441/4 47 79-0; Fax: 06441/4 47 79-50<br />
E-Mail: relpaed.wz@bistum-limburg.<strong>de</strong><br />
Internet: www.kath-bezirksamt-wetzlar.<strong>de</strong><br />
Dipl.-Theol. Beate Mayerle-Jarmer (-20)<br />
Franz-Günther Weyrich (-20)<br />
Sekretariat: Grazyna Theresa Andrzejewski (-18)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Biblio- und Mediothek:<br />
Mo und Fr 8.30-12.00 Uhr; Di, Mi und Do 13.00-17.00 Uhr<br />
und nach Vereinbarung.<br />
Bezirke Wiesba<strong>de</strong>n / Rheingau / Untertaunus<br />
Roncalli-Haus, Friedrichstr. 26-28, 65185 Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Fon: 0611/174-0; Fax: 0611/174-122<br />
E-Mail: rpa@roncallihaus.<strong>de</strong><br />
Internet: www.roncallihaus.<strong>de</strong><br />
Dipl.-Theol. Stefan Herok (-112)<br />
Elisabeth Kessels (-114)<br />
Sekretariat: Gisela Meffert (-113)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Biblio- und Mediothek:<br />
Di - Fr 10.00-12.00 Uhr; Mo und Do 14.00-18.00 Uhr<br />
Di und Mi 14.00-16.00 Uhr<br />
Zollstr. 8-11, 65366 Geisenheim<br />
Fon: 06722/5038-0; Fax: 06722/5038-18<br />
E-Mail: rpa@kath-rheingau.<strong>de</strong><br />
Martin E. Musch-Himmerich (-23)<br />
Sekretariat: Marga Heine (-17)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Biblio- und Mediothek:<br />
Mo - Do 9.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr<br />
Mainzer Allee 38, 65232 Taunusstein<br />
Fon: 06128/9825 8-0; Fax: 06128/98258-6<br />
E-Mail: bza-ut@gmx.<strong>de</strong><br />
Martin E. Musch-Himmerich (- 5)<br />
Sekretariat: Helga Hornig (- 0)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Biblio- und Mediothek:<br />
Mo - Fr 8.30-11.30 Uhr; Di und Mi 14.30-16.30 Uhr<br />
und nach Vereinbarung.<br />
Die Neuordnung <strong>de</strong>r mittleren Ebene ist in vollem Gang. In Zukunft wer<strong>de</strong>n unsere Ämter für Katholische Religionspädagogik<br />
im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> an <strong>de</strong>n nachfolgen<strong>de</strong>n Standorten weiterhin zur För<strong>de</strong>rung und Unterstützung<br />
<strong>de</strong>s Religionsunterrichts präsent sein: Frankfurt, <strong>Limburg</strong>, Montabaur, Oberursel, Wetzlar, Wiesba<strong>de</strong>n.<br />
INFO 33 • 3/2004<br />
SONSTIGES<br />
219
„Zwischen <strong>de</strong>r offenen Pforte zum<br />
Paradies und <strong>de</strong>r offenen Pforte zur<br />
Hölle. Was geschieht da? Was<br />
geschieht zwischen offenen Türen:<br />
Es zieht. Richtig. Es zieht. Wir stehen<br />
im Zug. Man friert sein Lebtag. Es<br />
braust und wir frieren drinnen stärker<br />
als draußen. Der komplette Ausfall aller<br />
Himmelsrichtungen. Das Überangebot<br />
an falschen Einschätzungen <strong>de</strong>r Lage.<br />
Die Fehl<strong>de</strong>utung je<strong>de</strong>s Verbots.“<br />
ISBN 3-921221-30-7<br />
ISSN 0937-8162<br />
Botho Strauß<br />
INFO