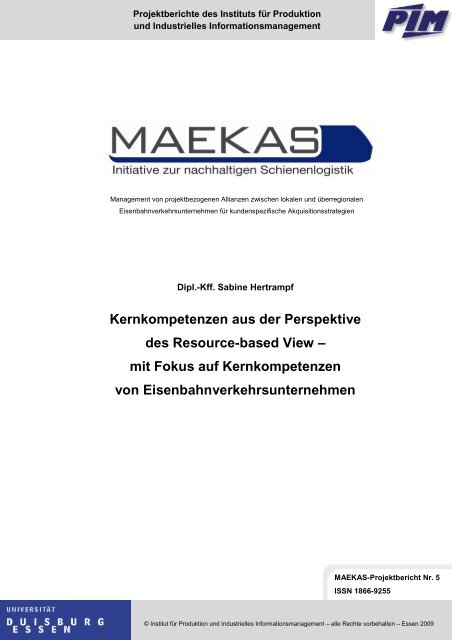Kernkompetenzen aus der Perspektive des Resource-based View
Kernkompetenzen aus der Perspektive des Resource-based View
Kernkompetenzen aus der Perspektive des Resource-based View
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong>Seite IIInhaltsverzeichnisSeiteAbstract ................................................................................................................................. IAbkürzungs- und Akronymverzeichnis .......................................................................... IV1 Einleitung .....................................................................................................................11.1 Problemstellung .............................................................................................................. 11.2 Vorgehensweise .............................................................................................................. 22 Ansätze zur Erklärung <strong>des</strong> Unternehmenserfolges .................................................22.1 Überblick ........................................................................................................................ 22.2 Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong>: Marktstruktur als Erfolgsdeterminante ......................................... 22.3 <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong>: Ressourcen als Erfolgsdeterminanten ....................................... 33 <strong>Kernkompetenzen</strong>: Unternehmenserfolg durch Wissen .........................................43.1 Konzeption ..................................................................................................................... 43.2 Zentrale Elemente ........................................................................................................... 53.2.1 Implizites Wissen ............................................................................................. 53.2.2 Komplexität ...................................................................................................... 63.3 Erfolgskritische Eigenschaften ....................................................................................... 74 Wettbewerbssituation im Schienengüterverkehr ...................................................124.1 Marktlage ...................................................................................................................... 124.2 Kompetenzbündelung als Wettbewerbsstrategie .......................................................... 145 Fallstudie: Bündelung von Kompetenzen zu <strong>Kernkompetenzen</strong> .........................145.1 Einführung .................................................................................................................... 145.2 Gegenstand ................................................................................................................... 155.3 Analyse ......................................................................................................................... 165.3.1 Vorgehensweise ............................................................................................. 165.3.2 Nachweis <strong>der</strong> Kernkompetenzeigenschaft ..................................................... 165.3.2.1 Werterzeugung ................................................................................. 165.3.2.2 Seltenheit .......................................................................................... 185.3.2.3 Komplexität als Schutz vor Entschlüsselung ................................... 195.3.2.4 Komplexität als Schutz vor Akquisitionsversuchen ........................ 205.3.2.5 Zeitvorteile und Multiplikatoreffekte ............................................... 21
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong>Seite III5.3.2.6 Transfermöglichkeit ......................................................................... 235.3.2.7 Möglichkeit <strong>der</strong> Weiterentwicklung ................................................ 235.3.2.8 Möglichkeit zur Aneignung <strong>der</strong> Gewinne ........................................ 245.4 Ergebnis ........................................................................................................................ 246 Fazit und Ausblick ....................................................................................................25Anhang: Fragebogen zum MAEKAS-Workshop am 30. Juli 2008 ..............................26Literaturverzeichnis ..........................................................................................................31
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong>Seite IVAbkürzungs- und AkronymverzeichnisAbb.AbbildungAufl.AuflageCRMCustomer Relationship Managementet al.et aliievtl.eventuellHrsg.Her<strong>aus</strong>geberJg.JahrgangNo.NumberNr.NummerS. Seitesog.so genanntu. a. und an<strong>der</strong>e, unter an<strong>der</strong>emu. ä. und ähnlichesvgl.vergleicheVol.Volumez. B. zum Beispiel
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 11 Einleitung1.1 ProblemstellungDer vorliegende Beitrag ist im Rahmen <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKAS – Management von projektbezogenenAllianzen zwischen lokalen und überregionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen fürkundenspezifische Akquisitionsstrategien – entstanden 1 . Ziel dieses Projekts ist eine teilweise Verlagerung<strong>der</strong> Güterströme von <strong>der</strong> Straße auf die Schiene. Im Rahmen <strong>des</strong> Projekts haben sich vierEisenbahnverkehrsunternehmen – drei lokale sowie ein überregional tätiges Unternehmen – zu einerKooperation zusammengeschlossen. Die Kooperationspartner streben eine intelligente Bündelung<strong>der</strong> Einzelwagenverkehre und eine Verringerung <strong>der</strong> bisher entstehenden Leerfahrten an. Aufdiese Weise können die Produktionskosten <strong>der</strong> Eisenbahnverkehrsunternehmen gesenkt und die individuellenKundenbedarfe besser berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit eröffnet den beteiligtenUnternehmen somit die Möglichkeit, potenziellen Kunden – in erster Linie kleinen und mittelgroßenUnternehmen <strong>der</strong> Region Ruhrgebiet mit passiven Gleisanschlüssen – bedarfsgerechteAngebote zu günstigen Preisen zu unterbreiten und sie somit von einer Verlagerung ihrer Gütertransporteauf die Schiene zu überzeugen. 2Die hier betrachtete Kooperation <strong>der</strong> Eisenbahnverkehrsunternehmen wird in Gestalt eines virtuellenUnternehmens durchgeführt. Im Zentrum dieser Kooperationsform steht die Bündelung <strong>der</strong>Kompetenzen <strong>der</strong> Partnerunternehmen zu <strong>Kernkompetenzen</strong>. Eine solche Vorgehensweise scheint<strong>aus</strong> zweierlei Gründen geboten. Durch den stetigen Wandel <strong>der</strong> Umfeldbedingungen – als Stichworteseien hier etwa die fortschreitende Globalisierung, ein zunehmen<strong>der</strong> Wettbewerb und die Einführungneuartiger Informations- und Kommunikationstechnologien genannt – sehen sich in <strong>der</strong> jüngerenVergangenheit viele Unternehmen dazu gezwungen, ihre strategischen Aktivitäten neu <strong>aus</strong>zurichten.Um die Wettbewerbsfähigkeit trotz <strong>des</strong> dynamischen Umfel<strong>des</strong> zu erhalten, verfolgen Unternehmenvielfach die Strategie <strong>der</strong> Fokussierung auf <strong>Kernkompetenzen</strong>. Prozesse, welche nichtzum Kerngeschäft <strong>des</strong> Unternehmens gehören, werden bei dieser Strategie <strong>aus</strong>gelagert, so dass sichdas Unternehmen auf jene Aufgaben konzentrieren kann, welche es am besten beherrscht. Hinzukommt, dass viele Unternehmen einem <strong>der</strong>artigen Umfeldwandel allein nicht mehr gewachsen sind.Sie gehen Kooperationen mit Konkurrenten („co-opetition“) ein, um ihre Stärken zu bündeln undauf diese Weise neue Potenziale für die Schaffung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile zu begründen.Von den Auswirkungen <strong>des</strong> Kontextwandels ist auch die Branche <strong>des</strong> schienengebundenen Güterverkehrsbetroffen. Ebenso wie Unternehmen an<strong>der</strong>er Wirtschaftszweige sehen sich auch Eisenbahnverkehrsunternehmen,welche Gütertransporte per Schiene durchführen, mit <strong>der</strong> Notwendigkeiteiner strategischen Neu<strong>aus</strong>richtung konfrontiert. Der vorliegende Beitrag konkretisiert das Konzept<strong>der</strong> <strong>Kernkompetenzen</strong> für Unternehmen <strong>des</strong> schienengebundenen Güterverkehrs und zeigt <strong>des</strong>senpraktische Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen virtueller Unternehmen zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmenauf.1 Zu einer detaillierten Darstellung <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKAS vgl. ZELEWSKI (2008).2 Darüber hin<strong>aus</strong> weist das Verbundprojekt MAEKAS für die an dem Projekt beteiligten lokalen Eisenbahnverkehrsunternehmeneine strategische Bedeutung auf, weil die Kooperation mit einem überregional tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmenden lokalen Eisenbahnverkehrsunternehmen die Möglichkeit bietet, sich von einer evtl.stagnierenden regionalen Entwicklung zu lösen.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 21.2 VorgehensweiseZunächst werden im zweiten Abschnitt grundlegende theoretische Ansätze zur Erklärung <strong>des</strong> Unternehmenserfolgeserläutert. Dazu gehören <strong>der</strong> Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong> sowie <strong>der</strong> <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong><strong>View</strong>. Der dritte Abschnitt stellt das Konzept <strong>der</strong> <strong>Kernkompetenzen</strong> dar. Im vierten Abschnitt wirddie Wettbewerbssituation <strong>der</strong> Unternehmen <strong>des</strong> schienengebundenen Güterverkehrs beleuchtet,während sich <strong>der</strong> fünfte Abschnitt mit den <strong>Kernkompetenzen</strong> <strong>der</strong> Unternehmen <strong>des</strong> schienengebundenenGüterverkehrs befasst. Im Zentrum dieses Kapitels steht eine im Rahmen <strong>des</strong> ProjektsMAEKAS bearbeitete Fallstudie zu gemeinsamen <strong>Kernkompetenzen</strong> von Eisenbahnverkehrsunternehmen.Der sechste Abschnitt fasst die in diesem Beitrag gewonnenen Erkenntnisse zusammenund gibt einen Ausblick auf zukünftige strategische Erfor<strong>der</strong>nisse von Unternehmen, welche imMarkt für Schienengütertransporte ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern möchten.2 Ansätze zur Erklärung <strong>des</strong> Unternehmenserfolges2.1 ÜberblickDie Hauptaufgabe <strong>des</strong> Strategischen Managements besteht in <strong>der</strong> langfristigen Sicherung <strong>der</strong> Unternehmensexistenz3 . Offensichtlich setzt die Erfüllung dieses Ziels die Erwirtschaftung nachhaltigerunternehmerischer Erfolge vor<strong>aus</strong>. Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage,warum in einer bestimmten Branche einige Unternehmen größere Erfolge erzielen als ihre Wettbewerber.Die Untersuchung dieser Fragestellung steht auch im Zentrum verschiedener betriebswirtschaftlicherTheorien, welche den her<strong>aus</strong>ragenden Erfolg bestimmter Unternehmen einer Branchezu ergründen suchen. Während sich die marktorientierten Ansätze, wie etwa <strong>der</strong> Market-<strong>based</strong><strong>View</strong>, dem Phänomen <strong>aus</strong> <strong>der</strong> externen <strong>Perspektive</strong> nähern und die unterschiedliche Ausrichtung<strong>der</strong> Unternehmensaktivitäten auf die Marktbedingungen für die Existenz von Erfolgsdifferenzenverantwortlich machen, beleuchten die Vertreter <strong>des</strong> ressourcenorientierten Ansatzes die Problematik<strong>aus</strong> einem unternehmensinternen Blickwinkel. In den anschließenden Abschnitten erfolgt <strong>aus</strong>Gründen <strong>der</strong> Abgrenzung zum ressourcenorientierten Ansatz zunächst eine kurze Darstellung <strong>des</strong>Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong>. Daran schließt sich eine <strong>aus</strong>führliche Darstellung <strong>des</strong> <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> an.2.2 Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong>: Marktstruktur als ErfolgsdeterminanteDer auf Erkenntnissen <strong>der</strong> Industrieökonomik basierende Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong> führt den Erfolg einesUnternehmens auf externe Determinanten zurück 4 . So resultiert <strong>der</strong> überragende Erfolg eines Unternehmensin <strong>der</strong> Argumentationslinie <strong>des</strong> Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong> insbeson<strong>der</strong>e <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Attraktivität<strong>des</strong> Marktes, auf dem das Unternehmen agiert. Die Strategie, die das Unternehmen zwecks Bearbeitung<strong>des</strong> Marktes einsetzt, ist an die gegebenen Marktbedingungen anzupassen. Erfolgreiche Unternehmensind demzufolge auf einem Markt tätig, <strong>der</strong> ihnen die Erlangung überdurchschnittlicherGewinne erlaubt, und verfolgen außerdem eine Strategie, mit <strong>der</strong>en Hilfe sie unter den gegebenenBedingungen relative Wettbewerbsvorteile begründen können. Die Möglichkeit, über dem Bran-3 Vgl. KRÜGER/HOMP (1997), S. 25.4 Zur Konzeption <strong>des</strong> Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong> vgl. PORTER (1999), S. 25-28, und weiterhin BAMBERGER/WRONA(1996), S. 146-147.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 3chendurchschnitt angesiedelte Gewinne zu erzielen, ist gemäß den Aussagen <strong>des</strong> Market-<strong>based</strong><strong>View</strong> an die Existenz bestimmter struktureller Marktbedingungen geknüpft. So ist ein Markt etwadann tendenziell als gewinnträchtig anzusehen, wenn eine nur mäßig hohe Wettbewerbsintensitätvorliegt, die Verhandlungsmacht <strong>der</strong> Kunden nicht zu stark <strong>aus</strong>fällt o<strong>der</strong> relativ hohe Markteintrittsschrankenden Marktzutritt neuer Konkurrenten erschweren 5 . Die marktstrukturellen Determinantenwerden im Fall erfolgreicher Unternehmen durch den Einsatz einer passenden Marktbearbeitungsstrategieergänzt. Hierbei kann es sich um die Strategie <strong>der</strong> Kostenführerschaft, <strong>der</strong> Differenzierungo<strong>der</strong> <strong>der</strong> Fokussierung handeln 6 .2.3 <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong>: Ressourcen als ErfolgsdeterminantenDer <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> stellt einen theoretischen Ansatz dar, <strong>der</strong> – ebenso wie <strong>der</strong> Market-<strong>based</strong><strong>View</strong> 7 – die Ursachen für den her<strong>aus</strong>ragenden Erfolg bestimmter Unternehmen einer Branche zuergründen sucht 8 . Im Gegensatz zum Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong>, <strong>der</strong> von einer homogenen Ressourcen<strong>aus</strong>stattung<strong>der</strong> einer Branche angehörenden Unternehmen <strong>aus</strong>geht 9 und demzufolge die jeweiligeBranchenstruktur sowie die Art <strong>der</strong> Anpassung an die Branchenstruktur für die Existenz unterschiedlicherfolgreicher Unternehmen verantwortlich macht 10 , liegt dem <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> dieAnnahme zugrunde, dass je<strong>des</strong> Unternehmen einer Branche aufgrund unvollkommener o<strong>der</strong> nichtexistenter Faktormärkte über eine einzigartige Ressourcen<strong>aus</strong>stattung verfügt 11 , welche über dasAusmaß seines Erfolges entscheidet 12 . So befinden sich gemäß <strong>der</strong> Argumentation <strong>des</strong> <strong>Resource</strong><strong>based</strong><strong>View</strong> einige Unternehmen im Besitz von Ressourcen, mit <strong>der</strong>en Hilfe Wettbewerbsvorteilegeschaffen werden können 13 , die ihren Ausdruck in <strong>der</strong> Realisierung überdurchschnittlicher Gewinnefinden 14 . Ob diese Gewinne allerdings einen nachhaltigen Charakter aufweisen, hängt davon ab,ob es dem Unternehmen gelingt, die für seinen Wettbewerbserfolg ursächlichen Ressourcen vordem Zugriff <strong>der</strong> Konkurrenz zu schützen 15 . Ressourcen, die ein Potenzial zur Erlangung nachhaltigerWettbewerbsvorteile darstellen, werden im Folgenden als strategisch relevante Ressourcen be-5 Unter den genannten Aspekten stellt <strong>der</strong> Markt für schienengebundene Gütertransporte, auf dem sich die in demVerbundprojekt MAEKAS kooperierenden Eisenbahnverkehrsunternehmen bewegen, ein schwieriges Terrain dar,weil hier sowohl eine intensive Substitutionskonkurrenz in Form von LKW-Transporten als auch eine starke Verhandlungsmacht<strong>der</strong> Kunden verzeichnet werden können. Vgl. Kapitel 4.1.6 Welche dieser generischen Wettbewerbsstrategien als passend betrachtet werden kann, hängt von den konkretenMarktbedingungen ab. So empfiehlt sich etwa für einen in <strong>der</strong> Wachstumsphase befindlichen Markt die Nutzungvon Erfahrungsvorteilen zwecks Realisierung von Kostensenkungspotenzialen, während man sich in <strong>der</strong> Reifephase<strong>des</strong> Marktes eher durch Differenzierungsvorteile von <strong>der</strong> Konkurrenz absetzen kann.7 Vgl. Abschnitt 2.28 Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 51.9 Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 63, sowie NOLTE/BERGMANN (1998), S. 7.10 Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 51.11 Die Unvollkommenheit von Faktormärkten beruht insbeson<strong>der</strong>e auf Informationsasymmetrien zwischen denMarktteilnehmern, die es z. B. einem über Informationsvorsprünge verfügenden Käufer erlauben, eine Ressourceunter ihrem Wert zu kaufen und dadurch Gewinne zu erzielen. Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 64, sowie RASCHE(1994), S. 58-59. Ursächlich für nicht existente Faktormärkte sind dagegen unzureichend abgrenzbare Eigentumsrechtefür Ressourcen, wie z. B. im Falle <strong>der</strong> Reputation eines Unternehmens o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Loyalität seiner Kunden.Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 64. Die fehlende Abgrenzungsmöglichkeit <strong>der</strong> Eigentumsrechte führt zur Immobilität<strong>der</strong> betroffenen Ressourcen. Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 64, sowie BAMBERGER/WRONA (1996), S. 137.12 Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 53-54 und S. 62-63.13 Vgl. METZENTHIN (2002), S. 123.14 Vgl. BAMBERGER/WRONA (1996), S. 132.15 Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 73, sowie BAMBERGER/WRONA (1996), S. 132.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 4zeichnet, weil sie zur Sicherung <strong>der</strong> langfristigen Existenz eines Unternehmens beitragen 16 . Abb. 1stellt die grundlegenden Aussagen <strong>des</strong> Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong> und <strong>des</strong> <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> einan<strong>der</strong>gegenüber.Market<strong>based</strong><strong>View</strong>homogeneRessourcen<strong>Resource</strong><strong>based</strong><strong>View</strong>heterogeneRessourcenErfolgsursachen:rentabler Markt,adäquate WettbewerbsstrategieErfolgsursache:strategischrelevanteRessourcenAbb. 1: Ursachen <strong>des</strong> Unternehmenserfolges 173 <strong>Kernkompetenzen</strong>: Unternehmenserfolg durch Wissen3.1 KonzeptionUm eine spezifische, nämlich wissensbasierte Ausprägung strategisch relevanter Ressourcen handeltes sich bei den sog. <strong>Kernkompetenzen</strong>. Grundsätzlich kann eine Kompetenz als die Fähigkeitbeschrieben werden, Ressourcen eines Unternehmens zielorientiert miteinan<strong>der</strong> zu kombinieren 18,19 .Eine Kompetenz lässt sich somit als ein Bündel von Ressourcen beschreiben, bestehend <strong>aus</strong> einerFähigkeit sowie weiteren Ressourcen, auf <strong>der</strong>en betriebliche Verwertung sich diese Fähigkeit bezieht.Kompetenzen sind erfor<strong>der</strong>lich, um die im Besitz eines Unternehmens befindlichen Ressourcenüberhaupt verwerten zu können. Nicht allein die bloße Verfügungsmacht über Ressourcen, son<strong>der</strong>nerst die Fähigkeit, diese Ressourcen zielgerichtet einzusetzen, führt zu einer Wertschaffung für dasUnternehmen 20 .Die zielgerichtete Kombination von Ressourcen erfolgt durch Menschen, denn Fähigkeiten sindstets an Personen gebunden. Die in dem Ressourcenverbund namens “Kompetenz” gebündelten16 Vgl. BÜRKI (1996), S. 199.17 Quelle: eigene Darstellung.18 Vgl. OELSNITZ (2003a), S. 187-188.19 Auch Fähigkeiten stellen Ressourcen – konkret: Wissensressourcen – dar. Vgl. AL-LAHAM (2003), S. 43.20 Vgl. TRÄGER (2006), S. 42.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 5Ressourcen stehen in einem interdependenten Verhältnis zueinan<strong>der</strong>. So können sich die Ressourcenhinsichtlich ihrer Wirkung gegenseitig abschwächen o<strong>der</strong> verstärken 21 . Möglich ist auch, dasssich die Ressourceneffekte <strong>aus</strong>gleichen. Da es sich somit bei Kompetenzen um Ressourcenbündelunter Beteiligung von Humanressourcen handelt, weisen Kompetenzen in jedem Fall soziale Komplexitätauf 22 . Kompetenzen in ihrer Eigenschaft als Fähigkeiten enthalten darüber hin<strong>aus</strong> Wissen,denn Fähigkeiten lassen sich als das Wissen über Handlungsregeln charakterisieren 23 . Das in Kompetenzeneingeschlossene Wissen weist sowohl explizite als auch implizite Bestandteile auf 24,25 .Hinsichtlich ihrer Wirkung lassen sich verschiedene Arten von Kompetenzen unterscheiden. Sowerden etwa die sog. Basiskompetenzen benötigt, um den reibungslosen Ablauf <strong>der</strong> Geschäftsprozessezu gewährleisten 26 . <strong>Kernkompetenzen</strong> dagegen bilden für ein Unternehmen ein Potenzial zurSchaffung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile 27 , wor<strong>aus</strong> sich ihr beson<strong>der</strong>er Wert für das Unternehmenableitet.Einen Großteil ihres Wertes für das sie besitzende Unternehmen entfalten <strong>Kernkompetenzen</strong> aufgrund<strong>des</strong> in ihnen enthaltenen impliziten Wissens sowie ihres komplexen Charakters 28 . DieseMerkmale verhin<strong>der</strong>n sowohl die Akquisition als auch die Imitation o<strong>der</strong> Substitution <strong>der</strong> <strong>Kernkompetenzen</strong>durch konkurrierende Unternehmen. Wegen <strong>der</strong> her<strong>aus</strong>ragenden Bedeutung dieser Eigenschaftenwerden im folgenden Abschnitt die Phänomene <strong>des</strong> impliziten Wissens sowie <strong>der</strong>Komplexität eingehen<strong>der</strong> betrachtet.3.2 Zentrale Elemente3.2.1 Implizites WissenImplizites Wissen bezeichnet die Diskrepanz zwischen dem tatsächlich vorhandenen und dembeschreibbaren Wissen eines Individuums 29 . Diese Form von Wissen ist dadurch gekennzeichnet,dass <strong>der</strong> Wissensträger nur schwerlich in <strong>der</strong> Lage ist, sein Wissen zu kodifizieren, weil es ihmselbst gar nicht bewusst ist 30 . Dabei meint die Kodifizierbarkeit “the extent to which knowledge canbe structured into a set of identifiable rules and procedures for communication“ 31 . So könnte einWissensträger grundsätzlich sein Wissen schriftlich nie<strong>der</strong>legen, es mit Hilfe von Zeichnungen <strong>aus</strong>drückeno<strong>der</strong> anhand von Modellen erläutern. Im Falle impliziten Wissens ist jedoch gerade einesolche Kodifizierung mit großen Problemen behaftet. Das bedeutet, dass es für Dritte zu einem großenTeil nur in den Leistungsergebnissen <strong>des</strong> Wissensträgers wahrnehmbar ist 32 . Die Akquisition,Imitation und Substitution impliziten Wissens durch Konkurrenten werden somit erheblich er-21 Vgl. Abschnitt 3.2.2.22 Vgl. RASCHE (1994), S. 149. Zum Begriff <strong>der</strong> Komplexität vgl. <strong>aus</strong>führlich Abschnitt 3.2.2.23 Vgl. AL-LAHAM (2003), S. 43.24 Vgl. OELSNITZ (2003a), S. 188.25 Implizites Wissen stellt eine spezifische Form von Wissen dar, die durch ihren Träger nur schwer kodifiziert werdenkann. Vgl. <strong>aus</strong>führlich Abschnitt 3.2.1.26 Vgl. KRÜGER/HOMP (1997) S. 41-53.27 Vgl. KRÜGER/HOMP (1997), S. 27.28 Vgl. Abschnitt 3.2.3.29 Vgl. FREILING (2001), S. 112.30 Vgl. FREILING (2001), S. 112 und S. 115.31 LAM (1997), S. 975.32 Vgl. AL-LAHAM (2004), S. 410.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 6schwert. Allerdings schließt die eingeschränkte Kodifizierbarkeit <strong>des</strong> impliziten Wissens die effektiveAnwendung durch seinen Träger nicht <strong>aus</strong> 33 .3.2.2 KomplexitätMit dem Begriff „komplex“ bezeichnet man im allgemeinen Sprachgebrauch einen kompliziertenSachverhalt. Die Systemtheorie jedoch, die maßgeblich zur Präzisierung dieses Begriffs beigetragenhat, verwendet die Bezeichnungen “kompliziert” und “komplex” nicht in <strong>der</strong>selben Bedeutung 34 .Aus systemtheoretischer Sicht bezieht sich <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Kompliziertheit auf die Struktur einesSystems, d. h. auf die Anzahl und die Vielfalt <strong>der</strong> in diesem System enthaltenen Elemente sowie <strong>der</strong>zwischen diesen Elementen bestehenden Beziehungen 35 . Die Bezeichnung Komplexität dagegenrichtet sich auf das Systemverhalten. Ein System wird als komplex bezeichnet, wenn es innerhalbeines gegebenen Zeitraums eine Vielzahl verschiedener Zustände annehmen kann 36 . Dabei kannman jedoch nicht vorhersagen, welchen konkreten Zustand das System künftig annehmen wird, weildas Systemverhalten keine linearen K<strong>aus</strong>alitäten 37 aufweist 38 . Diese Unberechenbarkeit komplexerSysteme ist insbeson<strong>der</strong>e auf die Beteiligung von Menschen zurückzuführen 39 . Komplexe Systeme,die in hohem Maße soziale Elemente enthalten, werden auch als sozial komplex bezeichnet 40 .Überträgt man diese Überlegungen nun auf ressourcenorientierte Problemstellungen, so verbindetsich mit dem Begriff “Komplexität” eine Anzahl interdependenter Ressourcen 41 , <strong>der</strong>en künftigeVerhaltensweisen nicht prognostizierbar sind.Wettbewerbsvorteile, die auf komplexen Ressourcen basieren, resultieren <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Fähigkeit einesUnternehmens, ein im Wettbewerbsvergleich überlegenes Ressourcenbündel zusammenzustellen 42 .Ob es tatsächlich gelingt, Ressourcen in <strong>der</strong> Weise zu kombinieren, dass ihr Zusammenwirken zueinem Wettbewerbsvorteil führt, hängt insbeson<strong>der</strong>e von den Beziehungen ab, die zwischen denRessourcen herrschen 43 . Komplexe Ressourcen können in verschiedenen Beziehungen zueinan<strong>der</strong>stehen. So können sich die Ressourcen gegenseitig in ihrer Wirkungabschwächen,kompensieren o<strong>der</strong>verstärken 44 .Nachhaltige Wettbewerbsvorteile können insbeson<strong>der</strong>e mit Hilfe von Ressourcen geschaffen werden,die sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. Unternehmen, die über <strong>der</strong>artige Komple-33 Vgl. FREILING (2001), S. 113.34 Vgl. BÜRKI (1996), S. 115.35 Vgl. BÜRKI (1996), S. 115.36 Vgl. BÜRKI (1996), S. 116, sowie MALIK (1992), S. 186.37 Unter einer linearen K<strong>aus</strong>alität versteht man einen einfachen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang <strong>der</strong> Form „A beeinflusstB“. Im Gegensatz dazu steht die zirkuläre K<strong>aus</strong>alität, die durch Rückkopplungseffekte gekennzeichnetist. Im Falle einer zirkulären K<strong>aus</strong>alität gilt nicht nur die Aussage „A beeinflusst B“, son<strong>der</strong>n gleichfalls „B beeinflusstA“. Vgl. MASAK (2007), S. 311.38 Vgl. BÜRKI (1996), S. 116.39 Vgl. BÜRKI (1996), S. 119.40 Vgl. BÜRKI (1996), S. 119.41 Vgl. SIMONIN (1999), S. 600, sowie REED/DEFILLIPPI (1990), S. 91.42 Vgl. FREILING (2001), S. 107.43 Vgl. BLACK/BOAL (1994), S. 131-133.44 Vgl. BLACK/BOAL (1994), S. 138-139.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 7mentärressourcen verfügen, weisen ein hohes Potenzial zur Realisierung von Synergieeffekten auf 45und befinden sich damit im Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten.Komplexe Ressourcen, die sich wechselseitig in ihrer Wirkung verstärken, bilden aber nicht nur einegünstige Vor<strong>aus</strong>setzung für die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen. Darüber hin<strong>aus</strong> sichert dieKomplexität von Ressourcen auch die Nachhaltigkeit eines auf ihnen beruhenden Wettbewerbsvorteils,indem sie die Ressourcen vor dem Zugriff <strong>der</strong> Konkurrenz schützt.Diese Schutzfunktion resultiert <strong>aus</strong> dem spezifischen Charakter komplexer Ressourcen. Dieser führtdazu, dass Außenstehende kaum in <strong>der</strong> Lage sind, den K<strong>aus</strong>alzusammenhang zwischen einemWettbewerbsvorteil und den ihn begründenden Ressourcen zu erkennen. Diese Intransparenz wirdals k<strong>aus</strong>ale Ambiguität bezeichnet. Komplexe Ressourcen führen in zweifacher Weise zu k<strong>aus</strong>alerAmbiguität. Zum einen ist schon die Struktur eines komplexen Ressourcenbündels von Außenstehendennur schwer zu durchschauen, weil we<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bündelungsprozess noch das fertige Bündelvon unternehmensexternen Personen vollständig einsehbar sind 46 . Darüber hin<strong>aus</strong> för<strong>der</strong>n geradedie Verhaltensweisen <strong>der</strong> Ressourcen die Entstehung k<strong>aus</strong>aler Ambiguität, weil sich diese Komponenteneiner exakten Prognose entziehen 47 .Konkurrenten, die auf komplexe Ressourcen zuzugreifen versuchen, stoßen also gleich auf zweiHin<strong>der</strong>nisse: die untrennbare und nicht eindeutig erkennbare Verbindung <strong>der</strong> Ressourcen sowie ihrnicht bestimmbares künftiges Verhalten. Akquisitionen, Imitationen und Substitutionen werden aufdiese Weise erheblich erschwert und somit wird die Nachhaltigkeit eines auf komplexen Ressourcenberuhenden Wettbewerbsvorteils gesichert.3.3 Erfolgskritische Eigenschaften<strong>Kernkompetenzen</strong> weisen eine Reihe charakteristischer Merkmale auf 48 , welche zur Begründungeines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils gemäß <strong>der</strong> Argumentation <strong>des</strong> <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> 49 führenund damit die strategische Relevanz dieser Kompetenzen begründen:Sie schaffen einen beson<strong>der</strong>en Kundenwert.Sie sichern die Dauerhaftigkeit eines auf ihnen beruhenden Wettbewerbsvorteils.Sie sind auf alternative Anwendungsbereiche transferierbar.WerterzeugungRessourcen können einen Wettbewerbsvorteil begründen, wenn sie einen Wert schaffen, d. h. wenndas Unternehmen, welches die Ressourcen besitzt, mit ihrer Hilfe Leistungen auf dem Absatzmarktanbieten kann, die für die Abnehmer einen – im Vergleich zu den Konkurrenzangeboten – höherenNutzen stiften 50,51 . Dieser kann sich beispielsweise in einem niedrigeren Preis o<strong>der</strong> einer höheren45 Vgl. FREILING (2001), S. 108 und 136.46 Vgl. FREILING (2001), S. 109.47 Vgl. FREILING (2001), S. 109.48 Vgl. PRAHALAD/HAMEL (1990), S. 83-84.49 Vgl. Abschnitt 2.3.50 Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 66, sowie WELGE/AL-LAHAM (2003), S. 265.51 An dieser Stelle zeigt sich, dass <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> und Market-<strong>based</strong> <strong>View</strong> miteinan<strong>der</strong> in Verbindung stehen,denn die Beurteilung einer Ressource hinsichtlich ihrer potenziellen Werterzeugung erfor<strong>der</strong>t eine Analyse <strong>des</strong>Absatzmarktes, insbeson<strong>der</strong>e hinsichtlich <strong>der</strong> Käuferpräferenzen. Vgl. BAMBERGER/WRONA (1996), S. 146-150.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 9Resistenz gegenüber Imitations- und SubstitutionsversuchenSchließlich hängt die Nachhaltigkeit eines Wettbewerbsvorteils von <strong>der</strong> Resistenz <strong>der</strong> ihn begründendenRessourcen gegenüber Imitations- und Substitutionsbemühungen <strong>der</strong> Wettbewerber ab.Kann ein Konkurrent die dem Wettbewerbsvorteil zugrunde liegenden Ressourcen nicht über denMarkt erwerben, so steht ihm weiterhin die Möglichkeit offen, sie intern zu entwickeln, d. h. sie zuimitieren, o<strong>der</strong> sie zu substituieren 64 . Letztere Methode sieht vor, die originären durch an<strong>der</strong>sartigeRessourcen zu ersetzen, welche im Endeffekt zum gleichen Resultat führen, mithin zur Begründungeines Wettbewerbsvorteils beitragen 65 . Dabei können entwe<strong>der</strong> sehr ähnliche Ressourcen eingesetzto<strong>der</strong> aber ein vollkommen an<strong>der</strong>er Weg beschritten werden, um den Vorsprung <strong>des</strong> Wettbewerbersaufzuholen 66 . Begünstigt wird die Substituierbarkeit von Ressourcen durch einen rapiden technologischenWandel 67 .<strong>Kernkompetenzen</strong> entziehen sich einer problemlosen Imitation o<strong>der</strong> Substitution durch konkurrierendeUnternehmen. Diese Schutzfunktion ergibt sich zum einen <strong>aus</strong> ihrem Gehalt an implizitemWissen 68 , zum an<strong>der</strong>en <strong>aus</strong> ihrem komplexen Charakter 69 . Die Komplexität von <strong>Kernkompetenzen</strong>sowie ihr Gehalt an implizitem Wissen führen dazu, dass Außenstehende die Ursachen eines Wettbewerbsvorteilsnicht ergründen können 70 . Folglich bleibt ihnen das Zielobjekt ihrer Imitationso<strong>der</strong>Substitutionsbemühungen verschlossen, und ein entsprechen<strong>der</strong> Zugriff <strong>der</strong> Konkurrenz wirdverhin<strong>der</strong>t 71 . Die Intransparenz <strong>der</strong> K<strong>aus</strong>alstruktur zwischen einem kompetitiven Vorteil und demihm zugrunde liegenden Wissen wird als k<strong>aus</strong>ale Ambiguität bezeichnet 72 .Das in <strong>Kernkompetenzen</strong> enthaltene implizite Wissen übt darüber hin<strong>aus</strong> noch weitere Schutzfunktionen<strong>aus</strong>. So stellt die Tatsache, dass <strong>der</strong> Bestand eines Unternehmens an implizitem Wissen dasResultat <strong>der</strong> einzigartigen historischen Entwicklung <strong>des</strong> Unternehmens ist, ein Imitations- und Substitutionshin<strong>der</strong>nisfür Konkurrenten dar 73 . Implizites Wissen wird im Rahmen langwieriger Lernprozesseakkumuliert 74 . Den Entwicklungspfad dieses Wissens müsste ein lernwilliger Konkurrentin exakt <strong>der</strong>selben Weise beschreiten wie das im Besitz <strong>des</strong> Wissens befindliche Unternehmen 75 .Dies ist jedoch aufgrund <strong>der</strong> nicht möglichen Reproduzierbarkeit <strong>der</strong> historischen Rahmenbedingungen<strong>aus</strong>geschlossen 76 .Schließlich werden die Versuche eines Konkurrenten, <strong>Kernkompetenzen</strong> zu imitieren o<strong>der</strong> zu substituieren,durch <strong>des</strong>sen beschränkte Absorptionsfähigkeit erschwert 77 . Wie<strong>der</strong>um ist für dieseSchutzfunktion das in den <strong>Kernkompetenzen</strong> enthaltene Wissen ursächlich. Nimmt man an, <strong>der</strong>Konkurrent wäre in <strong>der</strong> Lage, exakt denselben Entwicklungspfad einzuschlagen wie das im Besitz64 Vgl. WELGE/AL-LAHAM (2003), S. 263 und S. 264, MELLEWIGT (2003), S. 67 und S. 72-73, sowie PADBERG(2000), S. 84-87.65 Vgl. PADBERG (2000), S. 86.66 Vgl. MELLEWIGT (2003), S. 72, sowie PADBERG (2000), S. 86-87.67 Vgl. RASCHE (1994), S. 86.68 Zum impliziten Charakter von Wissen vgl. <strong>aus</strong>führlich Abschnitt 3.2.1.69 Zur Komplexität von Ressourcen vgl. <strong>aus</strong>führlich Abschnitt 3.2.2.70 Vgl. REED/DEFILLIPPI (1990), S. 91-92.71 Vgl. AL-LAHAM (2004), S. 412.72 Vgl. AL-LAHAM (2004), S. 412.73 Vgl. AL-LAHAM (2004), S. 412.74 Vgl. AL-LAHAM (2004), S. 411.75 Vgl. PADBERG (2000), S. 84.76 Vgl. PADBERG (2000), S. 84-85.77 Vgl. AL-LAHAM (2004), S. 411-412.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 11an Verän<strong>der</strong>ungen <strong>des</strong> Unternehmensumfel<strong>des</strong>, wie z. B. den technologischen Wandel, bleibt <strong>aus</strong>.AL-LAHAM spricht in diesem Zusammenhang von einer “paradoxen Wirkung <strong>der</strong> Konzentration auf<strong>Kernkompetenzen</strong>” 85 . <strong>Kernkompetenzen</strong> bergen somit gleichzeitig Chancen und Risiken. Chancenerwachsen <strong>aus</strong> ihnen, wenn sie fortlaufend weiterentwickelt und an die sich wandelndenUnternehmensumfeldbedingungen angepasst werden. Ein Risiko kann <strong>aus</strong> ihnen entstehen, wenndiese Weiterentwicklung unterbleibt.Möglichkeit zur Aneignung <strong>der</strong> GewinneUm <strong>aus</strong> ihrer relativ vorteilhaften Wettbewerbsposition auch den angestrebten finanziellen Vorteilzu erlangen, müssen Unternehmen, die mit Hilfe von strategisch relevanten Ressourcen diesenkompetitiven Vorteil begründet haben, in <strong>der</strong> Lage sein, sich die Gewinne, die mit dem Wettbewerbsvorteilverbunden sind, anzueignen 86 . Dazu benötigen sie die Verfügungsrechte über die demWettbewerbsvorteil zugrunde liegenden Ressourcen, im Fall von <strong>Kernkompetenzen</strong> somit die Verfügungsrechtesowohl über das in dem Ressourcenbündel enthaltene Wissen als auch über die diesesWissen ergänzenden Ressourcen. Das für den beson<strong>der</strong>en strategischen Wert von <strong>Kernkompetenzen</strong>ursächliche implizite Wissen ist aufgrund seiner eingeschränkten Kodifizierbarkeitstets personengebunden 87 . Aus diesem Grunde kann an dieser Ressourcenart – im Gegensatz zutangiblen Ressourcen – kein direktes Verfügungsrecht begründet werden. Vielmehr ist es erfor<strong>der</strong>lich,den Träger <strong>des</strong> erfolgskritischen Wissens durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. Motivationskonzepte88 , an das Unternehmen zu binden, um sich auf diese Weise zumin<strong>des</strong>t einen mittelbarenZugriff auf die Ressource zu sichern.Abb. 2 fasst die Eigenschaften von <strong>Kernkompetenzen</strong>, die ihre strategische Relevanz begründen,zusammen.85 AL-LAHAM (2003), S. 152.86 Vgl. BAMBERGER/WRONA (1996), S. 139.87 Vgl. Abschnitt 3.2.1.88 Vgl. HERTRAMPF (2009b).
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 12Resistenz gegenüber- Akquisitionen- Imitationen- SubstitutionenTatbestand <strong>der</strong>- Werterzeugung- SeltenheitMöglichkeit zu- Transfer- Weiterentwicklung- Gewinnaneignung<strong>Kernkompetenzen</strong>Abb. 2: Eigenschaften von <strong>Kernkompetenzen</strong> 894 Wettbewerbssituation im Schienengüterverkehr4.1 MarktlageDie Marktbedingungen für Unternehmen <strong>des</strong> schienengebundenen Güterverkehrs wurden in <strong>der</strong>jüngeren Vergangenheit durch eine Reihe verschiedener Einflüsse geprägt, welche teilweise zu tiefgreifendenVerän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Wettbewerbssituation von Eisenbahnverkehrsunternehmen führten 90 .Im Folgenden seien exemplarisch politische und kundenbezogene Einflussfaktoren dargestellt.Zu den politischen Aspekten, welche den Markt für schienengebundene Gütertransporte erheblichtangierten, gehören insbeson<strong>der</strong>e die Vollendung <strong>des</strong> Binnenmarktes sowie die Aufhebung <strong>der</strong> TeilungEuropas 91 . Diese Faktoren führten zuGrenzöffnungen und damit zu einer erleichterten Marktzugänglichkeit,einer Internationalisierung <strong>der</strong> Anbieter- und <strong>der</strong> Nachfragerseite sowie zu<strong>der</strong> schrittweisen Liberalisierung <strong>der</strong> Verkehrsmärkte.Insgesamt resultierte <strong>aus</strong> den beschriebenen Aspekten eine Intensivierung <strong>des</strong> Wettbewerbs aufzahlreichen Märkten.89 Quelle: eigene Darstellung.90 Zur Marktsituation im Schienengüterverkehr vgl. GÜNES (2009), KIRCHNER/ZEHNHÄUSERN (2009), BUTTERMANN(2003), S. 42-95, sowie BERNDT (2001), S. 65-80.91 Vgl. BERNDT (2001), S. 67.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 13Gleichzeitig ergab sich in den letzten Jahren ein erhebliches mengenmäßiges Wachstum <strong>des</strong> Güterverkehrsinsbeson<strong>der</strong>e in Deutschland 92 . Allerdings konnten die europäischen Bahnen nicht im gewünschtenAusmaß von <strong>der</strong> Nachfragesteigerung profitieren, da <strong>der</strong> größte Anteil <strong>des</strong> Güterverkehrsüber die Straße abgewickelt wird. So verzeichnete <strong>der</strong> Straßengüterverkehr im Jahr 2007 imVergleich zum Vorjahr ein Wachstum von ca. 5,5 %. Die per Schiene transportierte Gütermengenahm zwar im selben Zeitraum mit etwa 4,3 % fast ebenso stark zu. Allerdings betrug die absoluteGütertransportmenge im Bereich <strong>des</strong> Straßengüterverkehrs im Jahre 2007 ca. 3,43 Mrd. t, währendper Schiene im selben Jahr lediglich 361,12 Mio. t Güter transportiert wurden 93 .Zwar weist <strong>der</strong> Straßengüterverkehr im Gegensatz zur Bahn mehr Probleme, wie etwa begrenzteKapazitäten und eine vergleichsweise hohe Umweltbelastung, auf 94 . Jedoch können die Kapazitätsreservensowie die ökologischen Vorzüge <strong>der</strong> Bahn nur dann marktlich genutzt werden, wenn auchdie übrigen Konditionen für den Abnehmer attraktiv erscheinen. Notwendig ist das Angebot kundengerechterLeistungen zu marktfähigen Preisen. Diese Erfor<strong>der</strong>nisse stellen für das Management<strong>der</strong> Bahnunternehmen keine Neuheit dar, doch die Handlungsmöglichkeiten waren durch politischeVorgaben bislang stark eingeschränkt. Die in <strong>der</strong> jüngeren Vergangenheit vollzogene sukzessiveLiberalisierung <strong>des</strong> Schienengüterverkehrs schafft nun neue Handlungsspielräume.Hinsichtlich <strong>des</strong> Kundenverhaltens stellt MEFFERT einerseits eine verän<strong>der</strong>te Bedarfsstruktur inForm einer Individualisierung <strong>der</strong> Kundenwünsche, an<strong>der</strong>erseits einen raschen Wechsel <strong>der</strong> Präferenzenfest, <strong>der</strong> mit einer sinkenden Loyalität <strong>der</strong> Kunden gegenüber den Anbietern einhergeht 95 .Im Bereich <strong>des</strong> Schienengüterverkehrs erwarten die potenziellen Abnehmer <strong>der</strong> Logistikdienstleistervon den Anbietern mehr und mehr individuelle und ganzheitliche Lösungen 96 . Unternehmen, <strong>der</strong>enAngebot lediglich den Gütertransport von einem Ort zum an<strong>der</strong>en umfasst, werden ihre Wettbewerbsfähigkeitauf Dauer nicht erhalten können. Die Tendenz geht vielmehr zur Organisationkompletter Wertschöpfungsketten, wobei die Leistungen individuell auf den Kundenbedarf zugeschnittenwerden 97,98 . Zwar kann in <strong>der</strong> Branche <strong>des</strong> schienengebundenen Güterverkehrs kein übermäßigschneller Wechsel in den Kundenpräferenzen festgestellt werden, jedoch erwarten die Kundenvon den Eisenbahnverkehrsunternehmen ein hohes Reaktionsvermögen in Bezug auf kurzfristigeTransportanfragen, d. h. Aufträge, die bereits 24 Stunden nach Auftragseingang zu bearbeitensind 99 . Der Wandel in den Kundenpräferenzen erfor<strong>der</strong>t von den Anbietern schienengebundenerGütertransporte somit in zweifacher Hinsicht eine <strong>aus</strong>geprägte Flexibilität. Um den Ansprüchen <strong>der</strong>Kunden gerecht zu werden, müssen die Eisenbahnverkehrsunternehmen einerseits in <strong>der</strong> Lage sein,den Kunden individuell gestaltete Angebote zu unterbreiten. An<strong>der</strong>erseits ist aber auch eine rasche92 Vgl. BERNDT (2001), S. 66-67.93 Die Angaben basieren auf Daten <strong>des</strong> Statistischen Bun<strong>des</strong>amtes. Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT (2009).94 Völlig problemfrei stellt sich allerdings auch die Eisenbahn nicht dar. So können auch hier ökologische Beeinträchtigungen,etwa in Form von Lärmbelästigung, auftreten.95 Vgl. MEFFERT (1999), S. 16-17.96 Vgl. BERNDT (2001), S. 69.97 Vgl. auch MÜLLER-STEWENS (1997), S. 29.98 Um den Kunden <strong>der</strong> Eisenbahnverkehrsunternehmen ganzheitliche Lösungen anbieten zu können, ist es teilweiseauch nötig, den Verkehrsträger Straße zu nutzen und in die Transportkette einzubeziehen. Dieses Erfor<strong>der</strong>nisergibt sich beispielsweise, wenn ein Kunde keinen Bahnanschluss auf seinem Betriebsgelände besitzt und die zubeför<strong>der</strong>nden Güter zunächst per LKW zu einer Umschlagsplattform transportiert werden müssen.99 Die Informationen wurden im Rahmen eines Workshops gewonnen, <strong>der</strong> im Rahmen <strong>des</strong> VerbundprojektsMAEKAS am 24. Juni 2008 an <strong>der</strong> Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, unter dem Titel „1. Arbeitstreffen<strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKAS“ mit potenziellen Kunden durchgeführt wurde.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 14Reaktion gefor<strong>der</strong>t, wenn Kundenaufträge innerhalb einer geringen Zeitspanne <strong>aus</strong>geführt werdensollen.4.2 Kompetenzbündelung als WettbewerbsstrategieDie Beschreibung <strong>der</strong> aktuellen Marktsituation von Eisenbahnverkehrsunternehmen 100 hat die Faktorenaufgezeigt, die künftig von Unternehmen <strong>des</strong> schienengebundenen Güterverkehrs zu bewältigensind, wenn sie ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten wollen. Die Fähigkeit, qualitativ hochwertigeProdukte zu marktfähigen Preisen anzubieten und dabei flexibel auf die Bedürfnisse <strong>der</strong> Kundeneinzugehen, kann insbeson<strong>der</strong>e durch eine Kooperation zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmenerworben werden. Eine diesen Anfor<strong>der</strong>ungen in hohem Maße angemessene Kooperationsformstellt das sog. virtuelle Unternehmen dar 101 .Virtuelle Unternehmen streben eine Bündelung <strong>der</strong> Kompetenzen <strong>der</strong> beteiligten Unternehmen zu<strong>Kernkompetenzen</strong> an 102 . Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten,weil sich je<strong>des</strong> Unternehmen im Verbund auf die Aktivitäten konzentriert, die es am bestenbeherrscht. Daneben können gerade durch eine Kooperation im Schienengüterverkehr die Produktionskostenreduziert werden, weil sich durch die Zusammenarbeit die Möglichkeit <strong>der</strong> Reduzierungvon Leerfahrten ergibt 103 . Werden diese Kostensenkungen in Form von Preissenkungen an dieKunden weitergegeben, so besteht hier eine weitere Chance zur Schaffung eines Kundenwertes,diesmal in finanzieller Hinsicht. Schließlich wird in virtuellen Unternehmen auch dem Erfor<strong>der</strong>nis<strong>der</strong> Flexibilität Rechnung getragen. Zum einen wird in dieser Kooperationsform auf umfangreicheVertragswerke verzichtet. Kurzfristig auftretende Marktchancen können daher zeitnah genutzt werden.Zum an<strong>der</strong>en können im Rahmen <strong>der</strong> Kooperation Kundenaufträge bedient werden, zu <strong>der</strong>enErfüllung die aktuell verfügbare Kapazität eines einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmens nicht<strong>aus</strong>reichen würde. Aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Kunden führt dieser Kapazitätsbündelungseffekt im virtuellenUnternehmen zu einer Vergrößerung <strong>der</strong> Gesamtkapazität. Die Bündelung von Kompetenzen zwischenEisenbahnverkehrsunternehmen wird im folgenden Abschnitt anhand einer Fallstudie nähererläutert.5 Fallstudie: Bündelung von Kompetenzen zu <strong>Kernkompetenzen</strong>5.1 EinführungDie folgende Fallstudie wurde in einem Workshop, <strong>der</strong> im Rahmen <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKASstattfand, gemeinsam mit den an <strong>der</strong> Kooperation beteiligten Unternehmen <strong>des</strong> schienengebundenen100 Vgl. Abschnitt 4.1.101 Zur Wirkung virtueller Unternehmen auf die Erfolgsfaktoren Kosten, Qualität und Zeit vgl. <strong>aus</strong>führlich RINGLE(2004), S. 191-268.102 Zu einer <strong>aus</strong>führlichen Darstellung <strong>der</strong> Konzeption virtueller Unternehmen vgl. z. B. HERTRAMPF (2009a) sowieJURK (2003), S. 27-53.103 Leerfahrten können im Rahmen <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKAS insbeson<strong>der</strong>e durch die Bündelung von Einzelwagenverkehrenreduziert werden. Die Einzelwagenverkehre werden in Abhängigkeit von <strong>der</strong> nachgefragtenMenge, <strong>der</strong> nachgefragten Zeit und <strong>der</strong> nachgefragten Destination zusammengestellt und in bestehende Ganzzügeeingefügt.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 15Güterverkehrs bearbeitet 104 . Es handelt sich bei dieser Fallstudie um ein Beispiel für eine möglicheBündelung von Kompetenzen im Rahmen eines virtuellen Unternehmens, in dem die Praxispartner<strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKAS zusammenarbeiten. In einer Diskussion wurde mit den an <strong>der</strong> Kooperationbeteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen die Frage erörtert, inwiefern die vorgeschlageneBündelung von Kompetenzen zur Begründung einer Kernkompetenz führen könne, über welchedie Praxispartner <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKAS gemeinsam verfügen.5.2 GegenstandZum täglichen Geschäft <strong>der</strong> an <strong>der</strong> Kooperation beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen gehörtdie Akquisition neuer Kunden. Für die effektive Beratung dieser potenziellen Kunden benötigen dieUnternehmen verschiedene Wissensressourcen. Dazu gehören etwaFachwissen, d. h. das Wissen über die eigene Produktpalette,Kundenwissen, z. B. Wissen über die Unternehmenslage <strong>des</strong> Kunden 105 ,Marktwissen, z. B. Wissen über Konkurrenten und Institutionen 106 , sowieMarketingwissen, z. B. Wissen über Methoden <strong>der</strong> Verkaufsför<strong>der</strong>ung.Die einzelnen Kenntnisse sind bei den Kooperationspartnern unterschiedlich stark <strong>aus</strong>geprägt 107 . Soverfügen beispielsweise die lokalen Anbieter über hervorragende Kenntnisse <strong>des</strong> regionalen Marktes,während <strong>der</strong> überregional tätige Kooperationspartner fundierte Marketingkenntnisse aufweist.In diesem Fall bietet es sich an, die komplementären Wissensressourcen zu bündeln und gemeinsamzu nutzen. Die Fähigkeit zur gemeinsamen Nutzung <strong>der</strong> Ressourcenbasis erhöht nicht nur die Chance<strong>der</strong> Kooperationspartner, in einem einzelnen Fall einen neuen Kunden zu gewinnen, son<strong>der</strong>nstellt vermutlich sogar eine Kernkompetenz dar, welche den an <strong>der</strong> Kooperation beteiligten Unternehmenzur Erlangung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile verhilft.104 Der Workshop mit dem Titel „Anwendungsmöglichkeiten <strong>des</strong> <strong>Resource</strong>-Based <strong>View</strong> für das Management VirtuellerUnternehmen zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen“ fand am 30. Juli 2008 an <strong>der</strong> Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, unter <strong>der</strong> Leitung von Frau Dipl.-Kff. Sabine Hertrampf, Institut für Produktion und IndustriellesInformationsmanagement <strong>der</strong> Universität Duisburg-Essen, statt. Herr Prof. Dr. Matthias Klumpp,inomic GmbH und FOM, unterstützte die Veranstaltung mit einem themenspezifischen Vortrag. Zu den Teilnehmern<strong>des</strong> Workshops gehörten Herr Michael Kirschner, SBB Cargo GmbH, Frau Chiara Leonardi, SBB CargoGmbH, Frau Birgit Thienel, Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG, sowie Herr Dieter Schulten, MülheimerVerkehrsgesellschaft mbH. Außerdem nahmen Herr Prof. Dr. Stephan Zelewski, Leiter <strong>des</strong> Instituts für Produktionund Industrielles Informationsmanagement, sowie die Institutsangehörigen Frau Dr. Naciye Akca, Frau Dipl.-Wirt.-Inf. Susanne Jene, Frau Dipl.-Kff. Alexandra Saur, Herr Dr. Malte Peters und Herr Dipl.-Kfm. Nazif Günesan dem Workshop teil.105 Im Rahmen <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKAS umfasst das Kundenwissen insbeson<strong>der</strong>e auch Kenntnisse über passiveGleisanschlüsse potenzieller Kunden. Die Erlangung <strong>der</strong>artiger Informationen erfor<strong>der</strong>t systematische und permanenteAktivitäten im Bereich <strong>der</strong> Marktforschung.106 Dazu gehören beispielsweise Industrie- und Handelskammern, lokale Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsorganisationen undan<strong>der</strong>e Wirtschaftsverbände, die über marktbezogene Informationen verfügen.107 Vgl. GÜNES (2009), Kapitel 6.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 165.3 Analyse5.3.1 VorgehensweiseDie Teilnehmer <strong>des</strong> Workshops erhielten einen Fragebogen mit neun Fragen 108 . Jede dieser Fragenbezog sich auf eine spezifische Eigenschaft von <strong>Kernkompetenzen</strong> 109 . Die Teilnehmer wurden gebeten,anhand dieser Fragen zu überprüfen, ob es sich bei <strong>der</strong> beschriebenen gemeinsamen Nutzungvon Wissensressourcen um eine Kernkompetenz im Sinne <strong>des</strong> <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> 110 handelt. DieFragen bezogen sich im Einzelnen auf die folgenden Charakteristika von <strong>Kernkompetenzen</strong> 111 :Werterzeugung,Seltenheit,Resistenz gegenüber Akquisitions-, Imitations- und Substitutionsversuchen,Transfermöglichkeit,Möglichkeit <strong>der</strong> Weiterentwicklung sowieMöglichkeit zur Aneignung <strong>der</strong> Gewinne.5.3.2 Nachweis <strong>der</strong> Kernkompetenzeigenschaft5.3.2.1 WerterzeugungDie grundlegende Vor<strong>aus</strong>setzung für die Erlangung kompetitiver Vorteile bildet in <strong>der</strong> Argumentationslinie<strong>des</strong> <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> die Schaffung eines für den Kunden einzigartigen Wertes, d. h.eines Wertes, den konkurrierende Unternehmen diesem Kunden nicht zu bieten vermögen 112 . Dabeikann sich die Wertschaffung auf verschiedene Aspekte richten. So ist es etwa möglich, für denKunden einen beson<strong>der</strong>en finanziellen Wert zu schaffen, indem man ihm für das betreffende Produkteinen relativ vorteilhaften Preis einräumt. Weiterhin kann sich ein einzigartiger Kundenwertaber auch <strong>aus</strong> dem Umstand ergeben, dass das betreffende Produkt in einer ungewöhnlich hochwertigenQualität 113 angeboten wird.Ob man seinem Kunden kostenbezogene o<strong>der</strong> qualitative Vorteile einräumen möchte – in jedemFall muss <strong>der</strong> geschaffene Wert von dem Kunden auch wahrgenommen werden. Ein Kundenwert,den niemand zur Kenntnis nimmt, kann für das Unternehmen keine strategische Wirkung entfalten.Der geschaffene Wert muss dem Kunden in einer <strong>der</strong> Person und <strong>der</strong> Situation angemessenen Weisekommuniziert werden. Unter diesem Aspekt ist insbeson<strong>der</strong>e die Marketingkompetenz <strong>des</strong> Unternehmensgefor<strong>der</strong>t, denn die Übermittlung <strong>des</strong> Kundenwertes gehört zum Arbeitsgebiet <strong>des</strong> CustomerRelationship Management, einem Teilbereich <strong>des</strong> Marketings 114 .Im vorliegenden Fall kann für die Kunden <strong>der</strong> Eisenbahnverkehrsunternehmen ein beson<strong>der</strong>er Wertgeschaffen werden, wenn das Kundenwissen <strong>der</strong> regionalen Anbieter im Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatungzum Einsatz gelangt. Kundenindividuelle Informationen sind erfor<strong>der</strong>lich, um ein Angebot er-108 Der komplette Fragebogen befindet sich im Anhang dieses Berichtes.109 Ausgenommen war Frage 9, welche lediglich zusammenfassenden Charakter hatte.110 Vgl. Abschnitt 2.3.111 Vgl. Abschnitt 3.3.112 Vgl. Abschnitt 3.2.2.113 In Bezug auf Unternehmen <strong>des</strong> schienengebundenen Güterverkehrs ist hierbei insbeson<strong>der</strong>e an die Servicequalitätzu denken. Diese umfasst Komponenten wie Pünktlichkeit, Lieferzeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Umgang mitReklamationen.114 Vgl. HAAS (2006), S. 448.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 17stellen zu können, das präzise auf den Bedarf <strong>des</strong> Kunden zugeschnitten ist. Für die Kundengewinnungrelevantes Wissen erstreckt sich auf Faktoren, wie etwa die Produktpalette <strong>des</strong> Kunden, seineLieferanten, seine Abnehmer sowie die gegenwärtigen situativen Bedingungen seines Unternehmens.Letzterer Aspekt beinhaltet insbeson<strong>der</strong>e Kenntnisse über die Art <strong>der</strong> beim Kunden verfügbarenGleisanschlüsse, seine Be- und Entladevorrichtungen und die Art <strong>der</strong> für die Bedienung <strong>des</strong>Kunden benötigten Güterwagen. Die Kenntnis <strong>der</strong> aktuellen Situation eines Kunden umfasst aberauch Informationen über eine angespannte finanzielle Lage seines Unternehmens o<strong>der</strong> bevorstehendeUmstrukturierungsmaßnahmen. Je mehr Informationen über einen Kunden zur Verfügung stehen,<strong>des</strong>to größer ist die Chance, für diesen Kunden ein bedarfsgerechtes Angebot erstellen zu könnenund zu seiner Übermittlung die dem Kunden angemessenen Marketinginstrumente einzusetzen.Eine effektive Ergänzung findet das vorhandene Kundenwissen durch die hervorragenden Marktkenntnisse<strong>der</strong> regionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen. So können beispielsweise Informationenüber die Produktpalette <strong>der</strong> Konkurrenten bereits im Rahmen <strong>der</strong> Angebotserstellung für den Kundenberücksichtigt werden, indem etwa spezielle, auf die Produkte <strong>des</strong> Kunden abgestimmte Wagentypenin das Angebot aufgenommen werden. Auch das Wissen um für den Kunden relevante Institutionen115 und Verbände kann die Erarbeitung eines individuellen Angebotes unterstützen. Sokönnen etwa über die reine Transportdienstleistung hin<strong>aus</strong> Serviceleistungen, wie die Erledigungvon Antragsformalitäten 116 u. ä., in das angebotene Leistungspaket aufgenommen werden.Ist mit Hilfe <strong>des</strong> Kunden- und Marktwissens <strong>der</strong> regionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen ein bedarfsgerechtesAngebot erstellt worden, so muss dem potenziellen Kunden im nächsten Schritt dieMöglichkeit <strong>der</strong> Bedarfsdeckung durch dieses Angebot verdeutlicht werden 117 . Das Angebot zur individuellenBedarfsdeckung verkörpert den durch den Anbieter zu realisierenden Kundenwert. DieÜbermittlung <strong>des</strong> konkreten Angebotes – und damit die Wahrnehmung <strong>des</strong> potenziellen Kundenwertesdurch den Kunden – wird durch die hervorragenden Marketingkenntnisse <strong>des</strong> überregionalenKooperationspartners gewährleistet. Bei <strong>der</strong> Realisierung <strong>des</strong> Informationstransfers kommen insbeson<strong>der</strong>edie kommunikativen Fähigkeiten <strong>des</strong> überregional tätigen Partnerunternehmens zum Einsatz.So können insbeson<strong>der</strong>e persönliche Verkaufsgespräche – etwa auf Fachmessen o<strong>der</strong> im Rahmeneiner Verkaufspräsentation – genutzt werden, um potenziellen Kunden individuelle Angebotezu übermitteln. Die Wirkung <strong>der</strong>artiger Maßnahmen ist am größten, wenn die übermittelte Botschafteine hohe Übereinstimmung mit den Einstellungen und Neigungen <strong>des</strong> potenziellen Käufersaufweist 118 . Somit kommt hierbei wie<strong>der</strong>um dem Kunden- und Marktwissen <strong>der</strong> regionalen Kooperationspartnereine hohe Bedeutung zu.Das Kunden- und Marktwissen <strong>der</strong> regionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie die hervorragendenMarketingkenntnisse <strong>des</strong> überregionalen Anbieters lassen sich also bündeln, um1. auf den einzelnen Kunden zugeschnittene Angebote zu erstellen und2. diese Angebote dem Kunden in angemessener Weise zu übermitteln.Insgesamt lässt sich somit durch die Bündelung <strong>der</strong> Kompetenzen <strong>der</strong> Eisenbahnverkehrsunternehmenauf den Gebieten <strong>des</strong> Kunden- und Marktwissens sowie im Bereich <strong>des</strong> Marketings ein einzigartigerKundenwert schaffen.115 Dazu gehören etwa Industrie- und Handelskammern, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsgesellschaften u. ä.116 Hierbei ist z. B. an die Erledigung jener Antragsformalitäten zu denken, die im Falle <strong>der</strong> Reaktivierung einesGleisanschlusses auf dem Betriebsgelände eines Kunden anfallen.117 Vgl. HAAS (2006), S. 448.118 Vgl. KOTLER/KELLER/BLIEMEL (2007), S. 657.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 185.3.2.2 SeltenheitEng verbunden mit dem Kriterium <strong>des</strong> her<strong>aus</strong>ragenden Kundenwertes ist jenes <strong>der</strong> Seltenheit, dennein beson<strong>der</strong>er Nutzen entsteht für einen Kunden nicht zuletzt auch dadurch, dass die Verfügbarkeiteines Produktes eingeschränkt ist 119 . Könnte er das Produkt bei zahlreichen Anbietern erwerben, soverlöre es seinen einzigartigen Charakter und damit seinen beson<strong>der</strong>en Wert.Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite könnte aber auch das anbietende Unternehmen durch die Begründung einessolchen Wertes keine vorteilhafte Wettbewerbsposition erlangen, wenn zahlreiche Konkurrenten in<strong>der</strong> Lage wären, für ihre Kunden einen vergleichbaren Wert zu schaffen. Notwendig ist die Schaffungeines Wertes, <strong>der</strong> es dem betreffenden Unternehmen ermöglicht, sich eindeutig von seinerKonkurrenz abzusetzen. Der Besitz einer Kompetenz, mit <strong>der</strong>en Hilfe ein Produkt geschaffen werdenkann, das dieser Anfor<strong>der</strong>ung genügt, erlaubt es dem anbietenden Unternehmen, eine uniqueselling position aufzubauen.Bei <strong>der</strong> Bestimmung <strong>des</strong> Seltenheitsgra<strong>des</strong> ist die Marktabgrenzung zu berücksichtigen. Das angeboteneProdukt muss nicht weltweit, son<strong>der</strong>n lediglich auf dem für das Unternehmen relevantenMarkt eine Rarität darstellen, um seine strategische Bedeutung zu erlangen. Im Falle <strong>der</strong> hier betrachtetenEisenbahnverkehrsunternehmen stellen sich verschiedene Märkte als relevant dar. Soagieren die lokalen Anbieter überwiegend in <strong>der</strong> Region Ruhrgebiet, während das überregional tätigeUnternehmen einen weit<strong>aus</strong> größeren Aktionsradius aufweist.Im vorliegenden Fall konnte die Frage <strong>der</strong> Seltenheit <strong>der</strong> betrachteten Fähigkeit nicht abschließendgeklärt werden. Die anwesenden Vertreter <strong>der</strong> im Rahmen <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKAS kooperierendenEisenbahnverkehrsunternehmen gaben an, dass auch ihre Konkurrenten eine gemeinsameWissensnutzung im Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung praktizierten. Allerdings stellt sich hier die Frage,inwiefern die Fähigkeit zur gemeinsamen Wissensnutzung konkurrieren<strong>der</strong> Unternehmen mit<strong>der</strong> Fähigkeit <strong>der</strong> hier betrachteten Eisenbahnverkehrsunternehmen gleichgesetzt werden kann. DerFähigkeit zur Wissensbündelung liegen jeweils an<strong>der</strong>e Wissensressourcen zugrunde, weil jede Person– somit auch die Mitarbeiter <strong>der</strong> Konkurrenzunternehmen – über individuelle Berufserfahrungenverfügt. Die Fähigkeit zur gemeinsamen Wissensnutzung bezöge sich folglich auf verschiedenartigeWissensressourcen. Dieser Umstand wirft die Frage auf, inwiefern aufgrund unterschiedlicherWissensressourcen auch von differierenden Fähigkeiten <strong>aus</strong>gegangen werden kann.<strong>Kernkompetenzen</strong> stellen komplexe Ressourcenbündel dar. Sie umfassen die Fähigkeit, die Ressourceneines Unternehmens in strategisch relevanter Weise miteinan<strong>der</strong> zu kombinieren. Da aberFähigkeiten ebenfalls Ressourcen darstellen, sind sie Bestandteil <strong>des</strong> komplexen Ressourcenbündels.Die Komplexität von <strong>Kernkompetenzen</strong> führt dazu, dass die gebündelten Ressourcen nur ineben jenem Verbund zur Schaffung eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils beizutragen vermögen.Steht eine <strong>der</strong> Ressourcen <strong>des</strong> Bündels nicht mehr zur Verfügung, so gerät <strong>der</strong> Wettbewerbsvorteilin Gefahr. Der Wert <strong>des</strong> Ressourcenbündels für das Unternehmen beruht somit auf je<strong>der</strong> einzelnenRessource <strong>des</strong> Verbun<strong>des</strong>. Wenn nun eine <strong>der</strong> Ressourcen <strong>des</strong> Verbun<strong>des</strong> einen beson<strong>der</strong>en Seltenheitswertaufweist, so teilt sich aufgrund <strong>der</strong> in dem Verbund herrschenden Interdependenzen dieserCharakter allen übrigen Ressourcen <strong>des</strong> Bündels mit. Im betrachteten Fall weisen die zu bündelndenWissensressourcen jeweils einen einzigartigen Charakter auf. Ein Unternehmen erwirbt sein Wissenunter bestimmten historischen Rahmenbedingungen 120 . Dazu gehören etwa Personen, die das Un-119 Vgl. Abschnitt 3.3.120 Vgl. die Ausführungen zum Aufbau von Wissen im Rahmen <strong>der</strong> einzigartigen historischen Entwicklung von Unternehmenin Abschnitt 3.3.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 19ternehmen über einen bestimmten Zeitraum geleitet haben, Entscheidungen, die von diesen Personengefällt wurden, sowie politische o<strong>der</strong> gesellschaftliche Ereignisse, die den Verlauf <strong>der</strong> Unternehmensgeschichtebeeinflusst haben. Der Entwicklungsprozess, den das Unternehmen im Zugeseines Wissenserwerbs durchläuft, kann aufgrund seiner Einzigartigkeit von einem Konkurrentennicht in exakt <strong>der</strong>selben Weise reproduziert werden. Dies bedeutet für den hier betrachteten Fall,dass die Fähigkeit <strong>der</strong> gemeinsamen Wissensnutzung mit Sicherheit eine Seltenheit darstellt, weildie ihr zugrunde liegenden Wissensressourcen jeweils einen einzigartigen Charakter aufweisen. Je<strong>des</strong><strong>der</strong> an <strong>der</strong> Wissensbündelung beteiligten Unternehmen weist ein spezifisches Wissen auf, welcheses in Jahren o<strong>der</strong> Jahrzehnten unter einzigartigen historischen Bedingungen erworben hat.Unter diesen Aspekten könnte man argumentieren, dass die Fähigkeit, gerade diese spezifischenWissensbestände zu bündeln, nicht unmittelbar mit <strong>der</strong> Fähigkeit konkurrieren<strong>der</strong> Unternehmenverglichen werden kann, die mit <strong>der</strong> Bündelung an<strong>der</strong>sartiger Wissensressourcen konfrontiert werden.Allerdings kann die Problematik an dieser Stelle nur skizziert werden. Eine abschließende Beurteilungbedarf einer eingehenden Erörterung, welche in diesem Beitrag nicht realisiert werdenkann.Eine abschließende Beantwortung <strong>der</strong> Frage, ob die Fähigkeit, das Wissen <strong>der</strong> hier betrachteten Eisenbahnverkehrsunternehmenzu bündeln, als Seltenheit betrachtet werden kann, ist somit in demhier gesteckten Rahmen nicht möglich.5.3.2.3 Komplexität als Schutz vor EntschlüsselungGelingt es einem Unternehmen, durch eine – im Vergleich zur Konkurrenz – überlegene Kombinationseiner Ressourcen einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, so werden die konkurrierenden Unternehmenversuchen, diesen Wettbewerbsvorsprung aufzuholen. Dazu stehen ihnen grundsätzlichdrei Wege offen: die Akquisition, die Imitation o<strong>der</strong> die Substitution <strong>der</strong> erfolgsbestimmenden Ressourcen.Ob die Wettbewerber nun versuchen, die strategisch relevanten Ressourcen <strong>des</strong> erfolgreichenUnternehmens käuflich zu erwerben, die Ressourcen unternehmensintern nachzubilden o<strong>der</strong>sie durch an<strong>der</strong>e, wirkungsgleiche Ressourcen zu ersetzen – in jedem Fall müssen sie zunächst dieErfolgsursachen <strong>des</strong> Pionierunternehmens ergründen. Dabei sind im Einzelnen folgende Faktorenzu entschlüsseln 121 :die am Markt angebotene Leistung, die für den Erfolg ursächlich ist,die Ressourcen, welche dieser Marktleistung zugrunde liegen, sowiedie Interaktion <strong>der</strong> erfolgsbestimmenden Ressourcen.Für einen externen Beobachter dürfte es bereits schwierig sein, die erste Hürde <strong>der</strong> Entschlüsselungzu überwinden, d. h. die erfolgsbestimmende Leistung <strong>des</strong> betrachteten Unternehmens zu ergründen.So ist auch im vorliegenden Fall anzunehmen, dass ein externer Beobachter den Erfolg <strong>der</strong> Eisenbahnverkehrsunternehmennicht ohne weiteres auf die exzellente Kundenberatung zurückführenwird.Auch die Ressourcen, die im Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung eingesetzt werden, sowie die Art <strong>der</strong> Interaktionendieser Ressourcen werden sich einer externen Person – etwa einem Konkurrenten <strong>der</strong>kooperierenden Eisenbahnverkehrsunternehmen – vermutlich nicht unmittelbar erschließen. Sowird diese Person kaum in <strong>der</strong> Lage sein, eine Erfolgssteigerung auf die Tatsache zurückzuführen,121 Vgl. Abschnitt 3.2.2.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 20dass die Kooperationspartner ihr Wissen im Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung bündeln. Der Grund dafürist in <strong>der</strong> Intransparenz <strong>des</strong> Bündelungsprozesses zu sehen. Je<strong>des</strong> <strong>der</strong> vier beteiligten Unternehmenbringt spezifische Wissensressourcen in die Kooperation ein. Diese Ressourcen werden imRahmen <strong>der</strong> Kundenberatung gebündelt. Die Bündelung erfolgt durch die Interaktion <strong>der</strong> an <strong>der</strong> Beratungbeteiligten Partner. Aus diesem Zusammenwirken entsteht schließlich <strong>der</strong> beson<strong>der</strong>e Kundenwert,<strong>der</strong> den Partnern zum Wettbewerbserfolg verhilft. Der Erfolg <strong>der</strong> Kooperationspartnerwürde also im Fall <strong>der</strong> gemeinsamen Kundenberatung <strong>aus</strong> dem Zusammenwirken <strong>der</strong> vier verschiedenenUnternehmen resultieren. Da <strong>der</strong> Bündelungsprozess unter Beteiligung von Menschen erfolgtund Menschen in ihrem Verhalten nicht berechenbar sind, können <strong>der</strong> Ablauf und das Ergebnis <strong>des</strong>Bündelungsprozesses nicht eindeutig prognostiziert werden. Es liegt eine sog. soziale Komplexität122 vor. Aufgrund <strong>der</strong> Tatsache, dass die Prozesse, die zwischen den betrachteten Unternehmenablaufen, in ihrer Struktur und ihrem Resultat für einen Außenstehenden nicht vollkommen transparentsind, würden die Wettbewerber bereits an dem ersten Schritt jeglicher Zugriffsversuche, <strong>der</strong>Entschlüsselung <strong>der</strong> Erfolgsursachen, scheitern. Die hier vorliegende Komplexität übt somit eineSchutzfunktion gegen Akquisitions-, Imitations- o<strong>der</strong> Substitutionsversuche konkurrieren<strong>der</strong> Unternehmen<strong>aus</strong>.5.3.2.4 Komplexität als Schutz vor AkquisitionsversuchenIm vorigen Abschnitt wurde festgehalten, dass ein Zugriff auf erfolgskritische, durch Komplexität123 gekennzeichnete Ressourcen eines Unternehmens <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Position eines externen Beobachtersmit erheblichen Schwierigkeiten behaftet ist. Gelänge es einem Konkurrenten dennoch, auf einzelnedieser Ressourcen zuzugreifen – etwa durch die Abwerbung eines <strong>der</strong> internen Wissensträger 124 –so wäre jedoch zu bezweifeln, dass er mit Hilfe dieser Ressourcen den gleichen Kundenwert erzeugenkönnte, den vormals das Pionierunternehmen begründen konnte. Ursächlich hierfür ist wie<strong>der</strong>umdie dem Ressourcenbündel inhärente Komplexität. Diese führt dazu, dass <strong>aus</strong>schließlich <strong>aus</strong>dem Zusammenwirken <strong>der</strong> Ressourcen ein beson<strong>der</strong>er Kundenwert entsteht 125 .Würde im hier betrachteten Fall <strong>der</strong> gemeinsamen Kundenberatung <strong>der</strong> Eisenbahnverkehrsunternehmenbeispielsweise <strong>der</strong> überregional tätige Kooperationspartner <strong>aus</strong> dem Verbund <strong>aus</strong>scheiden,so könnten die übrigen Partner zwar immer noch einen beson<strong>der</strong>en Kundenwert schaffen. Allerdingsfehlte es ihnen an den nötigen Marketingkenntnissen, um diesen Wert dem Kunden auch effektivvermitteln zu können. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite könnte ein Konkurrent, <strong>der</strong> einen internen Wissensträger<strong>des</strong> überregional tätigen Partners abgeworben hätte, mit <strong>des</strong>sen Marketingkenntnissennicht den gleichen Erfolg erzielen wie zuvor die Gemeinschaft <strong>der</strong> Kooperationspartner. Es würdeihm in diesem Fall an den regionalen Marktkenntnissen <strong>der</strong> lokalen Eisenbahnverkehrsunternehmenmangeln, welche die Grundlage <strong>des</strong> beson<strong>der</strong>en Kundenwertes bilden. Der käufliche Erwerb einzelnerWissensressourcen durch die Konkurrenz würde somit aufgrund <strong>des</strong> fehlenden, erfolgsbestimmendenKontextes nicht zum gewünschten Resultat führen 126 .122 Vgl. Abschnitt 3.2.2.123 Vgl. Abschnitt 3.2.2.124 In diesem Fall würde <strong>der</strong> Konkurrent seine externe Position teilweise aufgeben.125 Die Beziehungen zwischen den Ressourcen weisen also einen sich gegenseitig verstärkenden Charakter auf, <strong>der</strong>eine Vor<strong>aus</strong>setzung für den wettbewerbskritischen Charakter komplexer Ressourcen darstellt. Vgl. Abschnitt3.2.2.126 Vgl. MÜLLER-STEWENS/OSTERLOH (1996), S. 18.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 21Die Fähigkeit <strong>der</strong> Partnerunternehmen, ihre Wissensressourcen zu bündeln und damit einen Wettbewerbsvorteilzu begründen, kann nur im Verbund <strong>der</strong> Kooperation ihren vollen Wert entfalten.Somit führt die Komplexität zu einer Immobilität <strong>der</strong> Ressourcen 127 , weil durch eine Ressourcenübertragungein Wertverlust entsteht. Die Komplexität <strong>des</strong> betrachteten Ressourcenbündels entfaltetfolglich nicht nur einen Schutz gegen die Entschlüsselung durch externe Beobachter 128 , son<strong>der</strong>nverhin<strong>der</strong>t selbst im Falle eines teilweisen Zugriffs auf den Ressourcenverbund die Schaffung einesvergleichbaren Wettbewerbsvorteils durch Konkurrenten.5.3.2.5 Zeitvorteile und MultiplikatoreffekteWenn es für einen Konkurrenten nicht erfolgversprechend scheint, auf einzelne, eine Kernkompetenzbegründende Ressourcen zuzugreifen, weil diese ohne den notwendigen Kontext keinen strategischenWert entfalten können 129 , so bietet sich für ihn weiterhin eine Imitation o<strong>der</strong> Substitution<strong>der</strong> erfolgsbestimmenden Kernkompetenz an 130 . Berücksichtigt man, dass eine Kompetenz die Fähigkeitdarstellt, Ressourcen <strong>der</strong>art zu kombinieren, dass <strong>aus</strong> ihnen ein Wettbewerbsvorteil erwächst,so wird deutlich, dass die Imitation einer Kernkompetenz zwei Aspekte umfasst: zum einendie Entwicklung <strong>der</strong> zu kombinierenden Ressourcen, zum an<strong>der</strong>en die Begründung <strong>der</strong> zur erfolgskritischenKombination dieser Ressourcen erfor<strong>der</strong>lichen Fähigkeit. Der Zugriff auf die erfolgsbestimmendenRessourcen wurde bereits in Abschnitt 5.3.2.4 im Rahmen <strong>der</strong> Ausführungen zur Akquisitionerfolgskritischer Ressourcen behandelt. In diesem Abschnitt wird daher die Entwicklungjener Fähigkeit behandelt, welche zur erfolgskritischen Kombination dieser Ressourcen erfor<strong>der</strong>lichist. Es stellt sich somit die Frage, ob ein Konkurrent, welcher bereits über die notwendigen Wissensressourcenverfügt, zudem in <strong>der</strong> Lage ist, die noch fehlende Kombinationsfähigkeit zu entwickeln,welche letztlich zum Wettbewerbserfolg führt.Ausgangspunkt <strong>der</strong> Überlegungen zu dieser Fragestellung ist die Struktur einer solchen Kombinationsfähigkeit.Die Fähigkeit zur wissensorientierten Zusammenarbeit im Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung,d. h. die Fähigkeit zur Bündelung <strong>der</strong> verschiedenen Wissensressourcen <strong>der</strong> Kooperationspartner,setzt bestimmte Rahmenbedingungen vor<strong>aus</strong>. So erfor<strong>der</strong>t eine effektive Kooperation insbeson<strong>der</strong>eden Aufbau von Vertrauen zwischen den Partnern 131 , um die Furcht vor dem missbräuchlichenUmgang mit dem Wissen <strong>des</strong> jeweils an<strong>der</strong>en Unternehmens abzubauen. Weiterhin bedingtgerade die Zusammenarbeit in einem virtuellen Unternehmen die Fähigkeit zur Selbstorganisation<strong>der</strong> Partner 132 . Virtuelle Unternehmen sind durch Flexibilität gekennzeichnet. Eine solche rascheReaktionsfähigkeit auf Impulse <strong>aus</strong> dem Kooperationsumfeld könnte in einer von strengen Hierarchiengeprägten Kooperationskultur nicht gewährleistet werden. Vielmehr kommt sie gerade dadurchzustande, dass die Kooperationspartner sich im Falle zu treffen<strong>der</strong> Entscheidungen im Rahmenvon Diskussionen ohne die Einschaltung höherer Instanzen auf einen Beschluss einigen. Eineweitere wichtige Vor<strong>aus</strong>setzung für die Zusammenarbeit stellt die Koordinationsfähigkeit <strong>der</strong> Partnerunternehmendar 133 . Die gemeinsame Ausführung von Aktivitäten erfor<strong>der</strong>t eine effektive und127 Vgl. Abschnitt 3.3.128 Vgl. Abschnitt 5.3.2.3.129 Vgl. Abschnitt 5.3.2.4.130 Dies setzt natürlich vor<strong>aus</strong>, dass es dem Konkurrenten zunächst gelingt, die Kompetenz in ihrer Struktur und ihremAblauf zu entschlüsseln. Vgl. Abschnitt 5.3.2.3.131 Vgl. PETERS (2008), S. 1-4, 115-117, 133-137, 156-161 und 183-190, sowie OELSNITZ (2003b), S. 519-520.132 Vgl. HILLIG (1997), S. 184-189.133 Vgl. LORENZONI/LIPPARINI (1999), S. 320.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 22effiziente Abstimmung <strong>der</strong> Tätigkeiten zwischen den Kooperationspartnern, um die rasche und präziseAusführung von Kundenaufträgen zu sichern.Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass die Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Grundekeine Einzelfähigkeit darstellt, son<strong>der</strong>n sich vielmehr <strong>aus</strong> unterschiedlichen Subfähigkeiten zusammensetzt.Imitationswillige Konkurrenten sehen sich daher mit <strong>der</strong> Notwendigkeit <strong>des</strong> Erwerbs einerVielzahl von Fähigkeiten konfrontiert, die erst in ihrer Gesamtheit die gemeinsame Wissensnutzungermöglichen. Der Aufbau von Vertrauen, <strong>der</strong> Erwerb <strong>der</strong> Fähigkeit zur Selbstorganisation sowiedie Entwicklung <strong>des</strong> Koordinationsvermögens stellen langwierige Prozesse dar. So ergibt sichbeispielsweise ein Vertrauensverhältnis zwischen den hier betrachteten Kooperationspartnern erstdurch eine fortwährende Zusammenarbeit, in <strong>der</strong>en Verlauf sich die beteiligten Unternehmen sukzessivevon <strong>der</strong> Zuverlässigkeit und Fairness <strong>der</strong> jeweiligen Partner überzeugen können. Die wie<strong>der</strong>holtegemeinsame Ausführung von Kundenaufträgen, in <strong>der</strong>en Verlauf je<strong>der</strong> <strong>der</strong> Partner die vereinbartenAufgaben erfüllt und keine Versuche unternimmt, die übrigen Beteiligten zu übervorteilen,trägt nach und nach zur Festigung <strong>des</strong> Vertrauensverhältnisses zwischen den Kooperationspartnernbei. Die Entwicklungslinien, die im Rahmen <strong>der</strong> Zusammenarbeit von den Kooperationspartnerndurchlaufen werden, sind von historisch einzigartigen Ereignissen geprägt 134 . Die Entwicklungselbst findet auf einem spezifischen Pfad statt, welcher von den individuellen Entscheidungen <strong>der</strong>Kooperationspartner vorgezeichnet wird. Konkurrenten, welche diese Fähigkeit erwerben möchten,müssten also theoretisch denselben o<strong>der</strong> einen „hinreichend“ ähnlichen Entwicklungspfad beschreitenwie die Kooperationspartner. Dies ist aber <strong>aus</strong> zweierlei Gründen nicht möglich: Zum einen gestaltetsich ein identisches Durchlaufen <strong>des</strong>selben Entwicklungspfa<strong>des</strong> als sehr zeitaufwändig. DieseZeit steht dem Konkurrenten aber nicht zur Verfügung, weil mittlerweile die Unternehmen im Besitz<strong>des</strong> Wettbewerbsvorsprungs ebenfalls ihr Wissen weiterentwickeln (Zeitvorteile). Dabei verfügendie Pionierunternehmen – in diesem Fall die kooperierenden Eisenbahnverkehrsunternehmen –bereits über einen grundlegenden Wissensbestand, <strong>der</strong> es ihnen ermöglicht, weiteres Wissen in nochkürzerer Zeit zu akkumulieren (Multiplikatoreffekt). Abgesehen von den Vorteilen <strong>der</strong> Kooperationspartnerwäre es einem Konkurrenten aber auch gar nicht möglich, exakt denselben Entwicklungspfadzu durchlaufen, weil dieser Pfad einen einzigartigen Charakter aufweist und sich seineDurchschreitung somit nicht beliebig wie<strong>der</strong>holen lässt.Nun könnte ein Konkurrent, wenn eine Imitation <strong>der</strong> Fähigkeit nicht möglich ist, in Betracht ziehen,die Fähigkeit zur Zusammenarbeit durch eine ähnliche o<strong>der</strong> auch gänzlich an<strong>der</strong>s gestaltete Fähigkeitzu ersetzen. Hierzu müsste er vollwertige Substitute für das zwischen den Kooperationspartnernherrschende Vertrauen, ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation sowie ihr Koordinationsvermögenschaffen. Als Ersatz für die von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit käme grundsätzlich <strong>der</strong>Einsatz von Kontrollmechanismen in Betracht, die Fähigkeit zur Selbstorganisation etwa könntedurch straffe Hierarchien ersetzt werden. Allerdings ergäbe sich hierbei das Problem, dass durch dieSurrogate die für ein virtuelles Unternehmen charakteristische Flexibiliät und Reaktionsgeschwindigkeittendenziell sinken würden. Die genannten Mittel stellen daher keine vollwertigen Substituteim Kontext eines virtuellen Unternehmens dar.Somit lässt sich festhalten, dass sowohl Zeitvorteile als auch Multiplikatoreffekte im Rahmen <strong>des</strong>Wissenserwerbs die hier betrachtete Unternehmenskooperation vor Imitations- und Substitutionsversuchen<strong>der</strong> Konkurrenz effektiv schützen und damit einen auf dem gebündelten Wissen beruhendenWettbewerbsvorteil nachhaltig sichern.134 Vgl. Abschnitt 3.3.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 235.3.2.6 TransfermöglichkeitEine beson<strong>der</strong>e Eigenschaft von <strong>Kernkompetenzen</strong> besteht in ihrer Transferierbarkeit 135 . Die Anwendungvon <strong>Kernkompetenzen</strong> ist nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt. Vielmehr sinddiese Kompetenzen vielseitig einsetzbar. Damit sind <strong>Kernkompetenzen</strong> hinsichtlich ihrer Lebensdauernicht von vornherein beschränkt, son<strong>der</strong>n können – in modifizierter Form – in an<strong>der</strong>weitigenEinsatzgebieten, wie etwa in Bezug auf an<strong>der</strong>e Kunden, Märkte o<strong>der</strong> Produkte, weiter zur Erhaltung<strong>der</strong> Wettbewerbsfähigkeit <strong>des</strong> sie besitzenden Unternehmens beitragen.Die Frage nach <strong>der</strong> Transferierbarkeit <strong>der</strong> hier betrachteten Fähigkeit auf alternative Kundengruppenkann <strong>aus</strong>schließlich in Abhängigkeit von dem gewählten Abgrenzungskriterium beantwortetwerden. Selektiert man etwa die als Kunden in Frage kommenden Unternehmen nach ihrer Branchenzugehörigkeit,so erweist sich die zu prüfende Übertragbarkeit <strong>der</strong> betrachteten Kernkompetenzweitestgehend als gegeben. Die kooperierenden Eisenbahnverkehrsunternehmen beschränken sichim Rahmen ihrer Absatzaktivitäten nicht auf Unternehmen spezifischer Branchen, son<strong>der</strong>n generellauf die in <strong>der</strong> Region Ruhrgebiet ansässigen Abnehmer. Somit weisen sie im Hinblick auf potenzielleKunden umfassende Kenntnisse auf, welche einen möglichen Transfer <strong>der</strong> betrachteten Kompetenzdurch<strong>aus</strong> unterstützen.Schwieriger gestaltet sich dagegen eine Übertragung <strong>der</strong> betrachteten Kompetenzen auf neue Märkte.Die Kernkompetenz <strong>der</strong> hier betrachteten Eisenbahnverkehrsunternehmen resultiert unter an<strong>der</strong>em<strong>aus</strong> den hervorragenden Kenntnissen <strong>des</strong> regionalen Marktes <strong>der</strong> lokalen Anbieter. Ein Transferdieser Kernkompetenz auf – geographisch definierte – neue Märkte erweist sich insofern als problematisch.Eine Übertragung <strong>der</strong> Kernkompetenz auf innovative Produkte in Form neuartiger Transportlösungenim Bereich <strong>des</strong> Schienengüterverkehrs 136 kann dagegen als realistisch betrachtet werden, sofernsich die damit verbundenen Aktivitäten weiterhin auf die Region Ruhrgebiet konzentrieren und somitdie Kenntnisse <strong>des</strong> regionalen Marktes ihre tragende Rolle im Rahmen <strong>der</strong> Kernkompetenz behalten.Da zumin<strong>des</strong>t ein Kriterium <strong>der</strong> Transferierbarkeit – die Möglichkeit zur Übertragung <strong>der</strong> Kompetenzauf neue Kunden – erfüllt ist, kann die Fähigkeit zur Wissensbündelung als transferierbar bezeichnetwerden.5.3.2.7 Möglichkeit <strong>der</strong> Weiterentwicklung<strong>Kernkompetenzen</strong> zählen zu den wissensbasierten Ressourcen 137 . Diese Art von Ressourcen bietetihrem Besitzer die Möglichkeit ihrer ständigen Weiterentwicklung durch den Erwerb neuen Wissensund <strong>des</strong>sen Integration in die vorhandene Wissensbasis. Im vorliegenden Fall wurde die Fähigkeitzur gemeinsamen Wissensnutzung im Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung zwecks Akquisition von135 Vgl. Abschnitt 3.3.136 Hier wäre beispielsweise an die Entwicklung eines „Ruhr-Shuttle“ zu denken, welcher <strong>aus</strong> Einzelwagenverkehren<strong>der</strong> kooperierenden Praxispartner besteht und ohne die Kooperation im Verbundprojekt MAEKAS wegen mangeln<strong>der</strong>wirtschaftlicher Vorteilhaftigkeit nicht zustande gekommen wäre. Ein weiteres Beispiel für neuartigeTransportlösungen auf dem Gebiet <strong>des</strong> Schienengüterverkehrs wäre die Entwicklung einer „Transportbörse“, dievon den Praxispartnern <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKAS als Portal ihres virtuellen Unternehmens im Internet gemeinsambetrieben und evtl. auch weiteren kooperationswilligen Gütertransportunternehmen geöffnet wird.137 Vgl. Abschnitt 3.1.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 24Neukunden betrachtet. Die Werbung von Neukunden wurde im hier betrachteten Fall losgelöst von<strong>der</strong> übrigen Unternehmenstätigkeit dargestellt. Sie kann jedoch unter Berücksichtigung <strong>des</strong> Unternehmenskontextesin einen größeren Rahmen eingeordnet werden, welcher einen Ansatzpunkt zurErweiterung <strong>der</strong> analysierten Fähigkeit bietet.Aus marketingorientierter Sicht lässt sich die Kundenakquisition dem Bereich <strong>des</strong> CustomerRelationship Managements (CRM) zuordnen. Das CRM umfasst sämtliche Maßnahmen, die <strong>der</strong>Gewinnung und Bindung von Kunden an das jeweilige Unternehmen dienen. Somit bildet die Akquisitionvon Kunden lediglich einen Ausschnitt <strong>des</strong> CRM ab. Zu einem umfassenden CRM gehörendaneben auch Aspekte wie das Kundenbindungsmanagement, die Rückgewinnung abgewan<strong>der</strong>terKunden und das Beschwerdemanagement. Die Fähigkeit zur gemeinsamen Kundenberatung imRahmen <strong>der</strong> Akquisition von Neukunden birgt somit in ihrer Eigenschaft als Wissensressourcegrundsätzlich die Möglichkeit ihrer Weiterentwicklung in Richtung eines gemeinsamen CRM. Dadas CRM für die Entwicklung eines Unternehmens eine hohe Bedeutung hat, wäre es im Fall <strong>der</strong>hier betrachteten Eisenbahnverkehrsunternehmen sogar empfehlenswert, diese Möglichkeit tatsächlichzu nutzen und die Kundenberatung im Rahmen <strong>der</strong> Akquisition von Neukunden sukzessive zueinem gemeinsamen Customer Relationship Management <strong>aus</strong>zubauen. Die für <strong>Kernkompetenzen</strong>typische Eigenschaft <strong>der</strong> möglichen Weiterentwicklung kann also im vorliegenden Fall festgestelltwerden.5.3.2.8 Möglichkeit zur Aneignung <strong>der</strong> GewinneDamit ein erzielter Wettbewerbsvorteil den ihn begründenden Unternehmen auch tatsächlich zugutekommt, ist es nötig, dass die Unternehmen die Verfügungsrechte an den dem Wettbewerbsvorteilzugrunde liegenden Ressourcen besitzen 138 . Im vorliegenden Fall müssten also die Kooperationspartnerüber die <strong>der</strong> gemeinsamen Kundenberatung zugrunde liegenden Wissensressourcen verfügen,um sich die dar<strong>aus</strong> resultierenden Gewinne aneignen zu können. Da Wissen immer personengebundenist, kann an dieser Ressource kein unmittelbarer Besitz begründet werden. Vielmehr ist eserfor<strong>der</strong>lich, den Wissensträger an das Unternehmen – o<strong>der</strong> in diesem Fall: die Kooperation – zubinden. Da eine solche Bindung lediglich auf freiwilliger Basis erfolgen kann, empfiehlt sich in ersterLinie <strong>der</strong> Einsatz von Motivationsinstrumenten 139 , um dem Wissensträger einen Anreiz zu bieten,im Unternehmens- bzw. Kooperationsverbund zu verbleiben und diesem sein Wissen zur Verfügungzu stellen. Grundsätzlich kann somit die Frage <strong>der</strong> Aneignungsfähigkeit <strong>der</strong> <strong>aus</strong> einemWettbewerbsvorteil resultierenden Gewinne durch die Kooperationspartner bejaht werden. Letztlichhängt es aber von ihrem Geschick in Bezug auf die Motivierung <strong>der</strong> einzelnen Wissensträger ab, obes ihnen gelingt, sich die finanziellen Vorteile ihrer Wettbewerbsposition zu eigen zu machen.5.4 ErgebnisIn den vorangehenden Abschnitten wurde sukzessive geprüft, ob die Fähigkeit zur Wissensbündelungim Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung bei Eisenbahnverkehrsunternehmen die Kriterien einer Kernkompetenzim Sinne <strong>des</strong> <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> erfüllt. Die Prüfung ergab, dass die Fähigkeit zurWissensbündelung zum größten Teil den an sie gestellten For<strong>der</strong>ungen entspricht. Somit kann man138 Vgl. Abschnitt 3.3.139 Vgl. HERTRAMPF (2009b).
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 25feststellen, dass die Fähigkeit zur Wissensbündelung im Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung <strong>der</strong> hier betrachtetenEisenbahnverkehrsunternehmen tendenziell eine gemeinsame Kernkompetenz <strong>der</strong> Kooperationspartnerdarstellt.6 Fazit und AusblickDie in diesem Beitrag behandelte Bündelung von Kompetenzen zu <strong>Kernkompetenzen</strong> wurde vordem Hintergrund eines stetig voranschreitenden Wandels <strong>des</strong> Unternehmensumfel<strong>des</strong> und einerdamit einhergehenden Intensivierung <strong>des</strong> Wettbewerbsdrucks auf die Unternehmen beleuchtet. DieKooperation von Unternehmen zwecks Bündelung von Kompetenzen wurde als eine Notwendigkeitgesehen, um in einem ständig sich verän<strong>der</strong>nden Unternehmensumfeld die eigene Wettbewerbspositiondauerhaft zu sichern und damit das langfristige Überleben <strong>des</strong> Unternehmens sicherzustellen.Wenn man bedenkt, dass <strong>der</strong> beschriebene Wandel keinen deterministischen Prozess darstellt, son<strong>der</strong>nsein Ende nicht abzusehen ist, so resultiert dar<strong>aus</strong> zwangsläufig das Erfor<strong>der</strong>nis weiterer kompetenzorientierterPartnerschaften zwischen Unternehmen zwecks Sicherung <strong>der</strong> Wettbewerbsfähigkeit.Da von dem dargestellten Umfeldwandel nicht nur bestimmte Branchen betroffen sind,kann davon <strong>aus</strong>gegangen werden, dass in Zukunft die Anzahl <strong>der</strong> Kooperationen zwischen Unternehmenauch im Bereich <strong>des</strong> schienengebundenen Güterverkehrs tendenziell zunehmen wird.Die Zusammenarbeit im Rahmen eines virtuellen Unternehmens stellt vor diesem Hintergrund eineadäquate Form <strong>der</strong> Kooperation dar, weil das virtuelle Unternehmen aufgrund seiner spezifischenKonzeption die strategischen Erfolgsfaktoren Kosten, Qualität und Zeit positiv beeinflusst und somitden Kooperationspartnern die Möglichkeit bietet, ihre Wettbewerbsposition nachhaltig zu verbessern.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 26Anhang: Fragebogen zum MAEKAS-Workshop am 30. Juli 2008
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 27<strong>Kernkompetenzen</strong>vonEisenbahnverkehrsunternehmenDipl.-Kff. Sabine Hertrampf
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 28Fallstudie: KundenberatungFür die effektive Beratung Ihrer Kunden - beispielsweise im Rahmen <strong>der</strong> Akquisitioneines Neukunden - benötigen Sie verschiedene Wissensressourcen.Dazu gehören etwaFachwissenKundenwissenMarktwissenMarketingwissen(Wissen über die eigene Produktpalette)(Unternehmenssituation, Produktpalette)(Konkurrenten, Institutionen)(Werbung, Verkaufsför<strong>der</strong>ung)Vermutlich sind die einzelnen Kenntnisse bei Ihnen und Ihren Kooperationspartnernunterschiedlich stark <strong>aus</strong>geprägt. So verfügen Sie möglicherweiseüber hervorragende Kenntnisse <strong>des</strong> regionalen Marktes, währendeiner Ihrer Partner solide Marketingkenntnisse aufweist. In diesem Fall bietetes sich an, die komplementären Wissensressourcen zu bündeln und gemeinsamzu nutzen.Die Fähigkeit zur gemeinsamen Nutzung <strong>der</strong> Ressourcenbasis erhöht nichtnur Ihre Chance, in einem einzelnen Fall einen neuen Kunden zu gewinnen,son<strong>der</strong>n stellt vielleicht sogar eine Kernkompetenz dar, welche Ihnen und IhrenKooperationspartnern zur Erlangung nachhaltiger Wettbewerbsvorteileverhilft.Bitte überprüfen Sie anhand <strong>der</strong> folgenden Fragen, ob dieFähigkeit zur gemeinsamen Nutzung <strong>der</strong> Wissensressourcenim Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatungeine Kernkompetenz im Sinne <strong>des</strong> ressourcenorientierten Ansatzes darstellt.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 29Frage 1: Schaffung eines einzigartigen KundenwertesKönnen Sie und Ihre Kooperationspartner durch die gemeinsame Nutzung IhrerWissensressourcen für Ihre Kunden einen beson<strong>der</strong>en Wert schaffen?Frage 2: SeltenheitswertStellt die gemeinsame Nutzung von Wissensressourcen zwecks Kundenberatungin Ihrer Branche eine Seltenheit dar?Frage 3: Komplexität als Schutz vor EntschlüsselungNehmen Sie bitte an, dass die gemeinsame Nutzung Ihrer Wissensressourcenim Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung Ihren Unternehmenserfolg erhöht. Wärees für Ihre Konkurrenten als externe Beobachter schwierig, die Ursache IhrerErfolgssteigerung zu ergründen?Frage 4: Komplexität als Schutz vor käuflichem ErwerbNehmen Sie bitte an, dass Sie und Ihre Kooperationspartner sich dazu entschließen,Ihre Wissensressourcen gemeinsam zu nutzen. Würden Sie dann<strong>der</strong> folgenden Aussage zustimmen?Falls Konkurrenten auf einzelne Wissensträger unserer Kooperation zugreifenkönnten – beispielsweise durch das Abwerben eines <strong>der</strong> Kooperationspartner– so wäre es ihnen nicht möglich, mit Hilfe <strong>des</strong> einen Wissensträgersdenselben Kundenwert zu schaffen, den die Kooperationspartner durch ihregemeinschaftliche Arbeit erlangen können.Frage 5: Zeitvorteile und Multiplikatoreffekte als Schutz vor ImitationsundSubstitutionsversuchenÜberlegen Sie bitte, welche Rahmenbedingungen erfor<strong>der</strong>lich sind, damit Sieund Ihre Kooperationspartner Ihre Wissensressourcen gemeinsam nutzenkönnen.Wäre es für Ihre Konkurrenten schwierig, kurzfristiga) die gleichen Vor<strong>aus</strong>setzungen zu schaffen (Imitation)?b) ähnliche o<strong>der</strong> alternative Vor<strong>aus</strong>setzungen zu schaffen, mit denen sie dengleichen Kundenwert erzielen könnten (Substitution)?Frage 6: TransfermöglichkeitLässt sich die Fähigkeit, in <strong>der</strong> Kundenberatung zusammenzuarbeiten, aufverschiedenen Aktivitätsfel<strong>der</strong>n nutzen?
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 30Frage 7: EntwicklungsmöglichkeitenLässt sich die Fähigkeit, im Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung zusammenzuarbeiten,weiterentwickeln, z. B. zu einem gemeinsamen Customer RelationshipManagement?Frage 8: Möglichkeiten <strong>der</strong> GewinnaneignungFalls es Ihnen gelänge, durch die gemeinsame Kundenberatung Wettbewerbsvorteilezu erlangen, könnten Sie sich dann die <strong>aus</strong> diesen Wettbewerbsvorteilenresultierenden Gewinne aneignen?Frage 9: Charakteristika <strong>der</strong> KernkompetenzNachdem Sie nun die Fähigkeit zur gemeinsamen Nutzung <strong>der</strong> Wissensressourcenim Rahmen <strong>der</strong> Kundenberatung untersucht haben: Sind Sie <strong>der</strong>Meinung, dass es sich bei dieser Fähigkeit um eine Kernkompetenz handelt?
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 31LiteraturverzeichnisVorbemerkungen:Alle Quellen werden im Literaturverzeichnis wie folgt aufgeführt: In <strong>der</strong> ersten Zeile wird <strong>der</strong>Referenztitel <strong>der</strong> Quelle angegeben. Er entspricht <strong>der</strong> Form, die im Text Verwendung findet,wenn auf die Quelle hingewiesen wird.Bei <strong>der</strong> Vergabe <strong>der</strong> Referenztitel wird bei einem Autor <strong>des</strong>sen Nachname, gefolgt von dem Erscheinungsjahr<strong>der</strong> Quelle in Klammern, verwendet. Existieren zwei o<strong>der</strong> drei Autoren, werdendiese getrennt von einem Schrägstrich („/“) aufgeführt. Bei min<strong>des</strong>tens vier Autoren werden nurdie ersten drei Autoren mit dem Zusatz „et al.“ aufgeführt.Zu Internetquellen wird die dafür verantwortliche Instanz aufgeführt. Dies können sowohl natürlicheals auch juristische Personen sein. Zu den Internetquellen werden die zum Zugriffsdatumgültige Internetadresse (URL) und das Zugriffsdatum angegeben.AL-LAHAM (2004)Al-Laham, A.: Wettbewerbsvorteile <strong>aus</strong> Wissen? Was leistet <strong>der</strong> wissensbasierte Ansatz für diestrategische Unternehmensführung? In: Die Unternehmung, 58. Jg. (2004), Nr. 6, S. 405-432.AL-LAHAM (2003)Al-Laham, A.: Organisationales Wissensmanagement. Eine strategische <strong>Perspektive</strong>. Vahlen: München2003.BAMBERGER/WRONA (1996)Bamberger, I.; Wrona, T.: Der Ressourcenansatz und seine Bedeutung für die Strategische Unternehmensführung.In: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 48. Jg. (1996), Nr. 2, S. 130-153.BERNDT (2001)Berndt, T.: Eisenbahngüterverkehr. Teubner: Stuttgart – Leipzig – Wiesbaden 2001.BLACK/BOAL (1994)Black, J. A.; Boal, K. B.: Strategic <strong>Resource</strong>s: Traits, Configurations and Paths to SustainableCompetitive Advantage. In: Strategic Management Journal, Vol. 15 (1994), Special Issue: Strategy:Search for New Paradigms, S. 131-148.BÜRKI (1996)Bürki, D. M.: Der “resource-<strong>based</strong> view”-Ansatz als neues Denkmodell <strong>des</strong> strategischen Managements.Dissertation, Universität St. Gallen, Bamberg 1996.BUTTERMANN (2003)Buttermann, V.: Strategische Allianzen im europäischen Eisenbahngüterverkehr. Dissertation,Technische Universität Dresden 2003.COHEN/LEVINTHAL (1990)Cohen, W. M.; Levinthal, D. A.: Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation.In: Administrative Science Quarterly, Vol. 35 (1990), No. 1, S. 128-152.FREILING (2001)Freiling, J.: Ressourcenorientierte Reorganisationen: Problemanalyse und Change Management auf<strong>der</strong> Basis <strong>des</strong> <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong>. Deutscher Universitäts-Verlag: Wiesbaden 2001.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 32GÜNES (2009)Günes, N: Analyse <strong>der</strong> Ausgangssituation bei den Praxispartnern: Leistungsangebot – Kompetenzen– Geschäftsprozesse. MAEKAS-Projektbericht Nr. 4, Institut für Produktion und Industrielles Informationsmanagement,Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, Essen 2009.HAAS (2006)Haas, A.: Interessentenmanagement. In: Hippner, J.; Wilde, K. D. (Hrsg.): Grundlagen <strong>des</strong> CRM.Konzepte und Gestaltung. 2. Aufl., Gabler: Wiesbaden 2006, S. 443-471.HERTRAMPF (2009a)Hertrampf, S.: Das Konzept virtueller Unternehmen – konkretisiert für projektbezogene strategischeAllianzen zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen. MAEKAS-Projektbericht Nr. 6, Institut fürProduktion und Industrielles Informationsmanagement, Universität Duisburg-Essen, Campus Essen,Essen 2009.HERTRAMPF (2009b)Hertrampf, S.: Motivationskonzepte für Wissensteilung und gemeinsame Wissensanwendung in virtuellenUnternehmen <strong>der</strong> zweiten Generation – unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung <strong>des</strong> Wissensmanagementsvon Eisenbahnverkehrsunternehmen. MAEKAS-Projektbericht Nr. 7, Institut für Produktionund Industrielles Informationsmanagement, Universität Duisburg-Essen, Campus Essen,Essen 2009.HILLIG (1997)Hillig, A.: Die Kooperation als Lernarena in Prozessen fundamentalen Wandels. Ein Ansatz zumManagement von Kooperationskompetenz. Haupt: Bern – Stuttgart – Wien 1997.JURK (2003)Jurk, A. I.: Organisation virtueller Unternehmen. Eine systemtheoretische <strong>Perspektive</strong>. DeutscherUniversitäts-Verlag: Wiesbaden 2003.JUSTUS (1999)Justus, A.: Wissenstransfer in Strategischen Allianzen: Eine verhaltenstheoretische Analyse. Lang:Frankfurt am Main et al. 1999.KIRCHNER/ZEHNHÄUSERN (2009)Kirchner, C.; Zehnhäusern, P.: Eine bessere Regulierung als Vor<strong>aus</strong>setzung für die Verlagerung <strong>des</strong>Güterverkehrs von <strong>der</strong> Straße auf die Schiene. In: Die Volkswirtschaft, 82. Jg. (2009), Nr. 82, S. 8-11.KOTLER/KELLER/BLIEMEL (2007)Kotler, P.; Keller, K. L.; Bliemel, F.: Marketing-Management. Strategien für wertschaffen<strong>des</strong> Handeln.12. Aufl., Pearson: München – Boston – San Francisco et al. 2007.KRÜGER/HOMP (1997)Krüger, W.; Homp, C.: Kernkompetenz-Management. Steigerung von Flexibilität und Schlagkraftim Wettbewerb. Gabler: Wiesbaden 1997.LAM (1997)Lam, A.: Embedded Firms, Embedded Knowledge: Problems of Collaboration and KnowledgeTransfer in Global Cooperative Ventures. In: Organizational Studies, Vol. 18 (1997), No. 6, S. 973-996.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 33LANGE (2001)Lange, K. W.: Virtuelle Unternehmen: neue Unternehmenskoordination in Recht und Praxis. VerlagRecht und Wirtschaft: Heidelberg 2001.LORENZONI/LIPPARINI (1999)Lorenzoni, G.; Lipparini, A.: The Leveraging of Interfirm Relationships as a DistinctiveOrganizational Capability: A Longitudinal Study. In: Strategic Management Journal, Vol. 20(1999), No. 4, S. 317-338.MALIK (1992)Malik, F.: Strategie <strong>des</strong> Managements komplexer Systeme: Ein Beitrag zur Management-Kybernetikevolutionärer Systeme. 4. Aufl., Haupt: Bern – Stuttgart – Wien 1992.MASAK (2007)Masak, D.: SOA? Serviceorientierung in Business und Software. Springer: Berlin – Heidelberg2007.MEFFERT (1999)Meffert, H.: Marktorientierte Unternehmensführung im Umbruch. In: Meffert, H. (Hrsg.): MarktorientierteUnternehmensführung im Wandel. Retrospektiven und <strong>Perspektive</strong>n <strong>des</strong> Marketing.Gabler: Wiesbaden 1999, S. 3-33.MELLEWIGT (2003)Mellewigt, T.: Management und Erfolg von Strategischen Kooperationen in <strong>der</strong> Telekommunikationsbranche.Eine empirische Untersuchung auf <strong>der</strong> Basis <strong>des</strong> ressourcenorientierten Ansatzes. Gabler:Wiesbaden 2003.METZENTHIN (2002)Metzenthin, R.: Kompetenzorientierte Unternehmungsakquisitionen. Eine Analyse <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Sicht <strong>des</strong>Kompetenzlückenansatzes. Gabler: Wiesbaden 2002.MÜLLER-STEWENS (1997)Müller-Stewens, G.: Grundzüge einer Virtualisierung. In: Müller-Stewens, G. (Hrsg.):Virtualisierung von Organisationen. Schäffer-Poeschel: Stuttgart 1997, S. 23-41.MÜLLER-STEWENS/OSTERLOH (1996)Müller-Stewens, G.; Osterloh, M.: Kooperationsinvestitionen besser nutzen: InterorganisationalesLernen als Know-how-Transfer o<strong>der</strong> Kontext-Transfer? In: Zeitschrift Führung + Organisation, 65.Jg. (1996), Nr. 1, S. 18-24.NOLTE/BERGMANN (1998)Nolte, H.; Bergmann, R.: Ein Grundmodell <strong>des</strong> ressourcenorientierten Ansatzes <strong>der</strong> Unternehmensführung.In: Nolte, H. (Hrsg.): Aspekte ressourcenorientierter Unternehmensführung. Hampp: München– Mering 1998, S. 1-27.OELSNITZ (2003a)Oelsnitz, D. von <strong>der</strong>: Kooperation: Entwicklung und Verknüpfung von <strong>Kernkompetenzen</strong>. In:Zentes, J.; Swoboda, B.; Morschett, D. (Hrsg.): Kooperationen, Allianzen und Netzwerke: Grundlagen– Ansätze – <strong>Perspektive</strong>n. Gabler: Wiesbaden 2003, S. 184-210.OELSNITZ (2003b)Oelsnitz, D. von <strong>der</strong>: Strategische Allianzen als Lernarena. In: Das Wirtschaftsstudium, 32. Jg.(2003), Nr. 9, S. 516-520.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 34PADBERG (2000)Padberg, A.: Strategische Unternehmensnetzwerke versus Cross-bor<strong>der</strong>-Unternehmensakquisitionen:Analyse alternativer Markteintrittsformen. Gabler: Wiesbaden 2000.PETERS (2008)Peters, M. L.: Vertrauen in Wertschöpfungspartnerschaften zum Transfer von retentivem Wissen:eine Analyse auf Basis realwissenschaftlicher Theorien und Operationalisierung mithilfe <strong>des</strong> FuzzyAnalytic Network Process und <strong>der</strong> Data Envelopment Analysis. Gabler: Wiesbaden 2008.PORTER (1999)Porter, M. E.: Wettbewerbsvorteile: Spitzenleistungen erreichen und behaupten. 5. Aufl., Campus:Frankfurt/Main – New York 1999.PRAHALAD/HAMEL (1990)Prahalad, C. K.; Hamel, G.: The Core Competence of the Corporation. In: Harvard Business Review,Vol. 68 (1990), No. 3, S. 79-91.RASCHE (1994)Rasche, C.: Wettbewerbsvorteile durch <strong>Kernkompetenzen</strong>. Ein ressourcenorientierter Ansatz. Gabler:Wiesbaden 1994.REED/DEFILLIPPI (1990)Reed, R.; DeFillippi, R. J.: C<strong>aus</strong>al Ambiguity, Barriers to Imitation, and Sustainable CompetitiveAdvantage. In: Academy of Management Review, Vol. 15 (1990), No. 1, S. 88-102.REIß/BECK (1995)Reiß, M.; Beck, T. C.: <strong>Kernkompetenzen</strong> in virtuellen Netzwerken: Der ideale Strategie-Struktur-Fit für wettbewerbsfähige Wertschöpfungssysteme? In: Corsten, H.; Will, T. (Hrsg.): Unternehmungsführungim Wandel. Strategien zur Sicherung <strong>des</strong> Erfolgspotentials. Kohlhammer: Stuttgart1995, S. 33-60.RINGLE (2004)Ringle, C. M.: Kooperation in Virtuellen Unternehmungen. Auswirkungen auf die strategischen Erfolgsfaktoren<strong>der</strong> Partnerunternehmen. Deutscher Universitäts-Verlag: Wiesbaden 2004.SIMANEK (1998)Simanek, A.: Markt- und kompetenzorientierte Geschäftsfeldplanung: Wettbewerbs- und Integrationsstrategienin divisional organisierten Unternehmen. Gabler: Wiesbaden 1998.STATISTISCHES BUNDESAMT (2009)Statistisches Bun<strong>des</strong>amt: Güterbeför<strong>der</strong>ung. URL: http://www.<strong>des</strong>tatis.de/. Download am 9. März2009.TRÄGER (2006)Träger, S.: Der Beitrag <strong>des</strong> strategischen Kompetenzmanagements zur Erklärung von Wettbewerbsvorteilen.In: Burmann, C.; Freiling, J.; Hülsmann, M. (Hrsg.): Neue <strong>Perspektive</strong>n <strong>des</strong> StrategischenKompetenz-Managements. Gabler: Wiesbaden 2006, S. 36-66.WELGE/AL-LAHAM (2003)Welge, M. K.; Al-Laham, A.: Strategisches Management: Grundlagen – Prozess – Implementierung.4. Aufl., Gabler: Wiesbaden 2003.
Hertrampf: <strong>Kernkompetenzen</strong> Seite 35ZELEWSKI (2008)Zelewski, S.: Überblick über das Verbundprojekt MAEKAS – Management von projektbezogenenAllianzen zwischen lokalen und überregionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen für kundenspezifischeAkquisitionsstrategien. MAEKAS-Projektbericht Nr. 1, Institut für Produktion und IndustriellesInformationsmanagement, Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, Essen 2008.
Projektberichte <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKASAutorin:Dipl.-Kff. Sabine HertrampfTel: +49 (0)201/183-4080Fax: +49 (0)201/183-4017E-Mail: sabine.hertrampf@pim.uni-due.deInternet: www.pim.wiwi.uni-due.deImpressum:Institut für Produktion undIndustrielles InformationsmanagementUniversität Duisburg-Essen, Campus EssenFakultät für WirtschaftswissenschaftenUniversitätsstraße 9, 45141 EssenWebsite (Institut PIM): www.pim.wiwi.uni-due.deWebsite (MAEKAS):www.maekas.wiwi.uni-due.deISSN: 1866-9255Das Drittmittelprojekt MAEKAS (“Management von projektbezogenen Allianzen zwischen lokalen und überregionalenEisenbahnverkehrsunternehmen für kundenspezifische Akquisitionsstrategien”) wird mit Mitteln<strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>ministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) innerhalb <strong>des</strong> Rahmenkonzepts “IntelligenteLogistik im Güter- und Wirtschaftsverkehr” geför<strong>der</strong>t und vom Projektträger Mobilität und Verkehr, Bauenund Wohnen (PTMVBW), <strong>der</strong> TÜV Rheinland Consulting GmbH, betreut. Die Projektpartner danken für diegroßzügige Unterstützung ihrer Forschungs- und Transferarbeiten.Partner <strong>aus</strong> <strong>der</strong> Praxis:SBB Cargo GmbHMülheimer VerkehrsGesellschaft mbHNeuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KGWanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH
Projektberichte <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKASUniversität Duisburg-Essen – Campus EssenInstitut für Produktion und Industrielles InformationsmanagementProjektberichte <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKASISSN 1866-9255Nr. 1Nr. 2Zelewski, S.: Überblick über das Verbundprojekt MAEKAS – Management von projektbezogenenAllianzen zwischen lokalen und überregionalen Eisenbahnverkehrsunternehmenfür kundenspezifische Akquisitionsstrategien. Essen 2008.Zelewski, S.; Saur, A.; Klumpp, M.: Co-operative Rail Cargo Transport Effects. Essen2008.Nr. 3 Zelewski, S.; Koppers, L.; Klumpp, M.: Supply Chain Cooperation. Essen 2009.Nr. 4 Günes, N.: Analyse <strong>der</strong> Ausgangssituation bei den Praxispartnern. Leistungsangebot –Kompetenzen – Geschäftsprozesse. Essen 2009.Nr. 5Nr. 6Nr. 7Nr. 8Nr. 9Hertrampf, S.: <strong>Kernkompetenzen</strong> <strong>aus</strong> <strong>der</strong> <strong>Perspektive</strong> <strong>des</strong> <strong>Resource</strong>-<strong>based</strong> <strong>View</strong> – mit Fokusauf <strong>Kernkompetenzen</strong> von Eisenbahnverkehrsunternehmen. Essen 2009.Hertrampf, S.: Das Konzept virtueller Unternehmen – konkretisiert für projektbezogenestrategische Allianzen zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Essen 2009.Hertrampf, S.: Motivationskonzepte für Wissensteilung und gemeinsame Wissensanwendungin virtuellen Unternehmen <strong>der</strong> zweiten Generation – unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung<strong>des</strong> Wissensmanagements von Eisenbahnverkehrsunternehmen. Essen 2009.Zelewski, S.; Saur, A.: Vermeidung von Leerfahrten für Eisenbahnverkehrsunternehmendurch intelligente Nachfragebündelung – eine Beurteilung <strong>der</strong> ökonomischen und ökologischenEffizienz. Essen 2009.Hertrampf, S.: Etablierung einer Kooperationsstruktur für ein virtuelles Unternehmen <strong>der</strong>zweiten Generation – ein Ansatz auf <strong>der</strong> Basis von Rollenmodellierung und Konfliktmanagement.Essen 2009.Nr. 10 Hertrampf, S.: Wissensmanagement in strategischen Allianzen lokaler und überregionalerEisenbahnverkehrsunternehmen – Wissensbarrieren und Managementinstrumente zu ihrerÜberwindung. Essen 2009.Nr. 11 Hertrampf, S.: Offenlegung, Verbreitung und Anwendung kooperationsrelevanten Wissensin Unternehmensnetzwerken – Entwicklung und Erprobung eines Unterstützungskonzeptsfür die betriebliche Praxis. Essen 2009.Nr. 12 Günes, N.: Schienengüterverkehrsmarkt 2009 im Ruhrgebiet: Marktanalyse – Logistikpotenzial– Branchenanalyse – Kunden. Essen 2009.Nr. 13 Günes, N.: Das 4-Phasenmodell <strong>der</strong> Gleisanschlussreaktivierung. Essen 2009.Nr. 14 Günes, N.: Güterverkehrsleistungen im Verbundprojekt MAEKAS: Basisleistungen – Zusatzleistungen– Gewerbeflächenvermittlung. Essen 2009.
Projektberichte <strong>des</strong> Verbundprojekts MAEKASNr. 15 Thorant, C.: Rechtliche Analyse von virtuellen Unternehmen <strong>der</strong> ersten und zweiten Generation.Essen 2009.