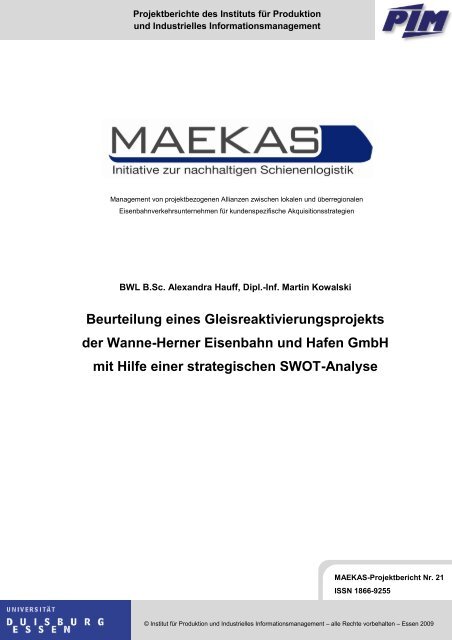Beurteilung eines Gleisreaktivierungsprojekts der Wanne-Herner
Beurteilung eines Gleisreaktivierungsprojekts der Wanne-Herner
Beurteilung eines Gleisreaktivierungsprojekts der Wanne-Herner
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Projektberichte des Instituts für Produktion<br />
und Industrielles Informationsmanagement<br />
Management von projektbezogenen Allianzen zwischen lokalen und überregionalen<br />
Eisenbahnverkehrsunternehmen für kundenspezifische Akquisitionsstrategien<br />
BWL B.Sc. Alexandra Hauff, Dipl.-Inf. Martin Kowalski<br />
<strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH<br />
mit Hilfe einer strategischen SWOT-Analyse<br />
MAEKAS-Projektbericht Nr. 21<br />
ISSN 1866-9255<br />
© Institut für Produktion und Industrielles Informationsmanagement – alle Rechte vorbehalten – Essen 2009
Abstract zum Projektbericht Seite I<br />
Abstract<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit wird eine Freiladegleisreaktivierung <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und<br />
Hafen GmbH mit Hilfe einer strategischen SWOT-Analyse beurteilt und dahingehend untersucht,<br />
ob eine solche Reaktivierung Erfolgspotenziale für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen bietet. Zunächst<br />
wird die Freiladegleisreaktivierung ausführlich beschrieben und das Transportkonzept <strong>der</strong><br />
Karo As Umweltschutz GmbH vorgestellt, welches den Umschlag von Altöl und Altölemulsionen<br />
mit Hilfe <strong>eines</strong> FÜLLCOMATEN vorsieht. Anschließend folgt die strategische SWOT-Analyse, aus<br />
<strong>der</strong> letztlich ein Stärken-Schwächen- und ein Chancen-Risiken-Profil für die WHE und eine<br />
SWOT-Matrix zum Ableiten von Strategien resultieren. Es wird gezeigt, dass eine Freiladegleisreaktivierung<br />
dann Erfolgspotenziale bietet, wenn <strong>der</strong> Umschlag von Gütern an einem solchen Gleis<br />
optimal in das Logistikkonzept <strong>eines</strong> Neukunden o<strong>der</strong> Abnehmers passt o<strong>der</strong> ein Eisenbahnverkehrsunternehmen<br />
mit Hilfe <strong>eines</strong> Freiladegleises eigene Auftragsspitzen besser bewältigen kann.<br />
Zudem wird durch die Verlagerung des Altöltransports <strong>der</strong> Karo As Umweltschutz GmbH von <strong>der</strong><br />
Straße auf die Schiene eine Reduzierung <strong>der</strong> Umweltbelastungen und <strong>der</strong> regelmäßigen Verkehre<br />
erreicht, da ein Kesselwagen zwei Tanklaster zu ersetzen vermag.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite II<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Abstract ................................................................................................................................. I<br />
Abkürzungs- und Akronymverzeichnis .......................................................................... IV<br />
Symbolverzeichnis.......................................................................................................... VIII<br />
Abbildungsverzeichnis ...................................................................................................... IX<br />
Tabellenverzeichnis............................................................................................................. X<br />
1 Einführung in die wissenschaftliche Problemstellung .............................................1<br />
1.1 Praktischer Kontext ........................................................................................................ 1<br />
1.2 Wissenschaftliche Problemstellung und intendierte Ergebnisse .................................... 3<br />
2 Dokumentation <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung .......................................................5<br />
2.1 Zustandekommen <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung .......................................................... 5<br />
2.2 Vertragliche Vereinbarungen und Zuständigkeiten ....................................................... 9<br />
2.3 Verlauf technischer und baulicher Maßnahmen und <strong>der</strong>en Kosten ............................. 11<br />
2.4 Geeignete Güter für den Umschlag an Freiladegleisen ................................................ 18<br />
3 SWOT-Analyse zur <strong>Beurteilung</strong> des <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> ......................20<br />
3.1 Inhalt <strong>der</strong> SWOT-Analyse ............................................................................................ 20<br />
3.2 Umweltanalyse als Teilanalyse <strong>der</strong> SWOT-Analyse ................................................... 21<br />
3.2.1 Globale Umwelt – Rahmenbedingungen für die <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong><br />
Eisenbahn und Hafen GmbH ......................................................................... 21<br />
3.2.2 Aufgabenspezifische Umwelt ........................................................................ 28<br />
3.2.2.1 Branchenstruktur: Identifikation <strong>der</strong> Wettbewerbskräfte ............................... 28<br />
Seite<br />
3.2.2.2 <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> Konkurrenz <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und<br />
Hafen GmbH .................................................................................................. 33<br />
3.3 Unternehmensanalyse als Teilanalyse <strong>der</strong> SWOT-Analyse ......................................... 37<br />
3.3.1 Unternehmensbeson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und<br />
Hafen GmbH .................................................................................................. 37<br />
3.3.2 Ressourcen- und kompetenzorientierte Betrachtung <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong><br />
Eisenbahn und Hafen GmbH ......................................................................... 37<br />
3.3.3 Ableiten von Erfolgspotenzialen .................................................................... 39<br />
3.4 Ergebnisse <strong>der</strong> SWOT-Analyse .................................................................................... 40<br />
3.4.1 <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung .................................................... 40
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite III<br />
3.4.2 Stärken-Schwächen-Profil <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen<br />
GmbH ............................................................................................................. 42<br />
3.4.3 Chancen-Risiken-Profil <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH .... 43<br />
3.4.4 SWOT-Matrix ................................................................................................ 44<br />
4 Fazit ............................................................................................................................47<br />
5 Literaturverzeichnis ..................................................................................................48
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite IV<br />
Abkürzungs- und Akronymverzeichnis<br />
A Autobahn<br />
Abs. Absatz<br />
AEG Allgem<strong>eines</strong> Eisenbahngesetz<br />
AG Aktiengesellschaft<br />
a.M. am Main<br />
Aufl. Auflage<br />
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
BIP Bruttoinlandsprodukt<br />
BMF Bundesministerium für Finanzen<br />
BMJ Bundesministerium <strong>der</strong> Justiz<br />
BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie<br />
bspw. beispielsweise<br />
B.V. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (nie<strong>der</strong>ländische<br />
Kapitalgesellschaft ähnlich <strong>der</strong> deutschen GmbH)<br />
bzgl. bezüglich<br />
ca. circa<br />
DB Deutsche Bahn<br />
DESTATIS Statistisches Bundesamt<br />
d.h. das heißt<br />
EBA Eisenbahn-Bundesamt<br />
EBHaftPflV Eisenbahnhaftpflichtversicherungsverordnung<br />
EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite V<br />
EBV Eisenbahnbetriebsleiterverordnung<br />
EBZugV Eisenbahnunternehmer-Berufszugangsverordnung<br />
EG Europäische Gemeinschaft<br />
EIBV Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung<br />
EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen<br />
ESiV Eisenbahn-Sicherheitsverordnung<br />
ESO Eisenbahn-Signalordnung<br />
EU Europäische Union<br />
EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen<br />
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft<br />
f. folgende<br />
ff. fortfolgende<br />
GefStoffV Gefahrenstoffverordnung<br />
gem. gemäß<br />
ggü. gegenüber<br />
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />
GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Komman-<br />
ditgesellschaft<br />
GPS Global Positioning System<br />
GVZ Güterverkehrszentrum<br />
Hbf Hauptbahnhof<br />
HGB Handelsgesetzbuch<br />
Hrsg. Herausgeber<br />
ICE Intercity Express<br />
ICF Intercontainer-Interfrigo S.A.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite VI<br />
insb. insbeson<strong>der</strong>e<br />
insg. insgesamt<br />
ITU Innovative Tank- und Umweltschutzsysteme GmbH<br />
Karo As Karo As Umweltschutz GmbH<br />
kg Kilogramm<br />
KV Kombinierter Verkehr<br />
Lkw Lastkraftwagen<br />
m Meter<br />
m² Quadratmeter<br />
mbH mit beschränkter Haftung<br />
Mrd. Milliarden<br />
No. number (Nummer)<br />
NRW Nordrhein-Westfalen<br />
OECD Organization for Economic Co-operation and Development<br />
o.S. ohne Seitenangabe<br />
S. Seite<br />
S.A. Société Anonyme (schweizerische Aktiengesellschaft)<br />
s.o. siehe oben<br />
sog. so genannte(r/s)<br />
Std. Stunde<br />
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats<br />
TEIV Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung<br />
TRG Transportrechtsreformgesetz<br />
u.a. unter an<strong>der</strong>em
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite VII<br />
UIC Union Internationale des Chemins de fer (Internationaler Eisenbahnverband<br />
mit Sitz in Paris)<br />
usw. und so weiter<br />
VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen<br />
Vol. Volume<br />
vgl. vergleiche<br />
WHE <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH<br />
z.B. zum Beispiel<br />
zw. zwischen
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite VIII<br />
Symbolverzeichnis<br />
Logisch-mathematische Symbole<br />
* Multiplikationsoperator<br />
/ Divisionsoperator<br />
= ist gleich<br />
Deskriptive Symbole<br />
€ Euro<br />
§ Paragraph<br />
% Prozent<br />
& und<br />
X Geldsumme
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite IX<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Frontansicht des FÜLLCOMATEN ....................................................................... 1<br />
Abbildung 2: Rückansicht des FÜLLCOMATEN und des dazugehörigen SATELLITEN ............. 2<br />
Abbildung 3: Mineralölraffinerie Dollbergen GmbH .............................................................. 6<br />
Abbildung 4: Tanklaster <strong>der</strong> Karo As Umweltschutz GmbH .................................................. 6<br />
Abbildung 5: Grobe Darstellung des alten und neuen Transportkonzepts <strong>der</strong> Karo As ......... 8<br />
Abbildung 6: Die Freiladegleisfläche .................................................................................... 10<br />
Abbildung 7: Die alte Freiladegleisanlage ............................................................................. 11<br />
Abbildung 8: Entfernung des alten Gleisoberbaus ................................................................ 13<br />
Abbildung 9: Vormontierte Gleisjoche .................................................................................. 14<br />
Abbildung 10: Neuer Gleisoberbau mit neuem Schotter ....................................................... 14<br />
Abbildung 11: Schienenschweißer ........................................................................................ 17<br />
Abbildung 12: Zwei-Wege-Bagger-Führer ........................................................................... 17<br />
Abbildung 13: Globale Umwelt ............................................................................................. 27
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite X<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Chronologischer Verlauf <strong>der</strong> baulichen und technischen Maßnahmen ................ 12<br />
Tabelle 2: Verwendete Materialien und <strong>der</strong>en Kosten .......................................................... 15<br />
Tabelle 3: Beschäftigte Mitarbeiter und die damit verbundenen Lohnkosten ....................... 16<br />
Tabelle 4: Finanz- und Investitionsplanung des Bundes für den Ausbau und Erhalt <strong>der</strong><br />
Verkehrsinfrastruktur ........................................................................................... 23<br />
Tabelle 5: Konkurrenzbeurteilung im Vergleich zur WHE ................................................... 35<br />
Tabelle 6: <strong>Beurteilung</strong> einer Freiladegleisreaktivierung ....................................................... 41<br />
Tabelle 7: Stärken-Schwächen-Profil <strong>der</strong> WHE .................................................................... 43<br />
Tabelle 8: Chancen-Risiken-Profil <strong>der</strong> WHE ........................................................................ 44<br />
Tabelle 9: SWOT-Matrix und abgeleitete Strategiearten ...................................................... 45
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 1<br />
1 Einführung in die wissenschaftliche Problemstellung<br />
1.1 Praktischer Kontext<br />
Die <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH 1 ist ein traditionsreiches und beständiges Eisenbahnverkehrs-<br />
und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Herne 2 . Die Gesellschaft bietet sowohl verschiedene<br />
Logistikdienstleistungen als auch produktbegleitende Dienstleistungen 3 , wie die Reparatur<br />
von Diesellokomotiven in <strong>der</strong> unternehmenseigenen Werkstatt, an. Im vierten Quartal 2009 hat<br />
die WHE erfolgreich eine Freiladegleisreaktivierung 4 durchgeführt. Dieses Freiladegleis soll in Zukunft<br />
für den Umschlag von Altöl und Altölemulsionen 5 mit Hilfe <strong>eines</strong> sog. „FÜLLCOMATEN“ genutzt<br />
werden (Foto siehe Abbildung 1).<br />
Abbildung 1: Frontansicht des FÜLLCOMATEN 6<br />
1 Im Folgenden wird die <strong>Wanne</strong> <strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH als „WHE“ bezeichnet.<br />
2 Vgl. WHE (2009a). Die Gründung <strong>der</strong> WHE erfolgte 1913.<br />
3 Vgl. LAY/JUNG ERCEG (2002), S. 7. Hier wird die Reparatur als „klassische“ produktbegleitende Dienstleistung<br />
verstanden.<br />
4 Im Grunde handelt es sich hierbei offiziell nicht um eine Gleisreaktivierung, son<strong>der</strong>n vielmehr um eine Sanierung<br />
des Freiladegleises. Dieses sog. Stumpfgleis wurde zwar ca. 20 Jahre lang nicht genutzt und daher betrieblich gesperrt,<br />
ist jedoch nie beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) gem. § 11 AEG abgemeldet worden. Die Sanierung ist<br />
daher mit weniger bürokratischem Aufwand verbunden. In dieser Arbeit wird dennoch <strong>der</strong> Begriff „Reaktivierung“<br />
verwendet, da hiermit nicht die behördliche, son<strong>der</strong>n die betriebsinterne Reaktivierung des Freiladegleises gemeint<br />
ist. Vgl. AEG (2009), S. 15.<br />
5 Um ständige Wie<strong>der</strong>holungen im Text zu vermeiden, sei hier darauf hingewiesen, dass im Folgenden mit dem Begriff<br />
„Altöl“ auch Altölemulsionen gemeint sind.<br />
6 Auf diesem Foto (02.12.2009) ist <strong>der</strong> FÜLLCOMAT verschlossen. Direkt dahinter befindet sich die Gleisanlage, auf<br />
<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Regel ein Kesselwagen bereitsteht. Um das Altöl in den Kesselwagen mit Hilfe des FÜLLCOMATEN umpumpen<br />
zu können, müssen die Tanklaster rückwärts an diesen heranfahren. Die Pumpe innerhalb des<br />
FÜLLCOMATEN sorgt für einen vor Leckage geschützten Umschlag des Altöls.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 2<br />
Bei dem FÜLLCOMAT handelt es sich um einen von <strong>der</strong> Innovative Tank- und Umweltschutzsysteme<br />
GmbH 7 entwickelten Automaten, <strong>der</strong> über eine eingebaute Auffangwanne und eine Pumpanlage<br />
verfügt, mit Hilfe <strong>der</strong>er das von Tanklastern angelieferte Altöl direkt und vor Leckage geschützt in<br />
einen auf dem Gleis stehenden Kesselwagen umgepumpt werden kann 8 (siehe Abbildung 2).<br />
Abbildung 2: Rückansicht des FÜLLCOMATEN und des dazugehörigen SATELLITEN 9<br />
Ungefähr die Hälfte <strong>der</strong> ca. 750 m² an das Freiladegleis angrenzenden Fläche des wird zu diesem<br />
Zweck an die Karo As Umweltschutz GmbH 10 vermietet. Der Einsatz einer solchen innovativen<br />
Technik ist zu diesem Zeitpunkt 11 einmalig in Nordrhein-Westfalen. Daher wird in dieser Arbeit<br />
dieses Praxisbeispiel des Altöltransports näher untersucht und dokumentiert.<br />
Die zweite Hälfte <strong>der</strong> Freiladegleisfläche kann zudem noch für an<strong>der</strong>e Umschlagsmöglichkeiten<br />
genutzt werden. Diese weiteren Umschlagsmöglichkeiten stellen zusätzliche Erfolgspotenziale für<br />
die WHE dar. Welche Umschlagsmöglichkeiten hier möglich und auch realisierbar sind und inwieweit<br />
diese Erfolgspotenziale für die WHE darstellen, wird in dieser Arbeit ebenfalls untersucht.<br />
7 Die Innovative Tank- und Umweltschutzsysteme GmbH wird im Folgenden als „ITU“ bezeichnet.<br />
8 Vgl. ITU (2010a).<br />
9 Auf dem in Abbildung 2 erkennbaren Freiladegleis stehen in <strong>der</strong> Regel zwei Kesselwagen bereit, sodass das Altöl<br />
und die Altölemulsionen getrennt voneinan<strong>der</strong> umgeschlagen werden können. Sofern die Anlage ohne Aufsicht ist,<br />
müssen <strong>der</strong> FÜLLCOMAT und <strong>der</strong> SATELLIT verschlossen bleiben. Da es sich bei Altöl um eine stark umweltgefährdende<br />
Substanz handelt, muss gewährleistet sein, dass sich unbefugte Dritte keinen Zugang verschaffen können(Foto<br />
vom 02.12.2009).<br />
10 Die Karo As Umweltschutz GmbH wird im Folgenden mit „Karo As“ abgekürzt.<br />
11 Die Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum Frühjahr 2010.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 3<br />
1.2 Wissenschaftliche Problemstellung und intendierte Ergebnisse<br />
Die strategische Analyse ist im Zuge <strong>der</strong> strategischen Planung für nahezu jedes Unternehmen unerlässlich,<br />
da dessen Wettbewerbsfähigkeit stark davon abhängt, wie genau es seine Ausgangslage,<br />
seine Stärken und Schwächen und seine unternehmensspezifische Umwelt kennt, um künftige Entwicklungen<br />
und damit insbeson<strong>der</strong>e Chancen und Risiken abschätzen und weiterhin im Wettbewerb<br />
mit an<strong>der</strong>en Unternehmen seiner Branche bestehen zu können 12 .<br />
In dieser Arbeit wird die Freiladegleisreaktivierung <strong>der</strong> WHE mit Hilfe einer strategischen SWOT-<br />
Analyse 13 beurteilt. Es wird untersucht, wie sich dieses zusätzliche Freiladegleis in die Unternehmensstrategie<br />
<strong>der</strong> WHE einglie<strong>der</strong>n lässt und inwieweit es zusätzliche Erfolgspotenziale 14 für das<br />
Unternehmen darstellt. Die ausführliche Dokumentation <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung <strong>der</strong> WHE<br />
als Praxisbeispiel des Altöltransports wird <strong>der</strong> strategischen SWOT-Analyse vorangestellt, um den<br />
Bezugsrahmen dieser Arbeit herauszustellen.<br />
Die SWOT-Analyse wurde mit <strong>der</strong> Begründung gewählt, dass dieser Analyseansatz in <strong>der</strong> Literatur<br />
sehr häufig beschrieben und zudem regelmäßig in <strong>der</strong> Praxis angewandt wird 15 . Auch die nach<br />
GRANT/NIPPA vertretene Kritik, dass die SWOT-Analyse mit vier Kriterien zu ungenauen Ergebnissen<br />
und Einschätzungen führen kann und daher nicht zu strategischen Analysezwecken genutzt<br />
werden sollte, wird in dieser Arbeit zwar als Nachteil <strong>der</strong> SWOT-Analyse verstanden, dennoch wird<br />
<strong>der</strong> starke Praxisbezug als ausschlaggebendes Argument dagegen gehalten 16 . Zudem bemängeln<br />
Kritiker des SWOT-Ansatzes wie KORTMANN, dass die Teilanalysen auf einer „subjektivselektive(n)<br />
Datenauswahl“ und „oberflächliche(n) Einzelbetrachtungen“ 17 beruhen. Die Subjektivität<br />
des Kriterienkatalogs und <strong>der</strong> Einschätzung <strong>der</strong> Umwelt wird in dieser Arbeit dadurch vermieden,<br />
dass die SWOT-Analyse von einer unternehmensexternen Person durchgeführt und somit die<br />
Objektivität gewahrt wird. Auch wird die SWOT-Analyse als eine Verknüpfung <strong>der</strong> Teilanalysen 18<br />
verstanden, sodass die einzelnen Teilergebnisse durchaus nicht nur oberflächlich beleuchtet und<br />
einzeln betrachtet werden, son<strong>der</strong>n vielmehr zu einem Gesamtergebnis zusammengefügt werden.<br />
Die strategische SWOT-Analyse mit den Teilanalysen Unternehmens- und Umweltanalyse 19 dient<br />
in dieser Arbeit zur <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung <strong>der</strong> WHE und ermöglicht schließlich,<br />
ein Urteil darüber abzugeben, inwieweit Gleisanschlussreaktivierungen positive Potenziale für<br />
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), wie z.B. die WHE, darstellen. Der Fokus <strong>der</strong> SWOT-<br />
12 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 38 ff.<br />
13 SIMON/VON DER GATHEN (2002), S. 214. Hinter dem Akronym SWOT verbergen sich die Begriffe Strengths,<br />
Weaknesses, Opportunities und Threats. Eine Beschreibung <strong>der</strong> SWOT-Analyse und ihrer jeweiligen Teilanalysen<br />
sowie <strong>der</strong> damit zusammenhängenden Arbeitstechniken findet sich in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit wie<strong>der</strong><br />
und soll daher an dieser Stelle nicht vorweg genommen werden.<br />
14 Als Erfolgspotenzialen werden erfolgsrelevante Voraussetzungen bezeichnet, die vor einer möglichen Erfolgsrealisierung<br />
durch ein Unternehmen gelten müssen. Sie können produkt- o<strong>der</strong> marktspezifisch sein und meist nur langfristig<br />
aufgebaut werden. Vergleiche hierzu GÄLWEILER (2005), S. 26 f.<br />
15 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 109 ff.; HUGENBERG (2008), S. 88 ff.; WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 289 ff.<br />
16 Vgl. GRANT/NIPPA (2008), S. 38.<br />
17 KORTMANN (2003), S. 52. Die Ergänzungen in Klammern wurden von <strong>der</strong> Verfasserin hinzugefügt.<br />
18 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 44 ff.<br />
19 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 54. Die Umwelt- und Unternehmensanalysen werden auch als Chancen-Risiken- bzw.<br />
Stärken-Schwächen-Analyse bezeichnet. Vergleiche hierzu SIMON/VON DER GATHEN (2002), S. 214 ff.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 4<br />
Analyse liegt daher auf eben dieser Freiladegleisreaktivierung und den damit verbundenen Betätigungsfel<strong>der</strong>n<br />
<strong>der</strong> WHE.<br />
Die Unternehmensanalyse als Teilanalyse <strong>der</strong> SWOT-Analyse gibt Aufschluss über die Stärken und<br />
Schwächen <strong>der</strong> WHE im Vergleich zu ihrer Konkurrenz. Nur wenn diese Stärken und Schwächen<br />
bekannt sind, können Strategien entwickelt werden, die auf den Stärken <strong>der</strong> WHE aufbauen und die<br />
Schwächen mit <strong>der</strong> Zeit abbauen.<br />
Aus <strong>der</strong> Umweltanalyse werden Chancen und Risiken aus möglichen zukünftigen Umweltentwicklungen<br />
für die WHE abgeleitet. Auch hier gilt, dass nur bekannte Chancen von <strong>der</strong> WHE zukünftig<br />
genutzt und nur erkannte Risiken reduziert o<strong>der</strong> kompensiert werden können.<br />
Nicht zuletzt wird in dieser Arbeit gezeigt, dass die Freiladegleisreaktivierung <strong>der</strong> WHE einen Ausbau<br />
ihrer regionalen Stärke und die Nutzung einer Chance darstellt, mit einem Kunden, wie <strong>der</strong> Karo<br />
As, eine langfristige Beziehung aufzubauen. Sie beschränkt sich jedoch auf die strategische<br />
SWOT-Analyse <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung und <strong>der</strong>en Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen im<br />
Hinblick auf zukünftige Erfolgspotenziale für das Unternehmen. Die ausführliche Formulierung<br />
von strategischen Plänen und Handlungsempfehlungen wird daher nicht als Teil dieser Arbeit verstanden.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 5<br />
2 Dokumentation <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung<br />
2.1 Zustandekommen <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung 20<br />
Die erste Kontaktaufnahme <strong>der</strong> Karo As 21 mit <strong>der</strong> WHE erfolgte über die DB Schenker Rail GmbH<br />
im Jahre 2007. Die Karo As hatte mit <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH schon zuvor an verschiedenen<br />
Standorten in Deutschland ein etabliertes Geschäft mit dem Umschlagen von Altöl aufgebaut 22 . Das<br />
Konzept sieht vor, dass verschiedene Tanklaster in dem für sie vorgegebenen Gebiet Werkstätten<br />
und Industrieunternehmen, die Altöle und Altölemulsionen zu entsorgen haben, täglich abfahren<br />
und anschließend einen <strong>der</strong> vorgegebenen Standorte für den Umschlag anfahren, von wo aus diese<br />
Stoffe getrennt voneinan<strong>der</strong> weitertransportiert werden, bis sie letztlich in <strong>der</strong> Raffinerie <strong>der</strong> Mineralöl-Raffinerie<br />
Dollbergen GmbH 23 weiterverarbeitet o<strong>der</strong> wie<strong>der</strong> aufbereitet werden können. Zu<br />
diesem Zweck fahren fünf Fahrer von Karo As mit ihren Tanklastern, die über ein Mehrkammern-<br />
System zum Trennen von Altöl und Altölemulsionen verfügen, durch das NRW-Einzugsgebiet und<br />
sammeln im Jahr ca. 5000 Tonnen Altöl, d.h. 1000 Tonnen pro Fahrer pro Jahr 24 . Abbildung 3 und<br />
4 auf <strong>der</strong> nächsten Seite zeigen die Mineralölraffinerie und die eben beschriebenen Tanklaster.<br />
20 Die in diesem Kapitel erläuterten Sachverhalte und Aussagen beziehen sich, wenn nicht an<strong>der</strong>s kenntlich gemacht,<br />
auf Antworten von Herrn RECKEL, die dieser in entsprechenden Interviews gegeben hat. Herr RECKEL ist bei <strong>der</strong><br />
WHE grundsätzlich für die Hauptaufgaben Vertrieb und Marketing zuständig, aber auch Projektleitung und -<br />
betreuung fallen in seine Zuständigkeit. Für diese Arbeit hat er sich als Interviewpartner zur Verfügung gestellt,<br />
sodass die Freiladegleisreaktivierung möglichst genau dokumentiert werden konnte. Zudem stellte er auch seine<br />
Expertise zur Verfügung.<br />
21 Für nähere Informationen zu den Leistungen <strong>der</strong> Karo As vgl. KARO AS (2010a).<br />
22 Deutschlandweit hat die DB Schenker Rail GmbH an verschiedenen Güterbahnhöfen Umfüllstationen für den Umschlag<br />
von Altöl installiert, die gemäß <strong>der</strong> Baumusterzulassung über eine betonierte Auffangwanne sowie Ölfilter<br />
und Ölabschei<strong>der</strong> verfügen. Jede dieser Installationen kostete 100.000 – 200.000 €, da beson<strong>der</strong>es die Auffangwanne<br />
unter <strong>der</strong> Gleisanlage und <strong>der</strong> Umfüllstation eine hohe Investition in den Boden darstellt. Als Gegenzug für<br />
solch kostspielige Investitionen hat sich die Karo As wie<strong>der</strong>um verpflichtet, entsprechende Mengen Altöl zu liefern.<br />
Für eine Übersicht über die Standorte <strong>der</strong> Karo As vgl. KARO AS (2010b).<br />
23 Für nähere Informationen bezüglich <strong>der</strong> Partnerschaftsbeziehung zwischen <strong>der</strong> Karo As und <strong>der</strong> Mineralöl-<br />
Raffinerie Dollbergen GmbH vergleiche auch MINERALÖL-RAFFINERIE DOLLBERGEN GMBH (2010).<br />
24 Aufgrund des Dichteunterschiedes zwischen Altöl und Wasser entsprechen 900 Tonnen Wasser ca. 1000 Liter Altöl.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 6<br />
Abbildung 3: Mineralölraffinerie Dollbergen GmbH 25<br />
Abbildung 4: Tanklaster <strong>der</strong> Karo As Umweltschutz GmbH 26<br />
25 Auf dem Foto (04.09.2009) in Abbildung 3 ist die Mineralölraffinerie Dollbergen GmbH <strong>der</strong> Karo As Umweltschutz<br />
GmbH zu sehen. Hier werden Altöle und Altölemulsionen weiterverarbeitet o<strong>der</strong> wie<strong>der</strong>aufbereitet.<br />
26 Bei den auf dem Foto (04.09.2009) in Abbildung 4 zu sehenden Tanklastern handelt es sich um sog. „2-Achser“,<br />
die im Umkreis von Herne im Auftrag <strong>der</strong> Karo As das Altöl sammeln und dieses anschließend mit Hilfe des<br />
FÜLLCOMATEN in einen am Freiladegleis <strong>der</strong> WHE bereitstehenden Kesselwagen umpumpen.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 7<br />
Das alte Transportkonzept <strong>der</strong> Karo As sah vor, dass die Fahrer ein Tanklager in Herne anfahren,<br />
wo das Altöl zwischengelagert wurde, bis es von einem von <strong>der</strong> Karo As beauftragten Spediteur mit<br />
Hilfe von größeren Tanklastern abgeholt und bis nach Dollbergen 27 gebracht wurde. In diesem beson<strong>der</strong>en<br />
Fall verfügte <strong>der</strong> Stellplatz in Herne nicht über einen aktiven Gleisanschluss, weshalb bisher<br />
auch ein Lkw-Spediteur eingesetzt werden musste.<br />
Nachdem die Karo As den FÜLLCOMATEN <strong>der</strong> ITU durch Zufall entdeckt und bereits in Wolfratshausen<br />
28 erfolgreich zum Umschlagen von Altöl genutzt hatte, suchte sie in Zusammenarbeit mit<br />
<strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH einen Standort mit Gleisanschluss im mittleren Ruhrgebiet für einen<br />
FÜLLCOMATEN, da die Karo As als Umweltschutz GmbH generell das Ziel verfolgt, möglichst viele<br />
Altöl- und Altölemulsionstransporte mit <strong>der</strong> Bahn abzuwickeln, um für diese Transporte eine möglichst<br />
geringe Menge an Kohlenstoffdioxid und Feinstaubpartikeln zu emittieren. Da die DB Schenker<br />
Rail GmbH auf ihren Güter- und Rangierbahnhöfen keinen solchen Standort zur Verfügung<br />
stellen konnte, nahm sie Kontakt zur WHE auf mit <strong>der</strong> Anfrage, ob die WHE möglicherweise über<br />
einen entsprechenden Standort verfüge 29 . Auf dem betrieblich aktiven Gleisgelände <strong>der</strong> WHE konnte<br />
ebenfalls kein entsprechen<strong>der</strong> Standort ausgemacht werden, da <strong>der</strong> Einsatz des FÜLLCOMATEN<br />
voraussetzt, dass die zu befüllenden Kesselwagen auf dem benachbarten Gleis bereitstehen, was den<br />
täglichen Betriebsablauf <strong>der</strong> WHE deutlich gestört hätte. Zudem muss es sich bei <strong>der</strong> Fläche für den<br />
FÜLLCOMATEN um befestigten Boden handeln, da nur so auch die Sicherheit <strong>der</strong> Anlage gegeben<br />
ist. Deshalb entschloss man sich, den FÜLLCOMATEN an das besagte, bisher betrieblich stillgelegte 30<br />
Stumpfgleis bzw. Freiladegleis 31 zu stellen, sodass die Kesselwagen am Ende dieses Stumpfgleises<br />
abgestellt werden konnten, ohne den Betriebsablauf <strong>der</strong> WHE zu stören.<br />
Das neue Transportkonzept sieht also vor, dass die fünf Fahrer <strong>der</strong> Karo As in NRW das Freiladegleis<br />
<strong>der</strong> WHE in Herne anfahren und mit Hilfe des FÜLLCOMATEN das Altöl in die bereitstehenden<br />
Kesselwagen tröpfchenfrei 32 umpumpen. Sind die Kesselwagen voll, bringt sie die WHE mit ihren<br />
Dieselloks bis zum Güter- und Rangierbahnhof <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH. Von dort aus werden<br />
sie, angekoppelt an einen Güterzug mit gleichem Zielbahnhof, auf dem Eisenbahnschienennetz <strong>der</strong><br />
27 Dollbergen liegt im Kreis Uetze und östlich <strong>der</strong> Stadt Hannover.<br />
28 Wolfratshausen liegt südlich <strong>der</strong> Stadt München.<br />
29 Die WHE arbeitet hauptsächlich bei Einzelwagenverkehren mit <strong>der</strong> Deutschen Bahn zusammen. Der Einzelwagenverkehr<br />
ist eine Angebotsform des Wagenladungsverkehrs. Darunter versteht man das Zusammenfassen einzelner<br />
Wagen zu einem Zug, wobei die einzelnen Wagen o<strong>der</strong> Wagengruppen von ausschließlich einem Kunden<br />
genutzt werden. Der Zug kann nicht als Ganzzug abgefertigt werden, son<strong>der</strong>n die einzelnen Wagen müssen regional<br />
auf die jeweiligen Kunden verteilt werden, was insb. zu einem höheren Rangieraufwand an den jeweiligen<br />
Knotenbahnhöfen führt. Dennoch machen diese Verkehre einen großen Anteil am Verkehrsaufkommen <strong>der</strong> Bahnen<br />
aus. Zur Abgrenzung <strong>der</strong> Begrifflichkeiten vgl. BERNDT (2001), S. 16 ff.<br />
30 Die betriebliche Stilllegung und Sperrung des Gleises erfolgte gem. <strong>der</strong> Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung<br />
(EBO), insb. hier die §§ 2, 17 Abs. 2 EBO. Vgl. EBO (2008), S. 5.<br />
31 Die Begriffe Freiladegleis und Stumpfgleis bezeichnen hier ein und dasselbe Gleis, sind jedoch unterschiedlichen<br />
Ursprungs. Der Begriff „Stumpfgleis“ kommt aus dem Eisenbahnbetrieb und bezeichnet ein Gleis, das ein Ende<br />
hat, d.h. ein Gleis, welches eine Sackgasse darstellt und mit einem Prellbock endet. Der Begriff „Freiladegleis“ beschreibt<br />
lediglich die Art des Umschlags näher. An diesen Gleisen kann <strong>der</strong> Umschlag direkt vom Lkw in den Güterwagen<br />
und umgekehrt erfolgen.<br />
32 Der FÜLLCOMAT bedient sich hierfür <strong>der</strong> Vollschlauch-Trockenkupplung, mit <strong>der</strong>en Hilfe das Altöl vor Leckage<br />
geschützt, d.h. tröpfchenfrei umgepumpt werden kann. Dieses Kupplungssystem wird auch beim Betanken von<br />
Flugzeugen verwendet und soll verhin<strong>der</strong>n, dass Gefahrenstoffe nach § 4 GefStoffV durch den Boden ins Grundwasser<br />
sickern können. Vgl. GEFSTOFFV (2008), S. 6; ITU (2010b).
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 8<br />
DB Netz AG mit Elektroloks weitertransportiert. Am Zielbahnhof wird <strong>der</strong> Güterzug wie<strong>der</strong> aufgelöst<br />
und die einzelnen Wagen werden verteilt, wobei die Kesselwagen bis zum privaten Gleisanschluss<br />
<strong>der</strong> Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH gebracht werden. Der Transport des Altöls erfolgt<br />
ab Herne nur noch auf Schienen 33 . Um die Strecke von Herne bis nach Dollbergen zurückzulegen,<br />
brauchen die Kesselwagen zwei Tage. Der Spediteur, <strong>der</strong> bei dem alten Transportkonzept<br />
eingesetzt wurde, brauchte mit seinen Tanklastern zwar nur ca. fünf Stunden. Allerdings konnten<br />
die Tanklaster des Spediteurs maximal 25 Tonnen Altöl transportieren. Die nun eingesetzten Kesselwagen<br />
fassen jeweils bis zu 55 Tonnen Altöl. In Abbildung 5 werden die beiden Transportkonzepte<br />
<strong>der</strong> Karo As zur Veranschaulichung gegenüber gestellt.<br />
Werkstätten/ Industrie (NRW)<br />
Tanklaster <strong>der</strong> Karo As mit Altöl befüllen<br />
Tanklager (Herne)<br />
Tanklaster des Spediteurs mit Altöl befüllen<br />
freie Strecke (Straße)<br />
volle Tanklasters des Spediteurs fahren<br />
Ladestelle (Raffinerie Dollbergen)<br />
Altöl aus Tanklaster zur Weiterverarbeitung abpumpen<br />
Abbildung 5: Grobe Darstellung des alten und neuen Transportkonzepts <strong>der</strong> Karo As 34<br />
Pro Umlauf werden ein bis zwei Kesselwagen bewegt, wobei einer r<strong>eines</strong> Altöl beinhaltet und <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>e Altölemulsionen. Monatlich sind drei Umläufe geplant, sodass die Karo As insgesamt einen<br />
Transport von mindestens 3.500 Tonnen 35 pro Jahr verbuchen kann. Ein Umlauf umfasst eine Hinfahrt<br />
mit vollen Kesselwagen und eine Leerfahrt wie<strong>der</strong> zurück.<br />
33 Zwischen Herne und Dollbergen erstrecken sich 264 Bahn-Kilometer.<br />
34 Diese Darstellung basiert auf BERNDT (2001), S. 17 f.<br />
Werkstätten/ Industrie (NRW)<br />
Tanklaster <strong>der</strong> Karo As mit Altöl befüllen<br />
Freiladegleis (WHE/ Herne)<br />
Kesselwagen mit Altöl befüllen<br />
freie Strecke (WHE/ Schiene)<br />
Kesselwagen fahren<br />
Bahnhof (DB/ <strong>Wanne</strong>-Eickel Hbf)<br />
Wagen übergeben, sammeln und Zug bilden<br />
freie Strecke (DB/ Schiene)<br />
Zug fahren<br />
Bahnhof (DB/ Hannover-Linden)<br />
Zug auflösen<br />
freie Strecke (DB/ Schiene)<br />
Fahren <strong>der</strong> Kesselwagen<br />
Ladestelle (Gleisanschluss Raffinerie Dollbergen)<br />
Altöl aus Kesselwagen zur Weiterverarbeitung abpumpen<br />
altes Transportkonzept neues Transportkonzept<br />
35 Die DB Schenker Rail GmbH hat die Anschaffungskosten des FÜLLCOMATEN übernommen. Die Karo As hat sich<br />
wie<strong>der</strong>um verpflichtet, mindestens 3.500 Tonnen Altöl jährlich zu för<strong>der</strong>n. Erfüllt die Karo As diese Pflicht nicht,<br />
muss sie nach fünf Jahren eine Vertragsstrafe in Höhe von 3.500 € pro Jahr zahlen.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 9<br />
Bevor die WHE jedoch mit den baulichen Maßnahmen <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung und <strong>der</strong> tatsächlichen<br />
Umsetzung des neuen Transportkonzepts <strong>der</strong> Karo As beginnen konnte, mussten noch<br />
entsprechende Verhandlungen, Kalkulationen für die Kosten <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung und vertragliche<br />
Vereinbarungen mit <strong>der</strong> Karo As durchgeführt bzw. ausgehandelt werden.<br />
Zudem war es nötig, die entsprechende Genehmigung des Umweltamtes Herne 36 für das Aufstellen<br />
des FÜLLCOMATEN zu erhalten.<br />
2.2 Vertragliche Vereinbarungen und Zuständigkeiten<br />
Um das oben beschriebene neue Altöl-Transportkonzept auch vertraglich abzusichern, musste das<br />
Gut Altöl in den Rahmenvertrag zwischen <strong>der</strong> WHE und <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH aufgenommen<br />
und preislich festgesetzt werden. In diesem Rahmenvertrag werden die Frachtanteile zwischen<br />
<strong>der</strong> WHE und <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH für <strong>der</strong>en Einzelwagenverkehre festgelegt, d.h., in diesem<br />
Vertrag sind Preis-Mengen-Angaben für die entsprechenden Güter-arten hinterlegt 37 . Beim<br />
Transport <strong>der</strong> Kesselwagen <strong>der</strong> Karo As erfolgt die Abrechnung pro Kesselwagen und es wird unterschieden<br />
zwischen Last- und Leerfahrten. Die WHE berechnet eine Geldsumme X für eine Leerfahrt,<br />
d.h. die Fahrt ihrer Diesellok zum Übergabe-Bahnhof <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH in <strong>Wanne</strong>-Eickel<br />
und zurück zum Freiladegleis in Herne, wenn sie die leeren Kesselwagen <strong>der</strong> Karo As<br />
abholt, und das Dreifache dieser Geldsumme X für eine Lastfahrt, d.h. wenn ihre Lok die vollen<br />
Wagen aus dem Freiladegleis herauszieht und bis zum Übergabe-Bahnhof fährt 38 .<br />
36 Da es sich bei Altöl und Altölemulsionen um Stoffe handelt, die bei falschem Umgang zu schädlichen Umwelteinwirkungen<br />
führen können, musste vom Umweltamt Herne eine Genehmigung für das Aufstellen und Betreiben<br />
dieser Altölumfüllanlage bzw. des FÜLLCOMATEN gem. Bundes-Immissionsschutzgesetz (sog. BImSchG-<br />
Genehmigung; Vgl. hierzu BIMSCHG (2009)) vorliegen, die am 02.12.2009 schriftlich erteilt wurde. Antragsteller<br />
war die Karo As als Betreiber <strong>der</strong> Anlage, um unter an<strong>der</strong>em den bürokratischen Aufwand geringer zu halten und<br />
die Zuständigkeiten genau abzugrenzen. Hätte die WHE statt <strong>der</strong> Karo As den Antrag gestellt, wäre in diesem Falle<br />
nicht mehr die Stadt Herne zuständig gewesen, son<strong>der</strong>n das Bundesland NRW, da es sich bei <strong>der</strong> WHE um eine<br />
100 %-ige Tochtergesellschaft <strong>der</strong> Stadt Herne handelt. Dadurch, dass die Zuständigkeit bei <strong>der</strong> Stadt Herne verbleibt,<br />
gestaltet sich das Genehmigungsverfahren aus diesem Grunde weiniger zeitaufwendig als ein Genehmigungsverfahren<br />
des Landes NRW. Die Genehmigung wurde jedoch nur unter Einhalten folgen<strong>der</strong> Auflagen erteilt:<br />
Zunächst muss die Sicherheit des FÜLLCOMATEN gewährleistet sein. Das System muss in sich dicht und umweltverträglich<br />
sein und über entsprechende Sicherheitssysteme verfügen. Zudem muss dafür Sorge getragen werden,<br />
dass <strong>der</strong> FÜLLCOMAT vor Einbruch und Vandalismus geschützt ist, über eine Beleuchtung mit Bewegungsmel<strong>der</strong>n<br />
verfügt und die Pipeline zwischen FÜLLCOMAT und SATELLIT anfahrgeschützt ist. Um Leckagen am Kesselwagen<br />
erkennen zu können, mussten die Gleise darunter mit weiß angestrichenen Gummimatten versehen werden. Die<br />
Genehmigung erlaubt, gemittelt, einen Umschlag von zehn Tonnen pro Tag.<br />
37 Die WHE ist eine öffentliche Eisenbahngesellschaft, d.h., sie muss jedem die Nutzung ihrer Eisenbahninfrastruktur<br />
ermöglichen, <strong>der</strong> ein entsprechendes Entgelt dafür zahlt. Die Preis-Mengen-Angaben sagen daher aus, welches<br />
Entgelt die WHE dafür berechnet, dass sie die Güterwagen den Gleisanschließern auf den letzten Kilometern zustellt.<br />
Die Güterarten werden zunächst grundsätzlich danach unterschieden, ob es sich um Stückgüter, Flüssiggüter,<br />
Streugüter usw. handelt. Anschließend wird weiter differenziert, sodass letztlich jedem Gut, sei es Altöl, Altölemulsionen,<br />
Kohle, Kies o<strong>der</strong> Gleisjoche, ein Preis pro Mengeneinheit, z.B. pro Tonne o<strong>der</strong> Stück, zugewiesen<br />
wird.<br />
38 Herr RECKEL konnte keine genauen Angaben zur Höhe <strong>der</strong> Geldsumme X machen, da dies eine Preisgabe betriebsinterner<br />
Daten darstellen würde.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 10<br />
Im Bezug auf den Transport besteht daher kein Vertrag zwischen <strong>der</strong> WHE und <strong>der</strong> Karo As, son<strong>der</strong>n<br />
zwischen <strong>der</strong> WHE und <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH und wechselseitig zwischen <strong>der</strong> DB<br />
Schenker Rail GmbH und <strong>der</strong> Karo As. Die vertragliche Beziehung <strong>der</strong> WHE zur Karo As besteht<br />
in Form <strong>eines</strong> Mietvertrages über die zum Betreiben <strong>der</strong> Umfüllanlage nötige Fläche, die an das<br />
Freiladegleis angrenzt. Die Mindestlaufzeit dieses Mietvertrages beträgt zehn Jahre und hat eine<br />
jährliche Mietzahlung zum Gegenstand, die nicht nur zu großen Teilen zur Refinanzierung des Investments<br />
in das Gleis dient 39 , son<strong>der</strong>n auch als Sicherheit für die WHE gilt, da die Miete auch gezahlt<br />
werden muss, wenn die Karo As im schlechtesten Szenario keine Umschlagsmengen liefert.<br />
Eine Klausel in diesem Mietvertag besagt jedoch, dass sich <strong>der</strong> Mietpreis min<strong>der</strong>t, wenn die Karo<br />
As eine Mindestumschlagsmenge liefern kann 40 . Auf dem Foto in Abbildung 6 ist die eben beschriebene<br />
Feiladegleisfläche zu erkennen.<br />
Abbildung 6: Die Freiladegleisfläche<br />
Es bleibt also festzuhalten, dass nicht die WHE, son<strong>der</strong>n die Karo As Betreiber <strong>der</strong> Altöl-<br />
Umfüllstation, d.h. des FÜLLCOMATEN, ist und die WHE hierfür lediglich das Grundstück zur Verfügung<br />
stellt. Das heißt die Karo As ist für das Umschlagen des Altöls selbst verantwortlich, während<br />
die WHE für den Transport <strong>der</strong> vollen bzw. leeren Kesselwagen die Verantwortung trägt. Die<br />
Zuständigkeit <strong>der</strong> Karo As endet, sobald die Kesselwagen voll sind und die Zuständigkeit <strong>der</strong> WHE<br />
dauert so lange an, bis die Kesselwagen an die DB Schenker Rail GmbH übergeben sind.<br />
39 Über die reinen Frachtanteile hätte die WHE ihre Investitionen in das Freiladegleis nicht refinanzieren können, da<br />
dafür die Umschlagsmengen <strong>der</strong> Karo As zu gering ausfallen. Die Reaktivierung wurde aus dem laufenden Etat <strong>der</strong><br />
WHE bezahlt und musste daher nicht beliehen werden.<br />
40 Auch im diesem Fall konnte Herr RECKEL keine genauen Angaben zur Höhe des Mietpreises o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Mindestumschlagsmenge<br />
machen, da es sich bei dem Vertragsinhalt um vertrauliche Daten handelt.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 11<br />
2.3 Verlauf technischer und baulicher Maßnahmen und <strong>der</strong>en Kosten 41<br />
Projektbeginn des <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> war Mitte 2008. Zunächst musste dieses Vorhaben<br />
geplant sowie vorkalkuliert und es mussten die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen vertraglichen<br />
Vereinbarungen getroffen werden, bevor die eigentliche Reaktivierung im vierten Quartal<br />
2009 durchgeführt werden konnte. Das Freiladegleis musste wie<strong>der</strong> in einen betriebssicheren Zustand<br />
versetzt werden 42 .Die Fotos in Abbildung7 zeigen die Freiladegleisanlage vor den technischen<br />
und baulichen Maßnahmen.<br />
Abbildung 7: Die alte Freiladegleisanlage 43<br />
Die für die Betriebsaufnahme des FÜLLCOMATEN am 16.12.2009 notwendigen Vorgänge und Maßnahmen<br />
werden in Tabelle 1 auf <strong>der</strong> nächsten Seite chronologisch aufgelistet 44 .<br />
41 Die Aussagen, die in diesem Kapitel zu den baulichen und technischen Maßnahmen und <strong>der</strong>en Kosten gemacht<br />
werden, basieren auf den Interviews mit Herrn RECKEL und Frau SMOLARZ. Aufgabenbereich von Frau SMOLARZ<br />
bei <strong>der</strong> WHE ist die Instandhaltung von Gleisanlagen und allen zugehörigen Begleitbauwerken, wie Bahnübergängen,<br />
Stellwerken, Oberleitungsanlagen sowie technisch gesicherten Bahnübergangsanlagen.<br />
42 Die WHE ist sowohl ein Eisenbahnverkehrs- als auch ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU), sodass sie<br />
grundsätzlich über das fachliche und technische Know-how für eine Gleisreaktivierung verfügt. Zusätzliche Erfahrungen<br />
konnte die WHE außerdem bei <strong>der</strong> Gleisanschlussreaktivierung <strong>der</strong> Müntefering-Gockeln Wertstoffrecycling<br />
& Containerdienst GmbH sammeln. Vgl. RECKEL/ KOWALSKI (2009).<br />
43 Abbildung 7 zeigt die noch unverän<strong>der</strong>te Freiladegleisanlage mit völlig maroden und unbefahrbaren Gleisen. Auf<br />
dem Foto rechts (18.08.2009) ist im Hintergrund das noch manuell betriebene Stellwerk zu erkennen.<br />
44 Am 16.12.2009 wurde <strong>der</strong> erst Probelauf des FÜLLCOMATEN durchgeführt. Dieses Datum stellt das Ende des Gleisreaktivierungsprojektes<br />
dar.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 12<br />
Maßnahmen Zeitraum<br />
Gelän<strong>der</strong>einigung 18.08.2009 - 04.09.2009<br />
alten Gleisoberbau entfernen 14.09.2009 - 28.09.2009<br />
- alte Gleisjoche entfernen<br />
- Gleisbett/Schotter entfernen<br />
planieren 07.10.2009 - 09.10.2009<br />
neuen Gleisoberbau errichten 12.10.2009- 23.10.2009<br />
- neues Schotterbett verlegen<br />
- vormontierte Gleisjoche verlegen<br />
- Prellbock montieren<br />
- Gleissperre anbringen<br />
- Schienen verschweißen<br />
aufstellen des FÜLLCOMATEN 02.12.2009<br />
Pipeline zwischen FÜLLCOMAT und SATELLIT<br />
verschweißen<br />
02.12.2009 - 04.12.2009<br />
Stromversorgung des FÜLLCOMATEN 02.12.2009 - 15.12.2009<br />
- Kabel vom Stellwerk aus verlegen<br />
- Kabelschacht legen<br />
Anfahrschutz für Pipeline errichten 16.12.2009 - 31.12.2009<br />
- platzieren alter Betonschwellen<br />
verlegen von Gummimatten 16.12.2009 - 31.12.2009<br />
Tabelle 1: Chronologischer Verlauf <strong>der</strong> baulichen und technischen Maßnahmen<br />
Bei <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> baulichen und technischen Maßnahmen ist zu beachten, dass die meisten<br />
Arbeiten am Freiladegleis von den Mitarbeitern <strong>der</strong> WHE neben <strong>der</strong> regulären Arbeit erledigt wurden.<br />
Auf diese Weise konnte sehr kosten-effizient gearbeitet werden. Bei <strong>der</strong> Entfernung des alten<br />
Gleisoberbaus sind Kosten für die Entsorgung <strong>der</strong> alten Holzschwellen angefallen 45 , die sich jedoch<br />
mit den Erlösen aus <strong>der</strong> Verschrottung <strong>der</strong> alten Schienen verrechnen ließen. Die Fotos in <strong>der</strong> folgenden<br />
Abbildung 8 zeigen das Gleisbett ohne den alten Gleisoberbau und das alte Schotterbett.<br />
45 Bei den alten Holzschwellen handelt es sich um überwachungsbedürftige Abfälle, weshalb diese über einen Fachbetrieb<br />
entsorgt werden müssen.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 13<br />
Abbildung 8: Entfernung des alten Gleisoberbaus 46<br />
Für den neuen Gleisoberbau wurde neuer Schotter verwendet, damit die Lagestabilität des Gleises<br />
gewährleistet ist 47 . Die Gleisjoche konnten schon auf einem separaten Lagerplatz vormontiert werden,<br />
was letztlich zu einer Zeiteinsparung geführt hat, da die Schwellen und Schienen bereits vorhanden<br />
waren. Hierbei handelt es sich um gebrauchte, aber neuwertige o<strong>der</strong> übrig gebliebene Materialen,<br />
weshalb die Kosten <strong>der</strong> Reaktivierung durch die WHE gedrückt werden konnten 48 . Abbildung<br />
9 und Abbildung 10 auf <strong>der</strong> nächsten Seite zeigen die vormontierten Gleisjoche und den neue<br />
Gleisoberbau.<br />
46 Auf dem linken Foto (18.09.2009) in Abbildung 8 ist das Gleisbett zu sehen, nachdem die alten Gleise von 1949<br />
entfernt wurden. Das rechte Bild zeigt das alte Schotterbett, das noch vollständig ausgehoben werden muss, bevor<br />
<strong>der</strong> neue Schotter und die neuen Gleisjoche verlegt werden können.<br />
47 Der neue Schotter sorgt für Lagestabilität <strong>der</strong> Gleisjoche, indem sich die scharfkantigen Schottersteine ineinan<strong>der</strong><br />
verzahnen. Je länger <strong>der</strong> Schotter Belastungen ausgesetzt ist, desto mehr reiben die Steine aneinan<strong>der</strong> und runden<br />
sich ab. Aus diesem Grund hat die WHE das Schotterbett erneuert.<br />
48 Bei den Schienen handelt es sich um UIC-60-Schienen (60 kg/m), d.h. ICE-Gleise, die von <strong>der</strong> Deutschen Bahn<br />
AG nicht abgenommen wurden. Da auf dem Freiladegleis jedoch keine hohen Geschwindigkeiten gefahren werden<br />
und das Gleis keinen hohen Belastungen ausgesetzt ist, konnten diese Schienen hier ohne Bedenken verlegt werden.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 14<br />
Abbildung 9: Vormontierte Gleisjoche 49<br />
Abbildung 10: Neuer Gleisoberbau mit neuem Schotter 50<br />
49 Jedes Gleisjoch hat eine Länge von 7,10 m (Foto vom 09.09.2009).<br />
50 Auf dem Foto (14.10.2009) in Abbildung 10 ist zu erkennen, dass die Gleisjoche sukzessive auf dem neuen Schotterbett<br />
verlegt worden sind. Dabei ist beson<strong>der</strong>s darauf zu achten, dass die Joche alle in <strong>der</strong> Waage liegen, da die<br />
Schienen ansonsten zu hoher Spannung ausgesetzt wären.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 15<br />
Den FÜLLCOMATEN hat die DB Schenker Rail GmbH bezahlt, die WHE ist jedoch für dessen<br />
Stromversorgung zuständig. Zu diesem Zweck wurde ein Stromkabel vom Stellwerk, das auf <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Straßenseite liegt, durch bereits vorhandene Rohre unterhalb des Bahnübergangs bis hin<br />
zum FÜLLCOMATEN verlegt. Auf dem Freiladegleisgelände wurde zudem noch ein Kabelschacht gelegt,<br />
damit das Stromkabel vor Witterung geschützt bleibt. Zur Absicherung <strong>der</strong> Kesselwagen wurde<br />
nicht nur eine Gleissperre installiert, son<strong>der</strong>n die Kesselwagen sind selbst noch mit zwei sog.<br />
„Hemmschuhen“ versehen, die verhin<strong>der</strong>n sollen, dass die Kesselwagen sich eigenständig und ungewollt<br />
bewegen können 51 .<br />
In <strong>der</strong> Tabelle 2 werden die verwendeten Materialien und <strong>der</strong>en Kosten dargestellt.<br />
verwendete Materialien<br />
gebrauchte, vorhandene Materialien neu gekaufte Materialien<br />
- Schienen - Schotter (14 €/ Tonne)<br />
- Schwellen 100 Tonnen * 14 € = 1400 €<br />
- Kleineisen - Gleisstopfmaschine (1250 €/ Std.)<br />
Buchwert insg.: 25.000 € 3 Std. * 1250 € = 3750 €<br />
- Prellbock - Stromkabel (a)<br />
- Gleissperre - Kabelkanal (b)<br />
- Betonschwellen (Anfahrschutz) - Kanalabdeckung (c)<br />
- Gummimatten - Kleinmaterial (d)<br />
kostenneutral behandelt 150 m * (a + b + c + d) = 4000 €<br />
Summe <strong>der</strong> Kosten für verwendete Materialien: 34.150 €<br />
Tabelle 2: Verwendete Materialien und <strong>der</strong>en Kosten<br />
Die zur technischen und baulichen Umsetzung <strong>der</strong> Gleisreaktivierung notwendigen Mitarbeiter und<br />
die mit ihnen einhergehenden Lohnkosten werden in <strong>der</strong> Tabelle 3 auf <strong>der</strong> nächsten Seite aufgelistet.<br />
51 Diese Absicherung mit Hemmschuhen o<strong>der</strong> Radvorlegern muss grundsätzlich für alle abgestellten Wagen o<strong>der</strong><br />
Loks erfolgen, da <strong>der</strong>en Feststellbremsen von außen gelöst werden können. Die Gleissperre sorgt wie<strong>der</strong>um dafür,<br />
dass die Kesselwagen zwangsentgleisen, sollten sie sich ungewollt und ungehin<strong>der</strong>t auf den direkt angrenzenden<br />
Bahnübergang hinbewegen.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 16<br />
Mitarbeiter<br />
intern extern<br />
- 2 Stellwerktechniker/-schlosser - 1 Schienenschweißer<br />
- 1 Maschinist<br />
- 1 Zwei-Wege-Bagger-Führer<br />
- 3 Gleiswerker<br />
- 1 Vorarbeiter<br />
(gleichzeitig Zugführer und<br />
stellvertreten<strong>der</strong> Bauleiter)<br />
alle zusammen insg. 200 Std.<br />
im Einsatz<br />
20 Stöße zu schweißen<br />
Stundenlohn : 30 - 40 € Bezahlung: 70 - 85 € / Stoß<br />
Summe <strong>der</strong> Lohnkosten: 7400 - 9700 €<br />
Tabelle 3: Beschäftigte Mitarbeiter und die damit verbundene Lohnkosten 52<br />
Abbildung 11 und Abbildung 12 auf <strong>der</strong> nächsten Seite zeigen den Schienenschweißer und den<br />
Zwei-Wege-Bagger-Führer bei <strong>der</strong> Arbeit.<br />
52 Da die internen Mitarbeiter, wie oben erwähnt, nicht permanent an <strong>der</strong> Gleisreaktivierung gearbeitet haben, können<br />
die gearbeiteten Stunden nicht jedem einzelnen Mitarbeiter genau zugeordnet werden. Deshalb werden an dieser<br />
Stelle nur die durchschnittlichen Lohnkosten berechnet.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 17<br />
Abbildung 11: Schienenschweißer 53<br />
Abbildung 12: Zwei-Wege-Bagger-Führer 54<br />
53 Die Schienen sind erst befahrbar, wenn sie fest verschweißt sind. Auf dem Foto (23.10.2009) ist zudem zu erkennen,<br />
dass die Gleisjoche nun fest im Schotter liegen, d.h., das „Stopfen“ erfolgreich abgeschlossen ist.<br />
54 Das Foto in Abbildung 12 vom 14.10.2009 zeigt den Zwei-Wege-Bagger und eine Planiermaschine.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 18<br />
2.4 Geeignete Güter für den Umschlag an Freiladegleisen<br />
Grundsätzlich sind zum Umschlagen an Freiladegleisen, wie dem <strong>der</strong> WHE, alle Stückgüter 55 und<br />
solche Güter, für die ein entsprechendes Verladegerät o<strong>der</strong> ein mobiles Umschlaggerät vor Ort vorhanden<br />
ist, geeignet, sofern hierfür die entsprechende Genehmigung <strong>der</strong> zuständigen Behörde vorliegt.<br />
Wie das oben beschriebene Praxisbeispiel zeigt, können mit <strong>der</strong> heutigen Technik, wie dem<br />
FÜLLCOMATEN, auch Gefahrenstoffe und Flüssigladungen, wie Altöl, auf einer vergleichbar geringen<br />
Fläche umgeschlagen werden 56 . Güter, die beim Umschlagen zu Verschmutzungen führen<br />
könnten, wie z.B. stark staubende Güter, eignen sich nicht für ein solches Vorhaben.<br />
Wie in Kapitel 1.1 erwähnt, ist ca. die Hälfte <strong>der</strong> an das Freiladegleis angrenzenden Fläche an die<br />
Karo As vermietet worden. Die an<strong>der</strong>e Hälfte kann jedoch noch für den Umschlag an<strong>der</strong>er Güter<br />
genutzt werden. Nach Angaben von Herrn RECKEL ist das Umschlagen von Gütern aufgrund <strong>der</strong><br />
vergleichsweise geringen Rangierfläche für Fahrzeuge, die entsprechende Güter zum Freiladegleis<br />
bringen, nur dann realisierbar, wenn diese Fahrzeuge über eine eigene Verladevorrichtung verfügen.<br />
Dies ist zum Beispiel bei Lkw‘s von Forstbetrieben <strong>der</strong> Fall, sodass das Umschlagen von Holz eine<br />
mögliche Alternative für die Nutzung <strong>der</strong> Freiladegleisfläche darstellt und daher eventuell in Zukunft<br />
Erfolgspotenziale birgt 57 . Grundsätzlich sind alle Güter für den Umschlag geeignet, welche<br />
mit einer Greifspinne o<strong>der</strong> einem Gabelstapler bewegt werden können 58 , da auch diese Verladegeräte<br />
eine relativ geringe Rangierfläche benötigen.<br />
Zudem besteht die Möglichkeit, dass Gleisanschließer an das Schienennetz <strong>der</strong> WHE ihre Kapazitäten<br />
mit Hilfe dieses Freiladegleises erweitern könnten. Als Beispiel sei hier die Müntefering-<br />
Gockeln Wertstoffrecycling & Containerdienst GmbH genannt, <strong>der</strong>en Gleisanschluss ca. 300 Meter<br />
Luftlinie von dem Freiladegleis <strong>der</strong> WHE entfernt ist 59 .<br />
Als Restriktion für alle möglichen Alternativen gilt jedoch, dass <strong>der</strong> Umschlag jeglicher Güter relativ<br />
schnell vollzogen werden muss 60 , da ansonsten die für diesen Zweck im Freiladegleis stehenden<br />
Wagen die Kesselwagen <strong>der</strong> Karo As blockieren und den Rangieraufwand für die Loks <strong>der</strong> WHE<br />
erheblich steigern würden. Die WHE ist zum einen vertraglich verpflichtet, die Kesselwagen auf<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen schnellstmöglich zum Übergabe-Bahnhof zu bringen. Zum an<strong>der</strong>en ist eine Be-<br />
55 Mit Stückgütern sind hier Güter gemeint, die in einem Stück transportiert werden können, d.h. in Form von Fässern,<br />
Kisten, Paketen o<strong>der</strong> Paletten. Stückgutverkehre sind allerdings sowohl beim Umschlag als auch in <strong>der</strong> Planung<br />
sehr aufwendig, da sie großflächig gesammelt und auch wie<strong>der</strong> verteilt werden müssen. Vgl. BERNDT (2001),<br />
S. 21.<br />
56 Der FÜLLCOMAT und sein SATELLIT messen jeweils ca. acht bis zehn Quadratmeter.<br />
57 Die WHE bekam schon häufig Anfragen für den Umschlag von Holz, die sie bisher auf ihrem betrieblich aktiven<br />
Gleisgelände erfüllt hat. Dies führte jedoch schon zu Störungen des betrieblich geregelten Ablaufs. Daher bietet<br />
sich mit dem nun reaktivierten Freiladegleis die Gelegenheit, solchen Anfragen in Zukunft vollständig zu entsprechen<br />
und das Holz dort ungestört umzuschlagen. Zudem verfügen Sägewerke regelmäßig über Gleisanschlüsse,<br />
weshalb es auch für solche Betriebe strategisch sinnvoll erscheint, das Holz auf <strong>der</strong> Schiene zu transportieren, da<br />
auch hier gilt, dass Lkw‘s weniger Holz transportieren können als bspw. zwei Einzelwagen.<br />
58 Nach Angaben von Herrn RECKEL, ist es durchaus üblich, dass Lkw‘s solche Gerätschaften wie Gabelstapler mit<br />
sich führen.<br />
59 Müntefering-Gockeln recycelt unter an<strong>der</strong>em alte Gleisschwellen, die grundsätzlich per Schiene transportiert werden,<br />
da sich dort, wo sie abmontiert werden, nur Gleisanlagen befinden.<br />
60 Mit „relativ schnell“ ist ein Zeitraum von ca. 24 bis 72 Std. gemeint, da die Kesselwagen planmäßig in einem Intervall<br />
von ca. drei Tagen leer in das Gleis gestellt, befüllt und wie<strong>der</strong> aus dem Gleis heraus gezogen werden müssen.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 19<br />
triebsstunde für eine Lok relativ teuer 61 , weshalb die WHE bei längeren Verweildauern von Wagen<br />
höhere Preise für ihre Dienstleistungen verlangen müsste und dies ein solches Vorhaben, d.h. das<br />
Umschlagen weiterer Güter an dem reaktivierten Freiladegleis neben dem Altölumschlag, dann<br />
gänzlich unrentabel erscheinen lassen könnte. Auch das Umschlagen von Gütern von einem Verkehrsträger<br />
auf einen an<strong>der</strong>en ist eine kostspielige Angelegenheit, weshalb mindestens einer, d.h.<br />
entwe<strong>der</strong> <strong>der</strong> Verla<strong>der</strong> o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Empfänger von Gütern, über einen aktiven Gleisanschluss verfügen<br />
sollte, damit sich ein solches Geschäft tatsächlich finanziell und auch strategisch lohnt 62 . Ob <strong>der</strong><br />
Verla<strong>der</strong> o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Empfänger seinen Sitz o<strong>der</strong> sein Warenlager in Herne und Umgebung hat, ist daher<br />
nicht entscheidend. Entscheidend für die Wahl des Verkehrsträgers Schiene sind das Volumen<br />
<strong>der</strong> zu transportierenden Güter und die Strecke, die diese zurücklegen 63 , sowie das Übereinstimmen<br />
des Dienstleistungsangebots mit dem Anfor<strong>der</strong>ungsprofil des Verla<strong>der</strong>s. So können insbeson<strong>der</strong>e<br />
Verla<strong>der</strong>, <strong>der</strong>en Lieferkonzepte auf die Belieferung von Endverbrauchern zugeschnitten sind, ein<br />
strategisches Interesse daran haben, aus ökonomischer, aber auch ökologischer Sicht auf den Verkehrsträger<br />
Schiene zu setzen. Beispielsweise könnte <strong>der</strong> Verla<strong>der</strong> mit Hilfe von Werbekampagnen<br />
die für den Umweltschutz sensibilisierte Kundschaft erreichen und damit auch die Kundenbindung<br />
steigern 64 . Rein aus ökologischen Beweggründen heraus wäre die Nutzung <strong>eines</strong> Freiladegleises,<br />
wie das <strong>der</strong> WHE, nur dann als realistisch einzustufen, wenn die Umsetzung <strong>eines</strong> solchen Konzepts<br />
zumindest kostenneutral ist.<br />
In jedem Falle muss die Nutzung des Freiladegleises in das jeweilige Logistikkonzept von potenziellen<br />
Kunden o<strong>der</strong> Abnehmern hineinpassen, um ökonomische, ökologische und damit eventuell<br />
auch organisatorische Vorteile zu generieren.<br />
61 Eine Betriebsstunde für eine Diesellok <strong>der</strong> WHE kostet 150 €.<br />
62 Vgl. STIEGELER (2007), S. 45.<br />
63 Vgl. STIEGELER (2007), S. 43.<br />
64 Zum Beispiel könnten Produzenten, wie z.B. Kohlekraftwerke, die während ihrer Produktionsprozesse relativ viele<br />
Emissionen „produzieren“, eine Image-Aufbesserung anstreben, indem sie alle vor- und nachgelagerten Prozesse<br />
so umweltschonend und emissionsneutral wie möglich abwickeln. Nach Angaben von Herrn RECKEL, gibt es im<br />
Umkreis Herne und damit auch in <strong>der</strong> Nähe des Freiladegleises Industriebetriebe und Speditionen mit zur Zeit inaktiven<br />
Gleisanschlüssen, <strong>der</strong>en Reaktivierung ebenfalls kostspielig ist und für die ein solches Szenario eventuell<br />
interessant werden könnte, die im Grunde als Schnittstellen fungieren könnten.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 20<br />
3 SWOT-Analyse zur <strong>Beurteilung</strong> des <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong><br />
3.1 Inhalt <strong>der</strong> SWOT-Analyse<br />
Die SWOT-Analyse bezeichnet die Unterteilung <strong>der</strong> strategischen Analyse in Umwelt- und Unternehmensanalyse<br />
65 o<strong>der</strong> in Chancen-Risiken- bzw. Stärken-Schwächen-Analyse 66 . Dieser Analyseansatz<br />
untersucht sowohl unternehmensinterne als auch -externe Faktoren, um diese einan<strong>der</strong> gegenüberzustellen<br />
und miteinan<strong>der</strong> zu verknüpfen und die entsprechend empfehlenswerten Strategiearten<br />
aufzuzeigen 67 .<br />
Die Umweltanalyse als Teilanalyse <strong>der</strong> SWOT-Analyse lässt sich unterteilen in die Analyse <strong>der</strong><br />
globalen und <strong>der</strong> aufgabenspezifischen Umwelt. Unter <strong>der</strong> globalen Umwelt 68 versteht man die für<br />
ein Unternehmen generell bestehenden Rahmenbedingungen aus <strong>der</strong> ökonomischen, <strong>der</strong> soziokulturellen,<br />
<strong>der</strong> technologischen, <strong>der</strong> politisch-rechtlichen und <strong>der</strong> ökologischen Umwelt 69 . Diese<br />
Rahmenbedingungen stehen in indirektem Bezug zur Unternehmensaufgabe und schränken den<br />
Handlungsspielraum des Unternehmens entscheidend ein. Die aufgabenspezifische Umwelt 70 erfasst<br />
die Branche und den Markt sowie die zur Erfüllung <strong>der</strong> Unternehmensaufgabe relevanten<br />
Umweltelemente, wie z.B. Kunden, Lieferanten und Konkurrenten, aber auch substitutive Produkte<br />
71 . Somit können die aufgabenspezifische Umwelt <strong>der</strong> WHE auch als Branchenumwelt und die<br />
beschriebenen Umweltelemente als „Triebkräfte des Branchenwettbewerbs“ 72 verstanden werden.<br />
In diesem Teil <strong>der</strong> Umweltanalyse gilt es, die relevanten Umweltelemente für die WHE zu identifizieren<br />
und zu analysieren 73 .<br />
Das heißt, mit Hilfe <strong>der</strong> Umweltanalyse werden Entwicklungen <strong>der</strong> Umwelt daraufhin untersucht,<br />
ob sie günstige o<strong>der</strong> ungünstige Entwicklungen für das Unternehmen darstellen. Hier gilt es insbeson<strong>der</strong>e<br />
zu differenzieren, welche Umweltfaktoren tatsächlich für das jeweilige Unternehmen relevant<br />
sind und daher in die Analyse einbezogen werden müssen, weil sie Chancen und Risiken darstellen<br />
und welche Faktoren und Entwicklungen nicht unternehmensspezifisch und daher irrelevant<br />
für die Analyse sind. Zudem ergeben sich aus <strong>der</strong> Umweltanalyse nicht sofort die Chancen und Risiken<br />
des Unternehmens. Erst durch die entsprechende Verknüpfung <strong>der</strong> Ergebnisse bei<strong>der</strong> Analy-<br />
65 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 54.<br />
66 Vgl. SIMON/VON DER GATHEN (2002), S. 214 ff.<br />
67 Vgl. HUNGENBERG (2008), S. 88.<br />
68 Die globale Umwelt wird auch als „generelle o<strong>der</strong> globale Bedingungen“ o<strong>der</strong> „makro environment“, d.h. „Makro-<br />
Umwelt“ bezeichnet. Vgl. BEA/HAAS (2005), S. 90 f.; HUNGENBERG (2008), S. 90 ff.; WELGE/AL-LAHAM (2008),<br />
S. 290.<br />
69 Je nach Ansatz werden die Faktoren, die <strong>der</strong> globalen Umwelt zugerechnet werden, an<strong>der</strong>s benannt o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>s unterteilt.<br />
Vgl. AEBERHARD (1996), S. 45 ff.; BERCHTOLD (1985), S. 22-31; CAMPHAUSEN (2007), S. 33;<br />
GRANT/NIPPA (2008), S. 99; HUNGENBERG (2008), S. 93 ff.; KREIKEBAUM (1997), S. 41 ff.;<br />
LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 99 f.; PÜMPIN (1992), S. 103, 194 f.; SIMON/VON DER GATHEN (2002), S. 219.<br />
In dieser Arbeit wurden die oben genannten Bezeichnungen und Unterteilungen gewählt.<br />
70 Die aufgabenspezifische Umwelt wird auch als „aufgabenspezifische Bedingungen“, als „task environment“ o<strong>der</strong><br />
als „Mikroumwelt“ bezeichnet. Vgl. SIMON/VON DER GATHEN (2002), S. 219; WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 290.<br />
71 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 49; HUNGENBERG (2008), S. 98.<br />
72 Vgl. PORTER (1999), S. 34.<br />
73 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 130 ff.; BEA/HAAS (2005), S. 99 ff.; HUNGENBERG (2008), S. 101 ff.;<br />
LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 101 ff.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 21<br />
sen und die damit verbundene Relativierung <strong>der</strong> Unternehmensstärken und -schwächen, lassen sich<br />
künftige strategische Chancen und Risiken ableiten 74 .<br />
Die Unternehmensanalyse stellt eine Stärken-Schwächen-Analyse <strong>der</strong> WHE dar und wird daher aus<br />
einer unternehmensinternen Perspektive heraus durchgeführt 75 . Ein Beurteiler, <strong>der</strong> die WHE als Unternehmen<br />
sehr gut kennen muss 76 , bewertet das Unternehmen anhand vorgegebener Kriterien im<br />
Vergleich zur Konkurrenz <strong>der</strong> WHE, sodass letztlich Unternehmenspotenziale sowie Stärken und<br />
Schwächen <strong>der</strong> WHE abgeleitet werden können 77 . Hier gilt es insbeson<strong>der</strong>e auf Unternehmensbeson<strong>der</strong>heiten<br />
und unternehmenseigene Ressourcen einzugehen 78 . Für die Darstellung dieser <strong>Beurteilung</strong><br />
kann ein Stärken-Schwächen-Profil erstellt werden 79 .<br />
Die SWOT-Analyse integriert und verknüpft die Umwelt- und die Unternehmensanalyse, um durch<br />
<strong>der</strong>en Gegenüberstellung empfehlenswerte Strategiearten abzuleiten. Die Verknüpfung von unternehmensexterner<br />
und -interner Perspektive soll in einer SWOT-Matrix 80 dargestellt werden. Diese<br />
Vier-Fel<strong>der</strong>-Matrix stellt die Chancen und Risiken und die Stärken und Schwächen <strong>der</strong> WHE jeweils<br />
in Kombination dar. Auf diese Weise können für jede Kombination eigene Strategiearten ermittelt<br />
werden.<br />
3.2 Umweltanalyse als Teilanalyse <strong>der</strong> SWOT-Analyse<br />
3.2.1 Globale Umwelt – Rahmenbedingungen für die <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen<br />
GmbH<br />
Die hier genannten Rahmenbedingen bzw. Segmente <strong>der</strong> globalen Umwelt beziehen sich allgemein<br />
auf den Eisenbahngüterverkehr in Deutschland 81 .<br />
74 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 39; PÜMPIN (1992), S. 105.<br />
75 Vgl. SIMON/VON DER GATHEN (2002), S. 216 f.<br />
76 Als Beurteiler und Ansprechpartner wurde in dieser Arbeit Herr RECKEL gewählt. Er ist bei <strong>der</strong> WHE, wie oben<br />
schon genannt, für Vertrieb und Marketing zuständig. Beson<strong>der</strong>s in diesen Bereichen ist es notwendig, das eigene<br />
Unternehmen, wie auch insbeson<strong>der</strong>e die Konkurrenz <strong>der</strong> WHE zu kennen, um entsprechend agieren zu können.<br />
77 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 42 f.; BEA/HAAS (2005), S. 111 ff.; SIMON/VON DER GATHEN (2002), S. 217.<br />
78 In dieser Arbeit wird bei <strong>der</strong> Unternehmensanalyse größtenteils auf qualitative Daten zurückgegriffen und ein ressourcen-<br />
und kompetenzorientierter Ansatz gewählt, da die WHE als regionales EVU ihre Stärken größtenteils aus<br />
regionalen Ressourcen (Schieneninfrastruktur) und spezifischen Kompetenzen (z.B. Know-how) bezieht. Die klassischen<br />
und wertorientierten Ansätze werden aus diesem Grund größtenteils vernachlässigt. Vgl. HUNGENBERG<br />
(2008), S. 141; LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 142 f.; WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 353 ff.<br />
79 Vgl. SIMON/VON DER GATHEN (2002), S. 118.<br />
80 Vgl. SIMON/VON DER GATHEN (2002), S. 220 f.<br />
81 Die Einschränkung wird an dieser Stelle vorgenommen, da die Betrachtung <strong>der</strong> globalen Umwelt aller Unternehmen<br />
und aller internationalen Rahmenbedingungen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Aus diesem Grund<br />
wird hier nur auf die wesentlichen globalen Rahmenbedingen für den deutschen Eisenbahngüterverkehr eingegangen.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 22<br />
a) (Makro-)Ökonomische Umwelt<br />
Zu den (makro-)ökonomischen Aspekten zählen vor allem die nationalen und internationalen wirtschaftlichen<br />
Entwicklungen, die sowohl vergangenheits- als auch zukunftsbezogen sein können 82 .<br />
Der Güterverkehr allgemein und damit auch <strong>der</strong> Eisenbahngüterverkehr hängen stark ab von <strong>der</strong><br />
weltweiten und nationalen Wirtschaftslage, insbeson<strong>der</strong>e von <strong>der</strong> volkswirtschaftlichen Produktions-<br />
und Handelstätigkeit 83 .<br />
Da <strong>der</strong> Güterverkehr nur im vollen Ausmaß getätigt werden kann, wenn die nötige Infrastruktur gegeben<br />
ist, wird bei steigen<strong>der</strong> Produktionstätigkeit und damit steigendem Güterverkehrsaufkommen<br />
auch ein Ausbau <strong>der</strong> landesweiten Verkehrsinfrastruktur nötig. Der Bund hat daher für den Ausbau<br />
und Erhalt <strong>der</strong> Verkehrsinfrastruktur in den Jahren 2006 bis 2010 Investitionen in Höhe von rund 57<br />
Mrd. Euro 84 eingeplant.<br />
Im Zuge <strong>der</strong> Weltwirtschafts- und Finanzkrise (Beginn: 2007) hat sich die deutsche Wirtschaftslage<br />
jedoch stark verschlechtert 85 , was auch negative Auswirkungen auf die Auftragslage des Eisenbahngüterverkehrs<br />
hatte, da diese Krise viele Produktionssektoren, insbeson<strong>der</strong>e das verarbeitende<br />
Gewerbe und die Industrie, stark getroffen hat 86 . So ist das Transportaufkommen in Deutschland im<br />
Jahr 2009 gegenüber dem Jahr 2008 um vier Mrd. Tonnen gesunken, was einen Rückgang von 11,2<br />
Prozent darstellt 87 .<br />
Um den Auswirkungen <strong>der</strong> Wirtschaftskrise entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung unter an<strong>der</strong>em<br />
die Konjunkturprogramme I und II 88 beschlossen. Diese sehen vor, dass <strong>der</strong> Bund vier Mrd.<br />
€ mehr für den Ausbau und Erhalt <strong>der</strong> Verkehrsinfrastruktur in den Jahren 2009 und 2010 zur Verfügung<br />
stellt 89 . Allerdings werden ab 2009, prozentual gesehen, weniger Investitionen für den Ausbau<br />
und Erhalt <strong>der</strong> Schieneninfrastruktur getätigt als für Bundesfernstraßen. Dies wird mit Hilfe von<br />
Tabelle 4 auf <strong>der</strong> nächsten Seite dargestellt.<br />
82 Zu <strong>der</strong> ökonomischen Umwelt gehören bspw. Aspekte wie die Entwicklung <strong>der</strong> Einkommen und <strong>der</strong>en Verwendung,<br />
das Wirtschaftswachstum, die konjunkturelle Entwicklung, die Arbeitslosenquote, das Lohn-/Gehaltsniveau,<br />
aber auch Aspekte wie die Infrastruktur einer Volkswirtschaft und die Entwicklung <strong>der</strong> für die WHE relevanten<br />
Märkte. Vgl. AEBERHARD (1996), S. 46; HUNGENBERG (2008), S. 94; LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 99 f.;<br />
STEINMANN/SCHREYÖGG (2005), S. 179; WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 293.<br />
83 Vgl. ABERLE (2003), S. 9.<br />
84 Vgl. BMVBS (2007), S. 6.<br />
85 Vgl. DESTATIS (2009a).<br />
86 Vgl. DESTATIS (2010a). Die Ursachen für die Weltwirtschafts- und Finanzkrise und <strong>der</strong>en Auswirkungen werden<br />
in dieser Arbeit nicht genau erläutert. Vergleiche hierzu EZB (2009), S. 166 f. Für Auswirkungen <strong>der</strong> Wirtschaftskrise<br />
auf den Eisenbahngüterverkehr vergleiche DESTATIS (2009b), S. 2. Für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt<br />
und das Lohnniveau siehe u.a. DESTATIS (2009c).<br />
87 Vgl. DESTATIS (2010b).<br />
88 Konjunkturprogramm I: „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“, Konjunkturprogramm II: „Entschlossen<br />
in <strong>der</strong> Krise, stark für den nächsten Aufschwung“. Vgl. BMWI/BMF (2008); BMWI (2010).<br />
89 Vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG (2010a), S. 21.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 23<br />
Finanzplanung des Bundes für die Verkehrsinfrastruktur<br />
Finanzplanung des<br />
Bundes 2006-2010<br />
[Mrd. €]<br />
2006-2010<br />
Investitionen in die<br />
Infrastruktur (in %)<br />
Arbeitsplatzprogramm<br />
Verkehr für 2009-2010<br />
[Mrd. €]<br />
2009-2010<br />
Investitionen in die<br />
Infrastruktur (in %)<br />
Finanzplanung des<br />
Bundes 2011-2012<br />
[Mrd. €]<br />
2011-2012<br />
Investitionen in die<br />
Infrastruktur (in %)<br />
Bundesschienenwege <br />
Bundesfernstraßen <br />
Bundeswasserstraßen<br />
Tabelle 4: Finanz- und Investitionsplanung des Bundes für den Ausbau<br />
und Erhalt <strong>der</strong> Verkehrsinfrastruktur 90<br />
Nach Schätzungen aus <strong>der</strong> Transport- und Logistikbranche soll es seit Beginn 2010 jedoch wie<strong>der</strong><br />
einen Aufwärtstrend im Bezug auf die Geschäftslage für Güterverkehrsunternehmen geben 91 . Ob<br />
dies positiv zu bewerten ist, bleibt für ein Unternehmen, das in <strong>der</strong> Logistikbranche tätig ist und daher<br />
insbeson<strong>der</strong>e für ein EVU, noch abzuwarten, da sich die Preise trotz leicht steigen<strong>der</strong> Nachfrage<br />
noch nicht angepasst o<strong>der</strong> erhöht haben.<br />
90 Vgl. BMVBS (2007), S. 6; BMVBS (2009), S. 6 ff.; DEUTSCHER BUNDESTAG (2010b).<br />
Summe<br />
28 22,9 6,1 57<br />
49,1 40,2 10,7 100<br />
8,2 9,4 2,1 19,7<br />
41,6 47,7 10,7 100<br />
7,8 9,7 1,8 19,3<br />
40,4 50,3 9,3 100<br />
91 Vgl. SCI (2010). Auch Herr RECKEL hat während des Interviews erwähnt, dass die Auftragslage bei <strong>der</strong> WHE seit<br />
Beginn des Jahres 2010 wie<strong>der</strong> wesentlich besser ausfallen würde, und zwar im Vergleich zum gesamten Jahr<br />
2009.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 24<br />
b) Ökologische Umwelt<br />
Die ökologische Umwelt umfasst alle Aspekte, die die natürliche Umwelt betreffen und damit zum<br />
Beispiel die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen, wie Energie und Rohstoffe, sämtliche den Umweltschutz<br />
betreffende Strömungen, wie das Umweltbewusstsein einer Gesellschaft und gesetzliche<br />
Umweltschutzmaßnahmen sowie die daraus entstehenden rechtlich und gesellschaftlich vorgegebenen<br />
Verpflichtungen, die die Unternehmensführung beeinflussen 92 . Diese Verpflichtungen stellen<br />
zunächst grundsätzlich Restriktionen dar, können jedoch auch zum Ausschöpfen von Erfolgspotenzialen<br />
dienen, sofern ein Unternehmen einer umweltbewussten Gesellschaft verdeutlichen o<strong>der</strong><br />
eventuell auch nur suggerieren kann, dass es nicht nur aus rein wirtschaftlichen o<strong>der</strong> effizienztechnischen<br />
Gründen umweltschonend handelt, son<strong>der</strong>n vielmehr bewusst Verantwortung zeigt, um beispielsweise<br />
neue Kunden zu gewinnen o<strong>der</strong> stärkere Kundenbindung zu erlangen 93 .<br />
Das Umweltbewusstsein in <strong>der</strong> deutschen Gesellschaft ist in den letzen Jahren o<strong>der</strong> Jahrzehnten<br />
deutlich gestiegen 94 . Konsumenten achten heutzutage beispielsweise darauf, umweltverträgliche<br />
Produkte zu kaufen o<strong>der</strong> treffen ihre Kaufentscheidung für ein Produkt danach, inwieweit das dahinterstehende<br />
Unternehmen sich bemüht, Umweltverschmutzungen, wie z.B. die Luftverschmutzung,<br />
zu reduzieren o<strong>der</strong> sogar zu vermeiden 95 . Beson<strong>der</strong>s Luftverschmutzung wird als großes<br />
Umweltproblem angesehen 96 , wofür die Gesellschaft insbeson<strong>der</strong>e den Verkehr 97 und damit auch<br />
den Güterverkehr verantwortlich macht. Daher ist anzunehmen, dass eine Verlagerung von Güterverkehren<br />
von <strong>der</strong> Straße auf die Schiene gesellschaftlich gefor<strong>der</strong>t wird, da sie, sofern effizient<br />
umgesetzt, Umweltbelastungen verringern kann. Dies kann wie<strong>der</strong>um dazu führen, dass sich die<br />
Marktverhältnisse im Bereich Gütertransport/-verkehr zukünftig än<strong>der</strong>n 98 .<br />
c) Politisch-rechtliche Umwelt<br />
Die politisch-rechtliche Umwelt umfasst alle Rahmenbedingungen, die von staatlicher Seite o<strong>der</strong><br />
Körperschaften mit Hoheitsgewalt und <strong>der</strong>en Aktivitäten ausgehen und die für ein Unternehmen<br />
verbindlich sind 99 . Hierzu gehören die staatliche Gesetzgebung sowie rechtliche Normen und Verordnungen,<br />
aber auch die Rechtshandhabung, wie z.B. die Dauer von Genehmigungsverfahren, sowie<br />
die politische Stabilität, die Subventionspolitik und die Einflussnahme supranationaler Instituti-<br />
92 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 48; HUNGENBERG (2008), S. 96 f.; PÜMPIN (1992), S. 194. Um das Ausmaß dieser<br />
Verpflichtungen zu verdeutlichen, sei hier erwähnt, dass im Jahre 2006 durch das produzierende und verarbeitende<br />
Gewerbe allein ca. 3,5 Mrd. € in den Umweltschutz investiert wurden. Vergleiche hierzu DESTATIS (2010c).<br />
93 Vgl. LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 99 f.; STEINMANN/SCHREYÖGG (2005), S. 183.<br />
94 Vgl. DESTATIS (2008), S. 28.<br />
95 Nach Angaben von Frau ANTER hat sich die Karo As dem Umweltschutz verpflichtet, was sich schon allein an ihrem<br />
Firmennamen erkennen lässt. Frau ANTER ist bei <strong>der</strong> Karo As unter an<strong>der</strong>em verantwortlich für die Planung<br />
des Transports von Altöl und Altölemulsionen mit Hilfe von Kesselwagen. Das beson<strong>der</strong>e Interesse <strong>der</strong> Karo As<br />
besteht darin, möglichst viele Güterverkehre von Altöl über die Schiene abzuwickeln, d.h., den Güterverkehr von<br />
<strong>der</strong> Straße auf die Schiene zu verlagern.<br />
96 Vgl. FARMER/STADLER (2005), S. 19.<br />
97 Vgl. OECD (2008), S. 178.<br />
98 Der gesellschaftliche Druck auf Produzenten wird hier allerdings höher eingeschätzt, wenn dieser für Endkonsumenten<br />
produziert. Liefert er nur ein Zwischenprodukt für einen weiteren Produzenten, ist er angehalten, die günstigste<br />
Transportalternative zu wählen. Dass <strong>der</strong> Transport über die Schiene ökologischer sein kann, soll an dieser<br />
Stelle nicht ausschließen, dass er außerdem noch wirtschaftlich effizienter sein kann.<br />
99 Vgl. LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 99 f.; PÜMPIN (1992), S. 195; STEINMANN/SCHREYÖGG (2005), S. 181.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 25<br />
onen, wie z.B. <strong>der</strong> Europäischen Union (EU) mit ihren Richtlinien, auf die nationale Gesetzgebung<br />
100 .<br />
Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens vom 27. Dezember 1993 ist eine Bahnreform<br />
auf den Weg gebracht worden, die die Liberalisierung des deutschen Eisenbahnmarktes zum<br />
Ziel hatte 101 . Das Gesetz ist die Umsetzung <strong>der</strong> EG-Richtlinie 91/440/EWG zur Entwicklung <strong>der</strong><br />
Eisenbahnunternehmen <strong>der</strong> Gemeinschaft vom 29. Juli 1991 in deutsches Recht 102 . Die Liberalisierung<br />
sieht die Unabhängigkeit von Eisenbahnunternehmen von staatlichen Einflüssen vor, was in<br />
Deutschland die Privatisierung <strong>der</strong> Deutschen Bahn AG zur Folge hatte, die Öffnung <strong>der</strong> Schienennetze<br />
für Dritte, d.h. in Deutschland für private EVU, sowie die Trennung <strong>der</strong> Eisenbahninfrastruktur<br />
vom Transportbereich. Dies sollte letztlich den Wettbewerb unter den EVU för<strong>der</strong>n. Das<br />
Trasportrechtsreformgesetz (TRG) des Deutschen Bundestages vom 25. Juni 1998 hat anschließend<br />
alle vorher geltenden unterschiedlichen Güterverkehrsrichtlinien außer Kraft gesetzt und alle<br />
„Frachtführer“ dem Handelsgesetzbuch (HGB) unterworfen, sodass Wettbewerbsnachteile zwischen<br />
den Beför<strong>der</strong>ungsarten auf Binnengewässern, in <strong>der</strong> Luft o<strong>der</strong> auf Schiene und Straße beseitigt<br />
wurden 103 .<br />
In Deutschland gilt das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) für alle Eisenbahnen 104 . Die zusätzlichen<br />
acht Verordnungen regeln die im AEG nicht abgehandelten Detailaspekte 105 . Die Aufsicht<br />
über alle EVU haben die Bundesnetzagentur und das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 106 .<br />
Gleisreaktivierungen, die auch im Sinne des § 11 AEG als Gleisreaktivierungen gelten, gestalten<br />
sich, aufgrund langwierigerer bürokratischer Genehmigungsverfahren, aufwändiger als eine reine<br />
Gleissanierung (s.o.). Für Gleissanierungen müssen keine Genehmigungen vom EBA eingeholt<br />
werden, da das Gleis in diesem Fall nicht abgemeldet wurde. Eine betriebliche Sanierung bedarf lediglich<br />
<strong>eines</strong> Wie<strong>der</strong>ufs <strong>der</strong> Bau- und Betriebsanweisung durch den Eisenbahnbetriebsleiter und <strong>der</strong><br />
entsprechenden baulichen und technischen Sanierungsmaßnahmen. Ist ein Gleis jedoch einmal mit<br />
Genehmigung des EBA entwidmet worden und hat daher ein entsprechend langwieriges Entwidmungsverfahren<br />
durchlaufen (ca. sechs Monate), ist für die später wie<strong>der</strong> einzuleitende Reaktivierung<br />
ein ebenso langwieriges Verfahren zur Wie<strong>der</strong>anmeldung und Wie<strong>der</strong>abnahme des reaktivierten<br />
Gleises nötig.<br />
100 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 48; HUNGENBERG (2008), S. 93 f.; WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 292 f.<br />
101 Vgl. ENEUOG (1993).<br />
102 Vgl. EUROPÄISCHER RAT (1991).<br />
103 Vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG (1998).<br />
104 Vgl. AEG (2009).<br />
105 Zu den Verordnungen zählen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO), die Eisenbahn-Signal-ordnung<br />
(ESO), die Eisenbahn-Sicherheitsverordnung (ESiV), die Eisenbahninfrastruktur-Benutzungs-verordnung (EIBV),<br />
die Eisenbahnbetriebsleiterverordnung (EBV), die Eisenbahnunter-nehmer-Berufs-zugangsverordnung (EBZugV),<br />
die Eisenbahnhaftpflichtversicherungsverordnung (EBHaftPflV) und schließlich die Transeuropäische-Eisenbahn-<br />
Interoperabilitätsverordnung (TEIV). Diese Verordnungen sind alle zu finden auf <strong>der</strong> Homepage des Bundesministeriums<br />
<strong>der</strong> Justiz, vgl. BMJ (2010).<br />
106 Vgl. §§ 14, 4-7 f. AEG.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 26<br />
d) Sozio-kulturelle Umwelt<br />
Mit <strong>der</strong> sozio-kulturellen Umwelt 107 sind all jene Rahmenbedingungen, die ihren Ursprung in <strong>der</strong><br />
Gesellschaft einer Volkswirtschaft haben gemeint. Ein Unternehmen ist allgemeinen gesellschaftlichen<br />
Einflüssen unterworfen, da es in Beziehungen zu den Menschen in <strong>der</strong> Gesellschaft steht 108 .<br />
Zu diesen Einflüssen gehören insbeson<strong>der</strong>e die Wertvorstellungen, Einstellungen und Verhaltensweisen<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft und <strong>der</strong>en Wandel mit <strong>der</strong> Zeit 109 . Ein Unternehmen muss auf die gesellschaftlichen<br />
Werte entsprechend reagieren und die Einflüsse <strong>eines</strong> eventuellen Wertewandels abschätzen<br />
können, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.<br />
Innerhalb <strong>der</strong> Gesellschaft Deutschlands hat sich in den letzten Jahren, wie auch schon im Absatz<br />
zur ökologischen Umwelt beschrieben, die Einstellung zum Umweltschutz verän<strong>der</strong>t und die Menschen<br />
sind nicht nur bereit, ihrerseits etwas für den Umweltschutz zu tun, son<strong>der</strong>n erwarten auch<br />
von den Unternehmen, dass diese die Umwelt schonen und nachhaltig wirtschaften 110 . Für EVU<br />
bietet sich daher die Gelegenheit, die auf diese Art sensibilisierten Kunden für sich zu gewinnen<br />
und in das eigene Kundenportfolio aufzunehmen, da <strong>der</strong> Transport über die Schiene, bei entsprechenden<br />
Mengen und Strecken, nicht nur wirtschaftlich effizient, son<strong>der</strong>n auch umweltschonen<strong>der</strong><br />
ist als <strong>der</strong> Straßentransport 111 .<br />
e) Technologische Umwelt<br />
Die technologische Umwelt umfasst alle technologischen Entwicklungen, die ein Unternehmen betreffen,<br />
wie z.B. Verän<strong>der</strong>ungen von Produkt- o<strong>der</strong> Verfahrenstechnologien o<strong>der</strong> auch Entwicklungen<br />
in <strong>der</strong> Informations- und Kommunikationstechnologie 112 . Auch hier gilt für die dauerhafte<br />
Wettbewerbsfähigkeit <strong>eines</strong> Unternehmens, dass es die technologischen Entwicklungstrends frühzeitig<br />
erkennt, um mit seinen Wettbewerbern schritthalten zu können, und sich entsprechend Zeit<br />
sichert, um auf solche Entwicklungen zu reagieren und sich mit neuen Technologien ausstatten zu<br />
können 113 .<br />
Viele Kunden von Verkehrsunternehmen haben das Bedürfnis zu wissen, wo sich ihre Waren zu einem<br />
bestimmten Zeitpunkt befinden 114 . Oft ist dies ein Grund dafür, dass Kunden den Transport<br />
über die Straße dem Transport über die Schiene vorziehen, da sich Lkw heutzutage über das sog.<br />
107 Die sozio-kulturelle Umwelt wird auch als gesellschaftliche Umwelt bezeichnet. Sie wird teilweilweise noch weiter<br />
unterteilt in kulturelle und sozio-demografische Faktoren. Vgl. CAMPHAUSEN (2007), S. 34; HUNGENBERG<br />
(2008), S. 94.<br />
108 Zu diesen Menschen zählen vor allem Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden, aber auch die Allgemeinheit sowie die<br />
Medien und die Presse, die als Sprachrohr <strong>der</strong> Allgemeinheit fungieren. Vgl. HUNGENBERG (2008), S. 94.<br />
109 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 46; HUNGENBERG (2008), S. 95; LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 99;<br />
STEINMANN/SCHREYÖGG (2005), S. 181; WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 294 f. Beispielsweise gehören zu den gesellschaftlichen<br />
Einflüssen die Arbeitsmentalität, das Bildungswesen, die demografische Entwicklung und auch die<br />
Einstellungen <strong>der</strong> Gesellschaft zum Umweltschutz und zum nachhaltigen Wirtschaften.<br />
110 Vgl. DESTATIS (2008), S. 32 f. Die Sensibilisierung <strong>der</strong> Gesellschaft für den Umweltschutz hat Auswirkungen<br />
auf das Konsumverhalten <strong>der</strong> Menschen und wirkt sich daher indirekt auf Unternehmensentscheidungen aus.<br />
111 Vgl. HENKE (2009), S. 13.<br />
112 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 46; HUNGENBERG (2008), S. 94; PÜMPIN (1992), S. 194; WELGE/AL-LAHAM (2008), S.<br />
295.<br />
113 Vgl. LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 99 f.; STEINMANN/SCHREYÖGG (2005), S. 179 f.<br />
114 Herr RECKEL erwähnte dies in dem geführten Interview.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 27<br />
Global Positioning System (GPS) leicht orten lassen. Rein technisch betrachtet kann man auch einzelne<br />
Eisenbahnwagen mit GPS-Peilsen<strong>der</strong>n versehen, sodass auch hier in Zukunft die Position <strong>der</strong><br />
Waren kontrolliert werden kann. Es ist daher möglich, dass eine solche Technologie im Eisenbahngüterverkehr<br />
in Zukunft mehr und mehr zum Einsatz kommt, um den Kunden eine zusätzliche Service-Leistung<br />
zu bieten 115 .<br />
Zudem hat die Alstom Lokomotiven Service GmbH eine Hybrid-Lokomotive mit dieselelektrischem<br />
Antrieb entwickelt, die einen um 40 Prozent geringeren Energieverbrauch gegenüber<br />
herkömmlichen Loks verzeichnen soll 116 . Vor dem Hintergrund, dass Kosteneinsparungsmöglichkeiten<br />
mit Hilfe einer solchen Technologieentwicklung für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit<br />
von EVU entscheidend sein können, sind brancheninterne Unternehmen angehalten, eine solche<br />
Entwicklung zu verfolgen, um eventuell daran partizipieren zu können.<br />
Abbildung 13 stellt die eben erläuterten Rahmenbedingungen <strong>der</strong> globalen Umwelt grafisch zusammengefasst<br />
dar.<br />
technologische Umwelt<br />
Möglichkeit GPS in den Eisenbahnverkehr<br />
einzubinden<br />
Hybrid-Lokomotiven<br />
115 Vgl. BERNDT (2001), S. 194-199.<br />
116 Vgl. ARNDT (2009).<br />
ökologische Umwelt<br />
Steigerung des Umweltbewusstseins<br />
in <strong>der</strong> deutschen Gesellschaft<br />
Luftverschmutzung als beson<strong>der</strong>s<br />
groß angesehenes Umweltproblem<br />
(makro-)ökonomische Umwelt<br />
Infrastruktur - Investitionspläne<br />
des Bundes<br />
negative Auswirkungen <strong>der</strong><br />
Weltwirtschafts- und Finanzkrise<br />
Konjunkturpaket I<br />
WHE<br />
Konjunkturpaket II<br />
WHE<br />
aufgabenspezifische Umwelt<br />
globale Umwelt<br />
Abbildung 13: Globale Umwelt 117<br />
117 Die Abbildung wurde erstellt in Anlehnung an WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 293.<br />
politisch-rechtliche Umwelt<br />
Liberalisierung des Eisenbahnmarktes<br />
Eisenbahn - Bau- und Betriebsordnung<br />
sozio-kulturelle Umwelt<br />
Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Einstellung zum<br />
Umweltschutz<br />
Entwicklung umweltbewusster<br />
Konsumenten
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 28<br />
3.2.2 Aufgabenspezifische Umwelt<br />
3.2.2.1 Branchenstruktur: Identifikation <strong>der</strong> Wettbewerbskräfte<br />
Ein in Herne und Umgebung ansässiges EVU in <strong>der</strong> Eisenbahngüterverkehrsbranche, wie die WHE,<br />
sieht sich zum einen mit einer Netzindustrie 118 konfrontiert, zum an<strong>der</strong>en mit Wettbewerbern, die<br />
auf demselben Markt o<strong>der</strong> in <strong>der</strong>selben Branche tätig sind. Der Wettbewerb innerhalb einer Branche<br />
hängt von <strong>der</strong> Branchenstruktur und <strong>der</strong> Stärke <strong>der</strong> fünf grundlegenden Wettbewerbskräfte 119 ab,<br />
die im Folgenden identifiziert und analysiert werden. Dabei wird die Aufmerksamkeit in dieser Arbeit<br />
auf <strong>der</strong> Konkurrenzanalyse potenzieller und existieren<strong>der</strong> Wettbewerber sowie <strong>der</strong> Analyse von<br />
Substitut-Wettbewerbern und <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Verhandlungsmacht von Lieferanten und Abnehmern<br />
gerichtet 120 . Auf die Analyse <strong>der</strong> Verhandlungsmacht von Arbeitnehmern und des Einflusses staatlicher<br />
Maßnahmen wird dagegen verzichtet 121 .<br />
a) Potenzielle Wettbewerber für die WHE<br />
Der Eintritt potenzieller Konkurrenten in den für die WHE relevanten Markt führt zu einer Erhöhung<br />
<strong>der</strong> Kapazitäten in <strong>der</strong> Eisenbahngüterverkehrsbranche und zu einem tendenziell sinkenden<br />
Preisniveau, was sich wie<strong>der</strong>um negativ auf die Attraktivität <strong>der</strong> Branche auswirkt 122 . Die Branchenattraktivität<br />
ist daher umso höher, je weniger das Risiko besteht, dass neue Konkurrenten einen<br />
Markteintritt wagen. Die Gefahr <strong>eines</strong> Markteintritts durch neue Wettbewerber hängt von den existierenden<br />
Markteintrittsbarrieren und den Reaktionen <strong>der</strong> branchenansässigen Wettbewerber ab 123 .<br />
Eine <strong>der</strong> Markteintrittsbarrieren in den Eisenbahngüterverkehrsmarkt stellen die hohen Anschaffungspreise<br />
für Rollmaterialien und die geringe Verfügbarkeit von Güterwagen für Wettbewerber<br />
aus dem privaten Sektor dar 124 . Zwar gibt es Vermietungsgesellschaften, die für bestimmte Branchen<br />
125 Wagen aus ihrem Fuhrpark zur Verfügung stellen können und auch öffentliche EVU vermieten<br />
grundsätzlich Güterwagen 126 , allerdings bleibt hier anzunehmen, dass dieses Angebot nicht<br />
für Wettbewerbsverkehre gilt.<br />
Auch <strong>der</strong> Zugang zur Schieneninfrastruktur für die Durchführung von Einzelwagenverkehren, wie<br />
sie auch die WHE abwickelt, gestaltet sich als schwierig, da sich die Trassenvergabe, nach Angaben<br />
von Wettbewerbern <strong>der</strong> Deutschen Bahn AG gegenüber <strong>der</strong> Monopolkommission, auf dem Netz <strong>der</strong><br />
DB Netz AG regelmäßig als problematisch erweist, weil ein Großteil an Netzkapazitäten oft schon<br />
118 Vgl. SCHULZE (2006), S. 46 f.<br />
119 Vgl. PORTER (2008), S. 35.<br />
120 Vgl. AEBERHARD (1996), S. 49; CAMPHAUSEN (2007), S. 38 ff.; HUNGENBERG (2008), S. 102 ff.;<br />
LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 101 ff.; MACHARZINA/WOLF (2008), S. 311 f.; PORTER (2008), S. 36 ff.;<br />
STEINMANN/SCHREYÖGG (2005), S. 191 ff.; WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 301 ff.<br />
121 Vgl. LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 105; STEINMANN/SCHREYÖGG (2005), S. 201.<br />
122 Vgl. HUNGENBERG (2008), S. 103; LOMBRISER/ABPLANALP (2005), S. 101. Siehe auch Kapitel 3.2.1.<br />
123 Vgl. PORTER (2008), S. 39 ff. PORTER zählt zu den wesentlichen Ursprüngen von Eintrittsbarrieren die folgenden:<br />
Betriebsgrößenersparnisse, Produktdifferenzierung, Kapitalbedarf, Umstellungskosten, Zugang zu Vertriebskanälen<br />
und staatliche Politik.<br />
124 Vgl. VORRATH (2008), S. 8.<br />
125 Vgl. VORRATH (2008), S. 8. Hierzu zählen Güterwagen für „die chemische Industrie, die Mineralölwirtschaft, den<br />
kombinierten Verkehr (KV) und den Automotive-Bereich“. Das Angebot an offenen Wagen ist jedoch gering.<br />
126 Vgl. BERNDT (2001), S. 147.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 29<br />
an Tochtergesellschaften <strong>der</strong> Deutschen Bahn AG im Vorhinein vergeben wird und Wettbewerber<br />
erst im Anschluss in den Fahrplan aufgenommen werden 127 . Die WHE als öffentliche Eisenbahn ist<br />
zwar gegen ein gewisses Entgelt ebenfalls verpflichtet, potenziellen Dritten Zugang zu ihrer Schieneninfrastruktur<br />
zu gewähren. Allerdings ist auch dies, aus rein wirtschaftlicher Perspektive betrachtet,<br />
kostspieliger als die Beauftragung <strong>der</strong> WHE, da die DB Schenker Rail GmbH auf dem<br />
Schienennetz <strong>der</strong> DB Netz AG mit Elektroloks fährt. Das Weiterfahren mit solchen Loks ist ab dem<br />
Übergabe-Bahnhof <strong>Wanne</strong>-Eickel Hbf nicht möglich, weil das Schienennetz <strong>der</strong> WHE nicht über<br />
entsprechende Oberleitungen verfügt und die WHE die Zustellung von Einzelwagen daher mit Dieselloks<br />
vollzieht. Deshalb handelt es sich bei <strong>der</strong> Schieneninfrastruktur <strong>der</strong> WHE regional und <strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> DB Netz AG überregional um ein natürliches Monopol mit irreversiblen Kosten 128 .<br />
Aufgrund <strong>der</strong> oben genannten Markteintrittsbarrieren dürfte die Bedrohung <strong>der</strong> WHE durch potenzielle<br />
Wettbewerber auf dem Eisenbahngüterverkehrsmarkt relativ gering ausfallen.<br />
Allerdings können potenzielle Wettbewerber auch, statt aus dem intramodalen Wettbewerb, aus<br />
dem intermodalen Wettbewerb einen Zutritt auf den regionalen Güterverkehrsmarkt wagen. So<br />
könnten zum Beispiel Substitut-Wettbewerber, wie Speditionsunternehmen, über die Straßeninfrastruktur<br />
regional ansässige Abnehmer bedienen, die entwe<strong>der</strong> schon über einen Gleisanschluss an<br />
das Schienennetz <strong>der</strong> WHE verfügen o<strong>der</strong> in Zukunft bereit wären, ein Freiladegleis <strong>der</strong> WHE gegen<br />
ein entsprechendes Entgelt zu nutzen. Insbeson<strong>der</strong>e Lkw-Speditionen können das Straßeninfrastrukturnetz<br />
stets befahren, sofern auf Autobahnen eine entsprechende Maut bezahlt und erlaubte<br />
Fahrzeiten eingehalten werden. Ortsansässige Abnehmer verfügen in <strong>der</strong> Regel jeweils über einen<br />
Straßenanschluss und können daher auch problemlos per Straße erreicht und von Lkw beliefert<br />
werden, sofern entsprechende Fahrzeuge für den Gütertransport jeglicher Art zur Verfügung stehen.<br />
Die WHE kann in diesem Fall nur über ihre potenzielle Reaktion Wettbewerber abschrecken, indem<br />
sie beispielsweise günstigere Preise und bessere Service-Leistungen anbietet o<strong>der</strong> eventuell durch<br />
den umweltschonenden Charakter des Schienentransports Image-Vorteile für ihre Abnehmer sichert.<br />
Das Verhalten <strong>der</strong> WHE gegenüber potenziellen regionalen Wettbewerbern kann <strong>der</strong>en<br />
Markteintritt verhin<strong>der</strong>n.<br />
b) Existierende Wettbewerber neben <strong>der</strong> WHE 129<br />
Existierende Wettbewerber sind solche, die bereits am Markt auftreten und daher einen direkten<br />
Einfluss auf den (Preis-)Wettbewerb innerhalb einer Branche haben und diesen aktiv mitgestalten<br />
130 .<br />
Überregional kann die DB Schenker Rail GmbH als Wettbewerber genannt werden, insbeson<strong>der</strong>e<br />
da es sich bei dieser Gesellschaft und dem dazugehörigen Konzern um den Branchenführer im Eisenbahngüterverkehr<br />
handelt. Die WHE strebt mit einem so großen Wettbewerber wie <strong>der</strong> DB<br />
Schenker Rail GmbH keinen konkreten Wettbewerb an, da sie diesem kaum etwas entgegenzuset-<br />
127 Vgl. MONOPOLKOMMISSION (2007), S. 66.<br />
128 Solche natürlichen Monopole mit irreversiblen Kosten werden auch als „monopolistische Bottlenecks“ bezeichnet.<br />
Vergleiche hierzu KNIEPS (2009), S. 14.<br />
129 Die Angaben in diesem und dem folgenden Abschnitt beziehen sich, sofern nicht mit an<strong>der</strong>en Verweisen kenntlich<br />
gemacht, auf Aussagen von Herrn RECKEL, <strong>der</strong> als Vertreter <strong>der</strong> WHE die Wettbewerber und Kunden <strong>der</strong> WHE<br />
konkret benennen kann. Zudem wurde seine Expertenmeinung für die Einschätzung <strong>der</strong> Verhandlungsmacht <strong>der</strong><br />
Abnehmer und <strong>der</strong> Rivalität <strong>der</strong> Wettbewerber zu Rate gezogen.<br />
130 Vgl. PORTER (2008), S. 51 ff.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 30<br />
zen hat und daher keinen Preis- o<strong>der</strong> Produktwettbewerb führen will und kann. Vielmehr verfolgt<br />
die WHE in diesem Falle, wie auch viele an<strong>der</strong>e private o<strong>der</strong> regionale Bahnen eine Nischenstrategie,<br />
indem sie z.B. Kunden bedient, die für die DB Schenker Rail GmbH aufgrund zu geringer<br />
Mengen uninteressant sind. Auch an<strong>der</strong>e Anbieter, die über eine größere Anzahl an Elektroloks verfügen,<br />
stellen Konkurrenten für die WHE dar, mit denen die WHE jedoch nicht konkurrieren kann<br />
und möchte, da diese Anbieter, wie auch die DB Schenker Rail GmbH, größere Strecken mit ihren<br />
Loks zurücklegen können, als es die WHE mit ihren Dieselloks aufgrund <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit<br />
vermag.<br />
An<strong>der</strong>e regionale Bahnen im Umkreis von Herne und im näheren Ruhrgebiet, wie z.B. die<br />
Bocholter Eisenbahngesellschaft mbH, die Duisport Rail GmbH, die Contrans Logistik GmbH und<br />
die Dortmun<strong>der</strong> Eisenbahn GmbH, stellen unter den oben genannten Aspekten direkte Konkurrenten<br />
und ernstzunehmende Rivalen für die WHE dar. Die Rivalität unter diesen Eisenbahnen wird als<br />
mittelmäßig eingestuft, da die WHE mit diesen Anbietern um regionale Verkehre konkurriert, das<br />
System „Bahn“ jedoch so aufgebaut ist, dass sich relativ lange Fahrten mit Dieselloks für potenzielle<br />
Kunden nicht mehr unbedingt lohnen 131 . Daher können Preisvorteile nur dann ausgespielt werden,<br />
wenn die zu fahrenden Strecken relativ kurz sind o<strong>der</strong> die Zuführung <strong>der</strong> Loks relativ wenig<br />
Zeit in Anspruch nimmt. Aus diesem Grund bekommt meist <strong>der</strong> Eisenbahnverkehrsanbieter den<br />
Auftrag, <strong>der</strong> die größeren Standortvorteile aufweist. Das heißt konkret: Da die regionalen Gleisanschlüsse<br />
nicht mit Elektroloks angefahren werden können, weil diese nicht überspannt sind, muss<br />
immer ein regionaler Anbieter von Dieselloks hinzugezogen werden. In diesem Falle ist also <strong>der</strong><br />
Standort <strong>der</strong> ausschlaggebende Faktor für die Erteilung <strong>eines</strong> Zustellungsauftrages für Verkehre, die<br />
an diesem Standort entstehen o<strong>der</strong> enden.<br />
Rivalität unter bestehenden Wettbewerbern entsteht entwe<strong>der</strong> dadurch, dass sich einzelne o<strong>der</strong> mehrere<br />
Konkurrenten zu einer bestimmten Wettbewerbshandlung o<strong>der</strong> einem Positionskampf genötigt<br />
sehen o<strong>der</strong> aufgrund ihrer Einschätzung, sich mit Hilfe bestimmter Handlungen in eine bessere<br />
Wettbewerbsposition zu versetzen 132 .<br />
Obschon die DB Schenker Rail GmbH immer noch Branchenführer ist und daher auch intensiv die<br />
Marktpreise mitbestimmt, ist die Konzentration <strong>der</strong> Wettbewerber seit <strong>der</strong> Liberalisierung des deutschen<br />
Eisenbahnmarktes gestiegen 133 . Die Produktdifferenzierung in <strong>der</strong> Eisenbahngüterbranche<br />
fällt relativ gering aus, da sie sich auf die Differenzierung von Ganzzug-, Wagengruppen-, Einzelwagenverkehre<br />
und den kombinierten Verkehr beschränkt. Aufgrund <strong>der</strong> hohen Fixkosten sind<br />
EVU angehalten, ihre Kapazitäten möglichst stark auszulasten. Daher sind Kapazitätserweiterungen<br />
insofern problematisch, als dass die Gefahr an Überkapazitäten im Eisenbahngüterverkehr stark<br />
präsent ist und Kapazitätserweiterungen, wie z.B. die Reaktivierung stillgelegter Freiladegleise, nur<br />
durch Aushandlungen gewisser Sicherheiten vollzogen werden. Austrittsbarrieren bestehen für private<br />
EVU nur im geringen Maße, da Wagen und Fahrzeuge meist geleast o<strong>der</strong> gemietet werden.<br />
Der intramodale Wettbewerb wird daher als relativ hoch eingeschätzt. EVU können sich diesem<br />
131 Gemeint ist in diesem Falle, dass die WHE und auch an<strong>der</strong>e vergleichsweise kleine regionale Bahnen nicht über<br />
ein entsprechendes Netzwerk verfügen, um bspw. einen Lokführer immer an dem Ort bereit- stehen zu haben, wo<br />
er gebraucht wird, son<strong>der</strong>n auch dieser zusammen mit <strong>der</strong> Diesellok erst einmal bis dorthin gebracht werden muss.<br />
132 Vgl. PORTER (2008), S. 51. Solche Wettbewerbshandlungen können sein: Preiswettbewerb, Werbung, Neueinführung<br />
von Produkten o<strong>der</strong> auch Verbesserung <strong>der</strong> eigenen Serviceleistungen.<br />
133 Zurzeit existieren 392 öffentliche EVU in Deutschland sowie 115 nicht-öffentliche EVU und Fahrzeughalter. Vgl.<br />
EBA (2010a), EBA (2010b).
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 31<br />
Wettbewerb jedoch teilweise entziehen, z.B. wenn sie, wie oben schon erwähnt, Nischenstrategien<br />
verfolgen o<strong>der</strong> aufgrund von Standortvorteilen regional eine gewisse Monopolstellung genießen.<br />
Dem intermodalen Wettbewerb, insbeson<strong>der</strong>e dem Wettbewerb gegenüber dem Verkehrsträger<br />
Straße, können sich EVU auf diese Weise jedoch nicht entziehen, sodass diese Art von Wettbewerb<br />
ebenfalls als relativ hoch eingestuft wird. Der Druck durch Substitut-Wettbewerber ist umso größer,<br />
je attraktiver diese ihre Ersatzprodukte und das damit einhergehende Preis/Leistungs-Verhältnis gestalten<br />
und vermarkten können. Die Wechselkosten vom Verkehrsträger Schiene auf die Straße fallen<br />
relativ gering aus, da davon auszugehen ist, dass Verla<strong>der</strong>, die über einen Gleisanschluss verfügen,<br />
auch Zugang zum Straßennetz haben. Umgekehrt ist <strong>der</strong> Wechsel vom Verkehrsträger Straße<br />
auf die Schiene mit höheren Kosten verbunden, da nicht je<strong>der</strong> Verla<strong>der</strong>, <strong>der</strong> bisher von Lkw bedient<br />
worden ist, automatisch über einen aktiven Gleisanschluss verfügt und eine solch Infrastruktur daher<br />
erst mit hohen Kosten aufgebaut werden muss.<br />
c) Substitut-Wettbewerber <strong>der</strong> WHE<br />
Unter Substitut-Wettbewerbern versteht man Anbieter von Ersatzprodukten o<strong>der</strong> von Substituten,<br />
die mit einer Branche o<strong>der</strong> auch einem einzelnen Unternehmen konkurrieren und das Gewinnpotenzial<br />
<strong>der</strong> Branchen eingrenzen, da auf diese Weise eine Preisobergrenze gesetzt wird 134 .<br />
Als Substitut-Wettbewerber allgemein ist zunächst <strong>der</strong> Verkehrsträger Straße zu nennen, sofern regionale<br />
Aspekte im Vor<strong>der</strong>grund stehen. Daher gelten insbeson<strong>der</strong>e die regional in Herne und Umgebung<br />
ansässigen Lkw-Speditionsunternehmen zu den Konkurrenten <strong>der</strong> WHE und stellen, beson<strong>der</strong>s<br />
auch im Hinblick auf die Vermarktung des reaktivierten Freiladegleises <strong>der</strong> WHE, Rivalen dar,<br />
sofern das Quellgebiet in Herne und Umgebung liegt 135 . Stellen Herne und Umgebung das Zielgebiet<br />
dar, können auch Speditionen in Quellgebieten überall in Deutschland zur Konkurrenz <strong>der</strong><br />
WHE gehören. Konkret und namentlich können an dieser Stelle daher keine Angaben zu dieser Art<br />
von Konkurrenten gemacht werden.<br />
d) Kundenportfolio <strong>der</strong> WHE und Verhandlungsmacht <strong>der</strong> Abnehmer<br />
Da das Kundenportfolio zu den betriebsinternen Daten <strong>der</strong> WHE gehört, konnte Herr RECKEL an<br />
dieser Stelle nicht alle konkreten Namen von Kunden und Abnehmern preisgeben. Die Verteilung<br />
<strong>der</strong> Kundengruppen auf die Anteile am Umsatz <strong>der</strong> WHE gibt jedoch Aufschluss über <strong>der</strong>en Verhandlungsmacht.<br />
Mit Verhandlungsmacht ist <strong>der</strong> Einfluss <strong>der</strong> Abnehmer auf die Preise und die<br />
Qualität <strong>der</strong> Leistungen einer Branche o<strong>der</strong> <strong>eines</strong> konkreten Unternehmens gemeint 136 .<br />
40 Prozent vom Umsatz <strong>der</strong> WHE werden durch die Lieferung von Kohle an das benachbarte Heizkraftwerk<br />
<strong>der</strong> Evonik Steag GmbH und den Transport <strong>der</strong> dort hergestellten Erzeugnisse erzielt.<br />
Weitere 40 Prozent des Umsatzes werden mit <strong>der</strong> Bedienung des Container-Terminals erreicht,<br />
welches zu 51 Prozent <strong>der</strong> WHE gehört und für das die WHE einen eigenen Geschäftsführer stellt.<br />
Die Kunden des Container-Terminals sind ebenfalls Verkehrsanbieter, darunter die Deutsche Bahn<br />
AG, die Intercontainer-Interfrigo S.A. (ICF), die TX Logistik AG, die Van Dieren Maritime B.V.<br />
134 Vgl. PORTER (2008), S. 58 f.<br />
135 Beispielhaft seihen hier nur genannt: die lila Logistik GmbH, die DERR Logistik GmbH sowie die Dachser GmbH<br />
& Co KG.<br />
136 Vgl. PORTER (2008), S. 59 ff.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 32<br />
und die PCC Intermodal S.A. Diese Gesellschaften sind die Hauptabnehmer des Container-<br />
Terminals, hinter denen jedoch noch viele weitere Abnehmer stehen, die wie<strong>der</strong>um für die hier genannten<br />
internationalen Gesellschaften die Auftraggeber darstellen. Die restlichen 20 Prozent des<br />
Umsatzes erzielt die WHE über die Bedienung ihrer Gleisanschließer 137 und über kleinere regelmäßige<br />
Verkehre 138 , d.h. Einzelwagen- und Wagengruppen-Verkehre nach Marl, Hagen, Bielefeld,<br />
Castrop-Rauxel und Mülheim 139 . Insgesamt bedient die WHE auf diese Weise ca. 20 Abnehmer, die<br />
sowohl in <strong>der</strong> Zahl, als auch in ihrer Zusammensetzung im Laufe <strong>der</strong> Zeit variieren können 140 . Darüber<br />
hinaus wickelt sie vereinzelt Spot-Geschäfte ab, die keine erkennbare Regelmäßigkeit aufweisen.<br />
Schließlich übernimmt die WHE auch Testläufe und Testfahrten für Probezüge für potenzielle<br />
Kunden, die ihre Logistikkette näher Richtung Schiene ausweiten wollen, sodass für diese im Anschluss<br />
und bei entsprechen<strong>der</strong> Zufriedenheit möglicherweise regelmäßige Fahrten durchgeführt<br />
werden.<br />
Da Betriebsabläufe effizienter gestaltet werden können, je höher die Auslastung <strong>der</strong> Wagen und<br />
Fahrzeuge <strong>der</strong> WHE ist, können anteilsmäßig größeren Abnehmern, wie z. B. dem oben erwähnten<br />
Kraftwerk, eher Rabatte eingeräumt werden als kleineren Abnehmern. Grundsätzlich wird bei <strong>der</strong><br />
WHE jedoch nach Aufwand abgerechnet und die Leistungen werden zu Marktpreisen angeboten.<br />
Dennoch wird die Verhandlungsmacht von Großabnehmern im Hinblick auf Rabattvergaben höher<br />
eingeschätzt, weil diese auch einen höheren Anteil am Umsatz <strong>der</strong> WHE verzeichnen. Da es sich<br />
bei <strong>der</strong> WHE jedoch nicht um einen Großkonzern handelt, <strong>der</strong> Verluste an einer Stelle mit Überschüssen<br />
an einer an<strong>der</strong>en Stelle ausgleichen kann, hält sich ihr Verhandlungsspielraum generell<br />
deutlich in Grenzen. Letztlich muss sie rentabel wirtschaften, um weiterbestehen zu können, weshalb<br />
selbst ein Großabnehmer keine unrentablen Preisfor<strong>der</strong>ungen an die WHE stellen kann. Generell<br />
versucht die WHE jedoch, ihre Leistungen individuell auf den jeweiligen Abnehmer zuzuschneiden,<br />
um somit ein zufriedenstellendes Preis/Leistungs-Verhältnis anbieten zu können.<br />
e) Lieferanten <strong>der</strong> WHE und <strong>der</strong>en Verhandlungsmacht<br />
Lieferanten mit einer hohen Verhandlungsstärke können die Rentabilität einer Branche und auch <strong>eines</strong><br />
einzelnen Unternehmens min<strong>der</strong>n, indem sie androhen, für ihre Leistungen höhere Preise zu<br />
verlangen o<strong>der</strong> für den gleichen Preis die Qualität <strong>der</strong> Leistung zu verschlechtern 141 . Im ersten Fall<br />
bedeutet das, dass sie Kostensteigerungen ihrer eigenen Preise auf ihre Abnehmer überwälzen können.<br />
Die Verhandlungsmacht <strong>der</strong> Lieferanten <strong>der</strong> WHE gestaltet sich insgesamt als relativ gering. Zu<br />
größten Teilen wickelt die WHE ihre Verkehre auf dem eigenen Schienennetz ab und ist daher unabhängig<br />
von den Trassen-Vergaben <strong>der</strong> DB Netz AG. Über das eigene Schienennetz hinaus ist<br />
137 Beispielhaft sei hier die Müntefering-Gockeln Wertstoffrecycling & Containerdienst GmbH genannt.<br />
138 Diese Verkehre dienen hauptsächlich zum Transport von Gütern wie Kohle, Getreide o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Schüttgütern.<br />
139 Da <strong>der</strong> Hafen Lünen selbst über keine eigene Eisenbahn verfügt, stellt die WHE dort eine Diesellok zur Verfügung.<br />
Eine Lok, die stets vor Ort verfügbar ist, birgt den Vorteil, dass sie nicht erst zugestellt werden muss, bevor<br />
die eigentliche Leistung angeboten werden kann, und die zu berechnenden Zustellungskosten daher wegfallen. Auf<br />
diese Weise konnte in Lünen eine hohe Auslastung <strong>der</strong> Lok <strong>der</strong> WHE erzielt werden. Auch in diesem Fall war die<br />
Standortfrage die entscheidende für den möglichen Erfolg.<br />
140 Die Karo As konnte z.B. durch die oben beschriebene Freiladegleisreaktivierung als neuer Abnehmer für die WHE<br />
gewonnen werden.<br />
141 Vgl. PORTER (2008), S. 62 ff.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 33<br />
auch die WHE abgängig von <strong>der</strong> DB Netz AG, da diese eine marktführende Stellung im Bezug auf<br />
die Schieneninfrastruktur deutschlandweit genießt und den größten Anteil am deutschen Schienennetz<br />
hält 142 .<br />
Der Strom, den die WHE zum Betreiben ihrer Anlagen benötigt, wird von den Stadtwerken Herne<br />
geliefert. Fahrstrom für Elektroloks bezieht die WHE nicht, da sie ihre Verkehre lediglich mit Dieselloks<br />
abwickelt. Den Treibstoff erhält die WHE von <strong>der</strong> Aral AG. Kostenüberwälzungen bei Dieselpreisen<br />
sind hier generell denkbar 143 . Wie bei je<strong>der</strong> Privatperson, jedem Speditionsbetreiber und<br />
jedem sonstigen Abnehmer von Diesel o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Treibstoffen, sind die zu zahlenden Preise abhängig<br />
von Rohölpreisen. Da die Anzahl von Rohöllieferanten weltweit relativ gering ist, kann man<br />
hier auch von einer oligopolistischen Stellung dieser Lieferanten sprechen. Es ist daher davon auszugehen,<br />
dass die Preise für Rohöl bzw. Diesel stets etwas höher liegen als Preise, die sich auf einem<br />
Markt mit vollständigem Wettbewerb einspielen würden 144 . Sofern die Loks <strong>der</strong> WHE längere<br />
Fahrten antreten, ist es möglich, dass die WHE in diesem Fall das Angebot <strong>der</strong> DB Energie GmbH<br />
in Anspruch nehmen muss. Aus diesem Grund ist die WHE nur selten abhängig von diesem marktführenden<br />
Energie- und Diesellieferanten.<br />
Die Wagen und Dieselloks, die die WHE für ihre Verkehre benötigt, befinden sich entwe<strong>der</strong> ausreichend<br />
in ihrem Besitz o<strong>der</strong> können von Partnern <strong>der</strong> WHE gemietet werden, sodass auch hier keine<br />
unangenehmen Abhängigkeiten entstehen können.<br />
3.2.2.2 <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> Konkurrenz <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH<br />
Im Folgenden soll die Konkurrenz <strong>der</strong> WHE beurteilt und anhand von <strong>Beurteilung</strong>skriterien mit <strong>der</strong><br />
WHE verglichen werden. Diese <strong>Beurteilung</strong> soll dabei helfen, Vor- und Nachteile <strong>der</strong> WHE gegenüber<br />
ihrer Konkurrenz herauszustellen, damit zum Ende <strong>der</strong> SWOT-Analyse, d.h. im Anschluss an<br />
die Unternehmensanalyse, ein aussagekräftiges Stärken-Schwächen-Profil <strong>der</strong> WHE erstellt werden<br />
kann. Die Leistungen <strong>der</strong> WHE werden für diese <strong>Beurteilung</strong> als Standard festgesetzt. Anhand einer<br />
Skala von eins bis sieben werden anschließend zwei ausgewählte Konkurrenten dahingehend beurteilt,<br />
ob diese im Hinblick auf das genannte Kriterium viel schwächer (1), schwächer (2), etwas<br />
schwächer (3), ähnlich (4), etwas stärker (5), stärker (6) o<strong>der</strong> viel stärker (7) eingeschätzt werden 145 .<br />
Da die Fokussierung dieser Arbeit auf <strong>der</strong> <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> oben beschriebenen Freiladegleisreaktivierung<br />
liegt, konzentriert sich die <strong>Beurteilung</strong> in diesem Kapitel auf Kriterien, die für kleinere Abnehmer<br />
von Bedeutung sind 146 .<br />
Als Konkurrenten werden die DB Schenker Rail GmbH herangezogen und ein fiktives Lkw-<br />
Speditionsunternehmen, welches als Substitut-Wettbewerber mit entsprechenden Standortvorteilen<br />
versehen ist. Die Fiktion wird damit begründet, dass es zum einen eine hohe Anzahl von Lkw-<br />
142 Vgl. ABERLE (2003), S. 256.<br />
143 Vgl. PORTER (2008), S. 63.<br />
144 Vgl. CEZANNE (2005), S. 162 f.<br />
145 Für die Einschätzung wurde Herr RECKEL zu Rate gezogen.<br />
146 In diesem Kapitel gilt es also nicht, die WHE als „Ganzes“ mit ihrer Konkurrenz zu vergleichen, son<strong>der</strong>n viel mehr<br />
herauszustellen, inwieweit es die Konkurrenz vermag, kleineren Abnehmern in gleicher Weise Kapazitäten zur<br />
Verfügung zu stellen, wie es bspw. die WHE mit ihrem neu reaktivierten Freiladegleis ermöglicht.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 34<br />
Speditionsunternehmen allein in Herne und Umgebung gibt und nicht nur <strong>eines</strong> von ihnen als Konkurrenz<br />
<strong>der</strong> WHE zu betrachten ist. Zum an<strong>der</strong>en wurde bereits erläutert, dass auch ein Lkw-<br />
Speditionsunternehmen in einem an<strong>der</strong>en Quellgebiet irgendwo in Deutschland ebenfalls zur Konkurrenz<br />
zählt, weshalb die hier zu vergleichende Lkw-Spedition eher als Vertreter des Verkehrsträgers<br />
Straße zu sehen ist und nicht als konkretes, mit Namen versehenes Unternehmen. Im Folgenden<br />
werden die herangezogenen <strong>Beurteilung</strong>skriterien kurz erläutert.<br />
Kapazität: Mit diesem Kriterium ist die Kapazität des Fuhrparks und <strong>der</strong> zur Verfügung stehenden<br />
Infrastruktur gemeint, auf die das einzelne Verkehrsunternehmen zurückgreifen kann. Zur Kapazität<br />
des Fuhrparks gehört auch, inwieweit die entsprechenden Wagen für unterschiedliche Güterarten<br />
und Loks für das Befahren unterschiedlicher Infrastrukturen vorhanden sind. Unter <strong>der</strong> Kapazität<br />
<strong>der</strong> Infrastruktur wird auch die Vernetzung ihrer einzelnen Schienenwege untereinan<strong>der</strong> und mit<br />
an<strong>der</strong>en Verkehrsträgern verstanden. Eine höhere Anzahl an Schienenwegen und Kreuzungen, d.h.<br />
eine höhere Vernetzung, macht kürzere Fahrten möglich, die wie<strong>der</strong>um zu Zeit- und Kosteneinsparungen<br />
führen.<br />
Flexibilität: Das Kriterium Flexibilität bezieht sich auf die zeitliche und die kapazitätsbezogene<br />
Flexibilität. Die zeitliche Flexibilität beschreibt, inwieweit ein Verkehrsunternehmen die Möglichkeit<br />
bietet, den Fahrplan an sich än<strong>der</strong>nde Abholungs- o<strong>der</strong> Lieferungstermine anzupassen. Hiermit<br />
sind auch die Vorlaufzeiten gemeint, die das jeweilige Unternehmen für die administrative Planung<br />
benötigt. Mit <strong>der</strong> kapazitätsbezogenen Flexibilität ist gemeint, inwiefern die genannten Verkehrsunternehmen<br />
ihren Fuhrpark aufstocken können und wie viel Zeit hierfür benötigt wird.<br />
Pünktlichkeit: Mit diesem Kriterium wird die Liefertermintreue, aber auch die Planbarkeit von<br />
Transporten beschrieben. Je mehr Störfaktoren diese Planbarkeit beeinflussen können, desto wahrscheinlicher<br />
ist eine zeitliche Abweichung des tatsächlichen Liefertermins vom geplanten Liefertermin.<br />
Preise: Preise sind im Güterverkehr stets abhängig von den beför<strong>der</strong>ten Mengen und <strong>der</strong> Auslastung<br />
<strong>eines</strong> Unternehmens. Diese Aspekte werden mit Hilfe dieses Kriteriums beleuchtet. Letztlich<br />
bezieht sich dieses Kriterium auf das zu zahlende Entgelt für eine entsprechende Verkehrsdienstleistung.<br />
Service und Qualität: Mit diesem Kriterium ist zum einen die Fülle an produktbegleitenden Dienstleistungen<br />
gemeint. Zum an<strong>der</strong>en wird auch das Eingehen auf individuelle Kundenwünsche unter<br />
dieses Kriterium gefasst. Letzteres führt zu einer höheren Zufriedenheit <strong>der</strong> Kunden bzw. Abnehmer<br />
und wird daher auch als Qualität <strong>der</strong> (Verkehrs-)Dienstleistung verstanden.<br />
Know-how: Das Kriterium Know-how bezieht sich vor allem auf die Mitarbeiterqualifikation und<br />
darauf, inwieweit auf Erfahrungen beim Umschlagen spezieller Güter zurückgegriffen werden kann.<br />
In Tabelle 5 auf <strong>der</strong> nächsten Seite werden die Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> Konkurrenz zusammengefasst.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 35<br />
Konkurrenzbeurteilung im Vergleich zur WHE<br />
Kriterien<br />
Kapazität:<br />
DB Schenker Rail GmbH<br />
Lkw-<br />
Speditionsunternehmen<br />
- Fuhrpark 6 4<br />
- Infrastruktur 5 7<br />
Flexibilität:<br />
- zeitlich 3 6<br />
- kapazitätsbezogen 6 3<br />
Pünktlichkeit 3 5<br />
Preis 2 2<br />
Service und Qualität 1 3<br />
Know-how 3 3<br />
Skala:<br />
1: viel schwächer; 2: schwächer;<br />
3: etwas schwächer; 4: ähnlich; 5: etwas stärker;<br />
6: stärker; 7: viel stärker<br />
Tabelle 5: Konkurrenzbeurteilung im Vergleich zur WHE 147)<br />
Die DB Schenker Rail GmbH weist gegenüber <strong>der</strong> WHE beson<strong>der</strong>s kapazitätsbezogene Vorteile<br />
auf. Aufgrund ihrer Unternehmensgröße, ihres insgesamt größeren Kundenportfolios und aufgrund<br />
<strong>der</strong> Tatsache, dass sie auch in <strong>der</strong> Fläche deutschlandweit präsenter ist als eine regionale Eisenbahn<br />
wie die WHE ist insbeson<strong>der</strong>e ihr Fuhrpark um einiges größer als <strong>der</strong> Fuhrpark <strong>der</strong> WHE. Die DB<br />
Schenker Rail GmbH hat Zugriff auf eigene Wagen für die unterschiedlichsten Güterarten, auf eigene<br />
Loks, Lkw und sogar Zugriff auf Flugzeuge. Das heißt, sie kann ihr Kapazitätsangebot schneller<br />
und in <strong>der</strong> Menge flexibler gestalten, als die WHE dies vermag. Allerdings verfügt die DB<br />
Schenker Rail GmbH nur noch über eine geringe Menge an eigenen Dieselloks, die sie hauptsächlich<br />
zum Rangieren auf ihren Bahnhöfen einsetzen, da hier <strong>der</strong> Einsatz von Elektroloks kostengünstiger<br />
ist. Regionale Schienennetze wie die <strong>der</strong> WHE sind jedoch nicht mit Oberleitungen für Elektroloks<br />
überspannt, d.h., hier können nur Dieselloks fahren, weshalb die DB Schenker Rail GmbH<br />
stets auf die Dieselloks <strong>der</strong> WHE angewiesen ist, sofern sie in <strong>der</strong>en Einzugsgebiet Güterwagen abholen<br />
o<strong>der</strong> zustellen will. Zudem spiegeln sich die Reserven, die die DB Schenker Rail GmbH an<br />
Kapazitäten hält, auch in ihren Preisen wi<strong>der</strong>, weshalb die WHE mit geringeren Kapazitätsreserven<br />
auch günstigere Preise anbieten kann.<br />
147 An dieser Stelle sei angemerkt, dass zur Bewertung <strong>der</strong> Konkurrenz absichtlich eine Gleichgewichtung <strong>der</strong> Kriterien<br />
vorgenommen wurde. Zwar kann man einräumen, dass die Kriterien Preis, Flexibilität und Pünktlichkeit bei <strong>der</strong><br />
Neugewinnung <strong>eines</strong> Kunden o<strong>der</strong> Abnehmers stärker ins Gewicht fallen würden. Letztendlich besteht ein Dienstleistungsangebot<br />
aber aus allen Aspekten <strong>der</strong> hier genannten Kriterien, sozusagen als „Gesamtpaket“, was wie<strong>der</strong>rum<br />
eine Gleichgewichtung rechtfertigen würde
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 36<br />
Im Bezug auf Pünktlichkeit und Know-how wurde die DB Schenker Rail GmbH etwas schwächer<br />
bewertet, da das Know-how <strong>der</strong> WHE konzentrierter vorhanden ist und zudem eine gewisse Übersichtlichkeit<br />
bei <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Ansprechpartner besteht. Die Fülle <strong>der</strong> Verkehre, die die DB<br />
Schenker Rail GmbH tagtäglich abwickelt, ist zudem anfälliger für Störfaktoren, was wie<strong>der</strong>um die<br />
Einhaltung <strong>der</strong> Liefertermine gefährdet, aber auch die zeitliche Flexibilität beeinträchtigt.<br />
Bei dem Kriterium Service und Qualität erhält die DB Schenker Rail GmbH die meisten Abzüge.<br />
Dies wird damit begründet, dass die DB Schenker Rail GmbH aufgrund ihrer Unternehmensgröße<br />
auch einen entsprechend großen und damit unübersichtlichen Verwaltungsapparat benötigt. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
in Punkten wie Erreichbarkeit des richtigen Ansprechpartners und individueller Betreuung<br />
kann die WHE stärker überzeugen. Das Vertragswerk <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH ist standardisierter<br />
und setzt zudem bestimmte zu beför<strong>der</strong>nde Mindestmengen fest, die kleinere Abnehmer<br />
nicht mit Sicherheit aufbringen können, weshalb diese regelmäßig nicht auf das Angebot <strong>der</strong> DB<br />
Schenker Rail GmbH zurückgreifen wollen 148 . Regionale EVU, wie die WHE, pflegen aufgrund <strong>der</strong><br />
Nähe zum Kunden o<strong>der</strong> zum Abnehmer auch ein persönlicheres Verhältnis und sind eher dazu bereit,<br />
maßgeschnei<strong>der</strong>te Angebote für ihre Abnehmer zu unterbreiten. Die individuelle Kalkulation,<br />
die hierfür notwendig ist, ist jedoch mit längeren Vorlaufzeiten verbunden.<br />
Im Vergleich zur WHE ist ein fiktives Lkw-Speditionsunternehmen im Bezug auf Kriterien wie<br />
Pünktlichkeit, zeitliche Flexibilität und infrastrukturbezogene Kapazität besser aufgestellt. Nach<br />
Angaben von Herrn RECKEL ist ein Lkw häufig pünktlicher als die Bahn. Auch können Speditionen<br />
aufgrund geringerer Vorlaufzeiten flexibler auf Terminän<strong>der</strong>ungen reagieren. Insbeson<strong>der</strong>e am<br />
Standort Herne und Umgebung angesiedelte Lkw-Speditionsunternehmen können auf eine stark<br />
vernetzte Straßeninfrastruktur zurückgreifen 149 und sind beispielsweise auch nicht, wie die Bahn,<br />
auf einen Gleisanschluss beim Verla<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Empfänger angewiesen, da im Grunde jedes Unternehmen<br />
an einer Straße angesiedelt ist 150 .<br />
Allerdings ist auch ein Speditionsunternehmen nicht vollständig in <strong>der</strong> Lage, Fuhrpark-Reserven für<br />
jede Art von Gütern aufzuweisen. Die WHE kann hier jedoch diverse Partnerschaften aufweisen,<br />
sodass sie mit einer gewissen Vorlaufzeit entsprechend benötigte Wagen einfach und günstig beschaffen<br />
kann.<br />
Für kleinere Abnehmer, die relativ regelmäßig kleinere Wagengruppen bewegen müssen, kann sich<br />
<strong>der</strong> Transport per Schiene gegenüber dem per Straße preislich dann lohnen, wenn mindestens <strong>der</strong><br />
Verla<strong>der</strong> o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Empfänger über einen eigenen aktiven Gleisanschluss verfügt. Einzelwagenverkehre<br />
lassen sich nicht ohne die Kooperation o<strong>der</strong> das Einbeziehen <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH<br />
vollziehen, allerdings kann auch hier <strong>der</strong> Transport effizienter sein, sofern man bei längeren Fahrten<br />
die einzelnen Wagen(-gruppen) an einen Ganzzug o<strong>der</strong> einen KV-Zug anhängen kann, da dies den<br />
Hauptlauf relativ günstig gestaltet und die Zustellung auf den letzten Kilometern per Diesellok erfolgen<br />
kann.<br />
148 Nach Angaben von Herrn RECKEL wurde dies von vielen Kunden <strong>der</strong> WHE im Bezug auf das Angebot <strong>der</strong> DB<br />
Schenker Rail GmbH bemängelt.<br />
149 Im Ruhrgebiet und auch im Umkreis Herne kann ein Speditionsunternehmen auf eine Fülle an Autobahnen zurückgreifen.<br />
Herne selbst grenzt direkt an die A 42 und die A 43 an.<br />
150 Muss mehr als ein Mal von einem Verkehrsträger auf einen an<strong>der</strong>en umgeschlagen werden, lohnt es sich zumeist<br />
für kleinere Anbieter nicht mehr, auf die Bahn zu setzen, da die Umschlagskosten die Transportkosteneinsparungen<br />
übertreffen.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 37<br />
Im Bezug auf Service und Qualität sowie Know-how lassen sich bei einem fiktiven Lkw-<br />
Speditionsunternehmen nur geringe Schwächen verzeichnen. Die WHE kann über die eigentliche<br />
Transportleistung hinaus auch eine betriebseigene Werkstatt anbieten. Geht daher das Angebot des<br />
fiktiven Spediteurs nicht über die zur Verfügung gestellte Transportdienstleistung hinaus, so ist die<br />
WHE in diesem Bereich kundenfreundlicher. Hinsichtlich des Know-hows kann die WHE aufgrund<br />
ihrer Erfahrungen bei eventuellen Gleisanschlussreaktivierungen mit Rat und Tat zur Seite stehen,<br />
weshalb auch hier das fiktive Lkw-Speditionsunternehmen geringfügig schlechter abschneidet.<br />
3.3 Unternehmensanalyse als Teilanalyse <strong>der</strong> SWOT-Analyse 151<br />
3.3.1 Unternehmensbeson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH<br />
Bevor im nächsten Unterkapitel die unternehmensspezifischen Ressourcen und Kompetenzen erläutert<br />
werden, soll dieses Kapitel dazu dienen, die nach Angaben von Herrn RECKEL stärksten Beson<strong>der</strong>heiten<br />
<strong>der</strong> WHE <strong>der</strong> Betrachtung voranzustellen.<br />
Die WHE zeichnet sich durch ihre Ganzheitlichkeit und ihr breites Tätigkeitsfeld aus. An ihrem<br />
Standort in Herne erstreckt sich ihr Angebot auf alles rund um Eisenbahn- und Binnenschiffsverkehre,<br />
d.h. sowohl Eisenbahnlogistik, <strong>der</strong> Umschlag von Massen-, Schütt- und Stückgütern sowie<br />
<strong>der</strong> Umschlag staubiger Güter, als auch <strong>der</strong> intermodale Umschlag Schiene/Straße, Schiene/Binnenschiff<br />
o<strong>der</strong> Straße/Binnenschiff. Der intermodale Umschlag kann sowohl über das reaktivierte<br />
Freiladegleis als auch auf dem Betriebsgelände o<strong>der</strong> mit Hilfe des Container-Terminals<br />
vonstattengehen. Darüber hinaus verfügt die WHE über Möglichkeiten, Züge zusammenzustellen<br />
und zu entkoppeln, ihre Wagen und Fahrzeuge sowie die ihrer Kunden zu warten, zu reparieren und<br />
Instand zu halten, da sie mit <strong>der</strong> Tochtergesellschaft <strong>der</strong> über ein eigenes Eisenbahntechnikzentrum,<br />
also auch eine eigene Werkstatt verfügt. Die Bedienung <strong>der</strong> Gleisanschließer erfolgt über das eigene<br />
Schienennetz, d.h. die WHE hat die volle Kontrolle, setzt ihre Trassenpreise bzw. Frachtanteile<br />
selbständig fest und ist flexibel in ihren Abläufen und Fahrplänen. Zudem können auch über das eigene<br />
Schienennetz hinausgehende Verkehre bundesweit auf dem Schienennetz <strong>der</strong> DB Netz AG gefahren<br />
werden. Darüber hinaus pflegt die WHE diverse Partnerschaften und ist Muttergesellschaft<br />
diverser Tochtergesellschaften und kann daher auch (Trocken-)Lagermöglichkeiten anbieten, von<br />
denen aus, direkt vor Ort, ebenfalls umgeschlagen werden kann. Über kurze Dienstwege kann die<br />
WHE Dienstleistungen bei Partnern im Verbund einkaufen, die sie selbst nicht anbieten kann, und<br />
ist daher fähig, für jede erdenkliche Logistikkette vorwiegend als Anbieter des Eisenbahngüterverkehrs<br />
den Schnittpunkt zu bilden.<br />
3.3.2 Ressourcen- und kompetenzorientierte Betrachtung <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn<br />
und Hafen GmbH<br />
Dem Recourced-Based-View 152 folgend, wird die WHE in diesem Kapitel einer ressourcen- und<br />
kompetenzorientierten Betrachtung unterworfen, damit im Anschluss an diese Betrachtung erörtert<br />
151 Auch die in diesem Kapitel getätigten Aussagen beziehen sich auf Antworten von Herrn RECKEL als Vertreter <strong>der</strong><br />
WHE mit entsprechenden unternehmensbezogenen Kenntnissen, die dieser in dem zu diesem Zweck geführten Interview<br />
gegeben hat. Etwaige Schlussfolgerungen wurden von den Verfassern ergänzt.<br />
152 Vgl. BARNEY/CLARK (2007), S. 222 ff.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 38<br />
werden kann, ob die WHE über einzigartige Ressourcen und Ressourcenkombinationen 153 verfügt<br />
und inwieweit diese als Erfolgs- bzw. Nutzenpotenziale 154 verstanden werden. Auch bei dieser Betrachtung<br />
liegt <strong>der</strong> Fokus auf <strong>der</strong> <strong>Beurteilung</strong> des neu reaktivierten Freiladegleises, weshalb sich<br />
dieses Kapitel nur auf Ressourcen bezieht, die direkt o<strong>der</strong> indirekt für das Angebot von kleineren<br />
Verkehren für kleinere Nachfrager entscheidend sein können. Ressourcen werden in materielle und<br />
immaterielle Ressourcen unterschieden 155 . Letztere lassen sich glie<strong>der</strong>n in personengebundene und<br />
personenunabhängige Ressourcen.<br />
a) Materielle Ressourcen<br />
Zu den materiellen Ressourcen gehören zum einen die allgemeine regionale Schieneninfrastruktur<br />
<strong>der</strong> WHE und ihr Fuhrpark. Zum an<strong>der</strong>en zählen auch die für den laufenden Betrieb benötigten Anlagen,<br />
die betriebseigene Werkstatt, das reaktivierte Freiladegleis, ein weiteres betrieblich stillgelegtes<br />
Freiladegleis und an<strong>der</strong>e Stumpfgleise, die sich für den Umschlag eignen, zu den hier als relevant<br />
zu betrachtenden materiellen Ressourcen.<br />
b) Personenunabhängige immaterielle Ressourcen<br />
Zu personenunabhängigen immateriellen Ressourcen zählen sowohl die in <strong>der</strong> Organisation <strong>der</strong><br />
WHE verankerten Fähigkeiten als auch Verfügungsrechte, wie beispielsweise Lizenzen, o<strong>der</strong> auch<br />
Reputation, die sich auf die WHE beziehen.<br />
Wie schon oben erwähnt, pflegt die WHE diverse Partnerschaften. Die WHE hat die Planungs- und<br />
Entwicklungsgesellschaft GVZ Emscher mbH, d.h. ein Güterverkehrszentrum, gegründet, um neue<br />
Geschäftsfel<strong>der</strong> zu erschließen und dem Strukturwandel im Eisenbahngüterverkehr zu folgen. Um<br />
sich vor allem auch in <strong>der</strong> Öffentlichkeit präsent zu zeigen und ein umfangreiches Angebot aufrechtzuerhalten,<br />
pflegt sie zudem viele offizielle und inoffizielle Kooperationen, um ihre eigenen<br />
Schwächen auf diese Weise möglichst gering zu halten und über unterschiedlichste Netzwerke noch<br />
näher an den (potenziellen) Kunden heranzurücken. Das heißt, die WHE hat für alle Betätigungsfel<strong>der</strong><br />
ihrer Branche Ansprechpartner und pflegt langjährige Geschäftsbeziehungen mit an<strong>der</strong>en<br />
Branchenmitglie<strong>der</strong>n, für <strong>der</strong>en Angebotsqualität sie auch jeweils bürgen kann. Da auf diese Kooperationen<br />
regelmäßig im organisatorischen Ablauf des Betriebes <strong>der</strong> WHE zurückgegriffen wird,<br />
wird dies in diesem Fall als Routine aufgefasst und deshalb zu den personenunabhängigen Ressourcen<br />
gezählt. Zudem unterhält die WHE auch offizielle Kooperationen, beispielsweise im Verbundprojekt<br />
MAEKAS 156 , dem Marketing Club Last Mile Logistik Netzwerk 157 , im Logisticluster<br />
NRW 158 und ist Mitglied im Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 159 , dem Bundesver-<br />
153 Vgl. WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 377 ff.<br />
154 Vgl. PÜMPIN (1992), S. 20 ff.<br />
155 Materielle und immaterielle Ressourcen werden auch als tangible o<strong>der</strong> visible assets bzw. intangible o<strong>der</strong> invi sible<br />
assets bezeichnet. Vgl. BARNEY/CLARK (2007), S. 20 f.; WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 379.<br />
156) Vgl. MAEKAS (2010).<br />
157 Vgl. LAST MILE LOGISTIK (2010).<br />
158 Vgl. LOGISTIKCLUSTER NRW (2010).<br />
159 Vgl. VDV (2010).
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 39<br />
band Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) und <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft Kanalhäfen NRW. Mit Hilfe<br />
dieser Kooperationen vermag es die WHE, beispielsweise ihre Kapazitätslücken bei Bedarf aufzufüllen,<br />
sich politisch zu äußern o<strong>der</strong> sich auf Gemeinschaftsständen auf Messen zu präsentieren, wo<br />
sie sich einen eigenen Stand finanziell nicht leisten könnte. Diese Kooperationen dienen <strong>der</strong> WHE<br />
zum Aufbau von Vorteilen gegenüber ihrer Konkurrenz 160 .<br />
c) Personenbezogene immaterielle Ressourcen<br />
Unter den personenbezogenen immateriellen Ressourcen werden Fertigkeiten und Fähigkeiten 161<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiter in einem Unternehmen zusammengefasst.<br />
Um dem oben bereits angesprochenem Strukturwandel in <strong>der</strong> Eisenbahngüterverkehrsbranche zu<br />
folgen, hat sich die WHE unter an<strong>der</strong>em mitarbeiterbezogen neu strukturiert. Im November 2008<br />
wurde im Zuge dieser Neustrukturierung Herr RECKEL für den Bereich Marketing und Vertrieb gewonnen.<br />
Die WHE hatte erkannt, dass sie sich und ihre Leistungen am Markt entsprechend präsentieren<br />
muss und dass es für die Kundenbetreuung und insbeson<strong>der</strong>e für die Neuakquisition von<br />
Kunden o<strong>der</strong> Abnehmern notwendig ist, einen entsprechend kompetenten Mitarbeiter mit dieser<br />
Aufgabe zu betreuen. Da beson<strong>der</strong>s Nachfrager von kleineren Verkehren einen entsprechenden Betreuungsbedarf<br />
haben und eventuell aufgrund fehlen<strong>der</strong> Routine o<strong>der</strong> Wissen über die Möglichkeiten,<br />
die die Eisenbahn bietet, erst über diese aufgeklärt und von <strong>der</strong>en Leistung überzeugt werden<br />
müssen, kann man die Fähigkeiten von Herrn RECKEL als erfolgsentscheidende personenbezogene<br />
immaterielle Ressourcen verstehen. Zudem gehören die Kalkulationsfertigkeiten und das Expertenwissen<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiter <strong>der</strong> WHE zu dieser Art von Ressourcen. Weisen Mitarbeiter ein ausführliches<br />
Wissen über Kundenwünsche auf, kann dies für die Gewinnung neuer Kunden ebenfalls eingesetzt<br />
werden, weshalb Erfahrungen und Branchenwissen <strong>der</strong> Mitarbeiter als personenbezogene immaterielle<br />
Ressourcen bezeichnet werden können. Ebenso zählen <strong>der</strong> Ausbildungsgrad <strong>der</strong> Mitarbeiter<br />
und eine für den Betrieb ausreichende Mitarbeiteranzahl hierzu und sollen zumindest kurz<br />
erwähnt sein. Beispielsweise ist eine gewisse Anzahl an Lokführern für ein EVU nötig, um eine<br />
entsprechende Menge an Verkehren bedienen zu können.<br />
Im Bezug auf die dokumentierte Freiladegleisreaktivierung war es zudem von Vorteil, dass die<br />
WHE als EIU über das entsprechende Know-how und die Mitarbeiter verfügt, um eine solche Reaktivierung<br />
kosten- und zeitsparend umzusetzen und ihrem Kunden, in diesem Fall <strong>der</strong> Karo As, einen<br />
entsprechenden Kundennutzen zu bieten.<br />
3.3.3 Ableiten von Erfolgspotenzialen<br />
Unter Erfolgspotenzialen versteht man allgemein eine Konstellation aus produkt- und marktspezifischen<br />
Voraussetzungen, die zu einem nachhaltigen operativen Erfolg führen können und langfristig<br />
160 Vgl. PFOHL (2004), S. 8.<br />
161 Unter Fertigkeiten fallen nach Ansicht <strong>der</strong> Verfasserin Methoden- und Branchenwissen sowie Kompetenzen, welche<br />
beispielsweise während <strong>der</strong> Berufsausbildung erlangt werden können. Fähigkeiten dagegen umfassen die sog.<br />
„Soft Skills“, d.h. soziale Kompetenzen wie z.B. Teamfähigkeit o<strong>der</strong> die Fähigkeit an<strong>der</strong>e Mitarbeiter zu motivieren.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 40<br />
aufgebaut werden 162 . Daher ist die Aufgabe <strong>der</strong> strategischen Führung darin zu sehen, etwaige Erfolgspotenziale<br />
zu suchen, aufzubauen und zu erhalten, um langfristig die Liquidität und Wettbewerbsfähigkeit<br />
<strong>eines</strong> Unternehmens zu erhalten 163 .<br />
Mit <strong>der</strong> Reaktivierung <strong>eines</strong> ihrer zwei vorhandenen Freiladegleise hat sich die WHE <strong>der</strong> Kundengruppe<br />
<strong>der</strong> kleineren Abnehmer zugewandt. Ungefähr die Hälfte <strong>der</strong> Fläche des reaktivierten Freiladegleises,<br />
d.h. ca. 300 m², steht <strong>der</strong> WHE weiterhin zur Verfügung. Zudem befindet sich auf ihrem<br />
Gelände ein weiteres Freiladegleis, welches sich im Moment jedoch noch in einem ähnlich<br />
schlechten Zustand befindet, wie das oben beschriebene Freiladegleis vor <strong>der</strong> Sanierung. Kunden<br />
für kleinere Verkehre kann die noch ungenutzte Umschlagsfläche am reaktivierten Freiladegleis angeboten<br />
o<strong>der</strong> zum Abpuffern von Auftragsspitzen <strong>der</strong> WHE selbst verwendet werden. Eines <strong>der</strong><br />
Charakteristika des Eisenbahngüterverkehrs ist, dass Betriebsabläufe umso effizienter gestaltet werden<br />
können, je höher die Auslastung des Betriebes insgesamt ausfällt, da beispielsweise weniger<br />
Leerfahrten eingeplant werden müssen. Das heißt, sowohl das reaktivierte Freiladegleis, die weitreichenden<br />
Partnerschaften und Netzwerke als auch die kundenorientierte Neuausrichtung <strong>der</strong> WHE<br />
stellen eine Konstellation dar, die als Erfolgspotenzial o<strong>der</strong>, weiter ausdifferenziert, als Erlössteigerungspotenzial<br />
bezeichnet werden kann 164 . Diese Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit bei<br />
Eintreten des Erfolges, d.h. <strong>der</strong> Neuakquisition <strong>eines</strong> Kunden bzw. Abnehmers, dieses Erlössteigerungspotenzial<br />
tatsächlich realisiert werden kann.<br />
Zudem zeigt das oben beschriebene Praxisbeispiel, dass eine Gleisreaktivierung generell Erfolgspotenziale<br />
im Sinne von zukünftigen Gewinnen bringt. Die Frachtanteile, die durch die Gewinnung<br />
<strong>der</strong> Karo As als Abnehmer realisiert werden können, erhöhen die Erlöse <strong>der</strong> WHE. Zusätzliche<br />
Mieteinnahmen über die Freiladegleisfläche, die über die Mindestlaufzeit von zehn Jahren hinaus<br />
gehen, eröffnen weitere Erlöse für die WHE. Ohne die nötigen Kapazitäten, d.h. ohne das Vorhandensein<br />
des Freiladegleises, hätte die Karo As nicht bedient werden können.<br />
3.4 Ergebnisse <strong>der</strong> SWOT-Analyse<br />
3.4.1 <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung<br />
Es wurde bereits erläutert, dass die Reaktivierung <strong>eines</strong> Freiladegleises, in Verbindung mit einer<br />
kundenorientierten Ausrichtung <strong>eines</strong> EVU Erfolgspotenziale birgt 165 . In diesem Kapitel wird die<br />
oben beschriebene Freiladegleisreaktivierung jedoch noch umfangreicher anhand von zusätzlichen<br />
<strong>Beurteilung</strong>skriterien beleuchtet. Die <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> Ausprägungen dieser Kriterien erfolgt dreistufig:<br />
Ein Kriterium ist entwe<strong>der</strong> stark, leicht o<strong>der</strong> gar nicht ausgeprägt. Die Kriterien werden im Folgenden<br />
kurz erläutert.<br />
Flexibilisierung des Unternehmens: Dieses Kriterium stellt darauf ab, inwieweit eine Freiladegleisreaktivierung<br />
zusätzlich Flexibilität für ein Unternehmen, in diesem Falle für die WHE, bietet.<br />
Kosten: Mit Hilfe dieses Kriteriums soll die finanzielle Belastung <strong>eines</strong> Unternehmens durch eine<br />
solche Freiladegleisreaktivierung näher betrachtet werden.<br />
162 Vgl. GÄLWEILER (2005), S. 26 f. Erfolgspotenziale können daher auch als Nutzenpotenziale bezeichnet werden.<br />
Vgl. PÜMPIN (1992), S. 19 ff.<br />
163 Vgl. GÄLWEILER (2005), S. 28.<br />
164 Vgl. GÄLWEILER (2005), S. 37 f.; JUNG (2007), S. 410; WELGE/AL-LAHAM (2008), S. 253.<br />
165 Vgl. Kapitel 3.3.3.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 41<br />
(Refinanzierungs-)Sicherheit: Dieses Kriterium hängt mit den Auszahlungen für die Investition in<br />
eine Freiladegleisreaktivierung zusammen. Die Refinanzierungssicherheit ist gegeben, wenn die<br />
Auszahlungen durch Einzahlungen aus Umsätzen mit Kunden o<strong>der</strong> Abnehmern so ausgeglichen<br />
werden, dass letztlich, unter <strong>der</strong> Berücksichtigung von Verzinsungseffekten, mindestens ein Kapitalwert<br />
von Null resultiert.<br />
Kundengewinnung: Dieses Kriterium stellt darauf ab, inwieweit ein Unternehmen mit einem reaktivierten<br />
Freiladegleis reale Neukunden o<strong>der</strong> Abnehmer gewinnen kann.<br />
Erlössteigerung: Mit diesem Kriterium ist sowohl die sofortige als auch die langfristige Erlössteigerung<br />
gemeint, die ein EVU erreichen kann, wenn es ein Freiladegleis reaktiviert.<br />
In Tabelle 6 werden die <strong>Beurteilung</strong>en <strong>der</strong> einzelnen Kriterien im Hinblick auf eine Freiladegleisreaktivierung<br />
zusammengefasst.<br />
Tabelle 6: <strong>Beurteilung</strong> einer Freiladegleisreaktivierung<br />
Eine Freiladegleisreaktivierung ist zunächst einmal mit vergleichsweise hohen Investitionskosten<br />
und damit mit relativ hohen Auszahlungen verbunden 166 . Das heißt, die Refinanzierungssicherheit<br />
ist kaum gegeben solange die zukünftigen Einzahlungen mit relativ hoher Unsicherheit behaftet<br />
sind. Das heißt, eine Branchenwachstumsprognose für den Eisenbahngüterverkehr 167 reicht für eine<br />
Reaktivierung <strong>eines</strong> Freiladegleises nicht aus. Die nötige Refinanzierungssicherheit kann jedoch<br />
durch ein entsprechendes Vertragswerk erreicht werden. Im Falle <strong>der</strong> Gleisreaktivierung <strong>der</strong> WHE<br />
wurde diese Sicherheit durch einen Mietvertrag über die Freiladegleisfläche mit Mindestlaufzeit<br />
166 Vgl. Kapitel 2.3.<br />
<strong>Beurteilung</strong> einer Freiladegleisreaktivierung<br />
<strong>Beurteilung</strong>skriterien stark ausgeprägt gar nicht ausgeprägt<br />
Flexibilisierung des Unternehmens x<br />
Kosten x<br />
(Refinanzierungs-) Sicherheit (x) x<br />
Kundengewinnung x<br />
Erlössteigerung x<br />
167 Vgl. ICKERT/MATTHES/ROMMERSKIRCHEN ET AL. (2007), S. 126.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 42<br />
hergestellt 168 . Die WHE erhält regelmäßig und unabhängig von <strong>der</strong> eigentlich transportierten Fracht<br />
und den Frachtanteilen Einzahlungen aus Mieteinnahmen für die Freiladegleisfläche. Darüberhinaus<br />
werden über die Frachtanteile zusätzliche Einzahlungen möglich, die aus dem Transport <strong>der</strong> Kesselwagen<br />
mit Altöl resultieren.<br />
Die Kriterien Kundengewinnung und Erlössteigerung sind bei einer Freiladegleisreaktivierung stark<br />
ausgeprägt, wenn <strong>der</strong> Umschlag mit Hilfe <strong>eines</strong> Freiladegleises optimal in das Logistikkonzept <strong>eines</strong><br />
bestimmten Kunden o<strong>der</strong> Abnehmers passt und ein EVU auf diese Weise neue Kunden zu akquirieren<br />
vermag. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, dann ist auch die Erlössteigerung nur dann<br />
tatsächlich gegeben, wenn das betreffende EVU ein solches Freiladegleis zum Abpuffern <strong>der</strong> eigenen<br />
Auftragsspitzen regelmäßig nutzen würde. Im Falle <strong>der</strong> Freiladegleisreaktivierung <strong>der</strong> WHE<br />
stellt das Freiladegleis eine optimale Schnittstelle für das Logistikkonzept <strong>der</strong> Karo As dar, weshalb<br />
die beiden Kriterien Kundengewinnung und Erlössteigerung in diesem speziellen Falle eine starke<br />
Ausprägung haben.<br />
3.4.2 Stärken-Schwächen-Profil <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH<br />
Das in diesem Kapitel tabellarisch dargestellte Stärken-Schwächen-Profil stellt eine Zusammenfassung<br />
<strong>der</strong> Erkenntnisse dar, die aus <strong>der</strong> Unternehmensanalyse und <strong>der</strong> <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> Konkurrenz<br />
<strong>der</strong> WHE gezogen werden können 169 . Um jedoch eine darstellungstechnische und inhaltliche Wie<strong>der</strong>holung<br />
größtenteils zu vermeiden, werden die Stärken und Schwächen <strong>der</strong> WHE in Tabelle 7 lediglich<br />
<strong>der</strong> Übersichtlichkeit halber aufgelistet. Der Konkurrenzbezug wird in dieser Tabelle nicht<br />
inhaltlich, son<strong>der</strong>n lediglich darstellungstechnisch vernachlässigt 170 .<br />
168 Vgl. Kapitel 2.2.<br />
169 Vgl. Kapitel 3.2.2.2 und Kapitel 3.3.<br />
170 Siehe hierfür Tabelle 5.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 43<br />
Stärken-Schwächen-Profil <strong>der</strong> WHE<br />
Stärken Schwächen<br />
Schieneninfrastruktur <strong>der</strong> WHE hat<br />
Charakter <strong>eines</strong> monopolistischen<br />
Bottlenecks<br />
Ganzheitlichkeit des Angebots und<br />
breites Tätigkeitsfeld<br />
Kontrolle über eigenes Schienennetz<br />
Partnerschaften und langjährige<br />
Geschäftsbeziehungen sowie umfang-reiche<br />
Kooperationen<br />
kurze Dienstwege<br />
maßgeschnei<strong>der</strong>te und persönliche<br />
Kundenbetreuung und Preisgestaltung<br />
umfangreiches Know-how <strong>der</strong><br />
Mitarbeiter<br />
Kapazitätsschwächen im Bezug auf<br />
Infrastruktur und Fuhrpark ggü. dem Branchenführer<br />
DB Schenker Rail GmbH<br />
kapazitätsbezogenen Flexibilitätsdefizite ggü.<br />
dem Branchenführer<br />
zeitliche Flexibilitätsdefizite ggü.<br />
Lkw-Speditionsunternehmen<br />
überregionale Verkehre nicht ohne<br />
Einbeziehen des Branchenführers möglich<br />
Pünktlichkeitsdefizit ggü.<br />
Lkw-Speditionsunternehmen<br />
Tabelle 7: Stärken-Schwächen-Profil <strong>der</strong> WHE<br />
3.4.3 Chancen-Risiken-Profil <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH<br />
Aus <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> globalen und aufgabenspezifischen Umwelt lassen sich Chancen und Risiken<br />
für die WHE ableiten, die in Tabelle 8 als Chancen-Risiken-Profil aufgelistet werden. Es bleibt<br />
festzuhalten, dass die WHE als regional ansässiger Eisenbahnverkehrsanbieter nur dann am Branchenerfolg<br />
partizipieren kann, wenn sie an ihrem Standort im Wettbewerb mit Straßenverkehrsanbietern,<br />
d.h. Lkw-Speditionen, „triumphiert“, also durch Marketing und Vertrieb potenzielle Abnehmer<br />
davon überzeugt, dass die Verkehre, die sich mit <strong>der</strong> Bahn lohnen würden, auch tatsächlich<br />
mit <strong>der</strong> Bahn gefahren werden.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 44<br />
3.4.4 SWOT-Matrix<br />
Chancen-Risiken-Profil <strong>der</strong> WHE<br />
Chancen Risiken<br />
Branchen-Aufschwung nach<br />
Weltwirtschaftskrise<br />
Ausbau und Erhalt <strong>der</strong> Schienen-infrastruktur<br />
in Deutschland<br />
öffentliches und politisches Interesse an umweltschonenden<br />
Verkehrsträgern<br />
Freiladegleisreaktivierung zur Akquisition<br />
von kleineren Abnehmern<br />
technologische Entwicklungen für<br />
Energieeinsparungen und Ortungsgeräte für<br />
mehr Service-Leistungen<br />
Ausbau von Vertrieb und Marketing zur<br />
kundenorientierten Unternehmensausrichtung<br />
und Online-Auftritt<br />
Kooperation und Zusammenarbeit mit dem<br />
Branchenführer DB Schenker Rail GmbH für<br />
überregionale Verkehre zur<br />
Attraktivitätssteigerung<br />
Preise passen sich im Vergleich zur<br />
steigenden Auftragslage nur langsam an<br />
anteilig mehr Gel<strong>der</strong> für Ausbau und Erhalt<br />
<strong>der</strong> Straßeninfrastruktur<br />
fehlende Marketingmaßnahmen und<br />
Neuausrichtung ggü. umweltbewusster<br />
Kundschaft<br />
hoher bürokratischer Aufwand für<br />
Freiladegleisreaktivierung,<br />
Refinanzierungsunsicherheit,<br />
hohe Investitionen/Kosten<br />
Aufholbedarf im Bereich <strong>der</strong> Ortung von<br />
Waren ggü. Lkw-Speditionsunternehmen<br />
Verlust von Frachtanteilen an regionale<br />
Lkw-Speditionsunternehmen<br />
Tabelle 8: Chancen-Risiken-Profil <strong>der</strong> WHE<br />
Die SWOT-Matrix dient zur Verknüpfung <strong>der</strong> beiden oben erstellten Stärken-Schwächen- und<br />
Chancen-Risiken-Profile, d.h. <strong>der</strong> Umwelt- und <strong>der</strong> Unternehmensanalyse. In dieser Arbeit soll die<br />
SWOT-Matrix lediglich dazu dienen, die daraus resultierenden vier generellen Strategiearten kurz<br />
darzustellen und zu erläutern. Für die Erläuterung wird jeweils ein Beispiel genannt. Tabelle 9 stellt<br />
schemenhaft die Kombinationen aus Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken dar, sowie die daraus<br />
abgeleiteten Strategien.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 45<br />
Chancen (O)<br />
Risiken (T)<br />
Ausbau-Strategien:<br />
Tabelle 9: SWOT-Matrix und abgeleitete Strategiearten 171<br />
Die Ausbau-Strategien, auch SO-Strategien genannt, beinhalten das Einsetzen von Unternehmensstärken<br />
zur Nutzung von Chancen, die sich aus <strong>der</strong> Umwelt des Unternehmens, in diesem Falle <strong>der</strong><br />
WHE, ergeben. Die WHE hat die Chance, ihr Kundenportfolio zu erweitern, indem sie weitere<br />
Nachfrager bedient, die kleine Wagengruppen zu bewegen haben. Dies ist jedoch nicht ohne Zusammenarbeit<br />
mit <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH möglich. Die WHE kann ihre Standortvorteile nutzen,<br />
um eine Kooperation mit <strong>der</strong> DB Schenker Rail GmbH einzugehen, da diese auf dem Schienennetz<br />
<strong>der</strong> WHE nicht fahren kann und deshalb für beide eine Win-Win-Situation herrschen könnte<br />
172 . Als Praxisbeispiel für eine solche positive Entwicklung kann das im zweiten Kapitel beschriebene<br />
Freiladegleisreaktivierungsprojekt genannt werden. Die Karo As ist sowohl Auftraggeber für<br />
die WHE als auch für die DB Schenker Rail GmbH und konnte mit Hilfe <strong>der</strong> oben beschriebenen<br />
Freiladegleisreaktivierung für die WHE gewonnen werden. Die an<strong>der</strong>e Hälfte <strong>der</strong> Freiladegleisfläche<br />
kann einem potenziellen Neukunden angeboten werden.<br />
Absicherungs-Strategien:<br />
Absicherungs-Strategien, auch ST-Strategien genannt, sehen vor, dass ein Unternehmen die eigenen<br />
Stärken nutzt, damit es eventuelle Risiken abwenden kann. Um den Bezug zum oben beschriebenen<br />
Praxisbeispiel aufrechtzuerhalten, seien hier die Risiken von Kapazitätserweiterungen für EVU angesprochen.<br />
Die WHE kann die persönliche Betreuung ihrer Kunden durch ihre Mitarbeiter und ihre<br />
langfristigen Geschäftsbeziehungen nutzen, um für Kapazitätserweiterungen, wie beispielsweise eine<br />
weitere Freiladegleisreaktivierung auf ihrem Gelände, entsprechende vertragliche Absicherungen<br />
auszuhandeln, um das Risiko von Refinanzierungsunsicherheiten möglichst gering zu halten.<br />
171 Vgl. BREITSCHUH/WÖLLER (2007), S. 10; MACHARZINA/WOLF (2008), S. 343.<br />
172 Vgl. GARBISCH/EDLER-PAIN (2004), S. 104.<br />
Stärken (S) Schwächen (W)<br />
Ausbau-<br />
Strategien<br />
Absicherungs-<br />
Strategien<br />
Aufholungs-<br />
Strategien<br />
Vermeidungs-<br />
Strategien
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 46<br />
Aufholungs-Strategien:<br />
Die Aufholungs-Strategien, auch WO-Strategien, beinhalten die Nutzung von Chancen, die sich aus<br />
<strong>der</strong> Umwelt ergebenden, um die unternehmenseigenen Schwächen zu überwinden. Auch hier kann<br />
die WHE versuchen, durch maßgeschnei<strong>der</strong>te Dienstleistungsangebote und einem Ausbau <strong>der</strong> Serviceleistungen<br />
den Lkw-Speditionen als Vertretern des Verkehrsträgers Straße die Anteile <strong>der</strong> Verkehre<br />
abzunehmen, die sich sehr wohl mit <strong>der</strong> Bahn lohnen würden, aber zur Zeit noch auf <strong>der</strong><br />
Straße abgewickelt werden. Auch hierfür kann die reaktivierte Freiladegleisfläche für den Umschlag<br />
angeboten werden.<br />
Vermeidungs-Strategien:<br />
Vermeidungsstrategien, o<strong>der</strong> auch WT-Strategien, zielen darauf ab, die eigenen Schwächen möglichst<br />
einzudämmen, um damit eventuelle Risiken zu vermeiden. Hier sei das Flexibilitätsdefizit <strong>der</strong><br />
WHE angesprochen, welches diese ggü. Lkw-Speditionsunternehmen in zeitlicher Hinsicht hat, da<br />
Bahnverkehre im Vergleich zu Verkehren mit dem Lkw stets längere Vorlaufzeiten benötigen. Mit<br />
Hilfe relativ kurzer Betriebswege kann daher versucht werden, diese Schwäche zu vermeiden, um<br />
nicht <strong>der</strong> Bedrohung zu erliegen, weitere Marktanteile an den Verkehrsträger Straße zu verlieren.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 47<br />
4 Fazit<br />
In dieser Arbeit sollte die Freiladegleisreaktivierung <strong>der</strong> WHE mit Hilfe einer strategischen SWOT-<br />
Analyse dahingehend beurteilt werden, inwieweit sich diese Freiladegleisreaktivierung in die Unternehmensstrategie<br />
<strong>der</strong> WHE einglie<strong>der</strong>n lässt und inwiefern eine solche Reaktivierung Erfolgspotenziale<br />
für ein EVU wie die WHE birgt.<br />
Die strategische Analyse hat ergeben, dass ein reaktiviertes Freiladegleis in Kombination mit einer<br />
entsprechenden Unternehmensausrichtung gegenüber kleineren Abnehmern und einer entsprechenden<br />
Ressourcenausstattung Erfolgspotenziale bietet 173 . Ein solches Gleis stellt eine Kapazitätserweiterung<br />
dar, die sowohl einzelnen Abnehmern, wie hier <strong>der</strong> Karo As, zur Verfügung gestellt o<strong>der</strong><br />
auch als Puffer für das EVU selbst genutzt werden kann.<br />
Die Unternehmens- und Umweltanalysen als Teilanalysen <strong>der</strong> SWOT-Analyse dienten in dieser<br />
Arbeit dazu, die Stärken und Schwächen <strong>der</strong> WHE herauszustellen und ihre Chancen und Risiken<br />
abzuschätzen, damit anschließend die daraus resultierenden Strategiearten abgeleitet werden konnten.<br />
Auf diese Weise konnte gezeigt werden, dass sich das reaktivierte Freiladegleis auch in Zukunft<br />
in die Unternehmensstrategie <strong>der</strong> WHE einbetten lässt, da nur so die herausgestellten Erfolgspotenziale<br />
zukünftig realisiert werden können 174 .<br />
173 Vgl. Kapitel 3.4.<br />
174 Vgl. insb. Kapitel 3.4.4.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 48<br />
5 Literaturverzeichnis<br />
ABERLE (2003)<br />
ABERLE, G.: Transportwirtschaft: einzelwirtschaftliche und gesamtwirtschaftliche Grundlagen. 4.<br />
Aufl., München et al. 2003.<br />
AEBERHARD (1996)<br />
AEBERHARD, K.: Strategische Analyse: Empfehlungen zum Vorgehen und zu sinnvollen Methodenkombinationen.<br />
Dissertation, Universität Freiburg/Schweiz. Bern et al. 1996.<br />
AEG (2009)<br />
BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ/JURIS GMBH: Allgem<strong>eines</strong> Eisenbahngesetz. Online-Publikation<br />
im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/aeg_ 1994/gesamt.pdf“,<br />
Zugriff am 15.04.2010.<br />
ARNDT (2009)<br />
ARNDT, E.-H.: Wettbewerb bringt die Bahn voran. In: Deutsche Logistik-Zeitung. Vol. 5 (2009),<br />
No. 73, o.S. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.wisonet.de/webcgi?ST<br />
ART=A60&DOKV_DB=ZECO&DOKV_NO=int073kknie<strong>der</strong>lande_400678_new&DOKV_HS=0<br />
&PP=1“, Zugriff am 12.5.2010.<br />
BARNEY/CLARK (2007)<br />
BARNEY, J.B./CLARK, D.N.: Resource-based theory: creating and sustaining competitive advantage.<br />
Oxford et al. 2007.<br />
BEA/HAAS (2005)<br />
BEA, F.-X./HAAS, J.: Strategisches Management. 4. Aufl., Stuttgart 2005.<br />
BERCHTOLD (1985)<br />
BERCHTOLD, R.: Instrumente zur Umweltanalyse im Rahmen strategischer Unternehmensplanung.<br />
Dissertation, Universität Augsburg. Augsburg 1985.<br />
BERNDT (2001)<br />
BERNDT, T.: Eisenbahngüterverkehr. Stuttgart et al. 2001.<br />
BIMSCHG (2009)<br />
BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ/JURIS GMBH: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen<br />
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-<br />
Immissionsschutzgesetz - BImSchG). Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://<br />
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bimschg/gesamt.pdf“, Zugriff am 27.04.2010.<br />
BMJ (2010)<br />
BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ: Gesetze/Verordnungen alphabetisch sortiert. Online-Publikation<br />
im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.gesetze-im-internet.de/aktuell.html“, Zugriff am<br />
07.05.2010.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 49<br />
BMVBS (2007)<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG: Investitionsrahmenplan bis<br />
2010 für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes (IRP). Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong><br />
URL: „http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1003308/Investitionsrahmen-plan-bis-2010 -fuer-die-<br />
Verkehrsinfrastruktur-des-Bundes-IRP.pdf“, Zugriff am 06.05.2010.<br />
BMVBS (2009)<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG: Arbeitsplatzprogramm Bau<br />
und Verkehr (APBV) „Verkehr“: Maßnahmen des Innovations- und Investitionsprogramms „Verkehr“<br />
für die Jahre 2009 und 2010. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL:<br />
„http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1098676/Arbeitsplatzprogramm-Bau-und-Ver-kehr-APBVaktualisierte-Fassung-August-2009.pdf“,<br />
Zugriff am 07.05.2010.<br />
BMWI (2010)<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE: Entschlossen in <strong>der</strong> Krise, stark für den<br />
nächsten Aufschwung: Überblick über das zweite Konjunkturpaket. Online-Publikation im Internet<br />
unter <strong>der</strong> URL: „http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/ Konjunktur/konjunkturpaket-<br />
2.html“, Zugriff am 06.05.2010.<br />
BMWI/BMF (2008)<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE/BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN:<br />
Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung: Maßnahmenpaket <strong>der</strong> Bundesregierung. Online-Publikation<br />
im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.bmwi.de/BMWi/ Redaktion/<br />
PDF/W/wachstumspaket-breg-november08,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf“,<br />
Zugriff am 06.05.2010.<br />
BREITSCHUH/WÖLLER (2007)<br />
BREITSCHUH, J./WÖLLER, T.: Internationales Marketing: Ausgewählte Strategien zur Sicherung von<br />
Absatz- und Beschaffungsmärkten. München 2007.<br />
CAMPHAUSEN (2007)<br />
CAMPHAUSEN, B.: Strategisches Management: Planung, Entscheidung, Controlling. 2. Aufl., München<br />
2007.<br />
CEZANNE (2005)<br />
CEZANNE, W.: Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 6. Aufl., München 2005.<br />
DESTATIS (2008)<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT: Auszug aus dem Datenreport 2008 Umwelt und Nachhaltigkeit, Kapitel<br />
12, S. 329 - 362. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.destatis.<br />
de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Querschnittsveroeffntlichu<br />
ngen/Datenreport/Downloads/Datenreport2008Umwelt,property=file.pdf“, Zugriff am 07.05.2010.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 50<br />
DESTATIS (2009a)<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 1. Quartal 2009.<br />
Pressemitteilung Nr.197 vom 26.05.2009. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL:<br />
„http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2009/05/PD09_18<br />
5_811,templateId=ren<strong>der</strong>Print.psml“, Zugriff am 06.05.2010.<br />
DESTATIS (2009b)<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT: Güter- und Personenverkehr in <strong>der</strong> Wirtschaftskrise. Online-<br />
Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/desta<br />
tis/Internet/DE/Content/Publikationen/STATmagazin/Verkehr/2009_07/PDF2009_07,property=file.<br />
pdf“, Zugriff am 06.05.2010.<br />
DESTATIS (2009c)<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT: 2. Quartal 2009: Kurzarbeit und geringere Son<strong>der</strong>zahlungen führen zu<br />
sinkenden Nominal- und Reallöhnen. Pressemitteilung Nr.354 vom 21.09.2009. Online-Publikation<br />
im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/<br />
DE/Presse/pm/2009/09/PD09__354__623.psml“, Zugriff am 06. 05.2010.<br />
DESTATIS (2010a)<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT: Verarbeitendes Gewerbe Juli 2010: Umsatz saisonbereinigt – 0,9%<br />
zum Vormonat. Pressemitteilung Nr. 314 vom 09.09.2010. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong><br />
URL: „http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/Uebersicht/<br />
IndustrieVerarbeitendesGewerbe,templateId=ren<strong>der</strong>Print.psml“, Zugriff am 06.05.2010.<br />
DESTATIS (2010b)<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT: Güterverkehr 2009: Starker Rückgang des Transportaufkommens um<br />
11,2%. Pressemitteilung Nr.030 vom 21.01.2010. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL:<br />
„http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2010/01/PD10_03<br />
0_46.psml“, Zugriff am 06.05.2010.<br />
DESTATIS (2010c)<br />
STATISTISCHES BUNDESAMT: Umwelt: Investitionen für den Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe<br />
2007, Fachserie 19 Reihe 3.1. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „https://wwwec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?CSPCHD=00100001000046y2v8I0000000k<br />
5Pr5tUbVEBXVgGQbuEpzw--&cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1024757“, Zugriff am 06.<br />
05.2010.<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG (1998)<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG: Gesetz zur Neuregelung des Fracht-, Speditions- und Lagerrechts (Transportrechtsreformgesetz<br />
- TRG). Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://pslogitrans.de/app/download/3357125202/TRG+-+Transportrechtsreformgesetz.pdf“,<br />
Zugriff am 07.<br />
05.2010.<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG (2010a)<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG: Verkehrsinvestitionsbericht 2009. Online-Publikation im Internet unter<br />
<strong>der</strong> URL: „http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/004/1700444.pdf“, Zugriff am 06.05. 2010.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 51<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG (2010b)<br />
DEUTSCHER BUNDESTAG: Antwort <strong>der</strong> Bundesregierung auf die Kleine Anfrage <strong>der</strong> Abgeordneten<br />
Viola von Cramon-Taubadel, Stephan Kühn, Dr. Anton Hofreiter, weiterer Abgeordneter und <strong>der</strong><br />
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN – Drucksache 17/513 –: Abarbeitungsstand <strong>der</strong> Konjunkturprogramme<br />
und des Mautmehreinnahmenprogramms im Bereich Verkehr. Online-Publikation im<br />
Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/ 17/006/1700699.pdf“, Zugriff am<br />
07.05.2010.<br />
EBA (2010a)<br />
EISENBAHNBUNDESAMT: Eisenbahnverkehrsunternehmen in <strong>der</strong> BRD (öffentliche EVU). Online-<br />
Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.eba.bund.de/cln_005/SharedDocs/ Publikationen/DE/Infothek/Eisenbahnunternehmen/EVU/evu__brd,templateId=raw,property=publicationFile.<br />
xls/evu_brd.xls“, Zugriff am 18.05.2010.<br />
EBA (2010b)<br />
EISENBAHNBUNDESAMT: Nichtöffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen und Fahrzeughalter (§ 31<br />
AEG). Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.eba.bund.de/cln_005/Shared<br />
Docs/Publikationen/DE/Infothek/Eisenbahnunternehmen/EVU/evu__n_C3_B6__brd,templateId=ra<br />
w,property=publicationFile.xls/evu_n%C3%B6_brd.xls“, Zugriff am 18.05.2010.<br />
EBO (2008)<br />
BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ/JURIS GMBH: Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung. Online-<br />
Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/ebo/ gesamt.pdf“,<br />
Zugriff am 21.04.2010.<br />
ENEUOG (1993)<br />
BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ/ JURIS GMBH: Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (Eisenbahnneuordnungsgesetz<br />
- ENeuOG). Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://<br />
bundesrecht.juris.de/bundesrecht/eneuog/gesamt.pdf“, Zugriff am 07.05.2010.<br />
EUROPÄISCHER RAT (1991)<br />
EUROPÄISCHER RAT: Richtlinie des Rates vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung <strong>der</strong> Eisenbahnunternehmen<br />
<strong>der</strong> Gemeinschaft (91/440/EWG). Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL:<br />
„http://www.transportrecht.de/transportrecht_content/1040372537.pdf“, Zugriff am 07. 05.2010.<br />
EZB (2009)<br />
EUROPÄISCHE ZENTRALBANK: Jahresbericht 2008. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL:<br />
„http://www.ecb.int/pub/pdf/annrep/ar2008de.pdf“, Zugriff am 07.05.2010.<br />
FARMER/STADLER (2005)<br />
FARMER, K./STADLER, I.: Marktdynamik und Umweltpolitik. Wien 2005.<br />
GÄLWEILER (2005)<br />
GÄLWEILER, A.: Strategische Unternehmensführung. 3. Aufl., Frankfurt a.M. et al. 2005.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 52<br />
GARBISCH/EDLER-PAIN (2004)<br />
GARBISCH, C./EDLER-PAIN, J.: Beziehungsmanagement zur Sicherung einer Win-Win-Partnerschaft<br />
aus Sicht <strong>eines</strong> Logistikdienstleisters. In: Pfohl, H.-C. (Hrsg.): Erfolgsfaktor Kooperation in <strong>der</strong> Logistik:<br />
Outsourcing – Beziehungsmanagement – Finanzielle Performance. Berlin 2004. S. 101-118.<br />
GEFSTOFFV (2008)<br />
BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ/JURIS GMBH: Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung<br />
– GefStoffV). Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.gesetzeim-internet.de/bundesrecht/gefstoffv_2005/gesamt.pdf“,<br />
Zugriff am 22. 04.2010.<br />
GRANT/NIPPA (2008)<br />
GRANT, R.M./NIPPA, M.: Strategisches Management: Analyse, Entwicklung und Implementierung<br />
von Unternehmensstrategien. 5. Aufl., München et al. 2008.<br />
HENKE (2009)<br />
HENKE, M.: Eisenbahnpolitik: Wachstum im Eisenbahnsektor – nicht ohne Bedingungen. In:<br />
VERBAND DEUTSCHER VERKEHRSUNTERNEHMEN (Hrsg.): VDV Jahresbericht 2008/2009: VDV und<br />
Verkehrsunternehmen – Mobilitätspartner <strong>der</strong> Gesellschaft. Köln 2009. S. 13.<br />
HUNGENBERG (2008)<br />
HUNGENBERG, H.: Strategisches Management in Unternehmen: Ziele – Prozesse – Verfahren. 5.<br />
Aufl., Wiesbaden 2008.<br />
ICKERT/MATTHES/ROMMERSKIRCHEN ET AL. (2007)<br />
ICKERT, L./MATTHES, U./ROMMERSKIRCHEN, S./WEYAND, E./SCHLESINGER, M./LIMBERS, J.:<br />
Schlussbericht: Abschätzung <strong>der</strong> langfristigen Entwicklung des Güterverkehrs in Deutschland bis<br />
2050. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.bmvbs.de/Anlage/original_<br />
999441/Gueterverkehrs-prognose-2050.pdf“, Zugriff am 23.05.2010.<br />
ITU (2010a)<br />
INNOVATIVE TANK- UND UMWELTSCHUTZSYSTEME GMBH: FÜLLCOMAT – FÜLLCO-MOBIL.<br />
Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.itu-gmbh.de/itu_fuellcomat-tech_ daten.htm“,<br />
Zugriff am 10.01.2010.<br />
ITU (2010b)<br />
INNOVATIVE TANK- UND UMWELTSCHUTZSYSTEME GMBH: Füllcomat – Technik. Online-<br />
Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.itu-gmbh.de/itu_fuellcomat-technik. htm“, Zugriff<br />
am 22.04.2010.<br />
JUNG (2007)<br />
JUNG, H.: Controlling. 2. Aufl., München 2007.<br />
KARO AS (2010a)<br />
KARO AS UMWELTSCHUTZ GMBH: Leistung: Altöle, Emulsionen, Flüssigabfälle, sonst. Abfälle. Online-Publikation<br />
im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.karoas-umweltschutz.de/kas/content/<br />
blogcategory/45/21/lang,de“, Zugriff am 21.04.2010.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 53<br />
KARO AS (2010b)<br />
KARO AS UMWELTSCHUTZ GMBH: Sammlung: Standorte. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong><br />
URL: „http://www.karoas-umweltschutz.de/kas/content/blogcategory/40/9/lang,de“, Zugriff am 21.<br />
04.2010.<br />
KNIEPS (2009)<br />
KNIEPS, G.: Der Markt für Netzinfrastrukturkapazität: Zur Vereinbarkeit von unternehmerischer<br />
Flexibilität und Regulierung. In: WEIß, H.-J. (Hrsg.): Fallstudien zur Netzökonomie. Wiesbaden<br />
2009. S. 1-25.<br />
KORTMANN (2003)<br />
KORTMANN, K.: Eine Methode für systematische Markt-, Branchen- und Wettbewerbsanalysen.<br />
Berlin 2003.<br />
KREIKEBAUM (1997)<br />
KREIKEBAUM, H.: Strategische Unternehmensplanung. 6. Aufl., Stuttgart et al. 1997.<br />
LAST MILE LOGISTIK (2010)<br />
MARKETINGCLUB LAST MILE LOGISTIK: Stärken gemeinsam stärken. Online-Publikation im Internet<br />
unter <strong>der</strong> URL: „http://www.lastmile-logistik.de/index.php?option=com_content&view=article&id<br />
=55&Itemid=55“, Zugriff am 22.05.2010.<br />
LAY/JUNG ERCEG (2002)<br />
LAY, G./JUNG ERCEG, P.: Produktbegleitende Dienstleistungen: Konzepte und Beispiele erfolgreicher<br />
Strategieentwicklung. Berlin et al. 2002.<br />
LOGISTIKCLUSTER NRW (2010)<br />
LOGISTIKCLUSTER NRW: Arbeitsbereiche. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://<br />
www.logistik.nrw.de/index.php?id=69“, Zugriff am 22.05.2010.<br />
LOMBRISER/ABPLANALP (2005)<br />
LOMBRISER, R./ABPLANALP, P.A.: Strategisches Management: Visionen entwickeln – Strategien<br />
umsetzen – Erfolgspotenziale aufbauen. 4. Aufl., Zürich 2005.<br />
MACHARZINA/WOLF (2008)<br />
MACHARZINA, K./WOLF, J.: Unternehmensführung: Das internationale Managementwissen: Konzepte<br />
– Methoden – Praxis. 6. Aufl., Wiesbaden 2008.<br />
MAEKAS (2010)<br />
VERBUNDPROJEKT MAEKAS: Das Verbundprojekt MAEKAS. Online-Publikation im Internet unter<br />
<strong>der</strong> URL: „http://www.maekas.wiwi.uni-due.de/ueber-maekas/“, Zugriff am 20.05.2010.<br />
MINERALÖL-RAFFINERIE DOLLBERGEN GMBH (2010)<br />
MINERALÖL-RAFFINERIE DOLLBERGEN GMBH: Partner. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong><br />
URL: „http://www.mineraloel-raffinerie.de“, Zugriff am 21.04.2010.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 54<br />
OECD (2008)<br />
OECD: OECD – Umweltausblick bis 2030. Berlin 2008.<br />
PFOHL (2004)<br />
PFOHL, H.-C.: Grundlagen <strong>der</strong> Kooperation in logistischen Netzwerken. In: Pfohl, H.-C. (Hrsg.): Erfolgsfaktor<br />
Kooperation in <strong>der</strong> Logistik: Outsourcing – Beziehungsmanagement – Finanzielle Performance.<br />
Berlin 2004. S. 1-38.<br />
PÜMPIN (1992)<br />
PÜMPIN, C.: Strategische Erfolgspositionen: Methodik <strong>der</strong> dynamischen strategischen Unternehmensführung.<br />
Bern et al. 1992.<br />
RECKEL/KOWALSKI (2009)<br />
RECKEL, D./KOWALSKI, M.: Success Stories <strong>der</strong> WHE im Verbundprojekt MAEKAS: Müntefering-<br />
Gockeln – Reaktivierung <strong>eines</strong> Gleisanschlusses. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL:<br />
„http://www.maekas.wiwi.uni-due.de/fileadmin/fileupload/PROJEKT-MAEKAS/PDFs/Success_St<br />
ories/Success_Stories_<strong>der</strong>_WHE_im_Verbundprojekt_MAEKAS-neu-1.pdf“, Zugriff am 03.05.<br />
2010.<br />
SCHULZE (2006)<br />
SCHULZE, A.: Liberalisierung von Netzindustrien: Eine ökonomische Analyse am Beispiel <strong>der</strong> Eisenbahn,<br />
<strong>der</strong> Telekommunikation und <strong>der</strong> leitungsgebundenen Energieversorgung. Dissertation,<br />
Universität Potsdam. Potsdam 2006.<br />
SCI (2010)<br />
SCI VERKEHR: Es geht stetig aufwärts: SCI Logistikbarometer: Geschäftsklima erreicht annähernd<br />
Vorkrisenniveau / Deutlich bessere Lage. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://<br />
www.sci.de/fileadmin/user_upload/logistikbarometer/pdf/050DVZ10-I006.pdf“, Zugriff am 07.05.<br />
2010.<br />
SIMON/VON DER GATHEN (2002)<br />
SIMON, H./VON DER GATHEN, A.: Das große Handbuch <strong>der</strong> Strategie-Instrumente: Werkzeuge für<br />
eine erfolgreiche Unternehmensführung. Frankfurt a.M. et al. 2002.<br />
STEINMANN/SCHREYÖGG (2005)<br />
STEINMANN, H./SCHREYÖGG, G.: Management: Grundlagen <strong>der</strong> Unternehmensführung Konzepte –<br />
Funktionen – Fallstudien. 6. Aufl., Wiesbaden 2005.<br />
STIEGELER (2007)<br />
STIEGELER, J.: Entwicklung des Güterverkehrs: Analysen und Handlungsalternativen unter ökologischen<br />
Aspekten. Saarbrücken 2007.<br />
VDV (2010)<br />
VERBAND DEUTSCHER VERKEHRSUNTERNEHMEN: Wir über uns. Online-Publikation im Internet unter<br />
<strong>der</strong> URL: „http://www.vdv.de/wir_ueber_uns/wir_ueber_uns.html?pe_id=1“, Zugriff am 22.05.<br />
2010.
Hauff: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH Seite 55<br />
VORRATH (2008)<br />
VORRATH, E.: Strukturentwicklungen auf dem europäischen Schienengüterverkehrsmarkt. Online-<br />
Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://iovg.cumed-fileserver.de/33/33_im pulsreferat1.pdf“,<br />
Zugriff am 12.05.2010.<br />
WELGE/AL-LAHAM (2008)<br />
WELGE, M.K./AL-LAHAM, A.: Strategisches Management: Grundlagen – Prozesse – Implementierung.<br />
5. Aufl., Wiesbaden 2008.<br />
WHE (2009a)<br />
WHE: Geschichte. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.whe.de/cms<br />
_de/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=55&f313e2a7d67db70a4eb279<br />
30cf50f058=384216b59829e5ae879cb4af190b5a42“, Zugriff am 10.01.2010.<br />
WHE (2009b)<br />
WHE: Fakten. Online-Publikation im Internet unter <strong>der</strong> URL: „http://www.whe.de/cms_de/index.<br />
php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=55“, Zugriff am 10.01.2010.
Autoren:<br />
BWL B.Sc. Alexandra Hauff<br />
E-Mail: Alexandra.Hauff@stud.uni-due.de<br />
Dipl.-Inf. Martin Kowalski<br />
E-Mail: Martin.Kowalski@pim.uni-due.de<br />
Projektberichte des Verbundprojekts MAEKAS<br />
Impressum:<br />
Institut für Produktion und<br />
Industrielles Informationsmanagement<br />
Universität Duisburg-Essen, Campus Essen<br />
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften<br />
Universitätsstraße 9, 45141 Essen<br />
Website (Institut PIM): www.pim.wiwi.uni-due.de<br />
Website (MAEKAS): www.maekas.wiwi.uni-due.de<br />
ISSN: 1866-9255<br />
Das Drittmittelprojekt MAEKAS (“Management von projektbezogenen Allianzen zwischen lokalen und über-<br />
regionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen für kundenspezifische Akquisitionsstrategien”) wird mit Mitteln<br />
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) innerhalb des Rahmenkonzepts “Intelligen-<br />
te Logistik im Güter- und Wirtschaftsverkehr” geför<strong>der</strong>t und vom Projektträger Mobilität und Verkehr, Bauen<br />
und Wohnen (PTMVBW), <strong>der</strong> TÜV Rheinland Consulting GmbH, betreut. Die Projektpartner danken für die<br />
großzügige Unterstützung ihrer Forschungs- und Transferarbeiten.<br />
Partner aus <strong>der</strong> Praxis:<br />
SBB Cargo GmbH<br />
Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH<br />
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG<br />
<strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong> Eisenbahn und Hafen GmbH
Projektberichte des Verbundprojekts MAEKAS<br />
Universität Duisburg-Essen – Campus Essen<br />
Institut für Produktion und Industrielles Informationsmanagement<br />
Projektberichte des Verbundprojekts MAEKAS<br />
ISSN 1866-9255<br />
Nr. 1 Zelewski, S.: Überblick über das Verbundprojekt MAEKAS – Management von projektbezogenen<br />
Allianzen zwischen lokalen und überregionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen<br />
für kundenspezifische Akquisitionsstrategien. Essen 2008.<br />
Nr. 2 Zelewski, S.; Saur, A.; Klumpp, M.: Co-operative Rail Cargo Transport Effects. Essen 2008.<br />
Nr. 3 Zelewski, S.; Koppers, L.; Klumpp, M.: Supply Chain Cooperation. Essen 2009.<br />
Nr. 4 Günes, N.: Analyse <strong>der</strong> Ausgangssituation bei den Praxispartnern: Leistungsangebot –<br />
Kompetenzen – Geschäftsprozesse. Essen 2009.<br />
Nr. 5 Hertrampf, S.: Kernkompetenzen aus <strong>der</strong> Perspektive des Resource-based View – mit Fokus<br />
auf Kernkompetenzen von Eisenbahnverkehrsunternehmen. Essen 2009.<br />
Nr. 6 Hertrampf, S.: Das Konzept virtueller Unternehmen – konkretisiert für projektbezogene<br />
strategische Allianzen zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Essen 2009.<br />
Nr. 7 Hertrampf, S.: Motivationskonzepte für Wissensteilung und gemeinsame Wissensanwendung<br />
in virtuellen Unternehmen <strong>der</strong> zweiten Generation – unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung<br />
des Wissensmanagements von Eisenbahnverkehrsunternehmen. Essen 2009.<br />
Nr. 8 Zelewski, S.; Saur, A.: Vermeidung von Leerfahrten für Eisenbahnverkehrsunternehmen<br />
durch „intelligente“ Nachfragebündelung – eine <strong>Beurteilung</strong> <strong>der</strong> ökonomischen und ökologischen<br />
Effizienz. Essen 2009.<br />
Nr. 9 Hertrampf, S.: Etablierung einer Kooperationsstruktur für ein virtuelles Unternehmen <strong>der</strong><br />
zweiten Generation – ein Ansatz auf <strong>der</strong> Basis von Rollenmodellierung und Konfliktmanagement.<br />
Essen 2009.<br />
Nr. 10 Hertrampf, S.: Wissensmanagement in strategischen Allianzen lokaler und überregionaler<br />
Eisenbahnverkehrsunternehmen – Wissensbarrieren und Managementinstrumente zu ihrer<br />
Überwindung. Essen 2009.<br />
Nr. 11 Hertrampf, S.: Offenlegung, Verbreitung und Anwendung kooperationsrelevanten Wissens<br />
in Unternehmensnetzwerken – Entwicklung und Erprobung <strong>eines</strong> Unterstützungskonzepts<br />
für die betriebliche Praxis. Essen 2009.<br />
Nr. 12 Günes, N.: Schienengüterverkehrsmarkt 2009 im Ruhrgebiet: Marktanalyse – Logistikpotenzial<br />
– Branchenanalyse – Kunden. Essen 2009.<br />
Nr. 13 Günes, N.: Das 4-Phasenmodell <strong>der</strong> Gleisanschlussreaktivierung. Essen 2009.<br />
Nr. 14 Günes, N.: Güterverkehrsleistungen im Verbundprojekt MAEKAS: Basisleistungen – Zusatzleistungen<br />
– Gewerbeflächenvermittlung. Essen 2009.<br />
Nr. 15 Thorant, C.: Rechtliche Analyse von virtuellen Unternehmen <strong>der</strong> ersten und zweiten Generation.<br />
Essen 2009.
Projektberichte des Verbundprojekts MAEKAS<br />
Nr. 16 Klumpp, M.; Kowalski, M.; Bielesch, B.: Erweiterte Wirtschaftlichkeitsanalyse für Eisenbahnverkehrsunternehmen.<br />
Essen 2009.<br />
Nr. 17 Hertrampf, S.: Kooperationen im Schienengüterverkehr. Essen 2009.<br />
Nr. 18 Klumpp, M.; Kowalski, M.; Bielesch, B.: Computergestützte Verkehrsträgervergleichsrechnung<br />
Straße – Schiene. Essen 2009.<br />
Nr. 19 Saur, A.; Kühn, T.; Pistorius, M.; Schlich, B.: Erfassung von Schadstoffreduktionen im<br />
Rahmen strategischer Allianzen zwischen überregionalen und regionalen Eisenbahnverkehrsunternehmen.<br />
Essen 2009.<br />
Nr. 20 Hertrampf, S.; Kowalski, M.: Integration von kooperationsrelevanten, wissensintensiven<br />
Geschäftsprozessen in einer projektbezogenen strategischen Allianz von Eisenbahnverkehrsunternehmen.<br />
Essen 2009.<br />
Nr. 21 Hauff, A.; Kowalski, M.: <strong>Beurteilung</strong> <strong>eines</strong> <strong>Gleisreaktivierungsprojekts</strong> <strong>der</strong> <strong>Wanne</strong>-<strong>Herner</strong><br />
Eisenbahn und Hafen GmbH mit Hilfe einer strategischen SWOT-Analyse. Essen 2010.