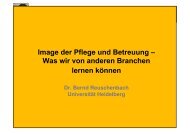Die Koordination für Betreuung und Pflege bei den regionalen ... - JKU
Die Koordination für Betreuung und Pflege bei den regionalen ... - JKU
Die Koordination für Betreuung und Pflege bei den regionalen ... - JKU
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
pflegerecht.manz.atP.b.b. Verlagsort 1010 Wien Plus.Zeitung 10Z038521PEditorialDr. Martin GreifenederRichter am Landesgericht WelsDr. Klaus Mayr, LL.M.Ar<strong>bei</strong>terkammer OÖÖZPR-Seminar „<strong>Pflege</strong> & Recht 2011“Österreichische Zeitschrift fürPFLEGERECHTZeitschrift für die Heim- <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>praxis <strong>und</strong> KrankenanstaltenMehr als 100 Teilnehmer <strong>bei</strong>Fachveranstaltung im Arcotel in Linz!Am 13. 10. 2011 durften wir im Linzer Arcotelmehr als 100 Teilnehmerinnen <strong>und</strong> Teilnehmer<strong>bei</strong>m restlos ausgebuchten ersten österreichischenFachseminar für „<strong>Pflege</strong> & Recht“ begrüßen. <strong>Die</strong>Präsi<strong>den</strong>tin des Österreichischen Ges<strong>und</strong>heits<strong>und</strong>Krankenpflegeverbandes, Frau Ursula Frohner,unterstrich in ihren Grußworten die Bedeutungdieses Fachseminars sowie der ÖsterreichischenZeitschrift für <strong>Pflege</strong>recht für die <strong>Pflege</strong>praxis. Nebenzahlreichen <strong>Pflege</strong>dienst- <strong>und</strong> Heimleitungennahmen auch Geschäftsführer von Sozialvereinensowie Vertreter der Interessenvertretungen <strong>und</strong>Sachverständige etc teil. <strong>Die</strong> Vorträge zu <strong>den</strong> ThemenNeuerungen <strong>bei</strong>m <strong>Pflege</strong>geld samt Einbindung von <strong>Pflege</strong>fachkräftenin die Begutachtung (Dr. Greifeneder, Richter LGWels), Ar<strong>bei</strong>tszeit (Dr. Mayr, AK OÖ), Haftung (HR Dr. Neumayr,OGH) <strong>und</strong> GuKG (Univ.-Prof. Dr. Pfeil) fan<strong>den</strong> großes Interesse<strong>und</strong> gaben Anlass zu reger Diskussion. <strong>Die</strong> vielen positivenRückmeldungen seitens der Seminarteilnehmer bestärken uns, diesenösterreichischen <strong>Pflege</strong>rechtstag in Hinkunft jährlich abzuhalten<strong>und</strong> zu einem festen Bestandteil im Fortbildungskalender der<strong>Pflege</strong> wer<strong>den</strong> zu lassen.ISSN 2079-0953Schriftleitung: Martin Greifeneder <strong>und</strong> Klaus MayrGuKG, Ar<strong>bei</strong>tsrecht & AnstaltenrechtMuster: Betriebsvereinbarungzur Suchtprävention<strong>Pflege</strong>geld & SozialrechtPilotprojekt Begutachtung durch<strong>Pflege</strong>fachkräfte – ErgebnisseHeimAufG & UbGDer neue § 34 a UbGin der RechtsprechungHaftung, Kosten & Qualität<strong>Koordination</strong> für <strong>Betreuung</strong><strong>und</strong> <strong>Pflege</strong> <strong>bei</strong> <strong>regionalen</strong> Trägernsozialer HilfeErstveröffentlichung!6/2011In der vorliegen<strong>den</strong> Zeitschrift bil<strong>den</strong> die Ergebnissedes Pilotprojekts betreffend Begutachtungdurch <strong>Pflege</strong>kräfte <strong>bei</strong>m <strong>Pflege</strong>geld sowieTeil I des Beitrags über medikamentöse Freiheitsbeschränkungnach dem HeimAufG die Schwerpunkte.Daneben erwarten Sie aber auch andereinteressante Beiträge, etwa zu Fragen der Ethik<strong>und</strong> Suchtprävention.Wie gewohnt wer<strong>den</strong> zudem in jeder Rubrikaktuelle Gerichtsentscheidungen kurz dargestellt<strong>und</strong>/oder von Ihnen gestellte Fragen beantwortet.Wir hoffen, wieder Ihr Interesse getroffen zuhabenn <strong>und</strong> freuen uns wie immer auf allfälligeRückmeldungen bzw Anregungen Ihrerseits.Mit der letzten Ausgabe in diesem Jahr weihnachtetes schon sehr, sodass wir Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest2011 <strong>und</strong> das Allerbeste für 2012 wünschen möchten!Wir hoffen, Sie auch 2012 wieder als LeserInnen begrüßen zukönnen.PS: Anregungen, Kommentare oder Fragen sen<strong>den</strong> Sie bitte anoezpr@manz.atÖZPR 2011/125Martin Greifeneder, Klaus Mayr, Ursula Frohner, Heinz KorntnerImpressumMedieninhaber (Verleger) <strong>und</strong> Herausgeber: MANZ’sche Verlags- <strong>und</strong> Universitätsbuchhandlung GmbH. Sitz der Gesellschaft: A-1014 Wien, Kohlmarkt 16, FN 124 181 w, HG Wien.Unternehmensgegenstand: Verlag von Büchern <strong>und</strong> Zeitschriften. Verlagsadresse: A-1015 Wien, Johannesgasse 23 (verlag@manz.at). Geschäftsführung: Mag. Susanne Stein(Geschäftsführerin) sowie Prokurist Dr. Wolfgang Pichler (Verlagsleitung). Schriftleitung: Dr. Martin Greifeneder, Dr. Klaus Mayr, LL.M. Redaktion: MR Dr. in Sylvia Füszl, Mag.Dr. Christian Gepart, Mag. Stefan Koppensteiner, Hon.-Prof. HR Dr. Matthias Neumayr, Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil, Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch, MR Dr. in Anna Ritzberger-Moser,Prof. Dr. Johannes Rudda, HR Dr. Hans Peter Zierl. E-Mail: oezpr@manz.at Verlagsredaktion: Mag. Katharina Hnatek-Petrak, E-Mail: katharina.hnatek@manz.at Druck: FerdinandBerger & Söhne Ges. m. b. H., 3580 Horn. Verlags- <strong>und</strong> Herstellungsort: Wien. Gr<strong>und</strong>legende Richtung: Veröffentlichung von Beiträgen zum Thema <strong>Pflege</strong>recht <strong>und</strong> Heimrecht.Zitiervorschlag: ÖZPR 2011/Nummer, Seite. Anzeigen: Heidrun R. Engel, Tel: (01) 531 61-310, Fax: (01) 531 61-181, E-Mail: heidrun.engel@manz.at Bezugsbedingungen: <strong>Die</strong> ÖZPRerscheint 6 Mal jährlich. Der Bezugspreis beträgt € 84,–. Nicht rechtzeitig vor ihrem Ablauf abbestellte Abonnements gelten für ein weiteres Jahr als erneuert. Abbestellungen sindschriftlich 6 Wochen vor Jahresende an <strong>den</strong> Verlag zu sen<strong>den</strong>. Einzelheft: € 16,80. AZR: Alle Abkürzungen entsprechen <strong>den</strong> „Abkürzungs- <strong>und</strong> Zitierregeln“ (AZR), 6. Auflage (VerlagManz, 2008). Urheberrechte: Mit der Einreichung seines Manuskriptes räumt der Autor dem Verlag für <strong>den</strong> Fall der Annahme das übertragbare, zeitlich <strong>und</strong> örtlich unbeschränkteausschließliche Werknutzungsrecht (§ 24 UrhG) der Veröffentlichung in dieser Zeitschrift, einschließlich des Rechts der Vervielfältigung in jedem technischen Verfahren(Druck, Mikrofilm etc) <strong>und</strong> der Verbreitung (Verlagsrecht) sowie der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, einschließlich des Rechts der Vervielfältigungauf Datenträgern jeder Art, auch einschließlich CD-ROM, der Speicherung in <strong>und</strong> der Ausgabe durch Datenbanken, der Verbreitung von Vervielfältigungsstücken an die Benutzer,der Sendung (§ 17 UrhG) <strong>und</strong> sonstigen öffentlichen Wiedergabe (§ 18 UrhG), ein. Gemäß § 36 Abs 2 UrhG erlischt die Ausschließlichkeit des eingeräumten Verlagsrechtsmit Ablauf des dem Erscheinen des Beitrags folgen<strong>den</strong> Kalenderjahrs; dies gilt für die Verwertung durch Datenbanken nicht. Der Nachdruck von Entscheidungen ist daher nurmit ausdrücklicher schriftlicher Bewilligung des Verlags gestattet. Haftungsausschluss: Sämtliche Angaben in dieser Zeitschrift erfolgen trotz sorgfältiger Bear<strong>bei</strong>tung ohne Gewähr.Eine Haftung der Herausgeber, der Autoren sowie des Verlags ist ausgeschlossen. Grafisches Konzept: Michael Fürnsinn für buero8, 1070 Wien.ÖZPR 6 | 2011 161
InhaltGuKG, Ar<strong>bei</strong>tsrecht &Anstaltenrecht163 INTRO164 <strong>Pflege</strong>forschung – eine neue Aufgabeder Ethikkommissionen166 Betriebsvereinbarung zur Suchtprävention169 RechtsprechungVertragsbedienstetenrechtHeimAufG & UbG181 INTRO182 Medikamentöse Freiheitsbeschränkungennach dem HeimAufG – Manual 2011Teil I – Allgemeine Gr<strong>und</strong>lagen185 Der neue § 34 a UbG in der Rechtsprechung188 RechtsprechungZustimmung des Vertreters zur Freiheitsbeschränkung einesBewohners?188 Fragen aus der Praxis<strong>Pflege</strong>geld & Sozialrecht171 INTRO172 Begutachtung durch <strong>Pflege</strong>fachkräfteErgebnisse des Pilotprojekts176 Einbindung von diplomierten <strong>Pflege</strong>fachkräftenin die <strong>Pflege</strong>geldbegutachtung ab1. 1. 2012179 Auch pflegen<strong>den</strong> Angehörigen kommtdas <strong>Pflege</strong>geldreformgesetz 2012 zugute180 Fragen aus der PraxisHaftung, Kosten &Qualität189 INTRO190 <strong>Die</strong> <strong>Koordination</strong> für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong><strong>bei</strong> <strong>den</strong> <strong>regionalen</strong> Trägern sozialer Hilfe:Rollen, Aufgaben <strong>und</strong> Einflusschancen192 RechtsprechungAnspruch auf Spitalskostenrückersatz im Rahmen der Sozialhilfe162 ÖZPR 6 | 2011
GuKG, Ar<strong>bei</strong>tsrecht & AnstaltenrechtMR Dr. in Sylvia FüszlB<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit<strong>Pflege</strong>forschung – eine neue Aufgabeder Ethikkommissionen<strong>Pflege</strong>forschung, Ethikkommission, <strong>Pflege</strong>wissenschaft. Im Beitrag wer<strong>den</strong> die Aufgabender Ethikkommission <strong>bei</strong> der <strong>Pflege</strong>forschung <strong>und</strong> damit zusammenhängende organisatorischeNeuerungen vorgestellt.<strong>Pflege</strong>wissenschaft <strong>und</strong><strong>Pflege</strong>forschung<strong>Pflege</strong> als <strong>Die</strong>nstleistung hat eine langeTradition, <strong>Pflege</strong>forschung ist wesentlichjüngeren Datums. <strong>Die</strong> erste Fachveröffentlichungüber klinische <strong>Pflege</strong>forschungstammt von Florence Nightingale aus demJahr 1858. Das Bedürfnis, zu forschen <strong>und</strong>die Effektivität von <strong>Pflege</strong>dienstleistungenzu erhöhen, hat in <strong>den</strong> letzten Jahren einebesondere Verstärkung erfahren. Technologische<strong>und</strong> insbesondere demographischeEntwicklung führen zu einem steigen<strong>den</strong>Bedarf an <strong>Pflege</strong>, der in Widerspruch mit<strong>den</strong> begrenzten Möglichkeiten <strong>und</strong> budgetärenRestriktionen im Ges<strong>und</strong>heitswesen<strong>und</strong> auf dem Gebiet der Langzeitpflegesteht. <strong>Die</strong>s führt zu neuen Herausforderungenin Effizienz- <strong>und</strong> Effektivitätssteigerungvon <strong>Pflege</strong>. Um darauf angemessenreagieren zu können, wer<strong>den</strong> relevante <strong>und</strong>valide Daten benötigt, die nur durch klinische<strong>Pflege</strong>forschung zu gewinnen sind.Daher ist <strong>Pflege</strong>forschung auch ein Mittelder Qualitätssicherung für <strong>Pflege</strong> <strong>und</strong> Patienten.An der Universität Wien besteht dasInstitut für <strong>Pflege</strong>wissenschaften seit 2005.<strong>Die</strong>s ist je<strong>den</strong>falls als Indiz dafür zu sehen,dass <strong>Pflege</strong>wissenschaft in Österreich zwarlangsam, aber doch als wissenschaftlicheDisziplin Anerkennung erfährt.<strong>Pflege</strong>forschung ist auchein Mittel der Qualitätssicherungfür <strong>Pflege</strong> <strong>und</strong>Patienten.Seit April 2008 gibt es die Möglichkeit,die Ausbildung im gehobenen <strong>Die</strong>nst fürGes<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflege auch alsBachelor-Studiengang an einer Fachhochschulezu absolvieren. <strong>Die</strong>ser Zug zur Akademisierung<strong>bei</strong> nichtärztlichen Ges<strong>und</strong>heitsberufen(auch für gehobene medizinisch-technische<strong>Die</strong>nste <strong>und</strong> Hebammenwurde die Möglichkeit der Absolvierungihrer Ausbildung im Wege von Fachhochschul-Bachelorstudiengängenermöglicht)führt zu einem weiteren Schub im Bereichder einschlägigen Forschung, da diese oftmalszum Erwerb von Diplomen erforderlichist (Qualifikationsforschung).Um Ergebnisse von Forschungsprojektenin hochwertigen Fachzeitschriften publizierenzu können, wird vielfach das positiveVotum einer Ethikkommission gefordert.Nachdem die Beurteilung von <strong>Pflege</strong>forschungsprojektenjedoch nicht explizitals Aufgabe der Ethikkommissionen imB<strong>und</strong>esgesetz über Krankenanstalten <strong>und</strong>Kuranstalten genannt war, haben mancheEthikkommissionen unter Hinweis aufmangelnde Zuständigkeit solche Beurteilungenverweigert.Novelle zum B<strong>und</strong>esgesetz überKrankenanstalten <strong>und</strong> Kuranstalten,BGBl I 2009/124Bereits seit 1988 findet sich im B<strong>und</strong>esgesetzüber Krankenanstalten <strong>und</strong> Kuranstalten(KAKuG) eine Regelung über die Verpflichtungvon Krankenanstaltenträgern,zur Beurteilung von klinischen Prüfungenvon Arzneimitteln eine Ethikkommissioneinzurichten. Eine Ethikkommission kannauch für mehrere Krankenanstalten zuständigsein (in <strong>den</strong> meisten B<strong>und</strong>esländerngibt es eine Ethikkommission, die für alleKrankenanstalten zuständig ist). Ethikkommissionensind interdisziplinär zusammengesetzteGremien, <strong>bei</strong> <strong>den</strong>en wissenschaftlicherSachverstand <strong>und</strong> die Sichtweisevon Laien, wie Patientenvertreter, Seelsorgeroder Juristen, eine umfassende ethischeBeurteilung eines Forschungsprojektsermöglichen soll. 1993 wurde die Aufgabeder Ethikkommission im KAKuG um dieBeurteilung neuer medizinischer Metho<strong>den</strong>in Krankenanstalten erweitert, mit demMedizinproduktegesetz um die Beurteilungvon klinischen Prüfungen von Medizinprodukten.Im Hinblick auf die wachsende Bedeutungder <strong>Pflege</strong>forschung <strong>und</strong> unter demGesichtspunkt, dass auch solche Studientunlichst nur nach ethischer Beurteilungvorgenommen wer<strong>den</strong> sollen, erfolgt in§ 8 c KAKuG eine Erweiterung der Aufgabender Ethikkommissionen in Krankenanstalten.Eine gewisse Lücke besteht nachwie vor dann, wenn <strong>Pflege</strong>forschung nichtim Spitalssetting, sondern etwa im Rahmender Hauskrankenpflege oder in <strong>Pflege</strong>heimenerfolgt, <strong>und</strong> könnte etwa im Rahmeneines umfassen<strong>den</strong> Forschungsgesetzesin Österreich geschlossen wer<strong>den</strong>.<strong>Die</strong> Erweiterung betraf sowohl <strong>Pflege</strong>forschungsprojekte(experimentelle <strong>und</strong><strong>Pflege</strong>interventionsstudien) als auch dieAnwendung neuer <strong>Pflege</strong>konzepte <strong>und</strong>-metho<strong>den</strong>. Experimentelle Studiendesignsuntersuchen Ursachen <strong>und</strong> Wirkungen ineinem kontrollierten Setting, während Interventionsstudiendeskriptiv sind. Auchdie Beurteilung der Anwendung neuer <strong>Pflege</strong>konzepte<strong>und</strong> -metho<strong>den</strong> – ohne Einbettungin ein systematisches Forschungsvorhaben– wurde in Anlehnung an die neuenmedizinischen Metho<strong>den</strong> als Aufgabe derEthikkommission definiert. Es ergibt sichaus <strong>den</strong> berufsrechtlichen Vorgaben, dass<strong>Pflege</strong>studien <strong>und</strong> die Anwendung neuer<strong>Pflege</strong>konzepte <strong>und</strong> -metho<strong>den</strong> nur im eigenverantwortlichenTätigkeitsbereich inBetracht kommen.Im Gegensatz zu <strong>den</strong> klinischen Prüfungen<strong>und</strong> der Anwendung neuer medizinischerMetho<strong>den</strong> ist die Befassung derEthikkommission im vorliegen<strong>den</strong> Zusammenhangnicht obligatorisch. Eine Befassungwird – nach <strong>den</strong> Erläuterungen zurRegierungsvorlage – je<strong>den</strong>falls dann zu erfolgenhaben, wenn die Innovation aus derSicht der Interessenlage des Patienten tatsächlicheiner Beurteilung durch die Ethikkommissionbedarf.Das Beurteilungsspektrum der Ethikkommissionbezieht sich im gegebenen Zusammenhangje<strong>den</strong>falls auf die mitwirken<strong>den</strong>Personen <strong>und</strong> vorhan<strong>den</strong>en Einrichtungen(personelle <strong>und</strong> strukturelle Rahmenbedingungen),<strong>den</strong> Prüfplan im Hinblickauf die Zielsetzung <strong>und</strong> die wissen-164 ÖZPR 6 | 2011
GuKG, Ar<strong>bei</strong>tsrecht & Anstaltenrechtschaftliche Aussagekraft sowie die Art <strong>und</strong>Weise, in der die Auswahl der Teilnehmerdurchgeführt wird <strong>und</strong> in der Aufklärung<strong>und</strong> Zustimmung zur Teilnahme erfolgen.Im Hinblick auf die wachsendeBedeutung der <strong>Pflege</strong>forschung<strong>und</strong> da auchsolche Studien nach ethischerBeurteilung vorgenommenwer<strong>den</strong> sollen,erfolgte eine Erweiterungder Aufgaben der Ethikkommissionenin Krankenanstalten.Im Hinblick auf die bis dahin eher„medizinlastige“ Ausrichtung der Ethikkommissionmussten auch organisatorischeFragen geklärt <strong>und</strong> geregelt wer<strong>den</strong>.So erfolgte eine Klarstellung, dass <strong>bei</strong><strong>Pflege</strong>forschungsprojekten die Befassungder Ethikkommission durch <strong>den</strong> Leiter des<strong>Pflege</strong>dienstes zu erfolgen hat. <strong>Die</strong> ärztlichenLeiter der Organisationseinheiten, an<strong>den</strong>en das Projekt durchgeführt wer<strong>den</strong>soll, sind zu informieren. <strong>Die</strong>s erfolgte mitdem Argument, dass pflegerische Belangedurchaus Rückwirkungen auf die medizinischeBehandlung haben könnten <strong>und</strong> daherein entsprechender Informationsflussgesichert sein muss. Daher hat der Leiterjener Organisationseinheit, an der ein <strong>Pflege</strong>forschungsprojektoder die Anwendungneuer <strong>Pflege</strong>konzepte oder -metho<strong>den</strong>durchgeführt wer<strong>den</strong> soll, das Recht, imRahmen der Sitzung der Ethikkommissionzu dem geplanten Forschungsprojekt Stellungzu nehmen.<strong>Die</strong> Protokolle über die Sitzung <strong>und</strong>Beurteilung der Ethikkommission sinddem Leiter des <strong>Pflege</strong>dienstes <strong>und</strong> <strong>den</strong>ärztlichen Leitern der betroffenen Organisationseinheitenzur Kenntnis zu bringen.Der Ethikkommission gehörten schonvon Anfang an Angehörige des <strong>Pflege</strong>dienstesan. Bei der Beurteilung von <strong>Pflege</strong>forschungsprojekten<strong>und</strong> der Anwendungneuer <strong>Pflege</strong>- <strong>und</strong> Behandlungskonzepte<strong>und</strong> neuer <strong>Pflege</strong>- <strong>und</strong> Behandlungsmetho<strong>den</strong>muss der Ethikkommission nunmehrauch eine Person angehören, die über Expertisehinsichtlich Metho<strong>den</strong> der qualitativenForschung verfügt, da für diesen Bereichdie im Rahmen von klinischen Prüfungendominieren<strong>den</strong> statistischen Metho<strong>den</strong>teilweise als nicht sachadäquat angesehenwur<strong>den</strong>. Unter Umstän<strong>den</strong> könnenauch qualitative <strong>und</strong> quantitative Erhebungs-<strong>und</strong> Auswertungsmetho<strong>den</strong> kombiniertwer<strong>den</strong>, um die Vorteile <strong>bei</strong>der Metho<strong>den</strong>zu nützen.Weitere InhalteEntsprechend dem Vorbild im Arzneimittelgesetz<strong>und</strong> Medizinproduktegesetz <strong>und</strong>im Hinblick auf <strong>den</strong> Beschluss der Bioethikkommission<strong>bei</strong>m B<strong>und</strong>eskanzleramtvom 15. 11. 2008 betreffend Empfehlungenmit Genderbezug für Ethikkommissionen<strong>und</strong> klinische Studien wurde klargestellt,dass <strong>bei</strong> der Zusammensetzung der Ethikkommissionauch auf ein ausgewogenesGeschlechterverhältnis zu achten ist.Zum ThemaInternationalen Vorbildern folgend,wurde für Mitglieder der Ethikkommissioneine „Conflict-of-interest-Erklärung“vorgeschrieben, um <strong>bei</strong> dieser Personengruppeschon <strong>den</strong> Anschein einer Befangenheitzu vermei<strong>den</strong>. Mögliche Interessenkonfliktesollen schon präventiv aufgear<strong>bei</strong>tetwer<strong>den</strong> können. Deshalb habendie Mitglieder der Ethikkommission gegenüberdem Träger ihre Beziehungen zurpharmazeutischen Industrie bzw zur Medizinprodukteindustrieoffenzulegen. <strong>Die</strong>sgilt sowohl für die erstmalige Offenlegung<strong>bei</strong> der Berufung als Mitglied einer Ethikkommissionals auch für jede weitere Veränderungin <strong>den</strong> Beziehungen zur pharmazeutischenIndustrie bzw Medizinprodukteindustrie.In weiterer Folge haben sich die Mitgliederder Ethikkommission in sämtlichenAngelegenheiten, in <strong>den</strong>en eine solche Beziehungzur pharmazeutischen Industriebzw der Medizinprodukteindustrie geeignetist, ihre Unabhängigkeit <strong>und</strong> Unbefangenheitzu beeinflussen, zu enthalten. Danebensind im Anlassfall auch weitere Befangenheitsgründe(vgl §§ 7 <strong>und</strong> 53 AVG)relevant.ÖZPR 2011/127In KürzeDurch die Novelle des B<strong>und</strong>esgesetzes über Krankenanstalten <strong>und</strong> Kuranstalten 2009 wurdeausdrücklich klargestellt, dass die Beurteilung von <strong>Pflege</strong>forschungsprojekten (experimentelle<strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>interventionsstudien) <strong>und</strong> die Anwendung neuer <strong>Pflege</strong>konzepte <strong>und</strong>-metho<strong>den</strong> eine Aufgabe der Ethikkommission ist. <strong>Die</strong> Befassung der Ethikkommission istallerdings nicht obligatorisch. Weiters wur<strong>den</strong> damit zusammenhängende organisatorischeFragen geklärt.Über die AutorinKontakt: MR Dr. in Sylvia Füszl, B<strong>und</strong>esministerium für Ges<strong>und</strong>heit, Abteilung II/A/4,Radetzkystraße 2, 1030 Wien, Tel: (01) 711 00-48 85, E-Mail: sylvia.fueszl@bmg.gv.atÖZPR 6 | 2011 165
GuKG, Ar<strong>bei</strong>tsrecht & Anstaltenrechtao. Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter ReissnerUniversität GrazBetriebsvereinbarung zur SuchtpräventionAlkohol- <strong>und</strong> Drogenverbote. Das folgende Muster bietet eine Regelung des Alkohol- <strong>und</strong>Drogenkonsums, die Kontrolle diesbezüglicher Beschränkungen sowie einen Stufenplan zurSuchtprävention.Alkohol <strong>und</strong> Drogenam Ar<strong>bei</strong>tsplatzDer Themenbereich „Alkohol <strong>und</strong> Drogenam Ar<strong>bei</strong>tsplatz“ ist von großer sozialpolitischer,aber auch betriebswirtschaftlicher<strong>und</strong> volkswirtschaftlicher Bedeutung. Unternimmtman <strong>den</strong> Versuch, Lösungs- oderVerbesserungsansätze zu <strong>den</strong> diesbezüglichenin der Realität auftreten<strong>den</strong> Problemenzu entwickeln, wird man bald bemerken,dass hier mit rechtlichen Mitteln alleinkaum das Auslangen zu fin<strong>den</strong> ist. Esbedarf vielmehr eines Bündels von Maßnahmen,ua auch solcher medizinischeroder sozialwissenschaftlicher Art. 1Im Folgen<strong>den</strong> wird als ar<strong>bei</strong>tsrechtlichesInstrument das Muster einer Betriebsvereinbarung(im Folgen<strong>den</strong>: BV) zurSuchtprävention dargestellt, welche aus<strong>den</strong> drei Elementen „Reglementierung“,„Kontrolle“ <strong>und</strong> „Akutmaßnahmen“ zusammengesetztist.1 Vergleiche dazu auch die sozialwissenschaftlichen Beiträgein Reissner/Strohmayer (Hrsg), Drogen <strong>und</strong> Alkohol am Ar<strong>bei</strong>tsplatz(2008).Betriebsvereinbarung gem § 96 Abs 1 Z 3 sowie § 97 Abs 1 Z 1 <strong>und</strong> Z 8 Ar<strong>bei</strong>tsverfassungsgesetzzum Thema Suchtprävention im Betriebabgeschlossen zwischen. . . als Betriebsinhaber/in (im Folgen<strong>den</strong>: BI) einerseits<strong>und</strong>Betriebsrat (im Folgen<strong>den</strong>: BR) des . . . andererseitsPräambelZiel dieser BV ist es, Ar<strong>bei</strong>tnehmerinnen <strong>und</strong> Ar<strong>bei</strong>tnehmern (im Folgen<strong>den</strong>: AN) im Falle von Alkohol- oder Drogenproblemenpersönlich zu helfen, aber auch deren volle Ar<strong>bei</strong>tskraft für das Unternehmen zu sichern.Innerhalb des Betriebs wer<strong>den</strong> daher sowohl klare Vorgangsweisen vereinbart als auch in Zusammenar<strong>bei</strong>t mit dem/der Ar<strong>bei</strong>tsmediziner/inein Beratungsangebot eingerichtet.<strong>Die</strong>se BV bietet im Anlassfall <strong>den</strong> Rahmen für die zu wählende Vorgangsweise.Geltungsbereich<strong>Die</strong>se BV gilt für alle im Betrieb beschäftigten AN im Sinne des § 36 Ar<strong>bei</strong>tsverfassungsgesetz (im Folgen<strong>den</strong>: ArbVG). 2Teil I: Regelung des Alkohol- <strong>und</strong> Drogenkonsums im Betrieb gem § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG 31. Allgemeine Beschränkung des Alkohol- <strong>und</strong> Drogenkonsums<strong>Die</strong> AN dürfen sich im Zusammenhang mit ihrer Ar<strong>bei</strong>t gem § 15 Abs 4 Ar<strong>bei</strong>tnehmer/innen/schutzgesetz nicht durch Alkohol,Arzneimittel oder Suchtgifte in einen Zustand versetzen, in dem sie sich oder andere Personen gefähr<strong>den</strong> können.2. Alkohol- <strong>und</strong> Drogenverbot während der Ar<strong>bei</strong>tWährend der Ar<strong>bei</strong>tszeit ist <strong>den</strong> AN der Konsum von Alkohol <strong>und</strong> sonstigen Drogen gr<strong>und</strong>sätzlich untersagt (zu <strong>den</strong> Ausnahmensiehe 4.).In <strong>den</strong> Ar<strong>bei</strong>tspausen ist der Konsum von Alkohol <strong>und</strong> sonstigen Drogen insoweit untersagt, als dies zu einer Beeinträchtigungder Leistungsfähigkeit führt.3. Verbot, alkoholisiert oder sonst beeinträchtigt die Ar<strong>bei</strong>t anzutretenDen AN ist die Ar<strong>bei</strong>tsaufnahme in alkoholisiertem oder sonst berauschtem Zustand untersagt.4. Weihnachtsfeiern <strong>und</strong> sonstige Betriebsfeste, Geburtstagsfeiern <strong>und</strong> ÄhnlichesIm Rahmen von Betriebsfesten oder betriebsinternen Feiern sowie <strong>bei</strong> sonstigen besonderen Anlässen (zB Geschäftsessen) istausnahmsweise angemessener Alkoholkonsum gestattet.2 Organmitglieder juristischer Personen oder leitende Angestellte mit Betriebsführungsaufgaben sind gem § 36 Abs 2 ArbVG keine AN im Sinne der Betriebsverfassung. Für sie müssten einschlägigeRegelungen in <strong>den</strong> Ar<strong>bei</strong>tsverträgen implementiert wer<strong>den</strong>. 3 <strong>Die</strong>se Regelungsermächtigung für die „erzwingbare BV“ betrifft „allgemeine Ordnungsvorschriften, welche das Verhalten der ANim Betrieb regeln“. Alkohol- <strong>und</strong> Drogenbeschränkungen fallen unter diesen Tatbestand.166 ÖZPR 6 | 2011
GuKG, Ar<strong>bei</strong>tsrecht & Anstaltenrecht5. Ar<strong>bei</strong>tsverbot <strong>bei</strong> Beeinträchtigung durch Medikamente <strong>und</strong> SuchtgifteDer Ar<strong>bei</strong>tsantritt unter Einfluss von nicht ärztlich verordneten Medikamenten, welche die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen,oder unter Einfluss von Suchtgiften ist <strong>den</strong> AN untersagt, ebenso wie deren Konsum während der Ar<strong>bei</strong>tszeit oder Ar<strong>bei</strong>tspausen.Teil II: Regelung der Kontrolle einer Alkohol- oder Drogenbeeinträchtigung gem § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG 41. Allgemeines. Reaktionen <strong>bei</strong> begründetem Verdacht einer Alkohol- oder Drogenbeeinträchtigung im Einzelfall<strong>Die</strong> Vorgesetzten haben im Sinne allgemeiner ar<strong>bei</strong>tsrechtlicher Gr<strong>und</strong>sätze <strong>bei</strong> begründetem Verdacht AN auf eine AlkoholoderDrogenbeeinträchtigung anzusprechen <strong>und</strong> gegebenenfalls abzumahnen.Zu ihrem eigenen Schutz, aber auch zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebsablaufs, haben Vorgesetzte AN, welcheunter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, aus ihrem Ar<strong>bei</strong>tsbereich abzuziehen. 5 Der BR wird diesbezüglich unverzüglichinformiert. 6Unbeschadet des Teils III dieser BV stehen dem/der BI <strong>bei</strong> einem für die Ar<strong>bei</strong>t im obigen Sinn relevanten Alkohol- <strong>und</strong>Drogenkonsum von AN als Ar<strong>bei</strong>tgeber/in (im Folgen<strong>den</strong>: AG) alle allgemeinen ar<strong>bei</strong>tsrechtlichen Maßnahmen, die in diesenFällen zur Verfügung stehen, offen. 72. Kontrolle durch einen sogenannten AlkomatenIm Falle eines diesbezüglichen Verdachts kann der/die AG bzw der/die zuständige Vorgesetzte <strong>den</strong>/die AN dazu auffordern,sich freiwillig einem Alkoholtest am im Betrieb am Standort . . . aufgestellten Alkomaten zu unterziehen. Der BR <strong>und</strong> der/dieAr<strong>bei</strong>tsmediziner/in wer<strong>den</strong> diesbezüglich unverzüglich informiert.<strong>Die</strong> AN haben das Recht, <strong>den</strong> Test zu verweigern. 8Verweigert der/die AN <strong>den</strong> Test, so hat ihn/sie der/die AG oder der/die Vorgesetzte von der Ar<strong>bei</strong>t abzuziehen. 9 Es ist diesfalls– unbeschadet der Regelungen des Teils III dieser BV – die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe bzw Beratung, etwa durch<strong>den</strong>/die Ar<strong>bei</strong>tsmediziner/in, vorzuschlagen.Teil III: Stufenplan zur Suchtprävention gem § 97 Abs 1 Z 8 ArbVG 10Ergibt sich <strong>bei</strong> einem/r AN der begründete Verdacht eines Suchtproblems, wird nach dem im Folgen<strong>den</strong> festgelegten Stufenplanvorgegangen.Allgemeiner Gr<strong>und</strong>satz ist da<strong>bei</strong>, dass <strong>bei</strong> im Rahmen des Stufenplans erfolgen<strong>den</strong> Gesprächen des/r AN mit Vorgesetztenauf Wunsch des/r AN jeweils der/die nächsthöhere Vorgesetzte <strong>und</strong>/oder der BR <strong>bei</strong>zuziehen ist.Gesprächsergebnisse sind in einem von allen Besprechungsteilnehmer/innen zu unterfertigen<strong>den</strong> Protokoll festzuhalten.Hinsichtlich der in <strong>den</strong> einzelnen Stufen gesetzten Maßnahmen sind, so dies der Verbesserung der Situation dient, die unmittelbarenKolleg/inn/en mit einzubeziehen.Stufe 1: Gespräch des direkten Vorgesetzten mit dem Betroffenen, Festlegung eines BeobachtungszeitraumsZeigen sich <strong>bei</strong> AN Auffälligkeiten im Hinblick auf <strong>den</strong> Alkohol- oder Drogenkonsum, die der/die Vorgesetzte selbst oder auchandere im Betrieb tätige Personen wahrgenommen haben, so hat der/die Vorgesetzte <strong>den</strong>/die AN mit diesem Umstand zu konfrontieren<strong>und</strong> dem/der Betroffenen mitzuteilen, dass er/sie in der Folge einer besonderen Beaufsichtigung unterliegt. <strong>Die</strong> Personalabteilung<strong>und</strong> der BR sind zu informieren.Der/<strong>Die</strong> Vorgesetzte hat mit dem/der Betroffenen einen Beobachtungszeitraum zwischen vier <strong>und</strong> acht Wochen samt Artder Beobachtung zu vereinbaren. Zusätzlich wer<strong>den</strong> Hilfsangebote, insbesondere ein Gespräch mit dem/der Ar<strong>bei</strong>tsmediziner/in,vorgeschlagen.In Abhängigkeit von der Tätigkeit (allfälliges Sicherheitsrisiko) kann dem/der AN zunächst vorübergehend eine andere Aufgabezugewiesen <strong>und</strong> die Ar<strong>bei</strong>tsleistung vom/von der Vorgesetzten regelmäßig überprüft wer<strong>den</strong>.Am Ende des Beobachtungszeitraums findet je<strong>den</strong>falls ein weiteres Gespräch zwischen dem/der Vorgesetzten <strong>und</strong> dem/derBetroffenen statt, in dem Bilanz über <strong>den</strong> Verlauf der Beobachtung gezogen wird.4 <strong>Die</strong>ser gesetzliche Tatbestand ermöglicht die Regelung von „Kontrollmaßnahmen <strong>und</strong> -systemen, welche die Menschenwürde berühren“; zu Detailproblemen in diesem Zusammenhang siehegleich unten <strong>bei</strong> 2. Im Allgemeinen müssen derartige Kontrollmaßnahmen <strong>bei</strong> sonstiger Rechtsunwirksamkeit mit dem BR in Form einer BV geregelt wer<strong>den</strong> (notwendige Mitbestimmung; vergleicheaber § 10 AVRAG). 5 Individualar<strong>bei</strong>tsrechtlich könnte es in der Folge in Richtung Krankenstand (im Falle einer Ar<strong>bei</strong>tsunfähigkeit wegen Krankheit) gehen, ansonsten könnte zur rechtlichenDeckung des Ar<strong>bei</strong>tsausfalls Urlaub im Sinne des UrlG vereinbart oder ein sogenannter unbezahlter Urlaub (das ist genau genommen die Vereinbarung einer kurzzeitigen Karenzierung) festgelegtwer<strong>den</strong>. <strong>Die</strong> Ar<strong>bei</strong>tgeberseite könnte aber auch – wenn zB die Ar<strong>bei</strong>tsunfähigkeit wegen der Beeinträchtigung klar dokumentierbar ist – einfach nur festhalten, dass wegen Verletzung bzw Nichterfüllungder Ar<strong>bei</strong>tspflicht kein Entgelt gebührt. 6 Bis zu diesem Punkt stellen die niedergelegten Inhalte noch immer – wie in Teil I der gegenständlichen BV – allgemeine Ordnungsvorschriftendar. 7 Damit wird insbesondere bekräftigt, dass sich der AG durch die vorliegende BV nicht seines Rechts zur Kündigung sowie – dies wäre <strong>bei</strong> Verschul<strong>den</strong> des AN ohnehin ar<strong>bei</strong>tsrechtlich be<strong>den</strong>klich– seines Rechts zur fristlosen Entlassung begibt. 8 <strong>Die</strong> Kontrolle des Alkohol- <strong>und</strong> Drogenkonsums ist mittels BV gem § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG regelbar, sofern eine solche nicht unmittelbareEingriffe in die körperliche Integrität des AN vorsehen will; Letzteres wäre eine Verletzung der Menschenwürde <strong>und</strong> daher je<strong>den</strong>falls sittenwidrig <strong>und</strong> nichtig. <strong>Die</strong> Einrichtung eines Alkomatentestsist daher nur mit Opting-out-Möglichkeit des AN ein bloßes Berühren der Menschenwürde <strong>und</strong> gültiger Regelungsinhalt einer BV (herrschende Lehre; Nachweise <strong>bei</strong> Reissner in Zeller Kommentar2 § 96 ArbVG Rz 25). 9 Zur individualar<strong>bei</strong>tsrechtlichen Erfassung siehe schon Fußnote 5. 10 In dieser gesetzlichen Ermächtigungsbestimmung geht es um „Maßnahmen <strong>und</strong> Einrichtungenzur Verhütung von Unfällen <strong>und</strong> Berufskrankheiten sowie Maßnahmen zum Schutz der Ges<strong>und</strong>heit der AN“. Es ist dies ein Fall einer freiwilligen BV.ÖZPR 6 | 2011 167
GuKG, Ar<strong>bei</strong>tsrecht & AnstaltenrechtSollten keine weiteren Auffälligkeiten mehr wahrgenommen wor<strong>den</strong> sein, wird die ursprüngliche Ar<strong>bei</strong>tssituation wiederhergestellt.Es sind in der Folge keine weiteren Schritte notwendig.Treten in der Beobachtungsphase gehäuft Auffälligkeiten auf, wird sofort auf Stufe 2 übergegangen. Der Übergang auf Stufe2 wird vom Vorgesetzten <strong>und</strong> von der Personalabteilung dem/der Betroffenen gegenüber erklärt. Der BR ist zu informieren.Stufe 2: Gespräch unter Einbeziehung weiterer Personen, Festlegung eines weiteren Beobachtungszeitraums,weitere AuflagenWur<strong>den</strong> in der Stufe 1 weitere Auffälligkeiten im Hinblick auf Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt, wird ein neuerlichesGespräch geführt, in welches nun auch der/die übergeordnete Vorgesetzte, ein/e Vertreter/in der Personalabteilung <strong>und</strong> der BReinbezogen wer<strong>den</strong>.In diesem Gespräch ist der/die AN mit <strong>den</strong> vom/von der Vorgesetzten aufgezeichneten weiteren Auffälligkeiten <strong>und</strong> sonstigennegativen Vorkommnissen zu konfrontieren.Es wird ein weiterer Beobachtungszeitraum im Ausmaß zwischen vier <strong>und</strong> acht Wochen vereinbart. Der/die Vorgesetztekann dem/der AN in diesem auch längerfristig andere Aufgaben zuteilen, wo<strong>bei</strong> der Gesamtzeitraum der anderweitigen Verwendunginklusive des Zeitraums in Stufe 1 maximal zwölf Wochen betragen soll. Dem/Der Betroffenen ist mitzuteilen, dass einerVereinbarung von Urlauben unter zwei Wochen während des Beobachtungszeitraumes von Ar<strong>bei</strong>tgeberseite gr<strong>und</strong>sätzlich nichtnahegetreten wer<strong>den</strong> wird. Es wird dem/der AN eingeschärft, dass er/sie eine Krankmeldung unverzüglich vorzunehmen hat<strong>und</strong> dass die Ar<strong>bei</strong>tgeberseite gegebenenfalls die Beibringung von ärztlichen Bestätigungen selbst <strong>bei</strong> kurzfristigen krankheitsbedingtenAbwesenheiten verlangen wird.Dem/Der AN wird angeboten, mit seiner/ihrer Zustimmung <strong>den</strong>/die Ehe- bzw Lebenspartner/in durch <strong>den</strong>/die Ar<strong>bei</strong>tsmediziner/inzu kontaktieren, damit auch diese/r ihn/sie <strong>bei</strong> der Beseitigung des Alkohol- bzw Drogenproblems unterstützen kann.Für <strong>den</strong> Fall weiterer Auffälligkeiten wird eine schriftliche Abmahnung durch <strong>den</strong>/die AG angekündigt.Sollten im Beobachtungszeitraum keine weiteren Auffälligkeiten mehr wahrgenommen wor<strong>den</strong> sein, wird in der Folge dieursprüngliche Ar<strong>bei</strong>tssituation wie in Stufe 1 beschrieben wiederhergestellt.Treten in der Beobachtungsphase gehäuft Auffälligkeiten auf, wird sofort auf Stufe 3 übergegangen.Stufe 3: Gespräch unter Einbeziehung weiterer Personen, Abmahnung, Beratung, RückkehrgesprächSind in der Stufe 2 weitere Auffälligkeiten registriert wor<strong>den</strong>, wird in einem neuerlichen Gespräch wie in Stufe 2 die weitere Vorgangsweisefestgelegt. Zusätzlich ist der/die Ar<strong>bei</strong>tsmediziner/in <strong>bei</strong>zuziehen; diese/r unterliegt hier<strong>bei</strong> der ärztlichen Schweigepflicht,von der er/sie auf Wunsch des/der Betroffenen ausdrücklich entb<strong>und</strong>en wer<strong>den</strong> kann. Auch weitere Betriebsratsmitglieder,insbesondere solche, die selbst im unmittelbaren Ar<strong>bei</strong>tsbereich des/der betroffenen AN tätig sind, können hinzugezogen wer<strong>den</strong>.Der/<strong>Die</strong> AN erhält eine schriftliche Abmahnung, in der nachdrücklich auf die ar<strong>bei</strong>tsrechtlichen Konsequenzen weiterer Auffälligkeiten<strong>bei</strong>m Alkohol- oder Drogenkonsum hingewiesen wird.Der/<strong>Die</strong> AN erhält ein neuerliches Hilfsangebot – in Absprache mit dem/der Ar<strong>bei</strong>tsmediziner/in sollte dies primär die Aufforderungsein, eine entsprechende Beratungsstelle aufzusuchen – <strong>und</strong> wird verpflichtet nachzuweisen, dass er dieses Angebotauch angenommen hat.Der/die AN wird aufgefordert, nach jedem Krankenstand zu einem Rückkehrgespräch <strong>bei</strong>m/<strong>bei</strong> der Ar<strong>bei</strong>tsmediziner/in zuerscheinen.Sollten in der Folge keine weiteren Auffälligkeiten mehr wahrgenommen wor<strong>den</strong> sein, wird die ursprüngliche Ar<strong>bei</strong>tssituationwie in Stufe 1 beschrieben wiederhergestellt.Treten in der Beobachtungsphase gehäuft Auffälligkeiten auf, wird sofort auf Stufe 4 übergegangen.Stufe 4: Gespräch, Aufforderung zur Therapie, Androhung der Auflösung des <strong>Die</strong>nstverhältnissesFür <strong>den</strong> Fall, dass keine Verbesserung der Situation eingetreten ist, ist das Gespräch wie in Stufe 3 zu wiederholen.Der/<strong>Die</strong> AN wird aufgefordert, umgehend eine entsprechende Therapie zu beginnen bzw eine stationäre Entziehungskur anzutreten.Gleichzeitig wird die Auflösung des Ar<strong>bei</strong>tsverhältnisses <strong>bei</strong> Nichterfüllung der Vereinbarung bzw der Auflagen angedroht.Stufe 5: Beendigung des Ar<strong>bei</strong>tsverhältnissesWer<strong>den</strong> die in Stufe 4 festgelegten Therapiemaßnahmen bzw Kuren vom/von der AN nicht durchgeführt bzw verweigert oderstellt sich trotz Therapierung nicht der gewünschte Erfolg nachhaltig ein, so erfolgt die Beendigung des Ar<strong>bei</strong>tsverhältnissesdurch <strong>den</strong>/die AG.Der/<strong>Die</strong> AG kann im Sinne der unternehmensseitigen Hilfestellung eine Wiedereinstellungszusage <strong>bei</strong> Erfüllung bestimmterAuflagen machen.168 ÖZPR 6 | 2011
GuKG, Ar<strong>bei</strong>tsrecht & AnstaltenrechtSollten die gesetzten Maßnahmen erfolgreich sein <strong>und</strong> keine weiteren Auffälligkeiten mehr wahrgenommen wer<strong>den</strong>, wird inder Folge gemäß Stufe 1 vorgegangen.1. Inkrafttreten<strong>Die</strong>se BV tritt mit . . . in Kraft.Schlussbestimmungen2. Geltungsdauer<strong>Die</strong>se BV wird unbefristet abgeschlossen.<strong>Die</strong> Parteien wer<strong>den</strong> nach Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten der gegenständlichen BV eine Evaluierung in Bezug auf diein der BV geregelten Inhalte vornehmen.3. KündigungSämtliche Bereiche dieser BV können von <strong>den</strong> Abschlussparteien unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Monatsletztenschriftlich gekündigt wer<strong>den</strong>.Teil I, Teil II <strong>und</strong> Teil III können von <strong>den</strong> Abschlussparteien jeweils für sich unter Einhaltung der oben genannten Kündigungszeitenschriftlich gekündigt wer<strong>den</strong>. 11§ 32 Abs 2 ArbVG steht <strong>den</strong> hier vereinbarten Kündigungsmöglichkeiten nicht entgegen. 12. . ., im . . .Für <strong>den</strong> Betriebsinhaber:Für <strong>den</strong> Betriebsrat:.............................. ..............................(. . .) (Betriebsratsvorsitzende[r])ÖZPR 2011/12811 Hinsichtlich des Kündigungsrechts müssen die Inhalte des vorliegen<strong>den</strong> Musters je nach gesetzlicher Materie getrennt für sich betrachtet wer<strong>den</strong>. In diesem Zusammenhang wird daher ausdrücklichauch die getrennte Beendigungsmöglichkeit vorgeschlagen. 12 Im Falle von BV, für deren einseitige Änderung bzw Aufhebung eine Schlichtungsstelle anzurufen ist – betroffen hiervonwäre Teil I der BV über die Alkohol- bzw Drogenbeschränkungen –, ist die Kündigung vom Gesetz her ausgeschlossen (§ 32 Abs 2 ArbVG). Wird eine derartige BV <strong>den</strong>noch gekündigt, so ist diesrechtsunwirksam. Strittig ist, ob <strong>bei</strong> diesen BV eine Kündigungsmöglichkeit vereinbart wer<strong>den</strong> kann (zum Meinungsstand Reissner in ZellKomm 2 § 32 ArbVG Rz 10); meines Erachtens wird mandies bejahen können.Zum ThemaÜber <strong>den</strong> AutorDr. Gert-Peter Reissner ist ao. Univ.-Prof. am Institut für Ar<strong>bei</strong>tsrecht <strong>und</strong> Sozialrecht der Universität Graz. Kontaktadresse: Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsstraße 15/A2, 8010 Graz. Tel: +43 316 380 6622, Fax: +43 316 380 9435, E-Mail: gert.reissner@uni-graz.at,Internet: www.g-p-reissner.atLiteraturtippReissner/Strohmayer (Hrsg), Drogen <strong>und</strong> Alkohol am Ar<strong>bei</strong>tsplatz (2008).Mag. Dr. Christian GepartRechtsanwalt in WienRechtsprechungVertragsbedienstetenrecht. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> des ar<strong>bei</strong>tsrechtlichen Gleichbehandlungsgr<strong>und</strong>satzeskann auch Anästhesiepflegepersonal im OP eine Strahlengefahrenzulage gebühren.1. <strong>Die</strong> beklagte Stadtgemeinde betrieb biszum 31. 12. 2007 das Krankenhaus W. imRahmen der Privatwirtschaftsverwaltung.Mit 1. 1. 2008 wurde das Krankenhausvom Land Niederösterreich übernommen.Auf die <strong>Die</strong>nstverhältnisse der Anästhesieschwestern<strong>und</strong> -pfleger fand die Nebengebührenordnungder Beklagten (NGO) Anwendung.<strong>Die</strong>se regelt im II. Abschnitt unterPunkt 4 verschie<strong>den</strong>e Nebengebührenfür das <strong>Pflege</strong>personal. So ist unter anderemauch eine Strahlengefahrenzulage(2700 – 2720) für das <strong>Pflege</strong>personal aufRadium- <strong>und</strong> Röntgenstationen <strong>und</strong> derAbteilung für Radioonkologie-Strahlentherapievorgesehen, um die latente Gefährdungdurch Strahlen, gestaffelt nach derZeitdauer der Exposition, finanziell zuÖZPR 6 | 2011 169
GuKG, Ar<strong>bei</strong>tsrecht & Anstaltenrechtkompensieren. Im Lauf der letzten zehnJahre erhöhte sich im Krankenhaus W. dieZahl der Operationen von 10.000 – 12.000auf ca 15.000. Besonders <strong>bei</strong> Operationenim Bereich der Unfallchirurgie <strong>und</strong> Orthopädiestieg durch die begleitende Kontrolledie Strahlenbelastung an. Davon warenauch die Anästhesieschwestern <strong>und</strong> -pflegerbetroffen, die der gleichen Strahlenbelastungwie alle anderen <strong>bei</strong> Operationeneingesetzten Mitar<strong>bei</strong>ter der Beklagten ausgesetztwaren. In Einzelfällen konnte zwardas <strong>Pflege</strong>personal über Nachfrage <strong>den</strong>Operationssaal verlassen; eine generelleMöglichkeit dazu bestand jedoch nicht.<strong>Die</strong> in Punkt 4 NGO vorgesehenen Zulagenwur<strong>den</strong> von der beklagten Stadtgemeindeauch kumulativ gewährt. So erhieltdie überwiegende Zahl der <strong>Pflege</strong>personenim Bereich der Chirurgie-OP, Unfall-OP,Urologie-OP, Orthopädie-OP <strong>und</strong> Neurochirurgie-OPneben einer Operations-/Anästhesiezulage3010 auch die Gefahrenzulage2690 <strong>und</strong> die Strahlengefahrenzulage2720. Gesprächsweise Vorstöße in <strong>den</strong> Jahren2005 – 2006, auch für das Anästhesiepflegepersonaldie Strahlengefahrenzulagezu erlangen, wur<strong>den</strong> von Beklagtenseitemit dem Argument abgelehnt, dass diesesPersonal keiner entsprechen<strong>den</strong> Strahlenbelastungausgesetzt sei. Tatsächlich konntenjedoch <strong>bei</strong> Ganzkörper-Dosimeterauswertungenkeine signifikanten Unterschiedezwischen <strong>den</strong> Mitar<strong>bei</strong>tern, die die Zulagen2690, 2720 <strong>und</strong> 3010 bezogen, <strong>und</strong><strong>den</strong> Anästhesieschwestern <strong>und</strong> -pflegernfestgestellt wer<strong>den</strong>.2. Der klagende Betriebsrat begehrtemit der verfahrensgegenständlichen Klagegegenüber der Beklagten die Feststellung,dass <strong>den</strong> Anästhesieschwestern <strong>und</strong> -pflegernim Krankenhaus W bis 31. 12. 2007 eine„Strahlenzulage“ zugestan<strong>den</strong> sei. DerBetriebsrat begründete dies damit, dass allenanderen Schwestern <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>rn, dieTätigkeiten im Operationssaal verrichteten,von der Beklagten eine Strahlenzulage gewährtwor<strong>den</strong> sei, nicht jedoch – trotzpraktisch gleicher Strahlenbelastung – <strong>den</strong>Anästhesieschwestern <strong>und</strong> -pflegern. Einsachlicher Gr<strong>und</strong> für diese Differenzierunghabe nicht bestan<strong>den</strong>.Das Erstgericht gab dem Klagebegehrenunter Zugr<strong>und</strong>elegung des vorstehend wiedergegebenenSachverhalts statt.Das Berufungsgericht bestätigte dasErsturteil. Es sei zwar richtig, dass die Anästhesieschwestern<strong>und</strong> -pfleger in Punkt 4NGO nicht ausdrücklich genannt seien.Durch <strong>den</strong> medizinischen Fortschritt sowiedie demografische <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitspolitischeEntwicklung hätten sich jedoch imKrankenhaus W. sowohl die Zahl der Operationenals auch die qualitativen Faktoren<strong>bei</strong> Operationen beträchtlich erhöht. Esherrsche deshalb (zufolge Intensivierungder begleiten<strong>den</strong> Kontrolle) in nahezu allenOperationssälen der Unfallabteilung <strong>und</strong>der Orthopädie erhöhte Strahlenbelastung.Speziell dort seien alle Mitar<strong>bei</strong>ter der gleichenStrahlenbelastung ausgesetzt. ErkennbarerZweck der Strahlengefahrenzulagegemäß Punkt 4 NGO sei es, das spezielleRisiko der <strong>Die</strong>nstnehmer, die typischerweiseeiner Strahlenbelastung ausgesetztseien, auszugleichen. Es stehe daher auch<strong>den</strong> Anästhesieschwestern <strong>und</strong> -pflegernbis 31. 12. 2007 eine Strahlengefahrenzulagenach Punkt 4 NGO zu.3. Auch der OGH bestätigte die Ansichtder Vorinstanzen:Nach <strong>den</strong> getroffenen Feststellungen istdavon auszugehen, dass die in der NGOvorgesehene Strahlengefahrenzulage <strong>den</strong>Zweck verfolgt, das spezielle Risiko für dieim <strong>Pflege</strong>dienst tätigen Mitar<strong>bei</strong>ter, die einererhöhten Strahlenbelastung ausgesetztsind, finanziell auszugleichen. Das durchgeführteVerfahren ergab nun, dass sichdie tatsächlichen Umstände in Bezug aufdie Strahlenbelastung im Krankenhaus derBeklagten in <strong>den</strong> Jahren nach der Erlassungder NGO bedeutend geändert haben.Durch die Erhöhung der Zahl der Operationen<strong>und</strong> die gestiegenen qualitativenAnforderungen an die begleitende Kontrolleder Operationen stieg die Strahlenbelastungin <strong>den</strong> Operationssälen deutlich an.<strong>Die</strong> Beklagte trug diesem Umstand vonsich aus dadurch Rechnung, dass sie dieGewährung der Strahlengefahrenzulagenicht mehr auf jene Mitar<strong>bei</strong>ter beschränkte,die in der NGO ausdrücklich als Empfängerder Strahlengefahrenzulage vorgesehenwaren (<strong>Pflege</strong>personal auf Radium<strong>und</strong>Röntgenstationen sowie der Abteilungfür Radioonkologie-Strahlentherapie). Siegewährte nämlich die Strahlengefahrenzulageauch <strong>den</strong> Krankenschwestern <strong>und</strong>-pflegern im Bereich der Chirurgie-OP, Unfall-OP,Urologie-OP, Orthopädie-OP <strong>und</strong>Neurochirurgie-OP, <strong>und</strong> zwar kumulativzu anderen Erschwernis- <strong>und</strong> Gefahrenzulagen.Nicht gewährt wurde die Strahlengefahrenzulagehingegen <strong>den</strong> Anästhesieschwestern<strong>und</strong> -pflegern, obwohl auch dieseder gleichen Strahlenbelastung ausgesetztwaren.Maßgebliches Kriterium für <strong>den</strong> Anspruchauf die Strahlengefahrenzulagenach Punkt 4 NGO ist, dass ein Bediensteterim Gefahrenbereich durch Strahlen tätigist, wie dies <strong>bei</strong> Erlassung der NGO<strong>bei</strong>m <strong>Pflege</strong>personal auf Radium- <strong>und</strong>Röntgenstationen <strong>und</strong> der Abteilung fürRadioonkologie-Strahlentherapie typischerweiseder Fall war. Anhaltspunkte dafür,dass der Gemeinderat der Beklagten imStrahlengefahrenbereich ar<strong>bei</strong>tende Angehörigedes <strong>Pflege</strong>personals von der Gewährungder Strahlengefahrenzulage ausschließenwollte, bestehen nicht.Auf Seite der Beklagten als Krankenhausträger(bis 31. 12. 2007) erkannte manoffensichtlich im Lauf der Zeit die durchdie Änderungen im Tatsächlichen bewirkteLückenhaftigkeit der Regelung des Kreisesder Anspruchsberechtigten der Strahlengefahrenzulage.<strong>Die</strong> Beklagte schritt daraufhinim kurzen Weg zur „Lückenschließung“,indem man die Strahlengefahrenzulagenicht nur dem <strong>Pflege</strong>personal auf Radium-<strong>und</strong> Röntgenstationen <strong>und</strong> der Abteilungfür Radioonkologie-Strahlentherapie,sondern auch <strong>den</strong> Krankenschwestern<strong>und</strong> -pflegern im Bereich der Chirurgie-OP,Unfall-OP, Urologie-OP, Orthopädie-OP<strong>und</strong> Neurochirurgie-OP gewährte.Nach <strong>den</strong> Ergebnissen des Verfahrenssind aber auch die Anästhesieschwestern<strong>und</strong> -pfleger, die der gleichen Strahlenbelastungausgesetzt sind, in die Lückenschließungeinzubeziehen, bestimmt doch § 7ABGB, dass auf ähnliche, in <strong>den</strong> Gesetzenbestimmt entschie<strong>den</strong>e Fälle <strong>und</strong> auf dieGründe anderer damit verwandten GesetzeRücksicht genommen wer<strong>den</strong> muss, wennsich ein Rechtsfall weder aus <strong>den</strong> Worten,noch aus dem natürlichen Sinn eines Gesetzesentschei<strong>den</strong> lässt.§§ 20 f NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz1976 (NÖ GVBG); § 47Abs 2 NÖ Gemeindebeamtendienstordnung1976 (GBDO); Nebengebührenordnungder Stadt Wr. NeustadtOGH 28. 6. 2011, 9 ObA 53/11 aÖZPR 2011/129170 ÖZPR 6 | 2011
Dr. Martin GreifenederRichter am Landesgericht WelsProf. Dr. Johannes RuddaHauptverband der österreichischenSozialversicherungsträger<strong>Pflege</strong>geld &SozialrechtINTRO. Hier fin<strong>den</strong> Sie alle Neuerungen r<strong>und</strong> ums <strong>Pflege</strong>geld, Antworten zur <strong>Pflege</strong>geldeinstufung<strong>und</strong> auf Verfahrensfragen sowie auf die <strong>Pflege</strong> betreffen<strong>den</strong> Fragen des Sozialrechts.ÖZPR – Leser bestinformiertDas von B<strong>und</strong>esminister H<strong>und</strong>storfer im Herbst 2010 in Auftrag gegebene Pilotprojekt„<strong>Pflege</strong>geldbegutachtung nach dem B<strong>und</strong>espflegegeldgesetz (BPGG) unter Einbeziehungvon <strong>Pflege</strong>fachkräften“ ist abgeschlossen, die Ergebnisse dieser Studie liegen nunmehrvor. <strong>Die</strong> wesentlichen – vereinzelt auch nach<strong>den</strong>klich stimmen<strong>den</strong> – Erkenntnisse dieseräußerst interessanten <strong>und</strong> aufschlussreichen Studie wer<strong>den</strong> nun erstmals in der ÖZPRveröffentlicht. ÖZPR-Leser sind somit informationsmäßig unmittelbar am Puls der Zeit.<strong>Die</strong>se Ergebnisse wur<strong>den</strong> der Entscheidung über <strong>den</strong> Einsatz von <strong>Pflege</strong>fachkräftenin der Begutachtung zugr<strong>und</strong>e gelegt <strong>und</strong> in durchaus sinnvoller Weise umgesetzt. Wiedieser Einsatz ab 1. 1. 2012 aussehen wird, wird in einem zweiten Beitrag dieser Rubrikim Detail dargestellt. Aus standespolitischer Sicht tragen damit seit Jahren bestehendeBemühungen ihre Früchte. Ob es nur ein erster Teilerfolg ist, oder ob weitere Schritte folgenwer<strong>den</strong>, wird nicht unwesentlich davon abhängen, wie die nun geplante Einbindungsich in der Praxis bewährt. Wie die Studie zeigt, gilt es neben der Sammlung von Erfahrungauch weiteres Fachwissen über die Erstellung von Gutachten samt deren rechtlichenGr<strong>und</strong>lagen zu erwerben <strong>und</strong> strikt die Rolle zwischen Gutachter <strong>und</strong> pflegender Personzu trennen.Was die Studie, insbesondere die Qualität der Gutachten, aber ebenfalls schonungslosaufzeigt: Der genannte Fortbildungsbedarf ist keineswegs auf die <strong>Pflege</strong>fachkräfte beschränkt,er gilt auch für nicht wenige der ärztlichen Gutachter. Für je<strong>den</strong> freiberuflich tätigenAllgemeinmediziner, der Führerscheinuntersuchungen durchführt, eine vergleichsweise„einfache“ Untersuchung, gibt es zwingende Aus- <strong>und</strong> regelmäßige Fortbildungsverpflichtungen(§ 22 Abs 2 <strong>und</strong> 3 FSG-GV). Für freiberuflich tätige <strong>Pflege</strong>geldgutachter fehlendiese Standards auch 18 Jahre nach Einführung des <strong>Pflege</strong>geldes noch (immer). Esbleibt daher zu hoffen, dass die Ergebnisse dieser Studie auch als Chance verstan<strong>den</strong> <strong>und</strong>konkrete Auswirkungen für die Qualitätssicherung in der <strong>Pflege</strong>geldbegutachtung habenwer<strong>den</strong>.Wir freuen uns, als erstes Medium Sie über die Ergebnisse dieses für die <strong>Pflege</strong> sowichtigen Pilotprojekts informieren zu können.Martin Greifeneder <strong>und</strong> Johannes RuddaÖZPR 2011/130AKTUELLESH<strong>und</strong>storfer: „<strong>Pflege</strong> ist die Herausforderungder Zukunft“„Österreich ist <strong>bei</strong>m <strong>Pflege</strong>geld Weltmeister,nirgendwo beziehen so viele Personen <strong>Pflege</strong>geldwie hierzulande, nämlich 5,1 Prozent“,sagte Sozialminister H<strong>und</strong>storfer in seinerEröffnungsrede <strong>bei</strong>m „pflegekongress11“ imAustria Center Vienna. H<strong>und</strong>storfer betonte,dass der Ist-Zustand im <strong>Pflege</strong>wesen inÖsterreich ein sehr guter sei. Zur Aufrechterhaltungdieses qualitativ hochwertigenSystems sind in naher Zukunft Reformennötig. „<strong>Die</strong> Bevölkerung wird im Durchschnittimmer älter <strong>und</strong> auf diese Veränderungenmüssen die Politiker <strong>und</strong> Verantwortlichenheute schon reagieren“, so der Sozialminister.Mit der bereits beschlossenen <strong>Pflege</strong>geldreform,die mit 1. 1. 2012 umgesetztwird, wer<strong>den</strong> 300 <strong>Pflege</strong>geldverwaltungsstellenzu acht Stellen zusammengelegt.Um das <strong>Pflege</strong>system an die Herausforderungender Zukunft anzupassen, hatdas Sozialministerium einen breit angelegtenDiskussionsprozess gestartet. „Es gehtdarum, vom Bo<strong>den</strong>see bis zum Neusiedlerseeeinheitliche Standards zu schaffen <strong>und</strong> dadurchkürzere Wartezeiten für Betroffene zugewährleisten“, so H<strong>und</strong>storfer. „Am Endemuss klar sein, wie es im Bereich <strong>Pflege</strong> abdem Jahr 2015 weitergeht, <strong>den</strong>n Ende 2014läuft die im heurigen März beschlosseneÜbergangslösung zur <strong>Pflege</strong>finanzierung aus.Danach braucht es eine Neuregelung“, betonteder Minister.ÖZPR 6 | 2011 171
<strong>Pflege</strong>geld & SozialrechtDr. Martin GreifenederRichter am Landesgericht WelsBegutachtung durch <strong>Pflege</strong>fachkräfteErgebnisse des Pilotprojekts<strong>Pflege</strong>geldbegutachtung. Das B<strong>und</strong>esministerium für Ar<strong>bei</strong>t, Soziales <strong>und</strong> Konsumentenschutzerteilte 2010 <strong>den</strong> Auftrag zum Pilotprojekt „<strong>Pflege</strong>geldbegutachtung nach dem B<strong>und</strong>espflegegeldgesetz(BPGG) unter Einbeziehung von <strong>Pflege</strong>fachkräften“. <strong>Die</strong> durchaus interessanten <strong>und</strong>aufschlussreichen Ergebnisse dieser sehr umfangreichen wissenschaftlichen Studie liegennunmehr vor <strong>und</strong> wer<strong>den</strong> in der ÖZPR erstmals veröffentlicht.Ziel der Studie –wissenschaftliche Begleitung<strong>Die</strong> vom BMASK in Auftrag gegebene Studiewurde vom Kompetenzzentrum fürNonprofit Organisationen der WirtschaftsuniversitätWien <strong>und</strong> dem Fachbereich fürGes<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflege der FHCampus Wien gemeinsam durchgeführt.Ziel der Studie war die Abklärung, ob<strong>und</strong>, wenn ja, aus welchen Grün<strong>den</strong> es <strong>bei</strong><strong>Pflege</strong>geldgutachten zu unterschiedlichenEinstufungen zwischen medizinischen <strong>und</strong>pflegerischen Sachverständigen kommt<strong>und</strong> ob in diesem Zusammenhang allgemeineTrends zu beobachten sind. 1Rahmenbedingungen –DoppelbegutachtungIm Rahmen dieses Projekts haben zunächst<strong>Pflege</strong>fachkräfte <strong>und</strong> Ärzte gleichzeitig(zur selben Zeit am selben Ort)die Begutachtung eines <strong>Pflege</strong>bedürftigendurchgeführt <strong>und</strong> anschließend – unabhängigvoneinander – ihr Gutachten erstellt.Im Unterschied zum Pilotprojekt im Jahr2004 2 wurde der Hausbesuch dieses Malgemeinsam durchgeführt, um einen einheitlichenInformationsstand <strong>bei</strong>der Gutachterzu gewährleisten.Der Studie liegen 857 BPGG-Fälle(PVA) sowie 76 Fälle nach dem WienerLandespflegegeldgesetz aus dem ZeitraumOktober 2010 bis Februar 2011 zugr<strong>und</strong>e.Projektregionen waren die B<strong>und</strong>esländerBurgenland, Niederösterreich, Salzburg,Tirol <strong>und</strong> Wien.Wissenschaftliche Analyseder Gutachten – Studie<strong>Die</strong>se Gutachten wur<strong>den</strong> zunächst nachquantitativen (statistischen) <strong>und</strong> dannnach qualitativen Gesichtspunkten mitdem Fokus auf allfällige Unterschiede zwischen<strong>den</strong> begutachten<strong>den</strong> Ärzten <strong>und</strong><strong>Pflege</strong>fachkräften analysiert. Als drittenSchritt diskutierten zwei Fokusgruppendie Fragestellung, worauf sich die festgestelltenberufsgruppenspezifischen Abweichungenzurückführen lassen könn(t)en.<strong>Die</strong>se Fokusgruppen waren aus einemArzt <strong>und</strong> einer <strong>Pflege</strong>fachkraft, die amProjekt teilgenommen haben, je einem gerichtlichenSachverständigen <strong>bei</strong>der Bereiche<strong>und</strong> einem bzw zwei Juristen zusammengesetzt.Zu diesen drei Bereichen liegen jeweilsumfangreiche Endberichte vor (Modul 1Quantitativer Teil: Schober/Schober 2011;Modul 2 Qualitativer Teil: Schneider/Stewig2011; Modul 3 Fokusgruppen: Schober et al2011).<strong>Die</strong> wesentlichen Ergebnisse dieser umfangreichenStudie lassen sich wie folgt zusammenfassen:<strong>Pflege</strong> ermittelt insgesamtdeutlich höheren funktionsbezogenen(zeitlichen) <strong>Pflege</strong>bedarfDa es mit dem BPGG, der entsprechen<strong>den</strong>Einstufungsverordnung zum B<strong>und</strong>espflegegeldgesetz(EinstV), <strong>den</strong> Richtlinien desHauptverbands für die einheitliche Anwendungdes B<strong>und</strong>espflegegeldgesetzes(RPGG) <strong>und</strong> der laufen<strong>den</strong> Rechtsprechungein relativ eindeutiges rechtlichesF<strong>und</strong>ament für die Begutachtung gibt, solltendie Abweichungen relativ gering ausfallen.Dennoch liegt der funktionsbezogene<strong>Pflege</strong>bedarf in St<strong>und</strong>en <strong>bei</strong>m <strong>Pflege</strong>fachpersonalim Durchschnitt deutlich höherals <strong>bei</strong> <strong>den</strong> Ärzten, wo<strong>bei</strong> verbindlicherechtliche Rahmenbedingungen – aus teilsnicht „vorwerfbaren“ Grün<strong>den</strong> – jedochnicht immer eingehalten wur<strong>den</strong>. Der Medianliegt <strong>bei</strong>m <strong>Pflege</strong>fachpersonal <strong>bei</strong>107 St<strong>und</strong>en, <strong>bei</strong> Ärzten <strong>bei</strong> 84 St<strong>und</strong>en,der Mittelwert <strong>bei</strong> 113 bzw 98 St<strong>und</strong>en.Generell besteht aber eine hohe Korrelationzwischen <strong>den</strong> für <strong>den</strong> funktionsbezogenen<strong>Pflege</strong>bedarf insgesamt i<strong>den</strong>tifiziertenSt<strong>und</strong>en/Monat.<strong>Pflege</strong>fachkräfte erachten <strong>bei</strong> mehr verschie<strong>den</strong>enVerrichtungen eine <strong>Pflege</strong> fürerforderlich (<strong>Pflege</strong>fachkraft: durchschnittlich8,4 Kategorien; Arzt: 7,5). Interessanterweiseschätzen sie aber <strong>den</strong> konkretenZeitbedarf für die einzelne Kategorie ten<strong>den</strong>ziellniedriger ein als Ärzte.<strong>Pflege</strong>fachkräfte stufenten<strong>den</strong>ziell höher ein,beachten da<strong>bei</strong> aber zumTeil rechtlich verbindlicheRahmenbedingungen nicht.Insgesamt relativ gleichläufigeEinstufung – relativ hohe Übereinstimmungim Globalvergleich<strong>Die</strong> Einstufungen in die <strong>Pflege</strong>geldstufendurch die <strong>bei</strong><strong>den</strong> Gutachtergruppen könnenglobal gesehen als relativ gleichläufigbezeichnet wer<strong>den</strong>. Abweichungen übermehrere <strong>Pflege</strong>geldstufen kommen wohlvor, sind aber vergleichsweise deutlich seltenerals in Bezug auf die unmittelbar angrenzen<strong>den</strong><strong>Pflege</strong>geldstufen <strong>und</strong> hängenzum Teil auch mit der Nichtbeachtungvon rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen.Generell hat sich gezeigt, dass das <strong>Pflege</strong>personalüber alle Diagnosegruppen hinwegetwas höher eingestuft hat.Geringere Übereinstimmung<strong>bei</strong> <strong>den</strong> Stufen 1 bis 3Vor allem hinsichtlich der Stufe 0 (keindie Stufe 1 erreichender <strong>Pflege</strong>bedarf) ergabensich gravierende Unterschiede. StuftenÄrzte in Stufe 0 ein, kamen lediglich 46,7%der pflegerischen Gutachten zum gleichenErgebnis. Stuften umgekehrt <strong>Pflege</strong>fachkräftein Stufe 0 ein, kamen immerhin20,5% der Ärzte zu einem <strong>Pflege</strong>bedarf zu-1 Vgl näher Grasser, Begutachtung durch <strong>Pflege</strong>fachkräfte –Ein Pilotprojekt des BMASK, ÖZPR 2010/126, 140. 2 Krispl, Einbeziehungvon <strong>Pflege</strong>fachkräften in die <strong>Pflege</strong>begutachtung –ein Pilotprojekt im Auftrag des BMSG, SozSi 2006, 21.172 ÖZPR 6 | 2011
<strong>Pflege</strong>geld & Sozialrechtrechtlichen Rahmenbedingungen eingehaltenwur<strong>den</strong>.Mangelnde Gutachtensqualität –geringe NachvollziehbarkeitNeben der Beachtung der gesetzlichen Vorgabenist einer der wichtigsten Gr<strong>und</strong>sätzeim Begutachtungsverfahren die Nachvollziehbarkeit<strong>und</strong> Plausibilität des Verfahrens<strong>und</strong> des Gutachtens, also eine transparenteVerfügbarkeit von Kriterien <strong>und</strong>Inhalten, die zur Einschätzung des <strong>Pflege</strong>bedarfsgeführt haben.<strong>Pflege</strong>rische wie ärztlicheGutachten sind oft nichtnachvollziehbar – Fehleneiner plausiblen Ableitung<strong>und</strong> Darstellung des<strong>Pflege</strong>bedarfs.In <strong>bei</strong><strong>den</strong> Gutachtergruppen gab esausgesprochen aussagekräftige <strong>und</strong> nachvollziehbareGutachten, gleichzeitig aberauch solche, die weit weniger nachvollziehbarwaren. Sowohl nach <strong>den</strong> Ausführungenin der qualitativen Auswertung(Schneider/Stewig) als auch in <strong>den</strong> Fokusgruppenbestand – von pflegerischer, medizinischer<strong>und</strong> juristischer Seite – Einigkeitüber die häufig geringe Nachvollziehbarkeitsowohl medizinischer als auch pflegerischerGutachten. <strong>Die</strong> geringe Nachvollziehbarkeitder Gutachten ließ sich keineswegsauf Berufsgruppenspezifika zurückführen,so stan<strong>den</strong> insbesondere dieschriftlichen Ausführungen in <strong>den</strong> Gutachtenhäufig nicht in einem nachvollziehbarenVerhältnis zu der numerischen St<strong>und</strong>enbewertung.So fin<strong>den</strong> sich noch in 88% der medizinischenGutachten <strong>und</strong> in über 70% derpflegerischen Gutachten zumindest stichwortartigeinzelne Angaben zu <strong>den</strong> Beschwer<strong>den</strong>der Antragsteller, jedoch nurmehr in knapp einem Drittel der medizinischen<strong>und</strong> in nur 15% der pflegerischenGutachten Angaben zum behaupteten <strong>Betreuung</strong>s-<strong>und</strong> Hilfsbedarf! Damit fehlt inder Darstellung des <strong>Pflege</strong>bedarfs ein zentralerFaktor, nämlich die Selbstwahrnehmungder Antragsteller.Ein ähnliches Bild zeigte sich in derDokumentation der Angaben von Vertrauens-/<strong>Betreuung</strong>spersonen<strong>und</strong> dervon ihnen erbrachten <strong>Pflege</strong>- <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>sleistungen.Zwar wurde deren Anwesenheitdokumentiert (zB „Gattin waranwesend“, „der Sohn bestätigte die Angaben“),allerdings fehlte oftmals die Dokumentationihrer konkreten Angaben zuderen tatsächlichen <strong>Betreuung</strong>sleistungenbzw zum Hilfe- <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>bedarf.In Fällen, in <strong>den</strong>en das Vorhan<strong>den</strong>seineiner <strong>Pflege</strong>dokumentation in <strong>bei</strong><strong>den</strong>Gruppen dokumentiert wurde, fan<strong>den</strong> sichhäufig Angaben wie „eingesehen“, „wurdeberücksichtigt“, „<strong>Pflege</strong>dokumentation wurdekorrekt geführt“ oder „eine <strong>Pflege</strong>dokumentationliegt vor“. Inwieweit die <strong>Pflege</strong>dokumentationdann aber tatsächlich zurErhebung pflegerelevanter Daten genutztwurde, lässt sich an dieser Stelle in keinerWeise nachvollziehen.Was daher zusammengefasst in vielenmedizinischen <strong>und</strong> pflegerischen Gutachtenfehlte, war die Darstellung der an der<strong>Pflege</strong>situation beteiligten Personen mitder Verknüpfung der eigenen Fachexpertise<strong>und</strong> dem daraus abgeleiteten <strong>Pflege</strong>bedarf.Damit wer<strong>den</strong> aber in einerbeträchtlichen Anzahl der medizinischen<strong>und</strong> pflegerischen Gutachten die rechtlichenVorgaben (zB § 25 a Abs 2 – 4BPGG; § 23 Abs 2, § 29 Z 3 RPGG 2010)bzw die Vorgaben der PVA hinsichtlichder plausiblen Ableitung <strong>und</strong> Darstellungdes <strong>Pflege</strong>bedarfs nicht berücksichtigt,<strong>den</strong>n:„Das Gutachten muss folgerichtig <strong>und</strong>schlüssig sein in Hinblick auf die Verknüpfungvon Anamnese, Untersuchungsbef<strong>und</strong>,Bef<strong>und</strong>lage, Diagnose, Gesamtbeurteilung<strong>und</strong> Ermittlung des <strong>Pflege</strong>bedarfes. <strong>Die</strong>Anamnese besteht aus <strong>den</strong> persönlichen Angabender zu untersuchen<strong>den</strong> Person <strong>und</strong> –soweit möglich – <strong>den</strong> ergänzen<strong>den</strong> Angabender <strong>Pflege</strong>person.“ (Gutachterfibel <strong>Pflege</strong>geldder PVA, Wien 2009, 17).<strong>Die</strong> Qualität eines Gutachtenswar stärker von der Erfahrung<strong>und</strong> der Schulungdes Gutachters abhängig alsvon der Berufsgruppe.<strong>Die</strong>ser generelle Mangel der Gutachtenführte letztlich dazu, dass sehr häufigkeine sinnvollen Erklärungen für objektivfestgestellte Abweichungen gef<strong>und</strong>enwer<strong>den</strong> konnten. Es war im Nachhineinschlicht nicht möglich festzustellen, warumeinzelne Verrichtungen in die <strong>Pflege</strong>bedarfsermittlungeinbezogen wur<strong>den</strong> <strong>und</strong>andere nicht. <strong>Die</strong>ser Bef<strong>und</strong> wurde in <strong>den</strong>Fokusgruppen von Ärzten, <strong>Pflege</strong>fachpersonal<strong>und</strong> Juristen unisono bestätigt.Ein Bef<strong>und</strong>, der im Hinblick auf einewirksame Oberbegutachtung bzw derenbisherige Praxis sehr zu <strong>den</strong>ken gebenmuss <strong>und</strong> dringen<strong>den</strong> Handlungsbedarfaufzeigt (Anm des Autors).Qualitativer GesamteindruckInsgesamt wurde deutlich, dass die Qualitäteines Gutachtens stärker von der Erfahrung<strong>und</strong> der Schulung des Gutachtersabhängt als von der Berufsgruppe;mit steigender Erfahrung <strong>und</strong> umfangreichererSchulung steigt die Qualität derGutachten. Der Unterschied in der Herangehensweiseliegt weniger in einer berufsgruppenspezifischenÜberlegenheit einerder <strong>bei</strong><strong>den</strong> Gruppen als vielmehr darin,dass die teilnehmen<strong>den</strong> Ärzte überwiegendlangjährig tätige Gutachter waren <strong>und</strong> entsprechendbesser mit <strong>den</strong> spezifischenRollenanforderungen zurechtkamen. <strong>Die</strong>neuen (pflegerischen) Gutachter habensich daher in der Regel auch mit dem Begutachtungsformularschwerer getan. Ausdiesem Gr<strong>und</strong> wünschen sich die <strong>Pflege</strong>fachkräftevielfach einen strukturierterenBegutachtungsbogen, der für Gutachterohne langjährige Erfahrung zweifelsohnesinnvoller wäre.Abweichungen zwischen <strong>den</strong> Gutachtergruppengründeten sich wohl auch aufdie unterschiedliche Erhebung <strong>und</strong> Bewertungvon Symptomen, krankheitsbedingtenFolgeerscheinungen, Risikobewertungen sowieUnterstützungsleistungen insbesonderein Teilbereichen.In medizinischen Gutachten lässt sichstärker eine traditionalistische Herangehensweisefeststellen. Herkömmliche Funktionsprüfungendes Bewegungsapparatesspielen eine große Rolle, während ganzheitlicheBeschreibungen des Unterstützungsbedarfsgeringer bewertet wer<strong>den</strong>.Den <strong>Pflege</strong>fachkräften wird – von <strong>den</strong>Fokusgruppen – eher eine am Wohlbefin<strong>den</strong>des Patienten orientierte Gesinnungunterstellt, <strong>den</strong> medizinischen Gutachterneher eine am objektiven Bedarf orientierteHaltung. Gutachter müssen unabhängigvon der beruflichen Herkunft stärker anrechtlichen Rahmenbedingungen orientierte,möglichst objektive, nachvollziehbareEntscheidungen fällen. <strong>Die</strong>s scheint neuenGutachtern nicht immer im vollen Ausmaßzu gelingen. <strong>Die</strong>s kann auf <strong>Pflege</strong>seitedazu geführt haben, dass St<strong>und</strong>en verge-174 ÖZPR 6 | 2011
<strong>Pflege</strong>geld & Sozialrechtben wur<strong>den</strong>, die keine rechtliche Deckungfin<strong>den</strong>.Eine weitere Problematik waren juristischeBegriffe in Gesetzen <strong>und</strong> Verordnungen,<strong>den</strong>en in der Alltagssprache bzw diversenanderen Fachsprachen eine andere Bedeutungzukommt. Hier ist es wiederumBestandteil der Rolle als Gutachter, sehrgut zwischen einer berufsspezifischen Verwendung<strong>und</strong> der gesetzlich fixierten bzwintendierten Verwendung zu unterschei<strong>den</strong>.<strong>Die</strong>s ist <strong>bei</strong> <strong>den</strong> Gutachtern auf <strong>Pflege</strong>seite<strong>bei</strong>spielsweise <strong>bei</strong>m Begriff des Motivationsgesprächs– sicher auch erfahrungsbedingt– nicht ausreichend der Fall gewesen,was zu entsprechen<strong>den</strong> Abweichungenführte.Handlungsempfehlungender StudienautorenHandlungsempfehlung 1: Bessere Schulungneuer Gutachter hinsichtlich der Rolleals Gutachter <strong>und</strong> <strong>den</strong> damit in Zusammenhangstehen<strong>den</strong> rechtlichen Vorgaben<strong>und</strong> Spielräumen. Besonderes Augenmerksollte hier<strong>bei</strong> auf heikle Begriffe, wie zBMotivationsgespräch oder <strong>Pflege</strong>dokumentation,<strong>und</strong> deren Bedeutung im Zusammenhangmit <strong>den</strong> <strong>Pflege</strong>geldgutachten liegen.Handlungsempfehlung 2: Überar<strong>bei</strong>tungdes PVA-Gutachtenformulars hinsichtlichder rechtlich problematischen Kategorie„Hilfestellung <strong>bei</strong>m Kochen“ oderzumindest Information an neue Gutachter,wie der organisationsinterne Usus <strong>bei</strong> dieserKategorie ist.Handlungsempfehlung 3: Gutachtergenerell nochmals auf die Bedeutung derNachvollziehbarkeit von Gutachten hinweisen.Allenfalls hier<strong>bei</strong> Schulungendurchführen <strong>und</strong> <strong>bei</strong>spielsweise kommentierteMustergutachten mit hoher Nachvollziehbarkeitals „Good-Practice-Beispiele“ausgeben.Handlungsempfehlung 4: Adaptiondes Gutachtenformulars, um erstens wenigererfahrenen Gutachtern die Vermeidunggängiger Fehler zu erleichtern <strong>und</strong> zweitensdie generelle Nachvollziehbarkeit zu erhöhen.Hier empfiehlt sich allenfalls eine ITbasierteVersion mit Erklärungen <strong>und</strong>Ausschlussmöglichkeiten zu erar<strong>bei</strong>ten.Handlungsempfehlung 5: Zur Erhöhungder Nachvollziehbarkeit der Gutachtendarauf achten, dass Angaben aus der<strong>Pflege</strong>dokumentation sowie Angaben der<strong>Pflege</strong>geldwerber bzw deren Vertrauenspersonenim Gutachten angeführt sind <strong>und</strong>Zum Themafür die Einstufung entsprechend nachvollziehbarherangezogen wer<strong>den</strong>. <strong>Die</strong>sbezüglichseitens der Oberbegutachtung stärkerauf die Bedeutung der Nachvollziehbarkeitder Gutachten hinweisen.ÖZPR 2011/131In Kürze<strong>Die</strong> unterschiedliche Einschätzung des <strong>Pflege</strong>bedarfs durch Ärzte <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>personal warwesentlich durch eine mangelnde Erfahrung des <strong>Pflege</strong>personals als Gutachter bedingt. Das<strong>Pflege</strong>personal hatte (noch) verstärkt Probleme mit der Rolle des Gutachters, unabhängigvon der beruflichen Herkunft stärker an rechtlichen Rahmenbedingungen orientierte, möglichstobjektive, nachvollziehbare Entscheidungen zu fällen. <strong>Die</strong>s hat dazu geführt, dassteilweise St<strong>und</strong>en vergeben wur<strong>den</strong>, die keine rechtliche Deckung fin<strong>den</strong>. Generell Handlungsbedarfzeigt sich <strong>bei</strong> der Gutachtensqualität (Nachvollziehbarkeit).Über die Autoren der besprochenen StudieDGKS Dr. in Cornelia Schneider ist Soziologin, sie ist langjährig als Referentin in der Fortbildungim Bereich Altenpflege <strong>und</strong> derzeit an der Fachhochschule Campus Wien als Lektorintätig. Ihre Ar<strong>bei</strong>tsschwerpunkte sind Demenz <strong>und</strong> herausforderndes Verhalten, Qualitätsar<strong>bei</strong>tin der Langzeitpflege, Forschungsprojekte mit Ausrichtung auf Lebensqualität in derLangzeitversorgung sowie die Versorgung demenzkranker Menschen im Heim.Dr. Christian Schober ist Direktor <strong>und</strong> Senior Researcher am Kompetenzzentrum für NonprofitOrganisationen der Wirtschaftsuniversität Wien, leitete zahlreiche praxisnahe Forschungsprojektezu unterschiedlichen NPO-relevanten Themenbereichen <strong>und</strong> beschäftigtsich aktuell vorwiegend mit <strong>den</strong> Themen (ökonomische) Evaluation von Nonprofit Organisationen,Projekten <strong>und</strong> Programmen <strong>und</strong> Finanzierung von Nonprofit Organisationen.Branchenmäßig sind Themen im Bereich Altenpflege <strong>und</strong> -betreuung sowie Behinderung<strong>und</strong> Barrierefreiheit zentral.Dr. in Doris Schober ist Vize-Direktorin des Kompetenzzentrums <strong>und</strong> beschäftigt sich aktuellvorwiegend mit <strong>den</strong> Themen Ar<strong>bei</strong>ts- <strong>und</strong> K<strong>und</strong>Innenzufrie<strong>den</strong>heit, Personalmanagementsowie (ökonomische) Evaluation von Nonprofit Organisationen, Projekten<strong>und</strong> Programmen.Friederike Stewig ar<strong>bei</strong>tet als <strong>Pflege</strong>wissenschaftlerin in der Ges<strong>und</strong>heit Österreich GmbH(GÖG) <strong>und</strong> war zuvor als selbständige Auftragsforscherin in <strong>den</strong> Bereichen Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong>Soziales tätig. Von 2006 – 2009 war sie an der „Akademie für Fort- <strong>und</strong> Sonderausbildungen“des Wiener Krankenanstaltenverb<strong>und</strong>es für <strong>den</strong> Fortbildungsbereich „Forschung inder <strong>Pflege</strong>“ verantwortlich. Ar<strong>bei</strong>ts- <strong>und</strong> Forschungsschwerpunkte sind <strong>Pflege</strong>ausbildung,Entwicklung von Ar<strong>bei</strong>tshilfen für die <strong>Pflege</strong>praxis, qualitative Forschungsmetho<strong>den</strong> sowie<strong>Pflege</strong>vorsorge.Über <strong>den</strong> Autor des BeitragsDr. Martin Greifeneder, Ar<strong>bei</strong>ts- <strong>und</strong> Sozialrichter am Landesgericht Wels, ist als Schriftleiterder ÖZPR für <strong>Pflege</strong>geldangelegenheiten zuständig. Er beschäftigt sich seit vielen Jahrenmit allen Fragen des <strong>Pflege</strong>geldes, ist Mitautor des im Verlag Manz erschienenen„Handbuch <strong>Pflege</strong>geld“ <strong>und</strong> in der Fortbildung <strong>und</strong> Ausbildung von Gutachtern tätig.E-Mail: martin.greifeneder@recht.atÖZPR 6 | 2011 175
<strong>Pflege</strong>geld & SozialrechtDr. Martin GreifenederRichter am Landesgericht WelsEinbindung von diplomierten <strong>Pflege</strong>fachkräftenin die <strong>Pflege</strong>geldbegutachtung ab 1. 1. 2012<strong>Pflege</strong>geldbegutachtung. Schon im Juni dieses Jahres – <strong>und</strong> damit unabhängig von <strong>den</strong> Ergebnissendes im vorigen Beitrag beschriebenen Pilotprojekts – kündigte BM H<strong>und</strong>storfer die Einbindungvon <strong>Pflege</strong>fachkräften <strong>bei</strong> der <strong>Pflege</strong>geld-Begutachtung nach Erhöhungsanträgen ab dem 1. 1.2012 an. <strong>Die</strong> nunmehr vorliegen<strong>den</strong> Ergebnisse des Pilotprojekts wur<strong>den</strong> der näheren Festlegungdes konkreten zukünftigen Tätigkeitsbereichs der <strong>Pflege</strong>fachkräfte im Rahmen der <strong>Pflege</strong>geldbegutachtungzugr<strong>und</strong>e gelegt. Entsprechende Vorbereitungstätigkeiten für die Umsetzung diesesVorhabens wur<strong>den</strong> in die Wege geleitet.Einsatzbereich der diplomierten<strong>Pflege</strong>fachkräfte ab 1. 1. 2012Keine gemeinsame Begutachtungdurch Arzt <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>fachkraftAuch in Hinkunft wird die Begutachtungin allen <strong>Pflege</strong>geldverfahren gr<strong>und</strong>sätzlichnur durch „einen“ Sachverständigen erfolgen.<strong>Die</strong>s ist wenig überraschend. <strong>Die</strong> vonverschie<strong>den</strong>sten Seiten propagierte gemeinsameBegutachtung durch Arzt <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>fachkraftin allen Einstufungsverfahren istfür die zuständigen Entscheidungsträgertatsächlich nie zur Diskussion gestan<strong>den</strong>.<strong>Die</strong>s völlig zu Recht. Der Mehrnutzendurch eine „Doppelbegutachtung“ wäreaufgr<strong>und</strong> der Besonderheiten des bestehen<strong>den</strong><strong>Pflege</strong>geldsystems (Maßgeblichkeit einerBasisversorgung, für die zeitlicheRicht-, Mindest- <strong>und</strong> Fixwerte existieren)als marginal einzuschätzen <strong>und</strong> würde inkeiner Relation zu <strong>den</strong> damit verb<strong>und</strong>enenerheblichen Mehrkosten stehen. In Zeitenvon notwendigen Einsparungen im Leistungsbereichwären derartige Mehrkostenim Verwaltungsbereich für eine Doppelbegutachtungvon mindestens 14 Mio Euroin keiner Weise zu rechtfertigen.Auch in Hinkunft wird die<strong>Pflege</strong>geldbegutachtung nurvon einem – medizinischenoder pflegerischen – Sachverständigenvorgenommenwer<strong>den</strong>.<strong>Pflege</strong>fachkräfte begutachtenin Erhöhungsverfahren beschränktauf die Stufen 5 bis 7<strong>Die</strong> Einstufung auf Gr<strong>und</strong> eines erstmaliggestellten Antrags auf Gewährung von<strong>Pflege</strong>geld wird wie bisher gr<strong>und</strong>sätzlichauf Basis eines ärztlichen Sachverständigengutachtenserfolgen.<strong>Pflege</strong>fachkräfte wer<strong>den</strong> als Gutachterausschließlich in Verfahren nach Erhöhungsanträgenoder im Rahmen eineramtswegigen Nachbegutachtung tätigwer<strong>den</strong>. Weitere Voraussetzung ist, dassim Vorverfahren auf Gr<strong>und</strong> eines ärztlichenGutachtens bereits ein durchschnittlichermonatlicher <strong>Pflege</strong>bedarf von mehrals 180 St<strong>und</strong>en festgestellt wurde. Mit anderenWorten: Betroffen sind Verfahren,in <strong>den</strong>en zu klären ist, inwieweit zusätzlichzum <strong>Pflege</strong>bedarf von mehr als180 St<strong>und</strong>en folgender für die Stufen 5, 6<strong>und</strong> 7 zusätzlich maßgeblicher qualifizierter<strong>Pflege</strong>bedarf nach § 4 Abs 2 BPGG erforderlichist:n Stufe 5: Vorliegen eines „außergewöhnlichen<strong>Pflege</strong>aufwandes“ im Sinne desErfordernisses– einer dauern<strong>den</strong> Bereitschaft, nichtjedoch Anwesenheit einer <strong>Pflege</strong>personoder– einer regelmäßigen Nachschau durcheine <strong>Pflege</strong>person in relativ kurzen,jedoch planbaren Zeitabstän<strong>den</strong>, wo<strong>bei</strong>zumindest eine einmalige Nachschauauch in <strong>den</strong> Nachtst<strong>und</strong>en erforderlichsein muss, oder– von mehr als fünf <strong>Pflege</strong>einheiten,davon eine auch in <strong>den</strong> Nachtst<strong>und</strong>en;n Stufe 6: Notwendigkeit– zeitlich unkoordinierbarer <strong>Betreuung</strong>smaßnahmenregelmäßigwährend des Tages <strong>und</strong> der Nachtoder– einer dauern<strong>den</strong> Anwesenheit einer<strong>Pflege</strong>person während des Tages<strong>und</strong> der Nacht wegen der Wahrscheinlichkeiteiner Eigen- oderFremdgefährdung;nStufe 7: Unmöglichkeit zielgerichteterBewegungen mit allen vier Extremitätenmit funktioneller Umsetzung bzwVorliegen eines gleichzuachten<strong>den</strong> Zustands.<strong>Pflege</strong>fachkräfte wer<strong>den</strong> ab1. 1. 2012 <strong>bei</strong> Erhöhungsanträgenab der Stufe 4 mitmehr als 180 St<strong>und</strong>en <strong>Pflege</strong>bedarfin <strong>den</strong> Stufen 5bis 7 als Gutachter tätigwer<strong>den</strong>.<strong>Die</strong>ses auf die Stufen 5 bis 7 eingeschränkteEinsatzgebiet darf aber nicht zu der irrigenAnnahme verleiten, das <strong>Pflege</strong>fachpersonalals Gutachter hätte nur <strong>den</strong> für diese Stufenmaßgeblichen qualifizierten <strong>Pflege</strong>bedarf zubeurteilen. Denn jede Höherstufung in dieStufen 5, 6 oder 7 hat einen aktuell (!) monatlichdurchschnittlich 180 St<strong>und</strong>en übersteigen<strong>den</strong><strong>Pflege</strong>bedarf als Gr<strong>und</strong>voraussetzung.Im Rahmen jeder Höherstufung istdaher als Anspruchsvoraussetzung ein solcheraktueller <strong>Pflege</strong>bedarf zusätzlichzum qualifizierten <strong>Pflege</strong>bedarf gutachterlichfestzustellen. Daran vermag derUmstand nichts zu verändern, dass in einemVorverfahren – zum damaligen Zeitpunkt(!) – durch einen medizinischen Sachverständigenein solcher <strong>Pflege</strong>bedarf bereitsfestgestellt wurde, zumal diese Feststellungkeinerlei Rechtswirkung für Folgeverfahrenentfaltet <strong>und</strong> – wie die Praxis häufig zeigt –nicht <strong>den</strong> Schluss zulässt, dass dieser Bedarfauch aktuell noch gegeben ist.Oberbegutachtung durchchefärztlichen <strong>Die</strong>nstEbenso wie jedes medizinische Einstufungsgutachtenwird auch das pflegerische176 ÖZPR 6 | 2011
<strong>Pflege</strong>geld & SozialrechtGutachten in weiterer Folge vom chefärztlichen<strong>Die</strong>nst (Ärzten) oberbegutachtet, ehees der Entscheidung zugr<strong>und</strong>e gelegt wird.<strong>Die</strong>s dient der Vereinheitlichung der Einschätzungspraxis<strong>und</strong> ist ein gr<strong>und</strong>sätzlichsinnvoller Beitrag zur Qualitätssicherungin der Begutachtung.Herabstufung setzt immerärztliches Gutachten vorausSollte eine diplomierte <strong>Pflege</strong>fachkraft zueiner Herabstufung als Ergebnis der Begutachtungkommen, soll vor der Entscheidungzusätzlich ein ärztliches Gutachtenerforderlich sein. Gr<strong>und</strong>sätzlichkann dies nur Fälle einer – in <strong>den</strong> Stufen5 bis 7 eher seltenen – amtwegigenNachbegutachtung betreffen. Konsequenterweisedürfte dieses zusätzliche medizinischeGutachten nur in Fällen einzuholensein, in <strong>den</strong>en die Nachbegutachtungdurch eine <strong>Pflege</strong>fachkraft einen <strong>Pflege</strong>bedarfvon (nunmehr) weniger als 180 St<strong>und</strong>energibt, nicht aber in Fällen des Wegfallseines für die Stufen 5 bis 7 maßgeblichenqualifizierten <strong>Pflege</strong>bedarfs, zumaldieser auch <strong>bei</strong> der Zuerkennung in Hinkunftallein durch die <strong>Pflege</strong>fachkraft festgestelltwer<strong>den</strong> soll.Diagnosebezogene Einstufungsetzt weiterhin medizinischesGutachten vorausEine diagnosebezogene Mindesteinstufungnach § 4 a BPGG für Menschen, die zur eigenständigenLebensführung überwiegendauf <strong>den</strong> selbständigen Gebrauch eines Rollstuhlsangewiesen sind, bzw für hochgradigSehbehinderte, Blinde <strong>und</strong> Taubblindesetzt weiterhin stets ein ärztliches Gutachtenvoraus, zumal <strong>bei</strong> dieser Einstufungsformdie medizinische Diagnose imVordergr<strong>und</strong> steht <strong>und</strong> der konkrete <strong>Pflege</strong>bedarfirrrelevant ist. Da es sich <strong>bei</strong> derdiagnosebezogenen Einstufung aber um eineMindesteinstufung handelt, die parallelimmer eine vergleichsweise funktionsbezogeneEinstufung erfordert (§ 4 a Abs 7BPGG), kann dies im Ergebnis zur Notwendigkeitsowohl eines medizinischen alsauch eines pflegerischen Gutachtens führen,was neben zusätzlichen Kosten das –unbedingt zu vermei<strong>den</strong>de – Risiko einerVerfahrensverlängerung in sich birgt.Zweckmäßigerweise wird in diesen eherseltenen Fällen der medizinische Gutachtermit der Gesamtbegutachtung zu beauftragensein.Praktische Umsetzung derBegutachtung durch diplomierte<strong>Pflege</strong>fachkräfte – ÜbergangsphaseStichtag 1. 1. 2012Der Einsatz von diplomierten <strong>Pflege</strong>fachkräftenin der Begutachtung im oben dargestelltenUmfang soll gr<strong>und</strong>sätzlich bereitsfür alle Erhöhungsanträge gelten, dieab 1. 1. 2012 neu gestellt wer<strong>den</strong>, bzw inamtswegigen Überprüfungsverfahren, dieab 1. 1. 2012 eingeleitet wer<strong>den</strong>.Sollten in der Anfangsphase nicht in allenRegionen genügend <strong>Pflege</strong>fachkräftezur Verfügung stehen, ist zur Vermeidungeiner Verfahrensverzögerung ein medizinischesSachverständigengutachten einzuholen.Gutachterpools wer<strong>den</strong>zentral <strong>bei</strong> PVA <strong>und</strong> BVAeingerichtet. Interessiertekönnen sich über <strong>den</strong> ÖGKVals Gutachter bewerben.Rekrutierung <strong>und</strong> Schulungvon <strong>Pflege</strong>fachkräften für dieBegutachtungAls Gutachter tätig wer<strong>den</strong> können Angehörigedes gehobenen <strong>Die</strong>nstes für Ges<strong>und</strong>heits-<strong>und</strong> Krankenpflege, die mindestensdrei Jahre praktische Berufserfahrunghaben <strong>und</strong> die einschlägigen Schulungen(siehe unten) absolvieren.Bei <strong>den</strong> SozialversicherungsträgernPVA <strong>und</strong> BVA wird ein Pool an pflegerischenGutachtern eingerichtet, der allenEntscheidungsträgern zur Verfügungsteht. Dadurch soll auch kleineren Entscheidungsträgernstets eine ausreichendeAnzahl an Gutachtern kurzfristig zurVerfügung stehen, wodurch Verfahrensverzögerungenvermie<strong>den</strong> wer<strong>den</strong> sollten.Als wichtiger Beitrag zu einer – derzeitunzureichen<strong>den</strong> – Qualitätssicherung inder Begutachtungspraxis ist die durch diePoollösung mögliche zentrale <strong>und</strong> damiteinheitliche Schulung bzw Fortbildung derSachverständigen zu sehen. Speziell auf<strong>Pflege</strong>fachkräfte abgestimmte SchulungsbzwAr<strong>bei</strong>tsunterlagen sind in Ausar<strong>bei</strong>tung.Interessenten aller neun B<strong>und</strong>esländerkönnen sich jederzeit <strong>bei</strong>m ÖGKV(office@oegkv.at) mel<strong>den</strong>, auf dessenHomepage (www.oegkv.at) sich weitere Informationenfin<strong>den</strong>. Eine Mitgliedschaftzum ÖGKV ist nicht Voraussetzung!Für bereits angemeldete Personen wirdnoch vor dem 1. 1. 2012 in <strong>den</strong> jeweiligenLändern eine Schulung durch die poolverantwortlichenSozialversicherungsträgerstattfin<strong>den</strong>. <strong>Die</strong> nächsten Schulungen wer<strong>den</strong>nach Informationen des BMASK imFrühjahr 2012 stattfin<strong>den</strong>.HonorierungDas Pauschalhonorar für ein pflegerischesGutachten wird g 65,– (inklusive Hausbesuchszuschlag)zuzüglich amtliches Kilometergeldbetragen. Auf die Wirtschaftlichkeitder Fahrtrouten (im Hinblick aufdas Kilometergeld) wird <strong>bei</strong> der Auswahldes Sachverständigen möglichst Bedachtzu nehmen sein.Rechtliche UmsetzungÄnderung des § 8 EinstV –AnstaltsverfahrenNach § 4 Abs 7 BPGG ist der B<strong>und</strong>esministerfür Soziales <strong>und</strong> Konsumentenschutzermächtigt, nach Anhörung desB<strong>und</strong>esbehinderten<strong>bei</strong>rates nähere Bestimmungenfür die Beurteilung des <strong>Pflege</strong>bedarfsdurch Verordnung festzulegen. AufBasis dieser Verordnungsermächtigung regeltderzeit § 8 Abs 1 Einstufungsverordnung(EinstV), dass die Gr<strong>und</strong>lage derEntscheidung ein ärztliches Sachverständigengutachtenbildet; erforderlichenfallssind zur ganzheitlichen Beurteilung der<strong>Pflege</strong>situation Personen aus anderen Bereichen,<strong>bei</strong>spielsweise dem gehobenen<strong>Die</strong>nst für Ges<strong>und</strong>heits- <strong>und</strong> Krankenpflege,der Heil- <strong>und</strong> Sonderpädagogik, der Sozialar<strong>bei</strong>t,der Psychologie sowie der Psychotherapie<strong>bei</strong>zuziehen. 1 § 8 Abs 1 EinstVmuss bis 1. 1. 2012 an die oben dargestellteEinbindung der <strong>Pflege</strong>fachkräfte in die Begutachtungangepasst wer<strong>den</strong>. Aber auchder bisher in § 8 Abs 2 EinstV definiertezwingende Inhalt eines <strong>Pflege</strong>geldgutachtenswird anzupassen sein, da derzeit einsolches Gutachten unter anderem eineAnamnese, Diagnose <strong>und</strong> die voraussichtlicheEntwicklung der Behinderung enthaltenmuss, was eine ärztliche Ausbildungerfordert.Einsatz von <strong>Pflege</strong>fachkräftenin Sozialgerichtsverfahren?Ein verpflichtender Einsatz von <strong>Pflege</strong>sachverständigenim sozialgerichtlichen1 Siehe näher Greifeneder, Das ärztliche Gutachten als Gr<strong>und</strong>lageder <strong>Pflege</strong>geldeinstufung – <strong>Die</strong> aktuelle Rechtslage, ÖZPR2010/125, 138.ÖZPR 6 | 2011 177
<strong>Pflege</strong>geld & SozialrechtVerfahren erfordert – ungeachtet dergr<strong>und</strong>sätzlichen Frage der Zweckmäßigkeiteiner solchen Regelung im Parteienprozess– meines Erachtens hingegen weiterreichendeGesetzesänderungen.Während die verpflichtende Heranziehungvon <strong>Pflege</strong>fachkräften als Gutachterim oben dargestellten, ab 1. 1. 2012 geplanten,Umfang im Verfahren <strong>bei</strong> <strong>den</strong> Sozialversicherungsträgerndurch eine umfassendeNovellierung des § 8 EinstV geregeltwer<strong>den</strong> kann, erfordert eine verpflichtendeHeranziehung in sozialgerichtlichen Verfahrenmeines Erachtens eine Änderungdes § 87 Ar<strong>bei</strong>ts- <strong>und</strong> Sozialgerichtsgesetzes(ASGG) oder des BPGG!Dem Gr<strong>und</strong>satz der sukzessiven Kompetenzentsprechend, haben die Ar<strong>bei</strong>ts<strong>und</strong>Sozialgerichte nicht die Aufgabe, dievon <strong>den</strong> Trägern der Sozialversicherung erlassenen,durch Klage bekämpften Bescheidezu überprüfen; sie haben vielmehr überdie mit einer Klage geltend gemachten Ansprüchenach Abschluss des Verwaltungsverfahrensin einem eigenen, selbständigenVerfahren zu entschei<strong>den</strong>.Ob <strong>Pflege</strong>fachkräfte auchim sozialgerichtlichen Verfahrenverpflichtend einzusetzensein wer<strong>den</strong>, wirddie konkrete rechtliche Umsetzungdieses Vorhabenszeigen.§ 87 Abs 1 ASGG verpflichtet in derartigenSozialrechtssachen das Gericht,„sämtliche notwendig erscheinen<strong>den</strong> Beweisevon Amts wegen aufzunehmen“,<strong>und</strong> zwar unabhängig von entsprechen<strong>den</strong>Beweisanboten. Im Beweisverfahrenherrscht sohin strikte Amtswegigkeit.„Notwendig“ im Sinne dieser Gesetzesbestimmungsind all jene Beweisaufnahmen,die voraussichtlich geeignet sind, jene Tatsachenzu „beweisen“, deren mit hoherWahrscheinlichkeit erforderliche Feststellungdem Gericht die Entscheidung über<strong>den</strong> Klagsanspruch ermöglicht. Mit anderenWorten: Das Gericht ist verpflichtet,alle sich aus dem Vorbringen der Parteien,aus Beweisergebnissen oder dem Inhaltdes Akts ergeben<strong>den</strong> Hinweise aufdas Vorliegen bestimmter entscheidungswesentlicherTatumstände in seine Überprüfungeinzubeziehen. 2 Aber auch nach§ 351 ZPO ist die Auswahl des SachverständigenErgebnis einer Ermessensentscheidungdes Gerichts; in der Bestellungeiner Person zum Sachverständigendrückt sich die Meinung des Gerichtsaus, dass diese Person für die konkretzu beurteilende Sachverhaltsfrage die erforderlicheSachkenntnis besitzt. 3Damit besteht aber nicht nur dasRecht, sondern vielmehr die Pflicht des Gerichts,im Einzelfall aufgr<strong>und</strong> des konkretenFalls zu entschei<strong>den</strong>, ob es für dieKlärung des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen– konkret auch betreffend<strong>den</strong> qualifizierten <strong>Pflege</strong>bedarf der Stufen 5bis 7 – ein medizinisches <strong>und</strong>/oder ein pflegerischesGutachten für notwendig im Sinnedes § 87 Abs 1 ASGG erachtet.Abgesehen vom zwingen<strong>den</strong> Charakterdes § 87 Abs 1 ASGG erscheint dies auchzweckmäßig: Denn dem Sozialgericht liegenzum Zeitpunkt der Gutachterbestellungbereits neben dem medizinischenoder in Hinkunft auch pflegerischen Anstaltsgutachten<strong>und</strong> der Klagebeantwortungder Sozialversicherung auch die gegendie bescheidmäßige Erledigung insZum ThemaIn KürzeTreffen geführten Klagsbehauptungen des<strong>Pflege</strong>bedürftigen vor. Auf deren Basiskann am besten beurteilt wer<strong>den</strong>, ob imkonkreten Fall für die zwischen <strong>den</strong> Prozessparteienstrittig verbliebene Frage, <strong>den</strong>strittigen Anspruch, eher medizinischeoder pflegerische Einschätzungen, Diagnosenusw notwendig sind. Wenn nach diesenInformationen <strong>bei</strong>spielsweise im Wesentlichenstrittig ist, ob die von pflegen<strong>den</strong>Angehörigen geschilderten nächtlichenUnruhe- <strong>und</strong> Verwirrtheitszustände glaubhaftsind oder allenfalls übertrieben dargestelltwer<strong>den</strong>, wird das Gericht zweckmäßigerweisedas Vorliegen bzw das Ausmaßeiner Gr<strong>und</strong>erkrankung abklären lassen,die mit diesen Angaben in Einklang stehenkönnten. Andernfalls wäre mit entsprechen<strong>den</strong>Anträgen, zB seitens der zuständigenSozialversicherung, zu rechnen,die wiederum weitere Gutachten erfordern<strong>und</strong> damit eine Verlängerung der Verfahrensdauersowie zusätzliche Kosten bedingenwür<strong>den</strong>.<strong>Die</strong> konkrete rechtliche Umsetzung desgeplanten Einsatzgebiets der <strong>Pflege</strong>fachkräftebleibt daher abzuwarten <strong>und</strong> wird inder ÖZPR zu einem späteren Zeitpunktdargestellt <strong>und</strong> kommentiert wer<strong>den</strong>.ÖZPR 2011/1322 Kuderna, ASGG 2 § 87 Anm 3; OGH 10 ObS 118/95; 10 ObS104/09 f. 3 OGH RIS-Justiz RS0040607.Ab 1. 1. 2012 wer<strong>den</strong> auch <strong>Pflege</strong>fachkräfte in die <strong>Pflege</strong>geldbegutachtung, beschränkt aufdie Stufen 5 bis 7, eingeb<strong>und</strong>en wer<strong>den</strong>. Voraussetzung ist, dass in einem Vorverfahren bereitsein <strong>Pflege</strong>bedarf von monatlich mehr als 180 St<strong>und</strong>en mit einer medizinischen Begutachtungfestgestellt wurde. Mit dieser Einbindung wird jahrelangen Bestrebungen der<strong>Pflege</strong> Rechnung getragen.LiteraturhinweisGreifeneder, Begutachtung durch <strong>Pflege</strong>fachkräfte – Ergebnisse des Pilotprojekts, ÖZPR 2011/131, 172.Greifeneder, Das ärztliche Gutachten als Gr<strong>und</strong>lage der <strong>Pflege</strong>geldeinstufung – <strong>Die</strong> aktuelleRechtslage, ÖZPR 2010/125.Linkwww.oegkv.at178 ÖZPR 6 | 2011
<strong>Pflege</strong>geld & SozialrechtADir Erwin BiringerB<strong>und</strong>esministerium für Ar<strong>bei</strong>t, Soziales <strong>und</strong> KonsumentenschutzAuch pflegen<strong>den</strong> Angehörigen kommtdas <strong>Pflege</strong>geldreformgesetz 2012 zuguteZuwendungen zu <strong>den</strong> Kosten der Ersatzpflege. <strong>Die</strong> Übertragung der Zuständigkeiten für Anspruchsberechtigtenach <strong>den</strong> Landespflegegeldgesetzen von <strong>den</strong> Ländern auf <strong>den</strong> B<strong>und</strong> hat auchin finanzieller Hinsicht positive Auswirkungen für pflegende Angehörige. Ab 1. 1. 2012 könnenAngehörige aller <strong>Pflege</strong>geldbezieher vom B<strong>und</strong>essozialamt unter bestimmten VoraussetzungenZuwendungen zu <strong>den</strong> Kosten für die Ersatzpflege erhalten.Bekanntlich wer<strong>den</strong> 80 bis 85% aller <strong>Pflege</strong>geldbezieherhäufig ohne die Inanspruchnahmeprofessioneller <strong>Die</strong>nste in häuslicherUmgebung von ihren Angehörigen gepflegt.Nur durch deren großes Engagementist es oftmals möglich, dass pflegebedürftigeMenschen – ihrem Wunsch entsprechend– zu Hause verbleiben können<strong>und</strong> eine Übersiedlung in ein <strong>Pflege</strong>heimvermie<strong>den</strong> wer<strong>den</strong> kann. Dass die <strong>Betreuung</strong>von pflegebedürftigen Familienmitgliederneine große Herausforderung <strong>und</strong> einepermanente Belastung darstellt, ist zwarallgemein bekannt, soll hier aber neuerlichbetont wer<strong>den</strong>.<strong>Pflege</strong>nde Angehörige wer<strong>den</strong>häufiger krank als dieDurchschnittsbevölkerung.In allen bis dato durchgeführten Studienzur Thematik der häuslichen <strong>Pflege</strong>wurde der <strong>Pflege</strong> zu Hause eine gute Qualitätausgewiesen. Einer Studie über die Situationpflegender Angehöriger 1 ist zuentnehmen, dass das Durchschnittsalterder pflegen<strong>den</strong> Angehörigen 58 Jahre beträgt;45% aller Hauptpflegepersonen sind60 Jahre <strong>und</strong> älter, 22% sind sogar 70 Jahre<strong>und</strong> älter. Ebenso zeigt diese Studie, dasspflegende Angehörige häufiger krankwer<strong>den</strong> <strong>und</strong> anfälliger für stressbedingteKrankheiten sind als die Durchschnittsbevölkerung.<strong>Die</strong> Belastungen aus der <strong>Pflege</strong>sind zumeist über einen längeren Zeitraumexistent <strong>und</strong> dieser Umstand wirkt sichverstärkend auf das pathogene Potenzialder <strong>Pflege</strong>belastungen aus.Von besonderer Bedeutung für pflegendeAngehörige ist das Bedürfnis, <strong>Betreuung</strong>ssicherheitfür die von ihnen betreuten<strong>und</strong> gepflegten älteren Angehörigenunbedingt zu gewährleisten. <strong>Die</strong>s erschwertes ihnen oftmals, anderen Bedürfnissennachzukommen <strong>und</strong> sich zwischendurchPhasen von Erholung, Auszeit oder Urlaubzu gönnen oder eigenen Interessenoder dem Bedürfnis nach sozial-kommunikativemAustausch mit Bekannten <strong>und</strong>Fre<strong>und</strong>en nachzukommen. 2 Dazu kommt,dass die Kosten für Ersatzpflegemaßnahmendurch stationäre Kurzzeitpflege inHeimen, professionelle soziale <strong>Die</strong>nsteoder private <strong>Pflege</strong>personen eine – in vielenFällen beträchtliche – zusätzliche Belastungdarstellen.Finanzielle Zuwendungenhelfen Angehörigen, sichvon der <strong>Pflege</strong> zu erholen.Zur finanziellen Unterstützung <strong>und</strong>Erleichterung, sich einen „Urlaub von der<strong>Pflege</strong>“ zu nehmen, wurde mit § 21 a desB<strong>und</strong>espflegegeldgesetzes (BPGG) die gesetzlicheMöglichkeit geschaffen, dass Angehörigeim Falle der Verhinderung an der<strong>Pflege</strong> Zuwendungen zu <strong>den</strong> Kosten fürdie Ersatzpflege erhalten können. 3,4Aufgr<strong>und</strong> der bis 31. 12. 2011 bestehen<strong>den</strong>Kompetenzlage können Zuwendungennach § 21 a BPGG ausschließlich an Personenausbezahlt wer<strong>den</strong>, die Bezieher eines<strong>Pflege</strong>geldes nach dem B<strong>und</strong>espflegegeldgesetzüberwiegend betreuen. Beinahe alleB<strong>und</strong>esländer haben im Wesentlichengleichlautende Gr<strong>und</strong>lagen dafür geschaffen,dass Hauptpflegepersonen von pflegebedürftigenMenschen, <strong>den</strong>en ein <strong>Pflege</strong>geldnach landesgesetzlichen Regelungengebührt, von <strong>den</strong> Ländern analoge Zuschüssezu <strong>den</strong> Ersatzpflegekosten erhaltenkönnen. Allerdings können nicht alle pflegen<strong>den</strong>Angehörigen solche Zuwendungenerhalten.Als notwendiger <strong>und</strong> großer Schritt inRichtung Verwaltungsreform <strong>und</strong> einerk<strong>und</strong>enfre<strong>und</strong>lichen Neuregelung der <strong>Pflege</strong>geldadministrationwurde am 8. 7. 2011im Nationalrat das <strong>Pflege</strong>geldreformgesetz2012 5 beschlossen. Schwerpunkt dieses Gesetzesist die Übertragung der Zuständigkeitfür Anspruchsberechtigte nach <strong>den</strong>bisherigen landesgesetzlichen Regelungenvon <strong>den</strong> Ländern auf <strong>den</strong> B<strong>und</strong>, sodass dasgesamte <strong>Pflege</strong>geldwesen in Gesetzgebung<strong>und</strong> Vollziehung ab 1. 1. 2012 in die Kompetenzdes B<strong>und</strong>es fällt; gleichzeitig wur<strong>den</strong>die auf dem Gebiet des <strong>Pflege</strong>geldes bestehen<strong>den</strong>landesgesetzlichen Bestimmungenaußer Kraft gesetzt. 6Ab 1. 1. 2012 ist nur mehrder B<strong>und</strong> für Zuwendungenzu <strong>den</strong> Ersatzpflegekostenzuständig – Anträge sindzentral <strong>bei</strong>m B<strong>und</strong>essozialamteinzubringen.Ab 1. 1. 2012 wer<strong>den</strong> Zuwendungenauf Basis des § 21 a BPGG vom B<strong>und</strong>essozialamtan Angehörige sämtlicher <strong>Pflege</strong>geldbeziehergeleistet. In Hinkunft ist esdafür unerheblich, ob dem pflegebedürftigenMenschen ein <strong>Pflege</strong>geld nach <strong>den</strong> biszum 31. 12. 2011 gelten<strong>den</strong> landesgesetzlichenRegelungen oder dem B<strong>und</strong>espflegegeldgesetzzuerkannt wurde.<strong>Die</strong>ser begrüßenswerte Effekt des <strong>Pflege</strong>geldreformgesetzes2012 könnte <strong>bei</strong> nähererBetrachtung während eines Übergangszeitraumsallerdings Nachteile für pflegendeAngehörige mit sich bringen:Eine der Voraussetzung für die Gewährungder Zuwendung gem § 21 a BPGG ist,dass der pflegebedürftige Familienangehörigebereits mindestens ein Jahr lang zumindestein <strong>Pflege</strong>geld in Höhe der Stufe 3oder der Stufe 1, wenn nachweislich einedemenzielle Erkrankung vorliegt bzw diepflegebedürftige Person minderjährig ist,1 ÖBIG, Situation pflegender Angehöriger 2005. 2 Elbe/Fritzer,Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen Sozialer Diagnostik im Kontextder ambulanten Altenpflege, Masterthese, erstellt an der FHSt. Pölten (2011). 3 BGBl I 2003/71. 4 Zu <strong>den</strong> näheren Voraussetzungenfür eine solche Zuwendung siehe Biringer, Zuwendungenzu <strong>den</strong> Kosten der Ersatzpflege, ÖZPR 2011/38, 42.5 BGBl I 2011/58. 6 Siehe Greifeneder, <strong>Pflege</strong>geldreformgesetz2012, ÖZPR 2011/90, 108.ÖZPR 6 | 2011 179
<strong>Pflege</strong>geld & SozialrechtZum Themanach dem B<strong>und</strong>espflegegeldgesetz bezieht.Angehörige von Beziehern eines bisherigenLandespflegegeldes, die ab 1. 1. 2012ex lege einen Anspruch auf <strong>Pflege</strong>geld nachdem B<strong>und</strong>espflegegeldgesetz in Höhe derbisher nach landesgesetzlichen Vorschriftengewährten Stufe haben (§ 48 c Abs 2BPGG) <strong>und</strong> im Jahr 2012 einen Antrag aufeine Zuwendung zu <strong>den</strong> Kosten für die Ersatzpflegeeinbringen, konnten demnachkeine Zuwendung erhalten, weil sie nochnicht mindestens ein Jahr „B<strong>und</strong>es“-<strong>Pflege</strong>geldbeziehen.Um solche Nachteile für pflegende Angehörigedurch die Übernahme der Landespflegegeldfälledurch <strong>den</strong> B<strong>und</strong> zu vermei<strong>den</strong>,hat das BMASK das B<strong>und</strong>essozialamtbereits dahingehend angewiesen, dass auchin solchen Fällen <strong>bei</strong> Zutreffen der sonstigenVoraussetzungen Zuwendungen zu gewährensind.Somit können ab dem Inkrafttretendes <strong>Pflege</strong>geldreformgesetzes 2012 im Unterschiedzur bis 31. 12. 2011 gelten<strong>den</strong>Rechtslage die Hauptpflegepersonen aller<strong>Pflege</strong>geldbezieher Zuwendungen zu <strong>den</strong>Kosten für die Ersatzpflege erhalten.ÖZPR 2011/133In KürzeEine Folge des <strong>Pflege</strong>geldreformgesetzes 2012 ist, dass ab 1. 1. 2012 Zuwendungen zu <strong>den</strong> Kosten für die Ersatzpflege vom B<strong>und</strong>essozialamtan pflegende Angehörige sämtlicher <strong>Pflege</strong>geldbezieher gewährt wer<strong>den</strong> können.Damit sind für pflegende Angehörige insofern wesentliche Verbesserungen verb<strong>und</strong>en, alsn nunmehr alle Hauptpflegepersonen <strong>bei</strong> Erfüllung der Voraussetzungen Zuwendungen erhalten können,n nur mehr eine Behörde für die Gewährung von Zuwendungen zuständig ist <strong>und</strong>n die Entscheidung b<strong>und</strong>esweit nach einheitlichen Kriterien erfolgt.Über <strong>den</strong> AutorADir Erwin Biringer ist Mitar<strong>bei</strong>ter der Abteilung IV/B/4 im B<strong>und</strong>esministerium für Ar<strong>bei</strong>t, Soziales <strong>und</strong> Konsumentenschutz, insbesonderezuständig für <strong>Pflege</strong>geld <strong>und</strong> Maßnahmen zur Unterstützung pflegender Angehöriger.LiteraturhinweisBiringer, Zuwendungen zu <strong>den</strong> Kosten der Ersatzpflege, ÖZPR 2011/38, 42; Greifeneder, <strong>Pflege</strong>geldreformgesetz 2012, ÖZPR 2011/90, 108.Zur InformationNähere Auskünfte zu <strong>den</strong> Zuwendungen zu <strong>den</strong> Kosten für die Ersatzpflege erteilen die Mitar<strong>bei</strong>ter des B<strong>und</strong>essozialamts (Tel: 059988)<strong>und</strong> des <strong>Pflege</strong>telefons des B<strong>und</strong>esministeriums für Ar<strong>bei</strong>t, Soziales <strong>und</strong> Konsumentenschutz (gebührenfreie Rufnummer: 0800 20 16 22).LinksSchriftliche Informationen fin<strong>den</strong> sich auf:www.b<strong>und</strong>essozialamt.gv.atwww.bmask.gv.atwww.pflegedaheim.atDr. Martin GreifenederRichter am Landesgericht WelsFragen aus der PraxisKann ein Gutachter gleichzeitig für Sozialversicherung <strong>und</strong> Sozialgericht tätig sein?Im Zuge der Einbindung von <strong>Pflege</strong>fachkräften in die Begutachtung wer<strong>den</strong> <strong>bei</strong> Pensionsversicherungsanstalt (PVA) <strong>und</strong> Versicherungsanstaltöffentlich Bediensteter (BVA) Pools von <strong>Pflege</strong>geldgutachtern gebildet, auf <strong>den</strong> alle Entscheidungsträger zugreifenkönnen (siehe dazu näher in diesem Heft ÖZPR 2011/132, Seite 176).Ein gerichtlich beeideter <strong>und</strong> zertifizierter Sachverständiger aus dem Bereich <strong>Pflege</strong> stellt dazu die Frage, ob die Tätigkeit ineinem derartigen Gutachterpool generell ausschließt, auch <strong>bei</strong>m Sozialgericht als Gutachter tätig zu wer<strong>den</strong>.Gem § 87 Abs 5 ASGG darf zum Sachverständigen nicht bestellt wer<strong>den</strong>, wer zur beklagten Partei (zB Sozialversicherung)in einem Ar<strong>bei</strong>tsverhältnis steht oder von dieser in Leistungssachen häufig als Sachverständiger beschäftigt wird.Meines Erachtens schließt sich eine gleichzeitige Tätigkeit für <strong>den</strong> Sozialversicherungspool <strong>und</strong> das Sozialgericht daher aus.Denkbar erscheint aber die Erklärung, von Seiten einer Sozialversicherung (zB Sozialversicherungsanstalt der Bauern [SVB])keine Gutachten aus dem Pool anzunehmen <strong>und</strong> in diesem Bereich <strong>bei</strong>m Sozialgericht tätig zu sein. ÖZPR 2011/134180 ÖZPR 6 | 2011
HR Dr. Hans Peter ZierlBezirkshauptmann von Freistadt a.D.Mag. Stefan KoppensteinerRichter am Bezirksgericht NeunkirchenHeimAufG & UbGINTRO. <strong>Die</strong>se Rubrik bietet Hilfe <strong>bei</strong> der richtigen Anwendung des Heimaufenthaltsgesetzes <strong>und</strong>des Unterbringungsgesetzes durch Aufzeigen <strong>und</strong> Lösen häufig auftretender Problemfälle.Praxisleitfa<strong>den</strong> für medikamentöse FreiheitsbeschränkungenViele theoretische <strong>und</strong> praktische Probleme, die die Erlassung des HeimAufG hervorgerufenhat, wur<strong>den</strong> einerseits <strong>bei</strong> zahlreichen Schulungen der mit diesem Rechtsgebiet befasstenPersonen <strong>und</strong> andererseits durch die Judikatur geklärt. Einige Probleme blieben<strong>den</strong>noch bestehen. Sie betreffen unter anderem die medikamentösen Freiheitsbeschränkungen.Obwohl sich bereits der Oberste Gerichtshof in mehreren Entscheidungen mit <strong>den</strong>rechtlichen Aspekten der medikamentösen Freiheitsbeschränkung befasst hat, sind nachwie vor wesentliche Fragen zu diesem schwierigen Thema ungeklärt bzw bedürfen sie nähererErörterung. <strong>Die</strong>se Situation erschwert bislang die tägliche Ar<strong>bei</strong>t in der Praxis nichtunerheblich.Dankenswerterweise hat sich unter Einbindung des B<strong>und</strong>esministeriums für Justiz eineAr<strong>bei</strong>tsgruppe – bestehend aus Vertretern mit dem Heimaufenthaltsgesetz befassterInstitutionen <strong>und</strong> Berufsgruppen – des Themas angenommen <strong>und</strong> in zahlreichen Besprechungeneinen detaillierten Praxisleitfa<strong>den</strong> („Manual“) zum Umgang mit medikamentösenFreiheitsbeschränkungen erar<strong>bei</strong>tet. Das Manual wird von zwei Teilnehmern diesesAr<strong>bei</strong>tskreises (Bürger <strong>und</strong> Herdega) in zwei Teilen in diesem <strong>und</strong> im nächsten Heft derÖZPR präsentiert. Damit setzt die ÖZPR in der Rubrik „HeimAufG <strong>und</strong> UbG“ einenSchwerpunkt zu diesem Thema.In der vorliegen<strong>den</strong> Ausgabe behandeln Bürger <strong>und</strong> Herdega die gr<strong>und</strong>legende Rechtsfrage,unter welchen Voraussetzungen die Verabreichung von Medikamenten als medikamentöseFreiheitsbeschränkung im Sinne des HeimAufG zu qualifizieren ist. Im folgen<strong>den</strong>Heft wer<strong>den</strong> Teilaspekte der medikamentösen Freiheitsbeschränkung in praxisnahenFall<strong>bei</strong>spielen beleuchtet.Weiters <strong>bei</strong>nhaltet die Rubrik „HeimAufG <strong>und</strong> UbG“ einen Beitrag von Koppensteinerzur Rechtsprechung zum „neuen“ § 34 a UbG.Wie immer r<strong>und</strong>en die Besprechung aktueller Judikatur sowie die Beantwortung vonFragen aus der Praxis diese Rubrik ab.Wir wünschen uns, dass die vorliegen<strong>den</strong> Beiträge <strong>bei</strong> unseren Lesern Anklang fin<strong>den</strong><strong>und</strong> dass vor allem offene Fragen im Zusammenhang mit <strong>den</strong> medikamentösen Freiheitsbeschränkungenim Interesse der Rechtssicherheit aller Beteiligten geklärt wer<strong>den</strong>können!Hans Peter Zierl <strong>und</strong> Stefan KoppensteinerÖZPR 2011/135AKTUELLESErfahrungsaustausch „Ub in NÖ“:19. 10. 2011, OLG WienAuch heuer fand wieder das alljährliche Vernetzungstreffender Patientenanwälte vomVertretungsNetz <strong>und</strong> der Ub-Richter in Niederösterreichstatt. Ziel dieser Veranstaltungist der vor allem für die Richter sonst schwierigeErfahrungsaustausch mit Schwerpunktauf der Praxis des Ub-Verfahrens.Schwerpunkt des Kontakttreffens 2011war die praktische Umsetzung der Ub-HeimAuf-Novelle 2010 <strong>und</strong> hier vor allemder neue § 34 a UbG.Bei der Abnahme der Privatkleidunggibt es weiterhin eine unterschiedliche Praxisder Krankenanstalten. Auch <strong>bei</strong> <strong>den</strong>Ausgängen ins Freie differiert die Praxis,wo<strong>bei</strong> auch diese Beschränkung im Einzelfallgenau zu begrün<strong>den</strong> ist.<strong>Die</strong> Abnahme von Handys ist speziellan <strong>den</strong> kinder- <strong>und</strong> jugendpsychiatrischenAbteilungen weiterhin ein Thema, wo sieals „alterstypische Erziehungsmaßnahme“gerechtfertigt sein kann.§ 32 a UbG hat wie erwartet kaumpraktische Auswirkungen gezeigt.Weiters angesprochen wurde etwa auchdie im Gesetz nicht ausdrücklich geregelteErstreckung von Tagsatzungen im Ub-Verfahren, das Vorgehen <strong>bei</strong> Entweichungdes Patienten <strong>und</strong> die Verständigungspflichtdes § 39 b Abs 2 UbG, die <strong>bei</strong> „informellerAufnahme“ (ohne Polizei bzwAmtsarzt) nicht greift.Alle Anwesen<strong>den</strong> zeigten Interesse aneiner Fortsetzung im Herbst 2012.Stefan KoppensteinerÖZPR 6 | 2011 181
HeimAufG & UbG1. Unterbindung/Dämpfungdes Bewegungsdrangs liegt vorDurch <strong>den</strong> Medikamenteneinsatz ist einebewegungseinschränkende Wirkung auchtatsächlich eingetreten. Hat die verabreichteMedikation überhaupt keinen Einflussauf <strong>den</strong> Bewegungsdrang bzw die Fortbewegungsmöglichkeitdes Patienten, dannliegt uE gar keine Freiheitsbeschränkungvor. 18 Beispielhaft hierfür ist die Gruppeder sog Antidementiva zu nennen, die regelmäßigkeine sedierende Wirkung aufweisen.2. <strong>Die</strong> Dämpfung des Bewegungsdrangsist intendiert bzwmitintendiertIn der Praxis wird oft fälschlicherweise angenommen,dass allein das Vorliegen einestherapeutischen Zwecks der Medikamentenverordnungdie Anwendung des Heim-AufG ausschließt. Dem ist entgegenzuhalten,dass für jede Medikamentenverordnungimmer auch ein therapeutischerZweck vorliegen muss. Auch der ObersteGerichtshof hält fest, dass „selbst die therapeutischindizierte medikamentöse Behandlungals Freiheitsbeschränkung zu beurteilenist, wenn sie primär der Unterbindungvon Unruhezustän<strong>den</strong> <strong>und</strong> der Beruhigung,also zur ‚Ruhigstellung‘ des Patientendient“. 19Entschei<strong>den</strong>d für die Fragedes Vorliegens einer medikamentösenFreiheitsbeschränkungist daher dermit der Verabreichung desMedikaments verfolgteZweck („Intention“).Ist die Bewegungsdämpfung/Ruhigstellungunmittelbarer Zweck der Medikamentenverabreichung,dann liegt je<strong>den</strong>falls eineFreiheitsbeschränkung vor. Nach dem Manualist somit von einer Freiheitsbeschränkungauszugehen, wenn Medikamente verabreichtwer<strong>den</strong>, um damit Symptome einerpsychischen Erkrankung, die mit einemBewegungsüberschuss einhergehen, zu behandeln.Beispiel:Bei einem Patienten mit akutem Verwirrtheitszustandliegt neben extremenUnruhezustän<strong>den</strong> auch erhebliche Fremdaggressivitätvor. Trotz Zure<strong>den</strong> lässt sichder Patient nicht beruhigen, schlägt, tritt<strong>und</strong> beschimpft das <strong>Pflege</strong>personal <strong>und</strong>stellt eine Gefahrenquelle auch für dieMitpatienten dar. Zur Ruhigstellung wirddem Patienten eine sedierende Medikationverabreicht. <strong>Die</strong>se ist als Freiheitsbeschränkungzu qualifizieren, da sie zumZweck der Ruhigstellung verabreichtwird. <strong>Die</strong> Verabreichung sedierender Medikamente,um Patienten an der Fortbewegungin der Einrichtung oder am Verlassender Einrichtung zu hindern, umRuhe auf der Station oder im Heim herzustellenoder um die <strong>Pflege</strong> zu erleichtern,stellt somit in der Regel eine Freiheitsbeschränkungdar.Ist die Bewegungsdämpfung/Ruhigstellungnicht ausschließliche Intention <strong>bei</strong> der Medikamentenverabreichung,so ist zu überprüfen,ob die um der medizinischen Behandlungdes Patientenwillen in Kauf genommeneUnterbindung der Ortsveränderungunvermeidlich ist. Nach dem Manualliegt Unvermeidlichkeit vor, wennn aus medizinischer Sicht keine Behandlungsalternativenfür das konkreteKrankheitsbild des Patienten gegebensind, die nicht oder weniger freiheitsbeschränkendwirken – dh es darf bspwunter Beachtung der Regeln der ärztlichenKunst kein anderes <strong>bei</strong>m Patientenanwendbares schonenderes Medikamentzur Auswahl stehen – <strong>und</strong>n aus pflegerischer Sicht keine sonstigengelinderen Mittel zur Verfügung stehen,die nicht oder weniger bewegungseinschränkendwirken; dh kann im obigenBeispiel der Patient durch validierendeGesprächsführung beruhigt wer<strong>den</strong>,so ist eine medikamentöse Interventionunzulässig.In der Praxis bedeutet dies, dass in jedemEinzelfall der Zweck der Medikation unter<strong>den</strong> angeführten Gesichtspunkten zu prüfenist. 20<strong>Die</strong> Beurteilung der Intention <strong>und</strong> derenNachvollziehbarkeit hängt da<strong>bei</strong> vonobjektiven Kriterien wie bspw Diagnose,Symptomatik, Verhalten des Patienten,Krankheitsempfin<strong>den</strong> <strong>und</strong> anderen relevantenFaktoren ab. In der Praxis müssen daherdie Gründe für die Anordnung derFreiheitsbeschränkung durch <strong>den</strong> Anordnungsbefugtenobjektiv erklärbar <strong>und</strong> fachlichnachvollziehbar sein. In diesem Zusammenhangist besonders darauf hinzuweisen,dass die Intention der Medikamentenverabreichung<strong>und</strong> der Mangel anschonenderen <strong>Pflege</strong>- <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>salternativenso dokumentiert wer<strong>den</strong> sollte,dass eine Überprüfung nach <strong>den</strong> obgenanntenKriterien möglich ist. 213. <strong>Die</strong> Bewegungsdämpfung ist nichtintendiert, sondern unvermeidlicheNebenwirkung in Verfolgung einesanderen TherapiezielsIst die Bewegungseinschränkung <strong>bei</strong> derMedikamentenverordnung von vornhereingar nicht beabsichtigt, sondern eine unvermeidlicheNebenwirkung der notwendigenmedizinischen Behandlung zur Erreichungdes Therapieziels, so liegt keine Freiheitsbeschränkungvor.Beispiel:Einer Patientin im Palliativstadium einerKarzinomerkrankung wird ein sedierendesSchmerzmedikament in therapeutischnotwendiger Dosierung verabreicht, wasdazu führt, dass sie die meiste Zeit desTages schläft. Andere ebenso wirksameMöglichkeiten zur Schmerzlinderung bestehennicht. <strong>Die</strong> Sedierung ist eine unvermeidlicheNebenwirkung der Schmerztherapie<strong>und</strong> daher nicht als Freiheitsbeschränkungzu qualifizieren.Gr<strong>und</strong>sätzlich ist das HeimAufG auch inKrankenanstalten anzuwen<strong>den</strong>. Währendin <strong>Pflege</strong>- <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong>seinrichtungen derGeltungsbereich jedoch einrichtungsbezogenanzuwen<strong>den</strong> ist, sieht das Gesetz fürdie Krankenanstalten personenbezogeneEinschränkungen vor. 22 Voraussetzung für<strong>den</strong> Anwendungsbereich ist, dass der Patientan einer psychischen Krankheit/geisti-18 Zustimmend Barth, Freiheitsbeschränkung durch Medikamente,iFamZ 2011, 81; Herdega, aaO, Rz 126; auch nach derJudikatur des OGH ist die konkrete Wirkung jedes einzelnender zu überprüfen<strong>den</strong> Medikamente entscheidungserheblich(2 Ob 77/08 z; 1 Ob 21/09 h). AA Ganner, Medikamentöse Freiheitschränkungennach dem HeimAufG, iFamZ spezial 2010,48. 19 2Ob77/08 z; 1 Ob 21/09 h. 20 Der OGH stellt in 2 Ob 77/08 z <strong>und</strong> 1 Ob 21/09 h dazu drei entscheidungserhebliche Fragestellungenauf, die auch im Manual angeführt sind: Welchentherapeutischen Zweck verfolgt die Anwendung jedeseinzelnen der zu überprüfen<strong>den</strong> Medikamente? Wur<strong>den</strong> <strong>und</strong>wer<strong>den</strong> die Medikamente dieser Zweckbestimmung entsprechendeingesetzt? Welche konkrete Wirkung war <strong>und</strong> ist für<strong>den</strong> Bewohner mit dem Einsatz der Medikamente verb<strong>und</strong>en?21 Bei einer nicht nachvollziehbaren Dokumentation bestehtdie Gefahr, dass dieser Mangel zu Lasten der anordnen<strong>den</strong>Person <strong>und</strong> der Einrichtung geht <strong>und</strong> in allfälligen gerichtlichenÜberprüfungsverfahren zur Unzulässigkeit der gesetztenMaßnahme führen kann. 22 Vgl Bürger, Zum Anwendungsbereichdes HeimAufG in Krankenanstalten, ÖZPR 2011/20;Herdega in Resch/Wallner (Hrsg), Handbuch Medizinrecht, VII.Heimaufenthaltsgesetz Rz 31 ff; Zierl, Heimrecht 3 79; Barth/Engel, Heimrecht (2004) § 2 Anm 8.184 ÖZPR 6 | 2011
HeimAufG & UbGgen Behinderung leidet <strong>und</strong> im Zusammenhangdamit ständiger <strong>Pflege</strong> oder <strong>Betreuung</strong>bedarf. Das angeführte Manual istunter Beachtung dieser Voraussetzung naturgemäßauch für medikamentöse Behandlungenin Krankenanstalten anwendbar.Das HeimAufG <strong>und</strong> damitauch das angeführte Manualgreifen gr<strong>und</strong>sätzlich nichtin die medizinischeBehandlung an sich ein.<strong>Die</strong> rechtlichen Bedingungen für dieDurchführung einer Krankenbehandlung(zB Aufklärung <strong>und</strong> Zustimmung des Patienten)wer<strong>den</strong> vom HeimAufG nicht berührt.Eine zulässige medikamentöse Freiheitsbeschränkungsetzt neben der Erfüllungaller Voraussetzungen nach demHeimAufG somit auch die Einhaltung derRegeln der ärztlichen Kunst sowie die allgemeinenVoraussetzungen einer Heilbehandlungvoraus.AusblickOberstes Anliegen der Mitglieder der Ar<strong>bei</strong>tsgruppewar vor allem, ein praxistauglichesManual zu erstellen, das allen mitdem HeimAufG befassten Personen <strong>bei</strong>der Entscheidung, wann die VerabreichungZum Themavon Medikamenten als medikamentöseFreiheitsbeschränkung im Sinne des Heim-AufG anzusehen ist, eine wertvolle Hilfestellungleisten soll. Gleichzeitig ist es gelungen,mit diesem Manual eine gemeinsameAuslegung <strong>bei</strong> dieser in der Praxisüberaus wichtigen Fragestellung zwischen<strong>den</strong> Stakeholdern des HeimAufG unterEinbindung des Justizministeriums zu erreichen.Es bleibt abzuwarten, wie die Judikaturauf die im Manual dargestellteRechtsauslegung reagieren wird. Eine regelmäßigeEvaluierung <strong>und</strong> Neuauflage desManuals unter Beachtung aktueller Entwicklungenim medizinischen <strong>und</strong> rechtlichenBereich ist vorgesehen.In der nächsten Ausgabe der ÖZPRwer<strong>den</strong> ausgehend von <strong>den</strong> hier aufgezeigtenGr<strong>und</strong>sätzen relevante Medikamentengruppendetaillierter beleuchtet <strong>und</strong> jeweilsLösungsansätze für die Praxis anhand vonFall<strong>bei</strong>spielen dargestellt.ÖZPR 2011/136In KürzeDer seit Inkrafttreten des HeimAufG strittigen Rechtsfrage der medikamentösen Freiheitsbeschränkungenhat sich eine Ar<strong>bei</strong>tsgruppe, bestehend aus Vertretern mit dem HeimAufGbefasster Institutionen <strong>und</strong> Berufsgruppen, gewidmet <strong>und</strong> ein erläuterndes Manual zurUnterstützung in der Praxis herausgegeben. Beide Autoren waren Mitglieder dieserAr<strong>bei</strong>tsgruppe.Über die AutorenDr. Christian Bürger hat <strong>bei</strong>m Niederösterreichischen Landesverein für Sachwalterschaft<strong>und</strong> Bewohnervertretung (NÖLV) <strong>den</strong> Fachbereich Bewohnervertretung aufgebaut<strong>und</strong> leitet diesen seit 2005. Er ist Univ.-Lektor an der Donauuniversität Krems <strong>und</strong> derMedizinischen Universität Wien. Kontakt: Bräuhausgasse 5/2, 3100 St. Pölten, E-Mail:christian.buerger@noelv.atMag. Nikolaus Herdega, MSc, ist Kammeramtsdirektor-Stv <strong>und</strong> Leiter der Abteilung für Ärzterecht& Ar<strong>bei</strong>tsrecht der Ärztekammer für OÖ <strong>und</strong> Autor einschlägiger Abhandlungenzum HeimAufG. Kontakt: Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, E-Mail: recht@aekooe.or.atMag. Stefan KoppensteinerRichter am Bezirksgericht NeunkirchenDer neue § 34 a UbG in der RechtsprechungErwartete Schwerpunkte. <strong>Die</strong> Patientenanwaltschaft hat seit Inkrafttreten der Ub-HeimAuf-Nov2010 mit 1. 7. 2010 bisher primär versucht, die Umsetzung der neu geregelten „Beschränkungsonstiger Rechte“ mit <strong>den</strong> Abteilungsleitern vorab im Gespräch zu klären. Nunmehr sind aberauch die ersten richtungsweisen<strong>den</strong> Gerichtsentscheidungen dazu ergangen, die hier vorgestelltwer<strong>den</strong> sollen.Der Ausgang ins Freie <strong>und</strong>die Abnahme der Privatkleidung<strong>Die</strong> neue RechtsschutzbestimmungSoweit überblickbar, haben vor allem diese<strong>bei</strong><strong>den</strong> Beschränkungen zu <strong>den</strong> ersten(zweitinstanzlichen) Gerichtsentscheidungenseit der Novelle geführt. Das war insofernzu erwarten, als sich hier die Interessender Beteiligten (medizinisches Personalder psychiatrischen Abteilungen auf der einen,Patienten <strong>und</strong> Patientenanwälte aufder anderen Seite) deutlich gegenüberstehen.Ganz im Sinn des Gr<strong>und</strong>gedankens derÖsterreichischen Zeitschrift für <strong>Pflege</strong>rechtsoll in diesem Artikel versucht wer<strong>den</strong>, diejeweiligen Hintergründe aufzuzeigen <strong>und</strong>im Interesse einer optimalen PatientenversorgungLösungsansätze anzubieten.Wortlaut des neuen § 34 a UbG:„Beschränkungen sonstiger Rechte desKranken während der Unterbringung, insbesondereBeschränkungen der Rechte auf Tragenvon Privatkleidung, Gebrauch persönlicherGegenstände <strong>und</strong> Ausgang ins Freie,sind, soweit nicht besondere Vorschriften bestehen,nur insoweit zulässig, als sie zur Abwehreiner Gefahr im Sinn des § 3 Z 1 oderzum Schutz der Rechte anderer Personen inder psychiatrischen Abteilung unerlässlichsind <strong>und</strong> zu ihrem Zweck nicht außer Verhältnisstehen. Auf Verlangen des Krankenoder seines Vertreters hat das Gericht unver-ÖZPR 6 | 2011 185
HeimAufG & UbGzüglich über die Zulässigkeit einer solchenBeschränkung zu entschei<strong>den</strong>.“Was ist „das Freie“?(LG Salzburg 21 R 302/11 z)<strong>Die</strong> Erläuterungen zur Novelle, die – ohnewie der Gesetzestext verbindlich zu sein –zur Auslegung herangezogen wer<strong>den</strong>, führendazu lediglich aus: „Das Recht auf Ausgangins Freie bedeutet, dass Patienten in derRegel zumindest täglich für die Dauer etwaeiner St<strong>und</strong>e die Möglichkeit haben müssen,sich im Freien aufzuhalten.“Mit seiner Entscheidung vom 20. 9.2011 definierte das Landesgericht (LG)Salzburg die Kriterien näher, wie dieses„Freie“ auszusehen hat.Ein 14-Jähriger war für längere Zeit imgeschlossenen Bereich der Kinder- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrieder Christian-Doppler-Klinikin Salzburg untergebracht. Er leidet aneiner hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltensmit sehr geringer Frustrationstoleranz<strong>und</strong> Impulsdurchbrüchen <strong>und</strong> darausfolgender Selbst- <strong>und</strong> Fremdgefährdung.An der Klinik für Kinder- <strong>und</strong> Jugendpsychiatriegibt es die sogenannte „Terrasse“,eine ca 20 m 2 große Fläche, die auf zweiSeiten von Mauern begrenzt ist; die anderen<strong>bei</strong><strong>den</strong> Seiten sind etwa 2 Meter hochverglast <strong>und</strong> bemalt. Nach oben ist der Bereich,der lediglich mit einer kleinen Sitzbankohne Lehne ausgestattet ist, mit einemmassiven Gitter abgeschlossen.In <strong>den</strong> ersten <strong>bei</strong><strong>den</strong> Monaten der Unterbringungkonnte der Minderjährige täglichmit zwei <strong>Betreuung</strong>spersonen für jeweilseine halbe bis eine St<strong>und</strong>e ins Freie;von Problemen <strong>bei</strong> diesen Ausgängen istnichts bekannt.Als er dann etwa eine Woche lang keineAusgänge machen konnte, erklärte daszuständige Bezirksgericht auf Antrag derPatientenanwaltschaft diese Beschränkungfür unzulässig.Der Abteilungsleiter erhob dagegen Rekurs;es stimme zwar, dass in diesem Zeitraumkeine Ausgänge durchgeführt wor<strong>den</strong>seien, aber man habe <strong>den</strong> untergebrachtenMinderjährigen nicht allen Mitar<strong>bei</strong>ternübergeben können. Außerdem habeer ja die Terrasse nützen können, die seitJahren als zulässiger Ausgang gewertetwor<strong>den</strong> <strong>und</strong> „im Sinne des Gewohnheitsrechtsakzeptierte Praxis“ sei.Das Landesgericht Salzburg gab diesemRekurs verständlicherweise keine Folge.Bei der Auslegung des Begriffs „insFreie“ wird auch der § 43 StrafvollzugsG<strong>und</strong> die diesbezügliche Literatur herangezogen,wonach der Aufenthalt im Freiender Aufrechterhaltung der psychischen<strong>und</strong> physischen Ges<strong>und</strong>heit dient. Durchihre Ausgestaltung erfüllt demnach die„Terrasse“, auf der keine sinnvolle Freizeitgestaltungwie zB Tischtennis, Fußball,Fangenspielen möglich ist, nicht die Voraussetzungen,einen Ausgang ins Freiedarzustellen. Da außergewöhnliche Umstände(siehe dazu gleich unten), <strong>den</strong>enzufolge die bisherigen Spaziergänge nichtmöglich gewesen seien, weder behauptetnoch dokumentiert wur<strong>den</strong>, war die Beschränkungunzulässig.Schlussfolgerungen für die PraxisWenn der Ausgang ins Freie innerhalb einesumgrenzten Bereichs gewährt wird(wogegen gr<strong>und</strong>sätzlich nichts spricht!),müssen dort Mindesterfordernisse imHinblick auf Fläche, Ausstattung, Bewegungsmöglichkeitenetc erfüllt sein. DerAusgang „ins Freie“ ist eben kein Ausgang„in die Freiheit“. Wenn es sich (wie <strong>bei</strong>der gegenständlichen Kinder- <strong>und</strong> Jugendpsychiatrie)um einen Altbau handelt, woeine Umgestaltung praktisch nicht möglichist, gilt die Benützung dieses Bereichesnicht als Ausgang ins Freie.Bei Neubauten im Bereichder Psychiatrie sollten diesebaulichen Erfordernisseje<strong>den</strong>falls mit berücksichtigtwer<strong>den</strong>.Gerechtfertigte Abnahmeder Privatkleidung?(LG Wiener Neustadt, 16 R 263/11 g)Hier wurde ein (volljähriger) Patient <strong>bei</strong>Verdacht auf eine schizophrene Erkrankungmit manischer Komponente ohnesein Verlangen im LKH Neunkirchen untergebracht.Einige Tage nach der Erstanhörungversuchte er, das Krankenhausarealzu verlassen, wo<strong>bei</strong> er vom Portier auf dieAbteilung zurückgebracht wurde; dagegenwehrte er sich nicht. Daraufhin wurde ihmauf ärztliche Anordnung die Privatkleidungabgenommen <strong>und</strong> der Ausgang insFreie beschränkt. Weitere Fluchtversuchesind nicht dokumentiert. Der Patient verhieltsich auch im weiteren Aufenthalt angepasst<strong>und</strong> bestrebt, mit dem Personalnicht in Konflikt zu geraten. Er gab mehrfach,auch dem Richter gegenüber, an, dieAbnahme seiner Privatkleidung nicht alsBelastung zu empfin<strong>den</strong>. <strong>Die</strong>se Beschränkungenblieben für mehr als zwei Wochenaufrecht.Das Erstgericht erklärte die Beschränkungdes Ausgangs ins Freie für unzulässig,die Abnahme der Privatkleidung hingegenfür zulässig, da das im Vergleich zueiner Fixierung das wesentlich gelindereMittel sei. Gerade <strong>bei</strong> nicht gewalttätigenPatienten werde dadurch die Verhinderungeines Fluchtversuchs <strong>und</strong> die allfälligeWiedereinbringung erleichtert. Durchzahlreiche Einträge im Dekurs sei nachgewiesen,dass der Patient im gegenständlichenZeitraum nicht krankheitseinsichtiggewesen sei <strong>und</strong> weiterhin Stimmen gehörthabe, weshalb die Selbst- <strong>und</strong> auchFremdgefährdung (paranoid besetzte Familienangehörige)weiterhin ernstlich <strong>und</strong>erheblich sei.Dagegen erhob der durch <strong>den</strong> Patientenanwaltvertretene Untergebrachte Rekurs.Auch in diesem Fall wurde nicht dieUnterbringung an sich angefochten, sonderndie Beschränkungen des Ausgangsins Freie <strong>und</strong> des Tragens der Privatkleidung.Das Rekursgericht gab dem Rechtsmittelstatt <strong>und</strong> erklärte auch die Beschränkungdes Tragens von Privatkleidungfür unzulässig. <strong>Die</strong> notwendigenVoraussetzungen des § 34 a, dass dieMaßnahme nämlich unerlässlich <strong>und</strong> verhältnismäßigist, seien nicht gegeben gewesen.Vielmehr sei es eine disziplinäreMaßnahme gewesen, es sollte abgewartetwer<strong>den</strong>, ob sich der Patient an die Vereinbarungüber die An- <strong>und</strong> Abmeldung halte.Durch die Beschränkung des Ausgangesins Freie habe er keine Möglichkeit gehabt,dieser Bedingung nachzukommen.<strong>Die</strong> Beschränkung wegen der vagen Möglichkeiteiner Fluchtgefahr sei nicht verhältnismäßig,da es seit dem ersten Versuchkeine weiteren Fluchthandlungenmehr gegeben habe.Auf die Frage, ob es vielleicht geradedeshalb zu keinen weiteren Fluchthandlungengekommen ist, weil dem Patienten bewusstwar, dass er in Anstaltsbekleidungschon <strong>bei</strong>m Passieren des Portiers (<strong>und</strong>spätestens auf der Straße) je<strong>den</strong>falls auffallenwürde, ging das Rechtsmittelgerichtnicht ein.186 ÖZPR 6 | 2011
HeimAufG & UbGSchlussfolgerungen für die Praxis<strong>Die</strong> Abnahme der Privatkleidungwird als massiverGr<strong>und</strong>rechtseingriff gewertet<strong>und</strong> muss daher imEinzelfall genau begründetwerde.Wie schon die Lehre (Kopetzki, RdM 2011/60), legt offenbar auch die Rechtsprechungdie Voraussetzungen des § 34 a sehr strengaus. Jede derartige Beschränkung muss„unerlässlich“ <strong>und</strong> „zu ihrem Zwecknicht außer Verhältnis“ sein. Das mussdaher regelmäßig (am besten täglich)überprüft <strong>und</strong> auch dokumentiert wer<strong>den</strong>.Das gilt auch <strong>bei</strong> der Abnahme derPrivatkleidung, die ganz offensichtlich fürviele <strong>Pflege</strong>personen <strong>und</strong> Ärzte selbstverständlichist. Das ist nachvollziehbar, da jaauch auf <strong>den</strong> sonstigen Abteilungen einesKrankenhauses die Patienten keine Privatkleidertragen, hier allerdings freiwillig bzwdurch die jeweilige Anstalts- oder Abteilungsordnung,der sie sich freiwillig unterwerfen,verpflichtet. Doch gerade <strong>bei</strong> dieserFrage gibt es in der Praxis offensichtlichauch große Unterschiede zwischen <strong>den</strong>psychiatrischen Abteilungen, die wohl auchlokal historische Hintergründe haben. Anmanchen Abteilungen wird scheinbar automatisch<strong>bei</strong> jeder zwangsweisen Unterbringungdie Privatkleidung abgenommen, ananderen wiederum praktisch nie (siehe dazuauch <strong>den</strong> Kurzbericht über das Vernetzungstreffen„Ub in NÖ“ in diesem Heft,ÖZPR 2011, 181).Wieder einmal zeigt sich, welche Bedeutunggerade im Rahmen des Unterbringungsverfahrensdie baulichen Gegebenheitenhaben. Im konkreten Fall ist die offengeführte psychiatrische Abteilung (ein geschlossenerBereich existiert nicht) in einemPavillon innerhalb eines umzäunten,aber frei betretbaren Krankenhausarealsuntergebracht. In unmittelbarer Nähe befindetsich eine stark befahrene B<strong>und</strong>esstraße.Gr<strong>und</strong>sätzliche Überlegungen<strong>Die</strong>se <strong>bei</strong><strong>den</strong> Entscheidungen zeigen dasSpannungsfeld, in dem sich die Rechtsprechung<strong>bei</strong> der Auslegung gerade auch desneuen § 34 a UbG befindet.Einerseits ist es unbestritten die Aufgabeder Gerichte (<strong>und</strong> der Patientenanwaltschaft),alle Eingriffe in die persönlicheFreiheit <strong>bei</strong> unfreiwilligen Aufenthalten inpsychiatrischen Abteilungen <strong>und</strong> Anstaltengenau zu kontrollieren <strong>und</strong> allfälligeMissstände abzustellen.Andererseits kann wohl davon ausgegangenwer<strong>den</strong>, dass die meisten Beschränkungendeshalb verfügt wur<strong>den</strong>, weil dasansonsten notwendige (<strong>Pflege</strong>-)Personalschlichtweg nicht zur Verfügung steht.Um es deutlich auszudrücken: Mit einer1 : 1-<strong>Betreuung</strong> r<strong>und</strong> um die Uhr („Sitzwache“)<strong>und</strong> einer Begleitung von kräftigenUntergebrachten durch vier ebenso kräftige<strong>Pflege</strong>personen <strong>bei</strong>m Ausgang ins Freie ließensich wohl fast alle Beschränkungenvermei<strong>den</strong> – nur ist das leider fast überalleine reine Wunschvorstellung.Natürlich entspricht es der herrschen<strong>den</strong>Rechtsprechung, dass allfällige Mängelin der personellen Besetzung nicht zur Beschneidungder Rechte von untergebrachtenPatienten führen dürfen. Doch einBlick in die allseits leeren Kassen lässt befürchten,dass sich dieser Umstand nichtso bald ändern wird.Auch hier spielt weiters die Ausgestaltungder Unterbringung (offene oder geschlossenePsychiatrie) 1 eine nicht unwesentlicheRolle. <strong>Die</strong> Belastung des (<strong>Pflege</strong>-)Personals einer offen geführten Station,das Entweichen der Patienten zu verhindern,sollte nicht unterschätzt wer<strong>den</strong>. O<strong>bei</strong>ne derart strenge Sichtweise <strong>bei</strong> wenigereinschnei<strong>den</strong><strong>den</strong> Maßnahmen zur Verringerungder Fluchtgefahr wie der Abnahmeder Privatkleidung im Endeffekt zielführendist, sollte differenziert betrachtet wer<strong>den</strong>.Zum ThemaWeder die Dokumentationspflichtnoch dieformellen Voraussetzungen<strong>bei</strong>m Vorbringen solltenüberspannt wer<strong>den</strong>.Ohne die Bedeutung einer kompetentenDokumentation gerade auch im Unterbringungsbereichzu übersehen, ist wohldoch auch eine gewisse Vorsicht angebracht,die Dokumentationspflicht desärztlichen <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>personals nicht zuüberspannen. Schließlich wird die Zeit, diefür die Dokumentation verwendet wird,nicht <strong>bei</strong> der Behandlung der Patientenverbracht.Vorsichtig sein sollten meiner Meinungnach alle im Ub-Verfahren beteiligten Juristenschließlich mit <strong>den</strong> formellen Anforderungenan die Stellungnahmen des medizinischenPersonals. Im zweiten Fall führtetwa das Rekursgericht in der Begründungaus, dass sich „die Stellvertreterin des Abteilungsleitersim erstinstanzlichen Verfahrenzur Rechtfertigung der Beschränkunggar nicht auf die vom Erstgericht herangezogeneSelbst- <strong>und</strong> Fremdgefährdungstützt“. <strong>Die</strong>se Argumentation ist im klassischenAnwaltsprozess gang <strong>und</strong> gäbe (<strong>und</strong>dort auch gerechtfertigt), sie setzt aber einformaljuristisches Denken voraus, das Psychiaternüblicherweise nicht zu eigen ist.Zum Glück – welcher psychisch Krankewill sich schon von Anwälten behandelnlassen?ÖZPR 2011/1371 Jelem/Stuppäck, Unterbringung: offen versus geschlossen,ÖZPR 2011/46, 52.In KürzeWie zu erwarten konzentrieren sich die Anträge auf Überprüfung der sonstigen Rechtewährend der Unterbringung vor allem auf <strong>den</strong> Ausgang ins Freie, daneben auch auf die Abnahmeder Privatkleidung. Gut ein Jahr nach Einführung des § 34 a mit der Novelle 2010fallen nun die ersten Gerichtsentscheidungen dazu an.Über <strong>den</strong> AutorMag. Stefan Koppensteiner ist als Richter des Bezirksgerichts Neunkirchen unter anderemauch für Unterbringungssachen zuständig. Zusammen mit HR Dr. Hans Peter Zierl ist er alsRedakteur der ÖZPR für die Rubrik III zuständig.ÖZPR 6 | 2011 187
Hon.-Prof. HR Dr. MatthiasNeumayrHofrat des Obersten GerichtshofsUniv.-Prof. Dr. Walter J. PfeilUniversität SalzburgHaftung, Kosten &QualitätINTRO. In dieser Rubrik informieren Sie sich über die Haftung <strong>bei</strong> <strong>Pflege</strong>fehlern, die Kostentragungnach <strong>den</strong> Sozialhilfegesetzen der Länder <strong>und</strong> <strong>den</strong> praktischen Umgang mit Fragen r<strong>und</strong>um Heimverträge.Am Ende des Jahres . . .Mit dem vorliegen<strong>den</strong> Heft geht das erste komplette Jahr für die ÖZPR zu Ende. Wirdürfen uns mit dem gesamten Redaktionsteam über einen äußerst erfolgreichen Start unsererZeitschrift <strong>und</strong> darüber freuen, dass wir im zweiten Jahr unsere Position sogar nochausbauen konnten. Das hat wohl ua damit zu tun, dass wir uns auch in dieser Rubrikimmer um eine Mischung aus aktueller Information <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>sätzlichen Beiträgen bemühthaben. Das ist uns hoffentlich auch <strong>bei</strong> dieser Nummer gelungen: Neben einer Entscheidungzum Sozialhilferecht fin<strong>den</strong> Sie einen umfassen<strong>den</strong> Beitrag zur <strong>Koordination</strong>für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong> <strong>bei</strong> <strong>den</strong> <strong>regionalen</strong> Trägern sozialer Hilfe.Während die Bilanz für unsere Zeitschrift recht positiv ausfällt, müssen wir leiderfeststellen, dass sich die Rahmenbedingungen für <strong>Pflege</strong> <strong>und</strong> <strong>Betreuung</strong> im bald zu Endegehen<strong>den</strong> Jahr nicht verbessert haben. <strong>Die</strong> bereits im Vorjahr beschlossenen Verschärfungen<strong>bei</strong>m Anspruch auf <strong>Pflege</strong>geld haben – Medienberichten zufolge – Verschlechterungenfür r<strong>und</strong> 18.000 pflege- <strong>und</strong> betreuungsbedürftige Menschen gebracht, weil sie keinoder nur mehr ein <strong>Pflege</strong>geld erhalten, das unter dem liegt, was sie nach der früherenRechtslage erwarten hätten dürfen. Wir haben stets betont, dass in Zeiten knapper Budgets<strong>und</strong> zu befürchtender Verschlechterung der allgemeinen Finanz- <strong>und</strong> Wirtschaftslageauch Leistungen für pflege- <strong>und</strong> betreuungsbedürftige Menschen nicht völlig außerStreit gestellt wer<strong>den</strong> können.Wenn es hier aber zu Kürzungen kommen sollte, dann müssen diese mit vernünftigen<strong>und</strong> nachhaltigen Strukturreformen verknüpft sein, die auch Verbesserungen derSach- <strong>und</strong> <strong>Die</strong>nstleistungsversorgung in qualitativer wie quantitativer Hinsicht bewirken.<strong>Die</strong> im vorletzten Heft vorgestellten Neuregelungen durch das <strong>Pflege</strong>geldreform- bzw das<strong>Pflege</strong>fondsgesetz könnten ein Einstieg in eine solche Entwicklung sein.Beide Gesetze treten mit Beginn des Jahres 2012 in Kraft. Wir wer<strong>den</strong> ihre Auswirkungengenau beobachten <strong>und</strong> Sie darüber auf dem Laufen<strong>den</strong> halten. Ganz unabhängigdavon dürfen wir uns für Ihr bisheriges Interesse <strong>und</strong> die fre<strong>und</strong>lichen Reaktionen bedanken<strong>und</strong> Ihnen persönlich ein paar besinnliche <strong>und</strong> friedvolle Tage zum Jahresende<strong>und</strong> viel Glück, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Erfolg für 2012 wünschen.Matthias Neumayr <strong>und</strong> Walter J. PfeilÖZPR 2011/140AKTUELLESJournalistInnenpreis des HilfswerksAm 24. 11. fand in Wien die Preisverleihungim Rahmen der Hilfswerk-Weihnachtsgalafür Kinder in Not statt: <strong>Die</strong>Beiträge der SiegerInnen lauten: StefanApfl: „<strong>Die</strong> Kinder vom Ar<strong>bei</strong>tsamt“, IsabelleEngels: „Kranke Eltern – Wenn Kinder zu<strong>Pflege</strong>rn wer<strong>den</strong>“, Julia Kovarik <strong>und</strong> EdMoschitz: „<strong>Die</strong> Angstmacher“.Nähere Informationen: www.hilfswerk.atTermineHeimaufenthaltsgesetz aktuellARS SeminarzentrumAkademie für Recht & Steuern,Schallautzerstraße 2 – 4, 1010 Wien28. Februar 2012, von 9.30 bis 17.30 UhrVortragender: Univ.-Prof. DDr. ChristianKopetzkiAnmeldung <strong>und</strong> Informationen:www.ars.at<strong>Pflege</strong>dienstleitung – Rechts- <strong>und</strong>Haftungsfragen für LeiterInnenstationärer <strong>und</strong> mobiler <strong>Pflege</strong>diensteARS SeminarzentrumAkademie für Recht & Steuern,Schallautzerstraße 2 – 4, 1010 Wien17. Jänner 2012, von 9.00 bis 17.00 UhrVortragender: Univ.-Prof. Dr. WolfgangMazalAnmeldung <strong>und</strong> Informationen:www.ars.atÖZPR 6 | 2011 189
Haftung, Kosten & QualitätProf. in (FH) Dr. in Brigitta Nöbauer / Dr. in Anita Buchegger-Traxler, MPH / o. Prof. Dr. Herbert AltrichterFachhochschule OÖ / Johannes Kepler Universität Linz / Johannes Kepler Universität Linz<strong>Die</strong> <strong>Koordination</strong> für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong><strong>bei</strong> <strong>den</strong> <strong>regionalen</strong> Trägern sozialer Hilfe:Rollen, Aufgaben <strong>und</strong> EinflusschancenRegionale Steuerung von Altenbetreuung <strong>und</strong> -pflege. Planung <strong>und</strong> Steuerung von Leistungenin der Altenbetreuung <strong>und</strong> -pflege vollziehen sich auf mehreren Ebenen, <strong>und</strong> zahlreiche Akteuresind mit unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten involviert (zB Land OÖ, Regionale Träger SozialerHilfe, Anbieterorganisationen). In <strong>den</strong> letzten Jahren wur<strong>den</strong> einige neue <strong>Koordination</strong>sinstrumenteeingeführt wie Leistungsverträge, das Normkostenmodell in <strong>den</strong> Mobilen <strong>Die</strong>nsten sowiedie Funktion der <strong>Koordination</strong> für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>. <strong>Die</strong>se sollte insbesondere Planungs- <strong>und</strong><strong>Koordination</strong>sleistungen <strong>bei</strong> <strong>den</strong> Regionalen Trägern Sozialer Hilfe erbringen bzw unterstützen.Der Beitrag geht der Frage nach, in welchen Bereichen diese Funktion tatsächlich koordinierendeinwirken kann <strong>und</strong> was sie da<strong>bei</strong> unterstützt.Im Jahr 2009 wurde in Oberösterreich dieFunktion der „<strong>Koordination</strong> für <strong>Betreuung</strong><strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>“ pilotiert <strong>und</strong> in weitererFolge in allen Bezirken <strong>bei</strong> <strong>den</strong> RegionalenTrägern Sozialer Hilfe (RTSH; Sozialhilfeverbände<strong>und</strong> Magistrate in Städten miteigenem Statut) eingesetzt. Im Rahmendes INTERREG-Projekts „Zukunft PFLE-GEN – Grenzüberschreitendes Age-Managementin der <strong>Pflege</strong>. Bayern – Österreich2007 – 2013“ wurde diese innovativeregionale Kooperationsform in einem Forschungsprojektan der Johannes KeplerUniversität Linz mit Hilfe der Kategoriender Governance-Forschung näher analysiert.1Governance: Steuerung in derAltenbetreuung <strong>und</strong> -pflegeMit dem Begriff Governance wer<strong>den</strong> sozialeProzesse des Steuerns, Regierens,Verwaltens <strong>und</strong> Planens verstan<strong>den</strong>. 2 Governance-Forschunguntersucht das Zustandekommensozialer Ordnung <strong>und</strong> sozialerLeistungen unter der Perspektiveder Handlungskoordination zwischen verschie<strong>den</strong>enAkteuren in komplexen Systemen,3 im vorliegen<strong>den</strong> Fall der Altenar<strong>bei</strong>t.Sie geht also der Frage nach, wer in derAltenar<strong>bei</strong>t mit welchen Mitteln (mit-)steuert. Bei genauerem Hinsehen wirddeutlich, dass nicht nur das Land OÖoder die RTSH verschie<strong>den</strong>ste Steuerungsinstrumente(zB Gesetze, Verordnungen,Entscheidungen, Leistungsverträge) einsetzen.Vielmehr sind auch andere Akteure(zB Anbieter Mobiler <strong>Die</strong>nste, Sozialberatungsstellen,Überleitungspflege) steuerndtätig, auch wenn sie selbst es nicht sowahrnehmen. <strong>Die</strong> <strong>Koordination</strong> für <strong>Betreuung</strong><strong>und</strong> <strong>Pflege</strong> wurde in der Absichteingesetzt, Veränderungen in der (<strong>regionalen</strong>)Steuerung der Altenbetreuung zu bewirken.Aus einer Governance-Perspektivekönnen daher Potenziale <strong>und</strong> tatsächlicheVeränderungen durch die <strong>Koordination</strong>für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong> in der <strong>regionalen</strong>Steuerung von Altenbetreuung nachgezeichnetwer<strong>den</strong>. Im Mittelpunkt steht alsodie Frage, welchen Beitrag die <strong>Koordination</strong>für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong> im bestehen<strong>den</strong>System leisten kann <strong>und</strong> welcheRahmenbedingungen dafür notwendigsind.Steuerung der Altenbetreuungdurch die RTSHIm Sozialhilfegesetz von 1998 wur<strong>den</strong> dieRTSH explizit für die Sicherstellung derSozialhilfe zuständig erklärt. Verschie<strong>den</strong>eRichtlinien des Landes OÖ 4 verpflichtendie RTSH zu einer <strong>regionalen</strong> Sozialplanung.Im Bereich der Altenbetreuung <strong>und</strong>-pflege sollten die RTSH darüber hinausein Controlling-System zur unterjährigenSteuerung der Leistungen einführen <strong>und</strong>die Wirtschaftlichkeit der Anbieter-Organisationen(va in <strong>den</strong> Mobilen <strong>Die</strong>nsten) beobachten.In <strong>den</strong> letzten Jahren wur<strong>den</strong> zusätzlichdas Normkostenmodell, die Leistungsverträgemit <strong>den</strong> Anbietern Mobiler<strong>Die</strong>nste, ein Berichtswesen an das LandOÖ sowie die Funktion der <strong>Koordination</strong>für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong> eingeführt. Alldiese Maßnahmen zielen auf eine bedarfsgerechte,koordinierte <strong>und</strong> wirtschaftlicheLeistungserbringung im Bereich der Altenbetreuung<strong>und</strong> -pflege. Neben einem erkennbarenVereinheitlichungsstreben (etwadurch Normkosten) soll auch die regionaleVersorgungssituation strategisch weiterentwickelt<strong>und</strong> die Vernetzung zwischen Ges<strong>und</strong>heits-<strong>und</strong> Sozialbereich vorangetriebenwer<strong>den</strong>.Es besteht ein umfassendesAufgabenspektrum der<strong>Koordination</strong>sfunktion.<strong>Die</strong> <strong>Koordination</strong> für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong><strong>Pflege</strong> soll diese Aktivitäten <strong>bei</strong> <strong>den</strong> RTSHunterstützen, indem sie vor allem drei Aufgabenbereichewahrnimmt: 5n Case Management im Einzelfall: AufBasis individueller Bedarfsanalysenwer<strong>den</strong> Ziele <strong>und</strong> ein individueller Versorgungsplanfestgelegt <strong>und</strong> die durchgeführtenMaßnahmen später überprüft<strong>und</strong> evaluiert. Eine weitere Aufga<strong>bei</strong>st die Mitwirkung an der Bedarfsobjektivierung.Unter anderem prüftsie <strong>bei</strong> Heimanträgen, ob nicht andere(mobile) Unterstützungsleistungen <strong>den</strong>Unterstützungsbedarf decken könnten.Bei der Analyse des Einzelfalls ist sie<strong>bei</strong>spielsweise in Kontakt mit <strong>den</strong> Trägernvon Alten- <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>heimen (sofernsie nicht von <strong>den</strong> RTSH selbst betriebenwer<strong>den</strong>), der Überleitungspflege1 Altrichter/Buchegger-Traxler/Nöbauer, Endbericht zum WP 8:Regional Governance des INTERREG-Projekts „Zukunft <strong>Pflege</strong>n– Grenzüberschreitendes Age-Management in der <strong>Pflege</strong>.Bayern – Österreich 2007 – 2012“. Unveröffentlichter Forschungsbericht(2010). 2 Mayntz, Über Governance: Institutionen<strong>und</strong> Prozesse politischer Regelung (2009). 3 Altrichter/Maag-Merki (Hrsg), Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem(2010). 4 Amt der Oö Landesregierung, Sozialabteilung, Richtlinienzur Förderung professioneller sozialer <strong>Die</strong>nste in Oberösterreich.Hauskrankenpflege – Mobile <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> Hilfe(2006); dies, Richtlinien Regionale Sozialplanung gemäß OöSHG 1998 (2007). 5 Amt der Oö Landesregierung, Handbuch fürdie <strong>Koordination</strong> für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong> (KBP) (2009).190 ÖZPR 6 | 2011
Haftung, Kosten & Qualitätder Krankenhäuser sowie <strong>den</strong> Mobilen<strong>Die</strong>nsten, die im Regelfall <strong>den</strong> <strong>Betreuung</strong>sbedarffeststellen.n Koordinieren <strong>und</strong> Vernetzen: <strong>Die</strong> <strong>Koordination</strong>entscheidet einerseits auffachlicher Ebene <strong>bei</strong> multiplen Problemlagen.<strong>Die</strong> Abstimmung geht unterUmstän<strong>den</strong> über <strong>den</strong> Einzelfall hinaus,wenn Zuständigkeiten, Prozesse <strong>und</strong>Aufgaben zu klären bzw neu zu definierensind. Da<strong>bei</strong> geht es um die Abstimmungder angebotenen Versorgungsleistungen,um Kooperation mit<strong>den</strong> Sozialberatungsstellen <strong>und</strong> anderen<strong>Die</strong>nstleistern im Sozialbereich, umVernetzung zwischen Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsbereichsowie um Informationsflüssezu <strong>den</strong> relevanten Stellendes Landes.n Mitwirken an der Sozialplanung: <strong>Die</strong><strong>Koordination</strong> wirkt auch <strong>bei</strong> der Entwicklungdes Leistungsangebots <strong>und</strong>der unterjährigen Steuerung mit, siesteuert die Leistungsangebote der Anbieterorganisationen,erar<strong>bei</strong>tet fachlicheStandards <strong>und</strong> Kennzahlen, führtstrukturelle Bestandsanalysen durch<strong>und</strong> informiert <strong>den</strong> RTSH über Versorgungsengpässe.<strong>Die</strong>ses Tätigkeitssegmentfokussiert die regionale Versorgungssituationin <strong>den</strong> Bezirken.Seit dem 1. Quartal 2011 ist die Funktion<strong>bei</strong> allen RTSH mit mindestens einerStelle (meist zwei Halbtagskräfte) eingerichtet<strong>und</strong> hat die Ar<strong>bei</strong>t aufgenommen.<strong>Die</strong> Sozialabteilung des Landes OÖ stelltes <strong>den</strong> RTSH frei, ob Diplomierte Ges<strong>und</strong>heits-<strong>und</strong> Krankenpflegepersonen(DGKP) oder Sozialar<strong>bei</strong>ter in dieserFunktion eingesetzt wer<strong>den</strong>. In der Umsetzungwur<strong>den</strong> fast alle Stellen mitDGKP besetzt.Auswirkungen der neuen Funktionauf die <strong>Koordination</strong> <strong>und</strong> Steuerungvon Leistungen in der Altenbetreuung<strong>und</strong> -pflegeAufgr<strong>und</strong> der geringen Erfahrungen mitder neuen Funktion können an dieser Stellenoch keine systematisch erhobenen Wirkungenberichtet wer<strong>den</strong>. Im Rahmen deseingangs genannten INTERREG-Projektswurde in zwei oberösterreichischen Bezirkenherausgear<strong>bei</strong>tet, welche Erwartungen,erste Erfahrungen sowie Chancen <strong>und</strong> Risikenhinsichtlich der neuen Funktion in<strong>den</strong> Bezirken aus Sicht relevanter Akteurebestehen. 6Eine Herausforderung liegtin der <strong>Koordination</strong> <strong>und</strong>Unterstützung der Sozialplanung.Erste Erfahrungen zeigen, dass dieKoordinatoren in erster Linie auf der Ebenedes Einzelfalls tätig wur<strong>den</strong>, <strong>und</strong> zwar<strong>bei</strong> der Objektivierung von Heimaufnahmen<strong>und</strong> im Rahmen der Feststellung desHilfebedarfs in <strong>den</strong> Mobilen <strong>Die</strong>nsten. Daskönnte auf die Qualifikation der Koordinatorenoder auf akute Handlungsbedarfe <strong>bei</strong><strong>den</strong> RTSH zurückzuführen sein. Möglicherweisewurde der Nutzen ihrer Fachexpertisefür die RTSH in diesem Bereich amklarsten ersichtlich. <strong>Die</strong> Heimaufnahmenstellen keine wesentlichen Eingriffe in bestehendeEntscheidungskompetenzen bzw-verfahren dar, da diese zu einem großenTeil <strong>bei</strong> <strong>den</strong> RTSH selbst liegen. Hier wurdedie <strong>Koordination</strong> als fachliche Bereicherungwahrgenommen. <strong>Die</strong> Bedarfsfeststellung<strong>bei</strong> <strong>den</strong> Mobilen <strong>Die</strong>nsten bleibt (bisauf Ausnahmen) unverändert <strong>bei</strong> <strong>den</strong> Anbieternselbst, es wurde aber eine Informations-bzw in gewissen Fällen eine „Kontrollschleife“eingeführt.Auf <strong>den</strong> Ebenen der <strong>Koordination</strong>bzw Sozialplanung wurde bisher stark die„Sammlung von Informationen“ betrieben,die die Möglichkeiten für <strong>Koordination</strong> aufEbene des Landes bzw der RTSH verbessernsoll. Neue Berichts- <strong>und</strong> Beobachtungssystemeder Sozialabteilung stärkeneinerseits die <strong>Koordination</strong> in ihrer Position,gleichzeitig wird die Informationslageüber das zu koordinierende System verbessert.Wie weit diese auf regionaler Ebeneaufgegriffen <strong>und</strong> planerisch genutzt wer<strong>den</strong>,wird von <strong>den</strong> RTSH abhängig sein.<strong>Die</strong> <strong>Koordination</strong> wird in der Sozialplanungvorwiegend unterstützend tätig sein,vorangetrieben muss sie allerdings von <strong>den</strong>Verantwortlichen der RTSH wer<strong>den</strong>. Eswird aber je<strong>den</strong>falls die „Beobachtungs“-Positiondes Landes im Bezirk durch die <strong>Koordination</strong>für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong> potentiellgestärkt.<strong>Koordination</strong>, Vernetzung<strong>und</strong> Sozialplanung erfordernRückhalt von RTSH<strong>und</strong> Sozialabteilung.<strong>Die</strong> größten Herausforderungen wer<strong>den</strong>sich für die <strong>Koordination</strong> in <strong>den</strong> letzten<strong>bei</strong><strong>den</strong> Rollensegmenten (Koordinieren/Vernetzen<strong>und</strong> Mitwirken an der Sozialplanung)ergeben. Hinderlich ist, dasses sich um eine Position mit relativ geringenKompetenzen <strong>und</strong> Ressourcen handelt,die sowohl für die RTSH als auch für dieSozialabteilung tätig ist. Von <strong>bei</strong><strong>den</strong> Akteurenbenötigt sie Rückhalt. Aus <strong>den</strong> Ergebnissender Studie lassen sich einige Faktorenherauslesen, die der Etablierung dieserneuen Rolle behilflich sein könnten.<strong>Die</strong>se sind:n gefestigte, <strong>den</strong> drei Tätigkeitssegmentenentsprechende professionelle Werte,Kompetenzen <strong>und</strong> Beziehungen;n spezielle Schulung für die Position;besondere Unterstützung zur konzeptentsprechen<strong>den</strong>Implementierung derFunktion in der ersten Phase der Berufstätigkeit;n regelmäßiger überregionaler Austauschzwischen <strong>den</strong> Koordinatoren;n Unterstützung durch einflussreicheAkteure; Beauftragung der neuen Positionmit der Wahrnehmung einflussverleihenderInstrumente, Prozeduren<strong>und</strong> Aufgaben (zB Erhebungsmaßnahmen,Umsetzung neuer Regelungen).Ziel der Einführung der <strong>Koordination</strong> warauch die Veränderung (Stärkung) der <strong>regionalen</strong>Steuerung sozialer Hilfeleistungen.<strong>Die</strong> Analysen der Fallstudien <strong>und</strong>Dokumente lassen erkennen: <strong>Die</strong> Einführungder <strong>Koordination</strong> für <strong>Betreuung</strong> <strong>und</strong><strong>Pflege</strong> könnte im Zuge der Verbesserungder Berichts- <strong>und</strong> Beobachtungssystemedie Informationslage der RTSH weiterstärken <strong>und</strong> durch persönliche Beziehungensowie durch lokale <strong>und</strong> professionelleKenntnisse anreichern <strong>und</strong> dadurch inhaltsreichermachen. Wahrscheinlich erschienuns – aufgr<strong>und</strong> der bisherigen Betonungder einzelfallbezogenen Ar<strong>bei</strong>t –die Betonung dieses „sozialplanerischen“Rollensegments allerdings nur dort, wodies auch von <strong>den</strong> RTSH energisch betriebenwird.<strong>Die</strong> <strong>Koordination</strong> trifft nämlich auf einFeld etablierter Beziehungen <strong>und</strong> zwar aufeinen Mix von hierarchisch-verwaltungsorientiertenBeziehungen, <strong>und</strong> lokalen, oftpersönlich gefärbten Verhandlungsbeziehungen.Ihre Funktion ist schwach institutionalisiert,was hierarchische Stellung <strong>und</strong>Ressourcen anlangt. <strong>Die</strong>s macht eine eigenständigeEtablierung im bestehen<strong>den</strong> Sys-6 Für Vorgangsweise <strong>und</strong> weitere Ergebnisse vgl Altrichter/Buchegger-Traxler/Nöbauer, Endbericht (2010).ÖZPR 6 | 2011 191
Haftung, Kosten & QualitätZum Thematem nicht einfach. Am wahrscheinlichstenist eine Ausformung der Rolle in Richtungder mitgebrachten professionellen Kenntnisse(was aufgr<strong>und</strong> der bevorzugten Anstellungserfordernissewohl meist in Richtungeiner Betonung der Einzelfallar<strong>bei</strong>tgehen wird) oder in Richtung einer regionalverträglichen <strong>Koordination</strong>s- <strong>und</strong>Vernetzungstätigkeit (die von <strong>den</strong> <strong>regionalen</strong>Stakeholdern präferiert wird).ÖZPR 2011/141Über die AutorInnenProf. in (FH) Dr. in Brigitta Nöbauer ist an der Fachhochschule OÖ, Fakultät für Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales, tätig. Kontakt: FH OÖ, Departmentfür Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales, Garnisonstraße 21, 4020 Linz. Tel: +43 (0)732 2008-2460, E-Mail: brigitta.noebauer@fh-linz.atDr. in Anita Buchegger-Traxler, MPH, <strong>und</strong> o. Prof. Dr. Herbert Altrichter sind Mitar<strong>bei</strong>terin <strong>und</strong> Professor an der Johannes Kepler UniversitätLinz, Abteilung für Pädagogik <strong>und</strong> Pädagogische Psychologie. Kontakt: Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstrasse 69, 4040 Linz.Tel: +43-70-2468-3206 <strong>und</strong> +43 (0)732 24 68-8221, E-Mail: anita.buchegger-traxler@jku.at <strong>und</strong> herbert.altrichter@jku.atLiteraturtippsLöcherbach/Klug/Remmel-Faßbender/Wendt (Hrsg), Case Management. Fall- <strong>und</strong> Systemsteuerung in der Sozialen Ar<strong>bei</strong>t 2 (2003); Mayntz, ÜberGovernance: Institutionen <strong>und</strong> Prozesse politischer Regelung (2009).Hon.-Prof. Dr. Matthias NeumayrHofrat des Obersten GerichtshofsRechtsprechungAnspruch auf Spitalskostenrückersatz im Rahmen der Sozialhilfe. Hat der Hilfesuchendeeinen Anspruch auf die erforderliche Leistung gegen die Gebietskrankenkasse, ist für <strong>den</strong>Anspruch auf Sozialhilfe entschei<strong>den</strong>d, ob er die erforderliche Leistung aufgr<strong>und</strong> diesesAnspruchs so rechtzeitig erhalten kann, dass er in seinem Bedarf nicht gefährdet wird.Der Betroffene befand sich vier Monatestationär in einer Landesnervenklinik.Nachdem die Gebietskrankenkasse eineKostenübernahme abgelehnt hatte, weil dieAnstaltspflege nicht mehr durch die Notwendigkeiteiner ärztlichen Behandlung bedingtwar („Asylierungsfall“ gem § 144Abs 3 ASVG), beantragte die Krankenanstaltengesellschaftdie Übernahme der Spitalskostendurch <strong>den</strong> Sozialhilfeträger.<strong>Die</strong> Berufungsbehörde ging davon aus,dass es sich tatsächlich überwiegend nichtum einen Krankenbehandlungsfall gehandelthabe. Für diese Zeit liege Hilfsbedürftigkeitvor, weil der Patient mit seinemEinkommen nicht in der Lage gewesen sei,die hohen Spitalskosten zu bezahlen. Fürzwölf Tage wurde der Antrag auf Spitalskostenrückersatzhingegen mit der Begründungabgewiesen, dass in dieser Zeit stationärerBehandlungsbedarf bestan<strong>den</strong> habe<strong>und</strong> daher die Kosten von der Gebietskrankenkassezu tragen seien.Der VwGH hob <strong>den</strong> Bescheid in seinemabweisen<strong>den</strong> Teil auf.Für die Berechtigung eines Ersatzanspruchsim Sinne des § 31 Stmk SHG istmaßgebend, ob der Hilfeempfänger zurZeit der Behandlung deren Kosten nichtoder nicht ausreichend aus eigenen Kräften<strong>und</strong> Mitteln bestreiten konnte <strong>und</strong> sie auchnicht von anderen Personen oder Einrichtungengedeckt wur<strong>den</strong>. Der angefochteneBescheid geht offenbar davon aus, dass derPatient nicht in der Lage gewesen sei, dieerforderliche Behandlung <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong> imKrankenhaus aus seinen eigenen Mittelnausreichend zu beschaffen. Ob es ihm möglichgewesen wäre, einen allfälligen Leistungsanspruchgegenüber dem Krankenversicherungsträgerrechtzeitig – bezogen aufdie erforderliche Anstaltspflege – durchzusetzen,hat die belangte Behörde unerörtertgelassen. Vielmehr hat sie eine Gefährdungseines Lebensbedarfs (Krankenhilfe) ausschließlichaus der Erwägung verneint, esbestehe ihres Erachtens eine Leistungspflichtdes Krankenversicherungsträgers.Da<strong>bei</strong> hat die belangte Behörde übersehen,dass die Hilfsbedürftigkeit eines Hilfesuchen<strong>den</strong>nicht bereits mit dem Hinweisverneint wer<strong>den</strong> kann, dieser habe gegenübereinem Dritten einen Anspruch auf dieerforderliche Leistung. Entschei<strong>den</strong>d istvielmehr, ob der Hilfesuchende die erforderlicheLeistung aufgr<strong>und</strong> dieses Anspruchsauch so rechtzeitig erhaltenkann, dass er in seinem Bedarf nicht gefährdetwird. Andernfalls hätte der Sozialhilfeträger– mit der allfälligen Möglichkeiteines Ersatzanspruchs gegenüber dem primärLeistungspflichtigen – in Vorlage zutreten.Praxishinweis:Selbst wenn letztlich eine Verpflichtungdes Krankenversicherungsträgers zur Übernahmeder Kosten für einen stationärenKrankenhausaufenthalt besteht, ist ein Anspruchdes Hilfsbedürftigen auf Sozialhilfezur Tragung der Spitalskosten nicht ausgeschlossen.§§ 4, 31 Stmk SHGVwGH 13. 5. 2011, 2007/10/0085ÖZPR 2011/142192 ÖZPR 6 | 2011