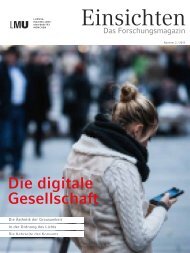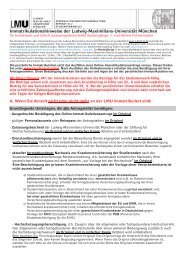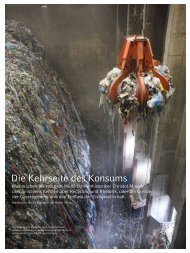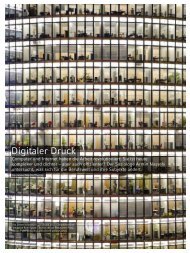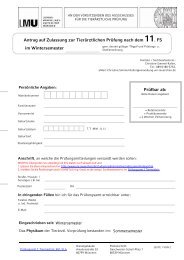30 - Ludwig-Maximilians-Universität München
30 - Ludwig-Maximilians-Universität München
30 - Ludwig-Maximilians-Universität München
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
eSSay menSchen<br />
28<br />
N R . 4 • 2010<br />
NEUBERUFEN<br />
1 Prof. Dr. Stefanie Diekmann<br />
1 Prof. Dr. ulrich Derenthal<br />
■ Prof. Dr. Stefanie Diekmann<br />
fakultät für GeSchichtS- unD<br />
kunStwiSSenSchaften<br />
Dem Theater, aber auch der Fotografie und dem<br />
Kino hat sich Stefanie Diekmann verschrieben;<br />
seit diesem Sommersemester ist sie Professorin<br />
für Theater und Medien am Institut für Theaterwissenschaft<br />
der LMU.<br />
Geboren 1969 in San Diego, USA, studierte Stefanie<br />
Diekmann das Fach „Drama, Theater, Medien“<br />
am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft<br />
der Justus-Liebig-<strong>Universität</strong> Gießen. An der<br />
Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-<br />
<strong>Universität</strong> Viadrina in Frankfurt an der Oder<br />
promovierte sie – unterstützt durch ein Stipendium<br />
des DFG-Graduiertenkollegs „Repräsentation-<br />
Rhetorik-Wissen“ – mit einer Arbeit zum Thema<br />
„Mythologien der Fotografie“. Zwischendurch<br />
ging sie für ein halbes Jahr als Visiting Fellow an<br />
das Poetics and Theory Institute der New York<br />
University. Während ihrer Zeit als Assistentin an<br />
der Europa-<strong>Universität</strong> Viadrina, wo sie zwischenzeitlich<br />
auch das Graduiertenkolleg koordinierte,<br />
verbrachte Stefanie Diekmann je ein Semester als<br />
DAAD-Gastdozentin am University College Cork in<br />
Irland und als Gastprofessorin an der University of<br />
Texas in Austin; im Wintersemester 2007/08 war<br />
sie als Gastdozentin am Institut für Theaterwissenschaft<br />
der <strong>Universität</strong> Bern. Anfang 2008 wurde<br />
Stefanie Diekmann an der Viadrina mit der Schrift<br />
„Backstage – Konstellationen von Theater und<br />
Kino“ habilitiert. Anschließend übernahm sie verschiedene<br />
Vertretungsprofessuren, unter anderem<br />
für den Bereich Theaterwissenschaft an der Freien<br />
<strong>Universität</strong> Berlin. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind<br />
intermediale Konstellationen von Theater und Kino<br />
oder Theater und Fotografie, daneben inszenierte<br />
Fotografie, Fotografie im Film, Theaterfeindlichkeit,<br />
Bild-Text-Beziehungen und Comics.<br />
Parallel zu ihrem Studium führten Hospitanzen und<br />
Assistenzen Stefanie Diekmann unter anderem an<br />
die Schaubühne Berlin, das Residenztheater <strong>München</strong><br />
und die Volksbühne Berlin. Als Jurymitglied<br />
wirkte sie 2008 bei Performance- und Theaterfestivals<br />
in Berlin und Erlangen mit, 2009 bei einem<br />
Kurzfilmfestival im Programm der Berlinale.<br />
■ Prof. Dr. ulrich Derenthal<br />
fakultät für mathematik,<br />
informatik unD StatiStik<br />
Von der <strong>Universität</strong> Freiburg wechselte der Mathematiker<br />
Ulrich Derenthal im Juli dieses Jahres<br />
nach <strong>München</strong> auf eine Professur für Mathematik<br />
am Lehrstuhl für Algebraische Geometrie der<br />
LMU. Seine Arbeitsgebiete sind Zahlentheorie und<br />
arithmetische Geometrie.<br />
Ulrich Derenthal, Jahrgang 1978, studierte Mathematik<br />
mit Nebenfach Informatik an der Georg-August-<strong>Universität</strong><br />
Göttingen; ein Auslandsstudium<br />
führte ihn von 2001 bis 2002 an die University of<br />
California in Berkeley. Von 2004 bis 2006 promovierte<br />
Derenthal an der <strong>Universität</strong> Göttingen mit<br />
einer Arbeit zum Thema „Geometry of universal<br />
torsors“. Anschließend wechselte er an die <strong>Universität</strong><br />
Zürich, wo er zunächst für zwei Jahre als<br />
Postdoktorand und von 2008 bis 2009 als Lecturer<br />
tätig war. 2008 ging der Mathematiker in die USA<br />
– ein Forschungsaufenthalt führte ihn zunächst<br />
an die Princeton University, ein weiterer im Frühjahrssemester<br />
2009 an das Mathematical Sciences<br />
Research Institute in Berkeley. Von 2009 bis 2010<br />
schließlich war Ulrich Derenthal als Juniorprofessor<br />
für Arithmetische Geometrie an der Albert-<br />
<strong>Ludwig</strong>s-<strong>Universität</strong> Freiburg tätig.<br />
Wissenschaftlich beschäftigt er sich insbesondere<br />
mit rationalen Punkten auf algebraischen Varietäten.<br />
„In der Zahlentheorie“, erklärt Derenthal, „interessiert<br />
man sich seit Langem für Lösungen von<br />
Polynomgleichungen in den natürlichen oder rationalen<br />
Zahlen. Das berühmteste Beispiel ist wohl<br />
die im 17. Jahrhundert formulierte Vermutung von<br />
Fermat, die erst Ende des 20. Jahrhunderts von<br />
Wiles bewiesen wurde.“ Die algebraische Geometrie<br />
befasst sich mit den Eigenschaften von durch<br />
Polynomgleichungen definierten geometrischen<br />
Objekten, sogenannten algebraischen Varietäten.<br />
Die Arithmetische Geometrie formuliert dabei<br />
die Frage der Zahlentheorie geometrisch<br />
als Frage nach der Verteilung von rationalen<br />
Punkten auf der zugehörigen Varietät. „Insbesondere<br />
interessiere ich mich für Varietäten mit<br />
unendlich vielen rationalen Punkten“, so Ulrich<br />
Derenthal. „Die Verteilung dieser Punkte wird<br />
von einer Vermutung von Yuri I. Manin präzise<br />
vorhergesagt. An dieser Vermutung arbeite ich<br />
mit Methoden der algebraischen Geometrie und<br />
der analytischen Zahlentheorie.“
An der LMU will Ulrich Derenthal sich insbesondere<br />
auch in der Ausbildung der Studierenden<br />
engagieren und mittelfristig eine Arbeitsgruppe<br />
aufbauen.<br />
■ Prof. Dr. anDreaS Butz<br />
fakultät für mathematik,<br />
informatik unD StatiStik<br />
Wie die Computer unserer Zukunft einmal aussehen<br />
und wir mit ihnen interagieren werden – mit<br />
solchen Fragen befasst sich Andreas Butz, der bereits<br />
seit 2004 als Professor für Computergrafik an<br />
der LMU war und zum 1. Juli dieses Jahres auf den<br />
Lehrstuhl für Mensch-Maschine-Interaktion im Institut<br />
für Informatik der LMU berufen wurde. Dabei<br />
hatte er der LMU den Vorzug gegenüber zwei Rufen<br />
an die <strong>Universität</strong> des Saarlandes (2008) und<br />
die <strong>Universität</strong> Würzburg (2010) gegeben.<br />
Andreas Butz, geboren 1967, studierte Informatik<br />
an der <strong>Universität</strong> Saarbrücken. Im Jahr 1997 promovierte<br />
er dort über die automatische Generierung<br />
dreidimensionaler Animationssequenzen. Als<br />
Postdoktorand an der Columbia University, New<br />
York, von 1997 bis 1998 wechselte Andreas Butz<br />
schließlich zum Kerngebiet der Mensch-Maschine-<br />
Interaktion und entwickelte Interaktionskonzepte<br />
für sogenannte „erweiterte Realitäten“.<br />
Nach zwei Jahren als Forscher an der <strong>Universität</strong><br />
des Saarlandes gründete er im Jahre 2000 aus einem<br />
Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
(DFG) heraus die Eyeled GmbH. Zwei Jahre lang<br />
baute er das Unternehmen, das mobile Softwarelösungen<br />
entwickelt und vertreibt, als Geschäftsführer<br />
mit auf. Mit einem Emmy-Noether-Stipendium<br />
der DFG kehrte Andreas Butz 2003 schließlich als<br />
Nachwuchsgruppenleiter an der <strong>Universität</strong> des<br />
Saarlandes in die akademische Welt zurück und<br />
wurde 2004 auf eine Professur für Computergrafik<br />
an die LMU berufen. Seine Arbeiten im Bereich<br />
neuartiger Benutzerschnittstellen wurden 2007 mit<br />
dem Alcatel-Lucent Forschungspreis „Technische<br />
Kommunikation“ ausgezeichnet.<br />
NEUBERUFEN<br />
„An der LMU finde ich für meine Arbeiten das<br />
ideale fachliche Umfeld“, so Butz. „Zur ganzheitlichen<br />
Betrachtung des Gebietes Mensch-Maschine-Interaktion<br />
gehören neben der Stammdisziplin<br />
Informatik auch die Psychologie sowie Aspekte der<br />
Gestaltung, der Wirtschafts- und der Kommunikationswissenschaften.“<br />
In der Freizeit kann er seit seiner Rückkehr nach<br />
<strong>München</strong> 2004 wieder einer alten Leidenschaft<br />
nachgehen: der Liebe zu den Bergen. „Ich versuche,<br />
sie im Sommer und im Winter einigermaßen<br />
regelmäßig zu besuchen – zum Wandern, Klettern,<br />
für Ski- und Hochtouren.“<br />
■ Prof. Dr. kirSten lauBer<br />
meDiziniSche fakultät<br />
„Wenn die zelluläre Müllabfuhr ihre Arbeit nicht<br />
ordentlich erledigt“, sagte Prof. Dr. Kirsten Lauber<br />
jüngst in einem Zeitungsinterview, „dann gibt<br />
es eine Katastrophe – innerhalb weniger Tage bis<br />
Wochen hätte sich unser Körpergewicht verdoppelt<br />
und wir würden aus der Form geraten.“ Die<br />
Biochemikerin erforscht, wie Körperzellen sterben<br />
und abgestorbene Zellen anschließend vom Immunsystem<br />
entsorgt werden; seit Juli dieses Jahres<br />
ist sie Professorin für Molekulare Onkologie in der<br />
Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie<br />
der LMU.<br />
Kirsten Lauber, geboren 1974, studierte Biochemie<br />
an der Eberhard-Karls-<strong>Universität</strong> Tübingen.<br />
Nach der Diplomarbeit am Institut für Medizinische<br />
Virologie des <strong>Universität</strong>sklinikums Tübingen<br />
wechselte sie in die Sektion für Molekulare Gastroenterologie.<br />
Hier wurde sie 2003 mit einer Arbeit<br />
zum Thema „Produktion von monozytären Attraktionssignalen<br />
während der Apoptose: Charakterisierung<br />
eines neuen Aspekts bei der Eliminierung<br />
apoptotischer Zellen” promoviert. Anschließend<br />
wirkte sie am <strong>Universität</strong>sklinikum Tübingen für<br />
ein knappes Jahr als Postdoktorandin, bevor sie die<br />
Leitung einer Juniorgruppe übernahm und diese<br />
bis zu ihrem Ruf nach <strong>München</strong> leitete.<br />
1 Prof. Dr. andreas Butz<br />
1 Prof. Dr. kirsten lauber<br />
eSSay menSchen<br />
29<br />
N R . 4 • 2010
eSSay menSchen<br />
<strong>30</strong><br />
N R . 4 • 2010<br />
NEUBERUFEN<br />
1 Prof. Dr. anke ortlepp<br />
Zu ihren Schwerpunktfächern gehören die Molekular-<br />
und Zellbiologie sowie die Proteinbiochemie.<br />
Kirsten Lauber erforscht, mit welchen<br />
Mechanismen der Körper abgestorbene Zellen<br />
entsorgt. „Die zellulären Reaktionen auf ionisierende<br />
Strahlung sind komplex und umfassen eine<br />
Vielzahl von biologischen Prozessen wie DNA-<br />
Reparatur, Zellzyklus-Arrest und Zelltod“, erklärt<br />
die Biochemikerin auf der neuen Internetseite ihrer<br />
Arbeitsgruppe. „Uns interessiert dabei die Induktion<br />
des Zelltods. Wir beschäftigen uns mit den<br />
molekularen Mechanismen der beiden extremen<br />
Zelltodformen Apoptose und Nekrose und ihrem<br />
Einfluss auf das Immunsystem. Während die Apoptose<br />
ein immunologisch stiller, tolerogener Zelltod<br />
ist, führen nekrotische Prozesse zu einer Immunaktivierung“,<br />
so Professor Lauber. „Wir versuchen,<br />
mit unserer Arbeit zu einem besseren Verständnis<br />
der molekularen Mechanismen des Zelltods, der<br />
immunologischen Konsequenzen und deren Modulation<br />
zum Beispiel durch pharmakologische<br />
Substanzen beizutragen.“<br />
■ Prof. Dr. anke ortlePP<br />
fakultät für SPrach- unD<br />
literaturwiSSenSchaften<br />
Derzeit bereitet Anke Ortlepp ein Gespräch mit<br />
dem Basketballstar Dirk Nowitzki vor – für ein<br />
kulturwissenschaftliches Projekt zu Akkulturationsmustern<br />
europäischer Profibasketballspieler in<br />
den USA. Denn Professor Ortlepps Arbeitsschwerpunkte<br />
sind amerikanische Kulturgeschichte, Reise-<br />
und Tourismusgeschichte – insbesondere die<br />
Geschichte des Flugreisens – sowie Geschlechtergeschichte,<br />
amerikanische Stadtgeschichte beziehungsweise<br />
„Urbanism“ und Migrationsgeschichte.<br />
Seit Mai 2010 ist Anke Ortlepp Professorin für<br />
Amerikanische Kulturgeschichte am Amerika-<br />
Institut der LMU.<br />
Geboren 1968, studierte Ortlepp Anglo-Amerikanische<br />
Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte<br />
sowie Englische Philologie an der <strong>Universität</strong> zu<br />
Köln und der Harvard University. Im Jahr 2000<br />
wurde sie in Amerikanischer Geschichte promoviert<br />
mit einer Arbeit zum Thema „,Auf denn, Ihr<br />
Schwestern!’ Deutschamerikanische Frauenvereine<br />
in Milwaukee (Wisconsin)“. Von 1998 bis<br />
2000 war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin der<br />
Anglo-Amerikanischen Abteilung der <strong>Universität</strong><br />
zu Köln, anschließend bis 2005 Wissenschaftliche<br />
Assistentin am Nordamerika-Studienprogramm<br />
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-<strong>Universität</strong><br />
Bonn. Von 2005 bis 2010 wirkte Anke Ortlepp als<br />
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen<br />
Historischen Institut in Washington, D.C. Dort<br />
wurde sie 2007 zunächst zur stellvertretenden Direktorin<br />
ernannt, im gleichen Jahr zur kommissarischen<br />
Direktorin; eine Position, die sie bis März<br />
2008 ausfüllte. Im Dezember 2009 habilitierte sie<br />
sich mit einer Schrift zum Thema „Cultures of Air<br />
Travel in Postwar America“ und erhielt die Venia<br />
Legendi für Nordamerikanische Kulturgeschichte<br />
und Transatlantikstudien.<br />
Auch bei ihrer zukünftigen Arbeit an der LMU<br />
wird Anke Ortlepp sich Forschungen zur amerikanischen<br />
Kulturgeschichte widmen. „Ich werde<br />
mich weiterhin mit der Geschichte des Flugreisens<br />
in den USA befassen. Zudem arbeite ich an einem<br />
neuen Buchprojekt ,Cultural History of the 1970s’,<br />
das sich unter anderem mit Musik, Mode, Design,<br />
Architektur und Stadtplanung der Siebzigerjahre<br />
befasst. Zugleich ist ein Oral-History-Projekt zu Akkulturationsmustern<br />
europäischer Profibasketballspieler<br />
in der amerikanischen NBA (National Basketball<br />
Association) sowie amerikanischer Basketballspieler<br />
in der deutschen Basketball-Bundesliga<br />
in Planung.“ Dazu sind verschiedene Interviews in<br />
Vorbereitung – neben Dirk Nowitzki von den Dallas<br />
Mavericks auch mit Detlef Schrempf, der ehemals<br />
für die Indiana Pacers spielte.
■ Prof. Dr. katharina inhetveen<br />
SozialwiSSenSchaftliche fakultät<br />
Zu ihren Forschungsgebieten zählt die Flüchtlings-<br />
und Migrationsforschung – seit August diesen Jahres<br />
ist Katharina Inhetveen Professorin für Soziologie<br />
mit dem Schwerpunkt „Qualitative Methoden<br />
der empirischen Sozialforschung“ an der LMU.<br />
Inhetveen, Jahrgang 1970, studierte Soziologie,<br />
Ethnologie und Musikwissenschaften an der Johannes<br />
Gutenberg-<strong>Universität</strong> Mainz. Von 1995 an<br />
wirkte sie dort als Wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
am Institut für Soziologie und promovierte 2000<br />
in diesem Fach mit den Nebenfächern Ethnologie<br />
und Musikwissenschaften. Ihre Dissertation trug<br />
den Titel „Institutionelle Innovation in politischen<br />
Parteien. Geschlechterquoten in Deutschland und<br />
Norwegen“.<br />
Von 2002 bis 2010 war sie Wissenschaftliche Assistentin<br />
im Fach Soziologie an der <strong>Universität</strong> Siegen.<br />
Innerhalb dieser Zeit arbeitete sie drei Jahre<br />
lang am DFG-Forschungsprojekt „Die politische<br />
Ordnung des Flüchtlingslagers“ mit, dessen empirischer<br />
Schwerpunkt in einer sechsmonatigen<br />
Feldforschung in zwei sambischen Flüchtlingslagern<br />
bestand. Im Juli 2009 wurde sie mit einer<br />
Schrift zu diesem Thema an der <strong>Universität</strong> Siegen<br />
habilitiert. Im Oktober desselben Jahres wechselte<br />
Katharina Inhetveen an die LMU – für eine Vertretung<br />
der Professur für Soziologie mit dem Schwerpunkt<br />
„Qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung“.<br />
Katharina Inhetveens Forschungs- und Lehrschwerpunkte<br />
sind Flüchtlings- und Migrationsforschung,<br />
Methoden der qualitativen Sozialforschung, Soziologie<br />
der Gewalt und Institutionenforschung,<br />
Politische Soziologie und Musiksoziologie. Forschungsaufenthalte<br />
führten sie nach Oslo, Bergen<br />
und Genf sowie an das Refugee Studies Centre der<br />
University of Oxford.<br />
NEUBERUFEN<br />
An der LMU wird Inhetveen ihre Forschung zu den<br />
Themen Flucht, Migration und Mobilität, qualitative<br />
Methoden sowie Gewaltsoziologie weiterführen.<br />
Ein Projekt befasst sich mit der Rückmigration<br />
angolanischer Flüchtlinge aus sambischen<br />
Flüchtlingslagern; daneben wird sich Inhetveen<br />
im Rahmen einer Forschungsgruppe am Zentrum<br />
für interdisziplinäre Studien in Bielefeld mit dem<br />
Themenfeld Mobilität und Katastrophe befassen.<br />
Andere Vorhaben umfassen den weiteren Ausbau<br />
der qualitativen Methodenausbildung am Institut<br />
für Soziologie, Arbeiten zum methodischen Umgang<br />
mit mehrsprachigen qualitativen Forschungsdesigns<br />
sowie, im Rahmen des interdisziplinären<br />
Arbeitskreises „Institutionen der Grausamkeit“,<br />
vergleichende Forschungen zur Gewaltsoziologie.<br />
■ Prof. Dr. martin DichGanS<br />
meDiziniSche fakultät<br />
Martin Dichgans ist seit September Professor<br />
für Translationale Schlaganfall- und Demenzforschung<br />
am gleichnamigen Stiftungslehrstuhl der<br />
LMU und Direktor des neu gegründeten Instituts<br />
für Schlaganfall- und Demenzforschung. Das von<br />
Stifter Zygmunt Solorz-Zak, einem der bedeutendsten<br />
Unternehmer Polens, eingebrachte Vermögen<br />
in Höhe von 100 Millionen Euro wird den<br />
wissenschaftlichen Betrieb des Instituts dauerhaft<br />
gewährleisten. Der Neubau des Instituts auf dem<br />
Campus Großhadern-Martinsried wurde maßgeblich<br />
durch den Freistaat Bayern unterstützt.<br />
Geboren 1966, studierte Dichgans Medizin an den<br />
<strong>Universität</strong>en zu Freiburg, Wien, Heidelberg und<br />
<strong>München</strong>. 1993 vollendete er seine am Zentrum<br />
für Molekulare Biologie in Heidelberg verfasste<br />
Dissertation zu den zellulären Mechanismen<br />
der Alzheimer Erkrankung. Das Praktische Jahr<br />
absolvierte er an der University of Michigan; als<br />
Arzt im Praktikum wirkte er anschließend an der<br />
Neurologischen Klinik am Klinikum Großhadern<br />
der LMU.<br />
1 Prof. Dr. martin Dichgans<br />
eSSay menSchen<br />
31<br />
N R . 4 • 2010
menSchen<br />
32<br />
N R . 4 • 2010<br />
NEUBERUFEN<br />
1994 verbrachte er einen halbjährigen Forschungsaufenthalt<br />
am Alzheimer Research Laboratory der<br />
Case Western Reserve University, Cleveland. 1995<br />
erhielt Martin Dichgans die Approbation als Arzt<br />
– und wechselte an die Neurologische Klinik des<br />
Klinikums Großhadern. Zunächst, bis 2001, war er<br />
dort als Wissenschaftlicher Assistent tätig; seine im<br />
Jahr 2000 fertiggestellte Habilitationsschrift trägt<br />
den Titel „Klinische, bildgebende und genetische<br />
Untersuchungen bei CADASIL“. Im folgenden Jahr<br />
machte er seinen Facharzt für Neurologie und<br />
wurde wenig später Oberarzt der Neurologischen<br />
Klinik. 2002 wurde Dichgans Leiter der Arbeitsgruppe<br />
Neurogenetik und der Neurogenetischen<br />
Ambulanz, kurz darauf Leiter der Neurologischen<br />
Poliklinik und 2004 Oberärztlicher Leiter der<br />
„Stroke Unit“, der Schlaganfallambulanz und des<br />
Dopplerlabors des Klinikums der LMU. Von 2006<br />
an hatte Martin Dichgans eine außerplanmäßige<br />
Professur für Neurologie inne und ist seit Januar<br />
2007 Sprecher des Interdisziplinären Schlaganfallzentrums<br />
am Klinikum der <strong>Universität</strong> <strong>München</strong>.<br />
2008 wurde er zum Kommissarischen Direktor des<br />
Instituts für Schlaganfall- und Demenzforschung<br />
am Klinikum der <strong>Universität</strong> <strong>München</strong> bestellt.<br />
Zu Professor Dichgans‘ Forschungsschwerpunkten<br />
zählen Schlaganfall und Demenz – bei Letzteren<br />
insbesondere die sogenannte Vaskuläre Demenz,<br />
welche die zweithäufigste Ursache von Demenz<br />
nach der Alzheimer’schen Erkrankung ist. Zudem<br />
befasst er sich intensiv mit Erkrankungen der kleinen<br />
Blutgefäße, sogenannten Mikroangiopathien,<br />
die eine wichtige Ursache von Schlaganfällen und<br />
die wichtigste Ursache der genannten Vaskulären<br />
Demenzen darstellen. Seine methodischen Schwerpunkte<br />
sind die Genetik (Identifikation von Risikogenen<br />
für Schlaganfall- und Demenzerkrankungen)<br />
sowie molekulare Mechanismen und Bildgebung.<br />
hinweis der redaktion: Eine vollständige Liste<br />
der Neuberufenen findet sich im Internet unter<br />
www.lmu.de/news/neuberufen<br />
honorarProfeSSur<br />
■ Prof. Dr. Günther franz kerScher<br />
meDiziniSche fakultät<br />
Professor Günther Franz Kerscher, Ministerialdirigent<br />
und zuletzt Leiter der Abteilung<br />
Gesundheit des Bayerischen Staatsministeriums<br />
für Umwelt und Gesundheit, hat seit Juni<br />
2010 eine Honorarprofessur für Public Health<br />
an der LMU inne. Geboren 1955, wurde<br />
Kerscher nach seinem Studium der Humanmedizin<br />
an der LMU ebendort im Jahre 1982<br />
promoviert – mit einer Arbeit zum Thema<br />
„Orale Hyposensibilisierung mit Pollenkapseln<br />
bei Inhalationsallergien“. Er war jeweils<br />
als Assistenzarzt am Kreiskrankenhaus Dachau<br />
und der Neurologischen Klinik der LMU in<br />
Großhadern, anschließend beim Staatlichen<br />
Gesundheitsamt <strong>München</strong> tätig. 1987 wurde<br />
er Referent in der damaligen Gesundheitsabteilung<br />
des Bayerischen Innenministeriums,<br />
ein Jahr später Referent für Umwelthygiene<br />
im Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung<br />
und Umweltfragen. 1992<br />
wurde er zum Leiter des Staatlichen Gesundheitsamts<br />
<strong>München</strong> bestellt und erhielt 1994<br />
einen Lehrauftrag im Postgraduiertenstudiengang<br />
„Öffentliche Gesundheit und Epidemiologie“<br />
(Public Health) der LMU. 2001 wurde<br />
Kerscher Leiter des Referats Umweltmedizin<br />
im Bayerischen Gesundheitsministerium, ein<br />
Jahr später übernahm er die Leitung der Abteilung<br />
Gesundheit und Ernährung. 2004 erhielt<br />
Günther Franz Kerscher einen Lehrauftrag an<br />
der Technischen <strong>Universität</strong> <strong>München</strong> (TUM),<br />
2005 einen Lehrauftrag auf dem Gebiet der<br />
Sozialmedizin an der LMU.<br />
Günther Franz Kerscher ist Facharzt für „Öffentliches<br />
Gesundheitswesen“ mit der Zusatzbezeichnung<br />
„Umweltmedizin“. Zu seinen<br />
thematischen Schwerpunkten zählen Grundsatzfragen<br />
der Medizin, der Gesundheitspolitik<br />
und des Gesundheitsrechts, Öffentliches<br />
Gesundheitswesen, Sozialmedizin, Infektionsschutz,<br />
Hygiene und Umweltmedizin.