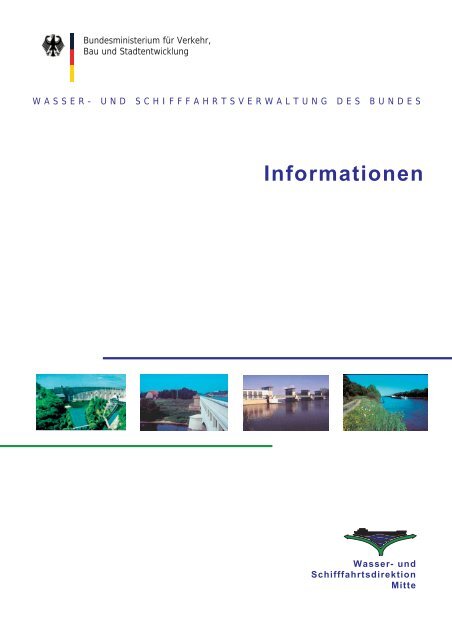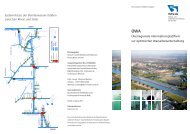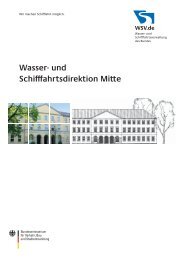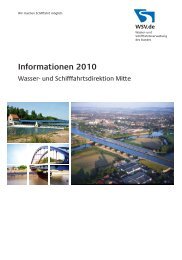Informationen 2005 - WSD Mitte - Wasser- und ...
Informationen 2005 - WSD Mitte - Wasser- und ...
Informationen 2005 - WSD Mitte - Wasser- und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr,<br />
Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung<br />
WASSER- UND SCHIFFFAHRTSVERWALTUNG DES BUNDES<br />
<strong>Informationen</strong><br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong>
<strong>Informationen</strong><br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>
Liebe Leserin,<br />
lieber Leser,<br />
mit dem Jahresbericht <strong>2005</strong> halten Sie eine Broschüre in den Händen, die wir gerne für Sie zusammengestellt<br />
haben. In lockerer, fast zufälliger Reihenfolge finden Sie kurze Aufsätze über unsere<br />
aktuellen Aktivitäten zur Förderung der Schifffahrt auf den B<strong>und</strong>eswasserstraßen Weser, <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
<strong>und</strong> Elbe – Seitenkanal sowie zum Bau oder Erhalt der dazugehörigen Bauwerke.<br />
Wir geben dieses Heft auch deswegen gerne aus der Hand, weil die Leserschaft nicht gezwungen<br />
ist, den ganzen Text wie einen Roman lesen zu müssen, sondern weil die Broschüre ähnlich einem<br />
Nachschlagewerk auch zur gezielten Information über Einzelthemen genutzt werden kann.<br />
Allen Autoren sei an dieser Stelle von Herzen gedankt; alle „Noch nicht Autoren“ werden zur Formulierung<br />
ihres Beitrages zur Gewährleistung der Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des Schiffsverkehrs<br />
<strong>und</strong> zur Verbesserung der Bedingungen für den umweltverträglichen Gütertransport auf den <strong>Wasser</strong>straßen<br />
im Bezirk der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> eingeladen <strong>und</strong> aufgefordert. Hier ist das Forum über das Gute,<br />
das wir leisten, mit Stolz zu berichten. Hier präsentieren wir, dass wir nicht nur Behörde, sondern<br />
ein tatkräftiger Dienstleister im Umfeld der Wachstumsbranche „Logistik“ sind.<br />
Auch im Namen der Redaktion wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre !<br />
Sönke Meesenburg<br />
Präsident der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong>
Liebe Kolleginnen,<br />
liebe Kollegen,<br />
die Ausgabe <strong>2005</strong> unserer Informationsschrift blickt auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen<br />
Jahres im Geschäftsbereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> zurück.<br />
Hierzu gehören insbesondere die Veranstaltung „100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal“, der Präsidentenwechsel<br />
<strong>und</strong> Ehrungen, die verschiedenen Beschäftigten zu teil wurden.<br />
Außerdem berichten Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter aus allen Verwaltungsebenen über besondere<br />
Baumaßnahmen <strong>und</strong> wichtige Projekte. Diese Berichte zeigen das vielfältige Spektrum unserer Aufgaben<br />
zum Erhalt <strong>und</strong> zur Verbesserung der <strong>Wasser</strong>straßeninfrastruktur für die Binnenschifffahrt.<br />
Anhand der Berichte wird auch deutlich, dass es die Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter sind, die mit<br />
hoher Motivation <strong>und</strong> mit Einsatzwillen dafür sorgen, dass der Binnenschifffahrt ein leistungsfähiger<br />
<strong>und</strong> sicherer Verkehrsweg zur Verfügung steht. Hinzu kommt das Engagement in der Berufsausbildung<br />
junger Menschen. Die Ausbildungsquote von r<strong>und</strong> 10 % zeigt, dass sich die Dienststellen der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> zu ihrer sozialen Verantwortung bekennen <strong>und</strong> zur Verbesserung<br />
der Ausbildungssituation in der Region beitragen.<br />
Inwieweit wir unsere vielfältigen Aufgaben allerdings in den kommenden Jahren noch mit der bisherigen<br />
hohen Qualität erledigen können, hängt in besonderem Maße von der Unterstützung durch die<br />
Politik ab. Die für die kommenden Jahre angekündigten zusätzlichen Investitionsmittel für die <strong>Wasser</strong>straßen<br />
sind ein erster richtiger Schritt zu einer besseren Förderung des Verkehrssystems Binnenschiff/<strong>Wasser</strong>straße.<br />
Ob es der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung, aufgr<strong>und</strong> der auch für die<br />
nächsten Jahre angekündigten weiteren Stelleneinsparungen, noch möglich ist, die sich hieraus ergebenden<br />
zusätzlichen Anforderungen zu erfüllen, bezweifle ich.<br />
Liebe Leserinnen <strong>und</strong> Leser,<br />
möge diese Informationsschrift Sie davon überzeugen, dass der Erhalt <strong>und</strong> die Weiterentwicklung<br />
des umweltfre<strong>und</strong>lichen <strong>und</strong> sicheren Verkehrssystems Binnenschiff/<strong>Wasser</strong>straße <strong>und</strong> damit eine<br />
nachhaltige Entlastung des Straßengüterverkehrs nur mit einer kompetenten <strong>und</strong> leistungsfähigen<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung möglich sein wird.<br />
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen.<br />
Karl-Heinz Kuhlmann<br />
Vorsitzender des Bezirkspersonalrates bei der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong>
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Vorwort des Präsidenten der<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Vorwort des<br />
Bezirkspersonalratsvorsitzenden<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
des B<strong>und</strong>es (WSV)<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
des B<strong>und</strong>es<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
in Hannover<br />
Die Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
Aktuelles <strong>und</strong> Informatives<br />
8 - 18<br />
Nachrichten<br />
100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
Festveranstaltung in Hannover am 5. April <strong>2005</strong>,<br />
▸ Vorstellung <strong>und</strong> Übergabe des Sonderpostwertzeichens<br />
„100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal“ <strong>und</strong> weitere regionale<br />
Veranstaltungen<br />
Staatssekretär Ralf Nagel zu Besuch bei der<br />
▸ Sonderstelle für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />
Wechsel in der Leitung des Dezernates<br />
▸ Haushalt/Controlling<br />
▸ B<strong>und</strong>esverdienstkreuz für Karl-Heinz Schade<br />
▸ Teilnahme am 2. Herz-Kreis-LAUF in Hannover<br />
▸ Pressegespräch an der Schleuse Sülfeld<br />
Gr<strong>und</strong>steinlegung für den Neubau des Aller-Wehres<br />
▸ in Marklendorf<br />
▸ Helmut Trapp im Ruhestand<br />
▸ 50-jähriges Dienstjubiläum<br />
Wechsel in der Leitung der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
▸ Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
▸ Weltberühmte Gäste am <strong>Wasser</strong>straßenkreuz Minden<br />
▸<br />
„Schifffahrt <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>straßen“<br />
Ausstellung über Nassbaggerei in der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
19<br />
Aufsatzbeiträge<br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser<br />
– Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
30 Neubestimmung der Inhaltslinie der<br />
Edertalsperre<br />
34<br />
Erfahrungen bei Abflussmessungen mit<br />
einem ADCP-Messgerät<br />
39 Planungen zum Neubau der<br />
Weserschleuse Dörverden<br />
42 ARGO-Teststrecke auf der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
45 Neubau der Brücken Nr. 80 <strong>und</strong> 81 am<br />
Stichkanal nach Osnabrück<br />
– Planung, Entwurf, Ausführung<br />
50<br />
54<br />
58<br />
62<br />
65<br />
Beweissicherung <strong>und</strong> messtechnische<br />
Überwachung beim Bau der neuen<br />
Schleuse Sülfeld Süd<br />
Fertigstellung des <strong>Mitte</strong>llandkanals in<br />
Wolfsburg<br />
Neubau <strong>und</strong> Abbruch einer<br />
Straßenbrückenanlage über den<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal <strong>und</strong> über ein Bahngleis im<br />
Zuge der B<strong>und</strong>esstraße 71 in Vahldorf<br />
Ausbau des oberen Vorhafens der<br />
Schleuse Uelzen<br />
Das Kom-Netz der WSV im Bereich der<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> – Technischer Wandel einer<br />
notwendigen Infrastruktur<br />
70 Informationszentren<br />
71<br />
73<br />
Veröffentlichungen<br />
Vorträge<br />
74 Adressen der Dienststellen im<br />
Bereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
75 Weserlied
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen sind neben<br />
den Straßen <strong>und</strong> Schienenwegen ein<br />
unverzichtbarer Teil des Verkehrswegenetzes<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
Sie verbinden die großen Seehäfen<br />
einerseits mit der Hohen See, andererseits<br />
mit ihrem jeweiligen Hinterland<br />
sowie die bedeutendsten Industrie- <strong>und</strong><br />
Handelszentren untereinander. So stehen<br />
den deutschen Seehäfen leistungsfähige,<br />
sichere <strong>und</strong> wirtschaftliche Zufahrtswege<br />
an Nord- <strong>und</strong> Ostsee zur<br />
Verfügung. Im Binnenland besitzt die<br />
überwiegende Zahl der deutschen<br />
Großstädte einen <strong>Wasser</strong>straßenanschluss<br />
mit eigenem Binnenhafen. Hinzu<br />
kommt eine Vielzahl von regionalen<br />
kleineren <strong>und</strong> größeren Umschlagstellen<br />
entlang der <strong>Wasser</strong>straßen.<br />
Die deutschen Seewasserstraßen<br />
(23.000 km²) in der deutschen Bucht<br />
<strong>und</strong> in der Ostsee gehören zu den am<br />
dichtesten befahrenen Revieren der<br />
Welt. Sie nehmen die Verkehre zu den<br />
deutschen Seehäfen auf, wo jährlich<br />
etwa 315 Mio. Tonnen Güter umgeschlagen<br />
werden. Auf den Binnenwasserstraßen<br />
(7.300 km) wird jährlich eine<br />
Verkehrsleistung von rd. 65 Mrd. tkm<br />
erbracht, was etwa 90% der Güterverkehrsleistung<br />
der Bahn entspricht. Die<br />
Binnenschifffahrt befördert pro Jahr rd.<br />
240 Mio. Tonnen, insbesondere Massengüter<br />
wie Baustoffe, Erze, Kohle,<br />
Mineralöle <strong>und</strong> landwirtschaftliche Produkte.<br />
Hinzu kommt der Transport von<br />
schweren <strong>und</strong> sperrigen Gütern, die auf<br />
dem Landwege nicht transportiert werden<br />
können <strong>und</strong> zunehmend der Containertransport.<br />
Das Binnenschiff zeichnet<br />
sich dabei als umweltfre<strong>und</strong>liches,<br />
kostengünstiges <strong>und</strong> sicheres Verkehrsmittel<br />
mit geringem Energieverbrauch<br />
aus.<br />
Neben der Nutzung als Verkehrsweg<br />
dienen die <strong>Wasser</strong>straßen auch der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, der Energiegewinnung,<br />
dem Hochwasserschutz sowie<br />
der Freizeitgestaltung <strong>und</strong> der Erholung<br />
der Bevölkerung. Die <strong>Wasser</strong>wege mit<br />
ihren Ufern erfüllen darüber hinaus eine<br />
wichtige Biotopfunktion <strong>und</strong> sind Lebensraum<br />
für eine Vielzahl von Pflanzen<br />
<strong>und</strong> Tieren.<br />
In der deutschen Küstenregion <strong>und</strong> im<br />
Binnenbereich sind r<strong>und</strong> 1.000.000 Arbeitsplätze<br />
direkt oder indirekt von den<br />
<strong>Wasser</strong>straßen <strong>und</strong> den See- <strong>und</strong> Binnenhäfen<br />
abhängig.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
1
2<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
des B<strong>und</strong>es<br />
Nach dem Gr<strong>und</strong>gesetz ist der B<strong>und</strong> Eigentümer der B<strong>und</strong>eswasserstraßen.<br />
Er verwaltet sie durch eigene Behörden<br />
– die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung – <strong>und</strong> nimmt<br />
die staatlichen Aufgaben im Bereich der Binnen- <strong>und</strong> See-<br />
schifffahrt wahr (Art. 87 <strong>und</strong> 89 GG).<br />
Wesentliche Gr<strong>und</strong>lage für die Tätigkeit der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsverwaltung sind das B<strong>und</strong>eswasserstraßengesetz,<br />
das Binnenschifffahrtsaufgabengesetz <strong>und</strong> das Seeaufgabengesetz<br />
mit den hierzu gehörenden weiteren<br />
Rechtsverordnungen.<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung ist dem B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung nachgeordnet.<br />
Sie gliedert sich in eine <strong>Mitte</strong>linstanz <strong>und</strong> eine<br />
Unterinstanz. Die <strong>Mitte</strong>linstanz besteht aus sieben <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsdirektionen in Kiel, Aurich, Hannover,<br />
BAW<br />
B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau<br />
Karlsruhe (Hamburg, Ilmenau)<br />
<strong>WSD</strong> Nord<br />
Kiel<br />
WSA<br />
Lübeck<br />
WSA<br />
Tönning<br />
WSA<br />
Brunsbüttel<br />
WSA<br />
Kiel - Holtenau<br />
WSA<br />
Strals<strong>und</strong><br />
WSA<br />
Hamburg<br />
WSA<br />
Cuxhaven<br />
NBA NOK<br />
Rendsburg<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
<strong>WSD</strong> Nordwest<br />
Aurich<br />
WSA<br />
Bremen<br />
WSA<br />
Bremerhaven<br />
WSA<br />
Wilhelmshaven<br />
WSA<br />
Emden<br />
Münster, Mainz, Würzburg <strong>und</strong> Magdeburg. Den <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsdirektionen sind als Unterinstanz insgesamt<br />
39 <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter sowie sieben<br />
Neubauämter nachgeordnet. Den <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämtern<br />
sind regionale Außenbezirke sowie jeweils<br />
ein Bauhof bzw. eine Werkstatt zugeordnet. Für spezielle<br />
Aufgaben sind bei einigen Direktionen bzw. <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsämtern zusätzlich sog. Fach- oder Bündelungsstellen<br />
eingerichtet.<br />
Zur <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung gehören außerdem<br />
vier B<strong>und</strong>esoberbehörden, die B<strong>und</strong>esanstalt für<br />
<strong>Wasser</strong>bau in Karlsruhe mit Außenstellen in Hamburg <strong>und</strong><br />
Ilmenau, die B<strong>und</strong>esanstalt für Gewässerk<strong>und</strong>e in Koblenz<br />
mit einer Außenstelle in Berlin, das B<strong>und</strong>esamt für Seeschifffahrt<br />
<strong>und</strong> Hydrographie in Hamburg <strong>und</strong> Rostock sowie<br />
die B<strong>und</strong>esstelle für Seeunfalluntersuchung in Ham-<br />
burg.<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr,<br />
Bau <strong>und</strong> < Stadtentwicklung<br />
BfG<br />
B<strong>und</strong>esanstalt für Gewässerk<strong>und</strong>e<br />
Koblenz (Berlin)<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Hannover<br />
WSA<br />
Hann .Münden<br />
WSA<br />
Verden<br />
WSA<br />
Minden<br />
WSA<br />
Braunschweig<br />
WSA<br />
Uelzen<br />
NBA<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
Hannover<br />
WNA<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
Helmstedt<br />
<strong>WSD</strong> West<br />
Münster<br />
WSA<br />
Köln<br />
In der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung (ohne Oberbehörden)<br />
sind rd. 13.500 Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
beschäftigt.<br />
WSA<br />
Duisburg-Rhein<br />
WSA<br />
Duisburg-<br />
Meiderich<br />
WSA<br />
Rheine<br />
WSA<br />
Meppen<br />
WNA<br />
Datteln<br />
BSH<br />
B<strong>und</strong>esamt für Seeschifffahrt<br />
<strong>und</strong> Hydrographie<br />
Hamburg <strong>und</strong> Rostock<br />
<strong>WSD</strong> Südwest<br />
Mainz<br />
WSA<br />
Freiburg<br />
WSA<br />
Mannheim<br />
WSA<br />
Bingen<br />
WSA<br />
Heidelberg<br />
WSA<br />
Stuttgart<br />
WSA<br />
Koblenz<br />
WSA<br />
Trier<br />
WSA<br />
Saarbrücken<br />
BSU<br />
B<strong>und</strong>esstelle für<br />
Seeunfalluntersuchung<br />
Hamburg<br />
<strong>WSD</strong> Süd<br />
Würzburg<br />
WSA<br />
Aschaffenburg<br />
WSA<br />
Schweinfurt<br />
WSA<br />
Nürnberg<br />
WSA<br />
Regensburg<br />
WNA<br />
Aschaffenburg<br />
<strong>WSD</strong> Ost<br />
Magdeburg<br />
WSA<br />
Dresden<br />
WSA<br />
Magdeburg<br />
WSA<br />
Lauenburg<br />
WSA<br />
Brandenburg<br />
WSA<br />
Berlin<br />
WSA<br />
Eberswalde<br />
WNA<br />
Berlin<br />
WNA<br />
Magdeburg
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong> in Hannover<br />
Innerer Aufbau der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Die <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> gliedert sich in ihrem inneren Aufbau in die<br />
Dezernate<br />
Zuständigkeitsbereich<br />
A<br />
C<br />
– Administration<br />
– Controlling <strong>und</strong> Haushalt<br />
Der Zuständigkeitsbereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdi-<br />
SR – Schifffahrt <strong>und</strong> Recht<br />
rektion (<strong>WSD</strong>) <strong>Mitte</strong> in Hannover umfasst folgende Bun-<br />
M – Regionales Management<br />
deswasserstraßen mit einer Gesamtlänge von 1.364 km:<br />
N – Neubau<br />
Weser<br />
P – Planfeststellung<br />
von Hann.Münden bis etwa 8 km oberhalb der Bremer<br />
Weserschleuse Hemelingen,<br />
Außerdem sind der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
• die Sonderstelle für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />
Werra<br />
(SAF) in der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwal-<br />
von Falken bei Treffurt bis Hann.Münden,<br />
tung des B<strong>und</strong>es,<br />
• die Drucksachenstelle der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Fulda<br />
Schifffahrtsverwaltung des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong><br />
von Bebra-Blankenheim bis Hann.Münden, • eine Lohnrechnungsstelle<br />
Aller für die zentrale Bearbeitung überregionaler Aufgaben an-<br />
von Celle bis zur Einmündung in die Weser bei Verden,<br />
gegliedert. Die SAF organisiert <strong>und</strong> führt Schulungsmaßnahmen<br />
im Bereich der Aus- <strong>und</strong> Fortbildung für Beschäf-<br />
Leine<br />
tigte der B<strong>und</strong>esverwaltung für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadt-<br />
von Hannover bis zur Einmündung in die Aller einschließentwicklung durch. Die Drucksachenstelle ist für die Herlich<br />
Ihme <strong>und</strong> „Schneller Graben“,<br />
stellung sowie Verteilung von Vordrucken <strong>und</strong> Verwaltungsvorschriften<br />
in Papierform bzw. digitaler Form bun-<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
desweit für die Dienststellen der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrts-<br />
von der Abzweigung aus dem Dortm<strong>und</strong>-Ems-Kanal bei verwaltung tätig. Die Lohnrechnungsstelle ist zuständig für<br />
Bergeshövede bis zur Elbe bei Magdeburg mit Stichkanä- die Zahlbarmachung der Löhne der Arbeiterinnen <strong>und</strong> Arlen<br />
nach Ibbenbüren, Osnabrück, Hannover-Linden, Misbeiter der <strong>WSD</strong>’n Nordwest, West <strong>und</strong> <strong>Mitte</strong> sowie des<br />
burg, Hildesheim <strong>und</strong> Salzgitter sowie Verbindungskanä- Luftfahrtb<strong>und</strong>esamtes <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esstelle für Flugunfalllen<br />
zur Weser in Minden <strong>und</strong> zur Leine in Hannover,<br />
untersuchung in Braunschweig.<br />
Elbe-Seitenkanal Weiterhin nimmt die „Fachstelle Vermessungs- <strong>und</strong> Kar-<br />
von der Abzweigung aus dem <strong>Mitte</strong>llandkanal bei Edesbüttel<br />
bis zur Einmündung in die Elbe bei Artlenburg.<br />
Zu diesen B<strong>und</strong>eswasserstraßen gehören als b<strong>und</strong>eseigene<br />
Anlagen auch die Eder- <strong>und</strong> die Diemeltalsperre.<br />
Dienststellen<br />
Zum Geschäftsbereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> gehören fünf <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsämter in Hann.Münden, Verden, Minden,<br />
Braunschweig <strong>und</strong> Uelzen sowie das Neubauamt für<br />
den Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover <strong>und</strong> das<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt Helmstedt. Die Anschriften<br />
dieser Dienststellen finden Sie auf Seite 74.<br />
Den fünf <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämtern sind im inneren<br />
Aufbau insgesamt neunzehn Außenbezirke sowie jeweils<br />
ein Bauhof bzw. eine Werkstatt (WSA Hann.Münden) zugeordnet.<br />
Die Außenbezirke sind für die Verkehrssicherung<br />
<strong>und</strong> bautechnische Unterhaltung eines ihnen zugewiesenen<br />
<strong>Wasser</strong>straßenabschnitts zuständig. Die Bauhöfe<br />
bzw. die Werkstatt sind zuständig <strong>und</strong> verantwortlich für<br />
alle werkstattrelevanten Unterhaltungsarbeiten an den<br />
maschinen- <strong>und</strong> elektrotechnischen Anlagen im jeweiligen<br />
WSA-Bereich. Die Unterhaltung der nachrichtentechnischen<br />
Anlagen sowie die Instandsetzungsarbeiten an<br />
<strong>Wasser</strong>fahrzeugen <strong>und</strong> schwimmenden Geräten (soweit<br />
Regiearbeiten) obliegt für den gesamten Zuständigkeitsbereich<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> dem Bauhof Minden.<br />
tenwesen“ bei der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> gebündelt Ausführungsaufgaben<br />
für die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter <strong>und</strong> die Neubauämter<br />
des Geschäftsbereichs wahr. Hierbei handelt es<br />
sich insbesondere um Aufgaben der Kartenherstellung<br />
<strong>und</strong> -fortführung, der Peilauswertung <strong>und</strong> der Auswertung<br />
von geodätischen Lage- <strong>und</strong> Höhennetzen.<br />
Eine weitere Bündelungsstelle für den gesamten Geschäftsbereich<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> zur Bearbeitung von Ingenieuraufgaben<br />
des Maschinenbaus, des Schiffbaus <strong>und</strong><br />
der Elektro- <strong>und</strong> Nachrichtentechnik besteht mit der<br />
„Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong>“ beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsamt Minden.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
3
4<br />
Die Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
Die gr<strong>und</strong>gesetzlich normierte Verwaltungstätigkeit der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung des B<strong>und</strong>es (WSV)<br />
erstreckt sich auf die <strong>Wasser</strong>straßen in ihrer Verkehrsfunktion<br />
sowie auf die staatlichen Aufgaben der Binnen-,<br />
Küsten- <strong>und</strong> Seeschifffahrt. Besonderheit der WSV – im<br />
Vergleich zu Schiene <strong>und</strong> Straße – ist die regional sehr<br />
unterschiedliche Ausprägung der Infrastruktur (Küstengewässer,<br />
Tideströme, freifließende Flüsse, Flüsse mit<br />
Schleusen <strong>und</strong> Wehren, Kanäle) <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen<br />
regional sehr unterschiedlichen Schifffahrtsbedingungen.<br />
Der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> <strong>und</strong> ihren<br />
nachgeordneten Ämtern obliegen nach dem B<strong>und</strong>eswasserstraßengesetz<br />
<strong>und</strong> dem Binnenschifffahrtsaufgabengesetz<br />
folgende Aufgaben:<br />
Unterhaltung der <strong>Wasser</strong>straßen<br />
Die Unterhaltung der Binnenwasserstraßen umfasst die<br />
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustands für den<br />
<strong>Wasser</strong>abfluss <strong>und</strong> die Erhaltung der Schiffbarkeit. Dabei<br />
ist den Belangen des Naturhaushalts Rechnung zu tragen;<br />
Bild <strong>und</strong> Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu<br />
berücksichtigen. Außerdem sind die Erfordernisse des<br />
Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Zur Unterhaltung<br />
gehören auch Arbeiten zur Beseitigung oder Verhütung<br />
von Schäden an Ufergr<strong>und</strong>stücken, die durch die Schifffahrt<br />
entstanden sind oder entstehen können, soweit die<br />
Schäden den Bestand der Ufergr<strong>und</strong>stücke gefährden.<br />
Im Rahmen der Unterhaltung der Binnenwasserstraßen ist<br />
dafür zu sorgen, dass in den Flussstrecken eine ausreichend<br />
breite <strong>und</strong> tiefe Fahrrinne für die Schifffahrt zur Verfügung<br />
steht. Besonders nach Hochwässern können sich<br />
störende Anlandungen bilden, die durch Baggerungen beseitig<br />
werden müssen. Daneben sind die durch Strömung,<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Leineauslass<br />
Wellenschlag <strong>und</strong> Eisgang verursachten Schäden an den<br />
Strombauwerken, insbesondere an Deckwerken <strong>und</strong> Buhnen<br />
zu beseitigen. An den staugeregelten Flüssen kommt<br />
die Unterhaltung der Wehranlagen, Schleusenkanäle <strong>und</strong><br />
Schleusen hinzu. An den künstlichen <strong>Wasser</strong>straßen (Kanäle)<br />
sind neben dem Gewässerbett zusätzlich die landseitigen<br />
Betriebswege, Seitendämme <strong>und</strong> -gräben bzw.<br />
Einschnittböschungen <strong>und</strong> eine Vielzahl von Ingenieurbauwerken,<br />
wie Schleusen, Pumpwerke, Sicherheitstore,<br />
Brücken, Düker <strong>und</strong> Durchlässe, zu unterhalten.<br />
Zu den Unterhaltungsarbeiten gehören die Inspektion <strong>und</strong><br />
Beurteilung des Ist-Zustands, die ständige Wartung <strong>und</strong>,<br />
sofern erforderlich, die Instandsetzung des Gewässerbetts<br />
<strong>und</strong> der baulichen Anlagen. So wird die Fahrrinnenbreite<br />
<strong>und</strong> -tiefe der Flüsse <strong>und</strong> Kanäle mit speziellen Peilschiffen<br />
regelmäßig vermessen <strong>und</strong> auf Abweichungen hin geprüft.<br />
Die regelmäßige Inspektion der Ingenieurbauwerke<br />
hat den Zweck, etwa eingetretene Mängel am Bauwerk<br />
rechtzeitig zu erkennen, um diese dann zu beseitigen, bevor<br />
größerer Schaden eintritt oder die Betriebs- bzw.<br />
Bauwerkssicherheit beeinträchtigt wird. Die Dammstrecken<br />
an den Kanälen werden im Rahmen einer Damminspektion<br />
durch regelmäßige Begehungen laufend beobachtet<br />
<strong>und</strong> überwacht. Die mechanischen, hydraulischen<br />
<strong>und</strong> elektrotechnischen Teile der Schleusen, Wehre,<br />
Pumpwerke, Sicherheitstore usw. werden im Rahmen einer<br />
sog. Planmäßigen Unterhaltung gepflegt <strong>und</strong> gewartet.<br />
In den <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämtern wird die Aufgabe<br />
der Unterhaltung durch fachk<strong>und</strong>ige Ingenieure <strong>und</strong> Techniker<br />
verschiedener Fachrichtungen, in den Außenbezirken<br />
<strong>und</strong> Bauhöfen ergänzend durch einen Regiebetrieb<br />
wahrgenommen, der aus Fachhandwerkern, wie <strong>Wasser</strong>bauern,<br />
Maschinen- <strong>und</strong> Motorenschlossern, Stahlbauern,<br />
Energieelektronikern <strong>und</strong> Nachrichtentechnikern besteht.<br />
Dieser Regiebetrieb ist mit Land- <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>fahrzeugen<br />
sowie Arbeitsgeräten ausgestattet. Entsprechend seiner<br />
personellen <strong>und</strong> technischen Ausstattung wird der Regiebetrieb<br />
vorrangig für folgende Aufgaben eingesetzt:
• Inspektion <strong>und</strong> Wartung von Gewässerbett,<br />
Schifffahrtsanlagen<br />
<strong>und</strong> Ingenieurbauwerken,<br />
• Soforteinsätze zur Vermeidung von<br />
Schifffahrtssperren <strong>und</strong> bei Havarien,<br />
• Überwachung der von Firmen auszuführenden<br />
Arbeiten,<br />
• Betrieb von Schifffahrtsanlagen<br />
(z.B. Schleusen, Pumpwerke, Sicherheitstore),<br />
• Kleinere Instandsetzungsarbeiten<br />
am Gewässerbett <strong>und</strong> an den Anlagen.<br />
Die größeren Instandsetzungsmaßnahmen<br />
werden über öffentliche Ausschreibungen<br />
an geeignete Fachunternehmen<br />
der Wirtschaft oder des Handwerks<br />
vergeben.<br />
Als besondere Aufgabe hat die <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung für die Eisbekämpfung<br />
auf den B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
zu sorgen, soweit diese wirtschaftlich<br />
vertretbar ist.<br />
Setzen <strong>und</strong> Betreiben von<br />
Schifffahrtszeichen<br />
Zur Verkehrsregelung, Verkehrslenkung sowie zum<br />
Schutz von Anlagen sind an den <strong>Wasser</strong>straßen Schifffahrtszeichen<br />
zu setzen <strong>und</strong> zu betreiben. Die Schifffahrtszeichen<br />
sind in verschiedene Gruppen eingeteilt:<br />
• feste visuelle Schifffahrtszeichen (z.B. Tafelzeichen,<br />
Signallichtanlagen),<br />
• schwimmende visuelle Schifffahrtszeichen (z.B. Fahrwassertonnen),<br />
• auditive Schifffahrtszeichen (z.B. Nebelschallanla-<br />
gen),<br />
• funktechnische Schifffahrtszeichen (z.B. Nautischer<br />
Informationsfunk).<br />
Betrieb von Schifffahrtsanlagen<br />
Zu den Schifffahrtsanlagen gehören die Schleusen,<br />
Schiffshebewerke, Pumpwerke <strong>und</strong> Sicherheitstore. Diese<br />
Anlagen sind vor Ort zum Teil mit Betriebspersonal besetzt,<br />
das im Schichtbetrieb tätig ist.<br />
Besondere Bedeutung kommt der Revier- <strong>und</strong> Betriebszentrale<br />
Minden zu. In dieser ständig besetzten Zentrale<br />
werden verschiedene Betriebsaufgaben <strong>und</strong> Dienste für<br />
die Schifffahrt aus dem Bereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong> gebündelt wahrgenommen:<br />
Instandsetzung Schachtschleuse Minden<br />
Schifffahrtszeichen am <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
• <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung des <strong>Mitte</strong>llandkanals <strong>und</strong> des<br />
Elbe-Seitenkanals mit der Fernbedienung <strong>und</strong> Fern-<br />
überwachung von Pumpwerken,<br />
• Fernbedienung <strong>und</strong> -überwachung der Sicherheitstore<br />
am <strong>Mitte</strong>llandkanal <strong>und</strong> am Elbe-Seitenkanal,<br />
• Fernüberwachung der Wehre der <strong>Mitte</strong>lweser <strong>und</strong> der<br />
unteren Fulda,<br />
• Notfallmeldestelle,<br />
• Nautischer Informationsfunk (NIF) für <strong>Mitte</strong>llandkanal,<br />
Elbe-Seitenkanal <strong>und</strong> <strong>Mitte</strong>lweser.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
5
6<br />
Die Einrichtung eines Melde- <strong>und</strong> Informationssystems<br />
Binnenschifffahrt (MIB) für Gefahrgutschiffe befindet sich<br />
in der Vorbereitung.<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter Braunschweig, Verden<br />
<strong>und</strong> Minden planen <strong>und</strong> realisieren zur Zeit gemeinsam<br />
mit der Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong> im Rahmen eines<br />
b<strong>und</strong>esweiten Programms die Automatisierung <strong>und</strong><br />
Fernbedienung der Schleusen ihres Zuständigkeitsbereiches.<br />
Hierzu wurden an der Schleuse Anderten bei Hannover,<br />
an der Schleuse Wedtlenstedt am Stichkanal Salzgitter<br />
<strong>und</strong> im Dienstgebäude des WSA Minden sog. Fernbedienzentralen<br />
eingerichtet. An den jeweils angeschlossenen<br />
Schleusen wird kein Betriebspersonal mehr vor Ort<br />
eingesetzt, sondern die Schleusen werden durch Schichtleiter<br />
von den Fernbedienzentralen aus fernbedient.<br />
Schifffahrtswesen<br />
Hier obliegen der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>und</strong> ihren nachgeordneten<br />
Ämtern u.a. folgende Aufgaben:<br />
• die Förderung der Binnenflotte <strong>und</strong> des Binnenschiffsverkehrs<br />
sowie das Führen von Binnenschiff-<br />
fahrtsstatistiken,<br />
• die Verhütung der von der Schifffahrt ausgehenden<br />
Gefahren <strong>und</strong> schädlichen Umwelteinwirkungen im<br />
Sinne des B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetzes,<br />
• die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Schiffsverkehr,<br />
• die Verkehrsregelung, Verkehrsberatung <strong>und</strong> Verkehrsunterstützung<br />
auf den <strong>Wasser</strong>straßen,<br />
• die schifffahrtspolizeiliche Genehmigung von Sondertransporten<br />
sowie von Veranstaltungen auf den Was-<br />
serstraßen,<br />
• die Ausstellung von Befähigungszeugnissen (Patenten),<br />
• die Ausstellung von Schifferdienstbüchern <strong>und</strong> Ölkontrollbüchern,<br />
• die Ausstellung von Kennzeichen für Kleinfahrzeuge.<br />
Die schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben werden<br />
nach zwischen dem B<strong>und</strong> <strong>und</strong> den Ländern abgeschlossenen<br />
Vereinbarungen durch die <strong>Wasser</strong>schutzpolizeien<br />
der Länder ausgeübt.<br />
Gewässerk<strong>und</strong>e <strong>und</strong><br />
<strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
Aufgabe ist die Beschaffung von Daten über die Gewässer<br />
<strong>und</strong> ihre <strong>Wasser</strong>führung, sofern <strong>und</strong> soweit diese für die<br />
Schifffahrt Bedeutung haben oder aber für Bau-, Betriebs-<br />
<strong>und</strong> Unterhaltungsbelange der <strong>Wasser</strong>straßen benötigt<br />
werden.<br />
Hierzu sind folgende Daten – insbesondere zur Beobachtung<br />
der Gewässermorphologie – notwendig:<br />
• Gewässerquerschnitte mit Form <strong>und</strong> Beschaffenheit<br />
der Gewässersohle,<br />
• Geschiebebewegungen,<br />
• Abflussprofile,<br />
• <strong>Wasser</strong>stände, Fließgeschwindigkeiten, Abflussmengen,<br />
• Luft- <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>temperatur,<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Fernbedienzentrale Minden<br />
• Windstärke, Windrichtung, <strong>Wasser</strong>standsänderungen<br />
infolge Windstau.<br />
Die <strong>Wasser</strong>stände der Fließgewässer werden an gewässerk<strong>und</strong>lichen<br />
Pegeln ständig beobachtet. An den Kanälen<br />
wird die Einhaltung der zulässigen <strong>Wasser</strong>spiegelschwankungen<br />
durch Betriebspegel überwacht. Der Ausgleich der<br />
<strong>Wasser</strong>verluste aus dem Schleusenbetrieb, aus Verdunstung<br />
<strong>und</strong> Versickerung sowie infolge von <strong>Wasser</strong>entnahmen<br />
für Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft erfolgt durch den Betrieb<br />
von Pumpwerken.<br />
Darüber hinaus unterhält die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
im Benehmen mit den jeweiligen Landesbehörden<br />
einen <strong>Wasser</strong>stands- <strong>und</strong> Hochwassermeldedienst.<br />
Pegel Hann. Münden
Strompolizeiliche Aufgaben<br />
Zur Gefahrenabwehr hat die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsverwaltung Maßnahmen zu treffen,<br />
um die B<strong>und</strong>eswasserstraßen in einem für die<br />
Schifffahrt erforderlichen Zustand zu halten. Sie<br />
umfasst insbesondere die Beseitigung von<br />
Schifffahrtshindernissen sowie die Bearbeitung<br />
von in diesem Zusammenhang notwendig werdenden<br />
strompolizeilichen Verfügungen.<br />
Dritte, d.h. Einzelpersonen, Firmen <strong>und</strong> andere<br />
Behörden benötigen für die Benutzung der<br />
B<strong>und</strong>eswasserstraßen oder für die Errichtung,<br />
die Veränderung <strong>und</strong> den Betrieb von Anlagen<br />
in, über oder unter einer B<strong>und</strong>eswasserstraße<br />
oder an ihrem Ufer eine sog. strom- <strong>und</strong> schifffahrtspolizeiliche<br />
Genehmigung. Durch Bedingungen<br />
<strong>und</strong> Auflagen in diesen Genehmigungen<br />
wird eine Beeinträchtigung des für die<br />
Schifffahrt erforderlichen Zustands der <strong>Wasser</strong>straße<br />
oder der Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des<br />
Verkehrs verhütet oder ausgeglichen.<br />
Wahrnehmung der Eigentümerinteressen<br />
(Liegenschaftsverwaltung)<br />
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen einschl. angrenzender Ufergr<strong>und</strong>stücke<br />
<strong>und</strong> Betriebsgelände sind privatrechtliches<br />
Eigentum der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland im Sinne des<br />
Bürgerlichen Rechts. Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter<br />
vertreten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Eigentümerinteressen<br />
des B<strong>und</strong>es. Die damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Aufgaben umfassen die Gr<strong>und</strong>stücksbewertung, den<br />
Gr<strong>und</strong>stücksverkehr sowie die Abwicklung von Verträgen<br />
mit Dritten. So hat jedes <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt mit<br />
einer Vielzahl von Nutzern der b<strong>und</strong>eseigenen Liegenschaften<br />
<strong>und</strong> Ufergr<strong>und</strong>stücke Gestattungs- <strong>und</strong> Nutzungsverträge<br />
abgeschlossen.<br />
Aus- <strong>und</strong> Neubau von B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
einschließlich Planfeststellung<br />
Beim Ausbau handelt es sich um Maßnahmen zur<br />
wesentlichen Umgestaltung einer B<strong>und</strong>eswasserstraße,<br />
eines oder beider Ufer, die über die Unterhaltung<br />
hinausgehen <strong>und</strong> die B<strong>und</strong>eswasserstraße<br />
als Verkehrsweg betreffen. Bei dem Neubau oder<br />
Ausbau einer B<strong>und</strong>eswasserstraße sind in Linienführung<br />
<strong>und</strong> Bauweise das Bild <strong>und</strong> die Erholungseignung<br />
der Gewässerlandschaft sowie die<br />
Erhaltung <strong>und</strong> Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens<br />
des Gewässers zu beachten <strong>und</strong><br />
die natürlichen Lebensgr<strong>und</strong>lagen zu bewahren.<br />
Aus- <strong>und</strong> Neubau von B<strong>und</strong>eswasserstraßen bedürfen<br />
vorab der Planfeststellung. Anhörungs- <strong>und</strong><br />
Planfeststellungsbehörde ist die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion.<br />
Die Neu- <strong>und</strong> Ausbauvorhaben werden über öffentliche<br />
Ausschreibungen vergeben <strong>und</strong> durch<br />
geeignete Fachunternehmen der Bauwirtschaft<br />
ausgeführt. Den Dienststellen der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Streckenausbau „Niedersachsen 2b“ mit Wendestelle, Liegestelle <strong>und</strong> Allerentlaster I<br />
Schifffahrtsverwaltung obliegt hierbei die Fachplanung, die<br />
Entwurfsaufstellung <strong>und</strong> Entwurfsprüfung, die Ausschreibung<br />
<strong>und</strong> Vergabe sowie die Überwachung <strong>und</strong> Abrechnung<br />
der Bauarbeiten.<br />
Im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> befinden sich folgende Neu-<br />
<strong>und</strong> Ausbauvorhaben in der Planung bzw. in der Ausführung:<br />
• Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals zwischen Sülfeld <strong>und</strong><br />
Magdeburg im Rahmen des Projektes 17 der Verkehrsprojekte<br />
Deutsche Einheit,<br />
• Ausbau der Stichkanäle Osnabrück, Hannover-<br />
Linden, Hannover-Misburg <strong>und</strong> Hildesheim,<br />
• Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser zwischen Minden <strong>und</strong><br />
Bremen,<br />
• Neubau von Schleusen. Die Schleuse Uelzen II ist<br />
weitgehend fertiggestellt <strong>und</strong> wird im Herbst 2006 in<br />
Betrieb genommen. Die Schleuse Sülfeld befindet<br />
sich in der Bauausführung, neue Schleusen in Bolzum,<br />
Minden <strong>und</strong> Dörverden in der Bauplanung.<br />
Neubau Schleuse Sülfeld<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
7
8<br />
� 100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
Präsentation des Sonderpostenwertzeichens<br />
(v.l.: Minister Hirche, Prof. Schröder,<br />
Staatssekretäre Diller <strong>und</strong> Nagel<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Nachrichten<br />
Festveranstaltung in Hannover am<br />
5. April <strong>2005</strong>,<br />
Vorstellung <strong>und</strong> Übergabe des<br />
Sonderpostwertzeichens<br />
„100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal“<br />
<strong>und</strong> weitere regionale Veranstaltungen<br />
Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal“ fand am<br />
5. April <strong>2005</strong> im MARITIM Stadthotel in Hannover eine Festveranstaltung<br />
mit rd. 500 Gästen statt. Der Staatssekretär im B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Verkehr, Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Ralf Nagel, hielt<br />
die Festansprache.<br />
Staatssekretär Nagel hob in seiner Festrede die Bedeutung<br />
des <strong>Mitte</strong>llandkanals als Teil der West-Ost-Magistrale<br />
vom Rhein bis nach Berlin hervor: „Mit dem <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
ist ein zentraler Teil des deutschen <strong>Wasser</strong>straßennetzes<br />
entstanden, der heute nicht mehr wegzudenken ist.<br />
Über 20 Mio. Tonnen Güter, in erster Linie Massengüter<br />
<strong>und</strong> mehr <strong>und</strong> mehr zunehmend Containertransporte, werden<br />
so kostengünstig, umweltfre<strong>und</strong>lich <strong>und</strong> leise transportiert.“<br />
Die <strong>Wasser</strong>straßen sind ein notwendiger Bestandteil<br />
in einem modernen, leistungsfähigen Verkehrsnetz, welches<br />
die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärkt <strong>und</strong><br />
Flachwasserzone bei Mannhausen<br />
damit Voraussetzung für eine gut funktionierende Volkswirtschaft<br />
ist.<br />
Vor 100 Jahren wurde mit dem preußischen <strong>Wasser</strong>gesetz vom 1. April 1905 der Bau des westlichen Teilstücks des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
(MLK) zwischen Bergeshövede <strong>und</strong> Hannover (damals Ems-Weser-Kanal) sowie der Bau von Eder- <strong>und</strong> Diemeltalsperre<br />
beschlossen. Der MLK ist 325 km lang, zweigt bei<br />
Bergeshövede aus dem Dortm<strong>und</strong>-Ems-Kanal in Richtung Osten ab<br />
<strong>und</strong> endet an der Doppelschleuse Hohenwarthe östlich der Elbe am<br />
<strong>Wasser</strong>straßenkreuz Magdeburg. Diese durchgehende, vom <strong>Wasser</strong>stand<br />
der Weser <strong>und</strong> der Elbe unabhängige <strong>Wasser</strong>straßenverbindung<br />
wurde in den letzten 100 Jahren schrittweise realisiert, zuletzt<br />
mit der Fertigstellung der Kanalbrücke über die Elbe im Zuge<br />
des Verkehrsprojektes Nr. 17 Deutsche Einheit. „Nicht zuletzt in<br />
diesem Zusammenhang kann die Kanalbrücke über die Elbe als<br />
Jahrh<strong>und</strong>ertbauwerk bezeichnet werden, <strong>und</strong> zwar als technische,<br />
architektonische <strong>und</strong> in die Landschaft angepasste Meisterleistung<br />
<strong>und</strong> in ihrer Symbolkraft für die Vollendung der deutschen Einheit“,<br />
so Nagel.<br />
Aus Anlass des 100. Geburtstages des MLK hat das B<strong>und</strong>esministerium<br />
der Finanzen ein Sonderpostwertzeichen herausgeben. Als<br />
Motiv zeigt es die Kanalbrücke des MLK über die Elbe. Es wurde<br />
Sonderpostwertzeichen mit Ersttagsstempel Berlin <strong>und</strong> Bonn von dem Grafiker Jochen Bertholdt aus Rostock gestaltet <strong>und</strong> hat<br />
einen Wert von 45 Cent.
Nachrichten<br />
Der Parlamentarische Staatssekretär beim B<strong>und</strong>esministerium der<br />
Finanzen, Karl Diller, stellte das Sonderpostwertzeichen in der<br />
Festveranstaltung vor. Weitere Grußworte sprachen Walter Hirche,<br />
Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit <strong>und</strong> Verkehr,<br />
Heinz Hofmann, Präsident des B<strong>und</strong>esverbandes der Deutschen<br />
Binnenschifffahrt e.V. <strong>und</strong> Dr. Rolf Bender, Präsident des B<strong>und</strong>esverbandes<br />
der öffentlichen Binnenhäfen e.V. <strong>und</strong> Dr. Wilfried<br />
Prewo, Hauptgeschäftsführer der Industrie- <strong>und</strong> Handelskammer<br />
Hannover.<br />
Über diese Festveranstaltung hinaus wurden im Jahr <strong>2005</strong> entlang<br />
des MLK durch die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter Minden <strong>und</strong><br />
Braunschweig, die Neubauämter Hannover <strong>und</strong> Helmstedt Führungen<br />
<strong>und</strong> Besichtigungen verschiedenster Bauwerke <strong>und</strong> Bauprojekte<br />
durchgeführt. Schwerpunktaktionen fanden dabei im Bereich<br />
des <strong>Wasser</strong>straßenkreuzes Minden statt. Die interessierte<br />
Öffentlichkeit<br />
hatte<br />
Führung durch das WNA Helmstedt<br />
Bauhofes darzustellen. Am „Tag des offenen Denkmals“ präsentierte<br />
sich der Außenbezirk Thune mit der Schleuse Wedtlenstedt. Hierbei<br />
hatten die Besucher auch die Möglichkeit bei der Besichtigung der<br />
Schleuse in die trockengelegte Schleusenkammer zu steigen. Das<br />
Neubauamt für den Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover stellte in<br />
der Zeit von Mai bis Oktober <strong>2005</strong> fünfmal ihr Schleusenneubauprojekt<br />
Sülfeld-Süd vor Ort der Bevölkerung vor. Nach fachk<strong>und</strong>iger Einführung<br />
in das Neubauprojekt konnten die Besucher „hautnah“ die Baustelle<br />
besichtigen <strong>und</strong> wurden dabei über tagesaktuelle Baufortschritte<br />
informiert. Im Bereich des <strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamtes Helmstedt<br />
wurden zwei Ersatz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen am MLK der Öffentlichkeitvorgestellt<br />
<strong>und</strong> erläutert.<br />
Zum einen<br />
handelte es sich<br />
Bauhof Anderten: Interessierte Gäste beim Tag der<br />
offenen Tür<br />
Erläuterungen im Informationszentrum<br />
die Möglichkeit, an fünf Führungen im Informationszentrum, an der Kanalbrücke<br />
über die Weser, der Schachtschleuse <strong>und</strong> dem Hauptpumpwerk<br />
Minden teilzunehmen. Die Resonanz war teilweise so groß, dass -<br />
um den vielen Teilnehmern gerecht zu werden - die Führungen um Besichtigungen<br />
der Fernbedienzentrale für Schleusen <strong>und</strong> der Revier- <strong>und</strong><br />
Betriebszentrale Minden ausgeweitet wurden. Ein größeres Hafenfest<br />
am Oberen Vorhafen der Schachtschleuse stand ganz unter dem Motto<br />
“100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal“. Das WSA Braunschweig führte vier Gästeführungen<br />
auf der Hindenburgschleuse in Anderten durch. Daneben<br />
wurden in der Stadtstrecke Hannover in Kombination mit<br />
der Fahrgastschifffahrt vier Themenfahrten „Brücken im Stadtgebiet“<br />
unter fachk<strong>und</strong>iger Betreuung durchgeführt. Der Bauhof Anderten veranstaltete<br />
einen „Tag der offenen Tür“ um der interessierten Öffentlichkeit<br />
die Zuständigkeiten<br />
<strong>und</strong><br />
Aufgaben der<br />
WSV sowie des<br />
Bauhof Anderten: Besichtigung des Taucherschiffes<br />
um die Ersatzmaßnahme „Allerwiesen“ bei Wolfsburg. Hierbei wurde<br />
über Planung, Herstellung <strong>und</strong> Pflege sowie über die einzelnen Biotoptypen<br />
informiert <strong>und</strong> aufgeklärt. Zum anderen wurde die Ausgleichsmaßnahme<br />
„Flachwasserzone bei Mannhausen“ vorgestellt. Neben detaillierten<br />
<strong>Informationen</strong> von der Planung bis zur Pflege wurden hier die<br />
vorkommenden Vogelarten vorgestellt.<br />
Alle Veranstaltungen wurden vorab durch Veröffentlichungen in den regionalen<br />
Tageszeitungen angekündigt; nach den Veranstaltungen folgten<br />
weitere Berichte. Sämtliche Veranstaltungen erfreuten sich großer<br />
Beliebtheit. So haben mehr als 2.000 Besucherinnen <strong>und</strong> Besucher die<br />
Bauwerke <strong>und</strong> Anlagen im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> besucht <strong>und</strong> kennen<br />
gelernt. Dieser Erfolg war nur durch das besondere Engagement der<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter der Dienststellen möglich.<br />
Ihnen sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
9
10<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Nachrichten<br />
� Staatssekretär Ralf Nagel zu Besuch bei der Sonderstelle für<br />
Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />
Aufmerksame Zuhörer<br />
programm der SAF. Anschließend präsentierte die Leiterin<br />
der SAF, Angela Pleban, die Neukonzipierung des<br />
Führungskräftetrainings der WSV. Hierbei wurden den<br />
Gästen die Herleitung, die SOLL-Anforderungen <strong>und</strong> die<br />
geplante Neuausrichtung des Schulungskonzeptes vorgestellt.<br />
Im Anschluss an diese <strong>Informationen</strong> fand mit den Vertretern<br />
der Fachreferate aus dem B<strong>und</strong>esministerium für<br />
Verkehr, Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, den Leitern der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter, der Personalvertretung,<br />
der Gleichstellungsbeauftragten <strong>und</strong> der Schwerbehindertenvertretung<br />
sowie den Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeitern<br />
der SAF ein anregender Meinungsaustausch<br />
statt.<br />
� Wechsel in der Leitung des Dezernates<br />
Haushalt/Controlling<br />
Am 11. Januar <strong>2005</strong> besuchte der damalige<br />
Staatssekretär im B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr,<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Ralf Nagel, die Sonderstelle<br />
für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung (SAF) der <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung (WSV) in<br />
Hannover.<br />
Anlass seines Besuches war die Präsentation der<br />
Neukonzipierung des Führungskräftetrainings<br />
durch die SAF. Der ehemalige Leiter der SAF,<br />
Gunther Jenner, berichtete über die Entwicklung<br />
der Aus- <strong>und</strong> Fortbildung <strong>und</strong> das aktuelle Jahres-<br />
Angela Pleban präsentiert ihr neues Konzept<br />
Am 1. Mai <strong>2005</strong> hat der Leiter des Dezernates Haushalt <strong>und</strong> Controlling, Ltd. Vermessungsdirektor<br />
Hans-Joachim Strauß, seine Freistellungsphase<br />
der Altersteilzeit angetreten. Strauß kann<br />
auf eine mehr als 33-jährige Tätigkeit in der <strong>Wasser</strong><strong>und</strong><br />
Schifffahrtsverwaltung zurückblicken. Stationen seines<br />
beruflichen Lebensweges waren u.a. das Neubauamt<br />
Minden, wo er als Sachbereichsleiter tätig war, <strong>und</strong><br />
die <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>, wo er langjährig die Dezernate für Vermessungswesen<br />
leitete. Am 1. Februar 1998 übernahm<br />
er die Leitung des Dezernates Haushalt <strong>und</strong> Controlling.<br />
Mit Strauß verliert die <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> einen anerkannten<br />
Fachmann, der sich als Vermessungsingenieur in das<br />
Hans-Joachim Strauß<br />
für ihn zunächst fremde Aufgabengebiet des Controllings<br />
hervorragend eingearbeitet hat.<br />
Matthias Bromm In der Nachfolge hat Oberregierungsrat Matthias Bromm die Leitung des Dezernates übernommen.<br />
Bromm war bereits als Sachbearbeiter <strong>und</strong> stellvertretender Dezernatsleiter in diesem<br />
Fachgebiet tätig.
Nachrichten<br />
� B<strong>und</strong>esverdienstkreuz für Karl-Heinz Schade<br />
Der Herr B<strong>und</strong>espräsident hat dem Vermessungsingenieur <strong>und</strong> ehemaligen Vorsitzenden<br />
der Personalvertretung beim Neubauamt (NBA) für den Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover,<br />
Karl-Heinz Schade, in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das Allgemeinwohl<br />
am 1. Juni <strong>2005</strong> das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland verliehen.<br />
Herr Schade setzt sich seit mehr als drei Jahrzehnten in vorbildlicher Weise ehrenamtlich für<br />
den Segelsport ein. 1965 wurde er Mitglied im Segler-Verein Großenheidorn am Steinhuder<br />
Meer <strong>und</strong> übernahm hier bereits 1968 Verantwortung im Vorstand. Bis 1978 war er 2. Vorsitzender,<br />
von 1978 bis 1982 Sportwart <strong>und</strong> von 1982 bis 1994 1. Vorsitzender des Vereins.<br />
Das Wirken des Geehrten für den Segler-Verein Großenheidorn hat den Segelsport am<br />
Steinhuder Meer entscheidend geprägt. Herr Schade war Initiator für die Ausrichtung der Jugendeuropameisterschaft<br />
der 420er Klasse sowie Wettfahrtleiter vieler Deutscher Meisterschaften,<br />
die der Verein ausrichtete. Darüber hinaus fungierte Herr Schade seit 1971 als<br />
Wettfahrtleiter großer internationaler Regatten. Von 1973 bis 2003 engagierte er sich als Mitglied von Wettfahrtleitungen<br />
während der Kieler Woche <strong>und</strong> zeitweise auch während der Travemünder Woche.<br />
Hervorzuheben ist ebenfalls die Tätigkeit des Herrn Schade im Segler-Verband Niedersachsen. So übte er von 1979 bis<br />
1985 die Funktion des Jugendwartes aus. Zudem arbeitete er hier lange Jahre als Lehrwart <strong>und</strong> war bis 2002 Referent für<br />
Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Auch im Deutschen Segler-Verband war er aktiv. Von 1971 gehörte er dem Vorstand der 420er Klassenvereinigung<br />
Deutschland an <strong>und</strong> war von 1976 bis 1981 deren Präsident. Zudem war er von 1976 bis 1982 Mitglied im Ausschuss der<br />
Klassenvereinigung, von 1979 bis 1986 im Jugendsegelausschuss <strong>und</strong> von 1995 bis 1999 im Leistungsausschuss tätig.<br />
1989 erhielt er die "Goldene Ehrennadel" des Deutschen Segler-Verbandes unter anderem für sein Engagement in der<br />
Jugendarbeit. 1985 wurde er in den Seglerrat des Deutschen Segler-Verbandes gewählt, dem er bis 1997 angehörte.<br />
1997 übernahm Herr Schade den Vorsitz der Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer <strong>und</strong> führte sie mit einer veränderten<br />
Organisation <strong>und</strong> moderner Satzung durch finanziell schwierige Phasen zukunftssichernd in das neue Jahrtausend. Zudem<br />
setzte er sich intensiv für ein vereinsübergreifendes Jugendtraining für Regattasegler ein. <strong>2005</strong> stellte er sich nicht<br />
mehr zur Wahl <strong>und</strong> wurde von den Delegierten der 24 Segelvereine am Steinhuder Meer zu ihrem Ehrenvorsitzenden gewählt.<br />
In die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung des B<strong>und</strong>es ist Herr Schade am 1. September 1957 eingetreten. Hier war er zunächst<br />
als Vermessungsingenieur beim NBA Mosel-Ost in Koblenz für den Ausbau der Mosel zur Großschifffahrtsstraße<br />
eingesetzt. Mit der Beendigung der dortigen Baumaßnahmen wurde Herr Schade Anfang 1965 in den Zuständigkeitsbereich<br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion (<strong>WSD</strong>) <strong>Mitte</strong> versetzt. Hier war er bei verschiedenen Ortsbehörden, zuletzt<br />
beim NBA Hannover, mit Vermessungs- <strong>und</strong> Liegenschaftsaufgaben für den Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals betraut. Herr<br />
Schade ist nach einer mehr als 35-jährigen Tätigkeit in der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung am 31.12.1992 in den Ruhestand<br />
getreten.<br />
Neben seiner eigentlichen Tätigkeit als Vermessungsingenieur hat sich Herr Schade in besonderem Maße für die Beschäftigten<br />
eingesetzt. So war er von 1968 bis 1992 Mitglied der Personalvertretung seiner jeweiligen Dienststelle, wobei er die<br />
überwiegende Zeit zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt war. Von 1972 bis 1992 war er zusätzlich Mitglied des Bezirkspersonalrats<br />
(BPR) bei der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>.<br />
Im BPR hat sich Herr Schade insbesondere für das Personal der Neubauämter Osnabrück, Minden, Hannover, Braunschweig<br />
<strong>und</strong> Helmstedt eingesetzt. Neben der Vertretung der berechtigten Interessen der Beschäftigten hat Herr Schade<br />
aber auch die Anliegen der Verwaltung angemessen berücksichtigt <strong>und</strong> im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit<br />
zwischen Personalvertretung <strong>und</strong> Dienststelle zu einem Interessenausgleich wesentlich beigetragen. Besonders zu erwähnen<br />
ist in diesem Zusammenhang sein Einsatz im Zuge der Einrichtung des <strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamtes (WNA)<br />
Helmstedt in den Jahren 1991/92. Nach der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands wurde die Oststrecke des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
in Sachsen-Anhalt dem Zuständigkeitsbereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> zugeordnet. Für die Maßnahmen zum Ausbau<br />
des <strong>Mitte</strong>llandkanals zwischen Wolfsburg <strong>und</strong> Magdeburg wurde im April 1992 ein WNA in Helmstedt eingerichtet. Herr<br />
Schade, damals Personalratsvorsitzender des NBA Hannover <strong>und</strong> erweitertes Vorstandsmitglied für Neubaufragen im<br />
BPR, hat die Planungen zur Einrichtung <strong>und</strong> zum Aufbau des neuen Amtes begleitet <strong>und</strong> die Beschäftigten solange als<br />
Personalrat betreut, bis in der neu eingerichteten Dienststelle Wahlen nach dem BPersVG durchgeführt werden konnten<br />
<strong>und</strong> die dann zuständige örtliche Personalvertretung seine Aufgaben übernommen hat. Erschwerend kam in dieser Zeit<br />
hinzu, dass die damals noch bestehende Außenstelle Braunschweig des NBA Hannover aufzulösen war <strong>und</strong> die Beschäftigten<br />
in das NBA Hannover bzw. in das neu gegründete WNA Helmstedt zu integrieren waren. Herr Schade hat diese zusätzliche<br />
Tätigkeit in den Monaten vor seinem Eintritt in den Ruhestand mit sehr viel Fleiß <strong>und</strong> persönlichem Engagement<br />
- auch außerhalb seiner regulären Arbeitszeit <strong>und</strong> unter Rückstellung privater Interessen - wahrgenommen.<br />
Das Verdienstkreuz wurde Herrn Schade am 13. Juli <strong>2005</strong> durch den Präsidenten der Region Hannover, Herrn Dr. Michael<br />
Arndt, feierlich ausgehändigt. Für die <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> überbrachten Karl-Heinz Kuhlmann (BPR-Vorsitzender), Lutz Weber (PR-<br />
Vorsitzender des WNA Helmstedt) <strong>und</strong> Reinhard Henke (Dezernatsleiter A) Glückwünsche zu dieser hohen Auszeichnung.<br />
Auch das Redaktionsteam dieser Informationsschrift gratuliert Herrn Karl-Heinz Schade ganz herzlich.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
11
12<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Nachrichten<br />
� Teilnahme am 2. Herz-Kreis-LAUF in Hannover<br />
Am 10. Juli <strong>2005</strong> fand der<br />
2. Herz-Kreis-LAUF um den<br />
Maschsee in Hannover statt.<br />
Ausrichter dieser Veranstaltung<br />
war die Kaufmännische Krankenkasse<br />
Hannover. Die<br />
Schirmherrschaft hatte der ehemalige<br />
Olympiasieger über<br />
5.000 m (1992), Dieter<br />
Baumann, übernommen. Mehr<br />
als 1.300 Aktive nahmen an dieser<br />
b<strong>und</strong>esweiten Präventionskampagne<br />
der Krankenkassen<br />
teil. Es wurden für alle Aktiven<br />
ein Vielzahl an Disziplinen <strong>und</strong><br />
Strecken angeboten. Bei dem<br />
6,2-km-Firmenlauf starteten<br />
30 Teams aus hannoverschen<br />
Unternehmen mit jeweils mindestens<br />
vier Läufern. Für die<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> gingen Volker Klose,<br />
Uwe Jansohn, Holger Isermann,<br />
v.l. Volker Klose, Martin Köther, Holger Isermann, Uwe Jansohn, Thilo Wachholz<br />
Thilo Wachholz <strong>und</strong> Martin<br />
Köther im Firmenlauf an den<br />
Start. Unser Team hat tapfer gekämpft <strong>und</strong> einen Ehrenplatz im breiten <strong>Mitte</strong>lfeld erreicht. Mehr als 7.000 Zuschauer haben<br />
die Sportlerinnen <strong>und</strong> Sportler angefeuert. Der Erlös aus Startgeldern, Tombola <strong>und</strong> Spenden in Höhe von 7.500 Euro<br />
wurde der BILD-Aktion „Ein Herz für Kinder“ zugeführt.<br />
Wir drücken unserem Team für den 28. Mai 2006 erneut die Daumen!<br />
� Pressegespräch<br />
an der<br />
Schleuse Sülfeld<br />
Am 15. August <strong>2005</strong> hatte der B<strong>und</strong>estagsabgeordnete<br />
Hans-Jürgen<br />
Uhl zu einem Pressegespräch an<br />
die Schleuse Sülfeld eingeladen.<br />
Gäste dieser Veranstaltung waren<br />
die damalige Parlamentarische<br />
Staatssekretärin im B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Verkehr, Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen,<br />
Angelika Mertens <strong>und</strong><br />
die Bürgermeisterin der Stadt<br />
Wolfsburg, Hiltrud Jeworrek.<br />
Die Gäste wurden von Volker Keitel,<br />
Referatsleiter Management der Binnenwasserstraßen<br />
beim B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Verkehr, Bau- <strong>und</strong><br />
Wohnungswesen, Hubert Kindt, Dezernatsleiter<br />
Regionales Management<br />
bei der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong> <strong>und</strong> Dieter<br />
v.l. Saathoff, Kindt, Jeworrek, Sts. Mertens, MdB Uhl, Keitel<br />
Eichler, Leiter des Neubauamtes (NBA) für den Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals, begrüßt. Joachim Saathoff, Sachbereichsleiter<br />
beim NBA Hannover, informierte die Gäste <strong>und</strong> die Pressevertreter gr<strong>und</strong>legend <strong>und</strong> vielseitig über den Neubau der<br />
Schleuse Sülfeld-Süd.<br />
Im Anschluss wurde bei der Besichtigung der Baustelle ein reger Dialog zwischen den Vertretern der Politik, der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> der Presse geführt. Hierbei wurde ausführlich auf die Bedeutung des Verkehrsträgers <strong>Wasser</strong>straße <strong>und</strong> die<br />
Wirtschaftlichkeit der Binnenschifffahrt eingegangen.
Nachrichten<br />
� Gr<strong>und</strong>steinlegung für den Neubau des Aller-Wehres in<br />
Marklendorf<br />
Am 28. Juni <strong>2005</strong> wurde unter regionaler Beteiligung von Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Vereinen <strong>und</strong> Verbänden<br />
sowie von Nutzern der B<strong>und</strong>eswasserstraße Aller der offizielle Startschuss zum Neubau des Wehres Marklendorf<br />
gegeben.<br />
Das <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
(WSA) Verden hat<br />
Anfang <strong>2005</strong> den Auftrag zur<br />
Errichtung der neuen Wehranlage<br />
an die Arbeitsgemeinschaft<br />
Wehr Marklendorf, bestehend<br />
aus den Bauunternehmen<br />
Martin Oetken GmbH<br />
& Co.KG, Oldenburg <strong>und</strong><br />
Gebrüder Neumann GmbH &<br />
Co.KG, Emden, erteilt.<br />
Die symbolische „Gr<strong>und</strong>steinlegung“<br />
wurde durch Herrn<br />
Prof. Dierk Schröder, Präsident<br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong>, Herrn Thomas<br />
Rumpf, Leiter des WSA<br />
Verden, Herrn Dr. Karl-Ludwig<br />
von Danwitz, Stellvertreter des<br />
Landrates des Landkreises<br />
Soltau-Fallingbostel, Herrn<br />
Björn Gehrs, Bürgermeister der<br />
Gemeinde Buchholz <strong>und</strong> Herrn<br />
Uwe Höpfner, Stellvertr. Abt.-<br />
Leiter der Martin Oetken<br />
GmbH, durchgeführt.<br />
v.l. Dr. Karl-Ludwig von Danwitz, Björn Gehrs, Prof. Dierk Schröder, Thomas Rumpf<br />
Die Staustufe Marklendorf ist<br />
die 3. Staustufe unterhalb von<br />
Celle <strong>und</strong> besteht wie jede der<br />
vier Aller-Staustufen aus einer Wehr- <strong>und</strong> einer Schleusenanlage sowie einer Sportbootumtragestelle <strong>und</strong> einer Fischwanderhilfe.<br />
Das Wehr Marklendorf wurde in den Jahren 1913 – 1915 gebaut. Die Nutzungsdauer des Massivbaus aus Klinker <strong>und</strong><br />
Stampfbeton war mit 90 Jahren erreicht. Die Nutzungsdauer des Stahlwasserbaus von 70 Jahren wurde deutlich überschritten.<br />
Die für die Aufrechterhaltung des Stauzieles erforderliche Stand- <strong>und</strong> Betriebssicherheit der Wehranlage war<br />
kaum mehr gegeben.<br />
In den 90er Jahren wurde als Alternative zu den sich ankündigenden Baumaßnahmen die Möglichkeit einer Staulegung aller<br />
vier Wehre detailliert geprüft. Nach sehr umfangreichen Untersuchungen - auch in wasserwirtschaftlicher <strong>und</strong> naturschutzfachlicher<br />
Sicht - entschied sich die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung des B<strong>und</strong>es 1997 in enger Abstimmung mit<br />
dem Land Niedersachsen für den Erhalt der Staustufen.<br />
Das neue Wehr besteht aus zwei gleichgroßen Wehrfeldern, die wenige Meter unterhalb direkt auf der Sohle des heutigen<br />
Altwehres hergestellt werden. Als Verschlusskörper werden mit <strong>Wasser</strong> gefüllte Schlauchverschlüsse eingesetzt. Die<br />
Schlauchmembran besteht aus einem gewebeverstärkten Elastomer. Die Steuerung der Verschlüsse erfolgt hydraulisch<br />
nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren.<br />
Damit während der Bauzeit in Marklendorf ein mögliches Sommerhochwasser gefahrlos abfließen kann, müssen die beiden<br />
neuen Wehrfelder nacheinander in zwei Bauabschnitten hergestellt werden. So ist sichergestellt, dass immer ein<br />
Wehrfeld <strong>und</strong> das <strong>Wasser</strong>kraftwerk zusammen die anfallenden <strong>Wasser</strong>mengen abführen können.<br />
Um Risiken für die Bauabwicklung durch die Winter- <strong>und</strong> Hochwasserzeit entsprechend auszuschließen, werden die Baustellentätigkeiten<br />
auf die Monate April bis Oktober zeitlich beschränkt. Die Inbetriebnahme des neuen Wehres ist Ende<br />
2006 geplant. Anschließend wird das alte Wehr abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt ist auch vorgesehen, den nach neuesten<br />
ökologischen Erkenntnissen geplanten Fischpass in Betrieb zu nehmen.<br />
Das Bauvolumen beläuft sich einschließlich der Herstellung des Fischpasses auf r<strong>und</strong> 3,3 Millionen Euro.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
13
14<br />
v.l.: Prof. Dierk Schröder, Helmut Trapp<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Nachrichten<br />
� Helmut Trapp im Ruhestand<br />
Am 27. April <strong>2005</strong> wurde der langjährige Leiter des <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamtes<br />
Uelzen, Ltd. Baudirektor Dipl.-Ing. Helmut Trapp, vom Präsidenten<br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>, Prof. Dipl.-Ing. Dierk Schröder,<br />
in den Ruhestand verabschiedet. Trapp war 17 Jahre Leiter des WSA Uelzen,<br />
das zuständig ist für Betrieb, Unterhaltung<br />
<strong>und</strong> Verkehrssicherung auf<br />
rd. 204 km <strong>Wasser</strong>straßen (Elbe-<br />
Seitenkanal <strong>und</strong> Oststrecke des Mit-<br />
tellandkanals). In die Amtszeit Trapps fiel die<br />
Wiedervereinigung Deutschlands. Der bis dahin<br />
von der DDR verwaltete Streckenabschnitt<br />
des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Sachsen-Anhalt wurde<br />
östlich von Wolfsburg bis kurz vor das Was-<br />
Matthias Buschmann<br />
serstraßenkreuz bei Magdeburg dem WSA<br />
Uelzen zugeordnet. Damit vergrößerte sich der<br />
Zuständigkeitsbereich des Amtes erheblich.<br />
Zum neuen Leiter des WSA Uelzen wurde Baudirektor Dipl.-Ing. Martin Köther bestellt.<br />
Köther war bisher als Leiter der Projektgruppe Controlling bei der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> tätig <strong>und</strong><br />
hat diese Aufgabe im Rahmen einer Abordnung bis zum 31. Dezember <strong>2005</strong> wahrgenommen.<br />
Übergangsweise wurde das WSA Uelzen von Mai bis Dezember <strong>2005</strong> durch<br />
Bauoberrat Dipl.-Ing. Matthias Buschmann geleitet.<br />
� 50-jähriges Dienstjubiläum<br />
Am 1. April <strong>2005</strong> feierte der Technische Amtsinspektor Heinz<br />
Zunke, <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt (WSA) Hann. Münden, sein 50jähriges<br />
Dienstjubiläum.<br />
Herr Zunke wurde am 1. April 1955 beim damaligen WSA Hameln als<br />
Auszubildender im Ausbildungsberuf „<strong>Wasser</strong>bauwerker“ eingestellt.<br />
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung war Herr Zunke bis<br />
Dezember 1964 als <strong>Wasser</strong>bauwerker beim WSA Hameln tätig. Von<br />
Januar 1965 bis März 1966 absolvierte er die Ausbildung für den mittleren<br />
bautechnischen Verwaltungsdienst <strong>und</strong> legte außerdem im<br />
Dezember 1965 die Prüfung zum <strong>Wasser</strong>bauwerkmeister erfolgreich<br />
ab. Nach der Ausbildung leitete Zunke als Außenbeamter beim damaligen<br />
WSA Kassel (seit 1970 WSA Hann. Münden) die Außenbezirke<br />
Rotenburg, Bad Sooden-Allendorf <strong>und</strong> Eschwege. Am 1. April 1990<br />
übernahm er schließlich die Leitung des Außenbezirks Höxter, wo er<br />
bis zum Ende seiner Arbeitsphase im Rahmen der Altersteilzeit tätig<br />
war. In einer Feierst<strong>und</strong>e gratulierte der Präsident der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>, Prof. Dierk Schröder, Herrn Zunke zu diesem<br />
seltenen Jubiläum <strong>und</strong> dankte ihm für seine langjährige, engagierte<br />
<strong>und</strong> erfolgreiche Tätigkeit in der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung.<br />
Herr Zunke ist am 1. Oktober <strong>2005</strong> in den wohlverdienten Ruhestand<br />
getreten.<br />
Martin Köther<br />
Heinz Zunke (links) <strong>und</strong> Prof. Dierk Schröder
Nachrichten<br />
� Wechsel in der Leitung der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
v.l. Dr. Herbert Schmalstieg, Rita Schröder, Prof. Dierk Schröder, Ralf Nagel, Sönke Meesenburg,<br />
Birgit Meesenburg<br />
Der langjährige Leiter der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
(<strong>WSD</strong>) <strong>Mitte</strong>, Präsident<br />
Prof. Dipl.-Ing. Dierk<br />
Schröder, wurde am<br />
31. August <strong>2005</strong> im Rahmen<br />
einer Festveranstaltung<br />
mit rd. 400 Gästen<br />
durch den Staatssekretär<br />
beim B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Verkehr, Bau- <strong>und</strong><br />
Wohnungswesen, Ralf<br />
Nagel, in den Ruhestand<br />
verabschiedet. Gleichzeitig<br />
wurde Dipl.-Ing. Sönke<br />
Meesenburg als neuer Leiter<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> in sein<br />
Amt eingeführt.<br />
Die Begrüßung der Gäste<br />
nahm der Vizepräsident<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>, Jürgen<br />
Mechelhoff, vor. Grußworte<br />
sprachen der Niedersächsische<br />
Minister für<br />
Wirtschaft, Arbeit <strong>und</strong> Verkehr,<br />
Walter Hirche, der<br />
Oberbürgermeister der<br />
Landeshauptstadt Hannover,<br />
Dr. Herbert Schmalstieg,<br />
der Präsident des<br />
B<strong>und</strong>esverbandes der Deutschen Binnenschiffahrt e.V., Heinz Hofmann, der Vorsitzende des Bezirkspersonalrates bei der<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>, Karl-Heinz Kuhlmann <strong>und</strong> der Leiter des <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamtes (WSA) Braunschweig, Baudirektor<br />
Johann Röben.<br />
Dierk Schröder, geb. 1940 in Celle, begann nach dem Hochschulabschluss an der TU Braunschweig seine berufliche<br />
Laufbahn 1968 beim Neubau des Elbe-Seitenkanals. Im August 1971 legte er nach dem Referendariat bei der damaligen<br />
<strong>WSD</strong> Hamburg die Zweite Staatsprüfung für den höheren bautechnischen Dienst ab. Nach verschiedenen Stationen in der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung wurde er im Februar 1978 in das B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr (Referat Gr<strong>und</strong>satzangelegenheiten<br />
der Bautechnik für den<br />
<strong>Wasser</strong>bau <strong>und</strong> das Verdingungswesen) berufen,<br />
dessen Referatsleitung er 1988 übernahm.<br />
Am 1. Februar 1993 wurde Prof.<br />
Schröder zum Präsidenten der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> in<br />
Hannover ernannt.<br />
Während der 12 Jahre unter Leitung von<br />
Prof. Schröder wurde in der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> insbesondere<br />
der Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
zielgerichtet weitergeführt. So konnte im Jahre<br />
2000 der Ausbau der Weststrecke des Kanals<br />
zwischen Bergeshövede <strong>und</strong> Wolfsburg<br />
abgeschlossen werden. Neben dem Bau von<br />
neuen Kanalbrücken über Weser <strong>und</strong> Leine<br />
war hierbei die Verbreiterung <strong>und</strong> Vertiefung<br />
des Kanals <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>ene Neubau<br />
von Brücken im Stadtgebiet Hannover<br />
eine besondere Herausforderung. Neben den<br />
verkehrlichen Anforderungen für die Binnenschifffahrt<br />
stand hier die städtebauliche <strong>und</strong><br />
landschaftsplanerische Einbindung im allge-<br />
v.l. Prof. Dierk Schröder, Jürgen Mechelhoff<br />
meinen Interesse. Durch die individuelle Ge-<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
15
16<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Nachrichten<br />
staltung der Brücken <strong>und</strong> die Integration der Uferzonen des Kanals in die städtische Parklandschaft hat der Ausbau heute<br />
eine hohe Akzeptanz. Der Verband der Bauindustrie für Niedersachsen hat mit der Verleihung des Bauindustriepreises<br />
2000 an Prof. Schröder diese Leistungen besonders gewürdigt.<br />
Weitere Arbeitsschwerpunkte der vergangenen Jahre waren die Gr<strong>und</strong>instandsetzung von Eder- <strong>und</strong> Diemeltalsperre aufgr<strong>und</strong><br />
gestiegener Sicherheitsanforderungen, der Neubau von Schleusen – derzeit befinden sich neue Schleusen in<br />
Uelzen am Elbe-Seitenkanal <strong>und</strong> in Sülfeld am <strong>Mitte</strong>llandkanal im Bau -, der Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals zwischen<br />
Wolfsburg <strong>und</strong> Magdeburg als Teil des Projektes 17 der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit <strong>und</strong> der Ausbau der Stichkanäle.<br />
Ein besonderes Anliegen von Prof. Schröder waren während all der Jahre als Präsident der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> die Belange der<br />
Binnenschifffahrt. So setzte er sich ständig dafür ein, die Schifffahrts- <strong>und</strong> Betriebsbedingungen auf den <strong>Wasser</strong>straßen<br />
seines Zuständigkeitsbereiches zu verbessern. Zu den Maßnahmen gehörten u.a. die Ausstattung von Liegehäfen mit<br />
Stromentnahmestellen, die frühzeitige Zulassung größerer Abladetiefen in Ausbaustrecken durch Einführung innovativer<br />
Verkehrslenkungskonzepte <strong>und</strong> die flexible Anpassung von Schleusenbetriebszeiten bis hin zum 24-St<strong>und</strong>en-Betrieb.<br />
Prof. Schröder hat zudem in einer Vielzahl von Fachgremien <strong>und</strong> anderen technisch-wissenschaftlichen Institutionen in leitender<br />
<strong>und</strong> mitwirkender Funktion seine Erfahrungen einbringen können <strong>und</strong> in zahlreichen Vorträgen <strong>und</strong> Veröffentlichungen<br />
insbesondere zu Fragen des <strong>Wasser</strong>straßenbaus Stellung bezogen. Im Juli 1990 wurde er als Lehrbeauftragter für<br />
Verkehrswasserbau an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen berufen. Im August 1995 erfolgte<br />
seine Ernennung zum Honorarprofessor. Von 1995 bis <strong>2005</strong> war Prof. Schröder darüber hinaus Präsident des Vereins für<br />
europäische Binnenschifffahrt <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>straßen. Auch ist er Mitglied vieler technisch-wissenschaftlicher Verbände, u.a.<br />
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik sowie der Hafenbautechnischen Gesellschaft <strong>und</strong> Mitglied<br />
im Hauptvorstand der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft.<br />
Im Auftrag des B<strong>und</strong>esministeriums für Verkehr, Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen weilte Prof. Schröder wiederholt in der Volksrepublik<br />
China. Seine Aufgabe bestand in der Begutachtung dortiger <strong>Wasser</strong>straßen <strong>und</strong> in der Beratung des Verkehrsministeriums<br />
der Volksrepublik. Seit 1997 ist Prof. Schröder Honorarprofessor an der Universität Chongqing.<br />
Der neue Leiter der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>, Dipl.-Ing. Sönke Meesenburg, geboren 1958 in Hamburg, begann seine berufliche Laufbahn<br />
nach dem Hochschulabschluss 1985 an der TU Braunschweig beim Amt für Strom <strong>und</strong> Hafenbau in Hamburg. Nach<br />
dem Referendariat legte er im Oktober 1987 die Zweite Staatsprüfung für den höheren bautechnischen Dienst ab.<br />
Meesenburg wechselte anschließend vom Amt für Strom- <strong>und</strong> Hafenbau in Hamburg in die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
des B<strong>und</strong>es als Sachbereichsleiter beim WSA Bremen. Im September 1994 übernahm er zunächst die Leitung<br />
des WSA in Emden (bis Mai 2002) <strong>und</strong> anschließend in Bremen (bis August <strong>2005</strong>).<br />
In dieser Zeit hat Meesenburg an der Realisierung von Großprojekten wie der neuen Staustufe in Bremen, der Emsvertiefung<br />
<strong>und</strong> dem Emssperrwerk mitgewirkt. Unter seiner Leitung wurden die Ausbaumaßnahmen an der Unteren Hunte <strong>und</strong><br />
in der Stadtstrecke Oldenburg im Zuge des Küstenkanals erfolgreich realisiert. Seine vielen praktischen Erfahrungen mit<br />
der Modernisierung <strong>und</strong> Neuausrichtung des Regiebetriebs führten dazu, dass Meesenburg in die Lenkungsgruppe für die<br />
Einführung des Controllings in der WSV berufen wurde.<br />
v.l. Dipl.-Ing. Sönke Meesenburg, Sts. Ralf Nagel
Nachrichten<br />
Meesenburg ist Obmann der DIN 18311 für Nassbaggerarbeiten <strong>und</strong> engagiert sich in diesem Feld seit 1994 auch international.<br />
Als HTG-Mitglied seit 1983 ist er im Fachausschuss für Sportboothäfen <strong>und</strong> wassertouristische Anlagen tätig.<br />
Bei der Festveranstaltung<br />
am<br />
31. August <strong>2005</strong><br />
dankten die Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
der <strong>WSD</strong><br />
<strong>Mitte</strong> einschließlich<br />
der nachgeordneten<br />
Dienststellen Prof.<br />
Schröder herzlich für<br />
die langjährige, vertrauensvolle<br />
<strong>und</strong><br />
konstruktive Zusammenarbeit<br />
<strong>und</strong><br />
wünschten ihm für<br />
die Zeit des (Un-)<br />
Ruhestandes viel Erfolg<br />
bei seinen noch<br />
vielfältigen Aktivitäten<br />
sowie Zufriedenheit<br />
<strong>und</strong> vor allem<br />
Ges<strong>und</strong>heit im Kreise<br />
seiner Familie.<br />
Die Organisation der Veranstaltung lag in guten Händen<br />
Am selben Tag konnten die Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter Ihren neuen Chef herzlich begrüßen.<br />
� Weltberühmte Gäste am <strong>Wasser</strong>straßenkreuz Minden<br />
Das <strong>Wasser</strong>straßenkreuz Minden ist faszinierend!<br />
Die neue Kanalbrücke über die Elbe bei Magdeburg wurde im vergangenen<br />
Jahr bereits auf einer Briefmarke abgebildet. Aber so berühmte<br />
Persönlichkeiten waren in Magdeburg noch nicht zu Gast:<br />
Vor 20 Jahren haben Donald Duck <strong>und</strong> Daniel Düsentrieb auf der<br />
Durchreise nach Entenhausen das <strong>Wasser</strong>straßenkreuz Minden besucht.<br />
Ihre Erlebnisse haben sie 1987 im Reisebericht „Der Lauf des<br />
<strong>Wasser</strong>s“ im Heft 120 der Reihe „Walt Disneys Lustige Taschenbücher“<br />
(EHAPA Verlag) veröffentlicht.<br />
Der Reisebericht kann auch als Prüfungsvorbereitung für angehende<br />
<strong>Wasser</strong>bauingenieure, Referendare <strong>und</strong> Anwärter genutzt werden.<br />
Fragen wie „Erläutern Sie den Kreislauf des <strong>Wasser</strong>s!“, „Wie funktioniert<br />
eine Schleuse?“, „Was verstehen Sie unter der Mehrzweckfunktion<br />
der <strong>Wasser</strong>straßen?“ werden auch dem etwas schwächeren<br />
Kandidaten anschaulich erläutert.<br />
Wie kommt der geneigte Leser nun zu diesem interessanten Heft? Er<br />
kann es auf Flohmärkten der Region oder in Comic-Läden, die es inzwischen<br />
in jeder größeren Stadt gibt, versuchen. Vielleicht hilft auch<br />
eine Recherche im Internet. Der frühere Präsident unserer <strong>Wasser</strong><strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>, Herr Prof. Schröder, ist jedenfalls innerhalb<br />
weniger Tage fündig geworden <strong>und</strong> hat das Heft uneigennützig<br />
dem Dezernat Administration zur Verfügung gestellt. Hierfür dankt<br />
das Redaktionsteam herzlich.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
17
18<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Nachrichten<br />
� „Schifffahrt <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>straßen“<br />
Ausstellung über<br />
Nassbaggerei in der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Schifffahrt, Häfen <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>straßen sind ein prägender Teil Norddeutschlands.<br />
Ohne sie wären Handel <strong>und</strong> Wandel durch die Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
bis in die Gegenwart nicht vorstellbar. Ein modernes <strong>und</strong><br />
leistungsfähiges <strong>Wasser</strong>straßennetz ist heute ein unverzichtbarer Teil<br />
der Verkehrswegeinfrastruktur der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland. Erhalt<br />
<strong>und</strong> Anpassung dieser Infrastruktur erfordern stetigen Aufwand.<br />
Die hierzu entwickelten wirtschaftlichen <strong>und</strong> umweltverträglichen Baggerstrategien<br />
nützen allen. Um diese Zusammenhänge aufzuzeigen,<br />
präsentierte die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion (<strong>WSD</strong>) <strong>Mitte</strong> die<br />
Ausstellung „Wirtschaftlich <strong>und</strong> umweltverträglich: Nassbaggerstrategien<br />
in Deutschland“. Die Ausstellung wurde unter Beteiligung<br />
von Vertretern der Binnenschifffahrt <strong>und</strong> der <strong>Wasser</strong>schutzpolizei<br />
am 16. November <strong>2005</strong> von Herrn Dipl.-Ing.<br />
Sönke Meesenburg, Präsident der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>, eröffnet <strong>und</strong> hier<br />
bis Februar 2006 präsentiert.<br />
Baggerarbeiten sind der natürliche Begleiter von Neubaumaßnahmen,<br />
beim Kelleraushub für ein Einfamilienhaus ebenso<br />
wie bei infrastrukturellen Jahrh<strong>und</strong>ertbauten wie Kanäle, Deiche<br />
<strong>und</strong> Hafenanlagen. Daneben findet laufende Baggerei zur<br />
Unterhaltung der <strong>Wasser</strong>wege statt: als Antwort auf den ständigen<br />
Prozess von Abtrag <strong>und</strong> Auflandung von Kieseln, Sand<br />
<strong>und</strong> Schwebstoffen in Fließgewässern. Jährlich werden zur Unterhaltung<br />
der deutschen <strong>Wasser</strong>straßen etwa 46 Mio. m 3 Sönke Meesenburg<br />
Sand<br />
<strong>und</strong> Schlick gebaggert. Die Menge des gebaggerten Materials,<br />
Gäste bei der Ausstellungseröffnung<br />
der Umfang der vorgehaltenen technischen <strong>und</strong> personellen<br />
Ressourcen <strong>und</strong> die Höhe der erforderlichen Finanzmittel machen<br />
die Nassbaggerei zu einer bedeutenden Branche. Ihr<br />
Nutzen für andere Wirtschaftszweige ist immens. Unterhaltungsbaggerungen<br />
sichern den Erfolg des Verkehrssystems<br />
Schiff/<strong>Wasser</strong>straße, der großen deutschen Hafenmetropolen,<br />
des Exports im Allgemeinen. Als Instrument der <strong>Wasser</strong>wirtschaft<br />
<strong>und</strong> des Hochwasserschutzes sind sie außerdem ein<br />
wichtiger Teil der Daseinsvorsorge.<br />
Die Ausstellung wurde vom B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr,<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen unter Beteiligung der zuständigen<br />
B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesbehörden erstellt. Die Ausstellung verfolgt<br />
die natürlichen Prozesse der Erosion <strong>und</strong> Sedimentation in unseren<br />
Fließgewässern - von der Quelle bis zur Mündung. Sie<br />
erläutert den Bedarf an Baggerei <strong>und</strong> stellt Umfang <strong>und</strong> Methoden<br />
der modernen Unterhaltungsbaggerei dar. Über den technischen<br />
Aspekt hinaus beleuchtet sie auch wichtige Fragen des<br />
Natur- <strong>und</strong> Umweltschutzes.<br />
Präsentation der Ausstellung<br />
Im Sommer 2006 wird die Ausstellung im Informationszentrum<br />
am <strong>Wasser</strong>straßenkreuz Minden präsentiert.
Winfried Reiner<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Die Weser entsteht in Hann.<br />
Münden aus dem Zusammenfluss<br />
von Werra <strong>und</strong> Fulda. Bis zur<br />
Mündung in die Nordsee ist sie<br />
452 km lang; das oberirdische<br />
Einzugsgebiet, einschließlich dem<br />
der Werra <strong>und</strong> Fulda, umfasst ca.<br />
46.000 km² (Abb. 1). Neben der<br />
Ems ist die Weser damit nach<br />
Länge <strong>und</strong> nach Fläche des Einzugsgebietes<br />
der kleinste der<br />
mitteleuropäischen Ströme. Die<br />
Weserstrecke von Hann. Münden<br />
bis Minden (Weser-km 204,445)<br />
wird als Oberweser, die Strecke<br />
von Minden bis Bremen (Schleuse<br />
Hemelingen, Weser-km 362)<br />
als <strong>Mitte</strong>lweser bezeichnet. Unterhalb<br />
Bremens folgen die Unterweser<br />
bis Bremerhaven <strong>und</strong><br />
die Außenweser bis zum offenen<br />
Meer.<br />
Das Abflussverhalten der Oberweser<br />
wird durch die verhältnismäßig<br />
großen <strong>und</strong> einheitlichen<br />
Einzugsgebiete der Fulda<br />
(6.945 km²) <strong>und</strong> der Werra<br />
(5.496 km²) bestimmt. Die Nebenflüsse<br />
der Oberweser sind dagegen<br />
relativ kurz <strong>und</strong> vermögen<br />
den Abfluss nicht wesentlich zu<br />
steigern. Östlich der Weser verhindert<br />
der nahegelegene Leinetalgraben<br />
die Entwicklung größerer<br />
Zuflüsse, während im Westen<br />
das Eggegebirge <strong>und</strong> der Teutoburger<br />
Wald das Einzugsgebiet<br />
einengen. Auch im Verlauf der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser nehmen die Niedrig-<br />
<strong>und</strong> <strong>Mitte</strong>lwasserabflüsse zunächst<br />
nur langsam zu. So beträgt<br />
der <strong>Mitte</strong>lwasserabfluss<br />
(Jahresreihe 1954/2003) oberhalb<br />
der Allermündung 208 m³/s, was<br />
auf einer Flusslänge von<br />
rd. 309 km im Vergleich zum<br />
<strong>Mitte</strong>lwasserabfluss bei Hann.<br />
Münden eine Erhöhung um nur<br />
Der Binnenschifffahrtsweg<br />
Weser<br />
– Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
Abb. 1 - Oberirdisches Einzugsgebiet der Weser<br />
Reinhard Henke<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
81 % bedeutet. Durch die Einmündung<br />
der Aller bei Verden<br />
vergrößert sich das Einzugsgebiet<br />
der Weser um rd. 15.700<br />
km² <strong>und</strong> der mittlere Abfluss um<br />
119 m³/s dann allerdings erheblich.<br />
Die Weser ist auf ihrer ganzen<br />
Länge eine dem allgemeinen<br />
Verkehr dienende B<strong>und</strong>eswasserstraße.<br />
Die Grenze zwischen<br />
der Binnen- <strong>und</strong> der Seeschifffahrtsstraße<br />
Weser befindet<br />
sich bei Unterweser-km 1,38 an<br />
der Eisenbahnbrücke in Bremen.<br />
Die Weser gehört von Hann.<br />
Münden bis Weser-km 354,19<br />
(etwa 8 km oberhalb der<br />
Schleuse Hemelingen) zum<br />
Verwaltungsbereich der <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
(<strong>WSD</strong>) <strong>Mitte</strong> mit nachgeordneten<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämtern<br />
(WSÄ) in Hann.Münden,<br />
Minden <strong>und</strong> Verden. Nördlich<br />
schließt sich bis zur Nordsee<br />
der Verwaltungsbereich der<br />
<strong>WSD</strong> Nordwest mit den WSÄ<br />
Bremen <strong>und</strong> Bremerhaven an.<br />
Geschichte der<br />
Weserschifffahrt<br />
Bereits seit dem Altertum ist<br />
das Schiff auf Meeren <strong>und</strong><br />
Flüssen ein wichtiges Transportmittel.<br />
Flüsse, im <strong>Mitte</strong>lalter<br />
"des Reiches Straßen" genannt,<br />
waren bestimmend für die<br />
Gründung von Ansiedlungen<br />
<strong>und</strong> Städten <strong>und</strong> konnten<br />
– wenn es der jahreszeitlich<br />
schwankende <strong>Wasser</strong>stand<br />
zuließ – insbesondere zum<br />
Transport von Massengütern<br />
oder von<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
19
20<br />
Abb. 2 - Pferdelinienzug bei Rinteln. Georg Osterwald von 1835<br />
leicht zerbrechlichen Waren genutzt werden. So kommt<br />
auch der Weser für den Handel der von ihr durchflossenen<br />
Regionen seit Jahrh<strong>und</strong>erten eine Bedeutung zu.<br />
Außerdem bot sich zahlreichen in der Nähe des Flusses<br />
lebenden Menschen die Möglichkeit, in dem vorbeiführenden<br />
Handel Arbeit zu finden oder aber Produkte der<br />
Region über den Fluss in die Ferne abzusetzen. Städte<br />
wie Hann. Münden, Höxter, Hameln <strong>und</strong> Minden begründeten<br />
nicht nur ihre besondere Bedeutung durch<br />
ihre Lage an der Weser, sondern eine wesentliche<br />
wirtschaftliche Basis für die Blüte der Renaissance im<br />
Weserraum war die Möglichkeit, über den Fluss Getreide,<br />
Holz, Eisen, Keramik, Bausteine <strong>und</strong> andere Produkte<br />
der Region gewinnbringend in den Norden, insbesondere<br />
über Bremen abzusetzen. Importgüter waren<br />
überwiegend kaufmännische Waren wie Weine, Tee,<br />
Fisch, Milchprodukte, Leinsamen, Tran, Teer <strong>und</strong> Hausrat.<br />
Die im 17. <strong>und</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert auf der Weser eingesetzten<br />
hölzernen Schiffe besaßen Tragfähigkeiten zwischen<br />
20 <strong>und</strong> 70 Tonnen. Oft wurden die Schiffe in einem<br />
Schiffszug, bestehend aus drei hintereinander gekoppelten<br />
Schiffen, gefahren. Das erste <strong>und</strong> größte Schiff war der<br />
"Bock", hinter ihm folgte der "Hinterhang". An den "Hinterhang"<br />
war der "Bullen" angehängt. In der zweiten Hälfte des<br />
18. Jahrh<strong>und</strong>erts war der Schiffszug aus "Bock", "Hinterhang"<br />
<strong>und</strong> "Bullen" die Regeleinheit auf der Weser. Ein<br />
solcher Schiffszug aus drei Schiffen wurde als "eine Mast"<br />
bezeichnet, weil der "Bock" einen Mast hatte, an dem die<br />
Zugleine für den Linienzug der Schiffe stromaufwärts befestigt<br />
wurde. Verschiedentlich hatten die "Böcke" ein Segel,<br />
welches zur Unterstützung der Fortbewegung <strong>und</strong> der<br />
Steuerung in<br />
Gebrauch genommen<br />
wurde.<br />
Bei der Fahrt der<br />
Schiffe flussabwärts<br />
wurde die<br />
Strömung (kalter<br />
Druck) ausgenutzt,<br />
wobei an<br />
Untiefen oftmals<br />
gestakt werden<br />
musste. Stromaufwärts<br />
wurden<br />
die Kähne mit<br />
Seilen, im land-<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
Abb. 4 - Schlepper mit Anhang aus Schleppkähnen auf der Oberweser bei Bodenwerder<br />
läufigen Ausdruck treideln, gezogen. Der Schiffszug<br />
erfolgte durch Menschen oder, besonders in späterer<br />
Zeit, durch Pferde (Abb. 2). Für den Schiffszug<br />
mussten die Ufer mit Leinpfaden versehen werden,<br />
was manchen Eingriff in das Gr<strong>und</strong>eigentum der<br />
Uferanlieger erforderte <strong>und</strong> nicht in wenigen Fällen<br />
zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führte. Die<br />
Leinpfade passten sich dem Ufergelände an, so<br />
dass es erforderlich wurde, Menschen <strong>und</strong> Pferde<br />
überzusetzen. Hierzu diente der "Bullen", der<br />
daneben auch als Leichterschiff bei Niedrigwasser<br />
eingesetzt wurde. Die Anzahl der benötigten Personen<br />
für den Menschenlinienzug war abhängig von<br />
der Anzahl der zu ziehenden Schiffe, ihrer Ladung,<br />
dem <strong>Wasser</strong>stand – bei Niedrigwasser mussten die<br />
Kähne teilweise über Untiefen gezogen werden –<br />
<strong>und</strong> den herrschenden Winden. Oft wurden 40 Personen,<br />
bei größeren Schiffen aber durchaus bis zu<br />
Abb. 3 - Raddampfer GERMANIA an der Steinmühle/Oberweser. Stahlstich um 1860<br />
100 Personen für einen Zug benötigt. Trotz des Übergangs<br />
auf den Pferdezug blieb der Menschenzug noch bis ins<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>ert auf Teilabschnitten der Weser gebräuchlich<br />
<strong>und</strong> bot einer Vielzahl von Menschen im Einzugsbereich<br />
des Flusses Arbeit.<br />
Erst die ab <strong>Mitte</strong> des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts aufkommende<br />
Dampfschifffahrt führte zur Verdrängung der Treidelschifffahrt<br />
(Abb. 3). Auf der Weser wurden im Laufe der folgenden<br />
Jahrzehnte sowohl selbstfahrende Fracht- <strong>und</strong> Passagierraddampfer<br />
(sogenannte Expressdampfer) als auch<br />
Schleppdampfer zum Ziehen von mehreren Schleppkähnen,<br />
die selbst ohne Antrieb waren, eingesetzt. Die<br />
Dampfmaschine als Antriebsmittel für Binnenschiffe wurde<br />
ab 1930 zunehmend durch den Dieselmotor verdrängt. Die<br />
Schlepper zogen nun jeweils drei<br />
bis vier stählerne Schleppkähne,<br />
die auf der Weser eine Länge<br />
von etwa 60 m, eine Breite von<br />
8,0 m bis 9,0 m <strong>und</strong> eine Tragfähigkeit<br />
von bis zu 600 Tonnen<br />
hatten (Abb. 4). Nach dem<br />
2. Weltkrieg wurde die Betriebsform<br />
der Schleppschifffahrt durch<br />
den Einsatz von schnellfahrenden<br />
Schiffen mit eigenem Antrieb<br />
(Motorgüterschiffe) abgelöst.
Rechtliche Einflüsse auf die<br />
Weserschifffahrt<br />
Die Weserschifffahrt wurde im Laufe der Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
durch rechtliche <strong>und</strong> natürliche Einflüsse immer wieder<br />
behindert. Rechtliche Behinderungen für die freie Schifffahrt<br />
bestanden insbesondere in den Stapelrechten mehrerer<br />
Städte (Bremen, Minden, Hameln <strong>und</strong> Hann. Münden). So<br />
wurde der durchziehende Händler bzw. der vorbeifahrende<br />
Schiffer genötigt, seine Waren für einen bestimmten Zeitraum<br />
(meistens drei Tage) niederzulegen <strong>und</strong> zum Kauf<br />
anzubieten. Regelmäßig wurde dabei auch auf den Preis<br />
Einfluss genommen. Auf diese Weise haben die mittelalterlichen<br />
Städte etwa ab dem 14. Jahrh<strong>und</strong>ert versucht, ihre<br />
wirtschaftliche Kraft zu stärken <strong>und</strong> die Existenzbedingungen<br />
ihrer Bürger zu verbessern. Nicht selten aber hat dieser<br />
Stapelzwang die berechtigten Städte in endlose Streitigkeiten<br />
mit den Konkurrenten verwickelt. So gerieten Minden<br />
<strong>und</strong> Bremen über den Stapelzwang in einen Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
dauernden Streit, bei dem jede Seite der anderen gerade<br />
das verwehrte, was sie selber beanspruchte, nämlich Stapelzwang<br />
<strong>und</strong> freie Schifffahrt auf der Weser. Erstmals in<br />
den Artikeln 108 bis 115 der Wiener Kongressakte vom<br />
9. Juni 1815 bekannten sich die europäischen Mächte zur<br />
Freiheit der Schifffahrt auf den großen Strömen <strong>und</strong> beschlossen<br />
in Artikel 114 ausdrücklich auch die Abschaffung<br />
der Stapelrechte. Was in Wien als Programm aufgestellt<br />
worden war, verwirklichte die am 10. September 1823 in<br />
Minden von den sieben Uferstaaten Preußen, Hannover,<br />
Kurhessen, Oldenburg, Braunschweig, Lippe-Detmold <strong>und</strong><br />
Bremen unterzeichnete Weserschifffahrtsakte. Sie bedeutete<br />
rechtlich <strong>und</strong> tatsächlich das Ende der Stapelberechtigungen<br />
an der Weser.<br />
Weitere rechtliche Behinderungen für die Schifffahrt entstanden<br />
aufgr<strong>und</strong> der politischen Kleinräumigkeit im Weserraum<br />
<strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen großen Anzahl der zu<br />
entrichtenden <strong>Wasser</strong>zölle. So bestanden noch im Jahre<br />
1800 zwischen Hann. Münden <strong>und</strong> Bremen 24 Zollstellen.<br />
Jeder der an den Fluss grenzenden deutschen Kleinstaaten<br />
bemühte sich, die Schifffahrt wie den Landweg zu kontrollieren<br />
<strong>und</strong> Einnahmen für den Staatssäckel zu erzielen. In<br />
der Weserschifffahrtsakte von 1823 wurde vereinbart, einen<br />
einheitlichen, gleichmäßigen <strong>Wasser</strong>zoll zu erheben <strong>und</strong><br />
die Anzahl der Zollstellen auf 11 zu senken. 1834 gründeten<br />
dann 18 Staaten den Deutschen Zollverein, dem einige<br />
Kleinstaaten wie Braunschweig <strong>und</strong> der Stadtstaat Bremen<br />
jedoch zunächst nicht beitraten. Die letzten Zollstellen an<br />
der Weser wurden erst nach 1850 – auch unter dem Wettbewerbseinfluss<br />
der Eisenbahn – aufgehoben.<br />
Entstehung der ersten<br />
<strong>Wasser</strong>bauverwaltung<br />
Eine Fachverwaltung für die Belange des Fahrwassers <strong>und</strong><br />
der Schifffahrt gab es, ähnlich wie bei anderen Strömen, an<br />
der Weser <strong>und</strong> ihren Quellflüssen bis Anfang des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
nicht. Die Unterhaltung der Ufer erfolgte lediglich<br />
in Eigen- <strong>und</strong> Nachbarschaftshilfe der Anlieger <strong>und</strong> diente<br />
ausschließlich der Erhaltung des Eigentums. Die Schiffer<br />
waren deshalb weitgehend auf Selbsthilfe angewiesen, um<br />
das damals sehr schlechte Fahrwasser <strong>und</strong> die Umschlagsanlagen<br />
in einem Mindestzustand zu erhalten. Erst<br />
mit der Weserschifffahrtsakte von 1823 verpflichteten sich<br />
die Anliegerstaaten für die Unterhaltung des Leinpfades,<br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
die Erhaltung eines ausreichenden Fahrwassers <strong>und</strong> die<br />
Beseitigung von Schifffahrtshindernissen aufzukommen.<br />
Erfahrungen <strong>und</strong> Beschäftigung mit dem Weserstrom, der<br />
mit seinen Nebenflüssen im Königreich Hannover die weitaus<br />
größte Bedeutung hatte, verstärkten dort die Erkenntnis,<br />
dass ein solches Stromgebiet einheitlich verwaltet<br />
werden müsste, um das Fahrwasser, die Ufer <strong>und</strong> Leinpfade<br />
nach gleichen fachlichen Gr<strong>und</strong>sätzen zu unterhalten.<br />
So wurde schon 1823 im Königreich Hannover die Generaldirektion<br />
des <strong>Wasser</strong>baus als oberste Zentralverwaltungsbehörde<br />
gegründet. Ihr oblag die oberste technische<br />
Leitung des gesamten <strong>Wasser</strong>baus sowie die Erarbeitung<br />
wasserrechtlicher <strong>und</strong> schifffahrtspolizeilicher Gesetze <strong>und</strong><br />
Verordnungen. Nachgeordnete Behörden waren die bei den<br />
Landdrosteien besonders eingerichteten <strong>Wasser</strong>bauinspektionen.<br />
Nach der Annektion des Königreichs Hannover <strong>und</strong><br />
des Kurfürstentums Hessen durch Preußen im Jahre 1866<br />
wurde die Generaldirektion 1869 aufgelöst. Ihre Aufgaben<br />
gingen direkt auf die Landdrosteien – die späteren Regierungspräsidenten<br />
– über. Im Wesergebiet bestanden damals<br />
<strong>Wasser</strong>bauinspektionen in Kassel, Höxter, Hameln,<br />
Rinteln, Minden, Nienburg, Hoya <strong>und</strong> Verden.<br />
Am 1. April 1896 wurde zur erneuten Zentralisierung die<br />
Weserstrombauverwaltung beim Oberpräsidenten in Hannover<br />
eingerichtet; ihr unterstanden als Bezirksbehörden<br />
die <strong>Wasser</strong>bauinspektionen. Dabei schloss die <strong>Wasser</strong>bauinspektion<br />
(WBI) Hameln jetzt den Bereich der bis dahin<br />
selbständigen WBI Höxter mit ein, die WBI Rinteln wurde<br />
Minden, die WBI Nienburg Hoya angegliedert. Die <strong>Wasser</strong>bauinspektionen<br />
wurden im Laufe der folgenden Jahre zu<br />
<strong>Wasser</strong>bauämtern <strong>und</strong> später zu <strong>Wasser</strong>straßenämtern<br />
umbenannt. Sie können damit als Vorgänger der heutigen<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter angesehen werden. Der<br />
Zuständigkeitsbereich der Weserstrombauverwaltung erstreckte<br />
sich auf<br />
• die preußische Weser von Hann. Münden bis zur oldenburgischen<br />
Landesgrenze oberhalb Geestemünde,<br />
• die kanalisierte Fulda einschließlich Hafen Kassel,<br />
• die Mündung der Werra einschließlich Wehr <strong>und</strong><br />
Schleuse sowie<br />
• den unteren Lauf der Aller bis nach Verden, einschließlich<br />
des dortigen Hafens.<br />
Daneben war die Strombauverwaltung in der Folgezeit<br />
auch für den Bau des <strong>Mitte</strong>llandkanals (MLK), der Eder-<br />
<strong>und</strong> Diemeltalsperre sowie den Ausbau der Aller zuständig.<br />
Nachdem die fertiggestellte MLK-Strecke Bergeshövede-<br />
Hannover der Weserstrombauverwaltung unterstellt worden<br />
war, erhielt die Behörde am 01.04.1918 die Bezeichnung<br />
<strong>Wasser</strong>straßendirektion. 1921, beim Übergang der <strong>Wasser</strong>straßen<br />
von den Ländern auf das Reich, blieben die<br />
<strong>Wasser</strong>straßendirektion <strong>und</strong> die <strong>Wasser</strong>straßenämter bestehen.<br />
Die Länder verwalteten die Reichswasserstraßen<br />
im Auftrage des Reiches <strong>und</strong> unter Fachaufsicht des<br />
Reichsverkehrsministeriums. Nach dem Gr<strong>und</strong>gesetz der<br />
B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland sind 1949 die ehemaligen<br />
Reichswasserstraßen B<strong>und</strong>eswasserstraßen geworden, die<br />
der B<strong>und</strong> seitdem durch eine eigene Behörde - die <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung - verwaltet. Die Aufgaben der<br />
früheren Weserstrombauverwaltung werden heute im wesentlichen<br />
von der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>und</strong> ihren nachgeordneten<br />
Ämtern in Hann. Münden, Minden <strong>und</strong> Verden wahrgenommen.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
21
22<br />
Natürliche Einflüsse auf die<br />
Weserschifffahrt<br />
Die natürlichen Behinderungen der Weserschifffahrt lagen<br />
insbesondere bei der Oberweser in der wechselnden <strong>Wasser</strong>führung<br />
des Flusses. Längere Trockenperioden im Sommer<br />
<strong>und</strong> Herbst mit geringer <strong>Wasser</strong>führung führten in<br />
Verbindung mit Veränderungen der Flusssohle (Untiefen,<br />
Sand- <strong>und</strong> Kiesbänke) zu Einschränkungen bei der Beladung<br />
der Fahrzeuge bis hin zur Einstellung der Schifffahrt.<br />
In den Winter- <strong>und</strong> Frühjahrsmonaten waren es die Eisverhältnisse<br />
<strong>und</strong> die Hochwasserereignisse, die die Schifffahrt<br />
stilllegten.<br />
Abb. 5 - Staustufe Hameln<br />
Die bis zur <strong>Mitte</strong> des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts in der Weser von<br />
Hann. Münden bis Bremen durchgeführten Maßnahmen zur<br />
Verbesserung der Schiffbarkeit waren auf die Beseitigung<br />
der gröbsten Hindernisse im Fluss beschränkt. Obwohl<br />
einzelne Uferstaaten oder die Schiffer bzw. Schiffergilden in<br />
Eigenleistung etwas zur Verbesserung des Fahrwassers<br />
unternahmen, blieb es bei Korrekturen an einzelnen Stellen.<br />
Nach der Vereinbarung der Weserschifffahrtsakte im<br />
Jahre 1823 erfolgte ab etwa 1840 ein erster Ausbau<br />
des Flusses, der aber infolge der weiterhin<br />
bestehenden politischen Vielgestaltigkeit im Weserraum<br />
nicht nach bestimmten, für den ganzen<br />
Fluss maßgebenden Regeln ausgerichtet war. An<br />
dieser Maßnahme waren bis 1866 fünf, danach<br />
noch drei B<strong>und</strong>esstaaten beteiligt. 1872 konnte<br />
eine neue Schleuse in Hameln fertiggestellt werden.<br />
Hier soll schon um das Jahr 1300 eine erste<br />
Wehranlage, damals zur Nutzung der <strong>Wasser</strong>kraft<br />
zum Antrieb von Getreidemühlen, errichtet worden<br />
sein, die im Laufe der Jahrh<strong>und</strong>erte mehrmals<br />
erneuert wurde. Die heute vorhandene<br />
Staustufe Hameln – einzige Staustufe der Oberweser<br />
– besteht aus zwei festen Wehren <strong>und</strong><br />
einer 1933 fertiggestellten Schleppzugschleuse<br />
mit einer gekrümmten Schleusenkammer (R =<br />
1500 m) von 225 m Länge <strong>und</strong> 12,50 m Breite.<br />
Heute dient die durch die Wehre geschaffene<br />
Stauhaltung nicht nur der Schifffahrt, sondern<br />
auch der regenerativen Stromerzeugung mittels<br />
zweier <strong>Wasser</strong>kraftwerke (Abb. 5).<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
1879 wurde die "Denkschrift betreffend die Regulierung der<br />
Oberweser von Hann. Münden bis Bremen" im preußischen<br />
Landtag eingebracht. Innerhalb von sieben Jahren sollte<br />
durch Einschränkung der Flussbreite mittels Buhnen, durch<br />
Baggerungen, Abflachung von Kurven, Beseitigung von<br />
Untiefen <strong>und</strong> andere Maßnahmen der Schifffahrt eine verbesserte<br />
Nutzung des Stromes ermöglicht werden. Das<br />
Ziel, auf der Weser von Hann. Münden bis Minden Fahrwassertiefen<br />
bei niedrigster <strong>Wasser</strong>führung von 1,00 m <strong>und</strong><br />
von Minden bis Bremen von 1,25 m zu erreichen, konnte<br />
nur teilweise <strong>und</strong> nicht immer über das ganze Jahr verwirklicht<br />
werden. Um die Jahrh<strong>und</strong>ertwende in Wirtschafts- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtskreisen aufkommende Forderungen nach einer<br />
Stauregelung der Weser – von Hann. Münden bis Hameln<br />
wurden 26 Staustufen (Nadelwehre), von Hameln bis<br />
Bremen weitere 24 Stufen projektiert – kamen aus unterschiedlichen<br />
Gründen, u.a. wegen der erheblichen Kosten,<br />
nicht zur Ausführung.<br />
1916 verfassten Muttray <strong>und</strong> Visarius die "Denkschrift<br />
über den erweiterten Ausbau der Weser von Münden bis<br />
zur Landesgrenze mit Bremen <strong>und</strong> der Aller". Sie stellten<br />
damit erstmals einheitliche Ausbaugr<strong>und</strong>sätze für den<br />
ganzen Strom auf <strong>und</strong> legten Bauziele fest, die noch<br />
heute im wesentlichen im Bereich der Oberweser Beachtung<br />
finden. Diesen Ausbaugr<strong>und</strong>sätzen lag ein gleichwertiger<br />
<strong>Wasser</strong>stand zugr<strong>und</strong>e, der sogenannte "Mittlere<br />
Kleinwasserstand" (M. Kl. W.). Zur Sicherstellung der<br />
Speisung des im Bau befindlichen <strong>Mitte</strong>llandkanals wurden<br />
Talsperren an der Eder (Nebenfluss der Fulda) mit<br />
202 Mio. m³ Inhalt <strong>und</strong> an der Diemel (Mündung bei<br />
Karlshafen in die Weser) mit 20 Mio. m³ Inhalt errichtet<br />
(Abb. 6). Diese sollten in niederschlagsarmen Zeiten,<br />
also vorwiegend im Sommerhalbjahr bis in den Herbst<br />
hinein, Zuschusswasser in die Weser, als Ersatz für die<br />
in Minden über ein Pumpwerk zu entnehmenden <strong>Wasser</strong>mengen<br />
zur Versorgung des Kanals, abgeben. Neben<br />
Maßnahmen des Hochwasserschutzes <strong>und</strong> der Energiegewinnung<br />
durch <strong>Wasser</strong>kraftwerke war damit auch eine<br />
Aufhöhung des <strong>Wasser</strong>stands der Oberweser für die Schifffahrt<br />
verb<strong>und</strong>en. Durch die Abgabe einer Zuschusswassermenge<br />
von z.B. 18 m³/s sollte in Hann. Münden eine<br />
<strong>Wasser</strong>spiegelanhebung von etwa 35 cm <strong>und</strong> im 200 km<br />
entfernten Minden von noch 15 cm erreicht werden. Aus<br />
dem M. Kl. W. wurde durch das Zuschusswasser aus den<br />
Abb. 6 - Diemeltalsperre
Abb. 7 - Pegel Karlshafen<br />
Talsperren der "Erhöhte <strong>Mitte</strong>lkleinwasserstand" (E. M. Kl.<br />
W.). Die Ausbaumaßnahmen von 1916 hatten zum Ziel,<br />
unter Berücksichtigung des Zuschusswassers aus den<br />
Talsperren, ganzjährig <strong>Wasser</strong>tiefen von mindestens<br />
1,10 m unterhalb von Hann. Münden, 1,25 m unterhalb von<br />
Karlshafen <strong>und</strong> 1,35 m unterhalb von Hameln vorzuhalten.<br />
Die in der Denkschrift gesteckten Ausbauziele sind aber auf<br />
der Strecke zwischen Hann. Münden <strong>und</strong> Minden nicht<br />
überall erreicht worden.<br />
Die wichtigste Zielsetzung bei der Steuerung der Talsperren<br />
lag in den ersten Jahrzehnten nach ihrer Fertigstellung<br />
im Ausgleich der <strong>Wasser</strong>entnahmen aus der Weser bei<br />
Minden für den <strong>Mitte</strong>llandkanal. Mit der Fertigstellung der<br />
Stauregelung der <strong>Mitte</strong>lweser (Minden – Bremen) im Jahre<br />
1960 hat sich diese Zielsetzung zugunsten der Niedrigwasseraufhöhung<br />
der Oberweser verschoben. Heute strebt die<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung durch die Zugabe von<br />
Talsperrenwasser in Niedrigwasserzeiten einen Pegelwert<br />
von 120 cm am Pegel Hann. Münden bzw. von 111 cm am<br />
Pegel Karlshafen an (Abb. 7). Diese <strong>Wasser</strong>stände reichen<br />
aus, um auf der Oberweser die für den Fremdenverkehr<br />
wichtige Fahrgastschifffahrt bis in den Herbst hinein zu<br />
ermöglichen. In durchschnittlichen hydrologischen Jahren<br />
reicht das Zuschusswasser aus den Talsperren zur Einhaltung<br />
dieser <strong>Wasser</strong>stände aus, bis sich im Spätherbst die<br />
natürlichen Abflüsse wieder erhöhen.<br />
Die Fahrwassertiefen der Oberweser können heute - bezogen<br />
auf die jeweiligen Pegel - wie folgt errechnet werden:<br />
Strecke<br />
• Hann. Münden – Karlshafen: Pegelstand Hann.<br />
Münden minus 17 cm<br />
• Karlshafen – Bodenwerder: Pegelstand Karlshafen<br />
minus 5 cm<br />
• Bodenwerder – Hameln<br />
(ohne Staubereich Hameln): Pegelstand Bodenwerder<br />
minus 28 cm<br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
• Hameln – Werremündung: Pegelstand Hameln plus<br />
5 cm<br />
• Werremündung – Minden: Pegelstand Porta minus<br />
31 cm<br />
Die Oberweser kann heute unter Berücksichtigung der v.g.<br />
Fahrwassertiefen von Fahrzeugen <strong>und</strong> Schubverbänden<br />
mit einer zulässigen Länge von 85 m <strong>und</strong> einer maximalen<br />
Breite von 11 m befahren werden.<br />
Verkehrsaufkommen auf der<br />
Oberweser<br />
Auf der Oberweser hat der Gütertransport mit dem Binnenschiff<br />
seit den 80er Jahren nur noch geringe Bedeutung.<br />
Trotz der <strong>Wasser</strong>abgabe aus den Talsperren reichen die<br />
Fahrwassertiefen, die in den Sommer- <strong>und</strong> Herbstmonaten<br />
teilweise nur rd. 100 cm betragen, nicht aus, um die Güterschifffahrt<br />
durchgehend das ganze Jahr über wirtschaftlich<br />
zu betreiben. Heute werden in den wasserreichen Frühjahrmonaten<br />
noch einige tausend Tonnen, überwiegend<br />
Getreide, aus den Räumen Beverungen, Holzminden <strong>und</strong><br />
Hameln in Richtung Minden bzw. Bremen verschifft.<br />
Die Oberweser besitzt allerdings eine erhebliche verkehrliche<br />
Bedeutung für die Fahrgastschifffahrt als herausragende<br />
touristische Attraktion sowie für die Freizeit- <strong>und</strong> Sportschifffahrt.<br />
Eine Flotte von Fahrgastschiffen bietet zwischen<br />
Hann. Münden <strong>und</strong> Minden <strong>und</strong> weiter weserabwärts R<strong>und</strong>-<br />
<strong>und</strong> Linienfahrten vom Frühjahr bis zum Herbst an (Abb. 8).<br />
Sportschifffahrt wird in vielfältiger Form betrieben. Hierzu<br />
gehören die Ruder- <strong>und</strong> Kanusportler ebenso wie Motorboot-,<br />
<strong>Wasser</strong>ski- <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>motorradfahrer. Der <strong>Wasser</strong>sport<br />
<strong>und</strong> der maritime Tourismus auf den <strong>Wasser</strong>straßen<br />
Deutschlands besitzt eine hohe wirtschaftliche Bedeutung.<br />
In diesem Marktbereich sind eine Vielzahl von Unternehmen<br />
<strong>und</strong> Institutionen wie Schiffs- <strong>und</strong> Yachtwerften, Häfen,<br />
Gaststätten, Hotels, bis hin zu Reiseveranstaltern mit be-<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
23
24<br />
Abb. 8 - Fahrgastschifffahrt auf der Oberweser bei Porta Westfalica<br />
achtlichen Beschäftigungs-, Wertschöpfungs- <strong>und</strong> Steuereffekten<br />
tätig. So trägt – auch in Kombination mit weiteren<br />
touristischen Angeboten, wie dem Weserradweg <strong>und</strong> der<br />
Deutschen Märchen Straße – die Fahrgast- <strong>und</strong> Sportschifffahrt<br />
in nicht unerheblichen Maße zur Sicherung von Arbeitsplätzen<br />
in der<br />
Oberweserregion bei.<br />
Seit 1995 werden<br />
oberhalb von Rinteln<br />
in großem Umfang<br />
Sand- <strong>und</strong> Kiestransporte<br />
als Werksverkehr<br />
von damals<br />
neu erschlossenen<br />
Abbauflächen bei<br />
Hohenrode (Weserkm<br />
158) zur Weiterverarbeitung<br />
zu einem<br />
Betonwerk in Engern<br />
(Weser-km 161) auf<br />
der Oberweser durchgeführt.<br />
Das für diesen<br />
Zweck neu gebaute<br />
Schubboot<br />
sowie die drei zugehörigen<br />
Leichter mit<br />
einer Tragfähigkeit<br />
von je 600 Tonnen wurden speziell für den Einsatz auch bei<br />
Niedrigwasser konzipiert. Mit diesen flachgehenden Fahrzeugen<br />
werden pro Jahr 0,6 bis 0,7 Mio. Tonnen Sand <strong>und</strong><br />
Kies auf besonders umweltfre<strong>und</strong>liche Weise auf dem <strong>Wasser</strong><br />
transportiert <strong>und</strong> eine zusätzliche Belastung der Straßen<br />
durch eine Lkw-Beförderung vermieden (Abb. 9). Weitere<br />
vergleichbare Projekte zur Durchführung von Sand<strong>und</strong><br />
Kiestransporten auf der Oberweser befinden sich in der<br />
Planung.<br />
Die Stauregelung der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser<br />
Der Plan, die Schifffahrtsverhältnisse durch Stauregelung<br />
der <strong>Mitte</strong>lweser zu verbessern, reicht bis in jene Zeit zurück,<br />
als die ersten Pläne für den Bau des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
heranreiften. Mit der schon erwähnten Errichtung von<br />
24 Staustufen von Hameln bis Bremen sollte u.a. verhindert<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
Abb. 9 – Schubverband für den Sand- <strong>und</strong> Kiestransport oberhalb von Rinteln<br />
werden, dass durch die <strong>Wasser</strong>entnahmen für den<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal der <strong>Wasser</strong>spiegel unterhalb der<br />
Entnahmestelle abgesenkt <strong>und</strong> damit der Tiefgang<br />
der Schiffe eingeschränkt worden wäre. Diese Absicht<br />
wurde jedoch wieder aufgegeben, nachdem<br />
festgestellt worden war, dass die <strong>Wasser</strong>entnahmen<br />
bei Niedrigwasser durch Abgabe von Zuschusswasser<br />
aus zwei Talsperren an Eder <strong>und</strong><br />
Diemel ausgeglichen werden konnten. Auch konnten<br />
mit der Abgabe des Zuschusswassers die<br />
Fahrwasserverhältnisse oberhalb von Hameln bzw.<br />
Minden verbessert werden. Außerdem waren die<br />
Baukosten der beiden Talsperren wesentlich geringer<br />
als die Kosten der Stauregelung.<br />
Das preußische <strong>Wasser</strong>gesetz vom 1. April 1905,<br />
mit dem die Gr<strong>und</strong>lage zum Bau des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
von Bergeshövede bis Hannover geschaffen<br />
wurde, sah folglich auch den Bau der beiden Talsperren<br />
an Eder <strong>und</strong> Diemel vor.<br />
Erst als zwischen den beiden Weltkriegen die Errichtung<br />
von Talsperren im Nordharz <strong>und</strong> Harzvorland<br />
zur <strong>Wasser</strong>versorgung des nun im Bau befindlichen<br />
östlichen Teil des <strong>Mitte</strong>llandkanals, wegen befürchteter<br />
Schädigung der Landeskultur <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>wirtschaft, nicht<br />
realisiert werden konnte, beschloss man, die Weser von<br />
Minden bis Bremen zu "kanalisieren" <strong>und</strong> das durch den<br />
Wegfall der Talsperren<br />
ersparte Geld für diese<br />
Maßnahme zu verwenden.<br />
Nach damals<br />
angestellten Berechnungen<br />
setzte eine<br />
zusätzliche <strong>Wasser</strong>entnahme<br />
aus der Weser<br />
für den östlichen Teil<br />
des <strong>Mitte</strong>llandkanals die<br />
Stauregelung zwingend<br />
voraus.<br />
Bereits in den Jahren<br />
1906 - 1911 war in<br />
Bremen-Hemelingen eine<br />
Staustufe als Endpunkt<br />
der Ausbaustrecke<br />
der Unterweserkorrektion<br />
von L. Franzius<br />
errichtet worden. Sie<br />
sollte eine weitere Erosion<br />
der Flusssohle<br />
stromauf <strong>und</strong> eine damit zusammenhängende <strong>Wasser</strong>spiegelabsenkung<br />
oberhalb Bremens verhindern. Eine weitere<br />
Staustufe wurde in den Jahren 1907 – 1914 in Dörverden<br />
errichtet. Durch sie wurde in Trockenzeiten die Abgabe von<br />
Weserwasser für die Bewässerung von landwirtschaftlichen<br />
Flächen zwischen Hoya <strong>und</strong> Bremen möglich. Außerdem<br />
wurde durch ein mit der Staustufe errichtetes <strong>Wasser</strong>kraftwerk<br />
das Hauptpumpwerk Minden über eine eigene Hochspannungsleitung<br />
für einige Jahrzehnte mit elektrischer<br />
Energie versorgt.<br />
Im Jahre 1934 wurde mit den Arbeiten zur Stauregelung<br />
der <strong>Mitte</strong>lweser durch die Herstellung von fünf weiteren<br />
Staustufen in Petershagen, Schlüsselburg, Landesbergen,<br />
Drakenburg <strong>und</strong> Langwedel begonnen (Abb. 10). Im Jahre<br />
1942 mussten die Arbeiten, die zu etwa einem Drittel fertiggestellt<br />
waren, infolge der Kriegsereignisse eingestellt werden.<br />
Die im Fluss unvollendet gebliebenen Bauwerke engten<br />
das Fahrwasser für die Schifffahrt ein <strong>und</strong> behinderten
Abb. 10 - Bau des Wehres Petershagen<br />
die Vorflut. Daneben war es erforderlich, die unfertigen<br />
Bauwerke mit hohen Ausgaben zu unterhalten. Dieser<br />
Zustand erforderte nach dem Krieg eine möglichst frühzeitige<br />
Fortsetzung der Arbeiten. Da auch die Energiewirtschaft<br />
bei den neuen Staustufen an der Stromerzeugung aus<br />
Abb. 11 - Staustufen der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
<strong>Wasser</strong>kraft interessiert war, wurden die Arbeiten<br />
bereits im Jahre 1952 wieder aufgenommen. 1960<br />
konnte die Stauregelung der <strong>Mitte</strong>lweser abgeschlossen<br />
werden (Abb. 11).<br />
Die staugeregelte Strecke von Minden bis Bremen-<br />
Hemelingen ist rd. 156 km lang. Das Gefälle zwischen<br />
dem Stau der obersten Staustufe Petershagen <strong>und</strong><br />
Hemelingen beträgt 32,5 m. Die Stauhöhe der einzelnen<br />
Haltungen – bezogen auf den hydrostatischen<br />
Stau – wechselt zwischen 4,50 m <strong>und</strong> 6,40 m. An<br />
jeder Staustufe wird die vorhandene Weserschleife<br />
mit einem Durchstich abgeschnitten, durch den der<br />
Schiffsverkehr geleitet wird. Hierdurch wird die von<br />
der Schifffahrt zu befahrende Weserstrecke von<br />
Minden bis Bremen um rd. 20 km verkürzt. Das zur<br />
jeweiligen Staustufe gehörende Wehr (Abb. 12) mit<br />
<strong>Wasser</strong>kraftwerk befindet sich in der Weserschleife;<br />
die in den Durchstichen (Schleusenkanälen) angeordneten<br />
Schleusen besitzen nutzbare Längen von<br />
215 - 225 m <strong>und</strong> eine Kammerbreite von 12,30 m<br />
(Abb. 13). Mit den an den Staustufen befindlichen<br />
Kraftwerken wird elektrische Energie auf besonders<br />
umweltfre<strong>und</strong>liche Weise erzeugt.<br />
Das Ziel der Stauregelung der <strong>Mitte</strong>lweser war die Herstellung<br />
einer Fahrwassertiefe von 2,50 m unter hydrostatischem<br />
Stau für den Schifffahrtsweg von Minden bis<br />
Bremen. Infolge verschiedener Behinderungen (Untiefen in<br />
Vorhäfen <strong>und</strong> an den Mündungen der Schleusenkanäle<br />
nach Hochwasserereignissen) wurde bis 1977 eine<br />
Fahrwassertiefe von 2,20 m, danach von 2,50 m unter<br />
hydrostatischem Stau erreicht. Die <strong>Mitte</strong>lweser kann<br />
nach der Binnenschifffahrtsstraßenordnung derzeit von<br />
Fahrzeugen <strong>und</strong> Schubverbänden mit einer Länge von<br />
85 m bei einer Breite von 11,45 m bzw. einer Länge von<br />
91 m <strong>und</strong> einer Breite von 8,25 m befahren werden.<br />
Verkehrsaufkommen auf der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser<br />
Der Gesamtverkehr der <strong>Mitte</strong>lweser hatte <strong>2005</strong> ein Ladungsaufkommen<br />
von 6,980 Mio. Tonnen, die sich in<br />
einen Gebietsverkehr von 6,689 Mio. Tonnen <strong>und</strong> einen<br />
Durchgangsverkehr von 0,291 Mio. Tonnen aufgliedern<br />
(Abb. 14). Die wichtigsten Umschlaggüter an der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
waren <strong>2005</strong> Baustoffe (3,778 Mio. Tonnen), Getreide/Futtermittel<br />
(0,998 Mio. Tonnen) sowie Kohle<br />
(0,948 Mio. Tonnen).<br />
In der Binnenschifffahrt hat der Transport von Containern<br />
in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung<br />
gewonnen. Während beispielsweise zwischen 1995 <strong>und</strong><br />
2004 die Beförderungsmenge in der Binnenschifffahrt<br />
b<strong>und</strong>esweit mit rd. 240 Mio. Tonnen nahezu gleich blieb,<br />
ist dagegen die im Container transportierte Warenmenge<br />
um über 160 % angestiegen. Der Anteil der im Container<br />
bewegten Güter an der Gesamtbeförderung der<br />
Binnenschifffahrt erhöhte sich in diesem Zeitraum von<br />
2,2 % auf 5,7 %. Während auf dem Rhein als meistbefahrene<br />
<strong>Wasser</strong>straße Europas der Container-Transport<br />
von <strong>und</strong> zu den Seehäfen Rotterdam, Antwerpen <strong>und</strong><br />
Amsterdam seinen Siegeszug bereits in den 80er Jahren<br />
angetreten hat, werden auf der Elbe <strong>und</strong> im nordwestdeutschen<br />
Kanalnetz etwa seit dem Jahr 1995<br />
Container vom Seehafen Hamburg zu Binnenhäfen am<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal <strong>und</strong> an der Elbe transportiert. Aus kleinen<br />
Anfängen heraus haben sich diese Transporte mit<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
25
26<br />
Abb. 12 - Wehr Petershagen<br />
erheblichen jährlichen Zuwachsraten inzwischen fest etabliert.<br />
Auf der <strong>Mitte</strong>lweser begann das Container-Zeitalter im<br />
Jahre 2002 mit der Fertigstellung eines Container-<br />
Terminals in Minden <strong>und</strong> der Aufnahme regelmäßiger Verkehre<br />
von <strong>und</strong> nach Bremerhaven (Abb. 15). Der Hafen<br />
Minden nimmt mit seiner Lage am Kreuzungspunkt von<br />
Weser <strong>und</strong> <strong>Mitte</strong>llandkanal eine wichtige Rolle für den Wirtschaftsraum<br />
Ostwestfalen ein. Der Hafen wird heute sowohl<br />
von Container-Linien aus Bremerhaven/Bremen als auch<br />
Hamburg regelmäßig angelaufen. Wurde nach der Einrichtung<br />
des Container-Terminals im Jahre 2003 ein Umschlag<br />
von 1.475 TEU getätigt, hat sich die Umschlagsmenge<br />
innerhalb von nur zwei Jahren auf 9.787 TEU in <strong>2005</strong> erhöht.<br />
Dabei entfallen etwa 45 % der Container auf die Relation<br />
Minden - Bremen/Bremerhaven. Mit heute jeweils zwei<br />
Abfahrten pro Woche von Bremerhaven nach Minden bzw.<br />
von Minden nach Bremerhaven hat damit der Container-<br />
Transport auf der Weser innerhalb nur weniger Jahre eine<br />
erfreuliche Entwicklung genommen, die für die Zukunft<br />
weitere erhebliche Steigungsraten erwarten lässt.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
Abb. 14 – Gesamtverkehr auf der <strong>Mitte</strong>lweser <strong>2005</strong><br />
An der Schleuse Petershagen wurde im Jahr<br />
<strong>2005</strong> eine Durchgangsmenge an Containern von<br />
7.413 TEU gezählt. Neben den Containern, die<br />
im Hafen Minden von <strong>und</strong> nach<br />
Bremen/Bremerhaven umgeschlagen wurden,<br />
sind in dieser Zahl auch die Container enthalten,<br />
die über die <strong>Mitte</strong>lweser <strong>und</strong> den <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
vorbei an Minden in Richtung Osten nach<br />
Hannover/Braunschweig (oder umgekehrt) transportiert<br />
wurden. Weiterhin enthalten sind Containertransporte,<br />
die zu Häfen im Ruhrgebiet <strong>und</strong><br />
am Rhein erfolgten. Wünschenswert wäre hier<br />
eine noch stärkere Etablierung dieser Transporte<br />
in Richtung Westen möglichst mit Einbindung der<br />
Großräume Osnabrück <strong>und</strong> Münster.<br />
Abb. 13 – Schleuse Landesbergen
Die Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
an das Großmotorgüterschiff<br />
Seit Jahrzehnten zeichnet sich ein Trend zu größeren<br />
Schiffen ab. Die Zukunft gehört dem Großmotorgüterschiff<br />
(GMS) von 110 m Länge, 11,45 m Breite <strong>und</strong> 2,80 m Abladung.<br />
Darüber hinaus drängt das bisher nur auf dem Rhein<br />
verkehrende übergroße Motorgüterschiff mit 135 m Länge<br />
(ÜGMS) auch in das Netz der übrigen B<strong>und</strong>eswasserstraßen.<br />
Die 156 km lange <strong>Mitte</strong>lweser zwischen Minden <strong>und</strong><br />
Bremen verfügt nach Fertigstellung der letzten der sieben<br />
Staustufen im Jahre 1960 bei hydrostatischem Stau über<br />
eine <strong>Wasser</strong>tiefe von 2,50 m. Die Schiffslänge wird durch<br />
die kleine Kammer in Dörverden <strong>und</strong> die Schachtschleuse<br />
in Minden auf 85 m begrenzt. Die große Kammer in<br />
Dörverden hat zwar eine Länge von 225 m, aber nur eine<br />
Drempeltiefe von 2,65 m. Die übrigen Schleusen haben<br />
ausreichende Längen von mehr als 214 m, Drempeltiefen<br />
von 3,00 m (Hemelingen 4,00 m) <strong>und</strong> lichte Breiten von<br />
12,30 m (Hemelingen 12,50 m).<br />
Im Jahre 1988 wurde in einem Regierungsabkommen zwischen<br />
dem B<strong>und</strong> <strong>und</strong> der Freien Hansestadt Bremen unter<br />
Kostenbeteiligung Bremens der Ausbau der <strong>Mitte</strong>lweser für<br />
das 2,50 m abgeladene Europaschiff (ES) mit einer Länge<br />
von 85 m <strong>und</strong> einer Breite von 9,50 m beschlossen. In<br />
einem ergänzenden Abkommen aus dem Jahre 1997 wurde<br />
entsprechend der Entwicklung in der Binnenschifffahrt<br />
festgelegt, dass die <strong>Mitte</strong>lweser auf ganzer Länge auch für<br />
das GMS allerdings nur auf 2,50 m Tiefe teilabgeladen <strong>und</strong><br />
mit eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten ausgebaut<br />
werden soll. Zwei Drittel der Kosten trägt der B<strong>und</strong>, ein<br />
Drittel das Land Bremen.<br />
Eine Untersuchung für die Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser an<br />
das GMS aus dem Jahre 1994 zeigt, dass die Variante mit<br />
eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten des GMS das<br />
höchste Nutzen/Kosten-Verhältnis von 3,2 ergibt. Die Vertiefung<br />
der <strong>Mitte</strong>lweser wurde bereits im B<strong>und</strong>esverkehrswegeplan<br />
(BVWP) 1992 <strong>und</strong> erneut im derzeit<br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
Abb. 15 - Containerschiff bei der Ausfahrt aus der Schachtschleuse Minden<br />
gültigen BVWP 2003 in den "vordringlichen Bedarf" aufgenommen.<br />
Der Entwurf HU für "Anpassungsmaßnahmen an der <strong>Mitte</strong>lweser"<br />
aus dem Jahre 1997 ersetzt den Rahmenentwurf<br />
"für Anpassungsmaßnahmen an der <strong>Mitte</strong>lweser zur Befahrung<br />
mit 2,50 m abgeladenen Europa-Schiffen" aus dem<br />
Jahre 1977. In dem Entwurf HU aus dem Jahre 1997 werden<br />
die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen für den<br />
Verkehr des 2,50 m abgeladenen GMS mit eingeschränkten<br />
Begegnungsmöglichkeiten veranschlagt. Der Entwurf<br />
schließt ab mit Kosten von 137,6 Mio. DM.<br />
Anpassungsmaßnahmen von Minden bis<br />
Landesbergen (km 204,4 - 252,6)<br />
Die Anpassungsmaßnahmen in den Stauhaltungen<br />
Petershagen, Schlüsselburg <strong>und</strong> Landesbergen sind für<br />
den Verkehr des ES nach dem Rahmenentwurf aus dem<br />
Jahre 1977 bis auf die Deckwerkserneuerung im Schleusenoberkanal<br />
Schlüsselburg <strong>und</strong> im Schleusenunterkanal<br />
Petershagen abgeschlossen. Mit den für das ES ausgeführten<br />
Anpassungsmaßnahmen ist auch ein eingeschränkter<br />
Begegnungsverkehr mit dem GMS möglich. Derzeit wird<br />
untersucht, welche ergänzenden Maßnahmen für den Verkehr<br />
des GMS noch erforderlich sind.<br />
Geplante Anpassungsmaßnahmen von Landesbergen<br />
bis Bremen (km 252,6 - 362,0)<br />
Der Entwurf HU sieht in den unteren vier Stauhaltungen<br />
Drakenburg, Dörverden, Langwedel <strong>und</strong> Hemelingen vor,<br />
dass für einen Begegnungsverkehr mit GMS drei Schleusenkanäle<br />
mit insgesamt 8,5 km Länge ausgebaut <strong>und</strong> in<br />
Krümmungen neunzehn Ufer zurückverlegt werden sollen.<br />
Sieben ökologisch hochwertige Kurven <strong>und</strong> zwei Schleusenkanäle<br />
können auch künftig nur einschiffig befahren<br />
werden. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:<br />
• Im Fließgewässer der Stauhaltungen wird die Fahrrinne<br />
von derzeit 2,50 m auf 2,80 m (zuzüglich 0,20 m<br />
Vorratsbaggerung) unter hydrostatischem Stau vertieft.<br />
Die Baggerungen beschränken sich auf den oberen<br />
Bereich der Haltung.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
27
28<br />
• Die Querschnittsaufweitungen in den engen Flusskrümmungen<br />
erfolgen bevorzugt am Gleithang mit einer<br />
flachen Böschungsneigung von 1 : 6. Dabei wird<br />
die derzeit vorhandene Schüttsteinbefestigung entfernt.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der vorgesehenen flachen Neigungen kann<br />
das Ufer durch Lebendverbau geschützt werden.<br />
• Für den Ausbau der Schleusenkanäle gelten die<br />
"Richtlinien für Regelquerschnitte von Schifffahrtskanälen,<br />
Ausgabe 1994". Mit der Vorgabe von 2,50 m Abladung<br />
muss die Sohle in den Schleusenkanälen auf<br />
3,50 m unter hydrostatischem Stau vertieft werden,<br />
was einer maximalen Vertiefung von 50 cm in den<br />
Ober- <strong>und</strong> 75 cm in den Unterkanälen entspricht. Eine<br />
Querschnittsaufweitung ist nur in Schleusenkanälen mit<br />
einer Länge von mehr als 1000 m vorgesehen. Die<br />
Querschnittsaufweitung erfolgt im Trapezprofil, bzw. im<br />
Schleusenoberkanal Langwedel wegen der engen<br />
Platzverhältnisse im kombinierten Rechteck-Trapez<br />
(KRT)-Profil.<br />
Ökologisch wertvolle Uferbereiche bleiben unverändert;<br />
durch die geplanten Ausgleichs- <strong>und</strong> Ersatzmaßnahmen<br />
kann regional sogar eine Verbesserung des bestehenden<br />
Zustandes erreicht werden. Die Hochwassersituation wird<br />
durch den Ausbau nicht verschlechtert, Hochwasserspitzen<br />
werden örtlich sogar reduziert. Das anfallende Baggergut<br />
soll weitestgehend in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt<br />
werden.<br />
Für die unteren vier Stauhaltungen (Drakenburg,<br />
Dörverden, Langwedel, Hemelingen) liegt der Beschluss im<br />
Planfeststellungsverfahren "für die Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
an den Verkehr mit auf 2,50 m abgeladenen 1.350t-<br />
Schiffen <strong>und</strong> den Verkehr von Großmotorgüterschiffen mit<br />
Begegnungs- <strong>und</strong> Abladebeschränkungen Weser-km<br />
252,600 - 354,190" mit Datum vom 15.11.2002 vor. Derzeit<br />
sind gegen den Planfeststellungsbeschluss noch zwei Klagen<br />
beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht<br />
Lüneburg anhängig.<br />
In dem zum Zuständigkeitsbereich der <strong>WSD</strong> Nordwest<br />
gehörenden Teil der <strong>Mitte</strong>lweser km 354,19 bis 362,0 <strong>und</strong><br />
im nur binnenschiffstiefen Teil der Unterweser bis Unterweser<br />
km 1,4 sind keine Anpassungsmaßnahmen erforderlich.<br />
Neubau der Schleusen Dörverden <strong>und</strong><br />
Minden,<br />
Möglichkeit des Verkehrs von 139 m langen<br />
Schubverbänden<br />
Vom B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr, Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen<br />
wurde der Ausbau der <strong>Mitte</strong>lweser im Jahre 2003<br />
erneut einer gesamtwirtschaftlichen Bewertung unterzogen.<br />
Die gesamtwirtschaftlichen Bewertungsrechnungen wurden<br />
auf der Basis aktualisierter Umschlags- <strong>und</strong> Verkehrsprognosen<br />
anhand der Bewertungsmethodik des BVWP 2003<br />
durchgeführt.<br />
Die "Gesamtwirtschaftliche Untersuchung zum Ausbau der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser sowie zum Neubau eines Weser-Jade-Kanals"<br />
liegt mit Datum vom Juni 2003 vor. Dabei erzielen die Ausbaumaßnahmen<br />
für übergroße Motorgüterschiffe (ÜGMS)<br />
bis 135 m Länge bzw. Verbände bis 139 m Länge <strong>und</strong><br />
jeweils 11,45 m Breite <strong>und</strong> 2,50 m Abladung mit einem<br />
Nutzen/Kosten-Verhältnis von 3,15 das beste gesamtwirtschaftliche<br />
Resultat.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
Das BMVBW hat daraufhin entschieden, dass der Bau der<br />
Schleusen in Dörverden <strong>und</strong> der Abstiegsschleuse vom<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal (MLK) im Verbindungskanal Nord in Minden<br />
mit jeweils 139 m Nutzlänge in den vordringlichen Bedarf<br />
des BVWP 2003 eingestellt wird. Unter der Voraussetzung,<br />
dass die in Aussicht gestellten Haushaltsraten zur Verfügung<br />
stehen, ist vorgesehen, den Neubau der Schleuse<br />
Dörverden bis Ende 2010 <strong>und</strong> den Neubau der Schleuse<br />
Minden bis Ende 2012 fertig zu stellen. Die Kosten für die<br />
neue Schleuse in Dörverden betragen 34 Mio. € <strong>und</strong> für die<br />
neue Schleuse in Minden 62 Mio. € (ohne die Kosten für<br />
den Umbau des Bauhofs des WSA Minden). Die Planungsarbeiten<br />
liegen im Zeitrahmen, Anfang 2006 wird das Planfeststellungsverfahren<br />
für den Neubau der Schleuse<br />
Dörverden, <strong>Mitte</strong> 2006 für den Neubau der Schleuse Minden<br />
eingeleitet.<br />
Stufenweises Erreichen des Ausbauziels<br />
Die Anpassungsmaßnahmen an der <strong>Mitte</strong>lweser sind<br />
hochwirtschaftlich. Sie müssen sich aber bei den verfügbaren<br />
knappen Haushaltsmitteln in eine b<strong>und</strong>esweite Prioritätenliste<br />
für die <strong>Wasser</strong>straßen einreihen. Ziel ist es, mit den<br />
nur beschränkt verfügbaren <strong>Mitte</strong>ln kurzfristig einen möglichst<br />
großen Nutzen zu erzielen. Für den <strong>Mitte</strong>lweserausbau<br />
ist deshalb in Abstimmung mit dem B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung ein stufenweiser<br />
Ausbau vorgesehen.<br />
Der stufenweise Ausbau der <strong>Mitte</strong>lweser, bei dem schrittweise<br />
größere Fahrzeuge zugelassen werden sollen, erfordert<br />
auch eine stufenweise auszubauende Verkehrslenkung,<br />
durch die unzulässige Begegnungen in den zunächst<br />
verbleibenden zusätzlichen Engstellen ausgeschlossen<br />
werden sollen.<br />
Von der B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau liegen für die einzelnen<br />
Ausbauschritte Aussagen zu einer Begegnungsmöglichkeit<br />
der Schiffstypen Gustav Koenigs (Länge 67 m,<br />
Breite 8,2 m, Tauchtiefe 2,50 m), ES <strong>und</strong> GMS bei den<br />
<strong>Wasser</strong>spiegellagen "hydrostatischer Stau" <strong>und</strong> "bordvoller<br />
Abfluss" vor. Dabei wird für den Zustand des Endausbaus<br />
auch ein einschiffiger Verkehr von ÜGMS mit bis 135 m<br />
bzw. von Verbänden mit bis 139 m Länge <strong>und</strong> mit jeweils<br />
2,50 m Abladung untersucht. Mit Hilfe des Programms<br />
PETRA werden in den Modellbetrachtungen die Bereiche<br />
ermittelt, die eine Begegnung zulassen, eingeschränkt<br />
zulassen oder nicht zulassen.<br />
Künftig ist mit einer weiteren deutlichen Steigerung des<br />
Containerverkehrs <strong>und</strong> des Transports von Massengütern<br />
zu rechnen. Immer mehr ausländische Schiffsführer verkehren<br />
auf der <strong>Mitte</strong>lweser. Da diese teilweise die deutsche<br />
Sprache nicht oder nur unzureichend beherrschen, werden<br />
die Verständigungsprobleme zunehmen. Dabei dürfen<br />
Schiffsführer auch ohne Ortsk<strong>und</strong>e die <strong>Mitte</strong>lweser befahren,<br />
sofern sie über ein Rhein- oder B-Patent verfügen.<br />
Auch aus diesen Gründen ist eine Verkehrslenkung erforderlich.<br />
Als Verkehrslenkung steht ein System bestehend aus AIS-<br />
Transpondern, elektronischer Binnenschiffskarte <strong>und</strong> zusätzlichem<br />
Selbstwahrschau über Funk zur Diskussion,<br />
wobei die AIS-Meldungen in einer Zentrale zusammenlaufen<br />
<strong>und</strong> dort überwacht werden sollen.
Für den Ausbau der <strong>Mitte</strong>lweser sind unter Einbeziehung<br />
der geplanten Schleusen-Neubauten in Minden <strong>und</strong><br />
Dörverden nunmehr folgende Ausbaustufen geplant<br />
(Abb. 16):<br />
1. Stufe: 2006 – 2007:<br />
für den Verkehr des 2,50 m abgeladenen ES mit Begegnungseinschränkungen<br />
• Vertiefung der vorhandenen Fahrrinne des Fließgewässers<br />
unterhalb von Landesbergen auf 2,80 m 1]<br />
• Vertiefung der Schleusenkanäle auf 3,20 m 1] unter<br />
Beibehaltung der alten Deckwerke<br />
• Verkehrslenkung ES/ES<br />
2. Stufe: 2008 – 2012:<br />
für den wasserstandsabhängigen Richtungsverkehr des<br />
2,50 m abgeladenen GMS<br />
• Ausbau der Schleusenkanäle auf 3,50 m 1]<br />
• Verkehrslenkung ES/ES<br />
• ab 2012 mit Fertigstellung der Schleusen Dörverden<br />
(2010) <strong>und</strong> Minden (2012) Verkehrslenkung ES/GMS<br />
3. Stufe: nach 2012:<br />
für den wasserstandsabhängigen Verkehr des GMS mit<br />
Begegnungseinschränkungen <strong>und</strong> dem Richtungsverkehr<br />
des ÜGMS, jeweils mit 2,50 m Abladung:<br />
• Ausbau der Fahrrinne des Fließgewässers unterhalb<br />
von Minden auf 2,80 m 1) mit 19 Kurvenverbreiterungen<br />
im Bereich Landesbergen-Hemelingen gemäß Planfeststellungsbeschluss<br />
vom 15.11.2002<br />
• ggf. weitere Kurvenverbreiterungen zwischen Minden<br />
<strong>und</strong> Landesbergen aufgr<strong>und</strong> eines weiteren Planfeststellungsverfahrens<br />
• Verkehrslenkung ES/GMS/ÜGMS<br />
1) bezogen auf hydrostatischen Stau<br />
Die 1. Stufe, mit deren Verwirklichung in 2006 begonnen<br />
wird, kann nur einen vorübergehenden Zwischenzustand<br />
darstellen, da die ohnehin schon abgängigen Deckwerke in<br />
den Schleusenkanälen weiter auf Verschleiß gefahren<br />
werden. Auch die 2. Stufe muss wegen der vielen Begegnungsverbote<br />
kurzfristig durch die 3. Stufe ersetzt werden.<br />
Erst mit der 3. Stufe können die Verkehrsrestriktionen auf<br />
das geplante Maß zurückgenommen werden. Aus wirtschaftlichen<br />
Gründen ist abzustreben, dass mit der Fertigstellung<br />
der Schleusen Dörverden <strong>und</strong> Minden Ende 2012<br />
auch die 3. Stufe der Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser abgeschlossen<br />
wird. Erst dann wird das gesteckte Ausbauziel<br />
erreicht. Darüber hinaus wäre dann auch gr<strong>und</strong>sätzlich ein<br />
– allerdings nur einschiffiger – Verkehr von 139 m langen<br />
Schubverbänden <strong>und</strong> von 135 m langen ÜGMS möglich.<br />
Abb. 16 - Terminplan für den schrittweisen Ausbau der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
Der Binnenschifffahrtsweg Weser – Geschichte <strong>und</strong> Zukunft<br />
Bis 2012 werden auch die Ausbaumaßnahmen an der<br />
"Kanalschiene" zwischen Rhein <strong>und</strong> den Berliner <strong>Wasser</strong>-<br />
straßen so weit abgeschlossen sein, dass das GMS durchgehend<br />
zwischen West <strong>und</strong> Ost verkehren kann. Ab diesem<br />
Zeitpunkt sind somit die mit den niedersächsischen <strong>und</strong><br />
bremischen Häfen an Unter- <strong>und</strong> Außenweser konkurrierenden<br />
Rhein-Mündungshäfen über den Dortm<strong>und</strong>-Ems-<br />
Kanal vollschiffig an das mitteleuropäische Binnenwasserstraßennetz<br />
angeschlossen. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit<br />
zu erhalten, drängen Bremen <strong>und</strong> Niedersachsen auf eine<br />
zügige Durchführung auch der Anpassungsmaßnahmen in<br />
der <strong>Mitte</strong>lweser.<br />
Zusammenfassung<br />
Seit Jahrh<strong>und</strong>erten ist die Weser ein wichtiger Handelsweg<br />
für den Güteraustausch zwischen Städten im Binnenland<br />
<strong>und</strong> dem Seehafen Bremen. Der F<strong>und</strong> eines mit Sandsteinblöcken<br />
beladenen Weserkahns in einem Weserarm bei<br />
Rohrsen (Nienburg) im Jahre 1999 zeigte eindrucksvoll, wie<br />
der Gütertransport im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert durchgeführt wurde.<br />
Der Weserkahn kann heute im Weserrenaissance-Museum<br />
Schloß Brake in Lemgo besichtigt werden.<br />
Noch bis ins 20. Jahrh<strong>und</strong>ert hinein hatte die Weser mit<br />
ihren Quell- <strong>und</strong> wichtigsten Nebenflüssen (Fulda, Werra<br />
<strong>und</strong> Aller) eine zentrale Bedeutung für den Güterverkehr.<br />
Mit dem Aufkommen der Eisenbahn <strong>und</strong> später des LKW's<br />
<strong>und</strong> dem immer dichteren Ausbau des Eisenbahn- <strong>und</strong> des<br />
Straßennetzes ist der gewerbliche Verkehr auf der Fulda,<br />
Werra <strong>und</strong> Aller erloschen. Auf der Oberweser ist er infolge<br />
der größer gewordenen Schiffsgefäße <strong>und</strong> der zu geringen<br />
<strong>Wasser</strong>tiefen erheblich zurückgegangen. Dagegen ist in<br />
den vergangenen Jahrzehnten die Bedeutung der Oberweser<br />
für den Tourismus deutlich gestiegen. Die Fahrgast-<br />
<strong>und</strong> Sportschifffahrt, der Weserradweg <strong>und</strong> weitere touristische<br />
Angebote an den Ufern des Flusses haben sich zu<br />
einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt.<br />
Die <strong>Mitte</strong>lweser (Minden - Bremen) besitzt noch heute eine<br />
große Bedeutung für den Gütertransport mit dem umweltfre<strong>und</strong>lichen<br />
Binnenschiff. Neben Massengütern werden<br />
hier seit einigen Jahren zunehmend auch Container von<br />
<strong>und</strong> zu den Nordseehäfen befördert. Der Stauregelung der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser <strong>Mitte</strong> des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts wurde das seinerzeitige<br />
Bemessungsschiff zugr<strong>und</strong>e gelegt. Um die<br />
Konkurrenzfähigkeit der <strong>Wasser</strong>straße zu erhalten <strong>und</strong><br />
nach Möglichkeit zu steigern, soll die <strong>Mitte</strong>lweser an moderne<br />
Schiffseinheiten angepasst werden.<br />
In der globalisierten Welt mit ständig wachsenden Umschlagzahlen<br />
in den deutschen Seehäfen kommt der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
als Hinterlandverbindung für die bremischen <strong>und</strong><br />
niedersächsischen Häfen an der Unter- <strong>und</strong> Außenweser<br />
eine hohe Bedeutung zu. Die Anpassungsmaßnahmen in<br />
der <strong>Mitte</strong>lweser müssen dieser Bedeutung gerecht werden.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
29
30<br />
Neubestimmung der Inhaltslinie<br />
der Edertalsperre<br />
Veranlassung<br />
Die Speicherinhaltslinie der Edertalsperre, die das Volumen<br />
des in der Talsperre befindlichen <strong>Wasser</strong>s in Abhängigkeit<br />
vom <strong>Wasser</strong>stand angibt, wurde während der Bauzeit der<br />
Talsperre 1912 traditionell vermessungstechnisch bestimmt<br />
<strong>und</strong> in 10 cm Höhenauflösung festgehalten. Diese Inhaltslinie<br />
wurde in den 70er Jahren von der Universität Hannover<br />
mit Hilfe einer Spline-Funktion verbessert <strong>und</strong> so auf eine<br />
Auflösung von 1 cm verfeinert, um den verbesserten Möglichkeiten<br />
der aufkommenden elektronischen Datenverarbeitung<br />
Rechnung zu tragen. Diese auf 10.000 m³ ger<strong>und</strong>ete<br />
Inhaltslinie wurde seit 1980 verwendet.<br />
Seit der Erstellung der ursprünglichen Inhaltslinie sind im<br />
Laufe der Zeit Veränderungen im Staubecken, an der<br />
Staumauer <strong>und</strong> auch in der Bewirtschaftung eingetreten,<br />
die bei genauer Betrachtung die Vermutung nahe legten,<br />
dass die Jahrzehnte lang verwendete Inhaltslinie nicht mehr<br />
uneingeschränkt gelten kann.<br />
Im Jahr 2001 wurde vom <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
(WSA) Hann. Münden eine verbesserte Bilanzierung der<br />
Talsperre eingeführt, mit der eine genauere Bewirtschaftung<br />
der Talsperre in den Wintermonaten ermöglicht werden<br />
sollte. Es kam jedoch immer wieder zu Differenzen<br />
zwischen dem berechneten <strong>und</strong> dem nach der Inhaltslinie<br />
bestimmten Volumen. Neben anderen möglichen Ursachen,<br />
wie zum Beispiel einer ungenauen Bestimmung des Zuflusses<br />
/ Abflusses <strong>und</strong> des Niederschlages, wurde als<br />
Fehlerquelle die Inhaltslinie als eine wesentliche Ursache<br />
ermittelt.<br />
Hinzu kam, dass sich in den Bemessungsrichtlinien für<br />
Entlastungsbauwerke Veränderungen ankündigten, die<br />
eine Ergänzung der vorhandenen Inhaltslinie notwendig<br />
machten. Gemäß DIN 19700-11 (neu) ist die Edertalsperre<br />
in die Talsperrenklasse 1 einzuordnen, für die der<br />
Lastfall BHQ2 mit T=10.000 a anzuwenden ist. Die bisherige<br />
Stauraumbestimmung umfasste aber lediglich<br />
den Bereich bis zum BHQ1 T=1.000 a. Auch aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong> bestand ein Handlungsbedarf, die Speicherinhaltslinie<br />
zu überprüfen.<br />
Vorbereitung<br />
Im Jahr 2002 wurde die Fachstelle Vermessungs- <strong>und</strong><br />
Kartenwesen bei der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> mit der Organisation<br />
der Neuvermessung durch das WSA Hann. Münden<br />
beauftragt. Schnell stellte sich heraus, dass das im<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Jiri Cemus<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Hann. Münden<br />
Kommen befindliche Laserscannverfahren den besten<br />
Erfolg für die Lösung der Fragestellung versprach.<br />
Die Forderung des WSA Hann. Münden war kurz beschrieben:<br />
Lieferung einer <strong>Wasser</strong>stands-Inhaltslinie <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>stands-Flächenlinie<br />
in 1 cm Auflösung ab angetroffenen<br />
<strong>Wasser</strong>spiegel bis zum vermutlichen HW10.000. Die Daten<br />
sollten unger<strong>und</strong>et auf 1 m³ bzw. auf 1 m² rechnerischer<br />
Genauigkeit <strong>und</strong> ohne Ausgleichsfunktion, so wie sie aus<br />
dem Digitalen Geländemodell (DGM) roh berechnet werden,<br />
geliefert werden.<br />
Die Haushaltsmittel für die Vermessung wurden in 2002 für<br />
das Jahr 2003 beantragt <strong>und</strong> bewilligt. Damit war die Hoffnung<br />
verb<strong>und</strong>en, dass die <strong>Wasser</strong>spiegellage für die Vermessung<br />
im Herbst 2003 eine möglichst große Lammelle<br />
des bewirtschafteten Volumens freigegeben würde. Je<br />
näher der vorgesehene Befliegungstermin rückte, desto<br />
klarer wurde, dass die Hoffnungen nicht nur erfüllt, sondern<br />
übertroffen wurden, da so gut wie der gesamte zu bewirtschaftende<br />
Raum gescannt werden konnte. Der „Jahrh<strong>und</strong>ertsommer“<br />
2003 führte zu einer Talsperre, dessen Pegel<br />
sich sehr schnell dem niedrigsten bewirtschaftbaren <strong>Wasser</strong>stand<br />
– gemäß DIN 19700 „Absenkziel“ genannt - annäherte.<br />
Die lange Trockenheit führte jedoch auch dazu, dass sich<br />
auf großen, länger als üblich trockengefallenen Flächen<br />
hohes, dichtes Gras bildete (Abb. 1), welches die Messung<br />
möglicherweise hätte verfälschen können.<br />
Abb. 1 – Grasbewuchs 2003 in der Edertalsperre
Zeitweise wurde überlegt, die bewachsenen Flächen abmähen<br />
zu lassen oder zur Beweidung freizugeben. Dies<br />
wäre aufgr<strong>und</strong> der Größe des Areals sehr aufwendig geworden<br />
<strong>und</strong> in Teilbereichen durch naturschutzrechliche<br />
Bestimmungen ohnehin kaum durchführbar gewesen.<br />
Glücklicherweise hat sich dieser Bewuchs bis zum Ende<br />
der Vegetationsperiode soweit gelegt <strong>und</strong> vermindert, dass<br />
keine wesentliche Beeinflussung des Ergebnisses mehr zu<br />
erwarten war.<br />
Rohdatenerhebung <strong>und</strong><br />
Verarbeitung<br />
Neubestimmung der Inhaltslinie der Edertalsperre<br />
Datenprüfung<br />
Die gelieferten Daten wurden im WSA Hann. Münden zunächst<br />
auf Plausibilität geprüft. Hierzu wurden die Differenzen<br />
der Volumina <strong>und</strong> der Flächen aus dem 1 cm Höhenraster<br />
gebildet <strong>und</strong> grafisch aufgetragen. Diese Differenzenbildung<br />
beschreibt die Zunahme des Inhalts pro 1 cm<br />
<strong>und</strong> entspricht mathematisch gesehen der ersten Ableitung<br />
der die Inhaltslinie beschreibenden Funktion. Bei einem<br />
natürlich geformten Gelände ist zu erwarten, das der Graph<br />
der ersten Ableitung homogen steigend ist, da sich das Tal<br />
immer weiter öffnet. Er darf keine Sprünge <strong>und</strong> keine negative<br />
Steigung aufweisen.<br />
Die Befliegung fand am 12.11.2003 zwischen<br />
08:00 Uhr <strong>und</strong> 13:00 Uhr bei besten Flugbedingungen<br />
statt. Der Pegelstand der Talsperre lag zu diesem<br />
Zeitpunkt bei 218,02 m ü. PNP <strong>und</strong> somit nur<br />
17 cm über dem Absenkziel. Die Flughöhe betrug<br />
1200 m über Gr<strong>und</strong>. Es wurde eine Dichte der Laserpunkte<br />
von mehreren Punkten pro 1 m² <strong>und</strong> eine<br />
Höhenauflösung von 1 cm erreicht. Ausgenommen<br />
davon waren größere Areale mit stehendem <strong>Wasser</strong>,<br />
die kein verwertbares Echo lieferten (Abb. 2). Aus<br />
den Rohdaten wurden im ersten Schritt die Reflexionen<br />
des Bewuchses <strong>und</strong> der Bebauung von denen<br />
des Untergr<strong>und</strong>es getrennt. Aus der verbleibenden<br />
Punktwolke wurde ein auf 1 m² Raster basierendes<br />
digitales Höhenmodell ohne Vegetation <strong>und</strong> Bebauung<br />
generiert. Die entstandenen Löcher wurden für<br />
die Weiterverarbeitung durch Interpolation der Nach-<br />
Abb. 3 – Differenzbildung 1. <strong>und</strong> 2. Ordnung der neuen Inhaltslinie - Gesamtübersicht<br />
barpixel geschlossen. Die Bereiche ohne Reflexionen (in Noch aufschlussreicher ist die zweite Ableitung, die man<br />
Abb. 2 rot dargestellt) wurden durch eine horizontale Fläche rechnerisch aus der Differenzenbildung der vorgenannten<br />
ersetzt, deren Höhe aus den Höhen der Nachbarpunkte Reihe erhält. Natürliche, offene Talflanken weisen in der<br />
interpoliert wurde. Im nächsten Schritt wurde das Höhenli- Regel eine immer geringer werdende Steigung auf. Die<br />
nienmodell erstellt <strong>und</strong> die Volumen- <strong>und</strong> Flächenermittlung Volumenänderung der Speicherinhaltslinie sollte also relativ<br />
durchgeführt.<br />
homogen <strong>und</strong> steigend sein. Der Wertebereich darf keine<br />
Die Ergebnisse lieferte die beauftragte Firma am 23.1.2004. Ausreißer aufweisen, die Werte dürfen nur innerhalb einer<br />
Neben den vom WSA Hann. Münden geforderten Ergeb- gewissen Bandbreite variieren, sie müssen immer >0 sein.<br />
nissen wurden auch eine umfangreiche Dokumentation der Ausreißer in der 2. Ableitung deuten auf größere horizonta-<br />
Vermessung <strong>und</strong> die Gr<strong>und</strong>daten vorgelegt.<br />
le Areale hin, wie sie in der freien Natur nicht vorkommen.<br />
Die Höhendaten wurden im Höhensystem DHHN92 gespei- Null bedeutet eine senkrechte Umrandung, negative Werte<br />
chert.<br />
würden überhängende Ränder bedeuten. Alle diese Bedingungen<br />
sind an den Talsperren nicht vorhanden.<br />
Tatsächlich entsprach die erste Version der Daten<br />
nicht ganz den Erwartungen. In der Nähe des <strong>Wasser</strong>spiegels<br />
gab es in der 1. Ableitung den Wert 0,<br />
in der zweiten einen negativen Wert. Dies lag an<br />
einem kleinen Fehler in der Berechnung der Inhaltslinie,<br />
der vom Auftragnehmer umgehend korrigiert<br />
wurde. Im sonstigen Datenbereich waren<br />
mehrere deutliche Ausreißer in der zweiten Ableitung<br />
zu erkennen (Abb.3).<br />
Die Ursache der einzelnen Ausreißer konnte geklärt<br />
werden. Hierbei handelte es sich um die oben<br />
genannten Areale mit stehendem <strong>Wasser</strong>, in denen<br />
während der Messung kein Laserstrahl reflektiert<br />
wurde. Diese wurden für die Volumenberechnung<br />
durch horizontale Flächen ersetzt. Von der beauftragten<br />
Firma wurde diesbezüglich noch ein zusätzlicher<br />
Nachweis am Beispiel eines längeren Ederabschnittes<br />
geführt, dass dieses Vorgehen zulässig<br />
Abb. 2 - Schummerungsbild Edertalsperre mit Restsee. Blau: <strong>Wasser</strong>fläche mit Echo,<br />
Rot: <strong>Wasser</strong>fläche ohne verwertbares Echo<br />
ist.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
31
32<br />
Datenaufbereitung<br />
Die gelieferte Inhaltslinie beschreibt<br />
den Talsperreninhalt ab dem bei der<br />
Messung angetroffenen <strong>Wasser</strong>spiegel<br />
<strong>und</strong> dies im Höhensystem<br />
DHHN92 (Höhenstatus 160 – Angabe<br />
als NHN). Für die Bewirtschaftung<br />
wird aber eine Inhaltslinie benötigt,<br />
die den gesamten Inhalt beschreibt,<br />
<strong>und</strong> das im Höhensystem der Pegellatte,<br />
deren Nullpunkt auf Normalnull<br />
von 1912 liegt (heutige Angabe: m<br />
ü.PNP - Pegelnullpunkt). In der Detailansicht<br />
der gelieferten Inhaltslinie<br />
im Bereich des <strong>Wasser</strong>spiegels (Abb.<br />
4) ist erkennbar, dass der <strong>Wasser</strong>spiegel<br />
nicht völlig scharf abgebildet<br />
ist. Diese Unschärfe wird verursacht<br />
von Laserpunkten, die an reflektierten<br />
Wellen liegen <strong>und</strong> von Laserpunkten,<br />
die von Unterwasserpunkten<br />
noch reflektiert werden. Das<br />
heißt, zunächst musste festgelegt<br />
werden, ab welcher Höhe die gelieferte<br />
Inhaltslinie vertrauenswürdig ist<br />
<strong>und</strong> übernommen werden kann. Für<br />
die Übernahme wurde schließlich die Höhe 218,30 m ü.<br />
NHN gewählt, dies ist nur 37 cm über dem “Absenkziel“.<br />
Zwischen den Höhensystemen der Pegellatte <strong>und</strong> des<br />
Laserscanns sind 7 cm Differenz. Um die Höhenangaben<br />
aus dem Laserscann auf die Pegellatte übertragen zu können,<br />
muss dieser Wert von den Laserscanndaten abgezogen<br />
werden.<br />
Festlegung der neuen Inhaltslinie<br />
Die neue Inhaltslinie wird im unteren Bereich bis 218,29 m<br />
ü. NHN (= Beginn der neuen Inhaltslinie) zunächst aus der<br />
ursprünglichen übernommen.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Neubestimmung der Inhaltslinie der Edertalsperre<br />
Abb. 4 – Differenzbildung 1. <strong>und</strong> 2. Ordnung der neuen Inhaltslinie – Detailansicht im<br />
Bereich des <strong>Wasser</strong>spiegels<br />
Ab 218,30 m ü. NHN werden die neuen Werte zu der<br />
alten Inhaltslinie aufaddiert. Einer besonderen Betrachtung<br />
bedurften die Vorbecken der Werbe <strong>und</strong><br />
des Rehbaches. Diese sind zwar in der Gesamtermittlung<br />
des Volumens enthalten, können aber, wenn<br />
im Betrieb, nicht voll als Rückhalteraum in Ansatz<br />
gebracht werden. Das Volumen zwischen Sohle <strong>und</strong><br />
Stauziel (= Überlaufschwelle der Vorbecken zur<br />
Edertalsperre) muss abgezogen werden <strong>und</strong> nur die<br />
Teilvolumina oberhalb der jeweiligen Schwellen dürfen<br />
in Ansatz gebracht werden.<br />
Nach den vorgenannten Arbeitschritten wurde<br />
schließlich die neue Inhaltslinie festgelegt.<br />
Das Ergebnis zeigt, dass nun an der bisherigen Vollfüllungshöhe<br />
(Angenommene Schwellenoberkante<br />
des Überlaufs bei 245,00 m ü. PNP) das Fassungsvermögen<br />
der Talsperre nicht mehr 202,4 Mio. m³<br />
sondern 199,67 Mio. m³ beträgt.<br />
Die Schwellenhöhen sowohl an der Edertalsperre als<br />
auch an den Überläufen der Vorbecken wurden im<br />
Rahmen dieses Projektes ebenfalls neu vermessen.<br />
Hierbei stellte sich heraus, dass die einzelnen Segmente<br />
des Talsperrenüberlaufs<br />
nicht völlig auf gleicher<br />
Höhe liegen. Die<br />
niedrigsten Segmente<br />
liegen bei der Höhenkote<br />
244,97 m ü. PNP. Somit<br />
fängt der Überlauf schon<br />
bei einem Inhalt der Edertalsperre<br />
von 199,34 Mio.<br />
m³ an. Die Abflusskurve<br />
des Überlaufes hat sich<br />
demnach ebenfalls geändert,<br />
da die unterschiedlichen<br />
Höhen der Teilsegmente<br />
in dem bisher gültigen<br />
Gutachten zu dieser<br />
Fragestellung nicht berücksichtigt<br />
wurden. Diese<br />
Anpassung wurde im Rahmen<br />
der Neubestimmung<br />
der Inhaltslinie auf Gr<strong>und</strong>lage<br />
der Abflusskurve für<br />
ein Teilsegment durch die<br />
Gewässerk<strong>und</strong>e des WSA<br />
Hann. Münden neu vorgenommen.<br />
Die Ergebnisse<br />
aus der Vermessung der<br />
Überlaufschwelle bestätigen die bisherige Beobachtung,<br />
dass einzelne Überläufe bereits unterhalb von 245,00 m ü.<br />
PNP <strong>Wasser</strong> abgeben.<br />
Abb. 5 – Höhenkontrolle an einer wassergefüllten Fläche im<br />
Ederbett<br />
Vergleich neue –<br />
alte Inhaltslinie<br />
In einem weiteren Arbeitsschritt wurden die alte <strong>und</strong> die<br />
neue Inhaltslinie miteinander verglichen, um herauszufinden,<br />
wie sich die Differenzen über die Höhe entwickeln <strong>und</strong><br />
um eventuell Aussagen zur Ursache der Veränderungen zu<br />
finden.
Neubestimmung der Inhaltslinie der Edertalsperre<br />
Abb. 6 – Vergleich der neuen mit der alten Inhaltslinie<br />
Es zeigen sich drei größere Bereiche mit einem deutlichen<br />
Defizit gegenüber der bisherigen Inhaltslinie, mit anschließenden<br />
Bereichen, die eine lokale Erosion vermuten lassen<br />
(Abb. 6). Besonders markant ist der Bereich um 243,30 m<br />
ü. PNP, der die maximale Abweichung von 3 Mio. m³ anzeigt.<br />
Ob die Abweichungen der Inhaltslinien tatsächlich auf<br />
Erosions- oder Auflandungseffekten beruhen oder eine<br />
nicht völlig genaue Erstvermessung ursächlich ist, lässt sich<br />
nicht mehr nachvollziehen, da zwischenzeitliche Vermessungen<br />
nicht vorhanden sind, um eine zeitliche Entwicklung<br />
belegen zu können. Auch existieren keine Unterlagen mehr,<br />
die die Methodik <strong>und</strong> Genauigkeit der Urvermessung dokumentieren.<br />
Vermutlich sind mehrere Ursachen für die Differenzen verantwortlich.<br />
Anpassung des Hochwasserschutzraumes<br />
Die Edertalsperre zeichnet sich durch einen zeitvariablen<br />
Hochwasserschutzraum aus. Zu Beginn eines <strong>Wasser</strong>wirtschaftsjahres<br />
am 1.11. bis zum 15.12. war der Hochwasserschutzraum<br />
konstant 72,4 Mio. m³ groß, bei einem In-<br />
halt von 130 Mio. m³. Über mehrere Stützstellen verringerte<br />
sich der Schutzraum linear, bis er am 1.5. (in einem sogenannten<br />
„trockenen Jahr“) ganz aufgegeben <strong>und</strong> die Vollfüllung<br />
angestrebt wurde.<br />
Der Hochwasserschutzraum sollte sich durch die Neuvermessung<br />
nicht zum Nachteil der Unterlieger verändern.<br />
Daher wurde der zeitvariable Hochwasserschutzraum um<br />
die Differenz zwischen altem Volumen <strong>und</strong> neuem Volumen<br />
linear verschoben. Rechnerisch ergibt sich somit der Beginn<br />
des Hochwasserschutzraumes bei einem Inhalt von<br />
126.937.410 m³. Da dieser Wert ein wenig „sperrig“ ist, wird<br />
er noch ger<strong>und</strong>et <strong>und</strong> mit den beteiligten Landesbehörden<br />
abgestimmt.<br />
Schlussbetrachtung<br />
Die neue Inhaltslinie wird bei der Bilanzierung <strong>und</strong> Bewirtschaftung<br />
der Talsperre nunmehr seit fast zwei Jahren<br />
angewendet. Die Erfahrungen zeigen, dass es nun wesentlich<br />
besser möglich ist, die sich am nächsten Tag ergebenden<br />
Volumina vorauszuberechnen. Auch in der langfristigen<br />
Bilanzierung zeigen sich verbesserte Ergebnisse.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
33
34<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Jiri Cemus<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Hann. Münden<br />
Das <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt (WSA) Hann. Münden<br />
betreibt <strong>und</strong> unterhält an Werra, Fulda <strong>und</strong> Oberweser<br />
sowie an den Zuflüssen von Eder- <strong>und</strong> Diemeltalsperre<br />
insgesamt zwanzig Pegel, an denen u.a. Abflussmessungen<br />
gemäß der Pegelvorschrift durchzuführen sind. Je nach<br />
Größe des Gewässers kommen unterschiedliche Messverfahren<br />
zum Einsatz. An den kleineren Gewässern (<strong>Wasser</strong>tiefe<br />
bis 1 m <strong>und</strong> Gewässerbreite kleiner 20 m) werden die<br />
Abflüsse mit dem Magnetinduktionsverfahren (Nautilus der<br />
Fa. Ott), Tauchstab oder mit Kleinflügeln gemessen. An<br />
den mittelgroßen Abflussmessstellen (<strong>Wasser</strong>tiefen über<br />
1 m <strong>und</strong> Gewässerbreite bis 50 m), die mit Seilkrananlagen<br />
ausgerüstet sind, wie an der unteren Fulda, unteren Werra<br />
<strong>und</strong> in Affoldern (Eder), kann mit dem Großflügel gemessen<br />
werden. Besonders aufwendig ist die Messung an größeren<br />
Abflussmessstellen, wie man sie an der Oberweser vorfindet<br />
(<strong>Wasser</strong>tiefen über 1 m <strong>und</strong> Gewässerbreite über<br />
50 m). Hier kann nur von vorhandenen Brücken <strong>und</strong> unter<br />
Einsatz eines auf einem LKW geladenen Messcontainers<br />
mit Großflügel gemessen werden. Alternativ wurde in der<br />
Vergangenheit das ADCP-Messboot „Wublitz“ des WSA<br />
Brandenburg eingesetzt. Leider ist dieser Einsatz an der<br />
Oberweser nur nach einem festen Jahreseinsatzplan möglich<br />
<strong>und</strong> nur bei einem <strong>Wasser</strong>stand, der deutlich über dem<br />
EMKlW 1 liegt. Dadurch konnte entgegen den ursprünglichen<br />
Erwartungen an der Oberweser der Abfluss kaum<br />
mehr als einmal im Jahr gemessen werden.<br />
Die Abflussmessung mit Flügel ist sehr personal- <strong>und</strong> zeitintensiv.<br />
Für eine Abflussmessung mit einem Großflügel<br />
vom LKW aus werden bis zu 8 Personen benötigt (LKW-<br />
Fahrer, Messtruppführer, zwei Gehilfen, zwei Wahrschauer<br />
zur Sicherung des Schiffsverkehrs, zwei Personen zur<br />
Verkehrssicherung auf der Brücke). Für eine vollständige<br />
Messung wird etwa ein Arbeitstag benötigt. Neben diesem<br />
Aufwand ergeben sich aus der Dauer der Messung auch<br />
Nachteile im Hinblick auf die Verwendbarkeit der Ergebnisse.<br />
Für eine Übernahme der Messergebnisse in das Datenkollektiv<br />
ist es erforderlich, dass möglichst während der<br />
gesamten Messung quasistationäre Verhältnisse herrschen.<br />
Dies ist bei einer Messdauer von über 8 St<strong>und</strong>en<br />
gerade bei ablaufenden Hochwasserwellen nicht zu erwarten.<br />
Es existieren zwar Verfahren, um leichte <strong>Wasser</strong>standsschwankungen<br />
zu korrigieren, doch ist die Gefahr<br />
sehr groß, dass innerhalb einer Messung die <strong>Wasser</strong>stands-<br />
<strong>und</strong> somit die Abflussschwankung über das zulässige<br />
Maß wächst <strong>und</strong> die gesamte Messung zu verwerfen<br />
ist.<br />
1 EMKlW = Erhöhter <strong>Mitte</strong>lkleinwasserstand<br />
Erfahrungen bei<br />
Abflussmessungen mit einem<br />
ADCP-Messgerät<br />
Aus diesen Gründen ergab sich in den letzten Jahren eine<br />
deutliche Diskrepanz zwischen der nach Pegelvorschrift<br />
erforderlichen Anzahl an Abflussmessungen <strong>und</strong> den tatsächlich<br />
durchgeführten Messungen. Abhilfe versprach ein<br />
neues Messverfahren – das sogenannte ADCP-Verfahren.<br />
Messverfahren<br />
ADCP steht für „ACCOUSTIC DOPPLER CURRENT PRO-<br />
FILER“ <strong>und</strong> ist ein akustisches Verfahren zur Abflussmessung.<br />
Das Messverfahren beruht auf dem Dopplereffekt, bei<br />
dem die Frequenzänderung des abgeschickten <strong>und</strong> zurückgeworfenen<br />
Echos eines Ultraschallsignals gemessen<br />
wird. Das Echo des Ultraschalls entsteht durch die im <strong>Wasser</strong><br />
enthaltenen Schwebstoffe. Durch die Strömung des<br />
<strong>Wasser</strong>s entfernen sich die Teilchen vom Messkopf oder<br />
nähern sich an. Durch diese Geschwindigkeitsdifferenzen<br />
entstehen die vorgenannten Frequenzänderungen. Die<br />
Geschwindigkeitsmessung erfolgt nicht nur integrativ über<br />
die gesamte <strong>Wasser</strong>tiefe, sondern in einzelnen Höhenzellen.<br />
Das besondere dieses Verfahrens besteht darin, dass<br />
das Gerät nicht nur die Geschwindigkeiten in einzelnen<br />
Höhenzellen unterhalb des Messkopfes misst, sondern<br />
auch seinen eigenen Weg über Gr<strong>und</strong> messen kann. Somit<br />
ist es möglich, den Messkopf beliebig über den Gewässerquerschnitt<br />
zu ziehen, ohne das Ergebnis der Abflussmessung<br />
zu beeinflussen. Bei der Fahrt des Messkopfes muss<br />
lediglich darauf geachtet werden, dass die Geschwindigkeit<br />
des Gerätes über Gr<strong>und</strong> geringer ist als die Strömungsgeschwindigkeit<br />
des <strong>Wasser</strong>s.<br />
Verfahrensbedingt wird bei der Messung nicht der gesamte<br />
Querschnitt gemessen. Die nicht gemessenen Bereiche<br />
werden vom Erfassungsprogramm mit abgesicherten Berechnungsformeln<br />
ergänzt. Nicht erfasst werden die Ränder,<br />
Bereiche in denen die Mindestwassertiefe unterschritten<br />
wird, die unterste Messlamelle über der Sohle <strong>und</strong> ein<br />
Teilbereich an der <strong>Wasser</strong>oberfläche. Der nicht zu messende<br />
Bereich an der <strong>Wasser</strong>oberfläche setzt sich zusammen<br />
aus der Tauchtiefe des Messkopfes <strong>und</strong> der sogenannten<br />
„Blanking distance“ – der Entfernung, die der<br />
Schall zurücklegt in der Zeit, in der das Gerät vom Senden<br />
auf Empfangen umschaltet. Der über der Sohle nicht messbare<br />
Bereich ist dadurch bedingt, dass das Gerät hier nicht<br />
zwischen der Fließgeschwindigkeit <strong>und</strong> der Eigenbewegung<br />
über Gr<strong>und</strong> unterscheiden kann. Eine Abflussmessung<br />
besteht üblicherweise aus vier Einzelmessungen, um aus<br />
der <strong>Mitte</strong>lung einen verlässlichen Wert zu erhalten <strong>und</strong> ggf.<br />
mögliche Messfehler zu erkennen.
Das Messverfahren ist an den mittleren <strong>und</strong> großen Abflussmessstellen<br />
der Fulda, Werra <strong>und</strong> Weser sehr gut<br />
einsetzbar.<br />
Seine Grenzen findet das Verfahren bei schlammigem<br />
Bodensubstrat, da wegen des fehlenden Echos das Gerät<br />
die Bewegung über Gr<strong>und</strong> nicht mehr selbst messen kann.<br />
Ein anderes Problem tritt während Hochwasserabflüssen<br />
auf, wenn sich infolge der hohen Schleppspannung die<br />
Sohle in Bewegung setzt. In diesem Fall kann das Gerät<br />
nicht mehr unterscheiden, ob es sich selbst, oder ob sich<br />
die Sohle bewegt. In beiden Fällen kann das ADCP mit<br />
einem DGPS-Empfänger nachgerüstet werden, der die<br />
genaue Satellitenortung erlaubt <strong>und</strong> so die Relativbewegungen<br />
feststellt. Alternativ kann bei bewegter Sohle dies<br />
durch eine zusätzliche Kontrollmessung getestet werden<br />
<strong>und</strong> ggf. das Messergebnis korrigiert werden. Diese Kontrollmessung<br />
besteht aus zwei Messungen (jeweils von<br />
einem Ufer zum anderen <strong>und</strong> zurück), wobei am anderen<br />
Ufer die Messung nicht, wie sonst üblich, unterbrochen<br />
wird. Im idealen Fall kommt der Geräteträger, sowohl im<br />
Messprotokoll als auch in der Natur, am Ende der Kontrollmessung<br />
am gleichen Punkt zum stehen, wie beim Start;<br />
der berechnete Gesamtabfluss ist Null. Bei bewegter Sohle<br />
ist der Endpunkt der Messung im Messprotokoll gegenüber<br />
dem tatsächlichen Endpunkt verschoben. Dieser Versatz ist<br />
ein Hinweis auf eine bewegte Sohle <strong>und</strong> kann mit entsprechenden<br />
Rechenverfahren korrigiert werden.<br />
Beschaffung<br />
Die ersten konkreten Planungen zur Beschaffung eines<br />
ADCP-Messgerätes begannen im Jahr 2000 mit dem Ziel,<br />
den Umfang <strong>und</strong> die Qualität des Messwesens im WSA<br />
Hann. Münden deutlich zu verbessern. Nach verschiedenen<br />
Beratungen mit der B<strong>und</strong>esanstalt für Gewässerk<strong>und</strong>e <strong>und</strong><br />
gründlichen Marktsondierungen kam es im Jahr 2003 zur<br />
Umsetzung des Vorhabens. Vorgesehen war zunächst,<br />
neben dem Flachwasser-ADCP auf einem Geräteträger<br />
auch ein ferngesteuertes Boot zu beschaffen. Dieses sollte<br />
bei Hochwasser eine Messung ohne eine eventuelle Gefährdung<br />
des beteiligten Personals ermöglichen. Bei Hochwasser<br />
kann durch Treibgutteppiche die Schraube beschädigt<br />
<strong>und</strong> das Boot manövrierunfähig werden. Aus wirtschaftlichen<br />
<strong>und</strong> technischen Erwägungen wurde diese Beschaffung<br />
jedoch zunächst zurückgestellt.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der hohen Wirtschaftlichkeit, die in einer Kostenvergleichsrechnung<br />
nachgewiesen wurde, stimmte die<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> dem neuen Messverfahren<br />
zu. Anschließend erfolgte die Beschaffung im<br />
Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung.<br />
Einsatzorte <strong>und</strong> Einsatzarten<br />
Das ADCP-Messgerät kann sehr variabel eingesetzt werden.<br />
Der Messkopf ist auf einem speziellen Geräteträger<br />
(Trimaran) (Abb. 1) montiert, der das Handling sehr einfach<br />
macht. Der Trimaran ist so leicht, dass er von einer<br />
Person ohne Probleme über ein Brückengeländer gehoben<br />
<strong>und</strong> über den Messquerschnitt geführt werden kann.<br />
Die vorhandenen Seilkrananlagen können auch für die<br />
ADCP-Messungen gut eingesetzt werden (Abb. 2). Durch<br />
die Begrenzung der Ziehgeschwindigkeit an der Seilkrananlage<br />
dauert eine Einzelmessung an einem solchen Mess-<br />
Erfahrungen bei Abflussmessungen mit einem ADCP-Messgerät<br />
Abb. 1 - Der Geräteträger Trimaran mit ADCP-Messkopf<br />
standort zwar etwas länger als an einer Brücke, ist aber<br />
deutlich kürzer als die Messung mit einem traditionellen<br />
Flügel, da das Verharren an einem Vertikalprofil über mehrere<br />
Minuten entfällt. Ingesamt dauert eine komplette Messung<br />
an einer Seilkrananlage inklusive Rüstzeit etwa eine<br />
St<strong>und</strong>e <strong>und</strong> lässt sich mit zwei Personen durchführen.<br />
Abb. 2 - Einsatz des ADCP-Messgerätes an der Seilkrananlage<br />
„Letzter Heller“ - Werra<br />
An Brücken lässt sich die Messung besonders schnell <strong>und</strong><br />
einfach realisieren (Abb. 3). Treten durch örtliche Randbedingungen<br />
keine besonderen Schwierigkeiten auf, dann<br />
kann eine komplette Messung innerhalb einer halben St<strong>und</strong>e<br />
durchführt werden. Der Personaleinsatz ist auch hier mit<br />
zwei Personen zu kalkulieren. Bei Schiffsverkehr ist jedoch<br />
eine weitere Person für den Wahrschaudienst einzuplanen.<br />
Besonderes Augenmerk erfordern Brückenpfeiler wegen<br />
der entstehenden Turbulenzen <strong>und</strong> Rückströmungen. Obwohl<br />
diese aufgr<strong>und</strong> der Messmethodik eigentlich keinen<br />
Einfluss auf das Ergebnis haben sollen, hat sich dies in der<br />
Praxis so nicht bewahrheitet. Insbesondere bei flachen,<br />
stark strömenden Gewässerabschnitten machen Brückenpfeiler<br />
die Messung sehr schwierig <strong>und</strong> fehleranfällig. Dennoch<br />
ist in der Regel beim Einsatz von ADCP-Messgeräten<br />
die Brückenmessung die richtige Wahl.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
35
36<br />
Abb. 3 - Einsatz des ADCP-Messgerätes an der Brücke bei<br />
Grebenau - Fulda<br />
An Flussabschnitten, an denen weder eine Seilkrananlage<br />
noch eine Brücke zur Verfügung steht, muss der Geräteträger<br />
entweder von Ufer zu Ufer mit Hilfe zweier Schwimmseile<br />
gezogen werden (Abb. 4) oder an einem bemannten<br />
Boot befestigt werden. Das Ziehen mittels eines Schwimmseiles<br />
erfordert einen erhöhten Personaleinsatz, da ein<br />
Beschäftigter mit Hilfe eines Bootes mit dem Seil zum anderen<br />
Ufer übergesetzt werden muss. Außerdem werden<br />
zwei Wahrschauer benötigt, um die Schifffahrt erforderlichenfalls<br />
stoppen zu können. Insgesamt sind somit sechs<br />
Personen erforderlich (Messführer, zwei Gehilfen am<br />
Schwimmseil, zwei Wahrschauer, ein Bootsführer).<br />
Abb. 4 - Messung mit Hilfe von Schwimmseilen am<br />
Pegel Bonaforth – Fulda<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Erfahrungen bei Abflussmessungen mit einem ADCP-Messgerät<br />
Der Einsatz eines bemannten Bootes ist in diesem Fall<br />
vorteilhafter, da nur zwei Personen für die Durchführung<br />
der Messung erforderlich sind (Messführer <strong>und</strong> Bootsführer).<br />
Die Messung lässt sich auch variabler gestalten, da sie<br />
an jeder beliebigen Station durchgeführt werden kann <strong>und</strong><br />
damit nicht mehr an feste Orte geb<strong>und</strong>en ist (Abb. 5 <strong>und</strong> 6).<br />
Abb. 5 - Einsatz des ADCP-Messgerätes am bemannten Boot<br />
im Uferbereich<br />
Abb. 6 - Einsatz des ADCP-Messgerätes am bemannten Boot im<br />
tiefen <strong>Wasser</strong><br />
Verwendete Software<br />
Die Messung selbst kann nur mit Hilfe der proprietären<br />
Software „WINRIVER“ durchgeführt werden. Diese Software<br />
besteht aus zwei Programmmodulen, dem sogenannten<br />
„Aquiremode“ <strong>und</strong> dem „Playbackmode“. Im „Aquiremode“<br />
lassen sich spezielle Steuerbefehle über die serielle<br />
Schnittstelle über Funk absetzen, mit denen das Messgerät<br />
eingestellt <strong>und</strong> die Messung gestartet wird (Abb. 7). Eingestellt<br />
werden zum Beispiel die Zellhöhe, die „blanking<br />
distance“ <strong>und</strong> die maximale <strong>Wasser</strong>tiefe.
Abb. 7 - Die Software „WINRIVER“ im Aquiremode während einer<br />
Messung im Bereich Hameln - Weser<br />
Im „Playbackmode“ lassen sich die Einzelmessungen kontrollieren,<br />
mit anderen vergleichen <strong>und</strong> in ASCII-Format<br />
exportieren (Abb. 8).<br />
Die in ASCII exportierten Dateien können mit dem Programm<br />
„Agila“ (Software der B<strong>und</strong>esanstalt für Gewässerk<strong>und</strong>e)<br />
ausgewertet werden (Abb. 9). Mit diesem Programm<br />
kann auch eine weitergehende Bearbeitung der Messung<br />
Erfahrungen bei Abflussmessungen mit einem ADCP-Messgerät<br />
Abb. 9 - Die Software „Agila“ beim Überlagern von vier Einzelmessungen<br />
- hier Pegel Porta - Weser<br />
Abb. 8 - Die Software „WINRIVER“ im Playbackmode beim Vergleich von vier Messungen am Pegel Porta - Weser<br />
vorgenommen werden. So kann man einzelne Messpunkte<br />
löschen oder ungültig machen. Die Messung auf Prüfung<br />
der bewegten Sohle kann mit Hilfe von „Agila“ in zwei Messungen<br />
getrennt werden. Insbesondere können mehrere<br />
Einzelmessungen zusammengefasst, überlagert <strong>und</strong> ausgewertet<br />
werden. Die Ergebnisse werden in einer Datenbank<br />
gespeichert <strong>und</strong> können innerhalb von „Agila“ mit<br />
anderen, älteren Messungen verglichen werden (Abb. 10).<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
37
38<br />
Aus „Agila“ können das Querprofil <strong>und</strong> das Ergebnis der<br />
Abflussmessung in eine Windows-Zwischenablage exportiert<br />
werden, um sie mit ergänzenden Programmen weiter<br />
zu verarbeiten.<br />
Zum Beispiel wird in der Gewässerk<strong>und</strong>e beim WSA Hann.<br />
Münden eine Excel-Tabelle zur Umformatierung des Abflussmessergebnisses<br />
genutzt, um einen Datentransfer in<br />
die Software „WISKI“ (Standardsoftware in der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsverwaltung zur Erfassung <strong>und</strong> Datenhaltung von<br />
Pegelmessdaten) zu ermöglichen. Innerhalb der Software<br />
„WISKI“ werden die Abflussmessungen in einer speziellen<br />
Tabelle verwaltet. Mit Hilfe des Programmmoduls „SKED“<br />
wird diese Tabelle zur Erstellung von Abflusskurven herangezogen<br />
(Abb. 11).<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Erfahrungen bei Abflussmessungen mit einem ADCP-Messgerät<br />
Abb. 10 - Datenhaltung <strong>und</strong> Vergleich mehrerer Messungen in „Agila“<br />
– hier Pegel Wahmbeck - Weser<br />
Abb. 11 - Verwendung der Abflussmessungen in „SKED“ zur Bestimmung der<br />
Abflusskurven<br />
Resumee<br />
Das neue ADCP-Messgerät (Abb. 12) hat bereits<br />
im ersten Jahr des Einsatzes gezeigt, wie flexibel<br />
<strong>und</strong> wirtschaftlich es eingesetzt werden kann. Die<br />
in der Vergangenheit entstandenen Defizite in der<br />
Anzahl der Abflussmessungen können kontinuierlich<br />
abgebaut <strong>und</strong> die vorhandenen Abflussbeziehungen<br />
qualifiziert überprüft <strong>und</strong> ggf. angepasst<br />
werden.<br />
Das ADCP-Messgerät ermöglicht zum Beispiel<br />
auch begleitende Abflussmessungen während<br />
<strong>Wasser</strong>spiegelfixierungen. Auch die Verwendung<br />
als Peilgerät zur Erfassung von Feuchtprofilen<br />
wurde schon erfolgreich getestet. Insgesamt kann<br />
die ADCP-Messung als etabliert <strong>und</strong> als das Messverfahren<br />
der Zukunft angesehen werden.<br />
Abb. 12 - ADCP-Messgerät im Einsatz
Die Schleusenanlage Dörverden<br />
liegt als Teil der gleichnamigen<br />
<strong>Mitte</strong>lweser-Staustufe im Schleusenkanal<br />
bei km 2,0 (Abb. 1). Sie<br />
besteht aus einer 1912 in Betrieb<br />
genommenen Schleppzugschleuse<br />
<strong>und</strong> der sog. kleinen Schleuse,<br />
die 1938 in Betrieb genommen<br />
wurde. Die Schleppzugschleuse<br />
verfügt über eine Drempeltiefe<br />
von 2,65 m, eine Kammerlänge<br />
von 225 m <strong>und</strong> eine Kammerbreite<br />
von 12,30 m. Die Abmessungen<br />
der kleinen Schleuse betragen<br />
3,65 m Drempeltiefe, 85 m<br />
Kammerlänge <strong>und</strong> 12,30 m<br />
Kammerbreite. Der Schiffsverkehr<br />
wird zur Zeit überwiegend über<br />
die kleine Schleuse abgewickelt.<br />
Die Schleppzugschleuse wird nur<br />
kurzfristig für Fahrzeuge über 85<br />
m Länge eingesetzt. Dabei sind<br />
jedoch erhebliche Einschränkungen<br />
der Abladetiefe hinzunehmen.<br />
Veranlassung<br />
Ilka Fischer<br />
Neubauamt für den Ausbau des<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover<br />
...\Uebersichtsplan\HU_1.dgn 02.09.<strong>2005</strong> 08:59:12<br />
Die "Gesamtwirtschaftliche Untersuchung zum Ausbau der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser sowie zum Neubau eines Weser-Jade-Kanals"<br />
(Schlussbericht Juni 2003) ergab das beste gesamtwirtschaftliche<br />
Resultat für einen Streckenausbau für Einzelfahrer<br />
bis 135 m bzw. für Schubverbände bis 139 m Länge.<br />
Dabei soll eine Abladetiefe von 2,5 m gewährleistet werden.<br />
Die schlechte Bausubstanz der Schleppzugschleuse <strong>und</strong><br />
der kleinen Schleuse erfordert in den kommenden Jahren<br />
erhebliche Aufwendungen zum Erhalt <strong>und</strong> zur Sanierung<br />
der Schleusenanlage. Für die kleine Schleuse wird mit<br />
einer Restnutzungsdauer von ca. 20 Jahren gerechnet.<br />
Zudem können die bestehenden Anlagen nicht an die heute<br />
erforderlichen Kammerabmessungen (Kammerlänge,<br />
Drempeltiefe) angepasst werden.<br />
Die schlechte vorhandene Bausubstanz <strong>und</strong> die für den<br />
durchgehenden Ausbau der <strong>Mitte</strong>lweser notwendigen Kammerabmessungen<br />
machen den Neubau einer Schleuse<br />
somit erforderlich.<br />
Planungen zum Neubau<br />
der Weserschleuse Dörverden<br />
Abb. 1 - Übersichtsplan Schleusenanlage Dörverden<br />
Mit Erlass des B<strong>und</strong>esministeriums für Verkehr, Bau <strong>und</strong><br />
Stadtentwicklung wurde daher festgelegt, dass ein Neubau<br />
mit einer Nutzlänge von 139 m zu planen ist.<br />
Neubau der Schleuse<br />
Dörverden<br />
Hydraulische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Folgende <strong>Wasser</strong>stände der Weser sind an der Schleusenanlage<br />
Dörverden maßgebend <strong>und</strong> sind den Planungen zu<br />
Gr<strong>und</strong>e zu legen:<br />
Oberwasser:<br />
• HHW (höchster Hochwasserstand) NN+17,35 m<br />
• HSW (höchster Schifffahrtswasserstand) NN+15,29 m<br />
• NoStau OW / MW (= hydrostatischer<br />
Stau Wehr Dörverden) NN+14,60 m<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
39
40<br />
Unterwasser:<br />
• HHW NN+16,42 m<br />
• HSW NN+14,15 m<br />
• MW (mittlerer <strong>Wasser</strong>stand) NN+11,28 m<br />
• NoStau UW (= hydrostatischer<br />
Stau Wehr Langwedel) NN+10,00 m<br />
Lage der neuen Schleuse<br />
Zur Festlegung der Lage für die neue Schleuse waren<br />
nachstehende Randbedingungen zu beachten:<br />
• Die vorhandene kleine Schleuse muss während der<br />
Bauzeit der neuen Schleuse in Betrieb bleiben.<br />
• Im Ober- <strong>und</strong> im Unterwasser sind jeweils zwei Liegestellen<br />
vorzusehen.<br />
• Die Eingriffe in Natur <strong>und</strong> Landschaft sind zu minimieren.<br />
• Die vorhandenen Böschungen der Vorhäfen sollen<br />
nicht zurückverlegt werden.<br />
• Die nautischen Anforderungen sind angemessen zu<br />
berücksichtigen.<br />
In einer Voruntersuchung wurden dazu folgende Standorte<br />
betrachtet:<br />
• Standort in der alten Schleppzugschleuse: Die neue<br />
Schleusenachse liegt innerhalb der Schleppzugschleuse.<br />
Das neue Oberhaupt liegt auf Höhe des alten (Variante<br />
1).<br />
• Standort zwischen den bestehenden Schleusen: Die<br />
neue Schleusenachse liegt auf der Schleuseninsel zwischen<br />
den bestehenden Schleusen. Das neue Oberhaupt<br />
liegt auf Höhe der vorhandenen Oberhäupter<br />
(Variante 2).<br />
• Standort in der Achse des Schleusenkanals: Die neue<br />
Schleusenachse liegt in der Achse des Schleusenkanals<br />
in einem Abstand von 19 m zur Achse der<br />
Schleppzugschleuse <strong>und</strong> in einem Abstand von 41 m<br />
zur Achse der kleinen Schleuse. Das neue Oberhaupt<br />
ist gegenüber den vorhandenen Oberhäuptern um<br />
30 m nach Unterwasser verschoben (Variante 3).<br />
Bei Variante 1 sind Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des Schiffsverkehrs<br />
im Ein- <strong>und</strong> Ausfahrbereich nicht gewährleistet.<br />
Zudem können im oberen Vorhafen auf der Ostseite keine<br />
Liegeplätze angelegt werden.<br />
Der Standort der Variante 2 gefährdet wegen des geringen<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Planungen zum Neubau der Weserschleuse Dörverden<br />
Abb. 2 - Lageplan Schleusenanlage Dörverden<br />
Abstandes von nur 3 m im Bereich der Oberhäupter die<br />
Standsicherheit der kleinen Schleuse.<br />
Bei der gewählten Variante 3 (Abb. 2) sind Sicherheit <strong>und</strong><br />
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs gegeben. Liege- <strong>und</strong> Startplätze<br />
können in der erforderlichen Anzahl ohne Erweiterung<br />
der Vorhäfen angeordnet werden. Die Standsicherheit<br />
der kleinen Schleuse wird nicht beeinträchtigt. Die Schleppzugschleuse<br />
muss im Zuge des Neubaus der Weserschleuse<br />
teilweise überbaut bzw. abgebrochen werden.<br />
Baugr<strong>und</strong><br />
Die B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau wurde u.a. mit der Erstellung<br />
des Baugr<strong>und</strong>-, Gr<strong>und</strong>wasser- <strong>und</strong> Gründungsgutachtens<br />
beauftragt. Zur Erk<strong>und</strong>ung des Baugr<strong>und</strong>es wurden<br />
Rammkernbohrungen, die auch als Gr<strong>und</strong>wassermessstellen<br />
ausgebaut wurden, <strong>und</strong> Drucksondierungen durchgeführt.<br />
Der Baugr<strong>und</strong> besteht aus einer bis zu 9 m mächtigen<br />
tonigen <strong>und</strong> schluffigen Auffüllungsschicht. Darunter liegen<br />
bis ca. 50 m unter Geländeoberkante zwei Sandschichten,<br />
die durch eine Zwischenschicht getrennt werden. Die Auffüllungsschicht<br />
besitzt eine geringe, die Sandschichten eine<br />
mittel bis große Festigkeit. In der oberen Sandschicht gibt<br />
es örtlich kiesige Bereiche, die eine große Festigkeit aufweisen.<br />
Der Gr<strong>und</strong>wasserstand liegt im Oberwasserbereich auf<br />
etwa NN + 14,0 m <strong>und</strong> damit 0,60 m unter Oberwasser –<br />
Normalstau. Entlang der Schleusenanlage fällt der Gr<strong>und</strong>wasserstand<br />
zum Unterwasser hin ab. Er liegt hier etwa auf<br />
NN + 11,80 m <strong>und</strong> damit 1,80 m über Unterwasser – Normalstau.<br />
Abmessungen<br />
Die neue Schleuse wird mit folgenden Abmessungen geplant:<br />
• Nutzlänge 139,00 m<br />
• Kammerbreite: 12,50 m<br />
• Normale Fallhöhe<br />
(NN + 14,60 m - 10,00 m) 4,60 m<br />
• OK Kammerwand<br />
(HHW NN + 17,35 m + 0,40 m) NN + 17,75 m<br />
• Drempeltiefe<br />
(NN +14,60 – 4,00 = NN + 10,60 m) 4,00 m<br />
• OK Sohle der Schleusenkammer<br />
(NoStau UW NN + 10,00 m – 4,00 m) NN + 6,00 m
Abb. 3 - Kammerquerschnitt der neuen Weserschleuse Dörverden<br />
Konstruktion<br />
Die neue Schleuse besteht aus Schleusenkammer, Oberhaupt<br />
<strong>und</strong> Unterhaupt sowie zwei symmetrischen Einfahrbereichen<br />
von jeweils 30 m Länge. Für die Schleusenvorgänge<br />
sind wegen des ausreichenden <strong>Wasser</strong>dargebotes<br />
der Weser keine Sparbecken erforderlich. Eine Hochwasserabfuhr<br />
durch die Schleuse ist nicht vorgesehen. Sie<br />
erfolgt, wie bisher, über das Wehr bzw. über die <strong>Wasser</strong>kraftanlage.<br />
Da es erforderlich ist, die Kammer für Revisionszwecke<br />
trockenzulegen, muss die Kammersohle für die Anforderungen<br />
der Betriebssicherheit, Standsicherheit <strong>und</strong> Dauerhaftigkeit<br />
gegenüber dem außen liegenden <strong>Wasser</strong> dicht<br />
<strong>und</strong> auftriebssicher hergestellt werden. Als Baugrubensohle<br />
kommt aufgr<strong>und</strong> des wasserdurchlässigen Baugr<strong>und</strong>es als<br />
sichere <strong>und</strong> kostengünstige Lösung nur eine verankerte<br />
Unterwasserbetonsohle in Frage. Darauf wird die verankerte<br />
Stahlbetonsohle als Bauwerkssohle ausgebildet.<br />
Im Rahmen der Voruntersuchung wurde eine Variantenuntersuchung<br />
zur Ausbildung der Schleusenkammer durchgeführt.<br />
Es waren folgende Randbedingungen zu beachten:<br />
• Baugr<strong>und</strong> sandig, durchlässig, kein Gr<strong>und</strong>wasserstauer;<br />
wegen sehr dichter Lagerung ohne Vorbohren nicht<br />
rammbar.<br />
• Lage zwischen zwei vorhandenen Schleusen, bei Aufrechterhaltung<br />
des Schleusenbetriebes der kleinen<br />
Schleuse.<br />
• Als Wände sind Ortbetonwände sowie Konstruktionen<br />
denkbar, bei denen der Verbau so erstellt wird, dass er<br />
in das Endbauwerk integriert wird oder das Endbauwerk<br />
selbst darstellt.<br />
Untersucht wurden die Varianten: Sp<strong>und</strong>wandlösungen,<br />
massive U-Rahmen, Schlitzwandlösungen mit Innenschale<br />
sowie Bohrpfahllösungen mit Innenschale. Insgesamt wurden<br />
dabei 11 Untervarianten betrachtet. Als Kriterien wurden<br />
die Technische Machbarkeit, Erstellungskosten, Unterhaltungskosten,<br />
Nutzungsqualität <strong>und</strong> Bauzeit herangezo-<br />
Planungen zum Neubau der Weserschleuse Dörverden<br />
gen. Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien ist die<br />
rückverankerte Bohrpfahlwand mit Vorsatzschale die günstigste<br />
Lösung, da die betrieblichen Vorteile <strong>und</strong> die erwarteten<br />
Vorteile bei der Unterhaltung gegenüber den anderen<br />
Varianten überwiegen (Abb. 3).<br />
Dabei bildet die überschnittene Bohrpfahlwand das statische<br />
Tragelement, die Vorsatzschale gewährleistet die<br />
Dichtigkeit der Konstruktion. Die 60 cm dicke Vorsatzschale<br />
wird kraftschlüssig an die Bohrpfähle angeschlossen, um<br />
die Kräfte aus den Nischenpollern usw. zu übertragen.<br />
Weitere Ausrüstungselemente, wie z.B. Steigeleitern, werden<br />
in die Vorsatzschale integriert, so dass äußerlich die<br />
Nutzungsqualität einer massiven Schleuse entsteht. Das<br />
Verankerungssystem besteht auf beiden Seiten aus R<strong>und</strong>stahlankern<br />
mit Ankertafeln.<br />
Die Häupter werden in Massivbauweise erstellt, um die<br />
hydraulischen, stahlwasserbaulichen <strong>und</strong> sonstigen betrieblichen<br />
Komponenten aufzunehmen.<br />
Da die Schleuse ohne Sparbecken errichtet wird, kann als<br />
hydraulisches System ein Endsystem zum Einsatz kommen.<br />
D.h. die Befüllung / Entleerung der Kammer kann<br />
über die Tore selbst bzw. über kurze Umläufe an den Toren<br />
vorgenommen werden. Die Füllung der Schleuse erfolgt<br />
über das Obertor, das als einseitig angetriebenes Drucksegment<br />
mit Füllmuschel ausgebildet wird. Die Entleerung<br />
der Kammer erfolgt über Umläufe, die seitlich vom Untertor<br />
durch das Unterhaupt führen. Als Untertor wird aus betrieblichen<br />
<strong>und</strong> wirtschaftlichen Gründen ein als Faltwerk ausgebildetes<br />
Stemmtor gewählt. In den Umlaufkanälen werden<br />
als Verschlüsse Zugsegmente verwendet. Die Kreuzungsschleusungszeit<br />
liegt mit diesem hydraulischen System<br />
bei 39 Minuten.<br />
Baudurchführung<br />
Mit der Baumaßnahme soll 2008 begonnen werden. Für die<br />
Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist ein Zeitraum von<br />
ca. 3 Jahren vorgesehen.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
41
42<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
ARGO-Teststrecke<br />
auf der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
Das elektronische Fahrrinnen-<br />
Informationssystem ARGO<br />
Der Name ARGO ist der griechischen Mythologie entnommen<br />
<strong>und</strong> steht für „Advanced River Navigation“.<br />
ARGO besteht aus drei verschiedenen Bausteinen:<br />
Elektronische Flusskarte mit Darstellung der Fahrrinne<br />
(ggf. mit Tiefenlinien)<br />
Für die elektronische Flusskarte wurde das System der<br />
elektronischen Seekarte ECDIS (Electronic Chart Display<br />
and Information System) ausgewählt <strong>und</strong> an die Verhältnisse<br />
der Binnenwasserstraßen (Inland ECDIS) angepasst.<br />
In diese Karte sind diverse <strong>Informationen</strong> für die Schifffahrt<br />
eingearbeitet (Schifffahrtszeichen, Bauwerke etc.). Sie dient<br />
somit als eine Art elektronischer Atlas.<br />
Der Schiffsführer verfügt damit über ein reines Informationsmedium.<br />
Abb. 1 - ARGO-Bildschirmansicht (RADARpilot 720°)<br />
Holger Isermann<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Wolfram Bahn<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Verden<br />
GPS (Global Positioning System) - Position des Schiffes<br />
Durch Integration eines GPS-Signals ist die Position des<br />
Schiffes in der Karte sichtbar <strong>und</strong> kann mittels eines automatischen<br />
Kartenvorschubes entsprechend der Fahrt fortgeführt<br />
werden.<br />
Radarbild<br />
Im Navigationsbetrieb wird die elektronische <strong>Wasser</strong>straßenkarte<br />
mit dem Radarbild (Radar-Map-Matching) überlagert<br />
<strong>und</strong> gemeinsam auf einem Monitor dargestellt.<br />
Das entwickelte integrierte Navigationssystem erkennt <strong>und</strong><br />
verfolgt während der Fahrt Radarziele auf der <strong>Wasser</strong>straße<br />
automatisch <strong>und</strong> stellt diese auf der Karte dar. Vom<br />
Radar erkannte Schiffe werden umrandet <strong>und</strong> mit einem<br />
Geschwindigkeitspfeil dargestellt, während unbewegte<br />
Objekte durch ein Kreuz markiert werden.<br />
Die Konturen der Karte werden bestmöglich mit den Konturen<br />
des Radarbilds zur Deckung gebracht. Dadurch wird die<br />
Lesbarkeit des Radarbilds <strong>und</strong> somit die Positionsbestimmung<br />
wesentlich verbessert <strong>und</strong> die Navigation<br />
vereinfacht.<br />
Durch leichteres Navigieren wird die Verkehrssicherheit<br />
erhöht <strong>und</strong> ein langfristig geringerer<br />
Unterhaltungsaufwand für die <strong>Wasser</strong>straße<br />
(Schonung der Deckwerke im Uferbereich<br />
durch exaktes Fahren in der Fahrrinne<br />
etc.) erzielt.<br />
Entwicklung des Projektes<br />
ARGO im Bereich<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Veranlassung<br />
Nachdem die Entwicklung eines elektronischen<br />
Fahrrinnen-Informationssystems am<br />
Rhein unter der Federführung der Fachgruppe<br />
Telematik bei der <strong>WSD</strong> Südwest durchgeführt<br />
<strong>und</strong> weitgehend abgeschlossen wurde, sind<br />
die Inland-ECDIS-Karten <strong>und</strong> das System<br />
ARGO flächendeckend in der WSV eingeführt<br />
worden.
Das Ziel der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung ist es, bis<br />
zum Jahr 2009 die Inland-ECDIS-Karten für alle von der<br />
gewerblichen Schifffahrt genutzten Binnenwasserstraßen<br />
der Klasse V <strong>und</strong> höher bereitzustellen.<br />
Auf natürlichen <strong>Wasser</strong>straßen stellt sich für den Binnenschiffer<br />
immer wieder die Frage nach der optimalen Beladung<br />
<strong>und</strong> damit dem möglichst wirtschaftlichen Einsatz<br />
seines Schiffes. Die aktuellen <strong>Wasser</strong>stände kann der<br />
Binnenschiffer aus den gewässerk<strong>und</strong>lichen <strong>Informationen</strong><br />
des Elektronischen-<strong>Wasser</strong>straßen-Informationssystems<br />
ELWIS erfahren. Bei Eingabe des ladungsabhängigen<br />
Tiefenanspruchs <strong>und</strong> aktueller Pegelwerte aus ELWIS<br />
berechnet ARGO den individuellen Fahrstreifen für die<br />
gesamte Fahrtstrecke, <strong>und</strong> zeigt ihn in der Karte auf dem<br />
Monitor an. <strong>Informationen</strong> zur Sohle der <strong>Wasser</strong>straße <strong>und</strong><br />
zu den aktuellen <strong>Wasser</strong>tiefen erhält der Schiffsführer zurzeit<br />
für die <strong>Mitte</strong>lweser noch nicht. Auf der staugeregelten<br />
<strong>Mitte</strong>lweser ist das aufgr<strong>und</strong> der garantierten Fahrrinnentiefen<br />
nicht ganz so bedeutsam; wichtig ist für den Schiffsführer<br />
jedoch die genaue Lage der Fahrrinne.<br />
Pilotstrecke<br />
Abb. 2 - Pilotstrecke<br />
Als <strong>Mitte</strong>lweser bezeichnet man den<br />
Weserabschnitt von Flusskilometer<br />
204,47 (Abzweigung des Verbindungskanals<br />
Süd in Minden) bis km 365 (Fuldahafen<br />
in Bremen).<br />
Die <strong>Mitte</strong>lweser ist ein mit 7 Stauanlagen<br />
reguliertes Fließgewässer. Gemäß<br />
§ 16.02 der Binnenschifffahrtsstraßenordnung<br />
sind Fahrzeuge mit 85 m Länge<br />
<strong>und</strong> 11,45 m Breite zugelassen. Die<br />
Fahrrinnentiefe beträgt von km 204,47<br />
bis zur Schleuse Landesbergen mindestens<br />
2,80 m, von km 252,52 talwärts<br />
mindestens 2,50 m.<br />
Als Pilotstrecke wurde in Abstimmung<br />
mit der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>, der Vermessungs-<br />
<strong>und</strong> Kartenstelle (VK) <strong>Mitte</strong> <strong>und</strong> dem<br />
WSA Verden der Abschnitt Weser-km<br />
220 - 250 inkl. der Schleusenkanäle<br />
Petershagen <strong>und</strong> Schlüsselburg festgelegt.<br />
Für diesen Bereich wurde die Inland-ECDIS-Karte<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
ARGO-Teststrecke auf der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
Abb. 3 - Kartenausschnitt ARGO-Viewer<br />
der digitalen B<strong>und</strong>eswasserstraßenkarte im Maßstab<br />
1 : 2000 (DBWK2) durch die VK <strong>Mitte</strong> erstellt.<br />
Diese Strecke wurde 1991 für das Europaschiff mit einer<br />
definierten Fahrrinne planfestgestellt <strong>und</strong> verfügt über zahlreiche<br />
interessante bauliche Anlagen <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>flächen,<br />
die mit zusätzlichen <strong>Informationen</strong> in das ARGO-System<br />
eingearbeitet wurden.<br />
Ziel des Probebetriebs auf der<br />
Weser<br />
Im Probebetrieb auf der Weser sollten der Aufwand zur<br />
Herstellung der Karten, der Nutzen <strong>und</strong> die Anwendbarkeit<br />
im Regiebetrieb sowie die technischen Rahmenbedingungen<br />
erfasst <strong>und</strong> überprüft werden.<br />
Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung<br />
Kartenherstellung<br />
Als Gr<strong>und</strong>lage der Kartenherstellung diente die flächendeckend<br />
vorhandene DBWK2, die auf den Inland-ECDIS-<br />
Standard umzuwandeln war.<br />
Die Inland-ECDIS-Karten sind im Gegensatz zu den<br />
DBWK2-Daten objektorientierte Kartendarstellungen. Durch<br />
die Objektorientierung ist es möglich <strong>und</strong> notwendig, zu<br />
jedem Objekt entsprechende <strong>Informationen</strong> zu hinterlegen,<br />
die der Nutzer dann per Mausklick abfragen kann.<br />
Die für die Herstellung der Inland-ECDIS-Karten benötigten<br />
Zusatzinformationen (Fähren, Häfen, Umschlagstellen,<br />
Bunkerstationen, Düker, Liegeflächen, Gebiete mit Einschränkungen<br />
usw.) mit den jeweils zugehörigen Geltungsbereichen<br />
<strong>und</strong> Betreiber- bzw. Ansprechpartnerdaten,<br />
wurden durch den Sachbereich 3 des WSA Verden zusammengestellt<br />
<strong>und</strong> der VK <strong>Mitte</strong> zur Einarbeitung in die<br />
Inland- ECDIS-Karten übergeben.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
43
44<br />
Ausrüstung des Probebetriebsschiffes<br />
Zunächst ist für den Probebetrieb das „MS Riehe“, das<br />
Arbeitsboot des Außenbezirks Windheim, entsprechend<br />
ausgestattet worden. Um die praxisnahe Nutzung an Bord<br />
testen zu können, entschied man sich für die Kopplung der<br />
vorhandenen SIMRAD-Peilanlage <strong>und</strong> den zu installierenden<br />
Inland ECDIS-Karten-Betrachter.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der knappen Haushaltslage wurde auf die zusätzlich<br />
zu beschaffende Radaranlage <strong>und</strong> den elektronischen<br />
Kompass verzichtet.<br />
Mit dem an Bord befindlichen DSM12-GPS-Empfänger,<br />
zusammen mit einem Verbesserungsdatenempfänger,<br />
erreicht das System eine Genauigkeit der Schiffsposition<br />
von ca. 0,5 bis 1 m.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Abb. 4 – Aufbau des Systems<br />
ARGO-Viewer<br />
Die im Auftrag der Fachgruppe Telematik bei der <strong>WSD</strong><br />
Südwest von der Fa. SevenC’s entwickelte Software<br />
ARGO-Viewer eignet sich speziell für den Einsatz auf den<br />
Arbeitsbooten der WSV für den Informationsbetrieb.<br />
Bei der Pilotstrecke wurde auf die fahrwassertiefenabhängige<br />
Darstellung der Fahrrinne verzichtet. Ohne Radar,<br />
Kompass <strong>und</strong> Tiefeninformationen stellt die verwendete<br />
Konstellation einen reinen Informationsbetrieb dar.<br />
Zum Einsatz kam das System an Bord der „MS Riehe“<br />
unter anderem beim Überprüfen der Fahrwassertiefe am<br />
Fahrrinnenrand <strong>und</strong> beim Setzen von Fahrrinnentonnen.<br />
Die Ergebnisse<br />
Funktionalität des Systems<br />
Die leicht zu bedienende Oberfläche des ARGO-Viewers<br />
stellt eine ideale Plattform für einen wirtschaftlichen Einsatz<br />
bei der Aufgabenerledigung in den Außenbezirken dar.<br />
Die Software ermöglicht es dem Bediener, den Darstellungsbereich<br />
zu zoomen, die Darstellung auf Tag- bzw.<br />
Nachtbetrieb umzustellen, eine Position mit <strong>Informationen</strong><br />
zu markieren, Entfernungen zu messen <strong>und</strong> die Darstellungstiefe<br />
für mehr Übersichtlichkeit zu verringern.<br />
ARGO-Teststrecke auf der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den unterschiedlichen<br />
Achsen der einzelnen Weserabschnitte (Hauptstrecke,<br />
Schleusenkanal, Wehrarm) sowie mit dem nicht einwandfrei<br />
laufenden automatischen Kartenvorschub funktioniert<br />
die Karte im Zusammenspiel mit dem GPS inzwischen<br />
sehr gut. Nach Rücksprache mit der Fa. SevenC’s konnte<br />
das Problem der unterschiedlichen Achsen gelöst werden.<br />
Leider ist der Kartenvorschub immer noch nicht zufriedenstellend.<br />
Die bisher einfache Darstellung der Schiffsposition durch<br />
einen Kreis sollte zukünftig durch entsprechende Schiffssymbole<br />
ersetzt werden, um unterschiedliche Schiffszusammenstellungen<br />
<strong>und</strong> Schiffstypen zu unterscheiden.<br />
Weiteres Vorgehen<br />
Nach erfolgreicher Beendigung des Probebetriebs sollen<br />
die Inland-ECDIS-Karten für den gesamten Bereich der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser erstellt werden. Die genauen Termine der Kartenfertigstellung<br />
werden zurzeit abgestimmt. Hierzu ist es<br />
notwendig, für den Bereich der Weser von km 252 – 356<br />
die derzeitige Unterhaltungsrinne (Planfeststellungsbeschluss<br />
der <strong>Mitte</strong>lweseranpassung ist zurzeit noch nicht<br />
bestandskräftig) festzulegen.<br />
Die Erhebung der Zusatz-Daten der gesamten Strecke der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser erfolgt durch das WSA Verden in 10 km-<br />
Abschnitten. Die Daten werden anschließend der VK <strong>Mitte</strong><br />
zur Einarbeitung übergeben.<br />
Nach Fertigstellung der Karten der einzelnen Abschnitte<br />
werden diese den Außenbezirken zur Verfügung gestellt.<br />
Durch die geplante Beschaffung eines Radars <strong>und</strong> elektronischer<br />
Kompasse soll der volle Umfang des Systems hergestellt<br />
werden.<br />
So können eigene Erfahrungen über das ARGO-System im<br />
flächendeckenden Praxiseinsatz gesammelt werden, um es<br />
für den zukünftigen Einsatz bei der Schifffahrt zu optimieren.<br />
Die Aktualisierung der Inland-ECDIS-Karten erfolgt durch<br />
Einpflegen von Änderungen in die DBWK 2 <strong>und</strong> anschließender<br />
Konvertierung in den Inland-ECDIS-Standard. Die<br />
Verteilung der Inland-ECDIS-Karten <strong>und</strong> zugehöriger Updates<br />
erfolgt über die Vertriebspartner der WSV. Die Aktualität<br />
der Karten <strong>und</strong> <strong>Informationen</strong> muss der Nutzer über Erwerb<br />
<strong>und</strong> entsprechende Downloads (z.B. über ELWIS) in Eigenregie<br />
sicherstellen.<br />
Ausblick<br />
Zukünftige Telematikanwendungen im Bereich der Binnenschifffahrt<br />
werden auf Basis des Inland-ECDIS-Standards<br />
erfolgen.<br />
Genannt seien hier unter anderem die Anwendung des<br />
Automatischen Identifizierungssystems AIS (über<br />
Transponder), Radarüberwachungssysteme in den Verkehrszentralen<br />
sowie Routenplanungs- <strong>und</strong> Logistikanwendungen<br />
im Bereich des Speditionswesens.<br />
Die Einführung des Systems AIS wird zurzeit in Zusammenarbeit<br />
mit der Fachgruppe Telematik bei der <strong>WSD</strong><br />
Südwest, der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>, dem WSA Verden <strong>und</strong> der Fachstelle<br />
Maschinenwesen <strong>Mitte</strong> im Rahmen der geplanten<br />
<strong>Mitte</strong>lweseranpassung geprüft.
Neubau der<br />
Brücken Nr. 80 <strong>und</strong> 81<br />
am Stichkanal nach Osnabrück<br />
– Planung, Entwurf, Ausführung<br />
Einleitung <strong>und</strong> Veranlassung<br />
Bei MLK-km 30,380, westlich von Bramsche, zweigt der<br />
Stichkanal nach Osnabrück (SKO) aus dem <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
(MLK) in südlicher Richtung ab. Die Gesamtlänge des SKO<br />
beträgt ca. 14,5 km, wobei die B<strong>und</strong>eswasserstraße bei<br />
SKO-km 13,000 am Oberen Vorhafen der Schleuse Haste<br />
endet. (vgl. Abb. 1).<br />
Der Ausbau des SKO wurde ab 1980 begonnen. Mindestvorgabe<br />
für die Gestaltung der Querschnitte ist die Möglichkeit<br />
zur Einzelfahrt von Großmotorgüterschiffen. Neben<br />
dem Neubau der Streckenabschnitte von SKO-km 2,5 –<br />
6,15 sowie SKO-km 8,9 – 11,54 <strong>und</strong> dem Neubau von zwei<br />
Dükern müssen auch die Brücken neu gebaut werden.<br />
Nach Abschluss der Strecken- <strong>und</strong> Brückenbauarbeiten<br />
werden die Schleuse Hollage <strong>und</strong> später auch die Schleuse<br />
Haste durch bedarfsgerechte Neubauten ersetzt.<br />
Bei SKO-km 11,000 (Abb. 2) überführen die Brückenbauwerke<br />
Nr. 80 <strong>und</strong> 81 direkt nebeneinander liegend eine<br />
Gemeindestraße (Glückaufstraße) <strong>und</strong> eine Eisenbahnverbindung<br />
(Anschluss des Werkbahnhofs Piesberg,<br />
Abb. 1 - Übersichtsplan des Stichkanals nach Osnabrück<br />
Abb. 2 - Übersichtsplan Brücke 80 <strong>und</strong> 81<br />
Jörg Straube<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Braunschweig<br />
(bis Herbst <strong>2005</strong><br />
Neubauamt für den Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals in<br />
Hannover)<br />
Betrieb durch die Stadtwerke Osnabrück). Die Brücken<br />
stehen in der Unterhaltungslast der Stadt Osnabrück.<br />
Die Brücken 80 <strong>und</strong> 81 weisen lediglich eine Durchfahrtshöhe<br />
von 4,25 m bzw. 4,22 m über dem Normalwasserstand<br />
auf <strong>und</strong> stellen daher eine Engstelle bei Transporten<br />
auf der <strong>Wasser</strong>straße dar. Abb. 3 zeigt, welche Schwierigkeiten<br />
durch die geringe Durchfahrtshöhe im Schiffahrtsbetrieb<br />
auftreten.<br />
Vorhandene Bauwerke<br />
Beide Brücken wurden ursprünglich 1914 errichtet <strong>und</strong> im<br />
2. Weltkrieg zerstört. Der Überbau der Straßenbrücke konnte<br />
1951 wieder errichtet werden, der Eisenbahnbetrieb<br />
konnte bereits 1946 wieder aufgenommen werden.<br />
Die vorhandene Straßenbrücke Nr. 80 war als Stahlvollwandträger<br />
in Verb<strong>und</strong>bauweise konstruiert. Die Breite der<br />
Fahrbahn betrug 2,90 m, dazu kamen zwei Notgehwege mit<br />
je 60 cm Breite sowie ein angehängter Radweg mit 1,35 m<br />
Breite. Die Eisenbahnbrücke Nr. 81 als Fachwerkhalbparabelträger<br />
überführte eine eingleisige Bahnlinie. Der lichte<br />
Querschnitt des Überbaus betrug ca. 4,65 m.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
45
46<br />
Planfeststellung<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Neubau der Brücken Nr. 80 <strong>und</strong> 81 am Stichkanal nach Osnabrück– Planung, Entwurf, Ausführung<br />
Abb. 3 - Durchfahrt unter der Brücke 80<br />
Für den Ausbau des SKO zwischen SKO-km 2,5 <strong>und</strong> 6,15<br />
sowie zwischen SKO-km 8,9 <strong>und</strong> 11,54 wurde am<br />
24.10.1996 vom damaligen Neubauamt (NBA) für den<br />
Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Minden - Außenstelle Osnabrück<br />
- der Antrag auf Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens<br />
gestellt. In den Planfeststellungsunterlagen war<br />
vorgesehen, für die neue Straßenbrücke Nr. 80 eine Verbreiterung<br />
der Fahrbahn auf 6,50 m vorzunehmen. Dies<br />
hätte eine Teilung der Baukosten zwischen der <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung <strong>und</strong> der Stadt Osnabrück gemäß<br />
§ 41 Abs. 5 <strong>und</strong> 6 <strong>Wasser</strong>straßengesetz (WaStrG)<br />
bedeutet. Die Eisenbahnbrücke Nr. 81 sollte in alter Breite<br />
neu errichtet werden. Die Brückendurchfahrtshöhe wird<br />
nach dem Neubau 5,25 m über dem oberen Betriebswasserstand<br />
(BWo) von NN + 55,15 m betragen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> einer Einwendung der Stadt Osnabrück wurde<br />
die ursprüngliche Absicht, auf der neuen Brücke Begegnungsverkehr<br />
zuzulassen, fallen gelassen. Das neue Bauwerk<br />
sollte jetzt für einspurigen Verkehr mit einer Fahrbahnbreite<br />
von 3,25 m geplant werden. Dadurch entfiel die<br />
Kostenbeteiligung der Stadt Osnabrück. Für das Bauwerk<br />
Nr. 81 ergaben sich keine Änderungen aus dem Planfeststellungsverfahren.<br />
Der Planfeststellungsbeschluss erging am 17.02.1999. Es<br />
wurde keine Klage gegen den Beschluss eingereicht, so<br />
dass er entsprechend Rechtskraft erlangte.<br />
Vergabe der<br />
Ingenieurleistungen für<br />
Entwurf <strong>und</strong> Ausschreibung<br />
Aufgr<strong>und</strong> von anderen Prioritäten (Ausbau der Osthaltung<br />
<strong>und</strong> der Stadtstrecke Hannover des <strong>Mitte</strong>llandkanals)<br />
konnte mit den Ausbauarbeiten am SKO zunächst nicht<br />
begonnen werden. Mittlerweile war das NBA Minden aufgelöst<br />
<strong>und</strong> in eine Außenstelle des NBA Hannover umgewandelt<br />
worden. Die Außenstelle Osnabrück wurde im<br />
Jahr 2001 endgültig aufgelöst. Die weiteren Planungen<br />
zum Ausbau des SKO wurden von der Außenstelle Minden<br />
des NBA Hannover übernommen.<br />
Da für die Bearbeitung des Entwurfs-AU <strong>und</strong> der Ausschreibungsunterlagen<br />
keine ausreichende Personalkapazität<br />
zur Verfügung stand, wurde beschlossen, diese Planungsleistungen<br />
an freiberuflich Tätige zu vergeben. Da die<br />
Höhe der Auftragssumme den sog. Schwellenwert überstieg,<br />
musste ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger<br />
Vergabebekanntmachung nach VOF durchgeführt werden.<br />
Dazu erfolgte die Bekanntmachung im Amtsblatt der EG am<br />
08.08.2000. Im Zuge des Verfahrens musste die Honorarermittlung<br />
überarbeitet werden, da es sich hier um ein<br />
kombiniertes Bauwerk (zwei Überbauten auf gemeinsamen<br />
Widerlager) handelt, der Entwurf des Ingenieurvertrages<br />
aber eine Honorarermittlung auf der Basis zweier getrennter<br />
Bauwerke vorsah.<br />
Eine erneute Anfrage mit überarbeitetem Vertragsentwurf<br />
an die beteiligten Büros erfolgte im April 2001. Aufgr<strong>und</strong><br />
einer im Juli 2001 erfolgten Vergabebeschwerde von zwei<br />
nicht berücksichtigten Bewerbern wurde der Vergabestelle<br />
von der 2. Vergabekammer des B<strong>und</strong>es beim B<strong>und</strong>eskartellamt<br />
mit Beschluss vom 31.08.2001 aufgegeben, das<br />
Vergabeverfahren unter Beachtung der Rechtsauffassung<br />
der Vergabekammer ab dem Zeitpunkt der Auswahl der<br />
Bewerber, die zur Verhandlung aufgefordert wurden, zu<br />
wiederholen. Die wesentlichen Gründe, die zur erfolgreichen<br />
Beschwerde der unterlegenen Bewerber geführt haben,<br />
sollen hier noch einmal kurz dargestellt werden:<br />
• Die maßgeblichen Auftragskriterien sind in der Vergabebekanntmachung<br />
oder der Aufgabenbeschreibung<br />
anzugeben.<br />
• Die Vergabestelle hat mit allen ausgewählten Bewerbern<br />
Auftragsverhandlungen nach § 24 Abs. 1 VOF zu<br />
führen, damit der Bewerber ermittelt werden kann, der<br />
am ehesten die Gewähr für eine sachgerechte Leistungserfüllung<br />
bietet.<br />
Abb. 4 - Längsschnitt der Brücken 80 <strong>und</strong> 81
Neubau der Brücken Nr. 80 <strong>und</strong> 81 am Stichkanal nach Osnabrück– Planung, Entwurf, Ausführung<br />
• Die Honorarzone ist nicht verhandelbar (nach der damaligen<br />
VV WSV 2108 wurde in den Vertragsentwürfen<br />
eine “empfohlene Honorarzone” eingetragen).<br />
• Der Preis darf nicht das einzige bzw. maßgebende<br />
Wertungskriterium sein.<br />
Abb. 5 - Querschnitt der Brücken 80 <strong>und</strong> 81<br />
Die Ergebnisse dieses Beschwerdeverfahrens flossen in<br />
die Überarbeitung des Vergabehandbuches für Leistungen<br />
freiberuflich Tätiger, VV WSV 2108, ein. Nach Wiederholung<br />
des Vergabeverfahrens konnte der Planungsauftrag<br />
für den Entwurf-AU <strong>und</strong> die Ausschreibungsunterlagen für<br />
die Brücken 80 <strong>und</strong> 81 an das Büro Wisserodt am<br />
09.04.2002 erteilt werden.<br />
Entwurf <strong>und</strong> Vergabe<br />
Nach der Vergabe der Ingenieurleistungen konnte mit der<br />
Bearbeitung des Entwurfs-AU begonnen werden. Da die<br />
Bauwerke in der Unterhaltungslast der Stadt Osnabrück<br />
stehen, war während der Bearbeitung eine intensive Ab-<br />
Abb. 6 - Ansicht Brücke 81 von Osten<br />
stimmung mit den beteiligten Stellen der Stadt <strong>und</strong> der<br />
Stadtwerke als Betreiber der Bahnahnlage erforderlich. Der<br />
Entwurf-AU wurde im Herbst 2003 der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> zur Prüfung<br />
<strong>und</strong> Genehmigung vorgelegt. In Abb. 4 sind die Bauwerke<br />
im Längsschnitt <strong>und</strong> in Abb. 5 im Querschnitt dargestellt.<br />
Abb. 6 zeigt die Ansicht der Brücke 81 von Osten<br />
gesehen.<br />
Noch während der Prüfung des Entwurfs wurde ein Vorschlag<br />
des Planungsbüros aufgegriffen, durch Veränderung<br />
der planfestgestellten Neigung der Gleisanlagen eine erhebliche<br />
Verkürzung des Eingriffs in den Bereich des<br />
Werkbahnhofs <strong>und</strong> damit eine wesentlich günstigere Bauausführung<br />
zu erreichen (Abb. 7). Gemäß Planfeststellung<br />
sollten die Gleisanlagen auf nahezu der gesamten Länge<br />
des Werkbahnhofs angehoben werden. Damit wäre auch<br />
eine Anhebung einer Brücke über die Gleisanlagen erforderlich<br />
geworden. Der Vorschlag des Planungsbüros sah<br />
vor, den Anschluss an die bestehenden Gleisanlagen bereits<br />
etwa auf Höhe des vorhandenen Stellwerks durchzuführen.<br />
Nachdem die Stadtwerke Osnabrück diesen Vorschlag im<br />
Vorfeld der Entwurfsbearbeitung zunächst abgelehnt hatten,<br />
konnte durch mehrere Gespräche im April 2004 eine<br />
Vereinbarung zwischen den Stadtwerken <strong>und</strong> der WSV<br />
erzielt werden, die vorsieht, den Anschluss des Werkbahnhofs<br />
an die neue Brücke Nr. 81 mit einer Neigung von 6-7‰<br />
durchzuführen. Dadurch konnten Kosten in Höhe von ca.<br />
1,3 Mio. € eingespart werden. Der Kostenvergleich ist in<br />
Abb. 8 dargestellt. Nachdem auch die Landeseisenbahnaufsicht<br />
als zuständige Genehmigungsbehörde für den<br />
Bahnbetrieb den Änderungen zugestimmt hatte, wurden die<br />
Änderungen in einem Änderungsplanfeststellungsbeschluss<br />
öffentlich-rechtlich abgesichert.<br />
Das Vergabeverfahren für den Neubau der Brücken 80 <strong>und</strong><br />
81 wurde am 30.07.2004 durch Absendung der Bekanntmachung<br />
(öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 VOB/A)<br />
Abb. 7 - Lageplan der Brücken 80 <strong>und</strong> 81<br />
eröffnet. Der geschätzte Auftragswert lag unterhalb des<br />
EG-Schwellenwertes. Nach Submission am 22.09.2004<br />
lagen 10 Angebote vor. Der Auftrag konnte am 09.11.2004<br />
erteilt werden.<br />
Abb. 8 - Kostenersparnis durch Änderung der Längsneigung der<br />
Bahnanlagen<br />
Ausführung der<br />
Baumaßnahme<br />
Auftragnehmer für den Neubau der Brücken 80 <strong>und</strong> 81 ist<br />
die Arbeitsgemeinschaft Fritz Spieker, Oldenburg <strong>und</strong><br />
Stahlbau Niesky. Nach Baubeginn im November 2004<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
47
48<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Neubau der Brücken Nr. 80 <strong>und</strong> 81 am Stichkanal nach Osnabrück– Planung, Entwurf, Ausführung<br />
ist vorgesehen, die Brücken zum Oktober 2006 fertig zu<br />
stellen.<br />
Der Neubau der Brücken erfolgt etwa in alter Lage der<br />
Brücke 80. Deshalb ist es erforderlich, den Straßenverkehr<br />
über die Brücke 80 während der Bauzeit über die benachbarte<br />
Brücke 79 umzuleiten. Eine Sperrung des Bahnbetriebes<br />
kam nicht in Frage, da die Brücke die einzige Zufahrtsmöglichkeit<br />
zum Bahnhof Piesberg darstellt. Lediglich<br />
für einen Zeitraum von ca. drei Wochen muss der Bahnbetrieb<br />
nach Einschub der neuen Brücke 81 zum Umschluss<br />
der Gleise außer Betrieb genommen werden.<br />
Die neuen Bauwerke erhalten ein gemeinsames Widerlager.<br />
Um das Widerlager herstellen zu können, musste zunächst<br />
die Brücke 80 abgebrochen werden (Abb. 9 <strong>und</strong> 10).<br />
Abb. 9 - Brücke 80 vor dem Abbruch<br />
Abb. 10 - Abbruch der Brücke 80<br />
Danach konnten die alten Widerlager im Bereich der Straßenbrücke<br />
abgebrochen werden, um Platz für den Neubau<br />
zu schaffen. Als Gründung wurde eine Tiefgründung mit<br />
Franki-Pfählen gewählt. Die Abb. 11 – 15 zeigen Phasen<br />
der Herstellung der Widerlager.<br />
Der Bahnkörper wurde auf der Nordseite mit einer rückverankerten<br />
Sp<strong>und</strong>wand gegen die Baugrube des neuen Widerlagers<br />
gesichert (Abb. 16). Die fertig gestellten Widerlager<br />
zeigen Abb. 17 <strong>und</strong> 18.<br />
Abb. 11 - Gründung Widerlager Süd<br />
Abb. 12 - Pfahlkopfplatte Widerlager Nord<br />
Abb. 13 - Herstellung Widerlager Süd Rückseite<br />
Nach dem Herstellen <strong>und</strong> Einschieben der Überbauten<br />
sowie dem Umschluss der Gleisanlagen kann dann die alte<br />
Brücke 81 sowie das restliche Widerlager abgebrochen<br />
werden.
Neubau der Brücken Nr. 80 <strong>und</strong> 81 am Stichkanal nach Osnabrück– Planung, Entwurf, Ausführung<br />
Das Montagekonzept der Brücken sieht vor, die beiden<br />
stählernen Überbauten nebeneinander auf dem Montageplanum<br />
auf der Südseite zu fertigen. Die im Werk vorgefertigten<br />
Teile werden mit Schwerlasttransportern angeliefert.<br />
Die Montage erfolgt in Verlängerung der Brückenachse.<br />
Jeder Überbau wird aus vier Fahrbahnteilen <strong>und</strong> je drei<br />
Bogenstücken pro Bogen hergestellt. Die Überbauten werden<br />
nacheinander vormontiert <strong>und</strong> dann mittels Verschubtechnik<br />
<strong>und</strong> Großkran längs über den Kanal verschoben.<br />
Nach Fertigstellung der Überbauten werden die Verkehrsanlagen<br />
hergestellt, so dass die neue Kreuzungsanlage ab<br />
Oktober 2006 dem Verkehr übergeben werden kann.<br />
Abb. 14 - Herstellung Widerlager Süd Vorderseite<br />
Abb. 15 - Gründung Widerlager Nord<br />
Abb. 16 - Sp<strong>und</strong>wand als Böschungssicherung des Bahnkörpers am<br />
Widerlager Nord<br />
Abb. 17 - Widerlager Nord<br />
Abb. 18 - Widerlager Süd<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
49
50<br />
Sven Neumann<br />
Neubauamt für den Ausbau des<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Beweissicherung <strong>und</strong><br />
messtechnische Überwachung<br />
beim Bau der neuen<br />
Schleuse Sülfeld Süd<br />
Die Bauarbeiten an der Schleuse Sülfeld Süd gehen zügig<br />
voran. Die bestehende Südschleuse wurde abgerissen, die<br />
Baugrubenumschließung hergestellt <strong>und</strong> die Baugrube<br />
ausgehoben. Im Frühjahr <strong>2005</strong> konnten die Betonarbeiten<br />
für das neue Bauwerk planmäßig beginnen.<br />
Neben den anspruchsvollen Bautätigkeiten erfordert die<br />
Erstellung der Schleuse eine umfangreiche <strong>und</strong> permanente<br />
messtechnische Überwachung. Es ist sicherzustellen,<br />
dass in den verschiedenen Bauphasen das neue Bauwerk<br />
funktionstüchtig errichtet wird, <strong>und</strong> dass die Nachbarbauten<br />
durch die Baumaßnahme nicht unzulässig beeinträchtigt<br />
werden. Die Gewährleistung dieser Anforderungen setzt<br />
eine detaillierte Planung voraus <strong>und</strong> beinhaltet während der<br />
Bauausführung eine intensive Beobachtung.<br />
Allgemeines<br />
Als Bauherr ist das Neubauamt für den Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
(NBA) Hannover für die bautechnische Sicherheit<br />
der Baustelle <strong>und</strong> der im Einflussbereich der Baumaßnahme<br />
befindlichen Objekte verantwortlich. Hieraus ergeht<br />
die Verpflichtung, ein Beweissicherungsverfahren rechtzeitig<br />
<strong>und</strong> in ausreichendem Umfang einzuleiten <strong>und</strong> auszuführen.<br />
Die Eigentümer <strong>und</strong> Betreiber der jeweiligen Objekte<br />
sind an diesem Verfahren bereits im Vorfeld zu beteiligen,<br />
da nur sie aus den speziellen bautechnischen Eigenschaften<br />
ihrer Bauwerke das Normalverhalten angeben <strong>und</strong><br />
die kritischen Veränderungswerte vorgeben können.<br />
Abb. 1 - Übersichtsplan mit Objekten<br />
In der Planungsphase wurde daher ein besonderes Augenmerk<br />
auf eine mögliche Beeinflussung der Baumaßnahme<br />
auf die Nachbarbebauung gelegt. In unmittelbarer<br />
Nähe befinden sich die Eisenbahnbrücke der ICE –<br />
Schnellbahnstrecke Hannover – Berlin, das Pumpwerk <strong>und</strong><br />
die Nordschleuse (Abb. 1). Diese Bauten dürfen durch die<br />
Baumaßnahme in ihrer Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt<br />
werden. Unter Anwendung umfangreicher numerischer<br />
Berechnungsmethoden (ebene <strong>und</strong> räumliche Finite-<br />
Elemente-Berechnungen der BAW) konnte eine Baugrubenkonzeption<br />
zur Minimierung der Bewegungen der<br />
Nachbarbauten entwickelt werden. Die aus diesen Berechnungen<br />
hervorgegangenen Verformungsprognosen wurden<br />
den kritischen Veränderungsbeträgen mit dem Ergebnis<br />
gegenübergestellt, dass für die gewählte Bauweise ein<br />
ausreichendes Sicherheitspotential zur Verfügung steht.<br />
In der Bauphase war dann die Beobachtung der tatsächlichen<br />
Bewegungen für den Abgleich mit den Prognosewerten<br />
erforderlich. Zudem sollte ein mögliches Annähern an<br />
die kritischen Werte so frühzeitig erkannt werden, dass<br />
bautechnische Maßnahmen rechtzeitig ergriffen <strong>und</strong> damit<br />
Störungen <strong>und</strong> Gefährdungen ausgeschlossen werden<br />
konnten. Zusammen mit der BAW <strong>und</strong> der BfG wurde eine<br />
Messkonzeption entwickelt, die eine sachgerechte Überwachung<br />
sicherstellte.<br />
Messkonzeption<br />
Joachim Saathoff<br />
Neubauamt für den Ausbau des<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover<br />
Für alle zu diesem Beweissicherungsverfahren<br />
gehörenden Bauwerke wurden<br />
Messprogramme nach der VV-WSV 2602<br />
(Entwurf) aufgestellt. In Abhängigkeit der<br />
jeweiligen bautechnischen Gegebenheiten<br />
konnte so die optimale messtechnische<br />
Lösung für alle Objekte ausgearbeitet<br />
werden 1) (s. Tabelle). Dabei wurden für die<br />
Erfassung der Zielgrößen sowohl geodätische<br />
als auch geotechnische Messverfahren<br />
einbezogen. Gr<strong>und</strong>lage für dieses<br />
messtechnologische Lösungskonzept war<br />
die „Trennschärfe des nachzuweisenden<br />
Veränderungsbetrages“, die aus dem<br />
erwarteten Prognosewert, dem kritischen<br />
Veränderungsbetrag <strong>und</strong> der Spontanität<br />
als maximal mögliche Veränderungsgeschwindigkeit<br />
resultierte. Gemeinsam mit<br />
dem objektbezogenen Sicherheitsbedürfnis<br />
folgten hieraus Vorgaben an die Häufigkeit<br />
der Messungen <strong>und</strong> deren Prä-
Beweissicherung <strong>und</strong> messtechnische Überwachung beim Bau der neuen Schleuse Sülfeld Süd<br />
Objekt Zielgröße geotechnische Messungen geodätische<br />
Messungen<br />
absolut automatisch manuell<br />
Baugrubenwände<br />
(Messqerschnitte)<br />
x,y<br />
z,<br />
Kraft<br />
Druck<br />
Baugrubensohle z<br />
Druck<br />
Volumen<br />
zision. Die Entscheidung zugunsten automatischer Messverfahren<br />
erfolgte immer dann, wenn zum einen ein sehr<br />
kleines Messintervall notwendig <strong>und</strong> zum anderen ein<br />
unmittelbarer Zugriff auf die Daten unerlässlich war. Im<br />
Inklinometer<br />
6-fach-Extensometer<br />
Ankerkraftmessdosen<br />
Steifenkraftgeber<br />
Gr<strong>und</strong>wasserdruck<br />
Porenwasserdruckgeber<br />
Extensometer<br />
Gr<strong>und</strong>wasserdruck<br />
<strong>Wasser</strong>mengen<br />
Bauumfeld Gr<strong>und</strong>wasser Gr<strong>und</strong>wasserstand<br />
DB-Brücken-<br />
Widerlager<br />
z<br />
x,y<br />
2-fach-Extensometer<br />
Schwimmlot<br />
Pumpenhaus z 2-fach-Extensometer<br />
Schlauchwaage<br />
Nordkammer<br />
(NK), Südwand<br />
Sparbecken (NK),<br />
Südseite<br />
z (relativ)<br />
x,y<br />
z<br />
x,y<br />
Inklinometer Polarvermessung<br />
Schwimmlot<br />
Nivellement<br />
(neues Bauwerk)<br />
Nivellement<br />
Polarvermessung<br />
Nivellement<br />
Nivellement<br />
Polarvermessung<br />
Nivellement<br />
Polarvermessung<br />
Pumpwassergraben z Nivellement<br />
Wohnhäuser z<br />
x,y (relativ)<br />
Abb. 2 - Messquerschnitt HQ1<br />
Nivellement<br />
Polarvermessung<br />
Sinne einer Red<strong>und</strong>anz wurden in sensiblen Bereichen<br />
automatische geotechnische Systeme mit manuellen geodätischen<br />
Verfahren kombiniert. Hierdurch konnten der<br />
Ausfall eines automatischen Systems überbrückt <strong>und</strong> zusätzlich<br />
zwei voneinander unabhängig ermittelte Werte<br />
nach deren Plausibilität bewertet werden.<br />
Die Abb. 2 zeigt beispielhaft den schematischen Messquerschnitt<br />
HQ 1 im Bereich der bestehen bleibenden alten<br />
Sparbecken der Nordschleuse. Um den Einfluss der nur ca.<br />
2 m entfernten <strong>und</strong> 16 m tiefen Baugrube auf die Sparbecken<br />
zu ermitteln, wurden neben den geodätischen Messpunkten<br />
ein Ketteninklinometer in der Baugrubenwand,<br />
Ankerkraftmessdosen, ein 6-fach Stangenextensometer,<br />
Porenwasserdruckgeber <strong>und</strong> Inklinometer in den Boden<br />
eingebracht.<br />
Messwertverarbeitung <strong>und</strong><br />
Datenbank<br />
Messwertverarbeitung<br />
Für die automatische Ermittlung der geotechnischen Messgröße<br />
<strong>und</strong> deren Veröffentlichung als Ergebniswert war<br />
eine umfangreiche Hard- <strong>und</strong> Softwareausstattung erforderlich.<br />
Die Umsetzung erfolgte durch eine spezifisch auf die<br />
Anforderungen zugeschnittene, projektbezogene Lösung.<br />
Die Messwerte der einzelnen Geber werden in vorgegebenen<br />
Zeittakten automatisch von den Datenloggern abgegriffen<br />
<strong>und</strong> über LWL-Verbindungen, GSM-Funk oder Richtfunk<br />
zu mehreren lokal vernetzten PC in die Bauüberwachung<br />
des NBA übertragen. Alle PC sind mit einer individuellen<br />
Software ausgestattet, die aus den eingehenden<br />
Rohwerten unter Anwendung der geberbezogenen Kalibrierfunktion<br />
die jeweiligen Zielgrößen erzeugt. Diese Ergebniswerte<br />
werden in Weg-Zeit-Diagrammen visualisiert,<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
51
52 <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Beweissicherung <strong>und</strong> messtechnische Überwachung beim Bau der neuen Schleuse Sülfeld Süd<br />
innerhalb einer objektbezogenen Datenstruktur abgelegt<br />
<strong>und</strong> durch automatisch generierte Exportdateien zur weiteren<br />
Verarbeitung bereitgestellt.<br />
Die lokal vernetzten PC der Bauüberwachung sind über<br />
eine DSL-Verbindung mit einem Datenbankserver in Berlin<br />
[2] verb<strong>und</strong>en. Ein hierzu eingerichteter Transferdienst<br />
regelt die sichere Datenübergabe nach einem definierten<br />
Zeitplan. Der Transfertakt ist auf die Messintervalllängen<br />
synchronisiert, die nach den unterschiedlichen Bauphasen<br />
variieren.<br />
Abb. 3 - Diagramm zur Messwertverarbeitung<br />
Datenbank<br />
Alle erfassten Daten werden<br />
innerhalb einer Datenbank<br />
abgelegt, verarbeitet<br />
<strong>und</strong> zur Nutzung<br />
über Internetzugriff oder<br />
Benachrichtigungsdienste<br />
bereitgestellt (Abb. 3).<br />
Hierbei verwaltet das Vermessungsprogramm<br />
Geo2000 die geodätischen<br />
Messungen in der Datenbank.<br />
Die Messwerte werden<br />
dabei ohne Umstrukturierung<br />
ausgewertet <strong>und</strong><br />
an die Datenbank übergeben.<br />
Die Verarbeitung aller<br />
automatischen Messungen<br />
wird innerhalb der Datenbank<br />
durch den Übernahmedienst<br />
automatisiert<br />
gesteuert. Als Kernaufgaben<br />
werden hier die Funktionen<br />
Datenübernahme,<br />
Plausibilisierung, Durchführung<br />
spezieller Auswertungen,Grenzwertprüfungen<br />
<strong>und</strong> die Aufbereitung<br />
der Daten für die Internetpräsentation<br />
ausgeführt.<br />
Abb. 4 - Übersichtsseite der Homepage<br />
Die Übernahme <strong>und</strong> Verwaltung aller händischen Messungen<br />
wird innerhalb der Datenbank über vorher definierte<br />
Eingabemasken gesteuert. Schnittstellen generieren die<br />
Präsentation für alle automatisch, händisch <strong>und</strong> geodätisch<br />
ermittelten Ergebnisdaten. Inhaltlich werden hierfür Steuertabellen<br />
in der Datenbank vorgehalten, in denen das Diagrammlayout<br />
<strong>und</strong> die Zuordnung der Diagrammkurven zu<br />
den Datentabellen enthalten sind.<br />
Gegen hardwareseitige Ausfälle wird die Datenbank durch<br />
eine red<strong>und</strong>ante Datenhaltung auf zwei identischen Servern<br />
betrieben. Der Datenbankbestand wird auf optischen<br />
Datenträgern monatlich dem NBA zur Einlagerung<br />
übergeben. Alle Systeme arbeiten unabhängig<br />
von den bestehenden Dienstnetzwerken<br />
<strong>und</strong> verfügen an ihren Schnittstellen über besonders<br />
zuverlässige Absicherungen hinsichtlich<br />
Datensicherheit, Schutz vor Fremdzugriff, Manipulation<br />
u.ä..<br />
Die Messwerte werden so in der Datenbank abgelegt,<br />
dass sie nach Ende der Baumaßnahme als<br />
dauerhafter Nachweis in anderen Systemen archiviert<br />
werden können.<br />
Datenbereitstellung <strong>und</strong><br />
Bewertung<br />
Datenbereitstellung<br />
Ein wesentliches Merkmal dieses Beweissicherungskonzeptes<br />
ist die automatische Veröffentlichung<br />
der Ergebnisse aller Messungen über eine<br />
Homepage. Auf diese Weise informieren sich die<br />
am Projekt verantwortlich beteiligten Stellen regelmäßig<br />
über den Zustand der Beweissicherungsobjekte.<br />
Dem Eintritt in die Homepage ist ein Anmeldebild-
Beweissicherung <strong>und</strong> messtechnische Überwachung beim Bau der neuen Schleuse Sülfeld Süd<br />
schirm vorgeschaltet. Jeder Benutzer verfügt über individuelle<br />
Zugangsdaten, die durch eine vom NBA geführte Benutzerverwaltung<br />
organisiert werden. Nach seiner Anmeldung<br />
zeigt sich dem Benutzer die Übersichtskarte (Abb. 4).<br />
Vor einem im Hintergr<strong>und</strong> dargestellten Lageplan des Bauvorhabens<br />
ist jedes Objekt durch ein Feld gekennzeichnet,<br />
wobei die Feldfarbe den aktuellen Objektzustand angibt.<br />
Daneben befindet sich eine Liste aller Objekte, die in Ordnerbaumstruktur<br />
ausgearbeitet wurde. Ein Klick auf jeden<br />
Ordner öffnet einen sek<strong>und</strong>ären Verzeichnisbaum, der die<br />
einzelnen Messverfahren zur Auswahl auflistet.<br />
Ein Klick auf den Unterpunkt eines Objektes zeigt die aufbereiteten<br />
Messwerte mit ihren gültigen Alarmbereichen<br />
<strong>und</strong> allen notwendigen Zusatzinformationen innerhalb eines<br />
Diagrammfensters an. Hierzu erzeugt der Grafikrenderer<br />
die Darstellungen „on-the-fly“ aus den Sachdaten der Datenbank.<br />
Als Diagrammtyp kommen Weg-Zeit- <strong>und</strong> 2D-<br />
Spurdiagramme zur Anwendung. Die individuelle Betrachtung<br />
wird durch diverse Funktionsbuttons (Zoom, speichern,<br />
...) komplettiert. Mit Hilfe eines eingeblendeten Selektionsmenüs<br />
können standardisierte <strong>und</strong> variable Beobachtungszeiträume<br />
ausgewählt werden. Die Abbildung 5<br />
zeigt hierzu die beispielhafte Darstellung eines Weg-Zeit-<br />
Diagramms.<br />
Abb. 5 - Weg-Zeit - Diagramm Extensometer Pumpenhaus<br />
Für konkrete Analysen verfügt die Homepage über eine<br />
Funktion, mit der die Daten in dem zuvor selektierten Zeitraum<br />
in einem definierten Format heruntergeladen werden<br />
können. Zudem werden die monatlich geführte Bauzustandsdokumentation<br />
<strong>und</strong> wesentliche Inhalte der objektbezogenen<br />
Monatsberichte als .pdf-Datei zum Download<br />
bereitgestellt. Beide Dokumente sind für die Bewertung der<br />
Messdaten von gr<strong>und</strong>legender Bedeutung.<br />
Im Sinne der Beweissicherung wird eine vollständige Verfahrensdokumentation<br />
aufgestellt, deren Gliederung <strong>und</strong><br />
Aktualität im Schadensfall einen sofortigen Zugriff ermöglicht.<br />
Neben den objektbezogenen Auswerteberichten aller<br />
Messungen umfasst die Dokumentation ein monatlich geführtes<br />
Berichtswerk, das auf die Objekt- <strong>und</strong> Bauzustände<br />
eingeht.<br />
Alarmierung<br />
Nach einem dreistufig gegliederten Alarmierungsplan werden<br />
die ermittelten Veränderungsbeträge während der<br />
Übergabe in die Datenbank den definierten Grenzwerten<br />
gegenübergestellt. Bei festgestellten Wertüberschreitungen<br />
generiert der Alarmierungsdienst über einen GSM-Router<br />
Meldungen, die per SMS, eMail oder Fax den Alarmempfängern<br />
(im Alarmierungsplan festgelegte Mitarbeiter) zugestellt<br />
werden. Der störungsfreie Betrieb dieses Dienstes<br />
wird durch interne Überwachungsroutinen abgefragt <strong>und</strong><br />
dem Administrator regelmäßig gemeldet.<br />
Bewertung<br />
Innerhalb des NBA informieren sich die projektverantwortlichen<br />
Mitarbeiter regelmäßig über den aktuellen Zustand<br />
der beweisgesicherten<br />
Objekte <strong>und</strong> bewerten die<br />
Ergebnisse messtechnisch<br />
<strong>und</strong> von den Gr<strong>und</strong>aussagen<br />
her bautechnisch.<br />
Im Zuge ihrer gutachterlichen<br />
Tätigkeit<br />
führen die Fachreferate<br />
der B<strong>und</strong>esanstalt für<br />
<strong>Wasser</strong>bau <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esanstalt<br />
für Gewässerk<strong>und</strong>e<br />
die detaillierte<br />
bautechnische Bewertung<br />
der Messergebnisse<br />
durch.<br />
Fazit<br />
Beim Bau der Schleuse<br />
Sülfeld wird für die Beweissicherung<br />
<strong>und</strong> für die<br />
messtechnische Überwachung<br />
erstmalig innerhalb<br />
der WSV ein online- Visualisierungssystemeingesetzt.<br />
Das Medium Internet<br />
<strong>und</strong> die Datenbankverwaltung<br />
werden dafür<br />
benutzt, die großen Datenmengen<br />
schnell <strong>und</strong><br />
ohne großen Aufwand zu<br />
erfassen, aufzubereiten<br />
<strong>und</strong> zu visualisieren. Nur so ist eine rasche Interpretation<br />
<strong>und</strong> Bewertung von Objektzuständen <strong>und</strong> damit eine aktive<br />
Steuerung <strong>und</strong> Kontrolle der Baumaßnahme möglich.<br />
Quellen<br />
[1] Saathoff / Röben: Planung der Schleuse Sülfeld Süd, erschienen in<br />
<strong>Informationen</strong> der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>, 2003<br />
[2] Arge Vermessung FF Schleuse Sülfeld, bestehend aus<br />
ARC Berlin GmbH <strong>und</strong> Angermeier Ingenieure GmbH<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
53
54<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Fertigstellung<br />
des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
in Wolfsburg<br />
Der 12 Kilometer lange Streckenausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
(MLK) in der Stadt Wolfsburg von MLK-km 238,0 bis<br />
250,0 erfolgte in drei Abschnitten. Am 6. Dezember 2004<br />
konnte der letzte Abschnitt fertig gestellt <strong>und</strong> an das <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsamt Uelzen übergeben werden. Dieser<br />
Abschnitt war das bisher längste Baulos des <strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamtes<br />
(WNA) Helmstedt mit einer Länge von<br />
6 Kilometern. Es reichte vom unteren Vorhafen der Schleuse<br />
Sülfeld bis zum VW-Werk in Wolfsburg. Mit Ausnahme<br />
eines etwa 400 m langen Teilstücks im Bereich des<br />
Grenzgrabendükers (Nr. 413) ist die gesamte Strecke im<br />
Stadtbereich Wolfsburg damit fertig gestellt. Die Bauzeit<br />
des letzten Streckenabschnittes dauerte von April 2001 bis<br />
Dezember 2004 knapp vier Jahre. Die Baukosten lagen bei<br />
r<strong>und</strong> 28 Mio. Euro.<br />
Ausbauprofil<br />
Der ursprüngliche Kanal besaß ein Muldenprofil mit einer<br />
<strong>Wasser</strong>tiefe von 3,25 m <strong>und</strong> einer <strong>Wasser</strong>spiegelbreite von<br />
etwa 39 m. Wegen der beengten Platzverhältnisse zwischen<br />
der ICE-Trasse im Süden <strong>und</strong> den Werksflächen der<br />
VW AG im Norden wurde für den neuen Kanalquerschnitt<br />
zum größten Teil das kombinierte Rechteck-Trapez-Profil<br />
(KRT - Profil) gewählt. Es besitzt unter <strong>Wasser</strong> senkrechte,<br />
im <strong>Wasser</strong>wechselbereich <strong>und</strong> darüber geböschte Ufer.<br />
Unter <strong>Wasser</strong> wurde der Kanal im Rechteckprofil mit einer<br />
<strong>Wasser</strong>tiefe von 4,25 m <strong>und</strong> einer <strong>Wasser</strong>spiegelbreite von<br />
42,0 m zwischen den Sp<strong>und</strong>wänden ausgebaut (Abb. 1 <strong>und</strong><br />
Abb. 2). Die Sp<strong>und</strong>wandoberkante ist in Abschnitten von je<br />
ca. 13 m Länge sichtbar <strong>und</strong> ca. 40 m Länge unsichtbar<br />
Abb. 1 - Kanalquerschnitt<br />
Dr. Johanna Merlein<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
Arnold Biernoth<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
Abb. 2 - letzte Nassbaggerung im KRT Profil<br />
ausgebildet, d.h. die Oberkante der Sp<strong>und</strong>wand wechselt<br />
zwischen 0,3 m unter <strong>und</strong> 0,1 m über dem Normalwasserstand.<br />
Einbauverfahren ohne<br />
<strong>Wasser</strong>haltung<br />
In der oben genannten Strecke wurde erstmalig eine neue<br />
Bauweise zur Herstellung des KRT – Profils angewendet.<br />
Damit konnte auf die sonst üblichen <strong>Wasser</strong>haltungsmaßnahmen<br />
mit einer Sicherungssp<strong>und</strong>wand für das Einbringen<br />
der Sp<strong>und</strong>wände <strong>und</strong> die Stahlbauarbeiten verzichtet werden.<br />
Das heißt, sämtliche Anschlusskonstruktionen wurden<br />
auf der Baustelle bei der Montage der Ankerstühle, Konsolen<br />
<strong>und</strong> des Holmgurtes mit einer Schraubkonstruktion ausgeführt.<br />
Die einzelnen Arbeitsschritte des Bauverfahrens<br />
sind in [1] beschrieben. Dieses Verfahren hat sich gegenüber<br />
der konventionellen früheren Bauweise mit einer <strong>Wasser</strong>haltung,<br />
bei der sämtliche Anschlüsse geschweißt wurden,<br />
bewährt. Eine enorme Leistungssteigerung sowie eine<br />
sehr gute Ausführungsqualität konnte durch die Schraublösung<br />
erreicht werden. Die neue Bauweise hat sich – im<br />
Vergleich zu geschweißten Lösungen – nicht nur als sehr<br />
schnelle <strong>und</strong> einfache Anwendungstechnik, sondern auch
Abb. 3 - KRT-Profil im Bereich der Liegestelle<br />
als sehr wirtschaftliche <strong>und</strong> umweltfre<strong>und</strong>liche<br />
Lösung erwiesen (Abb. 3 <strong>und</strong><br />
4).<br />
In der freien Strecke wurden die Sp<strong>und</strong>wände<br />
zum größten Teil mit einem Rüttelverfahren<br />
eingebracht. In Bereichen<br />
von Brücken <strong>und</strong> der nahe liegenden<br />
Bebauung der Gemeinde Sandkamp<br />
wurden die Sp<strong>und</strong>wände erschütterungsfrei<br />
eingepresst.<br />
Liegestellen<br />
In Fallersleben wurden beidseitig des<br />
Kanals Liegestellen von ca. 400 m <strong>und</strong><br />
600 m Länge für die Binnenschifffahrt angelegt. Auf der<br />
Nordseite befindet sich jetzt eine so genannte KRT – Liegestelle<br />
mit Landgangstegen für Personen <strong>und</strong> für PKWs<br />
(Abb. 5).<br />
Auf der Südseite wurde die Liegestelle im Rechteck – Profil<br />
ausgebaut. Während der größte Teil der Liegestelle für die<br />
Berufsschifffahrt reserviert ist, stehen 75 m davon der<br />
Sportschifffahrt mit einer besonderen Ausstattung zur Verfügung.<br />
Hier befindet sich die Sp<strong>und</strong>wandoberkante bzw.<br />
der Holmgurt 1,5 m über dem Normalwasserstand.<br />
Beide Liegestellen sind mit Beleuchtung <strong>und</strong> Stromzapfstellen<br />
versehen. Die Befestigung der 6 m breiten Betriebswege<br />
entlang der Liegestellen erfolgte beidseitig mit einem<br />
Drainagepflaster. Damit wurden die Belange der unteren<br />
Naturschutzbehörde, keine versiegelten Flächen herzustellen,<br />
erfüllt.<br />
Abb. 5 - Liegestelle mit Landgangsteg <strong>und</strong> Stromzapfstelle<br />
Fertigstellung des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Wolfsburg<br />
Wendestelle<br />
Die ehemalige Wendestelle gegenüber vom Hafen<br />
Fallersleben wurde aufgegeben, da sie in ihren Abmessungen<br />
nicht mehr für Großmotorgüterschiffe ausreicht. Sie<br />
bleibt jedoch als Flachwasserzone für die Entwicklung von<br />
Flora <strong>und</strong> Fauna erhalten.<br />
Eine neue Wendestelle wurde weiter westlich am Ende der<br />
KRT- Liegestelle angelegt, die im Notfall auch als Notliegestelle<br />
genutzt werden kann (Abb. 6 <strong>und</strong> Abb. 7).<br />
Abb. 6 - Wendestelle im Bau<br />
Abb 7 - Wendestelle nach Fertigstellung<br />
Hafen Fallersleben<br />
Der Hafen Fallersleben<br />
entsprach mit seiner<br />
<strong>Wasser</strong>tiefe nicht mehr<br />
den Forderungen der<br />
heutigen Berufsschifffahrt.<br />
Die statische Länge der<br />
vorh. Sp<strong>und</strong>wand reichte<br />
für eine Vertiefung der<br />
Kanalsohle nicht aus, so<br />
dass Zusatzmaßnahmen<br />
erforderlich wurden.<br />
Dies wurde gelöst, indem<br />
man vor den Bergbohlen<br />
je einen Breitflanschträger<br />
(IPB) mit einer Länge von ca. 10 m unter der<br />
neuen Kanalsohle als Sp<strong>und</strong>wandfußsicherung einbrachte.<br />
Abb.4 - Auflegen <strong>und</strong> Verschrauben des Holmes<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
55
56 <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Abb. 8 - Umschlag von Schrott im Hafen Fallersleben, im Hin-<br />
tergr<strong>und</strong> Wendestelle, Liegestelle <strong>und</strong> Flachwasser-<br />
zonen<br />
Der Hafen war in der Vergangenheit drei mal erweitert<br />
worden, wobei Bereiche des Hafens schon vor dem Krieg in<br />
Betrieb waren. Besonders schwierig stellte sich die Suche<br />
nach Kampfmitteln dar. Im Hafen hatte wegen der Fahrzeugproduktion<br />
in Wolfsburg über Jahrzehnte ein Schrottumschlag<br />
stattgef<strong>und</strong>en (Abb. 8). Die Kanalsohle war im<br />
Hafen mit verlorenem Schrott bedeckt. Die übliche Sondierung,<br />
mit der Kampfmittel festgestellt werden können, hatte<br />
den gesamten Bereich als kampfmittelverdächtig ausgewiesen.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> war eine Kampfmittelfreigabe<br />
wegen der Schrottverseuchung der alten Kanalsohle nicht<br />
zu erreichen. Der Kanalaushub konnte nur mit einer Aushubkontrolle<br />
durchgeführt werden. Da selbst im zwischengelagerten<br />
Aushubboden Munition gef<strong>und</strong>en wurde, musste<br />
dieser auf Forderung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes<br />
(KBD) nochmals unter Aufsicht durchgesiebt werden. Damit<br />
war der angenommene einfache Ausbau des Hafen Fallersleben<br />
sehr aufwendig geworden.<br />
Düker <strong>und</strong> Einlaufbauwerke<br />
Zwei alte Düker (Nr. 409 <strong>und</strong> Nr. 410) reichten in das neue<br />
Kanalprofil <strong>und</strong> waren abzubrechen. Der Viehtriftweggrabendüker<br />
(Nr. 410) war bereits vor dem Streckenausbau<br />
durch einen Neubau ersetzt worden. Der in den Abmessungen<br />
kleinere Drainagedüker (Nr. 409) wurde im Horizontalspülbohrverfahren<br />
zusammen mit dem Streckenausbau<br />
neu errichtet.<br />
Zusätzlich war der Ersatzneubau des Grenzgrabendükers<br />
(Düker 413) mit dem Streckenlos ausgeschrieben. Er konnte<br />
wegen Problemen der Standsicherheit des angrenzenden<br />
Bahndurchlasses nicht hergestellt werden <strong>und</strong> wurde<br />
aus dem Vertrag gekündigt. Der Düker wird nun mit einem<br />
anderen Bauverfahren an anderer Stelle geplant <strong>und</strong> separat<br />
gebaut.<br />
Für die Stadt Wolfsburg wurde ein neues Einlaufbauwerk<br />
(Nr. 39) errichtet. Dabei wurden drei einzelne Bauwerke zu<br />
einem gemeinsamen Bauwerk zusammen gefasst.<br />
Fertigstellung des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Wolfsburg<br />
Ein vorhandener Trinkwasserdüker der Stadt Wolfsburg<br />
erforderte eine gesonderte Ausführung der Sp<strong>und</strong>wand. Da<br />
die Rohroberkante des Dükers sehr hoch lag, war ein einfacher<br />
Sp<strong>und</strong>wandverbau nicht möglich. Stattdessen wurde<br />
eine Trägerbohlwand mit einer Ausfachung aus Stahlbetonfertigteilen<br />
vorgesehen. Damit konnten die planmäßige<br />
Lage der Uferwand eingehalten <strong>und</strong> unvorhersehbare Beschädigungen<br />
infolge Bodenverdichtung an den Dükerrohren<br />
vermieden werden.<br />
Beengte Platzverhältnisse<br />
In der Gemeinde Sandkamp stehen einzelne Gebäude sehr<br />
nahe am MLK. Hier wurde aus statischen Gründen anstelle<br />
einer verankerten Sp<strong>und</strong>wand eine überschnittene Bohrpfahlwand<br />
hergestellt. Sie besteht aus 90 Bohrpfählen mit<br />
je 9,80 m Länge <strong>und</strong> 90 cm Durchmesser.<br />
Wegen der nahe liegenden ICE-Trasse musste der südliche<br />
Ausbaubereich platzsparend im KRT-Profil bzw. Rechteck-<br />
Profil ausgebaut werden.<br />
Flachwasserzonen<br />
Als Ausgleichs- <strong>und</strong> Ersatzmaßnahmen wurden beidseitig<br />
des MLK Flachwasserzonen angelegt. Eine davon befindet<br />
sich unmittelbar im Bereich der KRT - Liegestelle Nord. Von<br />
den zwei Teichen wird einer mit Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Oberflächenwasser<br />
gespeist, der andere Teich dagegen ist mit dem<br />
MLK verb<strong>und</strong>en. Der Betriebsweg wurde im Einlaufbereich<br />
mit einer Brücke versehen. Die Flachwasserzone der Südseite<br />
wurde mit einem offen Einlauf bzw. mit einem durchströmten<br />
<strong>und</strong> überspülten Deckwerk gebaut. Schon während<br />
der Bauzeit wurden die Flachwasserzonen von<br />
Reihern, Möwen <strong>und</strong> Wildgänsen sehr gut angenommen<br />
(Abb. 9).<br />
Abb. 9 - Vogelschar an der Baustelle der Flachwasserzone
Betriebswege<br />
Beidseitig des MLK wurden die Betriebswege mit Schotterrasen<br />
neu angelegt bzw. auf der Nichtausbauseite instand<br />
gesetzt. Der MLK führt mit seinen Betriebswegen mitten<br />
durch die Stadt Wolfsburg. Für Fußgänger, Freizeitsportler<br />
<strong>und</strong> Radfahrer wurde ein ideales Naherholungsgebiet geschaffen<br />
(Abb. 10). Einige Radfahrer <strong>und</strong> Fußgänger konnten<br />
die Fertigstellung dieses Streckenabschnittes kaum<br />
abwarten.<br />
Fertigstellung des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Wolfsburg<br />
Abb. 10 - Herstellung bzw. Instandsetzung der Betriebswege<br />
Literatur<br />
[1] Huxoll, Wiese, Biernoth: Ausbau der Stadtstrecke Wolfsburg-Fallersleben<br />
von der Schleuse Sülfeld bis zum VW-Werk. Binnenschifffahrt, Supplement,<br />
1/2 – 2003.<br />
Fazit<br />
Der hier beschriebene Ausbau des Streckenabschnittes im<br />
Raum Wolfsburg-Fallersleben war für den Bauherrn <strong>und</strong> für<br />
die ausführende Firma wegen der Vielfältigkeit der einzelnen<br />
Arbeiten eine Herausforderung. Auf einer Länge von<br />
6 km waren unter anderem zwei Liegestellen, eine Wendestelle,<br />
mehrere Einlaufbauwerke <strong>und</strong> Flachwasserzonen<br />
herzustellen. Während dieses spannende Baulos für den<br />
Baubevollmächtigten Arnold Biernoth der Abschluss des<br />
Berufslebens war, stellte es für die Sachbereichsleiterin<br />
Johanna Merlein einen Einstieg nach dem Referendariat<br />
beim WNA Helmstedt dar.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
57
58<br />
Neubau <strong>und</strong> Abbruch einer<br />
Straßenbrückenanlage über den<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal <strong>und</strong> über ein<br />
Bahngleis im Zuge der<br />
B<strong>und</strong>esstraße 71 in Vahldorf<br />
(Brücken Nr. 479 <strong>und</strong> 479a)<br />
Der Neubau der kurz vor Magdeburg bei MLK-km 307,740<br />
liegenden Brücke Nr. 479, die in Vahldorf die B<strong>und</strong>esstraße<br />
71 über den <strong>Mitte</strong>llandkanal (MLK) führt, gilt als eine<br />
der schwierigsten Aufgaben, die im <strong>Wasser</strong>straßen-<br />
Neubauamt Helmstedt zu lösen waren. Mit der 5,8 Mio.<br />
Euro teuren Baumaßnahme sind insgesamt drei Brücken<br />
errichtet worden:<br />
• die Brücke der B<strong>und</strong>esstraße 71 über den MLK,<br />
• eine Brücke über ein parallel zum Kanal verlaufendes<br />
Eisenbahngleis <strong>und</strong><br />
• eine Behelfsbrücke für die Bauzeit, die zu einer Minimierung<br />
der Sperrzeit führte.<br />
Historisches<br />
Kurz nach dem Ende des 1. Weltkriegs wurden die Arbeiten<br />
zum Weiterbau des MLK ostwärts von Hannover vorangetrieben.<br />
Im Zuge dieser Bauarbeiten ist im Jahre<br />
1927 mit der Herstellung der alten Straßenbrücke Nr. 479<br />
in Vahldorf begonnen worden (Abb.1).<br />
Die Brückenkonstruktion überspannte mit einer Stützweite<br />
von insgesamt 62 m den MLK. Auf beiden Seiten waren<br />
Schleppträger mit einer Länge von 5,40 m zwischen dem<br />
Stützpfeiler <strong>und</strong> dem Widerlager vorgelagert. Die Nutz-<br />
Abb. 1 - Kanalbau 1935 unterhalb der Brücke Nr. 479<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Julia Sembritzki<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
Abb. 2 - Fachwerkknoten mit Nietverbindungen<br />
Michael Münch<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
breite betrug 8,20 m bei einer Straßenbreite von 6 m, zuzüglich<br />
Geh- <strong>und</strong> Notweg. Das Gesamtgewicht<br />
der Fachwerkkonstruktion, die mit den damals<br />
typischen Nietverbindungen (Abb. 2) hergestellt<br />
wurde, betrug ca. 307 t.<br />
Die Fahrbahn war mit sogenannten Buckelblechen<br />
ausgekleidet. Sie dienten nicht nur zur<br />
Lastverteilung der Gebrauchslasten, sondern<br />
wurden auch als Schalung für den weiteren Aufbau<br />
der Fahrbahnplatte verwandt.<br />
Nach insgesamt drei Jahren Bauzeit ist die Brücke<br />
im Jahr 1930 dem Straßenverkehr übergeben<br />
worden. Durch den damit verb<strong>und</strong>enen<br />
gleichzeitigen Bau der Straßenbrücke Nr. 479a<br />
über das Eisenbahngleis konnte schon damals<br />
der Wegfall des Bahnüberganges realisiert werden.
Planung<br />
Neubau <strong>und</strong> Abbruch einer Straßenbrückenanlage über den <strong>Mitte</strong>llandkanal <strong>und</strong> über ein Bahngleis im Zuge der B<strong>und</strong>esstraße 71 in Vahldorf<br />
Die Hauptabmessungen der neuen Brücke ergaben sich<br />
einerseits aus dem Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals sowie der<br />
Vergrößerung der Durchfahrtshöhe <strong>und</strong> andererseits aus<br />
den gestiegenen Anforderungen des Straßenverkehrs, die<br />
eine breitere Fahrbahn erforderten.<br />
Durch das breitere Kanalprofil erhält die neue Straßenbrücke<br />
eine Stützweite von 81,73 m. Das Bauwerk ist damit ca.<br />
20 m länger als die vorhandene Stahlfachwerkkonstruktion.<br />
Gleichzeitig wird der Schifffahrt durch die höher liegende<br />
neue Brücke eine ausreichende Durchfahrtshöhe von<br />
5,75 m zur Verfügung gestellt. Dies hat für den weiteren<br />
Straßenverlauf zur Folge, dass auch die Straßenbrücke Nr.<br />
479a über das Bahngleis angepasst werden muss. Mit<br />
einer um ca. 5 m vergrößerten Nutzbreite von 13,25 m <strong>und</strong><br />
der Brückenklasse 60/60 werden die neuen Brücken auch<br />
den zukünftigen Verkehrsanforderungen auf der Straße<br />
gerecht.<br />
Die Trassierung der neuen Brücken konnte trotz der Ortsrandlage<br />
nur im Wesentlichen in der alten Linienführung<br />
erfolgen, da die Trassierungsmöglichkeiten durch den<br />
Vahldorfer Hafen <strong>und</strong> durch Wohnhäuser auf beiden Seiten<br />
stark eingeschränkt waren. Dies hätte eine Vollsperrung<br />
der Brücke für die gesamte Bauzeit von fast zwei Jahren<br />
erfordert. Die Lösung erschien jedoch nahezu unmöglich,<br />
da auf der stark befahrenen B<strong>und</strong>esstraße 71 etwa 20.000<br />
Fahrzeuge am Tag gezählt werden <strong>und</strong> die Brücke außerdem<br />
eine sehr wichtige Verbindung der Landwirtschaft zum<br />
Hafen in Vahldorf, der Getreide, Düngemittel <strong>und</strong><br />
andere für die Landwirtschaft notwendige Erzeugnisse<br />
umschlägt, darstellt.<br />
Durch die Erörterung dieser Probleme im Planfeststellungsverfahren<br />
konnte eine Kompromisslösung<br />
gef<strong>und</strong>en werden. Die Lösung sah ein Konzept mit<br />
einer Behelfsumfahrung für die Baustelle vor, das<br />
eine Reduzierung der notwendigen Vollsperrungen<br />
auf insgesamt nur zwei Sperrzeiten außerhalb der<br />
Erntezeiten für je höchstens 60 Tage erlaubte. Mit<br />
diesen Vorgaben hat das <strong>Wasser</strong>straßen-<br />
Neubauamt Helmstedt eine Trassierung entwickelt,<br />
die es ermöglichte, eine Behelfsbrücke über den<br />
MLK parallel zu der vorhandenen Straßenachse<br />
herzustellen sowie gleichzeitig für diese Behelfsumfahrung<br />
die bestehende Brücke über das Bahngleis,<br />
das parallel zum MLK verläuft, zu nutzen. Daher<br />
wurde die neue Kanalbrücke in nahezu alter Lage<br />
errichtet. Die neue Brücke über das Bahngleis konnte<br />
jedoch neben der vorhandenen Bahnbrücke<br />
errichtet werden, so dass sich für die neugebaute<br />
B<strong>und</strong>esstraße eine leicht veränderte Linienführung<br />
ergab. Um die Kosten der Baumaßnahme möglichst<br />
gering zu halten, wurde nach ausführlichen Untersuchungen<br />
<strong>und</strong> Abwägungen entschieden, den<br />
alten Fachwerküberbau der Brücke über den MLK als<br />
Überbau für die Behelfsbrücke zu verwenden. In den Abwägungsprozess<br />
flossen insbesondere die gute Qualität der<br />
alten Materialien <strong>und</strong> der alten Verbindungsmittel (Nieten)<br />
ein. Die Untersuchung ergab eine niedrige Einschätzung für<br />
die Versagenswahrscheinlichkeit, so dass die alte Fachwerkbrücke<br />
ohne Bedenken als Brückenüberbau für eine<br />
Behelfsumfahrung genutzt werden konnte.<br />
Als statisches System wurde für die neue Brücke über den<br />
MLK eine Stabbogenbrücke, die eine sehr wirtschaftliche<br />
Konstruktion darstellt, gewählt. Darüber hinaus bietet sie<br />
eine harmonische Einpassung in die Landschaft.<br />
Der Brückenentwurf wurde so konzipiert, dass die statisch<br />
erforderlichen Bleche auch für gestalterische Aspekte genutzt<br />
werden konnten. Auffällig gegenüber den anderen<br />
Brückenbauwerken in der Osthaltung des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
sind die schräg liegenden Hängerstangen, welche typisch<br />
für die Brückenfamilie „Hohe Dammstrecke“ sind. In der<br />
„Hohen Dammstrecke“, dem östlichsten Abschnitt des <strong>Mitte</strong>llandkanals,<br />
wurden Gestaltungselemente aus dem<br />
Stadtbereich Hannover aufgegriffen. Die statischen Auswirkungen<br />
der schrägen Hänger sind gegenüber der sonst<br />
üblichen senkrechten Ausführung zu vernachlässigen. Die<br />
Farbgebung der Stahlkonstruktion setzt sich aus einem<br />
verkehrsblauen Bogen <strong>und</strong> Längsträger sowie rubinroten<br />
Hängerstangen <strong>und</strong> Anschlussblechen zusammen. Als<br />
Gestaltung für die Oberfläche der Betonwiderlager wurde<br />
eine Strukturierung in Verbindung mit einer Brettstruktur<br />
gewählt.<br />
Bauablauf <strong>und</strong> -ausführung<br />
Der Bau der Brücken 479 <strong>und</strong> 479a wurde am<br />
26. September 2003 an die Arbeitsgemeinschaft <strong>Mitte</strong>llandkanalbrücke<br />
Nr. 479 vergeben. Die auf Gr<strong>und</strong> eines Nebenangebotes<br />
verkürzte Bauzeit betrug 22 Monate.<br />
Bevor die Arbeitsgemeinschaft mit den Brückenneubauten<br />
Abb. 3 - Nördliches Behelfswiderlager mit Pendelstütze<br />
beginnen konnte, musste die Behelfsumfahrung hergestellt<br />
werden. Dafür wurden zunächst zwei Behelfswiderlager<br />
<strong>und</strong> eine Pendelstütze errichtet. Das südliche aus Stahlbeton<br />
bestehende Widerlager wurde flach gegründet. Auf der<br />
Nordseite wurden im Bereich der Uferlinie die Pendelstütze<br />
<strong>und</strong> ca. 5 m weiter nördlich das Widerlager tief gegründet.<br />
Für die Pendelstütze wurde im Bereich der Uferlinie eine<br />
Pfahlkopfplatte, gelagert auf vier Bohrpfählen mit einer<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
59
60 <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Neubau <strong>und</strong> Abbruch einer Straßenbrückenanlage über den <strong>Mitte</strong>llandkanal <strong>und</strong> über ein Bahngleis im Zuge der B<strong>und</strong>esstraße 71 in Vahldorf<br />
Länge von ca. 15 m, hergestellt. Auf der Pfahlkopfplatte ist<br />
die Pendelstütze als Stahlrahmenkonstruktion mit Rückverankerung<br />
am nördlichen Widerlager montiert. Sie dient<br />
gleichzeitig als Auflager für den alten Stahlüberbau <strong>und</strong> für<br />
den weiterführenden nördlichen Schleppträger, der den<br />
Betriebsweg überbrückt. Das nördliche Widerlager - Auflager<br />
für den Schleppträger - wurde als verankerter Sp<strong>und</strong>wandkasten<br />
mit einer Auflagerbank aus Beton ausgebildet<br />
(Abb. 3).<br />
Die unterschiedlichen Bauweisen der Behelfswiderlager<br />
erklären sich einerseits beim südlichen Stahlbetonwiderlager<br />
durch die relativ nahe Bebauung, die eine erschütterungsfreie<br />
Herstellung erforderte, <strong>und</strong> andererseits beim<br />
nördlichen Widerlager als Sp<strong>und</strong>wandkasten, weil dieser<br />
gleichzeitig als Verbau bei der späteren Herstellung der<br />
Gründung für die neue Brücke genutzt werden konnte.<br />
Abb. 4 - Querverheben der alten Brücke für die Behelfsumfahrung<br />
Für die Fertigstellung der Behelfsbrücke wurde die vorhandene<br />
Fachwerkkonstruktion bei der ersten Vollsperrung<br />
des Straßenverkehrs mit einem Schwimmkran um<br />
ca. 20 m nach Osten auf die Behelfswiderlager versetzt<br />
(Abb. 4). Da die Lastaufnahme des Schwimmkrans auf<br />
300 t begrenzt war, wurde zur Reduzierung des Gewichts<br />
der alte Fahrbahn- <strong>und</strong> Gehwegaufbau demontiert.<br />
Für die weitere Nutzung musste anschließend die<br />
Betonfahrbahn wieder hergestellt werden.<br />
Nach dem Anschluss der provisorischen Straßenrampen<br />
wurde die Behelfsumfahrung nach 60 Tagen Vollsperrung<br />
in Benutzung genommen. Dadurch wurden die<br />
angrenzenden kleineren Ortschaften <strong>und</strong> Straßen größtenteils<br />
vom Umleitungsverkehr entlastet.<br />
Nun konnte mit dem Bau der Straßenbrücken auf einem<br />
freien Baufeld begonnen werden. Zuerst wurde der Neubau<br />
der Straßenbrücke Nr. 479a über das Bahngleis als<br />
klassische Stahlbetoneinfeldbrücke mit Ortbetonplatte<br />
hergestellt. Danach folgte der Bau der Widerlager für die<br />
neue Brücke über den Kanal, die eine erhebliche Höhendifferenz<br />
zur Behelfsbrücke aufwies. Aufgr<strong>und</strong> des<br />
geringen Bauwerksabstandes konnte auf der Nordseite<br />
die Baugrube für die Pfahlkopfplatte unter Verwendung<br />
des als Behelfsbrückenwiderlagers ausgebildeten Sp<strong>und</strong>wandkastens<br />
hergestellt werden. Der Sp<strong>und</strong>wandkasten<br />
wurde neben den Verkehrslasten auch für diese beiden<br />
Verwendungszwecke bemessen. Auf der Südseite wurde<br />
dafür eine zusätzliche Sicherungswand vorgesehen.<br />
Jede Pfahlkopfplatte ist auf dreißig ca. 15 m langen Stahlbeton-Bohrpfählen<br />
gegründet. Diese Tiefgründung gewährleistet<br />
eine ausreichende Standsicherheit, um die auf den<br />
Pfahlkopfplatten stehenden Widerlager <strong>und</strong> Flügelwände<br />
aus Stahlbeton zu tragen.<br />
Während der Herstellung der Widerlager wurde gleichzeitig<br />
der Stahlüberbau auf der Südseite wie ein dreidimensionales<br />
Puzzle mit Hilfe von Autokränen zusammengesetzt bzw.<br />
vormontiert. Die Einzelteile sind vorher mit Sattelzügen, die<br />
als Sondertransporte in der Regel nur nachts verkehren<br />
durften, auf die Baustelle geliefert worden.<br />
Nach der Vormontage der Stahlkonstruktion, die ca. 450 t<br />
wiegt, konnte diese in ihre endgültige Lage über den<br />
Kanal eingebaut werden. Dafür wurde die Brückenkonstruktion<br />
mit sogenannten Schlitten auf einer Verschubbahn<br />
bis an die südliche Uferlinie des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
vorgeschoben. Hier wurden die vorderen Schlitten durch<br />
einen Ponton ersetzt, so dass der Stahlüberbau zur Hälfte<br />
auf dem Ponton im <strong>Wasser</strong> schwamm <strong>und</strong> mit der<br />
rückwärtigen Hälfte noch auf den Schlitten lagerte<br />
(Abb. 5). Danach wurde der Ponton mit Stahlseilen <strong>und</strong><br />
Winden auf die nördliche Uferseite gezogen. Mit Hilfe von<br />
Pressen <strong>und</strong> vorbereiteten Holzstapeln wurde die Brücke<br />
langsam auf den Widerlagern abgesetzt <strong>und</strong> mit den<br />
Lagern verb<strong>und</strong>en.<br />
Noch vor dem Einbau des Stahlüberbaus wurden während<br />
der zweiten Vollsperrung die Straßenanbindungen<br />
<strong>und</strong> -knotenpunkte für die neue Trasse hergestellt. Am<br />
10. Juni <strong>2005</strong> waren die Arbeiten für den neuen Abschnitt<br />
der B<strong>und</strong>esstraße 71 bis auf kleinere Arbeiten abgeschlossen<br />
<strong>und</strong> die neuen Brücken konnten dem Verkehr<br />
übergeben werden.<br />
Abb. 5 - Einbau des Stahlüberbaus mit einem Ponton
Neubau <strong>und</strong> Abbruch einer Straßenbrückenanlage über den <strong>Mitte</strong>llandkanal <strong>und</strong> über ein Bahngleis im Zuge der B<strong>und</strong>esstraße 71 in Vahldorf<br />
Abb. 6 - Absetzen der alten Brückenkonstruktion am südlichen Ufer<br />
Nach der Verkehrsfreigabe erfolgte der Rückbau der Behelfsumfahrung.<br />
Zunächst wurde die alte Brücke ausgebaut,<br />
in dem ein Schwimmkran die Fachwerkkonstruktion<br />
anhob <strong>und</strong> am südlichen Ufer absetzte (Abb. 6). Während<br />
die Brücke an Land für die Verschrottung zerlegt wurde,<br />
Abb. 7 - Fertiggestellte <strong>Mitte</strong>llandkanalbrücke<br />
fand gleichzeitig der Abbruch der beiden Behelfswiderlager<br />
statt. Danach erfolgte der Rückbau der provisorischen<br />
Straßenrampen <strong>und</strong> der endgültige Anschluss<br />
der Haupt- <strong>und</strong> Nebenrampen Die Gesamtkosten für<br />
das neue Bauwerk, einschließlich der Kosten für die<br />
neue Brücke über die Bahngleise <strong>und</strong> die Kosten für<br />
den Straßenbau, belaufen sich auf 5,8 Millionen Euro.<br />
Die neue Brücke ist eine sogenannte Kostenteilungsbrücke,<br />
d.h. die Forderungen der Straßenbauverwaltung<br />
nach einer größeren Nutzbreite für die überführte<br />
B<strong>und</strong>esstraße 71 wurden berücksichtigt <strong>und</strong> das Kreuzungsbauwerk<br />
an das gestiegene Verkehrsaufkommen<br />
angepasst. Damit ist die Straßenbauverwaltung an den<br />
Gesamtkosten zu beteiligen.<br />
Fazit<br />
Die komplizierte Baumaßnahme in Vahldorf stellte das<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt Helmstedt vor schwierige<br />
Aufgaben. Innerhalb von knapp zwei Jahren wurden<br />
einschließlich der Behelfsbrücke drei Brücken bei Aufrechterhaltung<br />
des Verkehrs errichtet. Hiervon wurde<br />
besonders die Planung des Bauablaufes beeinflusst.<br />
Eine Herausforderung stellte die Verwendung der alten<br />
Fachwerkbrücke <strong>und</strong> damit der Umgang mit dem über<br />
70 Jahre im Einsatz befindlichen alten Baustoff Stahl dar.<br />
Die Schwierigkeiten wurden von allen an der Baumaßnahme<br />
Beteiligten – Planer, Bauausführende <strong>und</strong> Bauaufsicht –<br />
in guter Zusammenarbeit bewältigt.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
61
62<br />
Uwe Kollecker<br />
Neubauamt für den Ausbau des<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover<br />
Veranlassung<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausbau des oberen<br />
Vorhafens der<br />
Schleuse Uelzen<br />
Die neue Schleuse Uelzen II entsteht direkt östlich neben<br />
der vorhandenen Schleuse. Der Achsabstand der beiden<br />
Schleusen beträgt 70 m.<br />
Bei der Planung des Elbe-Seitenkanals (ESK) <strong>Mitte</strong> der<br />
sechziger Jahre wurde berücksichtigt, dass zu einem späteren<br />
Zeitpunkt bei Erreichen der Leistungsfähigkeit der<br />
Schleuse Uelzen ein Schiffshebewerk mit einem 100 m<br />
langen Trog unterwasserseitig östlich neben der Schleuse<br />
hätte errichtet werden können. Hierfür wurden die Vorhäfen<br />
bereits so aufgeweitet, dass später nur noch die Zufahrten<br />
zu dem neuen Schiffshebewerk hätten hergestellt werden<br />
müssen.<br />
Die 1995 durchgeführten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen<br />
für ein zweites Abstiegsbauwerk in Uelzen haben dann<br />
jedoch ergeben, dass der Bau einer zweiten 190 m langen<br />
Schleuse wirtschaftlich günstiger ist.<br />
Die Entscheidung für eine zweite Schleuse parallel neben<br />
der vorhandenen hatte zur Folge, dass die Vorhäfen den<br />
neuen geometrischen Randbedingungen anzupassen waren<br />
(Abb. 1).<br />
Abb. 1 - Ausbau der Vorhäfen (Erweiterungsflächen dunkelblau)<br />
Günter Schulz<br />
Neubauamt für den Ausbau des<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover<br />
Ausbau des unteren Vorhafens<br />
Im Bereich des unteren Vorhafens musste die Vorhaltefläche<br />
für das ehemals geplante Schiffshebewerk abgegraben<br />
werden. Insgesamt waren 275 m Ufersp<strong>und</strong>wand neu zu<br />
rammen, 275 m alte Ufersp<strong>und</strong>wand mussten gezogen<br />
bzw. abgebrannt werden. Außerdem waren 75.000 m³<br />
Boden auszuheben <strong>und</strong> eine Sohlfläche von 12.000 m² mit<br />
Geotextil <strong>und</strong> Schüttsteinen zu befestigen. Die Arbeiten, die<br />
bautechnisch unproblematisch waren, wurden Ende <strong>2005</strong><br />
abgeschlossen.<br />
Ausbau des oberen Vorhafens<br />
Der obere Vorhafen wurde ausgebaut, damit auch die größeren<br />
Schiffseinheiten sicher <strong>und</strong> schnell in die Schleuse<br />
ein- <strong>und</strong> ausfahren können. Mit dem Ausbau, der insgesamt<br />
6,5 Mio. Euro kostete, wurde die Vorhafengeometrie so<br />
verbessert, dass<br />
• unmittelbar oberwasserseitig der neuen Schleuse zwei<br />
Startplätze der Schifffahrt zur Verfügung stehen,<br />
• die Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des Schiffsverkehrs bei<br />
der Ein- <strong>und</strong> Ausfahrt wesentlich erhöht wird,
• im oberen Vorhafen zusätzlich zwei Liegeplätze<br />
vorhanden sind <strong>und</strong><br />
• große Schubverbände ohne Abkoppeln in<br />
die neue Schleuse ein- bzw. aus der neuen<br />
Schleuse ausfahren können.<br />
Wirtschaftlich am stärksten wogt dabei, dass bei<br />
der vorhandenen Vorhafengeometrie die Ein-<br />
bzw. Ausfahrt der Schiffe <strong>und</strong> damit die Schleusungsdauer<br />
deutlich länger wäre, weil sowohl<br />
die ausfahrenden als auch die einfahrenden<br />
Schiffe sehr viel größere Strecken (einige h<strong>und</strong>ert<br />
Meter) zwischen Schleuse <strong>und</strong> Startplatz<br />
zurücklegen müssten.<br />
Der obere Vorhafen befindet sich in einer<br />
Dammstrecke. Die gedichtete Sohle liegt 10 –<br />
15 m über Gelände. Bei der Erweiterung war<br />
sicherzustellen, dass keine kritischen Bauzustände<br />
eintraten. Der Dammsicherheit war<br />
höchste Priorität einzuräumen.<br />
Die Erweiterung umfasste das Anschütten von<br />
200.000 m³ Bodenmaterial (Sand <strong>und</strong> Geschiebemergel),<br />
das Rammen <strong>und</strong> Verankern von 550 m Ufersp<strong>und</strong>wand<br />
<strong>und</strong> von 500 m Fangedammsp<strong>und</strong>wand, das Abbrennen<br />
von 1.000 m Sp<strong>und</strong>wand unter <strong>Wasser</strong> <strong>und</strong> das Herstellen<br />
von 15.000 m² gedichteter Kanalsohle.<br />
Zunächst wurde der Damm im Bereich des oberen Vorhafens<br />
mit dem Aushubmaterial aus der Baugrube für die<br />
neue Schleuse um das erforderliche Maß verbreitert. Dann<br />
wurde die neue Ufersp<strong>und</strong>wand eingebracht <strong>und</strong> verankert.<br />
Der Erweiterungsbereich zwischen alter <strong>und</strong> neuer Ufersp<strong>und</strong>wand<br />
wurde anschließend mit 30 cm Ton gedichtet,<br />
mit Geotextil abgedeckt <strong>und</strong> mit einer 60 cm dicken Deckschicht<br />
aus Silikatsteinen befestigt <strong>und</strong> geschützt. Ein 15 m<br />
breiter Streifen entlang der neuen Ufersp<strong>und</strong>wand wurde<br />
zusätzlich mit einer Vergussmenge von 90 l/m² verklammert,<br />
weil die Sohle hier durch den Schraubenstrahl der<br />
ablegenden Schiffe besonders beansprucht wird.<br />
Die Sohldichtung <strong>und</strong> -befestigung wurde, soweit es ging,<br />
im Trockenen eingebracht. Der Einbau der Sohle im Trockenen<br />
war jedoch nicht bis an die alte Ufersp<strong>und</strong>wand<br />
heran möglich. Die alte Sp<strong>und</strong>wand hätte den kanalseitigen<br />
<strong>Wasser</strong>druck nicht aufnehmen können, wenn landseitig der<br />
Boden im Trockenen bis zur Sohle abgegraben worden<br />
wäre. Außerdem wäre schon bei kleinen Fehlstellen in der<br />
vorhandenen Kanaldichtung (Asphalt) die hydraulische<br />
Gr<strong>und</strong>bruchsicherheit nicht mehr gegeben gewesen.<br />
Abb. 2 - Ausbau des oberen Vorhafens - Querschnitt<br />
Ausbau des oberen Vorhafens der Schleuse Uelzen<br />
Abb. 3 -Ausbau des oberen Vorhafens - Einbau der Sohle im Trockenen im<br />
Erweiterungsbereich. Rechts davon der Fangedamm mit der alten Ufersp<strong>und</strong>wand<br />
Mit Hilfe einer zweiten Sp<strong>und</strong>wand wurde die alte Ufersp<strong>und</strong>wand<br />
deshalb zu einer standsicheren 6 m breiten<br />
Fangedammkonstruktion verb<strong>und</strong>en. Im Schutze dieses<br />
Fangedammes war der Einbau der Sohle im Trockenen<br />
möglich (Abb. 2 <strong>und</strong> 3). Der fertiggestellte Bereich wurde<br />
anschließend geflutet.<br />
Die technische Herausforderung bestand im Rückbau des<br />
ca. 550 m langen Fangedammes. Ein Ausbau des 6 m<br />
breiten Zwischenraumes im Trockenen war nicht möglich,<br />
da die Sp<strong>und</strong>wände ohne Hinterfüllung nicht standsicher<br />
waren. Eine theoretisch denkbare gegenseitige Aussteifung<br />
der Wände wurde verworfen, weil die hydraulische Gr<strong>und</strong>bruchsicherheit<br />
auf der Seite der alten Ufersp<strong>und</strong>wand<br />
nicht in jedem Fall nachgewiesen werden konnte.<br />
Der 6 m breite Zwischenraum wurde zunächst im Nassen<br />
ausgehoben. Dann wurde die Sohle ebenfalls im Nassen<br />
abgedichtet (60 cm Colcredur, Geotextil, 60 cm verklammerte<br />
Deckschicht) <strong>und</strong> schließlich wurden die Sp<strong>und</strong>wände<br />
unter <strong>Wasser</strong> auf Sohlhöhe abgebrannt.<br />
Beim Aushub im Nassen war zwangsläufig bis zum Einbau<br />
der Dichtung eine gewisse Sohlfläche vorübergehend ohne<br />
Dichtung. Über diese Fläche versickerte eine bestimmte<br />
<strong>Wasser</strong>menge in den Damm. Dass sich hieraus keine Gefahrensituation<br />
entwickelte, hatte höchste Priorität bei der<br />
Bauabwicklung. Mit einem mehrstufigen Sicherheitskonzept<br />
wurde dem besonderen Gefahrenpotential in der mehr als<br />
10 m hohen Dammstrecke Rechnung getragen.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
63
Sicherheitskonzept<br />
<strong>und</strong> Alarmplan<br />
Das Konzept bestand aus konstruktiven Sicherheitsmaßnahmen,<br />
bautechnischen Auflagen, einer intensiven<br />
Dammbeobachtung <strong>und</strong> einem detaillierten Alarmplan.<br />
Der Kanaldamm wurde konstruktiv so ausgebildet, dass er<br />
auch bei vollständiger Durchströmung standsicher ist. Die<br />
Böschungsfüße erhielten eine Neigung von 1:4 <strong>und</strong> wurden<br />
zusätzlich im Vorhafenbereich mit einem abgestuften<br />
Schottergemisch abgedeckt.<br />
In Zusammenarbeit mit der B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau<br />
(Außenstelle Hamburg) wurde die maximal zulässige ungedichtete<br />
Sohlfläche festgelegt (500 m²). Der Auftragnehmer<br />
durfte maximal diese Fläche freilegen. Er war darüber hinaus<br />
bauvertraglich verpflichtet, Geräte <strong>und</strong> Material für alle<br />
denkbaren Schadensfälle bereit zu halten. Für den Fall,<br />
dass z.B. die Versickerung kritische Werte erreichte <strong>und</strong> die<br />
planmäßigen Abdichtungsarbeiten aus irgendwelchen<br />
Gründen nicht durchgeführt werden konnten, hatte er Dichtungsmatten<br />
(Bentonitmatten) einschließlich aller für das<br />
Verlegen der Matten erforderlichen Geräte auf der Baustelle<br />
vorzuhalten.<br />
Die Dammbeobachtung im Ausbaubereich des oberen Vor-<br />
64 <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Ausbau des oberen Vorhafens der Schleuse Uelzen<br />
Abb. 4 - Verlauf der Gr<strong>und</strong>wasserstände während <strong>und</strong> nach Rückbau des Fangedamms<br />
hafens bestand aus der Ablesung <strong>und</strong> Auswertung von 54<br />
Gr<strong>und</strong>wassermessstellen <strong>und</strong> aus der Dammbegehung.<br />
Ablesung <strong>und</strong> Begehung wurden täglich morgens <strong>und</strong><br />
abends durchgeführt. Abb. 4 zeigt den Verlauf von 4 Gr<strong>und</strong>wassermessstellen<br />
unmittelbar landseitig der Ufersp<strong>und</strong>wand<br />
des oberen Vorhafens. Der Rückbau des Fangedamms<br />
erfolgte auf Höhe der Messstellen 419 F <strong>und</strong> 421 F<br />
<strong>Mitte</strong> April bis Anfang Mai <strong>2005</strong>, auf Höhe der Messstellen<br />
501 <strong>und</strong> 502 <strong>Mitte</strong> Juli bis Anfang August <strong>2005</strong>. Es ist sehr<br />
schön zu erkennen, wie der Rückbau des Fangedamms<br />
zunächst zu einem Anstieg des Gr<strong>und</strong>wasserspiegels führte<br />
<strong>und</strong> wie nach Einbringen der Dichtung der Gr<strong>und</strong>wasserspiegel<br />
wieder abfiel. Der Gr<strong>und</strong>wasseranstieg war insgesamt<br />
sehr <strong>und</strong>ramatisch. Dies wird auch daran deutlich,<br />
dass der Kanalwasserstand im oberen Vorhafen auf NN +<br />
65,00 m liegt <strong>und</strong> der maximal gemessenen Wert (Messstelle<br />
502) etwa NN + 49,00 m betrug.<br />
In Zusammenarbeit mit den Katastrophenschutzbehörden<br />
wurde ein Alarmplan aufgestellt. Der Plan beschrieb in<br />
Abhängigkeit vom Schadensfall die einzuleitenden Sofortmaßnahmen.<br />
Er enthielt darüber hinaus eine Liste von<br />
Ansprechpartnern bei Behörden <strong>und</strong> Firmen.<br />
Der Ausbau des oberen Vorhafens wurde planmäßig <strong>Mitte</strong><br />
August <strong>2005</strong> abgeschlossen.
Wolfgang Huck<br />
Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong><br />
beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Minden<br />
Hans Peter Krönert<br />
Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong><br />
beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Minden<br />
Das Kom-Netz (Kommunikations-Netz, früher <strong>Wasser</strong>straßen-Fernmeldenetz<br />
[WF-Netz]) der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
(WSV) dient der Unterhaltung der B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
<strong>und</strong> dem Betrieb ihrer Anlagen, der<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des Verkehrs auf den <strong>Wasser</strong>straßen<br />
sowie dem Hochwasser- <strong>und</strong> Eismeldedienst. Diese<br />
Infrastruktureinrichtung besteht an den <strong>Wasser</strong>straßen<br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion (<strong>WSD</strong>) <strong>Mitte</strong> seit rd.<br />
90 Jahren <strong>und</strong> wurde im Laufe der Betriebsjahre den jeweiligen<br />
Anforderungen mehrfach angepasst.<br />
Geschichtliche Entwicklung<br />
der Netzinfrastruktur<br />
Die Einrichtung des Kom-Netzes im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Abb. 1 - Übersichtsplan der Fernsprechverbindungen am MLK um 1920<br />
Das Kom-Netz der WSV im Bereich<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> –<br />
Technischer Wandel einer<br />
notwendigen Infrastruktur<br />
erfolgte mit dem Bau des <strong>Mitte</strong>llandkanals (MLK) von 1906<br />
bis 1938. Damals wurde eine Freileitung errichtet, um einen<br />
Telefonverkehr zwischen den Dienststellen zu ermöglichen.<br />
In Abbildung 1 ist ein Übersichtsplan dieser Telefonverbindungen<br />
aus dem Jahre 1920 zu sehen. Bei nur zwei Fernleitungen<br />
<strong>und</strong> nur einer Bezirksleitung entlang des MLK<br />
(damals noch Ems-Weser-Kanal) war es kein W<strong>und</strong>er, dass<br />
die Richtlinie für die Benutzung eines Dienstanschlusses<br />
die Weisung enthielt, sich bei den Gesprächen „kurz zu<br />
fassen“ <strong>und</strong> sich auf „das unbedingt Nötigste“ zu beschränken.<br />
Die Vermittlung zwischen den Dienststellen erfolgte<br />
damals natürlich nicht mit Wählanlagen, sondern per Hand<br />
durch das „fre<strong>und</strong>liche Fräulein vom Amt“.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
65
66 <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Das Kom-Netz der WSV im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> – Technischer Wandel einer notwendigen Infrastruktur<br />
In den Jahren von 1936 bis 1940 wurden diese Freileitungen<br />
durch ein erdverlegtes, 12paariges Streckenfernmeldekabel<br />
ersetzt. Auch die Stichkanäle nach Osnabrück,<br />
Hannover-Linden, Hildesheim <strong>und</strong> Salzgitter wurden mit<br />
Erdkabeln ausgestattet, die teilweise noch heute in Betrieb<br />
sind. Die Errichtung der ersten Wählanlagen (Hebdrehwähler)<br />
fiel ebenso in diese Zeit.<br />
Das Kom-Netz wurde damals hauptsächlich zum Telefonieren<br />
genutzt. So mussten zum Beispiel zur <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
des MLK die <strong>Wasser</strong>stände der Betriebspegel<br />
vor Ort abgelesen <strong>und</strong> per Telefon nach Minden zum<br />
Pumpwerk gemeldet werden. Das Streckenfernmeldekabel<br />
war für reine Sprachverbindungen ausgelegt. Dies erforderte<br />
den Einbau von Muffen mit Spulen <strong>und</strong> Kondensatoren<br />
im Kabel, um die Verluste durch die Kabeldämpfung so<br />
gering wie möglich zu halten. Im Jahre 1952 wurden aus<br />
diesem Kabel am MLK die Spulen <strong>und</strong> Kondensatoren für<br />
ein Adernpaar entfernt, um es für Trägerfrequenz-Systeme<br />
(TF-Systeme) tauglich zu machen. TF-Systeme ermöglichen<br />
es, 12 Gespräche gleichzeitig über eine Doppelader<br />
zu übertragen. Damit waren insgesamt 23 (12 + 11) Verbindungen<br />
auf dem Kabel möglich – eine Steigerung der<br />
Kapazität um 92 % war erreicht.<br />
Das 12paarige Streckenfernmeldekabel fiel ab etwa 1968<br />
dem Ausbau des MLK für das 1350 t-Schiff <strong>und</strong> der damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Verbreiterung des Kanalquerschnitts zum<br />
Opfer. Mit dem Teilentwurf Nr. 15 zur „Erneuerung des<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Fernmelde-Netzes (WF-Netz) in Zusammenhang<br />
mit dem Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals“ wurde<br />
1967 die Verlegung eines 36paarigen Kupferkabels beantragt<br />
<strong>und</strong> genehmigt. Begründung für die hohe Anzahl von<br />
Doppeladern (immerhin das Dreifache) war die Übertragung<br />
von Pegeldaten, die Fernsteuerung von Sicherheitstoren<br />
sowie der Neubau des Elbe-Seitenkanals (ESK) <strong>und</strong><br />
der damit erforderlichen zusätzlichen Kommunikationsverbindungen.<br />
Die Umsetzung dieses Teilentwurfs erfolgte in<br />
Teilabschnitten <strong>und</strong> endete mit der Fertigstellung des MLK<br />
Abb. 2 - Fernsprechwegweiser Kom-Netz der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> aus dem Jahre 1988<br />
im Stadtgebiet Hannover. Hier wurde im Jahre 2000 allerdings<br />
kein Kupferkabel mehr verlegt, sondern ein der technischen<br />
Entwicklung angepasstes Lichtwellenleiterkabel<br />
(LWL-Kabel).<br />
Das Kom-Netz im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> wurde zusätzlich<br />
um ein 42paariges Kupferkabel entlang der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
(1952 – 1960) <strong>und</strong> ein ebenfalls 36paariges Kabel am ESK<br />
(1970 – 1977) ergänzt. Auch diese sind heute noch in Betrieb.<br />
Während der Zeit des Kalten Krieges sollten die Kabelstrecken<br />
im Verteidigungsfall auch der B<strong>und</strong>eswehr zur Verfügung<br />
stehen. Die Aufführungspunkte der <strong>Mitte</strong>llandkanalkabel<br />
<strong>und</strong> des Weserkabels in Minden wurden deshalb auf<br />
dem Bauhof Minden in einem Bunker eingerichtet.<br />
Die Telefonie vollzog sich in dieser Zeit mit analoger Technik.<br />
Die Sprache wurde als proportionale Spannungswerte<br />
im Frequenzbereich 300 – 3400 Hertz übertragen. Die<br />
Anwahl eines Teilnehmers einer anderen Dienststelle gestaltete<br />
sich dabei recht aufwendig nach dem Prinzip der<br />
Staffelwahl: Um einen weit entfernten Partner zu erreichen,<br />
war es notwendig, sich von einer Vermittlungsanlage zur<br />
nächsten durchzuwählen. Bei jeder Anlage die angewählt<br />
wurde, ertönte die betreffende Ortsansage, z. B.<br />
„Nienburg“. Dann konnte die nächste auf dem Weg liegende<br />
Vermittlungsanlage angewählt werden usw., bis die<br />
Staffel den gewünschten Endpunkt erreichte. Ohne den<br />
„Fernsprechwegweiser Kom-Netz“ (Abb. 2) fand man sich<br />
nur schwer zurecht. Die zentrale Anlage zur Anwahl anderer<br />
<strong>WSD</strong>-Bereiche stand in der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>.<br />
Eine Verbindung zwischen dem Kom-Netz der WSV <strong>und</strong><br />
dem Telefonnetz der Deutschen B<strong>und</strong>espost war in der Zeit<br />
von 1992 bis 1998 (Neuregelung durch das Telekommunikationsgesetz)<br />
nicht zulässig. Für beide Netze musste<br />
jeweils eine eigene Anlage aufgebaut <strong>und</strong> ein eigenes<br />
Telefon auf jedem Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden.
Aktuelle Entwicklung der<br />
Technik<br />
Das Kom-Netz der WSV im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> – Technischer Wandel einer notwendigen Infrastruktur<br />
Mit der Inbetriebnahme der ersten längeren digitalen Übertragungsstrecken<br />
zwischen Wasbüttel am ESK <strong>und</strong><br />
Magdeburg-Rothensee im Jahre 1997 begann das „digitale<br />
Zeitalter“ im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>. In der Digitaltechnik<br />
werden die Daten von dem kontinuierlichen Spannungsbereich<br />
in diskrete Stufen transformiert <strong>und</strong> anschließend<br />
Abb. 3 - Übersichtsplan Kabelnetz der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> in <strong>2005</strong><br />
binär codiert. Die Bündelung <strong>und</strong> Übertragung der Daten ist<br />
nun nahezu ohne Verluste über weite Entfernungen möglich.<br />
Die Speicherung <strong>und</strong> Verarbeitung ist nicht nur für<br />
Sprache, sondern auch für alle anderen Anwendungen<br />
(Steuerdaten von Fernwirkanwendungen, Videobilddaten,<br />
etc.) technisch einfacher zu realisieren. Zwischen<br />
Wasbüttel <strong>und</strong> Rothensee wurde dazu eine Richtfunkstrecke<br />
errichtet, da auch hier das im Betriebsweg liegende<br />
Fernmeldekabel dem Ausbau des MLK zum Opfer fiel. Im<br />
Rahmen des Kanalausbaus wurde in der Trasse des neuen<br />
Betriebswegs ein Kabelrohr verlegt, um nach Abschluss der<br />
Ausbaumaßnahmen eine LWL-Kabeltrasse aufzubauen.<br />
Die Richtfunkstrecke wird dann am Ende ihrer Nutzungsdauer<br />
durch eine wartungsarme <strong>und</strong> leistungsfähigere<br />
Infrastruktur abgelöst.<br />
Mit der Genehmigung des Entwurfs zur Digitalisierung der<br />
Übertragungswege am MLK im Jahre 1998 wurde ein weiterer<br />
Meilenstein zur Umrüstung des Kom-Netzes in der<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> erreicht. Dieser Entwurf beinhaltet die Umrüstung<br />
des 36paarigen Kupferkabels auf digitale Übertragungstechnik.<br />
Die Maßnahme umfasste den Aufbau von 2 x<br />
2MBit/s Übertragungsstrecken (entspricht ca. 60 Telefon-<br />
oder Datenkanälen) durch Entspulung der Kupferkabel <strong>und</strong><br />
Nutzung des pulscodemodulierten Multiplexverfahrens<br />
entlang des MLK sowie die Ersatzbeschaffung verschiedener<br />
Kom-/TK-Anlagen. Günstig für die Umsetzung des<br />
Entwurfs erwies sich, dass diese gerade in die Boomzeit<br />
der Entstehung von privaten Carriern <strong>und</strong> Telefonnetzbetreibern<br />
fiel, die ein großes Interesse zeigten, am MLK<br />
LWL-Kabel zu verlegen. In Teilbereichen ergab sich dadurch<br />
die Möglichkeit für die WSV, ein LWL-Kabel kostengünstig<br />
mit zu verlegen <strong>und</strong> auf die Entspulung des Kupferkabels<br />
zu verzichten. Das LWL-Kabel hat gegenüber Kupfer<br />
den Vorteil, dass die auf ihm maximal übertragbare<br />
Bandbreite um ein vielfaches höher ist als bei Kupferkabeln<br />
(Faktor 100.000).<br />
Bei der Inbetriebnahme der ersten digitalen Übertragungsstrecken<br />
zeigte sich sehr schnell, dass der 1998 angedachte<br />
Bedarf an 60 Telefon- <strong>und</strong> Datenkanälen bei weitem<br />
nicht ausreichend ist. Durch IT-Anwendungen, Schleusenfernbedienung<br />
<strong>und</strong> Telematikdienste stieg der Bedarf an<br />
Bandbreite erheblich an. Abbildung 3 zeigt einen Übersichtsplan<br />
über den jetzigen Ausbau des Kom-Kabelnetzes.<br />
Am MLK sind große Abschnitte mit LWL-Kabeln versehen.<br />
Die Verlegung eines LWL-Kabels im Streckenabschnitt<br />
Bramsche – Minden ist genehmigt <strong>und</strong> zur Zeit in der Planung.<br />
Mit Ausnahme des Bereichs Minden – Lohnde steht<br />
dann am MLK von Bevergern bis Wasbüttel ein LWL-Kabel<br />
zur Verfügung. Da sich zwischen Minden <strong>und</strong> Lohnde kein<br />
privater Telefonanbieter fand, der hier ein LWL-Kabel verlegen<br />
wollte, wurde in diesem Bereich das 36paarige Kupferkabel<br />
entspult <strong>und</strong> für den Betrieb von 8 Übertragungssystemen<br />
mit je 2MBit/s (30 Telefon- oder Datenkanäle)<br />
ausgestattet.<br />
Neben der Umsetzung des Entwurfs zur Digitalisierung der<br />
Übertragungswege am MLK erfolgte auch für die Fernbedienung<br />
von Schleusen die Verlegung von Lichtwellenleiterkabeln.<br />
So wurde 2003 vom <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
(WSA) Braunschweig entlang des Stichkanals Salzgitter ein<br />
LWL-Kabel verlegt, um die Kamerabilder zur Fernbedienung<br />
der Schleuse Üfingen an die Schleuse Wedtlenstedt<br />
in einer ausreichenden Qualität übertragen zu können.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
67
68 <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Das Kom-Netz der WSV im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> – Technischer Wandel einer notwendigen Infrastruktur<br />
Die Fernbedienung von Schleusen an der <strong>Mitte</strong>lweser von<br />
einer Zentrale in Minden war der Anstoß zur Verlegung<br />
eines LWL-Kabels von Minden bis Langwedel. Dieses Projekt<br />
wurde bis zur Schleuse Drakenburg bereits realisiert.<br />
Damit steht dann auch im Bereich des WSA Verden ein<br />
leistungsfähiges <strong>und</strong> zukunftsorientiertes Kabelnetz zur<br />
Verfügung.<br />
Für die Fernebene wurde durch die Fachstelle für Verkehrstechniken<br />
(FVT) in Koblenz bei der ARCOR der sog. „AR-<br />
COR-Ring“ angemietet. Dieser besteht aus acht 2MBit-<br />
Verbindungen <strong>und</strong> führt durch ganz Deutschland. Der Zugang<br />
auf diesen Ring für<br />
die <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> ist Hannover.<br />
Neben Telefonie<br />
werden hierauf hauptsächlichDatenanbindungen<br />
für Intranet / Internet<br />
zwischen den <strong>WSD</strong>-<br />
Bereichen, aber auch<br />
innerhalb der Bezirksnetzebene<br />
betrieben.<br />
Der Ausbau des Kom-<br />
Netzes auf digitale Übertragung<br />
ist für den Anwender<br />
nicht unbedingt<br />
spürbar vonstatten gegangen.<br />
Erst wenn durch<br />
zusätzliche Leistungsmerkmale(Wahlwiederholung,<br />
Anrufumleitung,<br />
Rufnummernübermittlung)<br />
oder einem vereinfachten<br />
Wahlverfahren<br />
das Telefonieren im<br />
Kom-Netz effizienter<br />
wird, bemerkt er die<br />
Änderungen. Durch den<br />
Einsatz von digitalen<br />
Vermittlungsanlagen<br />
(Kom/TK-Anlagen) in<br />
den Dienststellen wurde<br />
2001 die sog. Staffelwahl<br />
abgeschafft <strong>und</strong> im Bereich<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> ein<br />
Wahlsystem ähnlich dem<br />
im öffentlichen Fernsprechnetz<br />
eingeführt.<br />
Abbildung 4 zeigt den aktuellen Fernsprechwegweiser für<br />
die <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>. Jedes WSA hat dabei seine eigene Vorwahl<br />
(z.B. WSA Uelzen einschließlich Außenstellen: 9350).<br />
Abb. 4 - Kom-Netz Wegweiser <strong>2005</strong><br />
Die Umstellung des Kom-Netzes auf digitale Übertragungsstrecken<br />
<strong>und</strong> die Nutzung von LWL-Kabeln forderte vom<br />
zuständigen Unterhaltungspersonal des Bauhofs Minden<br />
eine Anpassung des Qualifikationsprofils. Der Schaden an<br />
einem LWL-Kabel ist mit anderen Techniken (optische<br />
Reflexmessung, Fertigung von Spleißverbindungen) zu<br />
beheben als bei einem Kupferkabel (Herstellung klassischer<br />
Muffenverbindungen). Durch die Überwachung der<br />
digitalen Übertragungsstrecken von einem zentralen Steuerrechner<br />
beim Bauhof Minden können Störungen frühzeitig<br />
erkannt <strong>und</strong> dadurch schneller behoben werden. Auch eine<br />
erste Fehleranalyse ist mit diesem System aus der Ferne<br />
möglich.<br />
Ausblick<br />
Ob für Fernsteuerung von Schleusen, IT-Anwendungen<br />
oder zur Fernüberwachung von Anlagen, der Bedarf an<br />
Übertragungsbandbreiten wird auch in den nächsten Jahren<br />
noch steigen. Wenn man von dem geplanten Ausbau<br />
im Bereich des MLK von 1998 ausgeht (2 x 2MBit/s) <strong>und</strong><br />
diesen mit der jetzt durchschnittlich genutzten Bandbreite<br />
von ca. 4 x 2Mbit vergleicht, so kann man von einer prozentualen<br />
Steigerung von rd. 10 % pro Jahr ausgehen. Hierin<br />
ist nicht der Bandbreitenbedarf für die Schleusenfernbedienung<br />
eingerechnet. Unter Berücksichtigung dieser Zu-<br />
kunftsprognose wurde von der Fachstelle Maschinenwesen<br />
<strong>Mitte</strong> die Realisierung von digitalen Übertragungsstrecken<br />
am ESK im Rahmen eines technischen Berichtes untersucht.<br />
Hierin wurden die Varianten Verlegung eines LWL-<br />
Kabels, Anmietung von Übertragungsstrecken <strong>und</strong> Aufbau<br />
von Richtfunkverbindungen technisch <strong>und</strong> wirtschaftlich<br />
einander gegenübergestellt. Die Untersuchung zu den<br />
Richtfunkstrecken war dabei am aufwendigsten. Nach Festlegung<br />
der Standorte für die Funkmasten wurde anhand<br />
von Kartenmaterial geprüft, ob eine Sichtverbindung besteht<br />
<strong>und</strong> wie hoch die Masten sein müssen. Dafür wurden<br />
Geländequerschnitte (Abb. 5) zwischen den Standorten<br />
erstellt, in denen die Geländehöhen aber auch Geländenutzungen<br />
(Wald- <strong>und</strong> Forstwirtschaft, bebaute Flächen oder<br />
Industrieanlagen) eingetragen wurden.
Das Kom-Netz der WSV im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> – Technischer Wandel einer notwendigen Infrastruktur<br />
Abb. 5 - Geländequerschnitt zwischen der Schleuse Uelzen <strong>und</strong> dem Liegehafen Bevensen<br />
Ist der Aufbau einer Richtfunkverbindung von den örtlichen<br />
Gegebenheiten her möglich, wird ein Dämpfungsplan erstellt,<br />
der Auswirkungen auf die Wahl der technischen<br />
Komponenten (z.B. Größe <strong>und</strong> Art der Antenne) hat. Die<br />
Planung der LWL-Trasse gestaltete sich dagegen recht<br />
einfach, weil beidseitig des ESK ein Betriebsweg vorhanden<br />
ist, in dem das Kabel verlegt werden kann. Die Kosten<br />
für die Anmietung der erforderlichen Übertragungskapazitäten<br />
bei privaten Anbietern war die unwirtschaftlichste Variante,<br />
gefolgt von der Richtfunkvariante. Die Netzerweiterung<br />
wird deshalb auch am ESK mit LWL-Kabeln realisiert.<br />
Die Verlegung eines LWL-Kabels ist eine Investition in die<br />
Zukunft. Durch den Einsatz entsprechender Übertragungstechniken<br />
(z. B. dichtem Wellenlängenmultiplex – dense<br />
wavelength division multiplex [DWDM]) lassen sich die<br />
Übertragungsbandbreiten bei Bedarf steigern. Möglich sind<br />
heute schon Übertragungsraten von 3 TeraBit/s (3 x 10 9<br />
Bit/s) pro LWL-Faser. Von diesem Bandbreitenbedarf sind<br />
wir in der WSV aber noch weit entfernt. Mit der aktuellen<br />
Entwicklung Photonischer Fasern, die auch als mikrostrukturierte<br />
Fasern oder Hohlfasern bezeichnet werden, wird<br />
eine weitere Bandbreitenerweiterung durch die Veränderung<br />
des Werkstoffs in Zukunft erreicht werden.<br />
Im Bereich der Vermittlungsanlagen ist anzunehmen, dass<br />
sich die Sprachübertragung über das Intranet (Voice over<br />
IP) auch in der WSV langfristig durchsetzen wird. Einzelne<br />
Versuchsobjekte außerhalb der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> haben schon<br />
zufriedenstellende Ergebnisse gebracht – eine Arbeitsgruppe<br />
des B<strong>und</strong>esministeriums für Verkehr-, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung<br />
erarbeitet zur Zeit eine Machbarkeitsstudie.<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem Ende<br />
des Monopols der Deutschen Telekom <strong>und</strong> der Entwicklung<br />
eines freien Telefonmarkts in Deutschland, das Telefonieren<br />
in den vergangenen Jahren immer günstiger geworden<br />
ist. Das Kom-Netz der WSV wäre ohne die neuen Dienste<br />
(Intranet / Internet, WaGIS, SAP, MIB, NIF, Steuerung,<br />
Überwachung <strong>und</strong> Fernwartung von Anlagen) <strong>und</strong> die Anforderungen<br />
an die Verfügbarkeit <strong>und</strong> Sicherheit (z.B. Verhinderung<br />
von Zugriffen Unbefugter, Virenangriffe, etc.) nur<br />
allein für das Telefonieren <strong>und</strong> die Übertragung einiger<br />
Pegeldaten nicht wirtschaftlich vertretbar. Die neuen Dienste<br />
machen jedoch ein leistungsfähiges Kommunikationsnetz<br />
erforderlich, um auch weiterhin der Binnenschifffahrt einen<br />
sicheren Schiffsverkehr zu ermöglichen.<br />
Der Kom-Netz-Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> ist mit dem hohen<br />
Anteil LWL-Kabelstrecken gut gerüstet für die zukünftigen<br />
Anforderungen. Die flächendeckende Vernetzung der LWL-<br />
Strecken der WSV ist mittelfristig das Ziel für den red<strong>und</strong>anten<br />
Betrieb des Kom-Netzes in der gesamten B<strong>und</strong>esverkehrsverwaltung.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
69
70<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Informationszentren<br />
Die Informationszentren informieren durch Modelle, Schautafeln <strong>und</strong> Filme über die umweltfre<strong>und</strong>liche Binnenschifffahrt,<br />
den Ausbau <strong>und</strong> die Bedeutung der <strong>Wasser</strong>straßen, die Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung <strong>und</strong> vieles<br />
andere mehr.<br />
Ein Besuch ist für Ausflügler, Schulklassen <strong>und</strong> allgemein Interessierte ebenso geeignet wie für Fachgruppen <strong>und</strong> kann mit<br />
einer Besichtigung der Schachtschleuse <strong>und</strong> des <strong>Wasser</strong>straßenkreuzes in Minden bzw. des Schiffshebewerkes in Scharnebeck<br />
in unmittelbarer Nähe der Informationszentren verb<strong>und</strong>en werden.<br />
Für Fragen stehen vor Ort Ansprechpartner zur Verfügung. Für spezielle Führungen ist eine Terminabsprache sinnvoll.<br />
Minden<br />
Öffnungszeiten: Saison 01.04. – 31.10.<br />
Montag – Samstag 9:00 – 17:00 Uhr<br />
Sonn- <strong>und</strong> Feiertag 9:00 – 18:00 Uhr<br />
Lüneburg-Scharnebeck<br />
Öffnungszeiten: Saison 15.03. – 31.10.<br />
Montag – Freitag 10:00 – 12:00 Uhr <strong>und</strong> 14:00 – 17:30 Uhr<br />
Samstag, Sonn- <strong>und</strong> Feiertag 10:00 – 17:30 Uhr<br />
Informationszentrum<br />
an der Schachtschleuse in Minden<br />
Auskünfte<br />
durch das<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Minden<br />
Telefon: 05 71 / 64 58 - 0<br />
Informationszentrum<br />
Am Schiffshebewerk Scharnebeck<br />
Auskünfte:<br />
Telefon: 0 41 36 / 4 73 (Saison)<br />
oder durch das<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Uelzen<br />
Telefon: 05 81 / 90 79 - 0
Veröffentlichungen<br />
Prof. Dierk Schröder<br />
Interview Chefredakteur<br />
Friedbert Barg<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> Der Rückhalt im VBW war eine w<strong>und</strong>erbare<br />
Erfahrung,<br />
Binnenschifffahrt, Nr. 9, Seite 6 - 10,<br />
September <strong>2005</strong><br />
Matthias Küßner WSA Uelzen Schiffe im Fahrstuhl,<br />
Gütertransport auf <strong>Wasser</strong>straßen hat Potenzial,<br />
ContiTech Initiativ, Magazin der<br />
Unternehmensgruppe<br />
ConiTech, Nr. 3/<strong>2005</strong>, 17. Jahrgang,<br />
Deutsche Ausgabe<br />
Matthias Küßner WSA Uelzen Poteniale der Containerschifffahrt auf den<br />
Kanälen,<br />
VBW Beitrag, Binnenschifffahrt kann mehr<br />
"Tag der europäischen Binnenschifffahrt <strong>2005</strong>"<br />
Mannheim, Sept. <strong>2005</strong><br />
Christoph Weinhold <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> 100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
- Tradition <strong>und</strong> Innovation<br />
"Verkehrsentwicklung auf dem MLK"<br />
Binnenschifffahrt, Nr. 4 - April <strong>2005</strong> - Supplement,<br />
60. Jahrgang, ISSN 0939-1916<br />
Helmut Trapp WSA Uelzen 100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
- Tradition <strong>und</strong> Innovation<br />
"Schifffahrt zwischen Wolfsburg <strong>und</strong> Magdeburg<br />
von 1945 - 1990",<br />
Binnenschifffahrt, Nr. 4 - April <strong>2005</strong> - Supplement,<br />
60. Jahrgang, ISSN 0939-1916<br />
Winfried Reiner <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> 100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
- Tradition <strong>und</strong> Innovation<br />
"Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals zwischen<br />
Bergeshövede <strong>und</strong> Rühen",<br />
Binnenschifffahrt, Nr. 4 - April <strong>2005</strong> - Supplement,<br />
60. Jahrgang, ISSN 0939-1916<br />
Dr. Manuela Osterthun <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> 100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
- Tradition <strong>und</strong> Innovation<br />
"Osthaltung des <strong>Mitte</strong>llandkanals -<br />
Verkehrsweg im vereinten Deutschland",<br />
Binnenschifffahrt, Nr. 4 - April <strong>2005</strong> - Supplement,<br />
60. Jahrgang, ISSN 0939-1916<br />
Reinhard Henke <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> 100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
- Tradition <strong>und</strong> Innovation<br />
"Bedeutende Bauwerke des <strong>Mitte</strong>llandkanals",<br />
Binnenschifffahrt, Nr. 4 - April <strong>2005</strong> - Supplement,<br />
60. Jahrgang, ISSN 0939-1916<br />
Siegfried Patzer<br />
Dietmar Abel<br />
NBA Hannover<br />
WNA Helmstedt<br />
100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
- Tradition <strong>und</strong> Innovation<br />
"Naturnaher Ausbau des MLK in ökologisch<br />
sensiblen Bereichen am Beispiel des<br />
Naturparks Drömling",<br />
Binnenschifffahrt, Nr. 4 - April <strong>2005</strong> - Supplement,<br />
60. Jahrgang, ISSN 0939-1916<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
71
72<br />
Dipl.-Ing. Hubert Kindt<br />
Dipl.-Ing. Tilman Treber<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> 100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
- Tradition <strong>und</strong> Innovation<br />
"<strong>Wasser</strong>bewirtschaftung des MLK"<br />
Zeitschrift für Binnenschifffahrt<br />
Nr. 4 - April <strong>2005</strong> - Supplement,<br />
60. Jahrgang, ISSN 0939-1916<br />
Andreas Hüsig WSA Uelzen 100 Jahre <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
- Tradition <strong>und</strong> Innovation<br />
"<strong>Wasser</strong> nicht nur für Schiffe: Tourismus,<br />
Landwirtschaft, Industrie <strong>und</strong> Hochwasserschutz"<br />
Binnenschifffahrt, Nr. 4 - April <strong>2005</strong> - Supplement,<br />
60. Jahrgang, ISSN 0939-1916<br />
Dr. Manuela Osterthun<br />
Michael Seifert<br />
Dr. Manuela Osterthun<br />
Michael Seifert<br />
Thomas Brase<br />
Dr. Manuela Osterthun<br />
Michael Seifert<br />
Arno Liebrecht<br />
Thomas Brase<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
WSA Minden<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
WSA Minden<br />
WaGIS<br />
- das <strong>Wasser</strong>straßenGeoInformationsSystem -<br />
Ein digitales Warenhaus für Geodaten.<br />
eGovernment Computing,<br />
Ausgabe 03/<strong>2005</strong>, Seite 24,<br />
"Damm-Gis"<br />
für Nachsorgemaßnahmen an Dämmen an<br />
B<strong>und</strong>eswasserstraßen,<br />
HTG-Kongress <strong>2005</strong> in Bremen, 14. - 17.09.<strong>2005</strong>,<br />
Tagungsband, Seite 63 - 72, Hamburg <strong>2005</strong><br />
"Damm-Gis"<br />
für Nachsorgemaßnahmen an Dämmen an<br />
B<strong>und</strong>eswasserstraßen,<br />
Binnenschifffahrt, 60. Jahrgang, Nr. 10, <strong>2005</strong><br />
Seite 59 - 63<br />
Andreas Hüsig WSA Uelzen Rekordverkehre auf Elbe-Seitenkanal<br />
<strong>und</strong> <strong>Mitte</strong>llandkanal,<br />
Binnenschifffahrt, 60. Jahrgang, Nr. 12, <strong>2005</strong><br />
Seite 42 - 44<br />
Eckard Dietel<br />
Hermann Lübbers<br />
Matthias Küßner<br />
Gerd Kaschell<br />
WSA Uelzen<br />
Nacap<br />
Nederland B.V<br />
WSA Uelzen<br />
<strong>WSD</strong> Ost<br />
Querung des Elbe-Seitenkanals <strong>und</strong> des<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanals mittels<br />
Horizontal-Directional-Drilling für eine<br />
380-km Pipeline<br />
Zeitschrift "Der Ingenieur"<br />
IWSV Nr. 3/05, Seite 18 - 22<br />
"Der Schwarzmeerkanal"<br />
Zeitschrift "Der Ingenieur"<br />
IWSV Nr. 4/05, Seite 5 - 7<br />
Sönke Meesenburg <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> Konzeptionelle Gedanken zur<br />
Arbeitsplanung im Regiebetrieb<br />
Zeitschrift "Der Ingenieur"<br />
IWSV Nr. 4/05, Seite 8 - 10
Vorträge<br />
Michael Seifert <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> „Damm-Gis"<br />
für Nachsorgemaßnahmen an Dämmen an<br />
B<strong>und</strong>eswasserstraßen.<br />
HTG-Kongress <strong>2005</strong> in Bremen, 15.09.<strong>2005</strong>,<br />
Vortragsblock 1A<br />
"Projekte Verkehrswasserbau"<br />
Michael Seifert <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> Fachapplikationen für WaGIS, das b<strong>und</strong>esweite<br />
GIS der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung.<br />
Vortragsveranstaltung der Deutschen<br />
Gesellschaft für Kartographie e.V.,<br />
Hannover, 08.12.<strong>2005</strong><br />
Dirk Iwasinski <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> "Pilotierung Julia MailOffice in der WSV"<br />
Eine Bilanz der Initiative B<strong>und</strong> Online <strong>2005</strong><br />
für die BVBW<br />
BAW-Kolloquium - 11. Oktober <strong>2005</strong>,<br />
Fachstelle für Informationstechnik (FIT),<br />
Ilmenau<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
73
74<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
Adressen<br />
der Dienststellen im Bereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Hann.Münden<br />
Kasseler Straße 5<br />
34346 Hann.Münden<br />
Tel.: (05541) 952-0, Telefax: (05541) 952-14 00<br />
E-Mail: postfach@wsa-hmue.wsv.de<br />
Internet: www.wsa-hmue.wsv.de<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Verden<br />
Hohe Leuchte 30<br />
27283 Verden<br />
Tel.: (04231) 898-0, Telefax: (04231) 898-13 33<br />
E-Mail: postfach@wsa-ver.wsv.de<br />
Internet: www.wsa-verden.wsv.de<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Minden<br />
Am Hohen Ufer 1 - 3<br />
32425 Minden<br />
Tel.: (0571) 64 58-0, Telefax: (0571) 64 58-12 00<br />
E-Mail: postfach@wsa-mi.wsv.de<br />
Internet: www.wsa-minden.de<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Braunschweig<br />
Ludwig-Winter-Straße 5<br />
38120 Braunschweig<br />
Tel.: (0531) 8 66 03-0, Telefax: (0531) 8 66 03-14 00<br />
E-Mail: postfach@wsa-bs.wsv.de<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Uelzen<br />
Greyerstraße 12<br />
29525 Uelzen<br />
Tel.: (0581) 90 79-0, Telefax: (0581) 90 79-11 77<br />
E-Mail: postfach@wsa-ue.wsv.de<br />
Internet: www.wsa-uelzen.wsv.de<br />
Fachstelle Vermessungs- <strong>und</strong> Kartenwesen <strong>Mitte</strong><br />
bei der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> ( s.o.)<br />
Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong><br />
beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Minden (s.o.)<br />
Drucksachenstelle der WSV<br />
bei der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> (s. o.)<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
Am Waterlooplatz 5<br />
30169 Hannover<br />
Tel. (05 11) 91 15 - 0<br />
Fax (05 11) 91 15 - 34 00<br />
E-Mail: postfach@wsd-m.wsv.de<br />
Internet: www.wsd-mitte.wsv.de<br />
Neubauamt für den Ausbau<br />
des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover<br />
Nikolaistraße 14/16<br />
30159 Hannover<br />
Tel.: (0511) 91 15-51 11, Telefax: (0511) 91 15-51 40<br />
E-Mail: postfach@nba-h.wsv.de<br />
Internet: www.nba-hannover.wsv.de<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
Walbecker Straße 23 b<br />
38350 Helmstedt<br />
Tel.: (05351) 394-0, Telefax: (05351) 394-52 40<br />
E-Mail: postfach@wna-he.wsv.de<br />
Internet: www.wna-helmstedt.de<br />
Sonderstelle für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung (SAF)<br />
in der WSV<br />
Möckernstraße 30<br />
30163 Hannover<br />
Tel. (05 11) 91 15-0, Fax (05 11) 91 15-24 00<br />
Außenstelle Schiffssicherung<br />
Achterwiek 2<br />
23730 Neustadt<br />
Tel: (04561) 81 91, Telefax: (04561) 17 46 0
Franz von Dingelstedt, * 30.4.1814, Halsdorf bei<br />
Kirchhain/Hessen-Kassel, † 15. Mai 1881, Wien.<br />
Dingelstedt war Dichter, Autor, ab 1867 Direktor des<br />
Hofoperntheaters, ab 1872 Direktor des Hofburgtheaters.<br />
Das Weserlied schrieb er in mehreren<br />
Fassungen. Die Fassung von 1835 erschien 1836 im<br />
"Deutschen Musenalmanch". Vertont wurde die dritte<br />
Fassung von 1845.<br />
"An der Weser"<br />
Text: Franz von Dingelstedt<br />
Komponist: Gustav Pressel<br />
Hier hab' ich so manches liebe Mal<br />
Mit meiner Laute gesessen,<br />
Hinunterblickend ins weite Tal,<br />
Mein selbst <strong>und</strong> der Welt vergessen.<br />
Und um mich klang es so froh <strong>und</strong> so hehr,<br />
Und über mir tagt es so helle<br />
Und unten brauste das ferne Wehr<br />
Und der Weser blitzende Welle.<br />
Wie liebender Sang aus geliebtem M<strong>und</strong>,<br />
So flüstert es rings durch die Bäume,<br />
Und aus des Tales offenem Gr<strong>und</strong><br />
Begrüßten mich nickende Träume.<br />
Und um mich klang es so froh <strong>und</strong> so hehr,<br />
Und über mir tagt es so helle<br />
Und unten brauste das ferne Wehr<br />
Und der Weser blitzende Welle.<br />
Da sitz' ich aufs Neue <strong>und</strong> spähe umher<br />
Und lausche hinauf <strong>und</strong> hernieder.<br />
Die holden Weisen rauschen nicht mehr,<br />
Die Träume kehren nicht wieder.<br />
Die süßen Bilder wie weit, wie weit!<br />
Wie schwer der Himmel, wie trübe!<br />
Fahr wohl, fahr wohl du selige Zeit!<br />
Fahrt wohl, ihr Träume der Liebe!<br />
Gustav Pressel, * 11.6.1827, Tübingen, † 30.6.1890,<br />
Berlin. Pressel studierte in Berlin <strong>und</strong> Wien Theologie<br />
<strong>und</strong> Musik. 1845 folgte er einer Einladung von<br />
Franz Liszt nach Weimar. Dort sah er den Text des<br />
Weserliedes von Dingelstedt in seiner dritten Fassung<br />
von 1845 <strong>und</strong> vertonte es.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2005</strong><br />
75
Impressum<br />
<strong>Informationen</strong> der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Herausgeber:<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
Am Waterlooplatz 5<br />
30169 Hannover<br />
Telefon (05 11) 91 15 – 0<br />
Telefax (05 11) 91 15 – 34 00<br />
E-Mail postfach@wsd-m.wsv.de<br />
Internet www.wsd-m.wsv.de<br />
Chefredaktion: Reinhard Henke <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Assistentin der Chefredaktion: Heike Erlinghäuser <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Redaktion: Dietmar Abel WNA Helmstedt<br />
Uwe Borges WSA Hann.Münden<br />
Iris Grasso <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Andreas Hüsig WSA Uelzen<br />
Arno Liebrecht <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Layout: Sabine Glaeser <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Regina Manke <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Druck: Benatzky, Druck & Medien, Hannover<br />
Ausgabe: <strong>2005</strong><br />
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> herausgegeben. Sie darf weder<br />
von Parteien noch von Wahlhelfern während des Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Europa-,<br />
B<strong>und</strong>estags-, Landtags- <strong>und</strong> Kommunalwahlen. Missbräuchlich sind besonders die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen<br />
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer <strong>Informationen</strong> oder Werbemittel. Untersagt ist<br />
gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg <strong>und</strong> in welcher Anzahl<br />
diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise<br />
verwendet werden, die als Parteinahme der B<strong>und</strong>esregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen im Bereich der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>