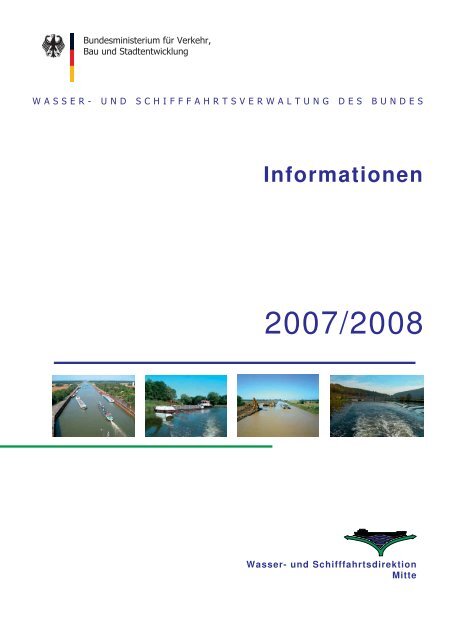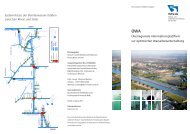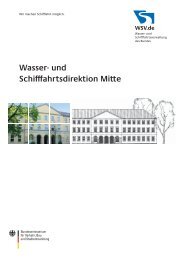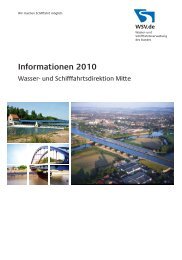Informationen 2007/2008 - WSD Mitte - Wasser- und ...
Informationen 2007/2008 - WSD Mitte - Wasser- und ...
Informationen 2007/2008 - WSD Mitte - Wasser- und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
��������������������������������<br />
������������������������<br />
����������������������������������������������<br />
<strong>Informationen</strong><br />
<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong><br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong>
<strong>Informationen</strong><br />
<strong>2007</strong>/<strong>2008</strong><br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Vorwort des Präsidenten der<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Interview mit dem<br />
Bezirkspersonalratsvorsitzenden<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
des B<strong>und</strong>es (WSV)<br />
1<br />
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
2 Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung des<br />
B<strong>und</strong>es<br />
3 Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> in<br />
Hannover<br />
4 Die Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Aktuelles <strong>und</strong> Informatives<br />
8<br />
Nachrichten<br />
� Ernennung des Dipl.-Ing. Hubert Kindt zum<br />
Vizepräsidenten<br />
� 160 Jahre öffentlicher Dienst – vierfaches<br />
Dienstjubiläum beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsamt Hann.Münden<br />
� Gr<strong>und</strong>steinlegung für den Neubau des Wehres<br />
in Bannetze<br />
� Zukunftstag <strong>2007</strong> (ehemals Girlsday) im WSA<br />
Uelzen<br />
� Entlastung der Straße<br />
Große Schiffe fahren vom Rhein <strong>und</strong> von<br />
Hamburg bis zur Elbe<br />
� Planungen zum Ausbau des Stichkanals nach<br />
Hildesheim haben begonnen<br />
� Fertigstellung des <strong>Mitte</strong>llandkanal-Bauloses<br />
Niedersachsen IIa (Wendschott)<br />
� Neubau der Unterführung U 164alt (Werftstraße)<br />
in Minden<br />
� Schwertransport auf der Oberweser<br />
� Ausbau des Stichkanals nach Salzgitter<br />
� Die Bifurkation der Hase <strong>und</strong> der Else in Melle-<br />
Gesmold<br />
20<br />
22<br />
25<br />
30<br />
33<br />
37<br />
39<br />
42<br />
46<br />
50<br />
53<br />
57<br />
Aufsatzbeiträge<br />
Neue Software für die Bauwerksinspektion<br />
- WSVPruf<br />
Änderung von Brücken am Stichkanal nach<br />
Osnabrück<br />
Realisierung der <strong>Mitte</strong>lweseranpassung mit<br />
Unterstützung der Freien Hansestadt Bremen<br />
Nachtragsbearbeitung bei Bauverträgen nach<br />
VOB/B im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Korruptionsprävention im Geschäftsbereich der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
Einführung einer Verkehrsregelung auf der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser unter Nutzung von AIS (Automatic<br />
Identification System) als Pilotprojekt auf<br />
deutschen Binnenschifffahrtsstraßen<br />
Arbeitsschutzmanagementsystem<br />
Die systematische Integration des Arbeitsschutzes<br />
in die Dienststellen der WSV<br />
Freizeitnutzung der B<strong>und</strong>eswasserstraßen des<br />
WSA Hann.Münden<br />
Gefährdung durch Spannungsrisskorrosion an<br />
älteren Spannbetonbrücken<br />
Einrichtung von Sicherheitsfunknetzen für<br />
<strong>Wasser</strong>bauwerke der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Gr<strong>und</strong>instandsetzung der Leineabstiegsschleuse<br />
Instandsetzungsarbeiten am Schiffshebewerk<br />
(SHW) Lüneburg<br />
61 Überraschung in der Tiefe – eine „fehlgeschlagene“<br />
Trockenlegung der Schleuse Uelzen I vom<br />
25.06. – 10.08.<strong>2007</strong> -<br />
65<br />
70<br />
73<br />
75<br />
Abwicklung von Schiffsunfällen – Strom– <strong>und</strong><br />
Schifffahrtspolizeiliche Aufgaben der <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
Optimierung von Anker-Pfahllängen mit Hilfe von<br />
Probebelastungen<br />
Abbruch <strong>und</strong> Entsorgung des PAK-belasteten<br />
Brechtdorfer Dükers Nr. 421 am <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser an das Großmotorgüterschiff<br />
80 Informationszentren<br />
81 Veröffentlichungen<br />
82 Adressen der Dienststellen im<br />
Bereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen sind neben<br />
den Straßen <strong>und</strong> Schienenwegen ein<br />
unverzichtbarer Teil des Verkehrswegenetzes<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland.<br />
Sie verbinden die großen Seehäfen<br />
einerseits mit der Hohen See, andererseits<br />
mit ihrem jeweiligen Hinterland<br />
sowie die bedeutendsten Industrie- <strong>und</strong><br />
Handelszentren untereinander. So stehen<br />
den deutschen Seehäfen leistungsfähige,<br />
sichere <strong>und</strong> wirtschaftliche Zufahrtswege<br />
an Nord- <strong>und</strong> Ostsee zur<br />
Verfügung. Im Binnenland besitzt die<br />
überwiegende Zahl der deutschen<br />
Großstädte einen <strong>Wasser</strong>straßenanschluss<br />
mit eigenem Binnenhafen. Hinzu<br />
kommt eine Vielzahl von regionalen<br />
kleineren <strong>und</strong> größeren Umschlagstellen<br />
entlang der <strong>Wasser</strong>straßen.<br />
Die deutschen Seewasserstraßen<br />
(23.000 km²) in der deutschen Bucht<br />
<strong>und</strong> in der Ostsee gehören zu den am<br />
dichtesten befahrenen Revieren der<br />
Welt. Sie nehmen die Verkehre zu den<br />
deutschen Seehäfen auf, wo jährlich<br />
etwa 315 Mio. Tonnen Güter umgeschlagen<br />
werden. Auf den Binnenwasserstraßen<br />
(7.300 km) wird jährlich eine<br />
Verkehrsleistung von rd. 65 Mrd. tkm<br />
erbracht, was etwa 90% der Güterverkehrsleistung<br />
der Bahn entspricht. Die<br />
Binnenschifffahrt befördert pro Jahr rd.<br />
249 Mio. Tonnen, insbesondere Massengüter<br />
wie Baustoffe, Erze, Kohle,<br />
Mineralöle <strong>und</strong> landwirtschaftliche Produkte.<br />
Hinzu kommt der Transport von<br />
schweren <strong>und</strong> sperrigen Gütern, die auf<br />
dem Landwege nicht transportiert werden<br />
können <strong>und</strong> zunehmend der Containertransport.<br />
Das Binnenschiff zeichnet<br />
sich dabei als umweltfre<strong>und</strong>liches,<br />
kostengünstiges <strong>und</strong> sicheres Verkehrsmittel<br />
mit geringem Energieverbrauch<br />
aus.<br />
Neben der Nutzung als Verkehrsweg<br />
dienen die <strong>Wasser</strong>straßen auch der<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung, der Energiegewinnung,<br />
dem Hochwasserschutz sowie<br />
der Freizeitgestaltung <strong>und</strong> der Erholung<br />
der Bevölkerung. Die <strong>Wasser</strong>wege mit<br />
ihren Ufern erfüllen darüber hinaus eine<br />
wichtige Biotopfunktion <strong>und</strong> sind Lebensraum<br />
für eine Vielzahl von Pflanzen<br />
<strong>und</strong> Tieren.<br />
In der deutschen Küstenregion <strong>und</strong> im<br />
Binnenbereich sind r<strong>und</strong> 1.000.000 Arbeitsplätze<br />
direkt oder indirekt von den<br />
<strong>Wasser</strong>straßen <strong>und</strong> den See- <strong>und</strong> Binnenhäfen<br />
abhängig.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
����
����<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
des B<strong>und</strong>es<br />
Nach dem Gr<strong>und</strong>gesetz ist der B<strong>und</strong> Eigentümer der B<strong>und</strong>eswasserstraßen.<br />
Er verwaltet sie durch eigene Behörden<br />
– die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung – <strong>und</strong> nimmt<br />
die staatlichen Aufgaben im Bereich der Binnen- <strong>und</strong> Seeschifffahrt<br />
wahr (Art. 87 <strong>und</strong> 89 GG).<br />
Wesentliche Gr<strong>und</strong>lage für die Tätigkeit der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsverwaltung sind das B<strong>und</strong>eswasserstraßengesetz,<br />
das Binnenschifffahrtsaufgabengesetz <strong>und</strong> das Seeaufgabengesetz<br />
mit den hierzu gehörenden weiteren<br />
Rechtsverordnungen.<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung ist dem B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung nachgeordnet.<br />
Sie gliedert sich in eine <strong>Mitte</strong>linstanz <strong>und</strong> eine<br />
Unterinstanz. Die <strong>Mitte</strong>linstanz besteht aus sieben <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsdirektionen in Kiel, Aurich, Hannover,<br />
BAW<br />
B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau<br />
Karlsruhe (Hamburg, Ilmenau)<br />
<strong>WSD</strong> Nord<br />
Kiel<br />
WSA<br />
Lübeck<br />
WSA<br />
Tönning<br />
WSA<br />
Brunsbüttel<br />
WSA<br />
Kiel-Holtenau<br />
WSA<br />
Strals<strong>und</strong><br />
WSA<br />
Hamburg<br />
WSA<br />
Cuxhaven<br />
NBA NOK<br />
Rendsburg<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>WSD</strong> Nordwest<br />
Aurich<br />
WSA<br />
Bremen<br />
WSA<br />
Bremerhaven<br />
WSA<br />
Wilhelmshaven<br />
WSA<br />
Emden<br />
B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr,<br />
Bau <strong>und</strong> Sta adtentwicklung<br />
BfG<br />
B<strong>und</strong>esanstalt für Gewässerk<strong>und</strong>e<br />
Koblenz (Berlin)<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Hannover<br />
WSA<br />
Hann.Münden<br />
WSA<br />
Verden<br />
WSA<br />
Minden<br />
WSA<br />
Braunschweig<br />
WSA<br />
Uelzen<br />
NBA MLK<br />
Hannover<br />
WNA<br />
Helmstedt<br />
<strong>WSD</strong> West<br />
Münster<br />
WSA<br />
Köln<br />
WSA<br />
Duisburg-Rhein<br />
WSA<br />
Duisburg-<br />
Meiderich<br />
WSA<br />
Rheine<br />
WSA<br />
Meppen<br />
WNA<br />
Datteln<br />
Münster, Mainz, Würzburg <strong>und</strong> Magdeburg. Den <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsdirektionen sind als Unterinstanz insgesamt<br />
39 <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter sowie sieben<br />
Neubauämter nachgeordnet. Den <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämtern<br />
sind regionale Außenbezirke sowie jeweils<br />
ein Bauhof bzw. eine Werkstatt zugeordnet. Für spezielle<br />
Aufgaben sind bei einigen Direktionen bzw. <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsämtern zusätzlich sog. Fach- oder Bündelungsstellen<br />
eingerichtet.<br />
Zur <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung gehören außerdem<br />
vier B<strong>und</strong>esoberbehörden, die B<strong>und</strong>esanstalt für<br />
<strong>Wasser</strong>bau in Karlsruhe mit Außenstellen in Hamburg <strong>und</strong><br />
Ilmenau, die B<strong>und</strong>esanstalt für Gewässerk<strong>und</strong>e in Koblenz<br />
mit einer Außenstelle in Berlin, das B<strong>und</strong>esamt für Seeschifffahrt<br />
<strong>und</strong> Hydrographie in Hamburg <strong>und</strong> Rostock sowie<br />
die B<strong>und</strong>esstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg.<br />
In der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung (ohne Oberbehörden)<br />
sind rd. 13.000 Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
beschäftigt.<br />
BSH<br />
B<strong>und</strong>esamt für Seeschifffahrt<br />
<strong>und</strong> Hydrographie<br />
Hamburg <strong>und</strong> Rostock<br />
<strong>WSD</strong> Südwest<br />
Mainz<br />
WSA<br />
Freiburg<br />
WSA<br />
Mannheim<br />
WSA<br />
Bingen<br />
WSA<br />
Heidelberg<br />
WSA<br />
Stuttgart<br />
WSA<br />
Koblenz<br />
WSA<br />
Trier<br />
WSA<br />
Saarbrücken<br />
ANH<br />
Amt für<br />
Neckarausbau<br />
Heidelberg<br />
BSU<br />
B<strong>und</strong>esstelle für<br />
Seeunfalluntersuchung<br />
Hamburg<br />
<strong>WSD</strong> Süd<br />
Würzburg<br />
WSA<br />
Aschaffenburg<br />
WSA<br />
Schweinfurt<br />
WSA<br />
Nürnberg<br />
WSA<br />
Regensburg<br />
WNA<br />
Aschaffenburg<br />
<strong>WSD</strong> Ost<br />
Magdeburg<br />
WSA<br />
Dresden<br />
WSA<br />
Magdeburg<br />
WSA<br />
Lauenburg<br />
WSA<br />
Brandenburg<br />
WSA<br />
Berlin<br />
WSA<br />
Eberswalde<br />
WNA<br />
Berlin<br />
WNA<br />
Magdeburg
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong> in Hannover<br />
Zuständigkeitsbereich<br />
Der Zuständigkeitsbereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
(<strong>WSD</strong>) <strong>Mitte</strong> in Hannover umfasst folgende B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
mit einer Gesamtlänge von 1.364 km:<br />
Weser<br />
von Hann.Münden bis etwa 8 km oberhalb der Bremer<br />
Weserschleuse Hemelingen,<br />
Werra<br />
von Falken bei Treffurt bis Hann.Münden,<br />
Fulda<br />
von Bebra-Blankenheim bis Hann.Münden,<br />
Aller<br />
von Celle bis zur Einmündung in die Weser bei Verden,<br />
Leine<br />
von Hannover bis zur Einmündung in die Aller einschließlich<br />
Ihme <strong>und</strong> „Schneller Graben“,<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
von der Abzweigung aus dem Dortm<strong>und</strong>-Ems-Kanal bei<br />
Bergeshövede bis zur Elbe bei Magdeburg mit Stichkanälen<br />
nach Ibbenbüren, Osnabrück, Hannover-Linden, Misburg,<br />
Hildesheim <strong>und</strong> Salzgitter sowie Verbindungskanälen<br />
zur Weser in Minden <strong>und</strong> zur Leine in Hannover,<br />
Elbe-Seitenkanal<br />
von der Abzweigung aus dem <strong>Mitte</strong>llandkanal bei Edesbüttel<br />
bis zur Einmündung in die Elbe bei Artlenburg.<br />
Zu diesen B<strong>und</strong>eswasserstraßen gehören als b<strong>und</strong>eseigene<br />
Anlagen auch die Eder- <strong>und</strong> die Diemeltalsperre.<br />
Dienststellen<br />
Zum Geschäftsbereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> gehören fünf <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsämter in Hann.Münden, Verden, Minden,<br />
Braunschweig <strong>und</strong> Uelzen sowie das Neubauamt für<br />
den Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover <strong>und</strong> das<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt Helmstedt. Die Anschriften<br />
dieser Dienststellen finden Sie auf Seite 64.<br />
Den fünf <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämtern sind im inneren<br />
Aufbau insgesamt neunzehn Außenbezirke sowie jeweils<br />
ein Bauhof bzw. eine Werkstatt (WSA Hann.Münden) zugeordnet.<br />
Die Außenbezirke sind für die Verkehrssicherung<br />
<strong>und</strong> bautechnische Unterhaltung eines ihnen zugewiesenen<br />
<strong>Wasser</strong>straßenabschnitts zuständig. Die Bauhöfe<br />
bzw. die Werkstatt sind zuständig <strong>und</strong> verantwortlich für<br />
alle werkstattrelevanten Unterhaltungsarbeiten an den<br />
maschinen- <strong>und</strong> elektrotechnischen Anlagen im jeweiligen<br />
WSA-Bereich. Die Unterhaltung der nachrichtentechnischen<br />
Anlagen sowie die Instandsetzungsarbeiten an<br />
<strong>Wasser</strong>fahrzeugen <strong>und</strong> schwimmenden Geräten (soweit<br />
Regiearbeiten) obliegt für den gesamten Zuständigkeitsbereich<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> dem Bauhof Minden.<br />
Innerer Aufbau der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Die <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> gliedert sich in ihrem inneren Aufbau in die<br />
Dezernate<br />
A – Administration<br />
C – Controlling <strong>und</strong> Haushalt<br />
M – Regionales Management<br />
N – Neubau<br />
P – Planfeststellung<br />
S – Schifffahrt<br />
R – Rechtsangelegenheiten<br />
Außerdem sind der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
• die Sonderstelle für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />
(SAF) in der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
des B<strong>und</strong>es,<br />
• die Drucksachenstelle der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsverwaltung des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong><br />
• eine Lohnrechnungsstelle<br />
für die zentrale Bearbeitung überregionaler Aufgaben angegliedert.<br />
Die SAF organisiert <strong>und</strong> führt Schulungsmaßnahmen<br />
im Bereich der Aus- <strong>und</strong> Fortbildung für Beschäftigte<br />
der B<strong>und</strong>esverwaltung für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung<br />
durch. Die Drucksachenstelle ist für die Herstellung<br />
sowie Verteilung von Vordrucken <strong>und</strong> Verwaltungsvorschriften<br />
in Papierform bzw. digitaler Form b<strong>und</strong>esweit<br />
für die Dienststellen der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
tätig. Die Lohnrechnungsstelle ist zuständig für<br />
die Zahlbarmachung der Entgelte der Tarifbeschäftigten<br />
der <strong>WSD</strong>’n Nordwest, West <strong>und</strong> <strong>Mitte</strong> sowie des Luftfahrtb<strong>und</strong>esamtes<br />
<strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esstelle für Flugunfalluntersuchung<br />
in Braunschweig (z. Z. für die Statusgruppe der<br />
ehemaligen Arbeiter).<br />
Weiterhin nimmt die „Fachstelle Vermessungs- <strong>und</strong> Kartenwesen“<br />
bei der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> gebündelt Ausführungsaufgaben<br />
für die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter <strong>und</strong> die Neubauämter<br />
des Geschäftsbereichs wahr. Hierbei handelt es<br />
sich insbesondere um Aufgaben der Kartenherstellung<br />
<strong>und</strong> -fortführung, der Peilauswertung <strong>und</strong> der Auswertung<br />
von geodätischen Lage- <strong>und</strong> Höhennetzen.<br />
Eine weitere Bündelungsstelle für den gesamten Geschäftsbereich<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> zur Bearbeitung von Ingenieuraufgaben<br />
des Maschinenbaus, des Schiffbaus <strong>und</strong><br />
der Elektro- <strong>und</strong> Nachrichtentechnik besteht mit der<br />
„Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong>“ beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsamt Minden.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
����
����<br />
Die Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
Die gr<strong>und</strong>gesetzlich normierte Verwaltungstätigkeit der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung des B<strong>und</strong>es (WSV)<br />
erstreckt sich auf die <strong>Wasser</strong>straßen in ihrer Verkehrsfunktion<br />
sowie auf die staatlichen Aufgaben der Binnen-,<br />
Küsten- <strong>und</strong> Seeschifffahrt. Besonderheit der WSV – im<br />
Vergleich zu Schiene <strong>und</strong> Straße – ist die regional sehr<br />
unterschiedliche Ausprägung der Infrastruktur (Küstengewässer,<br />
Tideströme, freifließende Flüsse, Flüsse mit<br />
Schleusen <strong>und</strong> Wehren, Kanäle) <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen<br />
regional sehr unterschiedlichen Schifffahrtsbedingungen.<br />
Der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> <strong>und</strong> ihren<br />
nachgeordneten Ämtern obliegen nach dem B<strong>und</strong>eswasserstraßengesetz<br />
<strong>und</strong> dem Binnenschifffahrtsaufgabengesetz<br />
folgende Aufgaben:<br />
Unterhaltung der <strong>Wasser</strong>straßen<br />
Die Unterhaltung der Binnenwasserstraßen umfasst die<br />
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustands für den<br />
<strong>Wasser</strong>abfluss <strong>und</strong> die Erhaltung der Schiffbarkeit. Dabei<br />
ist den Belangen des Naturhaushalts Rechnung zu tragen;<br />
Bild <strong>und</strong> Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu<br />
berücksichtigen. Außerdem sind die Erfordernisse des<br />
Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Zur Unterhaltung<br />
gehören auch Arbeiten zur Beseitigung oder Verhütung<br />
von Schäden an Ufergr<strong>und</strong>stücken, die durch die Schifffahrt<br />
entstanden sind oder entstehen können, soweit die<br />
Schäden den Bestand der Ufergr<strong>und</strong>stücke gefährden.<br />
Im Rahmen der Unterhaltung der Binnenwasserstraßen ist<br />
dafür zu sorgen, dass in den Flussstrecken eine ausreichend<br />
breite <strong>und</strong> tiefe Fahrrinne für die Schifffahrt zur Verfügung<br />
steht. Besonders nach Hochwässern können sich<br />
störende Anlandungen bilden, die durch Baggerungen beseitig<br />
werden müssen. Daneben sind die durch Strömung,<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Schleuse Bolzum<br />
Wellenschlag <strong>und</strong> Eisgang verursachten Schäden an den<br />
Strombauwerken, insbesondere an Deckwerken <strong>und</strong> Buhnen<br />
zu beseitigen. An den staugeregelten Flüssen kommt<br />
die Unterhaltung der Wehranlagen, Schleusenkanäle <strong>und</strong><br />
Schleusen hinzu. An den künstlichen <strong>Wasser</strong>straßen (Kanäle)<br />
sind neben dem Gewässerbett zusätzlich die landseitigen<br />
Betriebswege, Seitendämme <strong>und</strong> -gräben bzw.<br />
Einschnittböschungen <strong>und</strong> eine Vielzahl von Ingenieurbauwerken,<br />
wie Schleusen, Pumpwerke, Sicherheitstore,<br />
Brücken, Düker <strong>und</strong> Durchlässe, zu unterhalten.<br />
Zu den Unterhaltungsarbeiten gehören die Inspektion <strong>und</strong><br />
Beurteilung des Ist-Zustands, die ständige Wartung <strong>und</strong>,<br />
sofern erforderlich, die Instandsetzung des Gewässerbetts<br />
<strong>und</strong> der baulichen Anlagen. So wird die Fahrrinnenbreite<br />
<strong>und</strong> -tiefe der Flüsse <strong>und</strong> Kanäle mit speziellen Peilschiffen<br />
regelmäßig vermessen <strong>und</strong> auf Abweichungen hin geprüft.<br />
Die regelmäßige Inspektion der Ingenieurbauwerke<br />
hat den Zweck, etwa eingetretene Mängel am Bauwerk<br />
rechtzeitig zu erkennen, um diese dann zu beseitigen, bevor<br />
größerer Schaden eintritt oder die Betriebs- bzw.<br />
Bauwerkssicherheit beeinträchtigt wird. Die Dammstrecken<br />
an den Kanälen werden im Rahmen einer Damminspektion<br />
durch regelmäßige Begehungen laufend beobachtet<br />
<strong>und</strong> überwacht. Die mechanischen, hydraulischen<br />
<strong>und</strong> elektrotechnischen Teile der Schleusen, Wehre,<br />
Pumpwerke, Sicherheitstore usw. werden im Rahmen<br />
einer sog. Planmäßigen Unterhaltung gepflegt <strong>und</strong> gewartet.<br />
In den <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämtern wird die Aufgabe<br />
der Unterhaltung durch Ingenieure <strong>und</strong> Techniker verschiedener<br />
Fachrichtungen, in den Außenbezirken <strong>und</strong><br />
Bauhöfen ergänzend durch einen Regiebetrieb wahrgenommen,<br />
der aus Fachhandwerkern, wie <strong>Wasser</strong>bauern,<br />
Maschinen- <strong>und</strong> Motorenschlossern, Stahlbauern, Energieelektronikern/Mechatronikern<br />
<strong>und</strong> Nachrichtentechnikern<br />
besteht. Dieser Regiebetrieb ist mit Land- <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>fahrzeugen<br />
sowie Arbeitsgeräten ausgestattet. Entsprechend<br />
seiner personellen <strong>und</strong> technischen Ausstattung<br />
wird der Regiebetrieb vorrangig für folgende Aufgaben<br />
eingesetzt:<br />
Sicherh
• Inspektion <strong>und</strong> Wartung von Gewässerbett,<br />
Schifffahrtsanlagen <strong>und</strong> Ingenieurbauwerken,<br />
• Soforteinsätze zur Vermeidung von Schifffahrtssperren<br />
<strong>und</strong> bei Havarien,<br />
• Überwachung der von Firmen auszuführenden<br />
Arbeiten,<br />
• Betrieb von Schifffahrtsanlagen (z.B. Schleusen,<br />
Pumpwerke, Sicherheitstore),<br />
• kleinere Instandsetzungsarbeiten am Gewässerbett<br />
<strong>und</strong> an den Anlagen.<br />
Die größeren Instandsetzungsmaßnahmen werden<br />
über öffentliche Ausschreibungen an geeignete<br />
Fachunternehmen der Wirtschaft oder des Handwerks<br />
vergeben.<br />
Als besondere Aufgabe hat die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsverwaltung für die Eisbekämpfung auf den<br />
B<strong>und</strong>eswasserstraßen zu sorgen, soweit diese<br />
wirtschaftlich vertretbar ist.<br />
Setzen <strong>und</strong> Betreiben von<br />
Schifffahrtszeichen<br />
Zur Verkehrsregelung, Verkehrslenkung sowie zum<br />
Schutz von Anlagen sind an den <strong>Wasser</strong>straßen Schifffahrtszeichen<br />
zu setzen <strong>und</strong> zu betreiben. Die Schifffahrtszeichen<br />
sind in verschiedene Gruppen eingeteilt:<br />
• feste visuelle Schifffahrtszeichen (z.B. Tafelzeichen,<br />
Signallichtanlagen),<br />
• schwimmende visuelle Schifffahrtszeichen (z.B. Fahrwassertonnen),<br />
• auditive Schifffahrtszeichen (z.B.Nebelschallanlagen),<br />
• funktechnische Schifffahrtszeichen (z.B. Nautischer<br />
Informationsfunk).<br />
Betrieb von Schifffahrtsanlagen<br />
Zu den Schifffahrtsanlagen gehören die Schleusen,<br />
Schiffshebewerke, Pumpwerke <strong>und</strong> Sicherheitstore. Diese<br />
Anlagen sind vor Ort zum Teil mit Betriebspersonal besetzt,<br />
das im Schichtbetrieb tätig ist.<br />
Besondere Bedeutung kommt der Revier- <strong>und</strong> Betriebszentrale<br />
Minden zu. In dieser ständig besetzten Zentrale<br />
werden verschiedene Betriebsaufgaben <strong>und</strong> Dienste für<br />
die Schifffahrt aus dem Bereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong> gebündelt wahrgenommen:<br />
Bauhafen ABz Lohnde<br />
Feste visuelle Schifffahrtszeichen<br />
• <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung des <strong>Mitte</strong>llandkanals <strong>und</strong> des<br />
Elbe-Seitenkanals mit der Fernbedienung <strong>und</strong> Fernüberwachung<br />
von Pumpwerken,<br />
• Fernbedienung <strong>und</strong> -überwachung der Sicherheitstore<br />
am <strong>Mitte</strong>llandkanal <strong>und</strong> am Elbe-Seitenkanal,<br />
• Fernüberwachung der Wehre der <strong>Mitte</strong>lweser <strong>und</strong> der<br />
unteren Fulda,<br />
• Notfallmeldestelle,<br />
• Nautischer Informationsfunk (NIF) für <strong>Mitte</strong>llandkanal,<br />
Elbe-Seitenkanal <strong>und</strong> <strong>Mitte</strong>lweser.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
����
����<br />
Derzeit wird ein Melde- <strong>und</strong> Informationssystem Binnenschifffahrt<br />
(MIB) für Gefahrgutschiffe vorbereitet.<br />
Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter Braunschweig, Verden<br />
<strong>und</strong> Minden planen <strong>und</strong> realisieren zur Zeit gemeinsam<br />
mit der Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong> im Rahmen eines<br />
b<strong>und</strong>esweiten Programms die Automatisierung <strong>und</strong><br />
Fernbedienung der Schleusen ihres Zuständigkeitsbereiches.<br />
Hierzu wurden an der Schleuse Anderten bei Hannover,<br />
an der Schleuse Wedtlenstedt am Stichkanal Salzgitter<br />
<strong>und</strong> im Dienstgebäude des WSA Minden sog. Fernbedienzentralen<br />
eingerichtet. An den jeweils angeschlossenen<br />
Schleusen wird kein Betriebspersonal mehr vor Ort<br />
eingesetzt, sondern die Schleusen werden durch Schichtleiter<br />
von den Fernbedienzentralen aus fernbedient.<br />
Schifffahrtswesen<br />
Ämtern u.a. folgende Aufgaben:<br />
• die Förderung der Binnenflotte <strong>und</strong> des Binnenschiffsverkehrs<br />
sowie das Führen von Binnenschifffahrtsstatistiken,<br />
• die Verhütung der von der Schifffahrt ausgehenden<br />
Gefahren <strong>und</strong> schädlichen Umwelteinwirkungen im<br />
Sinne des B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetzes,<br />
• die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Schiffsverkehr,<br />
• die Verkehrsregelung, Verkehrsberatung <strong>und</strong> Verkehrsunterstützung<br />
auf den <strong>Wasser</strong>straßen,<br />
• die schifffahrtspolizeiliche Genehmigung von Sondertransporten<br />
sowie von Veranstaltungen auf den <strong>Wasser</strong>straßen,<br />
• die Ausstellung von Befähigungszeugnissen (Patenten),<br />
• die Ausstellung von Schifferdienstbüchern <strong>und</strong> Ölkontrollbüchern,<br />
• die Ausstellung von Kennzeichen für Kleinfahrzeuge.<br />
Die schifffahrtspolizeilichen Vollzugsaufgaben werden<br />
aufgr<strong>und</strong> von B<strong>und</strong>-/Ländervereinbarungen durch die<br />
<strong>Wasser</strong>schutzpolizeien der Länder ausgeübt.<br />
Gewässerk<strong>und</strong>e <strong>und</strong><br />
<strong>Wasser</strong>bewirtschaftung<br />
Aufgabe ist die Beschaffung von Daten über die Gewässer<br />
<strong>und</strong> ihre <strong>Wasser</strong>führung, sofern <strong>und</strong> soweit diese für die<br />
Schifffahrt Bedeutung haben oder aber für Bau-, Betriebs<strong>und</strong><br />
Unterhaltungsbelange der <strong>Wasser</strong>straßen benötigt<br />
werden.<br />
Hierzu sind folgende Daten – insbesondere zur Beobachtung<br />
der Gewässermorphologie – notwendig:<br />
• Gewässerquerschnitte mit Form <strong>und</strong> Beschaffenheit<br />
der Gewässersohle,<br />
• Geschiebebewegungen,<br />
• Abflussprofile,<br />
• <strong>Wasser</strong>stände, Fließgeschwindigkeiten, Abflussmengen,<br />
• Luft- <strong>und</strong> <strong>Wasser</strong>temperatur,<br />
• Windstärke, Windrichtung, <strong>Wasser</strong>standsänderungen<br />
infolge Windstau.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Fernbedienzentrale Wedtlenstedt<br />
Die <strong>Wasser</strong>stände der Fließgewässer werden an gewässerk<strong>und</strong>lichen<br />
Pegeln ständig beobachtet. An den Kanälen<br />
wird die Einhaltung der zulässigen <strong>Wasser</strong>spiegelschwankungen<br />
durch Betriebspegel überwacht. Der Ausgleich der<br />
<strong>Wasser</strong>verluste aus dem Schleusenbetrieb, aus Verdunstung<br />
<strong>und</strong> Versickerung sowie infolge von <strong>Wasser</strong>entnahmen<br />
für Industrie <strong>und</strong> Landwirtschaft erfolgt durch den Betrieb<br />
von Pumpwerken.<br />
Pegel Hann. Münden<br />
Darüber hinaus unterhält die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
im Benehmen mit den jeweiligen Landesbehörden<br />
einen <strong>Wasser</strong>stands- <strong>und</strong> Hochwassermeldedienst.
Strompolizeiliche Aufgaben<br />
Zur Gefahrenabwehr hat die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
Maßnahmen zu treffen, um die B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
in einem für die Schifffahrt erforderlichen Zustand<br />
zu halten. Sie umfasst insbesondere die Beseitigung von<br />
Schifffahrtshindernissen sowie die Bearbeitung von in diesem<br />
Zusammenhang notwendig werdenden strompolizeilichen<br />
Verfügungen.<br />
Dritte, d.h. Einzelpersonen, Firmen <strong>und</strong> andere Behörden<br />
benötigen für die Benutzung der B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
oder für die Errichtung, die Veränderung <strong>und</strong> den Betrieb<br />
von Anlagen in, über oder unter einer B<strong>und</strong>eswasserstraße<br />
oder an ihrem Ufer eine sog. strom- <strong>und</strong> schifffahrtspolizeiliche<br />
Genehmigung. Durch Bedingungen <strong>und</strong> Auflagen<br />
in diesen Genehmigungen wird eine Beeinträchtigung des<br />
für die Schifffahrt erforderlichen Zustands der <strong>Wasser</strong>straße<br />
oder der Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des Verkehrs<br />
verhütet oder ausgeglichen.<br />
Wahrnehmung der Eigentümerinteressen<br />
(Liegenschaftsverwaltung)<br />
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen einschl. angrenzender Ufergr<strong>und</strong>stücke<br />
<strong>und</strong> Betriebsgelände sind privatrechtliches<br />
Eigentum der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland im Sinne des<br />
Bürgerlichen Rechts. Die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter<br />
vertreten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Eigentümerinteressen<br />
des B<strong>und</strong>es. Die damit verb<strong>und</strong>enen<br />
Aufgaben umfassen die Gr<strong>und</strong>stücksbewertung, den<br />
Gr<strong>und</strong>stücksverkehr sowie die Abwicklung von Verträgen<br />
mit Dritten. So hat jedes <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt mit<br />
einer Vielzahl von Nutzern der b<strong>und</strong>eseigenen Liegenschaften<br />
<strong>und</strong> Ufergr<strong>und</strong>stücke Gestattungs- <strong>und</strong> Nutzungsverträge<br />
abgeschlossen.<br />
Aus- <strong>und</strong> Neubau von B<strong>und</strong>eswasserstraßen<br />
einschließlich Planfeststellung<br />
Beim Ausbau handelt es sich um Maßnahmen zur wesentlichen<br />
Umgestaltung einer B<strong>und</strong>eswasserstraße, eines<br />
oder beider Ufer, die über die Unterhaltung hinausgehen<br />
<strong>und</strong> die B<strong>und</strong>eswasserstraße als Verkehrsweg betreffen.<br />
Bei dem Neubau oder Ausbau einer B<strong>und</strong>eswasserstraße<br />
sind in Linienführung <strong>und</strong> Bauweise das Bild <strong>und</strong> die Erholungseignung<br />
der Gewässerlandschaft sowie die Erhaltung<br />
<strong>und</strong> Verbesserung des Selbstreinigungsvermögens<br />
des Gewässers zu beachten <strong>und</strong> die natürlichen Lebensgr<strong>und</strong>lagen<br />
zu bewahren.<br />
Aus- <strong>und</strong> Neubau von B<strong>und</strong>eswasserstraßen bedürfen<br />
vorab der Planfeststellung. Anhörungs- <strong>und</strong> Planfeststellungsbehörde<br />
ist die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion.<br />
Die Neu- <strong>und</strong> Ausbauvorhaben werden über öffentliche<br />
Ausschreibungen vergeben <strong>und</strong> durch geeignete Fachunternehmen<br />
der Bauwirtschaft ausgeführt. Den Dienst<br />
MLK-Ausbau<br />
stellen der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung obliegt<br />
hierbei die Fachplanung, die Entwurfsaufstellung <strong>und</strong><br />
Entwurfsprüfung, die Ausschreibung <strong>und</strong> Vergabe sowie<br />
die Überwachung <strong>und</strong> Abrechnung der Bauarbeiten.<br />
Im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> befinden sich folgende Neu<strong>und</strong><br />
Ausbauvorhaben in der Planung bzw. in der Ausführung:<br />
• Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals zwischen Sülfeld <strong>und</strong><br />
Magdeburg im Rahmen des Projektes 17 der Verkehrsprojekte<br />
Deutsche Einheit,<br />
• Ausbau der Stichkanäle Osnabrück, Hannover-<br />
Linden, Hannover-Misburg <strong>und</strong> Hildesheim,<br />
• Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser zwischen Minden <strong>und</strong><br />
Bremen,<br />
• Neubau von Schleusen. Die Schleuse Sülfeld befindet<br />
sich in der Bauausführung, neue Schleusen in Bolzum,<br />
Minden <strong>und</strong> Dörverden in der Bauplanung.<br />
Neubau Schleuse Sülfeld<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
����
����<br />
Hubert Kindt<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
N achrichten<br />
���� Ernennung des Dipl.-Ing. Hubert Kindt zum<br />
Vizepräsidenten<br />
Am 26. Juli <strong>2007</strong> wurde der Leitende Baudirektor Herr Hubert Kindt zum Vizepräsidenten<br />
einer <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion befördert. Zuvor war er ab 1. Februar <strong>2007</strong> bereits<br />
zum ständigen Vertreter des Präsidenten der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> bestellt worden.<br />
Herr Kindt studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Braunschweig.<br />
1985 trat er in den Dienst der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung ein. Sein beruflicher<br />
Lebensweg führte ihn über die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämter Uelzen, Lauenburg <strong>und</strong><br />
Kiel-Holtenau nach Helmstedt, wo er 1992 zum Leiter des neu eingerichteten<br />
<strong>Wasser</strong>straßenneubauamtes Helmstedt bestellt wurde. 1998 wurde Herr Kindt zur<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> versetzt <strong>und</strong> wurde dort Leiter des Dezernates<br />
Administration. Nach fünfjähriger Tätigkeit wechselte er das Dezernat <strong>und</strong><br />
übernahm die Leitung des Dezernates Regionales Management.<br />
���� 160 Jahre öffentlicher Dienst – vierfaches Dienstjubiläum<br />
beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Hann. Münden<br />
Vier Jahrzehnte im öffentlichen Dienst - solche Jubiläen sind selten geworden. Umso erfreulicher waren die 40-jährigen Dienstjubiläen<br />
der vier Mitarbeiter beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Hann. Münden im Jahr <strong>2007</strong>.<br />
Bereits am 1. Januar <strong>2007</strong> feierte der Elektriker Rolf-Wilhelm Bremmer sein 40-jähriges<br />
Dienstjubiläum. Herr Bremmer ist seit dem 1. Juli 1968 beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Hann. Münden, Außenbezirk Edertal, beschäftigt. Bis zur Beendigung der aktiven Phase seiner<br />
Altersteilzeit war Herr Bremmer ein engagierter Mitarbeiter, der vor allem für die Planmäßige<br />
Unterhaltung <strong>und</strong> die Betreuung der Pegel im Bereich des Außenbezirkes sowie für die Eder<strong>und</strong><br />
Diemelstaumauer zuständig war.<br />
Genau ein halbes Jahr später, am 1. Juni <strong>2007</strong>, konnte ein<br />
weiterer langjähriger <strong>und</strong> einsatzbereiter Mitarbeiter auf sein<br />
langes Arbeitsleben zurücksehen. Herr Manfred Becker<br />
wurde am 1. Juni 1969 beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Hann. Münden, Bauhof Hann. Münden, als Magazinverwalter<br />
<strong>und</strong> Schlosser eingestellt. Seit 1973 bis zum<br />
Ende seiner Arbeitsphase im Rahmen der Altersteilzeit<br />
arbeitete er als Berufskraftfahrer beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsamt in Hann. Münden.<br />
Zu den Jubilaren gesellte sich am 11. Juli <strong>2007</strong> Herr Baudirektor Uwe Klemm. Herr Klemm<br />
nahm nach Beendigung des Studiums 1969 sein abwechslungsreiches Arbeitsleben auf. Am<br />
1. November 1995 übernahm er die Leitung des <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamtes Hann.<br />
Münden, wo er bis zum Ende seiner Arbeitsphase im Rahmen der Altersteilzeit erfolgreich<br />
tätig war. Im September <strong>2007</strong> wurde Herr Klemm vom Präsidenten der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>, Herrn Sönke Meesenburg, nach Beendigung der Altersteilzeit in<br />
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Landrat Klaus Wiswe, Bürgermeister Wilfried Hemme, BDir Thomas Rumpf,<br />
Uwe Höpfner , Präsident Sönke Meesenburg (v. l.)<br />
Nachrichten<br />
Das Quartett vervollständigte am 15. Oktober <strong>2007</strong> der Vermessungstechniker Erich<br />
Langhans. Nach Abschluss der Ausbildung <strong>und</strong> Absolvierung des Gr<strong>und</strong>wehrdienstes<br />
wechselte Herr Langhans am 16. April 1969 zum <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Hann.<br />
Münden. Seitdem ist er im Bereich des Vermessungswesens <strong>und</strong> der Liegenschaftsverwaltung<br />
tätig. Herr Langhans ist ein kompetenter <strong>und</strong> zuverlässiger<br />
Ansprechpartner in seinem Aufgabengebiet <strong>und</strong> durch seine langjährige Tätigkeit ein allzeit<br />
geachteter Wissensträger beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Hann. Münden.<br />
Die Leiterin des <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamtes Hann. Münden <strong>und</strong> die Belegschaft<br />
dankten den Jubilaren anlässlich Ihrer Dienstjubiläen für ihren langjährigen aktiven <strong>und</strong><br />
engagierten Einsatz für die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung.<br />
���� Gr<strong>und</strong>steinlegung für den Neubau des Wehres in Bannetze<br />
Am 23. August <strong>2007</strong> fand unter breiter regionaler Beteiligung von Politik, Wirtschaft, Verwaltung sowie von Vereinen <strong>und</strong> Verbänden<br />
der offizielle Baubeginn zum Neubau des Wehres Bannetze statt.<br />
Nach einjähriger Planung hat das <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Verden im März <strong>2007</strong> den Auftrag zur Errichtung einer neuen<br />
Wehranlage an die Firma Müsing aus Bernau bei Berlin erteilt.<br />
Verschlusskörper werden mit <strong>Wasser</strong> gefüllte<br />
Schlauchverschlüsse eingesetzt. Die Schlauchmembran<br />
besteht aus einem gewebeverstärktem Elastomer. Die<br />
Steuerung der Verschlüsse erfolgt hydraulisch nach dem<br />
Prinzip der kommunizierenden Röhren.<br />
Damit folgt man konsequent der Bauweise <strong>und</strong> den ersten<br />
Erfahrungen der im Dezember 2006 in Betrieb genommen<br />
Wehranlage in Marklendorf.<br />
Um während der Bauzeit in Bannetze mögliche Sommerhochwässer<br />
gefahrlos abfließen lassen zu können, müssen<br />
die beiden neuen Wehrfelder nacheinander in 2 Bauabschnitten<br />
hergestellt werden. So ist sichergestellt, dass<br />
immer ein Wehrfeld die anfallende <strong>Wasser</strong>menge abführen<br />
kann. Um Risiken für die Bauabwicklung durch die Winter-<br />
Die Staustufe Bannetze ist die 2. Staustufe unterhalb von<br />
Celle <strong>und</strong> besteht wie jede der vier Aller-Staustufen aus<br />
einer Wehr- <strong>und</strong> einer Schleusenanlage sowie einer<br />
Sportbootumtragestelle <strong>und</strong> einer Fischwanderhilfe.<br />
Das Wehr in Bannetze wurde in den Jahren 1909 bis 1912<br />
gebaut <strong>und</strong> weist von den noch vorhandenen Anlagen aus<br />
dieser Zeit den schlechtesten Bauzustand auf. Die allgemein<br />
anerkannten Nutzungsdauern von 90 Jahren für<br />
die Massivbauteile aus Klinker <strong>und</strong> Stampfbeton <strong>und</strong> von<br />
70 Jahren für die Stahlwasserbauverschlüsse sind<br />
teilweise bereits deutlich überschritten. Die für die<br />
Aufrechterhaltung des Stauzieles erforderliche Stand- <strong>und</strong><br />
Betriebssicherheit war für die Wehranlage Bannetze kaum<br />
mehr gegeben.<br />
Das neue Wehr besteht aus zwei gleichgroßen Wehrfeldern,<br />
die wenige Meter unterhalb direkt auf der Sohle<br />
des heutigen Altwehres hergestellt werden. Als<br />
BDir Thomas Rumpf, Uwe Höpfner, Präsident Sönke Meesenburg<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
����
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
N achrichten<br />
<strong>und</strong> Hochwasserzeit entsprechend auszuschließen, werden die Baustellentätigkeiten zudem auf die Monate April bis Oktober<br />
zeitlich beschränkt.<br />
Das erste Wehrfeld soll im Herbst <strong>2007</strong> fertig gestellt sein. Mit der Inbetriebnahme des Wehres ist Ende <strong>2008</strong> zu rechnen. Dann<br />
werden ca. 3000 m³ Beton <strong>und</strong> r<strong>und</strong> 200 Tonnen Baustahl verarbeitet sein. Eine neue Brücke über das Wehr wird dann die<br />
höhengleiche Querung zwischen den Ufern möglich machen. Erst nach Inbetriebnahme des neuen Wehres wird das alte Wehr<br />
aus dem Betrieb genommen <strong>und</strong> abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt ist auch vorgesehen, den nach neuesten ökologischen<br />
Erkenntnissen geplanten Fischpass am linken Ufer in Betrieb zu nehmen.<br />
Das Bauvolumen wird sich einschließlich der Herstellung des Fischpasses auf r<strong>und</strong> vier Millionen Euro belaufen.<br />
���� Zukunftstag <strong>2007</strong> (ehemals Girlsday) im WSA Uelzen<br />
Seit 2001 gibt es in Deutschland den Girls'Day. Die Gr<strong>und</strong>idee<br />
hierbei war, dass Mädchen die Möglichkeit erhalten in Berufe<br />
hinein zu schnuppern, in denen Frauen (noch)<br />
unterrepräsentiert sind. Das Land Niedersachsen hat die Idee<br />
seit 2005 zum "Zukunftstag für Mädchen <strong>und</strong> Jungen"<br />
weiterentwickelt. Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler der Klassen 5 – 10<br />
können an berufsorientierenden Angeboten in Unternehmen<br />
<strong>und</strong> Behörden teilnehmen oder Mitglieder ihrer Familie bzw.<br />
ihres Bekanntenkreises an deren Arbeitsplatz begleiten.<br />
Das WSA Uelzen beteiligte sich am 26. April <strong>2007</strong> bereits zum<br />
zweiten Mal an dem b<strong>und</strong>esweiten beruflichen Orientierungstag.<br />
Diesmal waren es 14 Mädchen <strong>und</strong> Jungen, die<br />
das vielfältige Angebot im WSA Uelzen nutzten.<br />
Faszination im Steuerstand<br />
Erläuterung der Messgeräte<br />
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Amtsleiter Herrn<br />
Martin Köther <strong>und</strong> Vorstellung der Amtsaufgaben durch den<br />
Sachbereichsleiter 1, Herrn Klaus Ripphahn wurden den<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern verschiedene Berufsbilder durch<br />
Mitarbeiter des Amtes vorgestellt. Ausbilder Michael<br />
Blick in die Schleusenkammer Uelzen II<br />
Heidemann erläuterte Ausbildung <strong>und</strong> Beruf des <strong>Wasser</strong>bauers.<br />
Katharina Meyer berichtete von ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten <strong>und</strong> Frank Steinmann faszinierte<br />
die Mädchen <strong>und</strong> Jungen mit dem vielfältigen Aufgabenspektrum eines Bauingenieurs. Anschließend konnte man im<br />
Freien die Präzision moderner Vermessungstechnik bew<strong>und</strong>ern <strong>und</strong> unter fachkompetenter Anleitung eigene Messversuche<br />
vornehmen.
Besucher des Zukunftstags <strong>2007</strong> im WSA Uelzen<br />
GMS Freigabe - Regelungsstrecke<br />
Nachrichten<br />
Nach so vielen interessanten Eindrücken<br />
stärkten sich mittags die Jugendlichen mit<br />
Grillwürsten <strong>und</strong> Salaten bei schönstem Wetter<br />
unter freiem Himmel im Hof des WSA.<br />
Anschließend ging es zur Besichtigung der<br />
Schleusengruppe Uelzen. Herr Klaus Ripphahn<br />
führte die Kinder nicht nur in dunkle<br />
„Katakomben“ der Schleuse Uelzen II, die sonst<br />
nur Fachpublikum vorbehalten sind, sondern<br />
konnte den Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern viele<br />
interessante <strong>Informationen</strong> über den<br />
Schleusenbetrieb <strong>und</strong> die Schifffahrt auf dem<br />
Elbe-Seitenkanal vermitteln. Besonders beeindruckte<br />
die jungen Besucher der hochmoderne<br />
Steuerstand: ein Mausklick - <strong>und</strong><br />
59.000 m� <strong>Wasser</strong> werden bewegt. Zum<br />
Abschluss gab es eine Teilnahmebestätigung<br />
<strong>und</strong> r<strong>und</strong>um zufriedene Gesichter: Für diesen<br />
erlebnisreichen Tag hatte man gerne einmal auf<br />
die Schule verzichtet.<br />
Der Zukunftstag ist eine hervorragende Möglichkeit, jungen Menschen die Aufgaben der WSV näher zu bringen. Am<br />
24. April <strong>2008</strong> ist in Niedersachsen der nächste Zukunftstag für Mädchen <strong>und</strong> Jungen geplant.<br />
� Entlastung der Straße<br />
Große Schiffe fahren vom Rhein bis zur Elbe<br />
Ausbau der <strong>Wasser</strong>straße:<br />
Verkehrslenkung ermöglicht die Großmotorgüterschifffahrt schon während des Ausbaus des <strong>Mitte</strong>llandkanals<br />
Am 30. Juli <strong>2007</strong> trat auf dem <strong>Mitte</strong>llandkanal (MLK) in dem Streckenabschnitt zwischen der Schleuse Sülfeld <strong>und</strong> dem <strong>Wasser</strong>straßenkreuz<br />
Magdeburg eine neue Regelung zur Verkehrslenkung in Kraft. In einem zweistündigen Wechsel (bisher vierstündiger<br />
Wechsel) im Richtungsverkehr kann die Binnenschifffahrt die noch verbleibenden Baustellenbereiche passieren. Durch<br />
diese Regelung wird der ausgebaute Teil des MLK bereits vorgezogen für die Großmotorgüterschifffahrt (GMS; Länge bis<br />
110 m, Breite bis 11,45 m) mit einer Abladetiefe (t) bis zu 2,50 m freigegeben.<br />
Im Einzelnen gelten folgende Festlegungen:<br />
• in ausgebauten Abschnitten (Sülfeld bis Haldensleben) t = 2,50 m<br />
• in noch nicht ausgebauten Strecken (Haldensleben bis Magdeburg)<br />
t = 2,50 m mit Einzelgenehmigung<br />
• in Baustellenbereichen während der Bauzeit t = 1,60 m<br />
Mit der Einführung der neuen Verkehrslenkung in der Oststrecke des MLK treten die Bauarbeiten des Verkehrsprojekts Deutsche<br />
Einheit Nr. 17 in ihre letzte Phase ein. Die erforderlichen <strong>Wasser</strong>bauarbeiten am MLK sind auf einer Strecke von 80 km so<br />
weit fertig gestellt, dass mit der Einführung eines festen Fahrplanes <strong>und</strong> eines Richtungsverkehrs die GMS mit einer Abladetiefe<br />
von 2,50 m vom westdeutschen Kanalnetz <strong>und</strong> dem Seehafen Hamburg bis nach Magdeburg fahren können.<br />
Die endgültige Fertigstellung des Ausbaus am MLK für die Großmotorgüterschifffahrt mit einer Abladetiefe von 2,80 m ist nach<br />
derzeitigem Stand für das Jahr 2012 geplant.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
11
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
N achrichten<br />
���� Planungen zum Ausbau des Stichkanals nach Hildesheim<br />
haben begonnen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Planung<br />
Der Ausbau des Stichkanals nach Hildesheim (SKH) wurde verbindlich zwischen der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland <strong>und</strong> den<br />
B<strong>und</strong>esländern Niedersachsen, Hamburg <strong>und</strong> Bremen in dem Regierungsabkommen zum Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals einschließlich<br />
seiner Stichkanäle im Jahre 1965 vereinbart. Der <strong>Mitte</strong>llandkanal kann nur dann effizient genutzt werden, wenn auch<br />
die Häfen an den Stichkanälen mit den gleichen Schiffsgrößen zu erreichen sind.<br />
Der Ausbau des SKH ist nicht nur vor dem Hintergr<strong>und</strong> des bestehenden Abkommens sondern auch auf Gr<strong>und</strong> einer sich ändernden<br />
Flottenstruktur erforderlich. Aus Gründen der Kostenoptimierung werden die Schiffseinheiten größer.<br />
Auf dem <strong>Mitte</strong>llandkanal (MLK) verkehren bereits heute Großmotorgüterschiffe (110 m Länge, 11,45 m Breite) mit einer Abladetiefe<br />
von 2,80 m, die den SKH noch nicht befahren dürfen, da dort nur Schiffe bis 85 m Länge <strong>und</strong> 9,50 m Breite mit einer Abladetiefe<br />
von 2,00 m zugelassen sind. Die Bauwerksabmessungen des SKH lassen die Passage größerer Schiffe derzeit auch<br />
noch nicht zu. Das vorhandene Leistungspotenzial der Schifffahrt ist somit nicht voll genutzt. Die Einsatzmöglichkeit größerer<br />
Fahrzeuge mit einem größeren Tiefgang wird einen deutlich leistungsfähigeren <strong>und</strong> wirtschaftlicheren Betrieb ermöglichen.<br />
Darüber hinaus wird auch das bereits auf dem Rhein verkehrende überlange GMS mit einer Länge von 135 m zukünftig die<br />
Schifffahrtskanäle befahren. Dafür wird die neue Schleuse Bolzum mit einer Länge von 140 m gebaut <strong>und</strong> der Kanal entsprechend<br />
trassiert.<br />
Ausbaumaßnahmen<br />
Der Ausbau betrifft den gesamten Stichkanal zwischen SKH-Km 1,450 <strong>und</strong> SKH-Km 14,401. Das Bemessungsschiff für den<br />
Ausbau ist das überlange Großmotorgüterschiff (üGMS) mit L=135,00 m, B=11,45 m <strong>und</strong> T=2,80 m bzw. der Schubverband mit<br />
einer Länge von 139,00 m.<br />
Die erforderliche <strong>Wasser</strong>tiefe von insgesamt 4,00 m wird durch Anspannen des Normalwasserstandes im Stichkanal von bisher<br />
NN + 73,00 m auf NN + 73,50 m (<strong>Wasser</strong>standserhöhung 0,5 m) <strong>und</strong> Vertiefung der Sohle von ca. NN + 70,00 auf NN + 69,50<br />
m (Vertiefung der Sohle um 0,50 m) hergestellt.<br />
Neben den Streckenbauarbeiten betrifft der Ausbau des Stichkanals nach Hildesheim auch den Neubau bzw. die Anpassung<br />
von 18 Brücken <strong>und</strong> 2 Durchlässen. Davon sind 5 Brücken in den vergangenen 17 Jahren bereits neu gebaut <strong>und</strong><br />
3 weitere im Laufe der Zeit abgebrochen worden. Die anderen Brückenbauwerke nähern sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer.
Abb.1: Lage der Kanalstrecke Nds IIa<br />
Nachrichten<br />
Von diesen müssen 4 neu gebaut werden, 2 könnten erhalten bleiben. Bei den verbleibenden 4 Brücken (Wirtschaftswegbrücken)<br />
wird vor der Planung des Neubau das objektive Verkehrsbedürfnis ermittelt, um festzustellen, welche verkehrliche Bedeutung<br />
die Brücken heute noch haben. Aus dem objektiven Verkehrsbedürfnis ergibt sich dann, ob <strong>und</strong> in welchen Abmessungen<br />
die Brücken wieder zu errichten sind.<br />
In den Einschnittsbereichen des SKH sind die vorhandenen Böschungen aufgr<strong>und</strong> des großen Neigungswinkels <strong>und</strong> der Bodenart<br />
(Ton) rutschungsgefährdet. Im Rahmen des Ausbaus werden deshalb die Standsicherheiten der Böschungen erhöht.<br />
Das wird zum einem durch das Abflachen der Böschungen <strong>und</strong> zum anderen, soweit möglich, durch die Reduzierung des Porenwasserdrucks<br />
im Boden erreicht.<br />
Durch den Ausbau werden voraussichtlich ca. 900.000 m³ Boden gelöst. Da das Aushubmaterial bautechnisch im Rahmen<br />
dieser Maßnahme nicht wieder verwendet werden kann, muss die anderweitige Verwendung im Sinne einer Vermeidung geprüft<br />
werden bzw. eine Ablagerung erfolgen.<br />
Zur Unterhaltung des Kanals ist gr<strong>und</strong>sätzlich ein beidseitiger Betriebsweg geplant. Im Bereich der Brückenbauwerke <strong>und</strong> in<br />
ökologisch empfindlichen Bereichen kann ggf. unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheit <strong>und</strong> der betrieblichen Erfordernisse<br />
auf einen Betriebsweg verzichtet werden.<br />
Der Ausbau des Stichkanals nach Hildesheim soll eine Bauzeit von ca. 5 Jahren umfassen <strong>und</strong> unter laufendem, z. T. eingeschränktem<br />
Schifffahrtsbetrieb stattfinden. Mit dem Beginn der Ausbauarbeiten ist nicht vor 2011 zu rechnen.<br />
����Fertigstellung des <strong>Mitte</strong>llandkanal–Bauloses<br />
Niedersachsen IIa (Wendschott)<br />
Mit Fertigstellung des ca. 4,9 km langen MLK- Streckenausbauabschnitts Wendschott (östlich von Wolfsburg zwischen Vorsfelde<br />
<strong>und</strong> Rühen) wurde Ende <strong>2007</strong> die letzte längere noch verbliebene Engstelle zwischen Sülfeld <strong>und</strong> Haldensleben beseitigt.<br />
Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, dass ab sofort bis zu 2,50 m abgeladene <strong>und</strong> 11,45 m breite Schiffseinheiten von<br />
Westen über den <strong>Mitte</strong>llandkanal kommend bis Magdeburg fahren können. Spätestens nach Inbetriebnahme der Schleuse<br />
Sülfeld Süd Ende <strong>2008</strong> können dann GMS mit einer Abladetiefe von bis zu 2,80 m von Westen kommend bereits Haldensleben<br />
erreichen.<br />
Dieser Ausbauabschnitt liegt im Landschaftsschutzgebiet<br />
(LSG), im Europäischen<br />
Schutzgebiet nach FFH- Richtlinie<br />
(Flora- Fauna- Habitat) <strong>und</strong> im EU-Vogelschutzgebiet.<br />
Der<br />
Planfeststellungsbeschluss enthält daher für<br />
die Baumaßnahme eine Reihe von Auflagen<br />
zum Schutz von Natur <strong>und</strong> Landschaft.<br />
Ursprünglicher Zustand des MLK<br />
Die ursprünglichen Abmessungen des Kanalquerschnitts<br />
reichten für die Anforderungen<br />
der modernen Binnenschifffahrt nicht<br />
mehr aus. Das alte Muldenprofil besaß eine<br />
<strong>Wasser</strong>spiegelbreite von 39 m sowie eine<br />
<strong>Wasser</strong>tiefe im <strong>Mitte</strong>l von ca. 3,00 m. Die<br />
Böschungsneigungen betrugen im Bereich<br />
der <strong>Wasser</strong>wechselzone ca. 1:3, darunter<br />
ca. 1:4. Die Böschungen waren ab ca. 2 m<br />
unterhalb bis etwa 1 m oberhalb des Normalwasserspiegels<br />
mit Schüttsteinen befes-<br />
tigt. Beidseitig des Kanals existierten Betriebswege, die auf jeweils kanalparallel vorhandenen Wällen bzw. Deichen geführt<br />
wurden. Diese bis zu 3 m hohen Deiche schützen den Kanal vor dem Aller- Hochwasser. Im hier beschriebenen Streckenabschnitt<br />
befinden sich weiterhin 3 Düker <strong>und</strong> 2 Brücken.<br />
Der Düker 419 (Steekgraben) wurde bereits bis Ende 2005 neu gebaut . Mit dem Neubau des Dükers 420 (Aller) wird voraussichtlich<br />
2011 begonnen. In diesem Bereich verbleibt bis dahin eine ca. 170 m lange Engstelle im Kanal, die jedoch im Richtungsverkehr<br />
mit den o.g. GMS befahren werden kann. Der Düker 421 (Brechtdorfer Düker) konnte ersatzlos abgebrochen<br />
werden (vgl. gesonderten Artikel über den Abbruch des Dükers in dieser Infoschrift). Die beiden ca. 30 Jahre alten Brücken<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
N achrichten<br />
442 <strong>und</strong> 443 verfügten beide bereits über die erforderlichen lichten Weiten <strong>und</strong> Höhen für das neue Kanalprofil <strong>und</strong> konnten<br />
deshalb erhalten bleiben.<br />
Ausbauprofile<br />
Im gesamten Streckenabschnitt waren folgende Ausbauprofile<br />
auszuführen:<br />
T-Profil-Trapezprofil (Böschungsbauweise)<br />
KRT-Profil-Kombiniertes-Rechteck-Trapezprofil (Unterwassersp<strong>und</strong>wand)<br />
sowie<br />
R-Profil-Rechteckprofil (Überwassersp<strong>und</strong>wand)<br />
Die Ufersicherung im T-Profil war aus einer Schicht <strong>Wasser</strong>bausteine<br />
Steinklasse LMB 10/60 (bisher Größenklasse III)<br />
gemäß TLW mit einer Rohdichte von mind. 2,6 kg/dm³ waren<br />
in einer Dicke von 60 bzw. 80 cm einzubauen. Die Einbaudicke<br />
richtete sich nach dem darunter liegenden Filter (Abb. 1).<br />
Bauablauf <strong>und</strong> Verkehrsführung<br />
Durch mehrere Achsverschiebungen, Wechsel der Ausbauseiten<br />
<strong>und</strong> des Ausbauprofils ist während der Bauzeit eine Re-<br />
Abb 3.: Bauausführung unter laufendem Schiffsverkehr<br />
Abb. 5: Konsoleneinbau<br />
Abb. 2: Übergang von R zum T-Profil,<br />
Bauablauf, Logistik<br />
gelungsstrecke ohne Gegenverkehr eingeführt worden. Die ausführende Firma entwickelte einen sehr präzisen Bau-<br />
ablauf <strong>und</strong> eine entsprechende Logistik (Abb. 2). Dadurch konnte die Bauzeit von 30 Monaten auf 22 Monate reduziert werden.<br />
Es erfolgte somit auch eine um 8 Monate frühere Verkehrsfreigabe für die Schifffahrt (Abb. 3).<br />
bzw. zwischengelagert werden. Dafür waren bauvertraglich<br />
zunächst drei Ablagerungsflächen vorgesehen. Aufgr<strong>und</strong> des<br />
hohen Bodenanteils, der wiederverwendet werden konnte,<br />
konnte auf die Inanspruchnahme einer Ablagerungsfläche<br />
verzichtet werden, so dass insgesamt nur 2 Ablagerungsflächen<br />
gebraucht wurden.<br />
Bodenkonzept<br />
Insgesamt mussten im gesamten Streckenabschnitt<br />
ca. 817.000 m³ Boden bewegt werden. Davon konnten ca.<br />
145.000 m³ Boden im Baulos selbst wiederverwendet<br />
bzw. eingebaut werden. Etwa 200.000m³ Boden hat die Stadt<br />
Wolfsburg übernommen. Der gute sandige Boden fand<br />
Verwendung bei Straßenbauprojekten der Stadt. Der restliche<br />
Boden (ca. 472.000 m³) musste auf Ablagerungsflächen ab-<br />
Abb. 4: Flachwasserzone<br />
Wesentliche Leistungen<br />
Neben den im Zusammenhang mit den Streckenausbauarbeiten<br />
noch speziell zu erwähnenden 161.000 m² Deckwerksarbeiten,<br />
27.000 m² Sp<strong>und</strong>wandarbeiten sowie 10,5 km<br />
Wegebauarbeiten wurden auch umfangreiche Ausgleichs<strong>und</strong><br />
Ersatzmaßnahmen ausgeführt. Insgesamt waren in<br />
diesem Bauabschnitt entsprechende Maßnahmen auf ca. 30<br />
ha Fläche umzusetzen.
Nachrichten<br />
Herstellung des KRT- Profils<br />
Das KRT- Profil wurde in einer neuen Bauweise hergestellt. Dadurch konnte auf die sonst üblichen <strong>Wasser</strong>haltungsmaßnahmen<br />
mit einer Sicherungssp<strong>und</strong>wand, um das Einbringen der Sp<strong>und</strong>wände <strong>und</strong> die Stahlbauarbeiten zu ermöglichen, verzichtet<br />
werden.<br />
Abb. 6: Fertiggestelltes Kanalprofil<br />
Die Ankerstühle sowie auch die Konsolen<br />
(Auflager für den Sp<strong>und</strong>wandholm) konnten<br />
vor dem Einbringen der Sp<strong>und</strong>wand auf die<br />
Endtiefe im Trockenen eingebaut werden.<br />
Beide wurden - im Gegensatz zur Ausführung<br />
bei der Schraublösung - an die Sp<strong>und</strong>wände<br />
geschweißt.<br />
Als letzter Arbeitsgang wurde der Holmgurt<br />
an die Konsolen <strong>und</strong> an die Ankerstühle<br />
festgeschraubt.<br />
Dieses Verfahren stellt damit gegenüber der<br />
Schraublösung eine nochmalige Optimierung<br />
dar <strong>und</strong> hat in der Ausführung problemlos<br />
geklappt.<br />
Am 25.10.<strong>2007</strong> erfolgte die Abnahme der<br />
Baumaßnahme sowie auch die Übergabe des<br />
Abschnitts an das zuständige WSA Uelzen.<br />
Insgesamt beliefen sich die Baukosten auf<br />
etwa 15,2 Mio €. Die Abrechnungssumme<br />
entspricht damit in etwa der Auftragssumme.<br />
�Neubau der Unterführung U 164alt (Werftstraße) in Minden<br />
Die Unterführung U 164alt wurde in den Jahren 1911 bis 1914 als Eisenbeton-Gewölbekonstruktion mit zwei parallelen, gleich<br />
großen, in sich aber unsymmetrischen Bogentragwerken gebaut. Sie dient der Unterführung eines Werkbahngleises <strong>und</strong> der<br />
Werftstraße in Minden unter dem<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanal bei MLK-km<br />
102,035. Sowohl das Bauwerk<br />
selbst, als auch die sich daran<br />
anschließenden Böschungen<br />
des Kanalseitendamms erfüllen<br />
nicht mehr die heutigen technischen<br />
Anforderungen <strong>und</strong> Sicherheiten.<br />
Insbesondere sind<br />
für die Lastfälle „Schiffsstoß auf<br />
die Seitenwände“, „gesunkenes<br />
Schiff“ <strong>und</strong> „<strong>Wasser</strong>druck bei<br />
Versagen der Kanaldichtung“<br />
erhebliche Defizite vorhanden.<br />
Daher wird die Unterführung<br />
durch einen Neubau ersetzt<br />
Technische Angaben<br />
zum Neubau<br />
Das nach Abbruch der alten<br />
Anlage neu zu errichtende Bauwerk<br />
wird als Stahlbeton-<br />
Rahmenkonstruktion mit einer<br />
lichten Durchfahrtsbreite für den<br />
Straßen- <strong>und</strong> Bahnverkehr von<br />
Neue Kanalunterführung<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
N achrichten<br />
15 m <strong>und</strong> einer Länge von 39 m ausgeführt. Für die Schifffahrt bleibt die vorhandene Durchfahrtsbreite von 24 m erhalten. Die<br />
<strong>Wasser</strong>tiefe erhöht sich von 2,90 m auf 3,30 m.<br />
Zahlen <strong>und</strong> Daten<br />
• Auftragsvolumen: ca. 5,6 Mi. EURO<br />
• Bodenbewegung: 7.000 m³<br />
• Betonabbruch: 5.100 m³<br />
• Stahlsp<strong>und</strong>wand: 1.100 t<br />
• Stahlbeton: 2.000 m³<br />
Auftragnehmer<br />
Arbeitsgemeinschaft Wiebe <strong>und</strong> Hecker<br />
(Achim/Bremen)<br />
Bauzeit<br />
Juni <strong>2007</strong> bis Dezember <strong>2008</strong><br />
Bauablauf<br />
• Bauphase 1: Herstellen der Fangedämme, Baugruben- <strong>und</strong> Kanalsp<strong>und</strong>wände<br />
Juli bis Oktober <strong>2007</strong><br />
• Bauphase 2: Freilegen <strong>und</strong> Abbruch der alten Unterführung <strong>und</strong> F<strong>und</strong>amente<br />
November bis Dezember <strong>2007</strong><br />
• Bauphase 3: Kanalbauarbeiten <strong>und</strong> Herstellen der neuen F<strong>und</strong>amente<br />
Januar bis März <strong>2008</strong><br />
• Bauphase 4: Herstellen des neuen Bauwerks<br />
April bis August <strong>2008</strong><br />
• Bauphase 5: Erdbau, Rückbau der Baugrubensp<strong>und</strong>wände <strong>und</strong> Fangedämme<br />
September bis Dezember <strong>2008</strong><br />
Belastung durch „Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)“<br />
Beim Freilegen der Gewölbekonstruktion der alten Unterführung wurde festgestellt, dass der Beton seinerzeit mit einem teerhaltigen<br />
Kleber bestrichen wurde, auf den dann eine Bleiabdichtung zu liegen kam. Auf der Bleiabdichtung wurde wiederum erneut<br />
eine teerstämmige Abdichtung aufgebracht. Eine abfall- <strong>und</strong> altlastentechnische Untersuchung hat ergeben, dass der Beton so<br />
stark mit PAK belastet ist, dass er gem. den geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen als „gefährlicher Abfall“ gilt <strong>und</strong> gesondert<br />
entsorgt werden muss.<br />
Wegen der außerordentlich hohen Belastung steht als Entsorgungsweg nur die thermische Behandlung zur Verfügung (Umweltschutz<br />
West GmbH in Gladbeck). Anschließend kann das Material z.B. als Straßen- oder Deponieunterbau wiederverwertet<br />
werden.<br />
Abbruch der alten Unterführung
Nachrichten<br />
�Schwertransport auf der Oberweser<br />
Ein besonderes Ereignis hatte das WSA Hann. Münden im Jahr <strong>2007</strong> zu verzeichnen. Nach vielen Jahren wurde wieder ein<br />
Gütertransport auf der gesamten Strecke der Oberweser durchgeführt. Dieser Transport war notwendig, um die in Hessisch<br />
Lichtenau hergestellten Schwerlastteile für eine Rohrpresse in Russland auf die Reise zu schicken.<br />
Am Samstag, dem 6. Oktober <strong>2007</strong> wurde das Erste von zwei Schwergutteilen mit einem Gewicht von ca. 250 Tonnen in Gimte<br />
(Weser – km 0,600) auf einen Ponton verladen. Die Schwergutteile gelangten auf dem öffentlichen Straßennetz von Hessisch<br />
Lichtenau nach Hann. Münden. Auf dem Gelände des Außenbezirks des <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamtes wurden die Teile zwischengelagert<br />
bis der Schubverband mit Vorspann in Gimte eingetroffen war.<br />
Die Abmessungen des Verbandes betrugen:<br />
Abb. 1: Verband bei der Bergfahrt in Gieselwerder km 28,200<br />
Abb. 2: Verladung in Gimte<br />
• Schubboot 25,68 m Länge<br />
<strong>und</strong> 8,19 m Breite<br />
• Ponton 66,68 m Länge <strong>und</strong><br />
9,50 m Breite<br />
• Vorspannboot 16,17 m<br />
Länge <strong>und</strong> 3,38 m Breite<br />
Der Transport des ersten<br />
Schwergutteils endete zunächst<br />
beim Kernkraftwerk Grohnde<br />
(Weser-km 124,700). Nach der<br />
dortigen Umladung des Schwergutteils<br />
auf das Binnenschiff<br />
„Theresia“ erfolgte der<br />
Weitertransport nach Rotterdam.<br />
Der Schubverband kam zurück<br />
nach Gimte, um das zweite<br />
Schwergutteil zu übernehmen.<br />
Am 10. Oktober <strong>2007</strong> wurde<br />
auch dieses Teil verladen.<br />
Die Beförderung des zweiten Teiles auf der Oberweser konnte ebenfalls ohne Probleme durchgeführt werden <strong>und</strong> der Schubverband<br />
brachte dieses Teil auf direktem Weg nach Rotterdam. Von dort ging es per Küstenmotorschiff nach<br />
St. Petersburg in Russland. Für das Jahr <strong>2008</strong> ist ein weiterer Transport dieser Art angedacht.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
N achrichten<br />
�Ausbau des Stichkanals<br />
nach Salzgitter<br />
- Ausbauzustand <strong>und</strong> weitere Planungen<br />
Der Stichkanal nach Salzgitter (SKS) hat eine wichtige<br />
Verkehrsfunktion für die Industrie- <strong>und</strong> Gewerbebetriebe<br />
in der Region Salzgitter. Der SKS wurde 1941<br />
zum Anschluss des Stahlwerkes Salzgitter an den<br />
bereits bestehenden MLK gebaut. Der 18 km lange<br />
Stichkanal zweigt westlich von Braunschweig bei<br />
MLK-km 213,53 aus dem MLK in südlicher Richtung<br />
ab. Kurz nach der Eröffnung des Elbe-Seitenkanals<br />
wurde auch der Ausbau des SKS in den 70-er Jahren<br />
Schiffsverkehr auf dem SKS<br />
abgeschlossen. Somit waren bereits frühzeitig Transporte<br />
mit größeren Schiffen <strong>und</strong> Schubverbänden vom<br />
Hamburger Hafen zum Hafen Beddingen <strong>und</strong> zum Stahlwerk Peine - Salzgitter möglich. Aufgr<strong>und</strong> der niedrigen Transportkosten<br />
haben sich im Bereich des SKS neue Betriebe angesiedelt bzw. haben ihre Kapazitäten erweitert. Am SKS werden jährlich<br />
ca. 2,5 Mio. t Güter mit der Tendenz steigend umgeschlagen. Wichtigste Umschlagsgüter neben den landwirtschaftlichen Erzeugnissen,<br />
festen Brennstoffen <strong>und</strong> Mineralöl sind Steine/Erde/Baustoffe, Eisen/Stahl, Erze/Schrott <strong>und</strong> Düngemittel. Die Umschlagszahlen<br />
haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt, <strong>und</strong> es gibt Überlegungen, die Hafenanlagen in Beddingen zu<br />
erweitern. Gemäß der Binnenschifffahrtsstraßenordnung dürfen heute Schiffe bis 9,60 m Breite mit 2,80 m Abladung <strong>und</strong> Schiffe<br />
bis 11,45 m mit 2,50 m Abladung auf dem SKS verkehren. Das Ausbauziel (<strong>Wasser</strong>straßenklasse Vb) ist somit bisher nicht<br />
erreicht.<br />
Bestehender Ausbauzustand<br />
Der Teilausbau des SKS in seinen jetzigen Abmessungen wurde bereits Ende der 70er Jahre ausgeführt. Der damalige Ausbau<br />
erfolgte für das Europaschiff mit einer Breite von 9,50 m <strong>und</strong> 2,50 m Abladung. Mit dem 2. Nachtrag zum Rahmenentwurf für<br />
den Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals einschließlich seiner Stichkanäle vom 31.08.1991 wurde das Ausbauziel geändert. Als Bemessungsfahrzeuge<br />
wurden nunmehr das GMS bzw. der Schubverband mit 11,45 m Breite <strong>und</strong> 2,80 m Abladung zugr<strong>und</strong>e<br />
gelegt. Der Ausbau des SKS oberhalb der Schleuse Wedtlenstedt ist für ein voll abgeladenes GMS bzw. einen Schubverband<br />
aufgr<strong>und</strong> der unzureichenden <strong>Wasser</strong>tiefe nicht ausreichend. In den Vorhäfen ist derzeit nur eine <strong>Wasser</strong>tiefe von 3,30 m, <strong>und</strong><br />
in den Streckenbereichen ist noch das alte Muldenprofil mit einer max. <strong>Wasser</strong>tiefe von 3,80 m <strong>und</strong> einer <strong>Wasser</strong>spiegelbreite<br />
von 38,50 m vorhanden.<br />
In der Haltung Wedtlenstedt sind zudem bis zu 60 cm Sunk <strong>und</strong> bis zu 30 cm Schwall gemessen worden. Diese erheblichen<br />
Werte sind auf die „großen Schleusen ohne Sparbecken“, die kurze Haltung, die Überlagerung von Wellen <strong>und</strong> den kleinen<br />
Kanalquerschnitt zurückzuführen.<br />
Mit dem Teilausbau erfolgte die Anpassung der Brücken an die Durchfahrtshöhe von 5,25 m über dem Normalwasserstand.<br />
Eine erforderliche <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung sowie Schwall wurden jedoch bei den damaligen Planungen nicht bzw. nicht ausreichend<br />
berücksichtigt. Die Ostkammern der Schleusen Wedtlenstedt <strong>und</strong> Üfingen wurden saniert <strong>und</strong> für die größere Durchfahrtshöhe<br />
<strong>und</strong> größere Abladetiefe umgebaut. Eine für die <strong>Wasser</strong>straßenklasse Vb ausreichende <strong>Wasser</strong>- bzw. Drempeltiefe<br />
ist auch nach dem Umbau nicht vorhanden. Da die Schleusen keine Sparbecken haben, werden bei jeder Schleusung r<strong>und</strong><br />
25.000 m³ <strong>Wasser</strong> in die untere Haltung abgegeben, was den <strong>Wasser</strong>spiegel in der r<strong>und</strong> 6 km langen Haltung Wedtlenstedt um<br />
ca. 10 cm absinken bzw. ansteigen lässt. Das Verlustwasser der beiden Schleusen muss daher ständig zurück gepumpt werden.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der besonderen rechtlichen Gegebenheiten vom Bau des SKS werden die Stromkosten vom Rechtsnachfolger<br />
der „Reichswerke“ (heute: Stahlwerke Peine - Salzgitter AG) getragen.<br />
Erste Planungen<br />
Für die Ermittlung des erforderlichen Mindestquerschnitts an Stichkanälen wurde eine Versuchsfahrt mit einem 2,80 m abgeladenem<br />
GMS auf dem SKS durchgeführt. Nach vorläufiger Auswertung der Messfahrt <strong>und</strong> unter Berücksichtigung der Sicherheit<br />
<strong>und</strong> Leichtigkeit des Schiffsverkehrs ist ein Ausbau des SKS in den vorhandenen Abmessungen als T-Profil möglich.<br />
Zurzeit ist nur ein Lichtraumprofil von 5,25 m über dem Normalwasserstand vorhanden. Nach den heute geltenden Ausbaurichtlinien<br />
müssen bei den Ausbauplanungen auch die <strong>Wasser</strong>bewirtschaftung sowie Schwall <strong>und</strong> Sunk berücksichtigt werden. Eine<br />
weitere Brückenanhebung ist aufgr<strong>und</strong> der bereits erfolgten Brückenanpassung schwierig. Im Rahmen der Planungen wurde<br />
die B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau (BAW) beauftragt, ein numerisches Modell für Schwall <strong>und</strong> Sunk zu erstellen <strong>und</strong> Möglichkeiten<br />
zur Minimierung zu untersuchen. Es ist davon auszugehen, dass durch die Verringerung des Durchflusses (Verlängerung<br />
der Schleusungszeit) <strong>und</strong> die gezielte Steuerung der Schleusen Wedtlenstedt <strong>und</strong> Üfingen Schwall <strong>und</strong> Sunk reduziert werden<br />
kann.<br />
Der Fahrversuch am SKS belegt auch, dass trotz der geringen Schleusenbreite <strong>und</strong> -tiefe eine Schleusung mit einem voll abgeladenen<br />
GMS beim derzeitigen Normalwasserstand noch möglich ist. Die Schleusenein- <strong>und</strong> Schleusenausfahrt dauert jedoch<br />
sehr lange <strong>und</strong> ist mit erheblichen Einschränkungen verb<strong>und</strong>en. Die Leichtigkeit ist für Schiffe mit 11,45 m Breite <strong>und</strong> 2,80 m<br />
Abladung nicht mehr gegeben.
Nachrichten<br />
<strong>Mitte</strong>lfristig ist eine Sanierung, ein Umbau oder ggf. ein Neubau der Schleusen erforderlich. Da eine Sanierung der Ostkammern<br />
keinen ausreichenden Ausbaustandard darstellt, hat das WSA Braunschweig eine Machbarkeitsstudie für den Umbau der<br />
Westkammern an ein Ing.-Büro vergeben. Die Machbarkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass ein Umbau der Schleusen mit<br />
Verbreiterung <strong>und</strong> Vertiefung der Kammern entsprechend den heute geltenden Ausbaurichtlinien gr<strong>und</strong>sätzlich möglich wäre.<br />
Dieser Variante ist der Ersatz der Westkammern durch Neubauten gegenüber zu stellen.<br />
Ausblick<br />
Mit den weiteren Planungen für den Streckenausbau des SKS wurde das WNA Helmstedt beauftragt. Die Ergebnisse der<br />
Schwall- <strong>und</strong> Sunkuntersuchungen sowie die erforderlichen Mindestquerschnitte haben erhebliche Auswirkungen auf mögliche<br />
Ausbaumaßnahmen. Die Ergebnisse der Untersuchungen müssen vorliegen, damit die gr<strong>und</strong>legenden Randbedingungen für<br />
den Ausbau geklärt sind. Erst dann können weitere Entscheidungen zur Ausbauplanung getroffen werden. Die Randbedingungen<br />
für den Streckenausbau haben auch Auswirkungen auf die weiteren Entscheidungen für die Sanierung/den Neubau der<br />
Schleusen. Die erforderlichen Maßnahmen an den Schleusen werden unter der Federführung des NBA Hannover realisiert<br />
werden. Neben dem Stichkanal nach Hildesheim (SKH) soll vorrangig der SKS für die <strong>Wasser</strong>straßenklasse Vb ausgebaut<br />
werden. Nach Herstellung der rechtlichen Voraussetzungen sowie der erforderlichen Planungen soll mit dem Ausbau begonnen<br />
werden. Der Ausbau des SKS ist erforderlich, um Schiffen bis 11,45 m Breite <strong>und</strong> 2,80 m Abladung die Fahrt auf dem SKS<br />
sicher <strong>und</strong> leicht zu ermöglichen.<br />
�Die Bifurkation der Hase <strong>und</strong> der Else in Melle-Gesmold<br />
Bei einer Bifurkation handelt es sich um die natürliche Teilung eines Flusses aufgr<strong>und</strong> der landschaftlichen Gegebenheiten in<br />
zwei eigenständige <strong>Wasser</strong>läufe.<br />
Eines dieser seltenen<br />
Naturphänomene finden wir in<br />
Südamerika. Bereits Alexander<br />
von Humboldt (1769 bis<br />
1859), Naturforscher <strong>und</strong><br />
Begründer der physikalischen<br />
Geografie, erforschte auf<br />
seiner Südamerikareise von<br />
1799 bis 1804 unter anderem<br />
die Bifurkation am Orinoco in<br />
Venezuela. Aus dem 3500 km<br />
langen Orinoco zweigt der<br />
Casiquiare mit einer Länge<br />
von 1500 km ab. Im Orinoco<br />
verbleiben 75 % des <strong>Wasser</strong>s,<br />
25 % fließen in den<br />
Casiquiare. Im weiteren Verlauf<br />
fließt das <strong>Wasser</strong> des<br />
Orinoco in den Atlantischen<br />
Ozean, das <strong>Wasser</strong> des<br />
Casiquiare fließt über den Rio<br />
Negro <strong>und</strong> den Amazonas<br />
ebenfalls in den Atlantischen<br />
Ozean.<br />
Bifurkation der Hase <strong>und</strong> Else<br />
Uns ist in Deutschland nur die<br />
Bifurkation von Hase <strong>und</strong> Else<br />
bekannt. Die Hase entspringt in Melle-Wellingholzhausen in einem Quertal des Teutoburger Waldes. Sie fließt in Richtung<br />
Nordwesten durch Osnabrück, kreuzt den <strong>Mitte</strong>llandkanal bei Bramsche in einem großen Dükerbauwerk <strong>und</strong> mündet nach<br />
168 km Lauflänge in Meppen in die Ems. An der Bifurkation in Melle-Gesmold zweigt die Else von der Hase ab, wobei ca. 70 %<br />
des <strong>Wasser</strong>s in der Hase verbleibt. Etwa 30 % des Hasewassers fließt in die Else, die nach 47 km Lauflänge bei Löhne in die<br />
Werre mündet. Die Werre selbst entspringt bei Detmold im Teutoburger Wald, entwässert den Raum Ostwestfalen <strong>und</strong> mündet<br />
bei Bad Oeynhausen in die Weser. Über Hase, Else <strong>und</strong> Werre sind die Flussgebiete von Ems <strong>und</strong> Weser damit verb<strong>und</strong>en.<br />
Ein Fahrradweg, der Else-Werre-Radweg, führt von der Bifurkation entlang der Else <strong>und</strong> der Werre bis zur Weser <strong>und</strong> verbindet<br />
damit den Weserradweg mit der Hase-Ems-Tour. Fahrradtouristen können die Bifurkation über den nahegelegenen Bahnhof<br />
Melle-Westerhausen mit der Deutschen Bahn (Stadtexpress-Halt) erreichen. Mit dem Auto ist die Bifurkation über die Autobahn<br />
A30, Abfahrt Gesmold (in Richtung Gesmold fahren, dann der Beschilderung folgen) zu erreichen. <strong>Informationen</strong> zur Bifurkation<br />
gibt es im Internet unter www.bifurkation.de <strong>und</strong> www.melle-geschichte.de.<br />
Sollte ein Leser dieser Informationsschrift eine Bifurkation an einem anderen Ort in Deutschland kennen, wäre die Redaktion für<br />
einen Hinweis dankbar.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Uwe Borges<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Allgemein<br />
Das Ziel der Bauwerksinspektion ist das rechtzeitige Erkennen<br />
von Schäden an den Bauwerken der WSV zur<br />
Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer sowie zur<br />
Vermeidung aufwändiger Instandsetzungsmaßnahmen <strong>und</strong><br />
Nutzungseinschränkungen. Damit ist die regelmäßige <strong>und</strong><br />
qualifizierte Prüfung Ausgangspunkt für die Unterhaltung.<br />
Mit dem Programm WSVPruf steht ein leistungsfähiges<br />
IT-Werkzeug zur Unterstützung der Bauwerksinspektion zur<br />
Verfügung. Gegen Ende des Jahres 2006 wurde WSVPruf<br />
per Erlass eingeführt <strong>und</strong> es wird nach den umfangreichen<br />
Schulungen Anfang <strong>2007</strong> in den <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämtern<br />
eingesetzt. Es ist vorgesehen, dass nach 6 Jahren,<br />
also dem typischen Zyklus für Prüfungen, alle maßgeblichen<br />
Bauwerke in dem System abgebildet sind.<br />
Was leistet WSVPruf ?<br />
Die Leistung des Programmsystems reicht<br />
von der Erfassung der Anlage über die<br />
Erstellung der Aufgabenblätter <strong>und</strong> die<br />
Terminplanung bis hin zur Dokumentation<br />
der Inspektionsergebnisse sowie der Erstellung<br />
eines Zustandsberichtes.<br />
Gegenüber der bisherigen Vorgehensweise<br />
bietet die IT-gestützte Abwicklung folgende<br />
Vorteile:<br />
• Einfache Erstellung von Berichten der<br />
Bauwerksprüfung <strong>und</strong> Überwachung<br />
mit Fotos <strong>und</strong> Prüfnote in einheitlicher<br />
Form<br />
• Einfache Planung der zukünftigen<br />
Prüfungen <strong>und</strong> Überwachungen im Inspektionsmanagement<br />
• Bearbeitung <strong>und</strong> Speicherung der<br />
Aufgabenblätter im System<br />
• Verfolgung der Schäden über mehrere<br />
Inspektionen hinweg<br />
• Erfassung von Instandsetzungsmaßnahmen<br />
• Erzeugung aktueller Zustandsberichte<br />
über gesamte Anlagen oder Anlagenbereiche<br />
mit Zustandsnoten.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Neue Software<br />
für die Bauwerksinspektion – WSVPruf<br />
Zentrales Bedienfeld von WSVPruf<br />
• Digitale Abbildung der erforderlichen Unterlagen, dadurch<br />
ergibt sich eine hohe Verfügbarkeit <strong>und</strong> Anpassungen<br />
sind leicht möglich.<br />
• Einsichtnahme in die Unterlagen von verschiedenen<br />
Standorten.<br />
Die Software wird in einer zentralen Installation über das<br />
Intranet der WSV genutzt. Dies ermöglicht eine leichtere<br />
Wartung der Software sowie einfache Datensicherung <strong>und</strong><br />
vermeidet darüber hinaus eine red<strong>und</strong>ante Datenhaltung.<br />
Es handelt sich um ein Java Programm, welches als Anwendung<br />
die Daten in einer Oracle Datenbank bearbeitet<br />
<strong>und</strong> verwaltet. Die Datenbank läuft auf leistungsfähigen<br />
LINUX - Servern bei der FIT in Ilmenau. Durch die Leistungsfähigkeit<br />
der heutigen Datenfernübertragungen ist ein<br />
flüssiges Arbeiten über die Netzwerkverbindung möglich,<br />
wobei auch eine Offline – Version zur Verfügung steht, die<br />
Arbeiten ohne Netzanbindung erlaubt.
Die Dokumentation von Schäden <strong>und</strong> die Zusammenfassung<br />
in Berichten ist die Hauptaufgabe des Programms.<br />
Neu ist, dass dabei zukünftig auch für jedes Bauwerk eine<br />
Prüfnote, die sich auf die Tragfähigkeit <strong>und</strong> Gebrauchstauglichkeit<br />
bezieht, erzeugt wird. Die Verkehrssicherheit wird<br />
im Begriff der Gebrauchstauglichkeit mit umfasst.<br />
Basis für die Bewertungen der einzelnen Schäden, die mit<br />
einem Algorithmus zu einer einzelnen Note zusammengefasst<br />
werden, ist das Merkblatt „Schadensklassifizierungen<br />
an Verkehrswasserbauwerken“. Dieses soll unter anderem<br />
gewährleisten, dass Einschätzungen von Schäden durch<br />
die Prüfer <strong>und</strong> Überwacher in allen <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsämtern<br />
nach gleichen Maßstäben erfolgen, <strong>und</strong> deshalb<br />
auch die Gesamtnote des Bauwerks über alle Ämter<br />
hinweg weitgehend vergleichbar ist.<br />
Das Programm WSVPruf integriert sich an verschiedenen<br />
Stellen in die Abläufe der Unterhaltung von Verkehrswasserbauwerken.<br />
Die Funktionalität der Software zielt nicht<br />
nur auf die Generierung von Prüf- <strong>und</strong> Mängelberichte,<br />
sondern integriert auch die Terminplanung, das sogenannte<br />
Inspektionsmanagement. Im gleichfalls enthaltenen Modul<br />
„Schadenmanagement“ können zwischen den Terminen<br />
der Überwachungen <strong>und</strong> Prüfungen die Bewertungen der<br />
einzelnen Schäden (zum Beispiel aufgr<strong>und</strong> von Instandsetzungen)<br />
korrigiert <strong>und</strong> wiederum in einem sogenannten<br />
Zustandsbericht dokumentiert werden. Dieser fasst dann<br />
alle zu diesem Zeitpunkt aktuellen Schäden des Bauwerkes<br />
aus der Datenbank zusammen <strong>und</strong> ist somit auch Basis für<br />
die nächste Prüfung oder Überwachung.<br />
Einbindung in den Ablauf der Unterhaltung<br />
Neue Software für die Bauwerksinspektion – WSVPruf<br />
Aufgr<strong>und</strong> der zentralen Datenhaltung <strong>und</strong> des Rechte- <strong>und</strong><br />
Rollenkonzeptes können verschiedene Mitarbeiter mit dem<br />
Programm arbeiten <strong>und</strong> jeweils die für sie vorgesehenen<br />
Aufgaben ausführen. Beispielsweise korrigiert der zuständige<br />
Ingenieur im <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt aufgr<strong>und</strong><br />
von Korrosionsschutzarbeiten eine Schadensbewertung.<br />
Der Amtsleiter hingegen möchte sich über den Zustand<br />
aller Stahlwasserbauteile der Schleusen des Amtes informieren<br />
<strong>und</strong> erstellt sich zu diesem Zweck einen aktuellen<br />
Zustandsbericht.<br />
Nach wie vor ist die ausgedruckte Fassung der Berichte mit<br />
den notwendigen Unterschriften die endgültige <strong>und</strong> verbindliche<br />
Fassung der Dokumentation. Dies soll einen „aktenfesten“<br />
Nachweis der Bauwerksinspektion gewährleisten,<br />
unabhängig von der sehr hohen Verfügbarkeit <strong>und</strong> Ausfallsicherheit<br />
der IT-Anlagen. Wenngleich WSVPruf nicht das<br />
Ziel des „Büros ohne Papier“ umsetzt, ist geplant, dass die<br />
Berichte parallel <strong>und</strong> automatisch in die Digitale Schriftgutverwaltung<br />
(Digitale Verwaltung technischer Unterlagen –<br />
DvtU) überführt werden.<br />
Die Betreuung der Anwender <strong>und</strong> der Software erfolgt<br />
durch die jeweiligen Verfahrensbetreuer in jeder Direktion.<br />
Neben dem Ansprechpartner in jedem Amt stehen sie zur<br />
Unterstützungen bei Fragen <strong>und</strong> Problemen zur Verfügung.<br />
Aussicht<br />
Langfristig erlaubt die digitale Sammlung der Schäden in<br />
der Datenbank auch eine Auswertung der Schadensprozesse<br />
sowie die Erstellung von Prognosen für die Wirksamkeit<br />
von geplanten Maßnahmen. Dieses sogenannte Erhaltungsmanagementsystem<br />
(EMS) wird derzeit in der BAW<br />
konzipiert.<br />
WSVPruf ist schon jetzt<br />
ein leistungsfähiges System,<br />
welches die Abläufe<br />
<strong>und</strong> Maßnahmen der<br />
Bauwerksinspektion unterstützt<br />
<strong>und</strong> sich nahtlos<br />
in die Aufgabe der Unterhaltung<br />
unserer Verkehrswasserbauwerke<br />
einfügt.<br />
Zu erwarten ist, dass sich<br />
auf Gr<strong>und</strong>lage eines solchen<br />
transparenten Systems<br />
der Investitionsbedarf<br />
leichter ermitteln <strong>und</strong><br />
insbesondere vertreten<br />
lässt. Insoweit ist<br />
WSVPruf zukünftig für die<br />
gesamte technische Programmplanung<br />
ein bedeutsames<br />
Instrument zur<br />
Unterstützung der Aufgabenerledigung.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
������ �� �� ��<br />
Thilo Wachholz<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Dirk Biskupek<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Der Stichkanal nach Osnabrück (SKO) wird für den Richtungsverkehr<br />
mit Großmotorgüterschiffen (GMS) ausgebaut.<br />
Im Zuge der Baumaßnahmen sind auch die den SKO<br />
querenden Brücken an die neue <strong>Wasser</strong>spiegelbreite <strong>und</strong><br />
an die erforderliche Durchfahrtshöhe von 5,25 m über dem<br />
oberen Betriebswasserstand (BWo) anzupassen. An den<br />
zwei folgenden Beispielen wird gezeigt, dass es hierfür<br />
keine „Standardlösung“ gibt <strong>und</strong> nur eine Einzelfallbetrachtung<br />
zu sinnvollen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Ergebnissen führt.<br />
Abb. 1: Lage Brücke Nr. 75<br />
Brücke Nr. 75, SKO-km 4,873<br />
Bestehende Situation<br />
Die Brücke Nr. 75 (Abb. 1 <strong>und</strong> 2) überführt einen Wirtschaftsweg,<br />
der landwirtschaftliche Flächen erschließt im<br />
Bereich der Gemeinde Wallenhorst über den SKO. Ihre<br />
Nutzbreite setzt sich aus einer Fahrbahn mit einer Breite<br />
von 2,90 m sowie zwei je 40 cm breiten Hochborden zusammen.<br />
Sie ist für eine Tragfähigkeit von 9 t nach DIN<br />
1072 eingestuft. Die benachbarten Brücken Nr. 74 <strong>und</strong> Nr.<br />
76 liegen in Kanalachse ca. 900 m bzw. 1,2 km entfernt. Da<br />
heute übliche landwirtschaftliche Fahrzeuge wie Mähdrescher<br />
oder Feldhäcksler 3,00 m, in Ausnahmefällen sogar<br />
bis 3,80 m breit sind, schränkt die bestehende Fahrbahnbreite<br />
gerade wesentliche Nutzer der Brücke ein.<br />
Die Gemeinde Wallenhorst als Baulastträger des Wirtschaftsweges<br />
forderte daher im zwischen 1996 <strong>und</strong> 1999<br />
Änderung von Brücken<br />
am Stichkanal nach<br />
Osnabrück<br />
durchgeführten Planfeststellungsverfahren zum Ausbau des<br />
SKO zwischen SKO-km 2,50 <strong>und</strong> 6,15 sowie zwischen<br />
SKO-km 8,90 <strong>und</strong> 11,54 die Verbreiterung der Fahrbahn<br />
auf der Brücke Nr. 75, lehnte aber gleichzeitig die dann<br />
gesetzlich vorgeschriebene Kostenbeteiligung der Gemeinde<br />
am Brückenneubau ab. Der Planfeststellungsbeschluss<br />
vom 15.02.1999 sah daher den Neubau der Brücke mit der<br />
vorhandenen Fahrbahnbreite vor.<br />
Versuch der Optimierung<br />
Beginnend mit dem Jahr 2002 erfolgten in den Dienststellen<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> neue Überlegungen zur Optimierung der<br />
Brücken im Bereich der Gemeinde Wallenhorst.<br />
Mehrere Gründe waren dafür ausschlaggebend.<br />
Nach der Fertigstellung der Brücke Nr. 73, die auch mit der<br />
vorhandenen Fahrbahnbreite von 2,90 m neu gebaut wurde,<br />
kam es an dieser Brücke zu einer Demonstration mit<br />
landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Es wurde sehr öffentlichkeitswirksam<br />
dargestellt, dass die Fahrbahn der neuen<br />
Brücke für den modernen landwirtschaftlichen Verkehr<br />
teilweise zu schmal ist. Dieser nicht optimale Brückenneubau<br />
wurde der WSV angelastet, obwohl auch hier die Gemeinde<br />
die gesetzlich vorgeschriebene Kostenbeteiligung<br />
für eine Verbreiterung abgelehnt hatte.<br />
Die Brücke Nr. 76, die die Landesstraße L 109 überführt,<br />
konnte auf Gr<strong>und</strong>lage der aktuellen Gesetzgebung nicht mit<br />
einer für den heutigen Verkehr optimierten Nutzbreite durch<br />
die WSV neu gebaut werden. Sie besitzt eine Fahrbahnbreite<br />
von 5,50 m, die keinen Begegnungsverkehr von<br />
Lastkraftwagen zulässt sowie lediglich Notgehwege.<br />
Zudem erschien der Verkehr über die Brücke Nr. 75 sehr<br />
Abb. 2: Bestand Brücke Nr. 75
gering. Daher wurde in Abstimmung mit dem damaligen<br />
BMVBW <strong>und</strong> der Verwaltung der Gemeinde Wallenhorst<br />
folgende Lösung entwickelt:<br />
• die Brücke Nr. 75 wird ersatzlos abgerissen <strong>und</strong><br />
• die Brücke Nr. 76 wird um einen Geh- <strong>und</strong> Radweg<br />
nachträglich verbreitert.<br />
Dadurch kann auch die Fahrbahn auf der Brücke verbreitert<br />
werden. Der Umbau der Brücke Nr. 76 wird durch die beim<br />
Entfall der Brücke Nr. 75 eingesparten <strong>Mitte</strong>l finanziert.<br />
Diese Lösung wurde auch durch den B<strong>und</strong> der Steuerzahler<br />
unterstützt.<br />
Leider fand diese zweckmäßige <strong>und</strong> wirtschaftliche Lösung<br />
keine Mehrheit im Rat der Gemeinde Wallenhorst. Dieser<br />
forderte im Februar 2005 den planfestgestellten <strong>und</strong> damit<br />
rechtlich abgesicherten Neubau der Brücke Nr. 75 zu verwirklichen,<br />
obwohl dann ein Teil des landwirtschaftlichen<br />
Verkehrs die Brücke nicht passieren kann. Zudem wurde<br />
die Möglichkeit verpasst, die Brücke Nr. 76 zu optimieren.<br />
Gef<strong>und</strong>ene Lösung<br />
Was nun? Einerseits gab es einen geltenden Planfeststellungsbeschluss,<br />
andererseits war es nur schwer zu verantworten,<br />
öffentliche Gelder für den Bau einer für ihren Zweck<br />
nicht vollständig geeigneten Brücke zu verwenden.<br />
Zwei Lösungen standen aus Sicht der WSV zur Diskussion:<br />
1. Der Verkehr über die Brücke Nr. 75 ist so gering, dass<br />
der Neubau der Brücke unwirtschaftlich ist. Das hieße<br />
Entfall der Brücke.<br />
2. Es ist ein Verkehr zu erwarten, der den Neubau der<br />
Brücke Nr. 75 rechtfertigt. Die Brücke wird mit einem<br />
dem Verkehr entsprechenden Querschnitt errichtet.<br />
Eine Entscheidung für eine der Lösungen konnte nur auf<br />
Gr<strong>und</strong>lage der detaillierten Kenntnis des derzeitigen <strong>und</strong> zu<br />
erwartenden Verkehrs über die Brücke erfolgen. Hierfür<br />
wurde durch das NBA Hannover ein verkehrliches Gutachten<br />
in Auftrag gegeben. Durch den Gutachter wurde über<br />
einen repräsentativen Zeitraum die Menge <strong>und</strong> die Art des<br />
derzeitigen <strong>und</strong> des zu erwartenden Verkehrs über die<br />
Brücke mittels Zählungen <strong>und</strong> Befragungen erfasst, ausgewertet<br />
<strong>und</strong> auf dieser Basis eine Nutzen-Kosten-Analyse für<br />
den Neubau der Brücke erstellt.<br />
Das Ergebnis war eindeutig <strong>und</strong> bestätigte die Auffassung<br />
der WSV: Für den Neubau der Brücke Nr. 75 ergab sich ein<br />
Nutzen-Kosten-Verhältnis von nur 0,3! Das heißt, der Verkehr<br />
über die Brücke Nr. 75 muss sich mehr als verdreifachen,<br />
damit ein Neubau wirtschaftlich wird. Zudem bestätigte<br />
das Gutachten, dass bei Entfall der Brücke Nr. 75 der<br />
Verkehr problemlos die benachbarten Brücken nutzen<br />
kann.<br />
Auf Basis dieses Gutachtens wurde entschieden, eine<br />
Planänderung zum Entfall der Brücke Nr. 75 zu beantragen.<br />
Das Verfahren wird voraussichtlich <strong>2008</strong> durchgeführt.<br />
Brücke Nr. 79, SKO-km 10,722<br />
Bestehende Situation<br />
Die Brücke Nr. 79 (Abb. 3) überführt eine Gemeindestraße<br />
am Rand der Stadt Osnabrück. In diesem Bereich liegt der<br />
Änderung von Brücken am Stichkanal nach Osnabrück<br />
SKO in einem Einschnitt, so dass hier im Gegensatz zu<br />
anderen Kanalbrücken ein wesentlich größerer Abstand<br />
zwischen dem Kanalwasserspiegel <strong>und</strong> der Gradiente der<br />
Straße vorhanden ist.<br />
Die bestehende Brücke ist daher als Deckbrücke, das heißt<br />
mit einer über der tragenden Konstruktion liegenden Fahrbahn<br />
in Stahl ausgeführt worden. Sie besitzt eine Spannweite<br />
von 34,40 m <strong>und</strong> eine Durchfahrtshöhe für die Schifffahrt<br />
von 4,00 m.<br />
Variantenuntersuchung<br />
Für den Ausbau des SKO muss die Brücke mit einer<br />
Spannweite von ca. 53 m neu errichtet werden. Die Gradiente<br />
der Straße wird zur Ausführung eines gleichmäßigen<br />
Gefälles um ca. 30 cm gegenüber dem Bestand angehoben.<br />
Somit steht im Bereich des für die Schifffahrt freizuhaltenden<br />
Lichtraumprofils eine maximale Bauhöhe von<br />
2,35 m für den Überbau der neuen Brücke zur Verfügung.<br />
Abb. 3: Bestand Brücke Nr. 79<br />
Eine Brücke ist so zu entwerfen, dass sie auf Gr<strong>und</strong>lage<br />
der örtlichen Gegebenheiten eine wirtschaftliche <strong>und</strong> sichere<br />
Herstellung <strong>und</strong> spätere Unterhaltung <strong>und</strong> Erhaltung<br />
gewährleistet, ausreichend robust ist <strong>und</strong> in gestalterischer<br />
Hinsicht der Verantwortung des Bauherrn für die Gestaltung<br />
der Umwelt gerecht wird.<br />
Da hier nicht ohne weitere Gr<strong>und</strong>lagen klar war, welche Art<br />
der Konstruktion diesen Ansprüchen am besten genügen<br />
würde, beauftragte das NBA Hannover dazu eine Variantenuntersuchung.<br />
In ihr wurden die unter den örtlichen<br />
Gegebenheiten sinnvoll erscheinenden Konstruktionen<br />
dargestellt, die Bauweise beschrieben <strong>und</strong> die Kosten für<br />
die Herstellung <strong>und</strong> spätere Unterhaltung berechnet. Die<br />
Varianten wurden dann mit Hilfe folgender gewichteter<br />
Kriterien bewertet:<br />
• Herstellkosten,<br />
• Unterhaltungsaufwand,<br />
• Beeinträchtigung der Schifffahrt während der Herstellung<br />
(Bauzeit),<br />
• Einschränkung für den Kanalausbau.<br />
Zwei Konstruktionsvarianten stellten danach die besten<br />
Lösungen dar: ein Spannbetonrahmen <strong>und</strong> ein Rahmen als<br />
Verb<strong>und</strong>konstruktion.<br />
Sie sind wirtschaftlich herstellbar, minimieren durch den<br />
Verzicht auf Lager <strong>und</strong> damit auch auf Übergangskonstruktionen<br />
den Unterhaltungsaufwand <strong>und</strong> stellen sehr elegante<br />
Konstruktionen dar.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Entwurf<br />
Als Gr<strong>und</strong>lage für den Entwurf-AU wurde der Spannbetonrahmen<br />
gewählt. Er besitzt letztendlich Vorteile in der Unterhaltung,<br />
die gegenüber seinen Nachteilen <strong>und</strong> Risiken<br />
bei der Herstellung durch das notwendige Lehrgerüst als<br />
bedeutender angesehen wurden.<br />
Der Rahmen wird als einstegiger Plattenbalken geplant. Die<br />
Unterkante des Riegels ist in Längsrichtung als Kreisbogen<br />
gevoutet, was dem Schnittkraftverlauf eines Rahmens<br />
entspricht <strong>und</strong> zur Eleganz des Entwurfs beiträgt. Hier<br />
bewahrheitet sich die alte Regel des Ingenieurbaus: Eine<br />
im statischen Sinne gute <strong>und</strong> saubere Konstruktion sieht<br />
in den meisten Fällen auch ansprechend aus.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Änderung von Brücken am Stichkanal nach Osnabrück<br />
Abb. 4: Entwurf Querschnitt Überbau Brücke Nr. 79 neu<br />
Abb. 5: Entwurf Ansicht Brücke Nr. 79 neu<br />
Neben dem Verzicht auf Lager <strong>und</strong> Übergangskonstruktionen<br />
ist die Verwendung nur eines Materials für die Unterhaltung<br />
<strong>und</strong> Lebensdauer von Vorteil. Es entfallen so die für<br />
die Dauerhaftigkeit problematischen Schnittstellen zwischen<br />
Beton <strong>und</strong> Stahl bei einer Verb<strong>und</strong>brücke sowie der<br />
Korrosionsschutz.<br />
Zur weiteren Steigerung der Unterhaltungsfre<strong>und</strong>lichkeit<br />
<strong>und</strong> Lebensdauer werden im Querschnitt liegende Spannglieder<br />
ohne Verb<strong>und</strong> verwendet. Durch die an beiden<br />
Rahmenstielen bzw. Widerlagern angeordneten Wartungsräume<br />
lassen sich so über die gesamte Lebensdauer die<br />
Spannglieder kontrollieren, nachspannen oder einzeln<br />
austauschen. Die Spannglieder werden mit eigenem Korrosionsschutz<br />
geliefert <strong>und</strong> eingebaut (Abb. 4).<br />
Dieser Entwurf stellt eine innovative, wirtschaftliche <strong>und</strong><br />
unterhaltungsfre<strong>und</strong>liche Konstruktion dar.<br />
Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen erstellt. Der<br />
Bau der Brücke (Abb. 5) soll im Frühjahr <strong>2008</strong> beginnen.
Dr. Manuela Osterthun<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Neue Wege bei der Realisierung der <strong>Mitte</strong>lweseranpassung<br />
in Zusammenarbeit mit dem Finanzierungspartner Freie<br />
Hansestadt Bremen ermöglichten <strong>2007</strong> die Deckung von<br />
Personalengpässen in der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
<strong>und</strong> gaben dem Projekt neuen Schwung.<br />
Abgeschlossene Maßnahmen<br />
Die <strong>Mitte</strong>lweser zwischen Minden <strong>und</strong> Bremen Hemelingen<br />
besteht - stromabwärts - aus den sieben Staustufen<br />
Petershagen, Schlüsselburg, Landesbergen, Drakenburg,<br />
Dörverden, Langwedel <strong>und</strong> Bremen-Hemelingen.<br />
Die Stauregelung der <strong>Mitte</strong>lweser begann bereits 1911 <strong>und</strong><br />
dauerte bis 1960. Die Baumaßnahmen wurden von 1942<br />
bis 1952 kriegsbedingt unterbrochen. Nach dem Bau des<br />
Weserwehres Dörverden zur Bewässerung von landwirtschaftlichen<br />
Flächen <strong>und</strong> zur energetischen Versorgung<br />
des Hauptpumpwerks Minden am neuerrichteten <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
(MLK) wurde in den dreißiger Jahren mit der<br />
Stauregelung der <strong>Mitte</strong>lweser begonnen. Ziel war die Herstellung<br />
von 2,50 m Fahrwassertiefe unter hydrostatischem<br />
Stau.<br />
Abb. 1: Binnenschiff im Schleusenkanal der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser<br />
Realisierung der<br />
<strong>Mitte</strong>lweseranpassung mit<br />
Unterstützung der<br />
Freien Hansestadt Bremen<br />
Dörthe Eichler<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Auch in den Folgejahren mussten die Veränderungen der<br />
Schiffsgrößen <strong>und</strong> des gestiegenen Transportaufkommens<br />
zur Förderung des Schiffsverkehrs auf der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wurden<br />
1989 für die Stauhaltung Petershagen <strong>und</strong> 1991 für die<br />
Haltungen Schlüsselburg <strong>und</strong> Landesbergen entsprechende<br />
Planfeststellungsbeschlüsse bestandskräftig, auf deren<br />
Basis die Haltungen für 2,50 m abgeladene Europaschiffe<br />
(ES 1350 t) bis auf Restmaßnahmen ausgebaut wurden<br />
(Abb. 1).<br />
Die <strong>Mitte</strong>lweser kann nach der Binnenschifffahrtsstraßenordnung<br />
derzeit von Fahrzeugen <strong>und</strong> Schubverbänden mit<br />
einer Länge von 85 m bei einer Breite von 11,45 m bzw.<br />
einer Länge von 91 m <strong>und</strong> einer Breite von 8,25 m befahren<br />
werden.<br />
Geplante Maßnahmen<br />
Im Jahr 1999 wurde die Planfeststellung für die unteren vier<br />
Haltungen Drakenburg, Dörverden, Langwedel <strong>und</strong><br />
Hemelingen für den Ausbau für 2,50 m abgeladene ES <strong>und</strong><br />
den Verkehr von Großmotorgüterschiffen (GMS) mit Begegnungs-<br />
<strong>und</strong> Abladebeschränkungen beantragt. Der<br />
Planfeststellungsbeschluss erlangte aufgr<strong>und</strong> anstehender<br />
Klagen zunächst keine Rechtskraft <strong>und</strong> wurde erst am<br />
12.05.2005 bestandskräftig.<br />
Im Rahmen eines Gutachtens der B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau<br />
(BAW) konnte 2005 nachgewiesen werden, dass<br />
die bereits für das Europaschiff ausgebauten Haltungen<br />
Petershagen, Schlüsselburg <strong>und</strong> Landesbergen den Verkehr<br />
des 2,50 m abgeladenen GMS mit Begegnungseinschränkungen<br />
erlauben.<br />
Auf der Gesamtstrecke der <strong>Mitte</strong>lweser wird nach Abschluss<br />
der Anpassungsmaßnahmen darüber hinaus wasserstandsabhängig<br />
eine eingeschränkte Nutzbarkeit für das<br />
2,50 m abgeladenen übergroße Großmotorgüterschiff<br />
(üGMS) mit 135 m Länge möglich sein.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
25
�� �� �� ��<br />
Projektorganisation<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Realisierung der <strong>Mitte</strong>lweseranpassung mit Unterstützung der Freien Hansestadt Bremen<br />
Dem WSA Verden mit seinen spezifischen Revierkenntnissen<br />
wurden zur Erfüllung der anstehenden Anpassungsmaßnahmen<br />
2003 Personalressourcen befristet zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Da der Planfeststellungsbeschluss aufgr<strong>und</strong> anstehender<br />
Klagen zunächst keine Rechtskraft erlangte <strong>und</strong> die damalige<br />
Haushaltsmittelsituation des B<strong>und</strong>es einen unmittelbaren<br />
Projektbeginn nicht erlaubte, wurden weitere Personalressourcen<br />
anderen prioritären Neubauprojekten zugeordnet.<br />
Durch das steigende Transportaufkommen auf der Weser<br />
als Hinterlandanbindung der Bremer Häfen erhielten die<br />
Anpassungsarbeiten eine neue Dringlichkeit, die sich in<br />
dem Ziel widerspiegeln die <strong>Mitte</strong>lweser bis Ende 2012 auszubauen.<br />
Dazu mussten die personellen Randbedingungen deutlich<br />
verbessert werden, so dass das WSA Verden in die Lage<br />
versetzt werden konnte, die Arbeiten innerhalb der engen<br />
terminlichen Vorgaben auszuführen.<br />
2005 wurde in einem ersten Schritt beschlossen, im Rahmen<br />
einer Projektorganisation freie Personalkapazitäten<br />
<strong>und</strong> das Fachwissen benachbarter Ämter zu bündeln <strong>und</strong><br />
Abb. 2<br />
unter der Leitung eines Projektlenkungsausschusses <strong>und</strong><br />
der Projektleitung des WSA Verden mit den Arbeiten zu<br />
beginnen (Abb. 2).<br />
Insgesamt sind in die Projektstruktur drei WSÄ, zwei Neubauämter<br />
der WSV, zwei B<strong>und</strong>esanstalten, die Fachstelle<br />
der WSV für Verkehrstechnik (FVT), die Fachgruppe Telematik<br />
der <strong>Wasser</strong> <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion (<strong>WSD</strong>) Südwest<br />
<strong>und</strong> die Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong> (FMM) eingeb<strong>und</strong>en.<br />
Die Arbeit muss im Spannungsfeld verschiedener<br />
Interessen - konkurrierende Aufgaben in den Ämtern der<br />
Projektstruktur, politische Ebene - unter einem hohen Zeitdruck<br />
bewerkstelligt werden.<br />
Nach der Einrichtung der Teilprojektgruppen wurde schnell<br />
deutlich, dass die personelle Kapazität im WSA Verden für<br />
die verbleibenden technischen Planungsaufgaben sowie für<br />
die Wahrnehmung der Projektsteuerungsaufgaben nicht<br />
ausreichend war. Die knappen Personalressourcen im<br />
Geschäftsbereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>, die durch den Stellenabbau<br />
im öffentlichen Dienst geprägt sind, sowie die bereits<br />
erreichte Personalauslastung in den beteiligten Ämtern<br />
schlossen eine Besetzung bzw. die zusätzliche Schaffung<br />
von Stellen für die <strong>Mitte</strong>lweseranpassung von vornherein<br />
aus. Es mussten neue Personalressourcen erschlossen<br />
werden.
Regierungsabkommen mit der<br />
Freien Hansestadt Bremen<br />
chland<br />
<strong>und</strong> der freien Hansestadt Bremen die Anpassung der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser für die ganzjährige Befahrbarkeit mit 2,50 m<br />
abgeladenen 1350 t Schiffen beschlossen <strong>und</strong> mit dem<br />
Verwaltungsabkommen zwischen der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland <strong>und</strong> der Freien Hansestadt Bremen (FHB)<br />
über die Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser vom 17./26.10.1988<br />
fixiert. In der Ergänzung des Verwaltungsabkommens zwischen<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland <strong>und</strong> der Freien<br />
Hansestadt Bremen über die Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
vom 17.10.1997 wurde die Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser für<br />
das Großmotorgüterschiff (GMS) vereinbart. Die Kosten<br />
des Ausbaus werden zu 1/3 von der FHB <strong>und</strong> zu 2/3 vom<br />
B<strong>und</strong> getragen. Für die Abwicklung des Abkommens wurde<br />
eine Arbeitsgruppe gegründet. Bauprogramm <strong>und</strong> Finanzierungsplan<br />
werden im Rahmen der jährlichen Arbeitsgruppensitzungen<br />
der Finanzierungspartner einvernehmlich<br />
abgestimmt. Auf den Arbeitsgruppensitzungen wird über<br />
den Fortgang der Arbeiten berichtet <strong>und</strong> Probleme <strong>und</strong><br />
Engpässe werden aufgezeigt.<br />
Personalentsendung durch die<br />
FHB<br />
Im Rahmen der regelmäßigen Arbeitsgruppensitzungen<br />
wurde im September 2006 die personelle Unterstützung der<br />
Projektgruppe <strong>Mitte</strong>lweser durch das Land Bremen diskutiert<br />
<strong>und</strong> der Wille bek<strong>und</strong>et, im gegenseitigen Einvernehmen<br />
Bauleitungsaufgaben an die FHB zu übertragen. Die<br />
dabei entstehenden Kosten sollen auf den Finanzierungsanteil<br />
des Landes angerechnet werden.<br />
Die <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> wurde beauftragt, die Möglichkeit einer<br />
Personalentsendung zu prüfen <strong>und</strong> die rechtlichen Gr<strong>und</strong>lagen<br />
mit dem B<strong>und</strong>esministerium für Verkehr, Bau <strong>und</strong><br />
Stadtentwicklung (BMVBS) <strong>und</strong> mit der FHB abzustimmen.<br />
Mit Unterzeichnung der gemeinsamen Vereinbarung wurde<br />
im Dezember 2006 die personelle Unterstützung durch das<br />
Land Bremen schriftlich fixiert.<br />
Vereinbarung mit dem Land<br />
Bremen<br />
Wesentliche Randbedingungen<br />
die Vereinbarung der Unterstützung des B<strong>und</strong>es durch<br />
das Land mittels Entsendung von Personal <strong>und</strong> Übernahme<br />
von Planungsleistungen<br />
• die Anrechnung der Kosten für dieses Personal auf<br />
den Finanzierungsanteil des Landes<br />
• der Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung zwischen<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>und</strong> der FHB<br />
• die Kriterien zur Auswahl des Personals des Landes<br />
• die Vereinbarung von Qualitätsstandards<br />
• die Klärung der dienst- <strong>und</strong> arbeitsrechtlichen Beziehungen<br />
des zu entsendenden Bauleitpersonals<br />
• die Klärung von Haftungsfragen<br />
• das anzuwendende <strong>und</strong> geltende Regelwerk<br />
• die Regeln zur Beilegung von Streitigkeiten<br />
Realisierung der <strong>Mitte</strong>lweseranpassung mit Unterstützung der Freien Hansestadt Bremen<br />
Die Regelungen zur Berechnung des Finanzierungsanteiles<br />
(Finanzierungsvereinbarung) <strong>und</strong> die Modalitäten der Personalentsendung<br />
(Projektvereinbarungen) wurden detailliert<br />
in weiteren Vereinbarungen zwischen der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>und</strong><br />
der FHB geregelt.<br />
Finanzierungsvereinbarung<br />
Ziel war es, die Finanzierungsvereinbarung auf eine stabile<br />
rechtliche Gr<strong>und</strong>lage zu stellen, die in allen Punkten der<br />
B<strong>und</strong>eshaushaltsordnung genügt.<br />
In fiktiven Beispielrechungen wurden fünf mögliche Verfahren<br />
zur Ermittlung des anrechenbaren Finanzierungsanteils<br />
auf die Kostenbeteiligung der FHB geprüft:<br />
• Ermittlung der Kosten nach Leistungsbildern der HOAI<br />
• Ermittlung der Kosten über die St<strong>und</strong>ensätze der FHB<br />
• Ermittlung der Kosten über die in der Arbeitsgruppensitzung<br />
der Finanzierungspartner 1995 festgelegten<br />
St<strong>und</strong>ensätze für Oberbehörden des B<strong>und</strong>es (BAW,<br />
BfG)<br />
• Ermittlung der Kosten über die Personalkostensätze<br />
des BMF für Beamte <strong>und</strong> für Angestellte<br />
• Ermittlung der Kosten über die in der HOAI §6 genannten<br />
St<strong>und</strong>ensätze<br />
Die Varianten wurden hinsichtlich einer unkomplizierten <strong>und</strong><br />
flexiblen Anwendbarkeit für die verschiedensten Möglichkeiten<br />
des Personaleinsatzes, z.B. Personalentsendung oder<br />
Erbringung von Ingenieurleistungen, diskutiert.<br />
Im Ergebnis wurde vereinbart, die Personalkostensätze des<br />
BMF nach der jeweilig aktuellen Erlasslage des B<strong>und</strong>esministeriums<br />
für Finanzen (BMF) der Finanzierungsvereinbarung<br />
<strong>und</strong> damit den Projektvereinbarungen zu Gr<strong>und</strong>e zu<br />
legen. Der BMF-Erlass unterscheidet zwischen Personalkostensätzen<br />
für oberste B<strong>und</strong>esbehörden <strong>und</strong> für nachgeordnete<br />
B<strong>und</strong>esbehörden. Da die FHB durch die oberste<br />
Behörde, den Senator für Wirtschaft <strong>und</strong> Häfen, vertreten<br />
wird, war die Tabelle für die obersten B<strong>und</strong>esbehörden<br />
anzuwenden. Auf Gr<strong>und</strong>lage des Erlasses des BMF vom<br />
30.07.<strong>2007</strong> Az.IIA3-H1012-10/07/000 wurde am 07.02.<strong>2007</strong><br />
die Finanzierungsvereinbarung von der FHB <strong>und</strong> der <strong>WSD</strong><br />
<strong>Mitte</strong> unterzeichnet.<br />
Projektvereinbarungen<br />
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Entsende- <strong>und</strong> der<br />
Finanzierungsvereinbarung konnte die Erarbeitung <strong>und</strong><br />
Abstimmung der Projektvereinbarungen beginnen. Dazu<br />
wurde folgendes Vorgehen festgelegt:<br />
• auf fachtechnische Anforderung des WSA Verden<br />
erarbeitet die <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> eine Projektvereinbarung <strong>und</strong><br />
sendet diese der FHB zu<br />
• die FHB prüft, ob es möglich ist, das Personal für die<br />
angeforderte Leistung zu entsenden,<br />
• erarbeitet die FHB einen Ablaufplan (Kalkulation der<br />
Bearbeitungszeit <strong>und</strong> des Personalbedarfs)<br />
• die Projektvereinbarung wird zwischen der FHB <strong>und</strong><br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> ggf. diskutiert <strong>und</strong> angepasst<br />
• die Projektvereinbarung wird von der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>und</strong><br />
der FHB unterzeichnet<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Realisierung der <strong>Mitte</strong>lweseranpassung mit Unterstützung der Freien Hansestadt Bremen<br />
• die durch die Personalentsendung anzurechnenden<br />
Finanzierungsanteile sind jährlich im Voraus zu ermitteln<br />
<strong>und</strong> in den Finanzierungsplan aufzunehmen<br />
Für den Fall, dass die FHB nicht in der Lage ist, Personalressourcen<br />
bereit zu stellen, wirbt die <strong>Wasser</strong> <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
Ressourcen über den Weg der Vergabe<br />
ein.<br />
Zur Vereinfachung des Vorgehens wurde eine Muster-<br />
Projektvereinbarung (PV) erarbeitet, die als Gr<strong>und</strong>lage für<br />
alle weiteren Projektvereinbarungen dient <strong>und</strong> deren formalen<br />
Inhalte nicht mit jeder Projektvereinbarung neu abgestimmt<br />
werden müssen. Lediglich die fachtechnischen<br />
Inhalte sind PV spezifisch bzw. aufgabenspezifisch festzulegen.<br />
Inhalte<br />
Die erarbeiteten Instrumentarien wurden genutzt, um die im<br />
WSA Verden arbeitende Projektgruppe personell zu unterstützen<br />
<strong>und</strong> von anfallenden Planungsaufgaben zu entlasten.<br />
Mit Stand 30.11.<strong>2007</strong> sind sechs Projektvereinbarungen<br />
mit der FHB geschlossen worden (Tab. 1).<br />
Die ehemals aus zwei Bearbeitern bestehende Projektgruppe<br />
im WSA Verden wird derzeit durch fünf Mitarbeiter<br />
der FHB unterstützt. Die Erstellung der umfangreichen<br />
AU-Entwürfe für die Uferrückverlegungen wurde der FHB<br />
übertragen.<br />
Laufzeiten<br />
Anfänglich wurden die Projektvereinbarungen vorhabensgenau,<br />
mit zeitlichen Befristungen, z.B. PV 1 “Bauüberwachung<br />
der 1. Ausbaustufe“ für neun Monate geschlossen.<br />
Im Laufe der Bearbeitung stellte sich jedoch heraus, dass<br />
ein flexibler Einsatz des Personals unbedingt notwendig ist,<br />
so dass die neuen Projektvereinbarungen, die eine Personalentsendung<br />
beinhalten, bis zum Projektende am<br />
31.12.2012 abgeschlossen werden.<br />
Von der Idee zum Abschluss<br />
Die einzelnen Vereinbarungen sind inhaltlich <strong>und</strong> verfahrenstechnisch<br />
nicht vergleichbar, so dass eine pauschale<br />
Aussage, wie lange die Verhandlungsphase dauert, nicht<br />
möglich ist.<br />
Die Projektvereinbarungen zur Entsendung von Personal<br />
folgen den festgelegten Kostensätzen <strong>und</strong> sind innerhalb<br />
kürzester Zeit zu realisieren, dem Abschluss von Vereinbarungen,<br />
die das Erbringen von Planungsleistungen beinhalten,<br />
gehen mehrere Abstimmungsgespräche zu Aufwand<br />
<strong>und</strong> Umfang <strong>und</strong> zur Erläuterung der Inhalte voraus, so<br />
dass die Zeiten bis zur Unterzeichnung deutlich länger sind.<br />
PV Inhalt Abschlussdatum Laufzeit<br />
1 örtliche Bauüberwachung MW-Anpassung<br />
1. Stufe<br />
2 Koordination <strong>und</strong> Kontrolle der Projektbeteiligten<br />
Teilprojekt (TP) 1<br />
Sachbearbeiter im TP 1<br />
3 Erstellung Entwurf AU Technik <strong>und</strong> Grünplanung<br />
der Uferrückverlegungen in den Stauhaltungen<br />
4 Sachbearbeiter im TP 1 (Schriftgutverwaltung,<br />
Zeichnungen erstellen ....)<br />
5 Sachbearbeiter im MW-Projekt für Massenmanagement<br />
<strong>und</strong> VOF-Vergaben<br />
6 örtliche Bauüberwachung Munitionsräumung,<br />
Baugr<strong>und</strong>untersuchungen, Uferrückverlegung<br />
02./09.03.<strong>2007</strong> 01.04.<strong>2007</strong>-31.12.<strong>2007</strong><br />
02./09.03.<strong>2007</strong> 01.04.<strong>2007</strong>-31.03.2009<br />
17./30.10.<strong>2007</strong> 01.01.<strong>2008</strong>-31.12.2009<br />
08./12.11.<strong>2007</strong> 01.03.<strong>2008</strong>-31.12.2012<br />
30.10./02.11.<strong>2007</strong> 01.12.<strong>2007</strong>-30.11.2012<br />
30.10./09.11.<strong>2007</strong> 01.01.<strong>2008</strong>-31.12.2012<br />
7 Nachtrag zur Haushaltsunterlage HU 800 06./15.02.<strong>2008</strong> 15.02.<strong>2008</strong>-31.05.<strong>2008</strong><br />
Tab. 1: Stand der Projektvereinbarungen am 26.02.<strong>2008</strong>
Offene Fragen<br />
Seit knapp einem Jahr nutzt das WSA Verden die Möglichkeit<br />
der Personalentsendung durch die FHB. Bei der praktischen<br />
Abarbeitung der Projektvereinbarung entstanden<br />
neue Fragenstellungen zum Kündigungsschutz, Kündigungsrecht,<br />
zu den Nebenkosten sowie den anzurechnenden<br />
Finanzierungsanteilen der FHB. Alle Fragestellungen<br />
konnten einvernehmlich durch Ergänzungen der PV gelöst<br />
werden.<br />
Resümee<br />
Die Projektgruppe im WSA Verden personell so zu unterstützen,<br />
dass die Arbeit fristgerecht erfolgen kann, erforderte<br />
das Beschreiten neuer Wege. Die anfänglichen Befürchtungen<br />
über Integrations/Akzeptanzschwierigkeiten der<br />
„ausgeliehenen Mitarbeiter“ der FHB im WSA Verden <strong>und</strong><br />
über fehlende WSV-spezifische Befähigungen der entsendeten<br />
Mitarbeiter haben sich nicht bestätigt. Die Arbeitsgruppe<br />
arbeitet zielgerichtet <strong>und</strong> termingerecht die gestellten<br />
Aufgaben ab.<br />
Realisierung der <strong>Mitte</strong>lweseranpassung mit Unterstützung der Freien Hansestadt Bremen<br />
Die Personalunterdeckung im Bereich der Bauaufsicht<br />
kann durch Projektvereinbarungen nicht gelöst werden, so<br />
dass im Jahr <strong>2008</strong> diese Leistungen an Dritte vergeben<br />
werden.<br />
Die Projektarbeit erfordert durch die Weitergabe von umfangreichen<br />
Planungspaketen an das <strong>Wasser</strong>straßen Neubauamt<br />
(WNA) Helmstedt <strong>und</strong> an das Neubauamt für den<br />
Ausbau des <strong>Mitte</strong>llandkanals (NBA) in Hannover sowie<br />
durch die Entwicklung eines Verkehrslenkungssystems auf<br />
AIS Basis ein hohes Maß an Koordination.<br />
Trotz dieser komplexen Projektorganisation werden die<br />
Planungsaufträge zeitnah abgearbeitet. Die Arbeiten an<br />
den Ausführungsunterlagen für die Schleusenkanäle<br />
Langwedel <strong>und</strong> Drakenburg sind fast abgeschlossen <strong>und</strong><br />
werden Anfang <strong>2008</strong> in der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> zur Genehmigung<br />
vorgelegt, ebenso die Planänderungsunterlagen des<br />
Schleusenkanals Drakenburg. Der Baubeginn für die<br />
Schleusenkanäle Langwedel <strong>und</strong> Drakenburg ist für Ende<br />
<strong>2008</strong> vorgesehen.<br />
Dieser Projektfortschritt ist zum einen begründet in der<br />
nunmehr angemessenen personellen Ausstattung der<br />
Projektleitung <strong>und</strong> Projektgruppe im WSA Verden, aber<br />
zum anderen auch in der hohen Motivation aller ämterübergreifend<br />
angesiedelten Projektbeteiligten.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Michael Koch<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Nachträge gehören bei der Bauausführung zum täglichen<br />
Brot. Selbst die sorgfältigste Planung einer Baumaßnahme<br />
kann Nachträge nicht gänzlich verhindern. Häufig fordern<br />
die Baufirmen umfangreiche Mehrkosten, hervorgehend<br />
auch aus Bauzeitverlängerungen. Dem Auftraggeber ist es<br />
im Sinne einer vertragsgerechten Umsetzung sehr wichtig,<br />
die Nachforderungen sorgfältig nach den Regelungen der<br />
VOB/B <strong>und</strong> des Bauvertrags zu prüfen <strong>und</strong> abzuwickeln.<br />
In der Bauindustrie ist das Nachtragsmanagement schon<br />
seit vielen Jahren ein auf hohem Niveau fest integrierter<br />
Bestandteil bei der Abwicklung von Bauverträgen. Auch<br />
durch baubetriebliche Gutachten oder Einschaltung von<br />
Projektmanagementbüros <strong>und</strong> Juristen wird das Aufstellen<br />
<strong>und</strong> Durchsetzen von Nachträgen auf der Seite der Auftragnehmer<br />
unterstützt. Neben einer ohnehin schon inhaltlich<br />
umfangreichen Prüfung bedingt auch die Anzahl von<br />
Nachträgen einen zeitintensiven Aufwand mit entsprechend<br />
hohem <strong>und</strong> qualifiziertem Personaleinsatz. Dieser Situation<br />
muss die WSV als öffentlicher Auftraggeber auf "Augenhöhe"<br />
begegnen.<br />
Der B<strong>und</strong>esrechnungshof (BRH) fordert mit seinem Bericht<br />
vom 14.09.2005 über die Prüfung von Nachträgen im Bereich<br />
der WSV eine Verbesserung des Nachtragsmanagements.<br />
Als geeignete Maßnahmen sieht der BRH hierbei<br />
u.a. die Benennung von Ansprechpersonen zur Unterstützung<br />
bei der Bearbeitung problematischer Nachträge in den<br />
Ämtern, die Einführung <strong>und</strong> Anwendung von Standardprüfkriterien<br />
sowie eine inhaltlich gezielte Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />
der Mitarbeiter in den Ämtern.<br />
Arbeitskreis Nachtragsmanagement<br />
Das Neubaudezernat der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> hat auf die geschilderte<br />
Situation reagiert <strong>und</strong> einen Arbeitskreis Nachtragsmanagement<br />
gegründet. Der Arbeitskreis ist seit Januar 2006<br />
tätig <strong>und</strong> verfolgt das Ziel, über die Gründung eines Netzwerks<br />
von Ansprechpartnern einen Qualitätszirkel für die<br />
Nachtragsprüfung aufzubauen <strong>und</strong> damit den schon erreichten<br />
Qualitätsstandard der Nachtragsprüfung zu festigen<br />
<strong>und</strong> weiter zu verbessern.<br />
Die Mitglieder des Arbeitskreises verstehen sich dabei auch<br />
als Ansprechpartner zur Unterstützung bei der Problemlö-<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Nachtragsbearbeitung bei Bauverträgen<br />
nach VOB/B im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
sung von schwierigen <strong>und</strong> komplexen Nachträgen. Durch<br />
eine frühzeitige Kommunikation zwischen den Ämtern <strong>und</strong><br />
den Fachdezernaten der <strong>WSD</strong> (N/M/R) kann rechtzeitig<br />
nicht nur eine sachgerecht Lösung gef<strong>und</strong>en, sondern bei<br />
strittigen Forderungen auch eine Abschätzung <strong>und</strong> Minderung<br />
etwaiger Rechtsstreitigkeiten erreicht werden. Weiterhin<br />
stellt der Arbeitskreis für die Mitarbeiter in den Ämtern<br />
Arbeitshilfen für die Nachtragsprüfung (Mustervermerk) zur<br />
Verfügung <strong>und</strong> führt in den Ämtern Fortbildungen in Form<br />
von Seminaren <strong>und</strong> Workshops zur Baupreiskalkulation <strong>und</strong><br />
zum Nachtragsmanagement durch.<br />
Mustervermerk zur Nachtragsprüfung/-genehmigung<br />
Der Arbeitskreis hat einen Mustervermerk als Arbeitshilfe<br />
für die Nachtragsprüfung erarbeitet. Der Mustervermerk<br />
enthält Standardprüfkriterien, die eine einheitliche <strong>und</strong><br />
sachgerechte Nachtragsprüfung nach den Regelungen der<br />
VOB/B <strong>und</strong> des Bauvertrags sowie des Leitfadens zur<br />
Nachtragbearbeitung der VV-WSV 2102 unterstützt. Der<br />
Mustervermerk wurde im März 2006 den Neubauämtern zur<br />
Verfügung gestellt <strong>und</strong> dessen Anwendung im Rahmen<br />
einer Zielvereinbarung zwischen der <strong>WSD</strong> <strong>und</strong> den Ämtern<br />
beschlossen.<br />
Der Mustervermerk ist<br />
dabei nicht als auszufüllender<br />
Lückentext<br />
zu verstehen, sondern<br />
vielmehr als ein roter<br />
Faden, an dem sich<br />
die Mitarbeiter bei der<br />
Bearbeitung orientieren<br />
können <strong>und</strong><br />
sollen. Erschöpfende<br />
Formulierungen zur<br />
Darstellung von Sachverhalten<br />
<strong>und</strong> Prüfergebnissen<br />
sind selbstverständlich<br />
auch bei<br />
Anwendung des Mustervermerkserforderlich.<br />
Abb1: Einzelkosten der Teilleistung
Der Aufbau des Mustervermerks entspricht einer problemorientierten<br />
Systematik mit Teilaspekten <strong>und</strong> Fragestellungen,<br />
die bei der Nachtragsprüfung immer überprüft <strong>und</strong><br />
beantwortet werden müssen.<br />
Hierzu gehören<br />
A die Sachstandsprüfung<br />
mit Aspekten wie z.B.<br />
• Schilderung des neuen Sachverhalts (sind die behaupteten<br />
Umstände richtig?)<br />
• Beschreibung des Inhalts <strong>und</strong> Umfangs von geänderten<br />
oder zusätzlichen Leistungen<br />
• Liegen ausreichende Unterlagen/Nachweise der Nachtragsforderung<br />
bei?<br />
B die Prüfung dem Gr<strong>und</strong>e nach (Anspruchsgr<strong>und</strong>lage)<br />
• Feststellung der Anspruchsgr<strong>und</strong>lage nach § 2 VOB/B,<br />
z.B.<br />
• o § 2 Nr. 3 Mehr- <strong>und</strong> Mindermengen<br />
• o § 2 Nr. 5 Geänderte Leistung<br />
• o § 2 Nr. 6 Zusätzliche Leistung<br />
• o etc.<br />
• Liegt eine Anordnung des AG <strong>und</strong> eine Mehrkostenanmeldung<br />
des AN vor?<br />
C die Prüfung der Höhe nach (Anspruchshöhe)<br />
mit Fragestellungen wie z.B.<br />
• Wurde Einsicht in die Urkalkulation genommen?<br />
• Ist das Preisniveau des Hauptvertrags eingehalten?<br />
• Welche Zuschlagssätze sind zu verwenden?<br />
• Wurden Mehrkosten nachgewiesen?<br />
• Ist die Mengenermittlung zutreffend?<br />
Diese Standardprüfkriterien sollen natürlich nicht nur wegen<br />
einer Vereinheitlichung der Nachtragsprüfung beachtet<br />
werden. Vielmehr sorgt eine systematische <strong>und</strong> vollständige<br />
Bearbeitung aller Punkte dafür, dass keine wichtigen<br />
Regelungen der VOB/B <strong>und</strong> des Bauvertrags für eine geänderte<br />
Vergütung unberücksichtigt bleiben. Außerdem<br />
wird den Mitarbeitern, die erstmalig oder nicht regelmäßig<br />
mit der Nachtragsprüfung befasst sind, eine sachgerechte<br />
<strong>und</strong> vollständige Prüfung erleichtert.<br />
Die Anwendung des Mustervermerks hat sich bereits gut<br />
etabliert <strong>und</strong> zu einer deutlich erkennbaren Qualitätssteigerung<br />
in der Nachtragsprüfung geführt. Inzwischen findet der<br />
Mustervermerk durch Nachfrage auch über die Grenzen der<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> hinaus Anwendung. Seit Anfang <strong>2008</strong> wird der<br />
Mustervermerk als "Arbeitshilfe Nachtragsprüfung/genehmigung<br />
VOB" im Intranet des BMVBS (Fachinformationen<br />
WS 13) zur Verfügung gestellt <strong>und</strong> für die Anwendung<br />
in der WSV empfohlen.<br />
VV-WSV 2102 – Leitfaden zur<br />
Nachtragsbearbeitung<br />
Der Mustervermerk korrespondiert inhaltlich mit den Regelungen<br />
des Leitfadens zur Nachtragsbearbeitung (VV-WSV<br />
2102, Teil 5, Anlage 4), der im September 2006 durch das<br />
BMVBS eingeführt wurde. Der Arbeitskreis Nachtragsmanagement<br />
hat bei der Überarbeitung der VV-WSV 2102 <strong>und</strong><br />
bei der Entstehung des Leitfadens zur Nachtragsbearbeitung<br />
unterstützend mitgewirkt. Die Ergebnisse aus der<br />
Tätigkeit des Arbeitskreises sind bei der Entstehung des<br />
Leitfadens zur Nachtragsbearbeitung mit eingeflossen.<br />
Hierzu gehören z.B.<br />
• Voraussetzungen <strong>und</strong> Beispiele zur Zuordnung von<br />
Vergütungsansprüchen nach § 2 VOB/B<br />
Nachtragsbearbeitung bei Bauverträgen nach VOB/B im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
• Beispiele zur Berechnung neuer Einheitspreise<br />
• Erläuterungen zum Aufbau <strong>und</strong> Inhalt des Formblatts<br />
363-B,<br />
• etc.<br />
Abb. 2: Gemeinkosten der Baustelle<br />
Aus- <strong>und</strong> Fortbildung durch<br />
Seminare<br />
Die Nachtragsprüfung erfordert umfangreiche Detailkenntnisse<br />
der Baupreiskalkulation <strong>und</strong> der Vergütungsregeln<br />
der VOB/B. Um die Kenntnisse der Mitarbeiter, die mit der<br />
Nachtragsprüfung befasst sind, wieder aufzufrischen <strong>und</strong><br />
zu festigen, wurden im Jahr 2006 Seminare zum Nachtragsmanagement<br />
in den Neubauämtern Hannover <strong>und</strong><br />
Helmstedt von Mitgliedern des Arbeitskreises durchgeführt.<br />
Folgende Themen wurden hierbei u.a. behandelt:<br />
• Gr<strong>und</strong>lagen der Baupreiskalkulation<br />
• Ermittlung der Zuschlagssätze <strong>und</strong> Einheitspreise<br />
• Preisermittlungsgr<strong>und</strong>lagen (Preisniveau) des Hauptvertrags<br />
• Anspruchsvoraussetzungen nach § 2 VOB/B<br />
• Umgang mit Preisbestandteilen bei der Nachtragskalkulation<br />
• o EKT Einzelkosten der Teilleistung (Abb. 1)<br />
• o GkdB Gemeinkosten der Baustelle (Abb. 2)<br />
• o AGK Allgemeine Geschäftskosten (Abb. 3)<br />
• o W&G Wagnis <strong>und</strong> Gewinn (Abb. 4)<br />
• Fall- <strong>und</strong> Übungsbeispiele aus der Praxis<br />
Mit diesen Seminarthemen wurden gleichzeitig die Inhalte<br />
des Mustervermerks <strong>und</strong> des Leitfadens zur Vergütung<br />
aufgegriffen <strong>und</strong> vertieft.<br />
Seit ca. einem Jahr ist<br />
dieses Seminar auch<br />
regelmäßiger Bestandteil<br />
des Aus- <strong>und</strong> Fortbildungsprogramms<br />
der<br />
SAF geworden. In Kooperation<br />
mit der SAF<br />
wurde das Seminar als<br />
Inhouse-Schulung inzwischen<br />
auch in den<br />
WSÄ Minden, Verden <strong>und</strong><br />
Uelzen durchgeführt <strong>und</strong><br />
findet außerdem auf<br />
Abb. 3 : Allgemeine Geschäftskosten<br />
Nachfrage in anderen<br />
Ämtern der WSV statt.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Workshops / Erfahrungsaustausch<br />
Als weiterer Baustein der Aus- <strong>und</strong> Fortbildung <strong>und</strong> gleichzeitiges<br />
Instrument der Qualitätssicherung hat der Arbeitskreis<br />
im Frühjahr <strong>2007</strong> zwei Workshops für einen Erfahrungsaustausch<br />
zwischen den Mitarbeitern der Neubauämter<br />
organisiert <strong>und</strong> durchgeführt. Bei diesen Workshops<br />
haben die Mitarbeiter Praxisfälle aus laufenden oder abgeschlossenen<br />
Nachträgen vorgestellt. Typische Probleme<br />
bei ausgewählten Themenschwerpunkten wie z.B. Erd- <strong>und</strong><br />
Nassbaggerarbeiten, Anker- <strong>und</strong> Sp<strong>und</strong>wandarbeiten,<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Abb.4 : Wagnis <strong>und</strong> Gewinn<br />
Massivbau (Bewehrungsarbeiten) oder Stahlbau im Brückenbau<br />
wurden dabei gemeinsam analysiert <strong>und</strong> unterschiedliche<br />
Lösungsansätze diskutiert.<br />
Bei diesem Erfahrungsaustausch wurden Gr<strong>und</strong>satz- <strong>und</strong><br />
Spezialfragen der Nachtragsprüfung wieder aufgegriffen<br />
<strong>und</strong> vertieft. Somit konnten die Kenntnisse aus den Seminaren<br />
wieder aufgefrischt <strong>und</strong> ergänzt werden. Durch die<br />
gleichzeitige Mitwirkung der Mitarbeiter beider Neubauämter<br />
in den Workshops konnte ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch<br />
<strong>und</strong> Wissenstransfer über die Amtsgrenzen<br />
hinaus angestoßen werden. Ebenfalls konnten auch die<br />
oftmals so wichtigen Kontakte geknüpft <strong>und</strong> vertieft werden,<br />
damit auch künftig eine gegenseitige Unterstützung bei der<br />
Nachtragsprüfung ermöglicht oder verbessert werden kann.<br />
An dieser Stelle sei allen Beteiligten für ihre Transparenz<br />
<strong>und</strong> den kooperativen Umgang miteinander gedankt, insbesondere<br />
auch beim Aufzeigen eigener Fehler. Ohne diese<br />
Offenheit wäre eine gemeinsame Erörterung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
des Themenfeldes nur schwer möglich gewesen. Bitte<br />
weiter so.<br />
Mustervermerk auch für VOF-<br />
Nachträge<br />
Die positiven Erfahrungen aus der Anwendung des Mustervermerks<br />
haben dazu angeregt, eine vergleichbare Arbeitshilfe<br />
für Nachträge bei Ingenieurverträgen nach VOF zu<br />
erstellen. Eine weitere Arbeitsgruppe, ebenfalls mit Mitar-<br />
Nachtragsbearbeitung bei Bauverträgen nach VOB/B im Bereich der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
beitern des NBA Hannover, des WNA Helmstedt <strong>und</strong> des<br />
Neubaudezernats der <strong>WSD</strong> hat bereits einen Entwurf erarbeitet.<br />
Die Fertigstellung des Mustervermerks für die Nachtragsprüfung<br />
von Ingenieurverträgen wird voraussichtlich im<br />
Frühjahr <strong>2008</strong> sein.<br />
Ausblick<br />
Die Erfahrungen aus dem Tagesgeschäft, den Seminaren<br />
<strong>und</strong> den Workshops zeigen, dass es noch viele weitere<br />
Themen- <strong>und</strong> Fragestellungen gibt, die im Rahmen von<br />
Seminaren <strong>und</strong> Workshops behandelt werden können <strong>und</strong><br />
müssen. Weitere Workshops zu ausgewählten Fragestellungen<br />
sind geplant <strong>und</strong> werden voraussichtlich im Frühjahr/Sommer<br />
<strong>2008</strong> stattfinden. Weiterhin sind auch Seminare<br />
mit anderen Themenschwerpunkten wie z.B. Mehrkosten<br />
aus Behinderungen <strong>und</strong> Störungen des Bauablaufs sowie<br />
Ansprüche aus verzögertem Baubeginn <strong>und</strong> Bauzeitverlängerungen<br />
geplant.<br />
Die Mitglieder des Arbeitskreises<br />
Nachtragsmanagement:<br />
Frau Hochhut (NBA Hannover)<br />
Herr Schrader (NBA Hannover)<br />
Herr Münch (NBA Hannover, vormals Helmstedt)<br />
Herr Huxoll (WNA Helmstedt)<br />
Herr Overbeck (<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>)<br />
Herr Koch (<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>)<br />
Die Mitglieder des Arbeitskreises stehen Ihnen für Fragen<br />
zur Nachtragsbearbeitung jederzeit gerne zur Verfügung.
Michael Behr<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Korruption - ein nicht genau<br />
bestimmter Begriff<br />
Bei der Korruption handelt es sich um ein Jahrh<strong>und</strong>erte<br />
altes Phänomen <strong>und</strong> trotzdem gibt es keine präzise Definition.<br />
Im Duden hat der Begriff als Erklärung einen wirtschaftlichen<br />
<strong>und</strong> moralischen Aspekt. Er bedeutet danach<br />
Bestechlichkeit, Bestechung oder Verderben <strong>und</strong> Sittenverfall.<br />
Im Alltagsgebrauch werden unter Korruption komplizierte<br />
Geflechte verstanden, die keiner richtig durchdringt<br />
<strong>und</strong> auch gar nicht nachvollziehen soll. Das Strafrecht verwendet<br />
den Begriff „Korruption“ nicht. Er umfasst vielmehr<br />
verschiedene Strafrechtsnormen, wie z.B. Vorteilsannahme<br />
<strong>und</strong> Bestechung, sowohl als Amtsdelikte wie auch<br />
Delikte in geschäftlichem Verkehr. Auf der Gr<strong>und</strong>lage vieler<br />
erklärender Elemente lässt sich Korruption im öffentlichen<br />
Bereich schlagwortartig wie folgt definieren:<br />
Es handelt sich um den Missbrauch einer amtlichen Funktion<br />
(Machtposition) zur Erlangung oder zum Erstreben eines<br />
persönlichen Vorteils. Dabei wird gegen die allgemein anerkannten<br />
Regeln oder das Recht verstoßen. Der entstehende<br />
Schaden trifft die Allgemeinheit mittelbar <strong>und</strong> unmittelbar.<br />
Das Problem bei den genannten Fallgestaltungen ist, dass<br />
Korruption zum Verlust des Vertrauens der Bürger in die<br />
Funktionsfähigkeit des Staates führt. Die Integrität <strong>und</strong><br />
Lauterkeit seiner Repräsentanten wird geschwächt. Die<br />
wirtschaftlichen Folgen von Korruption sind die Verteuerung<br />
von Leistungen <strong>und</strong> Lieferungen. Steuergelder werden<br />
verschwendet.<br />
Wer sich in seiner amtlichen Funktion an korruptiven Verhaltensweisen<br />
beteiligt, kann leicht einen „point of no return“<br />
erreichen, an dem er im Sumpf der Korruption versinkt<br />
<strong>und</strong> in der Kriminalität endet sowie seine berufliche Existenz<br />
aufs Spiel setzt.<br />
Die Bekämpfung der Korruption ist zu einem zentralen<br />
politischen Thema geworden. Korruption darf sich nicht<br />
lohnen. Das Risiko, entdeckt <strong>und</strong> zur Rechenschaft gezogen<br />
zu werden, muss so groß wie irgend möglich sein.<br />
Dass das Thema Korruptionsprävention in der B<strong>und</strong>esverwaltung<br />
einen hohen Stellenwert hat, unterstrich auch der<br />
B<strong>und</strong>esminister für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung<br />
(BMVBS) Wolfgang Tiefensee persönlich im Rahmen des<br />
Treffens der für Korruptionsprävention zuständigen Mitarbeiter<br />
der B<strong>und</strong>esverwaltung für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung<br />
(BVBS) am 8. März 2006 in Berlin. In seiner<br />
Rede betonte der Minister, dass nichts dem Ansehen des<br />
Korruptionsprävention<br />
im Geschäftsbereich der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
öffentlichen Dienstes mehr schadet als Fälle von Korruption.<br />
Daher sei neben einer gut funktionierenden Verfolgung<br />
von Delikten die Korruptionsprävention das eigentliche<br />
Thema. Ihr kommt nach den Worten des Staatssekretärs<br />
Dr. Lütke Daldrup in der Pressemitteilung des BMVBS vom<br />
14. März 2006 „herausragende Bedeutung“ zu. Aus diesen<br />
Gründen hatte das BMVBS zu Beginn des Jahres 2006<br />
einen „Aktionsplan zur Korruptionsprävention“ gestartet.<br />
Dessen Kernpunkte sind die Erarbeitung eines nach einheitlichen<br />
Kriterien aufgestellten Risikoatlasses für die<br />
gesamte BVBS, klare Vorgaben für darauf basierende<br />
personelle Präventivmaßnahmen sowie ein neues Aus- <strong>und</strong><br />
Fortbildungsprogramm.<br />
Einen aktuellen Anhaltspunkt dafür, dass im Bereich Korruptionsprävention<br />
nach wie vor Handlungsbedarf besteht,<br />
liefert der von Transparency International veröffentlichte<br />
Korruptionswahrnehmungsindex <strong>2007</strong>. Dort steht Deutschland<br />
im internationalen Ranking auf Platz 16. Das ist eine<br />
Position, die gerade im europäischen Bereich noch verbessert<br />
werden kann.<br />
Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Die rechtliche Gr<strong>und</strong>lage findet sich in der Richtlinie zur<br />
Korruptionsprävention in der B<strong>und</strong>esverwaltung. Diese hat<br />
die B<strong>und</strong>esregierung nach Art. 86 Satz 1 des Gr<strong>und</strong>gesetzes<br />
als allgemeine Verwaltungsvorschrift im Jahre 1998<br />
erlassen <strong>und</strong> mit einer Neufassung vom 20. Juli 2004 weiterentwickelt.<br />
Die Richtlinie dient dem Ziel der Korruptionsprävention<br />
generell. Sie ist ein wichtiges Instrument zur<br />
Förderung von Integrität <strong>und</strong> zur Verhinderung von Korruption<br />
im öffentlichen Dienst. Als Verwaltungsvorschrift bietet<br />
sie für die Beschäftigten der B<strong>und</strong>esverwaltung auf allen<br />
Ebenen in verständlicher Weise eine Richtschnur für ein<br />
integres <strong>und</strong> transparentes Verhalten der Verwaltung. Die<br />
Richtlinie gilt für alle B<strong>und</strong>esbehörden, die Behörden der<br />
unmittelbaren <strong>und</strong> mittelbaren B<strong>und</strong>esverwaltung, die Gerichte<br />
des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Sondervermögen des B<strong>und</strong>es.<br />
Je nach Aufbau <strong>und</strong> Aufgabenstruktur einer Dienststelle<br />
können die in der Richtlinie getroffenen Regelungen nach<br />
speziellen Bedürfnissen verschärft oder präzisiert werden.<br />
Es ist also beispielsweise möglich, in einzelnen Dienststellen<br />
oder für einzelne Beschäftige jegliche Annahme von<br />
Belohnungen <strong>und</strong> Geschenken zu untersagen. Es sind<br />
flexible Lösungen für die unterschiedlichen Bereiche möglich,<br />
in denen der B<strong>und</strong> Verantwortung trägt <strong>und</strong> gleichzeitig<br />
ist die Einhaltung von Mindeststandards garantiert.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Inhalt der Richtlinie<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Korruptionsprävention im Geschäftsbereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
Die Richtlinie enthält vielfältige Instrumente zur Korruptionsprävention<br />
<strong>und</strong> zur Minimierung des Risikos der Bediensteten,<br />
sich in unlautere Machenschaften zu verstricken.<br />
Sie gibt Handlungsempfehlungen für Führungskräfte<br />
<strong>und</strong> Regelungsvorschläge für die Verantwortlichen in den<br />
Organisationseinheiten der Behörden.<br />
Wesentliche Inhalte der Richtlinie sind Hinweise zur Feststellung<br />
besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete.<br />
Das Mehr-Augen-Prinzip <strong>und</strong> Transparenz behördlicher<br />
Entscheidungsabläufe sind sicherzustellen. Laut Richtlinie<br />
soll unter bestimmten Voraussetzungen die Rotation von<br />
Personal angestrebt werden, wobei Ausnahmen schriftlich<br />
zu begründen sind. Sensibilisierung <strong>und</strong> Belehrung der<br />
Beschäftigten müssen erfolgen. Die Aus- <strong>und</strong> Fortbildung<br />
hat das Thema Korruptionsprävention aufzunehmen, was<br />
auch für Führungskräfte <strong>und</strong> Beschäftigte in Risikobereichen<br />
sowie für die Ansprechpersonen für Korruptionsprävention<br />
gilt. Dienst- <strong>und</strong> Fachaufsicht sind konsequent<br />
auszuüben. Die Einhaltung der Vorschriften über öffentliche<br />
Ausschreibungen hat besondere Bedeutung. Es sollte eine<br />
Trennung von Planung, Vergabe <strong>und</strong> Abrechnung organisiert<br />
sein. Der Wettbewerbsausschluss von Unternehmen<br />
bei Verfehlungen ist zu prüfen. Anti-Korruptionsklauseln<br />
können in Verträge aufgenommen werden. Auftragnehmer<br />
sollen nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden.<br />
Das Sponsoring ist zu regeln. Außerdem sind ein Verhaltenskodex<br />
für Beschäftige <strong>und</strong> ein Leitfaden für Vorgesetzte<br />
als amtliche Anlagen der Richtlinie verbindlich.<br />
Ansprechpersonen für Korruptionsprävention<br />
Ein weiteres wichtiges Instrument zur Korruptionsprävention,<br />
das die Richtlinie neben den vorgenannten Möglichkeiten<br />
vorsieht, ist die Bestellung einer Ansprechperson für<br />
Korruptionsprävention in den Behörden. Sie ist Ansprech<strong>und</strong><br />
Gesprächspartner für alle Beschäftigten in ihrem Zuständigkeitsbereich.<br />
Sie dient als Ansprechperson für sämtliche<br />
Bedienstete vom Streckenarbeiter bis zu den Dienststellenleitern.<br />
Jeder kann sich direkt <strong>und</strong> ohne Einhaltung<br />
des Dienstweges an die Ansprechperson für Korruptionsprävention<br />
wenden. Das kann persönlich, schriftlich oder<br />
auf anderem Wege formlos geschehen. Die Ansprechperson<br />
berät die Bediensteten <strong>und</strong> Dienststellenleitungen bei<br />
Fragen über Inhalt, Umfang <strong>und</strong> Grenzen von Korruption.<br />
Auch die Klärung von Verfahrensfragen im Zusammenhang<br />
mit Korruption (z. B. wie man sich bei staatsanwaltschaftlichen<br />
Ermittlungen verhält) gehört zur Aufgabe der Ansprechperson.<br />
Weiterhin soll sie auf Korruptionsanzeichen<br />
achten <strong>und</strong>, wenn ihr solche bekannt werden, das weitere<br />
Vorgehen je nach Lage des Falles mit Vorgesetzten, Personalbüro<br />
oder -dezernat sowie gegebenenfalls mit dem<br />
Rechtsdezernat klären. Die Entscheidung über zutreffende<br />
Maßnahmen liegt aber nicht bei der Ansprechperson, sondern<br />
bei der Behördenleitung. Letztere hat zu entscheiden,<br />
inwieweit interne Ermittlungen aufgenommen <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
gegen Verschleierung zu treffen sind. Auch die<br />
Unterrichtung <strong>und</strong> Einschaltung der Staatsanwaltschaft<br />
oder des Landeskriminalamtes liegt in einem durch Tatsachen<br />
gerechtfertigten Korruptionsverdachtsfall bei der Leitung<br />
der jeweiligen Dienststelle.<br />
Die Ansprechperson nimmt ihre Aufgaben zur Korruptionsprävention<br />
weisungsunabhängig wahr. Sie hat ein unmittelbares<br />
Vortragsrecht bei der Dienststellenleitung. Disziplinarbefugnisse<br />
werden einer Ansprechperson nicht übertragen<br />
<strong>und</strong> sie darf in Disziplinarverfahren wegen Korruption<br />
nicht als Ermittlungsführer eingesetzt werden. Im Geschäftsbereich<br />
des BMVBS üben die Ansprechpersonen für<br />
Korruptionsprävention ihre Aufgaben nebenamtlich aus.<br />
Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld der Ansprechperson<br />
ist die Mitwirkung bei der Fortbildung <strong>und</strong> Aufklärung der<br />
Beschäftigten. Außerdem kommen die Ansprechpersonen<br />
aus der BVBS regelmäßig zum Informationsaustausch<br />
zusammen. Kontakte zu Staatsanwaltschaften, Polizei <strong>und</strong><br />
anderen Institutionen, die sich mit dem Thema Korruptionsprävention<br />
beschäftigen, sind ebenso selbstverständlich.<br />
Soweit einer Ansprechperson für Korruptionsprävention im<br />
Rahmen ihrer Tätigkeit persönliche Verhältnisse von Beschäftigten<br />
bekannt werden, hat sie darüber Stillschweigen<br />
zu bewahren. Diese Schweigepflicht wird allerdings eingeschränkt<br />
gegenüber der Dienststellenleitung <strong>und</strong> der Personalverwaltung,<br />
wenn es um Tatsachen geht, die den Verdacht<br />
einer Korruptionsstraftat begründen.<br />
Gleichwohl ist zu betonen, dass der Ansatzpunkt der Tätigkeit<br />
einer Ansprechperson für Korruptionsprävention die<br />
Prävention ist. Ein frühzeitiges Beratungsgespräch <strong>und</strong><br />
ernsthafte Sensibilisierung von Beschäftigten kann insoweit<br />
mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme im Hinblick auf<br />
Korruption verhindern.<br />
Unabhängig von der Existenz einer Ansprechperson für<br />
Korruptionsprävention bleibt die Eigenverantwortung der<br />
Beschäftigten unberührt. Die Aufsichts- <strong>und</strong> Kontrollpflichten<br />
von Vorgesetzten bestehen unverändert.<br />
Wirksame Korruptionsprävention<br />
in der Praxis<br />
Bei Einhaltung der Vorgaben der Richtlinie <strong>und</strong> ihrer Anlagen<br />
können viele Schwachstellen festgestellt <strong>und</strong> Einfallstore<br />
für Korruption in der Verwaltung verschlossen werden.<br />
Wie sind aber solche Schwachstellen erkennbar <strong>und</strong> wo<br />
befinden sie sich? Es gibt zwei große Blöcke. Das sind die<br />
organisatorischen <strong>und</strong> die persönlichen Bereiche der Verw<strong>und</strong>barkeit<br />
einer Verwaltung. Korruption ist immer an eine<br />
Schnittstelle von außen mit der Verwaltung geb<strong>und</strong>en. Das<br />
ist in der Regel das Personal, also die Beamten oder Tarifbeschäftigten.<br />
Einfallstore für Korruption <strong>und</strong> damit die Verw<strong>und</strong>barkeit der<br />
Verwaltung finden sich dort, wo es um Geld geht, das entweder<br />
die Verwaltung selbst ausgibt oder das ein Dritter auf<br />
der Gr<strong>und</strong>lage einer behördlichen Entscheidung verdienen<br />
kann. Beispiele <strong>und</strong> damit sensible Bereiche sind die Vergabe<br />
von Aufträgen (Lieferungen, Leistungen, Bauleistungen)<br />
oder die Genehmigungen, Zustimmungen, Erlaubnisse<br />
<strong>und</strong> Konzessionen. Außerdem gehören hierher die behördlichen<br />
Kontrollen, Überprüfungen <strong>und</strong> Überwachungen, ob<br />
Gesetze, Verordnungen oder erteilte Genehmigungen eingehalten<br />
werden.<br />
Schwachstellen der Verwaltung zeigen sich in diesen Tätigkeitsfeldern,<br />
wenn die Dienst- <strong>und</strong> Fachaufsicht mangelhaft<br />
ausgeübt werden oder Leitungen ihren Mitarbeitern blind<br />
vertrauen, also Kontrollstrukturen fehlen oder unzureichend<br />
sind. Auch nennt die Richtlinie hier negatives Vorbildverhalten<br />
von Vorgesetzen <strong>und</strong> das Ausbleiben von Konsequen-
zen nach aufgedeckten Manipulationen. Selbst in einer gut<br />
organisierten Verwaltung ist Korruption jedoch nicht auszuschließen.<br />
Hier müssen insbesondere Führungskräfte, aber<br />
natürlich auch alle anderen Beschäftigten auf die alltäglichen<br />
Warnsignale achten. Es gibt laut B<strong>und</strong>eskriminalamt<br />
diverse Verhaltensauffälligkeiten, die als Indikatoren für<br />
Korruption gewertet werden können. Der „Leitfaden für<br />
Vorgesetzte <strong>und</strong> Behördenleitungen“ listet hierzu eine ganze<br />
Reihe von neutralen <strong>und</strong> dienststelleninternen Indikatoren<br />
sowie solchen im Bereich von Außenkontakten auf. Als<br />
Beispiele seien hier nur genannt: verstärkte Kontakte <strong>und</strong><br />
häufige Auftragsvergabe an bestimmte Bieter, Kompetenzkonzentrationen<br />
bei entscheidungsbefugten Mitarbeitern,<br />
Verheimlichung von Vorgängen, nicht nachvollziehbare<br />
Entscheidungen <strong>und</strong> nicht zuletzt ein auffallender unerklärlich<br />
hoher Lebensstandard mit vorgezeigten Statussymbolen.<br />
Keiner dieser ausgewählten Indikatoren aus einer langen<br />
Liste ist ein Nachweis für Korruption. Wenn ein Verhalten<br />
auffällt, ist es möglicherweise angezeigt, das Auftreten<br />
eines Indikators zusammen mit den Umfeldbedingungen<br />
auf Korruptionsgefahren zu überprüfen.<br />
R<strong>und</strong>schreiben zur Annahme<br />
von Belohnungen <strong>und</strong> Geschenken<br />
Ergänzend zu der Richtlinie zur Korruptionsprävention<br />
existiert in der B<strong>und</strong>esverwaltung das wichtige, viel diskutierte<br />
Hilfsmittel für die Beschäftigten, um sich <strong>und</strong> die Verwaltung<br />
vor Korruption zu schützen, nämlich das R<strong>und</strong>schreiben<br />
des B<strong>und</strong>esministeriums des Innern zum Verbot<br />
der Annahme von Belohnungen <strong>und</strong> Geschenken in der<br />
B<strong>und</strong>esverwaltung vom 8. November 2004.<br />
Dieses Schreiben baut auf dem gesetzlich festgelegten<br />
Gr<strong>und</strong>satz auf, dass Beamte <strong>und</strong> Tarifbeschäftigte keine<br />
Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihr Amt oder<br />
ihre Tätigkeit annehmen dürfen (vgl. § 70 B<strong>und</strong>esbeamtengesetz<br />
<strong>und</strong> § 3 Abs. 2 TVöD). Ausnahmen davon soll es<br />
nur in Fällen geben, in denen eine Beeinflussung der Beschäftigten<br />
nicht zu befürchten ist. Diese Ausnahmegenehmigungen<br />
müssen Dienstherr oder Arbeitgeber gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
vorher erteilen oder sie sind unverzüglich nachträglich<br />
einzuholen.<br />
Die Annahme von Bargeld als Belohnung oder Geschenk<br />
ist nach dem R<strong>und</strong>schreiben ohne Ausnahme verboten <strong>und</strong><br />
nicht genehmigungsfähig. Sogenannte Trinkgelder oder<br />
Spenden für die Kaffeekasse sind demnach nicht zulässig.<br />
Für einige besonders geregelte Fälle kann auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
des R<strong>und</strong>schreibens (dort Ziff. IV) von einer stillschweigenden<br />
Zustimmung zur Ausnahme vom Verbot der Annahme<br />
von Belohnungen <strong>und</strong> Geschenken ausgegangen<br />
werden. Das ist beispielsweise der Fall bei der Annahme<br />
von geringfügigen Aufmerksamkeiten bis zu einem Wert<br />
von 25 €. Dazu zählen Reklameartikel einfacher Art, wie<br />
Kugelschreiber, Schreibblocks oder Kalender. Allerdings<br />
müssen Annahmen dieser Geschenke dem Dienstherrn<br />
oder Arbeitgeber angezeigt werden.<br />
Zulässig ist auch die Teilnahme an Bewirtungen durch<br />
Private aus Anlass oder bei Gelegenheit dienstlicher Handlungen,<br />
Besprechungen, Besichtigungen oder dergleichen,<br />
wenn sie üblich <strong>und</strong> angemessen sind. Die Grenze des<br />
Zulässigen liegt dort, wo die Bewirtung nach Art <strong>und</strong> Umfang<br />
einen nicht unerheblichen Wert darstellt. Dabei richtet<br />
Korruptionsprävention im Geschäftsbereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
sich der im einzelnen Fall anzulegende Maßstab auch nach<br />
der amtlichen Funktion des Beschäftigten.<br />
Es ist darauf hinzuweisen, dass es nach dem ausdrücklichen<br />
Wortlaut des R<strong>und</strong>schreibens der zuständigen Stelle<br />
freisteht, die stillschweigende Zustimmung im Einzelfall zu<br />
widerrufen. Das bedeutet, dass jede Behörde für ihren<br />
Bereich schärfere Regelungen anordnen kann, als in dem<br />
R<strong>und</strong>schreiben dargestellt sind. Außerdem können die<br />
obersten Dienstbehörden zum R<strong>und</strong>schreiben ergänzende<br />
<strong>und</strong> weitergehende Anordnungen treffen.<br />
Falls Beschäftigte im Zusammenhang mit der Annahme von<br />
Geschenken oder Einladungen in ihrem beruflichen Umfeld<br />
Zweifel haben oder Probleme sehen, sollten die Betroffenen<br />
in jedem Fall den Rat ihrer Vorgesetzten oder der Ansprechperson<br />
für Korruptionsprävention einholen. Denn<br />
auch wenn es heißt „Kleine Geschenke erhalten die<br />
Fre<strong>und</strong>schaft“, sind die Übergänge zur Korruption fließend.<br />
Beim sogenannten „Anfüttern“ können schon kleine Aufmerksamkeiten,<br />
die über einen längeren Zeitraum gezielt<br />
eingesetzt werden, dazu führen, dass ein Dritter Beschäftigte<br />
der Verwaltung in ein Abhängigkeitsverhältnis bringt.<br />
Persönliche Konsequenzen<br />
Prävention ist zwar das beste <strong>Mitte</strong>l zur Vermeidung von<br />
Korruption <strong>und</strong> das Strafrecht ist die ultima ratio, um gesellschaftlichen<br />
Fehlentwicklungen zu begegnen. Aber die<br />
Rechtsordnung sieht auch strafrechtliche, dienst- <strong>und</strong> arbeitsrechtliche<br />
sowie vermögensrechtliche Konsequenzen<br />
für korruptes Verhalten vor.<br />
Strafrecht<br />
Vorteilsannahme gemäß § 331 Strafgesetzbuch (StGB) <strong>und</strong><br />
Bestechlichkeit nach § 332 StGB sind die beiden Delikte,<br />
die Amtsträger, also Beamte <strong>und</strong> Tarifbeschäftigte im öffentlichen<br />
Dienst als Korruptionsstraftat begehen können.<br />
Es besteht eine Strafdrohung von Geldstrafe oder bis zu<br />
drei Jahren Freiheitsstrafe für Vorteilsannahme <strong>und</strong> Geldstrafe<br />
oder Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf<br />
Jahren bei Bestechlichkeit.<br />
Der Tatbestand der Vorteilsannahme erfordert, dass ein<br />
Amtsträger für seine Dienstausübung einen Vorteil für sich<br />
oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt.<br />
Die Bestechlichkeit unterscheidet sich von der Vorteilsannahme<br />
dadurch, dass der Anknüpfungspunkt eine bestimmte<br />
Diensthandlung ist <strong>und</strong> dass der Täter für den Erhalt des<br />
Vorteils seine Dienstpflichten verletzt.<br />
Die Kehrseite der genannten Amtsdelikte sind die Vorteilsgewährung<br />
<strong>und</strong> die Bestechung nach den §§ 333 <strong>und</strong> 334<br />
StGB. Dadurch sollen diejenigen bestraft werden, die einem<br />
Amtsträger Vorteile gewähren für entweder die pflichtgemäße<br />
Dienstausübung (Vorteilsgewährung) oder eine<br />
pflichtwidrige Diensthandlung (Bestechung).<br />
Arbeitsrecht, Tarifrecht<br />
Wird einem Tarifbeschäftigten korruptes Verhalten nachgewiesen<br />
oder macht er sich wegen einer Korruptionstat<br />
nach dem Strafgesetzbuch strafbar, kann dies für ihn die<br />
Kündigung nach sich ziehen. In Betracht kommt auch eine<br />
sogenannte Änderungskündigung, wenn beabsichtigt ist,<br />
den Beschäftigten auf einem niedriger bewerteten <strong>und</strong><br />
bezahlten Arbeitsplatz einzusetzen. Im schlimmsten Fall<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Korruptionsprävention im Geschäftsbereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
besteht die Möglichkeit der außerordentlichen (fristlosen)<br />
Kündigung aus wichtigem Gr<strong>und</strong>.<br />
Dienstrecht<br />
Bei Beamten kann es, auch wenn er nicht wegen einer<br />
Straftat verurteilt wird, zu einem Disziplinarverfahren kommen,<br />
das mit Verweis, Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge,<br />
Zurückstufung oder Entfernung aus dem Beamtenverhältnis<br />
endet. Wird ein Beamter wegen einer vorsätzlichen<br />
Tat in einem ordentlichen Strafverfahren von einem<br />
deutschen Gericht zu einer Freiheitsstrafe von mindestens<br />
einem Jahr verurteilt, endet das Beamtenverhältnis kraft<br />
Gesetz nach § 48 B<strong>und</strong>esbeamtengesetz mit der Rechtskraft<br />
des Urteils.<br />
Schadensersatz<br />
Verletzt ein Beamter oder Tarifbeschäftigter durch korruptes<br />
Verhalten seine Dienst- oder Vertragspflichten, besteht<br />
die Möglichkeit, dass er Schadensersatz leisten <strong>und</strong> den<br />
erlangten Vorteil herausgeben muss.<br />
Konkrete Maßnahmen zur Korruptionsprävention<br />
im Geschäftsbereich<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Sensibilisierung<br />
Die Beschäftigten werden zum Thema Korruptionsprävention<br />
regelmäßig sensibilisiert <strong>und</strong> informiert. Dies geschieht<br />
insbesondere durch Belehrungen bei der Einstellung, regelmäßige<br />
von Hand abzuzeichnende Umläufe <strong>und</strong> mündliche<br />
<strong>Informationen</strong> sowie über das Intranet.<br />
Ansprechperson für Korruptionsprävention<br />
Es wurde eine Ansprechperson für Korruptionsprävention<br />
bestellt. Sie ist zuständig für den gesamten Geschäftsbereich<br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>. Sie hat<br />
einen Informationsblock im Intranet, informiert mündlich,<br />
zum Beispiel auf Personalversammlungen <strong>und</strong> wirkt mit bei<br />
Schulungen. Außerdem führt die Ansprechperson Beratungen<br />
im Einzelfall durch.<br />
Risikoanalyse<br />
Im Jahr 2006 hat das Dezernat Administration der <strong>WSD</strong><br />
<strong>Mitte</strong> auf der Gr<strong>und</strong>lage der standardisierten Vorgaben des<br />
BMVBS eine Risikoanalyse für den gesamten Geschäftsbereich<br />
durchgeführt.<br />
Schulungen<br />
Im 1. Quartal des Jahres <strong>2007</strong> wurden in der SAF umfangreiche<br />
Schulungen von Führungskräften aus dem Geschäftsbereich<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> durchgeführt. Dies geschah<br />
in eintägigen Seminaren nach einem mit der Innenprüfung<br />
<strong>und</strong> der Arbeitsgruppe Korruptionsprävention des BMVBS<br />
abgestimmten Lehrgangsprogramm. Sobald die Risikoana-<br />
lyse ausgewertet ist, werden weitere qualifizierte Schulungen<br />
für die Beschäftigten in besonders korruptionsgefährdeten<br />
Arbeitsgebieten erfolgen.<br />
Dienst- <strong>und</strong> Fachaufsicht<br />
Dienst- <strong>und</strong> Fachaufsicht sind auch unter dem Gesichtspunkt<br />
der Korruptionsprävention ernsthaft <strong>und</strong> konsequent<br />
wahrzunehmen.<br />
Transparenz<br />
Die Transparenz des Verwaltungshandelns <strong>und</strong> der Entscheidungsabläufe<br />
wird durch die klare Festlegung von<br />
Zuständigkeiten gewährleistet. Das Mehr-Augen-Prinzip bei<br />
Entscheidungen ist geregelt.<br />
Annahme von Belohnungen<br />
<strong>und</strong> Geschenken<br />
auch in dessen Geschäftsbereich gilt, wird gemäß Verfügung<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> vom 2. Dezember 2004 (A2-121.1:15)<br />
beachtet.<br />
Ausblick<br />
Die Korruptionsprävention bleibt ein allgegenwärtiges Thema.<br />
Es gibt immer noch Verbesserungspotenzial. Das Ansehen<br />
des Staates <strong>und</strong> die Verlässlichkeit der Entscheidungen<br />
ist zu festigen. Die Wachsamkeit im Hinblick auf die<br />
Vermeidung von Korruption ist bei der täglichen Arbeit aller<br />
Amtsträgerinnen <strong>und</strong> Amtsträger oberstes Gebot.
Christoph Weinoldt<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Einführung einer Verkehrsregelung auf der<br />
<strong>Mitte</strong>lweser unter Nutzung von AIS<br />
(Automatic Identification System) als Pilotprojekt auf<br />
deutschen Binnenschifffahrtsstraßen<br />
Der Ausbau der <strong>Mitte</strong>lweser zu einer <strong>Wasser</strong>straße der<br />
Klasse Va für das Großmotorgüterschiff (GMS, Länge<br />
110 m, Breite 11,45 m) zwischen Minden (Weser-km<br />
204,40) <strong>und</strong> Hemelingen (Weser-km 362,20) mit einer<br />
Fahrrinnentiefe von 2,80 m wird nach dem dazu ergangenen<br />
Planfeststellungsbeschluss der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong> (<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>) nicht als Vollausbau ausgeführt,<br />
sondern es werden auch nach Abschluss der Baumaßnahmen<br />
dauerhaft einige Engstellen für die Schifffahrt<br />
bestehen bleiben. Deshalb ist es erforderlich, zur Gewährleistung<br />
der Sicherheit der Schifffahrt auf der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
mit den Stauhaltungen Petershagen, Schlüsselburg, Landesbergen,<br />
Drakenburg, Dörverden, Langwedel <strong>und</strong> Hemelingen<br />
eine Verkehrslenkung einzuführen.<br />
Verkehrsregelung<br />
Die Regelungsstrecke umfasst die gesamte <strong>Mitte</strong>lweser<br />
(ca. 145 km), weist also eine erhebliche Länge auf <strong>und</strong><br />
stellt damit hohe Anforderungen an Art <strong>und</strong> Umfang der zu<br />
treffenden Regelungen. Das Ziel muss zum einen sein,<br />
dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu tragen, zum anderen<br />
aber auch eine praxisnahe Lösung für die Schifffahrt zu<br />
entwickeln. Aus diesem Gr<strong>und</strong> wurden die Vertreter der<br />
Schifffahrt bereits zu einem frühen Zeitpunkt im Juli <strong>2007</strong><br />
über das Vorhaben informiert. Die seitens der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
geleisteten Vorarbeiten wurden vorgestellt <strong>und</strong> in ersten<br />
Teilbereichen diskutiert. Für die weitere Entwicklung <strong>und</strong><br />
die schrittweise Modifikation der Verkehrsregelung vereinbarten<br />
die Beteiligten, eine kleine Arbeitsgruppe zu bilden<br />
mit paritätischer Besetzung aus der Schifffahrt <strong>und</strong> der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung (WSV) mit ca. 6 bis 8<br />
Teilnehmern. Diese Arbeitsgruppe trifft sich seitdem etwa<br />
im Monatsturnus zu Sitzungen, die sich als sehr konstruktiv<br />
erwiesen haben.<br />
Vor der textlichen Fassung der Regelungen als Basis für<br />
die Schaffung einer schifffahrtspolizeilichen Rechtsgr<strong>und</strong>lage<br />
in Form einer Anordnung beziehungsweise einer Änderungsverordnung<br />
zur Binnenschifffahrtsstraßenordnung<br />
wurde maßgeblich durch das Schifffahrtsbüro der <strong>WSD</strong><br />
<strong>Mitte</strong> für die gesamte Strecke zunächst eine schematische<br />
visuelle Darstellung entwickelt. Dabei handelt es sich um<br />
eine stark vereinfachte Übersicht der einzelnen Stauhaltungen<br />
als Diskussionsgr<strong>und</strong>lage für die weitere Abstimmung<br />
markiert sind.<br />
Als Beispiel ist nachfolgend die Stauhaltung Drakenburg<br />
abgebildet:<br />
Diese Darstellung basiert auf einer Befahrbarkeitsanalyse<br />
der B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau (BAW) für die <strong>Mitte</strong>lweser.<br />
Gr<strong>und</strong>lage der Untersuchungen war ein fahrdynamisches<br />
Modellverfahren (pegelabhängige Trassierung),<br />
welches die Ermittlung des Verkehrsflächenbedarfs bei<br />
vorgegebenen Kursachsen der Schiffe unter Berücksichtigung<br />
der Fließgeschwindigkeit erlaubt. Damit wurden die<br />
benötigten Verkehrsflächen für Begegnungen der Fahrzeugtypen<br />
Gustav Königs (GK, 67 m), Europaschiff (ES,<br />
85 m), Großmotorgüterschiff (GMS, 110 m) <strong>und</strong> Übergroßes<br />
GMS (ÜGMS, 135 m) ermittelt <strong>und</strong> als farbige Fahrspuren<br />
in Karten übertragen. Aus den jeweiligen Überschneidungen<br />
der Fahrspuren sind die Fehlstellen ersichtlich, die<br />
zukünftig einer Verkehrsregelung bedürfen.<br />
Diese Daten wurden in der genannten kleinen Arbeitsgruppe<br />
mit streckenk<strong>und</strong>igen Vertretern der Schifffahrt <strong>und</strong> dem<br />
ebenfalls streckenk<strong>und</strong>igen Nautiker der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> für die<br />
gesamte Strecke der <strong>Mitte</strong>lweser Abschnitt für Abschnitt<br />
durchgegangen <strong>und</strong> geprüft im Hinblick auf die tatsächlichen<br />
Fahrverhältnisse <strong>und</strong> -bedingungen vor Ort. Dabei<br />
stellte sich heraus, dass die von der BAW gelieferten Daten<br />
große Genauigkeit besitzen <strong>und</strong> lediglich in einigen wenigen<br />
Punkten Anpassungen vorzunehmen waren. Damit<br />
sind für die gesamte Strecke der <strong>Mitte</strong>lweser die Randbedingungen<br />
<strong>und</strong> notwendigen Festlegungen für eine Verkehrsregelung<br />
ermittelt worden. Als nächster Schritt folgt<br />
die Fassung einer schifffahrtspolizeilichen Anordnung, die<br />
vorliegend für die Phase der Bauzeit zunächst das geeignete<br />
Instrument für die rechtliche Absicherung der geplanten<br />
Verkehrsregelung darstellt.<br />
Wesentlicher Baustein der Regelung wird die Einführung<br />
einer Meldepflicht sein mit festgelegten Meldepunkten vor<br />
den jeweiligen Engstellen, um für die Schifffahrt geordnete<br />
<strong>und</strong> sichere Begegnungsabläufe zu gewährleisten. Mit der<br />
Meldepflicht <strong>und</strong> der damit angestrebten sicheren Standortbestimmung<br />
der Verkehrsteilnehmer unmittelbar verknüpft<br />
ist die geplante Einführung des automatischen Identifikationssystems<br />
AIS.<br />
AIS - Ausrüstung<br />
dungsdaten eines Fahrzeugs in regelmäßigen, kurzen<br />
Zeitabständen. Zu unterscheiden sind statische Schiffsdaten<br />
(z.B. Name, Länge, Breite), dynamische Schiffsdaten<br />
(z.B. aktuelle Position, Geschwindigkeit) <strong>und</strong> Reisedaten<br />
(z.B. Ladung, Tiefgang, Zielort). Für die Datenabgabe<br />
ist es notwendig, an Bord einen Transponder, also einen<br />
Sender zu installieren, der die Daten des Schiffes <strong>und</strong> des<br />
jeweiligen Standortes sendet. Diese Daten werden in der<br />
Revierzentrale Minden auf einer elektronischen <strong>Wasser</strong>straßenkarte<br />
(IENC / Inland Electronic Navigation Charts)<br />
am Bildschirm dargestellt. So sind die Verkehrslage im<br />
Revier sowie der genaue aktuelle Standort eines Schiffes<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
10<br />
Wehrarm<br />
Landesberge n<br />
Schleu se<br />
Landesbergen<br />
Schleusenkanal<br />
Km<br />
1,52<br />
Legende:<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Einführung einer Verkehrsregelung auf der <strong>Mitte</strong>lweser unter Nutzung von AIS (Automatic Identification System)<br />
km<br />
2, 23<br />
Hafen<br />
Lieb enau<br />
Km 2 56,10 –256,40<br />
Regelungsstrecke<br />
Begegnung ES -ES<br />
Beid e Fahrzeuge mit<br />
2,50 m A bl adu ng<br />
nicht mögli ch<br />
als Pilotprojekt auf deutschen Binnenschifffahrtsstraßen<br />
feststellbar <strong>und</strong> die Schiffs- <strong>und</strong> Ladungsdaten abrufbar.<br />
Dieses System ist bereits am Rhein erprobt <strong>und</strong> eingesetzt<br />
worden. Die Besonderheit des an der <strong>Mitte</strong>lweser geplanten<br />
AIS-Einsatzes als Pilotbetrieb besteht darin, dass auch die<br />
Schiffe generell eine sogenannte Vollausstattung erhalten,<br />
das heißt, auch mit einer entsprechenden Software ausgestattet<br />
werden. Dabei handelt es sich im wesentlichen um<br />
die elektronischen Karten, aus denen die Schifffahrt im<br />
Revier die gleichen <strong>Informationen</strong> erhält wie die Revierzentrale,<br />
so dass mit diesem nautischen Hilfsmittel die aktuelle<br />
Verkehrslage von jedem Verkehrsteilnehmer erfasst werden<br />
kann <strong>und</strong> eine qualitativ hochwertige Selbstwahrschau<br />
ermöglicht wird. Damit ist AIS von herausragender Bedeutung<br />
für die Gewährleistung der Sicherheit des Schiffsverkehrs,<br />
aber zum Beispiel hinsichtlich des effektiven Schleuseneinsatzes<br />
oder der Verhinderung einer Rangbildung<br />
auch bedeutungsvoll für die Leichtigkeit des Schiffsverkehrs.<br />
Eine Abfrage bei der auf der Weser verkehrenden Schifffahrt<br />
zur Frage der Bereitschaft, die Fahrzeuge mit AIS<br />
auszurüsten, ist auf großes Interesse gestoßen. Die Vertreter<br />
der Schifffahrt sind jedoch nicht nur an der Erprobung<br />
von AIS interessiert, sondern beteiligen sich im Rahmen<br />
der Arbeitsgruppensitzungen, bei Besprechungen <strong>und</strong><br />
weiteren Kontakten mit viel Engagement, Sachverstand <strong>und</strong><br />
wichtigen Anregungen an der Abstimmung <strong>und</strong> Festlegung<br />
der Rahmenbedingungen der Einführung von AIS.<br />
Bege gnungsstre cke<br />
Bege gnung ES -ES<br />
möglich<br />
Stauhaltung Drakenburg<br />
Verkehrslenkungskonzept für Begegnung ES - ES<br />
ab <strong>2008</strong><br />
W e s e r<br />
Kiesgru be<br />
Rh einum schlag<br />
K m 2 62,4 0<br />
U ms chlag st e lle<br />
u nd L iegestel le<br />
Nienburg<br />
K m 26 7,97 - 2 68,1 0<br />
Kiesgrube<br />
Baltus<br />
km 272, 80<br />
U ms chlag ste lle<br />
L eeseri ngen<br />
U ms chlag st e lle<br />
km<br />
254,59<br />
Km<br />
255,1<br />
km<br />
k m 26 0,05<br />
Km<br />
km<br />
K alichem ie<br />
km 269,40<br />
km<br />
259,50<br />
263,4<br />
267,00<br />
275,6 1<br />
7 Min<br />
7 M in.<br />
11<br />
25 Min.<br />
33 Mi n.<br />
Funkkanal Schi ff -Schiff<br />
erforderlich<br />
Funkkanal Schi ff -Schiff<br />
Zwingend erforderlich<br />
12<br />
20 Min .<br />
26 min .<br />
Ein Vorteil der <strong>Mitte</strong>lweser zur Erprobung des umfassenden<br />
AIS-Einsatzes ist die Tatsache, dass es sich hier um eine<br />
rein nationale <strong>Wasser</strong>straße handelt. Das erlaubt es, eine<br />
Ausrüstungspflicht auch rechtlich ohne den Aufwand einer<br />
internationalen Abstimmung einzuführen, was wiederum<br />
der zeitnahen Umsetzung zugute kommt. Gleichwohl sind<br />
dabei auch die internationalen Rahmensetzungen zu beachten,<br />
damit sich das System in die zukünftigen Entwicklungen<br />
des Bereiches Telematik einfügt. Denn es ist absehbar,<br />
dass der Telematik <strong>und</strong> besonders dem automatischen<br />
Identifikationssystem AIS in der Binnenschifffahrt<br />
zukünftig eine wesentlich stärkere Bedeutung zukommen<br />
wird, als bisher. So führt Österreich das AIS auf der Donau<br />
ein, allerdings zunächst wohl nur mit einer Transponderausstattung<br />
der Fahrzeuge <strong>und</strong> auch in den Niederlanden<br />
gibt es insoweit konkrete Pläne.<br />
Ausblick<br />
Aktuell wird Anfang <strong>2008</strong> zwischen dem B<strong>und</strong>esministerium<br />
für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung, B<strong>und</strong>esverband der<br />
Deutschen Binnenschifffahrt <strong>und</strong> dem B<strong>und</strong>esverband der<br />
Selbständigen, Abteilung Binnenschifffahrt, sowie der <strong>WSD</strong><br />
<strong>Mitte</strong> darüber verhandelt, ob <strong>und</strong> wie die nicht unerhebliche<br />
Kosten verursachende Ausstattung der Schiffe mit AIS<br />
finanziell gefördert werden kann, um in der zweiten Jahreshälfte<br />
<strong>2008</strong> mit der geplanten Umsetzung starten zu können.<br />
18 Min.<br />
1<br />
24 Min .<br />
Me lde pu nk t<br />
An Lei tst ell e<br />
43 Min.<br />
Tal fa hrt<br />
Zeit bei 12 km/h<br />
5 7 Min.<br />
W SD Mi tte D ezer nat S<br />
13 14<br />
15<br />
16<br />
Km 2 56 Km 262 Km 265 Km 26 8 Km 275<br />
km<br />
0,23<br />
Bergfahrt<br />
Ze it be i 9 km/ h<br />
Schleu senkanal<br />
Schleuse<br />
Drakenburg<br />
30 m in<br />
30 Min .<br />
km<br />
3,21<br />
Wehr<br />
Drakenburg Dr<br />
Schl eus enkanäle<br />
Zeit bei 6 km/h
Martina Bode<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Stefan Rychlewski<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Der allgemeinen Entwicklung folgend, Managementsysteme<br />
in der Arbeitswelt zu etablieren, wurde am 18.11.2003<br />
eine Zielvereinbarung zum Aufbau eines Arbeitsschutzmanagementsystems<br />
(AMS) zwischen dem Referatsleiter<br />
Z 31 des B<strong>und</strong>esministeriums für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung<br />
<strong>und</strong> den Präsidenten der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektionen<br />
<strong>und</strong> den Leitern der B<strong>und</strong>esanstalten für<br />
<strong>Wasser</strong>bau <strong>und</strong> Gewässerk<strong>und</strong>e abgeschlossen.<br />
Vom Projektauftrag „Entwicklung <strong>und</strong> Vorbereitung eines<br />
Einführungskonzeptes eines Arbeitsschutzmanagementsystems<br />
in der WSV“ im Februar 2004 bis zur Auftaktveranstaltung<br />
im November <strong>2007</strong> wurde ein langer <strong>und</strong> zum<br />
Teil steiniger Weg beschritten.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage des nunmehr vorliegenden AMS-<br />
Handbuches wird zum 01.02.<strong>2008</strong> in allen Geschäftsbereichen<br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektionen, in der B<strong>und</strong>esanstalt<br />
für <strong>Wasser</strong>bau <strong>und</strong> in der B<strong>und</strong>esanstalt für<br />
Gewässerk<strong>und</strong>e ein einheitliches Arbeitsschutzmanagementsystem<br />
eingeführt. Das Handbuch hilft den Dienststellenleitungen,<br />
den Vorgesetzten <strong>und</strong> den AMS-Koordinatoren<br />
/ Koordinatorinnen bei der Umsetzung der erforderlichen<br />
Maßnahmen. Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit<br />
stehen, wie bisher auch, beratend zur Verfügung.<br />
Das „Handbuch zum Arbeitsschutzmanagement“ ist im<br />
Intranet der WSV unter folgender Adresse zu finden:<br />
http://intranet.wsv.bvbs.b<strong>und</strong>.de/verwaltung/organisation/ar<br />
beitssicherheit/Arbeitsschutzmanagement/index.html<br />
Ziele <strong>und</strong> Adressaten eines Arbeitsschutzmanagementsystems<br />
en zu<br />
vermeiden oder so weit wie möglich zu minimieren, liegt im<br />
gemeinsamen Interesse von Arbeitgebern <strong>und</strong> Beschäftigten.<br />
Deshalb sind die Sicherheit <strong>und</strong> der Ges<strong>und</strong>heitsschutz<br />
der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des<br />
Arbeitsschutzes zu sichern, an sich verändernde Gegebenheiten<br />
anzupassen <strong>und</strong> zu verbessern. Diese Verpflichtung<br />
richtet sich in erster Linie an die Dienststellenleitung sowie<br />
Arbeitsschutzmanagementsystem<br />
Die systematische Integration des Arbeits-<br />
schutzes in die Dienststellen der WSV<br />
an Personen, die mit Leitungsaufgaben beauftragt sind.<br />
Auch die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten<br />
<strong>und</strong> entsprechen den Weisungen des Arbeitgebers,<br />
für ihre Sicherheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit bei der Arbeit<br />
Sorge zu tragen.<br />
Mit Hilfe eines AMS sollen die Aktivitäten der Arbeitgeber<br />
<strong>und</strong> Beschäftigten der WSV zum Erreichen der vorgenannten<br />
Arbeitsschutzziele <strong>und</strong> zur Erfüllung der gesetzlichen<br />
Verpflichtungen durch ein systematisches, planmäßiges<br />
<strong>und</strong> zielorientiertes Arbeitsschutzhandeln optimiert <strong>und</strong> eine<br />
Verbesserung der Ges<strong>und</strong>heitsquote erreicht werden. Dadurch<br />
wird eine nachhaltige Verbesserung des Arbeitsschutzes<br />
erreicht.<br />
Das zukünftige Arbeitschutzhandeln in der WSV soll gewährleisten,<br />
dass<br />
• jede Organisation von klaren Arbeitsschutzzielen gelenkt<br />
wird,<br />
• die ges<strong>und</strong>heitlichen Beeinträchtigungen von Beschäftigten<br />
sowohl während des Arbeitslebens als auch über<br />
das Arbeitsleben hinaus stetig reduziert werden,<br />
• eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit<br />
<strong>und</strong> des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes erreicht wird,<br />
• die krankheits- <strong>und</strong> unfallbedingten Ausfallzeiten der<br />
Beschäftigten stetig reduziert werden,<br />
• die innerbetriebliche Organisation des Arbeitsschutzes<br />
so gestaltet wird, dass der Arbeitschutz integraler Bestandteil<br />
aller Arbeitsprozesse wird,<br />
• alle am Arbeitsprozess Beteiligten vor strafrechtlichen,<br />
zivilrechtlichen <strong>und</strong> disziplinarrechtlichen Folgen geschützt<br />
sind <strong>und</strong><br />
• alle Vorgesetzten <strong>und</strong> Mitarbeiter die Ziele der Arbeitssicherheit<br />
<strong>und</strong> des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes als Antrieb für<br />
ihr Handeln sehen (Motivation).<br />
Aufbau des AMS-Handbuches<br />
Das Handbuch ist in vier Teile gegliedert, wobei<br />
„Arbeitssicherheitsmanagement“ “ <strong>und</strong><br />
„Ges<strong>und</strong>heitsmanagement“<br />
die gr<strong>und</strong>legenden <strong>Informationen</strong> enthalten. Die dazu gehörenden<br />
Bausteine sollen allen Dienststellen der WSV ermöglichen,<br />
die Organisation der Arbeitssicherheit <strong>und</strong> des<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Arbeitsschutzmanagementsystem<br />
Die systematische Integration des Arbeitsschutzes in die Dienststellen der WSV<br />
Ges<strong>und</strong>heitsschutzes zu vereinfachen <strong>und</strong> die Arbeitsbedingungen<br />
in ihren Dienstellen so sicher <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>heitsfördernd<br />
wie möglich zu gestalten<br />
Arbeitssicherheitsmanagement<br />
Das Arbeitssicherheitsmanagement umfasst die gezielte<br />
Planung <strong>und</strong> Organisation von Sicherheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsschutz,<br />
sowie das konsequent-systematische Betreiben als<br />
Führungsaufgabe.<br />
Es trägt zur Verbesserung der Rechtssicherheit im Betrieb<br />
bei <strong>und</strong> hält die potenziellen Risiken für die Beschäftigten<br />
so gering wie möglich, in dem sichergestellt wird, dass von<br />
Anlagen, Arbeitsmitteln, Prozessen <strong>und</strong> Stoffen keine oder<br />
nur geringe Gefährdungen ausgehen.<br />
Die Risikominimierung wird z.B. durch folgende Maßnahmen<br />
erreicht:<br />
• Organisation des Arbeitsschutzes (Verantwortung von<br />
Vorgesetzten)<br />
• Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen (Anwendung<br />
der Handlungshilfe)<br />
• Berücksichtigung von vorgeschriebenen Prüfpflichten<br />
<strong>und</strong> Prüferqualifikation<br />
• Schutz vor physikalischen Einwirkungen (Lärm, Vibration)<br />
<strong>und</strong> Gefahrstoffen<br />
• Durchführung von Unterweisungen <strong>und</strong> Aufstellen von<br />
Betriebsanweisungen, resultierend aus den Ergebnissen<br />
der Gefährdungsbeurteilungen<br />
Problem<br />
(Quelle: AMS-Handbuch)<br />
Problemfeld<br />
Umsetzung<br />
Kontrolle<br />
Planung<br />
Entscheidung<br />
Lösung<br />
Fachausschuss<br />
Ges<strong>und</strong>heit<br />
Moderator<br />
Ges<strong>und</strong>heitszirkel<br />
• Analysieren <strong>und</strong> Auswerten von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten<br />
• Arbeiten mit Fremdfirmen usw.<br />
Ges<strong>und</strong>heitsmanagement<br />
Die Weltges<strong>und</strong>heitsorganisation definiert „Ges<strong>und</strong>heit“ folgendermaßen:<br />
„Ges<strong>und</strong>heit ist ein Zustand vollständigen körperlichen,<br />
geistigen <strong>und</strong> sozialen Wohlbefindens <strong>und</strong> nicht nur die<br />
bloße Abwesenheit von Krankheit <strong>und</strong> Gebrechen.“<br />
Das betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsmanagement betrachtet die<br />
Ges<strong>und</strong>heit der Beschäftigten als strategischen Faktor, der<br />
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, die Kultur <strong>und</strong> das<br />
Image der Dienststelle hat.<br />
Die betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung (BGF) ist ein wichtiger<br />
Bestandteil des Arbeitsschutzes <strong>und</strong> gewinnt mehr <strong>und</strong><br />
mehr an Bedeutung. Ziel der BGF ist es, durch individuelle<br />
Maßnahmen die Verbesserung von Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wohlbefinden<br />
am Arbeitsplatz zu erreichen.<br />
Reduzierte Belastungen, optimierte Arbeitsabläufe <strong>und</strong> eine<br />
Verbesserung der innerbetrieblichen Kommunikation, die<br />
Stärkung persönlicher Kompetenzen sowie eine aktive<br />
Beteiligung der Beschäftigten erhöhen die Arbeitszufriedenheit<br />
<strong>und</strong> Arbeitsmotivation.<br />
top - down<br />
bottom - up
Durch immer knapper werdende Personalressourcen <strong>und</strong><br />
der demographischen Entwicklung sind ges<strong>und</strong>e Beschäftigte<br />
unabdingbar. Ges<strong>und</strong>heitsschutzmaßnahmen im Betrieb<br />
lassen sich jedoch nicht verordnen, sondern müssen<br />
von allen Beschäftigten mitgetragen werden.<br />
Um eine effektive betriebliche Ges<strong>und</strong>heitsförderung zu<br />
gewährleisten, ist es notwendig, sich vorab ein Bild über die<br />
subjektive Wahrnehmung der Beschäftigten zu machen. Ein<br />
geeignetes Analyseinstrument ist hierzu eine Mitarbeiterbefragung<br />
in Form eines anonym auszufüllenden Fragebogens<br />
(<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong>).<br />
Gut geführte Beschäftigte sind in der Regel motiviert. Wissenschaftliche<br />
Untersuchungen erkennen einen Zusammenhang<br />
zwischen dem Führungsverhalten der Vorgesetzten<br />
<strong>und</strong> dem Ges<strong>und</strong>heitszustand der Beschäftigten. Gute<br />
Führung ist jedoch nicht immer einfach zu gewährleisten.<br />
Vorgesetzte müssen planen <strong>und</strong> organisieren, motivieren<br />
<strong>und</strong> kontrollieren, während sie selbst stark in die Projektarbeit<br />
<strong>und</strong> das Tagesgeschehen eingeb<strong>und</strong>en sind. Ein weiteres<br />
wichtiges Instrument zur Betrachtung des eigenen Führungsverhaltens<br />
ist die „Selbsteinschätzung der Vorgesetzten“<br />
(Baustein 9.2.1).<br />
Organisation Ges<strong>und</strong>heitsmanagement<br />
Als zentrales Instrument wird der Fachausschuss Ges<strong>und</strong>heit<br />
(als Teil des Arbeitsschutzausschusses) die Ziele<br />
der betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung steuern.<br />
Der Ges<strong>und</strong>heitszirkel ist das kommunikative <strong>und</strong> gestaltungsorientierte<br />
Instrument der betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung.<br />
Es handelt sich um ein, für eine begrenzte Zeit<br />
stattfindendes, regelmäßiges Treffen von Beteiligten, die<br />
ein aktuelles Problem des Ges<strong>und</strong>heitsschutzes aufgreifen<br />
<strong>und</strong> Verbesserungsvorschläge erarbeiten, deren Umsetzung<br />
vom Fachausschuss Ges<strong>und</strong>heit unterstützt <strong>und</strong> kontrolliert<br />
wird. Die Wirksamkeit betrieblicher Ges<strong>und</strong>heitsförderung<br />
lässt sich nicht sofort nach Durchführung diverser<br />
Ges<strong>und</strong>heitsfördermaßnahmen zuverlässig messen. Ein<br />
kontinuierlich weiter zu entwickelndes Ges<strong>und</strong>heitsmanagement<br />
trägt, auf Dauer gesehen, zur Arbeitszufriedenheit<br />
der Beschäftigten <strong>und</strong> damit auch zur Senkung des Krankenstandes<br />
bei.<br />
Weitere Vorgehensweise im<br />
AMS<br />
• Bis zum Ende des Monats Januar <strong>2008</strong> sind in den<br />
Behörden Einführungsveranstaltungen durchzuführen,<br />
bei denen die Leiterin/der Leiter der Behörde die wesentlichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> Zielsetzungen des Arbeitsschutzmanagementsystems<br />
darstellen.<br />
• Bei den beteiligten Behörden sind Koordinatoren für<br />
das Arbeitsschutzmanagementsystem in eigener Zuständigkeit<br />
zu bestellen.<br />
Arbeitsschutzmanagementsystem<br />
Die systematische Integration des Arbeitsschutzes in die Dienststellen der WSV<br />
• Bei der <strong>WSD</strong> West wird zum 01.01.<strong>2008</strong> eine Koordinierungsstelle<br />
AMS eingerichtet.<br />
• Erarbeitung <strong>und</strong> Durchführung von Umsetzungsmaßnahmen,<br />
orientierend am AMS-Handbuch.<br />
• Durchführung von Maßnahmen zur betrieblichen Ges<strong>und</strong>heitsförderung,<br />
orientierend an verschiedenen<br />
Analyseinstrumenten (z.B. Mitarbeiterbefragung).<br />
• Rückkoppelung anhand eines ersten Erfahrungsberichtes<br />
aller Dienststellen zum 01.01.2010.<br />
Resümee<br />
Die erfolgreiche Umsetzung des Arbeitsschutzmanagements<br />
in den Dienststellen steht im unmittelbaren Zusammenhang<br />
mit dem Verständnis, Arbeitsschutz nicht als eine<br />
alleinige Vorschrift des Gesetzgebers, sondern als eine<br />
Verpflichtung zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit<br />
zu sehen, um damit die Ges<strong>und</strong>heit der Beschäftigten<br />
zu schützen <strong>und</strong> die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.<br />
Durch das einfache „Abhaken“ der einzelnen Kapitel des<br />
Handbuches werden Arbeitssicherheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsschutz<br />
nicht automatisch in die betrieblichen Abläufe integriert.<br />
Die Philosophie des Arbeitsschutzesmanagements ist<br />
weitreichender <strong>und</strong> erfordert ein hohes Maß an Engagement<br />
seitens der Führungskräfte <strong>und</strong> einen immerwährenden<br />
Verbesserungsprozess.<br />
Das vorliegende AMS-Handbuch, das Verständnis, dass<br />
Arbeitsschutz gelebt werden muss <strong>und</strong> die Bereitschaft zum<br />
zielgerechteten <strong>und</strong> präventiven Arbeitsschutzhandeln<br />
können dazu beitragen, die Organisation bzw. die Arbeitsbedingungen<br />
<strong>und</strong> somit die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu<br />
verbessern.<br />
So wird aus einem anfänglich komplexen Arbeitsschutzmanagementsystem<br />
ein<br />
„Arbeiten mit Sicherheit“<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Dana Halbe<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
Voraussetzungen <strong>und</strong> Besonderheiten<br />
Das <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Hann. Münden betreut<br />
fast 400 km B<strong>und</strong>eswasserstraßen. Diese sind verteilt auf<br />
die beiden b<strong>und</strong>eseigenen Talsperren an Eder <strong>und</strong> Diemel<br />
sowie die Werra von Falken bis Hann. Münden, die Fulda<br />
von Mecklar bis Hann. Münden <strong>und</strong> die Oberweser von<br />
Hann. Münden bis kurz vor Rinteln.<br />
Sehr unterschiedlich stellen sich die Randbedingungen zur<br />
Nutzung der einzelnen <strong>Wasser</strong>straßen dar. So sind die<br />
Talsperren künstlich geschaffene Seen, die innerhalb eines<br />
Kalenderjahres schwankende <strong>Wasser</strong>stände aufweisen.<br />
Zum Mai jeden Jahres wird die Vollfüllung der Talsperren<br />
angestrebt. Im Sommer wird das <strong>Wasser</strong> verwendet, um<br />
insbesondere die Schifffahrt auf der Oberweser zu unterstützen.<br />
Dadurch sinkt der <strong>Wasser</strong>spiegel kontinuierlich <strong>und</strong><br />
erreicht in der Regel im Herbst des Jahres seinen Tiefststand.<br />
Die Zweckbestimmung der Talsperren schließt zwar<br />
auch heute noch nicht die Freizeitnutzung auf <strong>und</strong> an der<br />
Talsperre mit ein, unabhängig davon ist das Angebot <strong>und</strong><br />
auch der Grad der Nutzung Ende des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
sehr stark gestiegen.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Abb. 1: Planung der Staustufe in Carlshafen Ende 19. Jh<br />
Die Randbedingungen für den Nutzer an den Fließgewässern<br />
sind andere. Die Werra <strong>und</strong> die obere Fulda sind mit<br />
jahrh<strong>und</strong>ertealten festen Wehren versehen, die das <strong>Wasser</strong><br />
in den beiden Flussläufen nur in geringem Umfang aufstau-<br />
Freizeitnutzung der<br />
B<strong>und</strong>eswasserstraßen des<br />
WSA Hann. Münden<br />
Abb. 2<br />
en. Dadurch sinken die <strong>Wasser</strong>stände in den Sommermonaten<br />
in vielen Abschnitten auf weniger als einen Meter.<br />
Die Nutzung durch Motorboote ist hier in der Regel nicht<br />
möglich. Im Bereich der unteren Fulda, ungefähr ab Kassel,<br />
wurden in den 90 Jahren des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts die beweglichen<br />
Wehre erneuert, so dass dort auch heute noch<br />
eine durchgehende Stauhaltung vorhanden ist. Diese<br />
ermöglicht das Befahren gr<strong>und</strong>sätzlich für Fahrzeuge bis<br />
1,20 m Tiefgang.<br />
Die Pläne für eine Stauregelung der Oberweser Ende des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts wurden aufgr<strong>und</strong> der beiden Weltkriege<br />
<strong>und</strong> weiterer Schwierigkeiten nicht umgesetzt.<br />
[Abbildung 1+2]<br />
Die einzige Staustufe an der Oberweser findet man daher<br />
bis heute in Hameln. Die erste Schleuse wurde dort bereits<br />
im frühen 18. Jahrh<strong>und</strong>ert erbaut, die heutige Schleuse<br />
wurde 1933 fertiggestellt. Trotz dieser Stauanlage ist fast<br />
die gesamte Oberweser freifließend. Der <strong>Wasser</strong>stand ist<br />
dadurch stark von den jahreszeitlichen Gegebenheiten<br />
abhängig. Allerdings wird das <strong>Wasser</strong> aus den beiden Talsperren<br />
an Eder <strong>und</strong> Diemel dazu verwendet, den <strong>Wasser</strong>stand<br />
in der Oberweser zu erhöhen. Angestrebt wird dabei<br />
ein Zielwasserstand von 1,20 m am Pegel Hann. Münden.
Dieser Pegelwert entspricht einer tatsächlichen <strong>Wasser</strong>tiefe<br />
von r<strong>und</strong> einem Meter, an die sich die Nutzer anpassen<br />
müssen.<br />
Segeln<br />
Auf den beiden Talsperren findet man ausgesprochen<br />
attraktive <strong>und</strong> gut genutzte Segelreviere, deren Beliebtheit<br />
sich vor allem an der Anzahl an Bootsliegeplätzen zeigt.<br />
Auf der Edertalsperre sind es über 2.100 <strong>und</strong> an der deutlich<br />
kleineren Diemeltalsperre noch r<strong>und</strong> 100 Liegeplätze.<br />
Die dafür notwendigen Steganlagen mit teilweise über 50<br />
Liegeplätzen sind an beiden Talsperren in ausgewiesenen<br />
Hafengebieten konzentriert.<br />
[Abbildung 3]<br />
Jährlich finden auf den Talsperren Segelregatten statt; 20<br />
im Frühjahr <strong>und</strong> Sommer <strong>2007</strong>. Der Schwerpunkt liegt mit<br />
einem Anteil von 90% an der Edertalsperre.<br />
Abb. 3: Steganlagen an der Edertalsperre im Herbst<br />
Windsurfing<br />
Zusätzlich zu der Nutzung als Segelrevier kann auf beiden<br />
Talsperren auch Windsurfing betrieben werden. Sowohl für<br />
Anfänger als auch für Fortgeschrittene sind die Reviere<br />
geeignet. Dabei bieten die verschiedenen Buchten unterschiedliche<br />
Herausforderungen. Die Edertalsperre verfügt<br />
insgesamt über eine sehr anspruchsvolle Thermik <strong>und</strong><br />
bietet damit die besten Voraussetzungen, um hier jedes<br />
Jahr die Hessenmeisterschaften im Windsurfing auszutragen.<br />
Tauchen<br />
An den Talsperren wurden ausgewiesene <strong>und</strong> abgesperrte<br />
Tauchzonen eingerichtet. Zwei befinden sich an der Edertalsperre<br />
am linken Ufer von See-km 32,4 bis 33,2 (Tauchzone<br />
1) <strong>und</strong> von See-km 35,3 bis 36,0 (Tauchzone 2) <strong>und</strong><br />
eine befindet sich an der Diemeltalsperre am rechten Ufer<br />
Freizeitnutzung der B<strong>und</strong>eswasserstraßen des WSA Hann. Münden<br />
von See-km 5,0 bis 5,3. Eine gesonderte Genehmigung<br />
durch das Amt ist für das Tauchen innerhalb dieser Bereiche<br />
nicht erforderlich.<br />
Schwimmen<br />
Zusätzlich zu den vorhandenen öffentlichen Badestellen<br />
gibt es jährlich mehrere Schwimmveranstaltungen - einzeln<br />
oder im Rahmen eines Triathlons. Im Jahr <strong>2007</strong> wurden<br />
durch das WSA Hann. Münden acht Schwimm- <strong>und</strong> Triathlonveranstaltungen<br />
genehmigt.<br />
Kanu, Rudern, Drachenboot<br />
Auf allen <strong>Wasser</strong>straßen sind die verschiedenen muskelbetriebenen<br />
Fahrzeuge unterwegs wie z.B. Kanu oder Kajak,<br />
Ruderboote, Schlauchboote oder Drachenboote. An vielen<br />
Verleihstationen kann man sich Kanus oder Kajaks st<strong>und</strong>en-<br />
oder tageweise mieten. Derzeitig sind im WSA Hann.<br />
Münden r<strong>und</strong> 1.200 Verleihboote bei fast 60 Verleihstationen<br />
angemeldet. Ein Teil davon muss regelmäßig durch die<br />
Leiter der Außenbezirke oder Sachverständige überprüft<br />
werden. Zusätzlich sind viele mit eigenen oder mitgebrachten<br />
Fahrzeugen auf den <strong>Wasser</strong>straßen unterwegs. In <strong>2007</strong><br />
fand auf der Werra <strong>und</strong> der oberen Fulda eine Bootszählung<br />
der dort verkehrenden <strong>Wasser</strong>wanderer statt. Allein in<br />
den dabei berücksichtigten Streckenabschnitten von ca.<br />
180 km Länge wurden von Juni bis Oktober trotz der<br />
schlechten Witterung des Sommers r<strong>und</strong> 15.000 muskelbetriebene<br />
<strong>Wasser</strong>fahrzeuge gezählt, davon ungefähr 8.000<br />
auf der Werra.<br />
[Abbildung 4]<br />
Abb. 4: Paddelbootanleger in Beverungen an der Weser<br />
Außerdem werden in jedem Jahr eine Reihe von Wettkämpfen<br />
durchgeführt. Dabei reicht das Angebot von Vereinsmeisterschaften<br />
bis hin zu Deutschen Meisterschaften.<br />
In <strong>2007</strong> wurde die Durchführung von über 20 Wettkämpfen<br />
durch das WSA Hann. Münden genehmigt. Den größten<br />
Anteil hat dabei die Fulda im Bereich der Stadt Kassel.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Flößerei<br />
Die Berufsflößerei auf der Oberweser wurde <strong>Mitte</strong> des<br />
20. Jahrh<strong>und</strong>erts eingestellt. Seitdem besteht die Flößerei<br />
als reines Freizeitvergnügen. Die Nutzung eines Floßes ist<br />
nur auf den Fließgewässern gestattet. Auf den beiden Talsperren<br />
sind keine Flöße zugelassen. Eine Genehmigungspflicht<br />
für Flöße besteht immer bei gewerblicher Nutzung<br />
oder bei Abmessungen von mehr als 6,00 m Länge <strong>und</strong><br />
3,50 m Breite bzw. beim Transport von mehr als 12 Personen.<br />
Unterhalb dieser Grenzwerte ist keine Genehmigung<br />
erforderlich. Trotzdem sind bei der Nutzung von Flößen die<br />
Bestimmungen des „Merkblattes über Bau, Ausrüstung <strong>und</strong><br />
Bemannung von Flößen“, herausgegeben von der <strong>Wasser</strong><strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> in Hannover, zu beachten.<br />
Motorboote<br />
Auf den Talsperren sind lediglich Elektromotorboote zulässig.<br />
Ansonsten sind vor allem auf der unteren Fulda <strong>und</strong> der<br />
Oberweser Motorboote unterwegs. Entlang dieser <strong>Wasser</strong>straßen<br />
haben sich dementsprechend auch viele Vereine<br />
angesiedelt. Diese organisieren jährlich die verschiedensten<br />
Veranstaltungen <strong>und</strong> wirken wie auch alle anderen<br />
<strong>Wasser</strong>sportler bei der Durchführung von Großveranstaltungen<br />
mit. Zu beachten sind beim Einsatz der Motorboote<br />
die aktuellen <strong>Wasser</strong>stände. Gerade an der Oberweser<br />
können diese im Sommer für größere Fahrzeuge nicht<br />
immer ausreichend sein. Wie unterschiedlich sich die Situation<br />
in den Sommermonaten darstellen kann, zeigt Abbildung<br />
5.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Abb. 5: Pegel Hann.Münden Sommer 2006 <strong>und</strong> <strong>2007</strong> im Vergleich<br />
Freizeitnutzung der B<strong>und</strong>eswasserstraßen des WSA Hann. Münden<br />
<strong>Wasser</strong>ski<br />
Im gesamten Amtsbereich existieren mehrere <strong>Wasser</strong>skistrecken.<br />
Die einzelnen Strecken sind nachfolgend [Tabelle<br />
1] aufgelistet. Zu beachten sind hierbei die „Verordnung<br />
über das <strong>Wasser</strong>skilaufen auf den Binnenwasserstraßen“<br />
sowie die darüber hinausgehenden Einschränkungen der<br />
Nutzungszeiten der jeweiligen <strong>Wasser</strong>skistrecke, welche<br />
durch Zusatzschilder kenntlich gemacht werden.<br />
<strong>Wasser</strong>straße/Gemarkung Km<br />
Edertalsperre: rechtes Ufer 30,0 bis 31,00<br />
Fulda: Fuldabrück – Bergshausen 74,50 bis 75,40<br />
Fulda: Kassel – Wolfsanger 82,85 bis 83,55<br />
Werra: Laubach 82,26 bis 83,45<br />
Weser: Wahmbeck 38,20 bis 39,80<br />
Weser: Stahle - Heinsen 85,60 bis 87,00<br />
Weser: Kemnade 112,10 - 114,10
Fahrgastschifffahrt<br />
Sowohl auf den beiden Talsperren als auch auf der unteren<br />
Fulda <strong>und</strong> der Oberweser haben sich Fahrgastunternehmen<br />
etabliert. Insgesamt verkehren im Zuständigkeitsbereich<br />
des WSA Hann. Münden 8 Fahrgastunternehmen mit<br />
mehr als 15 Schiffen. Dabei reicht das Angebot von kleinen<br />
R<strong>und</strong>fahrten mit r<strong>und</strong> einer St<strong>und</strong>e Dauer über Linienfahrten<br />
zwischen den einzelnen Städten bis hin zu Sonderfahrten<br />
mit speziellem Programm an Bord oder entlang der<br />
Strecke. Die Saison der Fahrgastschifffahrt beginnt in der<br />
Regel an Ostern <strong>und</strong> endet Ende Oktober. Über die Wintermonate<br />
gilt ein eingeschränkter Fahrplan.<br />
[Abbildung 6]<br />
Fazit<br />
Freizeitnutzung der B<strong>und</strong>eswasserstraßen des WSA Hann. Münden<br />
Abb. 6: Fahrgastschifffahrt<br />
Diese Darstellung könnte noch um einiges ergänzt werden,<br />
z.B. gehört auch das Angeln an den Gewässern zu einer<br />
beliebten Nutzung. Das Spektrum ist sehr breit gefächert.<br />
Viele Veranstaltungen – allein im Jahr <strong>2007</strong> waren es mehr<br />
als 100 – gewähren Einblick in die Möglichkeiten. Trotzdem<br />
sollte man nicht vergessen, dass die Fließgewässer in<br />
früheren Zeiten vor allem als Transportwege für die Güter<br />
genutzt wurden. Heute bringen nur wenige Hann. Münden<br />
mit Güterschifffahrt in Verbindung. Allerdings lassen die<br />
aktuellen Anfragen zum Transport von Stückgütern hoffen,<br />
dass auch der Güterverkehr wieder an Bedeutung zunimmt.<br />
Im Jahr <strong>2007</strong> wurde die Machbarkeit eines solchen Transportes<br />
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In Hann. Münden<br />
wurden zwei Schwergutteile zum Transport nach Russland<br />
verladen <strong>und</strong> erfolgreich auf der Oberweser talwärts<br />
transportiert. [s. S. 17]<br />
Die Aufgabe des WSA Hann. Münden ist vor allem, die<br />
gleichzeitige Nutzung durch die verschiedensten Interessen<br />
zu genehmigen <strong>und</strong> in Zusammenarbeit mit der <strong>Wasser</strong>schutzpolizei<br />
zu überwachen. Trotz der unterschiedlichen<br />
Anforderungen steht dabei die Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit<br />
des Verkehrs auf dem <strong>Wasser</strong> <strong>und</strong> die gegenseitige Rücksichtnahme<br />
an erster Stelle. Dieses zu gewährleisten ist<br />
auch zukünftig eine spannende Herausforderung für die<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter des Amtes.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Olaf Nitsch<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Verden<br />
Im Amtsbereich des <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamtes Verden<br />
(WSA Verden) befinden sich 50 Stück Brücken im Zuge von<br />
öffentlichen Straßen. Von diesen Brücken sind 18 Stück als<br />
Spannbeton- bzw. Spannbetonverb<strong>und</strong>brücken hergestellt<br />
worden. Die Bauzeiten (1954 – 1960) liegen in der Anfangszeit<br />
der Spannbetontechnologie. An den erbauten<br />
Brücken sind zusätzlich verschiedene Ausführungen der<br />
Tragbewehrung umgesetzt worden.<br />
Im Rahmen der Einfachen Brückenprüfungen nach<br />
DIN 1076 fielen Rostfahnen an alten verschlossenen Bohrlöchern<br />
an den Brücken 35 <strong>und</strong> 59 auf. Wie sich in der<br />
weiteren Betrachtung herausstellte, sind diese Bohrlöcher<br />
1984 zur Entnahme <strong>und</strong> Untersuchung des Verpressmaterials<br />
in den Hüllrohren für die Spannstähle entstanden.<br />
Vom Prüfer wurde der Verdacht geäußert, dass die Spannbewehrung<br />
evtl. korrodiert ist <strong>und</strong> er stellte die Forderung<br />
zur Ursachenforschung.<br />
Bei den vorgenannten Brücken handelt es sich um die<br />
Spannbetonbrücken Nr. 35 (Abb. 1) am Unterhaupt der<br />
Schleuse Schlüsselburg <strong>und</strong> Nr. 59 im Schleusenunterkanal<br />
der Staustufe Langwedel.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Abb.: 1 Brücke Nr. 35<br />
Gefährdung durch Spannungsrisskorrosion<br />
an älteren<br />
Spannbetonbrücken<br />
Im Zuge der Erstellung des Zustandsgutachtens für die<br />
Brücke Nr. 59 ist die B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau (BAW)<br />
zu einer möglichen Ursache der Rostfahnen an beiden<br />
Brücken befragt worden. Dieser Umstand ließ sich theoretisch<br />
nicht erklären <strong>und</strong> deshalb wurden die alten Bohrlöcher,<br />
unter fachlicher Beratung der BAW Referat B 2, erneut<br />
geöffnet. Dabei ergaben sich folgende Schadensbilder<br />
(Abbildungen 2 – 9):<br />
Brücke 59<br />
Abb. 2: Rostfahne am Hauptträger<br />
Abb. 3: Korrodierter Spannstahl<br />
Ute Westrup<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Verden
Brücke 35<br />
Abb. 4: Detail<br />
Abb. 5: Detail<br />
Die filigrane Ausführung der Spannbewehrung (Mehrfachlitzen)<br />
<strong>und</strong> das festgestellte Schadensbild (gebrochene<br />
Litzen) führte aus Sicherheitsgründen zu einer sofortigen<br />
Reduzierung der zulässigen Verkehrsbelastung von 30 t auf<br />
6 t.<br />
Abb. 6: Korrodierte <strong>und</strong> gebrochene Spannstahllitzen<br />
Gefährdung durch Spannungsrisskorrosion an älteren Spannbetonbrücken<br />
Abb. 7: Detail<br />
Abb. 8: Detail<br />
Abb. 9: Detail<br />
Weitere Vorgehensweise<br />
Seitens der BAW wurde für jede der beiden Brücken ein<br />
umfangreiches Untersuchungsprogramm aufgestellt <strong>und</strong><br />
unter Mithilfe des WSA Verden abgewickelt.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Vor Ort wurden Proben des Verpressmaterials <strong>und</strong> des<br />
Spannstahls an statisch relevanten Stellen entnommen <strong>und</strong><br />
labortechnisch untersucht. Das Verpressmaterial (Tonerdeschmelzzement)<br />
hatte sich in einigen Proben bereits zersetzt.<br />
Eine Verb<strong>und</strong>wirkung mit dem Spannstahl war nicht<br />
mehr vorhanden. Aufgr<strong>und</strong> des vorgef<strong>und</strong>enen Zustands<br />
des Spannstahls war offensichtlich die Schutzwirkung des<br />
Verpressmaterials gegen Korrosion ebenfalls nicht mehr<br />
gegeben.<br />
Der in der Theorie angenommene Bruch an spannungsrissgefährdeten<br />
Stählen konnte an der Brücke Nr. 35 in situ<br />
(= im laufenden Prozess) festgestellt werden.<br />
Die Untersuchungen <strong>und</strong> Probeentnahmen wurden sowohl<br />
durch die BAW selbst als auch von Fremdfirmen durchgeführt.<br />
Parallel zu den Materialentnahmen wurde das rechnerische<br />
Vorankündigungsverhalten (d. h. erkennbare Rissbildung<br />
im Beton der Tragkonstruktion nach Ausfall von Spannbewehrung)<br />
der Überbauten nachgerechnet. Für beide Brücken<br />
konnte ein theoretisches Vorankündigungsverhalten<br />
ermittelt werden.<br />
Brücke Nr. 35<br />
Aufgr<strong>und</strong> des vorhandenen Vorankündigungsverhaltens<br />
konnte die zulässige Belastung für die Brücke Nr. 35 auf<br />
12 t erhöht werden, allerdings nur im Einbahnverkehr. Deshalb<br />
wurde die Überfahrt der Brücke durch Leitplanken auf<br />
eine Spurbreite reduziert (Abb. 10).<br />
Abb. 10: Eingeschränkte Überfahrt über die Brücke<br />
Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht wurde vom<br />
WSA Verden eine vierteljährliche Sonderprüfung nach<br />
DIN 1076 am Überbau durchgeführt. Zur Gefahrenabwehr<br />
sollte hiermit, bis zum Ende der prognostizierten Lebenszeit<br />
(31.08.2009) der Brücke, eine mögliche Veränderung<br />
(Rissbildung im Überbaubeton) frühzeitig erkannt werden.<br />
Da die personellen Kapazitäten für die Abwicklung der<br />
Neubaumaßnahme beim WSA Verden nicht ausreichen,<br />
wurde unverzüglich das <strong>Wasser</strong>straßen - Neubauamt<br />
Helmstedt (WNA Helmstedt) im Rahmen einer Projektvereinbarung<br />
mit dem Neubau einer Brücke an gleicher Stelle<br />
beauftragt.<br />
Da die Bedeutung der bisher für 30 t ausgelegten Brücke<br />
für den Raum Petershagen/Schlüsselburg sehr groß ist<br />
(Schulbusse, landwirtschaftlicher Verkehr mit Großgeräten),<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Gefährdung durch Spannungsrisskorrosion an älteren Spannbetonbrücken<br />
war das Herabstufen der zulässigen Verkehrslast ein großes<br />
Problem für die Region.<br />
Gemeinsam mit dem zuständigen Kreis Minden-Lübbecke<br />
wurde deshalb auch recht schnell ein gemeinsames Konzept<br />
für die neue Brücke entwickelt. Nach erfolgter öffentlicher<br />
Ausschreibung begann der Neubau der Brücke im<br />
November <strong>2007</strong>.<br />
Die neue Brücke entsteht an gleicher Stelle <strong>und</strong> soll bereits<br />
im Sommer <strong>2008</strong> für den Verkehr freigegeben werden.<br />
Brücke Nr. 59<br />
Zusätzlich zu den durchgeführten Materialuntersuchungen<br />
wurde an der Brücke Nr. 59 im November 2006 eine umfangreich<br />
vorbereitete Probebelastung der Brücke durchgeführt.<br />
Abb. 11: Probebelastung durch LKW<br />
Hierbei wurden drei Lkws mit unterschiedlichem zulässigen<br />
Gesamtgewicht (23 t / 23 t / 40 t) an vorher genau berechneten<br />
Stellen des Überbaus platziert (Abb. 11). Zusätzlich<br />
sind diese Lkws in verschiedenen Lastkombinationen auf<br />
dem Überbau verteilt worden.<br />
Abb. 12: Dehnungsmessstreifen für die Betonspannung<br />
Bei der jeweiligen Lastkombination wurde die Dehnung des<br />
Spannstahls <strong>und</strong> des angrenzenden Beton in situ gemessen<br />
(Abb. 12, 13 u. 14). Die Messungen dienten zur Verifizierung<br />
des Rechenmodels der B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau.
Aufgr<strong>und</strong> der gemessenen Werte konnte nachgewiesen<br />
werden, dass der Verb<strong>und</strong> Spannstahl <strong>und</strong> Beton noch im<br />
angenommenen Maße vorhanden ist <strong>und</strong> die prognostizierte<br />
Reststandzeit bis zum 31.12.2009 gerechtfertigt ist.<br />
Abb. 13: Dehnungsmessstreifen für die Stahlspannung<br />
Eine Instandsetzung / Verstärkung des ÜÜberbaus<br />
ist<br />
bauartbedingt nicht möglich. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e ist auch<br />
hier mit dem WNA Helmstedt ein Projektauftrag für den<br />
Neubau der Brücke abgeschlossen worden.<br />
Abb. 14: Echtzeitdarstellung der Messergebnisse<br />
Die Rahmenbedingungen für den Neubau der Brücke erfordern<br />
die Durchführung eines Planfeststellungsverfahren.<br />
Mit einem Baubeginn kann daher frühestens ab 2010 gerechnet<br />
werden.<br />
Die Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis Verden, um<br />
die Gr<strong>und</strong>lagen des Neubaus festzulegen, haben bereits<br />
stattgef<strong>und</strong>en.<br />
Gefährdung durch Spannungsrisskorrosion an älteren Spannbetonbrücken<br />
Weitere Spannbetonbrücken<br />
Die verbleibenden weiteren 17 Stück Spannbetonbrücken<br />
wurden auf Basis des BMV-Erlasses vom 27.10.1993,<br />
BW 21/52.12.01/92 BAW 93, in 4 Gefährdungsklassen<br />
eingeordnet.<br />
Hiernach sind 7 Brücken in die Gefährdungsklasse 1 + 2<br />
eingestuft worden <strong>und</strong> gelten damit in Bezug auf die Spannungsrisskorrosion<br />
als gefährdet.<br />
Die übrigen Bauwerke sind zum jetzigen Zeitpunkt als unkritisch<br />
zu betrachten.<br />
An den als gefährdet eingestuften Brücken ist ein umfangreiches<br />
Untersuchungsprogramm durchgeführt worden.<br />
Hierbei sind Bohrkerne zur Bestimmung der Spaltzugfestigkeit<br />
des Betons entnommen worden, außerdem wurden<br />
Proben des eingesetzten Verpressmaterials genommen.<br />
Als Ergebnis dieser Beprobung wurde nur noch bei einem<br />
weiteren Bauwerk die Verwendung des kritischen Tonerdeschmelzzementes<br />
nachgewiesen.<br />
Da es sich hierbei allerdings um eine Verb<strong>und</strong>brücke handelt<br />
<strong>und</strong> lediglich die Fahrbahnplatte quer vorgespannt ist,<br />
sind z. Z. keine weiteren Maßnahmen erforderlich.<br />
Neben den durchgeführten Materialuntersuchungen wurden<br />
von der BAW für die Brücken Nr. 38 <strong>und</strong> Nr. 48 Nachrechnungen<br />
des Vorankündigungsverhaltens durchgeführt. Die<br />
Berechnung ergab, dass ein Vorankündigungsverhalten<br />
rechnerisch nicht vorhanden ist. Aufgr<strong>und</strong> der robusten<br />
Bauweise der Brücken wurde jedoch von der BAW eine<br />
weitere Nutzung dieser Bauwerke uneingeschränkt empfohlen.<br />
Die Nachrechnung der weiteren 5 Brücken wird vom WSA<br />
Verden im Frühjahr <strong>2008</strong> vergeben. Mit der Vorlage dieser<br />
Ergebnisse ist die umfangreiche Untersuchung der spannungsrisskorrosionsgefährdeten<br />
Brücken im Amtsbereich<br />
angeschlossen.<br />
Fazit<br />
Abschließend bleibt festzuhalten, dass aus der bisher bekannten<br />
Problematik der Spannbetontechnologie der frühen<br />
Jahre diese Bauwerke in der Überwachung auch in Zukunft<br />
ein besonderes Augenmerk erfordern werden. Neue Erkenntnisse<br />
nach möglichen weiteren Schadensfällen könnten<br />
mittelfristig den Neubau weiterer Brücken zur Folge<br />
haben.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Heinz-Jürgen Helming<br />
Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong><br />
Minden<br />
Der folgende Beitrag stellt die unterschiedlichen, betrieblichen<br />
Anforderungen an Sicherheitsfunknetzen für <strong>Wasser</strong>bauwerke<br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion (<strong>WSD</strong>)<br />
<strong>Mitte</strong> am Beispiel der Edertalsperre <strong>und</strong> der Schleuse<br />
Uelzen II dar. Das übergeordnete Ziel ist jeweils die Steigerung<br />
des Sicherheitsniveaus für die vor Ort eingesetzten<br />
Arbeitskräfte.<br />
Sicherheitsfunknetz für die<br />
Edertalsperrmauer<br />
Die Edertalsperre liegt im Quellgebiet der Eder zwischen<br />
Korbach <strong>und</strong> Bad Wildungen.<br />
Abb. 1: Edertalsperre<br />
Ihre Staumauer ist eine gekrümmte Schwergewichtsmauer<br />
mit einer Höhe von 47 m <strong>und</strong> einer Kronenlänge von ca.<br />
400 m (Abb. 1).<br />
Im Innern der Mauer sind an verschiedenen Stellen messtechnische<br />
Einrichtungen installiert, die über zwei in unterschiedlichen<br />
Höhen befindliche Kontrollgänge (Abb. 2) zu<br />
erreichen sind.<br />
Abb. 2: unterer Kontrollgang<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Einrichtung von Sicherheitsfunknetzen<br />
für <strong>Wasser</strong>bauwerke<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Die Inspektionsarbeiten an den messtechnischen Anlagen<br />
sind bisher von 2 Beschäftigten des Außenbezirks (ABz)<br />
Edertal ausgeführt worden. Durch die Veränderung der<br />
Arbeitssituation müssen diese Tätigkeiten zukünftig als sog.<br />
„Alleinarbeitsplatz“ ausgeübt werden.<br />
Für die Personensicherung in den Kontrollgängen der Talsperre<br />
ergab sich somit die Notwendigkeit zum Aufbau<br />
einer Rettungskette. Sollte der Beschäftigte einen Unfall<br />
innerhalb der Staumauer haben, ist der ABz Edertal anzusprechen,<br />
um weitere Rettungsmaßnahmen einzuleiten.<br />
Hierfür war ein besonderes Sicherheitsfunknetz zu erstellen,<br />
welches gewährleistet, dass in allen begehbaren Bereichen<br />
der Talsperrenmauer die dauernde Erreichbarkeit für<br />
tragbare Handsprechfunkgeräte sichergestellt wird.<br />
Durch Funkreichweitenversuche wurde festgestellt, dass<br />
die funktechnische Überdeckung aller relevanten Bereiche<br />
mit Richtfunkantennen nicht sichergestellt werden konnte.<br />
Als alleinige Lösung wurde der Einsatz spezieller Funkkabel,<br />
bei denen sich die elektromagnetischen Wellen gleichmäßig<br />
in alle Richtungen ausbreiten, ermittelt.<br />
Diese sog. Schlitzkabel (Abb. 3)<br />
bestehen aus einem Innenleiter<br />
aus Cu-Rohr, einer Isolierung aus<br />
PE-Schaum <strong>und</strong> einem Aussenleiter<br />
aus Kupferfolie, der in<br />
bestimmten, genau definierten<br />
Bereichen mit Öffnungen, sog.<br />
Schlitzen, versehen ist. Der<br />
äußere Mantel besteht aus<br />
Polyäthylen. Das Kabel hat einen<br />
Durchmesser von 21,6 mm (5/8“),<br />
ist halogenfrei, flammwidrig <strong>und</strong><br />
Abb. 3: Schlitzkabel<br />
feuerhemmend. Somit wurde ein Betriebsfunksystem mit<br />
Schlitzkabelantennen zur funktechnischen Versorgung aller<br />
begehbaren Bereiche der Staumauer vorgegeben.<br />
Folgende Funktionsanforderungen<br />
werden erfüllt:<br />
Die Funkverbindung vom oberen zum unteren Kontrollgang<br />
ist zwingend vorgeschrieben.<br />
Innerhalb der Kontrollgänge muss eine sichere <strong>und</strong> einfach<br />
zu bedienende Funkkommunikation zwischen mehreren<br />
Personen mit tragbaren Handsprechfunkgeräten möglich<br />
sein.
Die bereits bestehende Betriebsfunkeinrichtung für den<br />
Bereich des ABz Edertal mit einer abgesetzt betriebenen<br />
ortsfesten Funkstelle (Abb. 4), dessen Antenne mit Sende/Empfangsgerät<br />
auf dem Peterskopf stationiert ist, wurde<br />
mit in das neu aufzubauende Funksystem integriert.<br />
Zur einfachen Mitarbeiterführung<br />
durch den ABz sollten<br />
die Bedienung der bestehenden<br />
Funkeinrichtung<br />
sowie der neuen Funkeinrichtung<br />
für die Kontrollgangversorgung<br />
künftig über<br />
ein gemeinsames Bediengerät<br />
in Tischausführung<br />
vom Büro des ABz aus<br />
erfolgen. Ergänzend zu den<br />
v. g. Rufbedienungen waren<br />
die Funktionen der Alarmaufnahme<br />
<strong>und</strong> Anzeige für<br />
Abb. 4: ortsfeste Funkstelle<br />
Einrichtung von Sicherheitsfunknetzen für <strong>Wasser</strong>bauwerke der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
die Personensicherung im<br />
Bediengerät mit aufzunehmen.<br />
Die Alarmmeldungen müssen während der normalen Betriebszeiten<br />
von der internen Abfragestelle beim ABz<br />
Edertal <strong>und</strong> von allen mobilen <strong>und</strong> tragbaren Geräten im<br />
Sendebereich der Funkstelle Peterskopf empfangen werden<br />
können.<br />
Ist der ABz nicht besetzt (z.B. an Sonn- <strong>und</strong> Feiertagen)<br />
erfolgt die Alarmweitergabe automatisch an die dauernd<br />
besetzte Abfragestelle in der Betriebszentrale Minden.<br />
Die Alarmweitergabe an diese externe Abfragestelle ist mit<br />
einer integrierten Alarmtextansage ausgerüstet worden. Die<br />
vom Anlagenbetreiber vorgegebenen Meldetexte werden in<br />
Form gut verständlicher Sprachmeldungen an diese externe<br />
Abfragestelle übertragen.<br />
Zusätzlich sind die Handsprechfunkgeräte mit einem gegen<br />
unbeabsichtigte Fehlauslösung gesicherten Alarmtaster<br />
ausgerüstet worden, mit dem im Gefahrenfall ein manueller<br />
Alarm ausgelöst werden kann.<br />
Des Weiteren wurden die tragbaren Geräte mit einer lageabhängigen<br />
Alarmauslösung versehen, um bei einer Geräte-Neigung<br />
außerhalb der für den Tragebetrieb üblichen<br />
Position ( ca. 60° zur Senkrechten) eine vom Bediener<br />
unabhängige Alarmauslösung auszuführen.<br />
Sollte der Mitarbeiter stürzen <strong>und</strong> somit nicht in der Lage<br />
sein, einen Alarm selbsttätig auszulösen, erfolgt die Auslösung<br />
automatisch.<br />
Die Versorgung der Funkstellen <strong>und</strong> der Zentraleinrichtung<br />
muss auch bei Netzausfall für einen definierten Zeitraum<br />
sicher gestellt sein. Eine ausreichend dimensionierte unterbrechungsfreie<br />
Stromversorgung (USV) muss einen Überbrückungszeitraum<br />
von 4 St<strong>und</strong>en (bei 30% Sender <strong>und</strong><br />
70% Standbybetrieb) zulassen.<br />
Sowohl Netzausfälle als auch Störungen oder Ausfälle der<br />
Ladeeinrichtung sowie die Betriebsbereitschaft der<br />
USV-Einrichtung werden überwacht. Bei Erkennung einer<br />
Störung wird diese an die zentrale Abfrage- <strong>und</strong> Bedienstelle<br />
beim ABz Edertal gemeldet <strong>und</strong> dort in geeigneter Weise<br />
signalisiert.<br />
Die USV-Einrichtung ist zusammen mit der Funkeinrichtung<br />
<strong>und</strong> den erforderlichen HF-Kopplern (HF: Hochfrequenz)<br />
<strong>und</strong> Anschalteinheiten in je einem Schaltschrank untergebracht<br />
. Ein Schutz gegen Korrosion <strong>und</strong> Tropfwasser ist<br />
hierbei vorhanden.<br />
Die Funktionen bzw. der Zustand für die Betriebsbereitschaft<br />
der einzelnen Module muss über Anzeigen (LED<br />
wird bevorzugt) an der jeweiligen Komponente erkennbar<br />
sein.<br />
Zum Anschluss für einen bauseitig bereit gestellten<br />
ISDN- Basisanschluss muss in der Zentraleinrichtung ein<br />
Anschlusspunkt eingerichtet sein. Über diesen Anschlusspunkt<br />
soll bei Alarmauslösung eine automatisch gesteuerte<br />
Wählverbindung zur externen Abfragestelle nach Minden<br />
bedient werden.<br />
Funktionsanforderungen an<br />
die Alarmierung im Sicherheitsfunknetz<br />
Jedes innerhalb der Staumauer eingesetzte tragbare Gerät<br />
muss mit einer eigenständigen Rufkennzeichnung eine<br />
eindeutige Standortzuordnung des übermittelten Alarms<br />
ermöglichen.<br />
Eine bereits erfolgte Alarmauslösung darf vom Träger des<br />
Handsprechfunkgerätes nicht mehr gelöscht werden können.<br />
Der ausgelöste Alarm läuft zuerst an der Bedienstelle beim<br />
ABz auf <strong>und</strong> wird von dort bearbeitet.<br />
Zur Rücksetzung dieses externen Signals muss am Tischbedienteil<br />
eine Löschtaste „Alarm abschalten“ vorhanden<br />
sein.<br />
Die dauerhafte Abschaltung darf jedoch mit dieser Taste<br />
nicht verb<strong>und</strong>en sein.<br />
Ein nachfolgender erneuter Alarm muss in gleicher Weise<br />
ablaufen.<br />
Wird am ABz-Bediengerät bei aufgelegtem Handhörer die<br />
Alarmmeldung nicht innerhalb einer definierbaren Reaktionszeit<br />
bearbeitet, so muss eine automatische Weiterleitung<br />
der Alarmfunktion an die Betriebszentrale Minden<br />
erfolgen.<br />
Dazu muss über den ISDN-Anschluss eine Wählverbindung<br />
zu der vorgegebenen Abfragestelle aktiviert werden <strong>und</strong> ein<br />
Meldetext (Sprachansage) an die angerufene Abfragestelle<br />
übertragen werden.<br />
Sicherheitsfunknetz für die<br />
Schleuse Uelzen II<br />
Die Schleuse Uelzen II liegt am Elbe-Seitenkanal (ESK)<br />
zwischen Wittingen <strong>und</strong> Uelzen nahe der Ortschaft Esterholz<br />
(Abb. 5).<br />
Abb. 5: Schleuse Uelzen II<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Sie hat eine Nutzlänge von 190 m <strong>und</strong> überwindet eine<br />
Fallhöhe von 23 m zwischen der mittleren <strong>und</strong> der unteren<br />
Haltung des ESK.<br />
Eine Begehung der Schleuse durch die örtlich zuständige<br />
Feuerwehr hat ergeben, dass innerhalb der Betriebs- <strong>und</strong><br />
Kontrollgänge aufgr<strong>und</strong> der Stahlbetonwände keine Funkkommunikation<br />
der Einsatzkräfte mit einer außerhalb der<br />
Schleuse befindlichen Einsatzleitung möglich ist. Diese<br />
Kommunikation im Einsatzfalle ist für die Einsatzkräfte<br />
jedoch lebenswichtig, um eingeschlossene Personen rechtzeitig<br />
bergen zu können.<br />
Die Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong> (FMM) wurde deshalb<br />
beauftragt, für die Personensicherung in den Gängen<br />
<strong>und</strong> Räumlichkeiten der Schleuse ein besonderes Sicherheitsfunknetz<br />
zu erstellen. Die örtlichen Besonderheiten<br />
bedingen, dass für die Betriebs- <strong>und</strong> Kontrollgänge (Abb. 6)<br />
incl. der Technikräume eine optimale Funkversorgung für<br />
tragbare Handsprechfunkgeräte zu allen begehbaren Bereichen<br />
gewährleistet sein muss.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Abb. 6: Betriebsgänge Ebene 3<br />
Durch Funkreichweitenversuche konnte ermittelt werden,<br />
dass durch die Verlegung eines Strahlerkabels (als sog.<br />
Ringleitung) eine funktechnische Versorgung aller Kontroll<strong>und</strong><br />
Verbindungsgänge, der Treppenhäuser <strong>und</strong> des Steuerstandes<br />
funkmäßig sichergestellt werden kann (gute<br />
Sprachverständigung).<br />
Damit die Funkversorgung auch in den Kontrollgängen zu<br />
den Sparbecken gewährleistet ist, wurden an 7 verschiedenen<br />
Stellen im Bereich der Drucktüren sog. Auskoppelpunkte<br />
vorgesehen.<br />
Zur Funkverbindung der Handsprechfunkgeräte der Feuerwehr<br />
mit dem Einsatzleitfahrzeug als auch zur Funkverbindung<br />
der Handsprechfunkgeräte der WSV sind zwei Funksysteme<br />
mit folgenden Anforderungen zu installieren:<br />
Funksystem 1 (BOS - Funkanlage)<br />
Nach den funktechnischen Forderungen zur Einsatzunterstützung<br />
der Feuerwehr ist ein Gebäudefunksystem zu<br />
installieren, welches aus einer Solo-Funkstelle besteht.<br />
Diese kann verwendet werden, da eine Funkstelle das<br />
gesamte Gebäude ausleuchten kann.<br />
Die Funkstelle hat den Technischen Richtlinien der Behörden<br />
<strong>und</strong> Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)<br />
Teil C zu entsprechen.<br />
Einrichtung von Sicherheitsfunknetzen für <strong>Wasser</strong>bauwerke der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Die Aktivierung der Funkanlage erfolgt automatisch über<br />
die Brandmeldeanlage <strong>und</strong> kann zusätzlich bei Bedarf<br />
manuell über ein Feuerwehr-Bedienfeld eingeschaltet werden.<br />
Das Strahlerkabelsystem ist als Schleife mit einer Einspeisung<br />
vorzusehen.<br />
Die Dämpfung des Antennen-Netzwerkes ist so auszulegen,<br />
dass zu einem späteren Zeitpunkt der digitale Funkdienst<br />
TETRA mit ausreichender Red<strong>und</strong>anz eingespeist<br />
werden kann. Somit wird die absehbare technische Veränderung<br />
bei der Feuerwehr bereits berücksichtigt.<br />
Funksystem 2 (WSV – Funkanlage)<br />
Dieses ortsfeste Funkgerät ist so aufzubauen, dass es über<br />
ein Koppelnetzwerk an das Antennennetzwerk der<br />
BOS-Funkanlage angeschaltet werden kann. So wird die<br />
Kommunikation des PU-Personals mit dem Schleusensteuerstand<br />
sichergestellt.<br />
Für die Personensicherung in den Kontroll- <strong>und</strong> Verbindungsgängen<br />
sowie in den Treppenhäusern der Schleuse<br />
muss die Anlage über ein sicher funktionierendes Alarmsystem<br />
verfügen. Die weiteren Anforderungen sind mit dem<br />
Sicherheitsfunknetz in der Edertalsperrmauer vergleichbar.<br />
Ausblick<br />
Aus den vorstehenden Ausführungen zur Einrichtung der<br />
unterschiedlichsten Sicherheitsfunkanlagen wird deutlich,<br />
dass aus den unterschiedlichsten Motivationen diese Funkanlagen<br />
zu errichten sind.<br />
Steht bei dem Funknetz in der Edertalsperrmauer der Alleinarbeitsplatz<br />
im Vordergr<strong>und</strong>, so ist es bei dem kombinierten<br />
Funknetz in der Schleuse Uelzen II der feuerwehrtechnische<br />
Aspekt (Retten, Bergen, Löschen unter Funkführung<br />
von der Leitstelle).<br />
Als weiteres, demnächst anstehendes sicherheitsrelevantes<br />
Projekt wurde die FMM vom WSA Hann Münden mit dem<br />
Aufbau der Notfallrettungskette für die Staumauer der<br />
Diemeltalsperre beauftragt.<br />
Dieses neu einzurichtende Funknetz ist analog zum System<br />
in der Edertalsperrmauer aufzubauen.<br />
Die fachliche Betreuung des Auftraggebers, intensive Ausarbeitung<br />
<strong>und</strong> Ausschreibung der Maßnahme incl. Auftragsabwicklung<br />
wird durch die FMM als Bündelungsstelle<br />
der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> wahrgenommen.<br />
Mit dem dritten Projekt ergibt sich eine Standardisierung<br />
der Technik, die von der FMM individuell auf die betreffende<br />
Organisation <strong>und</strong> ihre Aufgabenstellung zugeschnitten<br />
wird.<br />
Die dargestellten Maßnahmen tragen erheblich zur Steigerung<br />
der Arbeitssicherheit bei <strong>und</strong> berücksichtigen die aktuellen<br />
Veränderungen in der Arbeitsorganisation.
Andreas Bartel<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Braunschweig<br />
Die Leineabstiegsschleuse befindet sich in Hannover-<br />
Limmer im Verbindungskanal zur Leine (VKL), der den<br />
Stichkanal nach Linden <strong>und</strong> die Leine verbindet. Die<br />
Schleuse wurde in den Jahren 1913/14 gebaut <strong>und</strong> steht<br />
unter Denkmalschutz. Es handelt sich um eine Einkammerschleuse<br />
mit 106,5 m Gesamtlänge, 10 - 13 m Kammerbreite<br />
<strong>und</strong> ca. 1,90 m Fallhöhe.<br />
Die Schleuse wird seit Jahrzehnten fast ausschließlich von<br />
Fahrgastschiffen <strong>und</strong> Sportbooten genutzt. In den Jahren<br />
1990 – 2005 wurden durchschnittlich 415 Schleusungen<br />
pro Jahr, vorwiegend in den Sommermonaten, durchgeführt.<br />
Die Schleuse besteht aus den Schleusenhäuptern <strong>und</strong> der<br />
dazwischen liegenden Schleusenkammer, die durch Fugen<br />
von den Häuptern getrennt ist.<br />
Die Schleusenkammer ist 78,80 m lang. In Abb. 1 ist ein<br />
Abb. 1: Querschnitt der alten Schleusenkammer<br />
Gr<strong>und</strong>instandsetzung der<br />
Leineabstiegsschleuse<br />
Querschnitt durch die alte Schleusenkammer dargestellt.<br />
Bei den Wänden handelt es sich um Schwergewichtswände<br />
aus unbewehrtem Stampfbeton, die im Überwasserbereich<br />
<strong>und</strong> in der <strong>Wasser</strong>wechselzone mit Klinkermauerwerk verblendet<br />
sind. Im Bereich der Poller <strong>und</strong> Leiternischen sind<br />
die Wände im Abstand von 17,5 m verstärkt. Die Wände<br />
sind kammerseitig ger<strong>und</strong>et. Die Kammersohle besteht aus<br />
Druckriegeln b/d = 0,80/1,25 m im Abstand von 8,40 m <strong>und</strong><br />
einer dazwischen betonierten 0,50 m dicken Sohle mit<br />
Entlastungsöffnungen Ø 10 cm. (Abb. 1)<br />
Bei den Häuptern handelt es sich um massige, unbewehrte<br />
Rahmenbauwerke in U-Form mit Klinkerverblendung in den<br />
bewitterten Bereichen <strong>und</strong> der <strong>Wasser</strong>wechselzone. Die<br />
Wendenischen <strong>und</strong> Drempelanschläge der Schleusentore<br />
<strong>und</strong> die vertikalen Ecken der Häupter sind mit großformatigen<br />
Natursteinen aus Basaltlava eingefasst.<br />
Als Schleusenverschlüsse sind Stemmtore mit integrierten<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Schützen zum Befüllen <strong>und</strong> Entleeren der Schleuse vorhanden.<br />
Auf dem Schleusenunterhaupt befindet sich eine dreifeldrige<br />
Stahlbrücke.<br />
Bauwerksschäden <strong>und</strong> ungenügende<br />
Stand- <strong>und</strong> Auftriebssicherheit<br />
Bei der Bauwerksprüfung im Jahr 1993 wurde neben altersbedingten<br />
Schäden <strong>und</strong> Abnutzungen insbesondere<br />
eine stellenweise extrem schlechte Qualität des Schleusenbetons<br />
festgestellt.<br />
Zur Ermittlung von Gr<strong>und</strong>lagen für die Erarbeitung eines<br />
Instandsetzungskonzeptes wurden 1993 Betonbohrkerne<br />
aus dem Bauwerk entnommen. Im Schleusenbereich wurden<br />
Erk<strong>und</strong>ungsbohrungen durchgeführt <strong>und</strong> 10 Gr<strong>und</strong>wassermessstellen<br />
eingerichtet, an denen kontinuierlich die<br />
Gr<strong>und</strong>wasserstände gemessen wurden.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage der v.g. Beton- <strong>und</strong> Baugr<strong>und</strong>untersuchungen,<br />
zusätzlicher Betonprüfungen sowie einer umfangreichen<br />
Bestandsaufnahme im Oktober 2000 hat die B<strong>und</strong>esanstalt<br />
für <strong>Wasser</strong>bau (BAW) ein Gutachten zum baulichen<br />
Zustand der Leineabstiegsschleuse erstellt.<br />
Die wesentlichen Feststellungen des Gutachtens sind:<br />
• Der Beton lässt sich der Festigkeitsklasse B5 zuordnen.<br />
• Im wasserseitigen Randbereich befinden sich lokal<br />
begrenzte Bereiche ohne Verb<strong>und</strong> zwischen den Zuschlagskörnern<br />
(nur noch Kies), wobei der tatsächliche<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Gr<strong>und</strong>instandsetzung der Leineabstiegsschleuse<br />
Abb. 2: Querschnitt der neuen Schleusenkammer, die in die alte Kammer betoniert wurde<br />
Umfang dieser stark geschädigten Bereiche wegen einer<br />
äußeren Schale aus höherwertigem Beton nicht erkennbar<br />
ist.<br />
• Wegen der stark geschädigten Bereiche ist eine Trockenlegung<br />
der Schleuse ohne Abstütz- oder Entlastungsmaßnahmen<br />
nicht möglich.<br />
• Bei intaktem Beton ist eine Trockenlegung nur bei<br />
Gr<strong>und</strong>wasserständen unter NN +47,50 m möglich, da<br />
andernfalls die Standsicherheit gefährdet ist.<br />
• Der Beton der Kammersohle ist weitestgehend intakt.<br />
• Wegen verstopfter Entlastungsöffnungen der Kammersohle<br />
darf die Schleuse nur bis zu einer Gr<strong>und</strong>wasserhöhe<br />
von max. NN +45,90 m trockengelegt werden.<br />
• Die Häupter sind wegen der massigen Querschnittsabmessungen<br />
ausreichend standsicher.<br />
• Die genieteten, in Riegelbauweise hergestellten<br />
Schleusentore weisen punktuell erhebliche Abrostungen<br />
<strong>und</strong> stellenweise lose Niete auf. Der Korrosionsschutz<br />
ist komplett abgängig. Die Holzdichtungen sind<br />
überwiegend in den <strong>Wasser</strong>wechselbereichen defekt.<br />
Die Hals- <strong>und</strong> Spurlager der Tore sind ausgeschlagen<br />
<strong>und</strong> schwergängig. Eine Nachrechnung der Tore hat<br />
ergeben, dass die statische Ausnutzung nur gering ist<br />
<strong>und</strong> daher eine Instandsetzung der Tore möglich wäre.<br />
Am Klinkermauerwerk wurden mehrere Probeflächen mit<br />
Hochdruckwasserstrahlen gereinigt. Eine anschließende<br />
Begutachtung mit dem Denkmalpfleger ergab, dass das<br />
gesamte Klinkerpflaster der Planie <strong>und</strong> die Klinkerverblendung<br />
der Wände in den oberen 0,5 - 1,0 m abgängig ist, da<br />
der Anteil der geschädigten Steine zu hoch ist. Das restliche<br />
Mauerwerk <strong>und</strong> die Natursteineinfassungen weisen nur<br />
geringe Schäden auf.
Vorgesehene Maßnahmen<br />
Im Rahmen der Entwurfsbearbeitung wurden mehrere<br />
Varianten untersucht <strong>und</strong> deren Wirtschaftlichkeit betrachtet.<br />
Ziel der Instandsetzung der Schleusenkammer sollte<br />
das Sicherstellen der Standsicherheit in allen Betriebszuständen<br />
<strong>und</strong> für alle Lastfälle <strong>und</strong> Lastkombinationen <strong>und</strong><br />
die Wiederherstellung der Dauerhaftigkeit sein.<br />
Als Ergebnis der Variantenuntersuchungen <strong>und</strong> der statischen<br />
Vorbemessungen wurde der Einbau einer neuen<br />
Schleusenkammer in die alte Kammer gewählt (Abb. 2).<br />
Die damit verb<strong>und</strong>ene Verringerung der Kammertiefe um<br />
0,60 m von 3,60 m auf 3,00 m ist hinnehmbar, da die<br />
Schleuse nur noch von Schiffen mit geringer Abladetiefe<br />
genutzt wird.<br />
Bei den Häuptern war das Instandsetzungsziel die möglichst<br />
originalgetreue Instandsetzung der geschädigten<br />
Bauteile zur Wiederherstellung der Dauerhaftigkeit, da die<br />
Standsicherheit ohnehin gewährleistet ist.<br />
Da eine Gr<strong>und</strong>instandsetzung der alten Schleusentore<br />
unwirtschaftlich <strong>und</strong> bezüglich der tatsächlichen Kosten mit<br />
erheblichen Risiken behaftet wäre, wurde der Einbau neuer<br />
Schleusentore beschlossen. Für die Antriebe der Tore <strong>und</strong><br />
die in die Tore integrierten Schütze wurden Elektrohubzylinder<br />
gewählt.<br />
<strong>Wasser</strong>haltung/Gr<strong>und</strong>wasserabsenkung<br />
Die seit 1993 durchgeführten Gr<strong>und</strong>wassermessungen<br />
haben ergeben, dass der Gr<strong>und</strong>wasserstand in Abhängigkeit<br />
vom Leinewasserstand stark schwankt. Der im Zeitraum<br />
von 12 Jahren höchste gemessene Gr<strong>und</strong>wasserstand<br />
lag bei NN +49,42 m, der dazugehörige Leinewasserstand<br />
bei NN +49,60 m. Die <strong>Wasser</strong>spiegelschwankungen<br />
können, auch in erheblichem Umfang, innerhalb weniger<br />
St<strong>und</strong>en eintreten. Wegen der fehlenden Auftriebssicherheit<br />
der Schleuse im trockengelegten Zustand bei<br />
Gr<strong>und</strong>wasserständen über NN +45,90 m <strong>und</strong> zur Gewährleistung<br />
der Standsicherheit war zum Anfang der Baumaßnahme<br />
bis zur Fertigstellung der neuen Schleusenkammer<br />
eine Gr<strong>und</strong>wasserabsenkung erforderlich. Für deren Auslegung<br />
wurde vor Ausschreibung der Baumaßnahme ein<br />
Pumpversuch durchgeführt.<br />
Die Absperrung der Schleuse gegen das Kanal- bzw. Lei-<br />
Abb. 3: Abbruch- <strong>und</strong> Betonfräsarbeiten in der alten Schleusenkammer<br />
Gr<strong>und</strong>instandsetzung der Leineabstiegsschleuse<br />
newasser erfolgte am Oberhaupt mit dem vorh. Revisionsverschluss.<br />
Am Unterhaupt wurde eine kanalseitig vorgesetzte<br />
Stahlwand eingebaut, da hier der vorh. Revisionsverschluss<br />
nicht hoch genug gewesen wäre, um die Baustelle<br />
vor größerem Leinehochwasser zu schützen.<br />
Ausführung der Arbeiten<br />
Die Massivbauarbeiten, der Stahlwasserbau, die Torantriebe<br />
<strong>und</strong> die Elektrotechnik wurden getrennt öffentlich ausgeschrieben.<br />
Die Massivbauarbeiten wurden im August 2006 an die Fa.<br />
Mölders vergeben. Ende August wurden 8 Tiefbrunnen für<br />
die Gr<strong>und</strong>wasserabsenkungsanlage hergestellt <strong>und</strong> die<br />
Baustelle eingerichtet. Die Trockenlegung der Schleuse<br />
erfolgte am 13.09.2006, zu diesem Zeitpunkt wurde auch<br />
mit den Erdarbeiten begonnen. Die Kammerwandköpfe<br />
wurden 0,40 m tief abgestemmt <strong>und</strong> an den Kammerwänden<br />
wurden die unteren R<strong>und</strong>ungen abgefräst (Abb. 3).<br />
Da die alten Kammerwände als Ballast zur Auftriebssiche-<br />
Abb. 4: Betonieren der Kammersohle<br />
rung dienen, wurden im Abstand von ca. 2,0 m Querkraftdollen<br />
aus Stahlträgern HEM 120 eingebaut (Abb. 2). Die<br />
Kammersohle wurde am 09.11.2006 fugenlos betoniert<br />
(Abb. 4), es wurden 512 m³ Beton eingebaut. Die Betonagen<br />
der Kammerwände erfolgten am 09.11.2006 <strong>und</strong> am<br />
21.12.2006. Der Einbau der 450 m³ Beton je Wand dauerte<br />
ca. 12 St<strong>und</strong>en (Abb. 5). Die Gr<strong>und</strong>wasserabsenkung wurde<br />
am 02.01.<strong>2007</strong> abgestellt <strong>und</strong> rückgebaut.<br />
Parallel zu den Arbeiten an der Schleusenkammer wurden<br />
die Bauarbeiten an den Häuptern ausgeführt. Ab dem<br />
Abb. 5: Betonieren der nördl. Kammerwand<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
27.09.2006 wurde das Klinkerpflaster <strong>und</strong> das Klinkermauerwerk<br />
in den oberen 0,90 m Höhe abgebrochen. Der<br />
Wandbeton unter dem Klinkermauerwerk <strong>und</strong> der Sohlenbeton<br />
im Schwenkbereich der Schleusentore wurden<br />
0,30 m tief abgefräst. Anschließend wurden in diesen Bereichen<br />
Anker zur Rückverankerung der neuen Stahlbetonvorsatzschale<br />
eingebaut. In der Zeit vom 06.11.2006 bis<br />
01.03.<strong>2007</strong> wurden in 16 Betonagen die Betonbauteile der<br />
Schleusenhäupter hergestellt. Die Natursteinarbeiten wurden<br />
ab dem 06.02.<strong>2007</strong> <strong>und</strong> die Mauerarbeiten ab dem<br />
19.02.<strong>2007</strong> ausgeführt. Parallel dazu wurden die Erdarbeiten<br />
ausgeführt, die Flächenbefestigungen hergestellt <strong>und</strong><br />
die Außenanlagen errichtet.<br />
Die Arbeiten für den Stahlwasserbau wurden im August<br />
2006 an die Fa. Sibau Genthin vergeben. Die Schleusentore,<br />
hierbei handelt es sich um Stemmtore in Faltwerkbauweise,<br />
wurden bei Sibau Genthin gefertigt <strong>und</strong> am<br />
20.03.<strong>2007</strong> angeliefert (Abb. 6). Der Ausbau der alten <strong>und</strong><br />
der Einbau der neuen Tore wurde zeitlich so abgestimmt,<br />
dass die Tore in einem Schleusenhaupt immer eingebaut<br />
waren <strong>und</strong> somit in Verbindung mit dem Revisionsverschluss<br />
im Oberhaupt eine doppelte Sicherheit zum Oberwasser<br />
hin bestand.<br />
Abb. 6: Neue Schleusenkammer mit neuen Schleusentoren<br />
Die Elektrohubzylinder für die Torantriebe wurden Anfang<br />
April <strong>2007</strong> montiert, die Elektrotechnik in den Monaten<br />
März/April installiert.<br />
Am 21.04.<strong>2007</strong> wurde die gr<strong>und</strong>instandgesetzte Schleuse<br />
planmäßig wieder in Betrieb genommen. Die Gesamtkoten<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Gr<strong>und</strong>instandsetzung der Leineabstiegsschleuse<br />
der Maßnahme betrugen 2.650.000,-- Euro. Davon entfielen<br />
1.430.000,-- Euro auf den Massivbau, 695.000,-- Euro<br />
auf den Stahlwasserbau, 390.000,-- Euro auf die Torantriebe<br />
<strong>und</strong> die Elektrotechnik sowie 135.000,-- Euro auf sonstige<br />
Ausgaben.<br />
Fazit<br />
Umfangreiche Zustandsfeststellungen (Bestandsaufnahme)<br />
<strong>und</strong> Voruntersuchungen (Vorstatik, Pumpversuch) waren<br />
wertvoll, da dadurch eine detaillierte Ausschreibung möglich<br />
war, was wiederum zu weniger Nachträgen führte.<br />
Durch die Wahl „robuster Lösungen“, die auch bei gewissen<br />
Abweichungen im Bestand ausführbar waren, konnte die<br />
Baumaßnahme planmäßig abgewickelt werden. Die Unterstützung<br />
durch die B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau bei der<br />
Planung <strong>und</strong> bei der Abwicklung (bautechnische <strong>und</strong> baustoffliche<br />
Beratung) war sehr hilfreich.<br />
Die Bauabwicklung verlief mit guten Fachfirmen überwiegend<br />
planmäßig <strong>und</strong> qualitativ gut, wobei der milde Winter<br />
2006/<strong>2007</strong> die Durchführung der Arbeiten erheblich begünstigt<br />
hat.
Tilman Treber<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Uelzen<br />
Andreas Hüsig<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Uelzen<br />
Durchgeführte Maßnahmen in<br />
<strong>2007</strong> <strong>und</strong> Planungen für eine<br />
Gr<strong>und</strong>instandsetzung ab <strong>2008</strong><br />
Das Doppelsenkrechthebewerk Lüneburg in<br />
Scharnebeck<br />
Das Senkrechthebewerk Lüneburg ist Bestandteil des<br />
115,177 km langen Elbe-Seitenkanals (ESK), der den <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
mit der Elbe verbindet. Es überwindet seit<br />
1975 mit zwei unabhängigen Trögen von je 100 m Nutzlänge<br />
<strong>und</strong> 12 m Breite bei einer Tiefe von 3,38 m einen<br />
Höhenunterschied von 38 m zwischen der mittleren (NN<br />
+42 m) <strong>und</strong> der unteren Haltung (NN +4 m). Auf dem ESK<br />
werden seit Jahren regelmäßig zwischen 8 <strong>und</strong> 9 Mio.<br />
Tonnen Güter transportiert. Es hat sich auch ein Containerverkehr<br />
von durchschnittlich 70.000 TEU eingestellt.<br />
Nach rd. 30 Betriebsjahren sind im Rahmen der Bauwerksinspektion<br />
<strong>und</strong> im laufenden Betrieb Schäden festgestellt<br />
worden, welche die Betriebs- <strong>und</strong> Standsicherheit des<br />
Bauwerks kurz- bis mittelfristig gefährden. Mit einer Gr<strong>und</strong>instandsetzung<br />
wird der Sollzustand wieder hergestellt, um<br />
einen störungsfreien Betrieb <strong>und</strong> eine hohe Verfügbarkeit<br />
bei wachsendem Verkehrsaufkommen sicherzustellen.<br />
Kern der geplanten Maßnahmen ist die Instandsetzung des<br />
SHW in den Bereichen<br />
• des Seiltriebs, welcher Seile, Seilscheibenlager <strong>und</strong><br />
Seilscheiben umfasst,<br />
• der Verschlusskörper (Obere <strong>und</strong> untere Haltungstore,<br />
Trogtore am Osttrog),<br />
Abb. 1: Schiffshebewerk Lüneburg<br />
(roter Pfeil: Lage der Zentralsteuerung zwischen<br />
den Trögen)<br />
Instandsetzungsarbeiten<br />
am Schiffshebewerk (SHW)<br />
Lüneburg<br />
• der Hydraulikantriebe,<br />
• des Antriebs- <strong>und</strong> Bremssystems, welches die<br />
Zahnstangen/Spindeln <strong>und</strong> die Troghaltevorrichtung<br />
umfasst,<br />
• großflächige Betoninstandsetzung sowie<br />
• Korrosionsschutzmaßnahmen an den Trögen <strong>und</strong><br />
Vorlandbrücken.<br />
Instandsetzungsarbeiten in <strong>2007</strong><br />
Für die im Weiteren beschriebene Gr<strong>und</strong>instandsetzung<br />
des SHW ist es als Vorarbeit erforderlich, die bereits im<br />
Jahr 2004/05 erfolgte Erneuerung der elektrotechnischen<br />
Anlagenteile inkl. Steuerung des Westtroges auch auf dem<br />
Osttrog durchzuführen. So kann gewährleistet werden,<br />
dass eine größtmögliche Betriebssicherheit während der<br />
ca. 6-jährigen Instandsetzungsdauer von <strong>2008</strong>-2013 gegeben<br />
ist. In dieser Zeit wird es mehrfach zu längeren Sperrzeiten<br />
kommen, in denen nur ein Trog für den Schiffsverkehr<br />
zur Verfügung steht.<br />
Veranlassung für die elektrotechnische<br />
Erneuerung<br />
Ersatzteile für die elektrotechnischen Anlagenteile inkl.<br />
Steuerung des SHW waren nicht mehr ausreichend vorhanden<br />
<strong>und</strong> werden aufgr<strong>und</strong> der heutigen Produktlebenszyklen<br />
z.T. seit Jahren nicht mehr hergestellt.<br />
Es häuften sich Steuerungsfehler, wobei sich die Fehlersuche<br />
aufgr<strong>und</strong> der noch nicht speicherprogrammierbaren<br />
Elektronik-Bauteile als sehr zeitaufwändig erwies. Die Frequenzumrichteranlage<br />
(FUA), die einen hochgenauen<br />
Wechselstrom an die Elektro-Antriebsmotore liefert, musste<br />
ohnehin ersetzt werden, da sie seit 1990 in Betrieb <strong>und</strong><br />
mittlerweile ebenfalls abgängig war.<br />
Die FUA (West) wurde – wie die gesamte Elektroanlagentechnik<br />
inkl. Steuerung des Westtrogs – bereits 2005 nach<br />
einer schweren Havarie im Sept. 2004, bei der die Wanne<br />
des Westtrogs <strong>und</strong> der Westtrog selbst samt Betriebsgängen<br />
geflutet war, vollständig erneuert.<br />
Die übrigen elektrotechnischen Einrichtungen des Schiffshebewerkes<br />
stellen den technischen Stand des Jahres<br />
1975 dar.<br />
Bei den verschiedenen Steuerungen der Funktionsbereiche<br />
<strong>und</strong> der Zentralsteuerung kamen teilweise noch fest ver-<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
drahtete, elektromechanische Schützensteuerungen zum<br />
Einsatz. Deshalb musste eine große Anzahl von (Teil-)<br />
Steuerungen des Osttroges erneuert werden, z.B.<br />
• Torsteuerungen OH/UH<br />
• Trogsteuerung <strong>und</strong> Troghaltevorrichtung<br />
• Kraftmessanlage (Ritzelkraft), Schmieranlage Ritzel<br />
<strong>und</strong> Seile<br />
• Teleskoprahmen<br />
• Feuerlöschanlage mit Torspülung<br />
• Umrichtersteuerung / Gleichlaufsteuerung<br />
• U.v.a.(Trogbefüllleitung,Schieflaufüberwachung,Schildschütz.<br />
)<br />
Es werden dazu Geräte gewählt, die bereits im SHW vorhanden<br />
sind <strong>und</strong> mit deren Programmierung das Bauhofspersonal<br />
vertraut <strong>und</strong> sicher geschult ist.<br />
Die Bedienung des SHW durch das zentrale Steuerpult wird<br />
durch eine Prozess-Visualisierung unterstützt, wie sie auch<br />
bei modernen Schleusensteuerungen zum Einsatz kommt.<br />
Bestandteil der Visualisierung ist auch die Erfassung <strong>und</strong><br />
die Verwaltung von Störmeldungen der Anlage.<br />
Mit der Erneuerung der elektrotechnischen Ausrüstung des<br />
Osttroges wird eine mit dem Westtrog identische Anlage<br />
geschaffen. So können bei Störungssuchen Synergieeffekte<br />
genutzt werden. Die Qualität der Ausführung der Arbeiten<br />
wird dabei durch ein Ingenieurbüro überwacht, das über<br />
spezielle Erfahrungen in der Prüfung von Software von<br />
speicherprogrammierbaren Steuerungen verfügt.<br />
Folgende Baumaßnahmen wurden für den Osttrog geplant:<br />
• Demontage der alten Kabel-Infrastruktur des Troges<br />
<strong>und</strong> Montage der neuen Kabel-Infrastruktur<br />
(ca. 25.000 m),<br />
• Demontage der alten Schaltschränke auf dem Trog<br />
<strong>und</strong> der Zentralsteuerung auf der 19 m-Bühne, Montage<br />
der neuen Anlagen,<br />
• Demontage <strong>und</strong> Remontage des Schleppkabels <strong>und</strong><br />
Aufbau der neuen Trafos,<br />
• Demontage der alten FUA <strong>und</strong> Aufbau der neuen FUA<br />
(19 m-Bühne),<br />
• Inbetriebnahme der neuen FUA <strong>und</strong> aller neuen Steuerungen,<br />
• Korrosionsschutzarbeiten auf den Troglaufgängen,<br />
• Demontage der alten <strong>und</strong> Remontage der Trogtorspül<strong>und</strong><br />
Feuerlöschleitung inkl. Einbindung in die Steuerung.<br />
Für die Maßnahmen waren Kosten in Höhe von insgesamt<br />
2,3 Mio. € veranschlagt. Die Maßnahmen sollten in dem<br />
sehr kurzen Zeitraum zwischen Juni <strong>und</strong> November <strong>2007</strong><br />
ausgeführt werden.<br />
Abwicklung der Baumaßnahmen<br />
Die Außerbetriebnahme des Osttroges erfolgte Anfang<br />
Juni, so dass ab diesem Zeitpunkt die Schifffahrt über den<br />
Westtrog abgewickelt wurde. Um eine höchstmögliche<br />
Anlagensicherheit zu gewährleisten, wurde eine Schubhilfe<br />
verpflichtend eingesetzt, die größere Schub- <strong>und</strong> Koppelverbände<br />
bei Ein- <strong>und</strong> Ausfahrt unterstützte.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Instandsetzungsarbeiten am Schiffshebewerk (SHW) Lüneburg<br />
Die Korrosionsschutzarbeiten an den Seitengängen des<br />
Troges waren ideal mit den elektrotechnischen Arbeiten zu<br />
koordinieren, da nach Demontage der Kabel <strong>und</strong> Schaltschränke<br />
sowie der abgängigen Trogspül- <strong>und</strong> Feuerlöschringleitung<br />
eine ideale Baufreiheit für den Korrosionsschutz<br />
bestand. Im Anschluss an diese Arbeiten konnten dann die<br />
Elektroarbeiten durchgeführt, die erneuerte Ringleitung<br />
installiert <strong>und</strong> an das System wieder angeschlossen werden.<br />
Ein weiterer kritischer Weg führte über die Lieferung <strong>und</strong><br />
anschließende Montage des sog. „Schleppkabels“, welches<br />
die örtlichen Steuerungen am Trog mit der erforderlichen<br />
Spannung versorgt <strong>und</strong> an die Zentralsteuerung anbindet.<br />
Dies lag einerseits an der erforderlichen Kautschukzusammensetzung<br />
des Kabels, die höchst widrigen Witterungsumständen<br />
standhalten muss <strong>und</strong> andererseits an den für<br />
die im Schleppkabel vorhandenen Kabel erforderlichen<br />
maximalen Biegeradien. Zudem wurden neue Transformatoren<br />
beschafft, die eine Ebene über der Zentralsteuerung<br />
aufgestellt wurden. So konnte die anliegende Spannung im<br />
Schleppkabel von 6000 V auf nur 400-520 V reduziert werden.<br />
Abb. 2: Arbeiten am Schleppkabel<br />
Nach Demontage der alten Kabelinfrastruktur am Osttrog<br />
wurde diese durch neue Kabel mit einer Gesamtlänge von<br />
mehr als 25 km ersetzt. Gleichzeitig musste darauf geachtet<br />
werden, dass die Infrastruktur elektromagnetisch verträglich<br />
(„EMV“) ausgeführt wurde. Die hierfür gewählten<br />
drahtummantelten Kabel besitzen einen größeren Querschnitt<br />
als bisher, wodurch die vorhandenen Kabelbahnen<br />
stark ausgenutzt wurden <strong>und</strong> im Einzelfall auch neue Kabelwege<br />
verlegt werden mussten.<br />
Kurz nach Baubeginn, d.h. nachdem die elektrischen Anlagenteile<br />
demontiert waren, ereignete sich eine Havarie an<br />
einem Antriebsmotor auf dem Westtrog. Da auch hier kein<br />
Ersatzmotor mehr verfügbar war <strong>und</strong> die Lebensdauer der<br />
Motoren ebenfalls abgelaufen war, wurde kurzfristig ein<br />
bereits demontierter Motor des Osttrogs eingebaut.<br />
So mussten aber 8 neue Motore, d.h. für den West- <strong>und</strong><br />
den Osttrog, beschafft werden. Trotz einer Lieferzeit von
16 Wochen konnte der Bauzeitenplan so angepasst werden,<br />
dass es nur zu geringfügigen Verzögerungen kam.<br />
Der entscheidende Vorteil bei dieser Baumaßnahme, nämlich<br />
von den steuerungstechnischen Einstellungen <strong>und</strong><br />
Parametrierungen des Systems vom Westtrog profitieren zu<br />
können, war allerdings dahin. Für die Parametrierung der<br />
Anlage auf dem Westtrog wurden ca. 2 Monate benötigt, so<br />
dass eine ähnliche Dauer auch hier befürchtet wurde <strong>und</strong><br />
die Bauzeit am Osttrog sich entsprechend zu verlängern<br />
drohte.<br />
Es ist trotzdem gelungen, den ursprünglich geplanten Wiederinbetriebnahmetermin<br />
angesichts der zwischenzeitlich<br />
aufgetretenen Schwierigkeiten nicht zu stark zu verschieben,<br />
so dass am 21.12.07 der geplante Probebetrieb mit<br />
dem ersten Schiff durchgeführt werden konnte.<br />
Abb. 3: Neue Frequenzumrichter <strong>und</strong><br />
Zentralsteuerung des SHW<br />
Das Schiffshebewerk Lüneburg befindet sich auf dem aktuellen<br />
Stand der Technik nach dem erfolgreichen Abschluss<br />
der zuvor beschriebenen Arbeiten. Somit ist ein aus steuerungstechnischer<br />
Sicht störungsfreier Betrieb künftig gewährleistet.<br />
Auf dieser Basis kann in den kommenden Jahren<br />
die bautechnische <strong>und</strong> maschinentechnische Gr<strong>und</strong>instandsetzung<br />
sicher erfolgen.<br />
Bautechnische <strong>und</strong> maschinentechnischeGr<strong>und</strong>instandsetzung<br />
des Schiffshebewerks<br />
Gesamtprojekt, Projektorganisation<br />
Für die Durchführung der Gr<strong>und</strong>instandsetzung der bau<strong>und</strong><br />
maschinentechnischen Teile des Schiffshebewerks ist<br />
ein Zeitraum von 6 Jahren vorgesehen. Die Umsetzung<br />
erfolgt in insgesamt 3 größeren Bauabschnitten in den<br />
Jahren 2009, 2010 <strong>und</strong> 2012. Für jeden dieser Bauabschnitte<br />
ist jeweils eine längere Sperrung des entsprechen-<br />
Instandsetzungsarbeiten am Schiffshebewerk (SHW) Lüneburg<br />
den Anlagenteils erforderlich. Damit die Schifffahrt auf dem<br />
Elbe-Seitenkanal ohne Unterbrechung weitergeführt werden<br />
kann, wird ein Trog dabei planmäßig immer in Betrieb<br />
bleiben.<br />
Das Ausgabevolumen beträgt 38 Millionen Euro. Die Gesamtmaßnahme<br />
wird als Projekt durch das <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsamt (WSA) Uelzen mit einer eigens dafür eingerichteten<br />
Projektgruppe durchgeführt. Die Projektgruppe<br />
besteht im Kern aus 6 Personen:<br />
1 Projektleiter, 1 Maschinenbauingenieur, 4 Techniker (Bau<br />
<strong>und</strong> Maschinenbau).<br />
3 weitere Ingenieure des WSA Uelzen sind anteilig an der<br />
Projektgruppenarbeit beteiligt.<br />
Die Entscheidung, die Gr<strong>und</strong>instandsetzung des Hebewerks<br />
mit einer Projektgruppe durchzuführen, resultiert aus<br />
folgenden Randbedingungen:<br />
- es handelt sich um eine einmalige Maßnahme mit<br />
zeitlicher Begrenzung<br />
- es gibt zu wenig Personalressourcen zur Aufgabenbewältigung<br />
in der Linie<br />
- die Aufgabenstellung ist sehr komplex, im Projekt sind<br />
verschiedene Fachdisziplinen beteiligt<br />
Für die Zusammensetzung der Projektgruppe mussten 2<br />
Dienstposten neu ausgeschrieben werden, die übrigen<br />
Mitglieder kommen aus dem WSA Uelzen bzw. der <strong>WSD</strong><br />
<strong>Mitte</strong>. Seit dem 01.01.<strong>2008</strong> ist die Projektgruppe vollzählig.<br />
Umsetzung der Maßnahmen<br />
Die umfassenden Maßnahmen der Gr<strong>und</strong>instandsetzung<br />
lassen sich sowohl inhaltlich als auch räumlich meist gut<br />
differenzieren. Zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit bei<br />
der Planung <strong>und</strong> der Durchführung des Gesamtprojekts<br />
wird dieses deshalb in 5 Teilprojekte unterteilt. Jedes Teilprojekt<br />
wird von einem verantwortlichen Teilprojektleiter in<br />
eigener Regie organisiert. Die Abstimmung untereinander<br />
erfolgt in regelmäßig stattfindenden Besprechungen der<br />
gesamten Projektgruppe.<br />
Die 5 Teilprojekte teilen sich wie folgt auf:<br />
1.) Instandsetzung der Antriebshydraulik des Osttrogs<br />
Hier werden die Hydraulikaggregate <strong>und</strong> die mechanischen<br />
Teile der auf dem Trog <strong>und</strong> dessen Stützkonstruktion befindlichen<br />
Antriebe ersetzt oder überarbeitet. Es handelt<br />
sich im Einzelnen um:<br />
• die Troghaltevorrichtung, die den Trogantrieb –speziell<br />
das Trogantriebsritzel <strong>und</strong> die zugehörige Zahnstange-<br />
vor unplanmäßigen Lasten schützt<br />
• den Teleskoprahmen, der das verschiebbare Endstück<br />
des Troges bildet. Er überbrückt bei angelegtem Trog<br />
den Spalt zwischen Trog <strong>und</strong> dem Haltungsanschluss<br />
• Die Ritzeldruckanlage, die das Trogantriebsritzel mit<br />
einer definierten Kraft auf die Führungsschienen drückt<br />
<strong>und</strong> somit die planmäßige Einstellung zur Verzahnung<br />
der Zahnstange herstellt<br />
• Das Getriebegleichlaufsystem, das für einen Gleichlauf<br />
aller vier Trogantriebe sorgt<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Das Teilprojekt 1 wird durch den Austausch verschiedener<br />
Dichtungen, die Erneuerung des Korrosionsschutzes am<br />
Teleskoprahmen <strong>und</strong> den Austausch der Troglager vervollständigt.<br />
Die unter 1.) beschriebenen Maßnahmen werden<br />
von Oktober <strong>2008</strong> bis Januar 2009 durchgeführt.<br />
2.) Stahlwasserbau<br />
Dieses Teilprojekt beinhaltet den Ersatz sämtlicher Haltungstore,<br />
den Ersatz der Trogtore am Osttrog, sowie<br />
Korrosionsschutzarbeiten <strong>und</strong> konstruktive Maßnahmen an<br />
den Vorlandbrücken <strong>und</strong> deren Lagerung.<br />
3.) Seiltrieb<br />
Das Teilprojekt Seiltrieb umfasst die Instandsetzung bzw.<br />
den Ersatz der Seilumlenkrollen (Seilscheiben) <strong>und</strong> deren<br />
Lager, die Verstärkung des Seilscheibentragwerks <strong>und</strong> die<br />
Erneuerung aller Tragseile.<br />
4.) Hochbau, Korrosionsschutz<br />
Hinter diesem Titel verbirgt sich die Betoninstandsetzung<br />
des Gebäudes, die Erneuerung von Dachflächen <strong>und</strong> Türen,<br />
Taubenabwehrmaßnahmen, Gebäudetechnik <strong>und</strong> die<br />
Erneuerung des Korrosionsschutzes der Tröge.<br />
5.) Spindel, Zahnstange, Schildschütz<br />
Hier werden die Ausrichtung <strong>und</strong> die Vorspannung der<br />
Spindel, die Befestigung der Zahnstangen <strong>und</strong> die Mechanik<br />
des Schildschützes überprüft bzw. instandgesetzt.<br />
Die unter 2.) -5.) beschriebenen Maßnahmen werden am<br />
Osttrog im Jahr 2010 <strong>und</strong> am Westtrog im Jahr 2012<br />
durchgeführt.<br />
Bei der Planung der Maßnahmen ergeben sich viele Fragen,<br />
deren Klärung entscheidend für den Projektablauf ist,<br />
wie z.B.:<br />
• Wie können die Maßnahmen so organisiert werden,<br />
dass die Sperrzeit minimiert wird?<br />
• Welche Maßnahmen sind besonders zeitkritisch, zeitintensiv?<br />
• Wo ist die Unterstützung durch die BAW oder durch<br />
Ingenieurbüros erforderlich?<br />
• Wie lange sind die Lieferzeiten der Ersatzteile, welche<br />
Unsicherheiten gibt es hier?<br />
• Welche Voruntersuchungen sind erforderlich?<br />
• Welche Maßnahmen können parallel laufen?<br />
• Welche Verbesserungen können für den zukünftigen<br />
Betrieb <strong>und</strong> die Unterhaltung erreicht werden?<br />
• Kann eine Erhöhung des verfügbaren Trogwasserstandes<br />
erreicht werden?<br />
• Wie baue ich die Umlenkrollen aus?<br />
• Welche Seile werden eingebaut, welche Seildurchmesser<br />
sind zu wählen?<br />
• Welche Lösung ist die jeweils wirtschaftlichste?<br />
• Welche Varianten-, bzw. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen<br />
müssen durchgeführt werden?<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Instandsetzungsarbeiten am Schiffshebewerk (SHW) Lüneburg<br />
Derzeitiger Sachstand (Januar <strong>2008</strong>)<br />
Der Entwurf für das Teilprojekt 1 „Instandsetzung der Antriebshydraulik<br />
des Osttrogs“ ist bereits genehmigt, ein Teil<br />
dieser Maßnahmen wurde kürzlich öffentlich ausgeschrieben.<br />
Die Teilprojekte 2-5 befinden sich noch weitgehend in<br />
der Vorplanungsphase.<br />
Notfallmanagement<br />
der Sperrzeiten des im Bau befindlichen Troges eine optimale<br />
Verfügbarkeit des planmäßig in Betrieb befindlichen<br />
Troges zu gewährleisten. Hierfür ist ein Notfallmanagementplan<br />
in Verbindung mit einer Risikoanalyse zu erstellen.<br />
Ausblick<br />
Mit der Gr<strong>und</strong>instandsetzung des bestehenden Schiffshebewerks<br />
wird die Betriebssicherheit des Bauwerks <strong>und</strong> der<br />
Maschinenbauteile für weitere 35 Jahre hergestellt. Eine<br />
Vergrößerung der nutzbaren Troglänge ist aus statischen<br />
<strong>und</strong> konstruktiven Gründen nicht möglich. Für den Transport<br />
größerer Schiffseinheiten <strong>und</strong> die Steigerung der Leistungsfähigkeit<br />
des SHW Lüneburg müsste ein weiteres<br />
Abstiegsbauwerk errichtet werden.<br />
Überlegungen zur Machbarkeit eines solchen neuen Abstiegsbauwerks<br />
sind zwar vorhanden; es liegen allerdings<br />
aufgr<strong>und</strong> des komplexen Bauwerks <strong>und</strong> der hohen Investitionssumme<br />
noch keine konkreten Planungen zur Umsetzung<br />
vor. Dieses wird aber unter Berücksichtigung der<br />
Verkehrsentwicklung auf dem ESK weiterhin begleitend<br />
Aufgabe sein <strong>und</strong> in einen gesamtverkehrlichen Betrachtungsprozess<br />
einfließen.
Harald Weike<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Uelzen<br />
Andreas Hüsig<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Uelzen<br />
Die Schleusengruppe Uelzen<br />
Seit der Inbetriebnahme der Schleuse Uelzen II am<br />
08.12.2006 stehen am 115,2 km langen Elbe-Seitenkanal<br />
zwei Abstiegsbauwerke in Uelzen zur Verfügung. Die<br />
Schleuse Uelzen I ist seit 1976 in Betrieb <strong>und</strong> hat eine<br />
Länge von 190 m, eine Breite von 12 m bei einer Hubhöhe<br />
von 23 m. Sie ist als Sparschleuse mit 3 offenen Sparbecken<br />
konstruiert worden. Dies ermöglicht eine <strong>Wasser</strong>ersparnis<br />
von 60 %. Die Schleuse Uelzen II ist mit den Abmessungen<br />
190 m x 12,50 m <strong>und</strong> einer <strong>Wasser</strong>ersparnis<br />
von 70 % durch beidseits je 4 ins Bauwerk integrierten<br />
Sparbecken etwas größer als die Schleuse Uelzen I.<br />
Wie auch bei der Schleuse Uelzen II befindet sich bei der<br />
Schleuse Uelzen I unterhalb der Schleusenkammer der<br />
Gr<strong>und</strong>kanal. Hier münden 6 Sparbeckenkanäle sowie je<br />
2 Längskanäle vom Ober- bzw. Unterhaupt. Durch zwei<br />
Füllbatterien strömt das <strong>Wasser</strong> vom Gr<strong>und</strong>kanal in die<br />
Schleusenkammer (Abb. 1).<br />
Überraschung in der Tiefe<br />
- eine „fehlgeschlagene“ Trockenlegung<br />
der Schleuse Uelzen I<br />
vom 25.06. bis 10.08.<strong>2007</strong> -<br />
Abb. 1: Längsschnitt <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>riss der Schleuse Uelzen I<br />
Vorbereitung <strong>und</strong> Planung der<br />
Maßnahme<br />
Ab dem 13. August <strong>2007</strong> war geplant, die neue Schleuse<br />
Uelzen II für die Ausführung von Restarbeiten für einen<br />
Zeitraum von 8 Wochen trocken zu legen. Im Frühjahr <strong>2007</strong><br />
festgestellte Schäden an der Schleuse Uelzen I an den<br />
Seilen des Untertores sowie den Seilscheibenlagern <strong>und</strong><br />
ein <strong>und</strong>ichter Längskanalverschluss im Oberhaupt waren<br />
vor einer Trockenlegung der neuen Schleuse instand zu<br />
setzen, um einen reibungslosen Betrieb an der Schleuse I<br />
während der Trockenlegungszeit von Uelzen II sicher zu<br />
stellen.<br />
Für die Durchführung der Arbeiten einschließlich der Bauwerksinspektion,<br />
hier insbesondere an den Fugen, wurde<br />
ein Zeitraum von ca. 4 Wochen veranschlagt. Hierzu musste<br />
die Schleuse Uelzen I vollständig, d.h. einschließlich<br />
Gr<strong>und</strong>kanal <strong>und</strong> aller Zuläufe, trockengelegt werden.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Überraschung in der Tiefe - eine „fehlgeschlagene“ Trockenlegung der Schleuse Uelzen I vom 25.06. bis 10.08.<strong>2007</strong><br />
Der Beginn der Trockenlegung wurde auf den 25. Juni<br />
gelegt, Ende der Trockenlegung sollte planmäßig am<br />
20. Juli sein. So sollte sicher gestellt werden, dass die Arbeiten<br />
- mit einem eingeplanten Zeitpuffer von 3 Wochen -<br />
vor dem Beginn der Maßnahmen an der Schleuse Uelzen II<br />
abgeschlossen waren.<br />
Trockenlegung - Plan A<br />
Nachstehend wird zunächst der standardisierte Ablauf einer<br />
Trockenlegung der Schleuse Uelzen I dargestellt:<br />
Montag, 25. Juni <strong>2007</strong> - 07:00 Uhr. 10 <strong>Wasser</strong>bauer, aufgeteilt<br />
in 3 Arbeitsgruppen, sperren die Besucherplattform <strong>und</strong><br />
die Zufahrten für den öffentlichen Verkehr. Nachdem zwei<br />
Mobilkrane <strong>und</strong> die Tauchergruppe eingetroffen sind, folgt<br />
eine gemeinsame Einsatzbesprechung einschließlich der<br />
erforderlichen Unterweisungen.<br />
09:00 Uhr: Die Schleuse wird nach einer Talschleusung für<br />
die Schifffahrt gesperrt. Am Oberhaupt werden die Betondeckel<br />
über den Revisionsverschlussnischen der Längskanäle<br />
entfernt, die äußeren Füllrahmen gezogen (zu den<br />
Füllrahmen wird im Weiteren noch ausführlich berichtet)<br />
<strong>und</strong> die Längskanalrevisionsverschlüsse (LKRV) gesetzt.<br />
Anschließend folgen die Kammerrevisionsverschlüsse<br />
(KRV) vor dem Obertor. Gleichzeitig werden die Sparbeckenverschlüsse<br />
im manuellen Betrieb durch das Bauhofspersonal<br />
geöffnet, um das Restwasser ablaufen zu lassen.<br />
Die Arbeitsgruppe 2 setzt im Unterhaupt zwei Turmpumpen<br />
mit einer Leistungsfähigkeit von jeweils 400m³/h in den<br />
Gr<strong>und</strong>kanal (Abb. 2).<br />
Abb. 2: Arbeiten zur Trockenlegung am Oberhaupt<br />
10:00 Uhr: Die 3. Arbeitsgruppe beginnt am Unterhaupt mit<br />
dem Setzen der Revisionsverschlüsse. Nachdem der<br />
Dammbalkenverschluss mit Taucherunterstützung eingebaut<br />
ist, werden kammerseitig drei Tauchpumpen mit einer<br />
Leistungsfähigkeit von je 1.000m³/h hinter den Verschluss<br />
positioniert. Während die Bauhofs-Elektriker die Stromversorgung<br />
herstellen, werden die Revisionsverschlüsse<br />
der Längskanäle (LKRV) gesetzt,<br />
14:00 Uhr: Pumpen <strong>und</strong> alle Revisionsverschlüsse sind an<br />
Ort <strong>und</strong> Stelle, so dass die eigentliche Trockenlegung der<br />
Schleuse beginnen kann. Planmäßig soll die Schleusenkammer<br />
gegen 18:00 Uhr trocken sein, für das Auspumpen<br />
des Gr<strong>und</strong>kanals werden weitere 12 St<strong>und</strong>en<br />
benötigt (Abb. 3).<br />
Abb. 3: Leerpumpen des Gr<strong>und</strong>kanals<br />
15:00 Uhr: Bei einem ersten Kontrollgang wird im obersten<br />
Sparbecken (SB 3) ein drei Meter langes, ca. 400 kg<br />
schweres Stahlteil aufgef<strong>und</strong>en (Abb. 4). Dass sich in den<br />
Sparbecken Ablagerungen <strong>und</strong> Unrat ansammeln, die bei<br />
Trockenlegungen aufgef<strong>und</strong>en werden, ist nicht ungewöhnlich<br />
- ein derart massives, vermutlich aus der Schleuse<br />
Uelzen I selbst stammendes Bauteil dieser Größenordnung<br />
überraschte aber alle Beteiligten <strong>und</strong> gab Anlass zur Sorge.<br />
Abb. 4: Bauteilf<strong>und</strong> im Sparbecken<br />
Massives Bruchstück eines<br />
Füllrahmens<br />
- Ein unerwarteter F<strong>und</strong><br />
Was tun? - Dies war die Frage auf der unverzüglich einberufenen<br />
Krisensitzung. Bei dem F<strong>und</strong>stück handelte es sich<br />
um ein Bruchstück eines Füllrahmens.<br />
Die Füllrahmen haben die Aufgabe, die Revisionsverschlussnischen<br />
der Längskanäle im Oberhaupt während<br />
des Schleusenbetriebs zu verschließen. Sie dienen der<br />
Vermeidung von Strömungsturbulenzen, die schädliche<br />
Vibrationen an den naheliegenden Betriebsverschlüssen<br />
verursachen können.
Überraschung in der Tiefe - eine „fehlgeschlagene“ Trockenlegung der Schleuse Uelzen I vom 25.06. bis 10.08.<strong>2007</strong><br />
Jeder der beiden Längskanäle kann separat trockengelegt<br />
werden <strong>und</strong> verfügt über einen vorhafenseitigen <strong>und</strong> kammerseitigen<br />
Revisionsschacht. Vor dem Einbau der Revisionsverschlüsse<br />
müssen die je 1,4 Tonnen schweren Füllrahmen<br />
ausgebaut werden. Der Ein-/Ausbau erfolgt mit<br />
einem Zangenbalken, mit dem auch die Revisionsverschlüsse<br />
gesetzt werden (Abb. 5).<br />
Abb. 5: Intakter Füllrahmen beim Ein- /Ausbau<br />
Da zu Beginn der Trockenlegung die beiden äußeren Füllrahmen<br />
aus- <strong>und</strong> die Verschlüsse eingebaut worden sind,<br />
konnte das Bruchstück nur von einem der inneren Rahmen<br />
stammen.<br />
Jeder Füllrahmen hat die Form eines auf den Kopf gestellten<br />
U’s. In der Einbaulage wird er auf jeder Seite durch<br />
zwei in der Sohlschiene eingelassene Kegelzapfen fixiert<br />
(Abb. 6).<br />
Abb. 6: Kegelzapfen zur Fixierung des Füllrahmens auf dem Boden<br />
Oberhalb der Kopfleiste des Füllrahmens befinden sich<br />
seitlich Riegel, die beim Absetzen herausklappen <strong>und</strong> in<br />
Riegeltaschen eingreifen, die in die Nische eingelassen<br />
sind (Abb. 7).<br />
Das im Sparbecken 3 gef<strong>und</strong>ene Bruchstück hat auf seinem<br />
Weg mindestens 150 Meter Strecke <strong>und</strong> 25 Meter<br />
Höhenunterschied überw<strong>und</strong>en. Dieser „Schwimmweg“ des<br />
zerstörten Bruchstücks ist Abb. 1 (oben) zu entnehmen. Ob<br />
es auf diesem Weg zu weiteren Schäden an den Betriebsverschlüssen<br />
oder an den Fugenbändern der Bauwerksfugen<br />
gekommen ist, war eine entscheidende Frage<br />
stellung. Insbesondere die Beschädigung eines Fugenbandes<br />
würde sich bei der laufenden Trockenlegung gravierend<br />
auswirken, da bei trockener Schleuse bis zu 15 Meter<br />
Gr<strong>und</strong>wasserdruck auf die Dichtungen wirken.<br />
Daher musste die planmäßige Trockenlegung an die neue<br />
Situation angepasst werden – „Plan B“ musste her.<br />
Abb. 7: Riegel zur Fixierung des Füllrahmens<br />
oben in der Nische<br />
Trockenlegung - Plan B<br />
Montag, 25. Juni <strong>2007</strong> - 17:00 Uhr: Es wird beschlossen,<br />
dass das Vorhaben, die Schleuse trocken zu legen, weiter<br />
verfolgt wird. Daher soll, sobald der Gr<strong>und</strong>kanal frei ist,<br />
unverzüglich eine Begehung stattfinden, um festzustellen,<br />
welcher Füllrahmen zerstört wurde <strong>und</strong> ob es zu weiteren<br />
Schäden gekommen ist. Erst danach kann über den weiteren<br />
Ablauf der geplanten Maßnahmen entschieden werden.<br />
Für den Fall eines Schadens an einem Fugenband ist die<br />
schnellstmögliche Flutung der Anlage bis zum Gr<strong>und</strong>wasserausgleich<br />
vorzubereiten.<br />
Dienstag, 26. Juni <strong>2007</strong> - 06:00 Uhr. Der Gr<strong>und</strong>kanal ist bis<br />
auf 20 cm Restwasser trocken <strong>und</strong> kann kontrolliert werden.<br />
Glücklicherweise werden keine weiteren Schäden<br />
festgestellt. Auch sind alle Fugenbänder intakt, so dass ein<br />
Abbruch der Trockenlegung nicht erforderlich ist.<br />
Festgestellt wird, dass der Füllrahmen im Längskanal OH<br />
West zerstört ist. Die Nische ist noch intakt.<br />
09:00 Uhr: Baubesprechung – Ursachenforschung <strong>und</strong><br />
Festlegungen:<br />
• Die Schleuse kann ohne Füllrahmen nicht betrieben<br />
werden,<br />
• die Schadensursache kann erst nach Ausbau des<br />
Reststückes <strong>und</strong> der vollständigen Trockenlegung der<br />
Nische untersucht werden,<br />
• die Bauwerksinspektion muss auch die anderen Nischen<br />
<strong>und</strong> Füllrahmen umfassen, um Beschädigungen<br />
an diesen Bauteilen ausschließen zu können,<br />
• Ersatzbeschaffung von mindestens einem Füllrahmen<br />
muss vorbereitet werden,<br />
• Auswirkungen auf den Zeitplan sind fortlaufend zu<br />
überprüfen.<br />
Dienstag, 03.07.<strong>2007</strong>: Die Betondeckel in der Schleusenplattform<br />
auf NN + 66,50 m werden geöffnet. In der Antriebskaverne<br />
wird der Druckdeckel auf NN + 43,00 m über<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Überraschung in der Tiefe - eine „fehlgeschlagene“ Trockenlegung der Schleuse Uelzen I vom 25.06. bis 10.08.<strong>2007</strong><br />
der Revisionsverschlussnische geöffnet. Über eine Leiter<br />
kann der Sitz der oberen Riegel im Verschlussschacht auf<br />
NN + 35,00 m besichtigt werden. So kann sicher festgestellt<br />
werden, dass die restlichen Füllrahmen intakt sind.<br />
Abb. 8: Ausheben des Restes des zerstörten Füllrahmens<br />
Anschließend wird der Rest des zerstörten Füllrahmens mit<br />
einem Mobilkran nach oben herausgehoben (Abb. 8).<br />
Nach der geglückten Demontage auf der Westseite wird<br />
auch der unbeschädigte Füllrahmen auf der Ostseite ausgebaut.<br />
Auf beiden Seiten werden erhebliche Schäden an<br />
den beweglichen Teilen der Gewichtshebel festgestellt<br />
(Abb. 9). An den Stellschrauben in den Riegeltaschen werden<br />
ebenfalls Schäden festgestellt. Eine Einstellschraube<br />
fehlt vollständig.<br />
Ein glückliches Ende<br />
Um den kritischen Zeitplan für die Trockenlegung der<br />
Schleuse Uelzen II nicht zu gefährden, wird unverzüglich<br />
nach Erkennen des Totalschadens des einen <strong>und</strong> des<br />
Schadens am anderen Füllrahmen der Auftrag erteilt, zwei<br />
neue Füllrahmen im Werk zu fertigen. Währenddessen<br />
werden an der Schleuse die Nischen gereinigt <strong>und</strong> im gereinigten<br />
Zustand auf weitere Beschädigungen untersucht.<br />
Die beiden Füllrahmen für die vorhafenseitigen Verschlussnischen<br />
sind in einem ordnungsgemäßen Zustand. Allerdings<br />
sind die Abdrücke von den Stellschrauben auf den<br />
Riegeln nur am Rand, so dass die Endlage vermutlich nicht<br />
erreicht wird. Dies bedeutet, dass diese Bauteile künftig im<br />
Rahmen der Bauwerksüberwachung intensivierten Prüfintervallen<br />
zu unterziehen sind.<br />
<strong>Mitte</strong> Juli sind die planmäßigen Arbeiten abgeschlossen.<br />
Ende des Monats werden die neuen Füllrahmen angeliefert<br />
<strong>und</strong> eingebaut. Am 02. August wird die Schleuse geflutet.<br />
Nach dem Ausbau der Revisionsverschlüsse können die<br />
Nischen am Oberhaupt durch Taucher gereinigt <strong>und</strong> untersucht<br />
werden. Abschließend wird der ordnungsgemäße Sitz<br />
der Riegel wiederhergestellt.<br />
Fazit<br />
Abb. 9: Schäden an den beweglichen Gewichtshebeln am Füllrahmen<br />
(Detailansicht)<br />
Am 10. August <strong>2007</strong> konnte die Schleuse Uelzen I wieder<br />
in Betrieb genommen werden. Trotz allen Überraschungen<br />
<strong>und</strong> Widrigkeiten konnte am 13. August die Trockenlegung<br />
der neuen Schleuse Uelzen II planmäßig beginnen.
Rainer Behrens<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schiff-<br />
fahrtsamt Uelzen<br />
Dr. Katja Rettemeier<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Uelzen<br />
Michael Pape<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Uelzen<br />
Eine Bilanz der schweren<br />
Havarien am Elbe-Seitenkanal<br />
im Frühjahr <strong>2007</strong><br />
Das Binnenschiff gilt als umweltfre<strong>und</strong>licher <strong>und</strong> sicherer<br />
Verkehrsträger. Dies wird eindrucksvoll durch Angaben<br />
vom Statistischen B<strong>und</strong>esamt für das Jahr 2006 belegt (s.<br />
Tabelle 1). Während im Straßenverkehr in Niedersachsen<br />
r<strong>und</strong> 184.000 Unfälle, davon r<strong>und</strong> 34.000 mit Personenschäden<br />
festgestellt worden sind, ereigneten sich auf<br />
den Binnenwasserstraßen Niedersachsens dagegen nur<br />
117 Unfälle, mit nur einem Personenschaden in der Sportschifffahrt.<br />
Bezogen auf die transportierte Gütermenge lag<br />
das Unfallgeschehen 2006 in Niedersachsen auf den Straßen<br />
damit 80 Mal höher als auf den <strong>Wasser</strong>wegen.<br />
Auch wenn erfreulicherweise bei Schiffsunfällen Personenschäden<br />
kaum eine Rolle spielen, bergen sie aber die<br />
Gefahr in sich, die Umwelt durch <strong>Wasser</strong> gefährdende<br />
Stoffe zu beeinträchtigen, ferner in der möglichen Scha-<br />
denshöhe <strong>und</strong> in den Auswirkungen für den übrigen<br />
Schiffsverkehr (<strong>Wasser</strong>straßensperrungen). Die schweren<br />
Havarien im Frühjahr <strong>2007</strong> zeichneten sich im Besonderen<br />
durch eine Beeinträchtigung für die Schifffahrt aus.<br />
So musste der Rhein im März <strong>2007</strong> nach der Havarie der<br />
„Excelsior“ für über eine Woche gesperrt werden, um die<br />
verlorenen Container zu bergen. Bedingt durch dieses<br />
Ereignis stand das weitere Unfallgeschehen auf allen Binnenwasserstraßen<br />
im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Am<br />
südlichen Elbe-Seitenkanal (ESK) haben sich in der Folge<br />
zwei schwere Havarien, glücklicherweise ohne Personenschaden,<br />
ereignet, die insgesamt zu einer Schifffahrtssperre<br />
von r<strong>und</strong> 50 St<strong>und</strong>en geführt haben (Abb. 1).<br />
Abwicklung von Schiffsunfällen<br />
Strom- <strong>und</strong> Schifffahrtspolizeiliche<br />
Aufgaben der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
Havarie 1<br />
Havarie 2<br />
Havarie 2<br />
Havarie 1<br />
Abb. 1: Havarien am Elbe-Seitenkanal im Frühjahr <strong>2007</strong><br />
Niedersachsen Straßenverkehr Binnenschifffahrt f h Sportschifffahrt<br />
S hifff h<br />
Unfälle (PKW (PKW <strong>und</strong> <strong>und</strong> LKW)<br />
LKW) 184.000 78 39<br />
mit Personenschäden<br />
Personenschäden 34.000 0 1<br />
Transportmenge [Mio. t] 272 14<br />
Tabelle 1 Vergleich der Verkehrsunfälle Binnenschifffahrt <strong>und</strong> Straßenverkehr in 2006<br />
Unfallhergang <strong>und</strong> Bergung<br />
Havarie 1 am 18.04.<strong>2007</strong> mit den Unfallbeteiligten<br />
TMS „Ferntrans“ <strong>und</strong> SV „Edda“<br />
Am 18.04.<strong>2007</strong> sind um 7:15 Uhr das zu Tal fahrende<br />
Tankmotorschiff (TMS) „Ferntrans“ <strong>und</strong> der zu Berg fahrende<br />
Schubverband (SV) „Edda“ bei ESK km 13,7 zusammengestoßen<br />
(Abb. 1). Das TMS war mit Paraffin beladen,<br />
das kein gefährliches Gut nach den Vorschriften zur Beförderung<br />
gefährlicher Güter (ADNR) ist. Es hat keinen nennenswerten<br />
Schaden genommen. Somit konnte das TMS<br />
nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Der SV<br />
bestand aus drei Leichtern <strong>und</strong> hatte Baggergut aus der<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
18.04.<strong>2007</strong>, 07:15<br />
• Havarie <strong>und</strong> Sperrung<br />
18.04.<strong>2007</strong>, 11:00<br />
• Sicherung abgeschlossen<br />
• Vorbeifahrt möglich<br />
18.04.<strong>2007</strong>, 19:00<br />
• Sperrung für Bergung<br />
• Leichterung durch<br />
MZF „Verden“<br />
19.04.<strong>2007</strong>, 04:00<br />
• Leckabdichtung<br />
• Vorbeifahrt während<br />
der Bergung möglich<br />
19.04.<strong>2007</strong>, 12:00<br />
•Sperrung für Bergung<br />
• Leichterung durch<br />
MZF „Verden“<br />
•Pumpenwache<br />
20.04.<strong>2007</strong>, 01:40<br />
• Havarist kommt frei<br />
20.04.<strong>2007</strong>, 05:30<br />
• Aufhebung Schifffahrtsperre<br />
20.04.<strong>2007</strong>, 08:15<br />
• Havarist wird zur Liegestelle<br />
verholt<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Abwicklung von Schiffsunfällen - Strom- <strong>und</strong> Schifffahrtspolizeiliche Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
Wendestelle Bad Bevensen geladen. Der Kopfleichter des<br />
SV ist an der Unfallstelle Leck geschlagen <strong>und</strong> mit dem Bug<br />
gesunken. Der Elbe-Seitenkanal ist für die Durchführung<br />
der Bergungsmaßnahmen mit Unterbrechungen bis zum<br />
20.04.<strong>2007</strong>, 5:30 Uhr, für die Schifffahrt gesperrt worden.<br />
Nach Sicherung des Havaristen am Ufer, wurden weitere<br />
Schritte zur Bergung eingeleitet. Die Ladung des havarierten<br />
Leichters wurde durch einen auf der Mehrzweckfähre<br />
(MZF) „Verden“ befindlichen Bagger in eine leere Schute<br />
umgeladen. Begleitend dazu haben Taucher auf dem Einstieg<br />
zur Vorpik (vorderster Raum eines Schiffes) einen<br />
Schacht aufgesetzt. Über diesen Schacht konnte das eingedrungene<br />
<strong>Wasser</strong> aus der Vorpik abgepumpt werden,<br />
nachdem das Leck, ebenfalls durch Taucher, zuvor von<br />
außen abgedichtet worden ist. Der Hebevorgang wurde<br />
durch einen weiteren, leeren Schubleichter unterstützt.<br />
Diese Maßnahmen führten zum Erfolg: Der Havarist war<br />
nach 44 St<strong>und</strong>en wieder schwimmfähig, der Schubverband<br />
konnte zur nächsten Liegestelle gebracht werden. Insgesamt<br />
war der Kanal für r<strong>und</strong> 28 St<strong>und</strong>en voll gesperrt.<br />
(Abb. 2)<br />
Abb. 2: Havarie TMS „Ferntrans“ <strong>und</strong> SV „Edda“<br />
Havarie<br />
TMS „Ferntrans“ / SV „Edda“<br />
28 St<strong>und</strong>en<br />
Schifffahrtssperre<br />
Havarie 2 am 15.05.<strong>2007</strong> mit den Unfallbeteiligten<br />
MS „Schwaben“ <strong>und</strong> MS „Vera“<br />
Am 15.05.<strong>2007</strong>, 21:00, Uhr sind die Motorschiffe „Schwaben“<br />
<strong>und</strong> „Vera“ bei ESK km 12,6 kollidiert (Abb. 3). Das mit<br />
Mineralgemisch voll beladene MS „Schwaben“ ist dabei<br />
Leck geschlagen. Nach der Kollision lag die „Schwaben“<br />
quer im Kanal, mit Bug <strong>und</strong> Heck auf der Böschung. Durch<br />
den <strong>Wasser</strong>einbruch in Vorpik <strong>und</strong> Laderaum musste befürchtet<br />
werden, dass die „Schwaben“ sinkt, so bald sie von<br />
der Böschung rutscht. Gleichzeitig drohte sie bei sinkenden<br />
<strong>Wasser</strong>ständen durchzubrechen. Am mit Kohle beladenen<br />
MS „Vera“ wurde im Bugbereich ein leichter Schaden festgestellt,<br />
der die Schwimmfähigkeit jedoch nicht beeinträchtigt<br />
hat. Der Elbe-Seitenkanal musste bis zum Abschluss<br />
der Bergungsarbeiten am 16.05.<strong>2007</strong>, 19:00 Uhr, durchgehend<br />
gesperrt bleiben.<br />
Die besondere Schwierigkeit zu Beginn der Bergungsmaßnahmen<br />
bestand in der äußerst gefahrvollen Lage, in der<br />
sich das MS „Schwaben“ befand. Zunächst wurde die <strong>Wasser</strong>einspeisung<br />
in die Scheitelhaltung gestoppt, um das<br />
Schiff möglichst stabil zu halten. Mit der Leichterung des<br />
Havaristen wurde wiederum die MZF „Verden“ vom WSA<br />
Braunschweig beauftragt, die unverzüglich ihre Fahrt aus<br />
dem Stichkanal Salzgitter zur Unfallstelle aufnahm. Nach<br />
erster Leichterung, Ausbringung des Lecksegels <strong>und</strong> Einsatz<br />
von Pumpen der Feuerwehr <strong>und</strong> der WSV konnte der<br />
Havarist am frühen Nachmittag des nächsten Tages mit<br />
Unterstützung weiterer Fahrzeuge gestreckt an das westliche<br />
Ufer verholt <strong>und</strong> dort gesichert werden. Damit war die<br />
größte Gefahr gebannt. Nun war es möglich, die „Schwaben“<br />
innerhalb von nur 4 St<strong>und</strong>en mit der MZF „Verden“ so<br />
weit zu leichtern, dass das etwa 3 m 2 große Leck aus dem<br />
<strong>Wasser</strong> kam. Die Ladung wurde in das von Braunschweig<br />
kommende MS „Marvin Debus“ umgeladen. Der Havarist<br />
konnte nach ca. 22 St<strong>und</strong>en zur nächsten Liegestelle verholt<br />
<strong>und</strong> die Schifffahrtssperre aufgehoben werden (Abb. 3).<br />
15.05.<strong>2007</strong>, 07:15<br />
• Havarie <strong>und</strong> Sperrung<br />
16.05.<strong>2007</strong>, 01:30<br />
• Speisung der Haltung eingestellt<br />
• MZF „Verden“ leichtert<br />
•Lecksegel ausgebracht<br />
16.05.<strong>2007</strong>, 12:30<br />
• Ankunft MS „Marvin Debus“<br />
zur Aufnahme der Ladung<br />
<strong>und</strong> Stabilisierung<br />
16.05.<strong>2007</strong>, 14:00<br />
• Heck der MS Schwaben frei<br />
•gestreckt zur Seite verholt<br />
•Fortsetzung der Leichterung<br />
16.05.<strong>2007</strong>, 18:00<br />
• MS „Vera“ Ladung verraumt,<br />
Schlagseite beseitigt<br />
16.05.<strong>2007</strong>, 18:45<br />
• MS „Schwaben“ zur<br />
Liegestelle verholt<br />
16.05.<strong>2007</strong>, 19:00<br />
• Aufhebung Schifffahrtssperre<br />
Havarie<br />
MS „Schwaben“ / MS „Vera“<br />
22 St<strong>und</strong>en<br />
Schifffahrtssperre<br />
Abb. 3: Havarie der beiden Motorschiffe „Vera“ <strong>und</strong> Schwaben“<br />
Unfallstatistik der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong><br />
es<br />
Uelzen haben sich 2006 mit über 50 Havarien die meisten<br />
Schiffsunfälle im Bereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion<br />
<strong>Mitte</strong> ereignet (Abb. 4).<br />
Ohne Berücksichtigung der Havarien an den Abstiegsbauwerken<br />
liegt der Unfallschwerpunkt in Kollisionen <strong>und</strong> Böschungsanfahrungen<br />
mit meist nur leichtem Sachschaden.<br />
Diese treten nicht nur auf Gr<strong>und</strong> der schwierigen nautischen<br />
Verhältnisse in den Baustellen am <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
auf, sondern auch in den Bereichen der windanfälligen<br />
hohen Dammstrecken am Elbe-Seitenkanal <strong>und</strong> <strong>Mitte</strong>llandkanal.<br />
Die überwiegenden Havarien sind vergleichbar mit<br />
leichten Blechschäden im Straßenverkehr <strong>und</strong> erfordern
Km 0,0<br />
SS KKKK OOOO<br />
Osnabrück<br />
Km 14,53<br />
Abwicklung von Schiffsunfällen - Strom- <strong>und</strong> Schifffahrtspolizeiliche Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
selten ein besonderes polizeiliches Eingreifen seitens der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung.<br />
Hiervon unterscheiden sich die beiden schweren Havarien<br />
im Frühjahr <strong>2007</strong> am Elbe-Seitenkanal. Beide Havaristen<br />
waren in ihrer Schwimm- <strong>und</strong> Manövrierfähigkeit so stark<br />
beeinträchtigt, dass eine sichere Passage anderer Fahrzeuge<br />
nicht mehr möglich war. Der Elbe-Seitenkanal musste<br />
daher für die übrige Schifffahrt gesperrt werden. Die<br />
Bergungsmaßnahmen selbst erforderten darüber hinaus die<br />
<strong>WSD</strong><br />
Grenze<br />
Schiffsunfälle<br />
Gesunkenes Fahrzeug<br />
Zusammenstöße<br />
Böschungsanfahrungen<br />
Personenschäden auf dem Schiff<br />
Gr<strong>und</strong>berührungen<br />
Feuer auf dem Schiff<br />
Sp<strong>und</strong>wandanfahrungen<br />
Brückenanfahrungen<br />
Leck im Schiff<br />
Hollage<br />
Haste<br />
<strong>WSD</strong><br />
Grenze<br />
Unfälle durch Sog u. Wellenschlag<br />
Anfahrungen von Schleusen u. anderen Anlagen<br />
Sportbootunfälle<br />
Sonstiges<br />
Bergeshövede<br />
Diemelsee<br />
Edersee<br />
Minden<br />
Km 100,0<br />
B0naforth<br />
Wilhelmshausen sen<br />
Wahnhausen<br />
StadtschleuseKassel el<br />
WW EEE SS EE RRR<br />
W E SE S E<br />
E R<br />
F U L D A<br />
Bremer Weserschleuse.<br />
Langwedel<br />
Dörverden<br />
Drakenburg<br />
Landesbergen<br />
Schlüsselburg<br />
Petershagen<br />
Minden<br />
Schachtschleuse<br />
MLK<br />
Hameln<br />
Km 134,75<br />
Oberschleuse<br />
SS KK LL<br />
SS KK MM<br />
Unterschleuse Linden Li<br />
Km 11,20<br />
W E R R A<br />
Hann. Münden<br />
Anderten<br />
Km 174,20<br />
SS KK HH<br />
Hildesheim<br />
Km 15,12<br />
Bolzum<br />
Lüneburg<br />
Km 100,23<br />
Uelzen<br />
Km 70,74<br />
Braunschweig<br />
Km 220,,0<br />
SS KK SS<br />
Salzgitter<br />
Km 17,97<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> – Dez. S -55- Statistik tatistik 2006<br />
Abb. 4: Schiffsunfälle in der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> im Jahre 2006<br />
Beteiligung der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung. Damit<br />
ging das polizeiliche Eingreifen über die bloße Unfallaufnahme<br />
<strong>und</strong> Schadensfeststellung hinaus. Die erforderlichen<br />
strom- <strong>und</strong> schifffahrtspolizeilichen Maßnahmen zur Gewährleistung<br />
der Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des Schiffsverkehrs<br />
wurden begleitend zur Bergung vom <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsamt Uelzen veranlasst, mit dem Ziel, die verhängten<br />
Sperrungen schnellstmöglich wieder aufzuheben.<br />
Aufgabe Abwehr von Gefahren für die<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des<br />
Schiffsverkehrs sowie Verhütung<br />
von der Schifffahrt ausgehender<br />
Gefahren<br />
Km 115,20<br />
EE SS KK<br />
Wedtlenstedt<br />
Üfingen<br />
Lüneburg<br />
Sülfeld<br />
Uelzen<br />
Wolfsburg<br />
Km 246,0<br />
<strong>WSD</strong><br />
Grenze<br />
WSA Grenzen<br />
Schifffahrtspolizei Strompolizei<br />
Haldensleben<br />
Km 300,10 00 00,<br />
<strong>WSD</strong><br />
Grenze<br />
Magdeburg<br />
Rothensee<br />
Km 320,50<br />
Schiffsunfälle<br />
WSA Hann. Münden 3<br />
WSA Minden 20<br />
WSA Verden 7<br />
WSA Braunschweig 16<br />
WSA Uelzen 54<br />
Gesamt 100<br />
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr,<br />
die nötig sind, um die<br />
B<strong>und</strong>eswasserstraße in einem für<br />
die Schifffahrt erforderlichen<br />
Zustand zu halten<br />
Begriff Verkehrspolizei Wegepolizei<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage Binnenschifffahrtsaufgabengesetz<br />
(§ 1, Abs. 1, Nr. 2)<br />
ffahrtspolizei<br />
Vorgehensweise bei der Abwicklung von<br />
Havarien<br />
Die Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung leiten<br />
sich bei der Abwicklung von Havarien aus Maßnahmen zur<br />
Gewährleistung der Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des Schiffsverkehrs<br />
ab. Der Begriff der Schifffahrtspolizei ist im Binnenschifffahrtsaufgabengesetz<br />
(BinSchAufG) <strong>und</strong> der Be-<br />
griff der Strompolizei im B<strong>und</strong>eswasserstraßengesetz<br />
(WaStrG) definiert (Tab. 2). Der B<strong>und</strong> <strong>und</strong> die B<strong>und</strong>esländer<br />
haben ferner vereinbart, dass die schifffahrtspolizeilichen<br />
Vollzugsaufgaben von der <strong>Wasser</strong>schutzpolizei wahrgenommen<br />
werden. Unter anderem führt die <strong>Wasser</strong>schutzpolizei<br />
im Fall von Havarien die nötigen Ermittlungsaufgaben<br />
<strong>und</strong> Vollzugsaufträge aus.<br />
Damit sind alle Maßnahmen, die im Rahmen einer Havarie<br />
zu treffen sind <strong>und</strong> einen verkehrlichen Bezug haben,<br />
<strong>Wasser</strong>straßengesetz<br />
(§ 24, Abs. 1)<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Abwicklung von Schiffsunfällen - Strom- <strong>und</strong> Schifffahrtspolizeiliche Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
z.B. alle Verkehrsregelungsmaßnahmen, schifffahrtspolizeiliche<br />
Maßnahmen. Davon zu unterscheiden sind die strompolizeilichen<br />
Maßnahmen, wie die Beseitigung von Hindernissen,<br />
die den Zustand der <strong>Wasser</strong>straße, also den Verkehrsweg,<br />
betreffen. Die <strong>Wasser</strong>schutzpolizei nimmt den<br />
Schiffsunfall auf <strong>und</strong> stellt Untersuchungen zum Unfallhergang<br />
an.<br />
Die ersten verkehrsregelnden Maßnahmen sind bereits im<br />
Zuge der Gefahrenabwehr zu treffen. In der Verantwortung<br />
Havarie<br />
Schiffsführer, Eigner,<br />
Havariekommissar<br />
Turnen<br />
Bergung Veranlassen Durchführen Genehmigen Überwachen Verfügen<br />
Verbringung des Havaristen<br />
<strong>Wasser</strong>schutzpolizei<br />
Havarist<br />
WSV<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsverwaltung<br />
Sofortmaßnahmen zur Abwehr<br />
von Gefahren X X X<br />
Benachrichtigung Feuerwehr,<br />
Rettungsdienst, Behörden X X X<br />
Verfügen eines (vorläufigen)<br />
Weiterfahrverbotes X X<br />
Verfügung von verkehrlichen<br />
Einschränkungen<br />
(Schifffahrtssperre)<br />
Bekanntgabe von<br />
Verkehrsbehinderungen<br />
(Verkehrslenkung,<br />
Schifffahrtszeichen)<br />
Aufhebung des<br />
Weiterfahrverbotes<br />
(unter Auflagen)<br />
Ermittlungsaufgaben X<br />
Abb. 5: Aufgabenwahrnehmung zur Gefahrenabwehr bei einer Havarie<br />
für die übrige Schifffahrt werden schifffahrtspolizeiliche<br />
Maßnahmen, wie die Sperrung der <strong>Wasser</strong>straße, Information<br />
an die Schifffahrt über den Nautischen Informationsfunk<br />
(NIF) <strong>und</strong> ggf. übers Internet in www.elwis.de oder<br />
eine Hindernisbezeichnung erforderlich. Maßnahmen zur<br />
Verkehrslenkung werden gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
vom <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt veranlasst<br />
(Abb. 5).<br />
Räumen der Fahrrinne<br />
Nach § 1.18 Abs. 1 Binnenschifffahrtsstraßenordnung<br />
muss der Schiffsfüh- Leckabdichtung<br />
rer, dessen Fahrzeug die Fahrrinne Pump(hilfe)<br />
ganz oder teilweise versperrt oder zu<br />
Umladen <strong>und</strong> Leichtern<br />
versperren droht, die erforderlichen<br />
Maßnahmen treffen, um die Fahrrinne<br />
in kürzester Zeit freizumachen. Diese<br />
Aufgabe wird bei schweren Havarien,<br />
wie denen am Elbe-Seitenkanal, in der<br />
Regel von einem Havariekommissar, der vom Eigner oder<br />
der Versicherung eingesetzt wird, unterstützt.<br />
Selbst wenn der Schiffsführer <strong>und</strong> der eingesetzte Havariekommissar<br />
alle Maßnahmen treffen, die zur Wiederherstellung<br />
des schiffbaren Zustandes der <strong>Wasser</strong>straße erforderlich<br />
sind, so muss dennoch die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
weiter polizeilich tätig werden. Maßnahmen zur<br />
Bergung des Havaristen, wie das Turnen (Freischleppen),<br />
Umladen, Verbringen vom Havarieort dürfen nur mit Zustimmung<br />
oder Erlaubnis der zuständigen Behörde erfolgen.<br />
Damit ist das strom- <strong>und</strong> schifffahrtspolizeiliche (hoheitliche)<br />
Tätigwerden gr<strong>und</strong>sätzlich erforderlich.<br />
Darüber hinaus kann bzw. muss die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
auch ganz oder teilweise selbst bei den<br />
Bergungsarbeiten tätig werden. Häufig wird sie vom Havariekommissar<br />
dazu beauftragt, weil sie in gewissem Um-<br />
X X<br />
Havarist<br />
WSV<br />
Abb. 6: Aufgabenwahrnehmung zur Bergung von Havaristen<br />
fang Bergungsgeräte besitzt <strong>und</strong> über einschlägige Fachkenntnisse<br />
für derartige Arbeiten verfügt (Abb. 6).<br />
Maßnahmen, die zur Beseitigung einer Gefahr sofort<br />
erforderlich werden, kann die <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
aber auch im eigenen Ermessen durchführen.<br />
Hierfür hat der Gesetzgeber sowohl einen privatrechtlichen<br />
Weg nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) als auch<br />
einen öffentlich-rechtlichen Weg nach dem B<strong>und</strong>eswasserstraßengesetz<br />
(WaStrG) geschaffen (Abb. 7). Erforderlich<br />
wird diese Vorgehensweise in der Regel dann, wenn der<br />
X<br />
X<br />
Verfügungen zu erzwingen.<br />
WSV<br />
Verursacher nicht erreichbar<br />
ist oder seiner Beseitigungspflicht<br />
aus anderen Gründen<br />
nicht nachkommt.<br />
Dennoch müssen die Kosten<br />
nicht vom B<strong>und</strong><br />
übernommen werden. Die<br />
Kosten bei beiden<br />
Vorgehensweisen können<br />
dem Verantwortlichen für die<br />
Havarie nach den entsprechenden<br />
Rechtsvorschriften<br />
auferlegt werden. Darüber<br />
hinaus ist die Behörde<br />
befugt, die Beseitigung des<br />
Hindernisses mit strom-<br />
oder schifffahrtspolizeilichen<br />
Fazit aus den Havarien am Elbe-Seitenkanal<br />
Die beiden schweren Havarien am Elbe-Seitenkanal, glücklicherweise<br />
ohne Personenschäden, zeichneten sich durch<br />
ihre Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs aus. Obwohl die<br />
WSP<br />
WSV<br />
WSV<br />
Bergungsarbeiten auf Gr<strong>und</strong> der guten Zusammenarbeit<br />
zwischen allen Beteiligten sehr zügig durchgeführt<br />
werden konnten, musste der Elbe-Seitenkanal für<br />
insgesamt r<strong>und</strong> 50 St<strong>und</strong>en gesperrt werden.<br />
Die Havaristen sind ihrer Beseitigungspflicht voll umfänglich<br />
nachgekommen, so dass keine strom- oder schifffahrtspolizeilichen<br />
Verfügungen unter Androhung von Zwangsmitteln<br />
zur Räumung der Fahrrinne erlassen werden brauchten.<br />
Jedoch mussten die gesamten Bergungsmaßnahmen durch<br />
das <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Uelzen <strong>und</strong> den Außenbezirk<br />
Wittingen polizeilich begleitet werden. Neben den<br />
verkehrsregelnden Maßnahmen, sind die einzelnen Schritte<br />
zur Bergung vom <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Uelzen<br />
genehmigt <strong>und</strong> überwacht worden. Außerdem wurde das<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt mit Teilmaßnahmen zur Bergung<br />
beauftragt. Die hierbei entstandenen Kosten in Höhe<br />
von r<strong>und</strong> 50.000 € sind bereits bezahlt worden.
privatrechtliches<br />
Vorgehen<br />
Abwicklung von Schiffsunfällen - Strom- <strong>und</strong> Schifffahrtspolizeiliche Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung<br />
§ 677 ff<br />
BGB<br />
Beauftragung Geschäftsführung<br />
ohne Auftrag<br />
Die beiden schweren Havarien am Elbe-Seitenkanal haben<br />
gezeigt, dass gute fachspezifische Kenntnisse der Mitarbeiter<br />
der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung <strong>und</strong> eine gute<br />
Zusammenarbeit mit dem Havaristen, vertreten durch den<br />
Havariekommissar, Gr<strong>und</strong>voraussetzung zum Gelingen<br />
einer erfolgreichen Bergung sind. Wenn alle Beteiligten bei<br />
einer Havarie in der beschriebenen Form zusammenarbeiten,<br />
können auch in Zukunft die Beeinträchtigungen für die<br />
Schifffahrt <strong>und</strong> die Kosten minimiert sowie etwaige Arbeitsunfälle<br />
vermieden werden.<br />
Die Autoren bedanken sich bei den Mitarbeitern der <strong>Wasser</strong>-<br />
<strong>und</strong> Schifffahrtsämter Uelzen <strong>und</strong> Braunschweig, die<br />
durch ihren Einsatz maßgeblich zum Erfolg der Bergungsarbeiten<br />
beigetragen haben. Dadurch war es möglich, den<br />
Elbe-Seitenkanal nach den Havarien wieder schnell für den<br />
Schiffsverkehr freizugeben.<br />
§ 28 Abs.3<br />
bzw. § 30<br />
WaStrG<br />
Beseitigungsmaßnahmen<br />
WSV wird selbst tätig<br />
Kosten werden beim Verantwortlichen erhoben<br />
Abbildung 7: Vorgehensweise der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung bei einer Havarie<br />
öffentlich-rechtliches<br />
Vorgehen<br />
§ 28 Abs.1<br />
WaStrG<br />
strompolizeiliche<br />
Verfügung<br />
§ 1 Abs.2 i.V.m.<br />
§ 1 Abs.1 Nr.2<br />
BinSchAufG<br />
schifffahrtspolizeiliche<br />
Verfügung<br />
Adressat der Verfügung wird tätig<br />
Zwangsmittel werden vollstreckt<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Günter Schulz<br />
Neubauamt für den Ausbau des<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover<br />
Einleitung<br />
Die Schleusenanlage in Dörverden an der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
genügt nicht mehr den zukünftigen Anforderungen. Auf der<br />
Gr<strong>und</strong>lage von umfangreichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen<br />
für den Verkehr auf der <strong>Mitte</strong>lweser wurde festgelegt,<br />
eine neue Einkammerschleuse mit 139 m Länge,<br />
12,50 m Breite <strong>und</strong> 4 m Drempeltiefe bei hydrostatischem<br />
Stau zu bauen.<br />
Der Amtsentwurf, der nach intensiver Diskussion der verschiedenen<br />
Bauvarianten gewählt wurde, sieht als Baugrubenwand<br />
eine rückverankerte Bohrpfahlwand vor. Im<br />
Schutze dieser Wand wird die Baugrube unter <strong>Wasser</strong><br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Optimierung von<br />
Anker-Pfahllängen mit Hilfe<br />
von Probebelastungen<br />
Abb. 1: Querschnitt durch die Schleusenkammer<br />
Ilka Fischer<br />
Neubauamt für den Ausbau des<br />
<strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover<br />
ausgehoben. Dann wird eine rückverankerte Unterwasserbetonsohle<br />
eingebracht <strong>und</strong> anschließend die Baugrube<br />
gelenzt.<br />
Ober- <strong>und</strong> Unterhaupt werden als kompakte Massivbauwerke<br />
ausgeführt, die die Bohrpfahlwand als verlorene<br />
Schalung nutzen. Die beiden Bauwerke besitzen ein Eigengewicht,<br />
das auch bei einer Trockenlegung eine ausreichende<br />
Auftriebssicherheit gewährleistet. Die Rückverankerung<br />
der Bauwerkssohle ist deshalb in diesen Bereichen<br />
nach Fertigstellung des Bauwerks nicht mehr erforderlich.<br />
Anders sieht es bei der Schleusenkammer aus. Hier erhält<br />
die Bohrpfahlwand eine nur 40 cm dicke Vorsatzschale <strong>und</strong><br />
eine 1,00 m dicke Bauwerkssohle (siehe Abb. 1), so dass
das Eigengewicht der Konstruktion die Auftriebskräfte bei<br />
weitem nicht ausgleicht. Die Verankerung der Sohle muss<br />
hier also auf Dauer wirken.<br />
Im Folgenden wird nur die Verankerung der Sohle im Bereich<br />
der Schleusenkammer betrachtet. Die gr<strong>und</strong>sätzlichen<br />
Zusammenhänge gelten jedoch für alle Verankerungen.<br />
Ausgangssituation<br />
unten ein <strong>Wasser</strong>druck von 111 kPa (� 11,1 m WS).<br />
Daraus ergibt sich, dass zum Ausgleich des Auftriebs ein<br />
14,20 m dicker Bodenkörper mit Hilfe der Verankerung an<br />
die Betonsohle “angehängt“ werden muss.<br />
Der Amtsentwurf sieht als Verankerung Verpresspfähle<br />
nach DIN 4128 vor. Die wirtschaftlichste Lösung ergibt sich<br />
für ein Verankerungsraster von 2,70 m x 2,50 m <strong>und</strong> für<br />
GEWI – Einstabpfähle Ø 50 mm; BST 500 S mit doppeltem<br />
Korrosionsschutz. Als Verpresskörperdurchmesser werden<br />
20 cm angesetzt.<br />
Ohne Probebelastungen sind die in der DIN 1054 bzw. der<br />
DIN 4128 angegebenen Mantelreibungswerte anzusetzen.<br />
Mit diesen Werten errechnet sich für die Verankerung der<br />
Unterwasserbetonsohle eine erforderliche Verankerungslänge<br />
von bis zu 22 m.<br />
Der tragfähige Untergr<strong>und</strong> aus dicht bis sehr dicht gelagerten<br />
Sanden steht ab NN – 2,00 m an. Der Verpresskörper<br />
reicht also bis NN – 24,00 m. Für die Bohrungen ab Unterkante<br />
Unterwasserbetonsohle (NN + 3,80 m) ergibt sich<br />
somit eine Länge von ca. 28 m, für die GEWI-<br />
Einstabpfähle bis Oberkante Bauwerkssohle eine Länge<br />
von ca. 30 m.<br />
Gemeinsam mit der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>und</strong> der BAW wurde<br />
festgelegt, aufgr<strong>und</strong> der Vielzahl der einzubauenden Pfähle<br />
– insgesamt für Ober-, Unterhaupt <strong>und</strong> Kammer fast 650 –<br />
aus technischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen Gründen bereits im<br />
Rahmen der Entwurfsaufstellung Probebelastungen durchzuführen.<br />
Mit Hilfe der Probebelastungen ist es möglich<br />
• die tatsächlichen Mantelreibungswerte zu ermitteln <strong>und</strong><br />
damit die erforderliche Verankerungslängen wirklichkeitsnah<br />
festzulegen,<br />
• zuverlässige Annahmen für das Aufstellen der Verdingungsunterlagen<br />
zu erhalten <strong>und</strong><br />
• die Grenzen der Mantelreibung des Bodens zu ermitteln,<br />
um damit mögliche Nebenangebote sicher prüfen<br />
zu können.<br />
Optimierung von Anker-Pfahllängen mit Hilfe von Probebelastungen<br />
Probebelastungen<br />
Die Probebelastungen wurden Anfang 2006 ausgeschrieben<br />
<strong>und</strong> in der zweiten Jahreshälfte ausgeführt. Die Versuche<br />
wurden intensiv durch die BAW hinsichtlich der<br />
Gesamtkonzeption <strong>und</strong> Bewertung sowie die BAM (B<strong>und</strong>esanstalt<br />
für Materialforschung) hinsichtlich der Dehnungen/<br />
Lastabtragung begleitet. Insgesamt wurden acht vertikale<br />
Pfähle geprüft.<br />
Des weiteren sind auch 6 Schräganker geprüft worden, um<br />
gegebenenfalls Nebenangebote für die Verankerung der<br />
Bohrpfahlwände werten zu können. Der Amtsentwurf sieht<br />
hierzu R<strong>und</strong>stahlanker Ankertafeln als Verankerung vor.<br />
Zunächst wurde eine 3 m dicke Betonplatte auf der Geländeoberfläche<br />
(ca. NN +18 m) als Widerlager für die späte-<br />
Abb. 2: Widerlager für die Zugversuche<br />
ren Zugversuche hergestellt (siehe Abb. 2). Dann wurden<br />
durch Rohre, die in die Platte einbetoniert waren, Bohrungen<br />
bis maximal auf NN - 24 m niedergebracht.<br />
Die in die Bohrungen eingestellten bis zu 43 m langen<br />
vertikalen GEWI-Pfähle (siehe Abb. 3) wurden unterhalb<br />
des tragfähigen Baugr<strong>und</strong>es ab NN – 2 m verankert. Die<br />
Länge der Verpresskörper wurde zwischen 5 <strong>und</strong> 22 m<br />
(5, 9, 16, 22 m) variiert. Oberhalb der Verpressstrecke<br />
bewegt sich der GEWI-Stab in einem Hüllrohr reibungsfrei.<br />
Im Bereich der Verpressstrecke wurden auf einige Stahlzugglieder<br />
(GEWI-Stab) Lichtwellenleiter aufgeklebt. Wegen<br />
der festen Verbindung machen diese Sensoren die<br />
Verformung des GEWI-Stabes mit. Über ein optisches<br />
Messverfahren ist es möglich, die Dehnungen des Stahlzuggliedes<br />
in 1-2 m - Abschnitten zu erfassen. Aus den<br />
Dehnungen kann auf die Lastabtragung geschlossen werden.<br />
An der Stelle, an der das Stahlzugglied keine Verformungen<br />
mehr zeigt, ist die Zugkraft vollständig in den Baugr<strong>und</strong><br />
abgetragen. Der Anker unterhalb dieser Stelle ist für<br />
die Lastabtragung nicht mehr erforderlich.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Die Verpresskörper sind in der Tiefe hergestellt worden, in<br />
dem auch später die Zugpfähle ihre Last abtragen. Bei den<br />
Probebelastungen ist allerdings noch die Bodenauflast bis<br />
zur jetzigen Geländehöhe (NN + 18 m) vorhanden. Diese<br />
wird im Bereich der Baugrube bis auf NN + 3,80 m abgegraben.<br />
Der Einfluss, den die Reduzierung der Auflast auf<br />
den Spannungszustand im Boden <strong>und</strong> damit auf die Mantelreibung<br />
hat, wird über Finite Element (FE) Berechnungen<br />
ermittelt. Die erforderlichen Parameter für die<br />
FE-Berechnungen werden mit Hilfe der Ergebnisse der<br />
Probebelastungen - insbesondere aus dem Verlauf der<br />
Lastabtragung - festgelegt.<br />
Abb. 3: Einbau eines 43 m langen GEWI-Stabes<br />
Ergebnis<br />
Die Probebelastungen haben ergeben, dass sehr viel höhere<br />
Mantelreibungen aktiviert werden als in der DIN 1054<br />
bzw. DIN 4128 angegeben. Nach den Normen sind maximal<br />
120 kPa (0,12 MN / m²) anzusetzen. Mit dem Ergebnis<br />
aus den Versuchen kann hingegen eine mittlere Mantelreibung<br />
von mehr als 200 kPa angenommen werden.<br />
Die damit durchgeführten Berechnungen ergeben schließlich,<br />
dass bereits eine Verpresskörperlänge von 9 m ausreicht,<br />
um die Zugkräfte sicher in den Untergr<strong>und</strong> einzuleiten.<br />
Dies bedeutet, dass der Verpresskörper bis NN -11 m<br />
reicht, dass die Bohrung ca. 15 m lang ist <strong>und</strong> dass der<br />
GEWI-Pfahl eine Länge von ca. 17 m haben muss.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Optimierung von Anker-Pfahllängen mit Hilfe von Probebelastungen<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Probebelastung können also pro Zugpfahl 13<br />
m Bohrung, 13 m Verpresskörper <strong>und</strong> 13 m GEWI-Pfahl<br />
eingespart werden. Bei 650 Pfählen ergibt sich demnach<br />
eine Einsparung von 8.450 m Bohrung, 8.450 m Verpresskörper<br />
<strong>und</strong> 8.450 m GEWI-Pfahl. Setzt man 100 € / m an,<br />
so ergibt sich ein direkter wirtschaftlicher Nutzen aus der<br />
Probelastung von 845.000,- €. Demgegenüber stehen Kosten<br />
für Bohrungen, Widerlager, Messprogramm <strong>und</strong> Auswertung<br />
der Ergebnisse von ca. 380.000,- €.<br />
Für die Vertragssicherheit <strong>und</strong> die Prüfung von Nebenangeboten<br />
ist die genaue Kenntnis der Bodenkennwerte<br />
von sehr großem Vorteil. Eine wirtschaftliche Bewertung<br />
dieses Vorteils ist allerdings nicht möglich.<br />
Zusammenfassung<br />
Mit Hilfe von Probebelastungen <strong>und</strong> von FE-Berechnungen<br />
wurde die Länge der insgesamt 650 Zugverpresspfähle, die<br />
für die Auftriebssicherheit der Sohle der Schleuse Dörverden<br />
erforderlich sind, zuverlässig <strong>und</strong> genau ermittelt. Die<br />
Pfahllängen, die sich mit den nach DIN anzusetzenden<br />
Mantelreibungswerten ergeben hätten, konnten um 13 m<br />
verkürzt werden.
Abbruch <strong>und</strong> Entsorgung des<br />
PAK- belasteten<br />
Brechtdorfer Dükers Nr. 421<br />
am <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
Im Zuge des Ausbaus des <strong>Mitte</strong>llandkanals (MLK) zwischen<br />
Wolfsburg <strong>und</strong> Magdeburg sind mehrere Dükerbauwerke<br />
abzubrechen. Zu diesen gehört der 1932 erbaute<br />
Brechtdorfer Düker Nr. 421 bei MLK-km 254,485 zwischen<br />
Vorsfelde <strong>und</strong> Rühen in Niedersachsen. Es handelt sich um<br />
einen Stahlrohrdüker mit 1,50 m Innendurchmesser <strong>und</strong> ca.<br />
52 m Länge.<br />
Für die Ausschreibung <strong>und</strong> die Planung des Entsorgungsweges<br />
war von einer Belastung des Rohres auszugehen,<br />
zumal sich diese aus den bisherigen Erfahrungen mit benachbarten<br />
Dükerbauwerken bestätigt hatte.<br />
Die Bestandspläne wurden deshalb speziell auf gefährliche<br />
Stoffe hin überprüft. Es stellte sich heraus, dass die Isolierung<br />
des Innenanstrichs aus 2 Voranstrichen mit „Industriel-<br />
Spezial“ <strong>und</strong> einem ca. 2,5 mm starken „Semperfix“-<br />
Überzug der Firma Krebber, der Außenanstrich aus<br />
getränkter Jute mit 3 Bitumenanstrichen bestand. Alle<br />
Sp<strong>und</strong>wände <strong>und</strong> sonstigen Stahlteile wurden seinerzeit mit<br />
einem doppelten Bitumenanstrich <strong>und</strong> die Flanschdichtungen<br />
mit einer Asbestschnur <strong>und</strong> Bleiwolle versehen.<br />
Da aufgr<strong>und</strong> des Alters des Dükers keine Datenblätter über<br />
den Korrosionsschutz vorhanden waren <strong>und</strong> die genaue<br />
Zusammensetzung dieser Isolierung nicht bekannt war,<br />
wurden in Abstimmung mit der B<strong>und</strong>esanstalt für <strong>Wasser</strong>bau<br />
(BAW) in Karlsruhe Untersuchungen des Altanstrichs<br />
veranlasst. Beprobt wurden das Schütz, der Beton an der<br />
Einlaufoberseite sowie der Innen- <strong>und</strong> Außenanstrich des<br />
Dükers.<br />
Die Untersuchung der Anstriche ergab für alle Bauteile eine<br />
Belastung mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen<br />
(PAK), eine Asbestbelastung wurde jedoch nicht<br />
festgestellt. Die Beschichtung des Stahlrohrs wies eine<br />
Gesamtbelastung mit PAK von bis zu 458 mg/kg TS, die<br />
des Schützes von 861 mg/kg TS sowie die an der Betonoberfläche<br />
von 14.300 mg/kg TS auf.<br />
Hierbei handelte es sich um besonders überwachungsbedürftigen<br />
Abfall der Abfallart 170409 gemäß Abfallverzeichnis<br />
für die Metallteile <strong>und</strong> Abfallart 170106 für den belasteten<br />
Beton. Die Flanschdichtungen waren ohnehin wegen<br />
der vorhandenen Belastung mit Asbest einer gesonderten<br />
Entsorgung zuzuführen.<br />
Abb. 1: Außenbeschichtung des<br />
Stahlrohrdükers<br />
Nadine Conring<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
Eine Entschichtung der Stahlteile vor Ort kam wegen nicht<br />
gegebener Wirtschaftlichkeit aufgr<strong>und</strong> der Innenbelastung<br />
des Rohres <strong>und</strong> der erforderlichen, umfangreichen Arbeitssicherheitsmaßnahmen<br />
nicht in Frage.<br />
Es wurde ein Entsorgungskonzept für das Stahlrohr einschließlich<br />
aller behandelten Stahlteile, den gestrichenen<br />
Beton <strong>und</strong> die Flanschdichtungen aufgestellt.<br />
Nach den Gr<strong>und</strong>sätzen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist<br />
die Pflicht zur Verwertung von Abfällen einzuhalten, soweit<br />
dies technisch möglich <strong>und</strong> wirtschaftlich zumutbar ist,<br />
insbesondere, wenn für einen gewonnenen Stoff oder eine<br />
gewonnene Energie ein Markt vorhanden ist. Somit wurden<br />
für die belasteten Teile in Absprache mit der Niedersächsischen<br />
Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfällen<br />
(NGS) eine Anfrage bei mehreren Verwertern <strong>und</strong> Entsorgern<br />
durchgeführt.<br />
Nach Auswertung der Angebote unter Berücksichtigung<br />
aller zur Entsorgung hinzukommender Kosten wurden folgende<br />
Entsorgungswege gewählt:<br />
Das Stahlrohr einschließlich<br />
aller<br />
übrigen belasteten<br />
Stahlteile (ca.<br />
44 Tonnen) wurde<br />
nach Trier zur<br />
Firma Steil zur<br />
Verwertung gebracht.<br />
Die Firma<br />
besitzt ein patentiertes<br />
Verfahren<br />
zur wirtschaftlichenEntschichtung<br />
von asbestfreienAltanstrichen<br />
<strong>und</strong> ist in der<br />
Lage, große Bauteileanzunehmen.<br />
Da die<br />
Flanschdichtungen<br />
Artur Klippenstein<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
dort jedoch nicht angenommen werden durften, wurden<br />
diese vorab herausgetrennt <strong>und</strong> ebenso wie der belastete<br />
Beton zur Deponie Ihlenberg nach Selmsdorf gebracht.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Abbruch <strong>und</strong> Entsorgung des PAK- belasteten Brechtdorfer Dükers Nr. 421 am <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
Eine Besonderheit stellte der Abbruch des Dükerbauwerks<br />
aufgr<strong>und</strong> der schlechten Zuwegung dar. Der Düker lag im<br />
Moorgebiet des niedersächsischen Drömlings. In diesem<br />
Bereich war keine ausreichende Tragfähigkeit des Bodens<br />
für schweres Gerät gegeben. Auch stand im unmittelbaren<br />
Baustellenbereich kein Baufeld zum Trennen <strong>und</strong> Abtransportieren<br />
der Bauteile zur Verfügung. Der <strong>Mitte</strong>llandkanal<br />
konnte nur begrenzt gesperrt werden, so dass die Zerlegung<br />
des Dükers nicht vor Ort, sondern in der nahe gelegenen<br />
Liegestelle Rühen stattfinden musste. Darüber hinaus<br />
waren verschiedene Aspekte der Arbeitssicherheit<br />
(Arbeiten im kontaminierten Bereich) besonders zu berücksichtigen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der hohen Belastung mit PAK <strong>und</strong> der engen<br />
Platzverhältnisse wurde für die Entsorgung des Stahlrohrs<br />
ein gesondertes Abbruchkonzept in Abstimmung mit dem<br />
gewerblichen Aufsichtsamt in Braunschweig aufgestellt.<br />
Dieses Abbruchkonzept sah ein kontrolliertes Aufschwimmen<br />
des Dükers <strong>und</strong> ein späteres Abtrennen einzelner<br />
Bauteile unter <strong>Wasser</strong> vor.<br />
Bauablauf:<br />
Nach Durchführung aller Sicherungs- <strong>und</strong> Abbrucharbeiten<br />
am Einlauf- <strong>und</strong> am Auslaufbauwerk wurde das eigentliche<br />
Dükerrohr gereinigt <strong>und</strong> von Schlamm <strong>und</strong> Festablagerungen<br />
befreit. Das Rohr wurde mit Stahlblechen an den Rohrenden<br />
im Ein- <strong>und</strong> Auslauf verschlossen <strong>und</strong> anschließend<br />
freigebaggert. Danach wurde das noch im Rohr verbliebene<br />
<strong>Wasser</strong> mittels Luftdruck langsam herausgedrängt. Das<br />
Stahlrohr schwamm auf (Abb. 2).<br />
Abb. 2 : Aufschwimmen des Stahlrohres<br />
Abb. 3: Drehen des Stahlrohres<br />
Abb. 4: Abtransport zur Liegestelle<br />
Anschließend wurde das Stahlrohr langsam mit Hilfe von<br />
Schwimmbaggern gedreht <strong>und</strong> zur Liegestelle Rühen bei<br />
MLK- km 256,160 gezogen (Abb. 3 <strong>und</strong> 4).<br />
Nach Ankunft an der ca. 1,7 km entfernten Liegestelle wurde<br />
das Rohr wieder geflutet <strong>und</strong> parallel zur Liegestellensp<strong>und</strong>wand<br />
langsam wieder auf die Kanalsohle abgesenkt.<br />
Dann wurde das Rohr mit Hilfe von Kränen gedreht <strong>und</strong><br />
beidseitig der Flanschdichtungen (ca. 20 cm) in mehreren<br />
Arbeitschritten unter <strong>Wasser</strong> vorsichtig abgetrennt. Anschließend<br />
wurden die beiden Flanschdichtungen geborgen<br />
<strong>und</strong> per LKW ordnungsgemäß in verschlossenen Big-Packs<br />
zu IAG GmbH nach Selmsdorf abtransportiert <strong>und</strong> entsorgt<br />
(Abb. 5).<br />
Abb. 5: Stahlrohr mit Flanschdichtung<br />
Anschließend konnten die verbliebenen drei Rohrsegmente<br />
(je ca. 17,50 m lang) auf LKWs verladen <strong>und</strong> zusammen<br />
mit den übrigen belasteten Stahlbauteilen zur Fa. Steil nach<br />
Trier abtransportiert werden. Die Ausführung entsprechend<br />
des abgestimmten Abbruch- <strong>und</strong> Entsorgungskonzeptes<br />
klappte problemlos.
Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
an das<br />
Großmotorgüterschiff<br />
Das <strong>Wasser</strong>straßen- Neubauamt<br />
(WNA) Helmstedt hat mit<br />
der Planung der Schleusenkanäle<br />
im Bereich der <strong>Mitte</strong>lweser<br />
begonnen<br />
Im Rahmen des Ende 1999 eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens<br />
für die Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser an das<br />
Großmotorgüterschiff wurden insbesondere die Auswirkungen<br />
der geplanten Ausbaumaßnahmen auf die Umwelt im<br />
Rahmen einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung erfasst<br />
<strong>und</strong> bewertet. Am 15. November 2002 wurde durch die<br />
zuständige Planfeststellungsbehörde bei der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> in Hannover der Planfeststellungsbeschluss<br />
erlassen. Durch zwei zwischenzeitlich zurückgenommene<br />
Klagen beim Oberverwaltungsgericht<br />
Lüneburg ist der Planfeststellungsbeschluss aber erst seit<br />
Mai 2006 bestandskräftig. Damit wurde das entsprechende<br />
Baurecht für die <strong>Mitte</strong>lweseranpassung geschaffen.<br />
Dem WNA Helmstedt wurden daraufhin vom Gesamtprojekt<br />
<strong>Mitte</strong>lweseranpassung die Planung (Erstellung der Entwürfe-AU<br />
<strong>und</strong> Aufstellung der Ausschreibungsunterlagen)<br />
sowie die Durchführung der Vergabeverfahren <strong>und</strong> die<br />
anschließende Bauabwicklung für 5 Schleusenkanäle,<br />
10 Schleusenvorhäfen einschl. Liegestellen <strong>und</strong> 10 Dalbenleitwerke<br />
vor den Schleusen übertragen.<br />
Dies sind im Einzelnen:<br />
• Unterkanal Petershagen,<br />
• Vorhäfen <strong>und</strong> Dalbenleitwerke Petershagen,<br />
• Oberkanal Schlüsselburg,<br />
• Vorhäfen <strong>und</strong> Dalbenleitwerke Schlüsselburg,<br />
• Vorhäfen <strong>und</strong> Dalbenleitwerke Landesbergen,<br />
• Ober- <strong>und</strong> Unterkanal Drakenburg,<br />
• Vorhäfen <strong>und</strong> Dalbenleitwerke Drakenburg,<br />
• Oberkanal Dörverden,<br />
• Ober- <strong>und</strong> Unterkanal Langwedel sowie<br />
• Vorhäfen <strong>und</strong> Dalbenleitwerke Langwedel<br />
Manfred Sorge<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
Andreas Illies<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
Darüber hinaus obliegt dem WNA Helmstedt die Erstellung<br />
ggf. dafür erforderlicher Planänderungsunterlagen.<br />
Der im Zuge der <strong>Mitte</strong>lweseranpassung vorgesehene Ausbau<br />
der Schleusenkanäle in Drakenburg, Dörverden <strong>und</strong><br />
Langwedel wird entsprechend der sehr verschiedenen<br />
Randbedingungen auch mit unterschiedlicher Intensität<br />
durchgeführt. So werden die kurzen Kanalstrecken (bis<br />
ca. 1000 m) nicht verbreitert, lediglich in Teilbereichen um<br />
ca. 50 cm auf 3,50 m unter hydrostatischem Stau vertieft<br />
<strong>und</strong> das vorhandene Deckwerk durch ein neues, bis zur<br />
Sohle durchgängiges, filterstabiles Deckwerk ersetzt. Die<br />
Neigung wird mit 1:2,7 etwas steiler ausgebildet, um die<br />
Verhältnisse für die Schifffahrt in den Kanälen zu verbessern.<br />
Dagegen müssen die sehr langen <strong>und</strong> schmalen<br />
Kanäle in Langwedel sowie der Oberkanal in Drakenburg<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
im Querschnitt etwas aufgeweitet werden. Dieses erfolgt im<br />
Schleusenoberkanal Langwedel mittels eines symmetrisch<br />
ausgebildeten KRT-Profils (Unterwassersp<strong>und</strong>wand) bzw.<br />
im Schleusenunterkanal Langwedel <strong>und</strong> im Schleusenoberkanal<br />
Drakenburg durch ein Trapezprofil (Böschungsbauweise),<br />
jeweils aber ohne die vorhandenen kanalparallel<br />
angelegten Dämme bzw. Deiche <strong>und</strong> die Brücken anpassen<br />
zu müssen.<br />
Ziel ist es, den Ober- <strong>und</strong> den Unterkanal Langwedel sowie<br />
den Oberkanal Drakenburg für die Begegnung von zwei bis<br />
zu 2,50 m teilabgeladenen Großmotorgüterschiffen<br />
(GMS mit L= 110m, B= 11,45m) auszubauen. Zwischenzeitlich<br />
konnte nachgewiesen werden, dass im Richtungsverkehr<br />
sogar eine Befahrbarkeit mit bis zu 2,50 m teilabgeladenen<br />
übergroßen Großmotorgüterschiffen (üGMS mit<br />
L= 135,00 m; B= 11,45 m) bzw. 139 m langen Schubverbänden<br />
(L= 139,00 m; B= 11,45 m) möglich ist.<br />
Alle Baumaßnahmen sollen entsprechend der derzeitigen<br />
Zeitplanung bis Ende 2012 fertig gestellt sein.<br />
Planung des Schleusenkanals<br />
Langwedel<br />
Unmittelbar nach Übertragung der o.g. Aufgaben an das<br />
WNA Helmstedt wurde noch im Herbst 2006 mit den ersten<br />
Planungen für den Schleusenkanal Langwedel begonnen.<br />
Dieser Schleusenkanal wird von Mitarbeitern des WNA<br />
Helmstedt eigenständig geplant.<br />
Sehr schnell stellte sich mit konkreter werdender Planung<br />
heraus, dass gegenüber der planfestgestellten Lösung<br />
zusätzliche Maßnahmen planrechtlich abzusichern waren.<br />
Ein Planänderungsverfahren wurde notwendig. Die entsprechenden<br />
Planunterlagen wurden im WNA Helmstedt<br />
erstellt. Das WSA Verden als Träger des Vorhabens hat<br />
damit im Dezember <strong>2007</strong> das Planänderungsverfahren bei<br />
der zuständigen Planfeststellungsbehörde (Dezernat P der<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong>) beantragt.<br />
Parallel dazu wurde im WNA der Entwurf-AU erarbeitet.<br />
Dieser befindet sich derzeit in der Abstimmungs- <strong>und</strong> Genehmigungsphase.<br />
Der Baubeginn ist im Sommer <strong>2008</strong> vorgesehen.<br />
Ausbauprofile Schleusenoberkanal<br />
<strong>und</strong> Schleusenunterkanal<br />
Langwedel<br />
Der ca. 4,2 km lange Schleusenoberkanal wird zweischiffig<br />
im KRT-Profil (Unterwassersp<strong>und</strong>wand) symmetrisch zur<br />
vorhandenen Kanalachse mit einer <strong>Wasser</strong>tiefe von 3,50 m<br />
unter hydrostatischem Stau <strong>und</strong> einer Breite von 42,00 m<br />
ausgebaut. Vorhandene Übertiefen werden aufgefüllt. Die<br />
Kanalsohle bleibt unbefestigt. Die Oberkante der Unterwassersp<strong>und</strong>wand<br />
liegt nach Forderung der Unteren Naturschutzbehörde<br />
des Landkreises Verden im gesamten Streckenabschnitt<br />
20 cm unter hydrostatischem Stau. Der<br />
Flachwasserbereich landseitig der Unterwassersp<strong>und</strong>wand<br />
erhält bei einer <strong>Wasser</strong>tiefe von 20 cm je nach Ursprungsprofil<br />
Breiten von 90 bis 250 cm. Die Einbindung des neuen<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser an das Großmotorgüterschiff<br />
Profils in den vorhandenen Querschnitt erfolgt mit einer<br />
Neigung von 1:3.<br />
Abb. 2: Einfahrt aus der Weser in den<br />
Schleusenoberkanal Langwedel<br />
Der Böschungsbereich ab der Flachwasserzone hinter der<br />
Unterwassersp<strong>und</strong>wand wird bis 70 cm über dem hydrostatischen<br />
Stau mit einem filterstabilen Deckwerk aus losen<br />
Schüttsteinen CP 90/250, 40 cm dick, gesichert. Unter der<br />
Steinschüttung wird ein zweistufiger Kornfilter, 2x 15 cm<br />
dick, gemäß MAG angeordnet. Der Kanalseitendamm bzw.<br />
-deich wird nicht verändert <strong>und</strong> nicht beeinträchtigt.<br />
Die Unterwassersp<strong>und</strong>wände des KRT-Profils werden<br />
unverankert hergestellt. Aus statischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen<br />
Gründen ist eine Kolksicherung erforderlich. Deren<br />
Ausbildung erfolgt als Fußverlängerung mit 1,50 m tiefer<br />
Einbindung. Die Kolksicherung wird aus den vorhandenen<br />
alten <strong>Wasser</strong>bausteinen Klasse II <strong>und</strong> III in einer Stärke von<br />
50 cm hergestellt. Diese Steinschüttung wird mit 70 l/m²<br />
vergossen.<br />
Die im Oberkanal befindliche Schiffsanlegestelle Daverden<br />
wird zur Umschlag- <strong>und</strong> Verladestelle Daverden umgestaltet.<br />
Auf einer Länge von 100 m wird in der Flucht der Unterwassersp<strong>und</strong>wand<br />
eine Überwassersp<strong>und</strong>wand auf<br />
NN + 12,00 m als Umschlagstelle hergestellt. Der dahinter<br />
befindliche Materiallagerplatz wird höhengleich angepasst<br />
<strong>und</strong> die Befestigung mit einer 40 cm dicken Schottertragschicht<br />
erneuert. Des weiteren entsteht unmittelbar<br />
daneben eine Verladestelle für Geräte <strong>und</strong> Baumaschinen.<br />
Dazu wird an die Sp<strong>und</strong>wand eine 10 m breite Betonrampe<br />
herangeführt. Die Sp<strong>und</strong>wandübergänge der Oberkanten<br />
werden jeweils in einer Neigung von 1:16 ausgeführt.<br />
Die Trennspitze zwischen Schleusenoberkanal <strong>und</strong> Weser<br />
wird ebenfalls mit einer Überwassersp<strong>und</strong>wand ausgeführt.<br />
Die Sp<strong>und</strong>wand wird um die Trennspitze herumgeführt. Das<br />
vorhandene Gelände wird daran angepasst.<br />
Das neue Profil im Schleusenoberkanal Langwedel ermöglicht<br />
den Begegnungsverkehr zweier 2,50 m abgeladener<br />
Großmotorgüterschiffe (GMS).<br />
Der ca. 2,2 km lange Schleusenunterkanal wird im Trapezprofil<br />
mit einer <strong>Wasser</strong>tiefe von 3,50 m unter hydrostatischem<br />
Stau ausgebaut. Vorhandene Übertiefen werden<br />
aufgefüllt.<br />
Das Ausbauprofil wird symmetrisch zur Kanalachse aufgeweitet,<br />
die neue Sohlbreite beträgt 32,10 m, die anschlie-
ßenden Böschungsneigungen betragen 1:2,7 bis 70 cm<br />
über <strong>Mitte</strong>lwasser <strong>und</strong> darüber 1:2,5 bis zur Sommerdeichbzw.<br />
Geländeoberkante. Die <strong>Wasser</strong>spiegelbreite bei hydrostatischem<br />
Stau beträgt 51,00 m.<br />
Abb. 3: Regelquerschnitte Schleusenkanal Langwedel<br />
Beide Uferböschungen erhalten von der Sohle ausgehend<br />
bis 70 cm über dem <strong>Mitte</strong>lwasser ein filterstabiles Deckwerk<br />
aus losen Schüttsteinen, LMB 5/40, 60 cm dick. Unter der<br />
Steinschüttung wird ein zweistufiger Kornfilter, 2x 20 cm<br />
dick, gemäß MAG angeordnet. Die Kanalsohle bleibt unbefestigt,<br />
der Übergang der Böschungssicherung in die Sohle<br />
erfolgt mit einer Fußverlängerung entsprechend MAR mit<br />
einer 1,50 m tiefen Einbindung.<br />
Oberhalb von NN + 6,50 m wird die Böschung mit dem<br />
vorhanden Böschungsmaterial (Schüttsteine mit Bodenanteilen),<br />
60 cm dick, ausgeführt sowie mit Weidengehölzen,<br />
Röhricht <strong>und</strong> standortgerechten Ufergehölzen aus den<br />
LBP-Maßnahmen bis NN + 9,25 m bepflanzt. Darüber befindet<br />
sich die wasserseitige Böschung des Sommerdeiches,<br />
die eine Begrünung mit Rasen erhält. Der Sommerdeich<br />
wird in seiner Funktion nicht beeinträchtigt.<br />
Abb. 4: Blick vom Schleusenunterkanal aus auf die Brücke 60<br />
(im Hintergr<strong>und</strong> ist der Ort Baden zu sehen)<br />
Um die Standsicherheit der Brücke Nr. 60 mit Herstellung<br />
des neuen Ausbauprofils nicht zu gefährden, muss der<br />
neue Kanalquerschnitt im unmittelbaren Brückenbereich<br />
statt im Trapezprofil im Rechteckprofil hergestellt werden.<br />
Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser an das Großmotorgüterschiff<br />
Dort wird beidseitig eine hohe Sp<strong>und</strong>wand mit Oberkante<br />
auf NN + 6,50 m (entspricht der Höhe der Deckwerksbefestigung<br />
im Bereich des T- Profils) <strong>und</strong> einer Fahrrinnenbreite<br />
von 42,00 m ausgeführt. Im weiteren Verlauf bindet die<br />
Sp<strong>und</strong>wand mit einem Verzug von 1:10<br />
jeweils in die Böschungen des T- Profils ein.<br />
Das neue Profil im Schleusenunterkanal<br />
Langwedel ermöglicht den Begegnungsverkehr<br />
zweier 2,50 m abgeladener Großmotorgüterschiffe.<br />
Planung des<br />
Schleusenkanals<br />
Drakenburg<br />
Schleusenkanals Langwedel wurde die<br />
Planung des Schleusenkanals Drakenburg<br />
einschließlich der Vorhäfen (Entwurf- AU <strong>und</strong><br />
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen) an ein<br />
geeignetes Ingenieurbüro vergeben. Nach öffentlichem<br />
Teilnahmewettbewerb erfolgte im April <strong>2007</strong> die Vergabe<br />
der vorgenannten Planungsleistungen an das Ingenieurbüro<br />
grbv aus Hannover. Es ist vorgesehen den Entwurf AU<br />
Anfang <strong>2008</strong> in der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> einzureichen. Der Baubeginn<br />
für den Schleusenkanal Drakenburg ist im Herbst <strong>2008</strong><br />
geplant.<br />
Ausbauprofile<br />
Der gesamte ca. 2,9 km lange Schleusenoberkanal wird<br />
zweischiffig im Trapezprofil bei hydrostatischem Stau von<br />
NN+ 21,00 m mit einer <strong>Wasser</strong>spiegelbreite von 51,00 m<br />
ausgebaut. Dadurch wird bei Einzelschiffen ein Querschnittsverhältnis<br />
von n = 5,62 erreicht, so dass in diesem<br />
Bereich sogar eine wirtschaftliche Schiffsgeschwindigkeit<br />
von 9 km/h ermöglicht werden kann. Beim Begegnungsverkehr<br />
mit Großmotorgüterschiffen wird jedoch nur noch ein<br />
Querschnittsverhältnis von 2,81 erreicht. Die Mindestanforderung<br />
für das Querschnittsverhältnis bei einer fahrdynamische<br />
Begegnung von 5 km/h beträgt n = 3,00. Da dieser<br />
Wert nicht gewährleistet werden kann, ist die Begegnung<br />
mit übergroßen Großmotorgüterschiffen als Manövrierfahrt<br />
mit verringerter Geschwindigkeit vorzusehen.<br />
Abb. 5: Regelquerschnitte Schleusenkanal Drakenburg<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
Im Bereich der Vorhäfen ist der Ausbau ebenfalls im Trapezprofil<br />
vorgesehen. Der nur ca. 1 km lange Schleusenunterkanal<br />
wird einschiffig im Trapezprofil ausgebaut. Bei<br />
hydrostatischem Stau von NN+ 14,60 m beträgt die <strong>Wasser</strong>spiegelbreite<br />
38,00 m. Die Böschungsneigungen sind<br />
sowohl im Ober- als auch im Unterkanal gemäß Planfeststellung<br />
mit 1:2,7 festgelegt. Im Schleusenunterkanal beträgt<br />
das Querschnittsverhältnis n = 3,80. Damit ist gewährleistet,<br />
dass dieser Bereich auch mit dem üGMS, allerdings<br />
mit verminderter Geschwindigkeit befahren werden<br />
kann.<br />
Wendestelle<br />
Im Bereich des Schleusenoberkanals Drakenburg wurde<br />
die Notwendigkeit einer Wendestelle festgestellt. Da diese<br />
Wendestelle im früheren Planfeststellungsbeschluss nicht<br />
vorgesehen war, ist es erforderlich ein entsprechendes<br />
Ergänzungsverfahren zu initiieren. Im Zuge der Planänderungen<br />
ist eine Umweltverträglichkeitsstudie sowie eine<br />
Untersuchung der Beeinflussung des Hochwasserabflussverhaltens<br />
durch die neu zu errichtende Wendestelle vorgesehen.<br />
Die Wendestelle wird von den Abmessungen für<br />
das Wenden aller auf der <strong>Mitte</strong>lweser vorgesehenen Regelschiffe<br />
geplant. Die Ufer im Bereich der Wendestelle werden<br />
in Böschungsbauweise hergestellt, wobei die vorgesehene<br />
Ufersicherungssteinschüttung teilvergossen wird.<br />
Abb. 6: Planung der Wendestelle im Schleusenoberkanal Drakenburg<br />
Ausbildung der Deckwerke<br />
Der Schleusenkanal Drakenburg ist nicht gedichtet, so dass<br />
gemäß Merkblatt „Anwendung von Regelbauweisen für<br />
Böschungs- <strong>und</strong> Sohlensicherungen an <strong>Wasser</strong>straßen“ die<br />
Regeldeckschicht D1 mit losen <strong>Wasser</strong>bausteinen auf<br />
Kornfilter oder Geotextil gewählt wurde. Durch die BAW<br />
wurden dazu Berechnungen mit verschiedenen Schiffstypen<br />
durchgeführt. Der Schiffsvergleich ergab, dass im<br />
4,0 m tiefen Kanal das Schiff üGMS - leer die größten hydraulischen<br />
Belastungen verursacht. Die erforderliche Steingröße<br />
wurde mit der hydraulischen Bemessung für eine<br />
Gesteinsdichte ps = 2650 kg/m3 durch die BAW ermittelt.<br />
Für den Oberkanal ist die Steinklasse LMB 5/40 erforderlich,<br />
wobei ein G50 � 16 kg einzuhalten ist. Für den Schleusenoberkanal<br />
ergab sich bei Verwendung eines geotextilen<br />
Filters eine Deckwerksdicke von 85 cm. Alternativ dazu ist<br />
die Verwendung eines Kornfilters 2 x 20 cm nach MAK in<br />
Verbindung mit einer 60 cm dicken Deckschicht möglich.<br />
Im Schleusenunterkanal ergab sich eine unterhalb der nach<br />
MAR liegenden Mindestdicke der Deckwerke von 60 cm.<br />
Dort kann ein 30 cm starker Einstufen- Kornfilter nach MAK<br />
oder alternativ ein Geotextil nach MAG verwendet werden.<br />
Da in den Schleusenkanälen die Fußverlängerung als unterer<br />
Deckwerksabschluss vorgesehen wurde, hat die BAW<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser an das Großmotorgüterschiff<br />
auf Gr<strong>und</strong> der errechneten Kolktiefen eine Ausführung bis<br />
2,0 m unter die Kanalsohle vorgesehen.<br />
Für die Vorhäfen gelten die Empfehlungen zur Ausführung<br />
der Deckwerke genauso. Allerdings wird auf Gr<strong>und</strong> der,<br />
durch die An- <strong>und</strong> Ablegemanöver bedingten, erhöhten<br />
Schraubenstrahlbelastungen ein Deckwerk von d=40 cm<br />
aus Steinklasse CP 90/250 mit 70 l/m² Verguss für die<br />
Böschungs- als auch für die Sohlensicherung empfohlen.<br />
Im Bereich der verklammerten Deckwerke ist ein geotextiler<br />
Filter nach MAG zu bevorzugen.<br />
Anpassung der Vorhäfen<br />
Im Bereich der Vorhäfen sind die Liege- <strong>und</strong> Warteplätze<br />
für die Schiffe ebenfalls an die zukünftig erforderlichen<br />
Notwendigkeiten anzupassen. Hierzu zählen insbesondere<br />
die Dalben, welche an die größer werdenden Schiffseinheiten<br />
angepasst werden müssen. Eine Forderung des WSA<br />
Verden bestand darin, zukünftig auf die Verwendung von<br />
Bündeldalben zu verzichten, da sich diese als sehr wartungsintensiv<br />
<strong>und</strong> reparaturunfre<strong>und</strong>lich erwiesen haben.<br />
Es sollten deshalb vorrangig Einrohrdalben verwendet<br />
werden. Das zukünftig größte verkehrende Schiff auf der<br />
Weser ist das teilabgeladene üGMS (L=135 m, B=11,45 m)<br />
mit einer Tragfähigkeit (dw) von 2223 t. Deshalb musste<br />
zunächst festgelegt werden, welche Schiffsgröße als Bemessungsschiff<br />
herangezogen wird. Da eine Dalbenberechnung,<br />
in der das teilabgeladene ÜGMS als Bemessungsschiff<br />
angenommen wird, sehr steife Dalben ergeben<br />
würde, wurde als Kompromiss das teilabgeladene GMS<br />
(L=110 m, B=11,45 m) mit einer Tragfähigkeit (dw) von<br />
1800 t als Bemessungsschiff vorgesehen. Die Bemessung<br />
von Dalben mit der nächst kleineren verkehrenden Schiffseinheit<br />
hat den Vorteil, dass die verwendeten Dalbendurchmesser<br />
im wirtschaftlicheren Bereich liegen <strong>und</strong> auch<br />
für kleinere Schiffe wie z.B. dem Europaschiff (Tragfähigkeit<br />
tw 1350 t) noch genügend Elastizität vorhanden ist, damit<br />
diese beim Anlegevorgang nicht beschädigt werden. Die<br />
Ausstattung der Liege- <strong>und</strong> Warteplätze erfolgt nach dem<br />
vom WSA Verden erarbeiteten Liegestellenkonzept.<br />
Abb. 7: Blick von der Schleuse Drakenburg in den unteren Vorhafen<br />
(im Vordergr<strong>und</strong> das Dalbenleitwerk, im Hintergr<strong>und</strong> die Dalbenliegestelle)
Leitwerke<br />
Im Bereich der Schleusenzufahrten befindliche Leitwerke<br />
haben die Aufgabe, die Schiffseinheiten auch beim Abdriften<br />
von der idealen Einfahrtslinie möglichst schadlos in die<br />
Schleusenkammer zu leiten. Dazu ist es erforderlich, auch<br />
die Leitwerke an den Verkehr mit den vorgesehenen Regelschiffen<br />
anzupassen. Die vorhandenen Leitwerke stammen<br />
aus den 60er Jahren <strong>und</strong> sind größtenteils noch für<br />
das 1000 t Schiff bemessen <strong>und</strong> deshalb durch Neukonstruktionen<br />
zu ersetzen. Auch hier wurde das teilabgeladene<br />
GMS als Bemessungsschiff vorgesehen. Da es nach<br />
gegenwärtigem Erkenntnisstand keine übergeordneten<br />
Vorschriften, Empfehlungen bzw. Richtlinien zu den Belastungsansätzen<br />
<strong>und</strong> Berechnungsgr<strong>und</strong>lagen für Leitwerke<br />
an Binnenschifffahrtsstraßen gibt, wurde durch das<br />
WNA Helmstedt eine entsprechende Konzeption zur Bemessung<br />
von elastischen Leitwerken aus Stahl aufgestellt.<br />
Da seitens des Unterhaltungsamtes die Forderung aufgestellt<br />
wurde, die Leitwerke aus Einrohrdalben (keine Bün-<br />
Anpassung der <strong>Mitte</strong>lweser an das Großmotorgüterschiff<br />
Abb. 8: Leitwerk vor der Schleuse Drakenburg<br />
Abb. 9: Ansicht des Leitwerks<br />
deldalben mehr) zu planen, ergab sich zunächst das Problem<br />
der gr<strong>und</strong>sätzlichen Ausführung. Es musste geklärt<br />
werden, ob die Leitwerke als elastische oder als steife<br />
Konstruktion ausgeführt werden sollen. Die Untersuchungen<br />
ergaben, dass eine elastische Konstruktion die wirtschaftlichere<br />
Variante eines Leitwerkes darstellt. Da Leitwerke<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich durch Schiffsstoß beansprucht werden<br />
können, müssen die daraus resultierenden maßgebenden<br />
Kräfte erfasst <strong>und</strong> entsprechend berücksichtigt werden. Bei<br />
der weiteren Berechnung haben auch der Anfahrtswinkel<br />
sowie die Schiffsgeschwindigkeit einen entscheidenden<br />
Einfluss <strong>und</strong> deshalb sind diese beiden Faktoren ebenfalls<br />
vorher festzulegen. Wenn dieses erfolgt ist, können die<br />
Leitwerksdalben berechnet werden. Aus dem errechneten<br />
Rohrdurchmesser der vorgesehenen Leitwerksdalben ergibt<br />
sich dann eine Kopfauslenkung. Deshalb mussten<br />
dann die Probleme der Einzelauslenkung von Leitwerksdalben,<br />
mit daran befestigten Leitplanken <strong>und</strong> darauf befindlichen<br />
Stegen, gelöst werden. Der Neubau der Leitwerke im<br />
Schleusenkanal Drakenburg ist für <strong>2008</strong> vorgesehen.<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Informationszentren<br />
Die Informationszentren informieren durch Modelle, Schautafeln <strong>und</strong> Filme über die umweltfre<strong>und</strong>liche Binnenschifffahrt,<br />
den Ausbau <strong>und</strong> die Bedeutung der <strong>Wasser</strong>straßen, die Aufgaben der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsverwaltung <strong>und</strong> vieles<br />
andere mehr.<br />
Ein Besuch ist für Ausflügler, Schulklassen <strong>und</strong> allgemein Interessierte ebenso geeignet wie für Fachgruppen <strong>und</strong> kann mit<br />
einer Besichtigung der Schachtschleuse <strong>und</strong> des <strong>Wasser</strong>straßenkreuzes in Minden bzw. des Schiffshebewerkes in Scharnebeck<br />
in unmittelbarer Nähe der Informationszentren verb<strong>und</strong>en werden.<br />
Für Fragen stehen vor Ort Ansprechpartner zur Verfügung. Für spezielle Führungen ist eine Terminabsprache sinnvoll.<br />
Minden<br />
Öffnungszeiten: Saison: 01. April – 31. Oktober<br />
Montag – Samstag 9:00 – 17:00 Uhr<br />
Sonn- <strong>und</strong> Feiertag 9:00 – 18:00 Uhr<br />
Lüneburg-Scharnebeck<br />
Öffnungszeiten: Saison: 15. März – 31. Oktober<br />
Montag – Freitag 10:00 – 18.00 Uhr<br />
Samstag, Sonn- <strong>und</strong> Feiertag 10:00 – 18.00 Uhr<br />
Informationszentrum<br />
an der Schachtschleuse in Minden<br />
Auskünfte<br />
durch das<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Minden<br />
Telefon: 05 71 / 64 58 - 0<br />
Informationszentrum<br />
am Schiffshebewerk Lüneburg<br />
Auskünfte:<br />
Telefon: 0 41 36 / 4 73 (Saison)<br />
oder durch das<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Uelzen<br />
Telefon: 05 81 / 90 79 - 0
Veröffentlichungen<br />
Dana Halbe<br />
Jiri Cemus<br />
WSA<br />
Hann. Münden<br />
Die Edertalsperre im Spannungsfeld der<br />
Nutzungsinteressen<br />
Zeitschrift <strong>Wasser</strong>wirtschaft 10/<strong>2007</strong><br />
Seite 33-35<br />
Gerhard Meine WSA Verden Allerwehr Marklendorf<br />
- Ein Gummischlauch als Stauverschluss<br />
Der Ingenieur<br />
März 1007 – Seite 11-16<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
�� �� �� ��
�� �� �� ��<br />
<strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong> <strong>2007</strong><br />
Adressen<br />
der Dienststellen im Bereich der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Hann.Münden<br />
Kasseler Straße 5<br />
34346 Hann.Münden<br />
Tel.: (05541) 952-0, Telefax: (05541) 952-14 00<br />
E-Mail: postfach@wsa-hmue.wsv.de<br />
Internet: www.wsa-hmue.wsv.de<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Verden<br />
Hohe Leuchte 30<br />
27283 Verden<br />
Tel.: (04231) 898-0, Telefax: (04231) 898-13 33<br />
E-Mail: postfach@wsa-ver.wsv.de<br />
Internet: www.wsa-verden.wsv.de<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Minden<br />
Am Hohen Ufer 1 - 3<br />
32425 Minden<br />
Tel.: (0571) 64 58-0, Telefax: (0571) 64 58-12 00<br />
E-Mail: postfach@wsa-mi.wsv.de<br />
Internet: www.wsa-minden.de<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Braunschweig<br />
Ludwig-Winter-Straße 5<br />
38120 Braunschweig<br />
Tel.: (0531) 8 66 03-0, Telefax: (0531) 8 66 03-14 00<br />
E-Mail: postfach@wsa-bs.wsv.de<br />
Internet: www.wsa-braunschweig.wsv.de<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt<br />
Uelzen<br />
Greyerstraße 12<br />
29525 Uelzen<br />
Tel.: (0581) 90 79-0, Telefax: (0581) 90 79-11 77<br />
E-Mail: postfach@wsa-ue.wsv.de<br />
Internet: www.wsa-uelzen.wsv.de<br />
Fachstelle Vermessungs- <strong>und</strong> Kartenwesen <strong>Mitte</strong><br />
bei der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> ( s.o.)<br />
Telefax: (05 11) 91 15 - 44 90<br />
Fachstelle Maschinenwesen <strong>Mitte</strong><br />
beim <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsamt Minden (s.o.)<br />
bei der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> (s. o.)<br />
Telefax: (05 11) 91 15 - 41 51<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
Am Waterlooplatz 5<br />
30169 Hannover<br />
Tel. (05 11) 91 15 - 0<br />
Fax (05 11) 91 15 - 34 00<br />
E-Mail: postfach@wsd-m.wsv.de<br />
Internet: www.wsd-mitte.wsv.de<br />
Neubauamt für den Ausbau<br />
des <strong>Mitte</strong>llandkanals in Hannover<br />
Nikolaistraße 14/16<br />
30159 Hannover<br />
Tel.: (0511) 91 15-51 11, Telefax: (0511) 91 15-51 40<br />
E-Mail: postfach@nba-h.wsv.de<br />
Internet: www.nba-hannover.wsv.de<br />
<strong>Wasser</strong>straßen-Neubauamt<br />
Helmstedt<br />
Walbecker Straße 23 b<br />
38350 Helmstedt<br />
Tel.: (05351) 394-0, Telefax: (05351) 394-52 40<br />
E-Mail: postfach@wna-he.wsv.de<br />
Internet: www.wna-helmstedt.de<br />
Sonderstelle für Aus- <strong>und</strong> Fortbildung (SAF)<br />
in der WSV<br />
Möckernstraße 30<br />
30163 Hannover<br />
Tel. (05 11) 91 15-0, Fax (05 11) 91 15-24 00<br />
E-Mail: postfach@saf.wsv.de<br />
Außenstelle für Schiffssicherung<br />
Achterwiek 2<br />
23730 Neustadt<br />
Tel: (04561) 81 91, Telefax: (04561) 17 46 0<br />
E-Mail: postfach@saf.wsv.de
Impressum<br />
<strong>Informationen</strong> der <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Herausgeber:<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong><br />
Am Waterlooplatz 5<br />
30169 Hannover<br />
Telefon (05 11) 91 15 – 0<br />
Telefax (05 11) 91 15 – 34 00<br />
E-Mail postfach@wsd-m.wsv.de<br />
Internet www.wsd-m.wsv.de<br />
Redaktion: Dietmar Abel WNA Helmstedt<br />
Matthias Buschmann <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Wolfgang Feist <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Christian Fromm <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Iris Grasso <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Reinhard Henke <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Andreas Hüsig WSA Uelzen<br />
Thilo Wachholz <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Layout: Heike Erlinghäuser <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Monika Meyer <strong>WSD</strong> <strong>Mitte</strong><br />
Druck: Benatzky, Druck & Medien, Hannover<br />
Ausgabe: <strong>2007</strong>/<strong>2008</strong><br />
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der <strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong> herausgegeben. Sie darf weder<br />
von Parteien noch von Wahlhelfern während des Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Europa-,<br />
B<strong>und</strong>estags-, Landtags- <strong>und</strong> Kommunalwahlen. Missbräuchlich sind besonders die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen<br />
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer <strong>Informationen</strong> oder Werbemittel. Untersagt ist<br />
gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der r Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg<br />
<strong>und</strong> in welcher Anzahl<br />
diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise<br />
verwendet werden, die als Parteinahme der B<strong>und</strong>esregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
Die B<strong>und</strong>eswasserstraßen im Bereich der<br />
<strong>Wasser</strong>- <strong>und</strong> Schifffahrtsdirektion <strong>Mitte</strong>