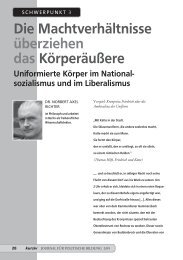kursiv 3x 09 - Wochenschau Verlag
kursiv 3x 09 - Wochenschau Verlag
kursiv 3x 09 - Wochenschau Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Perspektiven durch Indoktrination, Manipulation<br />
oder Überwältigung aufzwingen.<br />
Die Frage ist zunächst, worin die Ambivalenz dieses<br />
Kontroversitätsprinzips eigentlich liegt. Einerseits<br />
ist das Kontroversitätsprinzip mit dem Beutelsbacher<br />
Konsens der Politikdidaktiker aus dem Jahre<br />
1976 zu einer handlungsleitenden Selbstverständlichkeit<br />
des professionellen Selbstverständnisses<br />
von politischen Bildnerinnen und Bildnern geworden.<br />
Ein hessischer Lehrer hat dieses paradigmatische<br />
Selbstverständnis am Beispiel seiner Behandlung<br />
der Wehrmachtsausstellung im Unterricht so<br />
beschrieben:<br />
„[...] das ist mir auch wieder deutlich geworden<br />
jetzt bei der [...] Diskussion um die Wehrmachtsausstellung<br />
[...] nämlich viele Lehrer besuchen<br />
vielleicht die Ausstellung [...] und haben hinterher<br />
die Angst, dass ihre Schüler nicht den richtigen<br />
Weg [...] angesichts dieser Ausstellung erkennen.<br />
Das halte ich für problematisch, ich finde es ist<br />
sinnvoller [...] die Menschen dorthin zu führen<br />
und [...] sie auf bestimmte Situationen vorzubereiten<br />
und sie in die Lage zu versetzen, dass sie dann<br />
auch [...] in der Lage sind ein eigenes [...] Urteil<br />
nach und nach zu bilden und das auch überprüfen<br />
zu können.“<br />
Exemplarisch wird in diesem Interviewausschnitt<br />
deutlich, was viele schulische und außer schulische<br />
politische Bildnerinnen und Bildner heute in ihrer<br />
Berufspraxis mit dem Prinzip der Kontroversität<br />
verbinden: Dass politische Bildung kontroverse<br />
Themen und politischen Streit aufgreifen muss,<br />
statt solche Themen auszugrenzen; dass es in der<br />
politischen Bildung darum geht, für die Adressaten<br />
politischer Bildung solche Lerngelegenheiten und<br />
Lernumge bungen zu arrangieren, die ihnen eine<br />
eigene Urteilsbildung ermöglichen, so dass sie ihre<br />
eigenen Interessen erkennen und aktiv vertreten<br />
können; dass Methoden, Sozialformen, Materialien<br />
und Medien der politischen Bildung diesem<br />
Anspruch entgegenkommen müssen.<br />
Zur Realität der politischen Bildung gehört allerdings<br />
wohl auch, dass es in der alltäglichen Praxis<br />
nach wie vor und immer wieder zu Brechungen<br />
und Verletzungen dieses Prinzips kommt. So erin-<br />
<strong>kursiv</strong> JOURNAL FÜR POLITISCHE BILDUNG 3/<strong>09</strong><br />
nert z.B. ein sächsischer Student die folgende Lernerfahrung<br />
aus seiner politi schen Bildung in der<br />
Schule: …<br />
„Mein Gemeinschaftskundelehrer war und ist politisch<br />
sehr aktiv und musste seine Meinung, egal<br />
wo, seinen Schülern unterjubeln. Der Schüler hatte<br />
im Unterricht gar keine Alternativen kennen<br />
gelernt und ist nicht über solche informiert worden.<br />
[...]. Was vielen, sehr vielen Lehrern auch sehr<br />
schwerfällt, ist der kritische Umgang mit Politik<br />
und den Parteien sowie sich selbst.“<br />
Die empirische Forschung in der politischen Bildung<br />
zeigt, dass eine solche Episode kein Einzelfall<br />
aus der Vergangenheit ist, im Gegenteil: Neigungen<br />
zur Mission, zur Predigt, zur „moralischen Dauernötigung<br />
des Guten“ (Guggenberger) treten<br />
wohl nicht nur bei Lehrerin nen und Lehrern, sondern<br />
wohl auch in der außerschulischen politischen<br />
Bildung immer wieder auf. Zur Realität der politischen<br />
Bildung gehört, dass es in der schulischen<br />
wie außerschulischen Bildung nach wie vor politische<br />
Bildnerinnen und Bildner gibt, die zu einer<br />
offenen und kon troversen Verhandlung unterschiedlicher<br />
Gesellschafts- und Politikvorstellungen<br />
nicht bereit oder in der Lage sind – entweder<br />
weil sie von ihrer Mission überzeugt sind oder<br />
weil sie aus Furcht vor Streit und Kontroversen<br />
flüchten. Insofern ist auch heute noch die Einhaltung<br />
des Kontroversitätsgebots in der politischen<br />
Bildung einerseits notwendig und andererseits<br />
schwierig.<br />
Zum Sinn des Kontroversitätsprinzips:<br />
Politische Bildung als pädagogische<br />
Situation<br />
Die Idee der Kontroversität ist nicht neu. Die Griechen<br />
bevorzugten es, Probleme kontrovers zu<br />
durchdenken und dadurch zu Lösungen zu gelangen.<br />
Der politischen Entscheidung ging in der antiken<br />
Demokratie die meist kontroverse Debatte<br />
voraus. Die Bürger in der Volksver sammlung übten<br />
permanent, entgegengesetzte Meinungen auszuhalten,<br />
und erlernten Takti ken des Widerlegens und<br />
Begründens. Kontroverses Denken gehört zum<br />
27