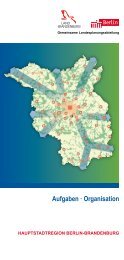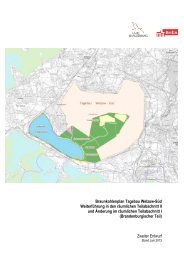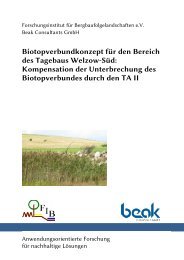Evaluierung der interkommunalen Zusammenarbeit innerhalb ...
Evaluierung der interkommunalen Zusammenarbeit innerhalb ...
Evaluierung der interkommunalen Zusammenarbeit innerhalb ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Evaluierung</strong> <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>innerhalb</strong><br />
funktionsteiliger Mittelzentren im Land Brandenburg<br />
Gutachten im Auftrag <strong>der</strong> Gemeinsamen Landesplanungsabteilung <strong>der</strong><br />
Län<strong>der</strong> Berlin und Brandenburg<br />
Endbericht<br />
Juni 2012
Auftraggeber:<br />
Gemeinsame Landesplanungsabteilung<br />
<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> Berlin und Brandenburg (GL)<br />
Lindenstraße 34a<br />
14467 Potsdam<br />
Ansprechpartner:<br />
Uwe Rühl,<br />
Referat GL 3<br />
Bearbeitung<br />
Regionomica GmbH<br />
Friedrichstr. 94<br />
D-10117 Berlin<br />
Telefon 030 / 28 44 49-0<br />
Fax 030 / 28 44 49-17<br />
Email info@regionomica.de<br />
Internet www.regionomica.de
Inhalt<br />
Kurzfassung .......................................................................................................................... I<br />
1. Ausgangssituation, Ziele und Arbeitsprogramm ................................................. 1<br />
2. Rahmenbedingungen und Methodik ..................................................................... 4<br />
2.1 Situation in an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n ........................................................................ 4<br />
2.2 Aktueller Forschungsstand..................................................................................... 13<br />
2.3 Angewandte Evaluationsmethodik ......................................................................... 18<br />
3. Analyse <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>innerhalb</strong> <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />
Mittelzentren ......................................................................................................... 23<br />
3.1 Übergreifende Betrachtung .................................................................................... 23<br />
3.2 Analyse <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> im Detail .................................................................. 27<br />
3.2.1 Elsterwerda – Bad Liebenwerda ............................................................................. 27<br />
3.2.2 Lauchhammer – Schwarzheide .............................................................................. 33<br />
3.2.3 Perleberg – Wittenberge ........................................................................................ 39<br />
3.2.4 Pritzwalk – Wittstock/ Dosse .................................................................................. 45<br />
3.2.5 Schönefeld – Wildau .............................................................................................. 52<br />
3.2.6 Senftenberg – Großräschen ................................................................................... 57<br />
3.2.7 Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz ........................................................................................ 62<br />
3.2.8 Zehdenick – Gransee ............................................................................................. 67<br />
4. Zusammenfassende Bewertung .......................................................................... 73<br />
5. Empfehlungen ...................................................................................................... 83<br />
Anhang
Kurzfassung<br />
Mit dem im Mai 2009 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg<br />
wurden acht Städtepaare als funktionsteilige Mittelzentren festgelegt. Es handelt<br />
sich dabei um Elsterwerda – Bad Liebenwerda, Lauchhammer – Schwarzheide, Per-<br />
leberg – Wittenberge, Pritzwalk – Wittstock/ Dosse, Schönefeld – Wildau, Senften-<br />
berg – Großräschen, Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz und Zehdenick – Gransee.<br />
Gleichzeitig wurde dabei eine Überprüfung <strong>der</strong> zentralörtlichen Einstufung dieser<br />
funktionsteiligen Mittelzentren drei Jahre nach Inkrafttreten des Landesentwicklungs-<br />
plans vorgegeben. Im Juli 2011 wurde deshalb die Regionomica GmbH mit <strong>der</strong><br />
Durchführung <strong>der</strong> „<strong>Evaluierung</strong> <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>innerhalb</strong><br />
funktionsteiliger Mittelzentren im Land Brandenburg“ beauftragt. Zwei Untersu-<br />
chungsfragen standen im Mittelpunkt <strong>der</strong> <strong>Evaluierung</strong>:<br />
1. Sichern Vereinbarungen zwischen den kooperierenden Gemeinden die mittel-<br />
zentralen Funktionen?<br />
2. Wie ist <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation?<br />
Das Arbeitsprogramm bestand aus zwei Leistungsbereichen. Die Bearbeitung des<br />
ersten Leistungsbereiches (Entwicklung <strong>der</strong> Evaluationsmethodik) erfolgte vom Juli<br />
bis zum Dezember 2011. Der zweite Leistungsbereich (Durchführung <strong>der</strong> Evaluation)<br />
wurde vom Januar bis zum Juli 2012 bearbeitet und fand mit dem vorliegenden Eva-<br />
luationsbericht seinen Abschluss. Zwischenergebnisse wurden den Kommunen<br />
übermittelt und auf zwei Workshops im November 2011 (Untersuchungsmethodik)<br />
und im Juni 2012 (Ergebnisse und Erstbewertung) vorgestellt.<br />
Methodische Schwerpunkte <strong>der</strong> Untersuchung bildeten vor allem leitfadengestützte<br />
Einzelgespräche mit den Hauptverwaltungsbeamten in den 16 Städten <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />
Mittelzentren sowie eine vor- bzw. nachgeschaltete Dokumenten- und Daten-<br />
analyse. Ergänzend dazu wurden weitere 22 persönliche o<strong>der</strong> telefonische Interviews<br />
mit Akteuren aus den jeweiligen Regionen bzw. involvierten Entwicklungsgesellschaften,<br />
Beratern o<strong>der</strong> Experten geführt.<br />
Zur Entwicklung und Absicherung <strong>der</strong> Untersuchungsmethodik erfolgte eine umfas-<br />
sende Literaturanalyse und eine Bewertung des aktuellen Forschungsstandes. Hierbei<br />
zeigte sich ein übergreifen<strong>der</strong> Konsens in den Handlungsempfehlungen in <strong>der</strong><br />
Literatur. So sind allen Experten zufolge Kooperationsvereinbarungen inklusive einer<br />
<strong>Evaluierung</strong> unerlässlich, um die ausgewiesenen funktionsteiligen Zentralen Orte in<br />
K-I
ihren Aufgaben und Zielen sowohl zu unterstützen als auch zu überprüfen. Die Vor-<br />
gabe einer Evaluation för<strong>der</strong>t grundsätzlich die Motivation und die Bereitschaft zur<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong>. Es muss allerdings auch konstatiert werden, dass praktische Erfahrungen<br />
und damit auch Vergleichswerte für eine Evaluation <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />
Zentralen Orte bisher so gut wie nicht vorhanden sind.<br />
Um diese Einschätzungen zu überprüfen, wurden Interviews mit den für die Landesplanung<br />
und ganz speziell für die Thematik funktionsteiliger Zentren Verantwortli-<br />
chen in den Flächenlän<strong>der</strong>n geführt. In fast allen Landesentwicklungsplänen <strong>der</strong> Flä-<br />
chenlän<strong>der</strong> lassen sich Festlegungen zu funktionsteiligen Zentralen Orten finden. Nur<br />
in Nordrhein-Westfalen gibt es keine entsprechenden Festlegungen. Derzeit sind in<br />
den deutschen Bundeslän<strong>der</strong>n insgesamt 80 funktionsteilige hochstufige Zentrale<br />
Orte (Ober- und Mittelzentren) mit 196 Städten ausgewiesen. Es bestätigte sich, dass<br />
für die vorzunehmende Untersuchung nur auf geringe Erfahrungen in an<strong>der</strong>en Bun-<br />
deslän<strong>der</strong>n und Vergleichsuntersuchungen zurückgegriffen werden konnte. Einzig<br />
Thüringen hat bisher entsprechende Erfahrungen mit einer solchen Evaluation, die<br />
allerdings hinsichtlich <strong>der</strong> Methode nicht geeignet erschien.<br />
Die Darstellung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren im Land<br />
Brandenburg, die einen Großteil <strong>der</strong> Evaluation ausmacht, erfolgte nach den folgenden<br />
vier Aspekten:<br />
- Basisdaten<br />
- Rahmenbedingungen und Kontext<br />
- Vereinbarungen zur Kooperation<br />
- Umsetzung.<br />
Die wichtigsten Ergebnisse <strong>der</strong> Analyse und Bewertung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong><br />
funktionsteiligen Mittelzentren lassen sich wie folgt zusammenfassen:<br />
� Die verbindlichen Regelungen zur <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> funktionsteiligen Mit-<br />
telzentren bzw. entsprechende Kooperationsverträge stellen eines von zwei<br />
wichtigen Evaluationskriterien dar. In sieben funktionsteiligen Mittelzentren im<br />
Land Brandenburg existieren entsprechende Vereinbarungen zur Zusammen-<br />
arbeit, dieses Evaluationskriterium ist damit von diesen funktionsteiligen Mittelzentren<br />
erfüllt. Im funktionsteiligen Mittelzentrum Senftenberg – Großräschen<br />
wurde ein solcher Vertrag bisher noch nicht abgeschlossen. Bei Betrachtung<br />
<strong>der</strong> Inhalte <strong>der</strong> Kooperationsverträge zeigt sich insbeson<strong>der</strong>e, dass – mit Ausnahme<br />
von Zehdenick – Gransee – die funktionsteiligen Mittelzentren bei den<br />
K-II
Regelungen zur <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Gemeinden des Mittelbereiches und<br />
zu den Regelungen zur Finanzierung übergreifend sehr vorsichtig vorgegangen<br />
sind. Hierbei handelt es sich um Aspekte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>, die von den jeweiligen<br />
Partnern weitergehende Zugeständnisse und eine nachprüfbare und<br />
belastbare Kooperation verlangen. Diese beiden Punkte sollten zukünftig stär-<br />
ker berücksichtigt und zu gegebener Zeit vielleicht auch vertraglich angepasst<br />
werden.<br />
� Bei einer Betrachtung sämtlicher Kooperationsaktivitäten über alle funktions-<br />
teiligen Mittelzentren ist einerseits festzustellen, dass alle funktionsteiligen Mittelzentren<br />
miteinan<strong>der</strong> kooperieren. Die Intensität und auch die Breite <strong>der</strong> Ko-<br />
operation variiert an<strong>der</strong>erseits zwischen den funktionsteiligen Mittelzentren<br />
spürbar. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> in den „klassischen“ Fel<strong>der</strong>n <strong>der</strong> öffentlichen Daseinsvorsorge<br />
ist insgesamt eher schwach ausgeprägt. Eine Kooperation in<br />
diesen Fel<strong>der</strong>n ist offensichtlich schwierig und erschließt sich – wenn überhaupt<br />
– erst mittel- und langfristig. Damit bestätigen sich hier auch die bisherigen wissenschaftliche<br />
Einschätzungen aus an<strong>der</strong>en Studien. Dagegen sind in Berei-<br />
chen wie beispielsweise <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung, des Tourismus o<strong>der</strong> des<br />
Standortmarketings häufiger Kooperationsprojekte und Aktivitäten zu erkennen.<br />
In diesen eher „weichen“ Fel<strong>der</strong>n ergeben sich überwiegend schnell und einfa-<br />
cher Kooperationsansätze.<br />
� Die <strong>Zusammenarbeit</strong> bzw. die Einbindung aller Gemeinden <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Mittelbereiche wird von einigen Mittelzentren nicht bzw. nur teilweise umge-<br />
setzt. In den meisten funktionsteiligen Mittelzentren sind die übrigen Gemein-<br />
den und Ämter zwar informell in die Kooperationsaktivitäten eingebunden, eine<br />
unmittelbare Projekteinbindung erfolgt aber nur in Ausnahmen. Beispielhaft ge-<br />
löst ist die Einbindung des gesamten Mittelbereichs im funktionsteiligen Mittel-<br />
zentrum Zehdenick – Gransee. Auch in den meisten RWK o<strong>der</strong> im funktionsteiligen<br />
Mittelzentrum Pritzwalk – Wittstock/ Dosse erfolgt eine <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
mit weiteren Gemeinden, hier sollte aber verstärkt für die Einbindung aller Ge-<br />
meinden des Mittelbereichs Sorge getragen werden.<br />
� Betrachtet man die dargelegten Aktivitäten und Evaluationskriterien über alle<br />
funktionsteiligen Mittelzentren, sind die Städtepaare Zehdenick – Gransee, Per-<br />
leberg – Wittenberge, Pritzwalk – Wittstock/ Dosse sowie Lauchhammer –<br />
Schwarzheide als beson<strong>der</strong>s aktiv bei <strong>der</strong> Untersetzung und Umsetzung <strong>der</strong><br />
Kooperation zu bezeichnen. Deutliche Entwicklungsotenziale haben die Koope-<br />
rationsstrukturen noch in Schönefeld – Wildau und in Elsterwerda – Bad Liebenwerda.<br />
K-III
� Dabei muss aber auch auf die Rahmenbedingungen hingewiesen werden, die<br />
sowohl für alle funktionsteiligen Mittelzentren insgesamt, als auch für einzelne<br />
Städtepaare gelten. Dazu gehört beispielsweise die relativ kurze Zeitspanne<br />
von drei Jahren seit Inkrafttreten des Landesentwicklungsplans bis zur Evalua-<br />
tion. Auch Aspekte wie die Überlagerung mit RWK-Aktivitäten o<strong>der</strong> die Lage im<br />
Raum prägen die Form und die Inhalte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> wesentlich. So haben<br />
beispielsweise die beiden funktionsteiligen Mittelzentren im Berliner Um-<br />
land einen an<strong>der</strong>en Kooperationsbedarf als funktionsteilige Mittelzentren in pe-<br />
riphereren Regionen des Landes Brandenburg.<br />
Auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Evaluationsergebnisse ergeben sich die nachfolgenden Empfeh-<br />
lungen, die sich zum einen an die funktionsteiligen Mittelzentren und zum an<strong>der</strong>en<br />
an das Land Brandenburg richten.<br />
Empfehlungen für die funktionsteiligen Mittelzentren<br />
� Die Kooperation in den funktionsteiligen Mittelzentren muss insgesamt intensi-<br />
viert und dabei insbeson<strong>der</strong>e auf alle Bereiche <strong>der</strong> Daseinsvorsorge ausgeweitet<br />
werden. Die verantwortlichen Akteure sollten dabei vorbehaltloser an die Zu-<br />
sammenarbeit herangehen und keine Themen von vornherein ausschließen. Es<br />
müssen entsprechende gemeinsame Strategien und Projekte zwischen den<br />
funktionsteiligen Mittelzentren entwickelt werden. Dies betrifft insbeson<strong>der</strong>e die<br />
Bereiche Gesundheitsversorgung, Kultur und Freizeit, Verkehrsdienstleistungen<br />
und die Erreichbarkeit von Infrastrukturen, eine gemeinsame Flächenplanung<br />
und –ausweisung sowie Ansiedlungsakquisition.<br />
� Ein weiterer Bereich, <strong>der</strong> sich für eine Intensivierung <strong>der</strong> Kooperationsaktivitä-<br />
ten anbietet ist die Verwaltungszusammenarbeit. Hier sollten allerdings Erwartungen<br />
an schnelle und übermäßige „Spareffekte“ nicht zu hoch gesteckt<br />
werden.<br />
� Die Kooperation in den funktionsteiligen Mittelzentren sollte systematisch vorbereitet<br />
und begleitet werden. In <strong>der</strong> Hälfte <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />
übernehmen beispielsweise Versorgungskonzepte o<strong>der</strong> vergleichbare Konzepte<br />
diese Funktion und haben sich bewährt.<br />
� Die Einbindung <strong>der</strong> übrigen Gemeinden und Ämter <strong>der</strong> Mittelbereiche muss<br />
konsequent umgesetzt und forciert werden. Die bisherige informelle Einbindung<br />
in vielen funktionsteiligen Mittelzentren sollte um eine tatsächliche Mitwirkung in<br />
Projekten und Maßnahmen erweitert werden.<br />
K-IV
� Die Verwendung des Mehrbelastungsausgleichs für Mittelzentren aus dem<br />
Finanzausgleichsgesetz sollte transparenter erfolgen.<br />
� Konkrete Umsetzungsprogramme bzw. Maßnahmenlisten mit eventuell jährlichen<br />
Schwerpunktsetzungen unterstützen diese Transparenz und ermöglichen<br />
eine systematische und zielführende Abwicklung. Gleichzeitig ermöglichen sol-<br />
che Programme die Selbstevaluation bzw. Kontrolle <strong>der</strong> Aktivitäten. Eine solche<br />
Selbstevaluation in regelmäßigen Abständen wäre grundsätzlich ratsam, um<br />
Ziel- und Maßnahmenanpassungen vornehmen zu können.<br />
� Die Kommunikation <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> und die Öffentlichkeitsarbeit sollte<br />
von allen funktionsteiligen Mittelzentren ausgebaut werden, um das Verständnis<br />
und die Akzeptanz in <strong>der</strong> Öffentlichkeit zu erhöhen.<br />
Empfehlungen für das Land<br />
� Das Land sollte die Kooperationsbemühungen <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzen-<br />
tren weiterhin aktiv unterstützen. Bei Bedarf sollte ein themen- bzw. projekt-<br />
bezogener Informationsaustausch angeboten bzw. organisiert werden. Wünschenswert<br />
und hilfreich wäre auch eine intensivere Unterstützung durch die<br />
Kommunalaufsicht, beispielsweise durch „Handreichungen“ o<strong>der</strong> Hilfestellun-<br />
gen bei vertraglichen und konzeptionellen Vorarbeiten.<br />
� Gemeinsam mit den funktionsteiligen Mittelzentren sollten das Land und ganz<br />
speziell die Gemeinsame Landesplanungsabteilung die Stärkung und die Ak-<br />
zeptanz des Instruments „funktionsteiliges Mittelzentrum“ bei an<strong>der</strong>en Akteuren<br />
im Land weiter vorantreiben.<br />
� Im Falle <strong>der</strong> Fortschreibung des Landesentwicklungsplans sollten die räumli-<br />
chen Abgrenzungen einzelner Mittelbereiche überprüft und bei Bedarf verän<strong>der</strong>t<br />
werden. Dies könnte unter Umständen die <strong>Zusammenarbeit</strong> von einzel-<br />
nen funktionsteiligen Mittelzentren mit allen beteiligten Gebietskörperschaften<br />
erleichtern.<br />
� Vom funktionsteiligen Mittelzentrum Senftenberg – Großräschen sollte die<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan und <strong>der</strong> Abschluss<br />
einer verbindlichen Kooperationsvereinbarung eingefor<strong>der</strong>t werden.<br />
K-V
1. Ausgangssituation, Ziele und Arbeitsprogramm<br />
Mit dem im Mai 2009 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg<br />
(LEP B-B) 1<br />
wurden die folgenden acht Städtepaare als funktionsteilige Mittelzen-<br />
tren festgelegt:<br />
� Elsterwerda – Bad Liebenwerda<br />
� Lauchhammer – Schwarzheide<br />
� Perleberg – Wittenberge<br />
� Pritzwalk - Wittstock/Dosse<br />
� Schönefeld – Wildau<br />
� Senftenberg – Großräschen<br />
� Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz und<br />
� Zehdenick – Gransee.<br />
Neben <strong>der</strong> Festlegung <strong>der</strong> grundsätzlichen Ziele und Aufgabenstellungen <strong>der</strong> Funkti-<br />
onsteilung, <strong>der</strong> Rahmenbedingungen und notwendiger Strukturen wurde „… eine<br />
Überprüfung <strong>der</strong> zentralörtlichen Einstufung dieser funktionsteilig agierenden Mittel-<br />
zentren drei Jahre nach Inkrafttreten des Landesentwicklungsplanes …“ fest geschrieben.<br />
2<br />
Mit <strong>der</strong> Durchführung dieser „<strong>Evaluierung</strong> <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
<strong>innerhalb</strong> funktionsteiliger Mittelzentren im Land Brandenburg“ wurde die<br />
Regionomica GmbH im Juli 2011 beauftragt.<br />
Ziel <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung war es, entsprechend <strong>der</strong> im LEP B-B vorgegebenen<br />
Dreijahresfrist die entsprechende Überprüfung vorzunehmen und somit Infor-<br />
mationen über die Umsetzung <strong>der</strong> Einstufung <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren zu<br />
erlangen. Bei Bedarf sollte die Untersuchung auch Grundlagen für die Entscheidungsfindung<br />
des Auftraggebers über eventuelle Anpassungen bereitstellen. Neben<br />
dieser unmittelbaren Zielsetzung <strong>der</strong> Evaluation ergeben sich erfahrungsgemäß aus<br />
einer solchen Evaluation auch viele Hinweise und Anregungen für die Betroffenen, in<br />
1<br />
2<br />
Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009, Gesetz- und<br />
Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, Teil II, Jahrgang 20, Nummer 13.<br />
Ebenda S. 205.<br />
1
diesem Fall die funktionsteiligen Mittelzentren selbst. Durch die Diskussionen und<br />
Ergebnisse und nicht zuletzt auch die gemeinsamen Workshops sollten Möglichkei-<br />
ten eröffnet werden, damit die eigenen Aktivitäten besser reflektiert und Verbesserungsmöglichkeiten<br />
aufgezeigt werden.<br />
Zwei Untersuchungsfragen sind durch den LEP B-B eindeutig vorgegeben und<br />
standen deshalb im Mittelpunkt <strong>der</strong> Evaluation: 3<br />
3. Sichern Vereinbarungen zwischen den kooperierenden Gemeinden die mittel-<br />
zentralen Funktionen?<br />
4. Wie ist <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation?<br />
Sie bestimmen wesentlich die angewandte Methodik und das Arbeitsprogramm, das<br />
ebenfalls aus zwei Leistungsbereichen bestand. Die Bearbeitung des ersten Leis-<br />
tungsbereiches (Entwicklung Evaluationsmethodik) erfolgte vom Juli bis zum Dezember<br />
2011. Der zweite Leistungsbereich (Durchführung <strong>der</strong> Evaluation) wurde vom<br />
Januar bis zum Juli 2012 bearbeitet und endete mit dem vorliegenden Evaluationsbe-<br />
richt.<br />
Der vorliegende Evaluationsbericht ist wie folgt geglie<strong>der</strong>t:<br />
� Im folgenden zweiten Kapitel werden in fokussierter Form die Situation und Hand-<br />
habung vergleichbarer Modelle sowie <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> Forschung beschrieben. An-<br />
schließend wird darauf aufbauend die angewandte Methodik und die eingesetzten<br />
Instrumente näher erläutert. Es handelt sich dabei weitgehend um die Arbeitser-<br />
gebnisse des ersten Leistungsbereiches, <strong>der</strong> in 2011 abgearbeitet wurde.<br />
� Das dritte Kapitel enthält die detaillierte Darstellung <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Zusammen-<br />
3<br />
arbeit <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren. Zuerst erfolgt einer Betrachtung wichtiger<br />
Kriterien für die Gesamtheit <strong>der</strong> Mittelzentren (Kap. 3.1). Anschließend werden auf<br />
<strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Untersuchungsleitfragen die Ergebnise für die einzelnen Mittelzentren<br />
einheitlich dargestellt und bewertet.<br />
In den Begründungen zu den Festlegungen zu 2.11 (G), Abs. 5 heißt es: „Dabei ist zu prüfen, ob Vereinbarungen<br />
zwischen den kooperierenden Gemeinden die mittelzentralen Funktionen sichern, und wie <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong><br />
Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation ist.“ Ebenda.<br />
2
� Das vierte Kapitel enthält dann eine zusammenfassen Bewertung <strong>der</strong> Ergebnisse<br />
und eine Einschätzung guter und weniger guter Umsetzungsbeispiele.<br />
� Im letzten und fünften Kapitel werden Handlungsbedarfe aufgezeigt und Empfeh-<br />
lungen aus Gutachtersicht vorgestellt. Dabei werden die Empfehlungen hinsichtlich<br />
unterschiedlicher Empfänger strukturiert.<br />
3
2. Rahmenbedingungen und Methodik<br />
Nachfolgend werden wichtige Rahmenbedingungen erläutert und methodische<br />
Grundlagen für die Evaluation abgeleitet. In <strong>der</strong> gebotenen Kürze wird die Situation<br />
und Handhabung <strong>der</strong> Ausweisung und Evaluation funktionsteiliger Mittelzentren 4<br />
in<br />
an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n dargestellt (Kap. 2.1). Anschließend wird in ebenso kompri-<br />
mierter Form ein Abriß des aktuellen Forschungsstandes und herausgehobener Untersuchungen<br />
zu diesem Thema gegeben (Kap. 2.2). Darauf aufbauend wird die an-<br />
gewandte Methodik und vor allem das wichtigste Untersuchungsinstrument abgeleitet<br />
und erläutert (Kap. 2.3).<br />
2.1 Situation in an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
Im Rahmen des Vergleichs <strong>der</strong> Raumordnungspläne (Landesentwicklungsprogramme<br />
und Landesentwicklungspläne) <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en deutschen Bundeslän<strong>der</strong> hinsichtlich <strong>der</strong><br />
jeweiligen Ausgestaltung des Zentrale-Orte-Konzepts bezogen auf funktionsteilige<br />
Mittelzentren kann festgestellt werden, dass sich in fast allen Landesentwicklungsplänen<br />
<strong>der</strong> Flächenlän<strong>der</strong> Festlegungen zu funktionsteiligen Zentralen Orten finden<br />
lassen. Nur in Nordrhein-Westfalen gibt es keine entsprechenden Festlegungen.<br />
Auffallend ist dabei, dass für funktionsteilige Zentrale Orte in jedem Raumordnungsplan<br />
an<strong>der</strong>e Begrifflichkeiten verwendet werden, obwohl vergleichbare Inhalte und<br />
Ziele hinter den unterschiedlichen Bezeichnungen stehen (vgl. Tab. 1).<br />
4<br />
Aus Vereinfachungsgründen wird die Bezeichung „funktionsteilige Mittelzentren“ durchgängig verwendet, auch<br />
wenn in an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n teilweise an<strong>der</strong>e Begriffe benutzt werden.<br />
4
Tab. 1: Bezeichnungen funktionsteiliger Zentraler Orte nach Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
Bundesland Kooperationsname<br />
Baden-Württemberg Doppel- o<strong>der</strong> Mehrfachzentrum<br />
Bayern Zentrale Doppel- o<strong>der</strong> Mehrfachorte<br />
Brandenburg Mittelzentren in Funktionsteilung<br />
Hessen Funktionale Ergänzung benachbarter ZO<br />
Mecklenburg-Vorpommern Gemeinsame Zentrale Orte<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen Zentrenverbünde<br />
Rheinland-Pfalz Kooperationsräume<br />
Saarland Kooperation zwischen benachbarten Orten<br />
Sachsen Städteverbünde<br />
Sachsen-Anhalt Orte mit gemeinsamen Verflechtungsbereich<br />
Schleswig-Holstein Mittelzentrum zusammen mit [...]<br />
Thüringen Funktionsteilige Zentrale Orte<br />
Quelle: eigene Darstellung, basierend auf aktuellen LEP <strong>der</strong> Län<strong>der</strong><br />
Die erste Ausweisung von Zentralen Orten in Funktionsteilung wurde 1971 in Bayern<br />
vorgenommen 5<br />
, nachdem die Ministerkonferenz für Raumordnung 1968 beschlossen<br />
hatte, dass es in Einzelfällen auch Verflechtungsbereiche mit mehreren zentralen<br />
Orten in Funktionsteilung geben kann. 6<br />
Derzeit sind in den deutschen Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
insgesamt 80 funktionsteilige zentrale Orte mit 196 Städten ausgewiesen. Die folgen-<br />
de Abbildung 1 gibt einen Überblick über die regionale Verteilung <strong>der</strong> Ausweisung<br />
funktionsteiliger zentraler Orte. In <strong>der</strong> danach folgenden Tabelle 2 sind noch einmal<br />
sämtliche zentrale Orte nach Bundeslän<strong>der</strong>n und Hierarchiestufen systematisch zu-<br />
sammen gefasst.<br />
5<br />
6<br />
BMVBS 2008, S. 25.<br />
Ebenda S. 13.<br />
5
Abb. 1: Funktionsteilige Ober- und Mittelzentren in Deutschland<br />
Quelle: eigene Darstellung nach BBSR „Raumabgrenzungen und Raumtypen des BBSR, 2012, nach aktuellen LEP <strong>der</strong> Län<strong>der</strong><br />
6
Tab. 2: Funktionsteilige Zentrale Orte in den Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
Bundesland<br />
Anzahl <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />
Zentralen Orte<br />
Anzahl <strong>der</strong><br />
Kommunen<br />
7<br />
Verteilung nach Hierarchiestufen<br />
OZ<br />
teilfunktionale<br />
OZ<br />
Baden-Württemberg 14 30 5 1, 2 - 9<br />
Bayern 18 3 39 2 1 1 15<br />
Brandenburg 8 16 - - 8<br />
Hessen 4 9 1 1 2<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
1 2 1 - -<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen 2 9 1 - 1<br />
Rheinland-Pfalz 22 60 - 1, 2 - 22<br />
Sachsen 4 16 1 - 3<br />
Schleswig-Holstein 1 2 - - 1<br />
Thüringen 6 13 - 2 4<br />
Gesamt 80 196 11 4 65<br />
1) Ulm - Neu-Ulm wurde nur für Baden-Württemberg berücksichtigt, 2) Ludwigshafen am Rhein - Mannheim wurde nur für Baden-<br />
Württemberg berücksichtigt, 3) Die drei grenzübergreifenden zentralen Orte in Bayern (mit Österreich / Tschechien) sind in <strong>der</strong><br />
Erhebung nicht mit einbezogen worden.<br />
Quelle: verän<strong>der</strong>t nach Bartsch, Robert (2006): Funktionsteilige zentrale Orte in Deutschland. S. 93. Aktualisiert nach aktuellen LEP<br />
des Län<strong>der</strong><br />
Neben den unterschiedlichen Bezeichnungen existieren in den einzelnen Bundeslän<strong>der</strong>n<br />
auch differenzierte Ausweisungs- und Umsetzungskriterien, in einigen wenigen<br />
Bundeslän<strong>der</strong>n gibt es weiterführende Empfehlungen bzw. Vorgaben für eine Bewer-<br />
tung bzw. Evaluation:<br />
� So werden in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Hessen und Mecklenburg-<br />
Vorpommern lediglich die Funktionen und Aufgaben Zentraler Orte nach Hierar-<br />
chiestufe genannt, detaillierte Kriterien für die Ausweisung funktionsteiliger Zentra-<br />
ler Orte lassen sich hingegen nicht finden.<br />
� Rheinland-Pfalz stellt ebenfalls keine Kriterien auf, welche Vorraussetzungen ein<br />
funktionsteiliger Zentraler Ort erfüllen muss. Dazu wird lediglich ausgeführt, dass,<br />
wenn <strong>innerhalb</strong> eines Mittelbereichs mehrere zentrale Orte <strong>der</strong> mittel- und ober-<br />
zentralen Stufe einen Beitrag zur mittelzentralen Versorgung leisten, es sich um ei-<br />
MZ
nen so genannten “mittelzentralen Verbund kooperieren<strong>der</strong> Zentren“ handelt 7<br />
. In<br />
<strong>der</strong> Begründung zu dieser Festlegung wird allerdings darauf verwiesen, dass die in-<br />
terkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> vertraglich geregelt werden soll.<br />
� Sachsen-Anhalt legt im LEP fest, dass lediglich „in dünn besiedelten und in schwer<br />
erreichbaren Gebieten [...] die zentralörtlichen Funktionen zur Versorgung <strong>der</strong> Be-<br />
völkerung zwischen benachbarten Orten o<strong>der</strong> Orten mit gemeinsamem Verflech-<br />
tungsbereich aufgeteilt werden [können]“ und funktionsteilige Zentrale Orte ausge-<br />
wiesen werden dürfen; bisher wurde davon allerdings noch nicht Gebrauch gemacht.<br />
8<br />
� Im LEP Nie<strong>der</strong>sachsen wird ebenfalls eine Vorgabe zur Ausweisung getroffen:<br />
„Zwischen räumlich und funktional verflochtenen Zentralen Orten ist eine Aufgaben-<br />
teilung und gegenseitige Ergänzung im Verbund möglich. Der Verbund soll <strong>der</strong><br />
Stärkung des jeweiligen Teilraumes und <strong>der</strong> Sicherung und Entwicklung einer tragfähigen<br />
Versorgungsstruktur bei angemessener Erreichbarkeit dienen.“ 9<br />
So wird<br />
weiterhin auch auf Funktionen eines funktionsteiligen Zentralen Ortes eingegan-<br />
gen, weitere Kriterien fehlen jedoch im LEP und sollen erst auf regionalplanerischer<br />
Ebene erfolgen. 10<br />
� Vergleichbar wird im LEP Saarland in <strong>der</strong> Fassung <strong>der</strong> <strong>der</strong> Ergänzung von 2006 die<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Möglichkeit zur Ausweisung ergänzt und konkrete Vorgaben gemacht, was funkti-<br />
onsteilige Zentrale Orte leisten müssen (Wirksamkeit des Zentrale Orte Konzepts<br />
ergänzen und flexibilisieren, die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> för<strong>der</strong>n und<br />
Konkurrenz vermin<strong>der</strong>n, die Daseinsvorsorge sicherstellen, die Auslastung zentral-<br />
örtlicher Einrichtungen gewährleisten sowie großräumige Infrastruktur besser nutz-<br />
bar machen). Trotz dieser Konkretisierung wurden bisher keine funktionsteiligen<br />
ISIM Rheinland – Pfalz (2008): LEP Rheinland – Pfalz (LEP IV), S.86.<br />
MLV Sachsen – Anhalt (2010): LEP Sachsen – Anhalt, S.15.<br />
ML Nie<strong>der</strong>sachsen (2008): LRP Nie<strong>der</strong>sachsen, S.14.<br />
Ebenda S. 14.<br />
8
Zentralen Orte im Saarland festgelegt, lediglich die Mittelzentren Merzig und Wa<strong>der</strong>n<br />
werden in diesem Zusammenhang genannt. 11<br />
� Der LEP Sachsen legt für die ober- und mittelzentralen Städteverbünde konkrete<br />
Vorgaben fest. So sollen funktionsteilige Oberzentren auf Grund ihrer Lage, ihrer<br />
vergleichbaren Einwohnerzahl, ihrer zentralörtlichen Ausstattung sowie einer ei-<br />
genständigen Ausprägung eines Verflechtungsbereichs gemeinsam die Funktion<br />
eines Oberzentrums ausüben. Funktionsteilige Mittelzentren werden durch ihre<br />
Nachbarschaftslage o<strong>der</strong> einen direkten baulichen Zusammenhang, ihrer zentral-<br />
örtlichen Ausstattung und einer verstetigten <strong>Zusammenarbeit</strong> nach § 204 Abs. 1<br />
BauGB gemeinsam die Funktion eines Zentralen Ortes ausüben. 12<br />
Sachsen stellt<br />
mit dieser Definition klare Vorgaben auf, die so in den vorangegangen LEP nicht zu<br />
finden sind.<br />
� Im LEP Thüringen wird ausführlich auf die Kriterien und Vorgaben zu funktionsteiligen<br />
Zentralen Orten eingegangen. 13<br />
Durch einen raumordnerischen Vertrag bzw.<br />
durch Zusammenschluss zu Planungsverbänden zur gemeinsamen Flächennut-<br />
zungsplanung für einen gemeinsamen Versorgungsbereich sollen Bedingungen für<br />
die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> geschaffen werden. Des Weiteren werden<br />
explizite Ausweisungskriterien, wie z. B. Entfernungen zwischen den Zentralen Or-<br />
ten in Funktionsteilung aufgeführt. Hervorzuheben ist auch, dass die funktionsteili-<br />
gen Zentralen Orte lediglich auf Zeit ausgewiesen wurden. Nach drei Jahren erfolg-<br />
te eine Evaluation <strong>der</strong> Landesplanung hinsichtlich Vorgaben und Umsetzung, in <strong>der</strong>en<br />
Ergebnis alle ausgewiesenen Zentren bestätigt wurden. 14<br />
� Der LEP Bayern benennt als explizites Ziel, dass Orte gleicher Stufe für einen einheitlichen<br />
Verflechtungsbereich zentralörtliche Aufgaben übernehmen sollen. 15<br />
In<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
den weiterführenden Begründungen im LEP werden zudem genaue Vorrausset-<br />
Ministerium für Inneres und Sport des Saarlands (2006): LEP Saarland, S. 974-975.<br />
SMI Sachsen (2003): LEP Sachsen, S.9.<br />
TMBLV (2004): LEP Thüringen, S.17.<br />
Ebenda S.18.<br />
STMWIVT Bayern (2006): LEP Bayern, S.22.<br />
9
zungen für die funktionsteiligen Zentralen Orte genannt (z. B. bauliche und funkti-<br />
onale Ergänzung durch die Kommunen, günstig zugeordnete Versorgungseinheiten<br />
<strong>der</strong> Daseinsvorsorge). Weiterhin werden landesplanerische Verträge gefor<strong>der</strong>t,<br />
welche die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> sichern sollen. Wie in Thüringen ist<br />
die Festlegung befristet, allerdings hier auf fünf Jahre. Eine Evaluation ist nach<br />
Kenntnis des Gutachters bisher allerdings noch nicht erfolgt.<br />
Wie gezeigt, lassen sich auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> LEP <strong>der</strong> Bundeslän<strong>der</strong> nur<br />
bedingt Schlussfolgerungen für die vorzunehmende Evaluation und die Entwicklung<br />
einer entsprechenden Methodik ziehen. Nur in einigen Län<strong>der</strong>n existieren entsprechend<br />
operationalisierte Vorgaben und Kriterien. Hinweise auf eine Evaluation bzw.<br />
zugrunde zu legende Kriterien sind nur in den LEP von Thüringen und Bayern zu fin-<br />
den. Darüber hinaus wurde nur in Thüringen eine solche Evaluation bisher durchgeführt<br />
und veröffentlicht (vgl. Fußnote auf dieser Seite).<br />
Um diesen Befund zu verifizieren und eventuell doch noch Anregungen für die vorlie-<br />
gende Evaluation zu erhalten, wurden im August 2011 die für die Landesplanung und<br />
ganz speziell die Thematik funktionsteiliger Zentren Landesplaner und Landesplane-<br />
rinnen in den Flächenlän<strong>der</strong>n kontaktiert. Insgesamt wurden 11 Telefoninterviews und<br />
ein persönliches Fachgespräch geführt (vgl. Anhang 1). Die Ergebnisse dieser Gespräche<br />
lassen sich hinsichtlich <strong>der</strong> Entwicklung <strong>der</strong> Evaluationsmethodik wie folgt<br />
zusammen fassen:<br />
- Die meisten Gesprächspartner waren insgesamt sehr an <strong>der</strong> Untersuchung und<br />
den zukünftigen Ergebnissen interessiert. Einige regten sogar eine Vorstellung<br />
<strong>der</strong> Ergebnisse in einem geeigneten Rahmen an. Die Gesprächspartner aus<br />
den Län<strong>der</strong>n, die keine funktionsteiligen Zentren ausgewiesen haben, waren<br />
nachvollziehbar deutlich weniger interessiert.<br />
- Für die Entwicklung <strong>der</strong> Evaluationsmethodik konnten – mit Ausnahme des Ge-<br />
sprächs mit dem Thüringer Vertreter – allerdings nur wenige konkrete Anregungen<br />
abgeleitet o<strong>der</strong> Hinweise auf bereits durchgeführte Evaluationen aufge-<br />
nommen werden.<br />
- In Thüringen wurde in einem längeren Prozess eine Überprüfung ausgewählter<br />
zentraler Orte sowie funktionsteiliger Zentren entsprechend <strong>der</strong> Festlegung im<br />
Landesentwicklungsplan (LEP) 2004 Thüringen vorgenommen und 2009 in ei-<br />
10
nem Abschlussbericht 16<br />
sowie einem Bericht des Thüringer Ministeriums für<br />
Bau, Landesentwicklung und Medien an den Landtag vorgelegt. 17<br />
Betrachtet<br />
wurden die zentralen Orte Bad Lobenstein und Stadtroda sowie die funktionsteiligen<br />
Zentren Hermsdorf/ Bad Klosterlausnitz, Neuhaus a. Rwg./ Lauscha,<br />
Schmölln/ Gößnitz, und Zeulenroda-Triebes. Die funktionsteiligen Zentren<br />
Suhl/ Zella-Mehlis und Saalfeld/ Rudolstadt/ Bad Blankenburg wurden nur einer<br />
Teilbewertung unterzogen (vgl. eingekreiste Städte in Abb. 2).<br />
Abb. 2: Auszug aus LEP Thüringen 2004, Raumstruktur<br />
Quelle: Thüringer Ministerium für Bau und Verkehr: Landesentwicklungsplan 2004, Kartenteil S. 95, Erfurt, 2004<br />
16<br />
17<br />
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien: Abschlussbericht zur Überprüfung einiger Zent-<br />
raler Orte höherer Stufe entsprechend <strong>der</strong> Festlegung im Landesentwicklungsplan (LEP) 2004 Thüringen, Er-<br />
furt, Mai 2009.<br />
Vgl. dazu: Drucksache 4/5373 des Thüringer Landtags vom 2. Juli 2009, Die Bedeutung <strong>der</strong> Oberzentren und<br />
Mittelzentren für die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens, insbeson<strong>der</strong>e des ländli-<br />
chen Raums im Freistaat Thüringen.<br />
11
- Nach einem Zwischenbericht 2006 folgten Stellungnahmen <strong>der</strong> Gemeinden,<br />
eine Anhörung im Landtagsausschuss, <strong>der</strong> Entwurf des Endberichts und wie-<br />
<strong>der</strong>um diverse Stellungnahmen, bevor 2009 <strong>der</strong> Abschlußbericht veröffentlicht<br />
wurde. Als Indikatoren wurden beispielsweise die Bevölkerungsentwicklung,<br />
die Arbeitsplatzentwicklung, <strong>der</strong> Nahverkehr o<strong>der</strong> die gemeinsame Flächennutzungsplanung<br />
herangezogen. 18<br />
Kritik wurde im Rahmen einer Anhörung im<br />
Ausschuss für Bau und Verkehr des Thüringer Landtags u. a. durch die Regi-<br />
onalen Planungsgemeinschaften an diesen Kriterien geäußert, da die Indika-<br />
toren von vielen an<strong>der</strong>en Einflüssen abhängen und von den Gemeinden nicht<br />
o<strong>der</strong> nur wenig beeinflussbar sind. 19<br />
Darüber hinaus wurde die kurze Zeit-<br />
spanne von <strong>der</strong> Ausweisung bis zur Bewertung bemängelt. Insgesamt wurden<br />
als Ergebnis <strong>der</strong> Bewertung alle Mittelzentren bestätigt und den funktionsteiligen<br />
Mittelzentren wurde überwiegend eine Verbesserung <strong>der</strong> Zusammenar-<br />
beit testiert.<br />
- Eine zukünftig stärkere Ausgestaltung und Befassung mit diesem Thema ist<br />
darüber hinaus in den folgenden Län<strong>der</strong>n geplant:<br />
18<br />
19<br />
20<br />
o Rheinland-Pfalz: Mit <strong>der</strong> Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans wird<br />
das System <strong>der</strong> Zentralen Orte überprüft. Aus heutiger Sicht ist eine Befragung<br />
<strong>der</strong> „mittelzentralen Verbünde“ angedacht.<br />
o Sachsen-Anhalt: Eine Funktionsteilung Zentraler Orte ist nur in Ausnahme-<br />
fällen vorgesehen. Grundlage <strong>der</strong> Funktionsteilung sind konkrete vertragliche<br />
Regelungen zwischen <strong>der</strong> Regionalen Planungsgemeinschaft und den<br />
beteiligten Orten. Die Realisierung <strong>der</strong> vertraglichen Regelung ist nach<br />
zehn Jahren zu überprüfen. 20<br />
o Sachsen: Die Fortschreibung des Landesentwicklungsplans ist beschlos-<br />
sen. Das Instrument eines landesplanerischen Vertrages zur Sicherung <strong>der</strong><br />
Funktionsteiligkeit wird voraussichtlich darin festgeschrieben. Die Planungen<br />
bzw. die Bauleitplanungen sollen einvernehmlich abgestimmt werden.<br />
Folgende Kriterien wurden betrachtet (Stand und Entwicklung): Bevölkerung, Arbeitsplätze, Bildungs- und<br />
Ausbildungsfunktion, kulturelle Angebote, Nahverkehr, Einzelhandel und Dienstleistungen, Gesundheit und So-<br />
zialwesen, Funktionsteilige <strong>Zusammenarbeit</strong> bzw. gemeinsame Flächennutzungsplanung.<br />
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien, a. a. O., S. 5.<br />
Vgl. Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt 2010, Begründung zu Z 32.<br />
12
Im Entwurf des LEP befindet sich ein Hinweis darauf, dass die „Einhaltung<br />
zu evaluieren ist“.<br />
o Bayern: Für die ab April 2003 neu definierten zentralen Doppelorte sollten<br />
landesplanerische Verträge erstellt und Evaluationen durchgeführt werden.<br />
Nach Auskunft des Gesprächspartner ist eine Neuausweisung erfolgt, für<br />
<strong>der</strong>en Durchführung und Überprüfung aber dann die Regionalplanung zuständig<br />
ist.<br />
o Hessen: Im neuen Landesentwicklungsplan wird es eventuell konkrete Re-<br />
gelungen zu den funktionsteiligen Orten geben (u. a. Organisation/Struktur,<br />
Aufteilung <strong>der</strong> Funktionen, Zeitplanung).<br />
Insgesamt lässt sich feststellen, dass in den Raumordnungsplänen <strong>der</strong> Bundeslän-<br />
<strong>der</strong>n nur wenige bzw. keine operationalisierte Kriterien für die Ausweisung und Evaluation<br />
von funktionsteiligen Zentralen Orten festgelegt sind und es auch kaum prak-<br />
tische Erfahrungen mit <strong>der</strong> Evaluation funktionsteiliger Zentren gibt. Einzig Thüringen<br />
hat bisher entsprechende Erfahrungen mit einer solchen Evaluation, die allerdings<br />
hinsichtlich <strong>der</strong> Methode auf eine statistisch-deskriptive Aus- und Bewertung zurück-<br />
gegriffen haben. Von daher konnte für die vorzunehmende Untersuchung nur auf ge-<br />
ringe Erfahrungen in an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n und Vergleichsuntersuchungen zurückgegriffen<br />
werden.<br />
2.2 Aktueller Forschungsstand<br />
Während <strong>der</strong> gesamten Projektlaufzeit erfolgte die Recherche und Analyse aktueller<br />
Forschungsergebnisse. Insgesamt wurden knapp zehn Quellen gefunden, die einen<br />
mehr o<strong>der</strong> weniger engen Bezug zum Thema haben und sich mit funktionsteiligen<br />
Zentren beschäftigen (vgl. Anhang 2). Dabei ist festzustellen, dass zwar eine breite<br />
Auswahl an Literatur zum Thema <strong>der</strong> Zentralen Orte insgesamt existiert, die funkti-<br />
onsteiligen Zentralen Orte werden hingegen eher wenig betrachtet. In den letzten<br />
Jahren wird sich diesem Thema seitens <strong>der</strong> Wissenschaft etwas stärker gewidmet,<br />
teilweise auch unter dem Blickwinkel des übergreifenden Themas <strong>der</strong> Städtekoopera-<br />
tionen und -verbünde. Vor diesem Hintergrund ist es insgesamt wenig verwun<strong>der</strong>lich,<br />
dass auch für das Thema <strong>der</strong> Evaluation von funktionsteiligen Zentralen Orten nur<br />
geringe Erfahrungswerte o<strong>der</strong> Untersuchungsergebnisse existieren.<br />
Als beson<strong>der</strong>s relevant für die vorliegende Evaluation haben sich die in <strong>der</strong> folgenden<br />
Tabelle 3 dargestellten Studien erwiesen.<br />
13
Tab. 3: Ausgewählte Literatur mit Bezug zum Thema<br />
Autor/ Herausgeber Bibliographische Angaben<br />
Jörg Lippert Sonneberg – Neustadt bei Coburg, Zur Möglichkeit eines grenzüberschreitenden<br />
Doppelzentrums, Schriften <strong>der</strong> Hochschule für Architektur<br />
und Bauwesen Weimar, Weimar, 1994.<br />
Bernhard Müller, Burkhard<br />
Beyer<br />
Regionalentwicklung im kommunalen Verbund. Städteverbünde in<br />
Sachsen - Region und Stadt. Dresdner Materialien zur räumlichen<br />
Planung, Bd. 3, 1999.<br />
Antonia Leitz Zur Ausweisung gemeinsamer Zentraler Orte, Schriften zur Raumordnung<br />
und Landesplanung 7, Augsburg/ Kaiserslautern, 2001.<br />
Hans H. Blotevogel (Hrsg.) Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts, Forschungs- und Sitzungsberichte<br />
ARL; Bd. 217, Hannover 2002.<br />
Robert Bartsch Funktionsteilige zentrale Orte in Deutschland, Schriftenreihe des Lehrstuhls<br />
für Wirtschaftsgeographie und Regionalentwicklung <strong>der</strong> Friedrich-Schiller-Universität<br />
Jena, Jena, 2006.<br />
Thüringer Ministerium für<br />
Bau, Landesentwicklung<br />
und Medien<br />
Bundesministerium für<br />
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
und Bundesamt<br />
für Bauwesen und Raumordnung<br />
(Hrsg.)<br />
Julia Kern<br />
Bundesministerium für<br />
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
und Bundesinstitut<br />
für Bau-, Stadt- und<br />
Raumforschung<br />
Abschlussbericht zur Überprüfung einiger Zentraler Orte höherer Stufe<br />
entsprechend <strong>der</strong> Festlegung im LEP 2004 Thüringen, 2009.<br />
Kooperation zentraler Orte in schrumpfenden Regionen. Praxiserfahrungsstudie,<br />
Werkstatt: Praxis Heft 53, Bonn, 2008.<br />
Städteverbünde als Instrument <strong>der</strong> Raumordnung - Untersuchung <strong>der</strong><br />
mittelzentralen Städteverbünde im Ländlichen Raum <strong>der</strong> neuen Bundeslän<strong>der</strong><br />
sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen für den Freistaat<br />
Thüringen, Diplomarbeit an <strong>der</strong> Justus-Liebig-Universität Gießen,<br />
Institut für Geographie, 2010.<br />
Regionalstrategie Daseinsvorsorge - Denkanstöße für die Praxis, Berlin,<br />
2011.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die Publikationen „Funktionsteilige Zentrale Orte in Deutschland“ von<br />
Robert Bartsch sowie „Kooperation zentraler Orte in schrumpfenden Regionen. Pra-<br />
xiserfahrungsstudie“ vom BMVBS und BBR bzw. einem Autorenteam um Greiving<br />
haben sich explizit auch mit Evaluationen von Mittelzentren in Funktionsteilung be-<br />
schäftigt. Als einziges Bundesland evaluierte bisher zudem Thüringen seine funkti-<br />
onsteiligen Mittelzentren. Der bereits erwähnte Bericht „Die Bedeutung <strong>der</strong> Oberzentren<br />
und Mittelzentren für die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen<br />
Lebens, insbeson<strong>der</strong>e des ländlichen Raums im Freistaat Thüringen“ kann somit par-<br />
14
tiell als Vergleich herangezogen werden. Im Folgenden werden die wichtigsten As-<br />
pekte <strong>der</strong> genannten Arbeiten für die hier vorliegende Evaluationsstudie aufgeführt<br />
und somit ein kurzer Abriss des Forschungsstandes gegeben.<br />
- Eine sehr umfassende und systematische Betrachtung <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />
zentralen Orte hat Bartsch 2006 vorgelegt. Er arbeitet neben einer Definition,<br />
den Unterschieden zwischen funktionsteilige zentralen Orten und Städtenetzen<br />
beispielsweise auch Kriterien für eine erfolgreiche <strong>Zusammenarbeit</strong> von funkti-<br />
onsteiligen zentralen Orten heraus. So sollten sich die kooperierenden Kom-<br />
munen beispielsweise über die gemeinsamen Motive <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> klar<br />
sein. Des Weiteren soll auf positiven Erfahrungswerten aufgebaut werden, die<br />
eventuell schon vorhanden sind o<strong>der</strong> sich durch externe Anstöße an<strong>der</strong>er Ko-<br />
operationsprozesse motivieren lassen. Zudem sollte ein Kooperationskonzept<br />
bzw. -vertrag vorliegen, in dem die Ziele, Strategien und Maßnahmen schriftlich<br />
fixiert sind. Die dort festgelegten Maßnahmen und Kooperationsprojekte erfor-<br />
<strong>der</strong>n zudem ein fähiges Management, hinsichtlich Organisation, För<strong>der</strong>mittelerschließung<br />
und Projektumsetzung. Abschließend sollten Entscheidungen, Pro-<br />
zesse und Vorgehen transparent und nachvollziehbar gestaltet sein, um die<br />
gemeinsame <strong>Zusammenarbeit</strong> zu stärken. 21<br />
. Des Weiteren stellt Bartsch Bewertungskriterien<br />
bzw. besser -fragen für die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
auf. 22<br />
Insgesamt sieht er bei einer Vielzahl funktionsteiliger Zentraler Orte nur<br />
eine formale Ausweisung und erheblichen Bedarf bei einer realen Ausgestaltung<br />
bzw. Umsetzung<br />
- Bereits 1999 haben Müller und Beyer eine Untersuchung <strong>der</strong> sächsischen<br />
21<br />
22<br />
23<br />
Städteverbünde vorgelegt, die einen längeren Untersuchungszeitraum umfasste<br />
und vornehmlich auf fünf Bewertungskriterien abstellte (Versorgungsfunktion,<br />
gemeinsame Einrichtungen, <strong>Zusammenarbeit</strong> in an<strong>der</strong>en zentralörtlichen Berei-<br />
chen, <strong>Zusammenarbeit</strong> in an<strong>der</strong>en weichen Bereichen, koordinierende Zentraleinheit,<br />
verbindliche Organisationsformen). Interessant ist im vorliegenden Kon-<br />
text die Aussage, dass in den meisten Fällen die <strong>Zusammenarbeit</strong> im zentralört-<br />
lichen Bereich nur eine nachrangige Bedeutung hatte und eine Kooperation<br />
vielmehr auf „weichem“ und vor allem im kulturellen Bereich erfolgte. 23<br />
Vgl. R. Bartsch, 2006, S. 48f.<br />
Ebenda 108f.<br />
Vgl. B. Müller/ B. Beyer, 1999, S. 213<br />
15
- Auch Leitz stellt 2001 in ihrer Untersuchung die Chancen und Probleme von<br />
gemeinsamen Zentralen Orten ausführlich dar. Als offensichtlichster Vorteil ei-<br />
nes gemeinsamen Zentralen Ortes wird die Beseitigung des Versorgungsdefizits<br />
im Mittelbereich angesehen. Damit verbunden ist die Bindung <strong>der</strong> Umland-<br />
gemeinden an die Zentren und daraus resultierende Agglomerationsvorteile für<br />
Bevölkerung und Wirtschaft. 24<br />
Darüber hinaus beschäftigt sie sich ausführlich<br />
mit den Inhalten entsprechen<strong>der</strong> landesplanerischer Verträge. Inhaltlich sollen<br />
diese die freiwillige vertragliche <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> Kommunen regeln und die<br />
Kommunen zur Verpflichtung bestimmter Umsetzungsstrukturen anregen. Wichtig<br />
ist ihr auch die vertragliche Verpflichtung zu einer <strong>Evaluierung</strong> <strong>der</strong> inter-<br />
kommunalen <strong>Zusammenarbeit</strong>. Diese soll beispielsweise in Form von Bilanz-<br />
workshops und regelmäßigen Zusammenkünften stattfinden, welche die Effektivität<br />
und den Wirkungsgrad <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> eruieren. 25<br />
Weiterhin stellt<br />
Leitz dar, dass die <strong>Evaluierung</strong> zwar nach klassischen „harten“ Kriterien – wie<br />
es in Thüringen <strong>der</strong> Fall war – bewertet werden kann, die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
aber mittels „weicher“ qualitativer Faktoren gemessen werden<br />
soll. 26<br />
- Aus den von vielen Autoren dargestellten Chancen und Problemen für funktionsteilige<br />
Zentrale Orte ergeben sich diverse Handlungsbedarfe, um eine er-<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
folgreiche interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> zu gewährleisten, die auch von<br />
Greiving et al. 2008 in <strong>der</strong> Studie des BMVBS aufgegriffen werden. Auch er<br />
sieht wie Bartsch die Mehrzahl an Kooperationen stagnieren und for<strong>der</strong>t externe<br />
Impulse, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. 27<br />
Für die vorliegende<br />
Untersuchung anregend waren die entsprechenden Empfehlungen für die gefor<strong>der</strong>ten<br />
Evaluationen. Die Erfolgskontrolle <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> Zusammen-<br />
arbeit setzt nach Greiving jedoch voraus, dass klar definierte und operationali-<br />
sierte Ziele bzw. Evaluanden vorhanden sind, die es zu überprüfen gilt. Das ersichtlichste<br />
Evaluandum stellt nach Greivings Auffassung <strong>der</strong> Kooperationsver-<br />
trag und die dort getroffenen Vereinbarungen dar. Des Weiteren soll evaluiert<br />
werden, wie <strong>der</strong> Kooperationsprozess <strong>der</strong> Kommunen gestaltet ist und wie beispielsweise<br />
die Aufgaben <strong>innerhalb</strong> des Städteverbunds verteilt sind. Als letztes<br />
Vgl. A. Leitz, 2001, S. 34ff.<br />
Ebenda S. 69.<br />
Ebenda S. 77.<br />
BMVBS 2008, S. 57.<br />
16
Evaluandum werden <strong>der</strong> Stand <strong>der</strong> im Vertrag und Prozess vereinbarten Projekte<br />
und Aufgaben genannt. 28<br />
Abschließend wird ein dreiphasiges Evaluations-<br />
modell empfohlen, welches in einem Zeitraum von mehreren Jahren den Kooperationsprozess<br />
analysieren und bewerten soll. In Phase 1 soll geprüft wer-<br />
den, ob ein Vertrag sowie ein Kooperationsgremium vorhanden ist. Zudem soll<br />
erörtert werden, ob es festgelegte Handlungsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kommunen gibt. Dies<br />
soll nach etwa drei Jahren geschehen. Nach fünf Jahren soll in <strong>der</strong> zweiten<br />
Phase geprüft werden, ob die vereinbarten Umsetzungen tatsächlich stattge-<br />
funden haben und ob eine abgestimmte Planung, z. B. in Form von Flächennutzungsplänen,<br />
existiert. In Phase 3 soll nach zehn Jahren die räumliche Wir-<br />
kung auf den Versorgungsbereich, hinsichtlich Arbeitsmarkt, Pendler, Kaufkraft,<br />
etc. evaluiert werden. 29<br />
- Die einzige bisher durchgeführte und veröffentlichte Evaluation <strong>der</strong> gemeinsa-<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
men Zentralen Orte erfolgte in Thüringen durch das Ministerium für Bau, Lan-<br />
desentwicklung und Medien im Jahre 2009. Als Kriterien zur Überprüfung <strong>der</strong><br />
ausgewählten Kommunen wurden folgende Punkte gewählt: Bevölkerung, Ar-<br />
beitsplätze, Bildungs- und Ausbildungsfunktion, kulturelle Angebote, Nahver-<br />
kehr, Einzelhandel und Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen sowie<br />
die funktionsteilige <strong>Zusammenarbeit</strong> bzw. gemeinsame Flächennutzungsplanung.<br />
30<br />
Im Untersuchungszeitraum wurden hinsichtlich dieser Kriterien keine<br />
erheblichen Funktionsverluste beobachtet, bzw. bezüglich <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong><br />
Kooperation sei sogar eine Verbesserung eingetreten. 31<br />
Zwar bestehen noch<br />
immer erhebliche Verbesserungspotenziale, jedoch wird als Erfolg gewertet,<br />
dass bereits die Ankündigung einer Evaluation die <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />
Mittelzentren erhöhte. 32<br />
Kritisch zu sehen an dieser Evaluation ist<br />
jedoch, dass die Indikatoren zur Überprüfung kaum durch die Kommunen o<strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>e Instanzen beeinflussbar sind. Die Umsetzung <strong>der</strong> funktionsteiligen <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
wird in dieser Arbeit nur ansatzweise erörtert.<br />
Ebenda S.62.<br />
Ebenda S. 66.<br />
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien: „Abschlussbericht zur Überprüfung einiger<br />
Zentraler Orte höherer Stufe entsprechend <strong>der</strong> Festlegung im Landesentwicklungsplan 2004 in Thüringen“,<br />
2009, S. 6ff.<br />
Ebenda S. 16.<br />
Ebenda S. 17.<br />
17
Insgesamt macht die ausgewertete Literatur deutlich, dass ein übergreifen<strong>der</strong> Kon-<br />
sens in den Handlungsempfehlungen existiert. So sind allen Experten zufolge Koope-<br />
rationsvereinbarungen inklusive einer <strong>Evaluierung</strong> unerlässlich, um die ausgewiesenen<br />
funktionsteiligen Zentralen Orte in ihren Aufgaben und Zielen sowohl zu unter-<br />
stützen als auch zu überprüfen. Die Vorgabe einer Evaluation för<strong>der</strong>t grundsätzlich<br />
die Motivation und die Bereitschaft zur <strong>Zusammenarbeit</strong>. Es muss allerdings auch<br />
konstatiert werden, dass die praktischen Erfahrungen und damit auch Vergleichswer-<br />
te für eine Evaluation <strong>der</strong> funktionsteiligen Zentralen Orte bisher nur auf eine Evalua-<br />
tion in Thüringen beschränkt ist und die angewandte Methodik hierzu aber nicht<br />
übernommen werden kann.<br />
2.3 Angewandte Evaluationsmethodik<br />
Die für die Evaluation untersuchungsleitenden Fragestellungen sind im Landes-<br />
entwickungsplan bereits explizit vorgegeben. Dort heißt es in den Begründungen zu<br />
Punkt 2.11 (G) im Absatz 5: „Dabei ist zu prüfen, ob Vereinbarungen zwischen den<br />
kooperierenden Gemeinden die mittelzentralen Funktionen sichern, und wie <strong>der</strong><br />
Stand <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation ist.“ 33<br />
Damit sind die beiden wichtisten Bewer-<br />
tungsaspekte, zum einen die Vereinbarungen und zum an<strong>der</strong>en <strong>der</strong> Umsetzungsstand<br />
<strong>der</strong> Kooperation, vorgegeben.<br />
Zu den Inhalten <strong>der</strong> Vereinbarungen wird im Absatz 4 weiter konkretisiert: „Es sollen<br />
ausgehend von den Funktionszuordnungen Festlegungen dahingehend getroffen<br />
werden, in welcher Form die Funktionen weiterentwickelt, wie die Finanzierung si-<br />
chergestellt, welche gemeindeübergreifenden Gremien gebildet und wie die Zusam-<br />
menarbeit mit den Gemeinden des Verflechtungsbereiches entwickelt werden soll.<br />
Entsprechende Vereinbarungen können auch weitere Elemente <strong>der</strong> Kooperation um-<br />
fassen, insbeson<strong>der</strong>e hinsichtlich einer Abstimmung <strong>der</strong> Planung, die Konkurrenzen<br />
bei <strong>der</strong> Siedlungsflächen- und Infrastrukturentwicklung verhin<strong>der</strong>n hilft.“ 34<br />
Aus diesen Ausführungen im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg ergibt sich<br />
auch, dass in <strong>der</strong> Evaluation die Betrachtung von Ergebnissen o<strong>der</strong> Wirkungen eine<br />
eher nachrangige Rolle spielen. Die Betrachtung <strong>der</strong> Rahmenbedingungen und des<br />
Kontextes des Evaluationsgegendstandes sowie <strong>der</strong> Rahmenbedingungen in den<br />
33<br />
34<br />
Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), a. a. O., S. 205.<br />
Ebenda.<br />
18
einzelnen funktionsteiligen Mittelzentren ist dagegen eine zwingende Notwendigkeit.<br />
Nur so kann eine realistische und faire Bewertung erfolgen.<br />
Aus diesen Überlegungen ergibt sich die in <strong>der</strong> nachfolgenden Abbildung 3 dargestellte<br />
Evaluationsstruktur, die eine systematische Unterteilung <strong>der</strong> Evaluations-<br />
struktur in die vier Bereiche Rahmenbedingungen und Kontext, Kooperationskonzept<br />
und Vereinbarungen, Umsetzung sowie Ergebnisse und Auswirkungen ermöglicht.<br />
Abb. 3: Evaluationsstruktur<br />
Rahmenbedingungen und Kontext<br />
Kooperationskonzept und Vereinbarungen<br />
Umsetzung<br />
Ergebnisse und Auswirkungen<br />
19<br />
Vertrag<br />
Gremien/ Finanzierung<br />
Zuordnung/ Weiterentw.<br />
Verflechtungsbereich<br />
Weitere Koop.-elemente..<br />
Funktionsteilung<br />
Weiterentwicklung<br />
Sonstige Projekte<br />
In <strong>der</strong> vorliegenden Evaluation werden vornehmlich die ersten drei Bereiche betrachtet:<br />
Rahmenbedingungen<br />
und Kontext:<br />
In kompakter Form muss auf die räumlichen und struk-<br />
turellen Kooperationsvoraussetzungen eingegangen<br />
werden. Dazu gehören auch Kooperationsbemühun-<br />
gen <strong>der</strong> Vergangenheit und die <strong>Zusammenarbeit</strong> in<br />
an<strong>der</strong>en Strukturen. So spielt – wie später noch im<br />
Detail zu zeigen sein wird – die Zugehörigkeit bzw.<br />
Mitarbeit von Städten und Gemeinden in einem Regio-
Kooperationskonzept<br />
und Vereinbarungen<br />
nalen Wachstumskern (RWK) 35<br />
20<br />
für die jeweiligen Mit-<br />
telzentren eine erhebliche Rolle. Insgesamt muss die<br />
Unterschiedlichkeit <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />
im Blick behalten und ausreichend bei einer Bewertung<br />
berücksichtigt werden.<br />
Auch die Beachtung des insgesamt kurzen Zeitraums<br />
von drei Jahren vom Inkrafttreten des Landesentwick-<br />
lungsplans Berlin-Brandenburg bis zur vorliegenden<br />
Evaluation gehört zu diesen Rahmenbedingungen.<br />
Betrachtet werden die konzeptionellen und die darauf<br />
aufbauenden vertraglichen Vereinbarungen. Neben<br />
dem Vorhandensein einer Vereinbarung gehören solche<br />
Aspekte wie beispielsweise die Festlegungen zu<br />
gemeindeübergreifenden Gremien o<strong>der</strong> die Zusam-<br />
menarbeit mit an<strong>der</strong>en Gemeinden im Verflechtungsbereich<br />
zu bewertungsaspekten.<br />
Umsetzung Im Mittelpunkt <strong>der</strong> Betrachtung steht hier die Umset-<br />
zung <strong>der</strong> getroffenen vertraglichen Vereinbarungen,<br />
wobei Versorgungsfunktionen sowie diesbezügliche<br />
Maßnahmen, Aktivitäten und Projekte beson<strong>der</strong>s wich-<br />
tig sind. Ergänzend werden an<strong>der</strong>e Kooperationsformen<br />
in die Bewertung aufgenommen.<br />
Die genannten Evaluationsschwerpunkte wurden mit dem Auftraggeber abgestimmt<br />
und im Rahmen eines Workshops im November 2011 mit Vertretern <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />
Mittelzentren diskutiert. Einig waren sich alle Beteiligten, dass bei <strong>der</strong> Evaluati-<br />
on ein pragmatisches Vorgehen und eine auf die spezifischen Verhältnisse angepass-<br />
te Methodik angewandt werden muss.<br />
35<br />
Im Rahmen einer Neuausrichtung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>politik hat das Land Brandenburg im November 2005 15 Regionale<br />
Wachstumskerne (RWK) ausgewiesen. Neben dieser regionalen erfolgte gleichzeitig eine sektorale Ausrichtung<br />
und Konzentration. Die Neuausrichtung <strong>der</strong> För<strong>der</strong>politik auf RWK soll u. a. dazu beitragen die Schaffung von<br />
Arbeitsplätzen zu unterstützen, die Abwan<strong>der</strong>ung von Einwohnern zu verringern und auch die rückläufigen För-<br />
<strong>der</strong>mittel effizienter einzusetzen. Die 15 RWK setzen sich aus insgesamt 26 Städte und Gemeinden zusammen,<br />
die über beson<strong>der</strong>e wirtschaftliche bzw. wissenschaftliche Potenziale und über eine Mindesteinwohnerzahl ver-<br />
fügen (Vgl. dazu http://www.stk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.138294.de, eingesehen am<br />
18.06.2012).
Methodische Schwerpunkte des abgearbeiten Arbeitsprogramm waren – neben den<br />
vorbereitenden Arbeitsschritten (vgl. Kap. 2.1 und 2.2) – leitfadengestützte Einzelge-<br />
spräche mit den Hauptverwaltungsbeamten in den 16 Städten <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />
Mittelzentren sowie eine vor- bzw. nachgeschaltete Dokumenten- und Datenanalyse.<br />
Ergänzend dazu wurden weitere 22 persönliche o<strong>der</strong> telefonische Interviews mit Akt-<br />
euren aus den jeweiligen Regionen bzw. involvierten Entwicklungsgesellschaften,<br />
Beratern o<strong>der</strong> Experten geführt 36<br />
. Zwischenergebnisse und vor allem die Erstbewer-<br />
tungen für die einzelnen funktionsteiligen Mittelzentren wurden den Kommunen<br />
übermittelt und auf einem weiteren Workshop Ende Mai 2012 vorgestellt. Zeitgleich<br />
bestand die Möglichkeit ergänzen<strong>der</strong> Konsultationen mit dem Gutachter. Abgeschlos-<br />
sen wurde die Evaluation mit einer qualitativen Bewertung und Einschätzung durch<br />
den Gutachter und die Ableitung entsprechen<strong>der</strong> Empfehlungen.<br />
Der für die Fachgespräche benutzte Leitfaden bestand aus vier Abschnitten mit den<br />
folgenden Leitfragen (vgl. Anhang 4):<br />
1. Rahmenbedingungen<br />
- Wie stellen sich die funktionalen, historischen und politischen Bezüge (zwi-<br />
schen den Gemeinden und im gemeinsamen Mittelbereich) dar?<br />
- Wie kann man den Anlass und den Verlauf <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> beschreiben?<br />
- Welche Akteure sind involviert?<br />
2. Verbindliche Regelungen<br />
- Existieren verbindliche Regelungen über die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong>?Sind<br />
in diesen Festlegungen enthalten<br />
36<br />
o zu gemeindeübergreifenden Gremien<br />
o zur Funktionszuordnung und zur Weiterentwicklung <strong>der</strong> Funktionen<br />
o zur Finanzierung<br />
o zur <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Gemeinden des Verflechtungsbereiches<br />
Vgl. Anhang 3.<br />
21
- Enthalten die Vereinbarungen weitere Elemente <strong>der</strong> Kooperation, wenn ja wel-<br />
che?<br />
3. Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation<br />
- Wie erfolgt die organisatorische Umsetzung <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> Zusammen-<br />
arbeit?<br />
- Wie wurde die Kooperation bisher inhaltlich untersetzt bzw. auf welchen Gebieten<br />
ist sie geplant?<br />
- Sind die Gemeinden des gemeinsamen Mittelbereiches eingebunden?<br />
- Wie kann die Umsetzung belegt werden?<br />
4. Ergebnisse / Wirkungen<br />
- Gibt es erste Ergebnisse/ Projekte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>?<br />
- Wie schätzen die Gesprächspartner die Entwicklung ein?<br />
- Sehen Sie Verbesserungs- und/o<strong>der</strong> Unterstützungsbedarf?<br />
22
3. Analyse <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>innerhalb</strong> <strong>der</strong><br />
funktionsteiligen Mittelzentren<br />
Das folgende Kapitel drei bildet den Hauptteil <strong>der</strong> vorliegenden Evaluation. Es enthält<br />
einleitend eine vergleichende Betrachtung wichtiger Aspekte und Indikatoren für alle<br />
funktionsteiligen Mittelzentren (vgl. Kap. 3.1). Anschließend werden die einzelnen<br />
funktionsteiligen Mittelzentren im Detail betrachtet. Die Darstellung erfolgt dabei nach<br />
folgen<strong>der</strong> Struktur:<br />
- Basisdaten<br />
- Rahmenbedingungen und Kontext<br />
- Vereinbarungen zur Kooperation<br />
- Umsetzung.<br />
3.1 Übergreifende Betrachtung<br />
Die nachfolgende Abbildung 5 gibt einen Überblick über die Lage <strong>der</strong> Zentralen Orte<br />
und Mittelbereiche im Land Brandenburg. Die funktionsteiligen Mittelzentren sind jeweils<br />
als Paar und in ihrer räumlichen Beziehungen zueinan<strong>der</strong> ausgewiesen (vgl.<br />
Abb. 4).<br />
Die funktionssteiligen Mittelzentren in Brandenburg sind unterschiedlich im Land verteilt.<br />
Der Mittelbereich des funktionsteiligen Mittelzentrums Schönefeld – Wildau<br />
grenzt beispielsweise unmittelbar an Berlin an. Der Mittelbereich Wer<strong>der</strong> (Havel) –<br />
Beelitz grenzt an die Landeshauptstadt Potsdam und liegt auch in einer günstigen<br />
Entfernung zu Berlin mit einer entsprechend guten Anbindung. Die an<strong>der</strong>en sechs<br />
funktionsteiligen Mittelzentren liegen in deutlicher Entfernung zur Bundeshauptstadt<br />
in eher peripheren Regionen, dem sog. „weiteren Metropolenraum“ <strong>der</strong> Hauptstadtregion.<br />
Vier <strong>der</strong> acht funktionsteiligen Mittelzentren sind zugleich Regionaler Wachs-<br />
tumskern. Die funktionsteiligen Mittelzentren Lauchhammer – Schwarzheide sowie<br />
Senftenberg – Großräschen bilden gemeinsam mit Finsterwalde den RWK Westlausitz.<br />
Das funktionsteilige Mittelzentrum Perleberg – Wittenberge ergänzt durch Kar-<br />
städt bilden den RWK Prignitz. Königs Wusterhausen und das funktionsteilige Mittel-<br />
zentrum Schönefeld – Wildau prägen den RWK Schönefel<strong>der</strong> Kreuz aus.<br />
23
Abb. 4: Zentrale Orte im Land Brandenburg<br />
Quelle: http://www.berlin-brandenburg.de/daten-fakten/regionalmonitoring/index_rm.php (erstellt am 2.05.2012)<br />
Weitere Grunddaten sind in <strong>der</strong> folgenden Tabelle 4 aufgeführt. Die durchschnittliche<br />
Entfernung zwischen den jeweiligen Verwaltungssitzen beträgt beispielsweise rund<br />
15,5 km. Die kürzeste Entfernung kann zwischen Lauchhammer und Schwarzheide<br />
mit nur knapp 10 km, die weiteste Entfernung zwischen Pritzwalk und<br />
Wittstock/ Dosse mit 23,4 km gemessen werden. Die durchschnittliche Bevölke-<br />
rungszahl in den funktionsteiligen Mittelzentren lag 2010 bei rd. 27.300 Einwohnern.<br />
Die geringste Einwohnerzahl weist dabei das funktionsteilige Mittelzentrum Elster-<br />
werda – Bad Liebenwerda mit etwa 18.700 Einwohnern auf. Senftenberg – Groß-<br />
räschen führt diesen Größenvergleich mit knapp 36.800 Einwohnern an. Den größten<br />
Mittelbereich unter den funktionsteiligen Mittelzentren mit knapp 57.500 Einwohner<br />
bildet Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz, den kleinsten mit gut 30.000 Einwohnern Zehdenick –<br />
Gransee.<br />
24
Tab. 4: Grunddaten <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />
Elsterwerda - Bad<br />
Liebenwerda<br />
Lauchhammer -<br />
Schwarzheide<br />
Perleberg -<br />
Wittenberge<br />
Pritzwalk -<br />
Wittstock/Dosse<br />
Schönefeld -<br />
Wildau<br />
Senftenberg -<br />
Großräschen<br />
Wer<strong>der</strong> (Havel) -<br />
Beelitz<br />
Zehdenick -<br />
Gransee<br />
Entfernung <strong>der</strong><br />
Mittelzentren 37<br />
In km in h<br />
in Mittelzentren<br />
25<br />
Einwohner 2010 Fläche<br />
im Mittelbe- Anteil <strong>der</strong><br />
in km²<br />
reich Mittelzentren<br />
13,2 0:25 18.667 38.898 47,9 % 521,2<br />
9,9 0:19 23.009 37.215 61,8 % 330,0<br />
12,9 0:20 27.833 46.331 60,1 % 1.049,4<br />
23,4 0:31 30.903 51.952 59,5 % 1.485,8<br />
16,2 0:38 23.154 47.465 48,8 % 115,3<br />
13,1 0:26 36.792 50.352 73,1 % 475,1<br />
22,9 0:30 34.917 57.499 60,7 % 477,3<br />
12,7 0:15 23.220 30.188 76,9 % 753,6<br />
Durchschnitt 15,5 0:25 27.312 44.988 61,1 % 651,0<br />
Quelle: eigene Berechnungen, Amt für Statistik Berlin Brandenburg. Im Internet: http://www.statistik-berlinbrandenburg.de/Publikationen/Stat_Berichte/2011/SB_A6-12_j01-10_BB.pdf<br />
(eingesehen am 12.06.2012), LBV-Mittelbereichsprofile<br />
(http://www.lbv.brandenburg.de/2068.htm, eingesehen am 11.06.2012)<br />
Auffällig ist in den Mittelbereichen zudem <strong>der</strong> hohe Anteil <strong>der</strong> in den Mittelzentren<br />
lebenden Bevölkerung im Gegensatz zu den jeweiligen Verflechtungsbereichen. Im<br />
Schnitt leben über 61 % <strong>der</strong> Einwohner in einem <strong>der</strong> beiden funktionsteiligen Mittel-<br />
zentren, lediglich Elsterwerda – Bad Liebenwerda, aber auch Schönefeld – Wildau<br />
liegen mit knapp unter 50% weit unter dem Durchschnitt. Weit über diesem Wert lie-<br />
gen Zehdenick – Gransee mit fast 77 % gefolgt von Senftenberg – Großräschen mit<br />
etwas über 73 % <strong>der</strong> Einwohner.<br />
37<br />
Verkehrliche Anbindung von Amtssitz zu Amtssitz nach kürzester Strecke Routenplaner auf www.falk.de (Zu-<br />
griff 28.02.2012). Dabei kann es bei einer Betrachtung des schnellsten Fahrweges zu teilweise erheblichen Un-<br />
terschieden kommen. So beträgt <strong>der</strong> kürzeste Weg zwischen dem Verwaltungssitz in Schönefeld und dem Ver-<br />
waltungssitz in Wildau 16,2 km, für den man rund 38 Minuten benötigt. Die schnellste Variante ist dagegen<br />
23,4 km lang und man benötigt nur rund 20 Minuten.
Allein diese knappe Gegenüberstellung zeigt die Vielfalt und die teilweise deutlich<br />
voneinan<strong>der</strong> abweichenden Rahmenbedingungen und Strukturen in den funktionstei-<br />
ligen Mittelzentren.<br />
26
3.2 Analyse <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> im Detail<br />
3.2.1 Elsterwerda – Bad Liebenwerda<br />
Neben dem funktionsteiligen Mittelzentrum Elsterwerda – Bad Liebenwerda gehören<br />
die amtsfreien Gemeinden Mühlberg/ Elbe und Rö<strong>der</strong>land sowie die Ämter Plessa<br />
(fünf Gemeinden) und Schradenland (vier Gemeinden) zum entsprechenden Mittelbe-<br />
reich (vgl. Abb. 5).<br />
Abb. 5: Mittelbereich Elsterwerda – Bad Liebenwerda<br />
Quelle: Kartengrundlage: www.falk.de, LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010, S.3.<br />
Bad Liebenwerda ist die größte Stadt im Mittelbereich und besitzt knapp 10.000 Ein-<br />
wohner, Elsterwerda hat rund 8.700 Einwohner. Die Gemeinden und Ämter des übri-<br />
gen Mittelbereiches weisen eine Einwohnerzahl von über 20.000 Einwohnern auf<br />
(vgl. Tab. 5).<br />
Die beiden Städte Elsterwerda und Bad Liebenwerda sind über die B 101 und diverse<br />
Kreisstraßen miteinan<strong>der</strong> verbunden. Die Entfernung zwischen ihnen liegt bei ca.<br />
13,2 km und die Fahrtzeit beträgt etwa 25 Minuten (vgl. Tab. 4). Zwischen den Städ-<br />
ten liegt zu einem Großteil die Gemeinde Rö<strong>der</strong>land.<br />
In Elsterwerda befinden sich ein Krankenhaus, eine Bibliothek, diverse Ärzte, Kreditinstitute,<br />
eine Oberschule und ein Gymnasium. In Bad Liebenwerda ist kein Kranken-<br />
27
haus, dafür aber u. a. ein medizinisches Versorgungszentrum angesiedelt, es gibt<br />
kein eigenes Gymnasium mehr. 38<br />
In beiden Städten sind die wesentlichen Einrichtun-<br />
gen <strong>der</strong> Daseinsvorsorge vorhanden.<br />
Tab. 5: Basisdaten Elsterwerda – Bad Liebenwerda<br />
Amtsfreie Gemeinde/ Amt Bevölkerung des Mittelbereichs Fläche (in km²)<br />
Elsterwerda 8.694 (22,4 %) 40,6<br />
Bad Liebenwerda 9.973 (25,6 %) 138,4<br />
Mühlberg/ Elbe 4.244 (10,9 %) 88,6<br />
Plessa 6.671 (17,1 %) 132,1<br />
Rö<strong>der</strong>land 4.358 (11,2 %) 46,1<br />
Schradenland 4.958 (12,7 %) 75,4<br />
Mittelbereich insgesamt 38.898 (100,0 %) 521,2<br />
Quelle: eigene Berechnung, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach<br />
amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden; LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010.<br />
Die wirtschaftsstrukturelle Ausrichtung <strong>der</strong> beiden Städte ist sehr unterschiedlich. Die<br />
Stadt Bad Liebenwerda konzentriert sich in ihrer Entwicklung schwerpunktmäßig auf<br />
den Tourismus und ihren Status als Kurstadt. Die innerstädtischen Sanierungsaktivitäten<br />
wie auch die Umsetzung des Kurentwicklungsplanes sind unter an<strong>der</strong>em auf<br />
diese Ziele ausgerichtet. Große Infrastruktureinrichtungen wie die Lausitztherme<br />
Wonnemar o<strong>der</strong> das Epikur-Zentrum prägen diese Entwicklung ebenso. Die Stadt<br />
Elsterwerda dagegen konnte nach den großen Strukturverän<strong>der</strong>ungen in den 1990er<br />
Jahren an seine wirtschaftlichen Stärken anknüpfen und hat sich als ein wichtiger<br />
regionaler Wirtschaftsstandort im Süden Brandenburgs etabliert. Mittelständische<br />
Unternehmen, insbeson<strong>der</strong>e aus <strong>der</strong> Metallverarbeitung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Ernährungswirt-<br />
schaft, prägen den Standort. Auch im Ausstellungs- und Messebereich ist die Stadt<br />
aktiv und organisiert überwiegend regional und teilweise aber auch überregional geprägte<br />
Veranstaltungen. Diese wirtschaftliche Ausrichtung wird durch die gute ver-<br />
kehrliche Anbindung und entsprechende Gewerbeflächenpotenziale unterstützt.<br />
Die bereits erwähnte unterschiedliche Ausrichtung <strong>der</strong> beiden Städte und nur geringfügige<br />
infrastrukturelle Überschneidungen waren eine gute Basis für eine Zusam-<br />
menarbeit. Bis 1989 konnten sich die beiden Städte somit relativ unabhängig von<br />
einan<strong>der</strong> entwickeln und es ergab sich keine unmittelbare „Wettbewerbssituation“.<br />
Die strukturellen und vor allem die demografischen Verän<strong>der</strong>ungen in den 1990er<br />
Jahren haben aber sehr schnell beiden Seiten die Notwendigkeit einer Zusammenar-<br />
38<br />
LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010, S. 15.<br />
28
eit gezeigt. Dabei darf allerdings auch nicht übersehen werden, dass Bad Lieben-<br />
werda flächenmäßig mehr als dreimal so groß wie Elsterwerda ist und aus 15 Ortstei-<br />
len besteht, was den Abstimmungsbedarf durchaus erhöht.<br />
Trotz <strong>der</strong> Mitte <strong>der</strong> 1990er Jahre begonnenden <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen Elster-<br />
werda und Bad Liebenwerda haben beide Städte die Kontakte und die projektbezo-<br />
gene <strong>Zusammenarbeit</strong> mit ihren unmittelbaren Umlandgemeinden nicht vernachlässigt.<br />
So ist beispielsweise Elsterwerda aktuell sehr intensiv in die Entwicklung des<br />
Wirtschaftsraums Schraden involviert, <strong>der</strong> eher den süd-östlichen Teil des Mittelbe-<br />
reichs abdeckt. Auch die <strong>Zusammenarbeit</strong> mit sächsischen Gemeinden hat hier eine<br />
viel größere Bedeutung. Bad Liebenwerda pflegt im Gegenzug enge Beziehungen mit<br />
Mühlberg/ Elbe, Uebigau-Wahrenbrück und Falkenberg. Die Städte arbeiten bei <strong>der</strong><br />
touristischen Entwicklung gut zusammen und ergänzen sich hier. In dieser projektbezogenen<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> kommt auch eine gewisse Unschärfe <strong>der</strong> Abgrenzung des<br />
Mittelbereiches zum Ausdruck. Beide Städte haben quasi einen eigenen Verflech-<br />
tungsbereich. Die Verflechtungen des äußeren Randes mit dem jeweils an<strong>der</strong>en<br />
Zentrum sind naturgemäß nur sehr schwach ausgeprägt. So umschrieb ein Ge-<br />
sprächspartner diesen Zusammenhang sehr plastisch: „Die Feuerwehr von Elster-<br />
werda würde nie nach Mühlenberg ausrücken“.<br />
Elsterwerda und Bad Liebenwerda bieten in ihrer Funktion als Mittelzentren die meis-<br />
ten Arbeitsplätze des Mittelbereichs, etwa 77 % <strong>der</strong> Pendler im Mittelbereich zieht es<br />
in einen <strong>der</strong> beiden Orte. Elsterwerda besitzt insgesamt ein positives Pendlersaldo,<br />
<strong>der</strong> Mittelbereich hingegen ein stark negatives Pendlersaldo (knapp 3.300). 39<br />
Die folgende Abbildung 6 zeigt die Pendlerverflechtungen, aus denen eine gewisse<br />
stärkere Bedeutung <strong>der</strong> Stadt Elsterwerda für den Arbeitsmarkt des Mittelbereiches<br />
und insbeson<strong>der</strong>e für den östlichen Teil abzulesen ist.<br />
39<br />
Vgl. Anhang 5, S. 10.<br />
29
Abb. 6: Pendlerverflechtungen <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereichs<br />
Quelle: eigene Darstellung, nur Verflechtungen auf Elsterwerda und Bad Liebenwerda bezogen, Datengrundlage Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur<br />
für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand: 30.06.2010.<br />
In Bezug auf die <strong>Zusammenarbeit</strong> als funktionsteiliges Mittelzentrum können die beiden<br />
Städte Elsterwerda und Bad Liebenwerda die längsten Erfahrungen aufweisen.<br />
Bereits im Landesentwicklungsplan I – Brandenburg von 1995 wurden sie als Mittel-<br />
zentrum in Funktionsergänzung festgelegt. Ein diesbezüglicher Vertrag wurde – auch<br />
unter dem Eindruck <strong>der</strong> beabsichtigten Verän<strong>der</strong>ung dieses Status – im November<br />
2005 geschlossen. Ein neuer und aktualisierter Kooperationsvertrag wurde im Ja-<br />
nuar 2012 abgeschlossen. Dieser neue Vertrag, <strong>der</strong>en Vorbereitung und Diskussion<br />
in den beiden Städten bereits 2010 begann, verarbeitet die Erfahrungen <strong>der</strong> Zusam-<br />
menarbeit in den letzten Jahren. So gibt es nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner<br />
unter an<strong>der</strong>em Verän<strong>der</strong>ungen hinsichtlich einer realistischeren Bewertung eines<br />
gemeinsamen Planungsverbandes bzw. <strong>der</strong> Verwaltungskooperation, <strong>der</strong> Einbezie-<br />
hung des Umlandes und <strong>der</strong> Bedeutung eines Versorgungskonzeptes. Die Erarbei-<br />
tung eines solchen Konzeptes, was von den Gesprächspartnern als beson<strong>der</strong>s wichtig<br />
erachtet wird, ist auch Bestandteil des aktuellen Vertrages. Hervorzuheben sind<br />
die detaillierten vertraglichen Ausführungen zur Funktionsteilung und zur Zusammen-<br />
arbeit im Bereich Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung und Tourismus. Weniger konkret sind die Bestimmungen<br />
zur <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den an<strong>der</strong>en Kommunen im Mittelbereich und zur<br />
Finanzierung. Als wichtigstes Kooperationsgremium soll eine Lenkungsgruppe fungie-<br />
ren.<br />
Bei <strong>der</strong> Bewertung <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation ist das funktionsteilige Mittel-<br />
zentrum Elsterwerda – Bad Liebenwerda insofern ein Son<strong>der</strong>fall, da hier nicht nur <strong>der</strong><br />
30
Zeitraum seit 2009, son<strong>der</strong>n ein viel längerer Zeitraum betrachtet werden muss. Ein<br />
unmittelbarer Vergleich mit den an<strong>der</strong>en funktionsteiligen Mittelzentren wird dadurch<br />
zwar erschwert, man kann allerdings auch auf gewisse „Langzeiterfahrungen“ zurückgreifen.<br />
So zeigt sich beispielsweise, dass die Intensität <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
unterschiedliche Etappen durchlaufen hat. Nach eher geringen Kooperationsaktivitä-<br />
ten zu Beginn, folgte dann mit dem ersten Kooperationsvertrag eine gewisse Intensivierung.<br />
Die Umsetzung des ersten Kooperationsvertrages hätte allerdings noch akti-<br />
ver und zielführen<strong>der</strong> erfolgen können. Möglicherweise sind dafür aber auch die teil-<br />
weise zu hohen Erwartungen im ersten Kooperationsvertrag verantwortlich. Mit dem<br />
aktuellen Kooperationsvertrag und den aktuell laufenden Abstimmungen (Bestätigung<br />
Geschäftsordnung <strong>der</strong> Lenkungsgruppe, Projektfindungsphase und -abstimmung)<br />
sollte diese „Schwächephase“ jedoch überwunden sein. Zumindest zeigt sich hier,<br />
dass <strong>der</strong> Prozess <strong>der</strong> Ännäherung, <strong>der</strong> Entwicklung und -umsetzung direkter Koope-<br />
rationsprojekte <strong>der</strong> Daseinsvorsorge einen größeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Ein<br />
Gesprächspartner umschrieb diesen Lernprozess als eine Entwicklung vom „unbewussten<br />
Wahrnehmen des an<strong>der</strong>en Partners zu einem bewussten Wahrnehmen.“ So<br />
musste man sich in Elsterwerda beispielsweise auch erst an den Verzicht des eige-<br />
nen Schwimmbades „gewöhnen“ und die Nutzung <strong>der</strong> Lausitztherme Wonnemar in<br />
Bad Liebenwerda akzeptieren.<br />
Hervorzuheben in <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation ist zweifelsohne die relativ strik-<br />
te und nachvollziehbare Funktionsteilung. Es gibt offensichtlich keine schwerwiegenden<br />
Konkurrenzen. Auch die Anpassung und Strukturierung <strong>der</strong> Bildungs- bzw. Schul-<br />
landschaft ist in <strong>der</strong> Vergangheit augenscheinlich gut gelungen. Hier wird das erfolg-<br />
reiche Zusammengehen <strong>der</strong> beiden Städte für eine breite Öffentlichkeit beson<strong>der</strong>s<br />
sichtbar. Dies ist ganz beson<strong>der</strong>s zu würdigen, da es sich in <strong>der</strong> Regel um einen be-<br />
son<strong>der</strong>s sensiblen Bereich <strong>der</strong> Daseinsvorsorge handelt. In diesem Zusammenhang<br />
erfolgt nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner auch eine Abstimmung des öffentlichen<br />
Nahverkehrs, da dieser auch sehr stark durch die Schülerbeför<strong>der</strong>ung geprägt ist.<br />
Gleichwohl gibt es insgesamt bei <strong>der</strong> besseren Koordinierung des ÖPNV und <strong>der</strong><br />
Koordinerung <strong>der</strong> Erreichbarkeiten wichtiger Infrstruktureinrichtungen in den beiden<br />
Städten Verbesserungspotenzial. Hier könnte unter an<strong>der</strong>em das im Kooperationsver-<br />
trag aufgeführte Versorgungskonzept ansetzen, welches in dieser Form nicht exis-<br />
tiert. Ein solches Versorgungskonzept scheint aus auch notwendig, um weitere und<br />
unmittelbare Kooperationen im Bereich <strong>der</strong> Daseinsvorsorge aufzuzeigen. Gut läuft<br />
anscheinend schon die Abstimmung und Kooperation im Bereich <strong>der</strong> stationären und<br />
ambulanten Versorgung, wo es unmittelbare Arbeitskontakte und Informationsaustausch<br />
gibt.<br />
31
Im Bereich <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung werden von Elsterwerda direkt Aufgaben für Bad<br />
Liebenwerda mit übernommen und unter an<strong>der</strong>em einheitliche Vermarktungsaktivä-<br />
ten realisiert. In Bad Liebenwerda gibt es daher keine Mitarbeiter für den Bereich <strong>der</strong><br />
Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung mehr. Umgekehrt übernimmt Bad Liebenwerda Aufgaben <strong>der</strong><br />
Tourismuswerbung und -entwicklung für das funktionsteilige Mittelzentrum. Auch die<br />
gemeinsamen Neujahrs- und Wirtschaftsempfänge haben sich bewährt und haben<br />
aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Gesprächspartner für die <strong>Zusammenarbeit</strong> eine nicht zu unter-<br />
schätzende Bedeutung.<br />
Verbesserungspotenzial gibt es aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Verantwortlichen selbst noch in <strong>der</strong><br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> beiden Verwaltungen und in <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Äm-<br />
tern und Gemeinden des Mittelbereiches. Zwar gibt es diverse Arbeitsgruppen <strong>der</strong><br />
Bürgermeister bzw. Amtsleiter, diese arbeiten allerdings überwiegend noch auf informeller<br />
Ebene. Hier sind in Zukunft sicherlich weitere Ergebnisse <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
zu erwarten (Brandschutz, Ordnung und Sicherheit, Finanzen, <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong><br />
Bauhöfe bzw. Bauämter und <strong>der</strong> Standesämter). Eine aktivere Einbeziehung und<br />
transparentere Darstellung <strong>der</strong> bisherigen <strong>Zusammenarbeit</strong> ist hier notwendig.<br />
Hilfreich wäre aus Sicht <strong>der</strong> Gesprächspartner, dass das funktionsteilige Mittelzent-<br />
rum auch in an<strong>der</strong>en Gremien und Planwerken eine gewisse Aufwertung erfährt. Dies<br />
betrifft beispielsweise den Kreisentwicklungsplan o<strong>der</strong> auch die Mitarbeit in <strong>der</strong> Regi-<br />
onalen Planungsgemeinschaft.<br />
Insgesamt ist festzustellen, dass das funktionsteilige Mittelzentrum Elsterwerda –<br />
Bad Liebenwerda die Evaluationskriterien erfüllt. Bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation<br />
und hier insbeson<strong>der</strong>e im Bereich <strong>der</strong> Daseinsvorsorge gibt es jedoch noch Verbes-<br />
serungsbedarf. Hier sollten die notwendigen Grundlagen durch das geplante Versorgungskonzept<br />
zeitnah geschaffen werden.<br />
32
3.2.2 Lauchhammer – Schwarzheide<br />
Der Mittelbereich Lauchhammer – Schwarzheide setzt sich zusammen aus den bei-<br />
den Städten des funktionsteiligen Mittelzentrums Lauchhammer und Schwarzheide<br />
sowie den Ämtern Ortrand und Ruhland, welche aus jeweils sechs Gemeinden be-<br />
stehen. Die beiden Ämter liegen südlich des funktionsteiligen Mittelzentrums und<br />
grenzen ihrerseits an den Freistaat Sachsen an. Beide Städte Lauchhammer und<br />
Schwarzheide bilden gemeinsam mit Senftenberg, Großräschen und Finsterwalde<br />
den RWK Westlausitz.<br />
Abb. 7: Mittelbereich Lauchhammer – Schwarzheide<br />
Quelle: Kartengrundlage: www.falk.de, LBV Mittelbereichsprofil Lauchhammer - Schwarzheide,2010, S.3.<br />
Auf Lauchhammer entfallen mit knapp 17.000 Einwohnern über 45 % <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
des gesamten Mittelbereiches, Schwarzheide hingegen hat rund 6.000 Einwoh-<br />
ner. Auf die Ämter des übrigen Mittelbereiches verteilen sich etwa 14.500 Einwohner<br />
(vgl. Tab. 6).<br />
33
Die beiden Städte des funktionsteiligen Mittelzentrum sind verkehrlich über die B 169<br />
sowie über Gemeindestraßen sehr gut miteinan<strong>der</strong> verbunden. Die Entfernung vom<br />
Verwaltungssitz Lauchhammer zum Verwaltungssitz in Schwarzheide beträgt rund<br />
9,9 km und die Fahrtzeit liegt bei etwa 19 Minuten (vgl. Tab. 4). Die Entfernung zwi-<br />
schen den beiden Städten ist damit so gering wie in keinem an<strong>der</strong>en funktionsteiligen<br />
Mittelzentrum. Durch diese günstige Lage wird auch die Entwicklung von Gewerbeflächen<br />
an <strong>der</strong> B 169 begünstigt, die unmittelbar aneinan<strong>der</strong> grenzen und bei dem<br />
geplanten Ausbau <strong>der</strong> Bundesstraße auch einen gemeinsamen Zufahrtsbereich er-<br />
halten sollen. Eine direkte Bahnverbindung zwischen beiden Städten ist nicht vorhanden.<br />
Lauchhammer erstreckt sich über sieben Ortsteile, ein einziges Stadtzent-<br />
rum gibt es nicht und das Siedlungsgebiet ist recht zersplittert.<br />
Tab. 6: Bevölkerung Lauchhammer – Schwarzheide<br />
Amtsfreie Gemeinde/ Amt Bevölkerung des Mittelbereichs Fläche (in km²)<br />
Lauchhammer 16.956 (45,6 %) 88,4<br />
Schwarzheide 6.053 (16,3 %) 33,2<br />
Ortrand 6.481 (17,4 %) 77,0<br />
Ruhland 7.725 (20,8 %) 131,4<br />
Mittelbereich insgesamt 37.215 (100,0 %) 330,0<br />
Quelle: eigene Berechnung, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach<br />
amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden; LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010.<br />
Gehobene Funktionen <strong>der</strong> Daseinsvorsorge finden sich in Lauchhammer mit einem<br />
Krankenhaus, diversen Ärzten sowie Kreditinstituten. Schwarzheide bietet zudem<br />
mehrere Kinosäle an. 40<br />
Beide Städte sind Mitglied im Wasserverband Lausitz.<br />
Rund 84 % <strong>der</strong> Pendler im Mittelbereich zieht es in eine <strong>der</strong> beiden Städte des Mittel-<br />
zentrums. Sowohl <strong>innerhalb</strong> des funktionsteiligen Mittelzentrums als auch überregional<br />
weist Schwarzheide deutlich ein positives Pendlersaldo auf. 41<br />
Zwischen den beiden<br />
Städten gibt es traditionell und insbeson<strong>der</strong>e durch die industrielle Vergangenheit<br />
enge Verflechtungen. Mit den Strukturumbrüchen in den 1990er Jahren und <strong>der</strong> sich<br />
danach vollziehenden Wirtschaftsentwicklung haben sich diese Verflechtungen allerdings<br />
stärker zugunsten Schwarzheides entwickelt.<br />
40<br />
41<br />
LBV Mittelbereichsprofil Lauchhammer-Schwarzheide, 2010, S. 15.<br />
Vgl. Anhang 5, S. 13.<br />
34
Aktuell sind nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner teilweise neue Entwicklungen in<br />
Bezug auf die Verkehrsströme zu beobachten, die zu einer weiteren Belastung des<br />
Kreuzungspunktes B 169/ A 13 führen und eventuell auch eine Konzentration <strong>der</strong><br />
Handelsstrukturen nach sich ziehen könnten.<br />
Abb. 8: Pendlerverflechtungen <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereichs<br />
Quelle: eigene Darstellung, nur Verflechtungen auf Lauchhammer und Schwarzheide bezogen, Datengrundlage Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur<br />
für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand: 30.06.2010.<br />
In den Gesprächen wurde von den Beteiligten übereinstimmend betont, dass den<br />
Verantwortlichen in den beiden Städten zeitig klar wurde, dass bestimmte Infrastruk-<br />
turen aufgrund <strong>der</strong> demografischen Entwicklung und <strong>der</strong> steigenden finanziellen Belastung<br />
„zusammen gelegt“ bzw. nicht in Konkurrenz zueinan<strong>der</strong> betrieben werden<br />
können. So gab es schon ab dem Jahr 2000 Verabredungen über einzelne Projekte,<br />
wie beispielsweise das Hallenfreizeitbad „Am Weinberg“ in Lauchhammer o<strong>der</strong> den<br />
Bau eines Freizeitzentrums mit Kinosälen in Schwarzheide. In <strong>der</strong> jeweils an<strong>der</strong>en<br />
Stadt wurde die Entwicklung entsprechen<strong>der</strong> Infrastruktureinrichtugen nicht forciert<br />
bzw. bestehende Einrichtungen nicht saniert, was von <strong>der</strong> Öffentlichkeit und auch von<br />
den Stadtparlamenten teilweise kritisch begleitet wurde. Hier galt und gilt es auch<br />
weiterhin für entsprechende Projekte zu werben und gewisse Vorbehalte zu überwin-<br />
den.<br />
Zwischen Lauchhammer und Schwarzheide wurde am 11. Januar 2007 ein öffentlich-<br />
rechtlicher Vertrag zur <strong>Zusammenarbeit</strong> als Städteverbund geschlossen. Dieser Ko-<br />
operationsvertrag ist damit gut zwei Jahre vor dem Inkrafttreten des LEP B-B datiert,<br />
wodurch möglicherweise die auf an<strong>der</strong>e Schwerpunktthemen orientierenden<br />
35
Formulierungen und Zielsetzungen erklärt werden können. So fällt auf, dass Fragen<br />
<strong>der</strong> Flächenplanung und Raumordnung – an<strong>der</strong>s als in an<strong>der</strong>en Kooperationsverträ-<br />
gen – einen großen Raum einnehmen. Die Aufstellung eines gemeinsamen Flächennutzungsplans<br />
wird hier explizit als Ziel definiert. Erst im zweiten Abschnitt wird auf<br />
Fragen <strong>der</strong> Daseinsvorsorge („Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtun-<br />
gen, gemeinsame Konzepte zur Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung im Kultur- und Sozialbereich“)<br />
eingegangen.<br />
Sehr detailliert und zielgerichtet werden die Prüfung bestehen<strong>der</strong> Einrichtungen so-<br />
wie die Abstimmungen zu einzelnen Bereichen <strong>der</strong> Daseinsvorsorge aufgeführt. Weniger<br />
konkret bzw. nicht geklärt werden Fragen <strong>der</strong> Funktionszuordnung bzw. <strong>der</strong><br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> mit dem Mittelbereich. Zur Struktur und dem Inhalt des Vertrages<br />
wurde von den Gesprächspartnern angemerkt, dass es sich dabei um ein „Gerüst“<br />
handelt. Konkrete Projekte und Maßnahmen werden durch entsprechenden Einzel-<br />
verträge gesichert, so beispielsweise in einer Vereinbarung zur Verbesserung <strong>der</strong><br />
wirtschaftsnahen Infrastruktur vom Juli 2010.<br />
Die <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Ämtern Ortrand und Ruhland scheint in diesem funkti-<br />
onsteiligen Mittelzentrum auch in <strong>der</strong> praktischen Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation ein<br />
gewisser Knackpunkt zu sein. Hier scheint es offensichtlich nur wenige Berührungspunkte<br />
und nur vereinzelt gemeinsame Projekte zu geben. So ist beispielsweise von<br />
Lauchhammer aktuell ein Projekt mit Ortrand geplant, in dem Leistungen des Jobcen-<br />
terstandortes aus Lauchhammer in Ortrand angeboten werden. Inwieweit die eher<br />
verhaltene Kooperation im Mittelbereich auf die räumlich-strukturellen Verhältnisse,<br />
die Befindlichkeiten <strong>der</strong> Akteure o<strong>der</strong> einfach auf die fehlenden Notwendigkeit zu-<br />
rückgeführt werden muss, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden.<br />
Insgesamt kann das funktionsteilige Mittelzentrum Lauchhammer – Schwarzheide auf<br />
eine durchaus überzeugende Bilanz <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> zurückblicken. Dabei muss<br />
jedoch berücksichtig werden, dass viele Projekte auch durch die <strong>Zusammenarbeit</strong> als<br />
RWK bzw. auf diesen Status zurückzuführen sind. Hier zeigt sich klar, dass sich die<br />
Kooperation im funktionsteiligen Mittelzentrum und die <strong>Zusammenarbeit</strong> im RWK<br />
überlagern. Deutlich wird das einem Beispiel: Über die <strong>Zusammenarbeit</strong> im RWK<br />
wurde die Möglichkeit <strong>der</strong> gemeinsamen Nutzung des Obdachlosenheims in <strong>der</strong><br />
Stadt Senftenberg durch diese angeregt. Nach entsprechen<strong>der</strong> Prüfung haben u. a.<br />
Lauchhammer und Schwarzheide mit <strong>der</strong> Stadt Senftenberg einen öffentlichrechtlichen<br />
Vertrag zur Unterbringung obdachloser Menschen aus den beiden Städ-<br />
ten im gemeinsamen Obdachlosenheim in Senftenberg geschlossen. Weitere Bei-<br />
spiele für die Überschneidung von RWK-Projekten und die Kooperation im funktionsteiligen<br />
Mittelzentrum sind die Ausbildungsmesse, die in diesem Jahr in <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>-<br />
36
lausitzhalle in Senftenberg stattfindet o<strong>der</strong> ein neues Projekt <strong>der</strong> technischen Früho-<br />
rientierung von Kin<strong>der</strong>n des „Jugend-forscht-Zentrums“ in Lauchhammer, welches<br />
zukünftig eventuell für das gesamte RWK-Gebiet angeboten werden kann.<br />
Trotz <strong>der</strong> kurz skizzierten Überschneidung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> durch den RWK, gibt<br />
es selbstverständlich auch Probleme und Ansatzpunkte, die ausschließlich die beiden<br />
Städte Lauchhammer und Schwarzheide betreffen.<br />
Eines dieser Projekte ist <strong>der</strong> SeeCampus, <strong>der</strong> im Januar 2011 fertiggestellt wurde.<br />
Neben dem gemeinsamen Gymnasium Schwarzheide – Lauchhammer befinden sich<br />
dort Teile des Oberstufenzentrums Lausitz und mittlerweile auch eine gemeinsame<br />
Bibliothek. Geeinigt hatten sich die beiden Städte auf diesen symbolträchtigen Stand-<br />
ort auf den Ortsgrenzen. An <strong>der</strong> Realisierung waren neben den beiden Städten <strong>der</strong><br />
Landkreis, das Land Brandenburg aber auch private Partner beteiligt. Dieses für die<br />
beide Städte sehr wichtige Infrastrukturvorhaben wird – trotz einer gewisser Skepsis<br />
von Teilen <strong>der</strong> Bevölkerung gegenüber <strong>der</strong> Projektentwicklung – von den Nutzern<br />
sehr gut angenommen.<br />
Eine weitere Beson<strong>der</strong>heit in <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> ist <strong>der</strong> gemeinsame in Bearbei-<br />
tung befindliche Flächennutzungplan. Basis für dieses Kooperationsprojekt waren<br />
zum Einen sicherlich die in Lauchhammer vorhandenen technischen und personellen<br />
Kapazitäten. Zum An<strong>der</strong>en liegt eine solche Kooperation durch die Lage <strong>der</strong> Gewer-<br />
beflächen und die dadurch gegebenen Möglichkeiten einer gemeinsamen Gewerbe-<br />
flächenentwicklung, <strong>der</strong> kostengünstigeren Erschließung, wie auch des Angebots<br />
größerer Flächen auf <strong>der</strong> Hand. Bei <strong>der</strong> Vermarktung <strong>der</strong> Flächen bedienen sich bei-<br />
de Städte eines gemeinsamen Dienstleisters.<br />
Unmittelbar zusammengearbeitet haben die beiden Städte auch bei <strong>der</strong> Planung und<br />
Realisierung einer verän<strong>der</strong>ten Auffahrt zur A 13, die für einige Unternehmen aus<br />
Lauchhammer von großer Bedeutung ist.<br />
Gute Ansätze gibt es des Weiteren in <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> Verwaltungen, beispielsweise<br />
bei <strong>der</strong> Nutzung gemeinsamer Dienstleistungsunternehmen o<strong>der</strong> Tech-<br />
nik, <strong>der</strong> gegenseitigen Vertretung in den Standesämtern bis hin zu den gemeinsamen<br />
Neujahrsempfängen. In dieser professionellen <strong>Zusammenarbeit</strong> und <strong>der</strong> organisatorischen<br />
Umsetzung und Abwicklung über die Verwaltungen sowie <strong>der</strong> engen Einbezie-<br />
hung <strong>der</strong> Stadtparlamente scheint auch ein wesentlicher Grund für die bisherige Pro-<br />
jektgenerierung zu liegen. Von den Gesprächspartnern wurde in diesem Zusammenhang<br />
allerdings angemerkt, dass viele Projekte, aus denen sich Einsparungen, <strong>der</strong><br />
Erhalt o<strong>der</strong> sogar eine Verbesserung <strong>der</strong> Daseinsvorsorge bzw. des Infrastrukturan-<br />
gebotes erzielen lassen, mittlerweile realisiert sind. Viele Planungen im Sozial- und<br />
37
Bildungsbereich sind getätigt und entsprechen den gegenwärtigen und mittelfristigen<br />
demografischen Anfor<strong>der</strong>ungen, weshalb in diesem Bereich zur Zeit kein erhöhter<br />
Abstimmungsbedarf gesehen wird.<br />
Vor diesem Hintergrund werden zukünftig neue Kooperationsansätze im Bereich <strong>der</strong><br />
Einwohnermeldeämter o<strong>der</strong> im Bereich <strong>der</strong> kommunalen Wohnungsbestände gese-<br />
hen. Hier wäre ein gemeinsamer strategischer Ansatz und eine Einbeziehung Lauchhammers<br />
in entsprechende För<strong>der</strong>programme des Stadtumbaus aus Sicht <strong>der</strong> Ge-<br />
sprächspartner sinnvoll. Weitere Projektideen beziehen sich auf die <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
mit Ruhland bei <strong>der</strong> Erweiterung des Bahnterminals in Schwarzheide o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Erarbeitung<br />
eines gemeinsamen Energiekonzeptes<br />
Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass das funktionsteilige Mittelzentrum<br />
Lauchhammer – Schwarzheide die Evaluationskriterien erfüllt. Die <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
mit den Ämtern und <strong>der</strong>en Einbeziehung in entsprechende Aktivitäten sollten aber<br />
konzeptionell und in <strong>der</strong> Umsetzung unbedingt forciert werden. Hierzu sollten ent-<br />
sprechende vertragliche Anpassungen vorgenommen werden. Um weiterhin die Kooperation<br />
professionell voranzutreiben, wäre vielleicht auch eine jährliche Schwer-<br />
punktsetzung o<strong>der</strong> Projektauswahl günstig.<br />
38
3.2.3 Perleberg – Wittenberge<br />
Der Mittelbereich des funktionsteiligen Mittelzentrums Perleberg – Wittenberge wird<br />
durch die genannten Städte, die amtsfreien Gemeinden Plattenburg und Karstädt<br />
sowie die Ämter Lenzen - Elbtalaue mit vier Gemeinden und Bad Wilsnack/ Weisen,<br />
bestehend aus fünf Gemeinden, gebildet.<br />
Abb. 9: Mittelbereich Perleberg – Wittenberge<br />
Quelle: Kartengrundlage: www.falk.de, LBV Mittelbereichsprofil Perleberg - Wittenberge, 2010, S.3.<br />
Mit rund 18.600 Einwohnern (Stand: 2010) ist Wittenberge die größte Stadt im Mittel-<br />
bereich. Die Kreisstadt Perleberg folgt mit knapp 12.300 Einwohnern. In den Ge-<br />
meinden des restlichen Mittelbereiches haben rund 21.000 Einwohner ihren Wohnsitz<br />
(vgl. Tab. 7). Mit einer Größe von rund 1.050 km² liegt das funktionsteilige Mittelzent-<br />
rum Perleberg – Wittenberge deutlich über dem entsprechenden Durchschnitt aller<br />
funktionsteiliger Mittelzentren. Es ist nach Pritzwalk – Wittstock/ Dosse das zweitgrößte<br />
funktionsteilige Mittelzentrum.<br />
Die B 189 verbindet die beiden Städte Perleberg und Wittenberge miteinan<strong>der</strong>. Die<br />
Entfernung zwischen den Verwaltungssitzen liegt bei knapp 13 km, die Strecke kann<br />
39
mit dem Pkw in rund 20 Minuten überbrückt werden (vgl. Tab. 4). Des Weiteren wer-<br />
den beide Städte durch eine Bahnlinie verbunden, sodass die Städte per Regionalex-<br />
press jeweils in rund 16 Minuten zu erreichen sind.<br />
Tab. 7: Bevölkerung Perleberg – Wittenberge<br />
Amtsfreie Gemeinde/ Amt Bevölkerung des Mittelbereichs Fläche (in km²)<br />
Perleberg 12.332 (23,7 %) 137,8<br />
Wittenberge 18.571 (35,7 %) 50,4<br />
Bad Wilsnack/ Weisen 6.454 (12,4 %) 188,6<br />
Karstädt 6.376 (12,3 %) 252,2<br />
Lenzen-Elbtalaue 4.507 (8,7 %) 219,6<br />
Plattenburg 3.712 (7,1 %) 200,8<br />
Mittelbereich insgesamt 51.952 (100,0 %) 1.049,4<br />
Quelle: eigene Berechnung, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach<br />
amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden; LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010.<br />
In den beiden Städten werden die wichtigsten Infrastruktureinrichtungen und Leistun-<br />
gen <strong>der</strong> gehobenen Daseinsvorsorge angeboten. Beide verfügen über eine Vielzahl<br />
an Ärzten und Kreditinstituten, je eine Bibliothek und mehrere Kinosäle. Zudem bieten<br />
Perleberg und Wittenberge Oberschulen und Gymnasien an, in Perleberg befindet<br />
sich außerdem das Kreiskrankenhaus. 42<br />
Die Arbeitsmarktverflechtungen im Mittelbereich sind sehr stark auf Perleberg ausgerichtet<br />
(vgl. Abb. 10). Allein aus den Gemeinden des Mittelbereiches erreicht Perle-<br />
berg ein positives Pendlersaldo von über 1.300 Personen. Wittenberge kommt noch<br />
auf einen leichten Einpendlerüberschuss von 21 Personen, alle übrigen Ämter und<br />
Gemeinden des Mittelbereiches haben einen teilweise deutlichen Auspendlerüberhang.<br />
43<br />
42<br />
43<br />
LBV Mittelbereichsprofil Perleberg - Wittenberge, 2010, S. 14.<br />
Vgl. Anhang 5, S. 15.<br />
40
Abb. 10: Pendlerverflechtungen <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereiches<br />
Quelle: eigene Darstellung, nur Verflechtungen auf Perleberg und Wittenberge bezogen, Datengrundlage Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur<br />
für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand: 30.06.2010.<br />
Zwischen den beiden Städten existieren lange und historische Beziehungen. So ge-<br />
hörten sie beispielsweise beide dem Alt-Kreis Perleberg und bis 1990 dem damaligen<br />
Bezirk Schwerin an. Die jeweils an<strong>der</strong>e Stadt spielt im Bewusstsein <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
eine durchaus große Bedeutung, was sich früher auch in einer gewissen Konkurrenz-<br />
situation wi<strong>der</strong>gespiegelt hat. Die wirtschaftsstrukturelle Vergangenheit und die jün-<br />
gere Entwicklung, die Zugehörigkeit zu Kulturlandschaften, aber auch die gemeinsame<br />
Lokalzeitung o<strong>der</strong> das gemeinsame Regionalfernsehen sind zwar prägend,<br />
gleichzeitig muss das Verhältnis <strong>der</strong> beiden Städte jedoch immer auch sensibel ge-<br />
handhabt werden. So haben sich beispielsweise die Pendlerverflechtungen, die früher<br />
stärker auf industrielle Schwerpunkte in Wittenberge ausgerichtet waren, heute in<br />
das durch Dienstleistungen und Verwaltung geprägte Perleberg verschoben. Diese<br />
neueren strukturellen Entwicklungen haben dann bei den Diskussionen und Planungen<br />
zur Ausweisung als funktionsteiliges Mitelzentrum auch schnell zu einer Annähe-<br />
rung geführt. Dies wurde zweifelsfrei auch durch die bestehende RWK-Ausweisung<br />
beför<strong>der</strong>t. Gemeinsam mit <strong>der</strong> Gemeinde Karstädt bildet das funktionsteilige Mittelzentrum<br />
Perleberg – Wittenberge den RWK Prignitz. Durch die <strong>Zusammenarbeit</strong> im<br />
RWK sind die Städte nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner schneller zusammen ge-<br />
kommen und es herrscht jetzt ein gutes Verhältnis. Der RWK - Status und die entsprechenden<br />
Strukturen prägen deshalb auch sehr stark die <strong>Zusammenarbeit</strong> als<br />
funktionsteiliges Mittelzentrum. Gerade diese Überschneidungen zwischen RWK,<br />
funktionsteiligem Mittelzentrum und eventuell noch <strong>interkommunalen</strong> Projekten müs-<br />
41
sen allerdings im öffentlichen und sogar im politischen Bereich regelmäßig erläutert<br />
werden. Auch wurden die Arbeitsstrukturen und Abläufe für die <strong>Zusammenarbeit</strong> im<br />
funktionsteiligen Mittelzentrum wegen bereits existieren<strong>der</strong> RWK-Strukturen bewusst<br />
schlanker gehalten. Dies muss bei einer Bewertung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> des funkti-<br />
onsteiligen Mittelzentrums ebenfalls beachtet werden.<br />
Mit Datum vom 29. Mai 2007 hatten Perleberg und Wittenberge ihren Kooperationsvertrag<br />
zur <strong>Zusammenarbeit</strong> und Entwicklung eines Mittelzentrums in Funktionstei-<br />
lung geschlossen. In diesem Vertrag wird explizit auf die Ausweisung als RWK, be-<br />
stehende Standortentwicklungskonzepte und prioritäre Maßnahmen Bezug genommen.<br />
Hinsichtlich entsprechen<strong>der</strong> Kooperationsgremien wird u. a. auf eine Klärungs-<br />
stelle verwiesen. Von mehreren Gesprächspartnern wurde in den Fachgesprächen<br />
auf die sehr gut funktionierenden und intensiv arbeitenden Arbeits- und Entscheidungsstrukturen<br />
im RWK hingewiesen. Es gibt eine regelmäßig alle 14 Tage zusam-<br />
men kommende Lenkungsgruppe, eine Koordinatorin sowie mehrere inhaltlich ausge-<br />
richtete Arbeitsgruppen des RWK. In <strong>der</strong> AG „Räumliche Entwicklung“ sind auch die<br />
Ämter bzw. Gemeinden des Mittelbereiches vertreten. Darüber hinaus existiert seit<br />
1996 eine GbR Elbtalaue, die von einem Amtsdirektor geleitet wird und in <strong>der</strong> vor<br />
allem Themen des ländlichen Bereichs und <strong>der</strong> entsprechenden För<strong>der</strong>ung organisiert<br />
werden. Insgesamt ist somit eine ausreichende Organisationsstruktur vorhan-<br />
den. Zusätzliche Gremien – speziell für das funktionsteilige Mittelzentrum – würden<br />
hier eher eine Überfrachtung bedeuten. Dabei muss auch beachtet werden, dass für<br />
spezielle Themen wie die Tourismusför<strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> die Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung wiede-<br />
rum eigene Strukturen existieren, in welche erneut die Städte jeweils entsprechend<br />
eingebunden sind. Bei <strong>der</strong> Definition <strong>der</strong> Kernthemen <strong>der</strong> Kooperation fällt auf, dass<br />
ein Schwerpunkt auf konzeptionelle Arbeiten (u. a. Bildungs- und Schulkonzept, Ge-<br />
sundheitskonzept, Kultur- Freizeit- und Tourismuskonzept) gelegt wird. Dabei wird<br />
auch auf die mittelfristige Erstellung eines gemeinsamen Flächennutzungsplanes<br />
hingewiesen. Dieses Ziel wird nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner auch weiter ver-<br />
folgt, eine aktuelle Umsetzung ist aus Effizienzgründen aber nicht geboten, da beide<br />
Städte einen Flächennutzungsplan besitzen und eine vorhabensbezogene Abstimmung<br />
erfolgt. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> im Mittelbereich wird zwar eher vage fomuliert,<br />
aber auch hier gibt es funktionierende Abstimmungen im Rahmen <strong>der</strong> RWK-<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong>. Dies trifft auch auf die Finanzierung bzw. entsprechende Regelungen<br />
zu.<br />
Auch die Umsetzung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> wird im funktionsteiligen Mittelzentrum<br />
sehr stark durch die Arbeit im RWK geprägt. So ist das Standortentwicklungskonzept<br />
des RWK eine zentrale Arbeitsgrundlage, in <strong>der</strong> viele Themen aus dem Kooperati-<br />
onsvertrag inhaltlich mit aufgeführt und bearbeitet werden. Vor allem Projekte im Be-<br />
42
eich <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung o<strong>der</strong> im Sozialbereich werden über den RWK initiiert<br />
und die Städte stimmen ihre Aktivitäten intensiv ab. Das führt auch dazu, dass Pro-<br />
jekte des RWK mittlerweile auf <strong>der</strong> Ebene des Landkreises aufgegriffen und auf dieser<br />
Ebene fortgeführt werden, wie das Beispiel des „Sozialpasses“ belegt. Auch in<br />
<strong>der</strong> Finanzierung dieser Projekte werden die unterschiedlichsten Programme auf EU-,<br />
Bundes- und Landesebene genutzt.<br />
Umgekehrt war das Kulturkonzept ursprünglich ein für das funktionsteilige Mittelzent-<br />
rum gedachter Ansatz, <strong>der</strong> mittlerweile auf den RWK ausgeweitet wurde. Das Kultur-<br />
konzept, welches mit Unterstützung <strong>der</strong> Fachhochschule Potsdam 2009 fertiggestellt<br />
wurde, ist dabei bewusst weiter gefasst und zeigt Kooperationspotenziale im Bereich<br />
Kunst, Kultur und Tourismus auf. Bei den Analysen und Kooperationsvorschlägen<br />
muss man allerdings auch beachten, dass bestimmte Zusammenlegungen o<strong>der</strong> Einsparungen<br />
nur bis zu einem gewissen Punkt sinnvoll sind.<br />
Deutlich wird insgesamt, dass sich die beiden Konzepte RWK und funktionsteiliges<br />
Mittelzentrum stark überlappen und es bedingt dadurch kaum möglich ist, das eine<br />
vom an<strong>der</strong>en zu trennen.<br />
Die Abstimmung zu wichtigen Infrastruktureinrichtungen lief in <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
eher problemlos. Zum einen gibt es nur wenige Einrichtungen mit sich überschneidenden<br />
Einzugsbereichen und zum an<strong>der</strong>en sind viele Planungen, zum Beispiel die<br />
Schulentwicklung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> ÖPNV unter maßgeblicher Fe<strong>der</strong>führung und Verantwor-<br />
tung <strong>der</strong> Kreisverwaltung, bereits vor <strong>der</strong> Ausweisung des funktionsteiligen Mittelzentrums<br />
auf den Weg gebracht worden.<br />
Bei wichtigen Einrichtungen gab es keine Doppelungen, die Einrichtungen ergänzen<br />
sich eher:<br />
- Wittenberge: Kulturhaus, Museum, Schwimmhalle/ Freibad, Elblandfestspiele<br />
mit Veranstaltungsbühne, Gymnasium/ Oberstufenzentrum und Gesundheits-<br />
zentrum<br />
- Perleberg: Tierpark, Museen, Freibad, Lotte-Lehmann-Akademie, Gymnasi-<br />
um/ Gesundheitsschule, Kreiskrankenhaus.<br />
Die Kooperationspartner verständigten sich darauf die Entwicklung von Konkurrenzangeboten<br />
zu vermeiden und entsprechende Planungen anzupassen.<br />
Sehr gut funktioniert die <strong>Zusammenarbeit</strong> im Bereich Katastrophenschutz (gemein-<br />
sames Training, Alarmierung, Kenntnis <strong>der</strong> Technik <strong>der</strong> jeweiligen Partner), im gemeinsamen<br />
Tourismusverband („Anradeln“, „Tour de Prignitz“, gemeinsame Werbung<br />
43
usw.), in <strong>der</strong> Einzelhandelsplanung und -abstimmung sowie in ausgewählten Berei-<br />
chen <strong>der</strong> Verwaltungszusammenarbeit (u. a. gemeinsames Obdachlosenheim, Frau-<br />
enhaus, Austausch von Technik). In letzterem Bereich sind weitere Kooperationsansätze<br />
denkbar bzw. bereits bestehende Kooperationen sollen ausgeweitet weden<br />
(Lohnabrechnung, Ausweitung <strong>der</strong> standesamtlichen <strong>Zusammenarbeit</strong> zwischen Per-<br />
leberg und Plattenburg). Dies betrifft sicherlich auch die konsequente Einbeziehung<br />
<strong>der</strong> übrigen Ämter und Gemeinden des Mittelbereiches, die nicht im RWK enthalten<br />
sind. Im Bereich <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> Bauhöfe o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Abwasserent- und<br />
Energieversorgung werden zu Zeit keine Kooperationspotenziale gesehen.<br />
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das funktionsteilige Mittelzentrum Per-<br />
leberg – Wittenberge die Evaluationskriterien erfüllt. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> ist sehr<br />
stark durch den RWK Prignitz und die entsprechenden Strukturen und Projekte bestimmt.<br />
Dadurch hat sich die <strong>Zusammenarbeit</strong> nach Einschätzung <strong>der</strong> Verantwortli-<br />
chen insgesamt deutlich verbessert. Eine Aufteilung in Funktionen und Projekte des<br />
RWK und des funktionsteiligen Mittelzentrums ist aber nicht zielführend. Für die Öffentlichkeit<br />
und teilweise auch die politischen Entscheidungsträger sind solche Zu-<br />
sammenhänge regelmäßig erklärungsbedürftig. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> im Bereich <strong>der</strong><br />
Daseinsvorsorge im engeren Sinn, aber auch bei bestimmten Verwaltungsaufgaben<br />
könnte noch stärker thematisiert werden. Dies gilt auch für die Einbeziehung des<br />
über Karstädt hinausgehenden Mittelbereiches.<br />
44
3.2.4 Pritzwalk – Wittstock/ Dosse<br />
Zum Mittelbereich Pritzwalk – Wittstock/ Dosse gehören das gleichnamige funktions-<br />
teilige Mittelzentrum, die amtsfreien Gemeinden Groß Pankow (Prignitz) und Heiligengrabe<br />
sowie die Ämter Meyenburg und Putlitz - Berge, jeweils bestehend aus fünf<br />
Gemeinden.<br />
Abb. 11: Mittelbereich Pritzwalk – Wittstock/ Dosse<br />
Quelle: Kartengrundlage: www.falk.de, LBV Mittelbereichsprofil Pritzwalk – Wittstock/Dosse , 2010, S.3.<br />
In Pritzwalk leben rund 12.600 Einwohner, in Wittstock/ Dosse rund 15.200. Auf die<br />
übrigen Ämter und Gemeinden des Mittelbereiches entfallen knapp 18.500 Einwoh-<br />
ner (Stand: 2010). Mit fast 1.500 km² ist <strong>der</strong> Mittelbereich des funktionsteiligen Mittelzentrums<br />
flächenmäßig mit Abstand <strong>der</strong> größte <strong>der</strong> acht verglichenen Mittelbereiche<br />
und mehr als doppelt so groß wie <strong>der</strong> entsprechende Durchschnittswert (651 km²).<br />
Verbunden sind die beiden Städte Pritzwalk und Wittstock/ Dosse durch die B 189.<br />
Die Entfernung zwischen ihnen beträgt etwa 23,4 km (vgl. Tab. 4). Das ist <strong>der</strong> größte<br />
Abstand zwischen zwei Polen eines funktionsteiligen Mittelzentrums. Die durch-<br />
schnittliche Entfernung beträgt rund 15,5 km. Die Fahrzeit zwischen Pritzwalk und<br />
Wittstock/ Dosse kann mit dem Pkw in ca. 31 Minuten und in 20 Minuten mit <strong>der</strong> Re-<br />
gionalbahn überbrückt werden.<br />
45
Tab. 8: Bevölkerung Pritzwalk – Wittstock/Dosse<br />
Amtsfreie Gemeinde/ Amt Bevölkerung des Mittelbereichs Fläche (in km²)<br />
Pritzwalk 12.598 (27,2 %) 165,6<br />
Wittstock/Dosse 15.235 (32,9 %) 417,2<br />
Groß Pankow (Prignitz) 4.132 (8,9 %) 248,8<br />
Heiligengrabe 4.693 (10,1 %) 206,3<br />
Meyenburg 4.577 (9,9 %) 209,7<br />
Putlitz-Berge 5.096 (11,0 %) 238,2<br />
Mittelbereich insgesamt 46.331 (100,0 %) 1.485,8<br />
Quelle: eigene Berechnung, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach<br />
amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden; LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010.<br />
Pritzwalk und Wittstock/ Dosse sind mit allen wesentlichen Einrichtungen <strong>der</strong> Infra-<br />
struktur und Daseinsvorsorge ausgestattet. Es sind Oberschulen und Gymnasien,<br />
Kinosäle und Bibliotheken vorhanden und auch die ärztliche Versorgung ist mit diversen<br />
Ärzten, Apotheken und jeweils einem Krankenhaus gegeben. 44<br />
Pritzwalk spielt für den Arbeitsmarkt des Mittelbereiches eine wichtige Rolle. Als ein-<br />
zige Gemeinde kann Pritzwalk gegenüber den an<strong>der</strong>en Gemeinden und Ämtern im<br />
Mittelbereich einen positiven Pendlersaldo aufweisen. Alle an<strong>der</strong>en Orte weisen<br />
durchweg einen negativen Saldo im Mittelbereich auf. Bei den überregionalen Pend-<br />
lerverflechtungen ist <strong>der</strong> Saldo von Pritzwalk zwar negativ, insgesamt betrachtet<br />
bleibt er aber wie schon erwähnt mit einem Überschuss von über 1.100 Pendlern<br />
positiv. 45<br />
44<br />
45<br />
LBV Mittelbereichsprofil Pritzwalk – Wittstock/Dosse, 2010, S. 14.<br />
Vgl. Anhang 5, S. 18.<br />
46
Abb. 12: Pendlerverflechtungen <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereiches<br />
Quelle: eigene Darstellung, nur Verflechtungen auf Pritzwalk und Wittstock/ Dosse bezogen Datengrundlage Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur<br />
für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand: 30.06.2010.<br />
Diese Verflechtungsbeziehungen und die räumlichen Strukturen sind dabei historisch<br />
gewachsen und liegen auch in den relativ vergleichbaren Strukturen <strong>der</strong> beiden Städ-<br />
te Pritzwalk und Wittstock/ Dosse begründet. Beide Städte waren bis zum Jahr 1993<br />
Kreisstädte und in beiden waren nennenswerte Industrieunternehmen ansässig, de-<br />
ren wirtschaftliche Bedeutung nach 1990 aber stark zurückging o<strong>der</strong> die, wie insbe-<br />
son<strong>der</strong>e in Wittstock/ Dosse, stillgelegt wurden. Dadurch entwickelten sich die zwei<br />
Städte zum einen zu gewissen Verkehrsknoten, zum an<strong>der</strong>en mussten sie für ihr Um-<br />
land Versorgungsfunktionen übernehmen. Es wurden darüber hinaus Infrastrukturein-<br />
richtungen vorgehalten , die im Fall von Pritzwalk fast sternenförmig auf die Stadt<br />
ausgerichtet sind. Desweiteren bestanden zwischen den beiden Zentren überdurch-<br />
schnittliche Pendlerverflechtungen. Von daher ist nachvollziehbar, dass schon Mitte<br />
<strong>der</strong> 1990er Jahre erste Kooperationsaktivitäten gestartet wurden und sich mehrere<br />
Städte zum Städtenetz Prignitz zusammenschlossen. Projekte, wie <strong>der</strong> mehrfach er-<br />
schienene Sozialatlas o<strong>der</strong> die jährlichen Sanierungswettbewerbe sind dieser Koope-<br />
ration entsprungen. Nach Aussagen einiger Gesprächspartner sind diese Aktivitäten<br />
im Laufe <strong>der</strong> Jahre aus Mangel an Projekten allerdings etwas „eingeschlafen“. Mit <strong>der</strong><br />
Diskussion und Ausweisung <strong>der</strong> RWK im Land Brandenburg und <strong>der</strong> kurz danach<br />
folgenden Diskussion über die Än<strong>der</strong>ungen im System <strong>der</strong> Zentralen Orte in Brandenburg<br />
wurden die Aktivitäten wie<strong>der</strong> in Gang gesetzt. Bei den Entscheidungsträger<br />
setzte sich die Erkenntnis durch, dass „… die Städte enger zusammenrücken und<br />
gemeinsam mit Heiligengrabe und Meyenburg etwas tun müssen.“ Ein wesentliches<br />
47
Ziel war dabei u. a. auch die Ausweisung als RWK. Der hauptsächliche Motor <strong>der</strong><br />
Entwicklung war dabei Ende 2005 die Gründung <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft Wachs-<br />
tumskern Autobahndreieck Wittstock/ Dosse e. V. mit mittlerweile über 30 Unternehmen<br />
und 5 Kommunen als Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Im Dezember 2007 wurde dann <strong>der</strong> sehr detaillierte Kooperationsvertrag zur Siche-<br />
rung mittelzentraler Funktionen zwischen Pritzwalk und Wittstock/ Dosse unter Einbeziehung<br />
<strong>der</strong> Gemeinden Heiligengrabe und des Amtes Meyenburg geschlossen.<br />
Den Gemeinden Groß Pankow (Prignitz) und dem Amt Putlitz-Berge wurde und wird<br />
eine handlungsfeldbezogene Kooperation, beispielsweise in Form <strong>der</strong> Mitarbeit in<br />
Facharbeitsgruppen angeboten. Diese Form <strong>der</strong> Kooperation wurde nach Aussagen<br />
<strong>der</strong> Gesprächspartner bewusst und von beiden Seiten so gewählt, um die Entschei-<br />
dungsfindung und Projektauswahl nicht zu verhin<strong>der</strong>n bzw. zu komplizert zu gestalten.<br />
Dies ist sicher auch Ausdruck gewisser historisch-mentaler Grenzen, <strong>der</strong> Zuge-<br />
hörigkeit <strong>der</strong> beiden Gebietskörperschaften zu an<strong>der</strong>en Strukturen vor 1993 und teil-<br />
weise auch an<strong>der</strong>en Versorgungsstrukturen danach. Zwischen den vertragsunterzeichnenden<br />
Partnern und insbeson<strong>der</strong>e zwischen Pritzwalk und Wittstock/ Dosse<br />
gab es bereits ein lange gewachsenes Vertrauensverhältnis und gleichgerichtete Ko-<br />
operationsziele. Gleichwohl dürfen diese Rahmenbedingung in <strong>der</strong> praktischen Umsetzung<br />
nicht zu einem Ausschluss von Groß Pankow und dem Amt Putlitz-Berge aus<br />
sämtlichen Aktivitäten und Projekten führen.<br />
Der Vertrag enthält eine begründete Funktionszuordnung sowie Ausführungen über<br />
ein Kooperationsgremium und einen so genannten Kooperationsfonds.<br />
Eine Weiterentwicklung bzw. Konkretisierung des Vertrages wurde im Juni 2011 vor-<br />
genommen, indem ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Bildung einer kommunalen<br />
Arbeitsgemeinschaft „Kooperation Wachstumskern Autobahndreieck<br />
Wittstock/ Dosse“ abgeschlossen wurde. Neben den ehemaligen kommunalen Ver-<br />
tragspartnern ist jetzt auch <strong>der</strong> o. g. private Verein Unterzeichner, um nach Aussagen<br />
<strong>der</strong> Gesprächspartner die Kräfte bei gleichen Zielen zu bündeln. Insofern stellt diese<br />
Situation eine Neuheit in den betrachteten Verträgen dar. Mit diesem Vertrag bzw. <strong>der</strong><br />
Gründung <strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaft sollen v. a. bessere und praktikablere Voraussetzungen<br />
für die Planungen und dann die Umsetzung investiver Maßnahmen für die<br />
städtebauliche Entwicklung im Bereich <strong>der</strong> überörtlichen Daseinsvorsorge geschaf-<br />
fen, wie auch die Akquisition und das Management von För<strong>der</strong>mitteln erleichert werden.<br />
Darüber hinaus haben sich die Partner in Fragen bezüglich <strong>der</strong> Geschäftsfüh-<br />
rung und <strong>der</strong> Einrichtung eines Kooperationsmanagements mit nennenswerten Kapa-<br />
zitäten geeinigt. In den Fachgesprächen wurde explizit darauf verwiesen, dass die<br />
neuen Regelungen bzw. Strukturen die bisherigen Hemmnisse in <strong>der</strong> Zusammenar-<br />
48
eit beseitigen sollen. Dazu gehört u. a. das Vorhandensein eines „Organisators“<br />
sowie verbindlichere Beschlüsse und Regelungen, insberson<strong>der</strong>e bei finanziellen<br />
Verpflichtungen und För<strong>der</strong>mittelprojekten.<br />
Die genannten Verän<strong>der</strong>ungen sind auch Ergebniss <strong>der</strong> konkreten Umsetzung <strong>der</strong><br />
Kooperation. Ein wichtiger Meilenstein in diesem Zusammenhang war zum einen die<br />
Teilnahme des funktionsteiligen Mittelzentrums an einem Wettbewerb des Bundes im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Nationalen Stadtentwicklungspolitik und die anschließende Bestätigung<br />
als Modellprojekt im ExWoSt-Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Ver-<br />
kehr, Bau und Stadtentwicklung. In diesem Modellvorhaben in den Jahren 2008 bis<br />
2009, das durch die Brandenburgische Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung<br />
und Mo<strong>der</strong>nisierung mbH begleitet wurde, wurden unter Einbeziehung einer breiten<br />
Öffentlichkeit die verschiedensten Themen <strong>der</strong> Daseinsvorsorge und Kooperation<br />
betrachtet. 46<br />
Damit ist ein sehr umfassen<strong>der</strong> Datenfundus und eine Abschätzung <strong>der</strong><br />
Kooperationspotenziale vorhanden. Zur kontinuierlichen Umsetzung <strong>der</strong> Konzeption<br />
wird ein Ziel-Maßnahmen-Katalog jährlich fortgeschrieben. Im Katalog für 2010 war<br />
beispielsweise die Einrichtung des Kooperationsmanagements vorgesehen, was mit<br />
<strong>der</strong> Vertragsunterzeichung zur ARGE-Bildung realisiert wurde.<br />
2010 wurde dann ein gemeinsamer Antrag um Aufnahmen in das Bund-Län<strong>der</strong>-<br />
Programm „Kleinere Städte und überörtliche <strong>Zusammenarbeit</strong> (KLS)“ gestellt und<br />
genehmigt. Von daher ist es auch nicht verwun<strong>der</strong>lich, dass aktuell in <strong>der</strong> städtebau-<br />
lichen Zielplanung als Ergänzung o. g. Entwicklungskonzeptes umfangreiche Investitonsmaßnahmen<br />
enthalten sind und zur Umsetzung anstehen. Dazu gehören u. a.<br />
schwerpunktmäßig festgelegte Investititonsmaßnahmen im Bereich Bildung, Kultur<br />
und Soziales für<br />
- die Umnutzung des Bahnhofsgebäudes und den Ausbau <strong>der</strong> Quandt`schen<br />
Tuchfabrik in Pritzwalk<br />
- die Sanierung <strong>der</strong> Grundschule sowie einer Integrationskita in Meyenburg<br />
- die Sanierung <strong>der</strong> Schwimmhalle und die Einrichtung einer Kulturetage in<br />
Wittstock/ Dosse,<br />
- Maßnahmen an <strong>der</strong> Klosterbühne in Heiligengrabe.<br />
46<br />
B.B.S.M. – Brandenburgische Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Mo<strong>der</strong>nisierung mbH: Integrierte<br />
Konzeption zur Wahrnehmung <strong>der</strong> mittelzentralen Funktionen und Aufgaben Pritzwalk – Wittstock/Dosse, Pots-<br />
dam, 2009.<br />
49
Die geplanten Maßnahmen zeugen insgesamt von einer ausgeglichenen und zielfüh-<br />
renden Abstimmung zwischen den Partnern. So wird Wittstock/ Dosse im Interesse<br />
von Meyenburg eine Schule schließen, um die entsprechende Einrichtung in Meyenburg<br />
und insgesamt kurze Schulwege zu sichern. Umgekehrt kommt die Sanierung<br />
<strong>der</strong> Schwimmhalle in Wittstock den Städten und Gemeinden im gesamten Mittelbe-<br />
reich zugute, die sich daher indirekt auch an <strong>der</strong> Sanierung beteiligen. Mit <strong>der</strong> Errichtung<br />
<strong>der</strong> Kulturetage wird <strong>der</strong> lokale Bedarf, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> vielen Vereine, in <strong>der</strong><br />
Stadt gedeckt und kein zusätzliches regionales Konkurrenzangebot geschaffen. Auch<br />
die Projekte in Pritzwalk zielen nicht unerheblich auf den Mittelbereich insgesamt ab<br />
(Beteiligung regionaler Akteure, Attraktivitätserhöhung ÖPNV). Insgesamt wurden von<br />
den Gesprächspartnern die Projekte aus dem KLS-Programm sehr hervorgehoben,<br />
mit denen „Politik und Kooperation im Mittelzentrum erlebbar wird.“ Lei<strong>der</strong> gilt dies<br />
bisher nicht für Groß Pankow und das Amt Putlitz-Berge, die als „mittelzentraler Versorgungsbereich,<br />
außerhalb des Kooperationsverbundes“ 47<br />
nicht unmittelbar an die-<br />
sen Kooperationsaktivitäten partizipieren.<br />
Die skizzierte Abstimmung von Angeboten <strong>der</strong> Daseinsvorsorge wurde auch in <strong>der</strong><br />
Vergangenheit schon praktiziert, allerdings nicht mit konkreten Investitonsprojekten<br />
ausgefüllt. So gab es u. a. Abstimmungen bei <strong>der</strong> Bä<strong>der</strong>planung und <strong>der</strong> Freibadnutzung<br />
in Pritzwalk bzw. <strong>der</strong> entsprechenden Busanbindung, <strong>der</strong> Abstimmung <strong>der</strong> Ein-<br />
zelhandelsplanung und im Kultur- und Veranstaltungsbereich. Intensiv ist die Zu-<br />
sammenarbeit auch in <strong>der</strong> Tourismuswerbung und bei Logistikprojekten. Über den<br />
Verein Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/ Dosse werden sehr intensiv und<br />
öffentlichkeitswirksam Themen wie die Fachkräftesicherung o<strong>der</strong> das Standortmarke-<br />
ting vorangetrieben. Im Bereich <strong>der</strong> Verwaltungskooperation gibt es aktuell Überlegungen<br />
die standesamtliche <strong>Zusammenarbeit</strong> zu intensivieren und auch im Energie-<br />
bereich ist ein neues Kooperationsprojekt geplant.<br />
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das funktionsteilige Mittelzentrum Pritzwalk –<br />
Wittstock/ Dosse die Evaluationskriterien erfüllt. Interessant ist auch aus Sicht <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en funktionsteiligen Mittelzentren, wie sich das neue Kooperationsmanagement<br />
und die <strong>Zusammenarbeit</strong> mit privaten Partnern in einer Arbeitsgemeinschaft bewährt<br />
und ob die beteiligten Unternehmen – wie bisher – als „Treiber <strong>der</strong> Kooperation“ auf-<br />
treten. Nach eigenen Einschätzungen sehen die Entscheidungsträger vor Ort durch-<br />
aus noch Potenziale in <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> im Bereich <strong>der</strong> Daseinsvorsorge, wobei<br />
bei einigen Aufgaben <strong>der</strong> „Druck“ aktuell nicht mehr so groß ist und auch <strong>der</strong> Land-<br />
47<br />
KLS Pritzwalk-Wittstock/ Dosse: Städtebauliche Zielplanung bzw. Ergänzung des überörtlichen Entwicklungskon-<br />
zeptes (Stand 28.11.2011), Karte S.<br />
50
kreis in größerer Verantwortung steht. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> im Mittelbereich muss mit<br />
allen Ämtern und Gemeinden realisiert werden. Hier gilt es auch gegen eventuell<br />
längfristig wirkende „(Raum-)Wi<strong>der</strong>stände“ anzugehen und entsprechende Kooperationsprojekte<br />
zu entwickeln.<br />
51
3.2.5 Schönefeld – Wildau<br />
Die beiden Gemeinden Schönefeld und Wildau bilden den gleichnamigen Mittelbe-<br />
reich unmittelbar südlichöstlich von Berlin. Zum Mittelbereich gehören darüber hinaus<br />
die amtsfreien Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf.<br />
Abb. 13: Mittelbereich Schönefeld – Wildau<br />
Quelle: Kartengrundlage: www.falk.de, LBV Mittelbereichsprofil Schönefeld - Wildau, 2010, S. 2.<br />
Die größte Gemeinde im Mittelbereich ist Schönefeld mit rund 13.300 Einwohnern,<br />
Wildau als Teil des funktionsteiligen Mittelzentrums besitzt knapp 9.900 Einwohner<br />
und ist damit sogar noch etwas einwohnerschwächer als Zeuthen (Stand: 2010). Die<br />
an<strong>der</strong>en Gemeinden des Mittelbereichs ohne Schönefeld und Wildau zählen etwa<br />
24.300 Einwohner und haben damit <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereiches einen etwas höheren<br />
Bevölkerungsanteil als die beiden genannten Gemeinden. Der Mittelbereich weist<br />
insgesamt nur eine Flächenausdehnung von rund 115 km² auf. Er ist damit <strong>der</strong> mit<br />
weitem Abstand kleinste Mittelbereich <strong>der</strong> acht funktionsteiligen Mittelbereiche. Mit<br />
dieser geringen Fläche bei einer gleichzeitig überdurchschnittlich hohen Bevölke-<br />
52
ungszahl kommt <strong>der</strong> Mittelbereich auf die ebenfalls mit Abstand höchste Bevölke-<br />
rungsdichte von 412 Einwohnern pro km². Allein in diesen wenigen Strukturangaben<br />
werden schon die Beson<strong>der</strong>heiten dieses funktionsteiligen Mittelzentrums durch seine<br />
Randlage zu Berlin und seine räumliche Struktur deutlich.<br />
Tab. 9: Bevölkerung Schönefeld – Wildau<br />
Amtsfreie Gemeinde/ Amt Bevölkerung des Mittelbereichs Fläche (in km²)<br />
Schönefeld 13.256 (27,9 %) 81,6<br />
Wildau 9.898 (20,9 %) 9,1<br />
Eichwalde 6.205 (13,1 %) 2,8<br />
Schulzendorf 7.706 (16,2 %) 9,1<br />
Zeuthen 10.400 (21,9 %) 12,7<br />
Mittelbereich insgesamt 47.465 (100,0 %) 115,3<br />
Quelle: eigene Berechnung, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach<br />
amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden; LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010.<br />
Die Gemeinden Schönefeld und Wildau sind über die A 113, bzw. A 10 sowie diverse<br />
Landes- und Kreisstraßen miteinan<strong>der</strong> verbunden. Die kürzeste Entfernung <strong>der</strong> bei-<br />
den Zentren liegt bei gut 16 km, wofür die Fahrtzeit mit einem Pkw 15-20 Minuten<br />
beträgt. Zudem besitzen beide Gemeinden einen Anschluss an die S-Bahn Berlin,<br />
sind aber nur über Umsteigeverbindungen miteinan<strong>der</strong> verknüpft.<br />
Die Einrichtungen <strong>der</strong> Infrastruktur und Daseinsvorsorge verteilen sich im Mittelbe-<br />
reich Schönefeld – Wildau, im Gegensatz zu den übrigen betrachteten fuktionsteiligen<br />
Mittelbereichen, gleichmäßiger auf alle Gemeinden. Auffallend ist jedoch, dass in<br />
<strong>der</strong> Gemeinde Schönefeld <strong>der</strong> Ausstattungsgrad unterdurchschnittlich ist. In den an-<br />
<strong>der</strong>en Gemeinden finden sich die sonst üblichen Ausstattungen an Schulen, Bibliotheken.<br />
Wildau verfügt zudem über mehrere Kinosäle. 48<br />
Die Pendlerverflechtungen <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereiches sind zwar deutlich auf<br />
Schönefeld ausgerichtet, ansonsten aber auf einem geringen Niveau. Schönefeld<br />
verzeichnet einen Pendlerüberschuss aus dem Mitelbereich von knapp 500 und<br />
Wildau von gut 140 Personen. Die an<strong>der</strong>en drei Gemeinden weisen gegenüber dem<br />
Mittelbereich jeweils einen geringen negativen Pendlersaldo auf. Vollkommen an<strong>der</strong>s<br />
sieht die Situation bei den überregionalen Pendlerverflechtungen aus. Hier beträgt<br />
<strong>der</strong> Überschuss von Schönefeld über 7.400 und von Wildau gut 950 Personen. Die<br />
48<br />
LBV Mittelbereichsprofil Schönefeld - Wildau, 2010, S.14.<br />
53
an<strong>der</strong>en drei Gemeinden haben einen negativen Pendlersaldo zwischen -2.308 und -<br />
1.088 Personen. 49<br />
Abb. 14: Pendlerverflechtungen <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereiches<br />
Quelle: eigene Darstellung, nur Verflechtungen auf Schönefeld und Wildau einbezogen, Datengrundlage: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur<br />
für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort,, Stand: 30.06.2010.<br />
Diese kurz beschriebenen Verflechtungsbeziehungen sind zum einen durch die Ar-<br />
beitsmarktbeziehungen mit Berlin und zum an<strong>der</strong>en und in noch viel größerem Ausmaß<br />
durch den bestehenden Flughafen Berlin-Schönefeld bzw. den voraussichtlich<br />
im März 2013 eröffnenden Flughafen Berlin-Brandenburg geprägt. Für dieses Projekt<br />
und die Entwicklung <strong>der</strong> beiden Gemeinden ergibt die Festlegung als funktionsteiliges<br />
Mittelzentrum – nach Auffassung <strong>der</strong> Gesprächspartner – weitere Entwick-<br />
lungsmöglichkeiten und planerische Freiheiten. Sie ist damit auch ein gewisser Vor-<br />
griff auf zukünftige Entwicklungsanfor<strong>der</strong>ungen. Im Landesentwicklungsplan I Brandenburg<br />
von 1995 waren noch Wildau und Königs Wusterhausen als Mittelzentrum in<br />
Funktionsteilung festgelegt . Jetzt ist Königs Wusterhausen alleiniges Mittelzentrum<br />
für einen eigenständigen Mittelbereich südlich <strong>der</strong> A 10 und Schönefeld gemeinsam<br />
mit Wildau ein funktionsteiliges Mittelzentrum für einen eigenständigen Mittelbereich<br />
nördlich <strong>der</strong> A 10. Die drei Zentralen Orte arbeiten im Rahmen des RWK „Schönfel<strong>der</strong><br />
Kreuz“ seit 2005 zusammen. Der RWK spielt dabei offensichtlich eine große Rolle<br />
und bildet auch die „Klammer für das funktionsteilige Mittelzentrum“.<br />
49<br />
Vgl. Anhang 5, S. 21.<br />
54
Die Kooperationsvereinbarung zwischen <strong>der</strong> Gemeinde Schönefeld und <strong>der</strong> Ge-<br />
meinde Wildau als gemeinsames Mittelzentrum in Funktionsteilung wurde am 19. Juli<br />
2007 geschlossen, womit die For<strong>der</strong>ung des LEP B-B nach einer vertraglichen Regelung<br />
<strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> erfüllt ist. In dem sehr knapp gehaltenen Vertrag werden<br />
vor allem hinsichtlich eines festen Kooperationsgremiums, <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> bei<br />
Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben sowie <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den an<strong>der</strong>en<br />
Gemeinden des Mittelbereichs die Prüfung entsprechen<strong>der</strong> Bedarfe und Möglich-<br />
keiten vereinbart. Explizit im Vertrag festgehalten ist, dass mindestens einmal pro<br />
Jahr gemeinsame Abstimmungen zwischen den Bürgermeistern <strong>der</strong> Gemeinden zur<br />
Weiterentwicklung des funktionsteiligen Mittelzentrums, wie auch zum Stand <strong>der</strong> Zu-<br />
sammenarbeit im gemeinsamen Mittelbereich stattfinden.<br />
Wie <strong>der</strong> Vertrag selbst ist auch die unmittelbare Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation durch<br />
ein sehr pragmatisches Vorgehen geprägt. Nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner<br />
wurden die vertraglich vereinbarten Prüfungen vorgenommen, daraus ergaben sich<br />
allerdings keine Handlungsbedarfe. So läuft die Abstimmung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
weitgehend im Rahmen des RWK und darüber hinaus mit den an<strong>der</strong>en Gemeinden in<br />
vielfältigen Verbänden und Gremien (Dialogforum Airport Berlin Brandenburg, BADC,<br />
Nachbarschaftsforum usw.). Auch im Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband<br />
sowie in <strong>der</strong> Dahme-Nuthe WasserAbwasserbetriebsgesellschaft mbH, die für<br />
die Entwicklung <strong>der</strong> Region eine wichtige Funktion übernehmen, erfolgen wichtige<br />
Abstimmungen.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Infrastruktur und Daseinsvorsorge ist insbeson<strong>der</strong>e für Schönefeld ein<br />
wachsen<strong>der</strong> Nachholbedarf zu decken, <strong>der</strong> durch Einrichtungen im Mittelbereich vor-<br />
erst nicht gedeckt werden kann. In das neu errichtete Schwimmbad in Schönefeld<br />
kommen dabei nicht nur ausschließlich Nutzer aus Schönefeld, son<strong>der</strong>n ein Großteil<br />
<strong>der</strong> Nachfrager stammen auch aus Berlin. Bei <strong>der</strong> geplanten Erweiterung <strong>der</strong> Han-<br />
delsstrukturen in Schönefeld wurden die Angebote in Wildau und dem Mittelbereich<br />
mit betrachtet, auch hier wird aber eher die lokale und regionale Nachfrage befriedigt.<br />
Diese Beispiele ließen sich fortsetzen, wobei von den Gesprächspartnern auch da-<br />
rauf hingewiesen wurde, dass absehbar nach <strong>der</strong> Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens<br />
die Abstimmungsbedarfe sicherlich noch zunehmen werden.<br />
Die <strong>Zusammenarbeit</strong> im Bereich Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung und Standortentwicklung läuft<br />
ebenfalls weitgehend im Rahmen des RWK. Hier sind auch Schwerpunkte bzw. eine<br />
Funktionsteilung zwischen den beiden Gemeinden und <strong>der</strong> Stadt Königs Wusterhau-<br />
sen vereinbart und entsprechende Finanzierungsmodalitäten für die Umsetzung <strong>der</strong><br />
Projekte geschaffen worden. Hervorzuheben ist hier beispielsweise die <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
mit <strong>der</strong> Technischen Hochschule Wildau (FH).<br />
55
Außerdem gibt es weitere nennenswerte Kooperationsprojekte zwischen den beiden<br />
Gemeinden und ausgewählten Gemeinden, teilweise unter Beteiligung des Landkrei-<br />
se. Dies betrifft beispielsweise die Radwegeplanung, die Verkehrsentwicklung, eine<br />
Studie zur Lärmentwicklung, den Tourismus, die Kita-Planung sowie den gemeinsam<br />
von Zeuthen, Eichwalde, Wildau, Schulzendorf und Königs Wusterhausen betriebe-<br />
nen Veranstaltungskalen<strong>der</strong> „Kulturwerk“.<br />
Festzuhalten bleibt, dass das funktionsteilige Mittelzentrum Schönefeld – Wildau die<br />
Evaluationskriterien erfüllt. Inbeson<strong>der</strong>e im Rahmen des RWK wird die Zusammenar-<br />
beit „gelebt“. Von den Entscheidungsträgern sollten die vertraglichen Regelungen<br />
zum funktionsteiligen Mittelzentrum und vielleicht auch die Einschätzungen zu den<br />
Kooperationsbedarfen im gesamten Mittelbereich für die kurz- und mittelfristige Pla-<br />
nungsperspektive eventuell noch einmal überprüft werden. Mit <strong>der</strong> Ausweisung des<br />
funktionsteiligen Mittelzentrums Schönefeld – Wildau wurde den Gemeinden u. a.<br />
auch ein Instrument an die Hand gegeben, um die sich abzeichnenden herausgeho-<br />
benen Entwicklungen kooperativ zu gestalten. Vor diesem Hintergrund nimmt dieses<br />
funktionsteilige Mittelzentrum durchaus eine Son<strong>der</strong>stellung ein und ist nur bedingt<br />
mit den funktionsteiligen Mittelzentren in periphereren Landesteilen zu vergleichen.<br />
56
3.2.6 Senftenberg – Großräschen<br />
Das funktionsteilige Mittelzentrum Senftenberg – Großräschen besteht aus <strong>der</strong> Kreis-<br />
stadt Senftenberg und <strong>der</strong> Stadt Großräschen. Zum entsprechenden Mittelbereich<br />
zählen darüber hinaus die Stadt Schipkau und das Amt Altdöbern, welches aus fünf<br />
Gemeinden besteht. Senftenberg und Großräschen bilden gemeinsam mit dem funk-<br />
tionsteiligen Mittelzentrum Lauchhammer – Schwarzheide wie auch mit Finsterwalde<br />
den RWK Westlausitz.<br />
Abb. 15: Mittelbereich Senftenberg – Großräschen<br />
Quelle: Kartengrundlage: www.falk.de, LBV Mittelbereichsprofil Senftenberg - Großräschen, 2010, S. 3.<br />
57
Mit über 26.500 Einwohnern stellt Senftenberg mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Einwohner des<br />
Mittelbereiches und ist gleichzeitig Kreisstadt des Landkreises Oberspreewald - Lau-<br />
sitz. Auch im Vergleich <strong>der</strong> 16 Einzelstädte bzw. -gemeinden <strong>der</strong> funktionsteiligen<br />
Mittelzentren ist die Stadt Senftenberg am einwohnerstärksten. Großräschen zählt<br />
rund 10.300 Einwohner. Im Amt Altdöbern und in <strong>der</strong> Gemeinde Schipkau wohnen<br />
13.600 Einwohner (vgl. Tab. 10).<br />
Tab. 10: Bevölkerung Senftenberg – Großräschen<br />
Amtsfreie Gemeinde/ Amt Bevölkerung des Mittelbereichs Fläche (in km²)<br />
Senftenberg 26.530 (52,7 %) 127,0<br />
Großräschen 10.262 (20,4 %) 81,3<br />
Altdöbern 6.203 (12,3 %) 198,1<br />
Schipkau 7.357 (14,6 %) 168,7<br />
Mittelbereich insgesamt 50.352 (100,0 %) 475,1<br />
Quelle: eigene Berechnung, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach<br />
amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden; LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010.<br />
Senftenberg und Großräschen sind über die B 96 und B 169 sowie über die Bahn<br />
miteinan<strong>der</strong> verbunden, die Entfernung beträgt etwa 13 km. Mit dem Pkw liegt die<br />
Fahrtzeit zwischen den beiden Verwaltungssitzen bei rund 26 Minuten, die Zugver-<br />
bindung dauert knapp 12 Minuten. Mit <strong>der</strong> Erschließung des Tagebaus Großräschen<br />
Süd Ende <strong>der</strong> 1980er Jahre entfiel auch die direkte Straßenverbindung, die damals<br />
nur 6 km betrug.<br />
Senftenberg ist mit allen notwendigen infrastrukturellen Angeboten ausgestattet und<br />
war im vorangegangenen LEP I - Brandenburg als Mittelzentrum festgelegt. Senftenberg<br />
ist Sitz <strong>der</strong> Fachhochschule Lausitz. Es existieren u. a. zwei Oberschulen, ein<br />
Gymnasium, eine För<strong>der</strong>schule, ein Krankenhaus, eine Vielzahl von Arztpraxen und<br />
Kreditinstituten, ein Theater, ein Erlebnisbad, eine Sport- und Veranstaltungshalle<br />
sowie Kinosäle. 50<br />
In Großräschen ist im Versorgungsbereich beispielsweise eine<br />
Oberschule, eine höhere Anzahl an Ärzten sowie ein regional ausgerichteter Veran-<br />
staltungssaal vorhanden. Das Gymnasium in Großräschen wurde 2007 geschlossen.<br />
Die Pendlerverflechtungen im Mittelbreich sind eindeutig auf Senftenberg ausgerich-<br />
tet (vgl. Abb. 16). Aus dem Mittelbereich ergibt sich ein positiver Pendlersaldo von<br />
920 Pendlern. Großräschen weist einen negativen Saldo von -72, Altdöbern von -275<br />
und Schipkau von -573 auf. Rechnet man die überregionalen Pendler hinzu, ergibt<br />
50<br />
LBV Mittelbereichsprofil Senftenberg - Großräschen, 2010, S. 14.<br />
58
sich für Senftenberg ein Pendlerüberschuss von 2.800 und für die an<strong>der</strong>en Gebietskörperschaften<br />
vervielfachen sich die negativen Salden deutlich. 51<br />
Abb. 16: Pendlerverflechtungen <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereiches<br />
Quelle: eigene Darstellung, nur Verflechtungen von Senftenberg und Großräschen einbezogen, Datengrundlage: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur<br />
für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort,, Stand: 30.06.2010.<br />
Nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner existieren historische Beziehungen zwischen<br />
Senftenberg und Großräschen, die u. a. aus <strong>der</strong> Siedlungsentwicklung und auch aus<br />
<strong>der</strong> wirtschaftlichen Entwicklung, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Bergbautradition, entspringen. So<br />
ergaben sich aus dem „Wechselspiel“ von Senftenberg als Verwaltungs- und Dienst-<br />
leistungstandort und Großräschen als Industrie- und Bergbaustandort bereits in den<br />
1930er Jahren starke Pendlerbeziehungen. Durch die Abbaggerungen Ende <strong>der</strong><br />
1980er und den Strukturumbrüchen in den 1990er Jahren verän<strong>der</strong>ten sich die Be-<br />
ziehungen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu Ungunsten von Großräschen.<br />
Senftenberg konnte seine traditionellen Umlandfunktionen dagegen beibehalten und<br />
auch die Verkehrsströme waren und sind noch immer auf Senftenberg ausgerichtet.<br />
Der Mittelbereich bildet einen „gemeinsamen Erfahrungsraum“, <strong>der</strong> auch heute noch<br />
in <strong>der</strong> gleichen Tageszeitung bzw. im Regionalfernsehen zum Ausdruck kommt. Diese<br />
51<br />
Vgl. Anhang 5, S.24.<br />
59
Faktoren haben übrigens einen nicht zu unterschätzenden Einfluss bei <strong>der</strong> öffentli-<br />
chen Wahrnehmung eines funktionsteiligen Mittelzentrums.<br />
Von den Gesprächspartnern in Senftenberg wurde vor diesem kurz geschil<strong>der</strong>ten<br />
Hintergrund angemerkt, dass die Ausweisung als funktionsteiliges Mittelzentrum als<br />
ein „Zugeständnis an Großräschen“ gewertet wurde und in Senftenberg auf wenig<br />
Verständnis stieß.<br />
Ein unterzeichneter Kooperationsvertrag zwischen Senftenberg und Großräschen<br />
lag im April 2012 noch nicht vor. Damit ist das funktionsteilige Mittelzentrum Senften-<br />
berg – Großräschen das einzige <strong>der</strong> acht funktionsteiligen Mittelzentren, das dieses<br />
formelle Evaluationskriterium nicht erfüllt. Nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner<br />
existiert mittlerweile ein entsprechen<strong>der</strong> Vertragsentwurf, <strong>der</strong> zur Zeit final verhandelt<br />
wird. Eine Einigung wurde zur Form und <strong>der</strong> Besetzung eines Koordinierungsgremiums<br />
erzielt. Fragen <strong>der</strong> Finanzierungsregelungen, insbeson<strong>der</strong>e zu mittelzentralen<br />
Einrichtungen und <strong>der</strong> Funktionszuordnung, sind noch offen und stellen nach Aussa-<br />
ge des Senftenberger Bürgermeisters einen entscheidenden Punkt in <strong>der</strong> Abstimmung<br />
dar.<br />
In <strong>der</strong> praktischen Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation zwischen Senftenberg und Groß-<br />
räschen gibt es gleichwohl vielfältige Beispiele. Beson<strong>der</strong>s zu erwähnen ist dabei die<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> im Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg (LSB), mit dem<br />
die Region die „höchste Form <strong>der</strong> Kooperation“ gewählt hat. Im Zweckverband arbei-<br />
ten Senftenberg, Großräschen, die Gemeinde Altdöbern, die Gemeinde Neu-Seeland<br />
und <strong>der</strong> Landkreis an <strong>der</strong> vor allem touristischen Entwicklung <strong>der</strong> seenahen Flächen<br />
im Verbandsgebiet. In Senftenberg ist davon rund ein Drittel <strong>der</strong> Stadtfläche betroffen.<br />
Die Entwicklung und die Arbeit des Zweckverbandes sind regelmäßig Thema von<br />
Abstimmungen und Diskussionen in den Stadtverordnetenversammlungen. Ihm ob-<br />
liegen Aufgaben <strong>der</strong> Rahmen- und Bauleitplanung, <strong>der</strong> Projektplanung und -<br />
umsetzung sowie <strong>der</strong> Betrieb öffentlicher Infrastruktur, wie beispielsweise Radwege.<br />
Die entsprechenden Flächennutzungspläne werden über den Verband abgestimmt, in<br />
Teilen wird das Planungsrecht bzw. die Planungshoheit an den Zweckverband abge-<br />
geben. Allein dies zeigt schon die Bedeutung und auch die Notwendigkeit <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>,<br />
dies umso mehr, da sich aktuell <strong>der</strong> Landkreis aus <strong>der</strong> Bewirtschaf-<br />
tung <strong>der</strong> Infrastrukturen zurückziehen möchte. Die Entwicklung des Seenlandes hat<br />
hohe Bedeutung für die Gesamtregion, für Brandenburg und den Freistaat Sachsen<br />
und mündete unlängst in <strong>der</strong> Bildung einer grenzüberschreitenden Reiseregion Lau-<br />
sitzer Seenland mit einem entsprechenden neuen Tourismusverband, in dem auch<br />
die Städte Senftenberg und Großräschen Verantwortung übernehmen.<br />
60
Ein weiteres Beispiel einer zwangsläufigen und gut funktionierenden Kooperation ist<br />
die <strong>Zusammenarbeit</strong> in <strong>der</strong> KWG kommunalen Wohnungsgesellschaft Senftenberg<br />
mbH bei Fragen des Stadtumbaus und <strong>der</strong> zu tätigenden Investitionen. Hauptgesellschafter<br />
sind Senftenberg und Großräschen, die auch die meisten Wohnungen des<br />
Gesamtbestandes aufweisen. Daneben sind aber auch Schipkau, Schwarzheide und<br />
Ortrand in <strong>der</strong> Gesellschaft vertreten.<br />
Eine vergleichbare <strong>Zusammenarbeit</strong> gibt es im gemeinsamen Wasser- und Abwas-<br />
serverband, in dem die Städte Senftenberg, Lauchhammer, Schwarzheide, Groß-<br />
räschen, die Gemeinde Schipkau und die Ämter Ruhland und Ortrand vertreten sind.<br />
Auf das gemeinsam mit Schipkau und den Städten des RWK Westlausitz Lauch-<br />
hammer und Schwarzheide (gleichzeitig ebenfalls funktionsteiliges Mittelzentrum)<br />
betriebene Obdachlosenheim wurde bereits hingewiesen. Hier zeigt sich wie<strong>der</strong>um<br />
die „größere Klammer des RWK“. Über den RWK laufen darüber hinaus viele Aktivä-<br />
ten <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung und Standortvermarktung, die hier nicht aufgeführt wer-<br />
den sollen.<br />
Zu nennen sind des Weiteren ausgewählte Aktivitäten im Mittelbereich, beispielswei-<br />
se mit Schipkau bei <strong>der</strong> Entwicklung des EuroSpeedway Lausitz, die Gewerbeflä-<br />
chenentwicklung für die Nutzung erneuerbarer Energien mit Großräschen, Schipkau,<br />
und Altdöbern o<strong>der</strong> die Entwicklung <strong>der</strong> Einzelhandelsstrukturen. Bei letzterer haben<br />
die beiden Städte mit <strong>der</strong> Erarbeitung ihrer Einzelhandelskonzeptionen die gleiche<br />
Firma beauftragt und die Berücksichtugng <strong>der</strong> Strukturen <strong>der</strong> jeweils an<strong>der</strong>en Stadt<br />
vereinbart.<br />
Großräschen ist Mitglied in den verschiedensten För<strong>der</strong>vereinen <strong>der</strong> Stadt Senften-<br />
berg, wie beispielsweise des Theaters, <strong>der</strong> Hochschule Lausitz o<strong>der</strong> des Gymnasiums<br />
in Senftenberg. Als Beispiel <strong>der</strong> Verwaltungszusammenarbeit <strong>der</strong> beiden Städte<br />
sei abschließend auf entsprechende Vereinbarungen zur gemeinsamen Wahrneh-<br />
mung <strong>der</strong> Aufgaben <strong>der</strong> Rechnungsprüfung verwiesen.<br />
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das funktionsteilige Mittelzentrum Senf-<br />
tenberg – Großräschen das Evaluationskriterium einer Vereinbarung zwischen den<br />
Partnern formell noch nicht erfüllt. Gleichwohl gibt es eine vielfältige <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
im Rahmen des RWK Westlausitz und darüber hinaus bilateral, wie auch mit dem<br />
Mittelbereich in den verschiedensten Bereichen und Gremien. Beson<strong>der</strong>s herausge-<br />
hoben ist dabei die weitgehende <strong>Zusammenarbeit</strong> im Zweckverband Lausitzer Seenland<br />
Brandenburg.<br />
61
3.2.7 Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz<br />
Das funktionsteilige Mittelzentrum wird aus den Städten Wer<strong>der</strong> (Havel) und Beelitz<br />
gebildet. Hinzu kommen die amtsfreien Gemeinden Groß Kreutz, Seddiner See und<br />
Schwielowsee. Mit einer Flächenausdehnung von knapp 480 km² liegt das funktions-<br />
teilige Mittelzentrum unter dem Durchschnitt <strong>der</strong> betrachteten Mittelzentren und ist<br />
mit Senftenberg – Großräschen vergleichbar. Seine Struktur und Entwicklung wird<br />
maßgeblich durch die Anbindung an die Landeshauptstadt Potsdam, die Nähe zu<br />
Berlin und auch das vorhandene Autobahnnetz geprägt.<br />
Abb. 17: Mittelbereich Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz<br />
Quelle: Kartengrundlage: www.falk.de, LBV Mittelbereichsprofil Wer<strong>der</strong> (Havel) - Beelitz, 2010, S. 3.<br />
Diese Lage an den (verschiedenen) Achsen bzw. Autobahnen hat in <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
auch eher die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong> zu ausgewählten Themen im<br />
62
nördlichen Teil des Mittelbereiches zwischen Wer<strong>der</strong> (Havel), Groß Kreutz und<br />
Schwielowsee und im südlichen Teil zwischen Beelitz und Seddiner See beför<strong>der</strong>t. 52<br />
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Wer<strong>der</strong> (Havel) und Beelitz durch die entsprechenden<br />
Obst/ Gemüse- bzw. Spargelanbaugebiete überregional bekannt sind.<br />
Wer<strong>der</strong> (Havel) ist mit rund 23.000 Einwohnern die größte Stadt im Mittelbereich, Be-<br />
elitz folgt mit 11.900 Einwohnern. Auf die drei übrigen Gemeinden des Mittelbereiches<br />
entfallen etwa 22.600 Einwohner. Insgesamt ist das funktionsteilige Mittelzent-<br />
rum mit knapp 58.000 Einwohnern das größte <strong>der</strong> betrachteten funktionsteiligen Mit-<br />
telzentren (vgl. Tab. 11).<br />
Tab. 11: Bevölkerung Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz<br />
Amtsfreie Gemeinde/ Amt Bevölkerung des Mittelbereichs Fläche (in km²)<br />
Wer<strong>der</strong> (Havel) 23.017 (40,0 %) 116,0<br />
Beelitz 11.900 (20,7 %) 180,1<br />
Groß Kreutz 8.197 (14,3 %) 99,0<br />
Schwielowsee 10.187 (17,7 %) 58,2<br />
Seddiner See 4.198 (7,3 %) 24,0<br />
Mittelbereich insgesamt 57.499 (100,0 %) 477,3<br />
Quelle: eigene Berechnung, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach<br />
amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden; LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010.<br />
Verbunden sind die Mittelzentren durch die A 9 und A 10 sowie diverse Landkreis-<br />
straßen. Die Entfernung vom Verwaltungssitz Wer<strong>der</strong> (Havel) zum Verwaltungssitz in<br />
Beelitz beläuft sich auf knapp 22 km, die Fahrtzeit beträgt knapp 30 Minuten. Die<br />
Entfernung <strong>der</strong> beiden Städte liegt damit über dem Durchschnitt <strong>der</strong> betrachteten<br />
Mittelzentren und nur wenig unter <strong>der</strong> längsten Entfernung im funktionsteiligen Mittelzentrum<br />
Pritzwalk – Wittstock/ Dosse.<br />
Die funktionsteiligen zentralen Orte Wer<strong>der</strong> (Havel) und Beelitz besitzen beide die<br />
wesentlichen infrastrukturelle Versorgungseinrichtungen, insbeson<strong>der</strong>e im Bildungsbereich<br />
(Oberschulen und Gymnasien). Beelitz verfügt über ein Krankenhaus, Wer<strong>der</strong><br />
über ein Kino sowie ein Theater. 53<br />
52<br />
53<br />
Vgl. dazu LPG Landesweite Planungsgesellschaft mbH: Entwicklungskonzeption für den Mittelbereich Wer<strong>der</strong><br />
(H.) – Beelitz, Berlin, 2011, S. 8.<br />
LBV Mittelbereichsprofil Zehdenick - Gransee, 2010, S. 14.<br />
63
Die Pendlerverflechtungen im Mittelbereich sind insgesamt sehr ausgeglichen und<br />
insbeson<strong>der</strong>e zwischen Wer<strong>der</strong> (Havel) und Beelitz auf einem vergleichsweise nied-<br />
rigen Niveau (von Wer<strong>der</strong> (Havel) nach Beelitz 107 und umgekehrt 105 Pendler).<br />
Gegenüber dem Mittelbereich besitzt Wer<strong>der</strong> (Havel) einen leichten Einpendlerüber-<br />
schuss von 147 und Beelitz einen leicht negativen Saldo von -47. Diese Relationen<br />
än<strong>der</strong>n sich aber bei <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> überregionalen Pendlerverflechtungen, die<br />
sich aus <strong>der</strong> Lage zu Potsdam und Berlin ergeben. In den überregionalen Verflech-<br />
tungen weist Wer<strong>der</strong> (Havel) einen negativen Saldo von fast -4.120 und Beelitz im-<br />
merhin noch von fast -1.470 Pendlern auf. Sowohl Groß Kreutz als auch Schwielowsee<br />
haben einen überregionalen Auspendlerüberschuss von über -2.000, allein die<br />
Gemeinde Seddiner See weist eine leichten überregionalen Pendlerüberschuss von<br />
gut 300 auf. 54<br />
Abb. 18: Pendlerverflechtungen <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereiches<br />
Quelle: eigene Darstellung, nur Verflechtungen auf Wer<strong>der</strong> (Havel) und Beelitz einbezogen, Datengrundlage: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur<br />
für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort,, Stand: 30.06.2010.<br />
54<br />
Vgl. Anhang 5, S. 26.<br />
64
Die dargestellten Pendlerverflechtungen zwischen Wer<strong>der</strong> (Havel) und Beelitz spie-<br />
geln sehr realistisch die Beziehungen in <strong>der</strong> Vergangenheit wi<strong>der</strong>. Es gab zwar auch<br />
in <strong>der</strong> Vergangenheit immer wie<strong>der</strong> Berührungspunkte und eine indirekte <strong>Zusammenarbeit</strong>,<br />
beispielsweise durch die <strong>Zusammenarbeit</strong> in <strong>der</strong> AG „Städte mit histori-<br />
schem Stadtkern“, ansonsten „hat man sich aber auf die eigene Entwicklung kon-<br />
zentriert.“ Dabei spielt sicherlich die Entfernung <strong>der</strong> beiden Städte, ihre räumliche<br />
Ausrichtung (Wer<strong>der</strong> (Havel) ist stark auf Potsdam orientiert) sowie gewisse Barrieren<br />
in <strong>der</strong> Erreichbarkeit eine Rolle. Darüber hinaus ergab sich nach Aussagen <strong>der</strong> Ge-<br />
sprächspartner bisher auch kein übergroßer „Druck“ <strong>der</strong> Anpassung <strong>der</strong> Infrastrukturen,<br />
wie das in an<strong>der</strong>en funktionsteiligen Mittelzentren im weiteren Metropolenraum<br />
<strong>der</strong> Fall ist.<br />
Die Ausweisung als funktionsteiliges Mittelzentrum wurde von Wer<strong>der</strong>aner Seite auch<br />
eher pragmatisch zur Kenntnis genommen („müssen die Ausgestaltung vernünftig<br />
hinbekommen“), nachdem man sich, als bis dahin ausgewiesenes Grundzentrum mit<br />
Teilfunktionen eines Mittelzentrums, vielleicht noch mehr erhofft hatte.<br />
Der Kooperationsvertrag zwischen Wer<strong>der</strong> (Havel) und Beelitz wurde am 23. Feb-<br />
ruar 2010, und damit im Vergleich zu den meisten an<strong>der</strong>en funktionsteiligen Mittel-<br />
zentren, relativ spät abgeschlossen. In dem Vertrag wurden bis auf die Einrichtung<br />
von <strong>interkommunalen</strong> Arbeitsgruppen aus <strong>der</strong> Verwaltung und einem zu bildenden<br />
Kooperationsmanagement keine Vereinbarungen zu gemeindeübergreifenden Gre-<br />
mien getroffen. Hier wurde in den Gesprächen darauf verwiesen, dass man die Strukturen<br />
bewusst „flach“ halten wollte und für die Umsetzung die Bürgermeister unmit-<br />
telbar verantwortlich sind. Regelungen zur Finanzierung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> wurden<br />
getroffen. Aussagen zur <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Gemeinden des Mittelbereichs und<br />
<strong>der</strong> Funktionszuordnung sind in allgemeiner Form ebenfalls enthalten. Als positiver<br />
Aspekt ist zu erwähnen, dass dem Vertrag eine Anlage mit einem Ziele-Maßnahmen-<br />
Katalog beigefügt ist.<br />
Die Umsetzung <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> beiden Städte scheint offensichtlich erst<br />
im Anfangsstadium zu sein. Man hat nach eigenen Aussagen „zu Beginn etwas Zeit<br />
verloren“, da in Beelitz ein Wechsel im Amt des Bürgermeisters stattgefunden hat und<br />
es gegenüber <strong>der</strong> Situation in an<strong>der</strong>en Mittelzentren einen weniger großen konzepti-<br />
onellen Vorlauf gab. Von daher ist es nachvollziehbar, dass im Oktober 2010 ein ex-<br />
ternes Dienstleistungsunternehmen mit <strong>der</strong> Erarbeitung einer Entwicklungskonzeption<br />
für den gesamten Mittelbereich beauftragt wurde. Dieses Konzept liegt in <strong>der</strong> End-<br />
fassung vom 18. April 2011 vor. Auf <strong>der</strong> Basis einer sehr ausführlichen Bestandsauf-<br />
nahme wurden in systematischer Form die Kooperationspotenziale und mögliche -<br />
65
projekte abgeleitet. Positiv zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die konse-<br />
quente Betrachtung und Einbeziehung <strong>der</strong> Akteure des gesamten Mittelbereiches.<br />
Nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner war eine solche Erhebung hilfreich und hat bei<br />
allen Beteiligten den Blick für mögliche Ansätze geschärft. Jetzt kommt es darauf an<br />
Prioritäten zu setzen und die erfolgversprechendsten Projekte auszuwählen. Auch<br />
dieser Prozess soll – so die Gesprächspartner – weiterhin von dem externen Büro<br />
betreut werden. Schwerpunkte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> zeichnen sich dabei beispiels-<br />
weise bei <strong>der</strong> Verbesserung <strong>der</strong> ÖPNV-Anbindung bzw. -Verbindung zwischen den<br />
beiden Städten, <strong>der</strong> Vernetzung <strong>der</strong> Radwege, die für die touristische Entwicklung <strong>der</strong><br />
Region beson<strong>der</strong>s wichtig sind, <strong>der</strong> gemeinsamen Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung bzw. Stand-<br />
ortvermarktung o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Abstimmung <strong>der</strong> Flächennutzung für regenerative Energien<br />
ab. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> auf letzterem Gebiet (von einer Konzeption bis hin zu einer<br />
gemeinsamen Energieberatung) scheint in den Diskussionen dabei einen besonde-<br />
ren Stellenwert zu haben.<br />
Neben den strukturellen Vorarbeiten im Rahmen <strong>der</strong> Entwicklungskonzeption wurden<br />
aber auch schon erste kleinere Projekte umgesetzt. So gibt es erstmals eine gemein-<br />
same Imagebroschüre und einen Veranstaltungskalen<strong>der</strong>. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> zwi-<br />
schen den Verwaltungen läuft in vielen Bereichen unproblematisch auf dem „kurzen<br />
Weg“ und reicht von <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> im Personalbereich bis zu <strong>der</strong> Abstimmung<br />
und Profilierung <strong>der</strong> Schulen und Kin<strong>der</strong>tagesstätten.<br />
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das funktionsteilige Mittelzentrum Wer<strong>der</strong> (Havel)<br />
– Beelitz die Evaluationskriterien erfüllt. Die Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation befindet<br />
sich in einem frühen Stadium, wird allerdings von den beteiligten Akteuren des ge-<br />
samten Mittelbereiches – und teilweise auch in <strong>der</strong> Öffentlichkeit – mit einem überzeugenden<br />
Engagement vorangetrieben. Verzögerungen bei <strong>der</strong> Umsetzung sind,<br />
nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner, auf Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Verwaltungsspitze<br />
in Beelitz und auf die Neuartigkeit <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> zurückzuführen. Von daher<br />
ist die Erstellung einer systematischen Entwicklungskonzeption nachvollziehbar und<br />
notwendig gewesen. Bei <strong>der</strong> Umsetzung weiterer Projekte sollte das funktionsteilige<br />
Mittelzentrum allerdings keine Zeit mehr verlieren und zukünftig auch Themen <strong>der</strong><br />
Verwaltungszusammenarbeit o<strong>der</strong> beispielsweise <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> in <strong>der</strong> ärztli-<br />
chen Versorgung bzw. im Bildungsbereich stärker in den Blick nehmen.<br />
66
3.2.8 Zehdenick – Gransee<br />
Die Stadt Zehdenick und die Stadt Gransee bilden gemeinsam das funktionsteilige<br />
Mittelzentrum Zehdenick – Gransee. Da Gransee nicht amtsfrei ist und zum Amt<br />
Gransee und Gemeinden gehört, ist hier eine gewisse Son<strong>der</strong>situation gegeben. Zum<br />
Amt Gransee und Gemeinden gehören noch vier weitere Gemeinden, zum Mittelbe-<br />
reich noch die amtsfreie Gemeinde Fürstenberg/ Havel.<br />
Abb. 19: Mittelbereich Zehdenick – Gransee<br />
Quelle: Kartengrundlage: www.falk.de, LBV Mittelbereichsprofil Zehdenick - Gransee, 2010, S. 2.<br />
67
Die größte Gemeinde im Mittelbereich ist Zehdenick mit rund 13.800 Einwohnern.<br />
Das Amt Gransee und Gemeinden folgt mit 9.390 Einwohnern, die Stadt Gransee<br />
separat betrachtet hat etwa 6.000 Bewohner 55<br />
. Fürstenberg/ Havel stellt mit etwa<br />
6.300 die restlichen Einwohner des Mittelbereiches. Insgesamt leben im Mittelbereich<br />
etwas mehr als 30.000 Einwohner. Er ist damit <strong>der</strong> kleinste Mittelbereich <strong>der</strong> betrach-<br />
teten funktionsteiligen Mittelzentren und kommt bezüglich <strong>der</strong> Bevölkerungsgröße auf<br />
rund 67 % <strong>der</strong> Durchschnittsgröße aller funktionsteiligen Mittelzentren. Gegenüber<br />
dem bevölkerungsreichsten Mittelbereich des funktionsteiligen Mittelzentrums Wer<strong>der</strong><br />
(Havel) – Beelitz kommt er nur auf knapp 53 %. Von <strong>der</strong> Flächenausdehnung steht<br />
<strong>der</strong> Mittelbereich des funktionsteiligen Mittelzentrums Zehdenick – Gransee mit<br />
753,6 km² nach den beiden funktionsteiligen Mittelzentren Pritzwalk –<br />
Wittstock/ Dosse und Perleberg – Wittenberge an dritter Stelle.<br />
Tab. 12: Bevölkerung Zehdenick – Gransee<br />
Amtsfreie Gemeinde/ Amt Bevölkerung des Mittelbereichs Fläche (in km²)<br />
Zehdenick 13.830 (46,9 %) 221,5<br />
Gransee und Gemeinden 9.390 (31,9 %) 319,5<br />
Fürstenberg/ Havel 6.257 (21,2 %) 212,6<br />
Mittelbereich insgesamt 29.477 (100,0 %) 753,6<br />
Quelle: eigene Berechnung, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach<br />
amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden; LBV Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010.<br />
Zehdenick und Gransee sind über die L 22 miteinan<strong>der</strong> verbunden, die Fahrtzeit für<br />
die rund 12,7 km beträgt etwa 15 Minuten. Eine direkte Bahnverbindung zwischen<br />
Gransee und Zehdenick ist nicht vorhanden.<br />
In Gransee und Zehdenick sind die wichtigsten Einrichtungen <strong>der</strong> Infrastruktur und<br />
Daseinsvorsorge vorhanden. Zehdenick besitzt beispielsweise eine Oberschule und<br />
einen Teilstandort eines Oberstufenzentrums, in Gransee gibt es eine Oberschule<br />
und ein Gymnasium. Die Bibliotheken im Mittelbereich sind in einem gemeinsamen<br />
Bibliothekenverbund Oberhavel Nord miteinan<strong>der</strong> verknüpft.<br />
Die Pendlerverflechtungen im Mittelbereich bewegen sich insgesamt auf einem nied-<br />
rigen Niveau. Nennenswerte Verflechtungen gibt es zwischen Zehdenick und Gran-<br />
see, wobei Gransee aus dem Mittelbereich einen leichten Einpendlerüberschuss von<br />
209 Pendlern generieren kann. Zehdenick und Fürstenberg/ Havel haben einen ne-<br />
55<br />
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amts-<br />
freien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden.<br />
68
gativen Pendlersaldo gegenüber dem Mittelbereich von -151 und -58. Betrachtet man<br />
dazu auch noch die überregionalen Pendlerverflechtungen, weisen das Amt Gransee<br />
und auch die beiden Städte deutliche negative Salden (Amt Gransee - 1.085, Zehdenick<br />
-2.031, Fürstenberg/ Havel -925) auf, wobei dies beim Amt Gransee und Zehde-<br />
nick zu rund einem Drittel auf die Auspendler nach Berlin zurückzuführen sein könnte.<br />
56<br />
Abb. 20: Pendlerverflechtungen <strong>innerhalb</strong> des Mittelbereichs<br />
Quelle: eigene Darstellung, nur Verflechtungen bezogen auf Gransee und Zehdenick enthalten, Datengrundlage Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur<br />
für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand: 30.06.2010.<br />
Gransee, Zehdenick und Fürstenberg/ Havel gehörten in den vergangenen Jahrzehn-<br />
ten teilweise unterschiedlichen Landkreisen an, so dass man nicht unbedingt von<br />
historisch gewachsenen Voraussetzungen für eine intensive und kontinuierliche <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
in <strong>der</strong> jetzigen Konstellation sprechen kann. Zwischen Gransee und<br />
Zehdenick gab es sogar eine gewisse Konkurrenzsituation. Erst mit <strong>der</strong> aufkommen-<br />
den Diskussion <strong>der</strong> neuen zentralörtlichen Strukturen im Rahmen des neuen LEP, in<br />
<strong>der</strong> die bisherige Ausweisung von Gransee und Zehdenick als Grundzentren mit Teil-<br />
funktion eines Mittelzentrums zur Debatte stand, formierten sich sehr schnell wichtige<br />
regionale Akteure in <strong>der</strong> Region. Antrieb war sicherlich die Erkenntnis, dass Verbes-<br />
56<br />
Vgl. Anhang 5, S. 29.<br />
69
serungen <strong>der</strong> Einstufung nur gemeinsam zu erreichen sind und man damit <strong>der</strong> Ge-<br />
fahr eines Bedeutungsverlustes entgegentreten könne. Im Ergebnis <strong>der</strong> geführten<br />
Gespräche zwischen Regions- und Landesvertretern wurde im August 2005 die Erstellung<br />
eines raumordnerischen Konzeptes bei <strong>der</strong> TU Berlin in Auftrag gegeben und<br />
im Juni 2006 fertiggestellt. Auf <strong>der</strong> Basis dieser systematischen Betrachtung <strong>der</strong> Ko-<br />
operationspotenziale und -fel<strong>der</strong> wurde dann gemeinsam die Einstufung als „Mittelzentrum<br />
in Funktionsteilung“ vorangetrieben.<br />
Den Kooperationsvertrag über die Funktionswahrnehmung eines Mittelzentrums in<br />
Funktionsteilung zwischen <strong>der</strong> Stadt Gransee und <strong>der</strong> Stadt Zehdenick wurde mit<br />
Zustimmung des Amtes Gransee und Gemeinden am 3. Mai 2007 unterzeichnet.<br />
Damit war das funktionsteilige Mittelzentrum Zehdenick – Gransee (abgesehen von<br />
Elsterwerda – Bad Liebenwerda) nach Lauchhammer – Schwarzheide das zweite<br />
funktionsteilige Mittelzentrum mit einem Kooperationsvertrag. In dem Vertrag sind<br />
Regelungen zur Funktionszuordnung, einem Kooperationsrat und sehr weitreichende<br />
Regelungen zur Finanzierung <strong>der</strong> Kooperation aus einem Kooperationsfonds 57<br />
enthalten.<br />
Die Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation bzw. des Vertrages wurde unverzüglich in Angriff<br />
genommen und erste Projekte in 2007/ 2008 gestartet. Hervorzuheben ist dabei,<br />
dass die nicht unerhebliche Finanzierung von Projekten in 2008 von den Partnern<br />
über die kommunalen Haushalte erfolgte und quasi einen „Vorgriff“ auf die mögliche<br />
Einstufung und Landesunterstützung darstellte. Zu diesem Zeitpunkt wurde die <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
noch von den Bearbeitern des Raumordnerischen Konzeptes inhaltlich<br />
und organisatorisch begleitet. Ab 2009 übernahm die neu gegründete Regionale<br />
Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel-Nord mbH (Regio Nord) die Aufgaben des<br />
Kooperationsmanagements. Die Gesellschaftsanteile sind paritätisch auf das Amt und<br />
die Stadt Gransee, Zehdenick und Fürstenberg/ Havel verteilt. An<strong>der</strong>s als noch im<br />
Kooperationsvertrag ist Fürstenberg/ Havel damit gleichberechtigter Kooperationspartner<br />
und <strong>der</strong> gesamte Mittelbereich profitiert von <strong>der</strong> Entwicklung und ist einbezo-<br />
gen. Die Regio Nord fungiert als eine Art Entwicklungsagentur und widmet sich ne-<br />
ben dem Kooperations- bzw. Regionalmanagement schwerpunktmäßig <strong>der</strong> Wirtschafts-<br />
und Tourismusför<strong>der</strong>ung und dem Standortmarketing. Die Gründung <strong>der</strong> Re-<br />
gio Nord ist nach Aussagen <strong>der</strong> Gesprächspartner auch <strong>der</strong> Erkenntnis geschuldet,<br />
dass es auf Dauer in solch einer Kooperation eines „Umsetzungsmotors und Organi-<br />
57<br />
Im Absatz 1 des Paragraphen 12 heißt es dazu: „Die Vertragspartner bilden aus den gemäß § 14 a des Bran-<br />
denburgischen Finanzausgleichsgesetzes zugewiesenen Mitteln für den Mehrbelastungsausgleich einen Ko-<br />
operationsfonds.“<br />
70
sators“ bedarf und man nicht dauerhaft auf externe Unterstützung zurückgreifen<br />
kann. Die Regio Nord entwickelt und bearbeitet nach eigenen Aussagen dabei nicht<br />
nur die vom Kooperationsrat beschlossenen Projekte „die Geld kosten“, son<strong>der</strong>n<br />
übernimmt auch die normalen Abstimmungen und Verwaltungsarbeiten, die unwei-<br />
gerlich anfallen. Für die vorliegende Evaluation war dies insofern hilfreich, da <strong>der</strong><br />
gesamte Abstimmungsprozess, die konzeptionellen Vorarbeiten für einzelne Themenbereiche<br />
und auch die Projektdurchführung bis zur Finanzierung <strong>der</strong> einzelnen<br />
Projekte lückenlos und sehr professionell dokumentiert waren.<br />
Folgende Projekte seien an dieser Stelle beispielhaft angeführt:<br />
- Unter dem Thema Daseinsvorsorge bilden mehrere Projekte im Bereich Zu-<br />
sammenarbeit <strong>der</strong> Feuerwehren einen Schwerpunkt. Hier reichen die Projekte<br />
von <strong>der</strong> Umsetzung einer Feuerwehrkonzeption, <strong>der</strong> gemeinsamen Beschaffung<br />
von Technik, bis zur Nachwuchsgewinnung an Kin<strong>der</strong>tagesstätten und<br />
Schulen.<br />
- Der bereits genannte Bibliothekenverbund ermöglicht beispielsweise den ehrenamtlichen<br />
Transport von bestellten Büchern zwischen den Standorten, so<br />
dass eine größere Auswahl an Literatur an allen drei Standorten bei nur einma-<br />
liger Anschaffung <strong>der</strong> Bücher angeboten werden kann.<br />
- Ein wichtiges Projekt <strong>der</strong> letzten Jahre ist eine spezifische Ausbildungsplatzför-<br />
<strong>der</strong>ung bzw. Lehrstellenbörse, über die die einstellenden Unternehmen einen<br />
entsprechenden Anreiz erhalten. Derzeit wird in <strong>der</strong> Region aufgrund <strong>der</strong> sich<br />
än<strong>der</strong>nden Rahmenbedingungen darüber diskutiert, dieses System umzustellen<br />
und den Auszubildenden diese För<strong>der</strong>ung eventuell in Form eines „Begrü-<br />
ßungsgeldes“ zu zahlen.<br />
- Sehr aktiv ist die Regio Nord im Bereich <strong>der</strong> Tourismuskoordinierung. Hier rei-<br />
chen die Projekte von <strong>der</strong> Planung <strong>der</strong> Messeauftritte, einem gemeinsamen In-<br />
ternetauftritt bei <strong>der</strong> Zimmervermittlung, dem Gastgeberverzeichnis, bis hin zur<br />
Planung und Umsetzung von Radrundwegen sowie <strong>der</strong> Standardisierung <strong>der</strong><br />
Ausschil<strong>der</strong>ung.<br />
- Die Ersatzinvestititon in einen Bürgerbus, die Kofinanzierung und das Management<br />
<strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung aus dem Bund-Län<strong>der</strong>-Programm „Kleinere Städte<br />
und überörtliche <strong>Zusammenarbeit</strong>“ durch Gransee, o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> Ge-<br />
meindeverbindungsstraße zwischen dem Granseer Ortsteil Kraatz und dem<br />
Zehdenicker Ortsteil Osterne, wo <strong>der</strong> Eigenanteil von über 200.000 Euro aus<br />
dem Kooperationsfonds stammte, runden die Projektzusammenarbeit ab.<br />
71
Insgesamt bleibt festzustellen, dass das funktionsteilige Mittelzentrum Zehdenick –<br />
Gransee die Evaluationskriterien erfüllt. Die relativ neue Kooperation hat es mit gro-<br />
ßem Engagement geschafft, in vielen Bereichen Projekte zu entwickeln und umzusetzen.<br />
Hervorzuheben ist dabei die sehr transparente Finanzierung und Verwendung<br />
des sog. „Mehrbelastungsausgleichs“ aus dem Finanzausgleichsgesetz. Auch die<br />
Einschaltung <strong>der</strong> Regio Nord als Dienstleister für das Kooperationsmanagement erscheint<br />
als effiziente Lösung, die nach anfänglichen Schwierigkeiten auch in <strong>der</strong> Re-<br />
gion akzeptiert ist. Neben den Schwerpunkten im Bereich Tourismus und Wirtschafts-<br />
för<strong>der</strong>ung sollte das funktionsteilige Mittelzentrum zukünftig vielleicht noch stärker als<br />
bisher Kooperationsprojekte in den Bereichen <strong>der</strong> Infrastrukturversorgung und <strong>der</strong><br />
Verwaltungszusammenarbeit prüfen, wie sie sich in ersten Konzepten zur Verwal-<br />
tungszusammenarbeit auch schon abzeichnen.<br />
72
4. Zusammenfassende Bewertung<br />
Nachfolgend werden die Detailanalysen <strong>der</strong> einzelnen funktionsteiligen Mittelzentren<br />
zusammengefasst und bewertet. Dabei wird die Bewertung schwerpunktmäßig nach<br />
folgenden Aspekten vorgenommen:<br />
� Vereinbarung<br />
� Kooperation und Themen <strong>der</strong> Kooperation<br />
� <strong>Zusammenarbeit</strong> im Mittelbereich<br />
� Bewertung <strong>der</strong> einzelnen funktionsteiligen Mittelzentren.<br />
Vereinbarung<br />
Wie bereits mehrfach erwähnt stellen die verbindlichen Regelungen zur Zusammen-<br />
arbeit <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren bzw. entsprechende Kooperationsverträge<br />
eines von zwei wichtigen Evaluationskriterien dar.<br />
Die nachfolgende Abbildung 21 gibt einen Überblick über die Kooperationsverträge<br />
und den Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung. 2005 wurde <strong>der</strong> erste Vertrag zwischen Els-<br />
terwerda und Bad Liebenwerda, also noch weit vor dem Inkrafttreten des relevanten<br />
Landesentwicklungsplans, geschlossen. Grund hierfür ist, dass das funktionsteilige<br />
Mittelzentrum Elsterwerda – Bad Liebenwerda schon im vorangegangen Landesent-<br />
wicklungsplan 1995 als Mittelzentrum in Funktionsteilung ausgewiesen wurde. Im<br />
Verlauf des Jahres 2007 folgten dann die Kooperationsverträge für die funktionsteili-<br />
gen Mittelzentren Lauchhammer – Schwarzheide, Zehdenick – Gransee, Perleberg –<br />
Wittenberge, Schönefeld – Wildau sowie Pritzwalk – Wittstock/ Dosse. Anfang 2010<br />
wurde dann mit einiger Verzögerung <strong>der</strong> Kooperationsvertrag zwischen Wer<strong>der</strong> (Ha-<br />
vel) – Beelitz unterzeichnet. Darüber hinaus wurden in einigen funktionsteiligen Mittelzentren<br />
Ergänzungsverträge bzw. neue Kooperationsverträge vereinbart. 58<br />
58<br />
Mehrere Verträge aus einem funktionsteiligen Mittelzentrum sind in <strong>der</strong> Abb. 22 farblich gleich gestaltet.<br />
73
Abb. 21: Zeitliche Entwicklung <strong>der</strong> Kooperationsverträge<br />
Quelle: eigene Darstellung, auf Grundlage <strong>der</strong> Kooperationsverträge <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />
74
So wurde Mitte 2011 ein öffentlich rechtlicher Vertrag zur Bildung einer kommunalen<br />
Arbeitsgemeinschaft zwischen Pritzwalk und Wittstock/ Dosse sowie im Januar 2012<br />
eine Neufassung des Kooperationsvertrages zwischen den beiden Städten Elsterwerda<br />
und Bad Liebenwerda unterzeichnet.<br />
Die Verträge sollen nach dem LEP Berlin-Brandenburg bestimmte Grundelemente<br />
enthalten, wie Regelungen zur Funktionszuordnung, zu den gemeindeübergreifenden<br />
Gremien, zur Finanzierung, zur <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Gemeinden im Verflechtungsbereich<br />
und zu weiteren Elementen <strong>der</strong> Kooperation. 59<br />
Eine zusammenfassen-<br />
de Bewertung aller Kooperationsverträge nach diesen Bestandteilen ist in <strong>der</strong> folgenden<br />
Abbildung 22 dargestellt. Dabei wurde eine Unterscheidung vorgenommen, ob<br />
eine entsprechende Regelung „vorhanden“ o<strong>der</strong> nur „teilweise vorhanden“ ist.<br />
Es zeigt sich, dass – mit Ausnahme von Zehdenick – Gransee – die funktionsteiligen<br />
Mittelzentren bei den Regelungen zur <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Gemeinden des Mit-<br />
telbereiches und bei den Regelungen zur Finanzierung übergreifend sehr vorsichtig<br />
vorgegangen sind. Hierbei handelt es sich offensichtlich um Aspekte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>,<br />
die von den jeweiligen Partnern weitergehende Zugeständnisse und eine<br />
nachprüfbare und belastbare Kooperation verlangen. Diese beiden Punkte sollten<br />
zukünftig stärker berücksichtigt und zu gegebener Zeit vielleicht auch vertraglich angepasst<br />
werden. Aspekte <strong>der</strong> Funktionszuordnung und <strong>der</strong> Kooperationsgremien<br />
werden von drei bzw. vier funktionsteiligen Mittelzentren klar erfüllt. Dabei ist anzu-<br />
merken, dass die Kooperationsgremien bei zwei weiteren funktionsteiligen Mittelzentren<br />
im Rahmen ihrer RWK-Funktion eingerichtet wurden und dementsprechend auf<br />
Doppelstrukturen verzichtet wurde. Von daher ist dieses Element in fast allen funkti-<br />
onsteiligen Mittelzentren geregelt. Weitere Elemente <strong>der</strong> Kooperation, die von den<br />
funktionsteiligen Mittelzentren in den Verträgen geregelt werden, betreffen beispiels-<br />
weise Fragen <strong>der</strong> Abstimmung bei <strong>der</strong> Flächenplanung, <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung und<br />
des Tourismus o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Abstimmung bei konkurrierenden Infrastrukturplanungen.<br />
Hier zeigen sich beson<strong>der</strong>s die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Lö-<br />
sungsmöglichkeiten in den betrachteten funktionsteiligen Mittelzentren, die einen<br />
59<br />
In den Begründungen zu den Festlegungen des LEP Berlin-Brandenburg heißt es unter 2.11 (G), Abs. 3: „Es<br />
sollen ausgehend von den Funktionszuordnungen Festlegungen dahingehend getroffen werden, in welcher<br />
Form die Funktionen weiterentwickelt, wie die Finanzierung sichergestellt, welche gemeindeübergreifenden<br />
Gremien gebildet und wie die <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Gemeinden des Verflechtungsbereiches entwickelt wer-<br />
den soll. Entsprechende Vereinbarungen können auch weitere Elemente <strong>der</strong> Kooperation umfassen, insbeson-<br />
<strong>der</strong>e hinsichtlich einer Abstimmung <strong>der</strong> Planung, die Konkurrenzen bei <strong>der</strong> Siedlungsflächen- und Infrastruk-<br />
turentwicklung verhin<strong>der</strong>n hilft.“<br />
75
Vergleich <strong>der</strong> Vertragslösungen – wie er hier vorgenommen wurde – insgesamt er-<br />
schweren.<br />
Festzuhalten bleibt, dass in sieben funktionsteiligen Mittelzentren entsprechende<br />
Vereinbarungen zur <strong>Zusammenarbeit</strong> existieren und dieses Evaluationskriterium da-<br />
mit von diesen funktionsteiligen Mittelzentren erfüllt ist. Im funktionsteiligen Mittel-<br />
zentrum Senftenberg – Großräschen wurde ein solcher Vertrag bisher noch nicht abgeschlossen.<br />
Abb. 22: Inhaltlicher Vergleich <strong>der</strong> Kooperationsverträge<br />
Elsterwerda –<br />
Bad Liebenwerda<br />
Lauchhammer –<br />
Schwarzheide<br />
Perleberg –<br />
Wittenberge<br />
Pritzwalk –<br />
Wittstock/ Dosse<br />
Schönefeld –<br />
Wildau<br />
Senftenberg –<br />
Großräschen<br />
Wer<strong>der</strong> (Havel) –<br />
Beelitz<br />
Zehdenick –<br />
Gransee<br />
Vertrag Funktionszuordnung<br />
Kooperatio<br />
nsgremien<br />
76<br />
KooperationMittelbereich<br />
Finanzregelungen<br />
erfüllt bzw. Regelungen dazu getroffen<br />
Weitere<br />
Elemente<br />
Kooperation<br />
teilweise erfüllt bzw. teilweise Regelungen getroffen<br />
Quelle: eigene Darstellung, auf Grundlage <strong>der</strong> Kooperationsverträge <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />
Kooperation und Themen <strong>der</strong> Kooperation<br />
Bei einer Betrachtung sämtlicher Kooperationsaktivitäten über alle funktionsteiligen<br />
Mittelzentren ist einerseits festzustellen, dass alle funktionsteiligen Mittelzentren mit-<br />
einan<strong>der</strong> kooperieren. Die Intensität und auch die Breite <strong>der</strong> Kooperation variiert an<strong>der</strong>erseits<br />
zwischen den funktionsteiligen Mittelzentren spürbar.<br />
Die <strong>Zusammenarbeit</strong> in den „klassischen“ Fel<strong>der</strong>n <strong>der</strong> öffentlichen Daseinsvorsorge<br />
ist insgesamt eher schwach ausgeprägt. Eine Kooperation in diesen Fel<strong>der</strong>n ist of-
fensichtlich schwierig und erschließt sich – wenn überhaupt – erst mittel- und langfris-<br />
tig. Damit bestätigen sich hier auch die bisherigen wissenschaftliche Einschätzungen<br />
aus an<strong>der</strong>en Studien 60<br />
Dagegen sind in Bereichen wie beispielsweise <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung,<br />
des Tourismus o<strong>der</strong> des Standortmarketings häufiger Kooperationsprojek-<br />
te und Aktivitäten zu erkennen. In diesen eher „weichen“ Fel<strong>der</strong>n ergeben sich über-<br />
wiegend schnell und einfacher Kooperationsansätze. Im Detail stellt sich die <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
über alle funktionsteiligen Mittelzentren nach Funktionen bzw. Bereichen<br />
beispielsweise wie folgt dar.<br />
- Wirtschaft und Siedlungsstruktur<br />
Einige funktionsteilige Mittelzentren haben eine ausgeprägte Funktionszuord-<br />
nung festgelegt und versuchen diese Zuordnung auch in <strong>der</strong> konkreten Zu-<br />
sammenarbeit umzusetzen bzw. auszugestalten. Geringe Aktivitäten sind in den<br />
funktionsteiligen Mittelzentren bei <strong>der</strong> Abstimmung zur Flächennutzung und zur<br />
Bauleitplanung zu verzeichnen. Hier gibt es zum Beispiel gute Ansätze in<br />
Lauchhammer – Schwarzheide, die allerdings von den konkreten Voraussetzungen<br />
geprägt sind. Fast jedes funktionsteilige Mittelzentrum kann auf Aktivitä-<br />
ten im Bereich <strong>der</strong> Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung verweisen. Gemeinsame Marketingpro-<br />
jekte, Broschüren o<strong>der</strong> Neujahrs- und Wirtschaftsempfänge sind bewährte Instrumente<br />
<strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>. Die <strong>Zusammenarbeit</strong> in Bereichen <strong>der</strong> techni-<br />
schen Infrastruktur wird überwiegend im Rahmen bestehen<strong>der</strong> Einrichtungen<br />
und Verbände organisiert und abgewickelt und ist fester Bestandteil <strong>der</strong> Kooperation.<br />
In einigen funktionsteiligen Mittelzentren gibt es erste Ansatzpunkte <strong>der</strong><br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> in <strong>der</strong> Wohnungswirtschaft.<br />
- Einzelhandel<br />
Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die Abstimmung bei <strong>der</strong> Erstellung ent-<br />
sprechen<strong>der</strong> Planungen und Einzelhandelskonzeptionen. Ansonsten sind ge-<br />
ringe bis keine Aktivitäten zu verzeichnen.<br />
- Kultur- und Freizeit<br />
60<br />
Gut und problemlos erfolgte in <strong>der</strong> Vergangenheit die informelle Abstimmung<br />
bei größeren Infrastrukturprojekten in den meisten funktionsteiligen Mittelzentren.<br />
Hier wird eher pragmatisch vorgegangen und so geplant, dass es keine<br />
Überschneidungen gibt („Projekte sollen sich gegenseitig nicht behin<strong>der</strong>n.“).<br />
Vgl. dazu u. a. B. Müller/ B. Beyer, 1999, S. 213; J. Kern, 2010, S. 85.<br />
77
Wechselseitige Beteiligungen o<strong>der</strong> die Errichtung von gemeinsamen Infrastruk-<br />
tureinrichtungen bilden noch eine Ausnahme wie beispielsweise beim See-<br />
Campus in Schwarzheide – Lauchhammer. Gute und vermehrte Ansätze sind in<br />
den letzten Jahren auch bei <strong>der</strong> Kooperation von Bibliotheken o<strong>der</strong> dem ge-<br />
meinsamen Betrieb von Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose zu fin-<br />
den.<br />
- Bildung<br />
In fast allen funktionsteiligen Mittelzentren wurde in diesem Bereich auf die in<br />
<strong>der</strong> Vergangenheit und in Verantwortung <strong>der</strong> jeweiligen Kreise stattgefundenen<br />
Abstimmungen und Maßnahmen verwiesen. Offensichtlich besteht hier aktuell<br />
wenig Kooperationsbedarf. Gute Beispiele gibt es in <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> und<br />
Koordinierung <strong>der</strong> Schülerverkehre.<br />
- Gesundheitswesen/ Altenpflege<br />
In vielen funktionsteiligen Mittelzentren gibt es mittlerweile Abstimmungen und<br />
erste Aktivitäten <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> im Bereich <strong>der</strong> medizinischen Versorgung.<br />
Hier entwickelt sich offensichtlich in den kommenden Jahren ein Schwer-<br />
punkt <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>.<br />
- Sonstige soziale und technische Dienstleistungen<br />
Gute Ansätze <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> wurden in mehreren funktionsteiligen Mittel-<br />
zentren bei den Feuerwehren und im Katastrophenschutz gefunden, die bei<br />
Bedarf auch noch ausgebaut bzw. von an<strong>der</strong>en funktionsteiligen Mittelzentren<br />
übernommen werden könnten. Auch die <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> Verwaltungen<br />
steht in den meisten funktionsteiligen Mittelzentren noch am Anfang (standes-<br />
amtliche Aufgaben, <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong> Bauhöfe usw.). Auch hier gibt es mittel-<br />
und langfristig sicherlich weitere Kooperationsansätze in den meisten funk-<br />
tionsteiligen Mittelzentren.<br />
- Verkehr<br />
In diesem Bereich sind nur geringe direkte Aktivitäten zu verzeichnen. Gute<br />
Beispiele bilden hier ein Bürgerbus (Zehdenick – Gransee) o<strong>der</strong> Maßnahmen<br />
und Projekte zur Attraktivierung <strong>der</strong> Bahnhöfe (Pritzwalk) und damit <strong>der</strong> indirekten<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> im Verkehr.<br />
78
<strong>Zusammenarbeit</strong> im Mittelbereich<br />
Die <strong>Zusammenarbeit</strong> bzw. die Einbindung aller Gemeinden <strong>der</strong> jeweiligen Mittelberei-<br />
che wird von einigen Mittelzentren nicht bzw. nur teilweise umgesetzt. In den meisten<br />
funktionsteiligen Mittelzentren sind die übrigen Gemeinden und Ämter zwar informell<br />
in die Kooperationsaktivitäten eingebunden, eine unmittelbare Projekteinbindung er-<br />
folgt aber nur in Ausnahmen. Beispielhaft gelöst ist die Einbindung des gesamten<br />
Mittelbereichs im funktionsteiligen Mittelzentrum Zehdenick – Gransee. Auch in den<br />
meisten RWK o<strong>der</strong> im funktionsteiligen Mittelzentrum Pritzwalk – Wittstock/ Dosse<br />
erfolgt eine <strong>Zusammenarbeit</strong> mit weiteren Gemeinden, hier sollte aber verstärkt für<br />
die Einbindung aller Gemeinden des Mittelbereichs Sorge getragen werden.<br />
Bewertung <strong>der</strong> einzelnen funktionsteiligen Mittelzentren<br />
Betrachtet man die in den vorangegangen Abschnitten dargelegten Aktivitäten und<br />
Evaluationskriterien über alle funktionsteiligen Mittelzentren, sind<br />
- Zehdenick – Gransee<br />
- Perleberg – Wittenberge<br />
- Pritzwalk – Wittstock/ Dosse<br />
- Lauchhammer – Schwarzheide<br />
als beson<strong>der</strong>s aktiv bei <strong>der</strong> Untersetzung und Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation zu bezeichnen.<br />
Deutliche Entwicklungspotenziale haben die Kooperationsstrukturen noch<br />
in<br />
- Schönefeld – Wildau<br />
- Elsterwerda – Bad Liebenwerda.<br />
Dabei muss bei einer solchen Bewertung aber auch die auf die Rahmenbedingungen<br />
hingewiesen werden, die sowohl für alle funktionsteiligen Mittelzentren insgesamt, als<br />
auch für einzelne Städtepaare gelten:<br />
- Seit Inkrafttreten des LEP Berlin-Brandenburg ist erst eine relativ kurze Zeit-<br />
spanne von drei Jahren vergangen. Mit Ausnahme von Elsterwerda – Bad Liebenwerda,<br />
die schon länger als Mittelzentrum in Funktionsteilung ausgewiesen<br />
79
sind, mussten sich viele Städte neu mit diesem Thema und den vertraglichen<br />
Regelungen auseinan<strong>der</strong>setzen.<br />
- Vier funktionsteilige Mittelzentren sind gleichzeitig RWK bzw. Teil eines RWK.<br />
Hier überlagern sich die Aktivitäten, vorhandene Gremien werden genutzt und<br />
die Abstimmung im Rahmen <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren erfolgt im Rah-<br />
men <strong>der</strong> RWK-Aktivitäten.<br />
- Die Lage im Raum prägt die Form und die Inhalte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> wesent-<br />
lich. So haben die beiden funktionsteiligen Mittelzentren im Berliner Umland ei-<br />
nen an<strong>der</strong>en Kooperationsbedarf als funktionsteilige Mittelzentren in periphereren<br />
Regionen des Landes. Bei letzteren gibt es einen viel höheren Druck hin-<br />
sichtlich <strong>der</strong> Auslastung und Finanzierung von Infrastruktureinrichtungen und<br />
damit auch einen viel höheren Kooperationsbedarf.<br />
- Historische Beziehungen o<strong>der</strong> die Zugehörigkeit zu verschiedenen Gebietskör-<br />
perschaften und Kulturlandschaften können auch noch nach Jahrzehnten die<br />
Kooperation <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren positiv und negativ beeinflussen.<br />
Nicht zuletzt hängt die <strong>Zusammenarbeit</strong> in den funktionsteiligen Mittelzentren<br />
auch sehr stark von den handelnden Personen ab.<br />
Abschließend werden die kennzeichnendsten Merkmale <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> <strong>der</strong><br />
jeweiligen funktionsteiligen Mittelzentren aufgeführt:<br />
Elsterwerda – Bad Liebenwerda: Die schon länger existierende <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
hat in den letzten Jahren etwas an Intensität und<br />
Dynamik eingebüßt. Mit dem im Januar 2012<br />
neu abgeschlossenen Kooperationsvertrag und<br />
auch vor dem Hintergrund <strong>der</strong> langjährigen Er-<br />
fahrungen sollte jetzt wie<strong>der</strong> neue Bewegung in<br />
die <strong>Zusammenarbeit</strong> kommen. Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e<br />
für den Bereich <strong>der</strong> Daseinsvorsorge,<br />
wo das geplante Versorgungskonzept eine gute<br />
Basis bilden könnte.<br />
Lauchhammer – Schwarzheide: Die <strong>Zusammenarbeit</strong> kann als sehr gut und<br />
strukturiert bezeichnet werden. Sie ist sehr stark<br />
von <strong>der</strong> Arbeit im RWK geprägt. Die <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
mit den Ämtern und <strong>der</strong>en Einbeziehung<br />
in entsprechende Aktivitäten sollte unbedingt<br />
forciert werden. Um weiterhin die Kooperation<br />
80
professionell voranzutreiben, wäre vielleicht<br />
auch eine jährliche Schwerpunktsetzung o<strong>der</strong><br />
Projektauswahl günstig.<br />
Perleberg – Wittenberge: Die Kooperation, die von <strong>der</strong> Arbeit und den<br />
Strukturen des RWK überlagert wird, ist sehr gut<br />
und deckt viele Bereiche ab. Die <strong>Zusammenarbeit</strong><br />
im Bereich <strong>der</strong> Daseinsvorsorge im engeren<br />
Sinn, aber auch bei bestimmten Verwaltungs-<br />
aufgaben könnte noch stärker thematisiert werden.<br />
Dies gilt auch für die Einbeziehung des<br />
über Karstädt hinausgehenden Mittelbereiches.<br />
Pritzwalk - Wittstock/Dosse: Die <strong>Zusammenarbeit</strong> ist sehr gut und wird vor<br />
allem durch Projekte im Bereich <strong>der</strong> Wirtschaft<br />
und aktuell durch das För<strong>der</strong>programm „Kleinere<br />
Städte und überörtliche <strong>Zusammenarbeit</strong>“ geprägt.<br />
Interessant ist für die Zukunft, wie sich<br />
das neue Kooperationsmanagement und die<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> mit privaten Partnern in einer<br />
Arbeitsgemeinschaft bewährt. Verbesserungspo-<br />
tenziale liegen im Bereich <strong>der</strong> Daseinsvorsorge<br />
und in <strong>der</strong> Einbeziehung aller Ämter und Gemeinden.<br />
Schönefeld – Wildau: Die <strong>Zusammenarbeit</strong> ist durch den RWK ge-<br />
prägt. Darüber hinaus ist die Situation in diesem<br />
funktionsteiligen Mitelzentrum nicht mit <strong>der</strong> in<br />
den funktionsteiligen Mittelzentren in periphere-<br />
ren Landesteilen zu vergleichen. Hier ergeben<br />
sich völlig an<strong>der</strong>e Kooperationsbedarfe, die al-<br />
lerdings von den Akteuren auch gezielt genutzt<br />
werden müssen. Von daher sollten von den Entscheidungsträgern<br />
die vertraglichen Regelungen<br />
zum funktionsteiligen Mittelzentrum und viel-<br />
leicht auch die Einschätzungen zu den Kooperationsbedarfen<br />
im gesamten Mittelbereich für die<br />
kurz- und mittelfristige Planungsperspektive<br />
eventuell noch einmal überprüft werden.<br />
Senftenberg – Großräschen: Hier existiert kein Kooperationsvertrag; das Eva-<br />
luationskriterium einer Vereinbarung zwischen<br />
81
den Partnern wird damit formell nicht erfüllt.<br />
Gleichwohl sind aber vielfältige Kooperationsak-<br />
tivitäten zu verzeichnen, die durch die Arbeit des<br />
RWK geprägt sind. Beson<strong>der</strong>s erwähnenswert<br />
ist die weitgehende <strong>Zusammenarbeit</strong> im Zweck-<br />
verband Lausitzer Seenland Brandenburg.<br />
Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz: Die Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation befindet sich in<br />
einem frühen Stadium, sie wird allerdings von<br />
den beteiligten Akteuren des gesamten Mittelbereiches<br />
mit einem überzeugenden Engagement<br />
vorangetrieben. Mit <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> erstell-<br />
ten Entwicklungskonzeption bzw. prioritärer Projekte<br />
sollte jetzt schnell begonnen werden.<br />
Zehdenick – Gransee: Die Kooperation kann als sehr gut und dyna-<br />
misch bezeichnet werden. Die Organisation <strong>der</strong><br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> und die transparente Finanzie-<br />
rung <strong>der</strong> Projekte sind vorbildlich. Die bisherigen<br />
Kooperationsprojekte, die sich auf den Bereich<br />
Wirtschaft und Tourismus konzentrieren, sollten<br />
zukünftig noch auf die Infrastrukturversorgung<br />
und die Verwaltungszusammenarbeit ausgedehnt<br />
werden.<br />
82
5. Empfehlungen<br />
Auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> bisherigen Ergebnisse ergeben sich die nachfolgenden Empfehlun-<br />
gen, die sich zum einen an die funktionsteiligen Mittelzentren und zum an<strong>der</strong>en an<br />
das Land Brandenburg richten.<br />
Empfehlungen für die funktionsteiligen Mittelzentren<br />
� Die Kooperation in den funktionsteiligen Mittelzentren muss insgesamt intensiviert<br />
und dabei insbeson<strong>der</strong>e auf alle Bereiche <strong>der</strong> Daseinsvorsorge ausge-<br />
weitet werden. Die verantwortlichen Akteure sollten dabei vorbehaltloser an die<br />
<strong>Zusammenarbeit</strong> herangehen und keine Themen von vornherein ausschließen.<br />
Der Kooperationsdruck und -bedarf wird in den kommenden Jahren aufgrund<br />
des demografischen Wandels mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter zunehmen.<br />
Rück- und Umbaumaßnahmen werden die Sicherstellung <strong>der</strong> Daseinsvorsorge<br />
in Zukunft mehr und mehr bestimmen. Von daher müssen entsprechende ge-<br />
meinsame Strategien und Projekte zwischen den funktionsteiligen Mittelzentren<br />
entwickelt werden. Dies betrifft insbeson<strong>der</strong>e die Bereiche<br />
- Gesundheitsversorgung<br />
- Kultur und Freizeit<br />
- Verkehrsdienstleistungen und Erreichbarkeit von Infrastrukturen (auch unter<br />
Beachtung verän<strong>der</strong>ter Mobilität und Nachfrage)<br />
- gemeinsame Flächenplanung und -ausweisung, Ansiedlungsakquisition<br />
� Ein weiterer Bereich, <strong>der</strong> sich für eine Intensivierung <strong>der</strong> Kooperationsaktivitäten<br />
anbietet ist die Verwaltungszusammenarbeit. Hier sollten allerdings Er-<br />
wartungen an schnelle und übermäßige „Spareffekte“ nicht zu hoch gesteckt<br />
werden.<br />
� Die Kooperation in den funktionsteiligen Mittelzentren sollte systematisch vor-<br />
bereitet und begleitet werden. In <strong>der</strong> Hälfte <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />
übernehmen beispielsweise Versorgungskonzepte o<strong>der</strong> vergleichbare Konzepte<br />
diese Funktion und haben sich bewährt.<br />
� Die Einbindung <strong>der</strong> übrigen Gemeinden und Ämter <strong>der</strong> Mittelbereiche muss<br />
konsequent umgesetzt und forciert werden. Die bisherige informelle Einbindung<br />
in vielen funktionsteiligen Mittelzentren sollte um eine tatsächliche Mitwirkung in<br />
83
Projekten und Maßnahmen erweitert werden. Die funktionsteiligen Mittelzentren<br />
sollten den Gemeinden und Ämtern diese <strong>Zusammenarbeit</strong> noch stärker anbie-<br />
ten und auch einfor<strong>der</strong>n.<br />
� Die Verwendung des Mehrbelastungsausgleichs für funktionsteilige Mittelzen-<br />
tren aus dem Finanzausgleichsgesetz sollte transparent und zielführend er-<br />
folgen. Auf diesem Weg kann zum einen die Notwendigkeit und zum an<strong>der</strong>en<br />
auch <strong>der</strong> praktische Nutzen <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> für alle Beteiligten und nicht<br />
zuletzt für die breite Öffentlichkeit nachvollziehbar dargestellt werden.<br />
� Konkrete Umsetzungsprogramme bzw. Maßnahmenlisten mit eventuell jährlichen<br />
Schwerpunktsetzungen unterstützen diese Transparenz und ermöglichen<br />
eine systematische und zielführende Abwicklung. Gleichzeitig ermöglichen sol-<br />
che Programme die Selbstevaluation bzw. Kontrolle <strong>der</strong> Aktivitäten. Eine solche<br />
Selbstevaluation in regelmäßigen Abständen wäre grundsätzlich ratsam, um<br />
Ziel- und Maßnahmenanpassungen vornehmen zu können.<br />
� Die Kommunikation <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> und die Öffentlichkeitsarbeit sollte<br />
von allen funktionsteiligen Mittelzentren ausgebaut werden, um das Verständnis<br />
und die Akzeptanz in <strong>der</strong> Öffentlichkeit zu erhöhen. Die zuvor genannten Bei-<br />
spiele (Transparenz <strong>der</strong> Mittelverwendung, Umsetzungsprogramme, Selbstevaluation)<br />
und ihre Darstellung in <strong>der</strong> Öffentlichkeit können dieses Anliegen unter-<br />
stützen.<br />
Empfehlungen für das Land<br />
� Das Land sollte die Kooperationsbemühungen <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzen-<br />
tren weiterhin aktiv unterstützen. Bei Bedarf sollte ein themen- bzw. projekt-<br />
bezogener Informationsaustausch angeboten bzw. organisiert werden. Wünschenswert<br />
und hilfreich wäre auch eine intensivere Unterstützung durch die<br />
Kommunalaufsicht, beispielsweise durch „Handreichungen“ o<strong>der</strong> Hilfestellun-<br />
gen bei vertraglichen und konzeptionellen Vorarbeiten.<br />
� Gemeinsam mit den funktionsteiligen Mittelzentren sollten das Land und ganz<br />
speziell die Gemeinsame Landesplanungsabteilung die Stärkung und die Ak-<br />
zeptanz des Instruments „funktionsteiliges Mittelzentrum“ bei an<strong>der</strong>en Akteuren<br />
im Land (z. B. Investitionsbank des Landes Brandenburg, ZukunftsAgentur<br />
Brandenburg GmbH, Landkreise, Planungsgemeinschaften) weiter vorantrei-<br />
ben.<br />
84
� Im Falle <strong>der</strong> Fortschreibung des Landesentwicklungsplans sollten die räumli-<br />
chen Abgrenzungen einzelner Mittelbereiche überprüft und bei Bedarf ver-<br />
än<strong>der</strong>t werden. Dies könnte unter Umständen die <strong>Zusammenarbeit</strong> von einzelnen<br />
funktionsteiligen Mittelzentren mit allen beteiligten Gebietskörperschaften<br />
erleichtern.<br />
� Vom funktionsteiligen Mittelzentrum Senftenberg – Großräschen sollte die<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan und <strong>der</strong> Abschluss<br />
einer verbindlichen Kooperationsvereinbarung eingefor<strong>der</strong>t werden.<br />
85
Anhang
Anhang 1: Terminliste Gespräche mit Vertretern an<strong>der</strong>er Bundeslän<strong>der</strong><br />
Bundesland Institution Gesprächspartner Gesprächsart Datum<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Ministerium für Verkehr, Bau und Landesplanung Frau Petra Schmidt Persönlich 11.08.2011<br />
Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie<br />
und Landesplanung<br />
1<br />
Herr Dr. Gerd Rojahn Telefonisch 15.08.2011<br />
Sachsen Staatsministerium des Innern Frau Margit Hegewald Telefonisch 15.08.2011<br />
Saarland Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr Frau Dr. Andrea Chlench Telefonisch 16.08.2011<br />
Sachsen-Anhalt Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Frau Margit Paepke Telefonisch 16.08.2011<br />
Schleswig-Holstein Innenministerium Herr Frank Liebrenz Telefonisch 16.08.2011<br />
Bayern<br />
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,<br />
Verkehr und Technologie<br />
Herr Matthias Proske Telefonisch 17.08.2011<br />
Nordrhein-Westfalen Staatskanzlei Herr Wolfgang Rembierz Telefonisch 18.08.2011<br />
Baden-Württemberg Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Herr Ulrich Schulze Telefonisch 18.08.2011<br />
Nie<strong>der</strong>sachsen<br />
Thüringen<br />
Hessen<br />
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz<br />
und Landesentwicklung<br />
Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr<br />
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Herr Püschel Telefonisch 24.08.2011<br />
Herr Thomas Walter Telefonisch 24.08.2011<br />
Frau Dagmar Meinen Telefonisch 30.08.2011
Anhang 2: Literaturübersicht<br />
Studien und Gutachten zum Thema funktionsteilige Mittelzentren<br />
Bartsch, R. (2006): Funktionsteilige zentrale Orte in Deutschland, Schriftenreihe des Lehrstuhls<br />
für Wirtschaftsgeographie und Regionalentwicklung <strong>der</strong> Friedrich-Schiller-Universität<br />
Jena. Jena.<br />
Blotevogel, Hans H. [Hg.] (2002): Fortentwicklung des Zentrale-Orte-Konzepts, Forschungs-<br />
und Sitzungsberichte ARL; Bd. 217. Hannover.<br />
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Bundesamt für Bauwesen<br />
und Raumordnung (2008): Kooperation zentraler Orte in schrumpfenden Regionen.<br />
Praxiserfahrungsstudie, Werkstatt: Praxis Heft 53. Bonn.<br />
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Bundesinstitut für Bau-,<br />
Stadt- und Raumforschung (2011): Regionalstrategie Daseinsvorsorge - Denkanstöße für<br />
die Praxis. Berlin.<br />
Kern, J. (2010): Städteverbünde als Instrument <strong>der</strong> Raumordnung - Untersuchung <strong>der</strong> mittelzentralen<br />
Städteverbünde im Ländlichen Raum <strong>der</strong> neuen Bundeslän<strong>der</strong> sowie Ableitung von<br />
Handlungsempfehlungen für den Freistaat Thüringen, Diplomarbeit an <strong>der</strong> Justus-Liebig-<br />
Universität Gießen, Institut für Geographie. Gießen.<br />
Leitz, A. (2001): Zur Ausweisung gemeinsamer Zentraler Orte, Schriften zur Raumordnung<br />
und Landesplanung 7. Augsburg/ Kaiserslautern.<br />
Lippert, J. (1994): Sonneberg – Neustadt bei Coburg, Zur Möglichkeit eines grenzüberschreitenden<br />
Doppelzentrums, Schriften <strong>der</strong> Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar.<br />
Weimar.<br />
Müller, B.; Beyer, B. (1999): Regionalentwicklung im kommunalen Verbund. Städteverbünde<br />
in Sachsen. Dresdner Materialien zur räumlichen Planung (Bd. 3 Region und Stadt). Dresden.<br />
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien (2009): Abschlussbericht<br />
zur Überprüfung einiger Zentraler Orte höherer Stufe entsprechend <strong>der</strong> Festlegung im Landes-entwicklungsplan<br />
(LEP) 2004 Thüringen. Erfurt.<br />
Zerbs, F. (2009): Sicherung von sozialen Infrastrukturleistungen durch Städtekooperationen<br />
in schrumpfenden peripheren Gebieten- Am Beispiel Gransee und Zehdenick. Bachelorarbeit<br />
an <strong>der</strong> Technischen Universität Berlin, Fachgebiet Orts- , Regional- und Landesplanung. Berlin.<br />
Landesentwicklungspläne und -programme<br />
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie<br />
[Hg.] (2006): Landesentwicklungsprogramm Bayern 2006. München.<br />
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung [Hg.] (2000):<br />
Landesentwicklungsplan Hessen 2000. Wiesbaden.<br />
Innenministerium des Landes Schleswig – Holstein [Hg.] (2010): Landesentwicklungsplan<br />
Schleswig – Holstein 2010. Kiel.<br />
2
Landesregierung Nordrhein – Westfalen [Hg.] (1995): Landesentwicklungsplan Nordrhein<br />
– Westfalen 1995. Düsseldorf.<br />
Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland - Pfalz [Hg.] (2008): Landesentwicklungsprogramm<br />
Rheinland – Rheinland Pfalz (LEP IV) 2008. Mainz.<br />
Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung [Hg.] (2005): Landesraumentwicklungsprogramm<br />
Mecklenburg – Vorpommern 2005. Schwerin.<br />
Ministerium für Bau und Verkehr Thüringen [Hg.] (2004): Landesentwicklungsplan Thüringen<br />
2004. Erfurt.<br />
Ministerium für Inneres und Sport Saarland [Hg.] (2006): Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt<br />
„Siedlung“ 2006. Saarbrücken.<br />
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen – Anhalt [Hg.] (2010): Landesentwicklungsplan<br />
Sachsen – Anhalt 2010. Magdeburg.<br />
Ministerium für Umwelt Saarland [Hg.] (2004): Landesentwicklungsplan, Teilabschnitt<br />
„Umwelt“ 2004. Saarbrücken.<br />
Nie<strong>der</strong>sächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und<br />
Landesentwicklung [Hg.] (2008): Landes - Raumordnungsprogramm Nie<strong>der</strong>sachsen 2008.<br />
Hannover.<br />
Sächsisches Staatsministerium des Innern [Hg.] (2003): Landesentwicklungsplan Sachsen<br />
2003. Dresden.<br />
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung<br />
Potsdam [Hg.] (2009): Landesentwicklungsplan Berlin - Brandenburg 2009. Hauptstadtregion<br />
Berlin-Brandenburg. Berlin/ Potsdam.<br />
Wirtschaftsministerium Baden - Württemberg [Hg.] (2002): Landesentwicklungsplan Baden<br />
- Württemberg 2002. Stuttgart.<br />
Ausgewählte Konzepte und Materialien <strong>der</strong> funktionsteiligen Mittelzentren<br />
B.B.S.M - Brandenburgische Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
mbH (2009): Integrierte Konzeption zur Wahrnehmung <strong>der</strong> mittelzentralen Funktionen<br />
und Aufgaben Pritzwalk – Wittstock/ Dosse. Potsdam.<br />
Complan Gesellschaft für Kommunalberatung, Planung und Standortentwicklung mbH<br />
(2003): Städtenetz Prignitz. Laufende Beobachtung <strong>der</strong> Bevölkerungsentwicklung und <strong>der</strong><br />
sich daraus ergebenden Konsequenzen als Instrument für eine zukunftsfähige Stadtentwicklungspolitik<br />
in den acht Städten des Städtenetzes Prignitz. Potsdam.<br />
Complan Gesellschaft für Kommunalberatung, Planung und Standortentwicklung mbH;<br />
B.B.S.M - Brandenburgische Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
mbH (2007): Integriertes Stadtentwicklungskonzept Senftenberg 2020. Potsdam.<br />
GMA Gesellschaft für Markt – und Absatzforschung mbH (2009): Interkommunales Einzelhandelskonzept<br />
für die Städte Wittstock/ Dosse und Pritzwalk. Erfurt.<br />
KLS Pritzwalk – Wittstock/ Dosse (2011): Städtebauliche Zielplanung bzw. Ergänzung des<br />
überörtlichen Entwicklungskonzeptes. Pritzwalk – Wittstock/ Dosse.<br />
3
Landkreis Elbe – Elster (2011): Modellvorhaben <strong>der</strong> Raumordnung: Wettbewerbsbeitrag des<br />
Landkreises Elbe – Elster „Regionalstrategie Daseinsvorsorge“. Herzberg.<br />
LPG Landesweite Planungsgesellschaft mbH (2011): Entwicklungskonzeption für den Mittelbereich<br />
Wer<strong>der</strong> (H:) – Beelitz. Berlin.<br />
REGIO - Nord Regionale Entwicklungsgesellschaft in Oberhavel – Nord mbH (2011):<br />
Maßnahmenbezogenes Konzept zum INSEK Gransee – Zehdenick unter Einbeziehung <strong>der</strong><br />
Stadt Fürstenberg/ Havel im Rahmen des Städtebauför<strong>der</strong>programms „Kleinere Städte und<br />
Gemeinden“. Gransee.<br />
Stadtverwaltung Lauchhammer (2006): Stadtentwicklungskonzept Lauchhammer 2020.<br />
Lauchhammer.<br />
Technische Universität, Berlin Fakultät VI, Institut für Stadt und Regionalplanung,<br />
Fachgebiet Planungstheorie (2006): Raumordnungskonzept Oberhavel – Nord. Berlin.<br />
Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock - Dosse e.V. (2011): Wachstumskern Autobahndreieck<br />
Wittstock - Dosse Jahresbericht 2010/ 2011. Meyenburg.<br />
4
Anhang 3: Terminliste Gespräche mit Vertretern <strong>der</strong> Mittelzentren<br />
Mittelzentrum Funktion Gesprächspartner Gesprächsart Datum<br />
Elsterwerda – Bad Liebenwerda Bürgermeister Elsterwerda Herr Herrchen Persönlich 02.03.2012<br />
Bürgermeister Bad Liebenwerda Herr Richter Persönlich 07.03.2012<br />
Stellvertr. Bürgermeister Elsterwerda Herr Große Telefonisch 23.03.2012<br />
Verkehrsmanagement Elbe-Elster GmbH Frau Zerna-Beck Schriftlich 05.04.2012<br />
Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg Frau Rettkowksi Telefonisch 27.03.2012<br />
Amtsdirektor Schradenland Herr Richter Telefonisch 16.04.2012<br />
Teilnahme Lenkungsgruppe Persönlich 20.03.2012<br />
Lauchhammer – Schwarzheide Bürgermeister Lauchhammer Herr Pohlenz Persönlich 09.02.2012<br />
Perleberg – Wittenberge<br />
Pritzwalk – Wittstock/ Dosse<br />
Bürgermeister Schwarzheide<br />
stellvertreten<strong>der</strong> Bgm.<br />
5<br />
Herr Schmidt<br />
Herr Richter<br />
Persönlich 06.02.2012<br />
Verantwortlich für FNP Herr Pfützner Telefonisch 30.03.2012<br />
Vorsitzen<strong>der</strong> Ausschuss Herr Gleitsmann Telefonisch 11.04.2012<br />
Bürgermeister Perleberg<br />
Leiter SG Wirtschaft<br />
Herr Fischer<br />
Herr Possenau<br />
Persönlich 13.02.2012<br />
Bürgermeister Wittenberge Herr Dr. Hermann Persönlich 13.02.2012<br />
Koordinatorin RWK Frau Jura Telefonisch 19.03.2012<br />
Landkreis Prignitz Geschäftsbereich II Frau Schimko Telefonisch 03.04.2012<br />
Wirtschaftsför<strong>der</strong>ungsgesellschaft Herr Büttner Telefonisch 03.04.2012<br />
Tourismusverband Prignitz Herr Neumann Telefonisch 26.03.2012<br />
Bürgermeister Pritzwalk<br />
GB-Leiter<br />
Bürgermeister Wittstock/ Dosse<br />
Stellvertreten<strong>der</strong> Bgm.<br />
Herr Brockmann,<br />
Herr Sachs<br />
Herr Gehrmann<br />
Herr Herm<br />
Persönlich 25.01.2012<br />
Persönlich 25.01.2012
Mittelzentrum Funktion Gesprächspartner Gesprächsart Datum<br />
BBSM mbH Herr Blank Persönlich 28.03.2012<br />
Amt Pritzwalk -Stadtentwicklung, Bau Herr Dr. Thiel Telefonisch 19.03.2012<br />
Complan GmbH Herr von Popowski Telefonisch 23.04.2012<br />
Amtsdirektion Meyenburg Frau Lange Telefonisch 27.03.2012<br />
Schönefeld – Wildau Bürgermeister Schönefeld Herr Dr. Haase Persönlich 07.02.2012<br />
Bürgermeister Wildau<br />
WiFö & RWK<br />
6<br />
Herr Dr. Malich<br />
Herr Rienitz<br />
Persönlich 07.02.2012<br />
Gemeinde Wildau Frau Paul Telefonisch 28.03.2012<br />
Senftenberg – Großräschen Bürgermeister Großräschen Herr Zenker Persönlich 09.02.2012<br />
Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz<br />
Zehdenick – Gransee<br />
Bürgermeister Senftenberg Herr Fredrich Persönlich 20.02.2012<br />
Zweckverband Lausitzer Seenland Herr Vetter Telefonisch 27.04.2012<br />
Bürgermeister Wer<strong>der</strong> (Havel)<br />
Wissenschaftl. Mitarbeiterin<br />
Bürgermeister Beelitz<br />
Hauptamt Beelitz<br />
Herr Große<br />
Frau Lack<br />
Herr Knuth<br />
Herr Ohligschläger<br />
Persönlich 02.03.2012<br />
Persönlich 06.03.2012<br />
LPG Landesweite Planungsgesellschaft mbH Herr Schrö<strong>der</strong> Persönlich 19.03.2012<br />
Vors. Stadtverordnetenversammlung Frau Gottschalk Telefonisch 28.03.2012<br />
Buschmann & Winkelmann GmbH (Spargelhof<br />
Klaistow)<br />
Amtsleiter Gransee<br />
Geschäftsführer RegioNord mbH<br />
Frau Winkelmann Telefonisch 28.03.2012<br />
Herr Stege<br />
Herr Bechert<br />
Persönlich 01.02.2012<br />
Bürgermeister Zehdenick Herr Dahlenburg Persönlich 01.02.2012<br />
Vorsitzen<strong>der</strong> Amtsausschuss Herr Stuhlmüller Telefonisch 29.03.2012<br />
Vors. Stadtverordnetenversammlung Herr Hass Telefonisch 27.03.2012
Anhang 4: Gesprächsleitfaden<br />
Gesprächspartner und Funktion:<br />
Datum:<br />
1. Abschnitt: Rahmenbedingungen<br />
1 Wie stellen sich die funktionalen, historischen und politischen Bezüge (zwischen<br />
den Gemeinden und im gemeinsamen Mittelbereich) dar?<br />
2 Wie kann man den Anlass und den Verlauf <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> beschreiben?<br />
3 Welche Akteure sind involviert?<br />
2. Abschnitt: Verbindliche Regelungen<br />
4 Existieren verbindliche Regelungen über die interkommunale <strong>Zusammenarbeit</strong>?<br />
(Verträge, Vereinbarungen)<br />
5 Sind in diesen Festlegungen enthalten<br />
5.1 � zu gemeindeübergreifenden Gremien<br />
5.2 � zur Funktionszuordnung und zur Weiterentwicklung <strong>der</strong> Funktionen<br />
(Wirtschafts- und Siedlungsfunktionen, Einzelhandelsfunktionen, Kultur- und Freizeitfunktionen,<br />
Verwaltungsfunktionen, Bildungs-, Gesundheits-, soziale Versorgungsfunktionen sowie überregiona-<br />
le Verkehrsknotenfunktionen)<br />
5.3 � zur Finanzierung<br />
5.4 � zur <strong>Zusammenarbeit</strong> mit den Gemeinden des Verflechtungsbereiches<br />
6 Enthalten die Vereinbarungen weitere Elemente <strong>der</strong> Kooperation, wenn ja welche?<br />
3. Abschnitt: Umsetzung <strong>der</strong> Kooperation<br />
7 Wie erfolgt die organisatorische Umsetzung <strong>der</strong> <strong>interkommunalen</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>?<br />
(Gremien, Arbeitsgruppen, Einbindung SVV)<br />
8 Wie wurde die Kooperation bisher inhaltlich untersetzt bzw. auf welchen Gebieten<br />
ist sie geplant?<br />
8.1 � <strong>Zusammenarbeit</strong> im Bereich <strong>der</strong> zentralörtlichen Funktionen<br />
(z.B. Einrichtungen, die gemeinsam vorgehalten werden bzw. die den gemeinsamen Mittelbereich<br />
versorgen usw.)<br />
8.2 � <strong>Zusammenarbeit</strong> auf sonstigen Gebieten<br />
(Planung, Tourismus, Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung, Veranstaltungskalen<strong>der</strong> etc.)<br />
9 Sind die Gemeinden des gemeinsamen Mittelbereiches eingebunden?<br />
7
10 Wie kann die Umsetzung belegt werden?<br />
(Protokolle, Arbeitsberichte, Dokumentationen etc.)<br />
4. Ergebnisse / Wirkungen<br />
11 Gibt es erste Ergebnisse/ Projekte <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong>?<br />
11.1 � hinsichtlich <strong>der</strong> zentralörtlichen Funktionsteilung<br />
11.2 � auf sonstigen Gebieten (z.B. Tourismus, Marketing)<br />
12 Wie schätzen die Gesprächspartner die Entwicklung ein?<br />
13 Sehen Sie zukünftig neue Themen <strong>der</strong> <strong>Zusammenarbeit</strong> bzw. Weiterentwicklungspotenziale?<br />
Gibt es Verbesserungs- und/o<strong>der</strong> Unterstützungsbedarf?<br />
Können Sie uns abschließend weitere Gesprächspartner in Ihrer Gemeinde benennen,<br />
mit denen wir ergänzende Interviews führen können.<br />
…………………………………………………………<br />
…………………………………………………………<br />
Erfahrungsgemäß lassen sich die aufgezeigten Fragen im Rahmen eines gut an<strong>der</strong>thalbstündigen<br />
Gesprächs abarbeiten. Wir hoffen, dass das Fachgespräch auch für<br />
Sie interessant ist und bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich.<br />
8
Anhang 5: Funktionsteilige Mittelzentren und Mittelbereiche<br />
Funktionsteiliges Mittelzentrum Seite<br />
Elsterwerda – Bad Liebenwerda 10<br />
Lauchhammer – Schwarzheide 13<br />
Perleberg – Wittenberge 15<br />
Pritzwalk – Wittstock/Dosse 18<br />
Schönefeld – Wildau 21<br />
Senftenberg – Großräschen 24<br />
Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz 26<br />
Zehdenick – Gransee 29<br />
9
1. Mittelbereich Elsterwerda – Bad Liebenwerda<br />
Tab. 1: Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und Prognose im Mittelbereich<br />
Amtsfreie Gemeinde<br />
/Amt<br />
Bevölkerung des Mittelbereichs<br />
Bevölkerungsdichte<br />
10<br />
Bevölkerungsprognose<br />
2020<br />
(Personen) (in Prozent) (EW/km²) (Personen) (2010=100)<br />
Elsterwerda 8.694 22,4 214 7.676 88,3<br />
Bad Liebenwerda 9.973 25,6 72 8.990 90,1<br />
Mühlberg/Elbe 4.244 10,9 48 3.763 88,7<br />
Plessa 6.671 17,1 50 5.779 86,6<br />
Rö<strong>der</strong>land 4.358 11,2 95 3.946 90,5<br />
Schradenland 4.958 12,7 66 4.600 92,8<br />
Mittelbereich gesamt 38.898 100,0 75 34.754 89,3<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobachtung: Bevölkerungsvorausschätzung 2011 bis 2030 - Ämter und<br />
amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, Fachbeiträge Raumbeobachtung, Mai 2012; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg:<br />
Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden.<br />
Tab. 2: Pendlerverflechtungen im Mittelbereich<br />
Elsterwerda<br />
Bad Liebenwerda<br />
Mühlberg/<br />
Elbe Plessa<br />
Rö<strong>der</strong>land <br />
Schradenland<br />
Auspendler<br />
gesamt<br />
Elsterwerda - 226 - 31 134 31 422<br />
Bad Liebenwerda<br />
345 - 91 14 96 - 546<br />
Mühlberg/Elbe 59 134 - - 13 - 206<br />
Plessa 229 70 - - 31 30 360<br />
Rö<strong>der</strong>land 301 111 - 11 - - 423<br />
Schradenland 251 45 - - 62 - 358<br />
Einpendler<br />
gesamt 1185 586 91 56 336 61<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- u. Arbeitsort, Stand: 30.06.2010.
Tab. 3: Pendler gesamt<br />
Einpendler Auspendler<br />
<strong>innerhalb</strong><br />
Mittelbereich überregional Mittelbereich überregional<br />
11<br />
Pendler-<br />
saldo<br />
Elsterwerda 1.185 1.310 422 1.243 830<br />
Bad Liebenwerda<br />
586 994 546 1.685 -651<br />
Mühlberg/Elbe 91 103 206 856 -868<br />
Plessa 56 171 360 585 -718<br />
Rö<strong>der</strong>land 336 403 423 933 -617<br />
Schradenland 61 533 358 1.388 -1.152<br />
Gesamt 3.514 6.690<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Abb. 1: Verwaltungsglie<strong>der</strong>ung (Stand 2008) und Raum Elsterwerda – Bad Liebenwerda<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr: Mittelbereichsprofil Elsterwerda – Bad Liebenwerda, 2010, S.2, www.falk.de (Zugriff 01.02.2012).<br />
12
2. Mittelbereich Lauchhammer – Schwarzheide<br />
Tab. 4: Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und Prognose im Mittelbereich<br />
Amtsfreie Gemeinde<br />
/Amt<br />
Bevölkerung des Mittelbereichs<br />
Bevölkerungsdichte<br />
13<br />
Bevölkerungsprognose<br />
2020<br />
(Personen) (in Prozent) (EW/km²) (Personen) (2010=100)<br />
Lauchhammer 16.956 45,6 192 14.511 85,6<br />
Schwarzheide 6.053 16,3 182 5.536 91,5<br />
Ortrand 6.481 17,4 84 5.729 88,4<br />
Ruhland 7.725 20,8 59 7.084 91,7<br />
Mittelbereich gesamt 37.215 100,0 113 32.860 88,3<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobachtung: Bevölkerungsvorausschätzung 2011 bis 2030 - Ämter und<br />
amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, Fachbeiträge Raumbeobachtung, Mai 2012; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg:<br />
Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden.<br />
Tab. 5: Pendlerverflechtungen im Mittelbereich<br />
Lauchhammer Schwarzheide Ortrand Ruhland<br />
Auspendler<br />
gesamt<br />
Lauchhammer - 426 74 44 544<br />
Schwarzheide 212 - 16 55 283<br />
Ortrand 229 235 - 58 522<br />
Ruhland 166 496 51 - 713<br />
Einpendler<br />
gesamt 607 1.157 141 157<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort,, Stand:<br />
30.06.2010.<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort,, Stand:<br />
30.06.2010.<br />
Tab. 6: Pendler gesamt<br />
Einpendler Auspendler<br />
<strong>innerhalb</strong><br />
Mittelbereich überregional Mittelbereich überregional<br />
Pendler-<br />
saldo<br />
Lauchhammer 607 1.747 544 2.710 -900<br />
Schwarzheide 1.157 1.966 283 1.106 1.734<br />
Ortrand 141 868 522 1.641 -1.154<br />
Ruhland 157 608 713 2.007 -1.955<br />
Gesamt 5.189 7.464<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort,, Stand:<br />
30.06.2010.
Abb. 2: Verwaltungsglie<strong>der</strong>ung (Stand 2008) und Raum Lauchhammer – Schwarzheide<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr: Mittelbereichsprofil Lauchhammer - Schwarzheide, 2010, S.2, , www.falk.de (Zugriff 01.02.2012).<br />
14
3. Mittelbereich Perleberg – Wittenberge<br />
Tab. 7: Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und Prognose im Mittelbereich<br />
Amtsfreie Gemeinde/Amt<br />
Bevölkerung des Mittelbereichs<br />
Bevölkerungsdichte<br />
15<br />
Bevölkerungsprognose<br />
2020<br />
(Personen) (in Prozent) (EW/km²) (Personen) (2010=100)<br />
Perleberg 12.332 23,7 89 11.237 91,1<br />
Wittenberge 18.571 35,7 368 16.120 86,8<br />
Bad Wilsnack/ Weisen 6.454 12,4 34 5.662 87,7<br />
Karstädt 6.376 12,3 25 5.566 87,3<br />
Lenzen-Elbtalaue 4.507 8,7 21 3.742 83,0<br />
Plattenburg 3.712 7,1 18 3.345 90,1<br />
Mittelbereich gesamt 51.952 100,0 50 45.672 87,9<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobachtung: Bevölkerungsvorausschätzung 2011 bis 2030 - Ämter und<br />
amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, Fachbeiträge Raumbeobachtung, Mai 2012; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg:<br />
Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden.<br />
Tab. 8: Pendlerverflechtungen im Mittelbereich<br />
Perleberg Wittenberge<br />
Bad Wilsnack/<br />
Weisen Karstädt<br />
Lenzen-<br />
Elbtalaue Plattenburg<br />
Auspendler<br />
gesamt<br />
Perleberg - 393 128 143 45 54 763<br />
Wittenberge 846 - 240 51 81 32 1250<br />
Bad Wilsnack/<br />
Weisen 404 545 - 21 - 44 1014<br />
Karstädt 434 137 33 - 39 15 658<br />
Lenzen-<br />
Elbtalaue 160 241 21 42 - - 464<br />
Plattenburg 223 83 84 24 - - 414<br />
Einpendler<br />
gesamt 2067 1399 506 281 165 145<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Tab. 9: Pendler gesamt<br />
Einpendler Auspendler<br />
<strong>innerhalb</strong><br />
Mittelbereich überregional Mittelbereich überregional<br />
16<br />
Pendlersaldo<br />
Perleberg 2.067 2.288 763 1.064 2.528<br />
Wittenberge 1399 1.288 1.250 1.392 45<br />
Bad Wilsnack/ Weisen 506 998 1.014 840 -350<br />
Karstädt 281 429 658 812 -760<br />
Lenzen-Elbtalaue 165 333 464 789 -755<br />
Plattenburg 145 315 414 512 -466<br />
Gesamt 5.651 5.409<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Abb. 3: Verwaltungsglie<strong>der</strong>ung (Stand 2008) und Raum Perleberg – Wittenberge<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr: MittelbereichsprofilPerleberg – Wittenberge, 2010, S.2, , www.falk.de (Zugriff 01.02.2012)<br />
17
4. Mittelbereich Prizwalk – Wittstock/Dosse<br />
Tab. 10: Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und Prognose im Mittelbereich<br />
Amtsfreie Gemeinde/ Amt<br />
Bevölkerung des Mittelbereichs<br />
Bevölkerungsdichte<br />
18<br />
Bevölkerungsprognose<br />
2020<br />
(Personen) (in Prozent) (EW/km²) (Personen) (2010=100)<br />
Pritzwalk 12.598 27,2 76 11.495 91,2<br />
Wittstock/Dosse 15.235 32,9 37 13.479 88,5<br />
Groß Pankow (Prignitz) 4.132 8,9 17 3.450 83,5<br />
Heiligengrabe 4.693 10,1 23 4.181 89,1<br />
Meyenburg 4.577 9,9 22 3.710 81,1<br />
Putlitz-Berge 5.096 11,0 21 4.423 86,8<br />
Mittelbereich gesamt 46.331 100,0 31 40.738 87,9<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobachtung: Bevölkerungsvorausschätzung 2011 bis 2030 - Ämter und<br />
amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, Fachbeiträge Raumbeobachtung, Mai 2012; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg:<br />
Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden.<br />
Tab. 11: Pendlerverflechtungen im Mittelbereich<br />
Pritzwalk<br />
Wittstock/<br />
Dosse<br />
Groß Pankow<br />
(Prignitz)<br />
Heiligengrabe<br />
Meyenburg<br />
Putlitz-<br />
Berge<br />
Auspendler<br />
gesamt<br />
Pritzwalk - 174 104 123 145 47 593<br />
Wittstock/<br />
Dosse 358 - 16 489 57 - 920<br />
Groß Pankow<br />
(Prignitz) 380 44 - 18 25 15 482<br />
Heiligengrabe 193 490 14 - 22 - 719<br />
Meyenburg 466 59 - 12 - 34 571<br />
Putlitz-Berge 391 24 33 20 37 - 505<br />
Einpendler<br />
gesamt 1788 791 167 662 286 96<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Tab. 12: Pendler gesamt<br />
Einpendler Auspendler<br />
<strong>innerhalb</strong><br />
Mittelbereich überregional Mittelbereich überregional<br />
19<br />
Pendler-<br />
saldo<br />
Pritzwalk 1.788 1.244 593 1.333 1.106<br />
Wittstock/Dosse 791 1.154 920 2.074 -1.049<br />
Groß Pankow<br />
(Prignitz) 167 218 482 679 -776<br />
Heiligengrabe 662 424 719 603 -236<br />
Meyenburg 286 399 571 654 -540<br />
Putlitz-Berge 96 481 505 969 -897<br />
Gesamt 3.920 6.312<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Abb. 4: Verwaltungsglie<strong>der</strong>ung (Stand 2008) und Raum Pritzwalk – Wittstock/Dosse<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr: MittelbereichsprofilPritzwalk – Wittstock/Dosse 2010, S.2, www.falk.de (Zugriff 01.02.2012).<br />
20
5. Mittelbereich Schönefeld – Wildau<br />
Tab. 13: Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und Prognose im Mittelbereich<br />
Amtsfreie Gemeinde/Amt<br />
Bevölkerung des Mittelbereichs<br />
Bevölkerungsdichte<br />
21<br />
Bevölkerungsprognose<br />
2020<br />
(Personen) (in Prozent) (EW/km²) (Personen) (2010=100)<br />
Schönefeld 13.256 27,9 162 17.183 129,6<br />
Wildau 9.898 20,9 1.088 10.678 107,9<br />
Eichwalde 6.205 13,1 2.216 6.423 103,5<br />
Schulzendorf 7.706 16,2 847 8.328 108,1<br />
Zeuthen 10.400 21,9 819 9.996 96,1<br />
Mittelbereich gesamt 47.465 100,0 412 52.608 110,8<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobachtung: Bevölkerungsvorausschätzung 2011 bis 2030 - Ämter und<br />
amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, Fachbeiträge Raumbeobachtung, Mai 2012; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg:<br />
Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden.<br />
Tab. 14: Pendlerverflechtungen im Mittelbereich<br />
Schönefeld Wildau Eichwalde Schulzendorf Zeuthen<br />
Auspendler gesamt<br />
Schönefeld - 64 - - 20 84<br />
Wildau 157 - 30 32 132 351<br />
Eichwalde 90 80 - 25 49 244<br />
Schulzendorf 175 132 38 - 93 438<br />
Zeuthen 159 217 43 28 - 447<br />
Einpendler gesamt<br />
581 493 111 85 294<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Tab. 15: Pendler gesamt<br />
Einpendler Auspendler<br />
<strong>innerhalb</strong><br />
Mittelbereich überregional Mittelbereich überregional<br />
22<br />
Pendler-<br />
saldo<br />
Schönefeld 581 11.691 84 4.279 7.909<br />
Wildau 493 3.516 351 2.629 1.029<br />
Eichwalde 111 315 244 1.774 -1.592<br />
Schulzendorf 85 346 438 2.259 -2.266<br />
Zeuthen 294 782 447 2.898 -2.269<br />
Gesamt 16.650 13.839<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Abb. 5: Verwaltungsglie<strong>der</strong>ung (Stand 2008) und Raum Schönefeld – Wildau<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr: MittelbereichsprofilSchönefeld - Wildau 2010, S.2, www.falk.de (Zugriff 01.02.2012).<br />
23
6. Mittelbereich Senftenberg – Großräschen<br />
Tab. 16: Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und Prognose im Mittebereich<br />
Amtsfreie Gemeinde/Amt<br />
Bevölkerung des Mittelbereichs<br />
Bevölkerungsdichte<br />
24<br />
Bevölkerungsprognose<br />
2020<br />
(Personen) (in Prozent) (EW/km²) (Personen) (2010=100)<br />
Senftenberg 26.530 52,7 209 23.190 87,4<br />
Großräschen 10.262 20,4 126 9.042 88,1<br />
Altdöbern 6.203 12,3 31 5.510 88,8<br />
Schipkau 7.357 14,6 44 6.733 91,5<br />
Mittelbereich gesamt 50.352 100,0 88 44.475 88,3<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobachtung: Bevölkerungsvorausschätzung 2011 bis 2030 - Ämter und<br />
amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, Fachbeiträge Raumbeobachtung, Mai 2012; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg:<br />
Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden.<br />
Tab. 17: Pendlerverflechtungen im Mittelbereich<br />
Senftenberg Großräschen Altdöbern Schipkau<br />
Auspendler<br />
gesamt<br />
Senftenberg - 294 - 173 467<br />
Großräschen 527 - 68 49 644<br />
Altdöbern 201 142 - - 343<br />
Schipkau 659 136 - - 795<br />
Einpendler<br />
gesamt 1.387 572 68 222<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.<br />
Tab. 18: Pendler gesamt<br />
Einpendler Auspendler<br />
<strong>innerhalb</strong><br />
Mittelbereich überregional Mittelbereich überregional<br />
Pendler-<br />
saldo<br />
Senftenberg 1.387 5.815 467 3.935 2.800<br />
Großräschen 572 1.068 644 1.547 -551<br />
Altdöbern 68 473 343 1.683 -1.485<br />
Schipkau 222 473 795 1.448 -1.548<br />
Gesamt 7.829 8.613<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Abb. 6: Verwaltungsglie<strong>der</strong>ung (Stand 2008) und Raum Senftenberg – Großräschen<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr: MittelbereichsprofilSenftenberg - Großräschen 2010, S.2, www.falk.de (Zugriff 01.02.2012).<br />
25
7. Mittelbereich Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz<br />
Tab. 19: Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und Prognose im Mittelbereich<br />
Amtsfreie<br />
Gemeinde<br />
/Amt<br />
Bevölkerung des Mittelbereichs<br />
Bevölkerungsdichte<br />
26<br />
Bevölkerungsprognose bis<br />
2020<br />
(Personen) (in Prozent) (EW/km²) (Personen) (2010=100)<br />
Wer<strong>der</strong> (Havel) 23.017 40,0 198 23.113 100,4<br />
Beelitz 11.900 20,7 66 11.358 95,4<br />
Groß Kreutz 8.197 14,3 83 7.796 95,1<br />
Schwielowsee 10.187 17,7 175 10.675 104,8<br />
Seddiner See 4.198 7,3 175 4.033 96,1<br />
Mittelbereich gesamt 57.499 100,0 120 56.975 99,1<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobachtung: Bevölkerungsvorausschätzung 2011 bis 2030 - Ämter und<br />
amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, Fachbeiträge Raumbeobachtung, Mai 2012; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg:<br />
Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden.<br />
Tab. 20: Pendlerverflechtungen im Mittelbereich<br />
Wer<strong>der</strong>(Havel) Beelitz<br />
Groß<br />
Kreutz Schwielowsee<br />
Seddiner<br />
See<br />
Auspendler<br />
gesamt<br />
Wer<strong>der</strong>(Havel) - 107 133 216 38 494<br />
Beelitz 105 - 13 56 153 327<br />
Groß Kreutz 368 33 - 36 11 448<br />
Schwielowsee 148 40 12 - 25 225<br />
Seddiner See 20 100 - 38 - 158<br />
Einpendler<br />
gesamt 641 280 158 346 227<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Tab. 21: Pendler gesamt<br />
Einpendler Auspendler<br />
<strong>innerhalb</strong><br />
Mittelbereich überregional Mittelbereich überregional<br />
27<br />
Pendler-<br />
saldo<br />
Wer<strong>der</strong> (Havel) 641 2.916 494 6.403 -3.340<br />
Beelitz 280 1.929 327 3.293 -1.411<br />
Groß Kreutz 158 800 448 2.464 -1.954<br />
Schwielowsee 346 981 225 2.855 -1.753<br />
Seddiner See 227 1.590 158 1.267 392<br />
Gesamt 8.216 16.282<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Abb. 7: Verwaltungsglie<strong>der</strong>ung (Stand 2008) und Raum Wer<strong>der</strong> (Havel) – Beelitz<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr: MittelbereichsprofilWer<strong>der</strong> (Havel) - Beelitz 2010, S.2, www.falk.de (Zugriff 01.02.2012).<br />
28
8. Mittelbereich Zehdenick – Gransee<br />
Tab. 22: Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und Prognose im Mittelbereich<br />
Amtsfreie<br />
Gemeinde/Amt<br />
Bevölkerung des MittelbereichsBevölkerungsdichte<br />
(EW/km²)<br />
29<br />
Bevölkerungsprognose<br />
2020<br />
(Personen) (in Prozent) (Personen) (2010=100)<br />
Zehdenick 13.830 46,9 62 12.144 87,8<br />
Gransee und Gemeinden<br />
9.390 31,9 29 8.317 88,6<br />
Fürstenberg/Havel 6.257 21,2 29 5.439 86,9<br />
Mittelbereich gesamt 29.477 100,0 39 25.900 87,9<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobachtung: Bevölkerungsvorausschätzung 2011 bis 2030 - Ämter und<br />
amtsfreie Gemeinden des Landes Brandenburg, Fachbeiträge Raumbeobachtung, Mai 2012; Amt für Statistik Berlin-Brandenburg:<br />
Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden.<br />
Tab. 23: Pendlerverflechtungen im Mittelbereich<br />
Fürstenberg/Havel<br />
Gransee und<br />
Gemeinden Zehdenick<br />
Auspendler gesamt<br />
Fürstenberg/Havel - 156 84 240<br />
Gransee und Gemeinden<br />
114 - 218 332<br />
Zehdenick 68 385 - 453<br />
Einpendler gesamt 182 541 302<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.<br />
Tab. 24: Pendler gesamt<br />
Einpendler Auspendler<br />
<strong>innerhalb</strong><br />
Mittelbereich überregional Mittelbereich überregional<br />
Pendler-<br />
saldo<br />
Fürstenberg/Havel 182 229 240 1.069 -898<br />
Gransee und Gemeinden<br />
541 842 332 2.140 -1.089<br />
Zehdenick 302 610 453 2.593 -2.134<br />
Gesamt 1.681 5.802<br />
Quelle: Statistik <strong>der</strong> Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn- und Arbeitsort, Stand:<br />
30.06.2010.
Abb. 8: Verwaltungsglie<strong>der</strong>ung (Stand 2008) und Raum Zehdenick – Gransee<br />
Quelle: Landesamt für Bauen und Verkehr: Mittelbereichsprofil Zehdenick – Gransee 2010, S.2, www.falk.de (Zugriff 01.02.2012).<br />
30