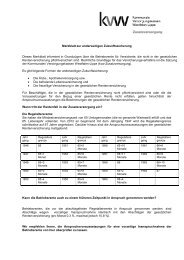Jahresbericht 08 | 09 Partner für - kvw
Jahresbericht 08 | 09 Partner für - kvw
Jahresbericht 08 | 09 Partner für - kvw
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4,35<br />
545<br />
112.48<br />
11.000<br />
17,12<br />
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>08</strong> | <strong>09</strong><br />
<strong>Partner</strong> <strong>für</strong><br />
Beamtenpensionen<br />
Beihilfen<br />
Versorgungsfonds<br />
Kindergeld<br />
Betriebsrenten<br />
PlusPunktRenten
2<br />
20.<strong>09</strong>0<br />
aktive Beamtinnen und Beamte<br />
14.541<br />
Pensionärinnen und Pensionäre<br />
545<br />
Mitglieder in der Beamtenversorgung<br />
112.481<br />
Beihilfeanträge<br />
289<br />
Mitglieder in der<br />
Beihilfekasse<br />
94,35<br />
Mio. Euro ausgezahlte Beihilfen<br />
312,43<br />
Mio. Euro Rentenleistungen<br />
11.000<br />
Kindergeldzahlfälle<br />
73.500<br />
Rentnerinnen und Rentner
825 Mio.<br />
Mitglieder in der Zusatzversorgung<br />
17,12<br />
440,02<br />
Mio. Euro Pensionsleistungen<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Euro ausgezahltes Kindergeld<br />
20<br />
Mitglieder in der<br />
Familienkasse<br />
S. 04 Vorwort<br />
S. 06 Das Jahr 20<strong>08</strong> / 20<strong>09</strong> im Überblick<br />
S. <strong>08</strong> <strong>kvw</strong>-Spezial: 10 Jahre Kassenausschussvorsitzender<br />
S. 10 <strong>kvw</strong>-Spezial: Digitale Akten – Einblick in das d.3-Projekt der <strong>kvw</strong><br />
S. 12 Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Geschäftsbereiche<br />
S. 12 <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />
S. 22 <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />
S. 30 <strong>kvw</strong>-Familienkasse<br />
S. 34 <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-Betriebsrenten<br />
S. 44 <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-PlusPunktRenten<br />
S. 48 <strong>kvw</strong>-Spezial: Rückblick auf die <strong>kvw</strong>-Fachtagung 20<strong>08</strong><br />
S. 50 <strong>kvw</strong>-Spezial: Altersversorgung in einer zunehmend globalisierten<br />
Gesellschaft<br />
S. 52 Die <strong>kvw</strong> stellen sich vor<br />
S. 56 Impressum<br />
Das Wichtigste <strong>für</strong> einen Dienstleister sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb stellen sich<br />
in diesem <strong>Jahresbericht</strong> <strong>kvw</strong>-Beschäftigte aus unseren fünf Geschäftsbereichen an ihrem Arbeitsort vor.<br />
263.000<br />
Rentenversicherte<br />
3
Vorwort<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
4<br />
Dr. Wolfgang Kirsch<br />
Kassenleiter der <strong>kvw</strong><br />
der <strong>kvw</strong>-<strong>Jahresbericht</strong> geht nun im 10. Jahr an unsere Kassenmitglieder und an die<br />
interessierte Öffentlichkeit. Er gibt Ihnen einmal im Jahr einen aktuellen Eindruck<br />
vom Leistungsspektrum der Kassen. Seit fünf Jahren stellen wir zusätzlich auf unserer<br />
jährlichen Mitglieder-Fachtagung aktuelle Themen aus der Altersversorgung,<br />
der Beihilfe oder dem Kindergeld vor. Hier kommen wir mit unseren Mitgliedern<br />
ins Gespräch und können daraus Anregungen <strong>für</strong> die Fortentwicklung unseres<br />
Angebots gewinnen.<br />
Die kommunal geprägte Mitgliederstruktur verpflichtet: Richtschnur unseres Handelns<br />
ist das Bestreben, maßgeschneiderte Angebote <strong>für</strong> die Kommunen zu entwickeln,<br />
diese so wirtschaftlich wie möglich umzusetzen und da, wo es erforderlich<br />
ist, besondere Risiken durch Solidargemeinschaften abzufedern. Auf diese Weise<br />
werden Gemeinden, Städte und Kreise von rechtlich komplexer Personalsachbearbeitung<br />
entlastet und erhalten Planungssicherheit <strong>für</strong> ihre Haushalte. Über diese<br />
strikte Orientierung an den Bedarfen unserer Mitglieder wachen die Kassengremien,<br />
in denen die Vertreterinnen und Vertreter unserer kommunalen Mitglieder aus<br />
Westfalen-Lippe das Sagen haben.<br />
Dass hier immer wieder Anpassungen nötig sind, um auftretende Bedarfe zu<br />
decken, zeigt die Entwicklung der letzten Jahre: Die Einführung einer freiwilligen<br />
Versicherung mit Ausnutzung staatlicher Förderung, die Errichtung eines Versorgungsfonds,<br />
um mitgliedsbezogen Kapital <strong>für</strong> künftig steigende Pensionslasten<br />
anzusparen, die Gründung der Beihilfekasse sowie der Familienkasse oder aktuell<br />
die Überlegungen zur Abdeckung von Spitzenrisiken in der Beihilfe sind da<strong>für</strong> die<br />
prominentesten Beispiele. Zugleich sind wir fortwährend bestrebt, die Wirtschaftlichkeit<br />
unserer Aufgabenerfüllung weiter zu verbessern. Lesen Sie hierzu in<br />
diesem <strong>kvw</strong>-<strong>Jahresbericht</strong> den Beitrag zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems,<br />
mit dem die digitale Akte in den <strong>kvw</strong> Einzug hält. Dadurch können<br />
Aktenarchive aufgelöst, Büroraum gewonnen, die Fallbearbeitung beschleunigt<br />
sowie die Beratung optimiert werden. Verbesserter Service bei höherer Effizienz –<br />
das zeichnet einen modernen Dienstleister aus.
Nach der Kommunalwahl hat unsere Beamtenversorgung wieder „Bürgermeister-<br />
Saison“. Ausgeschiedene Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamte wechseln in<br />
den Ruhestand. Wir berechnen und zahlen ihnen die wohlverdiente Pension. Unter<br />
den neuen Pensionären sind zahlreiche Mitglieder des Verwaltungsrates und des<br />
Kassenausschusses, u. a. Herr Jürgen Hoffstädt, bisher Bürgermeister in Ostbevern<br />
und gleichzeitig Vorsitzender des Kassenausschusses, und Herr Aloys Steppuhn,<br />
bisher Landrat im Märkischen Kreis und Vorsitzender des Verwaltungsrates. Allen<br />
ausgeschiedenen Gremienmitgliedern, insbesondere aber den beiden Vorsitzenden,<br />
danke ich ganz herzlich <strong>für</strong> ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement an sehr<br />
verantwortungsvoller Stelle. Ihnen alles Gute <strong>für</strong> den Ruhestand.<br />
Bei der Lektüre des 10. <strong>kvw</strong>-<strong>Jahresbericht</strong>s wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen<br />
und Leser, viele Anregungen <strong>für</strong> Ihre tägliche Arbeit in Ihrem Verantwortungsbereich.<br />
Ihre Anmerkungen und Fragen nehmen wir gerne auf.<br />
Ihr<br />
Matthias Löb<br />
Geschäftsführer der <strong>kvw</strong><br />
Dr. Wolfgang Kirsch<br />
LWL-Direktor und Kassenleiter<br />
Dr. Walter Bakenecker<br />
stellv. Geschäftsführer der <strong>kvw</strong><br />
5
Das Jahr 20<strong>08</strong> / 20<strong>09</strong> im Überblick<br />
In der Beamtenversorgung<br />
• wurde zur Kommunalwahl in NRW pünktlich – wie versprochen – die Versorgung der ausscheidenden Hauptverwaltungsbeamtinnen<br />
und -beamten berechnet.<br />
• steht die Verteilung der Versorgungslasten bei einem Dienstherrenwechsel auf einer neuen rechtlichen Grundlage.<br />
• wurden die Bezüge von 14.500 Versorgungsempfängerinnen und -empfängern zum 01.07.20<strong>08</strong> angepasst.<br />
In der Beihilfekasse<br />
• wird derzeit über die Einrichtung einer Beihilfeumlagegemeinschaft diskutiert.<br />
• wurde im November 20<strong>08</strong> der 100.000 Beihilfeantrag eingereicht. Für das Jahr 20<strong>09</strong> werden 126.000 Anträge erwartet.<br />
• sind die neuen Rechtsentwicklungen zur Kostendämpfungspauschale und zur Implantatversorgung umgesetzt worden.<br />
• verursacht die Herausrechnung nicht verschreibungspflichtiger Medikamente weiterhin hohen Verwaltungsaufwand.<br />
In der Familienkasse<br />
• sind 10 weitere Kommunen Mitglied geworden. Das gute Preis-/Leistungsangebot überzeugte sie.<br />
• wurden zum Jahresbeginn 20<strong>09</strong> – wie im Konjunkturpaket II kurzfristig beschlossen – die Kindergelderhöhung und der<br />
Kinderbonus umgesetzt.<br />
• wurde auf ein einheitliches Abrechnungssystem <strong>für</strong> die Beschäftigten aller Mitglieder umgestellt.<br />
In der Zusatzversorgung – Betriebsrenten<br />
• konnte mit dem kommunalen Arbeitgeberverband eine Regelung <strong>für</strong> Personalgestellungen vereinbart und anschließend<br />
in der Satzung verankert werden.<br />
• wurde die Umstellung auf das Punktemodell im Grundsatz <strong>für</strong> rechtmäßig erklärt.<br />
• ergaben sich aus der Finanzkrise dank rechtzeitiger Sicherung der Vermögensanlagen nur geringe Auswirkungen.<br />
• blieb es nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz beim Passivierungswahlrecht <strong>für</strong> Mitglieder im umlagefinanzierten<br />
Abrechnungsverband I.<br />
• erfolgte ab 20<strong>08</strong> ein langsamer Einstieg in die Steuerfreistellung von Umlagezahlungen.<br />
In der Zusatzversorgung – PlusPunktRenten<br />
• können Arbeitgeber nun auch die Entgeltumwandlung ihrer Beschäftigten mit Zuzahlungen fördern.<br />
• wurde die Attraktivität der Riester-Förderung durch den „Berufseinsteiger-Bonus“ weiter erhöht.<br />
• entschieden sich 600 zusätzliche Versicherte <strong>für</strong> die PlusPunktRente.<br />
7
<strong>kvw</strong> – Spezial<br />
10 Jahre Kassenausschussvorsitzender<br />
Ein Rück- und Ausblick von Jürgen Hoffstädt,<br />
Bürgermeister a. D. der Gemeinde Ostbevern<br />
Jürgen Hoffstädt ist am 23.10.20<strong>09</strong> als Bürgermeister der Gemeinde Ostbevern aus der aktiven Kommunalpolitik<br />
ausgeschieden. Gleichzeitig hat er damit seine Arbeit als Vorsitzender des Kassenausschusses der<br />
<strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung beendet. In einem Interview mit den <strong>kvw</strong> hält er Rückschau auf seinen Vorsitz.<br />
<strong>kvw</strong>: Herr Hoffstädt, was haben Sie nach fast 10 Jahren als Vorsitzender des Kassenausschusses<br />
besonders in Erinnerung?<br />
Hoffstädt: Ich bin in einer Zeit zum Vorsitzenden des Kassenausschusses gewählt worden, in der wir die<br />
Zusatzversorgung <strong>für</strong> die Zukunft fit machen mussten. Mit dem modernen Punktesystem verabschiedeten<br />
wir uns vom (teureren) Gesamtversorgungssystem. Wir riefen die PlusPunktRente als freiwillige<br />
Versicherung mit staatlicher Förderung ins Leben. Und wir legten den Grund <strong>für</strong> einen neuen kapitalgedeckten<br />
Abrechnungsverband II, um auch jungen kommunalen Unternehmen einen sinnvollen Weg <strong>für</strong><br />
ihre Altersversorgung anbieten zu können.<br />
Die meisten Mitglieder der <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung gehören dem umlagefinanzierten<br />
System an. Ist Umlagefinanzierung heute nicht längst überholt?<br />
Hoffstädt: Nein, ich glaube ganz im Gegenteil: Gerade die aktuelle Finanzkrise zeigt, wie gewagt es sein<br />
kann, sich vollständig den Finanzmärkten auszuliefern. Umlagefinanzierung ist hier weniger anfällig, man<br />
könnte fast sagen: finanzkrisenfest. Und bei der Zusatzversorgung kommt noch ein ansehnlicher Vermögensbestand<br />
hinzu, der <strong>für</strong> eine gleichmäßigere Belastung der Mitglieder im Zeitablauf sorgt. Das macht<br />
diesen Abrechungsverband auch gegenüber den demografischen Herausforderungen noch ein ganzes<br />
Stück widerstandsfähiger.<br />
Und der kapitalgedeckte Abrechnungsverband II?<br />
Hoffstädt: Hier habe ich mich <strong>für</strong> die <strong>kvw</strong> besonders gefreut, dass die Städtischen Kliniken Bielefeld den<br />
Weg zu ihnen gefunden haben. Auch viele jüngere Unternehmen klopfen bei den <strong>kvw</strong> an. Die Mitglieder<br />
trauen den <strong>kvw</strong> zu, dass sie solide wirtschaften und langfristig die nötigen Renditen erwirtschaften. Ein<br />
großes Plus haben die <strong>kvw</strong>: Sie müssen aus ihren Erträgen keine Boni und Provisionen abzweigen. Das<br />
Geld wird 1:1 den Konten der Beschäftigten gutgeschrieben. Wo gibt es das sonst?<br />
Die <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung legt an Kapitalmärkten an, in denen sich auch Investmentbanken<br />
und Hedgefonds tummeln. Können die <strong>kvw</strong> da überhaupt mithalten?<br />
Hoffstädt: Ja, absolut. Glücklicherweise waren wir uns im Kassenausschuss immer einig: Mit Geldern<br />
der Arbeitgeber und der Versicherten wird nicht gezockt. Die langfristige, breit gestreute Kapitalanlage<br />
der <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung ist uns sehr wichtig. Das macht die Kasse robuster und zukunftsfester als die<br />
Anleger, die jedem zehntel Prozent hinterherlaufen und sich die Risiken an den Kapitalmärkten schönreden.<br />
Wie sehen Sie die <strong>kvw</strong> insgesamt am Markt positioniert? Geben Sie uns einen Einblick.<br />
Hoffstädt: Als ich mein Amt als Kassenausschussvorsitzender aufgenommen habe, sind die Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter aus der Beamten- und Zusatzversorgung gerade gemeinsam in ein modernes<br />
Gebäude in der Zumsandestraße gezogen. Dadurch ist es gelungen, die mittlerweile sechs Produktbereiche<br />
besser zu vernetzen. Ich bin davon überzeugt: Die <strong>kvw</strong>-Beschäftigten kommunizieren besser,<br />
die Entscheidungswege sind kurz und die Effzienz ist weiter gestiegen. Das merken dann auch die<br />
Menschen, <strong>für</strong> die die <strong>kvw</strong> tätig sind. So werden die <strong>kvw</strong> sich in unserem kommunalen Umfeld auch<br />
weiterhin gut behaupten können.<br />
8
Jedenfalls werde ich<br />
die Füße nicht hochlegen.<br />
Was geben Sie den <strong>kvw</strong> <strong>für</strong> die Zukunft mit auf den Weg?<br />
Hoffstädt: Entscheidend ist <strong>für</strong> mich, dass die <strong>kvw</strong> ihre Ohren weiterhin ganz nah an ihren Mitgliedern<br />
und den Menschen haben, <strong>für</strong> die sie da sind. Wenn sich die <strong>kvw</strong> auch weiterhin als Dienstleister <strong>für</strong><br />
die kommunalen Mitglieder positionieren, wenn sie gefragte Zusatzangebote schaffen – und vor allem:<br />
wenn sie am Kapitalmarkt so umsichtig wie bisher bleiben – dann, finde ich, stehen die <strong>kvw</strong> ganz gut da.<br />
Wie werden Sie nun Ihren neuen Lebensabschnitt als Pensionär gestalten?<br />
Hoffstädt: Für diese Zeit habe ich viele Ideen. Jedenfalls werde ich „die Füße nicht hochlegen“. Wie<br />
manche vielleicht wissen, bin ich seit einigen Jahren Wohnmobilist. Künftig werde ich sicherlich ein<br />
wenig mehr auf Achse sein. Und wenn ich dann irgendwo in Europa am Automaten mein Geld ziehe,<br />
dann denke ich vielleicht auch mal an die <strong>kvw</strong>, die sich schließlich auch um meine Pension kümmern.<br />
Herr Hoffstädt, alles Gute <strong>für</strong> den neuen Lebensabschnitt.<br />
Für die kompetente, engagierte und freundliche Leitung der Kassenausschuss-Sitzungen<br />
ganz herzlichen Dank.<br />
9
Digitale Akten –<br />
Einblick in das d.3-Projekt der <strong>kvw</strong><br />
Ein Interview mit Dieter Skirde (Referatsleiter Informationstechnologie)<br />
& Elisabeth Boor-Kamender (Projektmanagerin d.3-Projekt)<br />
2006 fiel in den <strong>kvw</strong> die Entscheidung, in einem Projekt ein digitales Dokumentenmanagementsystem<br />
aufzubauen. Warum das sogenannte d.3.-Projekt aufgelegt wurde und wie der derzeitige Stand im Projekt<br />
ist, schildern der <strong>kvw</strong>-Referatsleiter Informationstechnologie, Dieter Skirde, und die Projektmanagerin,<br />
Elisabeth Boor-Kamender, in einem Interview.<br />
Warum wurde das d.3-Projekt aufgelegt?<br />
10<br />
Think big,<br />
start small.<br />
Skirde: Uns erreicht über viele verschiedene Kommunikationskanäle Post: Auf dem klassischen Weg<br />
per Brief, über Fax und immer mehr auch via E-Mail. Außerdem versenden wir jährlich über 3 Mio.<br />
Druckseiten an unsere Kunden und Geschäftspartner. Wie stellen Sie da sicher, dass Ihr Papierarchiv<br />
ordnungsgemäß und vollständig ist? Für uns konnte der Weg deshalb nur lauten: Aufbau eines digitalen<br />
Dokumentenmanagementsystems. Damit sind wir zudem einfach auch kundennäher: Auf einen Klick<br />
können Kundenakten am PC-Arbeitsplatz aufgerufen werden. Wir müssen die Akte nicht erst noch aus<br />
dem Papierarchiv heraussuchen. Es entfallen auch riesige Lagerflächen <strong>für</strong> das Papierarchiv; also auch<br />
eine deutliche Kosteneinsparung.<br />
Wie sind Sie bei der Projektplanung vorgegangen?<br />
Boor-Kamender: Uns war klar, dass mit dem Auflösen der Papierakten – immerhin fast 7 Mio. DIN-A4-<br />
Seiten – und dem elektronischen Geschäftsdurchlauf der Eingangspost ein massiver Eingriff in vertraute<br />
Arbeitsabläufe der Fachbereiche verbunden ist. So war der Leitgedanke bei der Projektplanung „Think<br />
big, start small“. Wir setzen das Projekt über eine Laufzeit von vier Jahren stufenweise um. Das Unternehmen<br />
T-Systems unterstützt uns dabei mit seinem fachlichen Know-how.
<strong>kvw</strong> – Spezial<br />
Was haben die <strong>kvw</strong>-Beschäftigten zu dem d.3-Projekt gesagt?<br />
Skirde: Wir haben die einzelnen Fachbereiche sofort eingebunden und die Vorteile präsentiert. So haben<br />
wir viele schnell begeistert. Außerdem lässt sich so ein Projekt nur umsetzen, wenn sich die Beschäftigten<br />
einbringen: Denn nur mit ihnen hatten wir die Chance, dass die Übernahme der alten Papierakten<br />
klappt und die neuen digitalen Aktenpläne sinnvoll sind. Mit dem Wissen haben wir ein anwenderfreundliches<br />
System aufbauen können, das sicherlich noch der einen oder anderen Optimierung bedarf, letztlich<br />
die Arbeitsabläufe aber wirklich erleichtert.<br />
Was haben Sie bisher umgesetzt? Was steht in den nächsten Monaten an?<br />
Boor-Kamender: Alle bestehenden Papierakten aus den einzelnen Fachbereichen liegen eingescannt vor.<br />
Die Basistechnologie ist in allen Fachbereichen eingeführt. Im September 20<strong>09</strong> haben wir den Startschuss<br />
<strong>für</strong> das sogenannte frühe Erfassen zunächst als Pilotprojekt in der Beamtenversorgung gegeben:<br />
Alle Posteingänge werden von unserer Registratur eingescannt und digital an die zuständige Sachbearbeitung<br />
verteilt. Dort werden sie über das bereitgestellte Fachverfahren bearbeitet. Damit Posteingänge<br />
und Fachverfahren parallel genutzt werden können, wurden alle Arbeitsplätze mit zwei Flachbildschirmen<br />
ausgestattet. Postausgänge werden ebenfalls in der digitalen Akte abgelegt und automatisch an unseren<br />
Druckdienstleister <strong>für</strong> Ausdruck, Kuvertierung und Versand weitergeleitet. Die Erfahrungen aus dem<br />
Pilotprojekt werden wir auswerten, den Prozess optimieren und ihn dann nach und nach in den anderen<br />
<strong>kvw</strong>-Geschäftsbereichen einführen.<br />
Viel Erfolg bei den nächsten Projektschritten. Vielen Dank <strong>für</strong> das Interview.<br />
So haben wir viele<br />
schnell begeistert.
Eric Telgmann setzt Versorgungsbezüge fest,<br />
berät aktive Beamtinnen und Beamte,<br />
Pensionäre und Mitglieder.
Kapitel<br />
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />
Überblick<br />
<strong>für</strong> 545 Mitglieder<br />
• kostenlose Beratung und Unterstützung in allen mit dem Versorgungsrecht in Zusammenhang stehenden<br />
beamtenrechtlichen Bestimmungen<br />
• Ausgleich von Versorgungsrisiken durch die Bildung von Finanzierungsgemeinschaften<br />
• Angebot neuer Finanzierungswege durch Kapitalbildung<br />
• Berechnung von Pensionsrückstellungen nach den Regelungen des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement)<br />
• Entlastung der Mitglieder durch die Übertragung der Festsetzungsbefugnisse auf die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />
• kostenlose Schulungsveranstaltungen<br />
• Unfall<strong>für</strong>sorgeleistungen <strong>für</strong> gemeldete Beamtinnen und Beamte<br />
• Informationen über aktuelle Entwicklungen durch Rundschreiben<br />
<strong>für</strong> ca. 20.000 aktive Beamtinnen und Beamte<br />
• fachkundige Beratung<br />
• individuelle Berechnungen der erworbenen Pensionsansprüche<br />
• Auskünfte an Familiengerichte, gesetzliche Rentenversicherung<br />
• informativer Internetauftritt<br />
<strong>für</strong> ca. 14.500 Pensionärinnen und Pensionäre sowie Hinterbliebene<br />
• zeitnahe Pensionsfestsetzungen<br />
• zuverlässige Auszahlungen der Pensionen in Höhe von insgesamt über 440 Mio. Euro jährlich<br />
• fachkundige telefonische und persönliche Betreuung<br />
• informativer Internet-Auftritt<br />
13
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />
Aktuelles<br />
Juli 20<strong>08</strong><br />
Anpassung der Versorgungsbezüge<br />
Mit Wirkung vom 01.07.20<strong>08</strong> wurden die Versorgungsbezüge<br />
der rund 14.500 Ruhegehaltempfänger und Hinterbliebenen<br />
um 2,9 % erhöht. Bei den Empfängern von Festbeträgen<br />
erfolgte die Anpassung um 2,8 %. Rechtsgrundlage ist das<br />
Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge<br />
vom 20.10.2007 (GV.NW.2007 S. 750 ff).<br />
November 20<strong>08</strong><br />
Pensionsrückstellung / Versorgungslastenverteilung<br />
Ein Dauerthema war im Berichtsjahr die Berechnung der Pensionsrückstellungen.<br />
Im Zusammenhang mit der Einführung<br />
des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die<br />
Kommunen verpflichtet, in ihren Haushalten Pensionsrückstellungen<br />
auszuweisen. Bis spätestens Ende 2010 sind <strong>für</strong> alle<br />
aktiven Beamten die jeweiligen Versorgungsanwartschaften<br />
individuell zu ermitteln. Die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung führt<br />
<strong>für</strong> ihre kommunalen Mitglieder die hier<strong>für</strong> notwendigen<br />
Berechnungen durch. Es werden die individuellen Daten aller<br />
aktiven Beamten erfasst. Mit Stand Ende 20<strong>08</strong> konnten <strong>für</strong><br />
alle kreisangehörigen Gemeinden die Pensionsrückstellungen<br />
berechnet werden.<br />
Das mit Wirkung vom 18.11.20<strong>08</strong> in Kraft getretene Versorgungslastenverteilungsgesetz<br />
des Landes NRW (VLVG) regelt<br />
die Versorgungslastenverteilung beim Wechsel einer Beamtin<br />
oder eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn. Jeder<br />
Dienstherrenwechsel wird damit künftig auch Auswirkungen<br />
auf die Bilanzen der beteiligten Kommunen haben, sei es als<br />
Forderung beim abgebenden oder als Verbindlichkeit beim<br />
aufnehmenden Dienstherrn. In der gegenwärtigen Fassung<br />
sieht das Gesetz noch eine Rückwirkung auf Dienstherrenwechsel<br />
vor dem Inkrafttreten des VLVG vor. Wegen des<br />
damit zusammenhängenden kaum zu bewältigenden Verwaltungsaufwandes<br />
gibt es zwischenzeitlich allerdings Bestrebungen,<br />
das VLVG in diesem Punkt zu ändern.<br />
14<br />
Dezember 20<strong>08</strong><br />
Umzug der <strong>kvw</strong>-Beschäftigten<br />
aus der Beamtenversorgung<br />
Im Dezember 20<strong>08</strong> sind die 36 Beschäftigten aus der<br />
<strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung in neue Büroräume an der Wolbecker<br />
Straße in Münster umgezogen. Hintergrund ist die<br />
wachsende Nachfrage von Kommunen, ihre Beihilfe- und<br />
Kindergeldberechnungen an die <strong>kvw</strong> auszulagern. Dadurch<br />
mussten neue Beschäftigte <strong>für</strong> die Beihilfebearbeitung und<br />
die Familienkasse eingestellt werden. Die Büroräume in der<br />
Zumsandestraße 12 reichten nicht mehr <strong>für</strong> alle Beschäftigten<br />
aus. Die Wirtschaftsförderung Münster GmbH vermittelte<br />
deshalb eine Büroetage mit ausreichender Fläche <strong>für</strong> die<br />
<strong>kvw</strong>-Beschäftigten in der Beamtenversorgung. Es konnte ein<br />
Standort gefunden werden, der in unmittelbarer Nähe des<br />
Hauptgebäudes in der Zumsandestraße liegt.<br />
Ebenfalls im Dezember begann die Umstellung der Akten<br />
der <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung im Rahmen des d.3-Projektes<br />
auf ein elektronisches Aktensystem. Neben der Einführung<br />
einer modernen zeitgemäßen Technologie waren vor allem<br />
auch die fehlenden Raumkapazitäten <strong>für</strong> die Aktenablage<br />
maßgebend.
Geschäftsverlauf<br />
Die Beamtenversorgung der Kommunalen Versorgungskassen<br />
<strong>für</strong> Westfalen-Lippe (<strong>kvw</strong>)<br />
• berechnet und zahlt die Versorgungsleistungen <strong>für</strong><br />
kommunale Beamte,<br />
• berät und unterstützt ihre Mitglieder in Fragen des<br />
Beamtenversorgungsrechts.<br />
1. MItGlIEDER<br />
Im Jahr 20<strong>08</strong> nutzten 545 Mitglieder unseren Service. Für<br />
kreisangehörige Gemeinden ist die Mitgliedschaft in den Versorgungskassen<br />
Pflicht. Freiwillige Mitglieder sind nahezu alle<br />
kreisangehörigen Städte, alle Kreise, sonstige Körperschaften,<br />
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Daneben<br />
können auch juristische Personen des privaten Rechts beitreten,<br />
an denen überwiegend Gemeinden oder Gemeindeverbände<br />
beteiligt sind oder die kommunale Aufgaben erfüllen.<br />
Die zentrale Abwicklung bietet den Mitgliedern der <strong>kvw</strong>-<br />
Beamtenversorgung viele Vorteile: Kostengünstig bündelt sie<br />
das erforderliche technische und fachliche Know-how. Dies<br />
führt zur Reduzierung der fachlich-rechtlichen Risiken <strong>für</strong> die<br />
Mitglieder. Die <strong>kvw</strong>-Mitglieder bilden außerdem eine große<br />
Solidargemeinschaft. Dadurch minimieren sie finanzielle<br />
Risiken.<br />
2. lEIStUNGEN<br />
20<strong>08</strong> betreute die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung insgesamt<br />
14.541 Pensionäre und Hinterbliebene. Die ausgezahlten Versorgungsleistungen<br />
stiegen um 0,7 % auf 440,02 Mio. Euro.<br />
Sie ergeben sich aus den Beamtengesetzen.<br />
2.1 Ruhegehaltempfänger<br />
20<strong>08</strong> erhöhte sich die Zahl der Ruhegehaltempfänger von<br />
9.495 im Vorjahr auf 9.534. Im Laufe des Jahres kamen<br />
417 hinzu, 378 verstarben. Dies entspricht einer normalen<br />
Altersentwicklung.<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
15<br />
14,5<br />
14<br />
13,5<br />
13<br />
‘94<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />
Entwicklung der Versorgungsleistungen seit 1993 in Mio. EUR<br />
‘94<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />
Entwicklung der Versorgungsfälle seit 1993 in Tausend<br />
15
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />
Gründe <strong>für</strong> den Eintritt in den Ruhestand:<br />
Die gesetzliche Altersgrenze erreichten<br />
188 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,97 %<br />
Das 63. Lebensjahr vollendeten<br />
50 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,23 %<br />
Ab dem 60. Lebensjahr schwerbehindert waren<br />
32 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,82 %<br />
Einstweiliger Ruhestand, Abwahl oder Ende der<br />
Amtszeit betrafen<br />
38 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,29 %<br />
Dienstunfähig wurden<br />
101 Personen = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,69 %<br />
Davon waren<br />
16 Personen . . . . . . . . . . . . . . im 60. Lebensjahr und älter,<br />
34 Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . im 55. – 59. Lebensjahr,<br />
27 Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . im 50. – 54. Lebensjahr,<br />
10 Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . im 45. – 49. Lebensjahr,<br />
14 Personen . . . . . . . . . . . . .im 44. Lebensjahr und jünger.<br />
Der älteste Ruhegehaltempfänger war 100 Jahre, der jüngste<br />
34 Jahre alt.<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
16<br />
‘94<br />
Versorgungsleistungen<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />
Entwicklung der Versorgungsleistungen und -fälle<br />
im Vergleich seit 1993 (1993 = Index 100)<br />
Versorgungsfälle<br />
Der Anteil der Beamten, die erst mit Erreichen der Altersgrenze<br />
in den Ruhestand treten, steigt weiter an. Hier<strong>für</strong> dürfte<br />
nach wie vor die Abschlagsregelung die Ursache sein, die<br />
bei einem vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand greift. Dieser<br />
Trend ist allerdings bei den Ruhegehaltempfängern rückläufig,<br />
die vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand<br />
gehen. Denn im Vergleich zum Vorjahr ist in den Fällen ein<br />
leichter Anstieg zu beobachten.<br />
2.2 Hinterbliebenenversorgung<br />
Ende 20<strong>08</strong> erhielten 5.007 Hinterbliebene Leistungen von<br />
der <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung. Im Vorjahr waren es 5.053:<br />
Es kamen 294 Hinterbliebene im Berichtsjahr hinzu, 340<br />
verstarben. Die älteste Witwe war 106 Jahre, die jüngste 27<br />
Jahre alt.<br />
2.3 Dynamisierung der Versorgungsbezüge 20<strong>08</strong><br />
Zum 01.07.20<strong>08</strong> wurden die Versorgungsbezüge um 2,9 %<br />
erhöht, die Festbeträge um 2,8 %. Damit wurde eine weitere<br />
Absenkung des Versorgungsniveaus bis zur geplanten Zielgröße<br />
von 71,75 % der letzten Bezüge vorgenommen.<br />
2.4 Bemessung der Sonderzahlung<br />
Im Jahr 2003 wurde auf Bundesebene das Gesetz über die<br />
Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung aufgehoben.<br />
Gleichzeitig wurde den Ländern damals über eine Öffnungsklausel<br />
das Recht eingeräumt, eine eigene landesrechtliche<br />
Regelung zu treffen. Das Land NRW hat hiervon zunächst<br />
im Jahr 2003 Gebrauch gemacht und <strong>für</strong> die Bemessung der<br />
Sonderzuwendung die Faktoren abgesenkt. 2006 erfolgte<br />
eine weitere Absenkung. Aktuell erhalten demnach Beamte<br />
der Besoldungsgruppen A 1 bis A 6 60 % , in den Besoldungsgruppen<br />
A 7 bis A 8 39 % und in den Besoldungsgruppen<br />
ab A 9 22 % ihrer Dezemberbezüge als Sonderzahlung.<br />
Bemessungsgrundlage sind die Versorgungsbezüge des<br />
Monats Dezember.
Sonderzahlung Bund<br />
Die <strong>kvw</strong> betreuen u. a. auch die Versorgungsempfänger der<br />
Vereinigten IKK, <strong>für</strong> die Bundesrecht gilt. Versorgungsempfänger,<br />
die nach diesen Regelungen zu betreuen sind, erhalten<br />
eine Sonderzahlung in Höhe von 2,036 % der Jahresbezüge<br />
vor Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften.<br />
Aufgrund der wirkungsgleichen Übertragung von Regelungen<br />
der sozialen Pflegeversicherung in das Dienstrecht wurde<br />
dieser so ermittelte Betrag zusätzlich um einen Betrag <strong>für</strong><br />
Pflegeleistungen in Höhe von 0,9125 % der Jahresversorgung,<br />
höchstens aber um 0,9125 % der Beitrags-<br />
bemessungsgrenze reduziert.<br />
2.5 Anrechnung von Renten<br />
In 9.773 Fällen wurden Renten auf die Versorgungsbezüge<br />
angerechnet (§ 55 BeamtVG). Dies sind ca. 67 % der vorhandenen<br />
Versorgungsfälle. Der aktuelle Rentenwert wurde 20<strong>08</strong><br />
durch das Rentenanpassungsgesetz erhöht. Dadurch ergaben<br />
sich auch Auswirkungen auf die Höhe der Versorgung.<br />
2.6 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner<br />
Im Berichtsjahr rechnete die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung mit 91<br />
Krankenkassen die Beiträge <strong>für</strong> die Krankenversicherung der<br />
Rentnerinnen und Rentner ab: Rund 636.000 Euro <strong>für</strong> die Pflege-<br />
und 10,<strong>09</strong> Mio. Euro <strong>für</strong> die Krankenversicherung wurden<br />
ausgezahlt.<br />
2.7 Unfall<strong>für</strong>sorge<br />
Von den Mitgliedern wurden im Jahr 20<strong>08</strong> 448 Dienstunfälle<br />
gemeldet. Rund 1,17 Mio. Euro zahlten die <strong>kvw</strong> hier<strong>für</strong><br />
gemäß dem Beamtenversorgungsgesetz und ihrer Satzung<br />
an die betroffenen Beamten und Versorgungsberechtigten. Es<br />
handelt sich dabei in der Hauptsache um Wegeunfälle und um<br />
Unfälle von Feuerwehrbeamten im Einsatz.<br />
2.8 Versorgungsausgleiche<br />
Im Falle der Ehescheidung ist auch in der Beamtenversorgung<br />
ein Versorgungsausgleich zwischen den ehemaligen Ehepartnern<br />
durchzuführen. Im Jahr 20<strong>08</strong> erteilte die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />
in 146 Fällen Auskünfte an Familiengerichte.<br />
Für den Aufbau einer Rentenanwartschaft von ausgleichsberechtigten<br />
Ehepartnern erhielten die Rententräger einen<br />
Versorgungsausgleich von 2,91 Mio. Euro.<br />
2.9 Nachversicherung<br />
Bei Ausscheiden einer Beamtin oder eines Beamten aus dem<br />
Beamtenverhältnis ohne Versorgungsberechtigung wird in<br />
der gesetzlichen Rentenversicherung durch Nachversicherung<br />
eine eigenständige Anwartschaft begründet. Im Berichtsjahr<br />
wurden <strong>für</strong> 71 Personen insgesamt 1,55 Mio. Euro zur Nachversicherung<br />
in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt<br />
(im Vorjahr 2,02 Mio. Euro <strong>für</strong> 102 Personen).<br />
2.10 Betriebsrenten<br />
Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind<br />
ausgeschiedene Dienstordnungsangestellte oder Angestellte<br />
mit beamtenrechtlicher Versorgungszusage nicht mehr nachzuversichern,<br />
wenn sie vorzeitig ohne Versorgung aus dem<br />
öffentlichen Dienst ausscheiden. Stattdessen erwerben sie<br />
einen Anspruch auf eine Betriebsrente nach dem Betriebsrentengesetz.<br />
Für 32 ehemalige Angestellte, die aus dem Dienst<br />
ausgeschieden sind, wurde eine Betriebsrentenanwartschaft<br />
berechnet. Im Rentenfall erfolgt die Zahlung von der <strong>kvw</strong>-<br />
Beamtenversorgung.<br />
17
Angela Engel berät aktive Beamtinnen<br />
und Beamte, Pensionäre sowie Mitglieder<br />
und setzt Versorgungsbezüge fest.<br />
18
Vermögens-, Finanz-<br />
und Ertragslage<br />
1. FINANZIERUNG<br />
Die Finanzierung der Leistungen der Versorgungskasse erfolgt<br />
in einem Mischsystem aus Umlage und Erstattung.<br />
Das bisherige Umlageverfahren wurde im Jahr 2007<br />
durch dieses System ersetzt. Dabei werden Versorgungsaufwendungen<br />
nach ihrer Vorhersehbarkeit unterschieden. Der<br />
Versorgungsaufwand von kalkulierbaren Risiken, wie z. B.<br />
Eintritt in den Ruhestand mit Erreichen der Altersgrenze, wird<br />
künftig im Erstattungswege aufgebracht. Ein Risikoausgleich<br />
<strong>für</strong> nicht vorhersehbare Ereignisse, wie z. B. Eintritt in den<br />
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, findet dagegen in einem<br />
Umlageverfahren statt.<br />
Eine Aufteilung in zwei Umlagegemeinschaften gewährleistet<br />
dabei möglichst homogene Strukturen. Im Jahr 20<strong>08</strong><br />
zahlten die kreisangehörigen Gemeinden und Städte rund<br />
179,7 Mio. Euro, die Kreise rund 75,7 Mio. Euro.<br />
2. VERSORGUNGSFONDS<br />
Mit Wirkung vom 01.01.2005 trat das Gesetz über ein Neues<br />
Kommunales Finanzmanagement <strong>für</strong> Gemeinden im Land<br />
Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) in Kraft. Mit der Einführung<br />
des NKFG NRW entfällt zwar die Verpflichtung, fungibles<br />
Vermögen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen<br />
anzusammeln. Nach dem NKFG sollen nunmehr die Pensionsverpflichtungen<br />
auf der Passivseite bilanziert werden. Diesen<br />
Verpflichtungen sollen Aktiva gegenüberstehen, die sicherstellen,<br />
dass die jederzeitige Erfüllbarkeit dieser Verpflichtungen<br />
gewährleistet ist. Fraglich erscheint jedoch, ob diese Aktiva<br />
künftig tatsächlich dem Zweck dienen können, Pensionsverpflichtungen<br />
zu finanzieren. Dann müsste die Gemeinde willens<br />
und rein rechtlich sowie tatsächlich in der Lage sein, bei<br />
Bedarf diese Vermögensgegenstände zu veräußern. Ein Blick<br />
auf die Aktivseite von Kommunalbilanzen zeigt jedoch, dass<br />
eine Veräußerung, ohne die Aufgabenerfüllung zu vernachlässigen,<br />
häufig nicht möglich ist oder aber wegen fehlender<br />
Marktfähigkeit ausscheidet. Man stelle sich beispielhaft nur<br />
den Verkauf einer kommunalen Straße vor, weil Geld <strong>für</strong> die<br />
Beamtenpensionen benötigt wird. Es führt also kein Weg daran<br />
vorbei, dass man über liquide Mittel verfügt und nicht über<br />
illiquide Vermögensgegenstände. Im Grundsatz ist es möglich,<br />
diese liquiden Mittel erst zum Auszahlungszeitpunkt über die<br />
traditionellen kommunalen Einnahmen zu beschaffen. Das<br />
verursacht bei steigenden Belastungen aus Beamtenpensionen<br />
im Zeitablauf steigende Haushaltsbelastungen und damit<br />
unerwünschte intertemporale Verteilungseffekte, die unter<br />
dem Stichwort „Generationengerechtigkeit“ diskutiert<br />
werden. Die <strong>kvw</strong> empfehlen deshalb dringend, mindestens<br />
die bisherigen Pflichtzuführungen aus der kameralen Welt<br />
auch in der doppischen Welt fortzuführen, nach Möglichkeit<br />
diese aber aufzustocken.<br />
Um die Finanzierungsbelastung aus der Beamtenversorgung<br />
im Zeitablauf <strong>für</strong> die kommunalen Haushalte gleichmäßiger<br />
zu gestalten, gibt es bei den <strong>kvw</strong> den Versorgungsfonds,<br />
dessen Kapital entsprechend dem Auftrag breit an den Kapitalmärkten<br />
gestreut wird. Die Mitglieder können hier flexibel<br />
je nach individueller Ausgangssituation und Zielsetzung Einzahlungen<br />
in unterschiedlicher Höhe und zu unterschiedlichen<br />
Zeitpunkten vornehmen und die Auszahlungen planen. Die<br />
unterschiedlichen Ausgangssituationen und unterschiedlichen<br />
Zielsetzungen sind dabei so vielfältig wie die kommunale<br />
Welt. Hier ist individuelle Beratung <strong>für</strong> die Mitglieder gefragt;<br />
die <strong>kvw</strong> sind gerne dazu bereit.<br />
Dem Fonds gehörten zum 31.12.20<strong>08</strong> insgesamt<br />
266 Mitglieder an.<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
‘94<br />
kreisang. Gemeinden und Städte<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />
Entwicklung der Umlageeinnahmen im Zeitablauf<br />
in Mio. EUR<br />
Kreise<br />
19
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
15<br />
12<br />
20<br />
0<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
‘99 ‘00<br />
‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘<strong>08</strong><br />
Entwicklung des Gesamtfondsvermögens (Kurswert)<br />
in Mio. EUR<br />
‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘<strong>08</strong><br />
Fondszuflüsse seit 2000 in Mio. EUR<br />
Freiwillige Zuführungen<br />
Pflichtzuführungen<br />
(seit 2005 analog EFoG)<br />
Das zulässige Anlagespektrum des Fonds richtet sich nach<br />
der Anlageverordnung, die auch <strong>für</strong> die Kapitalanlagen von<br />
Versicherungsunternehmen gilt. Die Einschätzung der Kapitalmärkte<br />
ist <strong>für</strong> den Erfolg des Versorgungsfonds von großer<br />
Bedeutung. Hier kann der Versorgungsfonds vom Know-how<br />
der <strong>kvw</strong> in der Zusatzversorgung profitieren, wo noch wesentlich<br />
größere Volumina über Spezialfonds verwaltet werden.<br />
Hierdurch kann zugleich auch eine günstige Gebührenstruktur<br />
gewährleistet werden.<br />
Zum Stichtag 31.12.20<strong>08</strong> ergab sich ein Gesamtfondsvermögen<br />
(Kurswert) von rund 147 Mio. Euro, das <strong>für</strong> die<br />
Mitglieder treuhänderisch verwaltet wird.<br />
Von den Mitgliedern wird verstärkt die Möglichkeit genutzt,<br />
zusätzlich in den Versorgungsfonds einzuzahlen. Hierbei<br />
steht es den Mitgliedern frei, in welcher Größenordnung sie<br />
fungibles Vermögen einzahlen, um ihre künftig steigenden<br />
Versorgungsverpflichtungen abfedern zu können.<br />
Die bisherigen Einzahlungen in den Versorgungsfonds –<br />
aufgeteilt nach Pflichtzuführungen entsprechend dem Entlastungsfondsgesetz<br />
und nach freiwilligen Zuführungen – sind in<br />
der nebenstehenden Grafik abgebildet.<br />
Gerne unterstützt die <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung ihre Mitglieder<br />
auch dabei, ein Konzept zur langfristigen Sicherung der Finanzierung<br />
des individuellen Versorgungsaufwandes zu erstellen.<br />
Dadurch bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, über<br />
den Versorgungsfonds die von ihnen gewünschte Kapitalisierung<br />
der Pensionen und Beihilfen sicherzustellen.
Ausblick<br />
Pensionsrückstellungen/<br />
Versorgungslastenverteilung<br />
Die Berechnungen der Versorgungsanwartschaften <strong>für</strong> etwa<br />
14.000 Beamte zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen<br />
<strong>für</strong> die Mitglieder der <strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung werden 20<strong>09</strong><br />
und 2010 weiterhin erheblichen Aufwand verursachen. Auch<br />
das neue Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW ist bei<br />
abgeschlossenen wie auch bei künftigen Pensionsrückstellungsberechnungen<br />
zu beachten. Es bleibt zu hoffen, dass<br />
der Gesetzgeber die in der derzeitigen Gesetzesfassung<br />
bestehende Rückwirkung <strong>für</strong> lange zurückliegende Dienstherrenwechsel<br />
wieder aufhebt, damit der Verwaltungsaufwand<br />
beherrschbar bleibt.<br />
Versorgung der Hauptverwaltungs-<br />
beamtinnen und -beamten<br />
Mit der Kommunalwahl 20<strong>09</strong> wurden die Bürgermeisterinnen<br />
und Bürgermeister sowie Landrätinnen und Landräte in den<br />
Kommunen und Kreisen neu gewählt. Bei den Mitgliedern<br />
der <strong>kvw</strong> sind 72 Hauptverwaltungsbeamte aus ihren Ämtern<br />
ausgeschieden. Da rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen<br />
getroffen wurden, ist sichergestellt, dass zum Zeitpunkt des<br />
Amtswechsels, am 21.10.20<strong>09</strong>, die Versorgungsbezüge pünktlich<br />
ausgezahlt werden können.<br />
Neuregelung des Versorgungsausgleichs<br />
Der Deutsche Bundestag hat am 12.02.20<strong>09</strong> die Strukturreform<br />
des Versorgungsausgleichs beschlossen. Das Gesetz ist<br />
zum 01.<strong>09</strong>.20<strong>09</strong> in Kraft getreten.<br />
Hauptziele der Reform sind eine gerechtere Verteilung der<br />
während der Ehezeit erworbenen Versorgungsanwartschaften<br />
auf die Ehegatten und eine deutliche Vereinfachung der<br />
komplexen Rechtsmaterie. Die Verbesserung der Verteilungsgerechtigkeit<br />
soll in der Hauptsache dadurch verwirklicht<br />
werden, dass künftig jedes Versorgungsanrecht intern, also<br />
innerhalb des Versorgungssystems des ausgleichspflichtigen<br />
Ehegatten, geteilt wird.<br />
Nach einer ersten Einschätzung werden durch die interne<br />
Teilung beamtenrechtliche Versorgungsanwartschaften<br />
auf den ausgleichsberechtigten Ehegatten übertragen, die<br />
zusätzlich zu der Versorgung durch den Dienstherrn bzw. die<br />
<strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung zu administrieren sind.<br />
Aufgrund der Föderalismusreform müssen die Länder<br />
eigene Regelungen zur internen Teilung im Rahmen des<br />
Versorgungsausgleichs schaffen. In NRW und den übrigen<br />
Bundesländern gibt es bislang keine entsprechenden Vorschriften.<br />
Wie die Familiengerichte damit bis zum Erlass einer<br />
landesrechtlichen Regelung umgehen, die eigentlich auch bis<br />
zum 01.<strong>09</strong>.20<strong>09</strong> hätte vorliegen müssen, bleibt abzuwarten.<br />
Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge<br />
Nach dem Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge<br />
20<strong>09</strong> / 2010 im Land NRW wurden die Versorgungsbezüge<br />
zum 01.03.20<strong>09</strong> um einen Festbetrag von 20<br />
Euro und um einen dynamischen Faktor von 3 % und zum<br />
01.03.2010 um einen dynamischen Faktor von 1,2 % erhöht.<br />
Mit diesen Erhöhungen ist eine Fortschreibung des Anpassungsfaktors<br />
aufgrund des Versorgungsänderungsgesetzes<br />
2001 verbunden, womit in Angleichung an das Rentenrecht<br />
das Versorgungsniveau von 75 % auf 71,75 % abgesenkt<br />
wird. Die Festbeträge werden um 2,9 bzw. um 1,1 % erhöht.<br />
Föderalismusreform<br />
Im Rahmen der Föderalismusreform ist mit der Aufhebung<br />
des Art. 74 des Grundgesetzes die bisher konkurrierende<br />
Gesetzgebungskompetenz zur Regelung der Besoldung und<br />
Versorgung der Landesbeamten in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz<br />
der Länder gefallen. Das Land NRW hat<br />
im Rahmen der Anpassungen der Besoldungs- und Versorgungsbezüge<br />
in den Jahren 20<strong>08</strong>, 20<strong>09</strong> und 2010 mit eigenen<br />
landesrechtlichen Regelungen hiervon Gebrauch gemacht.<br />
Im Übrigen gelten das bisherige Bundesbesoldungs- und das<br />
Beamtenversorgungsgesetz des Bundes, Stand 31.<strong>08</strong>.2006,<br />
zunächst weiter. Die Ablösung dieser Vorschriften durch eigenes<br />
Landesrecht wird voraussichtlich nach 2010 erfolgen.<br />
Welche Auswirkungen die Föderalismusreform haben<br />
kann, zeigt sich an der Versorgungslastenverteilung. Das<br />
Versorgungslastenverteilungsgesetz des Landes NRW gilt nur<br />
<strong>für</strong> die Beamten, die unter das LBG NRW fallen, bei einem<br />
Dienstherrenwechsel innerhalb des Landes NRW. Bei einem<br />
länderübergreifenden Wechsel oder bei einem Wechsel vom<br />
Bund zum Land oder zu einer Kommune in NRW erfolgt die<br />
Versorgungslastenverteilung zunächst noch gemäß § 107b<br />
BeamtVG, später durch einen Staatsvertrag zwischen dem<br />
Bund und den Ländern mit anderen Regelungsinhalten.<br />
Aufgrund der Föderalismusreform sind auch parallel die<br />
Änderungen des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes des Bundes<br />
in die EDV zu übernehmen, da die Versorgungsbezüge <strong>für</strong><br />
Dienstordnungsangestellte der IKK Signal-Iduna auch nach der<br />
Föderalismusreform nach Bundesrecht berechnet werden. An<br />
diesen Beispielen wird deutlich, dass die Föderalismusreform<br />
die Verwaltungstätigkeit durch die unterschiedliche Ausgestaltung<br />
künftig erheblich belasten wird.<br />
21
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />
Überblick<br />
Die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse hat im Jahr 20<strong>08</strong> <strong>für</strong> 289 Mitglieder nahezu 112.500 Anträge berechnet und die<br />
entsprechenden Beihilfebeträge ausgezahlt. Immer mehr kommunale und andere öffentlich-rechtliche<br />
Einrichtungen machen Gebrauch von diesem Service.<br />
... Ihre Vorteile<br />
• Entlastung von personalintensiven Aufgaben<br />
• kein Aufwand <strong>für</strong> Schulung und Fortbildung<br />
• zeitgerechte und qualifizierte Sachbearbeitung<br />
• Dienstleistungen aus einer Hand<br />
• planbare Verwaltungskosten durch Festpreis von 25 Euro pro Antrag<br />
... Unser Service<br />
• Beihilfeberechnungen im Rechtsgebiet NRW<br />
• schnelle Bearbeitungszeit<br />
• Beratung der Beihilfeberechtigten<br />
• Bescheiderteilung und Auszahlung<br />
• Informationen über Rechtsänderungen<br />
22
Eugenia Wall ist seit 20<strong>08</strong> bei der <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse.<br />
Sie bearbeitet Beihilfeanträge, berät Beihilfeberechtigte<br />
und Mitglieder zur Beihilfe.<br />
23
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />
Aktuelles<br />
Januar 20<strong>08</strong><br />
11 Jahre Wachstum der <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />
Am 01.01.20<strong>08</strong> bestand die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse 11 Jahre. Der<br />
starke kontinuierliche Anstieg der Mitgliederzahlen und der<br />
Anzahl der bearbeiteten Anträge während dieser Zeit veranschaulicht<br />
die Grafik auf Seite 27.<br />
Seit Anfang 2007 ist zwischen verschreibungspflichtigen<br />
und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten zu unterscheiden.<br />
Die notwendigen Informationen müssen sich die<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Internet besorgen.<br />
Aus einer sogenannten „Roten“ und einer „Gelben“ Liste,<br />
in der insgesamt etwa 11.000 Arzneimittel hinterlegt sind, ermitteln<br />
sie, ob es sich um ein verschreibungspflichtiges oder<br />
nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel handelt. Letztere<br />
sind nur noch ausnahmsweise und bei bestimmten Diagnosen<br />
mit ärztlicher Bescheinigung beihilfefähig. Da diese meist<br />
nachgereicht werden, entsteht hoher bürokratischer Aufwand;<br />
Einsparungen sind – wie von Fachleuten prognostiziert – zu<br />
bezweifeln. Dieser Mehraufwand hat dazu geführt, dass die<br />
Bearbeitungszeiten erheblich gestiegen sind. Das ist vor<br />
allem <strong>für</strong> die Beihilfeberechtigten unerfreulich, die häufig die<br />
Arztrechnungen früher bezahlen müssen.<br />
Mitgliederentwicklung<br />
Juni 20<strong>08</strong><br />
Eine kreisangehörige Stadt musste kurzfristig aufgenommen<br />
werden. Der <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse wurden ca. 1.500 Anträge aufs<br />
Jahr bezogen zugeführt.<br />
November 20<strong>08</strong><br />
„Es war abzusehen, dass wir die Marke von 100.000 Beihilfeanträgen<br />
vor Jahresschluss erreichen“, sagt Kurt Pölling,<br />
Referatsleiter der Beihilfekasse.<br />
Die Bearbeitungszeit von Beihilfeanträgen konnte in<br />
diesem Jahr wieder auf durchschnittlich 10 Arbeitstage je<br />
Antrag - gemessen vom Antragseingang bei den <strong>kvw</strong> bis zur<br />
Absendung des Bescheides - zurückgefahren werden. Selbst<br />
in den Sommermonaten, in denen die Zahl der eingereichten<br />
Beihilfeanträge bisweilen Jahresspitzenwerte erreichte, hielt<br />
die Beihilfekasse durch Überstunden auch an Samstagen ihr<br />
Serviceversprechen ein.<br />
Dezember 20<strong>08</strong><br />
Ein weiteres Mitglied mit einem Antragsvolumen von über<br />
6.000 Anträgen wollte möglichst kurzfristig in die Beihilfekasse<br />
aufgenommen werden. Mit dem Angebot, die<br />
Übernahme in 3 Chargen nach Antragstellergruppen zeitlich<br />
24<br />
aufzuteilen, konnte dem Mitglied geholfen werden. So sind<br />
der 01.04.20<strong>09</strong>, der 01.10.20<strong>09</strong> und der 01.04.2010 als weitere<br />
Übernahmetermine vorgesehen. Das bedeutet wiederum so<br />
schnell wie möglich weiteres Personal einzustellen.<br />
Spagat zwischen Prüfgenauigkeit und Kosten<br />
Die hohe Nachfrage nach einer Mitgliedschaft in der<br />
<strong>kvw</strong>-Beihilfekasse forderte die <strong>kvw</strong>-Beschäftigten:<br />
Einerseits wollten wir sehr rasch möglichst vielen<br />
Kommunen den Zugang ermöglichen; andererseits<br />
sollte die Bearbeitungsqualität nicht leiden. Unseren<br />
Mitgliedern hätte es nicht genutzt, zwar relativ geringe<br />
Verwaltungskosten, da<strong>für</strong> aber umso mehr an Beihilfen<br />
zu zahlen. Es galt und gilt, mit dem Geld unserer Mitglieder<br />
verantwortungsbewusst und sparsam umzugehen.<br />
Dazu sind eine fundierte Ausbildung und effektive<br />
Gegenprüfungen besonders wichtig.<br />
Personalentwicklung<br />
Januar 20<strong>09</strong><br />
Drei neue Gruppenleitungen in der Beihilfekasse<br />
Die Personalentwicklung in der Beihilfekasse machte es<br />
erforderlich, die Führungsstrukturen neu zu organisieren. Die<br />
Mitarbeiterzahl war inzwischen auf über 60 Beschäftigte in<br />
Voll- und Teilzeitstellen angewachsen, die bis dahin in drei<br />
Gruppen aufgeteilt wurden. Eine geringere Gruppengröße<br />
ermöglicht eine effizientere Arbeitsaufteilung. Derzeit besteht<br />
die Beihilfesachbearbeitung aus 7 Gruppen mit durchschnittlich<br />
9 Beschäftigten und einem DV-Koordinationsteam mit<br />
2 Beschäftigten.<br />
Rechtsentwicklung<br />
Kostendämpfungspauschale<br />
In verschiedenen Urteilen des Oberverwaltungsgerichtes<br />
NRW in Münster wurde die pauschale Kürzung der Beihilfe<br />
durch die Kostendämpfungspauschale mit dem verfassungsrechtlichen<br />
Grundsatz der Fürsorgepflicht des Dienstherrn<br />
<strong>für</strong> nicht vereinbar gehalten. Das Bundesverwaltungsgericht<br />
hat mit Urteilen vom 20.03.20<strong>08</strong> in mehreren Revisionsverfahren<br />
diese Auffassung nicht bestätigt. Darin wird ausgeführt,<br />
dass sich die pauschalierten Eigenbeteiligungen an<br />
den Krankheitskosten als Besoldungskürzungen auswirken.<br />
Daher können sie Anlass geben zu prüfen, ob das Netto-
einkommen der Beamten noch das Niveau aufweist, das der<br />
verfassungsgerechte Grundsatz der Gewährleistung eines<br />
angemessenen Lebensunterhaltes fordert. Nach diesem<br />
Grundsatz muss der Gesetzgeber da<strong>für</strong> Sorge tragen, dass<br />
die Beamtenbesoldung nicht von der allgemeinen Einkommensentwicklung<br />
abgekoppelt wird, d. h. deutlich hinter<br />
dieser Entwicklung zurückbleibt. Genügt das Nettoeinkommen<br />
der Beamten eines Bundeslandes diesen verfassungsrechtlich<br />
vorgegebenen Anforderungen nicht mehr, so muss<br />
der Gesetzgeber diesen Zustand beenden. Dabei sind ihm<br />
keine bestimmten Maßnahmen vorgegeben. So kann er die<br />
Dienstbezüge erhöhen, aber auch die Kostendämpfungspauschale<br />
streichen oder die Absenkung der jährlichen Sonderzuwendung<br />
rückgängig machen. Aufgrund dieses Gestaltungsspielraums<br />
kann das Einkommensniveau der Beamten nicht<br />
im Rahmen der Klagen auf höhere Beihilfe überprüft werden.<br />
Vielmehr sind sie darauf verwiesen, Klagen auf Feststellung<br />
zu erheben, dass sich bei Anwendung der besoldungsrechtlich<br />
relevanten Gesetze in ihrer Gesamtheit ein verfassungswidrig<br />
zu niedriges Nettoeinkommen ergibt. (BVerwG 2 C<br />
49.07, 2 C 52.07, 2 C 63.07 – Urteile vom 20.03.20<strong>08</strong>)<br />
Implantatversorgung<br />
Das OVG Münster hat zur Implantatversorgung entschieden,<br />
dass die gegenwärtige Regelung über keine ausreichende<br />
Ermächtigungsgrundlage <strong>für</strong> diesen engen, einschränkenden<br />
Indikationsbereich der Versorgung mit Implantaten verfügt.<br />
Aber auch die medizinische Notwendigkeit und Angemessenheit<br />
lassen im Einzelfall eine Implantatversorgung geeigneter<br />
erscheinen als die bisherige konventionelle Versorgung mit<br />
Brücken oder überkronten Zähnen. Das Land NRW beabsichtigt<br />
als Verordnungsgeber die Beihilfeverordnung entsprechend<br />
anzupassen.<br />
Erstattung nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel<br />
Verwaltungsgerichte haben die Ausgestaltung der bis Ende<br />
März 20<strong>09</strong> gültigen Ermächtigungsnorm in § 88 LBG a. F.<br />
auch hier nicht <strong>für</strong> ausreichend gehalten, Arzneimittel von der<br />
Beihilfefähigkeit auszuschließen.<br />
Das Land NRW hat deshalb kurzfristig die entsprechende Vorschrift<br />
in der Beihilfeverordnung zum Gesetz erhoben. Auch<br />
wurde die Ermächtigungsgrundlage im Landesbeamtengesetz<br />
dieser Rechtsprechung angepasst.<br />
Geschäftsverlauf<br />
1. MItGlIEDER<br />
Kommunale Arbeitgeber können die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse beauftragen,<br />
die Beihilfen <strong>für</strong> Beschäftigte und Versorgungsempfänger<br />
dem Beamtenrecht entsprechend festzusetzen und<br />
auszuzahlen. Die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse trifft dann im Namen des<br />
Mitglieds die notwendigen Entscheidungen und führt gegebenenfalls<br />
auch gerichtliche Auseinandersetzungen. Überträgt<br />
ein Mitglied die Beihilfegewährung an die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse,<br />
so ist es vollständig von allen zugehörigen Aufgaben entlastet.<br />
Finanzielle Beihilfen zu den Kosten bei Krankheit, Geburt<br />
und Todesfällen ergänzen die von den Beihilfeberechtigten<br />
selbst abgeschlossenen Versicherungen. Sie gehören zur Fürsorgepflicht<br />
des Dienstherrn. Sein Anteil wird dabei individuell<br />
so berechnet, dass Beihilfen und Krankenversicherung die<br />
Kosten gemeinsam annähernd oder sogar vollständig decken.<br />
Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Körperschaften<br />
werden dazu freiwillige Mitglieder der <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse. Nutzen<br />
können diesen Service zudem Körperschaften, Anstalten<br />
und Stiftungen im Sinne von § 4 VKZVKG, auch wenn sie das<br />
übrige Leistungsangebot der <strong>kvw</strong> nicht in Anspruch nehmen<br />
und ihnen bisher auch nicht angehörten. Am 31.12.20<strong>08</strong> hatte<br />
die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse 289 Mitglieder.<br />
31 %<br />
15 %<br />
7 %<br />
23 %<br />
24 %<br />
89 Städte<br />
44 Gemeinden<br />
21 Kreise<br />
68 Sparkassen<br />
67 Sonstige Organisationen (einschl. des LWL<br />
Zusammensetzung der Mitglieder nach Rechtsform<br />
25
26<br />
Andreas Groll bearbeitet Beihilfeanträge,<br />
berät Mitglieder und Leistungsberechtigte<br />
rund um die Beihilfe.
2. lEIStUNGEN<br />
20<strong>08</strong> hat die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse 112.481 Anträge mit einem<br />
Volumen von 94,35 Mio. Euro bearbeitet, davon:<br />
76.756 Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von Beamten,<br />
32.636 Anträge . . . . . . . . . . . . . von Versorgungsempfängern,<br />
2.511 Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von Angestellten<br />
(Pflichtversicherte und freiwillig Versicherte<br />
ohne Arbeitgeberzuschuss),<br />
578 Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . von Angestellten<br />
(freiwillig Versicherte mit Arbeitgeberzuschuss).<br />
Für das Jahr 20<strong>09</strong> werden ca. 126.000 Anträge über ca.<br />
103,5 Mio. Euro erwartet.<br />
Das Beihilferecht wurde im Laufe der Jahre mehrfach<br />
geändert. Dabei erhöhte sich ab 01.01.2003 auch die Eigenbeteiligung<br />
der Berechtigten durch die sogenannten Kostendämpfungspauschalen<br />
um 50 %.<br />
Sie sind nach Besoldungsgruppen gestaffelt und betragen:<br />
Stufe Besoldungsgruppe Betrag<br />
1 A 7 – A 11 150 €<br />
2 A 12 – A 15, B 1, C 1, C 2, H 1 – H 3, R 1 300 €<br />
3 A 16, B 2 + B 3, C 3, H 4 + H 5, R 2 + R 3 450 €<br />
4 B 4 – B 7, C 4, R 4 – R 7 600 €<br />
5 Höhere Besoldungsgruppen 750 €<br />
Pro Kind vermindert sich die Eigenbeteiligung seit Januar<br />
2004 um 60 Euro.<br />
Für Ruhestandsbeamte werden die Kostendämpfungspauschalen<br />
weiterhin nach dem Ruhegehaltssatz bemessen.<br />
Sie betragen jedoch höchstens 70 % der oben genannten<br />
Beträge. Für Witwen und Witwer bemessen sie sich nach<br />
60 % des Ruhegehaltssatzes.<br />
Die Herausforderungen 20<strong>09</strong><br />
Heute bearbeiten 68 <strong>kvw</strong>-Beschäftigte (rund 61 Vollzeitstellen)<br />
rund 112.500 Anträge im Jahr <strong>für</strong> 289 kommunale<br />
Mitglieder. Im Zuge der Kommunalisierung der Versorgungs-<br />
und Umweltverwaltung erwarten wir von den<br />
neuen Aufgabenträgern, den Kreisen, kreisfreien Städten<br />
und dem Landschaftsverband, in deren Geschäftsbereich<br />
die ehemaligen Landesbediensteten übernommen<br />
wurden, ca. 600 zusätzliche Anträge. Aufgrund aktueller<br />
Anfragen wird 20<strong>09</strong> mit weiteren Mitgliedschaften<br />
gerechnet. Wir erwarten <strong>für</strong> 20<strong>09</strong> ein Aufkommen von<br />
insgesamt 126.000 Anträgen.<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
‘98 ‘99 ‘00<br />
‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘<strong>08</strong><br />
Entwicklung der Mitgliederzahlen der Beihilfekasse<br />
seit Gründung<br />
‘98 ‘99 ‘00<br />
‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘<strong>08</strong><br />
Anzahl der Beihilfeanträge seit 1997 in Tausend<br />
27
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse<br />
Ausblick<br />
Einführung eines Umlagesystems<br />
Expandierende Kosten im Gesundheitswesen sind nicht nur in<br />
den Krankenversicherungssystemen ein Thema. Sie belasten<br />
auch zunehmend die kommunalen Haushalte, aus denen die<br />
Beihilfeaufwendungen <strong>für</strong> die Beamten zu finanzieren sind.<br />
So können die Kosten <strong>für</strong> Krankenhausaufenthalte, Operationen<br />
und spezielle Therapien schnell fünf- bis sechsstellige<br />
Summen erreichen. Selten sind solche Ereignisse vorhersehbar.<br />
Bei den Haushaltsplanungen stützt man sich regelmäßig<br />
auf die Zahlen der vergangenen Jahre und hofft, dass man<br />
von höheren Kosten verschont bleibt.<br />
Die <strong>kvw</strong>-Beihilfekasse ist nunmehr seit über 11 Jahren tätig.<br />
Inzwischen lassen ca. 22.000 beihilfeberechtigte Beamte und<br />
Versorgungsempfänger von 306 Mitgliedskörperschaften ihre<br />
Beihilfen durch sie berechnen. Im Jahr 20<strong>08</strong> wurden 112.500<br />
Anträge mit einem Finanzvolumen von 94,35 Mio. Euro<br />
berechnet und ausgezahlt. Dies ist inzwischen eine Größe,<br />
die es zulässt, neben der Berechnung und Auszahlung der<br />
Beihilfen auch eine Beihilferisikoabsicherung einzuführen.<br />
Zurzeit wird der Beihilfeaufwand von den Mitgliedern<br />
jeweils im Erstattungswege aufgebracht. Damit trägt jedes<br />
Mitglied die nicht vorhersehbaren Risiken, die im Gesundheitswesen<br />
liegen, selber. Zusätzlich werden dauerhaft<br />
Kostensteigerungen erkennbar, die mit der demografischen<br />
Entwicklung, insbesondere bei den Pensionären, in Zusammenhang<br />
stehen. Daher ist es nur zu verständlich, dass vor<br />
allem bei kleineren Kommunen immer häufiger der Wunsch<br />
besteht, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, um derartigen Risiken<br />
und Entwicklungen zu begegnen.<br />
Ein Ausweg wird häufig in einer Beihilferückdeckungsversicherung<br />
gesehen, wie sie inzwischen von verschiedenen<br />
Versicherungsunternehmen angeboten wird. Dabei geht man<br />
von der Überlegung aus, dass die finanziellen Belastungen im<br />
Beihilfebereich mit einer Beihilferückdeckungsversicherung <strong>für</strong><br />
den Gemeindehaushalt dauerhaft kalkulierbar bleiben.<br />
Fraglich ist allerdings, ob dies mit einer Beihilferückdeckungsversicherung<br />
auch gelingt. Erfahrungen einiger Kommunen,<br />
die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen,<br />
28<br />
zeigen, dass die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen<br />
mit einer Beihilferückdeckungsversicherung nur scheinbar<br />
Planungssicherheit <strong>für</strong> die kommenden Haushalte bieten.<br />
Steigende Ausgaben <strong>für</strong> Beihilfeaufwendungen bleiben in<br />
den Folgejahren nicht ohne Auswirkung auf die Beitragsprämien<br />
der Versicherungen. Es gibt Kommunen, die inzwischen<br />
ihre Mitgliedschaft in einer Beihilfeversicherung gekündigt<br />
haben, da die Beitragsentwicklung bereits nach 2 Jahren an<br />
die Kostenentwicklung der Beihilfeaufwendungen angepasst<br />
wurde. Außerdem sind dort – wie bei jeder Versicherung –<br />
Risikozuschläge und Aufschläge <strong>für</strong> Steuern, Ausschüttungen<br />
an Anteilseigner sowie die Provisionen des Außendienstes zu<br />
finanzieren. All dies benötigen die <strong>kvw</strong> nicht.<br />
Vor diesem Hintergrund wächst die Bereitschaft, innerhalb<br />
der kommunalen Familie einen Risikoausgleich zu organisieren.<br />
Hierbei können die <strong>kvw</strong> die Erfahrungen, die sie in der<br />
Neuorganisation des Umlagesystems in der Beamtenversorgung<br />
gewonnen haben, nutzen, um auch in der Beihilfekasse<br />
einen Risikoausgleich aufzubauen. Erkenntnisse und Erfahrungen<br />
kommunaler Versorgungskassen aus anderen Bundesländern,<br />
die bereits über Risikoausgleichssysteme verfügen,<br />
können zusätzlich ausgewertet werden. Inzwischen gibt es<br />
hier Überlegungen, in einen Risikoausgleich auch andere<br />
Versorgungskassen einzubeziehen. Je größer die Ausgleichsgemeinschaft<br />
ist, desto geringer sind die Belastungen <strong>für</strong> den<br />
Einzelnen. Eine Arbeitsgruppe, in der Vertreter verschiedener<br />
kommunaler Versorgungskassen mitarbeiten, entwickelt<br />
derzeit Vorschläge <strong>für</strong> eine solche Risikogemeinschaft, die<br />
möglicherweise sogar länderübergreifend gestaltet werden<br />
könnte.<br />
Ein hier entwickeltes Konzept, das die Absicherung von<br />
Einzelrisiken basierend auf den Zahlen der Jahre 2007 und<br />
20<strong>08</strong> vorsieht, stieß bei Bürgermeisterkonferenzen auf<br />
hohes Interesse. In Rundschreiben an alle Kommunen des<br />
Geschäftsbereichs der <strong>kvw</strong> werden wir darüber informieren<br />
und die Bereitschaft zu einer Beteiligung an einer solchen<br />
Risikoausgleichsgemeinschaft erfragen.
André Borken arbeitet neue Kolleginnen und Kollegen in der <strong>kvw</strong>-<br />
Beihilfekasse ein, prüft Beihilfeanträge gegen, beantwortet Mitgliedern<br />
und Beihilfeberechtigten Fragen zur Beihilfeverordnung (BVG).<br />
29
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Familienkasse<br />
Überblick<br />
Die Familienkasse der <strong>kvw</strong> erfüllt <strong>für</strong> ihre<br />
kommunalen Mitglieder alle Aufgaben rund um das Kindergeld.<br />
Sie ist in dieser Funktion Bundesfinanzbehörde („landesfamilienkasse“).<br />
• Sie entscheidet über die Ansprüche auf Kindergeld.<br />
• Sie erteilt Bescheide über die Festsetzung des Kindergeldes und dessen Aufhebung.<br />
• Sie zahlt das Kindergeld direkt an die Berechtigten aus.<br />
• Sie führt die vorgeschriebenen Einkommensüberprüfungen durch.<br />
• Sie bearbeitet Einsprüche.<br />
• Sie führt – wenn erforderlich – die Prozesse vor dem Finanzgericht.<br />
• Sie berät die Berechtigten.<br />
• Mit ihren Entscheidungen zum Kindergeld liefert sie den Arbeitgebern eine Entscheidungsbasis <strong>für</strong> weitere<br />
kinderbezogene Leistungen in Vergütung und Besoldung.<br />
• Sie erledigt alle Meldepflichten und statistischen Aufgaben, die mit dem Kindergeld verbunden sind.<br />
30<br />
Sibylle Pölking setzt Kindergeld<br />
fest, zahlt es aus und<br />
berät Mitglieder sowie<br />
Kindergeldberechtigte<br />
von A-Z in Kindergeld-<br />
angelegenheiten.
Aktuelles<br />
Für die Familienkasse war das Jahr 20<strong>08</strong> ein Jahr<br />
der Reorganisation:<br />
Januar – Mai 20<strong>08</strong><br />
Durchführung und Abschluss einer gründlichen<br />
Geschäftsprozessanalyse<br />
Vor dem Hintergrund zunehmender Mitgliederzahlen und<br />
steigender fachlicher Anforderungen wurden interne Arbeitsabläufe<br />
überprüft, teilweise neu organisiert und optimiert.<br />
Mai 20<strong>08</strong><br />
<strong>kvw</strong>-Familienkasse zieht um<br />
Aus Platzmangel im Gebäude der <strong>kvw</strong> an der Zumsandestraße<br />
zieht die Familienkasse in ehemalige Büroräume der<br />
Telekom an der Oststraße.<br />
Juni 20<strong>08</strong> – Mai 20<strong>09</strong><br />
Die Einführung einer elektronischen Kindergeldakte<br />
wurde vorbereitet und abgeschlossen<br />
Alle in der Kindergeldakte vorhandenen Dokumente wurden<br />
in einer elektronischen Akte erfasst und stehen dem Sachbearbeiter<br />
nun jederzeit zur Verfügung, um Auskünfte zu geben<br />
und Anträge ohne Aktensuche bearbeiten zu können.<br />
Eingehende und ausgehende Schreiben werden digitalisiert<br />
gespeichert und ermöglichen dem Bearbeiter einen jederzeitigen<br />
schnellen Zugriff.<br />
August – Dezember 20<strong>08</strong><br />
Alle Kindergeldauszahlungen wurden auf ein<br />
einheitliches Abrechnungssystem umgestellt<br />
Für einige Mitglieder erfolgte die Auszahlung des Kindergeldes<br />
noch gemeinsam mit dem Gehalt über das Mitglied.<br />
Durch die Einführung eines einheitlichen Abrechnungsverfahrens<br />
war es möglich, dass die Familienkasse das Kindergeld<br />
<strong>für</strong> alle Mitglieder direkt auszahlt. Alle zahlungsrelevanten<br />
Daten, einschließlich evtl. Rückforderungen und Einzahlungen,<br />
stehen nun übersichtlich zur Verfügung. Bescheide, Anforderungsschreiben<br />
und Information der Mitglieder können<br />
seitdem <strong>für</strong> alle Berechtigten systemunterstützt bzw. automatisiert<br />
erstellt werden.<br />
Rechtlich änderte sich Folgendes:<br />
Dezember 20<strong>08</strong><br />
Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Kürzung<br />
der Entfernungspauschale <strong>für</strong> verfassungswidrig<br />
Kindergeldanträge, die 2007 und 20<strong>08</strong> wegen zu hoher<br />
Einkünfte der Kinder abgelehnt werden mussten, werden<br />
wieder aufgegriffen und vielfach mit positivem Ergebnis <strong>für</strong><br />
die Berechtigten neu beschieden.<br />
Am 19.12.20<strong>08</strong> entscheidet der Bundesrat über die<br />
Kindergelderhöhung auf 164 Euro <strong>für</strong> die Kinder 1 und 2,<br />
auf 170 Euro <strong>für</strong> Kind 3 und 195 Euro ab Kind 4<br />
Durch die Umstellung der Kindergeldauszahlung auf ein einheitliches<br />
System konnte schnell gehandelt und das erhöhte<br />
Kindergeld pünktlich zum 01.01.20<strong>09</strong> ausgezahlt werden.<br />
31
Tanja Kitten prüft<br />
Kindergeldansprüche,<br />
setzt Kindergeld fest,<br />
zahlt es aus und berät<br />
Kindergeldberechtigte<br />
sowie Mitglieder zu<br />
Kindergeldangelegenheiten.<br />
Geschäftsverlauf<br />
Seit dem 01.01.2007 kann die <strong>kvw</strong>-Familienkasse als Landesfamilienkasse<br />
die Kindergeldbearbeitung <strong>für</strong> die Mitglieder<br />
übernehmen, wenn sie damit beauftragt wird. Ermächtigungsgrundlage<br />
da<strong>für</strong> ist die Landesfamilienkassenverordnung. Sie<br />
ist seither als Landesfamilienkasse tätig.<br />
Kommunale Arbeitgeber mit Sitz im Gebiet der Kommunalen<br />
Versorgungskassen Westfalen-Lippe können danach die<br />
<strong>kvw</strong> beauftragen, <strong>für</strong> ihre Beschäftigten das Kindergeld festzusetzen<br />
und direkt an sie auszuzahlen.<br />
Die Übertragung der Aufgaben erfolgt im Zusammenhang<br />
mit der Aufnahme als Mitglied durch schriftliche Vereinbarung,<br />
worin die gegenseitigen Rechte und Pflichten, der Zeitpunkt<br />
des Aufgabenübergangs und die Kostentragung geregelt<br />
werden.<br />
32<br />
Die Mitglieder<br />
• entlasten sich damit vollständig von diesen Aufgaben,<br />
• reduzieren ihre Personal- und Sachkosten,<br />
• sichern sich die qualifizierte, rasche und kostengünstige<br />
Bearbeitung,<br />
• erhalten Entscheidungshilfen <strong>für</strong> die tariflichen und besoldungsrechtlichen<br />
Leistungen, die an Kinder gezahlt werden,<br />
• ersparen sich die Auszahlung und Nachweisung des Kindergeldes<br />
und<br />
• ersparen sich den Zeitaufwand, der mit Steuerprüfungen<br />
und Statistiken verbunden ist.<br />
Seit 1996 ist das Kindergeld ein „Familienleistungsausgleich“,<br />
der nach dem Steuerrecht festgesetzt wird. Das Verfahrensrecht<br />
bestimmt die Abgabenordnung. Arbeitgeber des<br />
öffentlichen Dienstes sind zugleich Familienkasse <strong>für</strong> ihre Beschäftigten.<br />
Mit dieser Aufgabe wurden allerdings zunehmend<br />
Ressourcen gebunden: Rechtsprechungen der Finanzgerichte,<br />
diverse Meldepflichten, statistische Erhebungen und umfangreiche<br />
Dienstanweisungen erfordern nämlich fortlaufende
Schulungen und machen die Tätigkeiten komplexer. Insbesondere<br />
bei kleineren Arbeitgebern führt das häufig zu einer<br />
unverhältnismäßig hohen Arbeitsbelastung. Daher plädierten<br />
die öffentlichen Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen <strong>für</strong> eine<br />
zentrale Bearbeitung, was zum Erlass der Landesfamilienkassen-Verordnung<br />
führte. Ergänzend schuf das Bundesfinanzministerium<br />
Ende 2006 die rechtlichen Voraussetzungen, um<br />
im öffentlichen Dienst Kindergeld unabhängig vom Entgelt<br />
und von der Steuerbescheinigung direkt an die Berechtigten<br />
auszuzahlen.<br />
1. MItGlIEDER<br />
Die Landesfamilienkasse der <strong>kvw</strong> hat im Jahr 20<strong>08</strong> 7 neue<br />
Mitglieder aufgenommen und betreute im Dezember 20<br />
kommunale Mitglieder mit rund 11.000 Zahlfällen. Durch die<br />
Begrenzung der Kindergeldberechtigung auf das 25. Lebensjahr<br />
fielen 20<strong>08</strong> allerdings drei Jahrgänge (1981, 1982 und<br />
1983) aus der Kindergeldzahlung, sodass die Zahlfälle trotz<br />
steigender Mitgliederzahlen rückläufig waren.<br />
Das Interesse an einer Übernahme der Kindergeldbearbeitung<br />
ist nach wie vor hoch. Für viele Mitglieder ist bei der Abgabe<br />
der Aufgaben entscheidend, dass neben dem Personal- auch<br />
der Schulungsaufwand deutlich reduziert werden kann. Die<br />
teilweise komplizierten Anspruchsvoraussetzungen aus dem<br />
Steuerrecht und die ständige Weiterentwicklung des Rechts<br />
durch die Finanzgerichte zwingen zu einer permanenten<br />
Aktualisierung der Fachkenntnisse. Nur mit diesen Kenntnissen<br />
können die Standards eingehalten werden, die von der<br />
Fachaufsicht vorgegeben sind.<br />
2. lEIStUNGEN<br />
Schon jetzt ist es uns möglich, unseren Kunden einen optimalen<br />
Service zu bieten, indem wir ihre Anträge zeitnah bearbeiten,<br />
gut erreichbar und bestrebt sind, die Verwaltungskosten<br />
stabil zu halten. Selbst schwierige und umfangreiche Fälle<br />
können aufgrund der langjährigen Erfahrung des Personals<br />
rechtlich sicher und kompetent bearbeitet werden.<br />
Unabhängig davon werden wir auch in Zukunft daran arbeiten,<br />
• Arbeitsabläufe zu hinterfragen und zu vereinfachen, um<br />
dadurch die Effektivität der Arbeit zu steigern und den<br />
Kundenservice zu erhöhen.<br />
• qualifiziertes Personal vorzuhalten, um den Kundenvor-<br />
stellungen und Übernahmewünschen zeitgerecht nachkommen<br />
zu können.<br />
Finanzierung<br />
Die Mitglieder finanzieren die Verwaltungskosten durch Beiträge,<br />
die mit Zustimmung des Verwaltungsrates festgelegt<br />
werden. Gegenwärtig betragen die Kosten pro Fall und Jahr<br />
40 Euro. Berechnet wurde dieser Beitrag nach den realen<br />
Personal-, Sach- und Gemeinkosten in rund 11.000 Kindergeldfällen.<br />
Dabei wurde <strong>für</strong> alle Kinder ein einheitlicher Mischpreis<br />
ermittelt. Da die Bearbeitung <strong>für</strong> Kinder über 18 Jahren erheblich<br />
aufwendiger ist, ist es nicht möglich, nur diese an die<br />
Familienkasse der <strong>kvw</strong> zu übertragen. Die Verwaltungskosten<br />
werden jährlich im Dezember abgerechnet. Vierteljährlich sind<br />
Abschläge zu zahlen. Wer weniger als 12 Monate Mitglied ist,<br />
zahlt den anteiligen Beitrag.<br />
Ausblick<br />
Konjunkturpaket II: Kinderbonus von 100 Euro<br />
Allen Kindern mit einem Kindergeldanspruch im April 20<strong>09</strong><br />
wird im Rahmen des Konjunkturpakets II ein einmaliger<br />
Bonus von 100 Euro am 01.04. ausgezahlt.<br />
„Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung“<br />
bringt auch Änderungen im Kindergeldrecht<br />
Das neue Bürgerentlastungsgesetz vom 16.07.20<strong>09</strong> soll zwar<br />
in erster Linie der verbesserten steuerlichen Berücksichtigung<br />
von Vorsorgeaufwendungen dienen, wirkt sich allerdings auch<br />
auf das Kindergeldrecht aus. Der Grenzbetrag der Einkünfte<br />
und Bezüge, der <strong>für</strong> den Bezug des Kindergeldes unschädlich<br />
ist, erhöht sich von bisher 7.680 Euro auf 8.004 Euro. Die<br />
Einkommensberechnungen und Prognosen der Familienkasse<br />
sind daraufhin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.<br />
Gleichzeitig wird der Katalog der kindergeldrechtlich zu<br />
berücksichtigenden Freiwilligendienste erweitert und eröffnet<br />
einem größeren Personenkreis den Zugang zum Kindergeldanspruch.<br />
Die Familienkasse wird sich auf höhere Antrags-<br />
und Berechtigtenzahlen einstellen.<br />
Mitgliederzahl der Familienkasse<br />
steigt kontinuierlich<br />
Im Jahr 20<strong>09</strong> werden von der Familienkasse voraussichtlich<br />
10 neue Mitglieder aufgenommen werden können. Auch <strong>für</strong><br />
das Jahr 2010 laufen bereits die Gespräche und Vorbereitungen<br />
<strong>für</strong> weitere Mitgliederaufnahmen. Selbst große Kommunen<br />
denken mittlerweile über eine Abgabe der Aufgaben nach.<br />
33
Sonja Fallowe bearbeitet Rentenanträge und Einsprüche, berät Mitglieder<br />
und Versicherte in allen Fragen zur Zusatzversorgung.<br />
34
Kapitel<br />
Das Jahr 20<strong>08</strong>:<br />
<strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-Betriebsrenten<br />
Überblick<br />
<strong>für</strong> 825 Mitglieder<br />
• kostengünstige Abwicklung der Pflichtversicherung<br />
• kostenlose Schulungsveranstaltungen<br />
• telefonische Fachberatung<br />
• regelmäßige Information über aktuelle Entwicklungen durch Rundschreiben<br />
• informativer Internetauftritt<br />
• Informationsveranstaltungen bei den Mitgliedern<br />
<strong>für</strong> über 263.000 Versicherte<br />
• telefonische und persönliche Fachberatung rund um die betriebliche Altersversorgung<br />
• jährliche Mitteilung über die erworbenen Anwartschaften<br />
<strong>für</strong> fast 73.500 Rentnerinnen und Rentner<br />
• Rentenfestsetzung innerhalb von zwei Wochen<br />
• jährliche Rentenerhöhung<br />
• telefonische Fachberatung<br />
• zuverlässige Rentenzahlungen in Höhe von 312 Mio. Euro jährlich<br />
35
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-Betriebsrenten<br />
Aktuelles<br />
Januar 20<strong>08</strong><br />
Nachgelagerte Besteuerung von Betriebsrenten<br />
Mit dem Jahressteuergesetz 2007 ist auch in der umlagefinanzierten<br />
betrieblichen Altersvorsorge der erste Schritt zur<br />
nachgelagerten Besteuerung getan. Ab dem 01.01.20<strong>08</strong> sind<br />
Umlagezahlungen des Arbeitgebers nach § 3 Nr. 56 EStG bis<br />
zu 1% der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen<br />
Rentenversicherung dann steuerfrei, wenn diese Grenze nicht<br />
bereits durch eine Entgeltumwandlung von den Beschäftigten<br />
ausgeschöpft wird. Die über diesen Betrag hinausgehenden<br />
Umlagezahlungen sind weiterhin pauschal und abhängig von<br />
der Entgelthöhe teilweise individuell zu versteuern. Betriebsrenten,<br />
die aus steuerfreien Umlagen entstehen, werden<br />
voll nachgelagert besteuert. Der versteuerte Teil der Umlagezahlungen<br />
führt zu Betriebsrenten, die nur ertragsanteilig<br />
besteuert werden. Diese Besteuerung von Umlagezahlungen<br />
wird vom Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 07.05.20<strong>09</strong><br />
<strong>für</strong> rechtmäßig erklärt.<br />
Mai 20<strong>08</strong><br />
Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG)<br />
Am 21.05.20<strong>08</strong> hat das Bundeskabinett den Entwurf eines<br />
Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG)<br />
beschlossen. Das Gesetz trat am 29.05.20<strong>09</strong> in Kraft. Für die<br />
Zusatzversorgung ist vor allem von Bedeutung, dass Artikel<br />
28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB beibehalten wurde, sodass <strong>für</strong><br />
unsere Mitglieder das bisherige Passivierungswahlrecht <strong>für</strong><br />
mittelbare Pensionsverpflichtungen bestehen bleibt. Es sind<br />
jedoch im Anhang Ausführungen zur Art des Versorgungssystems<br />
weiterhin erforderlich.<br />
Dezember 20<strong>08</strong><br />
Überleitungen<br />
Der Überleitungsverkehr zwischen den kommunalen und<br />
kirchlichen Zusatzversorgungskassen des öffentlichen Dienstes<br />
wird wieder aufgenommen. Überleitungsanträge, die seit<br />
2002 gestellt wurden, konnten nach und nach den anderen<br />
Zusatzversorgungskassen zugeleitet werden. Nach der Überleitung<br />
werden die Versicherten informiert. Das gegenseitige<br />
Anerkennungsverfahren mit der Versorgungsanstalt des<br />
Bundes und der Länder (VBL) wird bisher bei Bedarf nur in<br />
Einzelfällen durchgeführt.<br />
36<br />
Geschäftsverlauf<br />
1. MItGlIEDER<br />
Die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe ist<br />
die betriebliche Altersvorsorgeeinrichtung <strong>für</strong> Arbeitgeber des<br />
kommunalen öffentlichen Dienstes in Westfalen-Lippe, die<br />
Mitglied sind. Wir betreuen 825 Mitglieder in allen Fragen der<br />
betrieblichen Altersversorgung.<br />
Die Beschäftigten der Mitglieder werden bei der Zusatzversorgungskasse<br />
pflichtversichert: Neben der gesetzlichen<br />
Rente erhalten sie im Alter oder bei Erwerbsminderung eine<br />
Betriebsrente. Im Todesfall sind die Hinterbliebenen zusätzlich<br />
versorgt.<br />
Darüber hinaus können sich die Beschäftigten seit Anfang<br />
2002 mit unserer PlusPunktRente freiwillig versichern.<br />
Betriebsrente und PlusPunktRente zusammen bieten eine<br />
umfassende Versorgung. (siehe zur PlusPunktRente separates<br />
Kapitel)<br />
2. lEIStUNGEN<br />
Die <strong>kvw</strong> übernehmen <strong>für</strong> ihre Mitglieder die tarifvertragliche<br />
Verpflichtung zur Versorgung der Beschäftigten. Mit diesem<br />
Service entlasten wir die Mitglieder von zusätzlichem Zeit-,<br />
Sach- und Personalaufwand. Im Leistungsfall zahlen die <strong>kvw</strong><br />
die Renten im eigenen Namen aus. Unsere Mitglieder unterstützen<br />
wir auch bei der Betreuung der aktiv Beschäftigten, z.<br />
B. durch Fortbildungen in der Personalsachbearbeitung.<br />
2.1 Schulungen & individuelle Beratung<br />
Wir bieten Seminare <strong>für</strong> Mitglieder, Datenzentralen und<br />
Versicherte an – sowohl im Haus der <strong>kvw</strong> als auch vor Ort bei<br />
unseren Mitgliedern. 20<strong>08</strong> wurden über 300 Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer aus Personalsachbearbeitung und Gehaltsstellen<br />
in 19 Seminaren geschult. Schwerpunkte waren das<br />
Versicherungs- und Leistungsrecht und der elektronische<br />
Datenträgeraustausch. In den kommunalen Rechenzentren<br />
besuchten 175 Teilnehmende die insgesamt 7 Seminare zum<br />
elektronischen Datenträgeraustausch. Bei über 20 Mitgliedern<br />
haben wir auf Personalversammlungen ausführlich über die<br />
betriebliche Altersversorgung informiert. Bei diesen Vorträgen<br />
waren über 1000 Beschäftigte anwesend; die Resonanz war<br />
sehr positiv. Wir reisten zu Veranstaltungen und Beratungstagen,<br />
z. B. zur IHK Nordwestfalen, zum Flughafen Paderborn-<br />
Lippstadt, zum Sozialwerk St. Georg, zum DRK Kreisverband<br />
Wanne-Eickel, zur Sparkasse Bielefeld, zum Studentenwerk<br />
Dortmund und zur Lebenshilfe Hamm und Bielefeld. Die speziell<br />
<strong>für</strong> Betriebs- und Personalräte durchgeführten Veranstaltungen<br />
besuchten insgesamt 358 Personen.
Seit mehreren Jahren informieren wir die Beschäftigten auch<br />
vor Ort bei unseren Mitgliedern. In Vorträgen und persönlichen<br />
Beratungen erläutern wir umfassend alle Fragen der betrieblichen<br />
Altersversorgung. Wir beraten zur PlusPunktRente,<br />
zu Entgeltumwandlung und Riester-Förderung ebenso wie zur<br />
Pflichtversicherung – so z. B. über das Punktemodell.<br />
Gerne besuchen wir auch Ihre Einrichtung. Bei Interesse melden<br />
Sie sich bitte bei Herrn Uhlenbrock unter 0251 591-4661.<br />
2.2 Die Abrechnungsverbände<br />
Die <strong>kvw</strong>-Betriebsrenten bieten ihre Leistungen in zwei Abrechnungsverbänden<br />
(AV) an:<br />
• im AV I – dem Klassiker <strong>für</strong> die Pflichtversicherung,<br />
• im AV II – besonders interessant <strong>für</strong> die Pflichtversicherung<br />
neuer Mitglieder.<br />
2.2.1 Abrechnungsverband I (AV I)<br />
Versicherte<br />
Im Berichtsjahr ist die Zahl der Pflichtversicherten auf rund<br />
161.000 gestiegen.<br />
Mittelfristig werden die Versichertenzahlen aufgrund von<br />
Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst jedoch eher<br />
stagnieren bzw. zurückgehen. In der Kalkulation des Umlagesatzes<br />
ist dieser Rückgang aber bereits berücksichtigt, sodass<br />
die Umlage in Zukunft gleichwohl stabil bleiben wird.<br />
Erfreulicherweise übersteigen die Einnahmen aus Umlagen<br />
und Sanierungsgeldern seit 2005 die Ausgaben <strong>für</strong> die<br />
Rentenleistungen. Das ist erforderlich, um auch längerfristig<br />
eine stabile Finanzierung zu erreichen.<br />
Jährlich aktueller Punktestand<br />
Die zusätzliche Altersversorgung wird immer wichtiger. Den<br />
Überblick über die eigene Zusatzversorgung erleichtert das<br />
klar strukturierte Punktemodell der <strong>kvw</strong>. Es informiert die Beschäftigten<br />
in verständlicher Form über ihre bislang erreichte<br />
Anwartschaft auf Betriebsrente. Die <strong>kvw</strong> erhöhen die Transparenz,<br />
indem sie allen Beschäftigten jährlich ihren Versicherungsnachweis<br />
senden. So können die Beschäftigten in jedem<br />
Jahr entscheiden, ob sie mit ihrem aktuellen „Punktestand“<br />
zufrieden sind oder ob eine zusätzliche Absicherung – z. B.<br />
als PlusPunktRente – sinnvoll oder notwendig wäre.<br />
900<br />
850<br />
800<br />
750<br />
700<br />
650<br />
600<br />
‘94<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04<br />
‘06 ‘<strong>08</strong><br />
Bestandsentwicklung der Mitglieder (AV I und AV II) seit 1993<br />
8 %<br />
8 %<br />
21 %<br />
8 %<br />
55 %<br />
173 Kommunen und Kommunalverbände<br />
65 Zweckverbände<br />
65 Sparkassen<br />
68 Sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts<br />
454 Sonstige Personen des privaten Rechts<br />
Rechtsformen der Mitglieder (AV I und AV II)<br />
37
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-Betriebsrenten<br />
170<br />
150<br />
130<br />
110<br />
90<br />
70<br />
50<br />
30<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
38<br />
‘94<br />
‘94<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04<br />
Entwicklung der Rentenlastquote (AV I)<br />
seit 1993 in Prozent<br />
Pflichtversicherte<br />
Rentenempfänger<br />
Zahl der Pflichtversicherten und Rentenempfänger<br />
(AV I und AV II) seit 1993 in Tausend<br />
‘06 ‘<strong>08</strong><br />
‘06 ‘<strong>08</strong><br />
Rentenleistungen<br />
Die <strong>kvw</strong> betreuten 20<strong>08</strong> 73.147 Rentnerinnen und Rentner.<br />
Das sind 2,0 % mehr als im Vorjahr. Davon waren 58.4<strong>09</strong><br />
selbst bei den <strong>kvw</strong> versichert, 13.816 Witwen oder Witwer<br />
und 922 Waisen. 344-mal wurde Sterbegeld gezahlt.<br />
20<strong>08</strong> zahlten wir:<br />
304,3 Mio. Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <strong>für</strong> Betriebsrenten<br />
(im Vorjahr: 299,0 Mio. Euro),<br />
0,1 Mio. Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<strong>für</strong> Sterbegelder<br />
(im Vorjahr: 0,6 Mio. Euro),<br />
0,4 Mio. Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<strong>für</strong> Abfindungen<br />
(im Vorjahr: 0,3 Mio. Euro).<br />
Die durchschnittliche monatliche Betriebsrente betrug im<br />
Berichtsjahr:<br />
<strong>für</strong> Rentnerinnen und Rentner . . . . . . . . . . . . . . . 382,58 Euro,<br />
<strong>für</strong> Witwen und Witwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233,24 Euro,<br />
<strong>für</strong> Waisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,06 Euro.<br />
bis 19 Jahre<br />
20 – 29 Jahre<br />
30 – 39 Jahre<br />
40 – 49 Jahre<br />
50 – 59 Jahre<br />
über 60 Jahre<br />
2.122 21.375 31.988 54.553<br />
Altersstruktur der Pflichtversicherten AV I<br />
43.728<br />
7.233
2.2.2 Abrechnungsverband II (AV II)<br />
Im Juli 2003 führte die <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung den vollständig<br />
kapitalgedeckten AV II ein. Im Unterschied zum<br />
AV I ist er nicht mit Ansprüchen aus dem alten Versorgungssystem<br />
belastet. Leistungsrecht und Rentenhöhen<br />
sind abhängig vom Tarifvertrag und daher in beiden<br />
Verbänden identisch.<br />
Vorteile <strong>für</strong> Arbeitgeber und Arbeitnehmer: Steuern<br />
und Sozialabgaben sparen!<br />
Interessant ist eine Mitgliedschaft im AV II <strong>für</strong> Arbeitgeber<br />
und Beschäftigte, weil die Beiträge steuerlich<br />
gefördert werden (§ 3 Nr. 63 EStG).<br />
Die Arbeitgeber sparen ihre Anteile zur Sozialversicherung<br />
und die pauschale Versteuerung eines Teils der<br />
Umlage, denn ihre Beiträge sind bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze<br />
der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
steuer- und sozialabgabenfrei. Die Arbeitnehmer sparen<br />
die individuelle Versteuerung der Umlagezahlungen und<br />
ihre Anteile zur Sozialversicherung.<br />
Als kommunaler Dienstleister stehen die <strong>kvw</strong> neuen<br />
Mitgliedern offen gegenüber. Die <strong>kvw</strong> sind gerne bereit,<br />
Unternehmen vor einem Beitritt individuell zu beraten.<br />
Versicherte und Rentenleistungen<br />
Im AV II hatten die <strong>kvw</strong> zum 31.12.20<strong>08</strong> 43 Mitglieder<br />
mit 3.490 Pflichtversicherten. Für den noch jungen AV II<br />
zahlten wir 27.300 Euro <strong>für</strong> 51 Betriebsrenten aus.<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
‘94<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04<br />
Durchschnittliche Rentenhöhe (AV I)<br />
<strong>für</strong> Betriebsrenten seit 1993 in EUR<br />
bis 19 Jahre<br />
20 – 29 Jahre<br />
30 – 39 Jahre<br />
40 – 49 Jahre<br />
50 – 59 Jahre<br />
über 60 Jahre<br />
27 403 798<br />
1.293<br />
Altersstruktur der Pflichtversicherten AV II<br />
ehemalig Versicherte<br />
840<br />
Witwen<br />
Waisen<br />
‘06 ‘<strong>08</strong><br />
129<br />
39
Daniel Uhlenbrock betreut Mitglieder in allen Fragen zur Zusatzversorgung<br />
und schult Personalsachbearbeiterinnen und Personalsachbearbeiter.<br />
40
Vermögens-, Finanz-<br />
und Ertragslage<br />
1. FINANZIERUNG<br />
1.1 AV I<br />
Zur Finanzierung der Pflichtversicherung zahlen alle Mitglieder<br />
im AV I eine Umlage an die <strong>kvw</strong>. Damit die Ausgaben zu jeder<br />
Zeit gedeckt sind, wird ihre erforderliche Höhe nach versicherungsmathematischen<br />
Grundsätzen alle drei Jahre ermittelt.<br />
Dabei wird ein unendlicher Deckungsabschnitt in den Blick<br />
genommen, der es ermöglicht, die Entwicklung der Auszahlungsverpflichtungen<br />
ganz langfristig abzuschätzen und die<br />
erforderlichen Umlage- und Sanierungsgeldeinnahmen hierauf<br />
abzustimmen.<br />
Auf Grundlage dieses Gutachtens hat der Kassenausschuss<br />
20<strong>08</strong> und 20<strong>09</strong> das Sanierungsgeld von 3,0 % in unveränderter<br />
Höhe festgesetzt. Der Umlagesatz blieb ebenfalls<br />
konstant bei 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte.<br />
Die Einnahmen aus Umlagen und Sanierungsgeld betrugen<br />
im Berichtsjahr 353 Mio. Euro (im Vorjahr: 335 Mio. Euro). Mit<br />
dem Sanierungsgeld können die Verpflichtungen aus dem bis<br />
2001 gültigen Gesamtversorgungssystem steuer- und sozialversicherungsfrei<br />
finanziert werden. Frühzeitig haben die <strong>kvw</strong><br />
Vermögenserträge angesammelt, die nun den Umlagesatz<br />
stützen. Um die Lasten gleichmäßiger und generationengerechter<br />
zu verteilen, führen wir im Interesse aller Mitglieder<br />
die Strategie fort, Vermögen aufzubauen: Vermögenserträge,<br />
die zur Finanzierung der satzungsmäßigen Leistungen nicht<br />
benötigt werden, fließen in die Rücklage. Die Zusatzversorgung<br />
ist insofern ein Umlagesystem mit teilweiser Kapitaldeckung.<br />
1.2 AV II<br />
Die Mitglieder im AV II zahlen zurzeit einen Beitrag von 4 %<br />
der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. Über die Höhe<br />
des Beitrags entscheidet der Kassenausschuss auf Vorschlag<br />
des verantwortlichen Aktuars jährlich neu. Maßgeblich ist im<br />
Wesentlichen die Entwicklung auf den allgemeinen Kapitalmärkten.<br />
In diesem im Wege der Kapitaldeckung finanzierten<br />
Abrechnungsverband ist jährlich darauf zu achten, dass keine<br />
Unterdeckung entsteht. Da die Entwicklung der Kapitalmärkte<br />
in der Vergangenheit nicht zu den vorgesehenen Renditen<br />
geführt hat, muss – entsprechend einem Beschluss des Kassenausschusses<br />
und auf Empfehlung des verantwortlichen<br />
Aktuars – der Beitrag ab Januar 2010 auf 4,8 % angehoben<br />
werden.<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
‘94<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />
Entwicklung der Umlageeinnahmen im AV I<br />
seit 1993 in Mio. EUR<br />
‘94<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04 ‘06 ‘<strong>08</strong><br />
Entwicklung der Aufwendungen <strong>für</strong> Betriebsrenten u. a.<br />
satzungsmäßige Leistungen (AV I) seit 1993 in Mio. EUR<br />
41
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-Betriebsrenten<br />
2. VERMöGEN<br />
2.1 AV I<br />
Die <strong>kvw</strong> verfügten zum 31.12.20<strong>08</strong> im umlagefinanzierten<br />
Abrechnungsverband I über ein Vermögen im Gesamtwert<br />
von 1,64 Mrd. Euro.<br />
Der Barwert aller bestehenden Verpflichtungen geht jedoch<br />
weit darüber hinaus, sodass nur eine teilweise Kapitaldeckung<br />
besteht. Die Vermögenserträge sollen jedoch weiterhin einen<br />
gleichmäßigen und finanzierbaren Hebesatz sichern. Würde<br />
das Vermögen nicht kontinuierlich aufgebaut, wären zukünftige<br />
Leistungen über stets höhere Zahlungen zu finanzieren.<br />
Das Vermögen der <strong>kvw</strong> ist vornehmlich in Wertpapieren,<br />
Wertpapierfonds, Schuldscheindarlehen und Termingeldern,<br />
zu einem geringeren Teil auch in Grundvermögen und Hypothekendarlehen<br />
angelegt.<br />
Es erwirtschaftete 20<strong>08</strong> Erträge in Höhe von 65,60 Mio.<br />
Euro. Das entspricht einer durchschnittlichen Verzinsung von<br />
4,<strong>08</strong> % des im Jahr 20<strong>08</strong> vorhandenen Vermögens.<br />
Durch ihre sehr konservative Ausrichtung der Kapitalanlagepolitik<br />
waren die <strong>kvw</strong> von den heftigen Turbulenzen an den<br />
Kapitalmärkten nur relativ geringfügig betroffen. Einerseits<br />
war der Anteil des Risikokapitals im Verhältnis zum gesamten<br />
Vermögensbestand recht gering; andererseits ist es<br />
gelungen, über rechtzeitige Sicherungsstrategien Verluste in<br />
großem Umfang zu vermeiden.<br />
1700<br />
1600<br />
1500<br />
1400<br />
1300<br />
1200<br />
1100<br />
1000<br />
42<br />
900<br />
800<br />
700<br />
‘94<br />
‘96 ‘98 ‘00 ‘02 ‘04<br />
Entwicklung des Vermögens (AV I) im Zeitablauf<br />
seit 1993 in Mio EUR<br />
‘06 ‘<strong>08</strong><br />
2.2 AV II<br />
Das System des AV II ist ein reines Kapitaldeckungssystem.<br />
Es verfügte zum 31.12.20<strong>08</strong> über einen Vermögensbestand<br />
im Gesamtwert von 13,5 Mio. Euro.<br />
Das Vermögen wird vornehmlich in dem eigens auf die<br />
Erfordernisse des AV II und der freiwilligen Versicherung<br />
ausgerichteten Spezialfonds (PPR-Fonds) angelegt, jedoch als<br />
separate Anteile ausgewiesen.<br />
Es erzielte im Jahr 20<strong>08</strong> Erträge in Höhe von rund 439.000<br />
Euro bei einer laufzeitgewichteten Verzinsung von 4,11 %.<br />
298,5<br />
11,9<br />
19,8<br />
106,9<br />
731,3<br />
319,9<br />
Gesamtvermögen 2006 (AV I)<br />
in Mio EUR: 1.488,4<br />
Sonstiges inkl.<br />
Termingelder<br />
Grundvermögen<br />
Hypothekendarlehen<br />
Schuldscheindarlehen<br />
Fonds<br />
Wertpapiere
Ausblick<br />
November 2007<br />
Bundesgerichtshof-Entscheidung über Startgutschriften<br />
<strong>für</strong> rentenferne Jahrgänge<br />
Im November 2007 hat der Bundesgerichtshof die mit<br />
Spannung erwartete Entscheidung zur Rechtmäßigkeit der<br />
Startgutschriften <strong>für</strong> rentenferne Jahrgänge verkündet. Damit<br />
steht nun fest, dass der Systemwechsel in der Zusatzversorgung<br />
von 2001 Bestand hat. Lediglich in einem Punkt hielt die<br />
Übergangsregelung <strong>für</strong> die Berechnung der Startgutschriften<br />
rentenferner Jahrgänge der Überprüfung wegen eines Verstoßes<br />
gegen Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz nicht stand. Der Verstoß<br />
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz führt, so der Bundesgerichtshof,<br />
zur Unwirksamkeit dieser Übergangsregelung und<br />
Sonstiges inkl.<br />
Termingelder<br />
Grundvermögen<br />
Hypothekendarlehen<br />
Schuldscheindarlehen<br />
Fonds<br />
376,0<br />
11,1<br />
15,4<br />
82,1<br />
7<strong>09</strong>,2<br />
Wertpapiere 447,9<br />
Gesamtvermögen 20<strong>08</strong> (AV I)<br />
in Mio EUR: 1.641,9<br />
zur Unverbindlichkeit der Startgutschriften. Mit Rücksicht auf<br />
die Tarifautonomie bleibt es den Tarifvertragsparteien vorbehalten,<br />
eine verfassungskonforme Neuregelung zu treffen. Es<br />
bleibt nun abzuwarten, welche Änderungen die Tarifvertragsparteien<br />
hinsichtlich der Berechnungsparameter der Übergangsregelung<br />
<strong>für</strong> rentenferne Versicherte vornehmen werden.<br />
Informationsveranstaltungen<br />
Die <strong>kvw</strong> haben das Ziel, den Kontakt zu ihren Mitgliedern<br />
und Versicherten weiter zu intensivieren. Hierzu bieten wir<br />
vielfältige Veranstaltungen an. Neben den Tagesseminaren<br />
<strong>für</strong> Personalsachbearbeiterinnen und Personalsachbearbeiter<br />
an unserem Standort in Münster sind hier vor allem die<br />
Informations- und Beratungstage bei unseren Mitgliedern zu<br />
nennen. Im Frühjahr 2010 wird es zudem wieder spezielle<br />
Veranstaltungen <strong>für</strong> Betriebs- und Personalräte geben. Alle<br />
Veranstaltungen sind kostenlos. Des Weiteren führen wir<br />
noch in diesem Jahr einen Online-Newsletter ein, der unseren<br />
Mitgliedern und interessierten Personen aktuelle Informationen<br />
noch schneller zur Verfügung stellt.<br />
Im Jahr 20<strong>08</strong><br />
Papierloses Büro<br />
Auch das papierlose Büro wird bei uns weiter Einzug halten.<br />
Nachdem bereits 20<strong>08</strong> die technischen Voraussetzungen mit<br />
der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems geschaffen<br />
wurden, werden nach und nach die Papierakten auf<br />
elektronische Akten umgestellt. Dies ermöglicht uns, unsere<br />
Ablauforganisation effizienter zu gestalten, Auskünfte auch<br />
telefonisch direkt zu geben und kostengünstiger zu arbeiten.<br />
Wir hoffen, unsere Kundenzufriedenheit wird hierdurch weiter<br />
steigen (vgl. Interview in diesem <strong>Jahresbericht</strong>).<br />
Personalgestellung<br />
Immer mehr unserer Mitglieder machen von der Möglichkeit<br />
der Personalgestellung (z. B. § 4 Abs. 3 TVöD) Gebrauch. Bislang<br />
hat die <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung da<strong>für</strong> auf der Grundlage einer<br />
BGH-Entscheidung von 1997 Abgeltungsbeträge verlangt,<br />
um nachteilige Effekte <strong>für</strong> die Umlagegemeinschaft auszugleichen.<br />
In Abstimmung mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband<br />
NW und der Rheinischen Zusatzversorgungskasse hat<br />
der Kassenausschuss der <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung im Juni 20<strong>09</strong><br />
eine klarstellende Regelung in die Satzung aufgenommen.<br />
Nach § 12a Satzung der <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung können<br />
die Mitglieder nun in zwei Betrachtungszeiträumen von jeweils<br />
5 Jahren eine Personalgestellung im Umfang von maximal 10 %<br />
vornehmen, ohne dass hier<strong>für</strong> Zahlungen an die Zusatzversorgung<br />
zu leisten sind. Einzelheiten zur Anwendung dieser Vorschrift<br />
werden voraussichtlich Ende des Jahres 20<strong>09</strong> feststehen.<br />
43
Das Jahr 20<strong>08</strong>:<br />
<strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-PlusPunktRenten<br />
Überblick<br />
<strong>für</strong> mehr als 14.700 freiwillig Versicherte<br />
• optimale Ausnutzung der staatlichen Förderung<br />
• telefonische und persönliche Fachberatung rund um die betriebliche Altersversorgung<br />
• flexible Anpassung des Versicherungsschutzes<br />
• jährliche Mitteilung über die erworbenen Anwartschaften<br />
• hohe Rendite durch niedrige Kosten<br />
Barbara Waldeck berät Beschäftigte<br />
unserer Mitglieder, die zusätzlich zur<br />
Pflichtversicherung eine freiwillige<br />
Altersversorgung aufbauen möchten.<br />
44
Aktuelles<br />
Januar 20<strong>08</strong><br />
Berufseinsteigerbonus bei Riester-Förderung<br />
Einen einmaligen Berufseinsteigerbonus und eine erhöhte<br />
Kinderzulage gewährt der Staat <strong>für</strong> Riester-Sparer ab 20<strong>08</strong>.<br />
Wer zum 01.01.20<strong>08</strong> das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet<br />
hat, erhält zu seinem Riester-Vertrag vom Staat einmalig 200<br />
Euro dazu. Dieser sogenannte Berufseinsteigerbonus kommt<br />
sowohl bereits bestehenden als auch neu abgeschlossenen<br />
Riester-Sparverträgen zugute. Ab 20<strong>08</strong> erhöht sich darüber<br />
hinaus die Kinderzulage <strong>für</strong> Riester-Verträge von 184 Euro<br />
auf insgesamt 300 Euro je Kind. Diese erhöhte Kinderzulage<br />
wird jährlich <strong>für</strong> alle Kinder ausgezahlt, die ab dem Jahr 20<strong>08</strong><br />
geboren sind.<br />
Juli 20<strong>08</strong><br />
Entgeltumwandlung nun auch mit Arbeitgeberförderung<br />
Viele unserer Mitglieder haben erkannt, dass eine Entgeltumwandlung<br />
auch ihnen finanzielle Vorteile verschafft, da sie<br />
die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sparen können.<br />
Daher fördern einige unserer Mitglieder den Abschluss einer<br />
Entgeltumwandlung mit einem zusätzlichen Arbeitgeberzuschuss<br />
zur umgewandelten Entgeltsumme. Hier<strong>für</strong> steht<br />
unser neuer Tarif „arbeitgeberfinanzierte Entgeltumwandlung“<br />
zur Wahl. In diesem Tarif werden die vom Arbeitgeber<br />
zusätzlich eingezahlten Beiträge separat verwaltet.<br />
bis 19 Jahre<br />
20 – 29 Jahre<br />
30 – 39 Jahre<br />
40 – 49 Jahre<br />
50 – 59 Jahre<br />
über 60 Jahre<br />
21 395 1.747 5.544 4.025 378<br />
Altersstruktur der freiwillig Versicherten<br />
Geschäftsverlauf<br />
Mit der PlusPunktRente bieten die <strong>kvw</strong> den Angestellten<br />
ihrer Mitglieder eine exklusive Altersvorsorge. Sie bietet alle<br />
Vorteile einer betrieblichen Altersversorgung, die zusätzlich<br />
vom Staat gefördert wird.<br />
20<strong>08</strong> sind ca. 600 neue Verträge hinzugekommen, sodass<br />
bislang fast 14.800 gültige Verträge im Bestand sind.<br />
Bei der PlusPunktRente wählen die Versicherten zwischen<br />
drei Möglichkeiten der staatlichen Förderung: Entgeltumwandlung,<br />
Riester-Rente oder Steuervorteile in der Rentenphase.<br />
Sie können mehrere Förderwege parallel nutzen und jederzeit<br />
kostenlos zwischen ihnen wechseln, z. B. wenn sich die persönliche<br />
Situation oder die staatliche Förderung ändern.<br />
1. PlUSPUNKtRENtE MIt ENtGEltUMWANDlUNG<br />
Klarer Vorteil <strong>für</strong> die Arbeitgeber:<br />
Personalnebenkosten sparen!<br />
Bei jedem Euro Entgeltumwandlung spart der Arbeitgeber<br />
rund 0,21 Euro Personalnebenkosten; wandelt ein Beschäftigter<br />
im Monat 200 Euro Entgelt um, so spart der Arbeitgeber<br />
monatlich etwa 42 Euro. Bei 200 Beschäftigten, die monatlich<br />
50 Euro umwandeln, spart der Arbeitgeber jährlich über<br />
25.000 Euro Personalnebenkosten.<br />
Die Beschäftigten vereinbaren mit dem Arbeitgeber, einen<br />
Teil des Bruttoentgelts in einen Beitrag zur PlusPunktRente<br />
umzuwandeln; maximal geht dies mit 4 % der Beitragsbemessungsgrundlage<br />
der gesetzlichen Rentenversicherung.<br />
20<strong>08</strong> sind das höchstens 2.544 Euro. Der Beitrag ist weder<br />
steuer- noch sozialversicherungspflichtig.<br />
2. PlUSPUNKtRENtE MIt RIEStERFöRDERUNG<br />
Hier werden die Beiträge vom Arbeitgeber aus dem Nettogehalt<br />
überwiesen. Der Beschäftigte erhält vom Staat Zulagen<br />
und gegebenenfalls zusätzlich einen Steuervorteil.<br />
Die volle staatliche Förderung erhält, wer ab 20<strong>08</strong> einen Beitrag<br />
von 4 % seines sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens<br />
des Vorjahres zahlt. Sie setzt sich zusammen aus<br />
der Grundzulage <strong>für</strong> den Versicherten von 154 Euro und einer<br />
Kinderzulage <strong>für</strong> jedes kindergeldberechtigte Kind von 185<br />
Euro. Für jedes ab 20<strong>08</strong> geborene Kind erhöht sich die Kinderzulage<br />
auf 300 Euro. Bei der Steuererklärung können Beiträge<br />
und Zulagen als Sonderausgaben geltend gemacht werden.<br />
Ist die Steuererstattung höher als die Zulagen, erstattet das<br />
Finanzamt die Differenz.<br />
45
Das Jahr 20<strong>08</strong>: <strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – <strong>kvw</strong>-PlusPunktRenten<br />
Hierzu zwei Beispiele:<br />
Die Riester-Förderung ist interessant<br />
• <strong>für</strong> Beschäftigte mit Kindern: wegen der hohen Zulagen,<br />
• <strong>für</strong> Beschäftigte mit höherem Einkommen ohne Kinder:<br />
wegen des Steuervorteils.<br />
mit Kindern ...<br />
Ein 30-jähriger Arbeitnehmer, verheiratet, Sozialversicherungsbrutto<br />
im Vorjahr: 33.000 Euro, 2 Kinder<br />
Jährlicher Beitrag 4 % von 33.000 € = 1.320 € im Jahr 20<strong>08</strong><br />
Abzüglich Grundzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 €<br />
Abzüglich Kinderzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 €<br />
Bleibt ein Eigenbeitrag von . . . . . . . . . . . 796 € im Jahr 20<strong>08</strong>.<br />
Das sind monatlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,34 €<br />
Staatliche Förderung durch Zulagen . . . . . . . . . . . . . 524 €,<br />
also ca. 65 % des Eigenbeitrags.<br />
ohne Kinder ...<br />
Eine 35-jährige Arbeitnehmerin, ledig, Sozialversicherungsbrutto<br />
im Vorjahr: 40.000 Euro, keine Kinder<br />
Jährlicher Beitrag 4 % von 40.000 € = 1.600 € im Jahr 20<strong>08</strong><br />
Abzüglich Grundzulage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 €<br />
Bleibt ein Eigenbeitrag von . . . . . . . . . . 1.446 € im Jahr 20<strong>08</strong>.<br />
Das sind monatlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,50 €<br />
Als Sonderausgaben abzugsfähig sind . . . . . . . . . . . . .1.600 €<br />
Staatliche Förderung durch Zulage<br />
und ergänzenden Steuervorteil . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 €,<br />
also ca. 40 % des Eigenbeitrags.<br />
46<br />
Das Serviceteam PlusPunktRente berät in<br />
Fragen zur freiwilligen Altersversorgung.<br />
53 %<br />
1 %<br />
7.834 Riesterverträge<br />
6.792 Entgeltumwandlung<br />
160 Ohne Förderung<br />
Vertragsabschlüsse zur PlusPunktRente<br />
46 %<br />
3. PlUSPUNKtRENtE OHNE StAAtlIcHE FöRDERUNG<br />
MIt StEUERVORtEIlEN BEI RENtENBEZUG<br />
Künftig werden gesetzliche Renten stetig höher besteuert<br />
werden, da schrittweise ihre nachgelagerte Besteuerung<br />
eingeführt wird. Auch die kapitalgedeckte Altersvorsorge mit<br />
staatlicher Förderung wird nachgelagert besteuert. Sie ist also<br />
bei der Auszahlung voll steuerpflichtig. Da der Steuersatz mit<br />
dem Einkommen steigt, kann eine Mischung aus vor- und<br />
nachgelagert zu versteuernden Renten sinnvoll sein. Die<br />
PlusPunktRente ohne staatliche Förderung bietet daher eine<br />
wichtige Ergänzung der Altersvorsorge. Hier ist später nur<br />
der Ertragsanteil der Rente zu versteuern; bei Rentenbeginn<br />
z. B. mit 65 Jahren beträgt dieser 18 %, d. h., nur 18 % der<br />
späteren Rentenzahlungen werden besteuert. Auch die hohe<br />
Ablaufleistung spricht <strong>für</strong> den Tarif. Möglich wird dies durch<br />
eine geringe Kostenquote, da wir weder Außendienstprovisionen<br />
noch Gewinnaufschläge <strong>für</strong> Anteilseigner einkalkulieren<br />
müssen.
Vermögens-, Finanz-<br />
und Ertragslage<br />
Die freiwillige Versicherung der <strong>kvw</strong> ist ein reines Kapitaldeckungssystem.<br />
Sie verfügte zum 31.12.20<strong>08</strong> über einen<br />
Vermögensbestand im Gesamtwert von 65,8 Mio. Euro.<br />
Das Vermögen wird vornehmlich in dem eigens auf die<br />
Erfordernisse der freiwilligen Versicherung ausgerichteten<br />
Spezialfonds (PPR-Fonds) sowie zu einem geringeren Teil<br />
auch in Termingeldern angelegt.<br />
Es erzielte im Jahr 20<strong>08</strong> Erträge in Höhe von rund<br />
2,2 Mio. Euro.<br />
Das Anlagevermögen erwirtschaftete eine laufzeit-<br />
gewichtete Verzinsung von 3,85 %.<br />
Die Vorteile der PlusPunktRente<br />
bei den <strong>kvw</strong> auf einen Blick:<br />
• niedrige Verwaltungskosten,<br />
da kein aufwendiger Außendienst besteht<br />
• eine hohe garantierte Rente<br />
• Leistungen aus einer Hand,<br />
im Rentenfall genügt ein Antrag bei den <strong>kvw</strong><br />
• Sicherheit, da die <strong>kvw</strong> nicht insolvenzfähig sind<br />
• freundliche und umfassende Betreuung<br />
durch das Serviceteam PlusPunktRente<br />
Michael Wallbaum<br />
stellt sicher, dass<br />
staatliche Zulagen<br />
zu Riester-Verträgen<br />
gewährt werden<br />
können, und berät<br />
Versicherte rund<br />
um die freiwillige<br />
Altersversorgung.<br />
Weitere Informationen zur PlusPunktRente erhalten Sie<br />
bei unserem Serviceteam unter 0251 591-5566 oder<br />
unter www.<strong>kvw</strong>-muenster.de.<br />
47
<strong>kvw</strong> – Spezial<br />
Rückblick auf die <strong>kvw</strong>-Fachtagung 20<strong>08</strong><br />
Der Blick in die Zukunft der kommunalen<br />
Altersversorgung im lWl-Industriemuseum<br />
Henrichshütte in Hattingen am 23.10.20<strong>08</strong><br />
123 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte sowie Vertreterinnen und Vertreter<br />
kommunaler Einrichtungen aus Westfalen-Lippe waren zur 4. <strong>kvw</strong>-Fachtagung am 23.10.20<strong>08</strong> in das LWL-<br />
Industriemuseum Henrichshütte nach Hattingen gekommen. Sie diskutierten mit dem Wiener Zukunftsforscher<br />
Matthias Horx und den <strong>kvw</strong>-Experten die Zukunft der kommunalen Altersversorgung.<br />
Wie in den Vorjahren eröffnete der <strong>kvw</strong>-Kassenleiter und<br />
LWL-Direktor, Dr. Wolfgang Kirsch, die Veranstaltung, dieses<br />
Mal mit einem Blick auf die aktuellen Auswirkungen der<br />
Finanzmarktkrise auf die <strong>kvw</strong>. Er betonte, dass sich der<br />
Einbruch an den Aktienmärkten zu Beginn des Jahres 20<strong>08</strong><br />
kaum auf den <strong>kvw</strong>-Kapitalbestand ausgewirkt habe. Denn<br />
insgesamt 1,7 Mrd. Euro seien konservativ angelegt, gegenwärtig<br />
seien 2 % des <strong>kvw</strong>-Vermögens den schwankenden<br />
Kursbewegungen an den Aktienmärkten ausgesetzt. Der<br />
Grundsatz der Finanzanlagestrategie „Sicherheit geht vor<br />
Rendite“ habe sich so wieder mal als richtig erwiesen.<br />
48<br />
Weitere zentrale Themen des Vortrags von<br />
Herrn Dr. Kirsch waren:<br />
• der umlagefinanzierte Abrechungsverband I und der<br />
kapitalgedeckte Abrechnungsverband II in der<br />
<strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung,<br />
• die neue Tarifvariante in der PlusPunktRente, die<br />
erstmals auch eine Beteiligung der Arbeitgeber an<br />
der freiwilligen Altersvorsorge möglich macht,<br />
• das große Interesse an dem Dienstleistungsangebot<br />
der Beihilfekasse,<br />
• das jüngste Angebot der <strong>kvw</strong>, die Familienkasse.
Anschließend beleuchtete Herr Landesrat Matthias Löb,<br />
Geschäftsführer der <strong>kvw</strong>, in seinem Vortrag die Folgen des<br />
Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) <strong>für</strong> die kommunale<br />
Altersversorgung. Dabei wies er auch auf die Unterstützungsangebote<br />
der <strong>kvw</strong> <strong>für</strong> die Mitglieder hin, mit denen<br />
eine reibungslose Einführung des NKF vereinfacht wird. Dazu<br />
gehören die Berechnung von NKF-konformen Pensionsrückstellungen,<br />
die Mitgliedschaft in der Umlagegemeinschaft<br />
Beamtenversorgung <strong>für</strong> die Absicherung von Dienstunfällen<br />
und der Versorgungsfonds zur Ansparung von zukünftigen<br />
Pensionsverpflichtungen.<br />
Herr Kurt Pölling, Referatsleiter Beamtenversorgung,<br />
Beihilfe und Familienkasse, befasste sich mit den neuen Regelungen<br />
zur Versorgung von Wahlbeamtinnen und -beamten.<br />
Exemplarisch legte er anhand von vier ausgewählten Fallbeispielen<br />
auch die Berechnung von Pensionsansprüchen dar. Eine<br />
individuelle Beratung und Berechnung von Pensionsansprüchen<br />
bieten die <strong>kvw</strong>-Beschäftigten in der Beamtenversorgung.<br />
Die Trends in der Zukunftsgesellschaft skizzierte Herr<br />
Matthias Horx, Wiener Zukunftsforscher, in seinem fast<br />
einstündigen Vortrag. Darin stellt er die These auf, dass „Altersversorgung“<br />
in Zukunft ganz konsequent dem sogenannten<br />
„Cappuccino-Prinzip“ (bestehend aus staatlicher Rente,<br />
obligatorischer Zusatzversorgung und privater Versorgung)<br />
folgen muss, wollen die „jungen“ Alten über ein auskömmliches<br />
Einkommen im Ruhestand verfügen.<br />
Infokasten: Die vier Vorträge der 4. <strong>kvw</strong>-Fachtagung 20<strong>08</strong><br />
können Sie einzeln oder alle als zip-Datei von unserer <strong>kvw</strong>-<br />
Internet-Seite herunterladen.<br />
Die 5. Fachtagung der <strong>kvw</strong><br />
Das Motto der Tagung am <strong>08</strong>.12.20<strong>09</strong> lautet „Alles<br />
bleibt anders“. Die Auswirkung der Finanzmarkt- und<br />
Wirtschaftskrise auf die kommunale Altersversorgung<br />
bildet in diesem Jahr das Schwerpunktthema. Die Gastredner<br />
auf der Veranstaltung in der Speicherstadt Münster<br />
sind Herr Prof. Dr. Dr. Radermacher und Herr Prof.<br />
Dr. Pfingsten.<br />
49
<strong>kvw</strong> – Spezial<br />
Altersversorgung in einer<br />
zunehmend globalisierten Gesellschaft<br />
Interview mit Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher<br />
zur 5. <strong>kvw</strong>-Fachtagung<br />
Herr Prof. Dr. Dr. Radermacher ist Wirtschaftswissenschafter und Mitglied im Club of Rome. Er ist mit seinem<br />
Global Marshall Plan <strong>für</strong> eine Ökosoziale Marktwirtschaft bekannt geworden. Was sich dahinter verbirgt und<br />
wie er die Zukunft der Altersvorsorge vor diesem Hintergrund sieht, beantwortet er im Folgenden.<br />
<strong>kvw</strong>: Ihre Mitstreiter und Sie haben mit einem Global Marshall Plan eine Ökosoziale<br />
Welt-Marktwirtschaft propagiert. Welche Kernaussagen hat dieser Plan?<br />
Prof. Dr. Dr. Radermacher: Wir argumentieren <strong>für</strong> die Durchsetzung der von 191 Staaten im Jahr 2000<br />
beschlossenen Millenniumentwicklungsziele der Vereinten Nationen. Wir argumentieren <strong>für</strong> die Ausweitung<br />
der Mittel <strong>für</strong> Entwicklungszusammenarbeit um etwa 100 Mrd. Dollar pro Jahr <strong>für</strong> den Zeitraum<br />
bis 2015, um die Millenniumentwicklungsziele noch erreichen zu können. Wir sehen <strong>für</strong> das Aufbringen<br />
der Mittel ein großes Spektrum von Möglichkeiten, das von der Steigerung der staatlichen Quoten <strong>für</strong><br />
Entwicklungs-zusammenarbeit in Richtung 0,7 % des eigenen Bruttoinlandsprodukts, gemäß langjährigen<br />
Versprechen der Industrieländer, bis zur Bepreisung der Nutzung von Weltgemeingütern und der<br />
Besteuerung von grenzüberschreitenden Transaktionen, z. B. im Finanz- und Handelssektor, reicht. Wir<br />
argumentieren weiterhin <strong>für</strong> Veränderungen im globalen institutionellen Design, insbesondere <strong>für</strong> einen<br />
stärkeren Abgleich zwischen den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) und des Weltfinanzsystems,<br />
den Regeln der International Labor Organisation (ILO) und den Umweltschutzprogrammen der<br />
Vereinten Nationen. Zu unseren Vorschlägen gehören eine Angleichung der Steuerniveaus, Maßnahmen<br />
gegen die Probleme, die aus grenzüberschreitender Steueroptimierung resultieren, und die dringende<br />
Notwendigkeit einer „Einhegung“ der Steuerparadiese. Schließlich argumentieren wir <strong>für</strong> wirkungsvolle<br />
Umsetzungsmechanismen vor Ort in Entwicklungsaktivitäten, z. B. in Form von Kleinkreditprogrammen,<br />
und die weitgehende Verhinderung von Korruption.<br />
Das ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus rechnete kürzlich vor, dass in zehn bis<br />
zwanzig Jahren 1/3 aller Neurenten nicht einmal das Niveau der Grundsicherung erreicht.<br />
Für Karl-Josef Laumann, Sozialminister in NRW, ist damit die Legitimation der gesetzlichen<br />
Rentenversicherung am Ende. Wie sehen Sie das?<br />
Prof. Dr. Dr. Radermacher: Ich kann nicht absehen, wie viele Neurenten in Zukunft das Niveau der<br />
Grundsicherung erreichen. Da aber nicht zuletzt infolge der politischen Reaktionen auf Globalisierungszwänge<br />
der Bereich der Geringverdiener, Teilzeitbeschäftigten und Selbstständigen ohne ausreichendes<br />
Einkommen deutlich ausgeweitet wurde, würden Renteniveaus unterhalb der Grundsicherung nur<br />
bedeuten, dass viele Beschäftigungen nicht das Wertschöpfungspotenzial haben, um daraus eine<br />
angemessene Alterversorgung der jeweiligen Beschäftigten zu finanzieren. Häufig ist das Einkommen<br />
auch nicht adäquat, um davon zu leben. Dann müssen andere Grundsicherungsmechanismen greifen.<br />
Daraus kann man nicht folgern, dass die Legitimation der gesetzlichen Rentenversicherung am Ende<br />
ist. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass die Finanzkrise deutlich zeigt, wie gefährlich es sein kann, wenn<br />
die Altersversorgung der gesamten Bevölkerung an einer bestimmten Performance der Kapitalmärkte<br />
hängt. Hier kann es durchaus vorkommen, dass in der Folge von Problemen auf den Weltfinanzmärkten<br />
irgendwann die Hälfte der Rente auf einen Schlag weg ist. Insofern argumentiere ich konsequent <strong>für</strong> die<br />
gesetzliche Rentenversicherung, halte es ansonsten <strong>für</strong> wichtig und sinnvoll, dass Menschen versuchen,<br />
sofern sie dazu leistungsfähig genügend sind, sich zusätzlich abzusichern.<br />
50
Wie kann Ihrer Meinung nach eine zukunftsweisende Altersversorgung<br />
aussehen?<br />
Prof. Dr. Dr. Radermacher: Eine zukunftsweisende Altersversorgung<br />
hängt zunächst einmal an vernünftigen Einkommen.<br />
Es ist die generelle Orientierungslinie einer Ökosozialen Marktwirtschaft,<br />
dass sie eine Balance anstrebt, dies bei durchaus<br />
akzeptierten, ja als erforderlich angesehenen Ungleichheiten<br />
und damit einhergehender Differenzierung bezüglich der<br />
Einkommen. Würden insbesondere über Veränderungen<br />
weltweiter Rahmenbedingungen höhere Besteuerung sehr<br />
hoher Einkommen, aber beispielsweise auch globaler Transaktionsprozesse<br />
stattfinden, wäre eine Entlastung des „Normalbürgers“<br />
auf der Einkommensteuerseite möglich. Das würde<br />
es wiederum erleichtern, eine ausreichend dotierte Altersversorgung<br />
aufzubauen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Vollund<br />
Teilzeitkräften. Es kann sein, dass der Wertschöpfungsumfang<br />
einer Teilzeitbeschäftigung generell nicht ausreicht, um<br />
eine Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus zu erreichen.<br />
Haben darin die kommunalen bzw. regionalen Altersversorgungssysteme aus Ihrer Sicht<br />
noch einen Platz?<br />
Prof. Dr. Dr. Radermacher: Natürlich haben kommunale bzw. regionale Altersversorgungssysteme auch<br />
in Zukunft ihren Platz. Im Einzelfall hängt dies insbesondere an den dort aufgebrachten Volumina. In vielen<br />
Fällen kann man aber auch bei kleineren Einheiten auf dem Weg der Kooperation viele der Potenziale<br />
erschließen, die anderenorts Argumentationsbasis <strong>für</strong> Fusionen sind.<br />
Was können Sie kommenden Generationen von Pensionären und Rentnern <strong>für</strong> ihre Altersversorgung<br />
auf den Weg geben?<br />
Prof. Dr. Dr. Radermacher: Besonders wichtig ist es, sich da<strong>für</strong> einzusetzen, eine vernünftige ökosoziale<br />
Ausrichtung von Gesellschaft und Wirtschaft zu erhalten bzw. zu realisieren. Auf diesem Wege sind<br />
langfristige Gesellschaftsverträge am besten zu verwirklichen, ferner werden so vielfältige Potenziale<br />
von Menschen und ein großes Wachstum über längere Zeit erschlossen. Dies auch bei insgesamt begrenzten<br />
Ressourcen und angesichts einer drohenden Klimakatastrophe. Anders ist die Situation, wenn<br />
es uns nicht gelingt, qualitative Wachstumsprozesse in Gang zu setzten. Hier sind wir dann unmittelbar<br />
mit den engen Begrenzungen konfrontiert, die im Moment schon absehbar sind. Das wird dann <strong>für</strong> fast<br />
alle eng werden. Zumindest besteht nach wie vor aber die Hoffnung, dass insgesamt noch ein balancierter<br />
Zustand und eine <strong>für</strong> die Menschen in Breite lebenswerte Zukunft erreicht werden können.<br />
Auf der 5. <strong>kvw</strong>-Fachtagung am <strong>08</strong>.12.20<strong>09</strong> führt Herr Prof. Radermacher seine Thesen<br />
in einem Gastvortrag weiter aus. Einen Nachbericht über die 5. Fachtagung lesen Sie im<br />
nächsten <strong>kvw</strong>-<strong>Jahresbericht</strong> 2010.<br />
Globalisierungsgestalter mit guten<br />
Vorschlägen <strong>für</strong> eine lebenswerte Zukunft<br />
51
Die <strong>kvw</strong> stellen sich vor<br />
„<strong>kvw</strong>“ steht <strong>für</strong> Kommunale Versorgungskassen <strong>für</strong> Westfalen-Lippe. Sie sind ein Zusammenschluss<br />
mehrerer Kassen, die Kommunen und kommunale Einrichtungen in Westfalen-Lippe in ihrem Personalgeschäft<br />
unterstützen. Als Dienstleister entlasten sie heute 900 kommunale Arbeitgeber in der Beamtenversorgung,<br />
betrieblichen Altersversorgung, Beihilfe- und Kindergeldbearbeitung – Spezialgebiete aus dem<br />
Personalgeschäft, die rechtlich komplex und wirtschaftlich bedeutsam sind.<br />
52
Kapitel<br />
Die Geschichte<br />
der <strong>kvw</strong><br />
Die <strong>kvw</strong> blicken auf eine gut 100-jährige Geschichte zurück.<br />
Alles begann mit der Gründung der Witwen- und Waisenversorgungsanstalt<br />
1885. 1937 erhielten die <strong>kvw</strong> ihren heutigen<br />
Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts und traten<br />
zunächst als Westfälisch-Lippische Versorgungskasse <strong>für</strong><br />
Gemeinden und Gemeindeverbände auf. Die Keimzelle der<br />
<strong>kvw</strong> liegt also im Bereich der Beamtenversorgung. Vor mehr<br />
als 50 Jahren kam mit der Kommunalen Zusatzversorgungskasse<br />
Westfalen-Lippe die Versorgung kommunaler Angestellter<br />
hinzu. Weitere Meilensteine gab es in jüngster Zeit:<br />
1997 entstand die Beihilfekasse, die mittlerweile im Jahr über<br />
130.000 Beihilfebescheide <strong>für</strong> Beamte und Beschäftigte erteilt.<br />
Seit 2007 rundet die Familienkasse mit der Berechnung<br />
und Auszahlung von Kindergeld das Angebot der <strong>kvw</strong> ab.<br />
Die <strong>kvw</strong> mit Geschichte<br />
1885 Gründung als Witwen- und<br />
Waisenversorgungsanstalt<br />
1937 Status Körperschaft des öffentlichen Rechts<br />
als „Westfälisch-Lippische Versorgungskasse<br />
<strong>für</strong> Gemeinden und Gemeindeverbände“<br />
1951 Gründung der Zusatzversorgungskasse<br />
Westfalen-Lippe<br />
1997 Gründung der Beihilfekasse<br />
2001 Unter dem Dach Kommunale Versorgungskassen<br />
<strong>für</strong> Westfalen-Lippe (kurz <strong>kvw</strong>)<br />
vereinen sich alle bestehenden und<br />
künftigen Angebote<br />
2007 Gründung der Familienkasse<br />
Rechtliche Grundlagen<br />
und leistungen der <strong>kvw</strong><br />
Grundlage <strong>für</strong> die Tätigkeit der <strong>kvw</strong> ist das Gesetz über die<br />
kommunalen Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen im<br />
Lande Nordrhein-Westfalen. Geschäftsgebiet der Kassen ist<br />
die Region Westfalen-Lippe, d. h., die Mitglieder haben ihren<br />
Sitz in dieser Region. Inhaltlich orientiert sich die Tätigkeit an<br />
den <strong>für</strong> den jeweiligen Fachbereich geltenden Vorschriften:<br />
In der Beamtenversorgung ist das im Wesentlichen das<br />
Beamtenversorgungsgesetz, in der Beihilfe die Beihilfeverordnung,<br />
in der Zusatzversorgung der Altersvorsorge-Tarifvertrag<br />
<strong>für</strong> die Kommunen und in der Familienkasse das Einkommensteuergesetz.<br />
Insgesamt betreuen die <strong>kvw</strong> über 360.000<br />
Beschäftigte ihrer 900 kommunalen Mitglieder und zahlen<br />
Leistungen von rund 1 Mrd. Euro pro Jahr aus.<br />
6 %<br />
25 %<br />
7 %<br />
18 %<br />
43 %<br />
282 Kommunen und Kommunalverbände<br />
68 Zweckverbände<br />
79 Sparkassen<br />
203 Sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts<br />
482 Juristische Personen des privaten Rechts<br />
Zusammensetzung der Mitglieder nach Rechtsform<br />
53
Die <strong>kvw</strong> stellen sich vor<br />
Der Aufbau der <strong>kvw</strong><br />
Die Geschäftsführung der <strong>kvw</strong> nimmt nach dem Landesrecht<br />
der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) wahr.<br />
Der Direktor des LWL ist zugleich der Leiter der Kassen.<br />
Er überträgt die Geschäftsführung an einen der Landesräte<br />
(Beigeordnete) des LWL. Die <strong>kvw</strong> haben kein eigenes Personal.<br />
Es ist vielmehr beim LWL beschäftigt und an die Kassen<br />
ausgeliehen. Von den insgesamt 13.000 LWL-Beschäftigten<br />
sind zurzeit etwa 210 Beschäftigte bei den <strong>kvw</strong> tätig (Grafik<br />
Mitarbeiterentwicklung). Die <strong>kvw</strong> gliedern sich organisatorisch<br />
in fünf Referate (Grafik: Organigramm).<br />
Netzwerk der <strong>kvw</strong><br />
Die <strong>kvw</strong> sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft kommunale<br />
und kirchliche Altersversorgung (AKA) e.V. in München. Die<br />
AKA bündelt die Interessen von allen 45 regional tätigen<br />
kommunalen und kirchlichen Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen.<br />
Sie engagiert sich <strong>für</strong> eine einheitliche Auslegung<br />
und Weiterentwicklung der Vorschriften in der Zusatz-<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
54<br />
0<br />
20<br />
13,5<br />
42<br />
36,5<br />
28<br />
‘06<br />
157,5 gesamt<br />
20<br />
14<br />
39,5<br />
38<br />
7,5<br />
31,5<br />
17,5 18<br />
18 22<br />
‘07<br />
168,5 gesamt<br />
Informationstechnologie<br />
Finanzen<br />
Zusatzversorgung<br />
Beihilfekasse<br />
Mitarbeiterentwicklung<br />
20<br />
14<br />
40,5<br />
49<br />
10<br />
33<br />
‘<strong>08</strong><br />
184,5 gesamt<br />
22<br />
16<br />
42<br />
68<br />
11<br />
37<br />
‘<strong>09</strong><br />
218 gesamt<br />
Familienkasse<br />
Beamtenversorgung<br />
Personal & Organisation<br />
und Beamtenversorgung, im Beihilfe- und Kindergeldbereich.<br />
www.aka.de<br />
Rechtsaufsicht und Aufsichtsgremien der <strong>kvw</strong><br />
Die Rechtsaufsicht über die Kassen übt das Innenministerium<br />
Nordrhein-Westfalen aus. Aufsichtsgremien der Kassen sind<br />
der Verwaltungsrat <strong>für</strong> die Angelegenheiten der Beamtenversorgung,<br />
der Beihilfe- und der Familienkasse und der Kassenausschuss<br />
<strong>für</strong> alle Angelegenheiten der Zusatzversorgung.<br />
Beide Gremien sind zuständig <strong>für</strong> Grundsatzbeschlüsse. Zugleich<br />
wachen sie über den zweckentsprechenden Einsatz der<br />
Finanzmittel. Verwaltungsrat und Kassenausschuss bestehen<br />
jeweils aus 11 Mitgliedern.<br />
Die Vorsitzenden des Verwaltungsrates und des Kassenausschusses<br />
werden in der jeweils nächsten Sitzung der Gremien<br />
neu gewählt. Denn die beiden Vorsitzenden sind mit dem Ende<br />
der Wahlperiode im Oktober 20<strong>09</strong> aus ihrem Amt als Hauptverwaltungsbeamte<br />
ausgeschieden. Wir danken Aloys Steppuhn,<br />
Landrat a. D. des Märkischen Kreises, und Jürgen Hoffstädt,<br />
Bürgermeister a. D. der Gemeinde Ostbevern, <strong>für</strong> ihre<br />
Vorsitzendentätigkeit.<br />
Kassenleitung<br />
LWL-Direktor Herr Dr. Kirsch<br />
Geschäftsführung<br />
Landesrat Herr Löb, Herr Dr. Bakenecker (stellv.)<br />
Beamtenversorgung, Beihilfe und Familienkasse<br />
Herr Pölling<br />
Zusatzversorgung: Betriebsrente, PlusPunktRente<br />
Herr Dr. Depner<br />
Organigramm <strong>kvw</strong><br />
controlling<br />
Herr Glusa<br />
Organisation und Personal<br />
Frau Raschdorf<br />
Finanzen<br />
Herr Möller<br />
Informationstechnologie<br />
Herr Skirde
Mitglieder im Verwaltungsrat der<br />
<strong>kvw</strong>-Beamtenversorgung – Amtszeit 2010-2015<br />
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund<br />
Mitglieder<br />
• Bernd Stute, Bürgermeister, Stadt Vlotho<br />
• Claus Jacobi, Bürgermeister, Stadt Gevelsberg<br />
• André Kuper, Bürgermeister, Stadt Rietberg<br />
• Heinz Hüppe, Bürgermeister, Stadt Hörstel<br />
Stellvertreter<br />
• Dr. Klaus Walterscheid, Bürgermeister, Stadt Sprockhövel<br />
• Christoph Ewers, Bürgermeister, Stadt Burbach<br />
• N.N.<br />
• Klaus-Viktor Kleerbaum, Fraktionsvorsitzender, Stadt Dülmen<br />
Städtetag Nordrhein-Westfalen<br />
Mitglieder<br />
• Harald Kaufung, Amtsleiter, Stadt Hamm<br />
• Dr. Peter Paul Ahrens, Bürgermeister, Stadt Iserlohn<br />
Stellvertreter<br />
• Gilbert Eßers, Fachbereichsleiter, Stadt Recklinghausen<br />
• Peter Nebelo, Bürgermeister, Stadt Bocholt<br />
Landkreistag Nordrhein-Westfalen<br />
Mitglieder<br />
• Thomas Gemke, Landrat, Märkischer Kreis<br />
• Dr. Ralf Niermann, Landrat, Kreis Minden-Lübbecke<br />
• Cay Süberkrüb, Landrat, Kreis Recklinghausen<br />
Stellvertreter<br />
• Eva Irrgang, Landrätin, Kreis Soest<br />
• Friedhelm Spieker, Landrat, Kreis Höxter<br />
• Dr. Kai Zwicker, Landrat, Kreis Borken<br />
Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband<br />
Mitglieder<br />
• Klaus R. Vorndamme,<br />
Vorstandsvorsitzender, Sparkasse Herford<br />
Stellvertreter<br />
• Armin Tilly, Vorstandsvorsitzender, Stadtsparkasse Rheine<br />
Sonstige Mitglieder<br />
Mitglieder<br />
• Horst Hogrebe, AOK Westfalen-Lippe Dortmund<br />
Stellvertreter<br />
• Dr. Petra Bles, Vereinigte IKK Münster<br />
Mitglieder im Kassenausschuss der<br />
<strong>kvw</strong>-Zusatzversorgung – Amtszeit 2010-2015<br />
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund<br />
Mitglieder<br />
• N.N.<br />
• Klaus Rieke, Bürgermeister, Stadt Enger<br />
Stellvertreter<br />
• Heinz Hüppe, Bürgermeister, Stadt Hörstel<br />
• Winfried Pohlmann, Bürgermeister, Gemeinde Hopsten<br />
Landkreistag Nordrhein-Westfalen<br />
Mitglieder<br />
• Sven-Georg Adenauer, Landrat, Kreis Gütersloh<br />
• Thomas Gemke, Landrat, Märkischer Kreis<br />
Stellvertreter<br />
• Friedhelm Spieker, Landrat, Kreis Höxter<br />
• Dr. Kai Zwicker, Landrat, Kreis Borken<br />
Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband<br />
Mitglieder<br />
• Hagen Reuning, Vorstandsmitglied, Sparkasse Bielefeld<br />
Stellvertreter<br />
• Thomas Biermann, Sparkassendirektor,<br />
Stadtsparkasse Gevelsberg<br />
KOMBA<br />
Mitglieder<br />
• Lisa Bethge, Landschaftsverband Westfalen-Lippe<br />
Stellvertreter<br />
• Michael Zarth, Stadtverwaltung Münster<br />
Ver.di<br />
Mitglieder<br />
• Annette Traud, Landschaftsverband Westfalen-Lippe,<br />
Stellv. Vorsitzende des Kassenausschusses<br />
• Udo Reinert, Landschaftsverband Westfalen-Lippe<br />
• Rita Kreuchauff, Stadtverwaltung Münster<br />
• Rolf Sicker, Landschaftsverband Westfalen-Lippe<br />
Stellvertreter<br />
• Thomas Rummler, Landschaftsverband Westfalen-Lippe<br />
• Christel Scholz, Stadtverwaltung Schwelm<br />
• Siegrid Heinzel, Sparkasse Münsterland-Ost<br />
• Wolfgang Dube, Landschaftsverband Westfalen-Lippe<br />
55
impressum<br />
Kommunale Versorgungskassen<br />
<strong>für</strong> Westfalen-Lippe<br />
Zumsandestraße 12<br />
48145 Münster<br />
Tel. 0251 591-6748<br />
Fax: 0251 591-5915<br />
<strong>kvw</strong>@<strong>kvw</strong>-muenster.de<br />
www.<strong>kvw</strong>-muenster.de<br />
Gestaltung<br />
Oktober Kommunikationsdesign, Bochum<br />
www.oktober.de<br />
Druck<br />
Lonnemann GmbH, Selm<br />
Fotografie<br />
Martin Steffen<br />
Martin Egbert (Fotostrecke Spezial <strong>kvw</strong>-Fachtagung)<br />
Herausgeber<br />
Kommunale Versorgungskassen <strong>für</strong> Westfalen-Lippe<br />
www.<strong>kvw</strong>-muenster.de<br />
(c) 20<strong>09</strong><br />
9