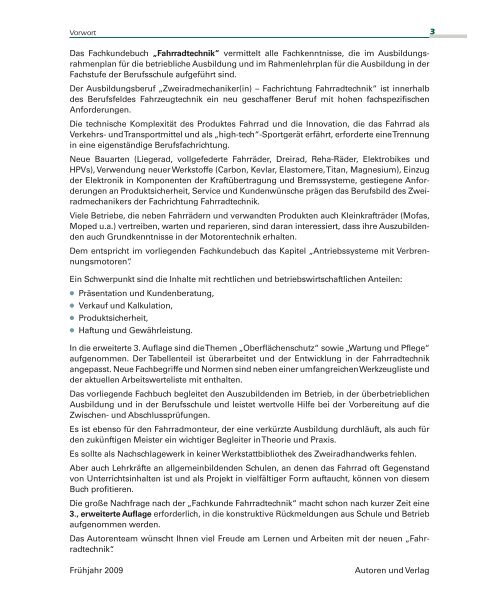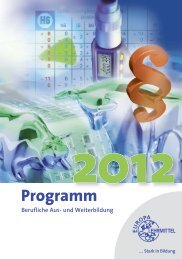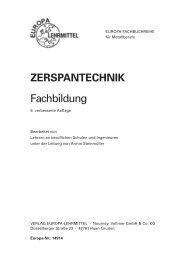Vorwort - Europa-Lehrmittel
Vorwort - Europa-Lehrmittel
Vorwort - Europa-Lehrmittel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Vorwort</strong><br />
Das Fachkundebuch „Fahrradtechnik“ vermittelt alle Fachkenntnisse, die im Ausbildungsrahmenplan<br />
für die betriebliche Ausbildung und im Rahmenlehrplan für die Ausbildung in der<br />
Fachstufe der Berufsschule aufgeführt sind.<br />
Der Ausbildungsberuf „Zweiradmechaniker(in) – Fachrichtung Fahrradtechnik“ ist innerhalb<br />
des Berufsfeldes Fahrzeugtechnik ein neu geschaffener Beruf mit hohen fachspezifischen<br />
Anforderungen.<br />
Die technische Komplexität des Produktes Fahrrad und die Innovation, die das Fahrrad als<br />
Verkehrs- und Transportmittel und als „high-tech“-Sportgerät erfährt, erforderte eine Trennung<br />
in eine eigenständige Berufsfachrichtung.<br />
Neue Bauarten (Liegerad, vollgefederte Fahrräder, Dreirad, Reha-Räder, Elektrobikes und<br />
HPVs), Verwendung neuer Werkstoffe (Carbon, Kevlar, Elastomere, Titan, Magnesium), Einzug<br />
der Elektronik in Komponenten der Kraftübertragung und Bremssysteme, gestiegene Anforderungen<br />
an Produktsicherheit, Service und Kundenwünsche prägen das Berufsbild des Zweiradmechanikers<br />
der Fachrichtung Fahrradtechnik.<br />
Viele Betriebe, die neben Fahrrädern und verwandten Produkten auch Kleinkrafträder (Mofas,<br />
Moped u.a.) vertreiben, warten und reparieren, sind daran interessiert, dass ihre Auszubildenden<br />
auch Grundkenntnisse in der Motorentechnik erhalten.<br />
Dem entspricht im vorliegenden Fachkundebuch das Kapitel „Antriebssysteme mit Verbrennungsmotoren“.<br />
Ein Schwerpunkt sind die Inhalte mit rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anteilen:<br />
● Präsentation und Kundenberatung,<br />
● Verkauf und Kalkulation,<br />
● Produktsicherheit,<br />
● Haftung und Gewährleistung.<br />
In die erweiterte 3. Auflage sind die Themen „Oberflächenschutz“ sowie „Wartung und Pflege“<br />
aufgenommen. Der Tabellenteil ist überarbeitet und der Entwicklung in der Fahrradtechnik<br />
angepasst. Neue Fachbegriffe und Normen sind neben einer umfangreichen Werkzeugliste und<br />
der aktuellen Arbeitswerteliste mit enthalten.<br />
Das vorliegende Fachbuch begleitet den Auszubildenden im Betrieb, in der überbetrieblichen<br />
Ausbildung und in der Berufsschule und leistet wertvolle Hilfe bei der Vorbereitung auf die<br />
Zwischen- und Abschlussprüfungen.<br />
Es ist ebenso für den Fahrradmonteur, der eine verkürzte Ausbildung durchläuft, als auch für<br />
den zukünftigen Meister ein wichtiger Begleiter in Theorie und Praxis.<br />
Es sollte als Nachschlagewerk in keiner Werkstattbibliothek des Zweiradhandwerks fehlen.<br />
Aber auch Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen, an denen das Fahrrad oft Gegenstand<br />
von Unterrichtsinhalten ist und als Projekt in vielfältiger Form auftaucht, können von diesem<br />
Buch profitieren.<br />
Die große Nachfrage nach der „Fachkunde Fahrradtechnik“ macht schon nach kurzer Zeit eine<br />
3., erweiterte Auflage erforderlich, in die konstruktive Rückmeldungen aus Schule und Betrieb<br />
aufgenommen werden.<br />
Das Autorenteam wünscht Ihnen viel Freude am Lernen und Arbeiten mit der neuen „Fahrradtechnik“.<br />
Frühjahr 2009 Autoren und Verlag<br />
3
Inhalt<br />
1 Geschichte des Fahrrades 9<br />
2 Fahrradtypen 12<br />
2.1 Standardtypen___________________________________ 12<br />
2.2 Sporträder ________________________________________ 15<br />
2.3 Kinderfahrräder _________________________________ 17<br />
2.4 Sonderkonstruktionen _________________________ 18<br />
2.5 Fahrräder mit Hilfsantrieb ____________________ 20<br />
3 Rahmen 21<br />
3.1 Rahmenbelastung ______________________________ 21<br />
3.1.1 Vertikalkräfte _____________________________________ 21<br />
3.1.2 Horizontalkräfte _________________________________ 21<br />
3.1.3 Seitenkräfte_______________________________________ 22<br />
3.1.4 Antriebskräfte____________________________________ 22<br />
3.1.5 Biegemomente __________________________________ 22<br />
3.2 Rahmentest ______________________________________ 23<br />
3.3 Rahmenbauarten _______________________________ 24<br />
3.4 Rahmenwerkstoffe _____________________________ 26<br />
3.4.1 Stahl________________________________________________ 26<br />
3.4.2 Aluminium________________________________________ 29<br />
3.4.3 Titan________________________________________________ 32<br />
3.4.4 Magnesium_______________________________________ 33<br />
3.4.5 Carbon_____________________________________________ 34<br />
3.5 Rohrherstellung _________________________________ 36<br />
3.5.1 Stahlrohre ________________________________________ 36<br />
3.5.2 Aluminiumrohre________________________________ 37<br />
3.5.3 Carbonrohre _____________________________________ 37<br />
3.5.4 Rohrverfeinerungen____________________________ 38<br />
3.6 Rahmenfügen____________________________________ 38<br />
3.6.1 Zuschneiden _____________________________________ 38<br />
3.6.2 Löten _______________________________________________ 39<br />
3.6.3 Schweißen________________________________________ 44<br />
3.6.4 Kleben _____________________________________________ 47<br />
3.6.5 Carbonrahmen __________________________________ 47<br />
3.7 Rahmen-Anbauteile ____________________________ 49<br />
3.8 Steuersystem ____________________________________ 52<br />
3.8.1 Gabel_______________________________________________ 52<br />
3.8.2 Steuersatz ________________________________________ 53<br />
3.8.3 Vorbau _____________________________________________ 57<br />
3.8.4 Lenker______________________________________________ 59<br />
3.9 Fahrverhalten und Rahmengeometrie ____ 63<br />
3.9.1 Kreiseleffekt ______________________________________ 63<br />
3.9.2 Nachlauf___________________________________________ 64<br />
3.9.3 Absenkung _______________________________________ 65<br />
3.9.4 Radstand __________________________________________ 65<br />
3.10 Sattel _______________________________________________ 66<br />
3.11 Sattelstütze _______________________________________ 68<br />
4 Antrieb 69<br />
4.1 Tretlagersatz _____________________________________ 69<br />
4.1.1 Verbindung Kurbelarm-Innenlager _________ 69<br />
4.1.2 Innenlager ________________________________________ 70<br />
4.1.3 Kurbelarme _______________________________________ 71<br />
4.2 Pedale______________________________________________ 72<br />
4.2.1 Pedalprüfung ____________________________________ 73<br />
4.2.2 Pedallagerung ___________________________________ 73<br />
4.2.3 Pedalausführungen ____________________________ 75<br />
4.3 Fahrradkette ______________________________________ 75<br />
4.3.1 Aufbau einer Fahrradkette____________________ 76<br />
4.3.2 Kettenlinie ________________________________________ 77<br />
4.3.3 Kettenreibung und Kettenverschleiß_______ 77<br />
4.3.4 Kettenfügen ______________________________________ 78<br />
4.3.5 Kettenlänge bei Kettenschaltungen ________ 79<br />
4.4 Fahrradschaltungen ____________________________ 80<br />
4.4.1 Nabenschaltungen _____________________________ 80<br />
4.4.2 Kettenschaltungen______________________________ 88<br />
4.4.3 Kombinierte Schaltsysteme __________________ 91<br />
4.4.4 Sonderschaltungen ____________________________ 92<br />
5 Bremsen 95<br />
5.1 Allgemeine Anforderungen an Bremsen _ 95<br />
5.2 Vorschriften, Gesetze und Prüfungen ______ 95<br />
5.2.1 Gesetzliche Vorschriften _______________________<br />
5.2.2 Sicherheitstechnische Anforderungen<br />
95<br />
und Prüfungen___________________________________ 95<br />
5.3 Bremssysteme___________________________________ 96<br />
5.3.1 Kraftübertragung und<br />
Übersetzungsverhältnis _______________________ 97<br />
5.3.2 Handbremsen____________________________________ 98<br />
5.3.3 Fußbremsen _____________________________________ 108<br />
6 Laufräder 110<br />
6.1 Speichenlaufräder ______________________________ 110<br />
6.1.1 Vertikale Belastung _____________________________ 110<br />
6.1.2 Antriebsbelastung ______________________________ 111<br />
6.1.3 Seitenbelastung _________________________________ 111<br />
6.2 Systemlaufräder ________________________________ 113<br />
6.2.1 Shamal-Prinzip __________________________________ 113<br />
6.2.2 Rolfs-Prinzip ______________________________________ 113<br />
6.2.3 Roval-Prinzip _____________________________________ 113<br />
6.2.4 Pulstar-Prinzip____________________________________ 113<br />
6.2.5 Citec-Prinzip ______________________________________ 114<br />
6.2.6 Shimano-Prinzip ________________________________ 114<br />
6.2.7 Scheibenräder ___________________________________ 114<br />
6.2.8 Composite Wheel _______________________________ 115<br />
6.3 Naben______________________________________________ 115<br />
6.3.1 Vorderradnaben _________________________________ 116<br />
6.3.2 Hinterradnaben__________________________________ 117<br />
6.3.3 Nabenklemmung _______________________________ 118<br />
6.3.4 Nabenlagerung__________________________________ 119<br />
6.3.5 Nabendichtungen_______________________________ 120<br />
6.4 Freilauf_____________________________________________ 121<br />
6.4.1 Klassischer Sperrklinkenfreilauf für<br />
Schraubnaben ___________________________________ 121<br />
6.4.2 Torpedo-Freilaufnabe __________________________ 122<br />
6.4.3 Freilauf-Kassettennabe ________________________ 122<br />
6.5 Felgen______________________________________________ 124<br />
6.5.1 Werkstoffe und Herstellung von Felgen___ 124<br />
6.5.2 Felgentypen ______________________________________ 125<br />
5
6<br />
6.5.3 Felgenprofile _____________________________________ 125<br />
6.5.4 Felgengeometrie ________________________________ 126<br />
6.5.5 Bremswirkung von Felgen ___________________ 127<br />
6.5.6 Felgenexplosion_________________________________ 128<br />
6.5.7 Speichenlöcher __________________________________ 129<br />
6.6 Speichen __________________________________________ 129<br />
6.6.1 Herstellung von Speichen ____________________ 129<br />
6.6.2 Speichenschwachpunkte______________________ 130<br />
6.6.3 Speichenausführungen _______________________ 131<br />
6.6.4 Speichenbruch___________________________________ 131<br />
6.6.5 Einspeichen ______________________________________ 132<br />
6.6.6 Ermittlung der Speichenlänge_______________ 133<br />
6.6.7 Standard-Einspeichanleitung ________________ 134<br />
6.7 Fahrradreifen_____________________________________ 136<br />
6.7.1 Reifenaufbau_____________________________________ 136<br />
6.7.2 Größenbezeichnungen von Reifen _________ 139<br />
6.7.3 Rolleigenschaften _______________________________ 139<br />
6.7.4 Reifenprofile _____________________________________ 140<br />
6.7.5 Ventile _____________________________________________ 142<br />
7 Federung und Dämpfung 144<br />
7.1 Grundlagen der Federung<br />
und Dämpfung __________________________________ 144<br />
7.2 Federkennlinie und Federrate _______________ 145<br />
7.3 Gefederte und ungefederte Masse _________ 147<br />
7.4 Dämpfung ________________________________________ 147<br />
7.5 Fachbegriffe der Federtechnologie _________ 149<br />
7.5.1 Negativ-Federweg ______________________________ 149<br />
7.5.2 Einfederungsweg _______________________________ 149<br />
7.5.3 Einfederungsrichtung__________________________ 150<br />
7.5.4 Bremsnicken _____________________________________ 150<br />
7.5.5 Einfedern im Wiegetritt ________________________ 150<br />
7.5.6 Kettenzug _________________________________________ 150<br />
7.5.7 Pedalschlag_______________________________________ 150<br />
7.6 Ausführungen von Federungssystemen__ 151<br />
7.6.1 Vorderradfederungen __________________________ 151<br />
7.6.2 Hinterradfederungen___________________________ 154<br />
7.6.3 Gefederte Sattelstützen________________________ 155<br />
8 Elektrische Ausrüstung 156<br />
8.1 Gesetzliche Grundlagen_______________________ 156<br />
8.2 Lichtmaschine ___________________________________ 157<br />
8.2.1 Spannungserzeugung durch Induktion ___ 157<br />
8.2.2 Dynamobauarten _______________________________ 158<br />
8.3 Lichtquellen ______________________________________ 160<br />
8.3.1 Temperaturstrahler _____________________________ 161<br />
8.3.2 Leuchtdiode ______________________________________ 161<br />
8.4 Scheinwerfer und Rücklicht __________________ 162<br />
8.5 Sicherheits- und Komforteinrichtungen___ 164<br />
8.6 Fehlersuche an der Beleuchtungsanlage _ 165<br />
8.7 Elektroantriebe __________________________________ 166<br />
8.7.1 Gleichstrommotor ______________________________ 166<br />
8.7.2 Elektrofahrräder _________________________________ 167<br />
8.7.3 Nachrüstung _____________________________________ 168<br />
8.8 Fahrradcomputer _______________________________ 169<br />
Inhalt<br />
9 Zubehör 171<br />
9.1 Schutzblech und Kettenschutz _______________ 171<br />
9.2 Gepäckträger_____________________________________ 171<br />
9.3 Schließ- und Sicherungstechnik_____________ 173<br />
9.4 Seitenstütze ______________________________________ 174<br />
9.5 Glocke _____________________________________________ 174<br />
9.6 Luftpumpe ________________________________________ 175<br />
9.7 Kindersitze________________________________________ 175<br />
9.8 Helm _______________________________________________ 176<br />
9.9 Anhänger _________________________________________ 178<br />
10 Anpassung Mensch – Maschine 179<br />
10.1 Körpermaße ____________________________________ 179<br />
10.1.1 Innenbeinlänge ________________________________ 179<br />
10.1.2 Armlänge________________________________________ 179<br />
10.1.3 Rumpflänge_____________________________________ 180<br />
10.2 Fahrradmaße ___________________________________ 180<br />
10.2.1 Rahmenhöhe ___________________________________ 180<br />
10.2.2 Rahmenlänge __________________________________ 181<br />
10.2.3 Tretkurbellänge ________________________________ 182<br />
10.2.4 Fußfreiheit ______________________________________ 182<br />
10.3 Positionsmaße _________________________________ 182<br />
10.3.1 Sattelhöhe (Sitzhöhe) ________________________ 182<br />
10.3.2 Sattelbreite, Sitzbreite________________________ 183<br />
10.3.3 Sitzlänge und Horizontalposition__________ 184<br />
10.3.4 Lenkerhöhe _____________________________________ 185<br />
10.3.5 Lenkerbreite ____________________________________ 185<br />
10.3.6 Fußstellung _____________________________________ 186<br />
10.3.7 Handhaltung____________________________________ 186<br />
10.3.8 Position Handbremshebel __________________ 187<br />
10.4 Ergonomie ______________________________________ 187<br />
10.4.1 Muskeln als Motor ____________________________ 187<br />
10.4.2 Sitzposition _____________________________________ 188<br />
11 Fachrechnen und physikalischtechnologische<br />
Grundlagen 191<br />
11.1 Längen ___________________________________________ 191<br />
11.2 Drehzahl _________________________________________ 191<br />
11.3 Geschwindigkeit _______________________________ 191<br />
11.4 Beschleunigung, Verzögerung _____________ 193<br />
11.5 Anhalteweg, Bremsweg _____________________ 193<br />
11.6 Masse und Dichte _____________________________ 193<br />
11.7 Trägheit und Trägheitsmoment ____________ 194<br />
11.8 Flächenmoment und<br />
Widerstandsmoment_________________________ 194<br />
11.9 Kraft_______________________________________________ 194<br />
11.10 Antriebsschlupf, Bremsschlupf ____________ 199<br />
11.11 Mechanische Arbeit ___________________________ 199<br />
11.12 Energie ___________________________________________ 200<br />
11.13 Leistung__________________________________________ 200<br />
11.14 Wirkungsgrad __________________________________ 202<br />
11.15 Drehmoment ___________________________________ 203<br />
11.16 Hebel _____________________________________________ 203
Inhalt<br />
11.17 Kreiselmoment und Kreiselkraft _________ 207<br />
11.18 Getriebe ________________________________________ 208<br />
11.19 Planetengetriebe _____________________________ 213<br />
11.20 Bremsen und Bremsarbeit ________________ 213<br />
11.21 Kurvenfahrt____________________________________ 217<br />
11.22 Federung _______________________________________ 217<br />
11.23 Festigkeit _______________________________________ 218<br />
11.24 Elektrotechnik _________________________________ 219<br />
12 Fahrmechanik 222<br />
12.1 Masse, Trägheit und Gewicht _____________ 222<br />
12.2 Kraft und Gegenkraft________________________ 224<br />
12.3 Reibungskräfte________________________________ 224<br />
12.3.1 Haftreibung____________________________________ 225<br />
12.3.2 Gleitreibung ___________________________________ 225<br />
12.3.3 Rollreibung ____________________________________ 226<br />
12.4 Schlupf _________________________________________ 226<br />
12.5 Kurvenfahrt____________________________________ 227<br />
12.6 Einleiten der Kurve __________________________ 228<br />
12.7 Stabilisierendes Lenksystem _____________ 230<br />
12.8 Stabilisierende Kreiselkräfte ______________ 231<br />
12.8.1 Handversuche zur Kreiselreaktion _______ 232<br />
12.8.2 Folgerungen für den Radfahrer __________ 233<br />
12.9 Bremsen _______________________________________ 233<br />
12.9.1 Grundlagen____________________________________ 234<br />
12.9.2 Bremsen in der Kurve ______________________ 235<br />
13 Oberflächenschutz 236<br />
13.1 Lacke ____________________________________________ 236<br />
13.2 Beschichtungsverfahren ___________________ 236<br />
13.2.1 Nasslackierung _______________________________ 236<br />
13.2.2 Pulverlackierung _____________________________ 237<br />
13.2.3 Kombinationen von Lackierungen_______ 238<br />
13.2.4 Elektrotauchlackierung _____________________ 238<br />
13.3 Eloxieren _______________________________________ 239<br />
14 Reinigung und Pflege 240<br />
14.1 Schmierstoffe _________________________________ 240<br />
14.1.1 Konsistenz von Ölen und Fetten _________ 241<br />
14.1.2 Schmierstoff-Verschleiß ____________________ 241<br />
14.2 Pflegehinweise _______________________________ 242<br />
14.2.1 Rahmen und Gabel__________________________ 242<br />
14.2.2 Federgabel, Dämpfer, Rahmenmechanik<br />
und Federsattelstütze _________ 243<br />
14.2.3 Vorbau und Lenker __________________________ 244<br />
14.2.4 Griffe ____________________________________________ 245<br />
14.2.5 Sattelstütze ____________________________________ 245<br />
14.2.6 Sattel ____________________________________________ 245<br />
14.2.7 Naben___________________________________________ 245<br />
14.2.8 Reifen ___________________________________________ 246<br />
14.2.9 Speichen _______________________________________ 246<br />
14.2.10 Felgen___________________________________________ 247<br />
14.2.11 Kette_____________________________________________ 247<br />
14.2.12 Zahnkranz und Kassette____________________ 248<br />
14.2.13 Pedale___________________________________________ 248<br />
14.2.14 Tretlager________________________________________ 248<br />
14.2.15 Kurbelgarnitur und Kettenblätte _________ 248<br />
14.2.16 Nabenschaltungen __________________________ 248<br />
14.2.17 Bremsen _______________________________________ 250<br />
14.2.18 Schrauben, Muttern und Zubehör _______ 250<br />
14.3 Radpflege-Ausstattung _____________________ 253<br />
15 Antriebssysteme mit<br />
Verbrennungsmotoren ____________________ 254<br />
15.1 Otto-Viertaktmotor___________________________ 254<br />
15.1.1 Arbeitsschritte des<br />
Otto-Viertaktmotors _________________________ 254<br />
15.1.2 Aufbau des Otto-Viertaktmotors _________ 255<br />
15.2 Otto-Zweitaktmotor _________________________ 257<br />
15.2.1 Aufbau des Otto-Zweitaktmotors________ 257<br />
15.2.2 Arbeitsschritte des<br />
Otto-Zweitaktmotors ________________________ 257<br />
15.3 Motorsteuerung______________________________ 258<br />
15.4 Motorschmierung ___________________________ 259<br />
15.4.1 Mischungsschmierung _____________________ 259<br />
15.4.2 Frischölschmierung _________________________ 259<br />
15.4.3 Druckumlaufschmierung___________________ 260<br />
15.4.4 Trockensumpfschmierung _________________ 260<br />
15.5 Motorkühlung ________________________________ 260<br />
15.5.1 Luftkühlung____________________________________ 260<br />
15.5.2 Flüssigkeitskühlung _________________________ 261<br />
15.6 Betriebsstoffe _________________________________ 261<br />
15.6.1 Kraftstoffe______________________________________ 261<br />
15.6.2 Schmierstoffe _________________________________ 262<br />
15.7 Zündung _______________________________________ 262<br />
15.7.1 Zündkerze______________________________________ 263<br />
15.7.2 Erzeugung des Zündfunkens _____________ 263<br />
15.8 Gemischaufbereitung_______________________ 264<br />
15.8.1 Vergaser ________________________________________ 264<br />
15.8.2 Einspritzanlage _______________________________ 266<br />
15.9 Abgasanlage __________________________________ 266<br />
15.10 Fahrräder mit Hilfsmotor __________________ 267<br />
16 Wirtschaftskunde 268<br />
16.1 Grundlagen der Wirtschaftskunde _______ 268<br />
16.1.1 Bedürfnisse____________________________________ 268<br />
16.1.2 Wirtschaften ___________________________________ 268<br />
16.2 Der Betrieb ____________________________________ 269<br />
16.2.1 Merkmale der Unternehmung____________ 269<br />
16.2.2 Rechtsformen _________________________________ 269<br />
16.2.3 Organisation eines Betriebes _____________ 270<br />
16.2.4 Lagerhaltung__________________________________ 270<br />
16.2.5 Kalkulation_____________________________________ 271<br />
16.3 Markt ____________________________________________ 272<br />
16.3.1 Markt und Wettbewerb _____________________ 272<br />
16.3.2 Marketinginstrumente______________________ 273<br />
16.4 Der Verkauf ____________________________________ 273<br />
164.1 Der Kunde _____________________________________ 273<br />
16.4.2 Verkaufsgespräche __________________________ 274<br />
16.4.3 Werkstattorganisation ______________________ 275<br />
7
8<br />
16.4.4 Die Ware _________________________________________ 276<br />
16.4.5 Kaufvertrag _____________________________________ 277<br />
16.4.6 Zahlungsverkehr ______________________________ 278<br />
16.4.7 Warenpräsentation ___________________________ 279<br />
17 Produktsicherheit 280<br />
17.1 Benutzerinformationen für<br />
Gebrauchgüter _________________________________ 280<br />
17.1.1 Informationspflicht____________________________ 280<br />
17.1.2 Informationsinhalte___________________________ 280<br />
17.1.3 Informationsfehler ____________________________ 280<br />
17.2 Gewährleistung________________________________ 281<br />
17.2.1 Sachmangel ____________________________________ 281<br />
17.2.2 Beweislastumkehr ____________________________ 281<br />
17.3 Haftung __________________________________________ 281<br />
17.3.1 Haftungsansprüche ___________________________ 281<br />
17.3.2 Zivilrechtliche Produzentenhaftung_______ 282<br />
17.4 Garantie und Kulanz __________________________ 282<br />
17.5 Normen __________________________________________ 283<br />
17.5.1 Das DIN __________________________________________ 283<br />
17.5.2 Normungsarbeit _______________________________ 283<br />
17.5.3 Sicherheitsnormen Fahrrad_________________ 283<br />
17.6 Gesetzliche Vorschriften Fahrrad __________ 284<br />
17.6.1 Die StVZO _______________________________________ 284<br />
17.6.2 Bauvorschriften Fahrrad _____________________ 285<br />
17.6.3 Typprüfung Fahrrad __________________________ 286<br />
17.7 Sicherheitstechnische Untersuchungen _ 286<br />
17.7.1 Betriebslasten __________________________________ 286<br />
17.7.2 Betriebslastenermittlungen_________________ 287<br />
17.7.3 Messfahrten und Labormessungen ______ 288<br />
17.7.4 Prüfgrundlagen ________________________________ 288<br />
177.5 Testverfahren, Testeinrichtungen __________ 288<br />
17.8 Schadensbegutachtung______________________ 292<br />
17.8.1 Sach- und Körperschaden___________________ 292<br />
17.8.2 Produkt- und Instruktionsfehler____________ 292<br />
17.8.3 Gerichts- und Privatgutachten _____________ 292<br />
17.9 Risiken ___________________________________________ 292<br />
18 Fachterminologie Englisch – Deutsch 294<br />
18.1 Englisch-Deutsch ______________________________ 294<br />
18.2 Deutsch-Englisch ______________________________ 299<br />
19 Formelsammlung Fahrradtechnik 305<br />
20 Anhang 318<br />
Fachbegriffe Fahrradtechnik__________________________ 318<br />
Übungsaufgabe Federung____________________________ 328<br />
Federweg Federsattelstütze __________________________ 336<br />
Fahrrad-Luftwiderstände______________________________ 336<br />
Magura-Federgabel ____________________________________ 337<br />
Rahmen und Rahmeneigenschaften _______________ 338<br />
Aufschlagprüfung einer Rahmen-Gabeleinheit _ 340<br />
NuVincy-Nabenschaltung_____________________________ 341<br />
Wartung 3-Gang SRAM _______________________________ 342<br />
Wartung 5-Gang SRAM _______________________________ 344<br />
Wartung 7-Gang SRAM _______________________________ 346<br />
Inhalt<br />
Wartung Shimano Inter 4 _____________________________ 348<br />
Wartung Shimano Inter 8 _____________________________ 350<br />
Wartung Sturmey Archer 8-Gang___________________ 352<br />
Wartung Rohloff Speedhub 500/14_________________ 354<br />
Übersetzungen von Kettenschaltungen ___________ 358<br />
Entfaltungen von Fahrrädern mit<br />
Kettenschaltung________________________________________ 359<br />
Übersetzungen von Fahrrädern mit<br />
Nabenschaltung _______________________________________ 360<br />
Entfaltungen von Nabenschaltungs-Fahrrädern 361<br />
Nabenschaltung-Einstellung _________________________ 362<br />
Zähnezahl und Teilkreisdurchmesser ______________ 363<br />
Kettenlinie ________________________________________________ 364<br />
Kettentypen ______________________________________________ 364<br />
Lochkreisdurchmesser und Lochmaße von<br />
Kettenblättern __________________________________________ 365<br />
Einbaumaße/Klemmbreite von Naben ____________ 365<br />
Lagerkugelgrößen ______________________________________ 365<br />
Anbaumaße von Scheibenbremsen _______________ 366<br />
Geschwindigkeiten bei Bremsprüfungen<br />
und Bremswegen _____________________________________ 367<br />
Mindest-Verzögerungswerte für die<br />
Brems-Prüfstandsmessung_________________________ 367<br />
Bremskraftmessung: Handbetätigte<br />
Bremse am Kinderfahrrad __________________________ 368<br />
Reibungskoeffizienten Fahrradbremsen __________ 368<br />
Reifengröße und Fahrradtyp_________________________ 369<br />
Welche Reifengrößen gibt es?_______________________ 370<br />
Zuordnung Reifenbreite-Felge_______________________ 372<br />
Haftreibungszahlen_____________________________________ 373<br />
Abrollwiderstandszahlen _____________________________ 373<br />
Reifendruck _______________________________________________ 373<br />
Einstellung Fahrradcomputer________________________ 374<br />
Gewinde im Fahrradbau ______________________________ 375<br />
Schraubengewinde am Fahrrad_____________________ 376<br />
Drehmomente von Befestigungsschrauben _____ 376<br />
Anzugsdrehmomente für Fahrradteile ____________ 377<br />
Sitzposition und Hebelwirkung _____________________ 381<br />
Rahmenhöhe_____________________________________________ 382<br />
Kurbellänge ______________________________________________ 383<br />
Messblatt Fahrer ________________________________________ 384<br />
Messblatt Fahrrad_______________________________________ 385<br />
Fahrradinspektion ______________________________________ 386<br />
Werkstatt-Kontrollbogen ______________________________ 387<br />
Reparatur-Auftrag_______________________________________ 388<br />
Arbeitswerteliste ________________________________________ 389<br />
Werkzeugliste ____________________________________________ 394<br />
DIN-, ISO- und EN-Normen __________________________ 400<br />
Benutzerinformation ___________________________________ 401<br />
Lichttechnik _______________________________________________ 402<br />
Überspannungsschutz_________________________________ 402<br />
Lichttechnische Einrichtungen § 67 StVZO _______ 403<br />
Gesetzl. Bestimmungen für Fahrradanhänger __ 404<br />
Typologie kleinmotorisierter Fahrzeuge __________ 405<br />
21 Sponsoren 406<br />
22 Sachwortverzeichnis 420
4<br />
82<br />
Im Berggang (Bild 1 und 2) wird das Hohlrad bis an<br />
die Planseite des Antreibers geschoben. Die Sperrklinken<br />
werden über die erste Klinkenverzahnung der<br />
Nabenhülse geschoben und kommen somit nicht zur<br />
Wirkung.<br />
Der Kraftverlauf erfolgt jetzt über das Hohlrad, den<br />
Planetenträger, Bremskonus und Sperrklinken auf<br />
die zweite Verzahnung der Nabenhülse. Die Übersetzung<br />
des Planetengetriebes bewirkt jetzt eine Verminderung<br />
der Drehzahl.<br />
Im Normalgang (Bild 3) greift die kleine Verzahnung<br />
des Kupplungsrades in die entsprechende Kupplungsverzahnung<br />
des Hohlrades.<br />
Der Antrieb erfolgt nun direkt (im Verhältnis 1 : 1) über<br />
die Hohlradsperrklinken auf die Nabenhülse. Über<br />
die Verzahnung des Hohlrades wird das Getriebe leer<br />
mitgenommen und kommt so nicht zur Wirkung.<br />
Nabenhülse<br />
Berggang<br />
Abtrieb Bremskonus- Planetenrad Hohlrad Hohlradsperrklinkesperrklinke<br />
Hohlrad,<br />
Antrieb<br />
4 Antrieb<br />
Planetenträger dreht langsamer,<br />
Abtrieb<br />
Bild 1: Berggang bei einer Dreigang-Nabenschaltung<br />
(SRAM)<br />
Antrieb Ritzel<br />
Antreiber<br />
Planetenträger Bremskonus Sonnenrad Mitnehmerscheibe Kupplungsrad Schubklotz Zugstange Hohlachse<br />
Bild 2: Kraftverlauf beim Berggang der Dreigang-Nabenschaltung<br />
Nabenhülse Bremskonus- Planetenrad Hohlrad Hohlradsperrklinkesperrklinke<br />
Abtrieb Antrieb Ritzel<br />
Planetenträger Bremskonus Sonnenrad Mitnehmerscheibe Kupplungsrad Schubklotz Zugstange<br />
Bild 3: Kraftverlauf beim Normalgang der Dreigang-Nabenschaltung<br />
Antreiber<br />
Hohlachse
4 Antrieb<br />
Bremsmantel Sperrklinken<br />
Nabenhülse Stufenplanetenrad Hohlrad<br />
Bremskonus Zugklotz Sonne 1 Planetenträger<br />
Bild 1: Kraftverlauf beim großen Berggang der Fünfgang-Nabenschaltung<br />
Beim Rückwärtstreten nimmt das Fünfgang-Planetengetriebe<br />
die Bremsstellung ein. Dabei wird der<br />
Bremskonus über das Bewegungsgewinde des Planetenträgers<br />
in den Konus des zweiteiligen Bremsmantels<br />
gedrückt und schiebt ihn nach links auf die<br />
konische Fläche des Hebelkonus. Die beiden Hälften<br />
des Bremsmantels werden gespreizt und pressen<br />
sich gegen den Bremszylinder der Nabenhülse.<br />
Das Bremsmoment ist vom eingelegten Gang abhängig.<br />
Es ist im Berggang am größten – was nicht im<br />
Interesse des Fahrers ist.<br />
Viergang-Nabenschaltung<br />
Bei der Viergangnabe von Shimano wird in allen vier<br />
Gängen der Planetenträger angetrieben. Im ersten<br />
Gang (Normalgang) ist das Getriebe direkt übersetzt:<br />
Der Planetenträger wird an- und abgetrieben. Die folgenden<br />
drei Gänge sind Schnellgänge, bei denen das<br />
Hohlrad die Nabe antreibt. Beim Schalten werden<br />
nacheinander unterschiedlich große Sonnenräder<br />
auf der Achse festgesetzt (Bild 2).<br />
Siebengang-Nabenschaltung<br />
Nach dem gleichen Schema der Fünfgangnaben<br />
sind die Siebengang-Naben von Sachs/SRAM und<br />
Sturmey-Archer konzipiert (Bild 1, Seite 86). Jedoch<br />
sind hier drei Sonnenräder mit den dazugehörigen<br />
Planetenrädern im Einsatz. Das Getriebe liefert neben<br />
einen Normalgang drei Übersetzungen ins Langsame<br />
und drei Übersetzungen ins Schnelle.<br />
Bei der Siebengang-Nabenschaltung von Shimano<br />
sind zwei Planetengetriebe mit je zwei Sonnenrädern<br />
hintereinander geschaltet. Hier entfällt der Normalgang,<br />
da dieser fast dem vierten Gang entspricht.<br />
In Bild 2, Seite 86 ist der Aufbau der Achtgang-<br />
Nabenschaltung von Shimano dargestellt.<br />
Kupplungsrad<br />
Ritzel<br />
Antreiber<br />
Bild 2: Viergang-Nabenschaltung von Shimano<br />
Die Gründe, warum Sportradler (selten) mit Nabenschaltungen<br />
fahren, sondern Kettenschaltungen<br />
bevorzugen, sind:<br />
● Nabenschaltungen haben relativ große Gangsprünge<br />
(siehe Kapitel 11.18).<br />
● Nabenschaltungen widerstehen auf Dauer nicht<br />
den hohen Pedalkräften.<br />
● Nabenschaltungen haben einen um etwa 6 %<br />
schlechteren Wirkungsgrad als Kettenschaltungen.<br />
● Bedingt durch dünne Speichenflansche kommt es<br />
bei einigen Nabenschaltungen häufiger zum Speichenbruch.<br />
85<br />
4
20<br />
328<br />
Übungsaufgabe Federung<br />
20 Anhang<br />
Die Fahreigenschaften und der Komfort eines Fahrrads können durch eine Federung verbessert werden. Notwendige<br />
Voraussetzungen für die Funktion einer Federung sind geringe ungefederte Massen und genügend<br />
nachgiebige (weiche) Federn. Unter diesen Umständen kann die Federung optimal arbeiten.<br />
Der Einfederweg kann zu einem Sicherheitsrisiko werden, wenn sich das Tretlager zu stark absenkt (hT in<br />
Bild 1, Seite 329). Üblicherweise wird dieser Problematik durch einen Endanschlag in der Federgabel begegnet.<br />
Gegeben ist die Weg-Kraft-Kennlinie einer Federgabel (Bild 1). Die Horizontalachse (x-Achse) entspricht dem<br />
Einfederweg. Eine Auslenkung = 0 mm bedeutet unbelastet, eine Auslenkung > 0 mm belastet. Auf der Vertikalachse<br />
(y-Achse) ist die dazugehörige Kraft aufgezeichnet.<br />
Kraft y<br />
1600<br />
N<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
EA<br />
0 20 40 60 80 mm 120<br />
Auslenkung x<br />
Bild 1: Weg-Kraft-Kennlinie einer Federgabel<br />
Der Endanschlag EA begrenzt den Ausfederweg, der<br />
Endanschlag EE den Einfederweg.<br />
Die Kennlinie der Federgabel gliedert sich in drei<br />
Bereiche. Im linken und rechten Teil lassen die Endanschläge<br />
die Kennlinie steil ausfallen.<br />
Im mittleren Teil befindet sich der Arbeitsbereich mit<br />
einem vorteilhaft flachen Kurvenverlauf.<br />
Auch die Reifen senken sich mit zunehmender Radlast<br />
ab. Die Weg-Kraft-Kennlinien (Bild 2) zeigen diesen<br />
Zusammenhang. Es wurde die Aufstandskraft<br />
über der Absenkung der Radachse aufgezeichnet,<br />
wobei mit einem Reifendruck von 2 bar und 4 bar gemessen<br />
wurde.<br />
Aufstandskraft<br />
1800<br />
N<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
EE<br />
4 bar<br />
2 bar<br />
0<br />
0 2 4 6 8 10 12 mm 16<br />
Absenkung<br />
Bild 2: Weg-Kraft-Kennlinie eines Reifens 50 x 559<br />
Aufgabe:<br />
Untersuchen Sie die Situation eines vorn gefederten Fahrrades (Bild 1, Seite 329) im unbeladenen, gebremsten<br />
und rollenden Zustand.
20 Anhang<br />
NuVinci-Nabenschaltung<br />
Die NuVinci-Nabe ist eine stufenlose Getriebenabe<br />
des amerikanischen Herstellers Falbrook. Sie hat<br />
eine Gesamtkapazität von 350 % und wiegt ca. 4,3 kg.<br />
Die Nabe wird über einen Drehgriffschalter geschaltet<br />
und ist für den Einsatz an Alltagsrädern vorgesehen<br />
(Bild 1).<br />
Bild 1: NuVincy-Nabe mit Drehgriffschalter<br />
Die NuVinci-Nabe arbeitet wie alle Nabenschaltungen<br />
als Planetengetriebe, das aber nicht aus Zahnrädern,<br />
sondern aus Kugeln und Kugellaufbahnen<br />
aufgebaut ist (Bild 2). Die Verbindung zwischen den<br />
Getriebebauteilen erfolgt nicht formschlüssig wie bei<br />
Zahnradgetrieben, sondern kraftschlüssig, wobei ein<br />
spezielles Hydrauliköl in der Nabe den Schlupf zwischen<br />
den Kugeln und Kugellaufbahnen verhindert.<br />
Bild 2: Schnittbild NuVincy-Nabe<br />
Durch Betätigung des Drehgriffschalters werden die<br />
Lagerachsen der Kugeln schräg gestellt. Die Kugeln<br />
entsprechen den Planetenrädern und die Lagerachsen<br />
den Planetenradachsen des normalen Zahnrad-<br />
Planetengetriebes. Durch die Schrägstellung verändert<br />
man den wirksamen Umfang der Kugel, so als<br />
würde man ein Zahnrad mit einer anderen Zähnezahl<br />
verwenden.<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
Bild 3: Schrägstellung der Kugelachsen<br />
a) Übersetzung ins Langsame<br />
b) Direkte Übersetzung<br />
c) Übersetzung ins Schnelle<br />
r i<br />
r i<br />
r i<br />
Ist die Kugelachse geneigt (Bild 3 a), übersetzt der<br />
linke Teil des Getriebes mit dem großen wirksamen<br />
Kugelradius ri stark ins Langsame und der rechte Teil<br />
mit dem kleinen wirksamen Kugelradius ra schwach<br />
ins Schnelle. Die Gesamtübersetzung ist eine Übersetzung<br />
ins Langsame.<br />
Steht die Kugelachse waagerecht (Bild 3 b), übersetzt<br />
der linke Teil des Getriebes genauso stark ins Langsame<br />
wie der rechte ins Schnelle. Die Gesamtübersetzung<br />
ist 1 : 1.<br />
Ist die Kugelachse geneigt (Bild 3 c), übersetzt der<br />
linke Teil des Getriebes mit dem kleinen wirksamen<br />
Kugelradius ri schwach ins Langsame und der rechte<br />
Teil mit dem großen wirksamen Kugelradius ra stark<br />
ins Schnelle. Die Gesamtübersetzung ist eine Übersetzung<br />
ins Schnelle.<br />
Durch das Schrägstellen der Kugelachsen werden<br />
stufenlos alle möglichen Übersetzungen durchlaufen.<br />
r a<br />
r a<br />
r a<br />
341<br />
20
20 Anhang<br />
Messblatt Fahrrad<br />
1 Reifen-/Felgendurchmesser nach ETRTO<br />
2 Rahmenhöhe 1<br />
3a Sitzrohrlänge<br />
3b Sitzrohr-Überstand<br />
4 Rahmenlänge<br />
5 Stand-Over-Maß<br />
6 Lenkrohrwinkel, Lenkkopfwinkel<br />
7 Sattelüberstand<br />
8 Sattelhöhe, Sitzhöhe<br />
9 Sattelrückstellung<br />
10 Vorbaulänge<br />
11 Lenkerausladung<br />
12 Lenkerhöhe<br />
8<br />
2<br />
3a<br />
7<br />
3b<br />
13<br />
9<br />
13 Sitzrohrwinkel<br />
14 Radstand<br />
15 Hinterbaulänge<br />
16 Vorderbaulänge<br />
17 Nachlauf<br />
21<br />
20 19<br />
15 16<br />
14<br />
18 Gabelversatz, Gabelvorbiegung<br />
19 Fußfreiheit 2<br />
20 Tretkurbellänge<br />
21 Tretlagerhöhe<br />
22 Tretlager-Tiefgang<br />
4<br />
Zähnezahl Kettenblätter<br />
Zähnezahl Ritzel<br />
Gewicht Fahrrad<br />
1 Mitte Tretlager – Oberkante Steuerrohr (waagerecht auf den Schnittpunkt mit der Sitzrohrlinie übertragen)<br />
2 Nach DIN EN bei ungünstigster Lenker-/Kurbelstellung gemessen<br />
Weitere Daten sind:<br />
Steuerkopflänge, Gabelschaftlänge, Steuersatzgröße, Steuersatzsystem, Vorbausystem, Federweg hinten,<br />
Federweg vorn, Federhärte vorderes und hinteres Federelement, Federelementlänge, Federelement-Einbaubreite,<br />
Übersetzungsverhältnis der Federung, Tretlagerbreite, Lenkerbreite, Hinterbaubreite, Kettenstrebenlänge<br />
10 11<br />
6<br />
18<br />
17<br />
12<br />
22<br />
1<br />
5<br />
385<br />
20