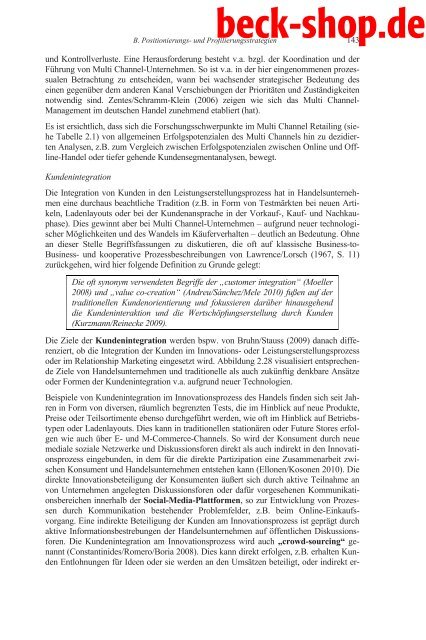Handelsmanagement - Zentes / Swoboda / Foscht, Leseprobe
Handelsmanagement - Zentes / Swoboda / Foscht, Leseprobe
Handelsmanagement - Zentes / Swoboda / Foscht, Leseprobe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eck-shop.de<br />
B. Positionierungs- und Profilierungsstrategien 143<br />
und Kontrollverluste. Eine Herausforderung besteht v.a. bzgl. der Koordination und der<br />
Führung von Multi Channel-Unternehmen. So ist v.a. in der hier eingenommenen prozessualen<br />
Betrachtung zu entscheiden, wann bei wachsender strategischer Bedeutung des<br />
einen gegenüber dem anderen Kanal Verschiebungen der Prioritäten und Zuständigkeiten<br />
notwendig sind. <strong>Zentes</strong>/Schramm-Klein (2006) zeigen wie sich das Multi Channel-<br />
Management im deutschen Handel zunehmend etabliert (hat).<br />
Es ist ersichtlich, dass sich die Forschungsschwerpunkte im Multi Channel Retailing (siehe<br />
Tabelle 2.1) von allgemeinen Erfolgspotenzialen des Multi Channels hin zu dezidierten<br />
Analysen, z.B. zum Vergleich zwischen Erfolgspotenzialen zwischen Online und Offline-Handel<br />
oder tiefergehende Kundensegmentanalysen, bewegt.<br />
Kundenintegration<br />
Die Integration von Kunden in den Leistungserstellungsprozess hat in Handelsunternehmen<br />
eine durchaus beachtliche Tradition (z.B. in Form von Testmärkten bei neuen Artikeln,<br />
Ladenlayouts oder bei der Kundenansprache in der Vorkauf-, Kauf- und Nachkauphase).<br />
Dies gewinnt aber bei Multi Channel-Unternehmen –aufgrund neuer technologischer<br />
Möglichkeiten und des Wandels im Käuferverhalten –deutlich an Bedeutung. Ohne<br />
an dieser Stelle Begriffsfassungen zu diskutieren, die oft auf klassische Business-to-<br />
Business- und kooperative Prozessbeschreibungen von Lawrence/Lorsch (1967, S. 11)<br />
zurückgehen, wird hier folgende Definition zu Grunde gelegt:<br />
Die oft synonym verwendeten Begriffe der „customer integration“ (Moeller<br />
2008) und „value co-creation“ (Andreu/Sánchez/Mele 2010) fußen auf der<br />
traditionellen Kundenorientierung und fokussieren darüber hinausgehend<br />
die Kundeninteraktion und die Wertschöpfungserstellung durch Kunden<br />
(Kurzmann/Reinecke 2009).<br />
Die Ziele der Kundenintegration werden bspw. von Bruhn/Stauss (2009) danach differenziert,<br />
obdie Integration der Kunden imInnovations- oder Leistungserstellungsprozess<br />
oder im Relationship Marketing eingesetzt wird. Abbildung 2.28 visualisiert entsprechende<br />
Ziele von Handelsunternehmen und traditionelle als auch zukünftig denkbare Ansätze<br />
oder Formen derKundenintegration v.a. aufgrund neuerTechnologien.<br />
Beispiele von Kundenintegration imInnovationsprozess des Handels finden sich seit Jahren<br />
inForm von diversen, räumlich begrenzten Tests, die im Hinblick auf neue Produkte,<br />
Preise oder Teilsortimente ebenso durchgeführt werden, wie oft im Hinblick auf Betriebstypen<br />
oder Ladenlayouts. Dies kann in traditionellen stationären oder Future Stores erfolgen<br />
wie auch über E-und M-Commerce-Channels. Sowird der Konsument durch neue<br />
mediale soziale Netzwerke und Diskussionsforen direkt als auch indirekt inden Innovationsprozess<br />
eingebunden, in dem für die direkte Partizipation eine Zusammenarbeit zwischen<br />
Konsument und Handelsunternehmenentstehen kann (Ellonen/Kosonen 2010).Die<br />
direkte Innovationsbeteiligung der Konsumenten äußert sich durch aktive Teilnahme an<br />
von Unternehmen angelegten Diskussionsforen oder dafür vorgesehenen Kommunikationsbereichen<br />
innerhalb der Social-Media-Plattformen, sozur Entwicklung von Prozessen<br />
durch Kommunikation bestehender Problemfelder, z.B. beim Online-Einkaufsvorgang.<br />
Eine indirekte Beteiligung der Kunden am Innovationsprozess ist geprägt durch<br />
aktive Informationsbestrebungen der Handelsunternehmen auf öffentlichen Diskussionsforen.<br />
Die Kundenintegration am Innovationsprozess wird auch „crowd-sourcing“ genannt<br />
(Constantinides/Romero/Boria 2008). Dies kann direkt erfolgen, z.B. erhalten Kunden<br />
Entlohnungen für Ideen oder sie werden an den Umsätzen beteiligt, oder indirekt er