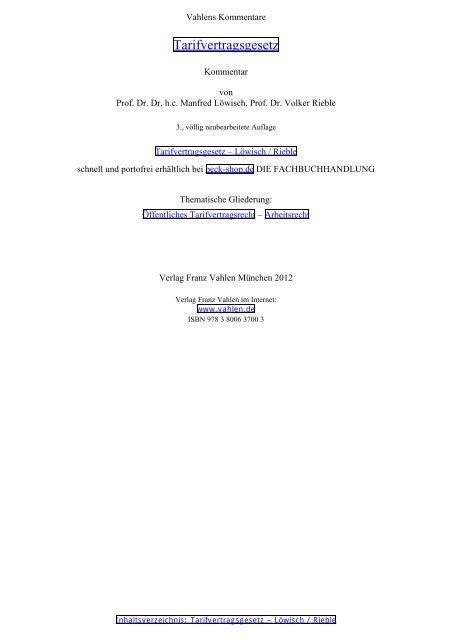Tarifvertragsgesetz - Löwisch / Rieble, Leseprobe
Tarifvertragsgesetz - Löwisch / Rieble, Leseprobe
Tarifvertragsgesetz - Löwisch / Rieble, Leseprobe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vahlens Kommentare<br />
<strong>Tarifvertragsgesetz</strong><br />
Kommentar<br />
von<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred <strong>Löwisch</strong>, Prof. Dr. Volker <strong>Rieble</strong><br />
3., völlig neubearbeitete Auflage<br />
<strong>Tarifvertragsgesetz</strong> – <strong>Löwisch</strong> / <strong>Rieble</strong><br />
schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG<br />
Thematische Gliederung:<br />
Öffentliches Tarifvertragsrecht – Arbeitsrecht<br />
Verlag Franz Vahlen München 2012<br />
Verlag Franz Vahlen im Internet:<br />
www.vahlen.de<br />
ISBN 978 3 8006 3700 3<br />
Inhaltsverzeichnis: <strong>Tarifvertragsgesetz</strong> – <strong>Löwisch</strong> / <strong>Rieble</strong>
eck-shop.de<br />
A. Tarifvertrag als Normenvertrag 19 – 22 § 1<br />
in seiner jeweils geltenden Fassung ausgesprochen. Eine solche dynamische Verweisung<br />
stelle zwar regelmäßig keine Preisgabe der Tarifmacht dar, weil die Tarifvertragsparteien<br />
die Verweisungsbestimmungen jederzeit aufheben, modifi zieren oder durch andere Tarifnormen<br />
ersetzen können und damit Herr dessen bleiben, was als Tarifrecht gelten soll<br />
(BAG 9.7.1980 – 4 AZR 564/78 – NJW 1981, 1574; 27.7.1956 –1 AZR 430/54 – NJW 1956, 1812 AP Nr. 3<br />
zu § 4 TVG Geltungsbereich, 10.11.1993 – AZR 316/93 – NZA 1994, 6224; Baumann, Die Delegation tarifl<br />
icher Rechtsetzungsbefugnisse [1992] 136 ff; Reinermann, Verweisungen in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen<br />
[1997] 82 ff ). Etwas anderes gelte aber dann, wenn die Tarifvertragsparteien<br />
die Unkündbarkeit der Verweisung vereinbarten oder eine zeitlich lange Bindung<br />
eingingen, sei es durch eine besonders lange Laufdauer der Verweisungsnorm oder durch<br />
die Vereinbarung einer langen Kündigungsfrist. Auch dann könnten sie zwar noch einvernehmlich<br />
die Verweisung aufheben. Jedoch führe die dann gegebene Möglichkeit des<br />
durch die Entwicklung der in Bezug genommenen Tarifnorm begünstigten Teiles, den<br />
anderen auf längere Dauer an einer möglicherweise nicht vorhersehbaren Regelung festzuhalten,<br />
zu einer nicht mehr hinnehmbaren Einschränkung von dessen Normsetzungs-<br />
befugnis (BAG 10.11.1982 – 4 AZR 1203/79 – AP Nr. 8 zu § 1 TVG Form).<br />
Dieser Gedanke gilt allgemein. Langfristig unkündbare Tarifverträge schließen die erforderlichen<br />
Neuverhandlungen zur Anpassung an veränderte Verhältnisse aus. Das<br />
Kündigungsrecht aus wichtigem Grund (Rn 1395 ff ) genügt nicht, weil es nicht schon<br />
dann greift, wenn die tarifl iche Regelung unangemessen geworden ist, sondern erst,<br />
wenn eine schwerwiegende Störung der Geschäftsgrundlage eingetreten ist (Rn 1404 ff ).<br />
An sich müßte das Maß der unzulässigen Bindung unterschiedlich für verschiedene Regelungsgegenstände<br />
(Lohn- und Gehaltstarifverträge einerseits – Manteltarifverträge andererseits)<br />
bestimmt werden. Die Folge wäre aber unerträgliche Rechtsunsicherheit.<br />
Deshalb bietet es sich an, analog § 624 BGB (und § 15 Abs. 4 TzBfG) die ordentliche<br />
Kündigung jeden Tarifvertrages nach fünf Jahren mit einer Frist von sechs Monaten<br />
zuzulassen (zustimmend Hanau/Kania, Stufentarifverträge, DB 1995, 1229, 1230; Däubler/Deinert § 4<br />
Rn 107 ff; in diese Richtung auch Richardi, Kollektivgewalt und Individualwille bei der Gestaltung des<br />
Arbeitsverhältnisses [1968] 223; Demiral, Die ordentliche und außerordentliche Kündigung von Tarifverträgen<br />
in Deutschland und in der Türkei [2003] 75; kritisch Kempen/Zachert/Stein § 4 Rn 133).<br />
Mittelbar wird durch diese Höchstfrist der Selbstbindung zugleich die Dauer der<br />
Nachbindung nach § 3 Abs. 3 sachgerecht begrenzt (§ 3 Rn 265 ff ).<br />
c) Kein Ausweichen auf Arbeitsvertragsgestaltung<br />
Der Selbstregelungsverantwortung können Tarifparteien nicht dadurch entgehen, daß<br />
sie eine schuldrechtliche Pfl icht zur Transformation tarifl icher Arbeitsbedingungen<br />
in den Arbeitsvertrag schaffen. Darin läge ein systemwidriger Wechsel der Rechtsquellen,<br />
außerdem wichen die Tarifparteien der Tarifverantwortung aus, weil sie einmal<br />
transformierte Klauseln nicht mehr selbst ändern könnten (BAG 10.12.2002 – 1 AZR 96/02 –<br />
NZA 2003, 734, 740; dazu Anmerkungen Buchner RdA 2003, 363 und Thüsing AP Nr. 163 zu Art. 9 GG,<br />
1799, 1802; Stamm, Sind Verpfl ichtungen einer Tarifvertragspartei, tarifvertragliche Regelungen in Arbeitsverträge<br />
zu übernehmen, zulässig?, RdA 2006, 39, 40 ff; Blanke, Flankenschutz für die Tarifautonomie,<br />
AuR 2004, 130, 134 f ). Schuldrechtliche gewollte Arbeitsbedingungen können die Tarifparteien<br />
– ebenso wie nicht-tariffähige Koalitionen – nur mit schuldrechtlichen<br />
Kollektiv-Verträgen vorsehen; die ebenso schuldrechtliche Umsetzung auf arbeitsvertraglicher<br />
Ebene ist dann Pfl icht des Mitglieds gegenüber seinem Verband (für einen Personalüberleitungsvertrag<br />
BAG 23.2.2011 – 4 AZR 439/09 – juris).<br />
Tarifparteien müssen also zwischen den unterschiedlichen Regelungssystemen<br />
wählen:<br />
Entweder gestalten sie die Arbeitsbedingungen normativ, dann ist ihnen nur das Tarifsystem<br />
des TVG mit seinen Regelungsoptionen, seiner spezifi schen Reichweite der<br />
Tarifmacht und deren Grenzen eröffnet.<br />
139<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22
140<br />
beck-shop.de<br />
§ 1 23 – 28 Inhalt und Form des Tarifvertrages<br />
Oder sie wählen den schuldrechtlichen Weg (der auch nicht-tariffähigen Koalitionen<br />
offensteht): Über ihn können sie die Arbeitsvertragsgestaltung durch kollektivvertragliche,<br />
aber eben nur schuldrechtliche Einwirkungs und Durchführungspfl ichten<br />
steuern.<br />
Mischformen hingegen sind nach dem dictum des BAG unzulässig.<br />
23 Das schließt es nicht aus, daß der Tarifvertrag einen Vertragsänderungsanspruch für<br />
notwendig individuelle Arbeitsbedingungen vorsieht, etwa auf Reduktion der Arbeitszeit<br />
in Erweiterung des Elternzeitanspruches.<br />
3. Fremdeinwirkung auf den Tarifi nhalt<br />
24 Üben die Tarifvertragsparteien ihre Tarifmacht aus, müssen sie sie auch verantwortlich<br />
wahrnehmen (vgl. BAG 10.11.1982 – 4 AZR 1203/79 – AP Nr. 8 zu § 1 TVG Form; 9.7.1980 –<br />
4 AZR 564/78 – AP Nr. 7 zu § 1 TVG Form mit Anm. Wiedemann). Sie dürfen die in Anspruch genommene<br />
Normsetzungsbefugnis Dritten nicht übertragen (allgemein Baumann, Die<br />
Delegation tarifl icher Rechtsetzungsbefugnisse [1992]). Von vornherein können die Tarifpartei<br />
ihre Tarifmacht nicht an tarifunfähige Parteien delegieren und so die Anforderungen an<br />
die Tariffähigkeit unterlaufen. Aber auch an fremde Tarifparteien ist eine Delegation<br />
nicht möglich, weil damit die Ausrichtung der Tarifautonomie am Willen der eigenen<br />
Mitglieder verfehlt wird.<br />
a) Grenzen dynamischer Verweisung<br />
25 Die Tarifvertragsparteien sind auf eine am Interesse ihrer Mitglieder orientierte Gestaltung<br />
der Arbeitsbedingungen verpfl ichtet. Diese ist nicht gewährleistet, wenn sie auf<br />
die Tarifnormen eines anderen Tarifbereiches dynamisch verweisen, für den die dortigen<br />
Tarifvertragsparteien eine eigenständige, an den Interessen ihrer Mitglieder orientierte<br />
Regelung getroffen haben (BAG 9.7.1980 – 4 AZR 564/78 – NJW 1981, 1574; 10.11.1982 – 4 AZR<br />
1203/79 – AP Nr. 8 zu § 1 TVG Form; 18.6.1997 – 4 AZR 710/95 – NZA 1997, 1234; 20.6.2001 – 4 AZR<br />
295/00 – NZA 2001, 517; zustimmend Wiedemann/Thüsing § 1 Rn 235 ff; kritisch Gamillscheg 571 ff:<br />
unzulässige Tarifzensur; deutlich großzügiger auch Umbach, Rechtsfragen des Anerkennungstarifvertrages<br />
[2004] 182 ff ).<br />
26 aa) Gebot des Sachzusammenhangs. Dieses Bedenken entfällt, wenn die Interessenlagen,<br />
die den Regelungen beider Tarifverträge zugrunde liegen, einander so ähnlich<br />
sind, daß die Lösung, welche im in Bezug genommenen Tarifvertrag getroffen worden<br />
ist, auch als sachgerechte Lösung des Interessenkonfl ikts der verweisenden Tarifparteien<br />
gelten kann. Anhänger der Delegationstheorie kommen über Art. 80 GG zum selben<br />
Ergebnis (Wiedemann/Thüsing § 1 Rn 259 ff; Baumann, Die Delegation tarifl icher Rechtsetzungsbefugnisse<br />
[1992] 54 ff ). Insofern liegt es anders als bei der Betriebsvereinbarung, die niemals eine<br />
dynamische Verweisung enthalten darf (§ 3 Rn 557). Die Normenklarheit verlangt allerdings<br />
gerade für die Bezugnahmeklausel, daß die in Bezug genommenen Arbeitsbedingungen<br />
eindeutig bezeichnet sind (Rn 869).<br />
27 Der notwendige Sachzusammenhang liegt stets vor, wenn die Tarifvertragsparteien auf<br />
einen von ihnen selbst abgeschlossenen Tarifvertrag verweisen: Die dynamische Verweisung<br />
innerhalb des eigenen Tarifwerkes der auf beiden Seiten vollständig identischen<br />
Tarifparteien ist schon deswegen unbedenklich, weil die Tarifparteien die Verweisungsfolgen<br />
selbst einschätzen. So verweisen typischerweise alle Tarifverträge eines<br />
Tarifwerkes für den Geltungsbereich auf den MTV, um die Regelung zu entschlacken.<br />
Das hat allerdings Konsequenzen für die Friedenspfl icht (Rn 1043).<br />
28 Die Tarifparteien können in einem normativen Tarifvertrag auch auf eine von ihnen<br />
selbst geschlossene schuldrechtliche Regelung der Arbeitsbedingungen verweisen, wodurch<br />
diese normative Kraft erlangt. So können die Tarifparteien sogar dynamisch auf
eck-shop.de<br />
A. Tarifvertrag als Normenvertrag 29 – 31 § 1<br />
die jeweiligen – nicht normativen – Protokollnotizen verweisen (vgl BAG 7.8.2002 – 10 AZR<br />
692/01 – AP Nr. 39 zu § 1 TVG Tarifverträge: Druckindustrie). Das Schriftformgebot verlangt nur,<br />
daß die in Bezug genommene Regelung ihrerseits als Schriftstück greifbar ist (Rn 1453).<br />
In engen Grenzen zulässig ist die Verweisung auf einen Tarifvertrag ganz oder teilweise<br />
fremder Tarifparteien – wenn die beiden Tarifverträge nach ihrem räumlichen,<br />
betrieblichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereich (§ 4 Rn 122 ff ) eng miteinander<br />
zusammenhängen (Kempen/Zachert § 1 Rn 796). Das trifft zu,<br />
wenn in dem für die im Ausland eingesetzten Angestellten der Goethe-Institute geltenden<br />
Tarifvertrag auf den Tarifvertrag für die deutschen Angestellten bei den diplomatischen<br />
und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland<br />
und von dort weiter auf den TVöD verwiesen wird (BAG 9.7.1980 – 4 AZR 564/78 – NJW<br />
1981, 1574; 18.12.1996 – 4 AZR 129/96 – NZA 1997, 830),<br />
wenn ein Haustarifvertrag für die Arbeitnehmer eines Metallunternehmens auf den<br />
einschlägigen Verbandstarifvertrag der Metallindustrie Bezug nimmt (BAG 10.11.1982 –<br />
4 AZR 1203/79 – AP Nr. 8 zu § 1 TVG Form; 20.6.2001 – 4 AZR 295/00 – NZA 2002, 517; 29.8.2001<br />
– 4 AZR 332/00 – NZA 2002, 513 = RdA 2002, 299 mit krit. Anm. Däubler; sogenannter »Anschluß<br />
oder Anerkennungstarifvertrag«). In der Diskussion um die Tariffähigkeit wird die Zulässigkeit<br />
eines solchen Anschlußtarifvertrags als Indiz für Durchsetzungskraft vorausgesetzt<br />
(BAG 16.1.1990 – 1 ABR 10/89 – NZA 1990, 623 und – 1 ABR 93/88 – NZA 1990, 626).<br />
Verweist dagegen ein Tarifvertrag für Leiharbeitnehmer auf die beim Entleiher geltenden<br />
Tarifbedingungen ist das aus sich heraus nicht sachgerecht, weil die Leiharbeit<br />
tarifpolitisch eine eigenständige Branche ist. Daß der Gesetzgeber das Entgeltgleichstellungsgebot<br />
(»equal pay«, zur Kritik Grundl Rn 184) in § 9 Nr. 2 AÜG als<br />
gesetzliche Auffanglösung für den Fall bereit hält, daß der Verleihertarifvertrag keine<br />
eigenständige Entgeltlösung formuliert, begründet keine tarifpolitische Sachgerechtigkeit.<br />
Wollen also die Verleihertarifparteien die Lohngleichstellung, so brauchen sie nur<br />
gerade keinen Tarifvertrag abzuschließen und können das Gesetz gelten lassen.<br />
Allerdings wird man erstens stets verlangen müssen, daß der persönliche Geltungsbereich<br />
des verweisenden Tarifvertrages kleiner ist als der des in Bezug genommenen.<br />
Nur dann sind die in Bezug genommenen Regelungen hinreichend allgemein, um als<br />
Modell für einen sachgerechten Interessenausgleich im verweisenden Tarifvertrag dienen<br />
zu können. Niemals darf deshalb ein Verbandstarif dynamisch auf einen Haustarif ver-<br />
weisen.<br />
Zweitens muß den Parteien des Anschlußtarifvertrages ein hinreichend effektives ordentliches<br />
Kündigungsrecht eingeräumt sein – damit sie die »Vorabunterwerfung« unter<br />
künftige fremde Tarifi nhalte abstellen, die Bezugnahme entdynamisieren können.<br />
Sonst verkommt der Anschluß zur Blankounterwerfung, zum Tarifdiktat – entgegen<br />
dem dictum des BAG, das den Gleichlauf von Beteiligung und Betroffenheit fordert<br />
(BAG 4.6.2008 – 4 AZR 419/07 – NZA 2008, 1366; weiter § 3 Rn 230 ff zur Blitzwechselrechtsprechung):<br />
Der Arbeitgeberverband des in Bezug genommenen Flächentarifs kann auch durch Vollunterwerfung<br />
nicht legitimiert werden, für sein Nicht- oder Ex-Mitglied dauerhaft Tarifbedingungen<br />
vorzugeben. Insofern ist es nicht anders als bei tariffreien Arbeitnehmern,<br />
die durch Bezugnahmeklauseln einem fremden Tarifdiktat unterworfen werden<br />
(§ 3 Rn 644 ff ). Das Kündigungsrecht muß jeden Fall der Änderung des in Bezug genommenen<br />
Tarifvertrags erfassen – so wie jede Änderung des Tarifvertrags die Nachbindung<br />
beendet (§ 3 Rn 272). Es kann nicht in den Tarifvertrag hineininterpretiert werden (so noch<br />
<strong>Rieble</strong> Anm EzA § 1 TVG Fristlose Kündigung Nr. 2); es muß vereinbart sein; andernfalls ist die<br />
dynamische Verweisung unwirksam, weil ihr die Sachgerechtigkeit fehlt. Im Hauptfall<br />
des Anschlußhaustarifvertrages leuchtet nicht ansatzweise ein, daß der angeschlossene<br />
verbandsfreie Arbeitgeber stärker an den Verbandstarifvertrag gebunden sein soll, als er<br />
dies als Mitglied wäre (schon <strong>Rieble</strong> Anm EzA § 1 TVG Fristlose Kündigung Nr. 2). Erst recht ist<br />
es bei dynamischen Verweisungen in Verbandstarifverträgen nicht hinzunehmen, daß<br />
der angeschlossene Tarifverband an fremde Tarifi nhalte stärker gebunden sein soll, als<br />
141<br />
29<br />
30<br />
31
142<br />
beck-shop.de<br />
§ 1 32 – 35 Inhalt und Form des Tarifvertrages<br />
wäre er unmittelbar durch Mitgliedschaft in einem Spitzenverband gebunden. Bezeichnenderweise<br />
meint das BAG, daß die Friedenspfl icht aus dem ungekündigten Anschlußtarif<br />
dann suspendiert sein soll, wenn der in Bezug genommene Verbandstarif ausgelaufen<br />
ist (18.2.2003 – 1 AZR 142/02 – NZA 2003, 866) – das aber soll nur einseitig die Gewerkschaft<br />
zum Streik befähigen, von einem Tarifdispens des angeschlossenen Arbeitgebers ist<br />
keine Rede.<br />
32 Insofern genügt weder ein schon im Tatbestand risikobehaftetes Kündigungsrecht<br />
aus wichtigem Grund wegen »unzumutbarer« Entwicklung des Bezugnahmeobjektes<br />
(so aber Umbach, Rechtsfragen des Anerkennungstarifvertrages [2004] 486 ff ), noch das allgemeine<br />
Prinzip der Laufzeitbegrenzung auf fünf Jahre (Rn 18). Mit einem solchen ordentlichen<br />
Kündigungsrecht läßt sich die Diskussion um die Erkämpfbarkeit des<br />
Anschlußtarifvertrages (Grundl Rn 442) deutlich entschärfen.<br />
33 Für die arbeitsvertragliche Bezugnahme auf einen Tarifvertrag wird eine gewisse (eher<br />
theoretische) Begrenzung dadurch erreicht, daß schlechthin unvorhersehbare Tarifentwicklungen<br />
von der Klausel nicht erfaßt werden (§ 3 Rn 539 f ). Auf die tarifl iche dynamische<br />
Bezugnahme auf fremde Tarifverträge ist das nicht übertragbar: Denn das Kriterium<br />
der Unvorhersehbarkeit läuft als aufl ösende Bedingung der Verweisung darauf<br />
hinaus, daß ein Richter entscheidet, wie weit der Tarifwille reicht und insoweit einen<br />
eigenen Tarifwillen bildet. Das aber ist – wie bei der ergänzenden Tarifauslegung (Rn 1518)<br />
grundsätzlich ausgeschlossen. Insofern ist nur ein außerordentliches Kündigungsrecht<br />
möglich (Rn 1410).<br />
34 Die für die Zulässigkeit einer dynamischen Verweisung auf einen Tarifvertrag maßgebenden<br />
Grundsätze gelten in gleicher Weise für die dynamische Verweisung auf ein<br />
Gesetz, das die Dienstbedingungen für Beamte regelt. Erfassen verweisender Tarifvertrag<br />
und beamtenrechtliche Regelung einen verwandten Personenkreis, kann davon ausgegangen<br />
werden, daß die für die Beamten geltende Regelung auch im Geltungsbereich<br />
des Tarifvertrags sachgerecht ist. Denn der Staat ist gegenüber seinem Beamten zur Fürsorge<br />
verpfl ichtet und hat demgemäß die Bedingungen, unter denen die Beamten ihre<br />
Dienste zu leisten haben, angemessen zu regeln (BAG 9.6.1982 – 4 AZR 274/81 – AP Nr. 1 zu<br />
§ 1 TVG Durchführungspfl icht für die Verweisung eines für angestellte Lehrer des öffentlichen Dienstes<br />
geltenden Tarifvertrages auf die Arbeitszeitbestimmungen für beamtete Lehrer; 7.9.1982 – 3 AZR 1252/79<br />
– AP Nr. 7 zu § 44 BAT für das damalige Umzugskostenrecht; ebenso BAG 16.1.1985 – 7 AZR 270/82 –<br />
AP Nr. 9 zu § 44 BAT für das Trennungsgeldrecht; Wiedemann/Thüsing § 1 Rn 240). Zwischenzeitlich<br />
koppeln sich TVöD und TVL mit den Tarifbedingungen wieder stärker von den Beamtenregeln<br />
ab, so daß die Rechtsfrage an Bedeutung verliert.<br />
35 Besonderheiten gelten für die Arbeitsortklausel in den Bautarifen. Sie gewährt entsandten<br />
Bauarbeitnehmern den höheren von zwei Löhnen, sei es der Lohn des Einstellungsortes,<br />
sei es der im Tarifgebiet des Einsatzortes maßgebliche Lohn (dazu BAG<br />
10.11.1993 – 4 AZR 316/93 – NZA 1994, 622). Insoweit ist zu unterscheiden:<br />
Die Arbeitsortklausel in den Mindestlohntarifverträgen des Baugewerbes (§ 3: »Es<br />
gilt der Mindestlohn der Arbeitsstelle.«) ist überhaupt keine Verweisung auf einen fremden<br />
Tarifvertrag, weil der regional differenzierte Mindestlohn sich in einem einheitlichen<br />
Tarifvertrag fi ndet und die Maßgeblichkeit des Arbeitsortes nur den Anknüpfungspunkt<br />
für die Entgeltbemessung defi niert. Damit wird innerdeutsche Lohnunterbietung<br />
verhindert: Wirkung hat die Arbeitsortklausel mithin nur für die Bauarbeitnehmer<br />
aus dem Osten, weil diesen bei Arbeit im Westen der dortige höhere Mindestlohn<br />
zusteht. Ohne eine solche Arbeitsortklausel könnten regional unterschiedliche Mindestlöhne<br />
nach dem AEntG mit Blick auf die Dienstleistungsfreiheit nicht gegenüber<br />
ausländischen Bauunternehmen auf Baustellen im Inland für allgemeinverbindlich erklärt<br />
werden – weil innerdeutsches Entgeltgefälle zur Lohnunterbietung genutzt werden<br />
könnte. § 1 Satz 1 AEntG in den Fassungen 1997 sowie 1999 verlangte eine solche<br />
Klausel ausdrücklich (»und auch inländische Arbeitgeber ihren im räumlichen Geltungsbereich<br />
des Tarifvertrages beschäftigten Arbeitnehmern mindestens die am Arbeitsort geltenden tarifvertragli-
eck-shop.de<br />
A. Tarifvertrag als Normenvertrag 36 – 39 § 1<br />
chen Arbeitsbedingungen gewähren müssen«) – weil damals noch getrennte regionale Tarifverträge<br />
galten.<br />
Die Arbeitsortklausel im Bundesrahmentarifvertrag Bau (§ 5 Satz 1: »Es gilt der Lohn der<br />
Arbeitsstelle.«) ist dagegen eine echte dynamische Verweisung, weil der Bundestarif nur<br />
die Vergütungsgruppen und Eckentgelte festlegt, aber durch gesonderte Regionaltarife<br />
unterschiedlicher Tarifparteien konkretisiert wird. Sie ist sachgerecht, weil sie die<br />
Lohnhöhe am Arbeitsort ausrichtet, eng auf dieselbe Branche beschränkt ist und<br />
durch die Vorgaben des BRTV vorstrukturiert ist.<br />
bb) Dynamikvoraussetzung: normative Kraft des verweisenden Tarifvertrags. Die<br />
Dynamik der Verweisung ist nur solange legitimiert, als der verweisende Tarifvertrag<br />
seinerseits normativ gilt und mit seiner Normativkraft die Inhaltsänderung des in Bezug<br />
genommenen Tarifvertrags »importieren« kann. Endet die normative Wirkung des dynamisch<br />
verweisenden Tarifvertrags, so verliert die Verweisung ihre Dynamik, bleibt<br />
aber als statische Verweisung auf den im Beendigungszeitpunkt maßgeblichen Rechtsstand<br />
der in Bezug genommenen Tarifnorm erhalten (BAG 10.11.1982 – 4 AZR 1203/79 – AP<br />
Nr. 8 zu § 1 TVG Form; 10.3.2004 – 4 AZR 140/03 – EzA § 4 TVG Nachwirkung Nr. 36; LAG Rheinland-Pfalz<br />
28.1.2009 – 8 Sa 656/08 – juris; für den Betriebsübergang aus einem dynamisch verweisenden<br />
Anschlußtarifvertrag: BAG 20.6.2001 – 4 AZR 295/00 – NZA 2002, 517; 29.8.2001 – 4 AZR 332/00 –<br />
NZA 2002, 513; 26.8.2009 – 5 AZR 969/08 – NZA 2010, 173). Dieses »Einfrieren« des Dynamik<br />
gilt stets, auch wenn auf eine gesetzliche Regelung oder Berechnungsgröße (Arbeitnehmeranteil<br />
am Sozialversicherungsbeitrag) Bezug genommen ist (BAG 24.11.1999 – 4 AZR<br />
666/98 – NZA 2000, 435, dazu Anm Jacobs AP § 4 TVG Nachwirkung Nr. 34). Das betrifft folgende<br />
Fälle:<br />
Normale Beendigung des Tarifvertrags mit Übergang in den Nachwirkungszeitraum<br />
des § 4 Abs. 5 (§ 4 Rn 704 ff ).<br />
Übergang in den Nachbindungszeitraum des § 3 Abs. 3 durch »vorzeitige« Beendigung<br />
der Mitgliedschaft, weil jede Inhaltsänderung und damit auch jede Veränderung<br />
des Bezugnahmeobjektes ihrerseits die Nachbindung beendet und zur Nachwirkung<br />
führt (§ 3 Rn 276).<br />
Das Herauswandern aus dem Geltungsbereich des verweisenden Tarifvertrags – mit<br />
der Folge der Nachwirkung (§ 4 Rn 692 f ).<br />
Schließlich den Arbeitgeberwechsel durch Betriebsübergang, weil die Transformation<br />
der bisherigen tarifl ichen Arbeitsbedingungen in das Arbeitsverhältnis nach<br />
§ 613a Abs. 1 Satz 2 bis 4 BGB (§ 3 Rn 390).<br />
Wollen Tarifvertragsparteien erreichen, daß die Dynamik ihrer Verweisung bis zu<br />
einem bestimmten Zeitpunkt fortwirkt, müssen sie die Kündbarkeit der Verweisungsklausel<br />
einschränken und damit ihre normative Kraft über den Ablauf der übrigen Bestimmungen<br />
ihres Tarifvertrags hinaus aufrechterhalten.<br />
cc) Keine Normativgeltung des Bezugnahmeobjekts erforderlich. Ist die Verweisung<br />
zulässig, bleibt sie auch wirksam, wenn der in Bezug genommene Tarifvertrag zwar<br />
gekündigt ist, aber noch nachwirkt (BAG 30.1.1990 – 1 ABR 98/88 – NZA 1990, 493). Die in<br />
Bezug genommene Tarifnorm wirkt als Teil des verweisenden Tarifvertrags weiter zwingend.<br />
Auch die Verweisung auf einen zum Zeitpunkt der Verweisung nur noch nachwir-<br />
kenden Tarifvertrag ist möglich (<strong>Rieble</strong>, Anm EzA Nr. 135 zu Art. 9 GG Arbeitskampf, S. 15, 30).<br />
Allerdings können die Parteien des verweisenden Tarifvertrages nicht nur auf den jeweiligen<br />
Tarifi nhalt, sondern auch auf die jeweilige Geltungskraft des in Bezug genommenen<br />
Tarifvertrages verweisen wollen – damit das nur nachwirkende Bezugnahmeobjekt<br />
auch für die dem verweisenden Tarifvertrag unterworfenen Arbeitsverhältnisse<br />
dispositiv ist. So kann eine spezifi sche Gleichbehandlung insbesondere des angeschlossenen<br />
Arbeitgebers mit den der tarifgebundenen Arbeitgebern erreicht werden (für einen<br />
sparwirksamen Sonderfall des öffentlichen Dienstes: BAG 13.8.1986 – 4 ABR 2/86 – AP MTV Ang-<br />
DFVLR Nr. 1). Aber das muß hinreichend eindeutig geschehen (BAG 7.5.2008 – 4 AZR<br />
143<br />
36<br />
37<br />
38<br />
39
144<br />
beck-shop.de<br />
§ 1 40 – 44 Inhalt und Form des Tarifvertrages<br />
229/07 – AP Nr. 45 zu § 1 TVG; BAG 29.8.2007 – 4 AZR 561/06 – NZA-RR 2008, 249; weiter Däubler/<br />
Bepler § 4 Rn 915e). Jede ergänzende Tarifauslegung in diese Richtung ist ausgeschlossen.<br />
40 Damit aber wird der verweisende Tarifvertrag nicht zum nachwirkenden – weil er<br />
nicht beendet ist, wenn nicht das Außerkrafttreten des Bezugnahmeobjektes seinerseits<br />
zur aufl ösenden Bedingung erhoben ist. Vielmehr gilt der verweisende Tarifvertrag weiter<br />
– und verzichtet nur zeitweise auf seine zwingende Wirkung; bei der unmittelbaren<br />
aber bewendet es, so daß im Unterschied zur Nachwirkung (§ 4 Rn 708 ff ) auch neu eingestellte<br />
Arbeitnehmer von ihr erfaßt werden.<br />
41 Das BAG will inzwischen generell, daß Anschlußtarifverträge immer dann in das<br />
Nachwirkungsstadium verfallen, wenn der Haupttarifvertrag nur noch nachwirkt<br />
(18.2.2003 – 1 AZR 142/02 – NZA 2003, 866). Das soll nicht etwa dem angeschlossenen Arbeitgeber<br />
Raum für abweichende Abmachungen geben, sondern die Friedenspfl icht suspendieren<br />
– damit die Gewerkschaft zur Mitgliederbindung im angeschlossenen Unternehmen,<br />
das keinen Einfl uß auf die Tarifauseinandersetzung um den in Bezug<br />
genommenen Haupttarif hat, einen »Streik« inszenieren kann. Daß der Tarifvertrag nach<br />
wie vor normativ wirkt, zeigt sich, wenn der Folgehaupttarif abgeschlossen ist – dann<br />
nämlich soll die weiterlaufende dynamische Verweisung selbstredend wieder zur Vollgeltung<br />
erstarken. Das aber zeigt: Der Anschlußtarifvertrag war stets in Kraft und löste<br />
damit stets notwendig auch Friedenspfl icht aus. Die dynamische Bezugnahme mag also<br />
zeitweise auf die zwingende Wirkung verzichten – das ändert aber nichts daran, daß der<br />
verweisende Tarifvertrag selbst »gilt« und deshalb notwendig Friedenspfl icht auslöst –<br />
auf die die Tarifparteien nicht einmal verzichten könnten, wenn sie dies wollten (Rn 1079 ff;<br />
zur Reichweite der Friedenspfl icht bei Unterstützungskämpfen Rn 1038 ff; ablehnend auch Wiedemann/<br />
Thüsing § 1 Rn 882).<br />
42 dd) Kein Anschluß an fremde gemeinsame Einrichtungen. Jede Verweisung auf ein<br />
Tarifwerk fremder Tarifparteien scheitert, wenn in dem in Bezug genommenen Tarifvertrag<br />
eine gemeinsame Einrichtung nach § 4 Abs. 2 vorgesehen ist (zum Scheitern der arbeitsvertraglichen<br />
Bezugnahme § 3 Rn 537 ff ). Die verweisenden Tarifparteien können eine ihnen<br />
fremde gemeinsame Einrichtung nicht gegen den Willen der fremden Tarifparteien<br />
unter eigene Tarifherrschaft stellen. Das schließt es insbesondere aus, daß ein Anschluß-<br />
Haustarifvertrag den Arbeitgeber an eine gemeinsame Einrichtung des Flächentarifs<br />
»anschließt«.<br />
43 Der Anschluß an eine fremde gemeinsame Einrichtung scheitert überdies daran, daß<br />
jene aus Sicht der verweisenden Tarifparteien keine »gemeinsame« ist: § 4 Abs. 2 verlangt,<br />
daß die Tarifparteien, die Tarifnormen nach dieser Vorschrift vereinbaren, gemeinsam<br />
die Einrichtung tragen und ihre Existenz so garantieren (§ 4 Rn 332 ff ). Deshalb können<br />
die Parteien des in Bezug genommenen Tarifvertrages ihre gemeinsame Einrichtung<br />
auch nicht dem »Anschluß durch Verweisungstarifvertrag« öffnen. Denn die verweisenden<br />
Tarifparteien lieferten sich dann dem fremden Einfl uß aus. Das wird deutlich insbesondere<br />
bei der Unterwerfung unter ein fremdes Schiedsgericht nach § 101 Abs. 2<br />
ArbGG (Rn 486). Der »Anschluß« an eine fremde gemeinsame Einrichtung ist nur möglich,<br />
indem die hinzukommenden Tarifparteien dem Tarifvertrag über die gemeinsame<br />
Einrichtung beitreten (zum Tarifvertragsbeitritt Rn 1289) und selbst zum Träger der gemeinsamen<br />
Einrichtung werden.<br />
44 ee) Rechtsfolge unzulässiger Dynamik. Ist die dynamische Verweisung unzulässig<br />
(Rn 25), so ist sie in der Rechtsfolge grundsätzlich als statische Verweisung aufrecht zu<br />
erhalten (vgl. BVerfG 1.3.1978 – 1 BvR 786/70 ua – BVerfGE 47, 285, 317 = NJW 1978, 1475: geltungserhaltende<br />
Reduktion der unzulässigen dynamischen Verweisung eines Bundesgesetzes auf Landesrecht),<br />
denn jede dynamische Verweisung besteht aus zwei Teilen: einer statischen Verweisung<br />
im Zeitpunkt des Abschlusses des verweisenden Tarifvertrags und der Anpassungsanordnung<br />
für den Fall zukünftiger Änderungen des Bezugnahmeobjektes. Grundsätzlich<br />
bezieht sich die Nichtigkeitsanordnung nur auf die Dynamik der Anpassungsanord-
eck-shop.de<br />
A. Tarifvertrag als Normenvertrag 45 – 50 § 1<br />
nung, weshalb der statische Teil bestehenbleiben kann. Gerade weil die Tarifparteien<br />
nach dem eben Gesagten damit rechnen, daß die Dynamik der Bezugnahme durch das<br />
Ende der normativen Tarifgeltung ihrerseits endet und sich in eine statische Verweisung<br />
verändert, haben sie diesen Fall der Statik in ihren Tarifwillen aufgenommen.<br />
Für die unzulässige dynamische Verweisung in einer Betriebsvereinbarung auf den Tarifvertrag<br />
hat das BAG dies bereits entschieden: die dynamische Verweisung wird als<br />
statische aufrechterhalten und bezieht den Tarifvertrag in der Fassung zum Zeitpunkt<br />
des Abschlusses der Betriebsvereinbarung ein (so ausdrücklich BAG 23.6.1992 – 1 ABR 9/92 –<br />
NZA 1993, 229, noch § 3 Rn 555 ff ).<br />
b) Stellvertretung<br />
Das Verbot der Delegation von Tarifmacht, also die Abwehr illegitimer Dritteinfl üsse<br />
begrenzt die Stellvertretung bei Tarifverträgen. Wie beim Abschluß jeden Vertrages<br />
können sich die Tarifvertragsparteien nicht bloß von ihren Organen, sondern auch von<br />
gewillkürten Stellvertretern vertreten lassen (Rn 1325 ff ). Das darf aber nicht in eine Delegation<br />
der Tarifmacht an einen externen Verhandlungsführer ausarten. Deshalb muß die<br />
Letztverantwortung bei den Tarifvertragsparteien liegen:<br />
Die Vollmacht zum Abschluß eines Verbandstarifvertrags darf von vornherein nicht<br />
unwiderrufl ich sein,<br />
der Vertreter muß an die tarifpolitischen Grundentscheidungen der Verbandsorgane<br />
gebunden sein und darf nicht frei von jeder Weisung seine eigene Tarifpolitik verfolgen.<br />
Das folgt auch aus § 165 BGB: Weil die Tariffähigkeit als spezielle tarifvertragsbezogene<br />
Geschäftsfähigkeit (§ 2 Rn 5 ff ) den Tarifparteien und ihrer verbandsinternen Willensbildung<br />
vorbehalten ist, darf sie keinem Fremden anvertraut werden. So gesehen<br />
bedeutet die Tariffähigkeit als spezielle Geschäftsfähigkeit auch ein Delegationsverbot –<br />
wenigstens im Prinzip.<br />
Typischerweise wird die tarifl iche Selbstbestimmung dadurch gesichert, daß die Verhandlungsführer<br />
keine Abschlußvollmacht haben, sondern ihr Verhandlungsergebnis<br />
der Tarifkommission als besonderem satzungsgemäßem Organ zur Billigung vorlegen<br />
müssen.<br />
Die Stellvertretung darf nicht »im Willen« erfolgen. Insbesondere kann ein Verband<br />
seine Tariffähigkeit nicht dergestalt »ausleihen«, daß er einem anderen (tariffähigen oder<br />
nicht tariffähigen) Verband gestattet, Tarifverträge in seinem Namen nach eigenem Willen<br />
abzuschließen. Praktisch wird das wiederum bei Parallelverbänden mit identischen<br />
Mitgliedern. So kann ein Arbeitgeberverband nicht etwa seine Tarifkompetenz an einen<br />
Wirtschaftsverband durchreichen, der dann im Wege der Stellvertretung seine wirtschaftspolitischen<br />
Zielsetzungen in den Tarif hineinverhandelt. Nur Spitzenverbände<br />
dürfen als Vertreter mehrerer Mitgliedsverbände eigenen tarifpolitischen Handlungs-<br />
spielraum wahrnehmen (§ 2 Rn 285).<br />
Das gilt im Kern auch für den Haustarifabschluß. Zwar ist der einzelne Arbeitgeber<br />
kein Verband und nicht kollektiv tariffähig (§ 2 Rn 339), doch setzt die Richtigkeitsgewähr<br />
der bipolaren Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft auch hier voraus, daß der Arbeitgeber<br />
selbst die Tarifverhandlungen verantwortet. Könnte der Arbeitgeber etwa das<br />
Mandat zum Tarifabschluß durch unwiderrufl iche Vollmacht delegieren, so könnte er<br />
damit zugleich die Gegnerabhängigkeit der Gewerkschaft manipulieren, weil sich diese<br />
auf den Entscheider ausrichten muß. Insbesondere darf ein Arbeitgeberverband nicht<br />
von einem Arbeitgeber (insbesondere nicht vom Nichtmitglied) durch unwiderrufl iche<br />
Vollmacht zu einer vom TVG nicht gebilligten Tarifmacht ohne Mitgliedschaft und ohne<br />
Mitwirkung ermächtigt werden.<br />
In der Rechtsfolge führt ein Überschreiten dieser Vollmachtgrenzen richtigerweise<br />
dazu, daß die Vollmacht insgesamt unwirksam ist. Ließe man eine unwiderrufl iche Voll-<br />
145<br />
45<br />
46<br />
47<br />
48<br />
49<br />
50
146<br />
beck-shop.de<br />
§ 1 51 – 56 Inhalt und Form des Tarifvertrages<br />
macht als widerrufl iche bestehen, so wäre die tarifl iche Selbstbestimmung gleichwohl<br />
nicht gewährleistet, wenn der Verband wegen der vermeintlichen Unwiderrufl ichkeit<br />
hiervon keinen Gebrauch macht. Erst die Entscheidung nach § 177 BGB (Rn 1333 ff ) sichert<br />
seine Selbstbestimmung.<br />
c) Schlichtung<br />
51 Wie die Stellvertretung muß sich auch die Schlichtung am Verbot der Fremdbestimmung<br />
messen lassen. Von vornherein unproblematisch ist die nachträgliche Annahme<br />
eines Schlichtungsspruchs durch die Tarifvertragsparteien (etwa Art. X Abs. 1 KRG<br />
Nr. 35). Durch die Annahme erklären die Tarifvertragsparteien, daß sie den Regelungsvorschlag<br />
des Schlichters als angemessene Lösung ihres Tarifkonfl iktes ansehen und die<br />
Regelung inhaltlich selbst und damit eigenverantwortlich tragen wollen.<br />
52 Die Tarifparteien können aber einen unbilligen und damit an sich unverbindlichen<br />
(§ 319 Abs. 1 Satz 1 BGB) Schlichtungsspruch bestätigen (dazu Staudinger/<strong>Rieble</strong> [2009] § 319<br />
Rn 4). Damit nehmen sie wiederum dessen Inhalt in ihren Vertragswillen auf und verschaffen<br />
ihm die vertragliche Richtigkeitsgewähr. Diese Bestätigung kann auch konkludent<br />
erfolgen, indem die Tarifvertragsparteien den Schlichtungsspruch als Tarifvertrag<br />
einvernehmlich durchführen. Vor allem muß die Billigkeitskontrolle zeitlich begrenzt<br />
werden, da sonst Rechtsunsicherheit über die Verbindlichkeit von Tarifnormen entstünde.<br />
Es bietet sich an, analog § 76 Abs. 5 Satz 4 BetrVG für diese Überprüfung eine<br />
Frist von zwei Wochen ab dem Schlichtungsspruch vorzugeben. Lassen die Tarifvertragsparteien<br />
diese Frist verstreichen, empfi nden sie den Schlichtungsspruch nicht als offenbar<br />
unbillig und nehmen ihn damit in ihren Willen auf (vgl. BAG 26.5.1988 – 1 ABR 11/87<br />
– NZA 1989, 26 unter B I 2d bb). Eine Billigkeitskontrolle durch die Normunterworfenen<br />
kommt von vornherein nicht in Betracht.<br />
53 Auch die vorherige Unterwerfung unter einen Schlichtungsspruch ist zulässig. Die<br />
inhaltliche Verantwortung für den so zustandegekommenen Tarifvertrag liegt zwar beim<br />
Schlichter und nicht bei den Tarifvertragsparteien. Dem Schlichter kommt aber vergleichbar<br />
dem Stellvertreter – allerdings für beide Seiten (§ 181 Alt 2 BGB) – die Funktion<br />
eines Vertragsgehilfen zu. Wie der Stellvertreter darf auch der Schlichter allein die<br />
widerstreitenden Interessen der Tarifvertragsparteien im Auge haben. Eine Verpfl ichtung<br />
auf das Gemeinwohl vertrüge sich damit nicht.<br />
54 Als einseitiger Regelung kann einem solchen Schlichtungsspruch keine vertragliche<br />
Richtigkeitsgewähr zukommen. Deshalb kann bei ihm auf die Kontrolle auf offenbare<br />
Unbilligkeit nach § 319 BGB nicht verzichtet werden. Andernfalls bedeutete die unkontrollierte<br />
Ermächtigung des Schlichters zum Tarifabschluß eine Delegation von Tarifmacht<br />
an eine nicht tariffähige Stelle. Erst die Billigkeitskontrolle verschafft den Tarifparteien<br />
den erforderlichen Einfl uß auf den ihnen zuzurechnenden Tarifabschluß.<br />
55 Die Tarifvertragsparteien können sich in Schlichtungsabkommen nicht auf Dauer dem<br />
Schlichterspruch unterwerfen. Vielmehr muß diese Unterwerfung für jeden Tarifkonfl<br />
ikt besonders erklärt werden.<br />
d) Eröffnung betrieblicher Handlungsspielräume<br />
56 Keine Delegation liegt vor, soweit die Tarifpartner, Arbeitgebern, Arbeitnehmern,<br />
dem Betriebsrat oder den Betriebspartnern oder paritätischen Kommissionen Regelungsspielräume<br />
eröffnen (Rn 2001 ff ). Diesen kommt keine normative Regelungskompetenz<br />
zu, die von den Tarifvertragsparteien abzuleiten wäre. Arbeitgeber, Arbeitnehmer<br />
oder Dritte werden lediglich zur schuldrechtlichen, nicht normativ wirkenden<br />
Leistungsbestimmung berufen (§§ 315 ff BGB). Soweit der Tarifvertrag Mitbestimmungsrechte<br />
des Betriebsrats ausdehnt, wird nicht die tarifl iche Normsetzungsbefugnis<br />
auf die Betriebsebene übertragen, sondern die Normsetzungsbefugnis der Betriebspartner<br />
nach dem BetrVG erweitert. Gleiches gilt für tarifl iche Generalklauseln, die dem