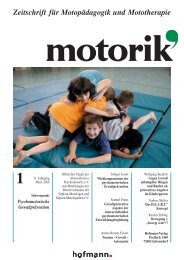Deutscher Sportlehrerverband eV (DSLV) - Hofmann Verlag
Deutscher Sportlehrerverband eV (DSLV) - Hofmann Verlag
Deutscher Sportlehrerverband eV (DSLV) - Hofmann Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erziehender Sportunterricht oder<br />
Erziehung durch Sport-Unterricht?<br />
Anmerkungen zur Kritik an den Richtlinien von Nordrhein-Westfalen<br />
Torsten Schmidt-Millard<br />
Die Sportpädagogik in der Bundesrepublik<br />
befindet sich in einer Dauerkrise,<br />
wenn es um die Frage eines<br />
Konsenses hinsichtlich der Legitimation<br />
des Schulfaches Sport geht.<br />
Diesen Eindruck muss man gewinnen,<br />
wenn man neuere Publikationen<br />
zur Begründung des Faches<br />
sichtet. Dass sich Wissenschaftler<br />
einer „Zunft“ streiten, gehört zum<br />
Geschäft, ist im guten Sinne für den<br />
Fortschritt einer Disziplin hilfreich,<br />
insbesondere wenn es – wie bei der<br />
Sportpädagogik – eine Handlungswissenschaft<br />
ist, die nicht nur Theorie<br />
der Praxis, sondern auch für<br />
die Praxis sein will. Problematisch<br />
wird es allerdings, wenn der wissenschaftliche<br />
Streit zum Orientierungsverlust<br />
auf Seiten der Sportlehrer<br />
führt. Sie müssen sich alleingelassen<br />
fühlen und wenden sich<br />
vielleicht mit Grausen von den<br />
Selbstbespiegelungsritualen im universitären<br />
Elfenbeinturm ab. Das ist<br />
misslich, denn worum es in der Gegenwart<br />
geht, ist nicht weniger als<br />
eine bildungstheoretisch tragfähig<br />
begründete Positionierung des<br />
Faches Sport innerhalb der Umgestaltung<br />
des deutschen Schulwesens<br />
(Stichwort: Ganztagsschule –<br />
„Schule neu denken“). Gerade dazu<br />
aber leisten die Richtlinien für Sport<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen<br />
(MSWWF NRW, 1999) bereits eine<br />
große Hilfe, wie hier gezeigt werden<br />
soll.<br />
Im Folgenden soll versucht werden,<br />
die unterschiedlichen und keineswegs<br />
einheitlichen Argumentationslinien<br />
in der kritischen Auseinandersetzung<br />
mit den Richtlinien<br />
Sport in NRW zu systematisieren<br />
und hinsichtlich ihrer Triftigkeit zu<br />
analysieren. Dabei ist es das An-<br />
liegen, Argumentationsmuster zu<br />
identifizieren, die sich zu Positionen<br />
verdichten. So sind es im Wesentlichen<br />
drei relativ trennscharf<br />
voneinander abzugrenzende Richtungen,<br />
aus denen die in NRW artikulierte<br />
Begründung des Schulsports<br />
kritisiert wird. Es sind dies<br />
a) die traditionalistische Position,<br />
b) die modernistische Position und<br />
c) die bildungstheoretisch-pädagogische<br />
Position. In der Auseinandersetzung<br />
mit diesen Positionen soll<br />
zugleich versucht werden, die Richtlinien<br />
Sport in NRW gegen die Kritiker<br />
in Schutz zu nehmen.<br />
Die traditionalistische<br />
Position – oder:<br />
„The Empire strikes back“<br />
Die Vertreter des „Sportartenprogramms“<br />
konnten sich bereits mit<br />
der „Pragmatischen Fachdidaktik“<br />
(Leitidee: „Handlungsfähigkeit im<br />
Sport“), wie sie den Richtlinien für<br />
Sport in NRW von 1980 zugrunde<br />
lag, kaum wirklich anfreunden.<br />
Denn dort wurde ja im Einleitungsteil<br />
der pädagogischen Grundlegung<br />
bereits eine klare Wendung<br />
von der „Sache Sport“ zu der individuellen<br />
Bedeutsamkeit des Handelns<br />
im Sport gezogen. Da war die<br />
Rede von der individuellen Bedeutsamkeit<br />
eines pädagogisch ausgewählten<br />
Sports, dessen Vermittlung<br />
orientiert an „Sinnperspektiven“<br />
zur Handlungsfähigkeit im Sport<br />
führen sollte. Dass die Richtlinien<br />
von 1980 in ihrer konkreten Umsetzung<br />
bereits auf der Ebene der inhaltlichen<br />
Ausdifferenzierung für<br />
Jahrgangsstufen hinter die eigene<br />
pädagogische Programmatik zurückfielen,<br />
war ein Anlass für die<br />
Revision von 1999.<br />
Nur wenn man diese prinzipielle<br />
Wendung zum Subjekt berücksichtigt,<br />
kann die Schlagkraft des auf<br />
das Sportartenprogramm bezogenen<br />
Diktums von Dietrich Kurz, es<br />
handele sich beim Sportartenprogramm<br />
um eine „Didaktik reduzierter<br />
Ansprüche“ (zitiert nach<br />
Balz, 1992, S. 14), richtig gewürdigt<br />
werden. Balz fügte in seiner Darstellung<br />
des Sportartenprogramms<br />
kommentierend hinzu, diese Kennzeichnung<br />
erfolge, „weil pädagogische<br />
Annahmen über bildende<br />
Wirkungen des Sports gar nicht gehegt<br />
werden“ (ebd.). Dagegen hat<br />
der Hauptvertreter des Sportartenprogramms,<br />
Wolfgang Söll, mit<br />
Recht unterstrichen, dass auch das<br />
Sportartenprogramm einem Bildungsbegriff<br />
folgt. Aber was für ein<br />
Bildungsbegriff wird hier bemüht?<br />
Bildung, so Söll, sei definiert als die<br />
Befähigung „zur Teilhabe an der<br />
kulturellen Umwelt, verstanden als<br />
die ,Kulturgüter‘ in ihrem sozialen<br />
Zusammenhang“ (Söll, 1996, S. 25).<br />
Sport ist ein wesentliches Kulturgut<br />
und ist in den Sportarten repräsentiert.<br />
Folglich sei die Bildungsaufgabe<br />
des Sportunterrichts, durch die<br />
Vermittlung von Sportarten eine<br />
„Einführung in die Bewegungskultur<br />
unserer Gesellschaft“ (S. 38) zu<br />
leisten. Es ist nicht zu übersehen,<br />
dass Söll hier einen materialen Bildungsbegriff<br />
verwendet, es wird<br />
von der Sache her gedacht. Sieht<br />
man sich in der modernen Bildungstheorie<br />
um, so wird die materiale<br />
Begründung heute als obsolet<br />
angesehen. Nicht der Erwerb von<br />
Kulturgütern steht im Vordergrund,<br />
sportunterricht, Schorndorf, 56 (2007), Heft 4 105