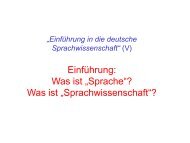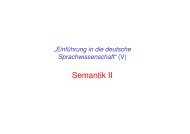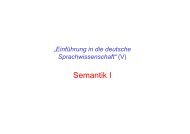„Niederdeutsche Sprachgeschichte“ (V)
„Niederdeutsche Sprachgeschichte“ (V)
„Niederdeutsche Sprachgeschichte“ (V)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>„Niederdeutsche</strong> <strong>Sprachgeschichte“</strong> (V)<br />
Mittelniederdeutsch
Vom Altsächsischen zum Mittelniederdeutschen<br />
Altsächsisch Mittelniederdeutsch<br />
- Ausdehnung des Sprachgebietes<br />
- Verlagerung der Domänen nd. Schriftlichkeit<br />
- Veränderungen im Sprachsystem<br />
- „Hansesprache“ und regionale Schreibtraditionen<br />
- Schriftlichkeit und Mündlichkeit in mnd. Zeit<br />
- Übergang zur frnhd. Schriftsprache<br />
- Gesprochenes Hochdeutsch in Norddeutschland<br />
- Herausbildung norddeutscher Umgangssprachen<br />
(„Missingsch“)<br />
- Niederdeutsche Schriftlichkeit nach 1600
Ausdehnung des niederdeutschen Sprachgebiets<br />
Die Ostkolonisation im Mittelalter (12.-13. Jh.)<br />
Ziele:<br />
- politische Unterwerfung der Slawen<br />
- christliche Missionierung<br />
- wirtschaftliche Nutzbarmachung des Landes östlich der Elbe<br />
Ansiedlung von Bauern aus dem ganzen nd. Altland (Niederrhein,<br />
Westfalen, Ostfalen, Holstein),<br />
außerdem niederländische Kolonisten<br />
Folge: sprachliche Ausgleichsprozesse (Dialektmischungen)<br />
= Entstehung der ostniederdeutschen Mundarten<br />
(Mecklenburgisch, Brandenburgisch, Pommersch, Niederpreußisch)<br />
[Vergleichbar: die Ostkolonisation im mitteldeutschen Raum<br />
� Entstehung des Ostmitteldeutschen als kolonialer Ausgleichssprache]
Ausdehnung des niederdeutschen Sprachgebiets<br />
Ausdehnung nach Norden: im 15. Jh. starker Einfluss des Mnd. auf den<br />
Norden (Skandinavien), Verschiebung des nd. Einflussgebietes etwa<br />
bis zur Höhe Husum - Schleimündung (Holsteinisch).<br />
[In Südschleswig erst seit dem 18. Jh. Sprachwechsel vom Jütischen<br />
zum Niederdeutschen.]<br />
Ausdehnung an der ostfriesischen Küste:<br />
seit dem 14. Jh. Verdrängung der altfries. Schreibsprache durch die<br />
mnd. Schreibsprache,<br />
danach wohl Übernahme des Mnd. als Sprechsprache der höheren<br />
Schichten, später allgemeine Ausbreitung, zeitlich gestaffelt (Jeverland:<br />
16. Jh., Harlingerland: 17./18. Jh., Wangerooge: um 1930): Entstehung<br />
des ostfries. Nd. (mit starken fries. und nl. Interferenzen)<br />
Letztes Reliktgebiet des alten (Ost-)Friesischen: das Saterfriesische<br />
(oldenburgisches Saterland)
Ausdehnung des niederdeutschen Sprachgebiets<br />
Ausdehnung an der nordfriesischen Küste:<br />
keine altnordfries. Textzeugnisse überliefert. Mnd. im 15. Jh. als<br />
Schreibsprache eingeführt<br />
In der Mündlichkeit bis heute Nebeneinander von (nordfries.) Nd. und<br />
Fries. (und Hochdeutsch).
Verlagerung der Domänen niederdeutscher<br />
Schriftlichkeit<br />
Domäne des Altsächsischen (ca. 800-1150): kirchlicher Bereich<br />
(Bibeldichtung, religiöse Gebrauchstexte, nd. Glossen in lat.<br />
Kirchentexten)<br />
nur wenig weltlich-pragmatische Schriftlichkeit<br />
Schreiborte: Klöster (ebenso im Althochdeutschen)<br />
Domänen des Mittelniederdeutschen: weltlicher Bereich<br />
- Rechtswesen: Rechtskodifikationen (Sachsenspiegel, Stadtrechte),<br />
Handwerksstatuten, Urkunden<br />
- Verwaltung: Stadtrechnungen, Ratsprotokolle, auswärtige<br />
Verwaltungskorrepondenz (Missiven), „Stadtbücher“<br />
- Geschichtsschreibung: Chroniken (Sächsische Weltchronik)<br />
- Handel: Texte aus dem Umfeld der Hanse (Handelskorrespondenz:<br />
Briefe, Frachtverträge, Rechnungen, Rechnungsbücher,<br />
Schuldbriefe, Bürgschaften usw.)<br />
- Literatur: v.a. imporierte Stoffe: Versdichtung Reynke de Vos,<br />
Lübecker Totentanz, Dat narren schyp usw.
Einige mittelniederdeutsche Textproben<br />
Typischer Beginn einer mnd. Urkunde (Duisburg, 9. Juni 1379):<br />
Wij Bruyn frentzen Scoilteyt henrich van volden end diderich specht<br />
scepene to duysborg doen kont allen luden dat vur vns komen sijn<br />
Gude halueridders diderick end Iohan oere sone end hebben<br />
bekant dat sye rechtlike verkocht hebben end vercopen ouermids<br />
desen brief twe Morghen lands an eynem stucke gelegen bauen<br />
dusseren by lande Iohans van Sest end by lande peter wetzels<br />
eruen ynghen hoevelde ...<br />
Wir, Bruyn Frentzen, Schultheiß, Henrich van Volden und Diderich<br />
Specht, Schöffen zu Duisburg, tun kund allen Leuten, dass vor uns<br />
getreten sind Gude Halueridders Söhne Diderick und Johan, und<br />
sie haben bekannt, dass sie rechtmäßig verkauft haben und<br />
verkaufen mittels dieses Briefs zwei Morgen Landes, an einem<br />
Grundstück gelegen jenseits von Duissern, bei dem Land Johans<br />
von Sest und dem Land von Peter Wetzels Erben im Hochfeld ...
Herausbildung mnd. Textsorten<br />
- Entwicklung volkssprachlicher Textsortenmuster und Sprachausprägungen<br />
(Varietäten)<br />
- Übernahme von formalen Mustern aus dem Lateinischen, zugleich<br />
allmähliche Emanzipation vom lat. Vorbild<br />
Textsorte „Urkunde“:<br />
Wij ... doen kont allen luden dat vur vns komen sijn ... end hebben bekant<br />
dat ...
Herausbildung mnd. Textsorten<br />
Beispiele für Formelhaftigkeit und Variabilität von Urkunden (am Beispiel<br />
städtischer Urkunden aus Essen (1350-1365, Stadtschreiber 1):<br />
- Cundic si allen luden dey dissen breyf seyt efte horet lesen Dat Ich, herman kerchellen ...<br />
- Cůndic si allen luden dey dissen breyf seyt efte horet lesen Dat Ich ...<br />
- Ich herman beneker eyn burger tho Essende do kůndic allen luden dey desen breyf seyt<br />
efte horet lesen dat Ich ...<br />
- Ich Randolf hake van heerne der Iunghe do kundic allen dey dissen breyf seyt of horet<br />
lesen dat Ich ...<br />
- Allen guden luden dey dissen breyf solen seyn of horen lesen doyn Ich kraft van<br />
Haystveld dey Iůnghe Ritter kund vnd bekenne openbare In dissen seluen breyue daz<br />
Ich ...<br />
- Ich Peter van Wytterinch do kůndich allen luden dey dissen breyf seyt of horet lesen Vnd<br />
bekenne openbare in Dessen breyue Dat ich ...<br />
- Ich Gerd kesken van der leyten Do kůndich vnd kenlich allen luyden dey dissen breyf seyt<br />
horet lesen Dat ich ...<br />
- Ich wenemer vnbetunde Do kůndich vnd kenlich allen luden vnd betuyge openbare in<br />
dessen breyue Dat Ich ...<br />
- Wij Ebdisse vnd dat ghemeyne Capytel des gestichtes van Essende doyt kůndich allen<br />
luyden dey nů sint of dey hir na komen moegen ...
Herausbildung mnd. Textsorten<br />
Formelhafte Wendungen:<br />
- kund sei allen Leuten oder ich tue kund allen Leuten<br />
- die diesen Brief sehen oder lesen hören<br />
- und bekenne öffentlich<br />
- in diesem vorliegenden Brief<br />
- allen Leuten, die nun sind oder nachkommen werden<br />
Sprachliche Merkmale der Rechtssprache:<br />
- Paarformeln: kůndich vnd kenlich, redeliken vnd rechtliken, orber vnd nůt, to<br />
hebbene vnd to besittene, myt hande vnd myt můnde, ghenghe vnd gheue,<br />
als ghewonlich vnd recht is, wedersprake of argelist (alls Beispiele aus einer<br />
Essener Urkunde von 1365)<br />
- juristische Fachterminologie<br />
- subtile Modifikation der Äußerungen durch Gebrauch von Modalpartikeln:<br />
sullen/scholen, mogen, kunnen, willen<br />
- komplexe Syntax<br />
- morphologische Besonderheiten, z.B. häufiger Gebrauch des Konjunktivs<br />
vgl. Beispiel „Sachsenspiegel“
Einige mittelniederdeutsche Textproben<br />
Aus dem Sachsenspiegel (Spegel der Sassen, ostfälisches Frühmnd.,<br />
1220/24) des Eike von Repgow:<br />
§ 1: Jewelk man den man sculdeget mach wol wegeren to antwerdene,<br />
man ne scüldege ine an der sprake, die ime angeboren is,<br />
of he düdesch nicht ne kann vnd sin recht dar to dut.<br />
Scüldeget man ine denne an siner sprake, so mut he antwerden,<br />
oder sin vorspreke von sinent haluen, als it die klegere vnde die<br />
richtere verneme.<br />
Jeder, den man beschuldigt, kann sich weigern zu antworten,<br />
wenn man ihn nicht in seiner Muttersprache beschuldigt,<br />
sofern er nicht Deutsch versteht und dies beschwört.<br />
Beschuldigt man ihn dann in seiner Sprache, so muss er<br />
antworten, oder es muss sein Vorsprecher an seiner Stelle tun,<br />
so dass es der Kläger und der Richter verstehen.
Einige mittelniederdeutsche Textproben<br />
Aus einer Verordnung der Stadt Hamburg (1435):<br />
Vortmer juncfrowen, de vnechte boren sind, de scholen noch myd<br />
smyd noch myd parlen to der kerken gan, men slichter kledere<br />
sunder smyde vnde voder moghen zee brouken.<br />
Ferner Jungfrauen, die unehelich geboren sind, die sollen weder<br />
mit Geschmeide noch mit Perlen zur Kirche gehen, sondern<br />
schlichte Kleider ohne Geschmeide und Pelzwerk sollen sie tragen.
Einige mittelniederdeutsche Textproben<br />
Beispiel für eine formal weniger standardisierte Textsorte: Handelsbrief<br />
Aus der Hansischen Korrespondenz (Brief aus Danzig nach Brügge, 1411):<br />
... Weten schole ghi, dat ic juwe breve wol vornomen hebbe also gy my<br />
schriven, dat gi my senden in schipper Noytte Stevenson 5 Hemborger<br />
tunnen engevers. Disse vorscreven schipper es, Got si ghelovet, myt<br />
leve wol overkomen unde dit gut en is noch nicht opgheschepet ...<br />
Ic will ju hirnest wol allre tidinghe toscriven. Nicht mer dan blivet<br />
ghesunt myt Gode. Grotet alle vrund sere. Ghescreuen 8 daghe na<br />
sunte Peter unde Pauwels dach 1411 in Danczeke ...<br />
... Wissen sollt Ihr, dass ich Eure Briefe wohl verstanden habe, so wie<br />
Ihr mir geschrieben habt, dass Ihr mir gesendet habt mit dem Schiffer<br />
Noytte Stevenson 5 Hamburger Tonnen Ingwer. Dieser vorgenannte<br />
Schiffer ist, Gott sei gelobt, wohlbehalten angekommen und dieses Gut<br />
ist noch nicht gelöscht ...<br />
Ich will Euch hiernächst wohl alle Nachrichten schreiben. Bleibt nur<br />
gesund mit Gott. Grüßet sehr alle Freunde. Geschrieben 8 Tage nach<br />
Sankt Peter und Paul 1411 in Danzig ...
Einige mittelniederdeutsche Textproben<br />
Aus dem Reynke de Vos (Lübecker Druck von 1498):<br />
De konnynck vnde de konnygynne,<br />
Se hopeden beyde vp ghewynne.<br />
Se nemen Reynken vp eynen ort<br />
Vnde spreken: „segget vns nu vort,<br />
Wor gy hebben den groten schat!“<br />
Reynke sprack: „wat hulpe my dat,<br />
Scholde ik nu wysen myn gud<br />
Deme konnynge, de my hangen doet<br />
Vnde lo e uvet den deuen vnde<br />
mordeneren<br />
De myt legende my besweren<br />
Vnde wyllen my vorretlyken myn lyff<br />
affwynnen?“<br />
Der König und die Königin,<br />
Sie hofften beide auf Gewinn.<br />
Die nahmen Reynke beiseite<br />
Und sprachen: „Sagt uns sofort,<br />
Wo Ihr den großen Schatz habt!“<br />
Reynke sprach: „Was hülfe mir das,<br />
Sollte ich nun mein Gut zeigen<br />
Dem König, der mich hängen lassen will<br />
Und den Dieben und Mördern glaubt,<br />
Die mich mit übler Nachrede verleumden<br />
Und mir verräterischerweise das Leben<br />
nehmen wollen?“
Veränderungen im Lautsystem<br />
Altsächsisch Mittelniederdeutsch<br />
Hauptveränderungen:<br />
1) Germanische Akzentkonzentration auf die Stammsilbe<br />
Folge: Abschwächung der vollen Nebensilbenvokale (As.) zum<br />
Schwa-Laut bis hin zum Vokalausfall (Mnd.)<br />
Bsp.: as. fadar - mnd. vader, as. folgon - mnd. volgen<br />
as. herta - mnd. herte ‚Herz‘<br />
as. heritogo - mnd. hertoch<br />
2) Dehnung / „Zerdehnung“ und Senkung der Kurzvokale in offener<br />
Silbe:<br />
Bsp.: as. sunu - mnd. sone ‚Sohn‘<br />
as. nigun - mnd. negen ‚neun‘
Veränderungen im Lautsystem<br />
Umlaut von a, o, u, â, ô, û:<br />
Bsp.: as. mannisk ‚Mensch‘, slutil ‚Schlüssel‘, lâri ‚leer‘, môdi ‚müde‘<br />
> mnd. mensch, slötel, leer, mööt<br />
Ausfall des anlautenden [X]:<br />
Bsp.: as. hladan ‚laden‘, hlûd ‚laut‘, hrêni ‚rein‘, hwat ‚was‘<br />
> mnd. laden, luyd, rein, wat<br />
Wandel von [�, �] zu [d]:<br />
Bsp.: as. thiof ‚Dieb‘, erða ‚Erde‘, dôð ‚Tod‘<br />
> mnd. deef, erde, doot<br />
Wandel von [w] zu [v]:<br />
Bsp.: as. uui ‚wir‘, uuorth ‚Wort‘<br />
> mnd. wi/we, wort<br />
Vereinfachung der Langkonsonanten, z.B. [d:], [g:], [l:] > [d], [g], [l]:<br />
Bsp.: as. roggon [rOg:o:n] > mnd. roggen [rOg@n] ‚Roggen‘<br />
as. allero [al:@ro] > mnd. aller [al�] ‚aller‘
Veränderungen im morphologischen System<br />
Abschwächung der vollen Nebensilbenvokale > Folge: Vereinfachung der<br />
grammatischen Paradigmen<br />
Bsp. aus der Substantivflexion:<br />
Altsächsisch Mittelniederdeutsch<br />
Sg. Nom. herta herte ‚das Herz‘<br />
Gen. herton herten ‚des Herzen‘<br />
Dat. herton herten ‚dem Herzen‘<br />
Akk. herta herte ‚das Herz‘<br />
Pl. Nom. hertun herten ‚die Herzen‘<br />
Gen. hertono herten ‚der Herzen‘<br />
Dat. herton herten ‚den Herzen‘<br />
Akk. hertun herten ‚die Herzen‘<br />
= 4 Ausdrucksformen = 2 Ausdrucksformen<br />
(-o, -on, -un, -ono) (-e, -en)
„Hansesprache“ und regionale Schreibtraditionen<br />
Zum Begriff der Hanse<br />
- ahd. hansa ‚Schar‘, erst später bezogen<br />
auf die norddeutsche Handelsgemeinschaft<br />
- Gründung der Hanse als Kaufmannsvereinigung<br />
im 13. Jh. (Ersterwähnung<br />
in einer engl. Urkunde<br />
von 1267) = Kaufmannshanse<br />
- Zielsetzung: Vertretung der wirtschaftl.<br />
Interessen im Ausland<br />
- ab Mitte des 14. Jh. Hanse als<br />
Städtebund = Städtehanse<br />
Der Danziger Hansekaufmann Georg<br />
Gisze (Bildnis von 1532) in<br />
London<br />
- 14./15. Jh.: ca. 70-80 unmittelbare Hansestädte, im weiteren Sinne etwa 200<br />
Städte im gesamten norddeutschen und ostniederländischen Raum, als loser<br />
Verbund (daher keine genauen Angaben möglich) -> Karte
„Hansesprache“ und regionale Schreibtraditionen<br />
Lübeck als führende nd. Metropole des 14./15. Jhs.<br />
- im 15. Jh.: ca. 25.000 Einwohner (zweitgrößte Stadt des dt. Reiches, nach<br />
Köln)<br />
- günstige Lage zwischen Nord- und Ostsee > Lübeck als Handelszentrum<br />
- Sammelpunkt für die nach Osten ziehenden Siedler > Beteiligung Lübecks an<br />
den dortigen Städtegründungen (Vergabe des lübischen Rechts)<br />
- dadurch auch Lübeck als Ort des Sprachausgleichs (im Mündlichen)<br />
- Zentrum von Kunst und Literatur<br />
- Zentrum des Buchdrucks<br />
-> Lübecks Sprache als „normgebendes Muster“<br />
Domänen der sog. „Hansesprache“:<br />
1) Handel: Schriftstücke zur Regelung der geschäftlichen Angelegenheiten der<br />
Hansekaufleute<br />
2) Recht und Diplomatie: Stadtrechte, Privilegien, Urkunden, Protokolle usw.<br />
3) Literatur: mnd. Drucke v.a. aus Lübecker Offizinen
„Hansesprache“ und regionale Schreibtraditionen<br />
„Hansesprache“ in der wiss. Tradition:<br />
= eine Sprache, die „eine überregionale Einheitlichkeit anstrebte“ (Sanders<br />
1982), eine Art Ausgleichsniederdeutsch<br />
= eine überregionale Verkehrssprache für den gesamten Hanseraum (von<br />
Brügge bis Nowgorod)<br />
= eine Sprache, die während der Blütezeit der Hanse im 14./15. Jh. ihre größte<br />
Einheitlichkeit besaß und die mit dem Untergang der Hanse an Bedeutung<br />
verlor (Stellmachers These von der „Dialektisierung“):<br />
„Macht und Machterstreckung der Hanse finden ihre exakte Widerspiegelung<br />
in Geltung und Geltungsbereich der ‚Hansesprache‘“ (Sanders, a.a.O.)<br />
Traditionelles Periodisierungsmodell:<br />
1. Mnd. Frühzeit<br />
- Schreibdialekte<br />
- starke Nähe zur<br />
Mündlichkeit<br />
2. Klassisches Mnd.<br />
(„Hansesprache“)<br />
- Ausgleichssprache<br />
- tend. überregional<br />
- größere Distanz zur<br />
Mündlichkeit<br />
3. Mnd. Spätzeit<br />
- „Rückfall ins Dialektale“
„Hansesprache“ und regionale Schreibtraditionen<br />
- Beispiele für lautnahe Verschriftungen im Frühmnd.:<br />
Kontraktionen: sir, mitten, upper, thor, mens > in späterer Zeit: Vollformen<br />
siner, mit den, up der, tho der, men des<br />
Lenisierungen: oben- > open<br />
Assimilationen: orkunne, gullen > orkunde, gulden<br />
Ausfall von intervokal. -d-: neer, broer > neder, broder<br />
Dentaleinschub zw. Nasal/Liquid und -er: honder, kelder > honer, keller<br />
Gutturalisierung von -nd-: gesynge, hange > gesinde, hande<br />
Diphthongschreibungen: tau, kou > to, ko<br />
Folge: das Frühmnd. wirkt „moderner“ (weil dialektnäher) als das klassische<br />
Mnd.<br />
- Allerdings: quantitativ relativ wenige „Reflexe der Mündlichkeit“ auch in<br />
frühmnd. Texten (z.B. Fedders 1993, S. 363: „nur in Ausnahmefällen“)
„Hansesprache“ und regionale Schreibtraditionen<br />
- Beispiele für regionale Varianz im Frühmnd.: z.B. wfäl. derde, sal, elk, op, tot<br />
vs. nordnds. drüdde, schall, ider, vp, bit usw.<br />
in der „Hansesprache“: Vereinheitlichung, Verzicht auf regionale Spezifika<br />
(Bsp.: ostfäl. mik/dik, südwestfäl. git ‚ihr‘, ink ‚euch‘ werden nicht<br />
geschrieben; -en wird als Einheitsplural verwendet, trotz dialektalem -et in<br />
den meisten Regionen)<br />
Allerdings: Verzicht auf die regionalen Formen nicht in allen Regionen<br />
in Westfalen meist keine Übernahme der lübischen Schreibungen, sondern<br />
nur interne, regionale Ausgleichsprozesse (Variantenabbau)
„Hansesprache“ und regionale Schreibtraditionen<br />
Einschränkungen zum Begriff „Hansesprache“:<br />
- medial: eine rein geschriebene Varietät<br />
- räumlich: „reinste Ausprägung“ nur in Texten großer Kanzleien, vor allem<br />
Lübecks<br />
- text- und schreiberbezogen: starke Variation selbst in der Lübecker<br />
Kanzleisprache je nach Textsorte und Schreiber<br />
Das heißt:<br />
- Mündlichkeit bleibt dialektal (gesprochene mnd. Ausgleichssprache gilt als<br />
unwahrscheinlich)<br />
- großer Teil der Schriftlichkeit bleibt regional geprägt (schwach oder nicht<br />
beeinflusst durch Lübecker Traditionen)<br />
- Drucke konnten nur von einer Bevölkerungsminderheit rezipiert werden<br />
- die „Lübecker Norm“ selbst ist nicht homogen > als Normvorbild wenig<br />
geeignet<br />
Fazit (R. Peters):<br />
- Hansesprache im Sinne einer Norm als bloßer „Mythos“<br />
- Mnd. im wesentlichen als Oberbegriff für verschiedene regionale Schreibsprachen
Schriftlichkeit und Mündlichkeit in<br />
mittelniederdeutscher Zeit<br />
Schreibsprachen = regional gefärbt<br />
aber:<br />
Schreibsprachen = relativ distanziert zur Mündlichkeit (insbesondere zu den<br />
Basisdialekten)<br />
- meist keine Wiedergabe typisch sprechsprachlicher Merkmale (s.o.)<br />
- keine Wiedergabe (potenziell) sozial stigmatisierter Formen<br />
- keine Wiedergabe bestimmter Lautunterschiede: z.B. keine klare<br />
Umlautkennzeichnung (obwohl es möglich gewesen wäre), häufig keine<br />
Wiedergabe diphthongischer Lautwerte<br />
- Orientierung der Schriftlichkeit eher an der Mündlichkeit der Oberschichten<br />
(Mnd. in diesem Sinne als „Sondersprache einer Minderheit“)<br />
> Mnd. als Schriftsprache ohne wesentlichen Einfluss auf die gesprochenen<br />
Dialekte<br />
> Nd. Dialekten in ihrer lautlichen und grammat. Entwicklung weitgehend<br />
unabhängig von der mnd. Schriftsprache