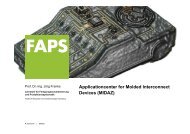Ent - FAPS
Ent - FAPS
Ent - FAPS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
NEWS NEWSProf.<br />
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg<br />
Das Bayerische Technologiezentrum für elektrische Antriebstechnik<br />
E|Drive-Center bezieht den neuen Standort „Auf AEG“<br />
Nach Fertigstellung der Umbauarbeiten in<br />
der neuen Laborhalle kann das mit 9 Mio. €<br />
vom Freistaat Bayern geförderte E|Drive-<br />
Center seine Forschungsarbeit auf insgesamt<br />
2.400 qm Fläche, verteilt auf 2 Stockwerke,<br />
aufnehmen. Im Erdgeschoss ist<br />
Das E|Drive-Center ist in den ehemaligen Produktionshallen derAEG in Nürnberg untergebracht<br />
nach viermonatiger Umbauzeit eine Laborumgebung<br />
neuesten Standards entstanden.<br />
Die großzügige und offene Gestaltung<br />
der Laborhalle gewährt Freiraum für spannende<br />
Forschungsarbeiten entlang der Prozesskette<br />
des Elektromaschinenbaus, die in<br />
den kommenden Monaten sukzessive aufgebaut<br />
wird. Im 1. OG bieten die Räumlichkeiten<br />
der ehemaligen Electrolux-<strong>Ent</strong>wicklungsabteilung<br />
hervorragende Voraussetzungen<br />
für die Forschungsarbeiten des<br />
E|Drive-Centers. Eine umfangreich ausgestattete<br />
Werkstatt mit Maschinen für Zerspanung,<br />
thermisches Fügen und Blechbearbeitung<br />
ermöglicht die Fertigung von Mustern,<br />
Vorrichtungen und Versuchsaufbauten.<br />
Ein Geräusch-Prüfraum mit einer<br />
Grundfläche von 4 x 4 m und einer Höhe<br />
von 3 m wird für schalltechnische Untersu-<br />
Ausgabe 8 | Dezember 2011<br />
chungen rund um die elektrische Antriebstechnik<br />
eingesetzt werden. Für den Aufbau<br />
eines Mess- und Prüfraums sowie einer<br />
Metallografie (siehe Bericht im Innenteil)<br />
steht ein klimatisierter Raum mit einer<br />
2<br />
Grundfläche von rund 120 qm zur Verfü-<br />
gung. Auch für die Lehre und die Durchführung<br />
von Seminaren bieten die neuen<br />
Räumlichkeiten des E|Drive-Centers „Auf<br />
AEG“ hervorragende Voraussetzungen. Mit<br />
den beiden vollklimatisierten Seminarräumen<br />
„Rotor“ (30 Sitzplätze) und „Stator“<br />
(60 Sitzplätze) sowie einen Computer-<br />
Raum mit 25 Arbeitsplätzen ist das E|Drive-<br />
Center hervorragend auf die steigenden Studierendenzahlen<br />
vorbereitet und leistet<br />
einen entscheidenden Beitrag zur Deckung<br />
der Nachfrage nach hochqualifizierten Fachkräften<br />
im Bereich Elektromaschinenbau.<br />
Weiterhin entwickelt die Georg-Simon-Ohm<br />
Hochschule fortschrittliche Antriebskonzepte<br />
als Untermieter im E|Drive<br />
Center<br />
florian.risch@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 0911/5302-9065<br />
Ausgabe 8 | Dezember 2011<br />
<strong>Ent</strong>wärmung leistungselektronischer<br />
Baugruppen<br />
Im Rahmen des von der Bayerischen Forschungsstiftung<br />
geförderten Vorhabens<br />
NEKO (<strong>Ent</strong>wicklung und Prozessierung<br />
eines nichtmetallischen halogenfreien <strong>Ent</strong>wärmungskonzeptes<br />
auf Basis neuartiger<br />
Pastensysteme), Laufzeit: 1.10.2008 bis<br />
30.09.2011, wurde von den Firmen KERA-<br />
FOL, KEW, KOENEN und LOEWE sowie<br />
dem Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> gemeinschaftlich ein<br />
innovatives <strong>Ent</strong>wärmungskonzept er-<br />
Projektkonsortium<br />
forscht. Dieses sieht vor, die an einzelnen<br />
elektronischen Bauelementen entstehende<br />
Verlustleistungswärme über ein polysiloxanbasiertes<br />
Pastensystem an ein Schirmungs-<br />
und Kühlblech eines Flachbildfernsehers<br />
abzuführen. Durch die entwickelte<br />
<strong>Ent</strong>wärmungslösung können einerseits Fertigungs-<br />
und Montagekosten in der Herstellung<br />
der elektronischen Signalbaugruppe<br />
reduziert werden. Andererseits wird durch<br />
die Absenkung des Temperaturniveaus auf<br />
der Baugruppe auch die Lebensdauer temperatursensibler<br />
Bauelemente erhöht, was<br />
sich positiv auf die Zuverlässigkeit der<br />
Gesamtbaugruppe auswirkt.<br />
gerald.gion@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/58058-25<br />
Lehrstuhl für<br />
Fertigungsautomatisierung und<br />
Produktionssystematik<br />
Egerlandstraße 7-9, D-91058 Erlangen<br />
Tel.: 09131/85-28972<br />
Fax: 09131/302528<br />
www.faps.uni-erlangen.de<br />
maria.kreiss@faps.uni-erlangen.de<br />
Administrative Fragen rund um den Newsletter,<br />
u.a. auch den Ein-/Austrag aus der Verteilerliste,<br />
beantwortet Ihnen gerne Frau Maria Kreiss.<br />
1
IMAK und <strong>FAPS</strong> zeigen das Universal Contacting Modul<br />
auf der Productronica 2011<br />
CAD-Modell der UCM-Roboterzelle<br />
Der <strong>FAPS</strong>-Kooperationspartner IMAK im<br />
ZIM-Projekt „ Universal Contacting Modul“<br />
startete das dritte Projektjahr mit der<br />
Demonstration eines Anlagenprototypen<br />
auf der Productronica in München (15.-18.<br />
November). Die dort gezeigte automatisierte<br />
Prüfzelle für elektromechanische<br />
Baugruppen beinhaltet we-<br />
Ausgabe 8 | Dezember 2011<br />
FORSCHUNG Prof.<br />
sentliche Ergebnisse aus der zurückliegenden<br />
Projektlaufzeit. Auf Grundlage<br />
der durch Simulationsstudien gewonnenen<br />
Erkenntnisse wurde die Roboterzelle<br />
für den geplanten Messeauftritt<br />
konstruiert und mit UCM-Prüfgeräten<br />
ausgestattet. Hinsichtlich des automatisierten<br />
Betriebs der Prüfzelle durch einen<br />
Industrieroboter konnten mit Hilfe der<br />
Ablaufsimulation die Auslegung optimiert<br />
und dadurch Randbedingungen zur<br />
Integration des UCM in automatisierte<br />
Produktionsumgebungen definiert werden.<br />
Im laufenden Projekt unterstützt der<br />
Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> den Projektpartner insbesondere<br />
bei der Auswahl steuerungstechnischer<br />
Komponenten für die Zellensteuerung<br />
sowie bei der Integration der<br />
UCM, weiterer Prüfgeräte sowie des<br />
Roboters in die Prototypenanlage. Die<br />
Umsetzung einer flexiblen Steuerungsarchitektur<br />
sowie die Programmierung<br />
beispielhafter Prüfabläufe der Zelle sind<br />
von Seiten des Lehrstuhls <strong>FAPS</strong> als<br />
weitere Schritte vorgesehen. Im Anschluss<br />
an den Messeauftritt wird die<br />
UCM-Zelle am Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> aufgebaut<br />
und steht dort für die Implementierung der<br />
flexiblen Steuerungskomponenten und<br />
Hochstapeln in der Elektronikproduktion:<br />
3D-Integration von ICs mittels Stacked-Die-BGA<br />
Der zunehmende Zwang zur Miniaturisierung<br />
macht den Einsatz von Bauelementen<br />
mit immer höherer Funktionsdichte<br />
notwendig, beispielsweise in<br />
Elektronikmodulen für aktive medizinische<br />
Implantate. Eine hinsichtlich der Gesamtheit<br />
der Eigenschaften optimale<br />
Lösung hierfür sind TFBGA (Thin Fine<br />
Pitch Ball Grid Array) mit dreidimensionaler<br />
Integration mehrerer ICs bzw.<br />
Dies, sogenannte Stacked Die Ball Grid<br />
Array (SDBGA). In Zusammenarbeit mit<br />
der Micro Systems Engineering GmbH<br />
(MSE) in Berg/Ofr. ist zum 01.07.2011 ein<br />
im Technologieförderprogramm „Mikrosystemtechnik<br />
in Bayern“ bewilligtes<br />
Projekt mit einer Laufzeit von 18 Monaten<br />
angelaufen. Die SDBGA-Technologie wird<br />
heute im Wesentlichen für hochvolumige<br />
Anwendungen der Consumer-Elektronik<br />
eingesetzt. Das Packaging erfolgt in der<br />
Regel überwiegend durch Dienstleister in<br />
Typische Aufbauvariante von Stacked Die BGA:<br />
„Reverse Pyramid“<br />
Asien, deren Linien und Prozesse auf<br />
hohen Durchsatz bei geringer Flexibilität<br />
ausgelegt sind. Aus der Übertragung der<br />
Großserienprozesse in eine Produktion<br />
für kleinere und mittlere Stückzahlen<br />
ergeben sich eine Reihe technologischer<br />
und logistischer Probleme, für die aktuell<br />
keine Standardlösungen verfügbar sind<br />
und die daher im Rahmen des geplanten<br />
Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
Versuchsdurchführungen zur Ablaufoptimierung<br />
bis Ende der Projektlaufzeit<br />
im Dezember 2012 zur Verfügung.<br />
Umsetzung für den Messeauftritt des CAD-Modells der<br />
UCM-Roboterzelle<br />
matthias.brossog@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 09131/85-27991<br />
jochen.merhof@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 09131/85-27241<br />
Förderprojekts innovativ gelöst werden<br />
sollen. Herausforderungen innerhalb des<br />
Projektes liegen dabei insbesondere in<br />
der Qualitätssicherung aller eingesetzten<br />
Komponenten bei voller Traceability sowie<br />
der Qualifizierung der beteiligten Prozessschritte<br />
beim Aufbau von SDBGA. Neben<br />
Einzelprozessen, wie beispielsweise dem<br />
Bumping oder dem Drahtbonden, bearbeitet<br />
der Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> insbesondere<br />
Arbeitspakete mit Analysen und Qualifikation<br />
der Materialien bis hin zu Zuverlässigkeitsuntersuchungen<br />
in Umwelt- und<br />
Belastungstests von gefertigten SDBGA-<br />
Prototypen. Ziel des Förderprojektes ist<br />
das Erarbeiten von Expertenwissen, um<br />
eine flexible Fertigung von SDBGA auf<br />
kleinere bis mittlere Stückzahlen<br />
übertragen zu können.<br />
stefan.haerter@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 0911/58058-23<br />
2
Der Lehrstuhl für <strong>FAPS</strong> verfügt seit Oktober<br />
2011 über ein eigenes Labor für<br />
Metallografie. Durch stetiges Anwachsen<br />
des Bedarfs von Schliffbildanalysen und<br />
der Verfügbarkeit neuer, größerer Räumlichkeiten<br />
am künftigen EP-Laborstandort<br />
„Auf AEG“ kann dieser technologische<br />
Ausbau realisiert werden. Vorrangig in der<br />
Aufbau- und Verbindungstechnik im<br />
Rahmen der Elektronikproduktion ist die<br />
Materialografie eine wichtige Säule der<br />
Qualitätssicherung und immens wichtig<br />
bei Einführung und Qualifizierung neuer<br />
Verfahren, Komponenten und Werkstoffe.<br />
Durch den Einsatz vielfältiger Werkstoffkombinationen,<br />
nicht zuletzt auch der<br />
3D-MID Technologie, und geprägt durch<br />
weiter voranschreitende Miniaturisierung<br />
entstand neben der klassischen "Metallografie"<br />
ein spezieller Zweig dieser Analysemethode,<br />
ausgerichtet auf die speziellen<br />
Bedürfnisse der modernen Elektronikproduktion.<br />
Der Mix aus harten<br />
Komponenten wie Keramikbauteilen oder<br />
Siliziumchips und andererseits der<br />
Einsatz neuer Lotlegierungen, Substrate<br />
aus fasergefüllten Kunststoffen oder im<br />
Aerosolverfahren generierter Schal-<br />
Schliffbildaufnahme eines Au-Stud-Bumps mit Ag-<br />
Leitkleber auf einem MID-Bauteil<br />
Erweiterung des Lehrangebotes durch<br />
Roboter-Kinematiksimulation „Robotstudio“<br />
Simulation eines Punktschweißvorganges<br />
Programme zur Simulation von Roboter-<br />
Kinematiken sind im Anlagen- und<br />
Roboterbereich ein unabdingbares<br />
Ausgabe 8 Dezember 2011<br />
FORSCHUNG Prof.<br />
<strong>FAPS</strong> investiert in eigenes Metallografielabor Neue CT-Röntgenanlage<br />
für die Elektronik-Prüfung<br />
tungsträger erfordert spezielle, neue<br />
Vorgehens- und Betrachtungsweisen. Die<br />
Verhinderung von Wärmeentwicklung<br />
beim Einbetten in Epoxidharze stellt<br />
zudem eine neue Herausforderung dar.<br />
<strong>Ent</strong>sprechende Materialien wurden<br />
bereits getestet. Die Ausstattung des<br />
Labors umfasst u.a. ein modernes Schleifund<br />
Poliersystem der Fa. Struers, eine<br />
Präzisionstrennmaschine mit wassergekühltem<br />
Diamantsägeblatt und ein<br />
Vakuum-Imprägniergerät für spaltfreies<br />
Einbetten.<br />
leonhard.maussner@faps.unierlangen.de,<br />
Tel.: 0911/ 58058-23<br />
Werkzeug zur Überprüfung der Durchführbarkeit<br />
von Montage- und Prozessaufgaben,<br />
der Layoutplanung sowie der<br />
Offline-Programmierung von Roboter. Um<br />
den Studenten die wesentlichen Funktionalitäten<br />
dieser Simulationsprogramme<br />
zu vermitteln, bietet der Lehrstuhl ab dem<br />
Sommersemester 2012 einen neuen<br />
Praktikumsversuch im Bereich der<br />
Roboter-Kinematiksimulation an. In<br />
mehreren Übungsblöcken erstellen die<br />
Studenten selbstständig mehrere<br />
einfache Roboterzellen zur Simulation<br />
charakteristischer Einsatzbereiche von<br />
Robotern. Untersucht werden hierbei<br />
Handhabungs-, Punktschweiß- und<br />
Bahnschweißprozesse. Durch die<br />
Bereitstellung von Lizenzen für das<br />
Programm „Robotstudio“ wird der Lehrstuhl<br />
<strong>FAPS</strong> durch die Firma ABB Automation<br />
GmbH; Friedberg unterstützt.<br />
arnd.buschhaus@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 09131/85-27822<br />
Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung<br />
mit der Firma Nordson Dage<br />
Deutschland GmbH hat der Lehrstuhl<br />
<strong>FAPS</strong> sein Anlagenspektrum um eine<br />
neue Röntgenanlage erweitert. Es handelt<br />
sich dabei um das Model XD7600 NT<br />
Diamond FP von Nordson Dage. Die<br />
wartungsfreie geschlossene Röntgenröhre<br />
mit Transmissionstarget bietet<br />
0.1μm Detailerkennung und bis zu 10 W<br />
Leistung. Mit der Röntgenanlage können<br />
bis zu 2.500fache optische Vergrößerungen<br />
realisiert werden. Schrägansichten<br />
sind bis 70° ohne Verlust der<br />
Vergrößerung möglich. Dabei können die<br />
zu untersuchenden Boards eine Größe<br />
von bis zu 736 x 580 mm aufweisen.<br />
Aufnahmen sind mit dem Long Lifetime<br />
Röntgeninspektionssystem XD7600NT Diamond FP<br />
(Bild: Nordson Dage)<br />
CMOS Digitaldetektor bis zu einer<br />
Bildgröße von 3 Megapixeln (1940 x 1530<br />
Pixel) möglich. Dabei erfolgt die<br />
Bildbearbeitung in Echtzeit mit 25 Bildern<br />
pro Sekunde bei voller Auflösung. Neben<br />
der herkömmlichen Röntgenaufnahmetechnik<br />
verfügt die XD7600 NT<br />
Diamond FP auch über die X-Plane<br />
Analysis Technologie. Damit können von<br />
großen Boards einzelne 2D-Schichtbilder<br />
angefertigt und separat betrachtet<br />
werden, ohne die Boards zersägen zu<br />
müssen. Darüber hinaus ist in dem<br />
System auch ein μCT integriert mit den<br />
bekannten Einschränkungen hinsichtlich<br />
der Objektgröße.<br />
denis.kozic@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 0911/ 58058-24<br />
3
Flexible Automatisierungslösungen für die Fertigung<br />
wickeltechnischer Produkte<br />
Die Dissertationsschrift von Andreas<br />
Dobroschke greift zwei wesentliche Technologiefelder<br />
aus dem Bereich der Wickeltechnik<br />
auf: Zum Einen die Fertigung lagegenauer<br />
Wicklungen, die durch ihren hohen<br />
Füllfaktor technologische und wirtschaftliche<br />
Vorteile gegenüber konventionellen<br />
wildgewickelten Spulen bieten, und zum<br />
Anderen den Einsatz von Industrierobotern<br />
in der Wickeltechnik für den Aufbau<br />
schlanker und gleichzeitig flexibler Prozessketten.<br />
Auf Grundlage einer detaillierten<br />
Prozessanalyse wird in der Arbeit der<br />
Nachlaufwinkel als entscheidender Prozessparameter<br />
für die Fertigung lagegenauer<br />
Wicklungen identifiziert. Hierauf aufbauend<br />
wird ein Konzept für einen prozessintegrierten<br />
Regelkreis zur automatisierten<br />
Fertigung lagegenauer Wicklungen entworfen<br />
sowie die für die Umsetzung des<br />
Regelkreiskonzepts in ein Prototypensystem<br />
erforderlichen Schritte abgeleitet. Als<br />
wesentlicher Bestandteil des Nachlaufwinkel-Regelkreises<br />
werden hierzu drei<br />
alternative Sensorsysteme für die prozessbegleitende<br />
Erfassung des Nachlaufwinkels<br />
entwickelt, prototypisch realisiert und<br />
getestet. Durch die Überführung der<br />
Die Dissertationsschrift von Michael Rösch<br />
hat die Optimierung des Schablonendruckprozesses<br />
von Lotpaste in der Elektronikproduktion<br />
zum Ziel, da dieser Prozessschritt<br />
für einen Großteil der Fertigungsfehler<br />
in der Oberflächenmontagetechnik<br />
verantwortlich gemacht wird und damit ein<br />
enormes Optimierungspotenzial aufweist.<br />
Im Rahmen der Arbeit werden verschiedene<br />
Potenziale und Strategien behandelt, die<br />
einen Beitrag zur Reduzierung der<br />
Prozessfehlerraten ermöglichen. Ausgehend<br />
von der Einordnung des Druckprozesses<br />
in die Oberflächenmontagetechnik, in<br />
der neben der Darstellung der einzelnen<br />
Teilprozesse des Druckprozesses auch alle<br />
wesentlichen Einflussgrößen, Qualitätsmerkmale<br />
und Fehlerbilder dargestellt<br />
Ausgabe 8 | Dezember 2011<br />
gewonnenen Ergebnisse in ein prototypisches<br />
Wickelsystem mit Nachlaufwinkel-<br />
Regelkreis sowie die Fertigung von<br />
Versuchsspulen im Rahmen der durchgeführten<br />
Wickelversuche, wird im Weiteren<br />
die Funktionsfähigkeit der entwickelten<br />
Konzepte sowie des aufgebauten Systems<br />
nachgewiesen. Die Kennwerte der gefertigten<br />
Versuchsspulen bestätigten durchweg<br />
die Erwartungen hinsichtlich der<br />
Einhaltung enger elektrischer Toleranzen<br />
aufgrund des lagegenauen Wicklungsaufbaus.<br />
Einen weiteren Schwerpunkt der<br />
Arbeit bildet die <strong>Ent</strong>wicklung und Realisierung<br />
eines robotergestützten Wickelsys-<br />
tems auf Basis eines parallelkinematischen<br />
Industrieroboters, das gegenüber den<br />
kostenintensiven maschinenbaulichen Sonderlösungen<br />
der Wickeltechnik zahlreiche<br />
Vorteile, insbesondere in Hinblick auf<br />
Prozessgestaltung und Anwendungsflexibilität,<br />
bietet. Neben der Bestimmung der<br />
technologischen Kennwerte des Versuchssystems<br />
wird der Nachweis der Funktionsfähigkeit<br />
sowie die Überprüfung der prinzipiellen<br />
Eignung des verwendeten Roboters<br />
für die Fertigung von Wickelprodukten<br />
anhand eines Beispielprodukts durchgeführt.<br />
Abschließend werden alternative<br />
Ansätze zur Programmierung des robotergestützten<br />
Wickelsystems entwickelt, mit<br />
denen eine aufwandsarme Wickelprogrammerstellung<br />
ermöglicht wird.<br />
Dobroschke, A.: Flexible Automatisierungslösungen<br />
für die Fertigung wickeltechnischer<br />
Produkte. Dissertation,<br />
Friedrich-Alexander-<br />
Universität Erlangen-<br />
Nürnberg, 2011, Meisenbach<br />
Verlag, ISBN 978-3-<br />
87525-317-7, Bezug über<br />
Verlag oder Lehrstuhl <strong>FAPS</strong><br />
Potenziale und Strategien zur Optimierung des Schablonendruckprozesses<br />
in der Elektronikproduktion<br />
Schablonendruck<br />
FORSCHUNG Prof.<br />
Prozessbegleitende Erfassung des Nachlaufwinkels<br />
mittels Bilderkennung<br />
werden, erfolgt zunächst eine Analyse von<br />
Qualitätsdaten aus einer realen Serienfertigung.<br />
Die hierbei identifizierten Ausschussraten<br />
für den Schablonendruck, die<br />
bei 1 % bis 8 % liegen, belegen das enorme<br />
Optimierungspotenzial. Ein wesentlicher<br />
Schwerpunkt der Arbeit stellen die<br />
Untersuchungen zu den Eigenschaften und<br />
Potenzialen innovativer Druckschablonentechnologien<br />
dar. Einerseits werden hierbei<br />
Gestaltungsrichtlinien und Prozessempfehlungen<br />
für den Einsatz von Stufenschablonen<br />
erarbeitet. Andererseits werden auch<br />
die Eigenschaften und Potenziale nanobeschichteter<br />
Druckschablonen vorgestellt<br />
und bewertet. Durch den Einsatz einer<br />
nanobeschichteten Druckschablone im<br />
Druckprozess können beispielsweise die<br />
Flächenverhältnisse auf Werte von bis zu<br />
0,36 reduziert werden, woraus sich ein<br />
erhebliches Miniaturisierungspotenzial für<br />
das Schablonendesign ergibt. Zudem weist<br />
eine nanobeschichtete Druckschablone<br />
eine wesentlich geringere Verschmutzungsneigung<br />
auf der Unterseite auf, so<br />
dass die Häufigkeit der druckerintegrierten<br />
Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
Schablonenunterseitenreinigung signifikant<br />
reduziert werden kann. Weitere Schwerpunkte<br />
der Arbeit stellen Untersuchungen<br />
zur Quantifizierung der Auswirkungen<br />
wesentlicher Einflussgrößen auf die<br />
Fertigungsqualität, die Erarbeitung eines<br />
Ansatzes zur Bestimmung von Designrichtlinien<br />
für Druckschablonen sowie die<br />
experimentelle Ermittlung bauelementspezifischer<br />
Prozessfenster für das Lotpastenvolumen<br />
dar. Abschließend wird ein<br />
Konzept zur Beurteilung der Prozessfähigkeit<br />
des Schablonendrucks vorgestellt, mit<br />
dem die Qualitätsleistung eines Druckprozesses<br />
bewertet werden kann.<br />
Rösch, M.: Potenziale und Strategien zur<br />
Optimierung des Schablonendruckprozesses<br />
in der Elektronikproduktion.<br />
Dissertation,<br />
Friedrich-Alexander-<br />
Universität Erlangen-Nürnberg,<br />
2011, Meisenbach<br />
Verlag, ISBN 978-3-87525-<br />
319-1, Bezug über Verlag<br />
oder Lehrstuhl <strong>FAPS</strong>.<br />
4
Audi Production Award an <strong>FAPS</strong>-Team vergeben<br />
Was haben eine direkt angetriebene X-<br />
Schweißzange, Sicherheitsformholz und<br />
eine modulare Weltfabrik gemeinsam?<br />
Sie alle gehören zu den insgesamt 68<br />
eingereichten Konzepten für den<br />
internationalen Audi Production Award<br />
2011. Dieser steht in diesem Jahr unter<br />
dem Motto „Ressourceneffizienz in der<br />
Produktion“. Nach einer Jury-Vorauswahl<br />
trafen die acht besten Teams am 16. und<br />
17. November beim Finalworkshop in<br />
Ingolstadt aufeinander. Bei der abschließenden<br />
Siegerehrung konnte sich<br />
das studentische Team des Lehrstuhls<br />
<strong>FAPS</strong> der Universität Erlangen-Nürnberg<br />
unter der Betreuung von Herrn Sven<br />
Kreitlein für ihr Projekt zur „Evaluierung<br />
der Ressourceneffizienz von Produktionsstätten“<br />
freuen. „Mit Ressourcen<br />
effizient umzugehen, ist ein grundlegendes<br />
Thema in unserem Unternehmen<br />
und fest im Audi Produktionssystem<br />
verankert“, betonte Frank Dreves,<br />
Vorstand Produktion der AUDI AG. „Aber<br />
auch hier schadet der Blick über den<br />
Tellerrand nicht. In den vorgestellten<br />
Konzepten des diesjährigen Audi<br />
Production Award stecken viele neue<br />
Denkansätze und kreative Ideen.“<br />
Elektromotoren recyceln: Neue Quelle für Rohstoffe<br />
Ein Konsortium aus Industrie und<br />
Forschung entwickelt unter der Leitung<br />
von Siemens Recyclinglösungen für<br />
Elektromotoren. Schwerpunkt sind dabei<br />
die Permanentmagnete mit ihrem hohen<br />
Anteil an Metallen der Seltenen Erden, die<br />
für Elektro- und Hybridfahrzeuge benötigt<br />
werden. Die Partner im Projekt MORE<br />
(Motor-Recycling) betrachten die gesamte<br />
Breite der Wertschöpfungskette von der<br />
Auslegung und Fertigung der Motoren<br />
über die Retrologistik bis zum Wiedereinsatz<br />
im Fahrzeug, um eine industriell<br />
einsetzbare Lösung zu entwickeln. Das<br />
Projekt wird vom Bundesforschungsministerium<br />
(BMBF) gefördert. Für<br />
kompakte und leichte Synchronmotoren<br />
werden Permanentmagnete mit einem<br />
Anteil von etwa 30 Prozent an Seltenerdmetallen<br />
benötigt. Der Bedarf an<br />
Seltenen Erden wird in den nächsten<br />
Jahren stark ansteigen – unter anderem<br />
auch aufgrund der Verbreitung von<br />
Elektro- und Hybridfahrzeugen. Da<br />
andererseits bei der Lieferung der<br />
Seltenen Erden im Moment ein chinesisches<br />
Monopol besteht, sind Versorgungsengpässe<br />
zu erwarten. Daher<br />
Ausgabe 8 |Dezember 2011<br />
Gewinnerteam des <strong>FAPS</strong> (von links nach rechts):<br />
Susanne Vernim, Hermann Pausch, André Dorndörfer,<br />
Michael Drechsel, Sven Kreitlein<br />
Dr. Bernd Griesbach, Sprecher des<br />
Vorentwicklungs- und Innovationsteams<br />
der Produktion, zeigte sich bei der<br />
Überreichung des Awards zufrieden: „Die<br />
acht Finalisten haben viel Zeit und Wissen<br />
in ihre Konzepte investiert. Das beweist<br />
die hohe Qualität aller Einreichungen.“ Dr.<br />
Griesbach unterstrich, dass der Wettbewerb<br />
einen internationalen Know-howtransfer<br />
zwischen Wissenschaft und<br />
Industrie ermögliche. Insgesamt 68<br />
Konzepte aus mehr als zehn Ländern<br />
waren 2011 im Award-Rennen vertreten.<br />
In zwei Vorrunden wählte eine Fachjury<br />
fördert das BMBF im Rahmen der<br />
Bekanntmachung „Schlüsseltechnologien<br />
(Bild Siemens AG) Ausrangierte Elektromotoren stellen<br />
eine hervorragende Quelle für wertvolle Materialien dar<br />
für die Elektromobilität“ (STROM) unter<br />
anderem die <strong>Ent</strong>wicklung Ressourcen<br />
schonender Technologien für Elektrofahrzeuge.<br />
Die Forscher verfolgen mit<br />
dem Projekt MORE verschiedeneAnsätze<br />
für das Recycling von Elektromotoren:<br />
Den Ausbau der insgesamt etwa ein Kilogramm<br />
schweren Magnete aus Alt-<br />
Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
um Dr. Griesbach die acht besten Projekte<br />
aus und lud die Teams zum Experten-<br />
Workshop ins Audi-Werk nach Ingolstadt<br />
ein. Die Forscher präsentierten im<br />
direkten Vergleich ihre Ideen und Ansätze,<br />
diskutierten sie mit den Audi-Fachleuten<br />
und spannen die Ideen gemeinsam weiter.<br />
Zahlreiche Fachvorträge zu Themen wie<br />
„Audi balanced mobility“, „Ressourceneffizienz<br />
in der Produktion“ oder „Strategie<br />
in der Audi Produktion“ rundeten den<br />
Workshop ab. Der Audi Production Award<br />
wird seit 2010 jährlich durch eine Fachjury<br />
vergeben. Neben dem Projekt der<br />
University of California und University of<br />
British Columbia wurden dieses Jahr das<br />
Team der Wittenstein AG für das Konzept<br />
mit der besten Umsetzungschance<br />
(„Direkt angetriebene X-Schweißzange“)<br />
sowie das Team der TU Dresden für das<br />
visionärste Konzept („Sicherheitsformholz“)<br />
ausgezeichnet. Der Audi<br />
Production Award bietet Wissenschaftlern<br />
aus der gesamten Welt eine Plattform zum<br />
Wissensaustausch und fördert innovative<br />
Konzeptideen.<br />
sven.kreitlein@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911-5302-9069<br />
motoren, die Reparatur und die anschließende<br />
Wiederverwendung des<br />
Elektromotors oder seiner Komponenten<br />
genauso wie die werk- und rohstoffliche<br />
Wiederverwertung der Magnetmaterialien<br />
und der Seltenerdmetalle durch Wiedergewinnung<br />
aus vorsortiertem und geschreddertem<br />
Material. Außerdem sollen<br />
Konzepte für ein recyclinggerechtes<br />
Motordesign erstellt, sowie Ökoeffizienzanalysen<br />
und Modelle für Stoffkreisläufe<br />
ausgearbeitet werden. Bis 2014 sollen die<br />
Ergebnisse des Förderprojekts vorliegen.<br />
Beteiligt sind Experten von Siemens,<br />
Daimler, Umicore und Vacuumschmelze,<br />
der Universität Erlangen, der Technischen<br />
Universität Clausthal, des Öko-Instituts<br />
Darmstadt und des Fraunhofer-Instituts<br />
für System- und Innovationsforschung.<br />
Die im Projekt entwickelten Technologien<br />
können in Zukunft auch Anwendungen in<br />
anderen Bereichen zugute kommen, in<br />
denen Seltene Erden eine Schlüsselrolle<br />
spielen, wie zum Beispiel in Windkraftanlagen.<br />
tobias.klier@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 0911/5302-9062<br />
5
Ausgabe 8 | Dezember 2011<br />
MITTEILUNGEN Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
MITTEILUNGENProf.<br />
3D-Werkstückträger zur automatisierten Montage von räumlichen<br />
Schaltungsträgern mit Standard-SMT-Produktionsanlagen<br />
Die automatisierte Montage von Bauelementen<br />
auf dreidimensionale spritzgegossene<br />
Schaltungsträger (MID) stellt<br />
nach wie vor eine große Herausforderung<br />
dar. Ein automatisierter Werkstückträger<br />
stellt einen Ansatz dar, räumliche<br />
Schaltungsträger entlang der gesamten<br />
SMT-Prozesskette zu verarbeiten. Im<br />
Rahmen eines Forschungsprojektes<br />
werden unterschiedliche Aufbaukonzepte<br />
des Werkstückträgers hinsichtlich der sich<br />
ergebenden Montageaufgabe (Medienauftrag,<br />
Bestücken und Löten bzw.<br />
Aushärten) entwickelt und bewertet. Auf<br />
Grund der geneigten Prozessflächen<br />
kann es zum Abrutschen der bereits auf<br />
Lotpaste oder Leitkleber bestückten<br />
Bauelemente kommen. Die Analyse der<br />
zugrundeliegenden Mechanismen für das<br />
Verrutschen der Bauelemente ist ein<br />
wesentliches Ziel des Forschungsvorhabens,<br />
um Vorhersagen über die<br />
Notwendigkeit einer Fixierung der Bauelemente<br />
während des Fertigungsprozesses<br />
treffen zu können. Unter<br />
Berücksichtigung der Verarbeitbarkeit in<br />
Standard-Produktionsanlagen sollen<br />
geeignete Fixiersysteme basierend auf<br />
schnell härtenden Klebstoffen und<br />
Leitklebstoffen identifiziert werden. Mit<br />
dem Forschungsvorhaben sollen mögliche<br />
Verfahren für die Montage von<br />
Bauelementen auf dreidimensionalen<br />
MID mit geneigten Flächen in Standard-<br />
Produktionsanlagen in einem Leitfaden<br />
CAD-Toolkette für die Konstruktion von 3D-MID<br />
Die professionelle Konstruktion von 3D-<br />
MID (Molded Interconnect Devices) erfolgt<br />
am Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> seit Kurzem mit<br />
kommerziell verfügbaren CAD-Systemen<br />
von Mentor Graphics und Mecadtron. Für<br />
die Erstellung und Pflege einer <strong>FAPS</strong>eigenen<br />
Bauteilbibliothek wird der Library<br />
Manager von Mentor Graphics und zur<br />
Erzeugung von Schaltplänen das<br />
Programm DxDesigner genutzt. Mit dem<br />
angegliederten EDA (Electronic Design<br />
Automation) System Expedition wird das<br />
temporäre 2D-Layout des Schaltungsträgers<br />
aus den Daten des DxDesigners<br />
generiert. Der Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> hat im<br />
Rahmen des Hochschul-Programms<br />
EUROPRACTICE Software Service, an<br />
dem auch die Universität Erlangen-<br />
Nürnberg beteiligt ist, Zugriff auf diese<br />
umfangreichen Softwarepakete.Das<br />
Werkstückträger für die 3D-Bestückung von MID<br />
bereitgestellt werden. Zudem dient der<br />
Leitfaden als Grundlage für Design-<br />
Richtlinien bei der geometrischen Auslegung<br />
dreidimensionaler Schaltungsträger<br />
für die Verarbeitung in SMT-<br />
Produktionsanlagen. Das AiF-Projekt<br />
„Automatisierte Montage von räumlichen<br />
Schaltungsträgern mit Standard-SMT<br />
Produktionsanlagen“ wird von den Forschungsstellen<br />
Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> und dem<br />
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik<br />
Interaktives 3D-Modell des MID-Demonstrators<br />
in NEXTRA (hier klicken)<br />
Layout der räumlichen elektronischen<br />
Baugruppen wird mit dem 3D-ECAD<br />
(electronic computer-aided-design)<br />
System NEXTRA® der Mecadtron GmbH<br />
und Angewandte Materialforschung<br />
(IFAM) bearbeitet. Das Projekt startete im<br />
August 2011 mit einer Laufzeit von 24<br />
Monaten. Insgesamt 16 Unternehmen<br />
unterstützen das Projekt im projektbegleitenden<br />
Ausschuss und unterstreichen<br />
damit das große Interesse der<br />
Industrie an der Themenstellung.<br />
michael.pfeffer@faps.uni-erlangen.de Tel.: 0911/58058-20<br />
gestaltet. Durch eine direkte Datenintegration<br />
von Expedition in NEXTRA®<br />
wird das vorläufige 2D-Layout in die 3D-<br />
<strong>Ent</strong>wicklungsumgebung übernommen.<br />
Die Platzierung der elektronischen<br />
Bauelemente auf der räumlich strukturierten<br />
Oberfläche sowie das Routing<br />
der elektrischen Verbindungen erfolgt<br />
durch intuitiv zu bedienende Funktionen.<br />
Im Bild ist der Demonstrator des<br />
Lehrstuhls <strong>FAPS</strong> zu sehen: ein PKWähnlicher<br />
Schaltungsträger mit einem<br />
Temperatursensor, einem Mikrocontroller<br />
als Verarbeitungseinheit und einer binären<br />
Anzeige der aktuellen Temperatur.<br />
christian.fischer@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 09131/85-27177<br />
michael.purkott@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 09131/85-27859<br />
6
MITTEILUNGEN Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
MITTEILUNGENProf.<br />
Charakterisierung der Hochfrequenz-<br />
Eigenschaften von LDS-MID<br />
Im August 2011 startete das neue AiF-<br />
Forschungsprojekt „Charakterisierung der<br />
Hochfrequenz-Eigenschaften von LDS-<br />
MID“ in der Forschungsvereinigung 3-D<br />
MID. Das Projekt wird aus öffentlichen Mitteln<br />
des Bundesministeriums für Wirtschaft<br />
und Technologie (BMWi) finanziert. Die<br />
ausführende Forschungsstelle ist das<br />
Institut für Hochfrequenztechnik und Funksysteme<br />
der Leibniz Universität Hannover,<br />
das durch den projektbegleitenden Ausschuss,<br />
bestehend aus den Unternehmen<br />
Antennentechnik ABB Bad Blankenburg<br />
AG, BMW AG, Evonik Degussa GmbH,<br />
HARTING AG, Laser Micronics GmbH,<br />
LPKF Laser & Electronics AG, MID Solutions<br />
GmbH, RFmondial GmbH, Ticona<br />
GmbH, fachlich unterstützt wird. Das Forschungsziel<br />
dieses Vorhabens ist die Charakterisierung<br />
der für Hochfrequenz-<br />
Applikationen relevanten Eigenschaften<br />
der LDS-MID Technologie. Hierbei liegen<br />
die Schwerpunkte auf der Untersuchung<br />
der dielektrischen Eigenschaften der<br />
Spritzgusskunststoffe und des prozessabhängigen<br />
Dämpfungsbelags von Streifenleitungen<br />
über einen Frequenzbereich von<br />
0,1 GHz bis 80 GHz. Im Detail werden die<br />
richtungsabhängige relative Permittivität<br />
und der dielektrische Verlustfaktor ausgewählter<br />
LDS-Substrate charakterisiert. Im<br />
darauf folgenden Schritt wird der Dämpfungsbelag<br />
von typischen HF-Leitungen,<br />
wie beispielsweise der Streifenleitung, für<br />
Ausgabe 8 | Dezember 2011<br />
Bestimmung der Permittivität des LDS-Substrats und der<br />
Leitungsdämpfung<br />
verschiedene Lasereinstellungen und<br />
Metallisierungen gemessen. Letztendlich<br />
sollen aus den Untersuchungen optimale<br />
Einstellungen der Prozessparameter für<br />
minimale Dämpfungsbeläge abgeleitet<br />
werden. Die Ergebnisse werden anschließend<br />
für den <strong>Ent</strong>wurf ausgewählter Antennensysteme<br />
verwendet, um durch Vergleich<br />
der Simulations- und Messergebnisse<br />
die Qualität der ermittelten Materialparameter<br />
zu verifizieren. Die Erkenntnisse<br />
dienen als Grundlage für eine optimierte<br />
Werkstoffauswahl und Prozesseinstellung<br />
und werden in einer Datenbank zusammengefasst.<br />
mueller@3dmid.de<br />
Tel.: 0911/58058-17<br />
Familienfreundliches Arbeitsumfeld am <strong>FAPS</strong><br />
Dem zunehmenden Fachkräftemangel<br />
auf dem Arbeitsmarkt sowie dem Bedarf<br />
an hochqualifizierten Nachwuchswissenschaftlern<br />
begegnet der Lehrstuhl <strong>FAPS</strong><br />
mit einer durchwegs familienfreundlichen<br />
Gestaltung des universitären Arbeitsumfelds.<br />
Hierzu trägt die Ausstattung eines<br />
jeden Wissenschaftlers mit einem<br />
eigenen Laptop ebenso bei wie die<br />
Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung,<br />
so dass bei Bedarf auch Lehrstuhltätigkeiten<br />
von zu Hause aus durchgeführt<br />
werden können. Des Weiteren<br />
wird am <strong>FAPS</strong> ausdrücklich die Inanspruchnahme<br />
von Elternzeit unterstützt,<br />
die bei Interesse des Wissenschaftlers<br />
auch mit einer flexibel gestalteten<br />
Teilzeittätigkeit kombiniert werden kann.<br />
In allen Fällen steht den Lehrstuhlmitarbeitern<br />
ebenso ein vielfältiges<br />
Angebot an Kinderbetreuungsmaßnahmen<br />
und Unterstützungsmöglich-<br />
keiten der Friedrich-Alexander-Universität<br />
Erlangen-Nürnberg zur Verfügung, um die<br />
Vereinbarkeit von Familie und Beruf am<br />
Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> nachhaltig zu sichern.<br />
christian.goth@faps.uni-erlangen.de Tel.:<br />
0911/58058-18<br />
franziska.schaefer@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.:09131/85-27709<br />
3-D MID e.V. beim Intern.<br />
Forum Mechatronik 2011<br />
Mechatronik als interdisziplinäre <strong>Ent</strong>wicklungsmethodik<br />
hat sich weltweit erfolgreich<br />
in der Industrie etabliert. Die synergetische<br />
räumliche und funktionale Integration von<br />
mechanischen, elektrischen und informationstechnischen<br />
Bausteinen zu mechatronischen<br />
Modulen und Systemen birgt Innovationspotenziale<br />
nicht nur im Produkt, sondern<br />
auch in betrieblichen Strukturen und<br />
Abläufen des Produktentstehungsprozesses.<br />
Ziele des siebten Internationalen<br />
Forum Mechatronik 2011 (21.-22. September<br />
in Cham) waren der Technologietransfer<br />
und die Vernetzung von Akteuren aus<br />
Industrie, Dienstleistung, anwendungsorientierter<br />
Forschung und Hochschule. In<br />
der von Prof. Dr.-Ing. Klaus Feldmann<br />
moderierten 3-D MID-Session wurden aktuelle<br />
Themenfelder und Beispiele der MID-<br />
Technologie vorgestellt. In diesem Zusammenhang<br />
berichtete Herr Uwe Remer (2E<br />
mechatronic GmbH & Co. KG) über einen<br />
innovativen, miniaturisierten Strömungssensor,<br />
Herr Karl Görmiller (MID-TRONIC<br />
Wiesauplast GmbH) zeigte Konzepte zur<br />
Bestückung elektronischer Bauteile auf<br />
dreidimensionalen MID-Strukturen auf und<br />
Herr Martin Müller (Lehrstuhl <strong>FAPS</strong>, Universität<br />
Erlangen-Nürnberg) referierte über<br />
die aktuelle Markt- und Technologieanalyse<br />
für MID. Vortragsbegleitend gab es eine<br />
Ausstellung verschiedener Unternehmen<br />
und Organisationen. Dabei präsentierte<br />
sich die Forschungsvereinigung 3-D MID<br />
mit ihrem Netzwerk aus über 80 Unternehmen<br />
und Instituten und informierte über die<br />
Attraktivität und Vorzüge einer Mitgliedschaft.<br />
martin.mueller@faps.uni-erlangen.de Tel.: 0911/58058-17<br />
Termine 3D-MID e.V.<br />
23. Mitgliederversammlung der<br />
Forschungsvereinigung 3D-MID e.V.<br />
am 14.03.2012,<br />
LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen<br />
www.3dmid.de<br />
10. Internationaler Kongress<br />
Molded Interconnect Devices<br />
am 19.-20.09.2012<br />
im Kongresszentrum Fürth<br />
www.3dmid.de<br />
7
<strong>FAPS</strong>-Kulturtag durchs Nürnberger Land<br />
Der alljährliche Betriebsausflug führte alle<br />
Mitarbeiter des Lehrstuhls <strong>FAPS</strong> dieses<br />
Jahr nach Schnaittach und Lauf a.d.<br />
Pegnitz. Nach einer Besichtigung der<br />
Festung Rothenberg, verbunden mit einer<br />
geschichtlichen Führung durch die<br />
Burgruinen und in die Katakomben,<br />
erlebte die Gruppe einen erstaunlichen<br />
Ausblick vom Rothenberg über das<br />
Besichtigung im Industriemuseum Lauf<br />
INTERN<br />
Nürnberger Land. Nach dem kräftezehrenden<br />
Aufstieg zur Festung und dem<br />
anschließenden Abstieg nach der<br />
Führung kehrte die Gruppe hungrig zum<br />
Mittagessen am Rothenberg ein. Frisch<br />
gestärkt machte sich der Lehrstuhl auf<br />
nach Lauf. Dort wartete schon das<br />
nächste kulturelle Ereignis, eine Zeitreise<br />
in die frühzeitige Industriegeschichte von<br />
Lauf. Eine interessante und detailierte<br />
Erste englischsprachige <strong>FAPS</strong>-Vorlesung<br />
„Integrated Production Systems“ gestartet<br />
Zum Start des Wintersemesters 2011/-<br />
2012 startete der Lehrstuhl seine erste<br />
englischsprachige Vorlesung „Integrated<br />
Production Systems“ im Rahmen des<br />
neuen Studiengangs „Integrated Production<br />
Engineering and Management“. Im<br />
Bereich schlanker Produktionsmethoden<br />
mit internationalem Fokus existieren<br />
bisher nur wenige Ausbildungskonzepte<br />
für Studenten. Diese sind allerdings<br />
essenziell, um Jungingenieuren in einer<br />
globalisierten Wirtschaftswelt die<br />
notwendigen Vorkenntnisse auf dem Weg<br />
ins Berufsleben zu vermitteln, die für eine<br />
erfolgreiche Einführung effizienter<br />
Produktionsprozesse notwendig sind.<br />
Inhalte der Vorlesung sind die Ziele,<br />
Prinzipien, Methoden und Werkzeuge<br />
ganzheitlicher Produktionssysteme.<br />
Diese Ansätze werden für den Bereich der<br />
Produktion und Logistik, aber auch für<br />
indirekte Bereiche wie beispielsweise<br />
Prozesse in der Administration und<br />
Führung in der Festung Rothenberg<br />
Führung durch das Industriemuseum gab<br />
allen <strong>FAPS</strong>´lern einen Einblick in dieArbeit<br />
und das Leben im 19. Jahrhundert.<br />
Abgerundet wurde der Kulturtag durch<br />
einen Einblick in das Leben der 70er Jahre<br />
mit all seinen fast schon vergessenen<br />
Vorzügen. Zum Abschluss wurde der<br />
Ausflug mit gut fränkischer Küche des<br />
Gasthofes „Zur Post“ gekürt.<br />
rene.schramm@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/58058-14<br />
matthaeus.brela@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 09131/85-28871<br />
<strong>Ent</strong>wicklung aufgezeigt. In den Übungen<br />
werden praxisorientiert an Montagezellen<br />
Themen wie Wertstromanalyse und<br />
Wertstromdesign, Arbeitsplatzoptimierung,<br />
OEE-Analyse und SMED<br />
adressiert. Durch die fachliche Synthese<br />
von theoretischen Grundlagen, Praxisübungen<br />
und Inhalten aus der industriellen<br />
Praxis erhalten die Studenten einen<br />
Überblick zum Thema „Ganzheitliche<br />
Produktionssysteme“. Dabei soll durch die<br />
praxisorientierte Darstellung schlanker<br />
Organisationsprinzipien, Abläufe und<br />
Prozesse in einem Produktionsbetrieb<br />
und die praktische Umsetzung im<br />
Rahmen von Planspielen eine Orientierung<br />
und Vorbereitung auf den<br />
Berufseinstieg erreicht werden.<br />
florian.risch@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/5302-9065<br />
sven.kreitlein@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/5302-9069<br />
Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
Automatisierung in der<br />
Medizintechnik<br />
Am 3. November fand am Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung<br />
und Produktionssytematik<br />
an der Universität Erlangen-<br />
Nürnberg ein neu entwickeltes Seminar<br />
zur Medizintechnik statt. Mitveranstalter<br />
waren der Cluster Mechatronik &Automation<br />
und das Automation Valley Nordbayern.<br />
„Was kann sich die Medizin aus der Automatisierungstechnik<br />
abschauen? Organisationsprinzipien,<br />
Workflowanalysen und<br />
-opptimierung, Materialflussstrukturen, Logistiklösungen,<br />
Einsatz von Robotik, Kooperation<br />
Mensch-Maschine. All das ist<br />
hier bei uns geboten“, so der Hausherr der<br />
Seminarreihe, Prof. Dr. Jörg Franke vom<br />
Lehrstuhl <strong>FAPS</strong>. Einer der spannenden<br />
Fachvorträge zum Thema Organisationsprinzipien<br />
kam von Dr. Möhlmann, McKinsey<br />
& Co: „Lassen Sie uns auf die Fakten<br />
sehen: Im internationalen Vergleich sind<br />
die Kosten pro Patient, Behandlung und<br />
Jahr in Deutschland mit unter 3.000 Euro<br />
sehr niedrig. Die USA liegt weit über 100%<br />
darüber. So gesehen optimieren wir auf<br />
einem guten Niveau. Wir müssen aber<br />
trotzdem in Deutschland noch effektiver<br />
und kostengünstiger werden, denn uns laufen<br />
die Kosten sonst davon“, so Dr. Möhlmann.<br />
„Dabei ist die Materialausstattung<br />
der höchste Kostenfehler, nicht das Personal.“<br />
Prof. Dr. med. Jürgen Schüttler, der<br />
Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität<br />
Erlangen bestätigte diese Aussage:<br />
„Wenn wir über Einsparungen reden,<br />
dann müssen wir auch über die Strukturen<br />
oder die Arzneimitteltherapie reden und<br />
nicht nur über die Prozesse.“Anschließend<br />
zeigten die weiteren Referenten, wo man<br />
bei weiterer Effizienzsteigerung im medizinischen<br />
Sektor erfolgreich ansetzt. Christian<br />
Ziegler vom Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> referierte<br />
über effiziente und sichere klinische Workflows<br />
am Beispiel der Strahlentherapie.<br />
Sein Fazit:Ablaufsimulation eignet sich insbesondere<br />
in der Großgerätemedizin zur<br />
quantifizierten Bewertung alternativer<br />
Workflows. Und neue Sensortechnologien<br />
bieten ein hohes Potential zur Realisierung<br />
eines sicheren und effizienten Workflows.<br />
Es folgten spannende Beispiele von Automatisierungstechnik<br />
über den Einsatz<br />
unterschiedlicher Medizinroboter, 3D-<br />
Bildgebungs- und Sensorsystemen sowie<br />
eine Laborpräsentation am Lehrstuhl.<br />
Dabei bestätigte sich übergreifend das Motto:<br />
„Innovationen entstehen an den<br />
Schnittstellen“.<br />
christian.ziegler@faps.uni-erlangen.de<br />
Ausgabe 8 | Dezember 2011 8
INTERN<br />
Das Department MB konnte 2011 rund 1300<br />
Erstsemester begrüßen<br />
<strong>Ent</strong>wicklung der Erst-Semester-Zahlen am Department Maschinenbau<br />
Intern. Production Engineering & Management<br />
Mechatronik<br />
Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Maschinenbau<br />
66<br />
101<br />
30<br />
66 71<br />
WS<br />
99/00<br />
WS<br />
00/01<br />
242<br />
81<br />
54 51<br />
107 108<br />
WS<br />
01/02<br />
296<br />
137<br />
WS<br />
02/03<br />
Der doppelte Abiturjahrgang hat erfreuliche<br />
Auswirkungen auf die Studienanfängerzahlen<br />
2011 in den Ingenieurwissenschaften<br />
am Department Maschinenbau.<br />
Um dem Nachwuchs trotz<br />
des Ansturms den Start ins Studium zu<br />
erleichtern, war dazu in diesem Jahr bei<br />
vielen Studiengängen auch ein Beginn<br />
zum Sommersemester möglich. Als<br />
Ergebnis konnte insbesondere der Maschinenbau<br />
das Interesse angehender<br />
Ingenieurinnen und Ingenieure wecken.<br />
Im Sommer- und im Wintersemester<br />
haben sich je rund 300 Studierende für<br />
Elektrofahrzeuge sind ein Wachstumsmarkt,<br />
dessen <strong>Ent</strong>wicklung stark von<br />
der Leistungsfähigkeit der Batterien und<br />
nicht zuletzt der zugrunde liegenden<br />
Aufladetechnologie abhängt. Die Variante<br />
des konduktiven Ladens, also dem<br />
traditionellen Laden via Kabel und<br />
Steckdose, ist nur eine Option. Eine<br />
weitere Technologie mit Potenzial ist die<br />
Möglichkeit der kontaktlosen Energieübertragung.<br />
Zusammen mit der Puls<br />
Marktforschung wurde eine Studie zu den<br />
Marktpotenzialen der induktiven Energieübertragung<br />
in Elektrofahrzeuge<br />
Ausgabe 8 | Dezember 2011<br />
393<br />
174<br />
61<br />
64<br />
158 128<br />
WS<br />
03/04<br />
329<br />
137<br />
WS<br />
04/05<br />
das Studium an der Technischen Fakultät<br />
entschieden. Auch die Anfängerzahl des<br />
im WS 10/11 neu eingeführten Studiengangs<br />
„International Production<br />
Engineering and Management“ legte noch<br />
einmal kräftig zu und hat sogar die 400er<br />
Marke überschritten. Bei den vom<br />
Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> mitgestalteten Studienrichtungen<br />
sind damit insgesamt über<br />
3400 Studierende mit dem angestrebten<br />
Abschluss Master bzw. Bachelor<br />
eingeschrieben.<br />
johannes.hoerber@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/58058-15<br />
Studie „Marktpotenziale zur induktiven<br />
Energieübertragung in Elektrofahrzeuge“<br />
435<br />
155<br />
85<br />
195<br />
WS<br />
05/06<br />
445<br />
358<br />
136<br />
49<br />
69 70<br />
240 239<br />
WS<br />
06/07<br />
WS<br />
07/08<br />
500<br />
69<br />
144<br />
185<br />
WS<br />
08/09<br />
332<br />
160<br />
121<br />
175<br />
182<br />
erstellt. Darin werden mögliche Vor- und<br />
Nachteile, Risiken sowie erforderliche<br />
technische Neuerungen, die eine<br />
Etablierung von induktivem Laden<br />
beschleunigen können, erörtert und die<br />
möglichen Anwendungsbereiche PKW,<br />
öffentlicher Personennahverkehr, Taxi,<br />
Carsharing und Hafenlogistik genauer<br />
betrachtet. Dazu wurden 14 Experteninterviews<br />
durchgeführt und 1.001<br />
Autofahrer befragt.<br />
florian.risch@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 0911/5302-9065<br />
51<br />
WS<br />
09/10<br />
594<br />
180<br />
57<br />
WS<br />
10/11<br />
555<br />
202<br />
49<br />
719<br />
194<br />
34<br />
205<br />
304 286<br />
SS 11 WS<br />
11/12<br />
Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
Neu am <strong>FAPS</strong><br />
Benjamin Bickel (Dipl.-Ing.)<br />
Seit September wird das<br />
Team des E|Drive-Centers<br />
durch Benjamin Bickel unterstützt.<br />
Mit seiner Diplomarbeit<br />
zum Thema „Konzeption<br />
und Realisierung einer Montagevorrichtung<br />
zur Fertigung<br />
des Stators einer Synchronmaschine<br />
für Hybridfahrzeuge“ hat er das Mechatronik-Studium<br />
an der Universität Erlangen<br />
erfolgreich abgeschlossen. Auch zukünftig<br />
wird er sich mit den Fertigungsverfahren<br />
von elektrischen Antrieben befassen, insbesondere<br />
flexible Produktionssysteme<br />
zur automatisierten Bewicklung von Traktionsantrieben<br />
zählen zu seinem Arbeitsgebiet.<br />
benjamin.bickel@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 0911/5302-9068<br />
Sebastian Reitelshöfer (Dipl.-Ing.)<br />
Sebastian Reitelshöfer<br />
arbeitet seit dem 01.10.2011<br />
am <strong>FAPS</strong> als neues Teammitglied<br />
der Forschungsgruppe<br />
Handhabungs- und<br />
Montagetechnik. Er schloss<br />
sein Mechatronikstudium an<br />
der Universität Erlangen-Nürnberg mit seiner<br />
Diplomarbeit zu dem Thema „<strong>Ent</strong>wicklung<br />
eines Stereokamerasystems zur<br />
Posemessung an einem Strahlentherapiegerät<br />
mit sechs Freiheitsgraden“ ab.<br />
Zukünftig wird er sich vor allem mit Bahnplanungsverfahren<br />
für unterschiedliche<br />
Kinematiken und neuen Interaktionsmöglichkeiten<br />
mit Robotern in medizinischen<br />
Anwendungsszenarien befassen.<br />
sebastian.reitelshoefer@faps.unierlangen.de,<br />
Tel.: 09131/85-27709<br />
Xu Zhang (M.Sc.)<br />
Seit dem 01.09.2011 arbeitet<br />
Xu Zhang am Lehrstuhl<br />
<strong>FAPS</strong> in der Gruppe Handhabungs-<br />
und Montagetechnik.<br />
Er schloss 2011 sein<br />
Maschinenbaustudium an<br />
der Xi'an Jiaotong Universität<br />
(China) mit seiner Masterarbeit zum<br />
Thema „Design und Implementierung<br />
eines intelligenten Video-Überwachungssystems<br />
für große Innenräume“ ab.<br />
Herr Zhang wird sich zukünftig insbesondere<br />
mit Themen aus dem Bereich „Fahrerlose<br />
Transportsysteme“ befassen.<br />
xu.zhang@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 09131/85-28871<br />
9
Ausgewählte neue Veröffentlichungen am <strong>FAPS</strong><br />
Franke, J.; Merhof, J.; Lebrecht, H.; Michl, M.;<br />
Koitzsch, M.<br />
Using DES for ROI Calculations within Semiconductor<br />
Manufacturing<br />
Proceedings: AEC/APC Symposium Asia, Tokio, 2011<br />
Franke, J.; Lütteke, F.<br />
Kostengünstige Transportfahrzeuge in der Produktion,<br />
Kleinskalig, vielseitig, autonom<br />
Hebezeuge Fördermittel, 2011, H. 9, S.476-479<br />
Franke, J.; Michl, M.; Fischer, C.; Merhof, J.;<br />
Comprehensive Support of Technical Diagnosis by<br />
Means of Web Technologies<br />
Proceedings:7th International Conference on Digital<br />
<strong>Ent</strong>erprise Technology, Athen, 2011<br />
Franke, J.; Michl, M.; Rösch, M.<br />
Optimierung des Schablonendruckprozesses unter<br />
Verwendung innovativer Inspektionsverfahren und wissensbasierter<br />
Diagnosesysteme<br />
In Tagungsband: Internationales Forum Mechatronik,<br />
Cham, 2011<br />
Franke, J.; Merhof, J.; Lebrecht, H.; Michl, M.<br />
DES within Semiconductor Manufacturing<br />
Abstracts Proceedings "New Trends in<br />
<strong>FAPS</strong> drives mechatronic!<br />
Das diesjährige Alumnitreffen des <strong>FAPS</strong> am<br />
07.10.2011 stand ganz im Zeichen des<br />
Aufbaus der neuen Forschungsgruppe<br />
E|Drive. Unter dem Leitmotiv „<strong>FAPS</strong> drives<br />
mechatronic!“ fand die Veranstaltung in den<br />
neuen Räumlichkeiten des Bayerischen<br />
Technologiezentrums für elektrische<br />
Antriebstechnik E|Drive-Center auf dem<br />
ehemaligen AEG Gelände im Herzen<br />
Nürnbergs statt. Die Gäste hatten die<br />
Gelegenheit, die neue Forschungsstätte zu<br />
Ausgabe 8 | Dezember 2011<br />
INTERN<br />
Micro/Nanotechnology", Slovakei, 2011, S. 176-177,<br />
Proceedings: ISMI Manufacturing Week, Austin, 2011<br />
Franke, J.; Rösch, M.; Läntzsch, C.; Kleemann, G.<br />
Eigenschaften und Potentiale nanobeschichteter<br />
Druckschablonen zur Optimierung des Schablonendruckprozesses<br />
PLUS, Produktion von Leiterplatten und Systemen,<br />
Jg. 109, 2011, H.05, S. 1095-1104<br />
„Best Paper of Session“ IMAPS 2011:<br />
Dohle, R.; Härter, S.; Goßler, J.; Franke, J.,<br />
Accelerated Life Tests of Flip-Chips with Solder<br />
Bumps Down to 30 μm Diameter,<br />
Proceedings of the 44th International Symposium on<br />
Microelectronics (IMAPS 2011), Long Beach, 2011.<br />
Best Student Paper Award:<br />
Reinhardt, A.; Franke, J.; Goth, C.<br />
Reliability of Micromechatronic Systems with Chip on<br />
Molded Interconnected Devices and Flexible<br />
Substrates,<br />
In Tagungsband: Electronics Packaging Technology<br />
Conference (EPTC 2010) in Singapur<br />
erleben. Im Rahmen einer Vortragsreihe,<br />
gestützt durch Forschung und Industrie,<br />
wurden aktuelle Themen zur <strong>Ent</strong>wicklung<br />
des Lehrstuhls <strong>FAPS</strong> in den Bereichen<br />
Medizin und Mechatronik diskutiert.<br />
Darüber hinaus boten Themen wie<br />
Rüstoptimierung im Bereich der spangebenden<br />
Fertigung sowie Beiträge zum<br />
Thema Patent- und Markenwesen dem<br />
interessierten Fachpublikum die Gelegenheit,<br />
sich über Ihren Erfahrungsschatz<br />
hinaus auszutauschen. Neben dem<br />
anschließenden Get Together, nutzten die<br />
Gäste die Chance, die neuen technologischen<br />
Einrichtungen und <strong>Ent</strong>wicklungen<br />
des E|Drive-Centers wie z.B. das induktiv<br />
geladene E-Kart oder das Segway im<br />
Betrieb zu testen und regelrecht am<br />
eigenen Leib zu erfahren.<br />
sven.kreitlein@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 0911/5302-9069<br />
CALL FOR PAPERS<br />
2nd International Electric Drives<br />
Production Conference<br />
October 16th-17th, 2012, Nuremberg,<br />
Germany<br />
www.edpc.eu<br />
alexander.kuehl@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/5302-9066<br />
TERMINE<br />
Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke<br />
Der Lehrstuhl <strong>FAPS</strong> veranstaltet<br />
folgende Seminare:<br />
● Rechnergestützte <strong>Ent</strong>wicklung<br />
mechatronischer Produkte<br />
am 07.03.2012 in Erlangen<br />
christian.fischer@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 09131/85-27177<br />
● Fachseminar zur MID-Technik<br />
am 20.06.2012 in Erlangen,<br />
martin.mueller@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/58058-17<br />
● Mensch-Maschine-Interaktion<br />
am 18.04.2012 in Erlangen<br />
christina.ramer@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 09131/85-27711<br />
MID-Workshop zu zukünftigen<br />
Forschungsthemen<br />
am 09.02.2012 bei der BMW AG<br />
München<br />
martin.mueller@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/58058-17<br />
<strong>FAPS</strong>-Spring School 2012; Engineering<br />
komplexer technischer Systeme<br />
am 15.-17.03.2012 in Behringersmühle,<br />
Sigrun Holzinger, 0911/58058-55<br />
info@faps-tt.de<br />
<strong>FAPS</strong> Spring Summit 2012<br />
am 21.03-25.03.2012 im Hotel „BlueBay<br />
Galatzó“ in Calvià auf Mallorca<br />
benjamin.bickel@faps.uni-erlangen.de,<br />
Tel.: 0911/5302-9068<br />
SMT 2012<br />
am 08.-10.05.2012 in Nürnberg,<br />
Messezentrum<br />
martin.mueller@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/58058-17<br />
<strong>FAPS</strong> -Summer School 2012; Soft Skills<br />
am 26.-28.07.2012 in Behringsmühle,<br />
Sigrun Holzinger, 0911/58058-55<br />
info@faps-tt.de<br />
2nd International Conference and<br />
Exhibition ELECTRIC DRIVES<br />
PRODUCTION<br />
16.10. - 17.10.2012 in Nürnberg<br />
alexander.kuehl@faps.uni-erlangen.de<br />
Tel.: 0911/5302-9066<br />
10