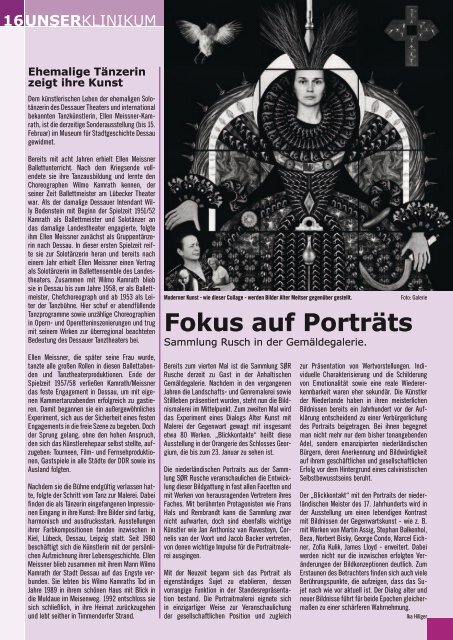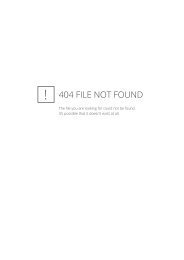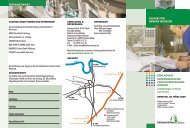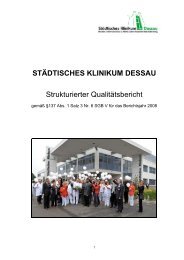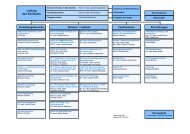UNSERKliniKum - Städtisches Klinikum Dessau
UNSERKliniKum - Städtisches Klinikum Dessau
UNSERKliniKum - Städtisches Klinikum Dessau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
16UnserKliniKum<br />
Kulturtipps Kulturtipps UnserKliniKum17<br />
Ehemalige Tänzerin<br />
zeigt ihre Kunst<br />
Dem künstlerischen Leben der ehemaligen Solotänzerin<br />
des <strong>Dessau</strong>er Theaters und international<br />
bekannten Tanzkünstlerin, Ellen Meissner-Kamrath,<br />
ist die derzeitige Sonderausstellung (bis 15.<br />
Februar) im Museum für Stadtgeschichte <strong>Dessau</strong><br />
gewidmet.<br />
Bereits mit acht Jahren erhielt Ellen Meissner<br />
Ballettunterricht. Nach dem Kriegsende vollendete<br />
sie ihre Tanzausbildung und lernte den<br />
Choreographen Wilmo Kamrath kennen, der<br />
seiner Zeit Ballettmeister am Lübecker Theater<br />
war. Als der damalige <strong>Dessau</strong>er Intendant Willy<br />
Bodenstein mit Beginn der Spielzeit 1951/52<br />
Kamrath als Ballettmeister und Solotänzer an<br />
das damalige Landestheater engagierte, folgte<br />
ihm Ellen Meissner zunächst als Gruppentänzerin<br />
nach <strong>Dessau</strong>. In dieser ersten Spielzeit reifte<br />
sie zur Solotänzerin heran und bereits nach<br />
einem Jahr erhielt Ellen Meissner einen Vertrag<br />
als Solotänzerin im Ballettensemble des Landestheaters.<br />
Zusammen mit Wilmo Kamrath blieb<br />
sie in <strong>Dessau</strong> bis zum Jahre 1958, er als Ballettmeister,<br />
Chefchoreograph und ab 1953 als Leiter<br />
der Tanzbühne. Hier schuf er abendfüllende<br />
Tanzprogramme sowie unzählige Choreographien<br />
in Opern- und Operetteninszenierungen und trug<br />
mit seinem Wirken zur überregional beachteten<br />
Bedeutung des <strong>Dessau</strong>er Tanztheaters bei.<br />
Ellen Meissner, die später seine Frau wurde,<br />
tanzte alle großen Rollen in diesen Ballettabenden<br />
und Tanztheaterproduktionen. Ende der<br />
Spielzeit 1957/58 verließen Kamrath/Meissner<br />
das feste Engagement in <strong>Dessau</strong>, um mit eigenen<br />
Kammertanzabenden erfolgreich zu gastieren.<br />
Damit begannen sie ein außergewöhnliches<br />
Experiment, sich aus der Sicherheit eines festen<br />
Engagements in die freie Szene zu begeben. Doch<br />
der Sprung gelang, ohne den hohen Anspruch,<br />
den sich das Künstlerehepaar selbst stellte, aufzugeben:<br />
Tourneen, Film- und Fernsehproduktionen,<br />
Gastspiele in alle Städte der DDR sowie ins<br />
Ausland folgten.<br />
Nachdem sie die Bühne endgültig verlassen hatte,<br />
folgte der Schritt vom Tanz zur Malerei. Dabei<br />
finden die als Tänzerin eingefangenen Impressionen<br />
Eingang in ihre Kunst: Ihre Bilder sind farbig,<br />
harmonisch und ausdrucksstark. Ausstellungen<br />
ihrer Farbkompositionen fanden inzwischen in<br />
Kiel, Lübeck, <strong>Dessau</strong>, Leipzig statt. Seit 1980<br />
beschäftigt sich die Künstlerin mit der persönlichen<br />
Aufzeichnung ihrer Lebensgeschichte. Ellen<br />
Meissner blieb zusammen mit ihrem Mann Wilmo<br />
Kamrath der Stadt <strong>Dessau</strong> auf das Engste verbunden.<br />
Sie lebten bis Wilmo Kamraths Tod im<br />
Jahre 1989 in ihrem schönen Haus mit Blick in<br />
die Muldaue im Meisenweg. 1992 entschloss sie<br />
sich schließlich, in ihre Heimat zurückzugehen<br />
und lebt seither in Timmendorfer Strand.<br />
Moderner Kunst - wie dieser Collage - werden Bilder Alter Meitser gegenüber gestellt. Foto: Galerie<br />
Fokus auf Porträts<br />
sammlung rusch in der gemäldegalerie.<br />
Bereits zum vierten Mal ist die Sammlung SØR<br />
Rusche derzeit zu Gast in der Anhaltischen<br />
Gemäldegalerie. Nachdem in den vergangenen<br />
Jahren die Landschafts- und Genremalerei sowie<br />
Stillleben präsentiert wurden, steht nun die Bildnismalerei<br />
im Mittelpunkt. Zum zweiten Mal wird<br />
das Experiment eines Dialogs Alter Kunst mit<br />
Malerei der Gegenwart gewagt mit insgesamt<br />
etwa 80 Werken. „Blickkontakte“ heißt diese<br />
Ausstellung in der Orangerie des Schlosses Georgium,<br />
die bis zum 23. Januar zu sehen ist.<br />
Die niederländischen Portraits aus der Sammlung<br />
SØR Rusche veranschaulichen die Entwicklung<br />
dieser Bildgattung in fast allen Facetten und<br />
mit Werken von herausragenden Vertretern ihres<br />
Faches. Mit berühmten Protagonisten wie Frans<br />
Hals und Rembrandt kann die Sammlung zwar<br />
nicht aufwarten, doch sind ebenfalls wichtige<br />
Künstler wie Jan Anthonisz van Ravesteyn, Cornelis<br />
van der Voort und Jacob Backer vertreten,<br />
von denen wichtige Impulse für die Portraitmalerei<br />
ausgingen.<br />
Mit der Neuzeit begann sich das Portrait als<br />
eigenständiges Sujet zu etablieren, dessen<br />
vorrangige Funktion in der Standesrepräsentation<br />
bestand. Die Portraitmalerei eignete sich<br />
in einzigartiger Weise zur Veranschaulichung<br />
der gesellschaftlichen Position und zugleich<br />
zur Präsentation von Wertvorstellungen. Individuelle<br />
Charakterisierung und die Schilderung<br />
von Emotionalität sowie eine reale Wiedererkennbarkeit<br />
waren eher sekundär. Die Künstler<br />
der Niederlande haben in ihren meisterlichen<br />
Bildnissen bereits ein Jahrhundert vor der Aufklärung<br />
entscheidend zu einer Verbürgerlichung<br />
des Portraits beigetragen. Bei ihnen begegnet<br />
man nicht mehr nur dem bisher tonangebenden<br />
Adel, sondern emanzipierten niederländischen<br />
Bürgern, deren Anerkennung und Bildwürdigkeit<br />
auf ihrem geschäftlichen und gesellschaftlichen<br />
Erfolg vor dem Hintergrund eines calvinistischen<br />
Selbstbewusstseins beruht.<br />
Der „Blickkontakt“ mit den Portraits der niederländischen<br />
Meister des 17. Jahrhunderts wird in<br />
der Ausstellung um einen lebendigen Kontrast<br />
mit Bildnissen der Gegenwartskunst - wie z. B.<br />
mit Werken von Martin Assig, Stephan Balkenhol,<br />
Beza, Norbert Bisky, George Condo, Marcel Eichner,<br />
Zofia Kulik, James Lloyd - erweitert. Dabei<br />
werden nicht nur die inzwischen erfolgten Veränderungen<br />
der Bildkonzeptionen deutlich. Zum<br />
Erstaunen des Betrachters finden sich auch viele<br />
Berührungspunkte, die aufzeigen, dass das Sujet<br />
nach wie vor aktuell ist. Der Dialog alter und<br />
neuer Bildnisse führt für beide Epochen gleichermaßen<br />
zu einer schärferen Wahrnehmung.<br />
lka Hillger<br />
Kranz und die Serie<br />
sonderausstellung der stiftung bauhaus.<br />
Die Stiftung Bauhaus <strong>Dessau</strong> widmet dem beeindruckenden<br />
Werk des Künstlers, Grafikers und<br />
Experimentalfilmers Kurt Kranz, der von 1930<br />
bis 1932 am <strong>Dessau</strong>er Bauhaus studierte, in den<br />
Wintermonaten eine umfassende Ausstellung<br />
„Kurt Kranz – die Programmierung des Schönen“.<br />
Ein einzigartiges Oeuvre serieller Arbeiten machte<br />
Kranz, der in diesem Jahr einhundert Jahre alt<br />
geworden wäre, zu einem Pionier der generativen<br />
und multiplen Kunst der 60er Jahre. Am Bauhaus<br />
hatte Kranz bei Lehrern wie László Moholy-Nagy,<br />
Josef Albers, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Walter<br />
Peterhans und Joost Schmidt studiert. Ihr experimenteller<br />
Unterricht prägte ihn nachhaltig.<br />
Die Ausstellung im Bauhaus <strong>Dessau</strong> zeigt Arbeiten<br />
aus der Bauhauszeit und darüber hinaus<br />
Ausschnitte aus einem Werk, das Kranz bis zu<br />
seinem Tod im Jahr 1997 kontinuierlich weiterentwickelte.<br />
Wie der Künstler selbst versteht<br />
sich auch die Ausstellungsgestaltung dabei als<br />
Grenzüberschreitung von künstlerischer Produktion,<br />
Grundlagenforschung und Kunstvermittlung.<br />
Die Ausstellungsarchitektur der Schau<br />
im Bauhaus <strong>Dessau</strong> ist selbst als Hommage an<br />
Entwürfe von Kurt Kranz konzipiert. Die Idee basiert<br />
auf einer Perspektivstudie für ein turmhaftes<br />
Display, die er 1931 am Bauhaus im Rahmen<br />
der Reklameklasse bei Joost Schmidt entwarf.<br />
Das Kranz‘sche Konzept wird in die Horizontale<br />
projiziert und weiterentwickelt. Ein winkelförmiges<br />
Grundelement wird fünffach wiederholt<br />
und dabei in Winkel und Höhe kontinuierlich<br />
transformiert. Die entstehenden Kabinette glie-<br />
dern die verschiedenen Werkgruppen nach ihren<br />
generativen Prinzipien. Die grafische Gestaltung<br />
arbeitet wiederum mit Kranz‘schen Farbsystemen<br />
in einer kontinuierlichen Variation. Auch in<br />
der Materialität finden sich Referenzen zu gestalterischen<br />
Konzepten von Kurt Kranz. In den<br />
50er Jahren entwarf er einige Messestände die<br />
er mittels Systemkomponenten aus der Bautechnik<br />
(z. B. Gerüstbau und Betonschalungstechnik)<br />
umsetzte. Diese Entwürfe greift die Ausstellungstechnik<br />
auf. Die Kunstwerke werden ergänzt<br />
durch Installationen, die die Arbeitsmethoden<br />
von Kranz offenlegen und erlebbar machen: Eine<br />
Do-It-Yourself-Rasterportrait-Maschine, ein interaktives<br />
Filmlabor zur Untersuchung der Formreihen,<br />
eine Kurt-Kranz-Bibliothek zur vertiefenden<br />
Recherche und Faltbilder zum Selbstfalten<br />
sollen die „Programmierung des Schönen“ aktiv<br />
nachvollziehbar machen.<br />
Kranz schuf keine Bilder, die auf ein singuläres<br />
Meisterwerk zielten, er dachte stets in Serien,<br />
Formengruppen und Varianten. Ihn interessierte<br />
das endlose Spiel der Veränderung, die Prozesse<br />
der Verwandlung. Der Meister der seriellen und<br />
generativen Kunst war zugleich ein Pionier des<br />
künstlerischen Animationsfilms und Erfinder jenes<br />
Rasterverfahrens, mit dem Künstler wie Roy<br />
Lichtenstein oder Sigmar Polke berühmt werden<br />
sollten. Im Wechselspiel von Kunst und Wissenschaft<br />
experimentierte Kranz mit erstaunlicher<br />
Frische, die bis heute nichts von ihrer Faszination<br />
verloren hat.<br />
lka Hillger<br />
Eines der Faltbilder von Kurt Kranz. Foto: Stiftung Bauhaus<br />
Philharmonie<br />
jetzt auch auf CD<br />
Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten ist<br />
beim Label cpo eine neue CD der Anhaltischen<br />
Philharmonie mit Werken des <strong>Dessau</strong>er Hofkapellmeisters<br />
August Klughardt (1847-1902) erschienen.<br />
Die Aufnahmen des Violinkonzerts mit<br />
der Geigerin Mirjam Tschopp und der 3. Sinfonie<br />
unter der Leitung von Golo Berg entstanden im<br />
März 2009 in Koproduktion mit Deutschlandradio<br />
Kultur. Schon seit einigen Wochen auf dem Markt<br />
ist der Mitschnitt des von Generalmusikdirektor<br />
Antony Hermus dirigierten Sinfoniekonzerts mit<br />
spanisch-lateinamerikanischer Musik vom Juli<br />
2010, der unter dem Titel „España“ auf CD veröffentlicht<br />
wurde. Beide CDs sind ab sofort an<br />
den Theaterkassen zum Preis von jeweils 14 Euro<br />
erhältlich.<br />
Premieren für<br />
das Schauspiel<br />
Die Anhaltische Philharmonie lädt zum Neujahrskonzert<br />
„Einzug der Gladiatoren“ am 1. Januar<br />
um 17 Uhr ins Große Haus ein. Ungewöhnlich und<br />
spannend ist ihr Programm: Da wird die Bühne<br />
zur Manege und das Konzertzimmer zum Zirkuszelt!<br />
Das Publikum erlebt Jongleure, musikalische<br />
Tiere, Ballett, einen Clown und den Weltmeister<br />
im Kunstpfeifen, und als „Zirkuskapelle“<br />
natürlich die Anhaltische Philharmonie unter der<br />
musikalischen Leitung von GMD Antony Hermus.<br />
Das Programm ist noch einmal am 9. Januar um<br />
18.30 Uhr im Großen Haus und am 14. Januar um<br />
19.30 Uhr im Elbe-Werk Roßlau in abgewandelter<br />
Form zu erleben.<br />
Am 2. Januar um 17 Uhr ist auf der Großen Bühne<br />
„Die Stumme von Portici“ als Wiederaufnahme<br />
zu erleben. Mit André Bückers Inszenierung von<br />
Daniel- François-Esprit Aubers Oper kehrte eine<br />
der erfolgreichsten Opern des 19. Jahrhunderts<br />
nach jahrzehntelanger Abwesenheit auf die <strong>Dessau</strong>er<br />
Opernbühne zurück. Die erste Premiere des<br />
neuen Jahres findet mit der russischen Komödie<br />
„Tolles Geld“ am 21. Januar im Schauspiel statt.<br />
Der Film- und Fernsehschauspieler Wolfgang<br />
Maria Bauer setzt das Stück von Aleksandr N.<br />
Ostrowski in Szene.<br />
Am 28. Januar gibt es dann im Alten Theater die<br />
nächste Premiere: Der junge Autor Dirk Laucke<br />
erzählt mit „alter ford escort dunkelblau“ eine<br />
tragische und zugleich komische Geschichte<br />
über drei Männer in einem vergessenen Landstrich,<br />
die sich ihre Träume trotz allem nicht nehmen<br />
lassen. Für seinen Erstling erhielt Laucke<br />
2006 den Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker.<br />
Christoph Sommerfeld schließt mit seinem<br />
<strong>Dessau</strong>er Inszenierungsdebüt sein Studium der<br />
Theaterregie an der Hochschule für Schauspielkunst<br />
„Ernst Busch“ Berlin ab.