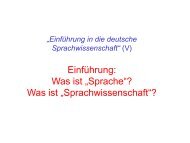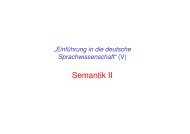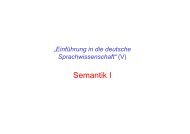Präsentation 3
Präsentation 3
Präsentation 3
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vorlesung<br />
„Niederdeutsch in Geschichte<br />
und Gegenwart“<br />
Niederdeutsche<br />
Dialektologie
Niederdeutsche Dialekte: Hörbeispiele<br />
Wenkersatz 16 in fünf niederdeutschen Dialekten:<br />
Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, du musst<br />
erst noch etwas wachsen und größer werden.<br />
1. Westfälisch<br />
2. Ostfälisch<br />
3. Ostfriesisch<br />
4. Dithmarsisch<br />
5. Mecklenburgisch
Niederdeutsche Dialekte: Hörbeispiele<br />
Einige lautliche Unterschiede: „bist“ „nicht“ „groß“ „genug“<br />
1. Westfälisch bis nich chraut chenouch<br />
2. Ostfälisch bis nich groot enoch<br />
3. Ostfriesisch bis net grout chenuch<br />
4. Dithmarsisch bis nit grout genooch<br />
5. Mecklenburgisch büst nich groot nauch<br />
Zum Vergleich: bisch ni groß knue<br />
(= Hochalemannisch)
Terminologische Fragen:<br />
„Dialekt“ - „Soziolekt“ - „Mundart“ u.a.<br />
Dialekt = eine regional gebundene Sprachausprägung (Kieler Platt, Westfälisch)<br />
Soziolekt = eine Sprachausprägung, die an eine soziale Gruppe gebunden ist<br />
(„Jugendsprache“?, „Arbeitersprache“?, „Frauensprache“?)<br />
Dialekt = Mundart?<br />
= eigentlich synonym, aber unterschiedlich konnotiert:<br />
Mundart: v.a. im Sinne von „Ortsdialekt“ gebraucht (die Kieler Mundart, die<br />
westfälischen Mundarten, die niederdeutschen Mundarten)<br />
Dialekt: auch für größere Sprachareale gebraucht (der westfälische Dialekt)<br />
Spezifizierungen:<br />
Ortsdialekt vs. Regionaldialekt/Regiolekt<br />
(Kriterium: areale Reichweite)<br />
Basisdialekt vs. Regionaldialekt/Regiolekt<br />
oder: Basisdialekt vs. neuer Substandard/Umgangssprache<br />
(Kriterien: Alter der Varietät, soziale Reichweite/Trägerschichten,<br />
Verwendungssituationen)
Traditionelle und neue Dialektologie<br />
Traditionelle Dialektologie:<br />
Forschungsgegenstand: die Basisdialekte<br />
Primäres Erkenntnisinteresse: areale Unterschiede<br />
Fokus: Lautung, Morphologie, Lexik<br />
Dialektologie in diesem Sinne = Dialektgeografie<br />
Neuere Dialektologie:<br />
Erweiterung des Gegenstandsbereiches: Basisdialekte + neue Substandards<br />
(Regionaldialekte + regionale Umgangssprachen)<br />
Neue Erkenntnisinteressen:<br />
- areale Gliederung der neuen Substandards (Umgangssprachenforschung)<br />
- soziale und pragmatische Aspekte des Dialektgebrauchs<br />
(Dialektsoziologie, „Sprecherdialektologie“)<br />
- Dialektbewertung (Spracheinstellungsforschung)<br />
- Dialekte im Kontakt untereinander oder mit der Standardsprache<br />
(Kontaktlinguistik)<br />
- Syntax stärker im Fokus
Begründer der Dialektgeografie<br />
in Deutschland: Georg Wenker<br />
geb. 1852 in Düsseldorf,<br />
gest. 1911<br />
„Das rheinische Platt“ (1877)<br />
1876-1887 Datenerhebung für den<br />
„Deutschen Sprachatlas“<br />
(44.251 Fragebögen aus<br />
40.736 Schulorten!)<br />
Der Atlas umfasst 1.668 Karten<br />
(entspricht 339 Einzelwörtern)<br />
Digitalisiert: DiWa<br />
Dialektgeografie
Die ersten 10 Wenker-Sätze<br />
1. Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum.<br />
2. Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser.<br />
3. Tu Kohlen in den Ofen, damit die Milch bald zu kochen anfängt.<br />
4. Der gute alte Mann ist mit dem Pferd(e) auf dem Eis eingebrochen und in<br />
das kalte Wasser gefallen.<br />
5. Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben.<br />
6. Das Feuer war zu heiß, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt.<br />
7. Er ißt die Eier immer ohne Salz und Pfeffer.<br />
8. Die Füße tun mir (so sehr) weh, ich glaube, ich habe sie (mir)<br />
durchgelaufen.<br />
9. Ich bin selber bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie sagte,<br />
sie wolle es auch ihrer Tochter sagen.<br />
10. Ich will es auch nicht mehr wieder tun/machen.
Beispiel: Der Wenkerbogen aus Meldorf (Dithmarschen), um 1880
Dialektgeografie<br />
Forschungsgegenstand „Basisdialekte“<br />
→ Gewährspersonen: maximal basisdialektkompetente Sprecher<br />
= „NORMs“ (Trudgill/Chambers)<br />
N = non-mobile, O = old, R = rural, M = male<br />
Zugrundeliegende Vorstellung: Homogenität des Basisdialekts<br />
→ Variation wird nicht erwartet<br />
→ standardisierte Erhebungsmethoden: Fragebuch, Übersetzungen (z.B.<br />
Wenkersätze)<br />
(nicht: spontane Kommunikation)<br />
Darstellungsverfahren:<br />
1) Dialektwörterbuch<br />
2) Dialektgrammatik<br />
3) Dialektatlas
Dialektwörterbuch<br />
Beispiel: Der Eintrag snacken im Holsteinischen Idiotikon<br />
von Johann Friedrich Schütze (Altona 1806)
Dialektwörterbuch<br />
Beispiel: Der Eintrag snacken im Schleswig-Holsteinischen Wörterbuch<br />
von Otto Mensing (Neumünster 1927-35)
Dialektwörterbuch<br />
Beispiel: Der Eintrag snacken im Wörterbuch der ostfriesischen Sprache<br />
von J. ten Doornkaat Koolman (Norden 1884)
Dialektgrammatik (lokal)<br />
Eintrag in einer Ortsgrammatik<br />
(aus H.-J. Pühn: Ostholsteinische Mundarten …, Marburg 1956)
Dialektgrammatik (regional)<br />
Eintrag in einer Flächengrammatik<br />
(aus H.-J. Pühn: Ostholsteinische Mundarten …, Marburg 1956)
Dialektatlas<br />
Punktsymbolkarte:<br />
Die Verteilung von bloot und bloos in den niederdeutschen Mundarten<br />
Niedersachsens (aus Stellmacher 2000, S. 247)
Dialektatlas<br />
Flächenkarte:<br />
Die Mundarten Schleswig-Holsteins (aus Sanders 1982, Karte 6)
Dialektatlas<br />
Dialektgrenzlinien = Isoglossen<br />
(„Isoglossen machen Landkarten zu Sprachkarten“, König 2004, S. 141)<br />
Kriterien für die Festlegung von Dialektgrenzen:<br />
- Zahl der Isoglossen zwischen zwei Orten („Isoglossenbündel“)<br />
- Wichtigkeit der betreffenden Phänomene innerhalb des Sprachsystems:<br />
strukturelle Unterschiede (z.B. ô vs. au für wgerm. ô wie in to/tau, -en vs. -et<br />
als Endung beim Plural der Verben wie in wi doon/wi doot)<br />
sind wichtiger als einzelwortbezogene Unterschiede (z.B. Schnöw vs.<br />
Schnuppen ‚Schnupfen‘, Sonnobend vs. Saterdach ‚Sonnabend/Samstag‘)<br />
Problem: Je nach Wahl der Isoglossen müssen Dialektgrenzen unterschiedlich<br />
festgelegt werden.<br />
Alternatives Verfahren zur Abgrenzung der Dialekte: „Kennformen“-Bestimmung<br />
„Schibboleth“: nach Richter 12, 5f. das Wort, an dessen abweichender Aussprache<br />
[Sibboleth] die Gileaditer die feindlichen Ephraimiter erkannten
Kennformen niederdeutscher Dialekte<br />
Hörbeispiel 1: „De aolle Baum“ von Augustin Wibbelt<br />
Text:<br />
Ick weet en aollen huollen Baum.<br />
De steiht up hauge Grabenkant;<br />
Do drömt he sinen Winterdraum,<br />
Do wät he wach in‘n Sunnenbrand.<br />
Un äoller wät he jedes Jaohr,<br />
Wät jedes Jaohr auk wier junk,<br />
Un windt en grönen Kranz in‘t Haor,<br />
Un is doch män en Stump un Strunk.<br />
Du meins, du wörs en aollen Mann,<br />
Dat Liäben suer, dat Stiärben hatt?<br />
Den aollen Baum den kiek di an,<br />
Den huollen Baum - un schiäm di wat!
Gemeinniederdeutsche Formen (Beispiele)<br />
Ick weet en aollen huollen Baum.<br />
De steiht up hauge Grabenkant;<br />
Do drömt he sinen Winterdraum,<br />
Do wät he wach in‘n Sunnenbrand.<br />
- Erhalt von unverschobenem p-t-k (up, weet, ick)<br />
- Monophthong in ‚weiß, einen‘ (weet, e(e)n)<br />
- Monophthong in ‚seinen, auf‘ (sinen, up)<br />
- r-loser Auslaut bei ‚der‘ und ‚er‘ (de, he)
Kennformen der westfälischen Dialekte<br />
Ick weet en aollen huollen Baum.<br />
De steiht up hauge Grabenkant;<br />
Do drömt he sinen Winterdraum,<br />
Do wät he wach in‘n Sunnenbrand.<br />
= Diphthong in wgerm. au (ô 2 ): Baum, hauge, draum (sonst nd. boom, hooge,<br />
droom)<br />
Du meins, du wörs en aollen Mann,<br />
Dat Liäben suer, dat Stiärben hatt?<br />
Den aollen Baum den kiek di an,<br />
Den huollen Baum - un schiäm di wat!<br />
= Kürzendiphthonge (fallende Diphthonge), bei Kurzvokalen in offener Silbe und<br />
vor r
Kennformen der westfälischen Dialekte<br />
... De steiht up hauge Grabenkant;<br />
... Un äoller wät he jedes Jaohr,<br />
... Un windt en grönen Kranz in‘t Haor<br />
= Differenzierung von altlangem â (Jaohr, Haor) und tonlangem ā (Graben)<br />
(in den meisten nd. Regionen keine Differenzierung)<br />
... Den huollen Baum - un s-chiäm di wat!<br />
... eene Flas-ke Wien ...<br />
= Aussprache des (wgerm. sk) als [sç] oder [sk]<br />
... De steiht up hauge Grabenkant;<br />
= spirantische Aussprache des anlautenden g als [W]
Abgrenzung des Westfälischen anhand von Kennformen<br />
Das Westfälische (aus Sanders 1982, Karte 4)
Abgrenzung des Westfälischen (Kartenausschnitt)<br />
å / ā<br />
beke, kogel …<br />
bieke, kuegel …<br />
å / ā<br />
nur å<br />
Das Westfälische (aus Sanders 1982, Karte 4)<br />
beke, kogel …<br />
å / ā<br />
beke, kogel …
Die westniederdeutschen Dialekte<br />
nördl.: Øsüdl.:<br />
ge-<br />
(z.B. lopen vs.<br />
gelopen ‚gelaufen‘)<br />
westl.: â ≠ ā<br />
östl.: â = ā<br />
(z.B. straot ≠ maken<br />
vs. straot vs. maoken)<br />
Karte nach Wiesinger (1983, Karte 47.13)<br />
Einheitsplural:<br />
westl.: -(e)t<br />
östl.: -(e)n<br />
(z.B. loop(e)t vs.<br />
lopen ‚wir/ihr/sie<br />
laufen‘)
Kennformen der ostfälischen Dialekte<br />
Nordniederdeutsch: Ick heff di dat seggt.<br />
Ostfälisch: Ick hebbe dick dat esegget.<br />
Nordniederdeutsch: He harr Köh un Peer för sinen Broder kofft.<br />
Ostfälisch: Hei harre Käuhe un Päre for sinen Brauder ekofft.<br />
1) Einheitspronomina auf -k: dik, mik, jük (statt di, mi, ju)<br />
2) Erhalt des auslautenden -e: hebbe, segget, harre, Käuhe, Päre<br />
3) Erhalt des e- (von ge-) im Partizip Perfekt: esegget, ekofft<br />
(Beispiele aus Blume 1980)
Einige Kennformen anderer westniederdeutscher Dialekte<br />
Niederrheinisch: Gemeinsamkeiten mit den niederländischen und den<br />
mittelfränkischen Dialekten<br />
- differenzierter Plural: wi lopen, ji loopt, se lopen (gegenüber Einheitsplural im<br />
übrigen Niederdeutschen)<br />
- Erhalt des ge- beim Partizip (gelopen statt lopen)<br />
- Senkung von i und u vor Nasal (drenken, pont statt drinken, punt)
Einige Kennformen anderer westniederdeutscher Dialekte<br />
Ostfriesisch - Schleswigisch: „Kolonialdialekte“ mit einigen Besonderheiten<br />
z.B. Einheitsplural auf -en: wi lopen, ji lopen, se lopen<br />
(trennt die jüngeren Dialekte Ostfriesisch und Schleswigisch<br />
vom restlichen Westniederdeutschen)<br />
Ostfriesisch: Friesische und niederländische Einflüsse: z.B. h-Pronomina<br />
(hem, hör), Wortschatz: Foon ‚Mädchen‘, Tuun ‚Garten‘ u.a.<br />
Schleswigisch: Dänische (jütische) Einflüsse: z.B. stimmlose Aussprache des<br />
anlautenden s (ßine), Infinitivkonstruktion mit und statt zu (Dat<br />
is nu Tid un plücken Appeln)<br />
Dithmarsisch: z.B. jüm ‚ihr‘ gegenüber holsteinisch ji/ju, guut statt goot,<br />
-li statt -lik (herrli, gruli)
Nordniederdeutsch als „Standardniederdeutsch“?<br />
Nordniederdeutsch: Ostfriesisch + Oldenburgisch + Nordhannoversch<br />
+ Dithmarsisch + Holsteinisch + Schleswigisch<br />
Bestimmung des Nordniederdeutschen ex negativo:<br />
„Was nicht westfälisch und ostfälisch ist, gilt als Nordniederdeutsch.“<br />
(nach Stellmacher 2000, S. 130)<br />
Gemeinsamkeit der nordnd. Dialekte: „Modernität“<br />
- Aufhebung der alten Diphthongierungen (vs. Westfälisch)<br />
- Ausfall des auslautenden -e (vs. Ostfälisch)<br />
Das in den Medien verwendete Platt orientiert sich am Lautstand der<br />
nordniederdeutschen Dialekte.<br />
Sprachausgleich auf nordniederdeutscher Basis?
Die ostniederdeutschen Dialekte (1)<br />
westl.: -(e)t<br />
östl.: -(e)n<br />
nördl.: up dem Feld(e)<br />
südl.: up det/dat Feld<br />
det (außerhalb: dat)<br />
Karte nach Wiesinger (1983, Karte 47.14)
Kennformen der mecklenburgischen Dialekte<br />
Hörbeispiel:<br />
Ausschnitt aus „Ut mine Stromtid“ (1864) von Fritz Reuter (1810-74)<br />
Romanfiguren: Inspektor Bräsig, Lining und Mining Nüssler, Jochen Nüssler, Fru<br />
Nüssler<br />
druwappel = Traubenapfel, kleiner Herrenapfel (eine Apfelsorte)<br />
twäschen = Zwillinge<br />
utschuddert = verwechselt<br />
Merkmale:<br />
- Diminitutivendung -ing: Lining, Mining, Vadding<br />
- Vokalhebung vor r: wier ‚wäre‘, irstgeburt ‚Erstgeburt‘<br />
- Diphthongierung von mnd. ô 1 (= mhd. uo, nhd. u): klauk ‚klug‘,<br />
aber mnd. ô 2 (= mhd. ou/o, nhd. au/o) als Monophthong: ook ‚auch‘, roden<br />
‚roten‘, Noot ‚Not‘, bloot ‚bloß‘<br />
→ dagegen im Nordniederdeutschen: klook = ook = bloot
Einige Kennformen anderer ostniederdeutscher Dialekte<br />
Für alle ostniederdeutschen Dialekte gilt:<br />
Einheitsplural auf -en: wi lopen, ji lopen, se lopen<br />
Vorpommersch: viele Gemeinsamkeiten mit dem Mecklenburgischen<br />
Spezifika: Hiattilgung durch -g- (maigen ‚mähen‘), Kurzvokal<br />
vor -lt (ult statt oolt ‚alt‘), Entwicklung sw > schw (schwîn)<br />
Mittelpommersch:Abgrenzung zum Mecklenburgisch-Vorpommerschen:<br />
Diminutivform -ke, Monophthong bei ô 1 und ^ö 1 (hoot ‚Hut‘,<br />
gröön ‚grün‘), Dativ > Akk. (up dat Feld ‚auf dem Feld‘)<br />
Brandenburgisch: det statt dat ‚das‘, Berch, Kerke usw. statt Barch, Kark ‚Berg,<br />
Kirche‘
Die ostniederdeutschen Dialekte (2)<br />
westl.: mîn ‚mein‘<br />
östl.: mî-e, mî-a<br />
westl.: mî-e, mî-a<br />
östl.: mîn ‚mein‘<br />
westl.: Ø- (lopen)<br />
östl.: je- (jelopen)<br />
Karte nach Wiesinger (1983, Karte 47.14)
Ostniederdeutsche Dialekte im heutigen Polen und Russland<br />
Ostpommersch: Slawische Einflüsse: z.B. Vokalisierung des -n z.B. in Baie<br />
‚Bein‘, mi-e ‚mein‘, Wio ‚Wein‘, Maa ‚Mann‘;<br />
teilweise Vokalisierung des -l z.B. in faia ‚viel‘, füüa ‚faul‘;<br />
teilweise [k] > [tR] z.B. Tschint ‚Kind‘, itsch ‚ich‘<br />
und [g] > [dY] z.B. dYrüt ‚Grütze‘, rüdYe ‚Rücken‘<br />
Niederpreußisch: z.B. Senkung von i, u zu e, o (schep ‚Schiff‘, op ‚auf‘),<br />
Entwicklung von -nd- zu /ŋ/ (Kinger, singen),<br />
Partizip Perfekt mit je- (statt präfixlos): jelope<br />
im Osten: Litauische Einflüsse: z.B. fallende Diphthonge wie in<br />
Seöp [zeəp] ‚Seife‘, deöp [deəp] ‚tief‘<br />
Sprachgeschichte ist zu einem großen Teil auch Sprachkontaktgeschichte.
Literatur zur niederdeutschen Dialektologie<br />
Überblicksdarstellungen:<br />
William Foerste: Geschichte der niederdeutschen Mundarten. In: Deutsche<br />
Philologie im Aufriß. Hrsg. v. Wolfgang Stammler. Bd. 1. Zweite, überarb.<br />
Aufl. Berlin 1957. Sp. 1729-1898.<br />
Dieter Stellmacher: Niederdeutsche Sprache. Zweite, überarb. Aufl. Berlin 2000.<br />
Willy Sanders: Sachsensprache – Hansesprache – Plattdeutsch. Göttingen<br />
1982.<br />
Peter Wiesinger: Die Einteilung der deutschen Dialekte. In: Werner Besch et al.<br />
(Hrsg.): Dialektologie. Ein Handbuch ... Berlin/New York 1983. S. 807-900.<br />
Kurzüberblick:<br />
Ingrid Schröder: Niederdeutsch in der Gegenwart. Sprachgebiet –<br />
Grammatisches – Binnendifferenzierung. In: Dieter Stellmacher (Hrsg.):<br />
Niederdeutsche Sprache und Literatur der Gegenwart. Hildesheim (u.a.)<br />
2004. S. 35-97.
Hörproben:<br />
1)<br />
2)<br />
3)<br />
1) Ruhrdeutsch<br />
Regionale Variation in den hochdeutschen<br />
Sprechvarietäten Norddeutschlands?<br />
kuckense, hasse,daddet<br />
dat, wat<br />
ma, do, au, nich, is<br />
leecht, träächt<br />
aufde hohe Kante,<br />
dat geht im Kopp,<br />
anne Blase<br />
2) Hamburgisch<br />
wågen, getån, sågen<br />
s-peder<br />
die Djungen, dscha<br />
Pabba, füddern, weider<br />
Zaaun, Haause<br />
Kinners, runner<br />
wiederkommen tust<br />
3) Berlinisch<br />
det<br />
zwanzisch, reischlisch<br />
Jottlieb, je-, jaab<br />
rin, uf<br />
een, zwee, abloofen<br />
wißta<br />
ville, knorke
Regionale Variation in den hochdeutschen<br />
Sprechvarietäten Norddeutschlands?<br />
Variation im gesprochenen Standarddeutschen<br />
Werner König: Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen ... (1989)<br />
- 44 Gewährspersonen (Studierende/Hochschulabsolventen)<br />
- Alter 21-29 Jahre, mindestens ein Elternteil mit Abitur<br />
- am jeweiligen Ort geboren und aufgewachsen<br />
Ausgewertete Sprachproben:<br />
- Vorleseaussprache Wortliste (1480 Einzelwörter),<br />
- Vorleseaussprache Minimalpaare (ca. 100 Minimalpaare),<br />
- Vorleseaussprache Einzellaute
Variation im gesprochenen Standard Norddeutschlands
Variation im gesprochenen Standard Norddeutschlands
Variation im gesprochenen Standard Norddeutschlands
Variation im gesprochenen Standard Norddeutschlands
Variation im gesprochenen Standard Norddeutschlands