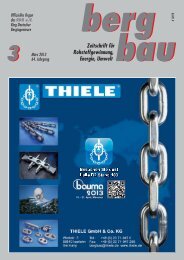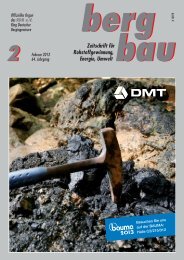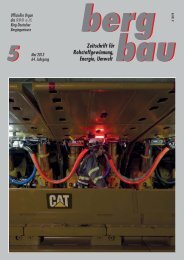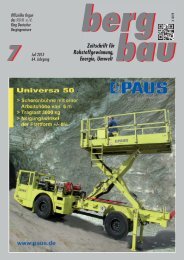Kohleflözgas – Aufstieg eines Energieträgers - RDB eV
Kohleflözgas – Aufstieg eines Energieträgers - RDB eV
Kohleflözgas – Aufstieg eines Energieträgers - RDB eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bergbau<br />
<strong>Kohleflözgas</strong> <strong>–</strong> <strong>Aufstieg</strong> <strong>eines</strong> <strong>Energieträgers</strong><br />
<strong>Kohleflözgas</strong> ist ein Methanreiches<br />
Gas aus Kohle, dessen<br />
Nutzung weltweit steigt. Dank des<br />
weltweit zunehmenden Energiebedarfs<br />
ist die Förderung von<br />
<strong>Kohleflözgas</strong>, welches zu den<br />
nicht-konventionellen Gasen<br />
gerechnet wird, wirtschaftlich<br />
interessant. Diese nicht-konventionellen<br />
Gase hatten 2007 bereits<br />
einen Anteil an der Welt-Erdgasförderung<br />
von 6 %, mit ansteigendem<br />
Trend. 2007 wurden weltweit<br />
45,7 Mrd. m³ <strong>Kohleflözgas</strong><br />
gefördert (Bild 1). Dies entspricht<br />
einem Energieinhalt von 39 Mio. t<br />
SKE. <strong>Kohleflözgas</strong> wird noch über<br />
sehr lange Zeiträume als Energieträger<br />
zur Verfügung stehen, da<br />
es kohlebürtig ist und die weltweite<br />
Kohleversorgung mindestens<br />
bis 2100 aus geowissenschaftlicher<br />
Sicht unkritisch ist [1].<br />
Gase aus Kohlen unterscheiden<br />
sich in Herkunft und Zusammensetzung.<br />
Daher sind folgende Begriffe üblich:<br />
Kohlegas ist ein Oberbegriff<br />
für natürlich gebildete Gase aus<br />
der Kohle sowie für über die technische<br />
Kohlevergasung erzeugte<br />
Gase.<br />
<strong>Kohleflözgas</strong> ist der Oberbegriff<br />
für alle natürlichen Gase aus der<br />
Kohle, wie Flözgas und Grubengas<br />
(Bild 2). Flözgas ist das<br />
aus Kohleflözen in unverritztem<br />
Dr. Thomas Thielemann, Köln*<br />
Gebirge etwa durch eine Bohrung<br />
freigesetzte Gas, im Englischen<br />
coalbed methane (CBM) genannt.<br />
Das durch Bergbautätigkeit im<br />
Grubengebäude unmittelbar oder<br />
nach Jahren austretende Kohle-<br />
flözgas wird als Grubengas bezeichnet.<br />
Es gliedert sich in das coalseam<br />
methane (CSM), welches aus<br />
dem aktiven Bergbaubetrieb<br />
durch Absaugung und Grubenbewetterung<br />
entfernt wird, und in<br />
das coalmine methane (CMM),<br />
das im stillgelegten Bergwerk<br />
noch über Jahre aus den Flözen<br />
entweichen kann.<br />
<strong>Kohleflözgas</strong> ist in allen Kohlelagerstätten<br />
zu erwarten, deren Kohlen das Reifestadium<br />
der Flammkohle bzw. „high volatile<br />
bituminous B coal“ (d. h. 0,7 % VRr,<br />
VR = Vitrinitreflexion) erreicht oder überschritten<br />
haben, so dass es zu einer umfangreichen<br />
Methanbildung kam. Daneben<br />
müssen die Versenkungsgeschichte der<br />
Lagerstätte und die heutige geologische<br />
Situation eine Gasspeicherung erlauben.<br />
Die höchsten Gasinhalte sind in Fett- bis<br />
Magerkohlen zu erwarten, während sich<br />
die hohe Inkohlung des Anthrazits negativ<br />
auf die Gasführung auswirken kann.<br />
Braunkohlelagerstätten sind aufgrund ihrer<br />
geringen Maturität für eine <strong>Kohleflözgas</strong>nutzung<br />
nicht relevant.<br />
*Dr. Thomas Thielemann,<br />
RWE Power AG, Abt. PBT-M<br />
Stüttgenweg 2, 50935 Köln<br />
Tel.: 0221/4800<br />
email: thomas.thielemann@rwe.com<br />
1 Entwicklung der weltweiten <strong>Kohleflözgas</strong>förderung von 1970 bis<br />
2007 Grafik: RWE Power AG<br />
Reserven und Ressourcen<br />
Nach heutigem Kenntnisstand verfügen<br />
78 Staaten über <strong>Kohleflözgas</strong>ressourcen.<br />
Derzeit sind in 56 Staaten die Bedingungen<br />
so günstig, dass neben den Ressourcen ein<br />
weiterer Teil der Vorkommen als wirtschaftliche<br />
Reserven ausgewiesen wurde. Diese<br />
Reserven haben eine statische Reichweite<br />
von mindestens 23 Jahren. Die Gewinnung<br />
von <strong>Kohleflözgas</strong> erfolgt derzeit vor allem in<br />
den USA, in Australien, Kanada, China, Indien,<br />
Deutschland, Großbritannien, Polen,<br />
Russland und der Ukraine.<br />
Die <strong>Kohleflözgas</strong>ressourcen der Welt<br />
beliefen sich 2007 auf 235 T.m³ (ca. 201<br />
Gt SKE). Davon verfügt Russland mit 80 T.<br />
m³ (= Billionen m³) über die größten Ressourcen,<br />
gefolgt von Kanada mit durchschnittlich<br />
54,5 T.m³, China (35 T.m³), Australien<br />
(14 T.m³), der Ukraine (12 T.m³), den<br />
USA (11 T.m³) und Indien (4 T.m³). Zu den<br />
Ressourcen sind noch 1,051 T.m³ an wirtschaftlich<br />
gewinnbaren Reserven zu addieren.<br />
Das hohe Ressourcen:Reserven-<br />
Verhältnis von 221:1 deutet auf den noch<br />
geringen Explorationsgrad dieses Rohstoffes<br />
hin. Folglich ist in den kommenden<br />
Jahren mit einer steigenden Nutzung von<br />
<strong>Kohleflözgas</strong> zu rechnen.<br />
In Russland, Kanada und China führte<br />
eine umfangreiche Exploration zu Reserven<br />
von jeweils über 130 G.m³ (= Milliarden<br />
m³; Bild 3). In den USA, dem Land mit seit<br />
30 Jahren ausgedehnten Explorationstätigkeiten,<br />
ließen diese Aktivitäten die Reserven<br />
sogar auf gut 480 G.m³ ansteigen. Das lässt<br />
den Schluss zu, dass die weltweit zunehmende<br />
Exploration auf <strong>Kohleflözgas</strong> die Reserven<br />
in den nächsten Jahren weiter steigern<br />
wird. Länder mit kleineren, aber umfangreich<br />
genutzten Reserven sind z.B. Tschechien<br />
(3,5 G.m³), Deutschland (2,2 G.m³), Polen<br />
(1,9 G.m³) und Großbritannien (1 G.m³).<br />
2 Gliederungsübersicht für <strong>Kohleflözgas</strong>. Entsprechend ihrer Herkunft<br />
enthalten die Gase unterschiedliche Gehalte an Einzelsubstanzen.<br />
KWs = Kohlenwasserstoffe. [2]<br />
bergbau 2/2008 63
Bergbau<br />
Förderung, Handel und<br />
Verfügbarkeit<br />
Die globale Förderung von <strong>Kohleflözgas</strong><br />
zur Wärme- und Stromproduktion<br />
stieg in den letzten Jahren deutlich. Waren<br />
es 1984 noch 23 G.m³ [3], stieg diese<br />
Zahl bis 2001 um 84 % auf etwa 42,3 G.<br />
m³ [4]. Bis 2007 nahm die Produktion noch<br />
einmal um 8 % auf 45,7 G.m³ zu (Bild 1).<br />
Dieser Trend zeigt die besonders in einigen<br />
Industrieländern rasante Entwicklung<br />
der <strong>Kohleflözgas</strong>nutzung. Daneben<br />
werden jedoch jedes Jahr in der gleichen<br />
Größenordnung Methanmengen aus dem<br />
Kohlebergbau ungenutzt in die Atmosphäre<br />
freigesetzt. Hier ist noch viel zu tun.<br />
Die <strong>Kohleflözgas</strong>förderung ist weiterhin<br />
besonders dominiert von den USA. 88,7 %<br />
der Weltförderung 2007 entfallen auf dieses<br />
Land (40,5 G.m³). 2001 waren es noch<br />
93,7 %. Dieses zeigt, dass auch andere<br />
Staaten eine steigende <strong>Kohleflözgas</strong>produktion<br />
aufweisen. Hinter den USA folgen<br />
Australien mit 2,2 % (1,1 G.m³), China mit<br />
1,5 % (0,69 G.m³), und Deutschland mit<br />
1,3 % (0,57 G.m³).<br />
Für nicht-konventionelle Erdgase wie<br />
das <strong>Kohleflözgas</strong> ist es charakteristisch,<br />
dass ihre Nutzung nur nach technischen<br />
Neuerungen oder steuerlichen Vergünstigungen<br />
wirtschaftlich wird. In den USA gab<br />
es seit den 1980er Jahren steuerliche Anreize,<br />
<strong>Kohleflözgas</strong> zu nutzen („section 29<br />
tax credits“). Die Resonanz war in den ersten<br />
Jahren zurückhaltend. Ende der 1980er<br />
und zu Beginn der 1990er Jahre kam es zu<br />
einem Anstieg der Bohrtätigkeit [5], da diese<br />
Vergünstigungen nur für Bohrungen galten,<br />
die bis Ende 1992 niedergebracht worden<br />
waren. Im Gesetz gab es die Auflage,<br />
diese steuerlich geförderten Bohrungen bis<br />
Ende 2002 in Produktion bleiben zu lassen.<br />
Dass es ab 2003 nicht zu einem Einbruch<br />
in der US-Produktion kam, ist ein weiteres<br />
Zeichen dafür, dass die <strong>Kohleflözgas</strong>produktion<br />
wirtschaftlich ist.<br />
In Russland könnte <strong>Kohleflözgas</strong> in den<br />
nächsten Jahren noch interessanter werden,<br />
da Russland den eigenen Kohlebedarf<br />
durch Ersatzbrennstoffe drosseln möchte.<br />
Erdgas scheidet als Ersatz aus, da es verstärkt<br />
als Devisenbringer exportiert werden<br />
soll. Viele russische Kohlegruben könnten<br />
mit Grubengas anstelle von Kohle einen<br />
Teil ihres Energiebedarfs decken. Nach [6]<br />
können im Kusnetsk-Becken je nach Grube<br />
zwischen 5 und 50 % der benötigten<br />
Energie aus dem bisher kaum genutzten<br />
Grubengas gewonnen werden.<br />
China ist <strong>eines</strong> der kohlereichsten Länder<br />
und verfügt über die drittgrößten <strong>Kohleflözgas</strong>reserven<br />
der Welt (139,4 G.m³). Die<br />
hohe Bevölkerungsdichte sowie die rasante<br />
industrielle Entwicklung bei gleichzeitig<br />
ineffizienter und umweltbelastender Kohleindustrie<br />
machen eine rasche Erschließung<br />
64 bergbau 2/2008<br />
3 Verteilung der globalen <strong>Kohleflözgas</strong>reserven 2007 von 1.051 G.m³ (Mrd. m³)<br />
Grafik: RWE Power AG<br />
des <strong>Kohleflözgas</strong>potenzials erforderlich.<br />
Die chinesische Regierung engagiert sich<br />
in der Entwicklung von Flözgasvorkommen<br />
und gründete 1995 die China Coalbed Methane<br />
Corporation. Ihr Ziel war, mit Hilfe<br />
ausländischer Firmen die <strong>Kohleflözgas</strong>förderung<br />
bis zum Jahr 2000 auf 1 G.m³ zu<br />
steigern. Vor allem begrenzte finanzielle<br />
Mittel und eine marode Infrastruktur führten<br />
dazu, dass im Jahr 2000 nur 40 % und<br />
auch 2007 nur 70 % dieses Ziels erreicht<br />
wurden.<br />
<strong>Kohleflözgas</strong>nutzung in<br />
Deutschland<br />
Im 20. Jahrhundert wurden die abgesaugten<br />
Gase zunehmend energetisch genutzt.<br />
Ab 1908 verwertete man Grubengas<br />
(CSM) im Saarland für die Dampferzeugung.<br />
1948 wurde in der Grube Hirschbach<br />
die erste CSM-Gasabsauganlage in Betrieb<br />
genommen. Bis 1954 kamen 12 weitere<br />
Anlagen hinzu. Inzwischen existiert im<br />
Saarland ein 93 km langes Grubengasverbundnetz,<br />
welches ein Stahlwerk, die chemische<br />
Industrie, eine Kokerei, Kraftwerke<br />
und Wärmezentralen mit Gas versorgt. Im<br />
Ruhrgebiet wird seit 1943 testweise [7] und<br />
seit 1948 dauerhaft Gas (CSM) abgesaugt<br />
[8] und verwertet. Der Anteil der Verwertung<br />
stieg bis 2000 auf etwa 80 % und verbleibt<br />
auf diesem hohen Niveau.<br />
Seit Anfang der 1990er Jahre gab es<br />
in Deutschland Versuche, Flözgas (CBM)<br />
zu fördern. Ein Konsortium aus der Ruhrkohle<br />
AG, der Ruhrgas AG und der amerikanischen<br />
Conoco teufte bis 1997 im<br />
Münsterland 2 Bohrungen (Rieth, Natarb)<br />
im Erlaubnisfeld „Sigillaria“ ab, gab das<br />
Projekt jedoch aufgrund geringer Gasförderung<br />
auf. Im Saarland brachte die DSK<br />
AG (ehem. Saarberg AG) ebenfalls 2 Boh-<br />
rungen (Aspenhübel in 1997, Weiher 1<br />
in 1999) bis in flözführendes Oberkarbon<br />
nieder. Die Gasführung war höher als im<br />
Ruhrgebiet. Die CBM-Produktionssituation<br />
am Standort Aspenhübel im Sommer 1998<br />
zeigt Bild 4. Doch selbst in der gasreichsten<br />
Bohrung Weiher 1 lag die anfängliche<br />
maximale Förderrate nur bei 2500 m³/d<br />
und fiel bis auf 200 m³/d nach 6 Monaten<br />
ab. Für einen wirtschaftlichen Betrieb<br />
wären mindestens 6000 m³/d erforderlich<br />
gewesen. Damit waren auch die CBM-<br />
4 Flözgasproduktion (CBM) am Standort Aspenhübel<br />
im Saarland (August 1998)<br />
Foto: T. Thielemann<br />
Projekte im Saarland nicht wirtschaftlich.<br />
Günstig sieht die Situation beim Grubengas<br />
aus. Dieser Energieträger wird in<br />
Deutschland bereits seit 1908 genutzt. Im<br />
Jahr 2001 wurden in Deutschland 237,5<br />
Mio. m³ <strong>Kohleflözgas</strong> aus aktiven und stillgelegten<br />
Bergwerken (CSM und CMM)<br />
verwertet. Davon stammten 145,3 Mio. m³<br />
aus dem Saarland, 72,1 Mio. m³ aus Ibbenbüren<br />
und 63,2 Mio. m³ aus dem Ruhrrevier<br />
(Bild 5).<br />
Seit dem Inkrafttreten des Erneuerbare-<br />
Energien-Gesetzes (EEG) am 01.04.2000<br />
wird verstärkt auch Grubengas aus stillgelegten<br />
Gruben gefördert. Aus Grubengas
5 Grubengasförderung (CSM) an der aktiven Grube Prosper bei<br />
Bottrop (April 2004) Foto: T. Thielemann<br />
wird erfolgreich Wärme und Strom produziert.<br />
Zur Bündelung der Betreiberinteressen<br />
wurde am 31.10.2001 in Oberhausen<br />
die „Grubengasinitiative NRW“ gegründet.<br />
Inzwischen sind die „claims“ im Inland abgesteckt<br />
und die Betreiber eruieren Aktivitäten<br />
im Ausland.<br />
Nach Angaben des Interessenverbandes<br />
Grubengas e. V. (IVG) wurden in NRW<br />
im Jahr 2007 im stillgelegten Bergbau 48,7<br />
Mio. m³ Grubengas gefördert. Daraus wurden<br />
etwa 71 GWh Strom und 33,7 GWh<br />
Wärme erzeugt und so gut 313000 t an<br />
CO2-Emissionen vermieden (http://www.<br />
grubengas.de).<br />
Beispiele für die Gasförderung (CMM)<br />
aus stillgelegten Grubenbauen zeigen die<br />
Bilder 6 und 7.<br />
6 Grubengasförderung (CMM) am Standort<br />
LÜNTEC in Lünen-Brambauer (November<br />
2002) Foto: T. Thielemann<br />
Recht<br />
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)<br />
garantiert dem Produzenten von Grubengasstrom<br />
eine Einspeisevergütung. Sie<br />
betrug nach §4 EEG ab dem 01.04.2000<br />
0,15 DM (0,08 €)/kWh und für Strom aus<br />
Anlagen über 500 MW ab diesem Anteil<br />
höherer Leistung 0,13 DM (0,07 €)/kWh.<br />
Neuanlagen erhalten nach §9 EEG einen<br />
Bestandsschutz über 20 Jahre. Die Höhe<br />
der Einspeisevergütung ist variabel und<br />
wird nach §12 EEG alle 2 Jahre Ende Juni<br />
überprüft und ggf. zum 01. Januar des<br />
Folgejahres angepasst. Die energetische<br />
Nutzung von Grubengas wirft juristische<br />
Fragen auf: Wer hat die Nutzungsrechte<br />
an dem Grubengas? Muss der alte Bergbautreibende<br />
oder der neue Grubengasproduzent<br />
für Bergbaufolgeschäden aufkommen?<br />
Denn der neue Nutzer profitiert<br />
von dem vergangenen <strong>–</strong> und eventuell<br />
Bergschäden verursachenden <strong>–</strong> Steinkohlebergbau,<br />
da erst durch die Kohlegewinnung<br />
das Grubengas zugänglich wurde.<br />
Andererseits ist die Grubengasnutzung<br />
im gesellschaftlichen Interesse, da sie<br />
die Nettoemissionen von Treibhausgasen<br />
(hier: Methan) reduziert und somit<br />
dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit entspricht.<br />
Folglich wird die Grubengasnutzung<br />
im EEG honoriert.<br />
Bei der Grubengasnutzung sind Belange<br />
aus dem Bergrecht, dem Immissionsrecht,<br />
dem Bodenschutzrecht sowie dem<br />
Polizei- und Ordnungsrecht betroffen. Die<br />
Rechtssprechung wird bei [9] sowie [10]<br />
dargelegt.<br />
Auf internationaler Ebene wird die Nutzung<br />
von Grubengas als Teil des Emissionshandels<br />
gesehen. Jener Teil des an<br />
einem stillgelegten Bergwerk produzierten<br />
Methans, der durch die natürliche Ausgasung<br />
innerhalb weniger Jahrzehnte auch<br />
ohne menschlichen Eingriff in die Atmosphäre<br />
entwichen wäre (sog. Referenzfall),<br />
kann vom Grubengasproduzenten in<br />
Form von Emissionszertifikaten genutzt<br />
werden. Denn die Verbrennung von Methan<br />
zu CO2 senkt den Treibhauseffekt<br />
dieses Gases um den Faktor 23.<br />
Sowohl vom Exekutivrat des Clean Development<br />
Mechanisms als auch von dem<br />
für JI-Projekte zuständigen Aufsichtsgremium<br />
(Joint Implementation Supervisory<br />
Bergbau<br />
7 Grubengasförderung (CMM) am stillgelegten Schacht Westfalen 6<br />
bei Ahlen (April 2004) Foto: T. Thielemann<br />
Committee) werden internationale Projekte<br />
der Grubengasnutzung so behandelt.<br />
Nur die deutsche Emissionshandelsstelle<br />
(DEHSt) ist derzeit nicht bereit, deutsche<br />
Grubengasprojekte nach international anerkannten<br />
Standards im Emissionshandel<br />
anzuerkennen. Dieses ist bedauerlich,<br />
da so einer der (international gängigen)<br />
Anreize für die Anwendung dieser relativ<br />
klimafreundlichen Technologie in Deutschland<br />
entfällt.<br />
Literatur<br />
[1] Thielemann, T., Schmidt, S., Gerling, J.P.<br />
(2007): Braun- und Steinkohle: Energielieferanten<br />
für den Weltbedarf bis in das Jahr 2100 -<br />
ein Ausblick. <strong>–</strong> Glückauf, 143 (3): 116 bis 123;<br />
Essen.<br />
[2] Thielemann, T. (2002): <strong>Kohleflözgas</strong> in<br />
Deutschland. <strong>–</strong> BGR Commodity Top News, 17:<br />
4 Seiten; Hannover (http://www.bgr.de/b121/<br />
ctn1702.pdf).<br />
[3] Bibler, C.J., Marshall, J.S. & Pilcher, R.C.<br />
(1998): Status of worldwide coal mine methane<br />
emissions and use. <strong>–</strong> Int. J. Coal Geol., 35: 283<br />
bis 310; Amsterdam.<br />
[4] BGR (2003): Rohstoffwirtschaftliche Länderstudien.<br />
Heft XXVIII, Reserven, Ressourcen<br />
und Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2002<br />
(„Energiestudie 2002“). <strong>–</strong> 426 Seiten, Hannover.<br />
[5] GRI (1999): North American Coalbed Methane<br />
Resource Map. <strong>–</strong> Gas Research Institute,<br />
1 Karte; Chicago.<br />
[6] EPA (2003): Reducing methane emissions<br />
from coal mines in Russia: A handbook for expanding<br />
coalbed methane recovery and use in<br />
the Kuznetsk coal basin. <strong>–</strong> EPA 430-D 95-001:<br />
64 Seiten; Washington (Environmental Protection<br />
Agency).<br />
[7] Weddige, A. & Bosten, J. (1944): Künstliche<br />
Ausgasung <strong>eines</strong> Abbaufeldes und Nutzbarmachen<br />
des Methans für die Gasversorgung. <strong>–</strong><br />
Glückauf, 80(23/24): 241 bis 250; Essen.<br />
[8] Mende, H. & Trösken, K. (1950): Einrichtung<br />
einer Methanabsaugeanlage auf der Zeche<br />
Hansa unter Tage. <strong>–</strong> Glückauf, 86(1/2): 1 bis 11;<br />
Essen.<br />
[9] Kremer, E. & Neuhaus gen. Wever, P. (2001):<br />
Bergrecht. <strong>–</strong> Studienbücher Rechtswissenschaft,<br />
170 Seiten; Stuttgart (Kohlhammer).<br />
[10] Frenz, W. (2001): Bergrecht und Nachhaltige<br />
Entwicklung. <strong>–</strong> Schriften zum Öffentlichen<br />
Recht, Band 841, 111 Seiten; Berlin (Duncker<br />
& Humblot).<br />
bergbau 2/2008 65