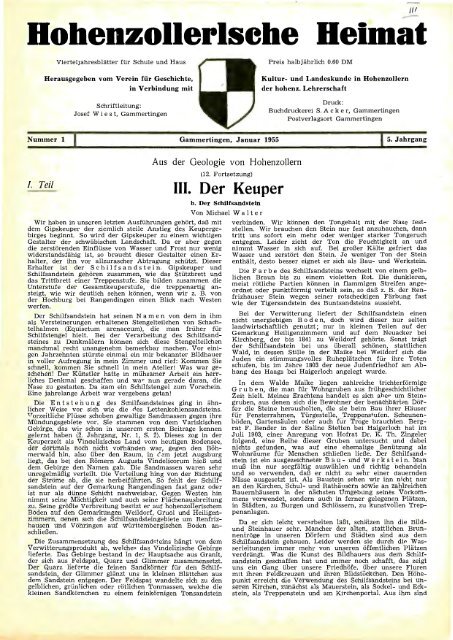III. Der Keuper - Hohenzollerischer Geschichtsverein eV
III. Der Keuper - Hohenzollerischer Geschichtsverein eV
III. Der Keuper - Hohenzollerischer Geschichtsverein eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
irr<br />
Hohenzollerlsehe Heimat<br />
Vierteljahresblätter für Schule und Haus<br />
Herausgegeben vom Verein für Geschichte,<br />
in Verbindung mit<br />
Schriftleitung:<br />
Josef Wiest, Gammertingen<br />
Preis halbjährlich 0.60 DM<br />
Kultur- und I.andeskunde in Hohenzollern<br />
der hohenz. Lehrerschaft<br />
Druck:<br />
Buchdruckerei S.Acker, Gammertingen<br />
Postverlagsort Gammertingen<br />
Nummer 1 Gammertingen, Januar 1955 5. Jahrgang<br />
/, Teil<br />
Wir haben in unseren letzten Ausführungen gehört, daß mit<br />
dem Gipskeuper der ziemlich steile Anstieg des <strong>Keuper</strong>gebirges<br />
beginnt. So wird der Gipskeuper zu einem wichtigen<br />
Gestalter der schwäbischen Landschaft. Da er aber gegen<br />
die zerstörenden Einflüsse von Wasser und Frost nur wenig<br />
widerstandsfähig ist, so braucht dieser Gestalter einen Erhalter,<br />
der ihn vor allzurascher Abtragung schützt. Dieser<br />
Erhalter ist der Schilfsandstein. Gipskeuper und<br />
Schilfsandstein gehören zusammen, wie das Stützbrett und<br />
das Trittbrett einer Treppenstufe. Sie bilden zusammen die<br />
Unterstufe der Gesamtkeuperstufe, die treppenartig ansteigt,<br />
wie wir deutlich sehen können, wenn wir z. B. von<br />
der Hochburg bei Rangendingen einen Blick nach Westen<br />
werfen.<br />
<strong>Der</strong> Schilfsandstein hat seinen Namen von dem in ihm<br />
als Versteinerungen erhaltenen Stengelteilchen von Schachtelhalmen<br />
(Equisetum arenaceum), die man früher für<br />
Schilfstengel hielt. Bei der Verarbeitung des Schilfsandsteines<br />
zu Denkmälern können sich diese Stengelteilchen<br />
manchmal recht unangenehm bemerkbar machen. Vor einigen<br />
Jahrzehnten stürzte einmal ein mir bekannter Bildhauer<br />
in voller Aufregung in mein Zimmer und rief: Kommen Sie<br />
schnell, kommen Sie schnell in mein Atelier! Was war geschehen!<br />
<strong>Der</strong> Künstler hatte in mühsamer Arbeit ein herrliches<br />
Denkma! geschaffen und wa r nun gerade daran, die<br />
Nase zu gestalten. Da Kam ein Schilfstengel zum Vorschein.<br />
Eine jahrelange Arbeit war vergebens getan!<br />
Die Entstenung des Schiifsandsteines ging in ähnlicher<br />
Weise vor sich wie die ''es Lettenkohlensandsteins.<br />
T<br />
Vorzeitliche Flüsse schoben gewaltige Sandmassen gegen ihre<br />
Mündungsgebiete vor. Sie stammen von dem Variskischen<br />
Gebirge, das wir schon in unserem ersten Beitrage kennen<br />
gelernt haben (2 Jnhrgar.g, Nr. 1, S. 2). Dieses zog in der<br />
<strong>Keuper</strong>zeit als Vinüelizisches Land vom heutigen Bodensee,<br />
der dortmals noch nicht vorhanden war, gegen den Böhmerwald<br />
hin, also über den Raum, in c". m jetzt Augsburg<br />
liegt, das bei den Römern Augusta Vindelicorum hieß und<br />
dem Gebirge den Namen gab. Die Sandmassen waren sehr<br />
unregelmäßig verteill Die Verteilung hing von der Richtung<br />
der Ströme ab, die sie herbeiführten. So fehlt der Schilfsandstein<br />
auf der Gemarkung Rangendingen fast ganz oder<br />
ist nur als dünne Schicht nachweisbar. Gegen Westen hin<br />
nimmt seine Mächtigkeit und auch seine F iächenausbreitung<br />
zu. Seine größte Verbreitung besitzt er auf hohenzoilerischem<br />
Boden auf den Gemarkungen Weildorf, Gruol und Heiligenzimmern,<br />
denen sich die Schilfsandsteingebiete um Renfrizhausen<br />
und Vöhringen auf<br />
schließen.<br />
württembergischen Boden an-<br />
Die Zusammensetzung des Schilfsand^+eins hängt von dem<br />
Verwitterungsprodukt ab, welche? das Vindelizische Gebirge<br />
lieferte. Das Gebirge bestand in de" Hauptsache aus Granit,<br />
der sich aus Feldspa t Quarz und Glimmer zusammensetzt.<br />
<strong>Der</strong> Quarz lieferte die feinen Sandkörner für den Schilfsandstein,<br />
der Gümmer glänzt uns in kleinen Blättchen aus<br />
dem Sandstein entgegen. <strong>Der</strong> 1 eldspat wandelte sich zu den<br />
geiblichen, gri mlichen oder rötlichen Tonmassen, welche die<br />
kleinen Sandkörnchen zu einem feinkörnigen Tonsandstein<br />
Aus der Geologie von Hohenzollern<br />
(12. Fortsetzung)<br />
<strong>III</strong>. <strong>Der</strong> <strong>Keuper</strong><br />
b. <strong>Der</strong> Schilfsandstein<br />
Von Michael Walter<br />
verbinden. Wir können den Tongehalt mit der Nase feststellen.<br />
Wir brauchen den Stein nur fest anzuhauchen, dann<br />
tritt uns sofort ein mehr oder weniger starker Tongeruch<br />
entgegen. Leider zieht der Ton die Feuchtigkeit an und<br />
nimmt Wasser in sich auf. Bei großer Kälte gefriert das<br />
Wasser und zerstört den Stein. Je weniger Ton der Stein<br />
enthält, desto besser eignet er sich als Bau- und Werkstein.<br />
Die Farbe des Schilfsandsteins wechselt von einem gelblichen<br />
Braun bis zu einem violetten Rot. Die dunkleren,<br />
meist rötliche Partien können in flammigen Streifen angeordnet<br />
oder punktförmig verteilt sein, so daß z. B. der Renfrizhauser<br />
Stein wegen seiner rotscheckigen Färbung fast<br />
wie der Tigersandstein des Buntsandsteins aussieht.<br />
Bei der Verwitterung liefert der Schilfsandstein einen<br />
nicht unergiebigen Boden, doch wird dieser nur selten<br />
landwirtschaftlich genutzt; nur in kleinen Teilen auf der<br />
Gemarkung Heiligenzimmern und auf dem Neuacker bei<br />
Kirchberg, der bis 1841 zu Weildorf gehörte. Sonst trägt<br />
der Schilfsandstein bei uns überall schönen, stattlichen<br />
Wald, in dessen Stille in der Maike bei Weildorf sich die<br />
Juden ein stimmungsvolles Ruheplätzchen für ihre Toten<br />
schufen, bis im Jahre 1803 der neue Judenfriedhof am Abhang<br />
des Haags bei Haigerloch angelegt wurde.<br />
In dem Walde Maike liegen zahlreiche trichterförmige<br />
Gruben, die man für Wohngruben aus frühgeschichtlicher<br />
Zeit hielt. Meines Erachtens handelt es sich aber um Steingruben,<br />
aus denen sich die Bewohner der benachbarter) Dörfer<br />
die Steine herausholten, die sie beim Bau ihrer Häuser<br />
für Fensterrahmen, Türgestelle, Treppenstufen Scheunenböden,<br />
Gartensäulen oder auch für Troge brauchten. Bergrat<br />
Bender in der Saline Stetten bei Haigerloch hat im<br />
Juli 1903, einer Anregung von Hofrat Dr. K Th. Zingeler<br />
folgend, eine Reihe dieser Gruben uniersucht und dabei<br />
nichts gefunden, was auf eine ehemalige Benützung als<br />
Wohnräume für Menschen schließen ließe. <strong>Der</strong> Schilfsaridstein<br />
ist ein ausgezeichneter Bau- und Werkstein. Man<br />
muß ihn nur sorgfältig auswählen und richtig behandeln<br />
und so verwenden, daß er nicht zu sehr einer dauernden<br />
Nässe ausgesetzt ist. Ais Baustein sehen wir ihn nicht nur<br />
an den Kirchen, Schul- und Rathäusern sowie an zahlreichen<br />
Bauernhäusern in der nächsten Umgebung seines Vorkommens<br />
verwendet, sondern auch in ferner gelegene Plätzen,<br />
in Städten, zu Burgen und Schlössern, zu kunstvollen Treppenanlagen.<br />
Da er sich leicht verarbeiten läßt, schätzen ihn die Bildund<br />
Steinhauer sehr. Mancher der alten, stattlichen Brunnentröge<br />
ir unseren Dörfern und Städten sind aus dem<br />
Schilfsandstein gehauen. Leider werden sie durch die Wasserleitungen<br />
immer mehr von unseren öffentlichen Plätzen<br />
verdrängt. Was die Kunst des Bildhauers aus dem Schilfsandstein<br />
geschaffen hat und mmer noch schafft, das zeigt<br />
uns ein Gang über unsere Friedhöfe, über unsere Fluren<br />
mit ihren Felctkreuzen und ihren Bildstockchen. Den Höhepunkt<br />
erreicht die Verwendung des Schilfsandsteins bei unseren<br />
Kirchen, zunächst als Mauerstein, als Sockel- und Eckstein,<br />
als Treppenstein und am Kirchenportal. Aus ihm sind
2 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
in unseren gotischen Kirchen die Gewölbegurten und die<br />
Gewölbeschlußsteine hergestellt, aber auch das kunstvolle<br />
Maßwerk ihrer Fenster. Die Grabdenkmäler in den Kirchen<br />
in Dießen, in Glatt und an manchen anderen Orten sind aus<br />
Schilfsandstein geschaffen, auch die wundervollen Sakramentshäuschen<br />
und Sakramentsnischen, von denen nur die<br />
in Stetten bei Hechingen und Glatt genannt seien. <strong>Der</strong> aufmerksame<br />
Kunst- und Heimatfreund wird manches Werk<br />
ermitteln, das die Kunst eines Meisters aus dem Schilfsandstein<br />
herausgemeißelt hat. <strong>Der</strong> Bildhauer Joh. Georg Weckenmann,<br />
der in Haigerloch ansäßig war, hat mit besonderer<br />
Vorliebe diesen Stein verwendet, wie uns die Vasen und<br />
Büsten bei der St. Annakirche in Haigerloch, das Kreuz auf<br />
dem Martinsberg bei Hechingen, die jetzt wieder erneuerte<br />
Kreuzigungsgruppe auf dem Kalvarienberg bei St. Luzen<br />
und seine Nepomukstatuen zeigen. Auch beim Wiederaufbau<br />
der Burg Hohenzollern in den Jahren 1847—1867 wurde<br />
Schilfsandstein verwendet und zwar besonders für die Tore,<br />
die Schmuck- und Figurenstücke, die Inschriftensteine. Neben<br />
den Steinbrüchen von Binsdorf und Renfrizhausen haben<br />
auch die Brüche von Weildorf wertvolles Material<br />
geliefert. Wenn die Jugend von Weildorf auf den Hohenzoller<br />
wandert, dann darf sie mit einem berechtigtem Heimatstolz<br />
daran denken, daß ihre Urgroßväter die Steine zu<br />
den Torgliederungen an der Auffahrt, zum Adlertore mit all<br />
seinem Schmuck und seinen Inschriften im Petersgraben<br />
und Weiherle gebrochen haben. Auch zum Neubau der<br />
Kirche in Rangendingen, der bald nach dem Wiederaufbau<br />
der Zollerburg folgte, wurde das benötigte weichere Steinmaterial<br />
in Weildorf geholt.<br />
Neben den Brüchen in Weildorf waren jene von Heiligenzimmern<br />
längere Zeit die Hauptlieferanten für<br />
Schilfsandstein im weiten Umkreis. Dem Orte selbst hat der<br />
Stein sein bestimmtes Gepräge gegeben, wie schon ein Blick<br />
auf die Bauernhäuser, aber auch auf die öffentlichen Gebäude,<br />
wie Kirche, Schul- und Rathaus erkennen läßt. Auch<br />
die nächste Umgebung hat hier ihren Baustein geholt, so die<br />
Klöster Bernstein und Kirchberg, sowie die Stadt Haigerloch.<br />
Doch hat sich der Schilfsandstein nicht immer so recht<br />
in das alte Stadtbild eingefügt, wie einige neuere Bauten<br />
zeigen. In der Glanzzeit des Steinbruchbetriebs von Heiligenmmera<br />
waren oft gegen 50 Mann in den Steinbrüchen beschäftigt,<br />
und ein Dutzend Fuhrwerke waren im Sommer<br />
unterwegs, um die sehr begehrten Steine nach Hechingen<br />
und Balingen, nach Ebingen und Sigmaringen, nach Sulz<br />
und Rottweil, ja selbst nach Blaubeuren, Weingarten, Ravensburg<br />
und an den Bodensee zu bringen. Beim Bau der<br />
Neckarbahn von Horb und Rottweil wurden manche Tunnels,<br />
Viadukte und Bahnhöfe aus dem Schilfsandstein von<br />
Heiligenzimmern gebaut. In Sigmaringen wurde er zum Bau<br />
der Kuppel an der Hedinger Kirche und zum Wiederaufbau<br />
des 1893 abgebrannten Schloßteiles verwendet. Wie der<br />
Kunstdünger den Gipsabbau bis auf zwei Betriebe zum Erliegen<br />
brachte, so haben der Kunststein und der Zement dem<br />
Abbau des Schilfsandsteins fast ganz ein Ende bereitet. Nicht<br />
nur ein einträgliches Gewerbe ist auf diese Weise zu Grunde<br />
gegangen, sondern auch die bodenständige, heimatverbundene<br />
Bauweise hat dadurch großen Schaden gelitten. Nur Herr<br />
Schellhammer arbeitet noch mit seinen beiden Söhnen im<br />
Steinbruch und versorgt die wenigen Liebhaber, vor allem<br />
Steinhauer, die den Schilfsandstein immer noch gerne zu<br />
Grabsteinen verwenden, mit dem erforderlichen Material.<br />
So wird der Schilfsandstein auch noch weiterhin, wenn auch<br />
in bescheidenerem Maße als früher, zur Gestaltung des<br />
Kunst- und Kulturbildes unserer Heimat seinen Beitrag<br />
leisten.<br />
Von alten Sitten und Bräuchen an Weihnachten<br />
Wohl kaum ein Fest des Kirchenjahres hat sich bei uns so<br />
tief in die christliche Volksseele eingegraben, wie gerade das<br />
Weihnachtsfest! Das Ereignis dieses Festes, so groß, erhaben<br />
und geheimnisvoll es auch sein mag, so einfach und natürlich,<br />
so lieblich und innig ist es mit aller Wärme in das<br />
deutsche Gemüt hineingebettet worden. Es ist deswegen<br />
nicht verwunderlich, wenn das Volk das Weihnachtsfest einstens<br />
durch einen Kranz von allerlei schönen Sitten und<br />
Gebräuchen vorbereitete und begleitete. Ein Teil dieser<br />
Bräuche reicht mit seinen Wurzeln weit hinab in die vorchristliche<br />
Zeit, in die Religion, Anschauungs- und Denkweise<br />
der germanischen Welt. Das Christentum hat die<br />
äußeren Brauchformen mitübernommen, sie aber im Laufe<br />
der Zeit mit neuem Inhalt gefüllt und veredelt.<br />
Ehedem waren schon wochenlang vor Weihnachten weite<br />
Bezirke des seelischen Lebens unserer ländlichen Bevölkerung<br />
von diesem hohen Fest und seinen Vorbereitungen<br />
gefangengenommen. <strong>Der</strong> Schuljugend hatten es ganz besonders<br />
die in den frühen Morgenstunden abgehaltenen Rorateämter<br />
angetan. Elektrisches Licht gab es vor mehr als vier<br />
Jahrzehnten nochl nicht am Orte. In der Kirche spendeten<br />
nur ein paar Oellampen ihrer dürftigen Schein. Altem<br />
Brauch gemäß brachten daher die Leute Kerzen mit in die<br />
Kirche. Jeder Schulbube war nun eifrigst darauf bedacht,<br />
auch so ein Kerzchen für das Rorate sein eigen nennen zu<br />
können. In den Adventswochen gab es deshalb in den Rockund<br />
Hosentaschen der Schuljungen keinen beliebteren<br />
Tausch- und Hanüelsgegenstand als Wachs- und Kerzenstumpen!<br />
Im Rorateamt wurden dann die Lichtlein auf die<br />
Kirchenbank geklebt. Die zahlreichen, flimmernden und<br />
strahlenden Kerzchen nahmen natürlicherweise die Aufmerksamkeit<br />
der Jugend oft über die Maßen in Anspruch,<br />
und nicht selten mußten zu geschäftige „Zündler" durch die<br />
plötzlich dazwischenfahrende,. ganz prosaische Hand des<br />
„Kirchensc ^ützen" wieder in die Wirklichkeit zurückgebracht<br />
werden. Mit der Einrichtung des elektrischen Lichtes verschwand<br />
dann dieser Brauch, der den Kirchenstühlen im<br />
Laufe der Jahre nicht unerhebliche Brandwunden eingetragen<br />
hat.<br />
Ebenso hatte auch das Aussuchen des Christbaumes seinen<br />
eigenen Brauch und seinen besonderen Reiz. Schon lange<br />
vor dem 'Feste streiften die Jungen in kleineren Gruppen die<br />
weitausgedehnten Gemeinde- und Privatwaldungen ab, um<br />
ein schönes Bäumchen auszukundschaften. War eines gefunden,<br />
so wurde dessen Standort streng geheimgehalten.<br />
Heimatliche Erinnerungen aus Rangendingen<br />
von J. Wannenmacher<br />
Frauen und Mädchen waren an den Winterabenden vor<br />
Weihnachten mit dem Backen und Ausstechen von „Springerle"<br />
beschäftigt. Kunstfertige Hände schnitzten dazu die<br />
oft sehr reichhaltigen und sinnigen Formen (Model). In den<br />
„Liachtstuben" erklangen dabei herrliche, alte Advents- und<br />
Weihnachtslieder, die Gemüt und Herz aufschlössen für das<br />
herannahende, hohe Fest.<br />
<strong>Der</strong> Hl. Abend und die Hl. Nacht brachten dann den Höhepunkt<br />
der Vorbereitungen und 1er sie umrankenden Gebräuche.<br />
Die Bauern hatten am Tage vor Weihnachten ausgiebig<br />
in der Scheune zu tun. Für zwei oder Irei Tage mußte<br />
das Futter (Häcksel) für das Vieh im Handbetrieb geschnitten<br />
und bereitgestellt werden. Nachmittags ging es dann in<br />
den Obstgarten, wo zu jedem Baum ein Strohwisch gele^.<br />
wurde. Die Frauen putzten und fegten; ganz geheimnisvoll<br />
wurde ein frischer Besen aus Tannenreisig angesteckt. Die<br />
jungen Burschen wiederum versanen sich mit Pulver und<br />
machten ihre alten Pistolen schußbereit. Und dann Warthe<br />
alles gespannt und freudig auf den Augenblick, ma in<br />
drei kurzen Abständen die „Schreck»-" läutete. Sämtliche<br />
Glocken im Turme fielen nacheinander ein — und ihren<br />
freudigen Akkord umjubelte mit seiner silberhellen Stimme<br />
das viele Jahrhunderte alte Klosterglöcklein, das in dieser<br />
Gemeinschaft nur am Hl. Abend und am Weihnachtstage<br />
erklang. Gleichzeitig krachten aus allen Ecken die Schüsse<br />
hervor, und in den Obstgärten war ein eifriges Laufen und<br />
Schaffen. Jedem Baum wurde der bereitgestellte Strohwisch<br />
umgebunden. Eis zum Ende des Schreckeläutens mußte diese<br />
Arbeit vollendet sein, dann würde der Baum nicht erfrieren<br />
und im kommenden Jahre besonders viel Früchte<br />
tragen, so glaubte man.<br />
Die Hausfrau aber machte sich in diesen feierlichen Minuten<br />
im Hause zu schaffen. Sie nahm für die Stube einen<br />
neuen KehrwiscL und für den Speicher den neuen Besen,<br />
fegen in Kreuzesform din vier Ecken aus, indem sie dabei<br />
die Worte sprach: „Naus ihr Ratta und Mäus aus meim Haus,<br />
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes!" —<br />
Niemand durfte die Hausfrau bei dieser Tätigkeit „braffeln"<br />
(ansprechen), sonst war nach altem Volksglauben die Wirkung<br />
dieses Spruches verloren, und das Ungeziefer wich<br />
nicht aus dem Hause.<br />
Nach Abfütterung des Viehes kehrte der Hausvater noch<br />
die Scheune und wischte besonders unter dem „Obadaloch"<br />
recht sauber. Man wollte am Weihnachtsmorgen sehen, von
fahrgang 1955 HOHENZOLLERISCHE HEIMAT 3<br />
welcher Fluchtart die meisten Körner auf dem Boden lagen,<br />
denn diese Sorte sollte nach damaliger Auffassung im darauffolgenden<br />
Jahre am besten gedeihen. — Alsdann wurden<br />
Scheune, Stall, Schuppen und alles gut abgeschlossen, weil,<br />
wie man glaubte, in der Christnacht der Dieb stehlen muß,<br />
— und wenn es nur ein Strohhalm auf der Miste wäre.<br />
Bald sammelten sich die Hausbewohner um den Christbaum,<br />
den inzwischen die Kinder „aufgerichtet" hatten. Am<br />
Hl. Abend ging man nicht ,,z' Liacht". Allerhand gruselige<br />
Geschichten wurden da von Geistern und Gespenstern erzählt,<br />
die in dieser geheimnisvollen Nacht freien Lauf hätten<br />
und den Menschen zu schaden versuchten. — Vor dem<br />
Schlafengehen legte man noch da und dort 12 Zwiebelschalen<br />
auf den Tisch, bezeichnete sie mit den Monatsnamen und<br />
füllte sie mit Salz. War das Salz einer Schale am Weihnachtsmorgen<br />
ganz vergangen, so bedeutete dies einen nassen<br />
Monat im kommenden Jahre. Andere Leute wiederum<br />
holten die wundersame Jerichorose hervor und stellten sie<br />
in Wasser. Ging sie voll auf, so war nach dem Volksglauben<br />
ein gutes Jahr zu erwarten; blieb sie geschlossen, so standen<br />
schlechte Zeiten in Aussicht.<br />
Am Christmorgen selber läutete man wiederum in aller<br />
Frühe „Schrecke". Dann wurde alles im Hause geweckt. <strong>Der</strong><br />
Hausvater begab sich sofort in den Stall und gab dem Vieh<br />
zu fressen. Während des Schreckeläutens bekamen die Haustiere<br />
auch Salz auf das Futter gestreut. Die Frauen aber<br />
liefen eiligen Schrittes zu den Brunnen. Wer am Weihnachtsmorgen<br />
beim Schreckeläuten zuerst Wasser aus dem<br />
Brunnen erhält, hatte im kommenden Jahr Glück und Vorrang<br />
vor allen anderen, glaubte man. Andere liefen zu den<br />
Hühnern, Gänsen und Enten und brachten auch diesen Futter,<br />
denn am Christmorgen unter dem Schreckeläuten mußten<br />
alle Tiere fressen, „damit sie wohl gedeihen und gesund<br />
bleiben!"<br />
Hernach begab sich jung und alt in die Christmette. Aus<br />
allen Gassen und Winkeln huschten die Leute hervor. Un-<br />
Nachdem die Alamannen die Römer besiegt hatten suchten<br />
sich die Sippen geeignetes Siedlungsgebiet und rodeten und<br />
bebauten dieses gemeinsam. Die Markungsgrenzen wurden<br />
festgelegt und die gesamte Markung in drei Esche eingeteilt<br />
Später verteilten die Sippengenossen große Teile der Markungsfläche<br />
unter sich als dauerndes Eigentum, der übrige<br />
Teil der Gemarkung blieb gemeinschaftlicher Besitz der<br />
Sippe bezw. der jungen Gemeinde. Die ungeteilte Fläche<br />
diente zur Anlage des Waldes, der Wege und Weiden. Durch<br />
die vielen Jahrhunderte ist dieser Gemeindebesitz bis in die<br />
Gegenwart erhalten geblieben und bildet das sogenannte<br />
Gemeindegiiedervermögen in den Gemeinden. Durch die Zunahme<br />
der Bevölkerung reichten Aecker und Wiesen für Ernährung<br />
der Menschen und Tiere nicht aus, und man ging<br />
daran, den besten Teil der brachliegenden Weide leihweise<br />
und lebenslänglich an die Gemeindebürger zur Bewirtschaftung<br />
und Nutznießung zu verteilen, wobei ein Bürger mehrere<br />
Grundstücke, ein sogenanntes Allmandlos erhielt. Dieser<br />
Namen deutet wohl darauf hin d?ß ursprünglich bei der<br />
Verteilung ^as Los gezogen wurde. Das war der Anfang der<br />
Allmand- die in den meisten Gemein uen Hohen zolierns heute<br />
noch vorhanden ist und nach altem Recht an die Gemeindebürger<br />
ausgeliehen wird. Wenn in früheren Jahrhunderten<br />
ein Aiimandbesitzer seine Allmandteile schlecht oder gar<br />
nicht umtrieb, so zog die Gemeinde das Allmandlos wieder<br />
an sich Heute ist die Ausgabe der Allmandteile durch die<br />
Gemeindeordnung vom Jahr» 1900 und durch ein Ortsstatut<br />
geregelt, wobei aber überall erkennbar ist, daß die alten<br />
Rechte nicht angetastet wurden.<br />
Die erste Voraussetzung zum Alimandrecnt war das Gemeindebürgerrecht,<br />
Diese« Recht ist heute durch den Begriff<br />
des Staatsbürgers stark überschattet and beinahe nicht mehr<br />
erkennbar. Im Mittelalter hatte der Gemeindebürger im<br />
Gegensatz zum Hintersaßen das uneingeschränkte Recht, an<br />
der Verwaltung der Gemeinde teilzunehmen, B^rgerversammlungen<br />
zu besuchen und mit den andern Gerneindebürgern<br />
die ungeteilte Markungsfläche (Wald, Weide und<br />
Allmend) „zu nutzen und zu nießen." Das Gemeindebürgerrecht<br />
konnte nur durch Vererbung oder Kauf erworben<br />
werden. Deshalb bestimmte auch die hohenz. Gemeindeordnung<br />
v. J. 1900 § 4C, Allmandberechtigt ist in einer Gemeinde:<br />
1) Wer beim Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den<br />
Bestimmungen des bisherigen Rechtes das Gemeindebürgerrecht<br />
besitzt; 2.) wer nach den Vorschriften diese" Abschnittes<br />
das Allmandrecht in der Gemeinde durch Geburt oder<br />
Die Allmand in Hohenzollern<br />
vergeßlicher Morgen, wenn der Schnee unter den Schuhen<br />
knirschte, die Sterne am Himmel glänzten und funkelten.<br />
Nach dem Engelamt wartete schon alles freudig gespannt auf<br />
das „In dunkler Nacht", ein altes christliches Volkslied, das<br />
schon generationenlang nur an Weihnachten erklingt, und<br />
das jeder heimatverbundene Rangendinger an Weihnachten<br />
vermißt, mag er draußen in der Welt auch noch so schön,<br />
aber ohne dieses Lied Weihnachten feiern. <strong>Der</strong> Ursprung<br />
dieses Liedes konnte bis heute noch nicht ermittelt werden.<br />
Beim Heimgang von der Christmette brannte in jedem Hause<br />
der Christbaum. Zu Hause erwartete dann die ganze Familie<br />
der Morgenkaffee, zu dem es an diesem hohen Tage neben<br />
Weißbrot auch ausreichend Hutzelbrot gab. — Am Nachmittag<br />
des ersten Weihnachtstages kamen dann die „Dott" und<br />
der „Dötte" (Taufpaten) und beschenkten ihre Patenkinder<br />
mit Brezeln, Aepfeln, Nüssen und Springerle. Viel mehr<br />
wurde allgemein nicht geschenkt. Die Nebensache war noch<br />
nicht zur Hauptsache geworden!<br />
Schade, daß ein großer Teil dieser Bräuche, die einst in so<br />
geheimnisvoller Weise die ganze belebte und unbelebte Natur<br />
am Weihnachtsgeschehen teilnehmen ließen, inzwischen<br />
eingegangen ist! Und so haben gute Sitten und Bräuche im<br />
Menschenleben eine hohe Bedeutung. Es sind geistig-seelische<br />
Gehäuse, in denen sich unser Gemüt aufhält, worin<br />
es sich betätigt und wächst; es sind vielfach die sinnfälligen<br />
Formen und Zeichen für das Uebersinnliche und Unfaßbare.<br />
Ihr Absterben und Verschwinden bedeutet daher immer<br />
einen entsprechend hohen seelischen und gemütsmäßigen<br />
Verlust, der durch alle Güter und Errungenschaften der<br />
modernen Kultur nicht ersetzt werden kann. Gutes Brauchtum<br />
läßt sich auch nicht befehlen, denn es erwächst nur<br />
aus den Urgründen eines kindlich frommen Glaubens, der<br />
Ehrfurcht vor dem Unfaßbaren und aus einem Gemüt, das<br />
all dem, was man nur berechnen, messen und wiegen kann,<br />
nicht den Vorrang im Menschenherzen einräumt!<br />
Aufnahme erwirbt. Das Allmandrecht vererbt sich vom Gemeindebürger<br />
auf dessen sämtliche Kinder und von einer<br />
allmandberechtigten Mutter auf ihre unehelichen Kinder. Das<br />
ererbte Allmandrecht kann aber nur von Personen vom vollendeten<br />
24. Lebensjahr, die einen selbständigen Haushalt<br />
führen, angetreten werden. In den meisten Gemeinden<br />
stehen nicht soviel Allmandlose oereit, um alle Ansprüche<br />
sofort erfüllen zu können, vielmehr müssen die Allmandberechtigten<br />
solange warten, bis durch den Tod eines Allmandbesitzers<br />
ein Allmandlos frei w"d. Wenn die Witwe des<br />
Verstorbenen allmandberechtigt ist, behält sie das Allmandlos<br />
bis zu ihrem Tode. Personer die zu einer mehr als einjährigen<br />
Freiheitsstrafe verurteilt werden, können während<br />
der Dauer der Freiheitsstrafe und die folgenden 3 Jahre<br />
keine Allmand erhalten.<br />
<strong>Der</strong> Kauf des Gemeindebürger rechts kann durch einen (zuziehenden<br />
Manne über 24 Jahre beantragt werden: 1.) für<br />
sich, 2.) für seine Frau und seine noch nicht 21 Jahre alten<br />
Kinder.<br />
Bei Antritt eines Allmandloses muß vom Berechtigten ein<br />
Antrittsgeld bezahlt werden. Die Höhe des Einkaufs und des<br />
Antrittsgeldes werden vom Genieindestatut, das der Gemeinderat<br />
den Zeitverhältnissen enispracnend ändern kann,<br />
bestimmt. Allmandteile können von der Gemeinde nicht verkauft<br />
werden.<br />
Die Allmand hatte in früheren ahrhunderten eine große<br />
wirtschaftliche Bedeutung. Die Verdienstmöglichkeiten waren<br />
damals gering, und mancher Familienvater konnte seil e Familie<br />
kaum ernähren. Durch Zuteilung emes Allmandloses<br />
wurde in vielen Fällen die Ernährung der Familie sichergestellt.<br />
Aehnlich war es auch beim Viehbestand.<br />
Noch vor 50 Jahren gruben die Aiimandbesitzer ihre Allmandteile<br />
an Abhängen in mühsamer Arbeit mit dem Spaten<br />
uim. Bei den heutigen v erdienstmüglichkeiten lol \t sich eine<br />
solche Arbeitsform nicht mehr, so daß heute die meisten<br />
Allmandteile in Hanglage in Wiese* umgewandelt wurden.<br />
Es klebt an dem Boden der Aiimand nicht nur der Gedanke<br />
einer uralten, sinnvollen Bodenbewirtschaftung, einer gutdurchdachten<br />
Unterstüt ung ärmerer Kleinbauern, sondern<br />
auch der Schweiß ehrlicher und zufriedener Lebenshaltung.<br />
<strong>Der</strong> materielle Wert der Allmand ist auch heute noch in vielen<br />
Gemeinden licht gemindert. Manche Gemeindöh treiben<br />
auf den Allmandteilen intensive Obstbaumpflege, und
4 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
der Obstertrag gehört jeweils dem Allmandinhaber. Es ist<br />
erklärlich, daß der Kleinbauer seine Allmandrechte nicht<br />
verlieren will. Vielleicht gibt es in Hohenzollern auch Gemeinden,<br />
in denen Allmandlose nicht mehr begehrt sind, besonders<br />
wenn sich gute Verdienstmöglichkeiten bieten. Einige<br />
Gemeinden haben das Allmandrecht mit Geld abgelöst und<br />
teilweise Siedlungsland geschaffen. Doch sollte man an diesen<br />
Vom Heuliecher<br />
Wenn in der Heu- und Oehmdernte die vollgeladenen<br />
Wagen abgeladen wurden, dann schickte der Bauer seine Buben<br />
auf den Heubarn, um das lockere Dürrfutter festzustampfen,<br />
damit alles in den meist nicht großen Barn untergebracht<br />
werden konnte. Durch das Feststampfen und durch<br />
die eigene Schwere bildete der Heustock dann eine feste<br />
Masse, aus der nur schwer Heu zu entnehmen war. Meist<br />
lag das Oehmd direkt auf dem Heu, so daß von oben kein<br />
Heu zum Futterschneiden herunter geworfen werden konnte.<br />
Auch glaubte der Bauer, daß sein Heustock zu schnell abnehmen<br />
würde, wenn der tägliche Bedarf von oben genommen<br />
würde. Deshalb hing im Heubarn ein Heuliecher; es<br />
war ein kräftiger Eisenstab, an dem unten ein runder Holzgriff<br />
und oben ein einseitiger kräftiger Widerhaken waren.<br />
Mit dem Heuliecher zogen die Buben das Heu aus dem Heustock,<br />
was große Mühe verursachte. Es dauerte oft eine halbe<br />
Stunde, bis der Heubedarf am Samstag für das Futterschneiden<br />
bereit lag. Durch die dauernde Benützung glänzte der<br />
Heuliecher wie Silber. Die älteren Buben wußten täglich, daß<br />
diese Arbeit nach dem Nachmittagsunterricht auf sie wartete.<br />
<strong>Der</strong> Bauer begann das Futterschneiden mit der Häckselmaschine<br />
so rechtzeitig, daß er ohne Laterne in der Scheune<br />
auskam. Am Samstag mittag fing das Futterschneiden meist<br />
schon um 3 Uhr an, damit der ganze Bedarf für den Sonntag<br />
gedeckt war. Auf keinen Fall wurde die Futterschneidmaschine<br />
am Sonntag in Bewegung gesetzt. <strong>Der</strong> Heuliecher ist<br />
heute längst verschwunden. <strong>Der</strong> neuzeitliche Bauer häckselt<br />
sein Heu gleich bei der Heuernte und lagert es in dieser Art<br />
im Barn. Vielleicht hängt noch in alten Scheunen an einem<br />
verrosteten Nagel ein alter Heuliecher als Zeuge einer anderen<br />
Arbeitsform. Er sollte dort bleiben, den Alten zur Ehr,<br />
der Jugend zur Lehr.<br />
alten Volksrechten nicht zu sehr rütteln, sie sind wertvollstes<br />
geschichtliches Kulturgut aus der Alamannenzeit.<br />
Es ist nur teilweise bekannt, daß in den Notzeiten der beiden<br />
Weltkriege Allmandbesitzer, die nicht Landwirte waren<br />
und die Allmandteile verpachtet hatten, sich die Pacht in<br />
Naturalien geben ließen. Was dies bedeutet hat, weiß jeder,<br />
der nach Karten kaufen und hungern mußte.<br />
Die Dreikönigsbuben gehen um<br />
In den Tagen vor Dreikönig und am Dreikönigstag selbst<br />
gehen allüberall, soweit üblich, die hl. Dreikönige mit ihrem<br />
Stern von Haus zu Haus. Mancherorts sind außer den Dreikönigen<br />
noch ein Josef oder Herodes dabei. Zuweilen haben<br />
sich in katholischen Gegenden auch Reste des alten Dreikönigsspiels<br />
bis in unsere Zeit erhalten, wie beispielsweise<br />
in Straßberg im hohenzollerischen Oberland. Einer der Dreikönige<br />
trägt einen Stab mit einem Stern, der sich rhythmisch<br />
während des Vortrags nachstehenden Gedichtes dreht:<br />
Die heiligen Dreikönige mit ihrem Slern,<br />
sie suchen den Herrn, sie hätten ihn gern!<br />
Sie kamen vor König Herodes Haus;<br />
Herodes schaute zum Fenster heraus.<br />
Herodes spricht mit falschem Verdacht:<br />
„Warum ist der hintere König so schwarz?"<br />
„Er ist nicht schwarz, er ist wohlbekannt,<br />
ist Kaspars König aus dem Mohrenland."<br />
„So biet du mir die rechte Hand!"<br />
„Mei rechte Hand, die biet ich dir it,<br />
du bist der Herodes, wir trauen dir it."<br />
Und wenn ihr uns etwas geben wollt,<br />
so gebt es uns fein bald,<br />
wir müssen heut noch durch den finsteren Wald,<br />
durch den finsteren Wald, den tiefen Schnee,<br />
der tut den hl. Dreikönig so weh!<br />
Nach der Beendigung des Gedichtes sagt der kleinste der<br />
Dreikönige folgenden Vers:<br />
I bi dr klein König,<br />
Gemmer it so wenig,<br />
Laume it so lang stau,<br />
I muaß glei wieder gau!<br />
August Wahl.<br />
Abschrift der Urkunde, die im Jahre 1819 in den Grundstein<br />
der Junginger Pfarrkirche eingelegt wurde<br />
Unter der beglückten Regierung ries Durchlauchtigsten<br />
Fürsten und Herren, Herrn Friedrich Hermann Otto, Höchst<br />
welcher den 22. Julius v77ti gebohren, neun Jahre als der<br />
Siebente Fürst an der Regierung zu Hohenzollern Hechingen,<br />
seit 1800 mit Luise Pauline Prinzessin von Kurland und<br />
Sagan vermählt, und dermalen mit einem einzigen Sohne,<br />
dem Durchlauchtigsten Erbprinzen Konstantin Friedrich<br />
Wilhelm, seines Alters 18 Jahre, gesegnet ist, wurde gegenwärtige<br />
Pfarrkirche erbaut, da auch der Hochwürdige Herr<br />
RäDhaei Huber, gebürtig von Owingen, Pfarrer, Georg Bumille:<br />
Herrschaftlicher Vogt, Christian Bumilier und Bernhard<br />
Diebold Heiligenpfleger, dann Franz Müller Gerichtsund<br />
Pius Schuler Gemeindebürgermeister wahren. In diesem<br />
gegenwärtigen Zeitpunkt war hier zu Jungingen 178 Bürger<br />
und Wittwen, in dem zu hiesiger Pfarrei gehörigen Filialorte<br />
Schlatt 103 Bürger, und in beiden Gemeinden 1243 Seelen.<br />
Im Laufe von 25 zurückgelegten Jahren wurden folgende<br />
Merkwürdigkeiten erlebt:<br />
Im Jahre 1789 fing das benachbarte Frankreich eine allgemeine<br />
Revolution an, ging in seiner Wuth so weith, daß<br />
es seinen eigenen König Ludwig den XVI. öffentlich enthaupten<br />
ließ. Dieser Königsmord gab Aniaß zu einem blutigen<br />
Krie. welcher zwischen den Franzosen und Allierten<br />
Deutschen Mächten mehrere Jahre mit abwechselndem Glücke<br />
geführt wurde. Im Jahre 1805 warf sich Napoleon Bonna-<br />
arte, aus der Insel Korsika gebürtig, dazumal als erster<br />
Konsul der Französischen Republik zum Kaiser in Frankreich<br />
auf, und setzte den Krieg mit den Allierten Mächten<br />
noch häufiger und blutiger fort, bis er bey Watterlo und<br />
Bellailiannon gänzlich geschlagen, und auf die Insel Helena<br />
verbannt wu_de. In diesen Kriegszeiten in welchen die Franzosen<br />
Deutschlai d viermahl mit ihrer Macht überschwemmten,<br />
und bis in die Oesterreichisch-Preußisch- und Russische<br />
Im Jahre nach Christi Geburt 1819<br />
Monnarchien eindrangen, waren die Beschwerden so groß,<br />
daß nur bey hiesiger Gemeinde der Kosten auf 25 000 Gulden<br />
belief. Auf den im Jahre 1816 erfolgten Frieden fieng<br />
die noth erst recht an, indem vom Monate Aprill bis August<br />
fast unaufhörliches Regenwetter andauerte, welchem wegen<br />
die Früchten und andere Nahrungsmittel sehr schiecht gerathen<br />
sind, und da es auch schon am 8. November wieder<br />
einwinkte, so stieg der Schöffel, das ist 8 Vitel Korn (Vesen)<br />
auf 15 Gulden. Im Jahre 1817 wurde eine solche Theurung.<br />
daß<br />
1 Schöffe] Korn 25 bis 30 fl Gulden, 1 Schöffe! Habe" 15<br />
Gulden, 1 Vitel Krompieren 1 fl 20 xer (Kreuzer), 1 Vitel<br />
Ackerbohnen 4 fl Gulden, 1 Pfund Brod 10 Kreutzer, 1 Pfund<br />
Rirdfleisch 15 Kreutzer, 1 Pfund Kalbfleisch 10 Kreutzer,,<br />
1 Pfund Schmalz 40 Kreutzer, 1 Maß mittleren Wein I fl<br />
4 xer, 1 Maß Bier 12 xer.<br />
Im gegenwärtigen Jahre 1819 wahren die Viktualen Preiße<br />
folgende:<br />
1 Schöffel Korn 4 fl Gulden, 1 Schöffel Haber 2 fl 40<br />
Kreutzer, 1 Vitel Krompieren 15 Kreutzer, 1 Pfund Brod 2<br />
Kreutzer, 1 Pfund Rindfleisch 7 Kreutzer, 1 Pfund Kalbfleisch<br />
6 Kreutzer, 1 Pfund Schmalz 24 xer, 1 Maß Neuer<br />
Wein 32 xer, 1 Maß Bier 6 xer.<br />
In diesem nämlichen Janre 1819 den 6ten May wurde<br />
dieser Grundstein in gegenwart des Herrn Hof und Regierungs<br />
Rath von Giegiing als der Zeit Hochfürstiichen<br />
Komisaier In Geistlichen Sachen durch den hiesigen Hochwürdigen<br />
Herr Pfarrer Raphael Huber eingeweiht und gelegt<br />
worden, und sofort der Kirchenbau unter der Leitung<br />
des Herrn Werkmeisters Johann Walter Sauter, und dessen<br />
Herrn Sohn Jo. Jakob Sauter von Behlingen, mit Großmütigster<br />
Unterstützung des Durchlaucntigsten Fürsten, größter<br />
Thätigkeit der hiesigen Bürger, und Hilfe der benachbarten
Jahrgang 1955 HOHENZOLLERIS C H E HEIMAT I<br />
Orte, für die beiden Gemeinden Jungingen und Schlatt zur<br />
Ehre Gottes, und zur Verherrlichung seines Heiligsten Namens<br />
angefangen. Gott wolle diese Arbeit Segnen, daß demüthige<br />
Gebeth seines Volkes in diesem Tempel gnädig<br />
erhören, und die ganze Nachkommenschaft von allen Übeln<br />
der Seele und des Leibes bewahren, und endlich alle zur<br />
Seeligen Unsterblichkeit in sein Ewiges Reich aufnehmen.<br />
Amen.<br />
Dieses ist die nämliche Abschrift, wie sie im Grundstein<br />
an der hiesigen Kirch ist eingelegt worden, damit es jeder<br />
Leeser nach mehreren Jahren lesen kann, wann daßselbe in<br />
II. Teil<br />
Ist es eigentlich nicht zu gefährlich, aus einem solch schweren<br />
Gebiet, wie es die Sprach- und Siedlungswissenschaft ist,<br />
zu plaudern? Gerade die Flußnamenforschung hängt an einem<br />
Baum der Wissenschaft, der sehr harte Nüsse zu knacken<br />
gibt. Und doch soll das Unterfangen gewagt sein. Es wird<br />
sich nicht darum handeln, den Bestand der gesicherten und<br />
der unsicheren Ergebnisse zu ergänzen oder zu vermehren.<br />
Es soll versucht werden, an einigen Namen auf die Schwierigkeiten<br />
aufmerksam zu machen, die oft einer befriedigenden<br />
Erklärung entgegenstehen.<br />
Schon die Namen der beiden großen Flüsse, die Hohenzollern<br />
an beiden Enden durchlaufen, der Neckar und die<br />
Donau, sind bisher nicht erklärt. Das mag davon herkommen,<br />
daß Wasserläufe von dieser Größe und Länge schon in<br />
allerfrühester Zeit bei Besiedlung der anliegenden Ufer benannt<br />
worden sind. Schriftliche Belege der Lautform aus<br />
solcher Zeit können nicht gefunden werden, weil es sie nicht<br />
gab. Auch herrscht keine Uebereinstimmung darüber, ob die<br />
Namengebung vom Unterlauf und der Mündung aus, oder<br />
vom Quellgebiet aus den Anfang genommen hat. Bei der<br />
Donau nimmt man an, daß der Name flußaufwärts gewandert<br />
ist. Ihr „Ursprung" ist bis heute noch nicht festgelegt.<br />
„Brigach und Breg bringen die Donau zuweg". So haben wir<br />
einst in der Schule vor 60 Jahren gelernt. Andere sagen, die<br />
Donau entspringe im Schloßpark zu Donaueschingen, die genannten<br />
Quellbäche seien Nebenflüsse.<br />
Eine ähnliche Unklarheit haben wir in Hohenzollern bei<br />
der Starzel. Wo entspringt sie? Im Loch, westlich vom Ort<br />
Starzein? Oder im Weilertal, nördlich von Hausen? Oder<br />
stimmt es, wenn behauptet wird, sie bekomme erst ihren<br />
Namen vom Ort ab? Mitten im Ort vereinige sich der von<br />
Norden kommende Hauser Bach, auch Schwarzer Brunnen<br />
geheißen, mit dem von Westen kommenden Schariebach. <strong>Der</strong><br />
Ausdruck Scharlebach ist mir erst jetzt begegnet, er ist aber<br />
noch im Volksmund im Gebrauch und wird bestätigt durch<br />
eine Veröffentlichung unseres verdienten Heimatforschers<br />
Joh. Adam Kraus, Freiburg i. Br. (s. Zollerheimat Jahrg. 37,<br />
Nr. 6/46). Aus einem Originalpergament im Fürstl. Archiv in<br />
Sigmaringen geht klar hervor, daß im Jahre 1559 der von<br />
Hausen kommende Bach mit Starzel und der aus dem Westen,<br />
aus dem Loch kommende Bach Scharlebach heißt.<br />
Eigentlich möchte ich vorschlagen, die Katasterbeamten und<br />
Kartenzeichner möchten diese Benennungen auch in Zukunft<br />
verwenden und festhalten. Sie empfiehlt sich, einmal um<br />
dem Wirrwarr in den Bezeichnungen ein Ende zu machen.<br />
Sie entspricht auch dem natürlichen Lauf, denn der von<br />
Hausen kommende Bach mit den zwei Namen führt in<br />
Starzein gradlinig fort, während der Scharlebach im Bogen<br />
langsam sein Wasser diesem Lauf zuführt, was auch heute<br />
noch nach der Bachkorrektion deutlich sichebar ist. Vor allem<br />
aber empfiehlt sich der Gebrauch, weil die schriftliche<br />
Festlegung im Jahre 1559 bald vierhundert Jahre alt ist. Sie<br />
ist sogar noch älter, denn die erwähnte Urkunde nimmt Bezug<br />
auf eine Renovation vom Jahre 1511, d. h. auf eine Bestandsaufnahme<br />
des Beuroner Besitzes in Starzein. Alierdings<br />
wird es den Starzeinern genau so schwer fallen wie<br />
mir, daß das Flüßchen, das ihrem Ort und ihnen den Namen<br />
gab, auf fremder Gemarkung entspringen soll.<br />
Wenn wir aber den Namen Starzein erklären wollen, so<br />
gibt es gleich noch eine harte Nuß zu knacken. Was heißt<br />
oder bedeutet das Wort Starzein? Seit Michel Buck in seinem<br />
Oberschwäbischen Flurnamenbuch es behauptet hat,<br />
schreiben alle Flurnamenforscher von einander ab, es komme<br />
von Starzein = Abgehauenes Wurzelwerk. Das glaube ich<br />
acht genommen wird, denn es ist vieles daran gelegen, und<br />
es wird in 50 Jahren sehr merkwürdig seyn, wenn man nur<br />
die Frucht-Preiße findet, sowohl auch die andern Plagen,<br />
dessentwegen hat es Christian Bumiller für gut befunden<br />
solches abzuschreiben, und mit Betacht zu bewahren.<br />
Christian Bumiller<br />
Jungingen, den 14ten Juli 1819<br />
Anmerkung: Zur Umrechnung in den heutigen Geldwert:<br />
1 Gulden (60 Kreuzer) um 1800 = 3 Goldmark,<br />
1 Kreuzer um 1800 = 5 Pfennig.<br />
M. Lorch, Jungingen.<br />
Von Flußnamen in Hohenzollern<br />
Eine Plauderei mit vielen Fragen<br />
von Dr. E. F 1 a d<br />
den gelehrten Herren nicht. Erstens bezeichnet man hierzulande<br />
mit Stoizla nur das Wurzelwerk von abgehauenen<br />
Krautköpfen usw., nicht aber von abgehauenen Baumstümpfen.<br />
Krautstoizla hat es aber in solchen Mengen in<br />
jenen Frühzeiten noch nicht gegeben, daß ihr Vorkommen<br />
einem klaren Bächlein hätte Namensgeber werden können.<br />
Vor allem aber frage ich, warum denn die Diphtongierung<br />
von a zu oi beim Bachnamen unterblieben sein soll. Stazla<br />
und Stoizla geht lautlich nicht zusammen. Auch Kraus lehnt<br />
jene Erklärung ab (s. Zollerheimat Jahrg. 36, S. 54) und versucht<br />
eine neue. Er glaubt das Grundwort sei Sturz. Zu<br />
dem oft überschnell anschwellenden, schnell stürzenden Bach<br />
würde jedenfalls der Name Starzel-ach = Sturzbach gut<br />
passen. <strong>Der</strong> Umlaut u zu a verursacht aber doch einige Bedenken.<br />
Ist es überhaupt richtig, Namen aus den Formen erklären<br />
zu wollen, wie sie die älteste Ueberlieferung bietet? Darf<br />
man von solchen ersten schriftlichen Festlegungen aus überhaupt<br />
eine Ableitung versuchen? Die Urformen der Namen<br />
sind sicher viel älter; sie sind wohl schon durch Lautverschiebung<br />
umgeformt, als sie schriftlich festgelegt wurden. Lautformen<br />
durch Schriftzeichen festzuhalten ist sowieso eine<br />
recht mißliche Sache, das zeigen auch heute alle Versuche,<br />
in Mundart zu schreiben. Fachgelehrte nahmen an, die mit<br />
-ach, -aach = Wasser zusammengesetzten Flurnamen seien<br />
meist keltischen Ursprungs, indem die einwandernden, besitzergreifenden<br />
Germanen einem keltischen Namen ihre<br />
Bezeichnung für Wasser anzuhängen oder das Grundwort<br />
germanisch umzudeuten pflegten, während die mit Bach gebildeten<br />
Namen einer jüngeren Zeitstufe angehörten. Sollte<br />
das auch für Starzil-ach der Fall sein? Die Fachgelehrten<br />
nehmen außerdem an, daß die -ach-Flüsse ihre Namen meist<br />
von der Mündung her bekommen hätten; danach wäre zu<br />
prüfen, wie die Besiedlung des Bachiaufes wohl vor sich<br />
gegangen ist. Können die Siedlungsforscher an der Mündung<br />
der Starzel Reste keltischer Niederlassungen nachweisen?<br />
Erforschung des Siedlungsverlaufes könnte darauf<br />
schließen lassen, ob die Benennung des Flusses von seiner<br />
Mündung in keltischem Siedlungslanu he/ ihrer. Anfang genommen<br />
hat. Bisher ist jedenfalls das Wort Starzel noch<br />
nicht einwandfrei erklärt. Soll man der gewiesenen Spur<br />
folgen? Wer hilft? Läßt sich dann vielleicht auch die Verschiedennamigkeit<br />
der Quellbäche erklären? Mag sein, daß<br />
man dann auch eine Antwort findet auf die Frage, warum in<br />
diesem Fall der Bachname nicht, wie sonst üblich dem Tal<br />
den Namen gegeben hat, sondern der Haupt-Kirchweiler<br />
= Killer entscheidend war.<br />
Soll man aber wirklich glauben, daß die -ach-Namen aus<br />
keltischen Grui. dwörtern hervorgegangen sind? Fast wäre es<br />
schade beim Plaudern davon auszugehen, denn es fielen so<br />
schöne Erklärungen in sich zusammen, wie sie sich bei Ableitungen<br />
aus germanischen Grundwörtern ergeben, Erklärungen,<br />
die unser Vorstellungsvermögen zur Anschaulichkeit,<br />
ja zu dichterischer Schau anregen. Eyach ist uns dann der<br />
Eibenbach. Zahl und Verbreitung dieses schönen Baumes<br />
muß einstmals dort viel größer gewesen sein. Nach diesem<br />
Baum haben wir als Jungen die Flitzebogen, mit denen wir<br />
Pfeile verschossen, Eiben genannt, auch wenn wir dem<br />
wachsamen Waldschütz ein anderes biegsames Stämmchen<br />
entluchst hatten. Wir wollen doch lieber annehmen, das germanische<br />
Wort liege zugrunde. Entweder hat das Flüßchen<br />
doch erst später den -ach-Namen erhalten, oder ein zu<br />
Grunde liegendes keltisches Wort ist zu einem germanischen<br />
umgedeutet worden.
6 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
Das lustige Bächlein mit dem Namen Fehla zaubert uns<br />
ein Tai oder dessen Anhöhe vor Augen, das mit Felben oder<br />
Felgen, mundartlich Feala = Weidenbaum bewachsen ist.<br />
Heute sind nur wenige Weidenbüsche am Bachrand zu finden.<br />
Sollen wir uns die schöne Vorstellung dadurch zi -<br />
stören lassen? Wenn der Zauber wissenschaftlich nicht haltbar<br />
sein sollte, so ist er wenigstens poetisch.<br />
Und wie steht es mit der Lauchert? Man hat den Namen<br />
als Lohach erklärt, das wäre der Waldbach Locn zu<br />
Lauch, wobei h = ch zu sprechen ist (vgl. hoch, honer). <strong>Der</strong><br />
Ortsname Aichelau auch Aychiloh bedeutet doch wohl nichts<br />
anderes als Eichenwald. Daß Lach = Grenzmark in Frage<br />
komme, darf man füglich bezweifeln, da erdkundlich und<br />
geschichtlich keine Grenzziehung durch das Flüßchen festzustellen<br />
war. Verständlicher ist schon, Lauch = Krümmung<br />
anzunehmen. Das Flüßchen macht tatsächlich recht viel Bogen<br />
durch sein Tal, vom Ursprung bis zur Mündung in die<br />
Donau. Diese Benennung wäre noch bestimmter und anschaulicher<br />
als Waldbach. Das entspräche der scharfen Beobachtungsgabe<br />
jener alten naturverbundener Menschen, die<br />
aas Wort fanden, oder, besser gesagt, erfanden.<br />
Was soll man aber mit der S e c k a c h anfangen? Ist es<br />
der Sickerbach? Oder hängt das Grundwort mit siechen =<br />
versiegen zusammen? Das Bächlein ist recht munter und<br />
lebhaft. Es ist aber doch möglich, daß in früheren Zeiten<br />
das Wasser nur spärlich floß. Klima, Feuchtigkeitsverhältnisse<br />
und Baumbestand sind in früheren Zeiten oft anders<br />
gewesen als heute. Wir wissen von schweren Erdbeben, die<br />
Veränderungen im Gefolge hatten, ist doch die Schera ganz<br />
verschwunden und hat einmal dem ganzen Gau den Namen<br />
Scheragau gegeben. Wir dürfen daher nicht allzuschnell<br />
vom heutigen Zustand des Baches oder Taies auf den früheren<br />
schließen.<br />
Man sieht, die Erklärung aller Bezeichnungen ist nicht<br />
leicht. Keinesfalls darf man sich mit sprachgeschichtlichen<br />
Kenntnissen und Erklärungen begnügen; man muß auch He<br />
Wissenschaft des Spatens, der Erdkunde und der Siedlungsforschung<br />
heranziehen. Auch dann gelingt es nicL* immer,<br />
Licht ins Dunkel zu bringen. Dichten und Deuten liegen<br />
nahe beieinander. Auch wissenschaftliches Denken and Forschen<br />
verlangt oft ein Verdichten, wie die reine Dichtkunst,<br />
bis sie ein schau- und faßbares Geblide hervorbringt, das<br />
der bestmöglichen Erklärung nahekommt, um einen Zipfel<br />
des geheimnisvollen großen Buches der Vergangenheit zu<br />
lüften.<br />
A b 1 a c h hält man für keltisch und unerklärbar. In ihrer<br />
Nähe fließt aber die O s t r a c h. Das ist doch wohl der Ostbach,<br />
der östliche Bach. Einem Ostbach pflegt allgemein ein<br />
Westbach zu entsprechen. Ist es allzu kühn, anzunehmen,<br />
daß Ablach = Abendbach ist Mit Abend (gegen Abend usw.)<br />
wird der Westen oft bezeichnet. Ein keltisches Vorwort<br />
braucht man dann nicht zu suchen. Ohne keltisches Grundwort<br />
geht's auch bei der S c h m e i e, in alten Urkunden<br />
Schmye geschrieben. Es liegt das Wort schmiegen zugrunde.<br />
Die Schmiegach ist daher das Wässerchen, das sich dem Gelände<br />
anschmiegt.<br />
Die wenigen Beispiele genügen wohl, zu zeigen, wie schwer<br />
die Wort- und Namenkunde ist. Die gelehrten Forscher haben<br />
ihre Freude daran, Rätsel zu lösen. Wir andern freuen<br />
uns an ihren Lösungen und ihren Versuchen. Gern lauschen<br />
wir dem Klang der Worte und ahnen eine Bedeutung aus<br />
urfernen Zeiten. Wer will uns dabei wehren, mit dem Herzen<br />
zu denken?<br />
Vordogmatische Immaculatabilder in Hohenzollern<br />
<strong>Der</strong> Jahreskreis: 8. Dezember 1953 bis 8. Dezember 1954<br />
wurde für die kath Christen als ein sogenanntes „marianisches<br />
Jahr" ausgerufen mit dem Wunsche, daran zu denken,<br />
daß vor 100 Jahren (1854) der Immakulata-Glaubenssatz<br />
feierlich verkündet wurde. Die Pilgerorte im Iniand und<br />
Ausland wurden in dieser Zeit zahlreich besucht. Gleichsam<br />
eine nachträgliche Säkularfeier soll es sein wenn eine Uebersicht<br />
über die zollerischen Immakulata-Bilder, die vor 1854<br />
entstanden sind, gegeben und dadurch zugleich ein Beitrag<br />
zur hohenzoll. Kultur- und Geistesgeschichte geleistet wird.<br />
I.<br />
Die Glaubenslehre von Marias unbefleckter Empfängnis<br />
brauchte einen Weg von vielen Jahrhunderten bis zu ihrer<br />
feierlichen Verkündigung. Im ersten Jahrtausend war man<br />
geruhsam gläubig und stützte sich auf die Aussprüche der<br />
alten Kirchenväter; dann begann, angeregt durch die mystische<br />
Strömung im Geistesleben, die Diskussion über Marias<br />
Bevorzugung und daran anschließend eine lebhafte Kontroverse<br />
unter den Gelehrten und Ordensschulen, besonders bei<br />
den Dominikanern und Franziskanern. Gerade diese letzteren<br />
dürfen den Ruhm in Anspruch nehmen, besondere Verteidiger<br />
der marianischen Glaubenslehre gewesen zu sein.<br />
Dabei wurden sie unterstützt in ihrem Streben von der theoretischen<br />
und praktischen Zustimmung im Volke und auch<br />
von gelegentlichen Kundgebungen der Päpste: Sixtus IV.<br />
sprach einem marianischen Meßformular für den 8. Dezember<br />
seine Billigung aus, bereicherte die feierliche Meßgestaltung<br />
mit Ablässen und nahm die Lehre und ihre Anhänger<br />
in seinen päpstlichen Schutz. Pius V. verbietet .570 unter<br />
Berufung auf das Konzil von Trient die übereifrige Disputation<br />
über die zur „frommen Meinung" gewordenen Lehre<br />
und reiht den 8. Dezember in die Zahl der gebotenen Feiertage<br />
ein. Veranlaßt durch heftige Streitgespräche in Spanien<br />
ergeht 1616 durch eine Bulle Pauls V. ein strenges Verbot,<br />
in Vorlesung und öffentlicher Predig' den Satz von der<br />
unbefleckten Empfängnis in Abrede zu stellen. Um 1650 findet<br />
man eine allgemeine Anerkennung doch erst nach 200<br />
Jahren (1854) wird der Satz feierlich und endgültig verkündet.<br />
Bald bricht er neugestaltend auch in den Garten der<br />
christlichen Kunst ein. Während der Disputationszeit findet<br />
sich präludierend statt eines fertigen Bildes nur eine Andeutung<br />
oder ein Symbol, hauptsächlich in liturgischen Büchern<br />
und illustrierten Kalendern. Bald ist dargestellt die<br />
Begegnung "in Joachim und Anna unter der goldenen Tempelpforte;<br />
bald is> es eine Mariengestalt, die umgeben wird<br />
von Engeln mit Spruchbändern, oder Propheten des alten<br />
Bundes oder auch von mittelalterlichen Gelehrten, die in<br />
ihren Schriften hinweisen auf den in Frage stehenden Glaubenssatz.<br />
Die marianische Tätigkeit des Franziskanerpapstes Sixtus<br />
IV. (1471—1484) und die zunehmende Verehrung und<br />
Pietät der Gläubigen drängte die Künstler, neue Formen für<br />
das Konzeptionsbild zu suchen. Und sie machen sich daran,<br />
hauptsächlich in Italien (Dosso-Dossi, Catignola, Signorelli)<br />
una in Spanien (Vargas, Ribera, Juan de Juanes). Die endgültige<br />
Immakulata-Darstellung verdanken wir dem Ausgang<br />
des 16. und dem Anfang des 17. Jahrhunderts. Fußend<br />
auf dem Reformgedankengut, das die große Kirchenversammlung<br />
von Trient (1545—1563) geschaffen, und das der<br />
gottseiige Pius V. zur Beseitigung vieler Mißstände mit Kraft<br />
und Energie unter Kirchen- und Laienständen ausbreitete,<br />
war eine Zustimmung kühner Unternehmungen und eine Atmosphäre<br />
siegesgewissen Arbeitseifers entstanden. Von diesem<br />
Geiste der Zuversicht wurden Fürsten und Völker, Gelehrte<br />
und Künstler ergriffen. Nun will man keine Pieta<br />
mehr; selbst das schmerzvolle Kreuz tritt etwas in den Hintergrund.<br />
Man sucht Bilder, die Sieg und Triumph und Auferstehung<br />
verkünden. Dazu gehört auch das Bild der Immakulata,<br />
für dessen Ausgestaltung die Apokalypse, das Buch<br />
vom christlichen Endsieg, willkommene Grundlage schafft,<br />
das im zwölften Kapitel von einer Frau spricht, die bekleidet<br />
ist mit der Sonne, den Mond zu ihren Füßen und auf<br />
ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen hat. Um Maria<br />
als Siegerin zu zeichnen, wird fernerhin die Weissagung der<br />
ueiiesis beigezogen, wo ein Weib in fernen Zeiten erscheinen,<br />
der Schlange den Kopf zertreten und ein Gegenbild<br />
zu E"a sein wird. Damit sind die Grundzüge für ein persönliches<br />
Immakulata-Bild gegeben, die zu verwerten nun<br />
die Aufgabe der Künstler wurde. Und sie zeigen sich dieser<br />
Aufgabe gewachsen und formen in Holz und Stein und in<br />
Farben ein sieghaftes Marienbild, meist ohne Kind und<br />
durchtränken es mit dem hoheitsvollen und feierlichen Geiste<br />
des Barocks. Ausgangspunkt ist Italien (Guido Reni, Tiepolo),<br />
von wo es den Weg sucht über Oesterreich und Vorarlberg<br />
nach Bayern und Süddeut ohland. Ausgangspunkt ist aber<br />
ebenso sehr Spanien (Roelas, Zurbaran, Cano), wo es mit<br />
lokal-religiör 5" Inbrunst gesättigt wir« und dann seinen Weg<br />
über die Niederlande nach Norddeutschland nacht. Doch alle<br />
diese Bilder können sich nicht messen mit den Immakulata-<br />
Werken, die H er Spanier Esteban Murillo geschaffen hat, die<br />
seinen Künstlerruhm hinausgetragen haben in alle Kulturländer<br />
und welche die religiöse spanische Volksseele her«vorragend<br />
verkörpern.<br />
II.<br />
Die Weile der religiösen Zuversicht nach der Trienter Kirchenversammlung<br />
versandete nicht in den Kultur- und Kunstzentralen,<br />
sondern wogte und kreiste weiter auch auf das<br />
flache Land und in die einsamsten Dörfer. Trient wirkte wie
Jahrgang 1955 HOHE ZOLLERISCHE HEIMAT 7<br />
Inneringen Photo Haselmeier<br />
ein warmer Föhn nach des Winters Ende und weckte überall<br />
neues Geistesleben und gab dem Kunstwillen des Volkes<br />
und den Künstlern neuen Impuls. Von ihm berührt, bevölkern<br />
sich die Kirchen mit neuen Gestalten (Immakulata-,<br />
Josephs-, Rosenkranzbildern). Auch im Zollerland haben sich<br />
mehr als zwei Dutzend Immakulata-Darstellungen erhalten<br />
aus der Zeit vor der Dogma-Erklärung 1854. Keines davon<br />
dürfte allerdings über das Jahr 1700 zurückgehen.<br />
a) Plastik. Ein Steinbild, das 1754 die Künstlerhand<br />
Weckenmanns gefertigt, stand ehemals über dem Eingang<br />
der 3t. Annakirche in Haigerloch. Nach kurzer Zeit<br />
wurde die Anlage durch Blitz stark beschädigt und in ein-<br />
Mekhingen Photo Keidel-Daiker<br />
Benzingen Photo Haselmeier<br />
facher Form wieder aufgestellt. Nur als Torso ist das Marienbild<br />
samt Erdkugel auf uns gekommen, das jahrelang<br />
„als Treppentritt" im Kaplaneihaus eingemauert war. Nur<br />
die allgemeinsten Umrisse des Bildes lassen sich wahrnehmen;<br />
ein Glück ist es, daß wir durch andere Stücke des Meisters<br />
reichlich entschädigt werden, die auch eine Vorstellung<br />
geben von der Eigenart seines Denkens und seiner Arbeitsweise.<br />
— Ein Immakulatabild, mehr als ein Meter hoch,<br />
zierte früher Owingens altes Weihnachsheiligtum, wanderte<br />
später in das Schwesternhaus und wird dort sorglich<br />
betreut und hoch geschätzt. Nach Mitteilung von Pfarrer<br />
Riegger erhielt schon 1709 ein Seitenaltar der Pfarrkirche<br />
Inzigkofen Photo Haselmeier
8<br />
die Weihe auf den Titel „zu Ehren Mariens der unbefleckten<br />
Empfangenen", sicherlich ein Beweis, wie der Glaube und<br />
der Kult der Immakulata auch auf dem Lande Wurzel gefaßt<br />
hat und vertrauensvoll gepflegt wurde. Auch ist nicht<br />
von der Hand zu weisen, daß gerade diese Altarweihe die<br />
spätere Anfertigung eines entsprechenden Bildwerkes angeregt<br />
hat. Es ist kein übles Bild geworden: Diese Muttergottes<br />
in weißem Gewand mit hochgerafftem Mantel, die Rechte<br />
vor die Brust legend, in der Linken eine Lilie tragend. Die<br />
schlangenumwundene Erdkugel ist zu ihren Füßen. Verhaltene<br />
Anmut ist ausgegossen über das Werk, in welchem der<br />
Schöpfer in Farben und Linien zu schwärmen verstand. —<br />
Auch Jungingen hatte einst in der Annakapelle ein<br />
holzgeschnitztes Empfängnisbild; es mag aus der Zeit 1740/50<br />
stammen. — <strong>Der</strong>selben Zeit gehört ein Marienbild in " a 1 -<br />
mendingen an. Die Kirchengemeinde ist glücklich zu<br />
preisen, daß ihm die ursprüngliche Fassung noch geblieben<br />
ist, und daß es nicht farbig und goldig eingekleidet wurde<br />
wie der hl. Joseph, der wohl vom gleichen Schnitzer kommt.<br />
Dieser war ein Ingenium, das seine Werke mit empfindsamstem<br />
barockem Geiste durchpulsen konnte und alle Mittel<br />
seiner Kunstvirtuos in den Händen hatte und spielen<br />
ließ. Erdkugel und Schlange und die Sternenkrone dürfen<br />
nicht fehlen. Maria trägt ein weißes Gewand mit flatterndem<br />
blauen Mantel und eine Lilie in der Hand.<br />
In der Michaelskapelle in Gammertingen ist eine<br />
kleine Holzstatue (30 cm) eine reizende Kleinarbeit, aus der<br />
Zeit von 1760, die wohl einem Kunstbetrieb vielleicht in der<br />
Gegend von Riedlingen entstammen könnte, der eingestellt<br />
war auf die Fertigung solcher niedlichen Stücke. Maria steht<br />
in wehendem Mantel auf der Erdkugel. — In gleicher Größe<br />
und gleicher Qualität, nur ohne Fassung, ist ein solches Figürchen<br />
in Stetten u. H. — Im Spethischen Schloß zu<br />
Hettingen sind die Decken der Wohnräume und des<br />
Treppenhauses mit mannigfaltigen Stuckornamenten verziert.<br />
An der Decke der ehemaligen Schloßkapelle ist ein schiefartiges<br />
Immakulatabild, wohl aus der Zeit um 1720. Die Madonna<br />
hat die Erdkugel und Mondsichel zu ihren Füßen<br />
und trägt in der rechten Hand ein Szepter. — Gerne wird<br />
Maria wiedergegeben mit ihrem Kind auf den Armen, weil<br />
dieses Kind Grund ihrer Größe und Verehrung ist; auf Immakulatabildern<br />
dagegen ist sie selten zu sehen mit dem<br />
Kind. Doch in Inneringen haben wir ein Beispiel auch<br />
für diese Darstellungsweise. In ernster Gelassenheit, fern<br />
von aller spätbarocken Gliederverzerrung und unmotivierten<br />
Kleiderwirbel steht Maria auf Erdkugel und Schlange;<br />
wohlgeordnet gehen die Falten ihres Gewandes bodenwärts;<br />
ihre Linke rafft den Mantel und trägt das Gotteskind; in<br />
der Rechten hält sie das Königsscepter. <strong>Der</strong> Blick ihrer Augen<br />
spiegelt Ernst und Würde wieder und weckt Zuneigung<br />
und Vertrauen. Um das Haupt sind goldene Strahlen und ein<br />
Sternenkranz. Wir haben eine wunderbare Verschmelzung<br />
von malerischer Feinheit und großer Form, von Devjtion<br />
und Selbstbewußtsein. Die Statue geht bis gegen das Jahr<br />
1700 zu. ück.<br />
Ein Maria-Empfängnisbild ist auch in Benzingen aus<br />
der Zeit um 1730. Die Erdkugel, mehrmals von der Schlange<br />
umwunden, ist der Muttergottes zum Fußschemel geworden.<br />
Die triumphale Kraft der Unschuld leuchtet auf in Gesicht<br />
und Gestalt; ein Strahlenkranz umfunkelt da . Haupt unu erhöht<br />
die Grazie in Wendung und Neigung; die rechte Hand<br />
erhebt das Scepter, das Zeichen der Macht und der schenkenden<br />
Gnadenfülle. — Nicht unerwähnt soll bleiben ein Bildwerk<br />
in V i 1 s i n g e n, bei dem der Schöpfer eine würdige<br />
Muttergottes mit frommem Ausdruck und gefalteten Händen<br />
schuf, in nebensächlichen Dingen aber ungehemmt einer malerisch-dekorativen<br />
Passion sich überließ. Vier geflügelte<br />
Engelsköpfe zieren neben der Schlange die Erdkugel; unmotiviert<br />
umflattert der Mantel die Gestalt; in seinen Falten<br />
und Bäusche macht sich sogar ein Engelskind heimisch wie<br />
anderswo an den Gesimsen und Säulen von Barockaltären.<br />
— Um die Zahl der zolleriscnen Immakulata-Darstellungen<br />
vollständiger zu machen, seien noch Bilder durchschnittlichen<br />
Charakters genannt; aus der Mitte des 18. Jahrhunderts in<br />
Storzingen, Ablach, Glashütte, Otterswang.<br />
Wenn sich im Jahr 1955 der Todestag von Kari Schoy zum<br />
dreißigsten Male jährt, so dürfen wir mit Recht Anlaß nehmen,<br />
dieses bedeutenden Sohnes unserer hohenzollerischen<br />
Heimat ehrend zu gedenken. Wer weiß, wer Kari Schoy<br />
war? Nur wenige wissen noch von ihm. in Hohenzollern ist<br />
er fast /ergossen, und doch hat sein 'Name in der wissenschaftlichen<br />
Welt einen guten Klang. Um es vorweg zu sa-<br />
HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
Karl Schoy zum Gedenken<br />
b) Malerei. Auch die Künstler mit Pinsel und Palette zögerten<br />
nicht, Maria zu ehren und dem Volke in seinem Marienglauben<br />
entgegen zu kommen.<br />
Bevor der Kreuzweg nach St. Luzen in Hechingen beginnt,<br />
begrüßt uns an der Straße eine kleine Kapelle, über<br />
deren Eingang die Jahreszahl 1720 zu lesen ist. In derselben<br />
ist ein Immakulata-Bild, das 1950 restauriert wurde. Weißgewandet<br />
und mit blauem Mantel steht Maria in der Mondsichel<br />
und auf der Erdkugel, die umschlungen ist von der<br />
Höllenschlange mit einem Apfel im Rachen. Die rechte Hand<br />
ruht vor der Brust, die linke zeigt nach unten; um ihr rosengeschmücktes<br />
Haupt ist ein lichter Schein; über ihr schwebt<br />
die Gestalt des hl. Geistes; ihr zur Seite 9 geflügelte Engelköpfe<br />
mit Blumenkränzen. — Die Kirchendecke zu Weilheim<br />
trägt ein Bild von Ferd. Dent (1769 im Ton gemalt).<br />
Maria, stehend dargestellt, legt die rechte Hand vor die Brust<br />
und trägt mit der linken Hand eine Lilie; zu ihren Füßen<br />
sind Erdkugel und Schlange und Mondsichel, neben ihrem<br />
Haupte die Taube des hl. Geistes. In ganz ähnlicher Weise,<br />
in Oel gemalt, mit einem Sternenkranz um das Haupt und<br />
von einigen Engeln umschwebt, ist Maria wiedergegeben auf<br />
einem Tafelbild in R i n g i n g e n, das ebenfalls Ferdinand<br />
Dent 1769 fertigte.<br />
Eifrige Marienverehrer scheinen ehemals die Gläubigen von<br />
Melchingen gewesen zu sein: an der großen Strahlenmonstranz<br />
aus der Zeit von 1750 ist neben Gott Vater und<br />
dem hl. Geist in Silber getrieben auch ein Immakulatabild.<br />
1772 wird der Nebenaltar auf der Epistelseite geweiht „zu<br />
Ehren von Maria, der unbefleckt Empfangenen"; 1793 wird<br />
für diesen Altar ein großes Blatt geschaffen von Konrad<br />
Zoller, Hofmaler in Möhringen. Maria im weißen Kleid und<br />
blauen Mantel steht auf der Erdkugel; mit der Linken greift<br />
sie nach einer Lilie, die ein Engel ihr entgegenhält, ein anderer<br />
Engel auf einer Wolkenbank bietet ihr einen Kranz<br />
von weißen Rosen an. Um ihr Haupt ist ein heller Schein,<br />
über ihr der hl. Geist. — Mancherorts wurden früher bei<br />
Prozessionen Stäbe getragen, an deren oberen Ende ovale gemalte<br />
Täfelchen mit den Rosenkranzgesetzen waren, gewöhnlich<br />
beginnend mit Maria Empfängnis. Es hat sich ein solches<br />
in Melchingen erhalten aus der Zeit um 1780. Maria ist wiedergegeben<br />
im weißen Kleid und blauen, faltenreichen, wehendem<br />
Mantel; mit der Linken weist sie nach oben, gleich<br />
als ob sie predigen wollte: zu Füßen sind Mondsichel und<br />
Erdkugel, um das Haupt zwölf Sterne. — Weitere Tafelbilder,<br />
in Oel auf Leinwand gemalt, in mehr oder weniger gleicher<br />
Ausführung sind in Steinhilben aus der Zeit von 1780,<br />
in Feldhausen, gemalt um 1750 von Joh. Bapt. Bommer,<br />
in Hochberg (Rundbild) um 1790, in Sigmaringen<br />
(Haus Nazareth) aus der Zeit von 1740.<br />
¿Vn der Holzdecke der Friedhofskirche zu V i I s i n g e n ist<br />
Maria gewandet in rotes Kleid und blauem Mantel; über<br />
ihrem HauDt.e sind zwei Engel, welche die Hostie verehren.<br />
— Eine Darstellung besonderer ATt ist in der Einsiealerkapelie<br />
zu Inzigkofen; dei Maler Phil. Zehender (1730)<br />
greift zurück auf frühere Bilder. Tn der Mitte steht Maria<br />
auf Erdkugel und Schlange; über ihr sind die drei göttlichen<br />
Personen, welche die Mitwirkung bekunden bei ihren Gnadenvorzügen.<br />
Von der Geistestaube gehl ein Licht- und<br />
Gnadenstrahl auf einen Spiegel („Spiegel ohne Mäkel"), den<br />
I T aria in der linken Hand hält, von welchem er dann zurückgeworfen<br />
wird auf ihr Kerz Die untere Bildhälfte füllen<br />
vier Engel mit Bändern, deren Beschriftung auf Marias unbefleckte<br />
Empfängnis sich bezieht: „Nur für dich nicht, sonst<br />
fuT alle ist erlassen dieses Gesetz" (Esth. 15). — „Ganz schön<br />
bist du, meine Freundin" (Hohes Lied 4). — „An welchem<br />
Tage du davon ißest, wirst du des Todes sterben" (Gen. 217).<br />
— „Keine Makel ist an dir" (Höh. Lied f).<br />
Diese T Übersicht gestattet uns einen Einblick in die Gedanken-<br />
und Glaubenswelt unserer Vorfahren. Waldenspul.<br />
Anm jrkung: Erst seit 1945 ist in der Kirche in Gammertingen ein<br />
Oelbild: Maria, der cH nge -";n Kopf zertretend, in blumendurchwii'<br />
tem hellblauem Kleid und azurblauem Mantel, in Ergriffenheit<br />
beide Hände auf der Brust haltend. Hinter dem mit Lilien geziertem<br />
Haupt strahlt die Sonne, als menschliches Gesicht gezeichnet. <strong>Der</strong><br />
Heilige Geist sendet von rechts einen Lichtstrahl gegen das Haupt<br />
der Jungfrau. Auf der andern Seite zwei Putten. N. M.<br />
gen: Ksrl Schoy war, als er im 49. Lebensjahr, in der Fülle<br />
seiner Forschungsarbeit stehend, von uns gehen mußte, der<br />
beste Quellenforscher auf -lern Gebiete der<br />
a abischen Astronomie und .lathema ük.<br />
In Bittelschieß ist er am 7. April 1877 als Sohn des Lehrers<br />
G'istav Schoy (aus Bisingen) geboren. Er sollte wie sein<br />
Vater Lehrer werden, und so ließ er sich nach Entlassung
Jahrgang ln55 HOHE" ZOLLERISCHE HEIMAT 9<br />
aus der Volksschule ins Lehrerseminar Meersburg am Bodensee<br />
aufnehmen. Seine überdurchschnittliche Begabung und<br />
sein Wissensdrang führten ihn aber bald über den Volksschuldienst<br />
hinaus. Ganz auf sich selbst gestellt, nur mit<br />
einem Lateinlehrer zur Seite, erarbeitete er sich am Realgymnasium<br />
in Karsruhe 1901 die Reifeprüfung. Dann studierte<br />
er in München und Heidelberg Mathematik und Physik.<br />
Nach Ablegung der Prüfung für das bayrische Lehramt<br />
in Mathematik und Physik kam er als Praktikant nach Buchen<br />
in Baden, nach Baden-Baden und Mannheim. Die Mittel<br />
zum Studium verschaffte er sich durch Stundengeben.<br />
Schon während seines Studiums in München war er aus dem<br />
gleichen Grund als Rechner an der dortigen Sternwarte tätig<br />
gewesen. Diese Beschäftigung an der Sternwarte hatte<br />
sein Interesse für Astronomie geweckt, und so widmete er<br />
sich neber seiner beruflichen Tätigkeit mit ganzer Hingabe<br />
dem Studium der Astronomie und der Geschichte dieser Wissenschaft<br />
und der Mathematik.<br />
So kam Richtung in sein geistiges Leben. Die Ueberfüllung<br />
des Lehrerberufes in Süddeutschland veranlaßte Karl<br />
Schoy, noch in Bonn •— im Jahre 1906 •— die Prüfung für<br />
das höhere Lehrfach in Preußen abzulegen. Daraufhin wurde<br />
er 1908/1909 wissenschaftlicher Hilfslehrer in Mühlheim a. d.<br />
Ruhr und am 1. April 1909 Oberlehrer am städtischen Gymnasium<br />
mit Realgymnasium in Essen. Damit hatte er seine<br />
Lebensstellung erreicht. In Essen lernte er, in der Prima des<br />
Gymnasiums, die Duisburger Kaufmannstochter Frieda Ettwig<br />
kennen, die 1912 seine Frau wurde. Unterdessen hatte<br />
er schon 1911 in München den Dr. ing. erworben mit der<br />
Arbeit „Die Geschichte der Polhöhenbestimmung bei den<br />
älteren Völkern". Im Jahre 1913 promovierte er nochmals in<br />
Heidelberg als Dr. phil. nat. mit der Dissertation „Arabische<br />
Gnomonik" (Astronomische Berechnungen mit Hilfe des<br />
Schattenzeigers, einer Art Sonnenuhr.) Diese und andere Arbeiten<br />
ließen K. Schoy zu der Erkenntnis kommen, daß er<br />
Arabisch können müsse, um weiter zu forschen, und er<br />
machte sich trotz eines Nierenleidens, das sich schon 1913<br />
meldete, und belastet mit vollem Schulunterricht, an das<br />
Studium dieser schwierigen Sprache. Einen Krankheitsurlaub<br />
in der Heimat im Jahr 1917 benützte er zu Studien in<br />
Tübingen, die er von Essen aus noch durch ein Semester in<br />
Bonn ergänzte. Das meiste aber mußte er sich durch Selbststudium<br />
aneignen. Zu Arabisch, das er mit unnachahmlicher<br />
Eleganz geschrieben habe, fügte er noch Persisch und Türkisch.<br />
Etwa um das Jahr 1918 konnte er beginnen, arabische<br />
Handschriften zu lesen, die er sich unter den größten materiellen<br />
Schwierigkeiten verschaffte.<br />
Im Jahre 1920 trat Schoy mit der ersten Frucht seiner<br />
Mühen hervor, indem er die Uebersetzung einer Arbeit des<br />
arabischen Gelehrten Ibn Yunus (f 1009) erscheinen ließ.<br />
Ein Rangendinger Kelch<br />
Die katholische Kirchengemeinde Rangendingen besitzt einen<br />
Keich aus Kupfer, reich mit Muschelwerk getrieben und vergoldet.<br />
Am unterer Rande des Kelchfußes ist folgende Inschrift<br />
eingraviert: Gervasi Waagur Burger u. Chur-Fürstl.<br />
Minz Schlosser Maister von München 1750. Wie kam nun<br />
dieser Kelch nach Rangendingen Wie wir aus der Geschichte<br />
des dortigen Kloster der Dominikanerinnen wissen, stammte<br />
der größte Teil der Klosterfrauen vorab des 18. Jahrhunderts<br />
aus Bayern, was auch für alle Klöster Hohenzollerns<br />
dieser Epoche zutrifft. Daß aus ein und derselben Familie<br />
aber gleich drei Töchter im selben Kloster den Schleier<br />
nahmen, ist eine große Ausnahme. So trat als erste aus dieser<br />
Münchener Familie Schwester Maria Johanna in Rangendingen<br />
ein und legte am 29. Oktobe 1 1749 die Ordensgelübde<br />
ab. Geboren war sie am 23. 6. 1727 in München. Wir<br />
dürfen annehmen, daß der oben beschriebene Kelch ein Profeßgeschenk<br />
der Eltern an das Ra lendinger Kioster ist und<br />
dürfen uns freuen, daß er bei Aufhebung des Klosters nicht<br />
auch auf dem Altar des Staates geopfert wurde. Im Jahre<br />
1764, am 10. Oktober, machte eine leibliche Schwester der<br />
vorigen unter dem Klosternamen Maria Johanna Pia im<br />
Rangendinger Kloster Profeß. Sie war am 16. 1 2. 1764 in<br />
München geboren und hatte wohl anläß" ch von Besuchen bei<br />
ihrer Schwester in Rangendingen den Klosterberuf heb gewonnen.<br />
Leider war bei ihrer Profeß ihre älteste Schwester<br />
schon nicht mehr am Leben, so erbte sie ihren Klosternamen.<br />
Als dritte der Familie Wagus legte Schwester Maria Columba<br />
a Nativitate Domini am 14. 9. 1 io8 im Alter von 22 Jahren<br />
im Kloster zu Rangendingen die* ewigen Gelübde ab. Leider<br />
mußte sie die Aufhebung ihres Kloster erleben, das gerade<br />
500 Jahre mit Unterbrechungen bestanden hatte. So zog sie<br />
mit noch vier Schwestern nach dem Kloster Gnadental zu<br />
Schon 1919 hatte sich unser Gelehrter in Bonn habilitiert<br />
und dort auch eine Antrittsvorlesung gehalten. Seine Berufung<br />
nach Bonn scheiterte aber an den Wirren der Besatzungszeit.<br />
Bald folgte Forschungsarbeit auf Forschungsarbeit.<br />
Es würde zu weit führen, hier auch nur die Mehrzahl seiner<br />
ungefähr siebzig wissenschaftlichen Abhandlungen anzuführen.<br />
Nur des Beispiels wegen seien folgende Arbeiten genannt:<br />
„Die Gnomonik bei den Arabern" (von einem Fachgelehrten<br />
als seine schönste selbständige Arbeit bezeichnet),<br />
„Die Geschichte der Zeitmessung und der Uhren", „Sonnenuhren<br />
der spätarabischen Astronomie", „Beiträge zur arabischen<br />
Trigonometrie", „Aus der astronomischen Geographie<br />
der Araber", „Ueber das regelmäßige Siebeneck und die<br />
Winkeldrittelung bei Griechen und Arabern".<br />
Es ist fast unbegreiflich, wie Karl Schoy das alles leisten<br />
konnte, während seine Erkrankung immer weiter fortschritt.<br />
Im Herbst 1923 mußten ihm Teile seines Magens weggeschnitten<br />
werden. Dazu große wirtschaftliche Not! Seine<br />
Frau, ausgebildet im künstlerischen Bucheinbinden, stand<br />
ihm treu zur Seite. Im April und Mai 1924 suchte er Erholung<br />
in Mentone, am 1. Oktober 1924 mußte er sich, nachdem<br />
er aus Gesundheitsrücksichten eine Honorarprofessur in<br />
Berlin hatte ablehnen müssen, in den Ruhestand versetzen<br />
lassen. Noch wollte er an der Universität Frankfurt a. M.<br />
einen Lehrauftrag für Geschichte der exakten Wissenschaften<br />
im Orient ausüben. Aber seine kühne Lebenskurve endete<br />
jäh, als ihn zu einer Zeit, da man auch im Ausland auf<br />
ihn aufmerksam geworden war •— er hatte den Lehrstuhl<br />
einer amerikanischen Universität (Columbia University) angeboten<br />
bekommen •— in Frankfurt a. M. an einem Schlaganfall<br />
am 7. Dezember 1925, schließlich doch unerwartet, der<br />
Tod hinwegraffte.<br />
Karl Schoy ist zeitlebens ein „derber Schwöb" geblieben.<br />
Er war ein gütiger, bescheidener und uneigennütziger Mensch.<br />
Seine von Fachgelehrten bewunderten Arbeiten nannte er<br />
immerwieder „Stöpseleien". Außer der Wissenschaft liebte er<br />
besonders die Musik. Seine Frau schrieb einmal: „Er spielte<br />
sich •— am Klavier — in seine Kindheit zurück und Kinderlieder,<br />
Volkslieder, Messen, Marienlieder, derer er eine Unzahl<br />
kannte, bekommen unter seinen Händen eine entzükkende<br />
und hinreißende Harmonie: die eines reinen Herzens<br />
und eines unbefangenen Gemüts, die sich wie durch ein Wunder<br />
von allen Schlägen des Schicksals nicht hatte zerstören<br />
lassen."<br />
In Verehrung gedenken wir des bedeutenden Sohnes unserer<br />
hohenzollerischen Heimat, der allzufrüh seine Seele in<br />
die Hand des Schöpfers zurückgeben mußte und der, wäre<br />
ihm eine weitere Schaffensperiode geblieben, der Welt sicher<br />
noch große wissenschaftliche Leistungen und Forschungsergebnisse<br />
geboten hätte. (Nach H. Wieleitner-München.)<br />
Josef Mühlebach.<br />
und seine Stifterfamilie<br />
Stetten b. Hech., wo der kleine Rangendinger Konvent im<br />
sog. Beichthaus zum Aussterben verurteilt war. Sie starb<br />
als letzte der Rangendinger Klosterfrauen am 13. 2. 1829<br />
abends 6 Uhr an i [terstuberkulose und wurde wohl auf dem<br />
Friedhof bei Hl. Kreuz beigesetzt, wo sich auch noch das<br />
Grab der letzten Stettener Klosterfrau erhalten hat.<br />
In diesem Zusammenhang soll noch eines weiteren Heiligtums<br />
gedacht werden, das sich ehemals im Kloster Rangendingen<br />
befunden hat. Es handelt sich um einen Kreuzparakel,<br />
der wohl in einem sog. Wettersegen geborgen war.<br />
Die dazu gehörende Authentik (Echtheitsbescheinigung) befindet<br />
sich im Fürstl. Archiv zu Sigmaringen mit folgenden<br />
Erläuterungen: Particulas er ligno Sanctissimae Crucis Domini<br />
nostri Jesu Christi (Teilchen vom allerheiiigsten Kreuzholz<br />
unseres Herrn Jesus Christus). Die zu dieser Krev<br />
Partikel gehörende Authentik ist vom 4. Novembe* 1731. datiert.<br />
<strong>Der</strong> Prälat des Klosters Irrsee (Bayeris Schwaben)<br />
bestätigt dem ehemaligen Eigentümer dieser Kreuzpartikel,<br />
nämlich dem Josef Käss von Leimnau deren Echtheit. Käss<br />
hat diese Kreuzpartikel dem Gotteshaus Ranendingen (wohl<br />
Rangendingen) verehrt. Vermutlich hatte dieser Josef Käss<br />
eine Töchter daselbst. Diese Vermutung des Sigmaringer<br />
Archivars hat sich beim Studium des Rangendinger Profeßbuches<br />
bestätigt. Am 30. Januar 1743 machte Schwester Maria<br />
Josepha Kasonin im Kloster Rangendingen Profeß. Sie<br />
war am 14. 4. 1721 in Leimnau bei Irrsee geboren und starb<br />
als Subpriorin am 27. 2. 1786. Es scheint sich bei diesem Wettersegen<br />
um jenes silberne Kreuz zu handeln, das der Hechinger<br />
Stadtpfarrer Broderotti am ?9. Dezember 1802 in Rangendingen<br />
mit noch weiteren Kirchengeräten abholte und der<br />
gnädigsten Herrschaft übergab. Wo es wohl hinkam? F. St.
10 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
Vom Zehnten, unter besonderer Berücksichtigung Ringingens<br />
Zu den bedeutendsten Abgaben unserer Vorfahren gehörte<br />
bis um 1860 der zehnte Teil an Früchten, Heu und<br />
Tieren. <strong>Der</strong> Zehnte war ursprünglich eine Abgabe an die<br />
Kirche, die ihn nach dem Vorbild des Alten Testamentes<br />
(Levit. 27, 30 fg.) zum Unterhalt ihrer Priester und der<br />
kirchlichen Gebäude seit ältester Zeit erhob. Im fränkischen<br />
Reich wurde durch die Synode von Mäcon im J. 585 das<br />
alte Zehntgesetz neu eingeschärft. Karl Marteli hat es zweifellos<br />
bestätigt (so Weikmann in Dtsche Gaue, Kaufbeuren,<br />
1951, 23) und Pipin erklärte 754 und später Karl der Große<br />
den Zehnten als pflichtmäßige Abgabe, die mit staatlichen<br />
Zwangsmitteln von den Bischöfen eingetrieben werden<br />
konnten. <strong>Der</strong> Zweck dieser Maßnahme war die finanzielle<br />
Sicherstellung der Kirche als der Hauptträgerin der<br />
Kultur. Zehntberechtigt waren damals nur die Pfarrkirchen.<br />
Nach einer Bestimmung vom J. 810 hatte jede Pfarrkirche<br />
ein Verzeichnis aller zugehörigen, also zehntpflichtigen Höfe<br />
anzulegen und so die Pfarrgrenze als Zehntgrenze genau<br />
festzustellen. Schon das Kapitulare von 819 erlaubte die<br />
Schaffung neuer Zehntbezirke in neugegründeten Orten mit<br />
neuer Kirche, auch wenn diese nicht Pfarrkirchen, sondern<br />
nur Eigenkirchen waren. Unter solchen versteht man Privatkirchen,<br />
die von irgend einem Herrn für seine Leute erbaut<br />
und sein eigen waren, wobei er das Eigentum über<br />
Bau, Vermögen, Grundstücke, Opfergelder und die ^ehntfrüchte<br />
(wenigstens in fränkischer Zeit) behielt und auch<br />
den Pfarrer ein- oder absetzen konnte. Diese bloßen Zehntkirchen<br />
wurden meist bald Pfarrkirchen. In der um 550 vermutlich<br />
von Chur aus gegründeten Diözese Konstanz, zu der<br />
unsere Gegend bis 1827 gehörte, war nach Luzian Pfleger<br />
der Zehnte anfangs in vier Teile geteilt: ein Viertel sollte<br />
der Bischof erhalten, ein Viertel der Pfarrer, ein Viertel die<br />
Kirche (der Heilige, dessen Vermögen etwa seit dem 12.<br />
Jahrhundert vom Pfarrgut getrennt erscheint), und das<br />
letzte Viertel die Armen. Dagegen bestimmt zur Zeit Kaiser<br />
Karls das Kapitular von Aachen im Jahr 801: Die Geistlichen<br />
sollen vor Zeugen den Zehnten in Empfang nehmen<br />
und ihn in drei Teile teilen, einen für die Kirche, einen für<br />
die Armen und Fremden und einen für den Pfarrgeistlichen.<br />
Aber bald wurde es hiermit anders. Die Sründer und Besitzer<br />
von Eigenkirchen zogen trotz des Widerstands der<br />
Bischöfe den Zehnten ein von allen freien und unfreien<br />
Hintersassen und verabreichten davon dem Seelsorger nur<br />
sein Viertel bezw. Drittel, während sie das andere alles für<br />
sich behielten, allerdings auch mit dem Pfarrgeistlichen nach<br />
Anteil der Baulast von Kirche und Pfarrhaus trugen. Papst<br />
Alexander <strong>III</strong>. (1159—1181) suchte in kirchlichem Interesse<br />
die Befugnisse der Eigenkirchenherrn auf ein Präsent; tionsoder<br />
Vorschlagsrecht (jus patronatus) zu reduzieren, das er<br />
aus Dankbarkeit den Stiftern von Kirchen bezw deren Nachkommen<br />
einräumte. In Wirklichkeit bedeutete der neue<br />
Name noch lange die alte Sache. Allmählich kamen auch andere<br />
Laien durch Schenkungen, Verpfändungen Käufe und<br />
Schutzvogteien in das volle Verfügungsr^cht über den sog.<br />
Kirchensatz (d. h. Kirche mit Vermügen Zehnte - und<br />
Recht, den Pfarrer zu ernennen (Zeitschr f Gesch. d. Oberrheins,<br />
1920. S. 245—61). So entstand der Laienzehnt.<br />
Nur das Viertel des Pfarrers blieb meist unangetastet,<br />
manchmal erhielt er auch 1 Drittel. In Ringingen dagegen<br />
oezog er seit mindestens 1545 auch schon zuvor nur e i n<br />
Achtel, die Herrschaft Fürstenberg dagegen sieben<br />
Achtel des Zehntens!<br />
Es gab i) Gewerbezehnten oder Personalzehnten, der oft<br />
früh abging, z. B. Schäferzehnten von durchziehenden Schafherden,<br />
b) dinglichen Zehnten, der in Groß- und Kleinzehnt<br />
g stellt war. Zum ersten gehörten alle Kalmfrüchte, die „an<br />
die Garb kommen", mancherorts auch das Heu, zum Kleinzehnt<br />
dagegen die andern Garten- .ind Ackerfrüchte (später<br />
st.'', c.. 1760 auch Kartoffeln), sowie der sog. lebende oder<br />
Blutzehnt von Schweinen, Kälbern, Hühnern, Gänsen, Ziegen<br />
usw. <strong>Der</strong> Kleinzehnt und der von Heu und "on Neubrüchen<br />
(durch den Pflug neu umgebrochene Allmenden)<br />
stai meist dem Pfarrer zu. Doch sind örtliche Unterschiede<br />
zu beobachten! Die Unbeliebtheit des Zehnten ist schon im<br />
Jahr 888 erwähnt! (L. Pfleger, Die Elsäßische Pfarrei, 1936.)<br />
Als Beispiel mögen die Verhältnisse im hohenzollerischen<br />
Ringingen rwähn' sein (für Trochtelfingen siehe M'itt. d.<br />
Vereins f. Gesch. Hohenz. 1904, 47 fg.).<br />
Am 5. Dezember 1345 verkauften Wernher der alte Boller,<br />
seir° Gattin Agnes und beider Enkel Agnes, Hailwig, Anne<br />
und Beth ihren vierten Teil des Laienzehnten ZM Ringingen<br />
um 60 Pfund Heller (= 5 280 Goldmark!) an den Grafen<br />
Friedrich von Zollern genannt Straßburger. Graf Ostertag<br />
von Zollern verpfändete am 12. 5. 1386 sein Viertel des Gesamtzehntens<br />
zu Ringingen mit zwei leibeigenen Familien<br />
Schuirer gegen eine Schuld von 130 Pfund Heller (= 8 580<br />
Goldmark) an den jungen Sweniger von Liechtenstein (Mon.<br />
Zoll. I, Nr. 400). Am 6. Juni desselben Jahres erhielt der<br />
gleiche Sweniger v. L. mit Truchseß Georg von Ringingen<br />
vom gleichen Grafen als Pfand gegen geliehene 800 Pfd.<br />
Hlr. seinen Teil an Burladingen mit Kirche und Kirchensatz,<br />
sowie den Weiler Mayingen dabei, alles mit Vogtrecht, Gericht<br />
und Zehnten beiderorts (M. Zoll. I. 402). Bei der<br />
Teilung der zollerischen Brüder im J. 1402 erhielt Gr. Eitelfriedrich<br />
unter anderem auch das Zehendli zu Ringingen.<br />
Die andern drei Viertel des Laienzehnten befanden<br />
sich wohl in Hand der Truchsessen von Ringingen bis 1391,<br />
des Heinrich von Killer-Ringelstein bis um 1410, der Gebrüder<br />
Hans Schwelher bis 1450, dann deren Erben von Königseck,<br />
First, Späth, Ow und Westernach. Das Späth'sche<br />
Viertel des Dorfes ging 1507/8 tauschweise gegen das verbrannte<br />
Schloß Wartstein an der Lauter in zollerischen Besitz<br />
über, nachdem die übrigen drei Teile samt dem Zehnten<br />
an die Grafen von Werdenberg zu Trochtelfingen gekommen<br />
und dann 1534 an deren Erben Fürstenberg übergingen.<br />
Vom Jahr 1545 haben wir zwei ausführliche Beschreibungen<br />
des Ringinger Herrschaftsbesitzes und damit des Zehnten<br />
(Archiv Donaueschingen). Damals bezog den Großzehnten<br />
von Roggen, Vesen, Haber, Emmer, Gerste und<br />
dergleichen Frucht, „die an die Garb kommt", zu drei Teilen<br />
die Herrschaft Fürstenberg und zu einem Viertel die Grafschaft<br />
Zollern. Doch war von dieser Teilung ausgenommen,<br />
was auf dem Seeheimer Berg gebaut wurde. Davon gehörte<br />
der Zehnt ausschließlich der Grafschaft Zollern, was vermutlich<br />
mit der ehemaligen dortigen Burg Eineck, oder alt<br />
„Frundsbürglin", zusammenhängt. Von den Aeckern und<br />
Egerten, die auf Seeheimerberg streckten, gehört der Zehnt<br />
beiden Herrschaften gemeinsam, wohl je halbteilig, die<br />
Landgarbe dagegen vom Seeheimerberg (d. h. von den dortigen<br />
herrschaftlichen Grundstücken, die gegen die neunte<br />
Garbe an die Ringinger verpachtet waren) ging im Verhältnis<br />
3 zu 1 an Fürstenberg und Zollern.<br />
Beide Herrschaften haben bisher, heißt es weiter, von<br />
diesem Zehnten dem Pfarrer zu Ringingen jährlich 20 Scheffel<br />
Vesen und 10 Scheff. Haber (Reutling Meß: 1 Schf. = 1,77<br />
hl) und je ein Fuder Winter- und Haberstroh als Besoldung<br />
gegeben. Außerdem gaben sie an die Kaplanei<br />
an der St.. Gallenkirche 'seit 1535 der Pfarrei) .8 Scheffel<br />
Vesen und 12 Scheffel Haber, sowie je 1 Fuder Winter- und<br />
Haberstroh und das Kurzfutter von beiden. <strong>Der</strong> Zehnt von<br />
allen Aeckern auf Markung Ringingen, die an die Heiligenpfiege<br />
U. L. Frau zu Killer Zins oder Ackerfeld zu zahlen<br />
hatten, fiel Zollern allei zu ; . Auch die beiden Lehengüter<br />
des Klaus uhd Konrad Kiot*. (heute Haus 12, ein Truchtelfinger<br />
S. Gallenlehen, und Hs. 24 wohl „Des Schwarzen<br />
Hof", beiö e seit alters Zollern unterstehend) gaben ien<br />
Zehnten halb an Zoilern und halb an die gemeinschaftliche<br />
Zehntscheuer von Fürstenberg-Zollern zu Ringingen (jetzt<br />
Zieglers Haus 81).<br />
Alle Neubrüche (aus neugerodetem Gebiet) lieferten den<br />
Zehnten dem Pfarrer, umgebrochene W.sen dagegen den<br />
Herrschaften. Wenn dagegen Aecker angeblümt und ?.u Wiese.<br />
gemacht wurden, Tehörte der Heuzehnt wieder dem<br />
Pfarrer. Das Pfarrwiddum (Pfründegüter) und die herrschaftlichen<br />
Wiesen (ohne Rücksicht auf die Lage „Schloßwiesen"<br />
genannt) waren zehntfrei, ebenso die Güter des Johanniterhöfles<br />
zu Jungental-Starzeln auf Markung Ringingen.<br />
<strong>Der</strong> Kleinzehnt von Heu, Erbsen, Linsen (bei beiden<br />
redet man heute noch von Buschein, nicht Garben), Bohnen,<br />
Rüben, Kraut, Obst, Zwiebeln, Hanf, Flachs und dergleichen<br />
(seit 1765 auch Kartoffeln) stand dem Pfarrer zu.<br />
Außerdem auer Vieh- oder lebende Zehnt, doch mußte er<br />
dafür den Eber unterhalten., was im 17. Jahrhundert abgeschafft<br />
wurae. <strong>Der</strong> Hanfsame gehörte dem Heiligen; die<br />
Pfleger hatten ihn zu dreschen und zu säubern (Oelgewinn<br />
ung!). Die herrschaftliche Zehntscheuer oben im Dorf war<br />
usiden Herrschaften gemeinsam und wurden von ihnen im<br />
Verh; ' is 3 zu 1 unterhalten, teils unter Ausnutzung der<br />
Fronpfiicht der Einwohner.<br />
Die Wiesen des Heufeldes waren angeblich zehntfre>; doch<br />
sind bei den einzel: jn Oehenhöfen von 1545 jeweils kleine<br />
Geldbeträge für Heufeldzehnten an die Herrschaft angesetzt
JE "¿ang 195-- HOHENZOLLEEISCEEHEIMAT 11<br />
(so z. B. für 4 Mannsmad Wiesen: 1 Schilling und vier Heller<br />
= 1.90 Goldmark). <strong>Der</strong> Zehnt von den im 18. Jahri- mdert<br />
auf Heufeld angebauten Kleinzenntfrüchten im Wert<br />
von zirka 74 Gulden bekam der Saimendinger Pfarrer (weil<br />
das Ringinger Heufeld auf Markung Saimendingen liegt),<br />
trotzdem sein Ringinger Kollege ihm dieses Recht zeitweise<br />
streitig zu machen suchte. Die 889 württbg. Morgen umfassenden<br />
Ringinger Felder daselbst gaben in J. 1860 an Fürstenberg<br />
1039 Garben oder 66 Scheffel Haberzehnt.<br />
Im Laufe der Zeit hat sich durch Uebergans der Naturalwirtschaft<br />
zur Geldwirtschaft der Zehnt überlebt- Auch war<br />
bei drohenden Gewittern ja das Ahwarten der Zehnigänger<br />
jedes einzelnen Zehntherrn auf den Aeckern, welche die<br />
Garben von Acker zu Acker auszählten, sehr hinderlich gewesen.<br />
Gelegentlich werden Klagen laut über ingleiche<br />
Größe der Garben, wobei man die Zehntgarbe kleiner zu<br />
machen suchte! Andererseits hatten die Bauern lieber Naturalien<br />
gegeben, mit denen sie dann weiter keine Arbeit<br />
hatten, als das rare Geld.<br />
Merkwürdigerweise hat man beim Uebergang der Herrschaft<br />
Trochtelfingen im J. 1806 von Fürstenberg an Hohenzollern-Sigmaringen<br />
den Zehntbezug der bisherigen Standesherrschaft<br />
belassen, wie auch den Kirchenpatronat. Seit<br />
der Revolution von 1848 ist der Ruf nach Ablösung der Zehnten<br />
und anderen Reallasten immer stärker geworden. I n<br />
ganz Hohenzollern wurden die Zehnten<br />
dann auf Grund des Gesetzes vom 2 8. Mai<br />
1860 endgültig abgeschafft. Die Ringinger Verhandlungen<br />
leiteten Regierungsassessor von Aweyde von<br />
Hechingen und der fürstenb ergische Sekretär Finninger, die<br />
am 30 Januar 1861 die genaue Zehntbeschreibung mit Durchschnittsberechnung<br />
seit 10 Jahren vorlegten. 1848—50 war<br />
der Großzehnt infolge der unruhigen Zeitläufe nicht erhoben<br />
worden. <strong>Der</strong> Zehntvergleich kam betr. Ringingen am 8. Februar<br />
zustande. <strong>Der</strong> Durchschnittsertrag des Großzehnten<br />
von 1850—1859 betrug jährlich 52 757 Garben oder Vesen<br />
213 Scheffel, 2 Simri, Schwachvesen 23V2 Scheffel, Roggen<br />
4 Schf. 7 Sri, Gerste 5 Sch. 7 Sri., Haber 165 Schf 4>/2 Sri.;<br />
Stroh 2 878 Buschein und an Brietz, Schwachs und anderen<br />
Abfall 78 fl 34 Kr.<br />
<strong>Der</strong> Vergleich setzte fest, Fürstenberg solle hierfür jährch<br />
'¡850 f := 5 700 Goldmark) und die »farrei 294 fl = 388<br />
Goldmark) erhalten. Das Ablösungskapital im 18fachen Betrag<br />
wurde auf 51 300 fl berechnet, wobei die Gemeinde<br />
Ringingen von der letzten Reichung des Zehnten in Natura<br />
St. Ottilien zu Hechingen<br />
Dem Finderglück von Fritz Staudacher, dem emsigen Forscher<br />
über Fechingen und Umgegend, verdanken wir folgende<br />
UrkundenaDschrift aus dem Pfarramt Hechingen bezw.<br />
fürstl. hohenzoll. Dom.-Archiv (R 78, 98). Sie fehlt in den<br />
Monumenta Zollerana, die bekanntlich nur das Grafennaus<br />
und viel zu wenig das Land Hohenzollern berücksichtigen<br />
und dringend Ergänzung in dieser Richtung bedürfen. Die<br />
Urkunde wirft neues Licht auf die Ottilienpfründe<br />
zu St. ' juzen in Hechingen und den Weiler ob<br />
Schlatt, über den wir 1952 S. 47 an dieser Stelle berichteten.<br />
inzwischen hat auch C. Bumiller das Abbruchsjahr<br />
der Katharinenkapelle im Weiler mit 1806 (10. September)<br />
festgestellt (Hohenz. Heimat 1954, S. 40). Ueber den Hof des<br />
Klosters Alpirsbach zu Schlatt scheint bisher nichts bekan<br />
t gewesen zu sein. Vgl. den Aufsatz „Aus der Ortsgeschichte<br />
von Schlatt" von Landrat Dr. H. Speidel in der<br />
„Festschrift zum Kreismusikfest zu Schlatt 1954", auf den<br />
Heimatfreunde besonders hingewiesen seien.<br />
„Berhtold der Tüwinger und seine Frau Haedwig, Bürger<br />
zi Reutlingen, geben an eine ewige Messe am St. Ottilienaltar<br />
ii> der Pfarrkirche St. Luzen zu Hechingen eine jährliche<br />
Gilt von 28 Schf. Vesen, Hechg. Meß, ui l 24 Schf. Haber<br />
aus ihren Gütern zu Wiler ob Schlatt, nämlich 8<br />
Schf. Vesen und 7 Schf. Haber aus Benzen des Mägers Gut.<br />
Aus Wernhers des Muhsels Gut, des vorgenannten Benzen<br />
Mägers Sohn, gehen 4 Schf. Vesen und 7 Schf. Haber. Aus<br />
Wernhers des Hatters Gut 4 Schf. Vesen und 2 Schf. Haber<br />
und 10 Herbsthühner. Us des Knollen Gut und aus Kuonen<br />
Gut 2 Schf. Haber. AL Benzen des Müllers Gut 4 Vesen und<br />
3 Schf. Haber, alles Hechinger Meß. Berntoid hat auch an<br />
die genannte Messe 1 Mit. Kernen ewiger Gilt ebenfalls<br />
Hechg. Meß, gegeben, die er gekauft hat umb ain Füllin 1 ).<br />
Dieses Malter geht aus der Herren Hof von Alpirsbach zu<br />
5 c h 1 a 11, den di Frigen (Freien) bauen und welcher der<br />
,Iesse a ls freies Eigengut verschrieben ist. Weiter erhält<br />
die Stiftung 4 Pfd 6 Sch. Hlr. jährlich, nämlich 1 Pfd. aus<br />
der Mühle zu Weiler, die Benz der Müller hat, 16 Sch.<br />
Hlr und 2 Fastnachtshühner aus Hans Engelfrieds Haus am<br />
Sülchentor zu Rottenburg, das Hainz Böhli innehat.<br />
1 860 fl, bis zum Ausführumgstermin am T. Juli 1861 noch<br />
1 425 fl nachzuzahlen hatte.<br />
Zur Abzahlung dieses Kapitals mußten die Zehntpflichtigen<br />
jährlich eine Zehntrente von 1861—1917 in löhe von<br />
2 459 fl aufbringen für den Großzehnt, und f r den Kltinzehnt<br />
des Herrn Pfarrers 179 fl 37 kr. und demselben für<br />
etwas Großzehnt aus Neubrüchen usf. 45 fl 47 kr. und 4 fl<br />
28 kr. Die Geldverrechnung hatte die Hohenzollerische<br />
Rentenbank übernommen, an welche also bis ii den ersten<br />
Weltkrieg hinein die jährliche Zehntrente zu zahlen war, de<br />
sie die Zehntberechtigten mit Rentenbriefen in entsprechender<br />
Höhe ausgesteuert hatte.<br />
Erst in neuerer Zeit lesen wir auch von Laster die auf<br />
dem Zehntbezug von Anfang an ruhten, nämlich (Teil)Besoldung<br />
des Pfarrers (1545) und aushilfsweise Baupflicht zur<br />
Kirche, falls die Heiligenpflege nicht stark genug sein sollte.<br />
Im Jahr 1707 hatte die Herrschaft Fürstenberg ein Drit<br />
t e 1 der Kosten des neuen Kirchenbaues zu Riningen mit<br />
800 fl (= 3 200 Goldmark) übernommen (doch ist der Turm<br />
nicht mitgerechnet, da er erst 1720 erstellt wurde!) 1860 heißt<br />
es: <strong>Der</strong> Großzehntherr hat zu Ringingen die Baupflicht zum<br />
Langhaus mit Chor, Sakristei und Paramentenkammer samt<br />
Inbau, wie Hochaltar (doch ohne besondere Verzierung),<br />
Kanzel, Taufstein, Beicht- und Betstühle, Turm und westliche<br />
Friedhofs- bezw. Stützmauer. Alles andere hat die<br />
Kirchengemeinde zu unterhalten und zu bauen, besonders<br />
auch die erforderlichen Fuhr- und Handfronen unentgeltlich<br />
zu leisten, während der Pfarrer einen jährlichen Baubeitrag<br />
von 10 Gulden zu geben hat.<br />
Am 3 0. Juni 1862 wurden nun auch diese<br />
Baulasten abgelöst: Nebenaltäre, Uhr, Glocken und<br />
Orgel übernahmen die Pfarrkir ¡er samt den vorerwähnten<br />
Fronen. Fürstenberg zahlte als Großzehntherr zur Ablösung<br />
4 375 Gulden (= 8 750 Goldmark), der Pfarrer aber als<br />
Kleinzehntherr 625 fl (= 1 250 Goldmark). Aus der Endsumme<br />
von 5 000 fl wurden verschiedene Bau- und Reparaturfonde<br />
gebildet, die als wertbeständig angesehen wurden.<br />
Ein großer Irrtum, wie wir am eigenen Leib erleben mußten!<br />
Außerdem hatten die Zehntherren schon bisher beim Unvermögen<br />
der Heiligenpflege jährlich zwischen 56 und 133<br />
Gulden zuschießen müssen. Jetzt zahlte Fürstenberg als<br />
Ablösung 1 750 fl und die Pfarrpfründe 250 fl, die ebenfalls<br />
angelegt wurden. So glaubte man für die Zukunft vorgesorgt<br />
zu haben. Die alte Institution des Zehnten hatte damit ihr<br />
Ende gefunden. Krs.<br />
und Weiler ob Schlatt 1355<br />
17'/2 Schilling Heller aus Hansen üuderlins Geseß am Sülchentor<br />
daselbst. Aus Hugen des Gebeis wies zu Bühl am<br />
Neckar in Stainach am Unterwasser 15 Sch. Hlr. Ferner 10<br />
Sch. Hlr. aus Samiels des Juden Haus von Tübingen zu<br />
Rottenburg, das er vom Boltringer kaufte, zwischen<br />
Fritz KenfBKs und Dietrichs des Boltringers Haus gelegen.<br />
7V2 Sch. Hlr. aus aer Knöllinen Haus zu Rottenburg<br />
•wischen Pfaff Hansen des Webers Haus und dem Haus, das<br />
ihres Vaters war.<br />
Dies alles geschah mit Zustimmung des Herr Grafen<br />
Friedrich von Zol r 2 ), Lehensherr und Kirchherr<br />
des Gotteshauses zu Hechingen, der diesen Altar<br />
dem Bruder des Stifters, Pfaff Heinrich, geliehen<br />
hat. Die Wertmüllerin gibt an diesen Altar 6 Hlr. aus der<br />
Bahwies bei Ebenloch. Die Sütlin gibt 6 Hlr. aus der Wies<br />
beim vorderen Weingarten, die jetzt ihrer Schwester Kinder,<br />
die Andelfinerinnen, haben. Wurk (Burkart?) der Esel gibt<br />
dazu das Hölzlin in Studach, das Ruf Malmsheim hat, daraus<br />
er jährlich 3 Herbsthühner gibt. Es stößt an Rapoltz<br />
Holz und des Lämmers Holz.<br />
Dieser Brief war zuerst anders geschrieben und wurde<br />
erneuert wegen einiger Gilten, die im bresthaften Brief<br />
nicht standen.<br />
Zeugen: Albrecht der Smit, Heinrich der Wirt, Cunrad der<br />
Wicker, sein Bruder Benz Mäslin und Benz von Jungingen<br />
und andere.<br />
Siegler: die Stadt Hechingen.<br />
Datum: Sonntag nach Margarethen Tag (19. Iuli) 1355.<br />
Rückseite: Verschreibung an St Ottilienaltar: Vesen 28<br />
Scheffel, Haber 24 Scheffel, Kernen 1 Malter, Hühner 14,<br />
Geld 4 Pfd. 6 Schi. Hlr.<br />
*) Mit Füllin ist wohl Albrecht gemeint, ein Angehöriger<br />
des Geschlechts der Fülhin zu Hechingen.<br />
2 ) Friedrich von Zoliern ist der Vitztum: 1298 noch unmündig,<br />
1325 Kirchherr zu Pfullingen, 1328 Vitztum von<br />
Augsburg, 1339 Administrator der Grafschaft Zollern,<br />
gest. 15. Dzb. 1361 (Hohz. Forschungen 156 f; Mon Zoll.<br />
I. S. 200 und besonders M. Walter in „Zeitschrift für<br />
Gesch. d. Oberrneins" 96, 1948, S. 307—323.) Kr.
12 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
Das Alemannische Institut in Freiburg i. Br., über dessen<br />
Bedeutung für Hohenzollern im Jahrgang 1953 dieser Zeitschrift,<br />
Seite 58, berichtet wurde, legt sein zweites Jahrbuch<br />
vor. Das „Alemannische Jahrbuch 1954" umfaßt 450 Seiten<br />
mit 44 Abbildungen im Text und kostet in solidem, schmukkem<br />
Ganzleinen-Einband 25.— DM. Es kann durch jede<br />
Buchhandlung oder unmittelbar vom Verlag Moritz Schauenburg<br />
in Lahr, Baden, bezogen werden.<br />
Von den vierzehn Beiträgen, die das Buch enthält, sind<br />
wieder eine Reihe für Hohenzollern sehr wichtig. Willy<br />
B a u r plaudert über „Schwäbische Kalenderheilige in<br />
Spruch und Brauch". Mancher Hörer von Baurs Radio-Vorträgen<br />
wird dankbar sein, wenn er diese in gedrängter Form<br />
nun auch schriftlich besitzt. Fritz Langenbeck, einer<br />
der gründlichsten Ortsnamenforscher der Gegenwart, bietet<br />
in diesem Jahre „Beiträge zur Weiler-Frage", durch welche<br />
ein vielumstrittenes Problem zu einem Abschluß gebracht<br />
wird, der alle befriedigen dürfte, die sich mit dieser Frage<br />
allseitig und ohne Voreingenommenheit beschäftigen. Seine<br />
Ausführungen sind für uns schon deshalb wichtig, weil Hohenzollern<br />
heute noch zwanzig alte Weiler-Namen besitzt,<br />
zu denen die Namen von fast ebensovielen abgegangenen<br />
„Weiler"-Siedlungen und außerdem noch die Namen Weilheim<br />
und Weildorf kommen.<br />
Dr. Hans J ä n i c h e n steuerte eine Abhandlung über:<br />
„Dorf und Zimmern am oberen Neckar" bei. Da beide Namen-Gruppen<br />
auch bei uns vorkommen, verdient der Aufsatz<br />
unsere besondere Beachtung. Bei den „Zimmern"-C ten<br />
bin ich zu etwas anderen Ergebnissen gekommen (Vgl.<br />
Schwäbisches Tagblatt - Hohenzoll. Zeitung vom 4. 9. 1948:<br />
Zimmern und Heiligenzimmern). Bei den „Dorf-Siedlungen<br />
decken sich unsere Ergebnisse (Vgl. Schwäb. Tagblatt - Hohenz.<br />
Zeitung vom 19. März, 30. April und 7. Mai 1949: Die<br />
hohenzollerischen -dorf-Siedlungen )f. Hohenzollern bietet<br />
auf diesem Gebiete einige recht überzeugende Beispiele, so<br />
in Weildorf, wo der Graf Gerold, der Schwager Karl des<br />
Großen, Besitz hatte, und vor allem Mindersdorf, der „Herberge<br />
der Könige", wie es im Jahre 997 genannt wird, dessen<br />
Bedeutung der bekannte Rechtshistoriker Dr. Franz<br />
Beyerle in seiner Untersuchung: „Rast, Sattellöse, Sentenhart:<br />
drei oberschwäbische Ortsnamen und ihr verfassungsgeschichtlicher<br />
Hintergrund" in der Festschrift für Ernst<br />
Ochs (Moriz Schauenburg, Lahr, 1951) klar herausgearbeitet<br />
hat. Bei der Zusammenstellung der Orte in der Goldineshuntare<br />
Seite 156 vermißt man deshalb ungern den Namen Mindersdorf,<br />
aber auch den Namen Liggersdorf sowie das hohenzollerische<br />
Oberndorf und die badischen Orte Sauldorf<br />
und Worndorf. <strong>Der</strong> andere Namen für die Goldineshuntare<br />
(S. 156), der späteren Grafschaft Sigmaringen, war Ratoldesbuch,<br />
die mit dem Fritgau im 9. Jahrhundert für kurze Zeit<br />
durch Personalunion verbunden war. Die verschiedenen Heudorf<br />
dürften in dem Bestimmungswort ihres Namens (S, 155)<br />
Alemannisches Jahrbuch 1954<br />
Eine Buchbesprechung<br />
wohl kaum alle auf unser heutiges Wort Heu zurückgehen,<br />
da einige andere Ableitungen für dieses Wort möglich sind.<br />
Ganz einverstanden bin ich mit Dr. Jänichen, daß die Ortsnamen<br />
nicht nur Modebenennungen sind, sondern einen realen<br />
Hintergrund haben, also eine eigene Siedlungsstruktur<br />
andeuten. Bei der Untersuchung unserer „Beuren"- und<br />
„Hausen"-Orte bin ich zu dieser Ueberzeugung gekommen<br />
Sehr wichtig für Hohenzollern ist sodann die Arbeit von<br />
Professor Dr. Fr. Huttenlocher: „Vom Werdegang der<br />
oberschwäbischen Kulturlandschaft", die den Raum zwischen<br />
Donau und Bodensee, also das ganze südliche Hohenzollern<br />
samt der Exklave Achberg umfaßt, und eine auf gründlicher<br />
Kenntnis der Naturlandschaft aufgebaute Entwicklungsgeschichte<br />
dieses Raumes auf siedlungskundlichem, wirtschaftlichem<br />
und kultur-geschichtlichem Gebiete bringt.<br />
<strong>Der</strong> Leiter des Alemannischen Instituts und Herausgeber<br />
des Alemannischen Jahrbuches Professor Dr. Fr. Metz würdigt<br />
in seinem Beitrag „Wilhelm Heinrich Riehl und die<br />
oberrheinischen Landes- und Volksforschung" die grundlegende<br />
Bedeutung, die Riehl auf dem Gebiete der Landesund<br />
Volksforschung zukommt. Ich habe auf der Generalversammlung<br />
des „Vereins für Geschichte, Kultur- und Landeskunde<br />
in Hohenzollern" am 25, Oktober 1954 aus der Metz'schen<br />
Abhandlung den Satz Riehls vorgelesen: „Kein<br />
Lehrer, Pfarrer, Arzt, Verwaltungsbeamter,<br />
Richter oder Offizier sollte seinen Beruf<br />
ausüben dürfen ohne die Grundausbildung<br />
in den Wissenschaften vom' Land und vom<br />
V o 1 k." Wenn man die Mitgliederverzeichnisse der Vereine<br />
durchsieht, welche die Wissenschaft vom Land und Volk<br />
pflegen, dann vermißt man gar viele Namen von Vertretern<br />
obiger Stände und Berufe. Ueberall hört man die Klage: Die<br />
Jugend fehlt! Das scheint mir aber eine Verschiebung der<br />
Tatsachen und der Verantwortung zu sein. Das Alter fehlt<br />
und legt seine Hände müßig in den Schoß! Die Jugend will<br />
Leistungen sehen, will Vorbilder und Anreger haben, dann<br />
macht auch sie mit, wie die Erfahrung zeigt. So kann der<br />
Aufsatz von Metz über Riehl für die Alten ein Anreger<br />
sein und sie zur Besinnung rufen, bevor es zu spät ist.<br />
Die Beiträge von S t o 11 und Schillinger über die<br />
Eisenwerke von Eberfingen im Wutachtal und von Kollnau<br />
im Elztal zeigen, mit welchen Schwierigkeiten die Eisengewinnung<br />
bei uns zu kämpfen hatte, und wir sind ordentlich<br />
stolz darauf, daß unser einheimisches Hüttenwerk Lauchertal<br />
allen Nöten zum Trotz dank der sozialen Gesinnung des<br />
Fürstenhauses bis heute durchgehalten hat.<br />
Auch die übrige^ Beiträge geben reiche und vielseitige Anregung,<br />
aber wir können hier leider nicht auf alle eingehen.<br />
Greife jeder, der für schwäbisch-alemannische Landes- und<br />
Volksforschung Liebe und Verständnis besitzt, zu dem Buche<br />
selbst. Seine Lekrüre wird ihm Gewinn und Genuß sein.<br />
Michael Walter.<br />
Hohenzollerische Bruderschaftsmitglieder in Maria Schray bei Pfullendorf<br />
Ungemein lebhaft war früher der Verkehr von Hohenzollern<br />
und Südwürttemberg nach dem Bodensee. Das beweist<br />
die Pfullendorfer Markt- und Handelsgeschichte und<br />
ganz besonders das Bruderschaftsbuch der Wallfahrtskirche<br />
Maria „zu der Schrayen", das 1748 angelegt, bis heute 7183<br />
Aufnahmen und 4530 Todesfälle registriert. Wir zählen darin<br />
etwa 531 Orte, im Grunde genommen aus dem Gebiet der<br />
alten Diözese Konstanz. Aus Hohenzollern finden sich im<br />
Aufnahmeteii 81 Orte mit insgesamt 1125 Personen. Alle bekamen<br />
einst das große Aufnahmediplom im Format von 35<br />
zu 45 cm mit dem Bild der Immaculata, das der Sigmaringer<br />
Maler Rebsam entworfen und Klauber in Augsburg gestochen<br />
hat. Viele Häuser werden wohl noch diesen „Bruderschaftszettel"<br />
wie auch die ebenfalls in Augsburg kunstreich gefertigten<br />
Bruderschaftspfennige als kostbares Erbgut ihrer<br />
Ahnen aufbewahren. Um diese segensreichen Erinnerungen<br />
aufzufrischen, folgen nun die Orte mit den Namen und dem<br />
Aufnahmejahr. Beachtenswert und vorbildlich sind auch die<br />
kraftvollen Vornamen.<br />
Ab lach : Magdalena Booß 8. 9. 1788; Magdalena Booß 16. 9. 1788;<br />
Magdalena Fischer 1794; Barbara Fischer 1836; Franziska Ginthner<br />
1766; Verena Henßler 1765; Anton Henzler 1793; Thomas Henzler 1795;<br />
Kaspar Huber 1796; Anna Maria Löffler 1780; Berta Nadler 1923; Anna<br />
Strehlin 1766; Gregor Utz 1792; Maria Anna Weiblin 1794. Ar-<br />
von Dr. Johann Schupp, Zell am Andelsbach<br />
noldsberg: Anna Maria Birkhofer 1752; Anna Maria Krözdörnin<br />
1752. Bachhaupten: Magdalena Biechlerin 1774; Theresia<br />
und Ba:._ara KohJiund 1802; Johann Georfe Scheideck 1774; Elisabeth<br />
und Maria Anna Scholter 1774; Katharina Störklin 1759; M.<br />
M-'Ifc.'jn! Stropp 1780. Eaindt: Maria Fra-icisc. de Paula Canzle<br />
-ierin 1751 (hier ist strittig, ob nicht Baindt bei Ravensburg gemeint<br />
sein könnte). Benzingen: Michael Knau3 1753; Joseoh<br />
Stauß 1757; Katharina und Waldbui' i Zi: ¡rmännin 1748. Beuron<br />
(„Klosterbäuren"): Maria Anna Frey 1791; Jakobea Seburgerin<br />
1748; Anna Maria Seburgerin 1749. Bingen: Ursula Danner 1803;<br />
Maria Anna Englin 1787; Joseph Fleisch 1749; M. Magdalena Gratler<br />
1751; Franziska Kratlerin 1749; Franziska Cuen 1787; Elisabeth Mezger<br />
1756; Christina Schneider 1801; ,mia MSTiS StShlin 1796; Katharina<br />
Treher 1 Maria Barbara Widmer 1756. Bisingen: Genovefa<br />
Sauter 1804. Bittelbronn bei Haigerloch: Wilh. Stehle 1794.<br />
Bittelschieß: Franziska Abt 1789; Humbeline Hirßler 1758;<br />
Apo'"Miia Hirtin 1750; Anna Mauch IT"" Maria Anna Treher 1768.<br />
Buffenhofen: Maria Katharina Diener 1763; Verena Scherer<br />
1755; Gertrud Weber 1755. Deutwang: Katharina Männer 1785;<br />
osa Männer 1789. Dietershofen: Kunigunda Diener 1761;<br />
Maria Agatha Diener 1763; Ma a Anna Gnädif 1763; Nikolaus Gnädig<br />
1764; Katharina Gnädig 1769; Katharina und Verena Walz 1788;<br />
Theresia Weißhaupt 1764. Ein hart: Magdalena Gluckherin 1749;<br />
Ann Maria Grueber 17"9; Anna Maria Kaivnann fSil; Joseph Heinrich<br />
1792; Franziska Heinzler 1786; Viktoria Heinzler 179( , Ursula<br />
Hueber 1768; Magdalena Nißlerin 1763; " aria Anna Schäfer 1785;<br />
Alois Schörer 1792; Joseph Waltenspiel 1795; Johann; Waitenspiel<br />
1795; Euphrosina Weiß 1749. Eschendorf (Astendo: ): Dionysius<br />
Scholter-1802. Ettisweiler: Marx Brucker 1748; Maria Anna<br />
Knoll 1765; M. Magdalena Wez 1757; Dorothea Wez 1763; Rosa Wetz<br />
1781; Anna Maria Wetz 1794. Fischingen: Melchior Brantle
Jahrgang 1955 HOHE ZOLLE ISCHE HEIMAT 13<br />
1748. Gaisweiler: Agatha Biechlerin 1753; Fidelis Biecheler 1759;<br />
Bernhard Biecheler 1762; Joseph Biecheler 1773; Anton Biecheler<br />
75; ^-ina Maria Biechlerin 1' Maria Anna und Magdalena Biecheler<br />
.786; Johann Bücheler 1796; Waldburga Biechlerin 1617, T -<br />
seph Biecheler 1817; Agnes Blocherin 1755; Luitgard Blocherer 1874<br />
(t 1907); Joseph und Josepha Blocherer 1877; Katharina Blocherer<br />
1905; Mathias Burster 1800; Mathäus Burster 1809; Kunegund Haas<br />
1779; Bernhard Jeli 1766; Anna Kohleflerin 1748; Maria Agatha Krenkel<br />
(„Krencklerin" 1758; Anna Krenkel 1759; Joseph Längle 1778;<br />
Maria Anna Lauberger 1800; Catharina Marquartin 1772; Anna Mayer<br />
1748; Franziska Miller 1759; Andreas Müller 1846; Anna Maria und<br />
Johanna Nothelfer 1748; Johannes und Mathäus und Franz Joseph<br />
Nothelfer 1719; Gallus Nothelfer 1751; Helena Nothelfer 1752; Katharina<br />
Nothelfer 1753; Maria Rosina Nothelfer 1758; Jakob Nothelfer<br />
1758; Miri Anna und Agnes Nothelfer 1798; Magdalena Rist 1759;<br />
Maria Agatha Schneider 1769; Johanna Sperlerin 1788. Gamm er -<br />
t in gen: Christiar Hodler 1749; Barbara Steinhart 1789. Glashütte<br />
(bei Wald): M. Katharina Faller 1763; M. Theresia Faller<br />
1768; Franz Joseph Faller 17E4; Kleophe Gräßlerin (Gräßle!) 5755;<br />
Jakobäa Greßlerin 1759; Fidelis Lender 1755; Mathäus Miller 1773;<br />
Ignaz Moser 1778; Rosina Schmid 1762. Gruol: Anton Fritz 1775;<br />
Anton Pfister 1807. Haigerloch : Meinrad Brugger 1748. Harthausen<br />
a. d. Scheer: Friedrich Roth 1799. Hausen am<br />
Andelsbach: Marx Arnold 1748; Eulalia Arnold 1763; Walpurga<br />
Arnold 1768; Marx Arnold 1782; Gertrud Arnold 1798; Vitalis Baur<br />
1767; Theresia Biehler 1801; Theresia Blaser 1789; Daniel Brettler<br />
1754; Ottilia Brucker 1756; Theresia Brucker 1793; Bernhard Brugger<br />
1797; Johanna Burstier 1759; Rosina Buestier 1772; Anelheid Dettenmayer<br />
1750; Adelhaid Dettenmayer 1768; Johannes Dettenmayer<br />
1787; Franziska Dettenmayer 1801; Katharina Deutelmoser 1788; Elisabeth<br />
Deutelmoser 1790; Magdalena Deutelmoser 1794; Judith Ehretin<br />
(= Ehret) 1763; Johann Baptist Ehret 1768; Antonius Ehret 1770;<br />
Jakob Ehret 1775; Franziska Ehret 1788; Ottilia Ehret 1790; Jakob<br />
Engst 1786; Veronika Enzeroßin 1773; Adelhaida Enzenrosin 1801;<br />
Maria Agatha und Salome Fecht 1785; Felizitas Fecht 1788; Joseph<br />
Fecht 1806; Waldburga Fischer 1750; M ria Jokobina Frey 1797; Antoni<br />
Frick 1749; Fidelis Frick 1753; Theresia Frick 1753; Theresia<br />
Frick 1763; Ottilia Frick 1778; Josepha Frick 1787; Johann Paul Frick<br />
1790; Magdalena Frick 1791; Margaretha Frick 1796; Maria Anna<br />
Waldburga Geiger 1763; Cacilia Glaser 1790; Meinrad Groß 1773;<br />
Priska Groß 1778; Franziska Groß 1780; M. Agatha Groß 1778; Rosina<br />
Grueber 1764; Salome Gülin (— Guhl) 1768; Joseph Hager 90; Maria<br />
Anna Hannissin 1809; Gertrud Hofmann 1765; Genovefa Keck<br />
1749; Susanna Keck 1756; Afra Keck 1773; Veronika und Maria Agatha<br />
Keck 1789; Johannes Keck 1790; Mathias Keck 1792; Bibiana Keck<br />
1779; Johanna Franziska Keller 1797; Anna Maria Kerlerin 1770;<br />
Vinzenz Kienler 1784; Genovefa Kienlerin 1791; Idda Kindin 173s;<br />
Katharina Lorinser 18Ä; Sebastian Lozer 1764; Katharina und I-iosimunda<br />
Luz 1750; Brigitta Luz 1759; Richard Luz 1762; Theodosia Luz<br />
1764; Margaritha Luz 1767; Petronilla Luz 1773; Apollonia Luz 1775;<br />
Gallus und Notburga Luz 1777; Katharina Lutz 1781; Kordula Lutz<br />
1777: Barbara Lutz 1778; Birgitta Lutz 1787; Cölestina und Elisabeth<br />
Lutz 1787; M. Agatha Luz 1791; Theresia Lutz 1797; Kordula Mauch<br />
1769; Klara Netzin 1776 (Notz?); Sara Reinhärtin 1796; Margaritha<br />
Reiter 1821; Agatha Restle 1786; Zacharias Ruetbret 1749; M. Agatha<br />
Schlögerin (= fchlegel) 1753; ebenso 1755; J iana Schlöglerin 1766;<br />
Johannes Schlögel 1772; Maximiiiana Schlögel 1739; Benedikta Schleglerin<br />
1797; Anna Maria Schlupfin 1763; Anna Maria Schwellinger<br />
1795; Nikodemus Seger 1752; Tarsilla Seeger 1765; Rosalia Seeger<br />
1782; Anna Maria Seeger 1784; Ottilia Seger 1791; Elisabeth Seeger<br />
1791; Anna Maria Seeger 1794; Xaver Seeger 1807; Monika Säger<br />
1809; Ba-lara Stecher 1781; Salome Stecher 1789; Maria Ursula Stecher<br />
1752; Ottilia Stemmer 1778; Afra Steyrerin 1799; Mechthild Stiegerin<br />
1787; Johannes Strobel 1797; Johann Georg Weiß 1753; Waldburga<br />
Weiß 1799; Ottilia Weißhaupt 1797; Simon Wetz 1775; Lorenz<br />
Wetz 1779; Klara Wetz 1768; Ottilia Wetz 1789; Ursula Wetz 1790;<br />
Anna und "laria Agatha We* 1797; Martha Wetz 1797.; Hilarius Widergrün<br />
1793. (Fortsetzung folgt!)<br />
Alte Gemeinderechnung von Jungingen 1791-92<br />
Am Glerets Tag Vor Ein Hl. Meß zolt —.21<br />
Dem Lehrer und schuoll Kinder zolt 2.06<br />
Wi Mon das Fron Holtz aus geloset Vogt und beiyden Burger<br />
Moister ober Jäger und Hau Moister zolt 1.08<br />
Dem Gebhart Bumiller wie er Krankh geweßen In zwey<br />
Mohlen zolt 1.06<br />
Trey Gaistlichen Herrn Vom Leonardus Berg Allmuosen<br />
geben —.24<br />
Weill man die Holtz Thaill Im Weiler Wald außgeben Herrn<br />
Wald Bereiter (?) Ober Jager Beyremer Jäger Vogt<br />
und Burger Moister und Holtz Geber Ihren Lohn zolt 6.10<br />
Wie man die Herner abgeschniten Vogt und Burger Moister<br />
Schizen und Kuoh Hirthen zolt 1.24<br />
Weyn Steyer Nacher Rottenburg zolt 2.14<br />
Nicolaus Bumiller wegen Boden zu Ponkratzi Riesters Haus<br />
zu fihren zolt 1.12<br />
Dene Schnayder Jäger wegen Haib aushenkhen zolt 1.30<br />
Jäger Dorle (?) Von Startzlen wegen aus henkhen zolt<br />
Dem Beyremer Jäger wegen Haib aushenkhen —.30<br />
Herrn Forst Maister wegen Haib aus henkhen 1.—<br />
Dem Schefer wegen 22 Nechten Pferchgelt in der Hagen<br />
wis zolt 1.12<br />
Weill man die Betstunden geholt dem Herrn Pfarr Vor Ein<br />
zo~ —.21<br />
Vor Eyn Memorial wegen Forststrofen zolt 15.—<br />
Dem ihrer wegen dem Schuoll Zimer Ein zu Heitzen 1.—<br />
Dent J] der Ginger Markengelt am Allmand zolt —.12<br />
Dene ui 1er ginger :hr Wart gelt zolt 1.—<br />
Vor die Cantzley Stäben Holtz zolt —.24<br />
Herrn Pfarr wegen Um Rith zolt —.30<br />
Ein Maß Weyn in Pfarr Hof —.24<br />
Auß eynem Pferd Vor den Herrn °farr zolt —.24<br />
Dem Kuoh Hirthen wegen Hagen fuoteren zolt 1.—<br />
Wie der Erste \i genschein hier gewesßen wegen dem Wildschaden<br />
Ein Zu sehen denen Vorgesetzten 1.04<br />
Weill Mon das Fro Holtz ab gemeßen Herr Wald Breiter (?)<br />
Bau Maister Vogt und Burger Maister zolt 2.10<br />
Dem Gebhart Bumiller Von 37 Ruthen Garben auf schlagen 5.22<br />
Vor Bolster Beym Esch Hirthen zolt 1.30<br />
Dieses Johr Vor 23 Buoch Papier zolt 2.48<br />
Dem Wolfgang Koller, Johannes Bosch, Johannes Buomiller<br />
und dem Vogt wegen der Hagen wis zu akhern zolt 9.48<br />
Denen selben wegen ¿g i zolt —.27<br />
Wie Man das Jagen Verglichen Vogt Burger Maister und<br />
schitzen zu Hausen gewesen zolt 1.48<br />
Weil das ganze Land in Hechingen bey eynander geweßen ist<br />
Vogt und Burger Maister zolt 1.38<br />
Mehr weill dieselbe widerum zu Hechingen geweßen wie<br />
¿/Eon di Resolution er thoillet hot zolt —.44<br />
Dem Herrn Pfarr seyn Presentgelt zolt 2.—<br />
Dem Herrn Por Vor 6 Creutz ging zu santanna 2.—<br />
Dem Maurer Vom schull Haus offen auß streichen —.12<br />
Dem Hl allhier Heller Zins zolt — 4i/2<br />
Dem Feld Moister von Eoll wegen Koy (Flurname) zu Meßen —.24<br />
Dem Gstifts Pfleger -vegen Weiler Wald Heller Zins zolt 1.12<br />
Zwoy Armen 'Geistlichen geben —.15<br />
Dem Gebhart Buomiller an seynem Lohn als Feldschitz abschlegig<br />
zol 8.46<br />
Fhloisch Steyr urbari Zins wegen Weiler Hof und Bodenzins<br />
zolt 3.16<br />
Dem Burger Moister von Schlatt Frohngelt 1.14i/2<br />
Dem Brono und Miller Fryder wegen Weiler Hof —.24<br />
Dem Cam..' Kehrer wegen Schuol zolt —12<br />
2 Armei Geistlichen Allmosen geben —.08<br />
Zwoi (Tollirner) wegen großen Waßer gißen Verunglikhet<br />
Anm usen geben —.08<br />
- or Eyn Finster ins schuollhaus zu flikhen zolt —.0<br />
Vor Creyden und eyn Bichlein in die schul —.05<br />
Dem Joseph Buomiller wegen Brunstlaifer zolt 2.08<br />
Mer demselben wegen Holtz versteigern und Etliche Bürger<br />
se^ 1 angewießen worden —.59<br />
Den. P iPtis' St toller wegen eynem Pfcrch Sc'"egel oit —.08<br />
Dem Marc Riester wegen schullstiellen und Tabel Tafel gem. 1.47<br />
von Casimir Bumiller<br />
Dem Lorenz Schuoller wegen Pferch flikhen und 2 Neye<br />
Rädle gemacht an Pferchkarren 6.29<br />
Dem Sebastian Riester wegen eynem Verschlag dem Armen<br />
Methle gemach 2.—<br />
Dem Gabriel l'ikhel und Leonhart Zanger wegen dem Weistelen<br />
Hay hereinzu fiehren 0.06<br />
Dem Marquard Speidel wegen Stein brechen zolt —.10<br />
Nicolaus Boumiller Feierschauerion zolt —.42<br />
Denen Wuocher Rinder vor 29 Fud. Soltz zolt 2.54<br />
Dem Alt Matheis Henenlotter Vor eyn Wuocher Rind zolt<br />
Carle Bosch Vor Schmidtarbeit zolt 4.04<br />
Fryedrich Bosch Vor Schmidtarbeit zolt 2.55<br />
Sylvester Boumiller Schnitter Lon zolt 2.18<br />
Vor 2 Dutzet Fakhlen zolt 1 —<br />
Freyedrich Speydel 2 Floischschetzer 1 Richter 1.18<br />
Dem Vogt von Killer Mihi Steyn Fuohr lon zolt 4.07<br />
J. Antoni und Matheis Boumiller schniter lon zolt —.50<br />
<strong>Der</strong> Heb Muter ihr Wartgelt zolt 1.20<br />
Dem Todten greber seyn Wartgelt zolt 1.20<br />
Meßmer vor Baum öell zolt —.24<br />
Dem Josef und Matheis Boumiller schniter lon zolt 6.24<br />
Dem Vogt seyn Wart gelt zolt 4.—<br />
Wegen schreiben 3.—<br />
Dem Schitzen Johannes Winter seyn Johres lon zolt 10.—<br />
Die letzten Bronst Loifer bey Remigi Glambser Verzert 1.05<br />
Dem Vogt und Xaveri Rister und Remigi Glambser wegen<br />
der Klosterwis en fohren in der Cantzley gewesen<br />
ine zolt —.54<br />
Wegen eynem Memorial zolt wegen dem fohren (fahren) —.15<br />
An Corpus Christi denen Kirchensenger Creutz und Fahnenfihrer<br />
Herrn Pfarr Vogt und Burger Moister zolt 11.30<br />
Dem Jergl Speydel wegen schniter lon zolt 6.26<br />
Dem Jerg Speydel vor Flekhen zolt 1.44<br />
Dieses Jahr den Ormen geben 2.29<br />
Vor 141/2 Vitel Esper in die Hagen wies zolt 9.42<br />
Vor 4 Vitel Gersten in die Hagenwis zolt 4.—<br />
Wie mon die Holtz Thoill im Weilerwald ausgegeben Herrn<br />
Wald Beriter (?) ober Jäger Beyremer Jäger Vogt und<br />
Burger Moister schitz und Holtzgeber in allem Kostet 6.10<br />
Denen Roß Schauer und schitzen wie Mon die Roß beschaut z. 1.35<br />
Herrn Weg Enspektor und Burger Moister zolt wie Er die<br />
Holl Kellen auß gestekht 1.03<br />
Dem Bollemer Burger Moister zolt wie man hat Herren<br />
Holtz führen und Keiner gefahren —.14<br />
Dem Beyremer Jäger In des Mires Hauß zolt wegen Weiler<br />
\ aTd in 2 Mohlen 1.26<br />
Dem Davit Schuoller als Kirchenvogt zolt —.30<br />
Wie Mon das Hasen Jagen Hier Im Eschen Herum dene<br />
Obere Jäger zolt 1.03<br />
Dene Buoben zolt wie sie Ayer gelesen 2.16<br />
Von der Holl Kellen und Thollen zu machen bey Remigi<br />
Glambsers Haus Steyn brechen und fihren Mauerer<br />
und Handfrohner auch sand Fuhr lon in allem Kostet<br />
laut Conto 43.36<br />
Dene Vorgesetzten und schitzen wie Mon das Hagen Hay und<br />
Embt Ein getan zolt 1.—<br />
Dem Herrn Bauentspektor Caminfeger feuer schauer Vogt<br />
und schitzen zolt 4.05<br />
Wie Mon die Ersten Windfahl Versteigert, Herrn Ober Jäger<br />
Vogt und Burger Moister und schitzen zolt 1.52<br />
Wie Mon das Flikh Holtz gegeben Herr Ober Jäger und<br />
Vorgesetzten zolt 1.52<br />
Wie Mon die Lehenfrichten geschit Herrn Castner<br />
Kasten Knecht und Schreiber Vogt und Burger Moister z. 3.08<br />
Wie Mon das Zwete Mohl Windfahl Versteigert<br />
denen Vorgesetzten zolt 1.04<br />
Dem Vogt zolt wie er mit einet Specification wegen der<br />
Pferde zr Hechingen gewesen — .z0<br />
Dem Gregori Cantzley Boten zolt —.06<br />
Dem Fryedrich Speidel wegen 2 Mohl im Friedrichs Thal<br />
geweßen bey Herrn Ober Jäger w Q gen dem Windfahl —.16<br />
Wie I n das 3te *iohl die Windfenl Versteigeret denen Vorgesetzten<br />
ihren Lohn zolt
14 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
Dem Pongrotzi Rister wegen 2| Högen so Bese Nebel gehobt<br />
Vor Solben und Lon :olt 1.—<br />
Dem Vogt und Jurger Moister und schitzen wegen Wild<br />
Zaun Mochen jeder 5 Tag iber seyn gebir ihnen zolt 6.40<br />
Denen 13r Bu.ger ietem 30 X (Kreutzer) wegen Pferch<br />
V»--steitcrn zolt 65.—<br />
Stall Mithe wegei. 3olldater. - "erden zc<br />
über Bezahltes Vom Stall Schuld Haißen (?) 1.42<br />
Denen Depentierten wegen Vieh und Schoff anlagen zolt 2.15<br />
Wegen Verschlag zu Mochen dem Vogt Einzieher und dem<br />
Lehrer )lt —.40<br />
Von der Zug Specification auch Handfroner und Witfrauen<br />
zu Mochen und zu Hechingen auf die Kammer eingeben<br />
zolt —.56<br />
Dem Vogt Zolt wegen 3 Mohlen zu Hechingen wegen Landstros,<br />
soladten und Zoll (Hobern?) 1.—<br />
Wie Mon die Gersten in der Hagen wis versteigert Versteigert<br />
denen Vorgesetzter zolt —.32<br />
Wie J."or. den Korn und Haber Esch gehuthet dem Vogt<br />
und Burger Moister und schitzen ietem 6 Nocht über<br />
seyn gebir gehüth 4.48<br />
Denen Boiden Burger Moister wegen 46 (Flekhen) Kletzen<br />
ab zu hauen zolt 3.04<br />
Denen Burger Moister zolt wie sie den Hagen auf den<br />
Hechinger Markt gefihrt —.24<br />
Mehr dieselben zu Gooselfingen geweßen wegen Einem<br />
Wuocher Rind —.24<br />
Die Burger Moister ieder 2 Mohl zu Hechingen gewesen<br />
wegen Birgles Hau und Forstrof —.48<br />
Dem schitzen wegen Einem Schaub zuom aushenkhen und 4<br />
Mohl beym Aushenken zölt —.32<br />
Mehr demselben wegen Schuoll Holtz Mochen und 1 Tag<br />
Flekhen Kietz gemacht -.32<br />
Dem Vogt und Burger Moister wegen Phom aus fihren im<br />
Freidrich Thal und Hagen ietem 1 Tag zolt 1.—<br />
Dem Yaveri Rister wegen gengen auf Hechingen und Bey<br />
Froh_ in Laut Seines Zedels ihme zolt<br />
Dem Pauli; Müller Feuer Sc auer Lon zolt —.48<br />
Dem Cari Bosch und cuiitzen wegen eynem Schrofen ab<br />
spri.igen Bey der Seg Mihle —-24<br />
Dem Fryedrich Speidel 3 Geng auf Hechingen —.45<br />
Vor Eyn Schloß an das Schuol Haus 5 t —40<br />
Vor 5 Mos Bier so Mon auf dem Ziegel Bach Vor 8 Johren<br />
zuom Hayen solle gehollet worden seyn zolt —25<br />
Wegen Grumbiren Zenden uor Johr 1790 noh dorauf geton<br />
Wie Mon das Flikh Holtz ein gefohren und den Augenschein<br />
Eingenommen Ober Jager Vogt und Burger Moister z. 1.<br />
Wie Mon im Wald gewesen und das Flikh Holtz Verkauft 1.30<br />
Dem Ober Jager wegen Heib aushenkhen zolt —.30<br />
2 Goistlichen All musen geben —.06<br />
Von der Burger Moisterrechnung zu mochen 2.—<br />
Wegn der Frucht Zänden Rechnung 2 Hoy Zänden<br />
2 Grumbiren Zanden Rechnung zu stellen 1.30<br />
Summarum der ganzen Ausgab 367 Fl. 35 Kr.<br />
Summarum der Einnahm 364 Fl. 56 Kr.<br />
Auß Gob Burger Maistei „ echnung<br />
von ; bis 1792.<br />
(Fortsetzung folgt.)<br />
Zur Geschichte des Kalvarienberges bei St. Luzen<br />
Wenn wir uns in der Geschichte des Klosters St. Luzen<br />
nach Angaben und Nachrichten über den Kalvarienberg umsehen,<br />
so müssen wir die - Erfahrung machen, daß diese<br />
äußerst spärlich sind. In der zwar umfangreichen, aber sehr<br />
dürftigen Klosterchronik lesen wir im Totenverzeichnis nur<br />
die eine Angabe, daß am 21. November 1737 Pater Cassian<br />
Freytag, wirklicher Guardian und Urheber des Kalvarien.<br />
berges, gestorben sei. Das Wohltäter- und Totenbuch berichtet<br />
uns u. a. von den Stiftern, die durch ihre Spenden die<br />
Errichtung des Kalvarienberges ermöglicht haben. Wie nicht<br />
anders zu erwarten, hat das Fürstenhaus eine namhafte<br />
Spende gegeben, dazu kommen noch folgende, namentlich<br />
aufgeführte Wohltäter des Klosters, deren Gedächtnis hier<br />
festgehalten werden soll: Anna Theresia Glücklin, Johannes<br />
Greilich, Kaufmann in Hechingen, der auch die Ruhechristikapelle<br />
erbauen ließ, Joachim Saile, allhiesiger Bürger, gest.<br />
1741, und noch viele andere Ungenannte. Seine Entstehung<br />
verdankt unser Kalvarienberg verschiedenen Umständen. Da<br />
war es vor allem der oben genannte Guardian des Klosters<br />
St. Luzen, P. Cassian Freytag, der in seinem Heimatkloster<br />
Lechfeld, südlich von Augsburg, die Erbauung eines Kalvarienberges<br />
miterlebt hatte. Dieser war 1719 erbaut und eingeweiht<br />
worden. Er wurde in der Folgezeit zum Vorbild<br />
unseres hiesigen Kalvarienberges. Sicher waren die päpstlicher<br />
Privilegien der Jahre 17?,6 und 1731 der unmittelbare<br />
Anlaß zur Errichtung des hiesigen Kalvarienberges und so<br />
erfolgte am 19. 7.1731 seine Grundsteinlegung. Darüber berichtet<br />
uns der damalige Staatpfarrer Fischer folgendes: Den<br />
1 9. Juli 1731 ist der erste Stein bei der ersten Capellen (Stationshäuschen)<br />
zu dem Berg Calvari gelegt worden im Namen<br />
Ihro Hocnfürstlichen Durchlaucht Friedrich Wilhelm<br />
Fürst zu Hohenzollern, Jh^o Hoch Edel Gestreng Herrn Paul<br />
c"e Baratti und Meiner Jo'nanr Martin Fischer Dechant und<br />
Pfarrer alda, wie auch Herrn Bürgermeister Johann Chrysostomi<br />
Greylich als geistlichem Vater. Das muß damals ein<br />
bedeutsames Ereignis gewesen sein, sonst hätte es wohl nicht<br />
auc. ir der Rangendinger Pfarrchronik einen Widerhall gefunden<br />
Dort schreibt Pfarrer Johann Christoph Mang: Anno<br />
1731 den 19. Juli ist zu Hechingen bei St. Luzen unter Titl.<br />
Patre Cassiano, damaligen wohlmeritiertcn Guardiano dt.<br />
prste Stein am kalvarienberg gelegt worden. Wie sehr die<br />
Errichtung von Kreuzwegen und Kalvarienbergen um 1730<br />
gefördert wurde und riese Andachten gleichsam in der Luft<br />
lagen, das zeigt uns eine ifottz in den Sdiriftchen von J. A.<br />
Kraus, Vom Werden und Wacnsen Mariabergs, 1937, S. 15,<br />
der wir entnehmen, daß die dortigen Klosterfrauen im Jahre<br />
173? e'nen Kreuzweg oder Kaivari :nberg mit Erlaubnis des<br />
Straßburger Provinziais, dem au^n unser Kloster St. Luzen<br />
unterstand, errichten durften. Wie wir dem Tagebuch des<br />
Konstanzer Weihbischofs Franz Josef Anton von Sirgenstein<br />
entnehmen (auszugsweise veröffentlicht von J. A. Kraus in<br />
„Honenz. Heimat 1951, Nr. 3, S. 4D ff.) wurde die Heiliggrabkapelle<br />
und ihr Altar am 13. August 1733 zu Ehren Jesu<br />
Christi des Gekreuzigten, der Schmerzensmutter, der H. Johannes<br />
Evang. Dismas und Petrus von Alkantara geweiht.<br />
<strong>Der</strong> Klosterchronist hebt im Wo 1 Itäterbucl" rühmend und<br />
dankbar hervor, daß der Weinbiscnof diese Weihe unentgeltlich<br />
vollzogen habe. Leider haben wir keine Abbildung un-<br />
seres Kalvarienberges aus jener Zeit. Seltsamerweise aber<br />
hat sich in einem Amulett ein kleiner Holzschnitt seines Vo. -<br />
bildes beim Kloster Lechfeld erhalten. Dieser zeigt genau die<br />
gleiche Gestalt, wie sie unser hiesiger Kalvarienberg heute<br />
noch hat: Einen steinernen Rundbau mit zwei seitlichen Aufgängen,<br />
über dem Eingang ein Rundfenster und auf der Plattform<br />
das Kreuz Christi mit den beiden Schächerkreuzen.<br />
Wir dürfen annehmen, daß ursprünglich die gleichen Kreuze<br />
auch auf dem Kalvarienberg zu St. Luzen standen, bis ia, i<br />
etwa in den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts die Figuren<br />
aus der Meisterhand des Haigerlocher Bildhauers Wekkenmann<br />
hinauf kamen. Das Franziskanerkloster St. Luzen<br />
hatte den Auftrag erteilt, und der Fürst bezahlte daran 60<br />
Gulden. Das geschah etwa 1766, denn diese Jahreszahl fand<br />
sich eingemeißelt am Fuße des ursprünglichen Kreuzes. So<br />
l<br />
and dieser herrliche Dreiklang des sterbenden Erlösers mit<br />
der Mater Dolorosa und dem Liebesjünger Johannes, umwoben<br />
von den andächtigen Gebeten der Pilger und Besucher<br />
dieser idyllischen Anlage, aber auch umtost von den<br />
Stürmen und Schneeschauern, die den Steinskulpturen mehr<br />
und mehr zusetzten. Schon in seinem Bericht über die Denkmalpflege<br />
in Hohenzollern von 1910 bis 1914 schreibt Prof.<br />
Laur folgendes: Auch der Kalvarienberg mit de> herrlichen<br />
Kreuzig ungsgruppe des Haigerlocher Bildhauers Georg Wekkenmann<br />
hat eine Instandsetzung erfahren. Die Bildwerke<br />
haben schon stark unter de*- Witterung gelitten, namentlich<br />
weist iie Christusfieur Zeichen iines starken Verfalls auJ<br />
An ihr hatte sich die vordere Hälfte des Kopfes losgelöst<br />
und war beim Herunterfallen in mehrere Stücke zersprungen.<br />
konnte jedoch wieder angesetzt werden. Eine schon in<br />
früherer Zeit vorgenommene Ausbesserung an den Beir°.,i<br />
beeinträchtigt leider sehr den Eindru dieser schönen Figur."<br />
Leider wurde in der Folgezeit die mehrfach geäußerte<br />
Absicht, die Figuren während der Frostperiode mit .'C^ützenden<br />
Bretterverschlägen zu umgeben, nichl verwirklich so<br />
daß die zermürbende Arbeit des Drostes ungehindert die Plastiken<br />
weiter zerstören konnte. Was nun schon lär_c;t zu befürchten<br />
war, das geschah in einer stürmischen Winternacht<br />
des Jahres 1930. <strong>Der</strong> Christuskörper stürzte herab, wobei<br />
Arme und Beine teilweise abbracher und ur der Torso<br />
übrig blieb, der heute in der Sakristei aufbewahrt wird.<br />
Beim Abräumen des Kreuzstammes fand sich eine stark zermürbte<br />
Bleikassette. Sie en lielt nur spärlich Stoffreste eines<br />
Amuletts, dabei eine Beneaiktusmedaille u id ein winziges<br />
Tonfigürchen einer Ansiedler Madonna. Leider fand sich<br />
kein schriftliches Dokument mehr dabei, so daß eine Datierung<br />
unmöglich ist. Vermutlich wurde diese Bleikassette<br />
bei der mutmaßlichen Errichtung der Kreuzigungsgruppe im<br />
Jahre 1766 hier eingefügt. Im Jahre 1932 wurde an Stelle<br />
des abgegangenen Kreuzes eine Kopie von der Hand i J .es<br />
Sigmaringer Bildhauers A. Tönnes aufgestellt. Da auch die<br />
beiden Assistenzfiguren der Muttergottes und des Jüngers<br />
Johannes starke Schäden aufwiesen jnd ganze Gewandpartien<br />
abzufallen drohten, mußte eine Gesamterneuerung . 1er<br />
Plastiken ins Auge gefaßt, werden F. ^t.<br />
(Mit Erlaubnis des K. H. Geistl. Rates und Staatpfarrers Baur-<br />
Hechingen aus dem Kath. Kirchenblatt des Dekanates Hechingen<br />
abgedruckt.)
Jahrgang 1955 HOHENZOLLEJISCHE HEIMAT 15<br />
Die Flurnamen der Markung Sigmaringen<br />
18. Bärenwirts Gumpen. Volkstümlicher Ausdruck<br />
für die Stelle in der Donau unterhalb der Laizerbrücke. Da<br />
der Gasthof zum Bären, nach welchem dieser Ausdruck benannt<br />
ist, 1695 erbaut wurde, entstand er also erst nach dieser<br />
Zeit. Ein Gumpen ist eine besonders tiefe Stelle in stehendem<br />
oder fließendem Wasser. Nach dem Volksmund holt<br />
der Storch die Kinder ins Bärenwirts Gumpen.<br />
19. Beckenäcker. Liegen zwischen den 7 Krisenbäumen<br />
und dem Bahnhof Hanfertal. Hießen im 17. Jahrhundert<br />
„dess Beckhenackher".<br />
20. B e c k e n w i e s e. Wiesenteil auf den Käppeleswiesen,<br />
wo früher verschiedene Wiesenteile eigene Namen hatten.<br />
21. Beim weißen Kreuz. <strong>Der</strong> Name tritt erst Ende<br />
des 18. Jahrhunderts auf und bezeichnet die Flur zwischen<br />
der neuen Jungnauerstraße und dem Witberg, wo sich an<br />
einem Feldweg ein Kreuz befindet.<br />
22. Bergen (Ober- und Unter...). <strong>Der</strong> Name ist<br />
entstanden aus Berkach, siehe Nr. 24.<br />
23. B e r g w i e s e n. Die Wiese, welche durch das Straßendreieck<br />
Sigmaringen-Laiz und Laiz-Gorheim gebildet wird.<br />
<strong>Der</strong> Name kommt wohl von der Flur Bergen. Seit 1916 steht<br />
hier ein gestiftetes Kreuz zu Ehren der gefallenen Krieger<br />
des 1. Weltkrieges.<br />
24. Berkach*. Alter Name für die heutige Flur Bergen<br />
zwischen Gorheim und Laiz. Nach Paret (Römer in Wttbg.<br />
<strong>III</strong>) findet man den Flurnamen Berkach oft bei römischen<br />
Ruinen. Hier war in der Nähe der alten Markungsgrenze<br />
Gorheim-Laiz ein römischer Gutshof. (Fundber. aus Hohenz.<br />
2 S. 14) und Paret, Römer <strong>III</strong> S. 376).<br />
25. B e z e n h ä u 1 e. Kleiner Walddistrikt Nr. 90 an der<br />
Grenz gegen Großwieshof. Betz = Bitz kommt von ahd. bizüne<br />
und ist die Bezeune, d. h. eine Umzäunung. Häule ist<br />
die Verkleinerungsform von Hau, welches von ahd. howi<br />
= hauen, schlagen kommt. Das Bezenhäule gehörte ursprünglich<br />
dem Fürsten, der es im Jahre 1848 gegen die städtische<br />
Buchhalde und die Brenzkoferhalde eintauschte.<br />
26. Bildstock*. Früher waren zahlreiche Bildstöcke<br />
aufgestellt, nach denen im 17. und 18. Jahrhundert verschiedene<br />
Felder und Wiesen bestimmt wurden.<br />
27. B 1 a u h a u. Walddistrikt Nr. 121 in Josefslust, der<br />
an die Laizer Markung grenzt. 1837 verkaufte die Stadt an<br />
den Fürsten den Blauhau.<br />
28. B 1 e u k e n *. Da der Bleuken oft in Verbindung mit<br />
den oberen und unteren Hanfgärten zu Brenzkofen genannt<br />
ist, dürfte wohl der Abhang nördlich der Brunnenbergstraße<br />
so geheißen haben. Es bedeutet eine Stelle, wo das nackte Gestein<br />
zu Tage tritt.<br />
29. B o 1 . Soviel aus dem Hed inger Urbar her T, orgeht, lag<br />
er zwischen Au, Josefsberg und der Bergstraße, also etwa an<br />
der Stelle des Sägewerks Steidle. Bol bedeutet eine Erhöhung.<br />
30 Bramstatt*. Um 1350 eine Wiese bei der Mühle zu<br />
Gorheim.<br />
51. Breite. Liegt südlich vom Nollhof und kam 1449 mit<br />
dem Hertensteinischen Gut an die Stadt. Breite nannte man<br />
ein größeres Stück Feld, das meist zu einem Rittergut oder<br />
Maierhof gehörte. Denn diese hatten ihre Felder im Gegensatz<br />
zu den übrigen Bauern nicht in Streulage, sondern in<br />
jedem Esch an einem Stück. Dies geht nach Victor Ernst<br />
auf den Besitz des ursprünglichen Sippenhauptes zurück.<br />
32. Breitstauden (Obere- und Untere...). Die<br />
Felder nördlich vom Brenzkoferberg, wo es an den Rainen<br />
viel Stauden gab.<br />
33. Bremsenstall. Stall bedeutet eine Spelle, es ist C ;r<br />
Platz nördlich vom Mühiberg gegen die Sandgruben zu, der<br />
meist schattig und kühl ist. Bremsenstall ist ein vor Bremsen<br />
gesicherter Platz.<br />
34. Brennofen*. Lage unbekannt.<br />
35. Brenzkofen. - bgegangenes Dorf, jetzt OrtsteiJ von<br />
Sigmaringen. <strong>Der</strong> Ort hieß ursprünglich Brenzighofen; Orte<br />
auf -hofen sind erst nach dem Jahre 700 entstanden. Er lag<br />
an der Quelle unu ihrem Abfluß. Dort befand sich auch<br />
eine alte Römersiedlung und wahrscheinlich auch das Heiligtum<br />
eines römischen Quellgottes, denn in der Quelle wurden<br />
über 200 römische Kupfermünzen gefunden. Im 12. Jahrh.<br />
hören wir mit den Brüdern Werinher und Reinvriedus von<br />
Brenzkoven von einem dortigen Ortsadel. Im Habsburger Urbar<br />
um 1300 ist Brenzkofen noch ein Dorf Jedoch heißt es<br />
schon 1362 m Lehensbuch des Grafen Eherhard „den layenzehend<br />
ze Sigmaringen, den man nemt Brenzkouer zehend".<br />
Brenzkofen wird also in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts<br />
abgegangen sein, und sei le Markung ging in der von<br />
Sigmaringen auf (wie die von Gorheim und Hedingen).<br />
von Dr. Alex F r i c k (1. Fortsetzung)<br />
Bei dem Namen Brenzkofen kann man im ersten Teil an<br />
einen alamannischen Namen Branzo denken; er kann aber<br />
auch den gleichen Stamm haben, der in dem Flußnamen<br />
Brenz steckt. Dieses Wort ist keltisch, und die keltische Wurzel<br />
Brent bedeutet fließen, sprudeln und ist verwandt mit<br />
unserem Wort Brunnen. <strong>Der</strong> Flußname hieß 779 Branzia,<br />
875 Prenza (Traub, Württ. Flußnamen aus vorgeschichtlicher<br />
Zeit, Württ. Viertelj. 1928, S. 7.). Es ist also wohl möglich,<br />
daß die bei Brenzkofen befindliche Quelle in vorrömischer<br />
Zeit Brenz hieß und daß Brenzkofen das Hofen bei der<br />
Brenz bedeutet. Denn gerade Berg- und Flurnamen haben<br />
sich oft aus keltischer Zeit erhalten.<br />
36. Brenzkoferbach. <strong>Der</strong> Bach entspringt einer starken<br />
Quelle am Fuße des Brenzkoferberges und mündet bei<br />
der Burgwiese in die Donau. Um 1300 trieb der Bach eine<br />
Mühle; heute dient die Quelle zur Wasserversorgung des<br />
fürstlichen Schlosses.<br />
37. Brenzkoferberg. <strong>Der</strong> Name kommt schon 1359<br />
vor; es ist der Berg nördlich von Brenzkofen. Im 17. und 18.<br />
Jahrhundert befanden sich dort die Hanfgärten. Um 1700<br />
kaufte die Stadt den Brenzkoferberg um 4 600 Gulden von<br />
der fürstlichen Herrschaft. Im Jahre 1848 verkaufte die Stadt<br />
an die fürstliche Herrschaft die Brenzkoferhalde mit ungefähr<br />
42 Morgen. Auf der höchsten Stelle des Brenzkoferberges<br />
steht das Kriegerdenkmal für die in den Kriegen 1864,<br />
1866 und 1870/71 gefallenen hohenzollerischen Soldaten.<br />
38. B r i e 1 *. Lage unbekannt. Mit Briel werden fette,<br />
sumpfige Wiesen bezeichnet, die oft in Besitz des Herrenhofes<br />
sind.<br />
39. Brunnenberg. Bezeichnung des Berges, auf dem<br />
das Haus Nazareth steht und der Straße, die von der Leopoldstraße<br />
aus hinauf führt. <strong>Der</strong> Name kommt von der Brunnenstube,<br />
die sich dort befand.<br />
40. B r u n n e n s t u b e *). Unter Brunnenstube versteht<br />
man ein Bretterhäuschen über einer Quelle. Beim Wentel befindet<br />
sich eine ergiebige Quelle, von der das Wasser in hölzernen<br />
Teucheln unter der Sägebrücke hindurch zu den<br />
Brunnen in der Stadt geführte wurde. Das Wasser der Quelle<br />
wird auch heute noch zur Wasserversorgung mitbenützt.<br />
41. Brunnenstubenkreuz*). Zweifelhaft, ob dieses<br />
Kreuz sich auf dem Brunnenberg oder bei der Hedinger<br />
Brunnenstube auf dem Schöneberg befand. Dort befindet sich<br />
in der Nähe der Quelle heute noch ein Kreuz.<br />
42. B u c h h a 1 d e. Die mit Buchen bewachsene Halde zieht<br />
sich vom Josefsberg bis zur Donau hin. Sie kommt 1359 schon<br />
vor, war früher städtisch und wurde 1848 mit dem Brenzkoferberg<br />
an den Fürsten verkauft.<br />
43. B u ' h s t o c k *. Lage etwa in der Nähe vom Hohenkreuz.<br />
1526 heißt es: „IV2 juchart haysst uff dem Hoff und<br />
haysset der acker der Buchs* ck". Sowohl der „Name Buchstock<br />
als auch „auf dem Hof" sind Flurnamen, welche eine<br />
An das<br />
in<br />
Postamt
16 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
alte römische Siedlung bezeichnen können. Denn oft bilden<br />
sich um römische Ruinen kleine Gebüsche. In dieser Gegend<br />
fand Archivar Schwarzmann um 1861 Mauern und machte<br />
römische Funde (siehe Nr. 118).<br />
44. Burgenacker*. 1687 kommt „der burggenackher<br />
in Berggen" vor. Da in Bergen ein römischer Gutshof festgestellt<br />
wurde, wird es sich wohl um einen Acker bei den<br />
dortigen Ruinen handeln.<br />
45. Burg wiese. Im Habsburger Urbar (um 1305) heißt<br />
es:-„da lit ouch ein hof und haißet der Burghof. Da lignet<br />
ouch 9 wisen, die zu dem hof hörent." Die Burgwiese war<br />
noch Ende des 18. Jahrhunderts österreichisches Mannlehen.<br />
Sie gehörte von Anfang an zum Burghof. (Fortsetzung folgt.)<br />
Kurznachrichten<br />
Verlorene Urkunden aus dem Killertal. Laut Mitteilung<br />
des Hauptstaatsarchivs Stuttgart sind im Bestand B 352 (Johanniterorden),<br />
Büschel 44 u. a. folgende Urkunden der Kommende<br />
Hemmendorf verzeichnet, die als verloren gelten<br />
müssen:<br />
„Consignation .. . der sämtlichen Dokumente usw. (ums Jahr<br />
1700): Nr. 14. Ein gar klein pergamentenes Brieflein, so<br />
schwerlich zu lesen, 1256 wegen J u n g e n t a 1 (d. h. Johanniterpriorat<br />
zu Starzein, siehe Zollerheimat 1951, Seite<br />
1 bis 3!).<br />
Nr. 35. Leibeigenschaftssachen: Hugo von Werstein 1280<br />
ebenso 1294. Ferner eine Lediglassung zu Jungingen 1258."<br />
Da wir vor 1275 vom Johanniterbesitz zu Starzein und<br />
Jungingen nichts wissen, ist der Verlust dieser Urkunden<br />
umso schmerzlicher. Man möchte vermuten, daß vielleicht<br />
damals die Herren von Jungingen ihren Besitz im Killertal<br />
samt der Burg Jungingen an den Johanniterorden veräußerten.<br />
Im andern Fall von 1258 hat der Orden offenbar Leibeigene<br />
zu Jungingen in die Freiheit entlassen. Hugo von<br />
Werstein gehörte bekanntlich zur Burg bei Fischingen am<br />
Neckar. Vermutlich hat er Leibeigene an den Orden veräußert.<br />
J. A. Kraus.<br />
1488 Pfarrkirche auf Burg Hohenzollern! Bischof Friedrich<br />
von Augsburg als Anwalt seines Bruders, des Grafen Eitelfriedrich<br />
von Zollern und dieser selbst urkunden: sie hätten<br />
ihre Kapelle im Schloß Zollern von der Pfarrkirche<br />
in Hechingen abgetrennt und zu einer Pfarrkirche erhoben,<br />
auch dies durch ihren Oheim, Bischof Otto von Konstanz<br />
(1479—1491)' bestätigen lassen. Sie versprechen nun<br />
letzterem das Subsidium caritativum, die Erstfrüchte und<br />
andern bischöflichen Rechte von der genannten Pfarrkirche<br />
und auch der von Zell unter Zollern wie von altersher zu<br />
geben, wie auch von der Pfarrkirche von Killer. Michael<br />
Zimmermann, der Kirchherr und Dekan der Pfarrkirche von<br />
Hechingen, sowie Pfarrer Thomas Knebel zu Zell und Pfarrer<br />
Kaspar Schuler zu Killer im Killertal erklären unter dem<br />
iegel des _
in<br />
Hohenzollerische Heimat<br />
Vierteljahresblätter für Schule und Haus<br />
Herausgegeben vom Verein für Geschichtej<br />
in Verbindung mit<br />
Schriftleitung:<br />
Josef Wiest, Gammertingen<br />
Preis halbjährlich 0.60 DM<br />
Kultur- und Landeskunde in Hohenzoilern<br />
der hohenz. Lehrerschaft<br />
Druck:<br />
Buchdruckerei S.Acker, Gammertingen<br />
Postverlagsort Gammertingen<br />
Nummer 2 Gammertingen, April 1955 I 5. Jahrgang<br />
/. Teil<br />
1. Bunte Mergel<br />
Ueber der Stufe des Schilfsandsteins erhebt sich als zweite<br />
Unterstufe des <strong>Keuper</strong>s die des Stubensandsteins. Auch sie<br />
setzt sich wie die Schilfsandsteinstufe aus einer Mergelschicht<br />
als Fuß und einer Sandsteinschicht als Deckplatte<br />
zusammen. Die Mergelunterlagerung, die bis zu einer Mächtigkeit<br />
von 30 m ansteigt, führt den Namen „Bunte" Mergel<br />
mit Recht, denn sie bestehen aus. waagrecht gelagerten roten,<br />
grünen, grauen, violetten, blutwurstfarbigen Mergelbänken,<br />
denen nach oben widerstandsfähigere Steinmergelbänke<br />
von hellerer Färbung zwischengeiagert sind. Wo<br />
Eyach und Starzel mit ihren Nebenbächen diese Bunten Mergel<br />
unterwascher stürzen sie in steilen, oft senkrechten<br />
Wänden ab und bilden in ihrer norizontalen Lagerung mit<br />
ihrem bunten Farbenwechsel ein eigenartiges Bild, das den<br />
Blick jedes Naturfreundes auf sich zieht. Solche Bilder können<br />
wir häufig im Eyachtal, in besonderer Schönheit aber<br />
im Starzeltal unterhalb von Stein schauen.<br />
Die Bunten Mergel setzen der Verwitterung keinen großen<br />
Widerstand entgegen. Das hören wir ganz deutlich, wenn<br />
wir nach einer frostreicnen IN acht an einer solchen senKrechten<br />
Mergelwand stehen, auf welche die Sonne scheint.<br />
Da rieseln beim Auftauen die durch den Frost in der Nacht<br />
abgesprengten Mergelteilchen wie ein feiner Regen ununterbrochen<br />
an der Mergelmauer herunter. Tief und breit haben<br />
sich Eyach und Starzel in die Bunten Mergel eingeschnitten<br />
und so dem Verkehr den Weg durch die <strong>Keuper</strong>stufe vom<br />
Oberland ins Unterland geöffnet.<br />
Eng und tief sind die Tälchen, welche die Seitenbächlein<br />
in diese Mergel eingenagt haben. Eine Wanderung durch die<br />
weglosen Schluchten, in die oft nur ein schmaler Streifen<br />
des Himmels hereinblickt, selten aber ein Strahl der Sonne<br />
dringt, bietet Bilder, die an den Urwald erinnern. Selbst das<br />
Ohr tritt hier in den Dienst der Geologie; denn immer, wenn<br />
wir das Plätschern eines kleinen Wasserfalles hören wissen<br />
wir, daß eine härtere Mergeibank den Lauf des Bächlein zu<br />
hemmen versucht.<br />
2. Stubensandstein<br />
Die Bunten Mergel wären schon längst aus der Landschaft<br />
verschwunden, wenn sich nicht der widerstandsfähige<br />
Stubensandstein über ihnen lagern und sie gegen Abtragung<br />
schützen würde.<br />
Seinen Namen verdankt der Stubensandstein seiner früheren<br />
Verwendung. <strong>Der</strong> aus der Verwitterung oder mechanischen<br />
Zerkleinerung dieses Steines hervorgegangene Sand<br />
diente einst zum Fegen oder Scheuern der Stubenböden und<br />
Treppen in den alten Bauernhäusern, die nach erfolgter<br />
Reinigung leicht mit Sand bestreut wurden. Diese ßehandlungsweise<br />
hatte den großen Vorteil, daß nicht nachher wie<br />
heute Warnungstafeln aufgestellt werden mußten: Achtung!<br />
Lebensgefahr! Frisch gebohnert!<br />
Die Entstehung des Stubensandsteines ging in ähnlicher<br />
Weise vor sich wie die des Lettenkohlen- und Schilfsandsteins,<br />
nur war das Gebirge, welches das Grundmaterial<br />
lieferte, nicht so weit weg wie beim Lettenkohlen- und<br />
Aus der Geologie von Hohenzoilern<br />
(13. Fortsetzung)<br />
<strong>III</strong>. <strong>Der</strong> <strong>Keuper</strong><br />
c. Bunte Mergel und Stubensandstein<br />
von Michael Walter<br />
Schilfsandstein. Deshalb sind die Körner, aus denen sich der<br />
Stuoensandstein zusammensetzt, größer und rauher wie bei<br />
diesen. Auch das Bindemittel, das die Sandkörner zusammenbackt,<br />
das in der Hauptsache aus den Feldspaten des<br />
verwitterten Granits hervorgegangen ist, ist noch in seiner<br />
hellen Farbe zur Verwendung gekommen und hat die weißen<br />
Sand- oder Quarzkörner in ihrer Farbe nicht geändert,<br />
so daß die Stubensandsteinfelsen in ihrem hellen Weiß in<br />
die Landschaft hinausschauen.<br />
Die Mächtigkeit des Stubensandsteins steigt von Westen<br />
nach Osten. Während sie auf den Gemarkungen Heiligenzimmern,<br />
Weildorf und Gruol kaum 15 m bet gt, steigt<br />
sie im Eyachtai auf den Gemarkungen Owingen und Grosselfingen<br />
auf über 20 m und erreicht bei Rangendingen und<br />
Stein gegen 30 m.<br />
Auch die flächenmäßige Ausdehnung wächst von Westen<br />
nach Osten. Auf der Gemarkung von Heiligenzimmern<br />
erscheint der Stubensandstein nur als schmales Band an<br />
den Hängen. Ueber dem Eyachtal tritt er schon in breiteren<br />
Terrassen auf, wie wir in der „Geiß", im Brand und über<br />
der Frühmeßhalde auf der Gemarkung Grosselfingen sehen<br />
können. Ganz besonders stark können wir die flächenhafte<br />
Ausdehnung in def. Wäldern von Rangendingen verfolgen.<br />
Hier bildet er die Ebene des Schiechtenhart, der von dieser<br />
Gestaltung seinen Namen trägt; denn der schlechte Hart<br />
ist der ebene Hart. Die Volkssage, die das Wort anders<br />
deutet, hat nicht bedacht, daß das Wort schlecht früher<br />
schlicht oder eben bezeichnete. Weiterhin bedeckt der Stubensandstein<br />
die Hochfläche des Weilerberges, der Hochburg<br />
und des Mönchwasens, des Bodelshauserkopfes, der Brucknaldt.<br />
des Nonnenwaides und der Nässe. Hier ist, nachdem<br />
die Brüche am Weiierberg und auf der Gemarkung Grosselfiiigen<br />
leider eingegangen sind, noch der einzige Stubensandsteinbruch<br />
von größerem Ausmaße auf hohenzollerischen<br />
Boden im Betrieb. Er ist seit über fünfzig -Jahren in den<br />
Händen der Firma Otto Breimesser in Hechingen und liefert<br />
sowohl guten Bausand als auch wertvolles Steinmatefial<br />
für Bauquader, Platten und Treppenstufen.<br />
Was aber in diesen Gebieten noch besonders auffällt, ist<br />
die Tatsache, daß die Wälder auf diesen Stubensandsteinjöden<br />
zum Teil echte Sandsteinwälder sind, wie wir sie auf<br />
dem Buntsandstein des Schwarzwaldes finden. Mancher<br />
fremde Besucher, den ich über die Hochburg und den Mönchwasen<br />
führte, wähnte sich angesichts des mit Heidelbeersträuchern<br />
bedeckten "idens oder des lieblichen Rotes des<br />
Heidekrautes auf den Hol lern des Schwarzwaldes. Die Rangendinger<br />
können auf ihr Heidekraut ebenso stolz sein, wie<br />
die Trochtelfinger auf ihr reizendes Steinröschen oder Egertnägele<br />
oder die Schweizer auf ihre Alpenrosen.<br />
<strong>Der</strong> Stubensandstein findet oder fand sowohl in seiner<br />
losen Form als Sand als auch als fester Stein von jeher<br />
reiche V erwendung. Ais Sand wird er als Bausand verwendet.<br />
Daß er früher auch als Feg- und Streusand diente,<br />
wurde schon erwähnt. In der Zeit, in der es noch keine<br />
F 1 'eßblätter gab, benützte man den feineren Sand auch als<br />
Schreibsand, den man auf das frisch beschriebene Papier<br />
streute, wo er die Tinte aufsaugte. Schreibsand hat mir in
18 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
den Tagen meiner Schulzeit recht wertvolle Dienste geleistet.<br />
Als kleiner Bub stand ich immer gern auf, nur morgens<br />
nicht. Das wirkte sich unangenehm aus, als ich zur Schule<br />
mußte. In den ersten zwei Schuljahren ging es noch, weil<br />
der Kleinlehrer sehr nachsichtig war. <strong>Der</strong> Mittellehrer war<br />
aber ein strenger Herr. Das deutete schon sein Name an.<br />
Da gab es Hiebe, wenn man zu spät kam. Das war unangenehm.<br />
Meine grundsätzliche Einstellung zum Frühaufstehen<br />
konnte dies aber nicht beeinflussen. Grundsätze darf<br />
man nicht ohne weiteres preisgeben. So mußte ich auf andere<br />
Weise Abhilfe schaffen. Ich merkte bald, daß der Mittellehrer<br />
ein großer Freund eines schönen, weißen Schreibsandes<br />
ist. Vor unserem Hause lag ein stattlicher Haufen<br />
Stubensand. Auf dem Speicher hing ein Kleesamensieb.<br />
Ich machte Papiertüten, füllte sie mit dem schönsten, feinsten<br />
Stubensand und legte sie auf das Gesims über der<br />
Haustüre auf das „Haulicht". Merkte ich, daß meine Zeit<br />
für den Schulweg zu knapp bemessen war, dann holte ich<br />
eine Tüte mit Schreibsand herunter, steckte sie in die Tasche<br />
und schritt wohlgemut zur Schule. Winkte mir der Lehrer<br />
beim Eintreten in das Schulzimmer, zu ihm an das Pult zu<br />
kommen, dann ging ich ohne Bangen vor, zog meine Schreibsandtüte<br />
heraus, überreichte sie dem Lehrer mit den Worten:<br />
„Ich habe noch Schreibsand gerichtet". „Das ist schön,"<br />
meinte er mit einer Miene, die deutlich zeigte, daß er meinen<br />
Bestechungsversuch durchschaute, aber zu würdigen verstand,<br />
„das hättest du aber auch schon gestern richten können".<br />
Ich konnte ohne Strafe an meinen Platz gehen. Jeder<br />
Schulbub wird verstehen, warum mir der Stubensandstein<br />
heute noch warm ans Herz gewachsen ist.<br />
Wenn auch der Stubensandstein wegen seines rauhen, groben<br />
Kornes nicht überall gebraucht werden kann, so findet<br />
er als Baustein doch immer noch Verwendung, besonders<br />
wenn er gut verquarzt ist. Wenn wir durch Orte wandern,<br />
in denen der Stubensandstein abgebaut wird, so können wir<br />
das an den Sockeln der Häuser, an den Stallwänden, an<br />
den Mauern um die Gärten und Miststätten, an den Treppenstufen,<br />
ja selbst an den Grenzsteinen, an den „Marken"<br />
ablesen. Daß er einen schönen und haltbaren Baustein auch<br />
für stattlichere Bauten abgibt, das zeigen manche Kirchenbauten<br />
in unserer Gegend, so die Kirche in Rangendingen,<br />
die herrliche Stifts- und Stadtkirche in Hechingen, deren<br />
Material aus den Brüchen bei Stein geholt wurde. Bei dem<br />
alten Wehrturm der Kirche von Weilheim sind die glatt gearbeiteten<br />
Eckquader und die Umfassungen der Schießscharten<br />
aus Stubensandstein. Auch zu Burgenbauten hat man<br />
den Stubensandstein gerne geholt, wie wir heute noch an<br />
den schönen Buckelquadern an der Ruine Hainburg beim<br />
Unteren Homburger Hof bei Grosselfingen sehen können.<br />
Auch zu manchen Kreuzweganlagen hat man ihn verwendet.<br />
Wer die Bauten näher betrachtet, der wird feststellen<br />
können, daß sich Schilfsandstein und Stubensandstein oft<br />
recht schön ergänzen. Wo rauhere und härtere Steine zweckmäßig<br />
erschienen, wählte man den Stubensandstein, wo aber<br />
weichere- Steine für Fenster- und Türumrahmungen, für<br />
Inschriften, für Wappensteine, für figürlichen Schmuck benötigte,<br />
holte man den leichter bearbeitbaren Schilfsandstein.<br />
So haben wir in diesen Steinen ein wertvolles, einheimisches<br />
Baumaterial. Es ist sehr bedauerlich, daß es<br />
durch künstliche Produkte immer mehr zurückgedrängt<br />
wird. Unsere Bauten verlieren dadurch viel an Bodenständigkeit<br />
und an Heimatverwurzelung, aber auch an Schönheit,<br />
wie sie ihnen nur die gestaltende Kraft des bauenden<br />
Meisters geben kann. Die Vermassung, die so tief beklagt<br />
wird, hält auch bei unseren Bauten ihren Einzug. <strong>Der</strong> heimatliche<br />
Steinbruchbetrieb kommt zum Erliegen, der einheimische<br />
Steinarbeiter stirbt aus. Als ich an meinem Hause,<br />
dessen Kellergeschoß aus Stubensandstein, dessen Haupteingang<br />
mit dem Inschriftenstein aus Schilfsandstein hergestellt<br />
ist, einen Treppenaufgang anbringen lassen wollte,<br />
wurde mir von den „Fachleuten" allen Ernstes eine Zementtreppe<br />
empfohlen. Ich lehnte ab, und wählte den Stubensandstein,<br />
trotzdem er mir als Sohlen- und Besenfresser<br />
gebrandmarkt wurde, aber nicht aus persönlichen Gründen,<br />
sondern aus Gründen des Geschmacks. Ganz ist die Empfindung<br />
für die Verwendung von Bau- und Quadersteinen noch<br />
nicht verloren gegangen. Man malt deshalb auf Zement und<br />
Gipsbewurf Quadersteine! Welche Geschmacksverirrung!<br />
<strong>Der</strong> Teufel wollte eine arme Seele holen<br />
„Ich war", so erzählte mein Großvater, „etwa neun Jahre<br />
alt. Da mußte ich mit meinen Kameraden das Vieh hüten.<br />
Die Viehweide befand sich auf dem Gelände vor dem Bosch<br />
in Grosseifingen, das heute noch Viehwoad und Fülleswies<br />
genannt wird. Die Hut var leicht; denn das Vieh fand auf<br />
dem nahrhaften Gelände ausgiebig Futter. Wir Buben aber<br />
sannen dauernd darüber nach, wie wir die Zeit vertreiben<br />
und uns die Langweile verkürzen könnten In dem Boschgelände<br />
gab es Weiden in Hülle und Fülle. Da hatten wir<br />
genug zu tun. Den dünneren Weidenzweigen zogen wir die<br />
Rinde ab und machten daraus „Huppeten 4 .-Das ging ganz<br />
leicht, denn die Weiden standen in vollem Saft Aus den<br />
fingerdicken Weidenszweigen machten wir Pfeifen, große<br />
unc 'deine. Das war schon ein kleines Kunstwerk; denn die<br />
tadellos abgestreifte Rind durfte nicht das geringste Löchlein<br />
haben. Außerdem mußte etwa 1 cm vom oberen Ende<br />
weg der Pfeife durch eine Kerbe die nötige Zunge gegeben<br />
werden. Das obere Ende verschlossen wir durch einen 1 cm<br />
langen Stöpsel als Ansatzooden für die in Bewegung zu<br />
setzei.le Luftsäule. Den unteren Teil des Pfeifenrohrs füllte<br />
ein längerer Stöpsel, der hin- unr> hergezogen werden<br />
konnte, wodurch höhere und tiefere Tone entstanden. Ganz<br />
dicken Aesten schalten wir die Rinde ab, indem wir die<br />
Rinde spiralig bis zum Bast durchschnitten. Dann wurde die<br />
Rinde zu einer Trompete aufgerollt. W«r das Mundloch zu<br />
weit, so steckten wir in dieselbe ein „Huppet" und in das<br />
weite Ende einen Dorn, damit sich das Gewinde nicht aufrollte.<br />
So hupten, pfiffen und trompeteten wir in allen Höhen<br />
und Tiefen der Tonkunst; es war ein schauderhaftes<br />
Konzert; das gefiel uns, und der war der größte Held, der<br />
die größte Trompete hatte.<br />
Hatten wir lange genug gepfiffen, gehupt und trompetet,<br />
so gingen wir in den Bosch. Dort standen damals junge<br />
Tannenbäume, worauf die Amseln ihre Nester bauten. Wer<br />
ein Amselnest zuerst fand, der betrachtete es als sein Eigentum<br />
und hütete es sorgfältig. Ein Ei oder ein Junges aus<br />
dem Nest zu nehmen, hielten wir für eine Sünde. Da<br />
brauchte man kein Verbot.<br />
oder: Wie aus der Geschichte Sagen entstehen<br />
So war es auch am Jörgentag 1819, auf den der Rangendinger<br />
Jahrmarkt fiel. Schon mehrmals waren Marktleute<br />
an uns vorbeigegangen, ohne daß sie uns besonders interessiert<br />
hätten. Nach langer Zeit kam niemand mehr, und<br />
wir Buben waren allein.<br />
Während wir nun • im Bosch wa^en und nach unseren<br />
Amselnestern schauten, die Eier zänlten una andere Nester<br />
suchten, wozu wir ja auf die Bäume klettern mußten, hörten<br />
wir auf einmal dort, wo ein Bach sich ein Rinnsal gegraben<br />
hatte, ein unheimliches Zwiegespräch. Eine tiefe Baßstimme<br />
rief überlaut: „Ich bin der lebendige Teufel aus der<br />
feurigen Hölle! Leine Uhr ist abgelaufen' Fort mußt du<br />
mit mir noch heut!" Dan aber kam es hilfesuchend in der<br />
höchsten Fisteistimme: „O je, meine arme Seele! Hilfe:<br />
Hilfe! Er spritzt mir schon die giftige Galle ins Gesicht. Hilie,<br />
Hilfe! Dann kam wieder der andere mit der Baßstimme:<br />
„Bösewicht, vermaledeiter! Du hast lange genug gelebt, geflucht,<br />
gesoffen und dein Weib geschlagen. Fort mußt du<br />
noch heut mit mir! Ha-ha-ha!"<br />
Als wir Buben dies hörten, verging uns alle Lust und<br />
Seligkeit. Die, welche noch auf den Bäumen waren, ließen<br />
beide Hände ios und rutschten zur Erde. Dann aber rannten<br />
wir, was wir nur konnten, der Heimat zu. Uns voraus aber<br />
sprang unser Pudel mit eingezogenem Schwanz; denn so<br />
etwas hatte auch er noch nicht gehört. Unser Vieh aber, das<br />
wir so jämmerlich verließen, streckte nur die Köpfe in die<br />
Höhe, als ob es sagen wollte: „Was ist denn heute mit euch<br />
los, ihr Hüter und Wächter?" Erst auf dem Berg oben 'rafen<br />
wir einige Männer, denen wir unser Abenteuer erzähl en.<br />
Diese lachten nur und sagten: „Kommt, ihr Buben 1 Wir<br />
gehen mit euch in den Bosch, und wenn wir den Teufel<br />
finden, so schlagen wir ihn tot." Noch voller Angst gingen<br />
wir hinter den Männern her, und das in die Hosen gerutschte<br />
Herz stieg langsam wieder empor. Ais wir in den<br />
Bosch kamen, traten aus demselben der Weberbast und der<br />
Ritteltum idas war sein Uebername) heraus und lachten aus<br />
vollem Hals über ihren gelungenen Scherz. Uns aber hat<br />
man noch jahrelang als „Teufelskerle" verulkt". J. Strobel.
Jahrgang 1955 HUHENZOLLEEISCIEHEIMAT 19<br />
Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten<br />
aus der Mundart in Rangendingen<br />
Unsere Vorfahren waren in der Hauptsache Bauern, mitten<br />
hineingestellt in die Natur, in die Vorgänge und das Geschehen<br />
in der Natur. Veranlagung, Wetter, Arbeitsgeräte<br />
und Haustiere bestimmten im wesentlichen das Tempoi ihrer<br />
alltäglichen Arbeit. Die „Hätz und Hetz" und auch der Lärm<br />
unserer Tage waren ihnen noch unbekannt. Gemächlich<br />
schritt der Bauer neben seinem langsam dahin trottenden<br />
Ochsen- oder Kuhgespann, und hinter dem Pflug blieb ihm<br />
noch viel Zeit zum Denken, zum Sinnieren und Philosophieren.<br />
Dieser gesunden Ruhe und innigen Verbundenheit<br />
mit der gesamten Natur entwuchsen immer wieder Menschen<br />
eigener Art mit scharfer Beobachtungsgabe, mit wendigem<br />
Geist und einem tiefen und reichen Gemüt, Originale,<br />
denen in Freud und Leid Lebenswahrheiten aus der S ele<br />
quollen. In der markigen und anschaulichen Sprache des Volkes<br />
fanden dann diese ihre meisterhafte Darstellung. Unwiderstehlich<br />
pflanzten sich die so bildhaft, klar und einfach geformten<br />
Weisheiten weiter, und eine Generation hat sie der<br />
anderen also goldene Regeln und Richtungspunkte auf den<br />
Lebensweg mitgegeben.<br />
Ueber 120 Sprichwörter, Wetterregeln ausgenommen, hat<br />
der Verfasser im Laufe der Jahre aus der Rangendinger<br />
Mundart gesammelt. Davon seien nachstehend eine Reihe<br />
angeführt. Vielleicht dienen sie da und dort als Anregung,<br />
doch etwas mehr als bisher in die Volkssprache hineinzuhorchen<br />
und arteigenes, altehrwürdiges Sprachgut treu zu bewahren.<br />
Wie der Mensch seit Urzeiten die Fabel, also Tiere dazu<br />
benützt; um sich Wahrheiten sagen zu lassen, so sind auch<br />
viele Sprichwörter an Tiere gebunden und sind im übertragenen<br />
Sinn auf Menschen anzuwenden. Da heißt es zum Beispiel:<br />
Wenn dr Kneacht uff da Gaul kommt, no reitet er en z'taod!<br />
Ama gschee(n)kta Gaul gucket ma it ees Maul!<br />
A Kuah deckt d'Armuat zua!<br />
A-n-alte Kuah schleckat au no ge(r)n Salz!<br />
Wenns dr Goaß z'wohl ischt, no scherret se!<br />
Dear (dia) ischt hälenga fett, wia a Goaß!<br />
Mit Gwalt lupft ma a Goaß am Schwanz nomm!<br />
Dia Hund, mo so laut bellat, brauch ma it sellig furcha!<br />
Ama bissega Hund soll ma zwoa Stücker Brot na werfa!<br />
E dr Nacht send eile Katza groob (grau)!<br />
Au dr gscheiteschta Kaiz könnt amol a Maus naus!<br />
Mit Speck fangt ma d'Mäus!<br />
A Katz lott Ha Tf) s'Mausa it!<br />
Dear ischt so hongrig wia a Kirchamaus!<br />
Armuat ischt a Haderkatz!<br />
A blinds Huhn findet au amol a Ko>(r)n!<br />
Oa Schwalb macht no kon Sommer!<br />
Dia Vögel, mo an. Morga so früah senget, liegt am Obed a<br />
so verreckt uff dr Mitschte!<br />
Das Wilflinger Urteil<br />
Am Heuberg, eine Meile ron Rottweil entfernt, liegt das<br />
hohenzollerische Dorf Wilflingen. Dort bestellten einst die<br />
Bauern einen Hirten aus Rottweil, daß er ihnen die Kälber,<br />
Geißen, Schafe und das andere Kleinvieh hüte. Da es in den<br />
benachbarten Wäldern auch Wölfe gab, wurde er streng angewiesen,<br />
in die Nähe dieser Waldungen seine Tiere nicht zu<br />
treiben. Doch kümmerte ihn das Verbot nicht. Da geschah es,<br />
daß eines Tages die Wolfe sechs von seinen Schafen zerrissen<br />
und auffraßen. <strong>Der</strong> Hirte war in großer Verlegenheit. <strong>Der</strong><br />
Bauer, dem die Schafe gehörten, verlangte Ersatz des Schadens<br />
und verklagte ihn beim Dorfgericht. <strong>Der</strong> Hirte verteidigte<br />
sich ohne Fürsprecher und sagte: „Nicht ich, sondern<br />
der soll von Gott und von Rechts wegen die Schafe bezahlen,<br />
der sie gefressen hat." Die Richter korinten und wollten gegen<br />
diese klare Beweisführung lichts einwenden. Sie kamen<br />
einmütig '_u dem Beschluß, daß der Hirte freizusprechen sei,<br />
und daß die Schafe von denen bezahlt werden sollten, die sie<br />
gefressen hätten. <strong>Der</strong> Bauer war anfänglicn mit diesem Urteil<br />
nicht zufrieden; aber endlich gab er sich darein, und so<br />
kam der Hirte ohne Strafe davon. Aber noch lange wurde<br />
in der Umgebung von Wilflingen über das Urteil des Dorfgerichts<br />
gelacht und gespottet.<br />
von J. Wannenmacher<br />
Mit ama Tropfa Honig fängt ma mai (mehr) Fliaga als mit<br />
ama ganza Faß voll Essig!<br />
M!a muaß it no (nach) älla Mucka schla!<br />
Dr Spaz e dr Ha(n)d ischt mr liaber als Daub uffem Dach!<br />
De kleinschta Grotta hend am meischta Gift!<br />
Und als Abschluß einer unliebsamen Angelegenheit sagt<br />
man gerne:<br />
Morga schprengt wieder a andere Sau da Ga(r)ta na, mo no<br />
a dreckigeres Fiedla hot wia dia!<br />
Des weiteren kann man hören:<br />
Am Morga muaß ma da Feirobed suacha!<br />
Ma soll da Tag it voar am Obed loba!<br />
In dr Jugend muaß ma an Schtecka schneida, daß ma em<br />
Alter dra laufa ka!<br />
'S ischt glei viel geiget, wenn d' Soita (Saiten) g'spannt sind!<br />
A was ma ka(nn), trait ma it schwer!<br />
Wenn ebbes auweart ischt, no muaß ma's am ärgschta heeba!<br />
Ma soll nontz (nichts) wegwerfa, nau uff Seita loana!<br />
Bettescht guat, no leischt guat!<br />
Ama necketa Ma — ka ma it guat en Sack (Hosentasche)<br />
nei langa!<br />
'S goht alles ums Häs und ums Gfräß!<br />
Ama Grauber ischt z'helfet, ama Braachter (Wichtigtuer)<br />
muaß ma brenga!<br />
Viel Rutscha geit blaede (dünne) Hosa!<br />
Ussa Hui und enna Pfui!<br />
A ledige Haut schreit überlaut!<br />
Wenns Kind in Brunna gfalla ischt, no deckt ma s' Loch zua!<br />
Ma ka am Mädle nontz en Schu(r)z nei werfa, wenn-s-a<br />
it uffhebt!<br />
'S Kami ka am Ofaloch nontz vorarwerfa!<br />
'S Alter treibt da Boom em Wald a (b)!<br />
Und wohl für alle Zeiten gilt:<br />
De Graossa lot ma laufa, de Kleine heegt ma uff!<br />
Kleine Kender, kleine Sorga — grauße Kendel', grauße Sorga!<br />
Voar jedem Haus leit a Stoa!<br />
'S bleibt koat Zeit wia se ischt!<br />
A schtrenger Gwalt wuut (wird) it alt!<br />
Wear sich ufi's Erba verloot, kommt z' früan und z'scnpootT<br />
<strong>Der</strong> eigentliche Gehalt der Sprichwörter, du- teilweise<br />
einen recht interessanten kulturgeschichtlichen Hintergrund<br />
haben, kommt einem erst so recht zum Bewußtsein, wenn<br />
man jedes einzeln durchdenkt. Schlagartig erhellen sie eine<br />
Situation oder ein Lebensgebiet. „Wer Gelenk im Hirn hat"<br />
und das Sprichwort seiner Rede einzuflechten versteht, verleiht<br />
der Sprache Leoenaigkeit, Frische una Kraft. •—<br />
<strong>Der</strong> Risiwald bei Wilflingen<br />
Am Risiwald ist es in den Zwölfnächten um Weihnachten<br />
nicht recht geheuer. Dort am Felsenhang vom Hochberg liegen<br />
die Felsentrümmer, die die Riesen der Vorzeit gegen den<br />
Lindwurm ausgruben und schleuderten. <strong>Der</strong> „Lind" narste<br />
in der Talmulde zwischen Hochberg und Lemberg. Nur dem<br />
Recken „Wilf" gelang es, den Lindwurm zu erlegen. Er zündete<br />
den Risiwald an, und der Lind" zerplatzte jämmerlich.<br />
Noch findet man versteinerte Knochen von ihm an der Steig<br />
vom Höchberg zu Tal und wieder den Lemberg hinan und<br />
bis hinab nach Wilflingen. Dieses trägt, für ewige Zeiten<br />
denkwürdig, des Lindwurmtöters Namen.<br />
Die „Hohenzollerische Heimat" kann bei allen<br />
Postanstalten oder bei den Austrägern oder bei<br />
der Buchdruckerei Seb. Acker in Gamwertingen<br />
bestellt werden. Bezugspreis pro Heft 30 Pfg.
20 H O H E N Z O L, L, E n E S C H E HEIMAT Jahrgang 1 55<br />
Wortfamilie „hagen"<br />
In unserer Zeitung kommt immer wieder der Ausdruck:<br />
„mit hagen und jagen" vor. Während das Wort „jagen" allen<br />
Menschen gemeinverständlich ist, wird für viele der Inhalt<br />
des Wortes „hagen" dunkel sein.<br />
1. hagen: heißt schlagen stoßen. Mit Axt und Schwert<br />
kämpfte der Germane gegen seine Feinde; mit den gleichen<br />
Waffen rodete er den Niederwald und das Gebüsch<br />
und nahm günstige Waldstücke in seine Pflege.<br />
2. Hag: Solche Waldstücke hießen ursprünglich Hag. Ein lebender<br />
Zaun umgab den Hag. <strong>Der</strong> Name ging auf diesen<br />
Buschzaun über und ist bis auf den heutigen Tag geblieben.<br />
3. Hagbuchen: wurden verwendet zum Anlegen des Hages.<br />
Pfosten zur Verstärkung des lebenden Zaunes hieß man<br />
Hagsäulen. In manchen Gegenden änderte sich das Wort<br />
Hagebuchen in Hainbuchen. Das Holz der Hagebucha ist<br />
zäh. Diese Eigenschaft wird mitunter auch auf gewisse<br />
Menschen übertragen: das ist ein hagebüchener Kerl. Eine<br />
menschliche Leistung kann hagebuchen, hanebüchen sein.<br />
4 Hagebutten: Die dornigen Sträucher waren beliebte Reiser<br />
im Hag, weil sie Eindringlinge abhielten. Im Volksmund<br />
auch Hagebutzen! (Butzen-Kerngehäuse).<br />
5. Hagen: <strong>Der</strong> Stoßgewaitige (Tier- und Menschenname).<br />
6. Hagestolz: Das Hauptgut ging bei den Germanen ungeteilt<br />
auf den ältesten Sohn über. Jüngere Söhne erhielten<br />
ein Nebengut, ein Hag, dessen magerer Ertrag meist keine<br />
Heirat ermöglichten. Das Vermögen des Hagestolzen fiel<br />
beim Tode an die Obrigkeit.<br />
7. Behagen: <strong>Der</strong> Anblick eines gepflegten Waldes weckt ein<br />
Gefühl der Zufriedenheit. (Vergl.: behaglich, Unbehagen,<br />
unbehaglich).<br />
8. Hager, Heger: Er ist der Pfleger des Hages, des Waldes.<br />
9. Hegereiter: berittener Waldaufseher.<br />
10. Gehege : Gepflegtes, eingezäuntes Waldstück.<br />
IL Teil<br />
Ein um 1450 entstandenes pergamentenes Fleckenbuch be<br />
saß die Gemeinde samt einer Erneuerung von 1570, die jedoch<br />
beide bei Besetzung des Rathauses im April 1945 verschwunden<br />
sind. Eine wörtliche Neuausgabe, bei der nur unvollständigen<br />
von Birlinger im J. 1871 (Anzeiger für Gesch.<br />
d, atsch. Vorzeit) Iware dringend notwendig. Hier sei nur der<br />
Hauptii ji*f angedeutet, nact äiner vorsorglich genommenen<br />
Abschrift. Da früher jedes Städtchen und auch oft Landorte<br />
eigenes Maß hatten, so sind zunächst die in Meldungen geltenden<br />
Maße aufgezeicnnet. In der Mühle sei Tübinger Maß<br />
zu gebrauchen, wohl in Erinnerung an die Pfalzgrafen von<br />
Tübingen, die als Nachfolger der Grafen von Gammertingen<br />
und Neiifen in unserer Gegend im 13. Jahrhundert zu befehlen<br />
hatten. Im Gegensatz dazu soll aber alles Korn, Haber,<br />
Küchenspeis, Erbsen, Linsen, Leinsaat, Bohnen, Gerste,<br />
Hanf, Obst, Birnen, Rüben und Äpfel nach Feutlingej Maß gemessen<br />
werden. Die Schmalsaat, nämlich Erbsen, Linsen usw.<br />
soll man gestrichen das andere aber, wie Obst, Rüben usf.<br />
„genuffet" messen. Reutlinger Maß unterschied 1 Scheffel<br />
= 8 Simri = 32 Imi. An rauher Frucht (d. h. mit Hülsen,<br />
wie Vesen) faßte der Scheffel 173,45 Liter. Trochtelfingen<br />
hatte wieder anderes Maß. 1825 führte man den württem'<br />
bergischen Schefie] mit 8 Simri zu je 22,15 Liter ein. In<br />
Tübingen hatte 1 Malter: 12 Viertel = 182,05 Liter; in rauher<br />
Frucht dagegen faßte der Malter 190,896 Liter. Ebenfalls<br />
verschieden war das Feldmaß; näheres Lohz. Jahreshefte<br />
1936, S. 120—178.<br />
Das alte Fleckenbuch war eine schönp Quelle der Rechtsgebräuche<br />
unserer Gemeinde. Es enthielt die Bestimmungen<br />
über die Wahl des Schultheißen (erst seit 1840 haben wir<br />
statt dessen einen Bürgermeister) durch die Herrschaft, der<br />
12 Richter durch Vogt und Schultheiß, über die Märkte und<br />
deren Ordnung, Abgeben von Marktvieh. Die Gemeinde<br />
hatte das Recht auf einen Stock und Galgen. Letzterer stand<br />
gegen tsißental und Salmendingen auf dem Bühl und wurde<br />
noch im 18. Jahrh. erneuert. Dann fand man im Fleckenuch<br />
eine Ordnung für Bäcker, Metzger, Bader (vgl. Hohz.<br />
Jhefte 1r 5l, 37—98) und auch für den Wald. „Item es sollen<br />
zwuo täfferen (Tabe.rnen = Bierwirtschaften) hie sin und<br />
sunst niemand dahe'rr Wirtschaft halten." Ferner waren ehenafte,<br />
d. h. gesetzmäßige fä r ege unc Stege aufgeführt, u. a.<br />
Gamerstaig, ±_,uckenbühl, Talwies, Pfatten hinauf, die Straße<br />
von Thalheim nach Stetten, die noch 1550 freie Königsstraße<br />
Vom Melchinger Fleckenbuch<br />
Das Klosterglöcklein von Starzein<br />
von Maria E. F 1 a d<br />
Hörst du das Glöcklein zum Feierabend läuten? Es klingt<br />
so anders als die vielen, die das liebliche Tal durchdringen.<br />
Etwas Geheimnisvolles hängt ihm an. Nicht immer war es<br />
in dem zierlichen Kirchlein in Starzein, das St. Johann geweiht.<br />
Oft klagt und weint es wie ein Kind. Ein andermal<br />
ist's Sehnsucht nach den himmlischen Gefilden. Da wird sein<br />
Klang zu innigem Gebet. An manchen Feiertagen aber quillt<br />
es in Freude über.<br />
Und bist du hellhörig — ein Sonntagskind, erzählt es dir:<br />
„Drüben über dem Fluß, am Waldesrain, stand vor alter<br />
Zeit ein Nonnenkloster. Eines Tages stampften Kriegerhorden<br />
durch das stille Tal. Sie brandschatzten und trampelten<br />
nieder, was ihnen am Wege lag. Auch das Nonnenkloster<br />
am Waldesrain entging seinem Schicksal nicht und lag gar<br />
bald in Schutt und Asche. Unter diesem Schutt lag auch ich,<br />
das Klosterglöcklein, jahrhundertelang, bis mich eines Tages<br />
ein einsamer Wanderer entdeckte. Ein Stückchen meines<br />
erzenen Mantels glänzte ihm entgegen. Er trat auf mich zu<br />
und befreite mich aus meiner, zwischen Schutt und Geröll<br />
eingeklemmten Lage. Darauf brachte er mich zu dem noch<br />
unversehrten Kirchlein über dem Fluß. Seit der Zeit läute ich<br />
den Gläubigen die Feierstunden ein. Ich mahne sie zur Andacht<br />
—• zum Gebet, wie ich es einst im stillen Klosterkirchlein<br />
tat. Noch liegen mir die Weisen der frommen Frauen in<br />
der Erinnerung.<br />
Sonntagskind, tue jetzt, was ich dir künde! Gehe um Mitternacht<br />
im Mondschein zum verödeten Waldesrain. Dort<br />
schaust du ein Bild, das sonst kein Sterblicher schauen darf:<br />
Umflossen vom Silberglanz des Mondes scheint das Kloster<br />
mit dem spitzen Türmchen in die Nacht. Aus geräumigen<br />
Hallen schweben schwarzweiß gekleidete Nonnen, in Andacht<br />
versunken, ihrer hellerleuchteten Kapelle zu. In ihr<br />
Psalmotieren klingt weich und silbern mein Glöcklein auf,<br />
zum ewigen Gott. Dieses Singen und Klingen hören heute<br />
noch die Menschen, die der einst entweihten Stätte nahe<br />
kommen. Aber sie verstehen es nicht, da sie nicht gläubige<br />
Sonntagskinder sind.<br />
heißt. Die Badstube lag an der Landstraße, die für Enzental<br />
hinauf auf den Schayakobel führte. <strong>Der</strong> Heerweg sei ein<br />
Weg, der in den Flecken herein gehe. Das kleine (Bernhards)<br />
Käppele ist erwähnt, wo vom Weg nach Ringingen der Weg<br />
um „Bühl" abzweigt. Die Schlußbestimmung heißt: Matheis<br />
Schmid habe jährlich dem Dorf 9 Pfennig aus der Hofstatt<br />
zu geben, worauf er die Schmitte hat, weil man ihm den<br />
Platz vom Gemeindegut zur Verfügung stellte. An Familien<br />
kommen damals vor: Michel Straubinger, Peter Hage, der<br />
Toldinger, Hans Hudel, Ludwig Werner, Baithas Nollnart,<br />
Claus Locher, der Cunbeck, Jakob Bronn, der Pflummer,<br />
Hans Bauer, Kaspar Hegelin, Kunlin Gauckel oder Gockel<br />
Ludwig Vogel, Hans Oswald, der Väßler, Aubert Flamm, der<br />
Bogner, Herr Aubert Mayer (der Frühmesser). Im J. 1554<br />
erscheint dann Kaspar Dietz mit Frau Walburga Yelin. Die<br />
Erneuerung des Buches im J. 1570 war ebenfalls auf Pergament<br />
sehr gut leserlich geschrieben. Neue Familien tauchen<br />
darin auf: Michael Rein, Jakob Beler-Föhler-Bayler,<br />
wohl von Stetten u. H. zugezogen. Paule Leffler, Wendel<br />
Gouck, Hans Visel und Ludwig Visel, der ein Frühmeßlehen<br />
hatte, Han:' Oschwald, Bartel Hepperlin (Häberle). Hans Dieser,<br />
Hans Klotz, Ma'tin Eh Stephan Jehle, Steohan Braun.<br />
Stephan Schneider; Hans Kraus hat meines gnäd. Herrn von<br />
Fürstenberg Hofstatt; ein Albert Frech genannt der Krus ist<br />
in Melching:'! bereits 1464 genannt. (üeber den hiesigen<br />
Bürgersohn Albert Kraus, der Weihbischof in Brixen wurde,<br />
siehe Hohz. Jhefte 1952, 20—21). Im J. 1598 war ein Jörg<br />
Diener dahier Ortsknecht. Bemerkenswert ist im Anhang<br />
ein Verzeichnis von Harnischen, die 1609 Gemeindeeigentum,<br />
aber an die Bürger ausgeliehen waren. Nur der Wirt Peter<br />
i^auckel (Gockel) hatte einen eigenen. Offenbar handelt es<br />
sich um eine Art Bürgerwehr. Inhaber sind: <strong>Der</strong> Heilig<br />
(wohl für den Mesner), der Herr Pfarrer Mg. Klaus Gliespenz,<br />
Jerg Hagen, Michel Jelin, Schultheiß Junghans Volk,<br />
T<br />
Tans Steuble, lerg Beler, Hans Oschwald, Hans Dietrich,<br />
Hans Reinen Witwe, Peter Werner, Gaiii Straubinger, Jerg<br />
Arnolds Witwe, Michel Bogner, Hans Schneider, Ludi Emelin,<br />
Michel Vogel, Mathias Nollhart, Basti Pfiumm, und<br />
Stephan Braun Bei den genannten Witwen waren die Harniscne<br />
vermutlich für den Knecht bestimmt. Zur Fam. Gokkel<br />
st Mitt. Hohz. 33,26 und Hohz. Jheft 1949, 8—100 zu<br />
vergleichen. Wappen: In Silber ein schwarzer Gockeler.<br />
J. A. Kraus.
Jahrgang 1955 HOHE '•ZOLLERISCHE HEIMAT 21<br />
Den Bauentwurf der hiesigen Dorfkirche fertigte Tiberius<br />
Moosbrugger, die Ausführung geschah 1768/69 durch Baumeister<br />
Großbayer, die Ausmalung erfolgte um die gleiche<br />
Zeit durch Ferdinand Dent. Die Altäre wurden etwas später<br />
erstellt, die Kanzel erst 1814. Jahrzehntelang hatten die Melchinger<br />
ein freundliches Gotteshaus, das mit seinen hellen<br />
Wänden und mit seinen Decken- und Altarbildern Andacht<br />
und religiöse Stimmung weckte und die Seele frei und freudig<br />
aufjubeln ließ. Da kam eine Zeit, in der man einen<br />
lebensfrohen, lichten Kirchenraum nicht mehr liebte und<br />
darauf ausging, ein sogenanntes „mystisches Dunlsel" herzu-<br />
Brief aus Melchingen<br />
tongemalten Zwickelbildern gereinigt und ausgebessert. Jetzt<br />
leuchten ihre Farben wieder gleich, als ob erst gestern Ferdinand<br />
Dent seine Palette gesäubert und nach getaner Arbeit<br />
mit Näpfen und Töpfen und Pinseln und Kübeln die<br />
Kirche und das Dorf verlassen hätte. Rings um das Chordeckenbild<br />
kam ein bisher unsichtbares Goldbrokatmuster<br />
zum Vorschein, das wie ein breiter, grüner Rahmen das imposante<br />
Weihnachtsbild einfaßt und gegen die weiße Deckenfläche<br />
abgrenzt. Die Blumen in den Spiegeln und Ziermuscheln<br />
wurden von der Ueberkalkung in mühsamer Schabarbeit<br />
befreit, ebenso die stilisierten Palmzweige zu beiden<br />
Vor der Restauration Foto Keidei-Duiker Nach der Restauration Foto Keidet-Daiker<br />
stellen Wie an anderen Orten wurden auch in Melchingen in<br />
der Zeit 1880/90 die Altäre durch unförmliche Holzkasten<br />
ohne Kunstwert ersetzt und die Lichtöffnungen mit lichtabhaltendem<br />
Farbenglas verziert, sodaß man selbst an hellen<br />
Sommertagen nicht ohne Kunstlicht auskommen konnte; kein<br />
Quadratzentimeter an Decken und Wänden blieb ohne Farbe.<br />
Dieser Zustand dauerte ungefähr 70 Jahre.<br />
Da wurde nun im Jahre 1952 unter unserm Ortspfarrer<br />
Albert Waldenspul mit der Innenrestauration der Kirche<br />
begonnen, die untermauert wurde durch die finanziellen<br />
Opfergaben der kirchlichen und bürgerlichen Gemeinde. Vertrauensvoll<br />
legte man die Durchführung in die bewährten<br />
Hände von Kirchenmaler Josef Lorch in Sigmaringen, der in<br />
den letzten Jahren vielfach Proben seiner glücklichen Künstlernand<br />
und seiner geläuterten Fachkenntnisse abgelegt hat.<br />
<strong>Der</strong> erste Schritt war die Einsetzung neuer Chorfenster, damit<br />
nach vielen Jahren auch wieder einmal das Tageslicht<br />
den Altarraum durchfluten und die zukünftige Wandtönung<br />
in ihrem Farbenklang zeigen könne. Dann wurae ein Gerüst<br />
erstellt, das dem Meister Friedrich Dorn hier alle Ehre<br />
machte, gefällig, stabil und bequem, das die Gottesdienstabhaltung<br />
in keiner Weise beeinträchtigte. Die Wände und<br />
Decken wurden vom Staub und von der letzten Bemalung<br />
befreit und die vier großen Gewölbebilder mitsamt ihren 18<br />
Seiten der NebenDilder, die duftigen Blumengewinde, welche<br />
bisher ein stillverborgenes Leben unter der Tünche führten<br />
und koinem Menschen mehr bekannt waren. Rahmenwerk<br />
und alle Stuckverzierungen erhielten die ursprüngliche Fassung<br />
und Vergoldung wieder. Wände und Decken bekamen<br />
einen hellen Kalkkaseinanstrich; die Pilaster wurden marmoriert,<br />
wie sie es ehemals waren; besondere Sorgfalt widmete<br />
man dem Chorbogen. An seinen Kapitälen durfte das<br />
einst zeitgemäße Oxydgrün nicht fehlen.<br />
Ein Glück ist, daß die Kirchengemeinde den alten Hochaltar<br />
bei der letzten Restaurierung sorgsam verwahrte und<br />
ihn nicht verkaufte oder zerschlug, wie es mancherorts geschehen<br />
ist. So konnte er nach gründlicher Ueberholung und<br />
Neumarmorierung leicht wieder aufgestellt werden und zur<br />
harmonischen Ausgestaltung der Kirche beitragen. Er ist<br />
freistehend und im Grunde genommen nichts anderes als ein<br />
neuer Panzerkasten, darüberstehend das alte Drehtabernakel,<br />
flankiert auf beiden Seiter. von einem Engel, der in glänzender<br />
Weiß-Politur Sinnbild ist für die Anbetung und Verehrung<br />
Gottes. Das große Bild hinter dem Altar von Ambros<br />
Reiser wurde ausgebessert und aufgefrischt; es stellt die<br />
Kreuzigung dar, und zwar in dem Augenblick, als die Sonne<br />
sich verfinsterte und sichelförmig am Himmel stand. Wie von<br />
Kunstlicht erhellt werden auf dem dunklen Hintergrunde die
•22 HOHENZOLLEK S C H E HEIMAT )ahiaang ljJ55<br />
Gestalten Christus am Kreuz, Maria und Johannes sichtbar.<br />
Ueber dem Kreuzbild ist im Rundbild der Kirchenpatron St.<br />
Stephanus dargestellt. —<br />
Auch die Kanzel wurde in den Erneuerungsprozeß einbezogen<br />
und erhielt Goldverzierungen und einen weißen Lackanstrich<br />
mit Halbglanz. <strong>Der</strong> runde Korb ist geschmückt mit<br />
den Evangelistensymbolen und einem Lorbeerkranzgehänge.<br />
Auf dem Schalldeckel ist ein Sinnbild der hl. Dreifaltigkeit<br />
(gleichseitiges Dreieck mit drei Feuerzungen und Goldstrah-<br />
len), von unserem Ortspfarrer gestiftet.<br />
So ist im großen und ganzen die ehemals zeitbedingte, aber<br />
verfehlte Restauration beseitigt und die langjährige Verwahrlosung<br />
behoben. Die Arbeit ist ein Ruhmesblatt im Lebenswerk<br />
von Kirchenmaler Joseph Lorch, die Inscenierung<br />
dasselbe für unsern Ortspfarrer und bewährten Kunstkenner<br />
Pfr. Waldenspul und die Finanzierung ebendasselbe für insere<br />
derzeitige Einwohnerschaft. Verschiedenes bleibt allerdings<br />
in der Zukunft noch zu leisten. M. H.<br />
200 Jahre St. Annakirche in Haigerloch<br />
Die weitbekannte und vielbesuchte St. Anna-Wallfahrtskirche<br />
zu Haigerloch wurde vor 200 Jahren<br />
am St. Annafest des Jahres 1755 feierlich eingeweiht. <strong>Der</strong><br />
tiefgläubige, opferbereite und kunstsinnige Fürst Joseph von<br />
Sigmaringen hatte die Kirche von führenden Künstlern des<br />
Süddeutschen Barocks in Erfüllung eines Gelübdes auf eigene<br />
Kasten erbauen lassen. In den Jahren 1952 bis 1955 wurde<br />
die gesamte kunstvolle Anlage erneuert und instandgesetzt:<br />
Kirche, Kaplanei und Umfassungsmauer mit Pfeilern, Figuren<br />
und Vasen. Auf diese Weise wurde die einzigartige Anlage<br />
vor weiterem Zerfall bewahrt, der kostbare Kunstbestand<br />
gerettet und die Gnadenstätte zu Ehren der Heiligen<br />
Mutter ANNA kommenden Generationen erhalten.<br />
Bei den Einweihungsfeierlichkeiten der Kirche vor 200 Jahren<br />
hielt Graf Meinrad von Hohenzollern, Domkapitular von<br />
Köln und Pfarrer von Veringen(dorf), das erste Hochamt in<br />
der neuen St. Annakirche und der berühmte Pater Sebastian<br />
S a i 1 e r, Prämonstratenserchorherr von Obermarchtal in Anwesenheit<br />
des Hohen Fürstlichen Erbauers die Festpredigt<br />
im St. Annahof.<br />
Da nun am diesjährigen St. Annafest 1955 die St. Anna-<br />
Wallfahrtskirche das 200-Jahrjubiläum ihres Bestehens<br />
feiern wird, veröffentlichen wir zu diesem Anlaß den hochbedeutenden<br />
Wortlaut der genannten Festpredigt. Sie ist von<br />
hohem sprachlichen, historischen und theologischen Interesse.<br />
Zudem bleibt sie durch diese Veröffentlichung der Nachwelt<br />
erhalten.<br />
Haigerloch, im Jubiläumsjahr der St. Annakirche 1955.<br />
M. Guide, Stadtpfarrer.<br />
Ite in domum Matris vestrae: Faciat vobiscum Dominus<br />
misericordiam. Ruth I. V. 8.<br />
Gehet in das Haus eurer Mutter; der Herr erweise euch<br />
Barmherzigkeit. 1. c.<br />
Eingang.<br />
Wann Fürsten Baumeister seynd / ist das Gebäude prächtig<br />
so sie aufführen; und mag sich derjenige billig rühmen<br />
deme darin zu wo nen vergönnet wird. Gott und die Natur<br />
geben ihnen die Vernunft Anschläge zu machen / die ihrer<br />
würdig seynd; und tragt auch das Glüke alles bey / was das<br />
Werck zu seiner Verfertigung forderet. Niedere Strohhütten<br />
seynd keine Ding für Fürsten-Seelen. Marmor und Porphyr<br />
müssen unter den Hamer; Fichten / und Eichbäumer unter<br />
das Beul; Ceder / und Cypressen unter die Axt / Fürstliche<br />
Baumaister bey aer Nachwelt anzurühmen.<br />
Geringe Schwalben macher sich aus Koth / und Schlamm<br />
ihre Wohnung; und verächtliche Sperling verfertigen aus<br />
Stoppeln / uno Federen eine Behausung, Adler wählen Aest<br />
von Cederen J ihre Nestei zu oauen, und wann doch ein<br />
Phoenix-Vogel anzutreffen / flechtet er sich eine Wohnung<br />
aus Zimmet-Stauden.<br />
Kein schönere Lust für Große / dann der edle Trieb der<br />
Baukunst. <strong>Der</strong> Namen eines Helden scheinet einem Fürsten<br />
nicht so herrlich zu sey.. / als jener eines Baumaisters, Es ersetzet<br />
dieser wiederum alles / was jener verberget; und da der<br />
erste allein in dem wilden Krieg '.rwächst / der andere zu<br />
holden Friedens Zeiten entspringt /' ist leicht zu schluessen /<br />
welcher aus beyden der beste sey. Salomon war ein Fürst /<br />
dessen Ansehen auf Erden nichts gegieichet. So lang er Israel<br />
vorgestanden / wurde die Fridens-Sonne von keinem Kriegs-<br />
Gewülk verfinsteret. <strong>Der</strong> Innwohner Palaestinens genoße die<br />
stille Ruhe unter dem Feigenbaum / und Weinstock; weil<br />
sein Lands-Fürst anstatt des Regiment-Stocks den Maaß-<br />
Stab eines Baumaisters in Händen getragen; und wem kan<br />
aus der Schrift verborgen seyn / daß Achab der Fürst zu<br />
Samaria mehrer Ehre von dem helffenbeinenen HaußU dessen<br />
Stifter er gewesen T erhaschet habe / als da er wider<br />
Syrien zu Felde gezogen.<br />
Wem inderst als der Baukunst Welt-Baumaister-Goit<br />
hat die Welt ihre Scnönheit zu danken? Sie bringet zerstreute<br />
Dinge in einen sehenswürdigen Haufen / und sie ehret die<br />
Natur / weil sie ihr zur Ehre in eines sammlet / was sie zu<br />
allgemeinem Nutzen hervorgebracht. Wie unachtbar wäre<br />
das Gehölze / sofern es nur zu dem Feuer bestimmet wäre;<br />
und wie schlecht wurden die Steiner seyn / wann sie lediglich<br />
im Sand / und Leim zu ligen hätten.<br />
Adam der erste Mensch wäre freylich der mächtigste<br />
Fürst / der jemahl unter den Planeten herum gewanderet.<br />
Seine Herrschafft reichte / also zu reden / über seine Erkantnuß<br />
hinaus. Er war der Herr des großen Oceans, ob er<br />
schon kein Schiff auf selbem ausgeschickt hat. Gesammte<br />
vier Welt-Theil waren sein großes Eigenthum / ohne daß wir<br />
wissen / daß er irgends eine Wohnung erbauet habe: die<br />
ganze Welt mußte es seyn. <strong>Der</strong> gestirnte Himmel wäre das<br />
Dach: Busch / Feld / und Auen die Zimmer / wo er sich mit<br />
den Seinigen beholfen. Cain der erste Menschen-Mörder<br />
solle auch der erste gewesen seyn / der sich an das Aufführen<br />
der Mauren gewagt hat. Ein schlechte Ehre für die Baukunst<br />
/ wann sie die Erfindung eines Tyrannen gewesen<br />
wäre. Allein da Gott der allerhöchste diese sichtbare Welt<br />
aufgestellt / und Noe von ihme den Grundriß seiner Archen<br />
eingehollet / bleibt dem Architecten, desto mehr wann sie<br />
Fürsten seynd, die Ehre Gott nachzuahmen<br />
Sieben Wunderwerk hat die Erde mit Freude auf dem<br />
Rucken getragen. Die meiste hatten dif Baukunst zur Mutter/<br />
und Fürsten zu Vätern. Die hoch / und breite Mauren<br />
zu Babylon blieben der Semiramis einer Fürstin das ungeheure<br />
Weesen schuldig. Gecrönte Fürsten zu Memphis baueten<br />
die erstaunliche Feuer-Saulen an dem Nil-Strom auf.<br />
Artemisia eine Fürstin in Carien machte sich durch das aufgesetzte<br />
Grabmahl ihre Ehegattens weltkundig. Bey dem<br />
Tempel der Diana zu Ephesus in Asien beeuferten sich die<br />
Fürsten von Griechenland in die Wette, und wo kan endlich<br />
die Baukunst Fürstlicher seyn / als wann sie auf Kirchen<br />
und Gottes-Häuser bedacht ist?<br />
Wo die Andacht Fürstlich ist / locket selbe auch andere<br />
zur Nachfolge. <strong>Der</strong> Fürsten-Geist gleichet dem Meer / welches<br />
der ganzen Welt mit dem Seinigen Fursehung thut.<br />
Das gemeine Volk / und der Unterthan muß nothweiidig zur<br />
Frömmigkeit angelockt werden / so bald e« seinen Fürsten<br />
bey von ihme erbauten Altären erblicket. Cyrus de" p erse<br />
schätzte sich giükseeiig dem Gott Israels einen neuen Tempel<br />
aildorten zu stifften / wo Nabuzardan das Heiligthum von<br />
Juda verstöhret hatte. Seine Majestät blitzte weit heiler aus<br />
diesem Gemäur J als unter dem Baldachin seines Throns<br />
hervor. Das erste Jahr seiner Herrschung wäre noc 1 " nicht zu<br />
Ende geloffen / da er hierzu Verordnungen ausgefertiget<br />
und Anstalten gemacht Er glaubte für die Wohlfahrt seiner<br />
Staaten kein füglicheres Bollwerk / als einen Tempel zu<br />
finden. Constantinus der Große hegete gleiche Gesinnung.<br />
Rom in Italien / und Byzanz an dem B isphorus von Thra<br />
cien hat die abgeloffene Jahrs Reihe nicht so abgeänderet /<br />
daß seine Gottseligkeit in beyden kein Muster in Stein / und<br />
Sand annoch aufweisen kann. Dss Creutz Christi mußte auf<br />
den Standarten seiner Heeren glänzen / und auf den Thürnen<br />
der Gottes-Häuseren schimmeren. Es schätzte sich dieser<br />
große Fürst glücklich auf dem Gerüst der Mauer / and<br />
Zimmerleuthen / als auf den Tapeteft seiner Galerien; und<br />
wann er selbsten ganze "Cörbe ~uf f ürstlichen Schulteren zu<br />
dem Kirchen-Bau geschleppet / gereichte ihme die Mühe zu<br />
einem Zeitvertreib; die Last, zur I".st. So wenig därfe" sich<br />
Fürsten schämen bey so heiligem Werk durchlauchtige Handlanger<br />
zu seyn; da Jesus Christus der Fürst des Friedens<br />
selb' ten das Creutz als den ersten Grund-Pfeiler seiner<br />
Kirche auf den Golgotna getragen.<br />
Hochansehnliche! betrachtet diese Mauren / in dero Umfang<br />
wir uns heut befinden. Augen / und Gemüthe kämpfen<br />
miteinander ^ob die erste sich in diesem prächtigen Go+tps-<br />
Haus bälder ersättigen; das andere mit innerlicher Zärtlichkeit<br />
hurtiger begnügen möge. Die Augen s-'ien die milde<br />
Stifftung rünes Reichs-Fürsten / welche ja nicht nur unser<br />
Schwaben / sonder die ganze Welt erblicken solle Das Ge<br />
müthe unterhaltet sich in der Ergebenheit eines Fürsten /'
Jj^irgang 195? HOHENZOLLERISCHE HEIMAT 23<br />
welche er gegen der Großmutter unseres Christenthums heiliger<br />
Anna mit einem so großen Aufwand bezeiget. Er<br />
wußte ^ >rie werth es Christo sey / wann man diejenige<br />
ehretj, so da an seiner Menschheit aus ihrem Geblüte etwas<br />
beygetragen.<br />
Schöner Entschluß unseres Durchlauchtigen Fürsten! daß<br />
nachdeme die schmerzhaffte Tochter in dem Ehrwürdigen<br />
Gottes-Haus zu Hedingen nächst der Hochfürstlichen Residenz<br />
Sigmaringen von seiner Freygebigkeit eine Capellen erhalten<br />
/ auch Anna die Mutter auf diesem Gnaden-Berg bey<br />
Haigerloch eine bessere Wohnung bezühen sollte. Er wurde<br />
in das Herz getroffen / als er ihre uralte Bildnuß in einem<br />
zerfallenen Kirchlein gesehen. <strong>Der</strong> Eifer übergienge alle Hindernußen.<br />
Er legte sie so geschwind / als die unebne dieses<br />
Felsen auf die Seite. Kein Iscariot trauete sich i wie dorten<br />
bey Zerbrechung der Alaba=ter-Schaalen / etwas entgegen<br />
zu sagen. Alle / ,und jede ! welche wider dieses kostbare<br />
Werk die Nasen gerumpfet / wurden mit diesem abgewiesen:<br />
Jesus, Maria, und Anna seyen all dessen würdig /» in<br />
dero Händen das Glück der ganzen Welt / und insbesondere<br />
seines Catholischen Fürstenthums stünde. Bündige Worte<br />
von einem Christlichen Fürsten! und konnte wohl ein Joseph<br />
änderst reden?<br />
Gott sey unendlicher Dank gesprochen Udaß er uns bis<br />
anheut das Leben vergonnert hat / damit wir nicht nur dieses<br />
schöne Gebäude bewunderten, /. sondern den ersten Opfer-<br />
Rauch unser wohlgeordneten Andacht in selbem Jesu, Mariä,<br />
und Annä wiedmeten. Wir befinden uns an eben dem hochen<br />
Fest-Tag Annä allhier / um dem ersten öffentlichen Gottes-<br />
Dienst beyzuwohnen. Nutzen und Trost können wir insgesamt<br />
von diese: .1 Gnaden-Orth anheim nemmen Es wird uns<br />
da eine Schul T und Kirche geöffnet; weil uns heilige Anna<br />
zu einer Mutter / und zu einer lehrenden Mutter werden<br />
will; sehet den Nutzen: weil uns Anna zu einer Fürbitterin<br />
seyn wird; sehet den Trost, anjetzo weiß ich / was mir zu<br />
sagen ist.<br />
Niemahlen begehen wir die Fest-Tö.ge lieber Heiligen besser<br />
/ als wann wir von ihnen erstens einen Unterricht; dann<br />
eine Hilfe begehren. Wir irren und tappen mit Fehl-Schritten<br />
in dem Nebel / so bald wir diese Ordnung nicht beowachten.<br />
Die Ort allein / sagt Hieronymus, wo wir uns die heilige zu<br />
verehren versammlen / geben uns noch nicht den Namen<br />
ihrer Pfleg-Kinderen: sonderen die Nachübung ihrer Thaten<br />
macht uns zu solchem tauglich. Sie seynd urbiethig Gottes<br />
milde Seel / und Leib nach uns zu erbetten; allein sie wollen<br />
uns vorher in der Nachfolg ihrer Tugenden erblicken /<br />
welche sie von so vielen Canzlen / als Altären lehren.<br />
Anna lehret uns wie eine Mutter: die Stuck seynd nicht<br />
unbegreiflich. Sie seynd aas / wa, ein jeder wißen solle. Die<br />
Gebott Gottes genau zu erfüllen / und so> dann dessen Vorsichtigkeit<br />
sich gänzlich zu überlassen. Anna bittet für uns /<br />
von der Barmherzigkeit Gottes alles Gute zu erfahren. Nun<br />
haben wir alles: Ihr Kochansennliche / was inr in Betrettung<br />
dieses Gotteshaus zu + hun 5 und zu hoffe n habt; ich t<br />
was mir heut zu erweisen ist. Kommet sodann / ruffet euch<br />
Anna, wie. Noemi Ruth der Moabiterin / zu /. Kommet in das<br />
Hauß eurer Mutter / Gott erweise euch Barmherzigkeit Ja<br />
deine Stim—i ist es Großmutter 'des Christenthums heilige<br />
Anna aus diesem Gnadenbild / von diesem Thron / wohin du<br />
gesteren von geweyhten Priester-Händen bist gesetzt worden.<br />
Deine nützlich und tröstliche Wort seyend dieses. Erlaube<br />
mir / daß ich in selbe als ein Dolmetsch weiter ausgehen<br />
dnif. Ich weiß zwar wohl / daß sich meine Kräften so weit<br />
nicht erstrecken / dich also zu loben / wie deine Verdienste<br />
es forderen. Ephiphanhis, Joannes der Damascener / Andreas<br />
der Cretenser / Fulbertus von Chartres, und Tnthemius<br />
der Abbt haben zu deiner Ehre Zung' 7 und Feder angewendet;<br />
und bekenneten gleicnv ihlen ,' daß sie zu wenig<br />
ethan; was kan ich mir- wohl selbsten zumuthen / da ich<br />
dich anzupreisen diesen Rede-Platz zu besteigen angehalten<br />
bin? Sey es gleicnwohlen. Ich getraue mir zwar keineswegs<br />
dich in dem Schimmer an7usehrn / mit deme du in dem<br />
Himmel von deinem Göttlichen Enkel bist umgeben worden;<br />
jedoch werde ich aufs wenigste melden / was wir von deinem<br />
Lebens Wand] auf Erden zu unser Nachfoig erfahren *<br />
und von deinem Vorspruch genießen: nemiich / daß du eine<br />
Lehrerin bist / und zugleich die Stell einer Anwaldin vertret<br />
est; jene / wj§ embsig wir die Gebott Gottes halten /<br />
und also uns auf dessen Vorsehung verlassen sollen; diese<br />
wann wir dur^t. unsere Uehertrettungen Gnttes Zorn wider<br />
uns gereitzet / wie wir durch dich dessen Erbarmungen hoffen<br />
können.<br />
Mir stehet es zu / Hochansehnliche! den Vortrag in abgemessen<br />
j r Kürze auszuführen. Gott verleyhe mir seinen Beystand.<br />
Euch betriff! es davon Antheil zu nemmen. Gott<br />
schenke euch seine Gnad.<br />
Paulus der Welt-Apostel thate schon wohl / wann er dem<br />
Frauen-Volk das Lehr-Amt in der Kirchen verbotten. Er<br />
wußte / daß die Lehrer-Kappe den Frauen übel stehe: und<br />
obschon zuweilen das schwächere Geschlecht / wie man von<br />
einer Sapho, den Sibyllen / und vielen anderen weißt / ein<br />
großes Hirn / unter einer kleinen Haube herumtragt / so<br />
ist ihme doch in Göttlichen Dingen die Lehr-Canzel gesperret.<br />
Die Beredsamkeit der Zungen manglet ihme zwar<br />
nicht; allein Chrysostomus sihet selbe für mißlich an. Als<br />
Christus in dem Tempel geopfert wurde / redete Simeon /<br />
der alte allein. Die Lust den kleinen Messias auf seinen<br />
Armen zu sehen löste ihme die stammelnde Zungen: und<br />
da er vor Schwere des Alters kaum etwas um sich selbsten<br />
wußte / wurde er ein Prophet. Er priese ihne als das Licht<br />
der Volkeren / und die Ehre Israels. Auch Anna die Prophetissin<br />
kam nach Zeugnuß des Evangelisten Lucas in den<br />
Tempel. Sie lobte ebenfalls Gott / und spräche von diesem<br />
ersprießlichen Kind mit allen / welche die Erlösung Israels<br />
mit sehnen erwarten: und dannoch seynd ihre Wort wie<br />
jene Simeons nicht angemerkt. Die Schrifft-Forscher geben<br />
sich die Mühe dessen die Ursach zu wissen. Gregorius der<br />
Nyssener gibt die Schuld den dunklen Ausdruckungen / deren<br />
sich Anna damahls seile gebraucht haben. Salmeron<br />
misset es dem Evangelisten selbsten bey / welcher sich der<br />
Kürze beflissen. Bonaventura gibt endlichen die sichere Ursach<br />
mit Hugo dem Cardinal, Lucas habe alles Fleißes der<br />
Worten A.nnä nicht gedacht / weil das Lehren in dem Tempel<br />
einem Weib nicht zustehe.<br />
Ungeacht dessen bleibt dem Frauen-Volk doch etwas /<br />
was sie noch zu Lehrerinnen machen kann. Die Tugenden E<br />
welche so viele aus ihnen geübt; das Gesätze Tin dessen<br />
Beobachtung so manche empor gekommen; die Wunder / so<br />
Gottes Vorsichtigkeit mit unzählbaren unternommen / seynd<br />
in Wahrheit Dinge T deren Betrachtung zur Lehre mehr<br />
dienen kann fl als das Geschwätz der sieben Weisen in Griechenland.<br />
Seneca ein Heyde findet zu einem Unterricht nichts<br />
füglicheres / als das Beispiel. Und was druckt uns der Kirchen-Rath<br />
zu Trient zur Lehrfassung mehrers ein / dann<br />
das Leben derjenigen £ so nach dem Gesätze Gottes gewandlet?<br />
Kommet das Beyspiel von einer Mutter L dringt<br />
es noch tiefer in das Herz des Kinds. Beyde hat die Lieb<br />
miteinander verknüpfet; und da die Mutter das Kind beständig<br />
um sich hat / muß die Gegenwarth der ersten dem<br />
anderen nothwendig zu einem Muster werden.<br />
Zwo Mütteren in der Schriften finde ich / so da Anna genennet<br />
worden. Beyde waren mit einem Sohn gesegnet /<br />
deme das Leben der Mutter zur Lehre gewesen. Anna die<br />
fromme zu Ramathaim-Sophim konte kein anderes Kind als<br />
ein gottseliges erziehen. Samuel lernete von ihr die Gebott<br />
des 1 errn zu halten / und dessen Vorsichtigkeit bey der<br />
geheiligten Lampen in Silo sich -nzutrauen. Anna die gottselige<br />
zu Ninive gebahr einen Tobias zur Welt. Was Sorg<br />
hatte sie nicht als eine Mutter ihne mit eigenem Vorgan;<br />
also an las Gesäze zu binden / daß er sich von selbem auch<br />
unter de* 1 Heyden von Assu- nicht entfernen konnte / und<br />
mittelst Gottes Vorsichtigkeit zu Rages gesegnet wurde?<br />
sollen wir von unser Großmutter heiliger Anna nicht eben<br />
dieses nnhoffen können?<br />
Das alte Testament / wie es in das- Gesäze der Natur / und<br />
in die Zeiten des geschriel '-nen Bunds eingetheilet ist /<br />
zehlte viele der Frauen-Bildp..en / weiche der Welt zur<br />
i .ehre / und Ein gewesen. Eva bey dem Spinnrocken /<br />
Noema bey der Wollrahmen; Sara, Rebeca, Rachel in Gemeinschaft<br />
der großen Patriarchen' / M^na -}ie Schwester<br />
Moysis unter den Cambein der Töchter Israels / Judith in<br />
dem Lager / Jabel in der Tenne / Ruth auf dem Ackerfeld /<br />
Debora unter den Palm-Aesten / Esther auf dem Thron I die<br />
Mutter der Machabaeeren unter den Tyrannen zierten die<br />
vergangene Zeiten: niemahlen tratte aber e.ne größere Tochhervor<br />
als ene / dero Vater Stolan, oder nach Meinung<br />
des gelierten Tornielle Ilachan, die Mutter Fmerentiana gewesen.<br />
Etlich tausend Jahre flössen dahin / Zeit deren die<br />
Menschen gtwunschen / die Natur gearbeitet ein Meisterstuck<br />
zu sehen / an deme Gottes Gnad wie das meiste gekünstiet<br />
f also ihren eigenen Namen besonders gezeichnet<br />
hätte. Das Menschen Geschlecht seufzete d^s Ende ihres<br />
Elends ^und den Anfang ihres Heyls zu erblicken.<br />
Bethlehem sähe ein Töchterlein / dcue man an die Wiegen<br />
statt des Wappen den Sceppter von Juda, und das REuch-r<br />
faß Aarons mit Recht hätte anzt . "ihnen sollen. Aus diesen<br />
großen Wurzelt sprosse diese edle Pflanz hervor. Anna<br />
wüchse kaum unier der schlafflosen Sorg ihrer Elteren in die<br />
Jahre / worin die Vernunf' zu würken anfangt ^Ida sie die<br />
Aermlein schon nach dem '-uten v sgestreckt / und mit den<br />
Füßiein vor dem Lasier geflohen. Sie erkannte die Schönheit<br />
des ersten; und den Greuel des anderen.
24 HOHENZOLLE ISCHE HEIMAT Tabrgang 1955<br />
Ihre erste Sprache wäre von Gott; und redete sie von Geheimnussen<br />
des Himmels / ehe sie selbe begriffen. Sie flöge<br />
mit ihren Gedanken wie die junge Lerche mit dem Gesang<br />
schon über der Erde; und damit sie fürohin keinen anderen<br />
Gegenwurf als Gott hätte / mußte sie nach dem Tempel<br />
wanderen. Gleichwie die Gewächse in fremden Erdreich nur<br />
fruchtbarer werden / also gedeyete diese Entfernung von<br />
dem Väterlichen Haus zur Vollkommenheit Annä. Sie sollte<br />
nicht mehr in der Schooß Mathans ihres Vaters / sonder in<br />
den Armen Gottes ihres Erschaffers ruhen; und ia sie von<br />
der Mutter Emertianä entlassen / wurden ihr die zwo Gesätz-Taflen<br />
angewiesen / von ihnen in Zukunft den Safft des<br />
Geistes einzuziehen; welchen David Honig nennet.<br />
Die Einsamkeit gonnete ihr Ruhe / und Zeit; in jener<br />
ihren Gott zu betrachten; diese zu gottseligen Uebungsn anzuwenden.<br />
Die Mauren ihres Kämmerleins lienten ihr wie<br />
die Muschel dem Perl gegen den Anfall wilder Wellen; und<br />
hatte sie von einem Vogi in dem Kefig nichts wenigers /' als daß<br />
sie: wie dieser an dem Draht seiner Gefängnuß / also am<br />
Schloß und Rigl ihrer heiligen Behaltnuß nach der Freyheit<br />
getrachtet; nichts mehrers / als daß sie ihme zu Trutz in<br />
dem glückseligen Kerker Gottes Lob gesungen.<br />
Sie wußte das Gebett mit der Arbeit zu paaren. Sie machte<br />
alle ihre Werke mit der Meinung kostbar t wie der Goldschmied<br />
den Edelstein mit dem goldnen Reif: und wann ihr<br />
kein Brand-Opfer zu schlachter erlaubt gewesen' 1 konnte<br />
sie auch mit Nadel / und Spindel die gesegnete Glut der<br />
Liebe Gottes also aufwecken / daß ihre Anmuthungen in<br />
selber / wie der Harz-Kernen von Saba werther Dufft nach<br />
den Wolken geflogen.<br />
So viele sie Gespielinnen um siel 1 sähe / wäre sie ihnen<br />
insgesamt ein Spiegel-Glas der Ehrbarkeit. Gottes Gegenwart<br />
wäre Annä, was der Stab einer Blumen / daß sie in<br />
die schädliche Frechheit der Sitten niemahlen gesunken. Ihre<br />
Blick aus den Augen waren unschuldig. Sie gleicheten dem<br />
Licht des Pol-Sterns / welcnes niemand in Gefahr; alle aus<br />
selber führet. Wenig Wort flössen von ihrer Zungen / und<br />
jede Sylben riechte nach der Gottseligkeit. Die reine Seele<br />
gäbe sich durch die Reden wie das gute Erz durch den Klang<br />
zu erkennen. Mit Betrachtung Himmlischer Dingen sperrte<br />
sie die Porte ihres Herzen allen Drohungen unlauterer Geister.<br />
Sie verstünde / wie gefährlich es sey mit diesen Feinden<br />
in eine Nachbarschaft zu tretten: und sie konnte sich<br />
gar wohl vorstellen / daß eine Jungfrau von einer mit ihnen<br />
gepflogenen Vertraulichkeit so wenig / als eine Taube von<br />
den Klauen des Stoß-Vogls — unverletzt zurückkommen<br />
werde.<br />
<strong>Der</strong> Namen des großen Adonai, und Emanuels böge die<br />
Seele Annä bis in das Nichts. Sie hielte bey ihme täglich auf<br />
den Knyen an / den Erlöser Israels °inmahl zu senden, und<br />
sie befahle seiner Barmherzigkeit alle Augenblick das bange<br />
Anligen der aus dem Paradeis verjagten Menschen. Die<br />
nahe Zeiten des unter dem Menschen-Fleisch wandlenden<br />
Sohnes Gottes waren schon da; und wäre sie selbsten bereits<br />
ein Theil des glückseligen Firmaments / an deme der<br />
Stern Jacobs aufgehen sollte.<br />
Bey Anruckung der geheiligten Sabbat-Stunden ruhete sie<br />
in der Andacht / und sottseligen Uebungen I wie die Bienen<br />
der Nacht-Zeiten in ihren Körben. Keine Minuten gienge<br />
ohne Gebett vorbey: und darfte sich wie Sonne / und Mond<br />
bey Josues Befehl über Gabaon, und Ajalon; also kein Glied<br />
bey Anna zur verbottenen Arbeit bey so heiligem Tag-Lauf<br />
bewegen.<br />
Ehrfurcht / und Liebe gegen den Elteren / wie nahe läget<br />
ihr an dem zarten Gemüthe heiliger Annä? Sie hatte sich<br />
keinen Willen zu einem Eigenthum vorbehalten / welcher<br />
dero Befehlen entgegen stehen sollte. Die Magnet-Zungen<br />
bewegt sich wider das Eisen. Annä Herz hegte keine andere<br />
Gesinnung / als nach dem Wohlgefallen deren / welche ihr<br />
Gott zu Vorsteheren gemacht hat; und wolte sie denen reiffen<br />
Baum-Früchten nicht nachahmen / die zu,' Herbst-Zeit<br />
von ihren Aesten lassen / so sie gezeuget haben. Die Erkantnuß<br />
dieses von der Natur selbsten unterstützten Gebotts<br />
leuchtete ihr alier Orten; und weil sie wußte / daß<br />
Stolanus, und Emerentiana für Gottes Ehre durchaus besorgt<br />
wären / trüge sie kein Bedenken dero Augen wink ohne<br />
fernere Untersuchung zu gehorchen.<br />
Sie erschrak von Herzen / wann sie aus den Bücheren<br />
Moysis einen seines Vaters spottenden Chams, den seinem<br />
Erzeuger Kummer maenenden Ismael, den seiner Mutter<br />
wiederwärtigen Esau, und die ihren Eltern Verdruß bringende<br />
Dina nennen hörte Mit der wahren Hochachtung belonnete<br />
sie Mühe / und Sorgfalt Stolani, die er auf ihre Ernährung<br />
angewendet hatte; Billig Ding / so da einem Kind 7<br />
wie Gott selbstei erinneret / vor Augen ohne Unterlaß<br />
schweben sollen. Eilete Anna nach dem Tempi / da ihr der<br />
Willen beyder sich dahin zu verschließen gebotten / so gienge<br />
sie von dar so behend anheim /' als ihr der Befehl von Bethlehem<br />
zur Ruckkehr zu Ohren gekommen. Jeohtias die Tochter<br />
eines großen Richters / und Helden in Israel hat zwar<br />
ihren Gehorsam hoch getrieben. Sie ertatterte wohl nicht an<br />
dem unverhoften Gelübd ihres Vaters; und sie wurde in<br />
ihrem Sayten-Spiel keineswegs gehinderet / da sie das erste<br />
unter der Stadt-Porten von Maspha zum Opfer bei ?nnet<br />
wurde. Sie küßte das Gefäß des Väterlichen Schwerds / dessen<br />
Schneide sie enthalsen sollte. Und dannoch bäte sie um<br />
Verzögerung / und erkiesete sich zween Monat auf dem Gebürg<br />
ihr Schicksal zu bedenken.<br />
Ganz was anderes haben wir von Anna zu hören. Sie<br />
wurde zu einem Opfer bestimmet / wo man Freyheit» und<br />
Willen die Kleinod des Menschlichen Lebens schlachten muß.<br />
<strong>Der</strong> Ehestand war es. Joachim, deme die Tugend zu einem<br />
Heyrath-Gut geworden; und von welchem die Beowachtung<br />
des Gesätzes als eine Morgen-Gaab gefordert wurde /' wäre<br />
Annä zu einem Bräutigam ausgesehen. Anna bedunge sich<br />
noch Tage noch Monath fcnoch Stunden. Das Belieben ihrer<br />
Elteren wäre zu der Entschließung hinlänglich. Arge Wohllust<br />
/ üppige Sinnen hatten keinen Theil in diesem Vorhaben.<br />
Gott in den Himmeln schlosse das Band der gesegneten<br />
Ehe; und haben wir seiner Vorsichtigkeit den Ring einer so<br />
glückseligen Vermählung zu danken. <strong>Der</strong> große Sabaoth<br />
selbsten / welcher Eva mit Adam verknüpfet / hat das Band<br />
Joachims und Annä verfertiget. Er / der durch Raphael<br />
einen Tobias mit Sara vermählet / führte Anna zu Joachim.<br />
Er / so da durch die Klugheit Eliezers Rebecca bey dem<br />
Brunnen vor Isaac aufgesucht / schickte Anna Joachim aus<br />
dem Tempel.<br />
Alles nach dem Willen Gottes, Beyde waren aus einer<br />
Zunft fast zu gleicher Zeit gebonren. Sie zeitigten / wie<br />
zween Palm-Bäume unter einer Sonne / also bey Anleitung<br />
einer aufrichtigen Gottseligkeit. Sitten / und Gebärden glei Jiten<br />
sich wie zween Wassertropfen / welche sich endlich<br />
miteinander vereinbaren. Die Cränze wurden von dei Tugend<br />
geflochten; und der Geschmuck von der Andacht gelieferet.<br />
Die Ehe-Verträge kamen nach den Gebotts-Taflen /<br />
die von dem Berg Sina genoiiet worden / zu Stand: und<br />
wurde der allerneiligste Willen Gottes allein zum Braut-Führer<br />
erkohren.<br />
<strong>Der</strong> glückliche Erfolg wäre die Probe alles dessen. Ein<br />
Mayr-Hof / wohin sich Anna mit Joachim verfügte / mußte<br />
der Ort seyn / wo Gottes Gebott so gut als in d-rn Bunds-<br />
Kaste bewahret wurden. Das gesegnete Ene-Paar Dand selbe<br />
nicht mit den Pharisäern an Stirne / und Arm / sonder<br />
legte sie in dem Herzen bey. Die Liebe Gottes / und des<br />
Nächsten / worin die Propheten samt dem Gesäze i wie die<br />
Welt-Ballen zwischen den zween Angel-Stern hangen /<br />
schrieben die ganze Tag-Ordnung; und konnte sieh noch<br />
Gott in dem Himmel / noch ein Mensch auf Erden über Anna<br />
beklagen. <strong>Der</strong> Mond an dem Firmament kann seinen Lauf<br />
so richtig nicht vollenden //als sie die jedem Israeliten gebottene<br />
obschon beschwerliche Pilgerfahrten nach Jerusalem<br />
gethan.<br />
Zehend / und Erstlinge waren der Triout / und Jahr-<br />
Schatzung ^welcher ohne die geringste Minderung an Gott /<br />
und seine Priester abgiengen. Die Traube an dem Weinstock<br />
die Frucht auf dem Halm 1 das Obst an den Bäumen / das<br />
Vieh bey den Herden darften sich nicht weigeren den Kinderen<br />
Levi in die Hände zu fallen / weil es geootten; und<br />
mußte aus allen das Beste erkiese' seyn / da es dem großen<br />
Jehova und seinen Dieneren gebünrte. Was das Thau 1er<br />
Morgen-Stunden befeuchtet; und die Fetts der Erden beschoren<br />
/ theilte sie dreyfach. Das erste wurde Gottes Ehr<br />
gewiedmet; der andere den Armen überlassen; und der dritte<br />
dem eigenen Gebrauch hingegeben. Wäre es in ihren Kräfften<br />
gestanden / hätte sie weit mehrer zu Auszierung des Tabernakels<br />
beiyg'etragen / als das Frauen-Volk in der Wüste<br />
Aaron dem Hohen-Priester vor die Füße geschüttet hat. Sie<br />
gäbe es nach Vermögen. <strong>Der</strong> eitie Ruhm war Kein Absicht<br />
ihrer Freygebigkeit. Sie machte es den Wasserleitungen nach<br />
/ weiche unter der Erde verborgen / das süße Element in<br />
den Kasten auswerfen.<br />
Niemahl ist ein Bettier von der Thür ihres Land-Guts<br />
ohne Erquickung abgetreter.. Abrahams Gast-Liebe I and<br />
Sarä Pfleg-Eifer seynd in der Schrifft sehr berühmt. <strong>Der</strong><br />
erste lüde unter seiner Feld-Hütte in dem Thal Mambre<br />
die Fremde zu sich; die andere arbeitete in der Kuchl. Anna<br />
mit ihrem Joachim thaten es ihnen zui Nachfolg. Ihre Freygebigkeit<br />
wäre den Fremdlingen so bekannt / als dem Wanersmann<br />
die Obst-Früchten an der Straßen. <strong>Der</strong> gute Willen<br />
machte die Labung noch angenehmer / und der Bedürftige<br />
sähe in dem freundlichen Aug einen Wink bald wiederum<br />
an der Porten anzuklopfen. Alles gienge Annä von
.1 ahrgang 1955 H O H E N Z O L L E R I S C H E HEIMAT 25<br />
Herzen; und wie der Seiden-Wurm sein Ingeweide ausspinnet<br />
/ also gönnete sie Männiglich das Allmosen vom innersten<br />
Gemüthe. Lumpen / und Fetzen der Land-Bettleren<br />
lockerten ihr offt das Gewand von dem Leib; und wa.'e es<br />
ihr eine Unmöglichkeit die Bedürftnuß erblicken / und selber<br />
keine Steur abfolgen lassen. Kranke Krippel / die mit<br />
Thränen sie angeflehet / giengen mit Lachen von ihr ab. Sie<br />
natten / was sie wolten / und hoften / wie der Durstige von<br />
dem Bach / also von Anna auf ein anderes mahl neuen Beystand.<br />
Rebecca thate nicht so viel für Jaccob bey ^m alten<br />
Isaac, als Anna für die Nothleydende bey Joachim. Wittwen /<br />
und Waisen fänden an ihr eine Mutter / bey welcher sie<br />
Rath [ und That gefunden. Sie gleichete den Pfersich-Pflanzen<br />
7 deren Blätter einer Zunge; die Früchten einem Herzen<br />
ähnlich seynd; und sie ließe sich die Eigenschafft der Cypressen<br />
nicht zulegen / welche mit der Blühe vieles verheissen /<br />
sonsten aber weiter nichts in die Schoos werfen. Wie die<br />
Tochter des Pharao den kleinen Moyses aus dem Nil-Strom<br />
aufgenommen / also führte sie Vaterlose Kinder unter ihr<br />
Obdach ' selber zu sorgen. Es wäre ihr aus der Schrifft bekannt<br />
/ wer dem Armen gebe / fühle keinen Abgang; und<br />
sie begriffe wohl / was Gott in Ueberfluß reiche / seye nicht<br />
nur für Begüterte / sonder auch für Bedürftige angesehen.<br />
Die erste müssen die andere ernähren; und gleichwie hoche<br />
Berg das Wasser aus tiefen Thäleren mittheilen / also sollen<br />
ebenfahls die reiche Ganäle aus ihren Vorraths-Kämmeren<br />
in die leere Speis-Körb der Armen ablaufen lassen. Dahero<br />
käme es / daß die Hungerleydende auf allen Fuß-Steig3n von<br />
Annä Gütigkeit gesprochen / und die Presthafte von ihrer<br />
Milde mehrers erzehlet / als die matte Soldaten Davids von<br />
der Höflichkeit Abigails auf dem Carmel-Berg angerühmet<br />
haben.<br />
Was sie zu ihrer Wirtschaft angewendet hat / stiege niemahlen<br />
über die Gränzen der Nothdurft. Fraß / und Füllerey<br />
die fette Gespenster irrdischer Tafl-Zimmeren haben ihre<br />
Behausung niemahlen mit Polderen beunruhiget. Alle Niedlichkeit<br />
wurde aus der Kuchl verbannt / und aus dem Speis-<br />
Gaden gestoßen. <strong>Der</strong> Segen Gottes wäre das Gewürz; und<br />
ersättigte sie sich an ihme vergnügter / dann die Jüdische<br />
Frauen an dem Himmel-Brod 7 so wie mit einem Gomor<br />
aufgesammlet. Sie lebte von ihrem Eigenthum. Kein ungerechte<br />
Brosam litte sie in ihrer Brod-Laden / und kein fremdes<br />
Körnlein ist jemahl in ihre Scheuren gekommen.<br />
Unerfreundliche Nachbarn mißgonneten ihr öfters die volle<br />
Feld / den fruchtbaren Weinstock / und die gesunde Heerden.<br />
Allein der Neid konnte sie niemahlen aufbringen / weil<br />
sie alles Gott; nichts denen Menscher zu danken hatte. Sie<br />
wurde manchesmahl von Gehäßigen / wie die Wittwe von<br />
Sunam von den Gläubigeren angefochten. Gottes-Schutz /'<br />
und der Schatten seines Schirms deckte sie allezeit wie das<br />
Blatt die Frucht gegen Wind / und Schlossen Sie gonnete<br />
jedermann die Wohlfahrt. Das Glück des Nächsten gereichte<br />
ihr zur Ergötzung; und konnte sie sich an den gesegneten<br />
Furchen auch ihrer Feinden nicht weniger / als an den eigenen<br />
belustigen.<br />
Zu der Begierde zu fremdem Gut stunde sie so fern ?als<br />
Salamons so belobtes Weib von den äußersten Welt-Gränzen<br />
7 welche sich von dem Rath ihrer Hän< n allein ersättigen<br />
wollte, und wäre ihr Jezabel ein Greul / welche es in<br />
Mitte des Ueberflußes nach den Trauben Naboths gehungert;"<br />
hat.<br />
Hader mit angränzenden / Gezänke mit Fremden / GPschwäzigkeit<br />
mit Bekannten / sonsten Erb-Fehier des schwächeren<br />
Geschlechts / ihr dorftet euch auf der Zungen Annä<br />
nicht lageren. Verläumdungen des Nächsten / falsche Zeugschaften<br />
Ehrenrührische Unterhaltungen / an welchen die<br />
Weibs-Zungen gemeiniglich so gerne / als an dem Zucker<br />
iecken / haßete sie wie Gall und Gifft. <strong>Der</strong> Friede / so sie mit<br />
ihrem Ehegemahl ohne die mindeste Abwerfung genossen /<br />
wäre der Schopf-Brunnen alles Vergnügens.<br />
Konnte aber Annä noch etwas manglen? ach! ja' und zwar<br />
eine Sach / nach welcher Anna des Elcana zu Silo geseufzet<br />
hat. Die Fruchtbarkeit des Erdreichs konnte so viel nicht<br />
geschätzt werden / als die Unfruchtbarkeit des Leibs vor<br />
Zeiten gehaßet wurde. Man achtete ein Kind / oder Leibs-<br />
Erben für ''as größte Glük;<br />
Die Ehefrauen waren damahls von sothanen Abgang noch<br />
heftiger getroffen. Sie sahen sich als verfluchte Erdreiche<br />
an ^auf welchen keine Pflanzt- wächst. Das blasse Gesichte /<br />
die zerstreute Haar / die von der Schamhaftigkeit geschloßne<br />
Augen / die mit Thänen benezte Wangen machten das innere<br />
Leydwesen offenbar. Sie bildeten sich ein / ihre Nämen werden<br />
ohne Kinder in der Gedächtnuß der Nach-Welt / wie<br />
die Wolken ohne Regen sonder Nutzen in der Luft verschwinden.<br />
Einige verlieffen sich ' n die Wälder / und klagten<br />
ihr Unstern den Bäumen / weiche ihnen zur Vermehrung<br />
ihrer Betrübnuß Früchten an den Aesten wiesen; und wann<br />
sie bey öden Felsen Trost suchen wolten / schiene es / als<br />
wolte auch der Echo ihrer spotten i der gleichwohlen ein Kind<br />
des trocknen Stein-Gebürgs in den Fable:, seyn solle.<br />
Heilige Anna wäre nicht weniger unruhig / weil sie ein<br />
gleiches Schicksal betroffen hatte. Die Erwartung des Heylands<br />
beherrschete in aller Herzen; und jede Ehe suchte durch<br />
die Erzeugung an dessen Sippschaft theil zu nemmen. Dieser<br />
Eifer konnte in Anna nicht änderst / dann größer seyn / weil<br />
sie von den Vordeutungen Jacob des Patriarchen versichert<br />
wäre / das Glück werde die Zunfft Juda, den Stamm Davids<br />
treffen / an deren Stammen-Baum sie mit Joachim nicht das<br />
kleinste Blatt innen hatte. Diese Unfruchtbarkeit wäre zwar<br />
nach Meinung Chrysostomi mehr ein Geheimnuß / als eine<br />
Würkung unkräftiger Natur. Jedoch mangelte ihr noch Spott<br />
noch übler Nachruf in Israel. Näherte sie sich der Porten<br />
des Tempels / wurde sie zuruck gewiesen. Wolte sie das<br />
Opfer zu dem Brand-Tische bringen / wurde ihr der Zugang<br />
abgeschlagen. Unglimpf / und Geringachtung waren<br />
das / so sie von allen Seiten auf sich mußte anprellen lassen;<br />
und gleichwie ein Wandersmann seinen Reis-Stab an<br />
den Baum schlägt / der keine Frucht trägt; der Schiffer zur<br />
See mit dem Ruder das bittere Wasser gegen einer Insul<br />
wirft / die kein süßes hat: also hatte sie Unbilden zu gedulden.<br />
Die Sanftmut wäre da die Zeugin ihres großen<br />
Geistes. Sie wäre eben wie ein unfruchtbarer Baum / welcher<br />
einem reisenden anstatt der Frucht den Schatten gibt /<br />
oder wie ein dürres Eyland / so da auf wonigste dem Anker<br />
einer Ruhe gestattet. Also begegnete Anna den Tadlern mit<br />
Milde / und stiller Gelassenheit. Sie seufzete freylich in Geheim<br />
mit solchem Ernst / daß / wie Tertullianus sagt / der<br />
Himmel bey Abfertigung ihres Ansuchen hätte errothen sollen.<br />
Ihre Hoffnung hatte die Demuth zum Grunde / welcher<br />
Gott nichts abschlagen kann; und sie verließe sich auf beständiges<br />
Gebett / deme sich ohnehin die Pforten des Himmels<br />
zu öffnen pflegen.<br />
Wahrhaftig der vorsichtige Gott neigte das Ohr zu dem<br />
hitzigen Anflehen Annä. Wir sehen oft aus Felsen / und altem<br />
Gemäur Blumen / und Sprossen hervor wachsen / die<br />
keine Menschen-Hand gepflanzet hat. Joachim, und Anna<br />
mußten unfruchtbar seyn / auf daß die Geburt eines Kinds<br />
aus Eis / und Schnee der erfrohrnen Natur ein Wunder<br />
wäre. Anna hoffte mit Abraham wider die Hoffnung selbsten.<br />
Sie trotzte die ungehaltene Verzweiflung; und sie<br />
machte sich durch ihre Beständigkeit eines solchen Vortheils<br />
genossen / dergleichen noch keinem Frauen-Bild von Anbeginn<br />
der Welt zugekommen.<br />
Eine überflüßige Ersetzung aller Widerwärtigkeiten<br />
wäre nun die Geburt Maria Annä geworden; und gleichwie<br />
die Rosen-Stauden alles unannehmliche bey Hervorgang seiner<br />
Blumen verlieret / also verschwände Sorg / und Kummer<br />
bey fröhlichem Anblick eines Kinds / welches die Vorsichtigkeit<br />
Gottes bescheret. Ergötziichkeit! so A.nnam befallen /<br />
als sie Mariam nach Drey Jahren in dem Tempel geopferet ß.<br />
wer kan dich begreifen? Trost / so Annä Herz überschwemmet<br />
/ da sie ihre unversehrte Tocater mit einem Jungfräulichen<br />
Joseph in einem Braut-Band wie zwo Lilien in einem<br />
Busch verknüpfet / wer kan dich fassen? Vergnügen! welches<br />
Annam erquicket / als sie vernommen / daß Maria von<br />
dem heiligen Geist zu Nazareth den Messias empfangen /<br />
wer kann dich verstehen? Freude! die Annam entzucket hat /<br />
als ihr die wundervolle Geburt Jesu Christi des von den<br />
Hirten erkannten / von den Morgenländern angebetteten<br />
zu Ohren gekommen / wem ist es gegeben dich zu beschreiben?<br />
Ach! der Namen Anna war erfüllet / welcher so viel als<br />
Gnade sagt. Gottes Vorsichtigkeit hat sie mit Gnaden überhäufet<br />
/ weil sie auf selbe ihr Hoffnung geoauet. Sie hat<br />
sich diese auch zugezogen / weil sie sich mit Haltung der<br />
Gebotten wie wir beydes zu unserer Lehr gesehen /' dazu<br />
tüchtig / und würdig gemacht hat. (Schluß folgt.)<br />
P. Sebastian Sailer<br />
<strong>Der</strong> Prediger beim ersten St. A-na-Fes. in Haigerloch wai der<br />
berühmte Prämonstratenser-P£ Seba \an Saiier vom Kloster Obermarchtal.<br />
Er ist geboren am 12. 2. 1714 ir Weißenhorr (Bayi rn).<br />
Seine Primiz als Ordenspriester feierte er 1738. Sailer galt al einer<br />
der besten Prediger seiner Zeit. Six Bachmann, sein Ordensbruder<br />
und Biograph, sagt von ihm: Sein treues Gedächtnis, sein klarer,<br />
durchdringender Verstand, sein sonores Org< , seine reine Aussprache<br />
und sein ganz einnehmender Vortrag bildeten ihn in der<br />
Tat zi e.rc-m großen Redner.<br />
Sailer dichtete viele biblische und weltliche Komödien, die alle<br />
vor. köstlichem und derl :m Witz und Humor durchwürzt sind.<br />
Durch diese Arbeiten wurde er zum Vater der schwäbischen Dialektdichtung.<br />
Als arbeitsfroher Priester versah er :ne "ere Klosterpfarreien in<br />
der Nane ^be*-n -rchtals und starb im 1. 3. 'Tp.<br />
Von seine] Geistes'egr ..wart und se.nem Wi als Prediger zeugt<br />
folgende Anekdote: Die ledigen Burschen der Pfarrei Dieterskirch
26 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
hatten die Gewohnheit, sich während der Predigt über das Geländer<br />
der Empore weit hinaus zu lehnen und nach den Mädchen unten im<br />
Schiff zu sehen. Saiier konnte diesen Unfug nicht leiden und unterließ<br />
nicht, sowohl mit Güte als Schärfe abzumahnen. Allein alles<br />
Mahnen half nicht. Die Kirchweihe kam heran, und als Saiier die<br />
Hälfte der Predigt vollendet hatte, stellte er sich an, als ob ihm<br />
das Gedächtnis versagte. „Weil ich nun den Faden meiner Predigt<br />
verloren habe," sagte er, „so will ich unterdessen, bis mir das<br />
Uebrige einfällt, etwas erzählen. Ich las neulich in den alten Pfarrbüchern<br />
und fand, daß vor Zeiten auf dem Platze, wo jetzt die<br />
Pfarrkirche steht, eine Fruchtscheuer gestanden habe. Es ist freilich<br />
den alten Nachrichten nicht immer zu trauen; doch, was mich betrifft,<br />
werde ich gänzlich in dieser Meinung bestärkt, denn jetzt<br />
sehet nur, die Flegel hängen noch von da oben herunter." Schnell<br />
richteten sich die Burschen auf, und diesem Unfug ward für alle<br />
künftige Zeiten abgeholfen.<br />
Zur Familien- und Namenskunde in der Grafschaft Zollern 1622<br />
Im Jahre 1622 ließ Johann Georg von Hohenzotlern-Hechingen,<br />
der von 1605—1623 regierte, eine „Beschreibung aller in<br />
der Grafschaft Zollern gebauten Sommer- und Winterfrüchte"<br />
vornehmen. Was den hochgebildeten und im Dienste dreier<br />
Kaiser als Diplomaten bewährten Grafen, der 1623 in den<br />
Reichsfürstenstand erhoben wurde, zu dieser höchst zeitgemäß<br />
anmutenden Maßnahme veranlaßte, ist nicht überliefert.<br />
Wir dürfen aber annehmen, daß es die Sorge des Landesvaters<br />
um das Wohl seiner Untertanen war, deren Ernährung<br />
er sicherstellen wollte, raste doich die Kriegsfurie schon<br />
im 5. Jahre durch die deutschen Lande. Die zweckmäßig angelegten<br />
und schön geschriebenen Blätter (F. H. Dom.-Arch.<br />
Abt. Hechingen, Rubr. 119) führen gemeindeweise alle Familienhäupter<br />
auf, die Ackerbau betreiben. Hinter den<br />
Namen der Familienvorstände stehen die Flächenangaben des<br />
angebauten Getreides in Jaucherten und Vierteln, getrennt<br />
nach Emer oder Vesen, Roggen, Gerste und Haber. Nicht genannt<br />
sind die Geistlichen, teilweise auch Diener und Beamte,<br />
die bekanntlich ebenfalls Landwirtschaft betrieben, bezw. betreiben<br />
ließen. Wenn die Angaben über die herrschaftlichen<br />
Höfe fehlen, so erklärt sich dies daraus, daß deren Anbauflächen<br />
bekannt waren, da die Hofgüter in Eigenbau standen.<br />
Trotz dieser Lücken können wir die Anbauflächenerhebung<br />
vom Jahre 1622 als eine Art Familienzählung in der<br />
Grafschaft Zollern ansehen, die für die Landgemeinden vollständig<br />
sein dürfte. Nur bei den Gemeinden, auf deren Gemarkungen<br />
herrschaftliche Höfe oder Sennereien lagen, wie<br />
Hechingen, Boll, Stetten, Weilheim, Grosselfingen und Burladingen<br />
kommt noch jeweils 1 Familie dazu.<br />
Die Kenntnis der Familien nach Namen und Zahl zu Beginn<br />
des 30jährigen Krieges gibt uns wertvolle Anhaltspunkte<br />
für die Verödung der Dörfer im Laufe des genannten<br />
Krieges 1 ). Von besonderem Werte sind unsere Listen<br />
aber für die Familienkunde, denn sie zeigen an, welche<br />
Geschlechter bereits vor dem 30jähr'gen Kriege in den einzelnen<br />
Ortschaften ansäßig waren. In nicht wenigen Fällen<br />
dürfte auch durch diese Veröffentli :hung die Verbindung von<br />
den viel familienkurdlichen S jff enthaltenden Archivalien<br />
des 1 6. Jahrhunderts bis zu den Kirchenbüchern, aie erst nach<br />
164t : beginnen, bezw. meist wieder neu angelegt werden<br />
mußten, hergestellt werden können 2 ).<br />
Von den 1093 aufgeführten Inhabern landwirtschaftlicher<br />
Betriebe H er 25 zollerischen Gemeinden sind nahezu alle mit<br />
Vor- u 1 Zunamen genannt. Unierzieht man die Vornamen<br />
einer näheren Untersuchung, so findet man den Namen Hans<br />
330, Jakob 115, Jerg 78, Martin 76, Michel 71, Baltner 44,<br />
Kaspar 43 und Meiches }9 mal vertreten. Von "iei Gesamtzahl<br />
entfallen also auf der Namen Hans 30%! In größerem<br />
Abstand folgt Jakob mit 10°/u, Georg in der Form von<br />
• erg mit 7 Martin und Michel mit je 6 °/o, während<br />
Kaspar, Meiches und B a 11 h e s die Reihe mit je 3 °/o<br />
beschließen. Alle übrigen Vornamen bleiben unter 3 vom<br />
Hundert. Ueberhaupt nicht vorkommen die Namen Anton,<br />
j Dsef, Karl und Paul, um nur einige der in den folgenden<br />
•Jahrhrunderten beliebten Vornamen zu nennen. <strong>Der</strong> hl. Antonius,<br />
für dessen Verehrung sich bekanntlich das Kloster<br />
St. Luzen mit seiner Antoniuskapelle einsetzte, kann in der<br />
fraglichen Zeit noch nicht einer der Lieblingsheiligen des<br />
Voikes gewesen sein! Daß die Verehrung des hl. Josef bei<br />
uns verhältnismäßig späten Ursprungs ist, geht schon daraus<br />
hervor, daß sein Fest erst 1701 in der Konstanzer Diözese<br />
gebotener Feiertag wurde. Nach NIED 3 ) erklärt sich die<br />
Volkstümlichkeit . J es Namens Johannes aus dem außerordentlichen<br />
Kult, der dem Vorläufer Jesu zuteil wurde und<br />
im Alter, der Zahl und dem Range seiner Feste, Kirchen<br />
und künstlerischen Darstellungen seinen beredten Ausdruck<br />
findet. So wurde der Marne Johannes abgekürzt Hans und<br />
meist Hanns geschrieben, zum verbreitetsten aller Taufnamen.<br />
Jakob ist einer der Lieblings jünger des Herrn und der<br />
erste Märtyrer unter den \posteln. Die Wallfahrt zu seinem<br />
Heiligtum Compnstela in Spanien kam in Mittelalter gleich<br />
neben der nach Rom und dem hl. Lande. Die Verehrung St.<br />
Georgs, des Ritters und Drachentöters wurde besonders<br />
von M. S c h a i t e 1<br />
durch die Kreuzzüge gefördert, während Michael, dessen<br />
Fest schon 813 bei uns eingeführt wurde, der Schutzpatron<br />
Deutschlands ist. Martin, der große fränkische Bischof, gab<br />
seinen Namen Hunderten von Kirchen, während sein Tag,<br />
der 11. November, für die Landbevölkerung mit der wichtigste<br />
Termin im Ablauf des Jahres war. Was die Verehrung<br />
der hl. Dreikönig betrifft, so klingt sie in dem Brauch nach,<br />
an ihrem Feste C + M 4 B über die Türen zu schreiben.<br />
Keinen wesentlichen Einfluß auf die Wahl des Vornamens<br />
scheinen die Kirchenpatrone ausgeübt zu haben. So ist z. B.<br />
der Name Sylvester, Kirchenpatron in Jungingen und Stetten<br />
u. Holstein, sowie Hubert in Grosselfingen, nicht vertreten.<br />
— Interessant ist zu hören, daß Karl Otto MÜLLER')<br />
bei seiner Untersuchung der Vornamen von 3000 Wehrfähigen<br />
der Grafschaft Hohenberg aus dem Jahre 1615 zu dem<br />
gleichen Resultat kam: Auf den Namen Hans fallen 29, auf<br />
Jakob 12, auf Georg 7 und auf Martin und Michel je 5 vom<br />
Hundert aller genannten Wehrfähigen.<br />
Für unseren Zweck wurden die Namen der Ortschaften<br />
wie der Familien alphabetisch geordnet und die Familienhäupter<br />
mit gleichen Vor- und Zunamen mit römischen<br />
Ziffern bezeichnet. Die jeweils in Klammern hinter den Ortsnamen<br />
stehende arabische Ziffer gibt die Anzahl der ackerbautreibenden<br />
Familien wieder. Bei Hechingen erfahren wir.<br />
welche Familien vor dem Oberen Tor, welche vor dem Unteren<br />
Tor oder in der Altstadt und endlich, welche Familien<br />
in der mit Mauern und Türmen umgebenen, eigentlichen<br />
Stadt ihren Wohnsitz hatten. <strong>Der</strong> Name Hans ist im Original<br />
meist mit zwei „n" geschrieben.<br />
Bechtoldsweiler (18): Anstatt Konrad - Arnolt<br />
Matheus - Bailer Adam - Bailer Hans - Bailer Konrad -<br />
Beck Hans - Beck Jerg - Haap Martin - Haap Martin, Beck -<br />
Hipp Jakob - Hipp Jerg - Hipp Matheus - Kappenmann<br />
Jerg - Kaus Adam - Poppel Hans - Popel alt Hans - Sautter<br />
jg. Jakob - Vischer Peter.<br />
Beuren (17): Glambser Jakob - Kantz Hans - Kantz<br />
Martin - Kleinmann Jerg - Landolt Hans - Singer Jakob -<br />
Singer Bastian Witwe - Scher Jakob - Schetter Stephan -<br />
Schetters Heinrich Witwe - Thalmiller Hans - Netz Jakoo -<br />
Netz Hans - Netz Jerg, Vogt - Netz Stepnan - Netz Ulrich -<br />
Zeifer Jakob.<br />
Bisingen (70): Beck Hans Weber - Lee* Hans, Jakobs<br />
Bruder - Binder Konrad - Binder's Gall, Witwe Döner<br />
Kaspar - Döner Michel, im Lew - Döner Michel - Döner<br />
Baitnas, Joachims Sohn - Döner Hans, Joachims Sohn - Döner's<br />
Joachim Witwe - Donst Hans • Emich Hans - Emich<br />
Kaspar Emich Melchior - Fatz Martin - Geckhinger Balthas<br />
- Geckingei' Melchior - Gfrerer Hans isell Melchior -<br />
Haug Hans - Haug Hans iung - Haug Balthas, Schmied -<br />
Haug Kaspar, Capeles Sohn - Haug Kaspar, Peters Sohl -<br />
Hausch alt Hans Hausch Michel, jung - Hchenloch Gall,<br />
Schneider - Honenloch Hans - Hohenloch Mf. rtin - Hohenloch<br />
Martin, Schuhmacher - Lacher Batha= - Lacher Hans -<br />
Leipold Jakob - Killmayev Balthas - Killmayer Martin -<br />
Krieger Hans - Mayer's Hans Witwe - Mayer's Martin<br />
Witwe - Mayer Melchior - Mayer Gall - Mayer Jakob -<br />
Mehr Balthas - Miller Michael - Paur Hans - Paur Martin -<br />
Rager Melchior - Sautter rians - Sautte. Martin - Sautter<br />
Balthas - Sautter Balthas, Biple - Sotz Michael, Beck - Sotz<br />
Michael Witwe - Sotz Kaspar - Sotz Balthas - Sotz Hans<br />
jung - Sotz Hans alt - Schetters Bieble - Schluck Balthas -<br />
Schn~id Hans, Vogt - Schneider Abraham - Schneider Hans -<br />
Schoy Jakob - Schoy Konrad - Schuemacher Michel - Vogt<br />
Kaspar - Vogt Konrad - Vecker Hans - Vecker's Kaspar<br />
Witwe - Vecker Jakob.<br />
Boll (33): Bogenschitz Adam - Boll Martin - Buck Hans -<br />
Buck Jerg - Daicker Br lthas - Ehemann Martin - Ehemann<br />
Martin II. - Ehemann's Balthas Witwe - Gamertinger Hans -<br />
Geri Georg - Gross Ambrosi - Gross Martin - Holzhauser<br />
Hanc - Kayser Hans - Killmayer Jakob - Kipff Hans - Leffler<br />
Hans - Leffler Martin - Leffler Mathäus - Mayer Jakob<br />
- Mayer Thoma - Milier Hans - Ot Hans - Pflumm
Jahrgauu 1955 UOHi:NZ.ULLKK[iiUllli HJäiMAT<br />
Hans - Schwab Georg - Schwab's Michel Witwe - Schwab<br />
Hans - Schwab Jakob - Speidel Jerg - Volmer Hans - Volmer<br />
alt Hans - Zinck Martin - der Ziegler.<br />
B u r l a f i n g e n (64): Allgewer Martin - Bach Hans -<br />
Baur Michel - Bausinger Hans - Bausinger Hans II. - Becherle<br />
Adarn - Beck Jakob - Bertsch Ludi - Buel Balthas -<br />
Buel Hans - Emele Michel - Epplin Hans - Felenschmid<br />
Simon - Felenscnmied Konrad - Franck Hans - Fritz, Hans -<br />
Fromm Burkhard - Fromm Stoffel - Graf Jerg - Gleri Theiß<br />
- Gluitz Theiß - Hardtmann Jerg - Hoch Hans - Holzhawer<br />
Hans - Holzhawer Jakob - Kletzle Hans - Koch Hans - Koch<br />
Gorgius - Koch Katharina - Lang Jerg - Laylin Hans - Lebhertz<br />
Hans - Lebhertz Jakob - Mautz Christa - Mautz Matheus<br />
- Mautz Matheus II. — Miller Hans - Miller Kaspar -<br />
Mock Christa - Pfister Hans - Pfister Barthle - Pfister Hans<br />
n. - Pfister Martin - Pfister Kaspar - Pfiueger Christa -<br />
Pfiueger Martin - Rauch Simon - Rentz Jerg - Reihing<br />
Joachim - Ridel Jerg - Riele Michel - Ruf Kaspar - Ruef<br />
Michel - Ruef Hans - Ruef Theis - Ruef Hans II, - Ruef<br />
Hans, Vogt - Sautter Jerg - Schweitzer Peter - Schweitzer<br />
Jakob - Schweitzer Balthas - Stecklin Hans - Wetzel Hans -<br />
Wolfer Kaspar.<br />
Gauselfingen (23): Armbruster Jakob - Baur Hans -<br />
Bettle Hans - Bieckhardt Theis - Eysele Claus - Eysele Hans<br />
- Flehner Hans - Glicker Theis - Gsell Peter - Hauch (Hoch)<br />
Martin - Hefele Hans - Kantz Hans Klaiber Jerg - Kiein<br />
Hans - Klein Martin - Lutz Hans - Mayer Theis - Paur<br />
Hans - Schiele Jerg - Schwenck Hans - Schwenck Janob -<br />
Vickher Peter - Zimmermann Hans. (Fortsetzung folgt.)<br />
1) Zahl der Bürg er einer Reihe von Gemeinden von 1620 und 164( in<br />
.,Die Hor-nz. Lande während dos SOjähiigen Krieges" von Heinz<br />
(Mi" Höh. X CXI) und „Folgen des 30jäh. ;en Krieges" von Kraus<br />
(Z. H. 1939, Nr. 4).<br />
2) Verzeichnis der Kirchenbücher Hohenzollerns von Haug (Höh.<br />
Jahresh. Bd. 9. 1949).<br />
3) Heiligenverehrung und Namengebung, Freiburg/Br. 1924.<br />
•i) Württ. Jahrb. f. Stat. u. Landesk., Stuttgart 1915.<br />
Alte Gemeinderechnung von Jungingen 1794—95<br />
Verzeichnus Was die Beede Burger Maister Casimir Riester und<br />
Joseph Buomiller Von Gleretstag von 1794 bis 1795 Aus geben Haben.<br />
Fl. Kr.<br />
Erstlich: Titel. Herr Pf; Vor sin HI. Mes zalt —.20<br />
Am Gleretstag d ien Schuol Kinder und Lehrer wegen<br />
Schriften zalt 1.52<br />
Weil Man die die Holtz Theil aus geben hat Im Waltertal<br />
dem Vc gl nd beede Burger-Maister Schitzen und zwey<br />
'»emeindsdeput<br />
Dem Ober Jager von Hechingen selbigsmal zalt 1.<br />
Beym Auslosen zalt l'.<br />
Weil die Comißion hier geweßen Von Stutgat haben sie verzert<br />
7<br />
Dem Gericht am Gleretstag wegen Runung (Rügung) 1.<br />
Weil man die Consignation w( den land Melizen gemacht<br />
Von 18 bis 50 Jahr den Vorgesetzten ihren Lohn zalt 1.33<br />
Dem Vogt weil er mit dene Buoben zu Hechingen geweße zalt —.30<br />
Dem Botten mit einem Befehl zalt —.6<br />
Weil man dem Tadeus Mayer sein gelt eingezogen 3i/., Tag<br />
denen Vorgestzten zahlt 4.24<br />
Dem Roß: .lauer zalt 1.30<br />
Weil man das Hagen Hay Heim gethan z. 1.08<br />
Denen Quartiermacher Vom 24. Mayen z. 2.32<br />
selbesmal dem Vogt und Burg.Maister z. 138<br />
Dem Schitzen zalt wegen 5 Karren voll 'tein gebrochen und<br />
zur Ur ersegmille schröpfen gefirt —.45<br />
Dem Burger M ister i nd Schitzen wegen Schuol Holtz<br />
. aa" v en zeit mit —.24<br />
D m Cantzley B' /en ir 3 Hlahl n zalt Cantzleibefehl — '.)<br />
Weil man im Frühjahr Vag: und BürgerMaister ur ' 3 Dep<br />
itiertf wegen den Bronnen zu Hechingen gewesen<br />
il en 'jOhn z. 2.08<br />
Selbes:: ahl dem Schleid . and (Ratschier; IDberle zahlt —.52<br />
nem Lehrer Vc Arme Schuol KTncJer z;^ - ; 2.54<br />
Dem Sylvester Buomiller und Xaveri Buomiller vor 3 Dutzet<br />
Fakhlen zahlt 1.30<br />
Dem Xaveri ,nd Methes die -uom i Vor T.aten zum Pferch<br />
san [ dem Schelor .Schällohn?) Von einer Euche Bezahlt 3.37<br />
D ; eses Jahr Vor 17 Buo h Pap; ir zahJc 2.50<br />
Weil man Uas Erste mal Windfal Versteigert Vogt und Burg,<br />
Maister und Schitzen ihren lohn zahlt 1.38<br />
Wie man den Hagen thom (Mist?) aus gefirt Hat Vor ihr<br />
Lohn z, l.lt Joseph unj Sclv —.20<br />
Weil dLr Comißionherr abgereist Vogt U!.d Burg Maister zu<br />
Hechingen gewesen Ihren lohn zalt 1.10<br />
Weil man die Henner abgeschnitten d< n Vogt und beede<br />
Burger Maister und Schitz und Viehhir 1.0'<br />
Franz Mayer wegen d.;i.n Schulofen zahlt —.15<br />
Wie man die Wochentag abgereel et He: Kastner Viehmeister<br />
Baumeister Vogt und -
28 HOHENZOLLE ISCHE HEIMAT Tah^p-pip- 1955<br />
Die Flurnamen der Markung Sigmaringen<br />
von Dr. Alex F r i c k, Tettnang 2. Fortsetzung.<br />
46. Dettingerberg. <strong>Der</strong> Name weist auf eine alte<br />
Siedlung Dettingen hin, welche wegen ihrer Endung -ingen<br />
wohl eine alamannische Ursiedlung war. Wir dürfen sie in<br />
dem Tal zwischen Dettingerberg und Schönenberg suchen.<br />
Dieses Dettingen lag links der Donau und seine Mark ging<br />
etwa vom Mühlberg bis zum Nonnenhölzle. <strong>Der</strong> Bestimmungsname<br />
Detto ist auch noch im Namen der Deutenau<br />
enthalten (siehe Nr. 47). Aber dieses Dorf muß schon vor<br />
Errichtung der Burg Sigmaringen, also vor dem 11. Jahrh.<br />
abgegangen sein. Denn die dortigen Felder sind später in die<br />
Dreifelderwirtschaft von Hedingen eingefügt, und der ganze<br />
Schön enberg ist im Besitze des dortigen Rittergeschlechtes,<br />
der Volkwin von Hedingen. An der Westseite des Dettingerberges<br />
wurden im Jahre 1913 Funde aus der jüngsten Steinzeit<br />
gemacht. In romantischer Lage liegt dort das alte Schützenhaus,<br />
seit 1922 Jugendherberge, jetzt Jugendheim. Seit<br />
der Mitte des 19. Jahrhunderts hießt der Berg im Volksmund<br />
auch Eulenberg.<br />
47. Deutenau. Diese große Wiese am Südfuß des Schönenberges<br />
wird frei von drei Seiten von der Donau begrenzt.<br />
Durch die Bahnen nach Ulm und Radolfzell wird sie<br />
heute in mehrere Teile zerlegt. Im 14. und 15. Jahrhundert<br />
hieß sie „Tittenow" und „ditnove". Erst 1526 findet sich der<br />
Name Deuttenouw. <strong>Der</strong> Bestimmungsname Deut kommt von<br />
dem Personennamen Tettoy Detto. Es ist die Au des Tetto,<br />
und wir haben hier die Tatsache vor uns, daß der Name des<br />
ursprünglichen Sippenhauptes, welcher der Siedlung — in<br />
diesem Falle Dettingen — seinen Namen gegeben hat, sich in<br />
einem Flurnamen wiederholt. Denn bei der Besiedlung erhielt<br />
das Sippenhaupt oft ein größeres Stück Flur zugewiesen<br />
Das können wir bei vielen alamannischen Ursiedlungen<br />
beobachten (siehe Nr. 85).<br />
48. Dreißig Jaucher t. 1441 heißt es: „ . .. haißt der<br />
Buchenstock und anwandet oben uff der Herren braitten".<br />
Diese dreißig Jauchert gehören zum österr. Mannlehen; es<br />
handelt sich also um die ursprünglichen Felder des Burghofes.<br />
Bei der Dreifelderwirtschaft mußten in jeder der drei<br />
Zeigen die Felder gleichmäßig verteilt werden, damit in jedem<br />
Jahre ungefähr gleich viel geerntet werden konnte.<br />
Während aber im allgemeinen die Bauern ihre Felder in<br />
Streulage verteilt hatten, besaßen die Rittergüter und Mäierhöfe<br />
ihre Felder in jeder Zeige an einem Stück. <strong>Der</strong> zur<br />
Burg Sigmaringen gehörige Burghof hatte seine drei Breiten<br />
1. südlich vom Hohen Kreuz, 2. die sogenannte Ziegelbreite<br />
beim Ziegelhaus und 3. den Ochsenacker und Furchtacker<br />
auf der Südseite des Schönenbergs. Alle drei hatten ungefähr<br />
die gleiche Größe von ca. 30 Jauchert. Die südlich des Ho-<br />
"sn l'-euzes g i^ene Flur erhielt davon ihren Namen. Aus<br />
dem Hedinger Urbar von 1441, in welchem die Felder des<br />
ursprünglichen Dorfes Hedingen genau nach den drei Zeigen<br />
aufgeschrieben sind, geht hervor, daß die drei Breiten des<br />
^ur-hofes nicht, wie man es sonst bei einem Rittergut findet,<br />
in der Nähe des Hofes liegen, sondern daß sie dort liegen,<br />
wo die ursprüngliche Flur des Dorfes Hedingen aufhörte.<br />
Burg und Burghof Sigmaringen sind also erst dann errichtet<br />
word als Hedingen nie Dettinger Felder übernommen und<br />
die Piur in die drei Zeigen eingeteilt hatte. Das Wort Jauchert<br />
kommt vom lateinischen jugerum, mhd. juchart und ist<br />
•"as Stück Feld, welches ein Ochse an einem Tag pflügen<br />
kann; sie betrug in Sigmaringen ungefähr 42,5 Ar.<br />
49. D y ß m a r s t a 1 *. Alter Name für Bachtai (siehe Nr. 17).<br />
Ein Angehöriger der Familie Volkwin von Hedingen na-<br />
• iens Dismar Volkwin hatte zu Sigmaringendorf ein Gut,<br />
das ebenfalls in den Besitz des Klosters Hedingen kam.<br />
50. St, Elogii 1 ", Eine der Kapellen, welche den Käppeleswiesen<br />
ihren Namen gaben, Sie stand etwa in der Ecke,<br />
weiche zwischen der Straße nach Laiz und nach Jungnau gebildet<br />
wird Vor 1612 wird nur von einer Elogiuskapeile gesprochen,<br />
Im Jahr« 5 1612 wird die neue Kapelle „in honore<br />
SS. S^oastiani et Elogii" aufgebaut. Wahrscheinlich war die<br />
Kapelle früher nur iem hl. Elogius geweiht, heim Neubau<br />
im Jahre 1612 wurde sie dann wegen der 1611 sehr stark<br />
aufgetretenen Pest auch ie-i Pestheiligen Sebastian geweiht.<br />
Nach Fischer, Schwäb. Lexikon, heißen die Leute von Bingen<br />
auch Elogiusreitei. weil sie früher jährlich eine Bittfahrt<br />
zu Roß nach Laiz machten. Ob diese Wallfahrt nicht zu dieser<br />
Kapelle war?<br />
5 E u I e N D e R g. <strong>Der</strong> Name kam im Volksmund seit dem<br />
19. Jahrhundert für den Devttingerberg auf.<br />
53. Feigenacker*. Ein Feldstück auf dem Schönenberg;<br />
das Wort kommt wohl voti Veigel Veilchen.<br />
54. Finstere Brünnele*. Die Quelle, welche beim<br />
Nonnenhölzle entspringt und der Bach, welcher von ihr durch<br />
die Deutenau zur Donau fließt.<br />
55. Fischerhäusle*. Lage unbekannt.<br />
56. Frauenstock. <strong>Der</strong> Wald zwischen der Straße nach<br />
Bingen und der Lauchert. 1611 heißt es „in unser frauen<br />
lauch". 1674 ist er im Besitz der Stadt. Es war wahrscheinlich<br />
der Wald, welcher im Besitz des Hornsteinischen Gutes zu<br />
Hedingen war und der später an das Kloster kam.<br />
57. Froschacker*. War ein Feldstück in Bergen.<br />
58. Furdrer*. Furdrer oder Fürderling hieß ein Gewann,<br />
das am Weg von Hedingen nach Laiz etwa in der Gegend<br />
westlich vom Hohenkreuz lag. Nach Fischer heißt<br />
Fürderling ein vorgetanes Stück Arbeit, wenn z. B. am Abend<br />
etwas von der Arbeit des folgenden Tages vorgearbeitet wird.<br />
59. F u r i n n e n *. Nach der Lagebezeichnung in Urkunden<br />
lag die Wiese dicht unterhalb Hedingen an der Donau. Das<br />
Wort hängt mit furan = weiden zusammen. Nach Buck ist<br />
die Endung -in, -innen häufig in Wiesennamen.<br />
60. Furcht*. Es kommt der Ausdruck vor: „am mittleren<br />
Furcht an Hedinger wiesen gelegen" (ca. 1600); ebenso<br />
kommt ein Furchtacker in der Deutenau vor. Furcht bedeutet<br />
soviel wie Furt, und hier war zwischen den Hedinger<br />
Wiesen und der Deutenau auch tatsächlich eine Furt, durch<br />
welche die Hedinger mit ihren Wagen auf nächstem Wege zu<br />
ihren Feldern auf dem Schönenberg kamen.<br />
61. Fürstenbuchen. Im Markungsbereich vom Jahre<br />
1511 heißt es: „dem Kruchenwyser nachhin zwyschen den<br />
Herren von Werdenberg und denen von Sigmaringen dem<br />
dorf höltzer" und 1601: „durch unseres Gnedigen Herren<br />
Buchen". Während heute der ganze Tiergarten Josefslust<br />
von der Morgenweide bis zur Markungsgrenze nach Ablach<br />
und Krauchenwies Eigentum des Fürsten von Hohenzollern<br />
ist, hatten die Grafen von Werdenberg und deren Rechtsnachfolger<br />
die Grafen und späteren Fürsten von Hohenzollern<br />
früher nur einen kleinen Wald dort in Besitz, Es<br />
sind die Waldstücke, welche um das Forsthaus Josefslust<br />
herum liegen.<br />
62. Fürstenhäule. Ein kleines Waldstück östlich vom<br />
Großwieshof, das schon Eigentum der Grafen von Werdenberg<br />
war. Im Jahre 1770 tauschte die Stadt einen Platz beim<br />
Nagelstein in Faulbronnen gegen einen Teil des Fürstenhäule<br />
ein. Den Rest des Fürstenhäule mit ca. 66 Morgen tauscht die<br />
Fürstliche Verwaltung mit der Stadt gegen den Blauhau<br />
westlich von Josefslust und bezahlt noch 5 131 Gulden (im<br />
Jahre 1838).<br />
63. Fürstensträßle. Die Straße, welche von der<br />
neuen Jungnauer Straße aus am Großwieshof vorbei zur<br />
Fürstenhöhe führt. Fürst Karl Anton ließ sie anlegen, um<br />
einen bequemen Fahrweg zur Fürstenhöhe zu haben.<br />
64. Galgen*. Im 16. Jahrhundert kommt öfters die Bezeichnung<br />
„beim Galger auf der Buchhalden" vor. 1595<br />
heißt e 3 „Deim alten Galgen". Dieser Galgen stand wahrscheinlich<br />
auf dem Katzenbuckel und kam Ende des 16.<br />
Jahrhunderts auf die Höhe westlich der fr "heren Unteroffiziervorschule.<br />
'weiche von da ab Galgenbühl heißt.<br />
65 Galgenbühl. Die Höhe über der Unteroffiziervorschule<br />
dicht .AI"> der Laizer Markungsgrenze. Dort stand seit<br />
Ende des 16. Jahrhunderts der Galgen (siehe auch Nr. 157).<br />
66. G a n s b r u n n e n. Die Niederung nördlich vom vorderen<br />
Tal bei der Jungnauer Straße. Hier war früher wohl<br />
die Gansweide.<br />
67. Gänsler. 1601 heißt es: „bildstockh uffm Gennßler".<br />
<strong>Der</strong> größte Teil dieses Waldes ist Eigentum der Stadt Meßkireh.<br />
Im Jahre 1629 nahm die Stadt Sigmaringen von Georg<br />
Leukamp in Meßkirch 1000 Gulden auf und gab als Unterpfand<br />
ihren Wald Gänsler an den Laizer und Inzigkofer<br />
Waid stoßend, Leukamp verkaufte 1632 den Zinsbrief an die<br />
Stadt Meßkirch, und da Sigmaringen nach dem Dreißigjährigen<br />
Krieg die Schuld nicht bezahlen konnte, auch durch<br />
den Rathausbau 1659 noch mehr beiastet wurde, mußte die<br />
Stadt 1659 den Wald an Meßkirch abtreten. <strong>Der</strong> noch im<br />
Besitz der Staat verbliebene Teil von 193 Jauchert wurde<br />
mit anderen Waldteilen im Fauibronnen 1804 an der Fürsten<br />
verkauft. <strong>Der</strong> Name kann mit Gänseier = Gänserich zusammenhängen<br />
(Fischer); nach 3uck bedeutet Gänseling einen<br />
jungen dürren Fichtenstamm, doch schreibt er, daß ein Waid<br />
Ginseier bei Laiigenenslinger seinen Namen von einem Personennamen<br />
Ginseii hat (Mitt. Hohenz. VII, S. 9.) In Beuroner<br />
Urkunden des 14. Jahrhunderts kommt ein Hermann<br />
der Gensler vor, so daß der Name wohl von einem Personennamen<br />
kommen kann. (Fortsetzung folgt.)
Jahrgang 1955 HOHE ZOLLERISCHE HEIMAT 29<br />
Besetzung Straßbergs durch Württemberg 1806<br />
Unsere Großeltern wußten noch viel zu erzählen vom<br />
Jahre 1866, als im Auftrag des Deutschen Bundes württembergische<br />
Truppen Hohenzollern besetzten und die Verwaltung<br />
übernahmen, bis das Waffenglück gegen sie entschied.<br />
Weniger bekannt sind ähnliche Gelüste aus dem Jahre 1806,<br />
als der König von Württemberg sogar in Sigmaringen am<br />
Rathaus sein Wappen anheften ließ. Auch auf die ehemals<br />
Fürstlich Buchauische und seit dem Reichsdeputationsschluß<br />
Thum- und Taxisschen Herrschaft Straßberg sollte die Württembergische<br />
Landeshoheit ausgedehnt werden.<br />
Am 26. Januar 1806 erzählt uns das Protokoll: „Heute<br />
nachmittags besichtigte der Oberamtsverwalter Berner die<br />
Chaussee gegen Winterlingen, und wurde um 1 /a5 Uhr in<br />
Winterlingen, woi er seine Einkehr nahm, durch einen reitenden<br />
Botten mit der Anzeige abgehollet, daß soeben ein<br />
Kommando wirtembergischer Jäger von 10 Mann, dann ein<br />
Oberjäger, nebst einem Kommissair in Straßberg eingerückt<br />
seien, um allda Besitz zu nehmen.<br />
<strong>Der</strong> Oberamtsverwalter eilte nach Straßberg zurück und<br />
traf die 10 Mann samt dem Oberjäger in dem Amtshause<br />
in dem Gesindezimmer an.<br />
Nachdem er mit dem Oberjäger über dessen Absendung<br />
gesprochen, sagte ihm dieser, daß er von dem Komvnissair,<br />
der in der untern Mühle logiere, beauftragt worden sei, mit<br />
seinen bei sich habenden Leuten sich in das Amtshaus zu verfügen,<br />
um denselben Quartier dahier verschaffen zu lassen.<br />
Wegen was er eigentlich hier sei, könne er nicht, sondern<br />
nur vielleicht der Kommissair sagen.<br />
Um zu erfahren, aus was für einer Ursache die Mannschaft<br />
hierher beordert worden sei, verfügte sich Oberamtsverwalter<br />
in die untere Mühle, und nachdem er einem fremden Herrn,<br />
der da zechte, sein Kompliment abgelegt hatte, so fragte derselbe,<br />
wer er seie, und wenn er zu der im Amtshause wirklich<br />
sich befindlichen Mannschaft der angebliche Kommissair<br />
sei, was ihn bevollmächtiget hätte, dieselbe dahier einzuquartieren.<br />
Hierauf erklärte sich derselbe, daß er beauftraget seie, von<br />
der Herrschaft Straßberg, als einem zu der Grafschaft Oberhohenberg<br />
mit der Landeshoheit gehörigen Orte mit seiner<br />
Mannschaft Besitz zu nehmen, und übergab, nachdem er um<br />
seine Vollmacht aufzuweisen ersuchet wurde, dieselbe. Die<br />
Vollmacht wies den Hofgerichtsadvokaten Hochstetter in<br />
Tuttlingen an, „von der zur Grafschaft Oberhohenberg gehörigen<br />
Herrschaft Straßberg, und zwar namentlich vom den<br />
Orten Straßberg, Kaiseringen, Frohnstetten, und dem Meierhof<br />
Lenzhütten rücksichtiich der Landeshoheit und Oberlehensherrlichkeit<br />
Namens Sr. Königl. Majestät von Würtemberg<br />
förmlichen Besitz zu ergreifen, wie dann auch auf<br />
der Markung aes fürstlich fürstenbergischen Ortes Storzingen<br />
an dem Ufer diesseits der Schmeie Grenzpfähle mit<br />
den königlichen Hoheitszeichen und Patenten aufzupflanzen,<br />
über diese Verrichtungen ein Protokoll zu führen, und<br />
sich durchaus nach der inm bekannt gemachten Instruktion<br />
zu richten." Die Vollmacht war geschrieben in Tuttlingen,<br />
am 24. Januar 180G, unterzeichnet von L. von Breitschwert,<br />
König!. Württ. Landeskommissar in der Grafschaft Ober- und<br />
Niederhohenberg.<br />
Hochstetter gab an, er habe noch den mündlichen Befehl<br />
mitbekommen, die Jäger einzuquartieren und am folgenden<br />
Tag die Vorgesetzten auf die von nun an württembergische<br />
Landeshoheit in Pflicht zu nehmen.<br />
Amtsverwalter Berner protestierte im Namen der Thurnund<br />
Taxisschen Regierung selbstverständlich feierlich gegen<br />
all diese Forderungen und wies „rücksichtlich der Landeshoheit<br />
auf das Instrument vom 17. April 1788" hin, „nach<br />
welchem das ehemalige Reichsstift Buchau die von Seite<br />
Oesterreichs teils ausgeübte, teils aber angesprochene Jura,<br />
in speci aber die Kriminal und forstl. Obrigkeit samt dem<br />
Jagen in der hiesigen Herrschaft für 14187 fl. bis an die<br />
Schmeien wirklich abgekauft und bisher ruhig ausgeübet<br />
habe". Unbeschadet aller Rechte werden die Württ. Jäger<br />
nur „wie jede fahrende Truppe" gegen Hausmannskost und<br />
bare Bezahlung in Bürgerquartiere gebracht.<br />
Auf folgenden Morgen, 27. Januar, ließ Amtsverwalter<br />
Berner „die Vorgesetzten" der 3 Ortschaften zu sich befehlen,<br />
und verboi ihnen im Namen des Fürsten, irgendwelche Befehle<br />
des Württ. Kommissairs auszuführen. Als daher dieser<br />
kurz darauf den Amtsknecht nach der Untern Manie rufen<br />
ließ, und darauf den Büttel, ließen beide durch den Boten<br />
Von Nikolaus M a i e r<br />
Dyonis Narr melden, es sei ihnen verboten, zu ihm zu kommen.<br />
Nun kam der Kommissar etwa um 9 Uhr vormittags<br />
nach dem Amtshaus, beschwerte sich über den Ungehorsam<br />
der beiden und verlangte vom Oberamtsverwalter, man solle<br />
Vogt, Bürgermeister und Ortsgericht zusammenrufen, da er<br />
dieselben jetzt in Pflicht nehmen wolle. Amtsverwalter Berner<br />
verweigerte alles. Er habe strengen Befehl, allen Unternehmungen<br />
Württembergs in Bezug auf Landeshoheit<br />
sich standhaft zu widersetzen. (Vogt war damals in Straßberg:<br />
Josef Goreth, Bürgermeister waren: Xaveri Bantle<br />
und Benedikt Ziegler.)<br />
Am 28. Januar, 8 Uhr vormittags, erschien Hochstetter wieder<br />
vor der Kanzlei. Was man gestern ihm verweigert habe,<br />
müsse heute, wenn nötig mit Gewalt, vollzogen werden. Er<br />
habe unterdessen auch mehr Soldaten mitgebracht. Trotzdem<br />
verweigerte das Oberamt alle Forderungen. Darauf ließ der<br />
Kommissär seine Mannschaft antreten, scharf laden und das<br />
Thum- und Taxische Wappen über dem Amtshaustor abnehmen;<br />
dafür das württ. Wappen und Patent an die Torflügel<br />
anschlagen. (Das „Patent" war eine gedruckte Bekanntmachung<br />
des Königs von Württemberg, daß ihm gemäß<br />
seines Traktats mit dem Kaiser von Frankreich und<br />
des Friedensvertrages mit dem Kaiser von Oesterreich die<br />
von seinem Bundesgenossen, dem französischen Kaiser, eroberten<br />
Gebiete mit allen daran haftenden Rechten zugefallen<br />
seien und er deshalb „von dem Obereigentum sämtlicher<br />
von der Grafschaft Hohenberg über die Herrschaft<br />
Straßberg herrührenden Rechte förmlichen Besitz" ergreife.)<br />
Das abgenommene Wappen nahm der Kommissar mit. Er zog<br />
mit den Soldaten zunächst nach dem Bauhof, wo auch ein<br />
Patent angeheftet wurde.<br />
Nun marschierte man nach Kaiseringen. Die Truppe<br />
pflanzte sich vor dem Haus des Vogts auf, die beiden „Burgermeister"<br />
werden gerufen; der Kommissar droht, 40 Mann<br />
Besatzung ins Dorf zu legen, wenn die Vorsteher nicht sofort<br />
das Handgelübde auf württembergische Landeshoheit zu<br />
leisten gewillt seien. Uebrigens seien soeben in Straßberg<br />
Vogt, Bürgermeister und Gericht auf Württemberg vereidigt<br />
worden. Auf diese Nachricht hin leistete der Vogt Joseph<br />
Fauler und die Bürgermeister Franz Fauler und Matheis<br />
Behr den verlangten Eid, daß sie gehorsam die Befehle des<br />
Königs von Württemberg vollziehen und seinen Nutzen fördern<br />
wollen, so wie sie es bisher dem Haus Oesterreich getan<br />
hätten. Darauf wurde am Wohnhaus des Vogtes das württ.<br />
Wappen angeschlagen.<br />
In Frohnstetten bezogen Kommissar und Truppen den<br />
„Adler"; Vogt, Bürgermeister und das Gericht werden dahin<br />
befohlen, aucn Pfarrvikar Wiedmann ersucht, zu kommen.<br />
Es geht wie in Kaiseringen. Weigerung, den Treueeid abzulegen,<br />
Drohung und zweimalige Versicherung des Kommissärs,<br />
daß die Straßberger Geistlichen, ebenso Vogt und Bürgermeister<br />
daselbst und in Kaiseringen den Eid schon abgelegt<br />
hätten. Eidleistung durch die Fronnstetter unter dem<br />
Beisatze: „wenn des so ist" wie der Kommissar sagte. Es<br />
waren Joseph Herrmann, Vogt, Franz und Mathias Horn,<br />
Bürgermeister, dazu 9 „Gerichtsmänner". Sie mußten nun<br />
mitgehen, als das Württ. Wappen und das Patent am Pfarrhaus<br />
angeschlagen wurde, worauf der Kommissar nach<br />
Stetten weiter ^ing mit, 8 Mann. <strong>Der</strong> Oberjäger mit 12 Mann<br />
marschierte nach Straßberg in die Quartiere zurück.<br />
„Mit größtem Befremden" vernahm die Thum- und Taxis-<br />
-i e Regierung in Buchau, was in der Herrschaft Straßberg<br />
Württemberg sich alles erlaubt habe, und sie schickte der<br />
Oberamtsverwalter Berner nach der Hammerschmelze „Beerenthal"<br />
zum Württ. Kommissar Baron von Breitschwert,<br />
verhandelte selbst mit dem König], Württ. Oberlandeskommissär<br />
von der Lühe in Rottenburg. Es stellte sich heraus,<br />
daß einzelne Kommissarien irrtümlich gehandelt, andere den<br />
erhaltenen \uftrag überscnritten hatten, so besonders Kommissar<br />
Hochstetter, der nur österreichische Wappen entLerner<br />
iurfte. Solche waren aber in der ganzen Herrschaft nirgends<br />
angebracht Die Verhandlungen brachten bald Klarheit<br />
in den Streitfall.<br />
Schon am 2. Hornung kam der Württ. Oberamtmann Bejlius<br />
vor das Amtshaus gefahren: er sei von dem Königl.<br />
Württ. lerrn Oberlandeskommissair von der Lühe bea ntragt,<br />
die unlänes von dem Württ. Kommissair Hochstetter<br />
an lern Schlosse dahier, dann zu Kaiseringen und Frohnstetten<br />
angeschlagenen Württ. Wappen und Patente abzunehmen<br />
und dem hochfürstlicnen Thum- und Taxisschen
30 ..ahrgang 1955<br />
Oberamte zu erklären, daß alle die von dem besagten Herrn<br />
Kommissär Hochstetter mit Gewalt vorgenommenen Handlungen<br />
hiermit aufgehoben, für null und nichtig erklärt<br />
seien, und daß der König von Württemberg, sein allergnädigster<br />
Herr nicht die mindesten Rechte der Hoheit, noch<br />
viel weniger das dominium utile in hiesiger Herrschaft, sondern<br />
nur die Oberlehensherrlichkeit, so wie sie dem allerdurchlauchtigsten<br />
Kaiserhaus Oesterreich zugestanden, anzusprechen<br />
habe, welcher Oberlehensherrlichkeit rücksichtlich<br />
einiger von der Grafschaft Hohenberg zu Lehen gehender<br />
Rechte nachzukommen von einer hochfürstlichen Thum- und<br />
Taxischen Regierung dem Herrn Oberlandeskommissar die<br />
Zusicherung gemacht worden sei.<br />
Nach dieser Erklärung erteilte der Oberamtmann Betulius<br />
den 13 Mann württ. Jägern den Befehl, sofort von Straßberg<br />
abzumarschieren, ließ durch einen von Ebingen eigens<br />
dazu mitgebrachten Schlossernleister die Württ. Wappen und<br />
Patente in Gegenwart des Oberamtes in allen 3 Ortschaften<br />
wieder abnehmen und am Schluß über das Geschienene ein<br />
Protokoll aufnehmen.<br />
Selbstverständlich gab es in diesen Tagen für die Einwohner<br />
Straßbergs viel Stoff zur Unterhaltung. Die Winterzeit.<br />
in der die Arbeit ruhte_. war ja ganz dazu angetan, die<br />
H c hing en: Friedrich Bogenschütz 1792; Agatha<br />
"gier 1862. H'edflgen: P. Gualbertus Baur 1754; P. ±joro..heus<br />
¿aumann • 1795 F Jordanus Fettenkoler, vicarius ui8 (alle drei:<br />
Franziskanerorden). Hermentingen: Maria Veronika Dehmerin<br />
1(48. Hippetsweiler: Maria zenhofer 175a; Johanna<br />
Benkler "750; Johann Georp äezikoier 1758; lana i ina ^ezikofer<br />
'o3: Katharina Bezekofer 1764; Ani.a M aria Ber.enkof : 1.64; Dioskorus<br />
Btzjkoler 17/7; Lorenz iïetzikofer 1778; Maria Anna Betzighofer<br />
180»; Anna Maria Bonerin luu3; Franz Joseph Boxler 1764;<br />
Johanna Braun 1752; Katharina Braun 1754; Xaveri Braun 1(56; Anna<br />
Maria und Maria Anna Braun 1759; Franz Xaveri Braun 1778; X hanna<br />
und Apollonia Braun K Jo ph B aun .. ; Mt :falena Bregenzer<br />
1759; Susanna Buxier 1751; Regina Fnüreß 1769; Maria Agat.<br />
Endreß 1(98; Anna Maria Fetscher li64; Magdalena Fischer 1767;<br />
Apollonia Fueterknecht 1759; Johanna Galler 17o2; Agatha Gaßlerin<br />
1751; Anna Goßweiler 1757; Magdalena Hahn 1780; Maria Hahn 1906;<br />
Katharina Jager 1761; M ia Fran/is'-.a Kah' l 1749; Maria and<br />
Joseline Kaltenbach 1904; Johannes Keberle l*i8î Anna ivlaria Köberlin<br />
1787; Agatha Keblerin 1794; Ursula Keller 1752; An'ini Keßler<br />
176a; Anna Maria Keßler 1793; Maria i a Keßler 1794; Kreszentia<br />
Keßler 1854; Katharina Kleiner 1(49; Jakob Kleiner 1769; Maria Anna<br />
Lengierin (= Lengle) 1770; Regma Längle 1((8; Anna Maria Längle<br />
1781; Bibiana Luz 1759; Bernhard Luz 1(62; Maria Mayer 1773; Anna<br />
Maria Michlerin (= Michel) 1777; Magdalena Moser 175. Ubald<br />
Moser 1780; Maria I iula Peter 1801; Anna Maria Restle .759; Theresia<br />
. ietmiller 1772; Johann Georg Sauter IT' Martin Sch-nid<br />
1773: Martin Schmid 180!, Anna Maria Schultheiß 1801; Antoni Seipert<br />
1758; Then. ' Seibert 1759; Agatha Seibert 1764; Kunigunda<br />
Gelber': "77; Kai., 'ina Sick 1764; Anna Maria Siebler 1854, f »w;<br />
Paula Sorg 1904; Viktoria Walk 1759; Mechthild Wallerspuehlin 1749;<br />
"liva Walz 1757; Elisabeth Wangenn = Wagner) 1 g Kl< : ne- 1778; 1 .. jgdale-i»<br />
'. M Johann Lehner 1 1: Esther Liene 74b; Johanna Lieir<br />
1785; Kafharim Vlork.n (= M :k) i307; Franziska Meri 1815; Maria<br />
A Mu ischeler 1754; Walburga Oschwald 1754; Anna Maria Oschwald<br />
1768; Aij on Ii hmidhäußler 17 1; Kunigunda Schmidhäußler<br />
1795; X er sjimid' aut ;r 17?», Magdalena S " er 1750; Maria<br />
nd 3 ili, Stecher 175'' ixlaria Ursula Stecher 17( . M äria Anna Steche:'<br />
1791; Ka harii J S eher 1796; GerLi'U• Teiiie: - ; = Tei :el) 1754;<br />
Katharina Türk 1795. L a i z : Theresia Hirterin 1750; Anna Maria<br />
Kienlin 1753; Maria Anna Mayer 1778; Judith Mayer 1783; Elisabeth<br />
und Vc ren" Weibel 1794; Katharina Wolf 1790; Josepha Wolf 1793.<br />
La.sneim Msria Anna Bernhard 1750; Magdalena B' ßenb.rger<br />
1765; Valenti i Bießenberger 1789; Joseph Binder ] r Mi \ • itoria<br />
Fenker 1753; Agatha Grad i"57; Anna Maria Handgräfin<br />
(= Handgrad!) 1795; Ri e^ a Heinlein 1758; Johannes Krad 1752;<br />
Joseph Mehrlr [= Mol rle) 1748; i'faria Anna 'äh.-Mn 1795; Monika<br />
Mutscheller 1758; Barbara r ;chn d 1756; Elisabeth Schölling 1752;<br />
M ia Anna Vollmer 177 r \ Levertsw -'er: Christoph Benz<br />
17 5; Leopold Benz 17=.?; l'idelis Be..7 "755; K tharina Binder 1788;<br />
Helen; Detenmayer ; Martha H.-khlerin 1750; Anna Maria Haug<br />
1750; Christian Hi ug 1790; Maria Haug 1762; Thomas Herbst 1 i;<br />
Jjsepha Iläser I8Ö1; \nna M ria Lendei 1783; Anna Samterin 1750;<br />
Anna Maria JJ.euermann "'99; Joseph Schiele 1748; Anna Maria<br />
Schiele 1750; Katharina Scltuele 1752; Maria Wezlerin (= Wezel) 1749.<br />
Liggersdorf; Maria Anna Algäuer 1775; Helena A! n 1756;<br />
Rosa Fuchs 1775; Sabina Fuchs 1781; Agatha Fuchs 842 jiaria Anna<br />
Hiiiin (= Ha 1 - 1750; Johann Friedrich Hautlauf 1758; Magdalena<br />
Keller 1781; Kat urina Waibel 1753; Bernhard Widenhorn 1748. Litzelbach:<br />
Maria Agatha Aemmin (= AramaniJ 1777; M ¡dal^na,<br />
aria Anna und Katharina Fetscher 1777, Johan Georg Fetscher<br />
1790; Katharina und Barbara Fetscher 1795. Magenbuch: Ka<br />
t'iai'. a -.erner "91; Theresi Bernhard 1784; Philipp tode» V~2;<br />
Agatha Binder 1762; Mari„ Binder 1780; .nhelm Bosch 1762. oO-<br />
, -,nes Dettenmayp^ 1766; Elisabeths Dreher 1843 jUCi? nker 1748;<br />
1 iiitgard : nkei 17B1; RI. igath- ^enkc. 1786 Va;_."t Grad 761:<br />
enovefa Krug 17!> Konr. Krug 1789: Elisi ' Kirv T 1790; Math. . b<br />
1789; Elisab. Lutz 1' 8; ,h. Mauch )05; Kath. Merk 1788; gatha<br />
M/'ier 1758; M .¡dal. Mödlerin 1798; Matth. ; Möhrle 17»5 Genovefa<br />
Müller 1849; Chrysostoir ; Muts" 1 - _ler 1748; K tharina Mutscheller<br />
i.'84; Ch -v ...tomus Mut« [eller 1789; Agatha Mutscheller 1790; Bernhard<br />
Nt.' 1770 Maria Raif'erin ; Joseph Rei'. le >784; 1 '_urg<br />
Riebsanrer ±785; Josep! ' Tiieger 1806 Tuuana " imhcTie] 1762; Wald-<br />
' urga Schindler L79:' M. " ,-smi ^.ch"t 1767. M e .hingen:<br />
Markv. Braun 1767, Pet us Heilig 1749; Chr. ;ian Heilig 1753; -d<br />
V7ild '.48; Anna Barbara Wild IV 1 1 Mi] der-doi ; Fidelis<br />
•egen 1752; M a "ia Kreszentia He.'p 1780; IV thiad SctiUler 1756; Anna<br />
Maria Siber 1793. Mottscl.eß' ' ina Maria old 1797; Julian<br />
Bachei. jr 3^96; Med: ld Biechlr. in 1777; EUv-.betb xiielerlT'F; Agatha<br />
Blüemir L74o; Ji.sephE äo' 5h 1Ü13 r na Mari Bra ißer 1769; Barbara<br />
Fii.ch • 1748: r itta Fischer 48; Id la Fi her, F 1 slis Fischer.<br />
Antoni Fischer 174 Genovefa Fischer 1756; Waldburga Fischer 7 C ":<br />
Jakob Fischer 176.; Katharina und Joseph "..scher 1772; _ oseph Fi<br />
sc .er 1775; Maria Fischer 1787; W^ncelin Fi ^C". Antonia Fischer<br />
1790; Matneis Fixier 1795; "Jherr Fischer 17 .; Joi - i F' eher 1^97;<br />
ms Ilaria Fischer 1803; Bar£^lomäus Fi: ffier 1807;W ' Durga Fischer<br />
1845; Karolina Fischer, Wirtin, 1862; M. A
Jahrgang 1955 HOHIKZOLLERISCHEHEIMAT 31<br />
Kurznachrichten<br />
Kirchenpatron von Weilheim bei Hechingen ist heute Maria<br />
Heimsuchung. Diese hat man im Jahre 1735 so bestimmt,<br />
weil damals niemand mehr wußte, welches Marienfest<br />
als Patrozinium gefeiert werden sollte! Diese Tatsache<br />
fand F. Eisele in der Zeitschrift „Freibg. Diözesanarchiv"<br />
60, 1932, S. 124 „etwas auffallend". Doch ist dieser Ausdruck<br />
viel zu schwach, es dürfte sogar außerordentlich<br />
merkwürdig zu bezeichnen sein und wohl ein<br />
Beweis dafür, daß Maria gar nicht die alte Patronin<br />
der Pfarrkirche war. Nach Hagens Lagerbuch<br />
der Grafschaft Hohenzollern vom J. 1544, das bereits „Unsre<br />
Liebe Frau" als Patronin der Pfarrkirche Weilheim nennt,<br />
befand sich damals noch eine „Kapelle Unsrer Lieben<br />
Frau uf dem Berg ob Weilhei m", die später<br />
nicht mehr erwähnt wird. Wiederum scheint es, für die<br />
frühere Zeit jedenfalls sehr sonderbar, daß neben der Pfarrkirche<br />
auch eine Kapelle derselben Patronin geweiht<br />
gewesen sei! Dies mag zwar für das 16. Jahrhundert für<br />
kurze Zeit möglich bleiben. Aber als Maria endgültig vor<br />
den alten eigentlichen Patron getreten war, scheint man die<br />
Marienkapelle in eine Urbanskapelle umbenannt zu haben,<br />
wenn auch A. Pfeffer dies noch nicht für wahrscheinlich<br />
halten möchte. Die heutigen Flurnamen „Käppelebukk<br />
e 1" (mit der Urbanskapelle) und „Uf dem Berg" müssen<br />
nicht notwendig schon 1544 so geheißen haben. Sicher<br />
gäbe das Mauerwerk<br />
sein wahres Alter!<br />
des Urbanheiligtums Auskunft über<br />
Welches Patrozinium ging nun bei der Pfarrkirche der<br />
Gottesmutter voraus? Aeltere Quellen scheinen nicht vorzuliegen.<br />
Aber nach Handschrift 67 des Erzbischöflichen Archivs<br />
Freiburg werden im August 1612 als Kirchenpatrone<br />
von Weilheim im Dekanat Hechingen genannt: „D i e<br />
Apostel Petrus und Paulus und die hl. Katharina,<br />
Jungfrau und Märtyrin". Pfarrer war damals<br />
Johannes Dietsch aus Empfingen, Vogt Stephan Halder,<br />
Aftervogt Jakob Rueff, und Heiligenpfleger Melchior Linder.<br />
Man könnte sich nun die Entwicklung so vorstellen: Vor<br />
die alten Patrone Petrus und Paulus trat ehrenhalber<br />
die Mutter Gottes. Im 16. Jahrhundert nennt Hagen<br />
sie nur allein, aber die früheren Schutzharrn<br />
sind 1612 noch bekannt gewesen, wobei St. Katharina<br />
vielleicht die Heilige eines Altars war. Von einer<br />
weiteren Kapelle weiß offenbar die Ueberlieferung nichts,<br />
was wiederum höchst auffallend ist, falls eine solche (außer<br />
der jetzigen zum Hl. Urban) je vorhanden gewesen wäre.<br />
Denn solche kirchlichen Gebäude, und wären sie auch noch<br />
so klein, sind im allgemeinen tief im Bewußtsein und Gedächtnis<br />
des Volkes verankert, viel tiefer jedenfalls als die<br />
Heiligen, denen sie geweiht sind! Joh. A. Kraus.<br />
Owingen und Stauffenberg, Oer älteste Dekannte lerr von<br />
Stauffenberg dürfte jener Heinrich von Stouphenberg sein,<br />
der im Jahre 1132 dem Kloster St. Georgen im Schwarzwald<br />
Güter zu Owingen schenkte (Notitia Eundationis dieses Kl.).<br />
Die Georgskirche in Oberowingen, das älteste bedeutende<br />
Kunstdenkmai aus der romanischen Stilperiode in Hohenzollern<br />
verdankt wohl diesem Kloster seinen Ursprung. E. G<br />
Johler berichtet in seiner Geschichte Hohenzollerns 1824 S.<br />
99: Im Jahre 1267 bestätigte Graf Friedrich von Zollern bei<br />
der Kirche zu Weilheim die Schenkung Hugos von Staufenberg,<br />
der seinem (?) Bruder Gero, Dominikanermönch zu<br />
Kirchoerg bei Haigerloch, bezw. diesem Kloster, einen Mansus<br />
(Bauerngut) zu Owingen überantwortete.<br />
Warum dieser A.kt gerade bei der Kirche zu Weilheim erfolgte,<br />
liegt wohl in der Tatsache begründet, daß die alte<br />
Burg Stauffenberg auf lern Käpfle bei Wessingen sowohl,<br />
als auch die neuere beim Stauffenburgerhof zur Pfairrei<br />
Weilheim gehörten. Volksversammlungen und Rechtsgeschäfte<br />
fanden wohl gern im Anschluß an Gottesdienste statt. Kr.<br />
Ein Michel Schwarz zu Hausen i. Kill, nat um 1620 den<br />
Grafen von Zollern um Gnad gebeten aber nicht erhalten.<br />
Er hatte nämlich dem gewesten Pfarrer zu Hausen, jetzt zu<br />
Meldungen, eines Nachts aufgelauert und mit der Axt beinahe<br />
zu Tode geschlagen, daß er einige Wochen zu f ett<br />
liegen mußte und 200 fl. Schadenersatz -orderte. Den Täter<br />
hat rnan damals ausgewiesen samt Weib und Kind. Seine<br />
Schuldner aber teilten das geringe Vermögen unter sich, so.<br />
daß die Familie Schwarz jetzt Beitlt sind. Er erhält auf<br />
neues Ansuchen den Bescheid: Er soll draußen bleiben; seine<br />
Angehörigen mögen alle vier Wochen in der Grafschaft<br />
betteln.<br />
Pfarrer Carolus Ort zu Hausen i. Kill, und Hieronymus<br />
Kircher, Pfarrherr zu Jungingen baten ca. 1578 um den<br />
ihnen zustehenden Hanfzehnten, den seit 2 Jahren der Kastenvogt<br />
Johannes Miller eingenommen.<br />
Kirchturm zu Killer. Am 6. November 1736 machte der<br />
Junginger Maurei Hans Adam Gresser einen Ueberschlag<br />
betreffs den Kirchturm zu Killer. Er rechnet für Abbruch<br />
des schlechten Mauerwerks, Aufbau ein es Stockwerks<br />
in 13 Schuh Höhe und 24 Schuh Weite, in allen vier Eck<br />
völlig in Riegel gemauert, die Riegel mit Stein verblendet<br />
etc. zusammen 83 Gulden. Zimmermeister Alexander Bosch<br />
von Jungingen verlangte für Abschlagen und Aufmachen des<br />
Glockenstuhls 80 Gulden. (Fürstl. hohenz. Archiv Sigmaringen<br />
R 83,49; Ka 12,5.) Ob seit damals der Turm um ein<br />
Stockwerk zu kurz blieb? Kr.<br />
Burladinger Adel zu Gammertingen<br />
Eine Pergamenturkunde vom Veringenstadter Pfarrhaus<br />
meldet: Am 12. Mai 1390 verkauft Cuon von Burladingen,<br />
des alten Cuonen selig von Burladingen Sohn,<br />
ehem. wohnhaft zu Gammertingen, dem Veringer Bürger Hans<br />
Murnhart sein Gütle zu Burladingen, das Albrecht der<br />
Kayser baut, um 33 Pfund Heller. Zeugen sind: Pfaff Richli<br />
(wohl von Veringen), Heinz Gretzinger, Hans Rudiger, Hensli<br />
Brüly. <strong>Der</strong> Aussteller siegelt (ruhender Falke auf einem<br />
Dreiberg stehend), dann Sweniger von Liechtenstein zu<br />
Holnstein gesessen, und Eberhard von Obrenstetten, gesessen<br />
zu Gammertingen. Vgl. Hohz. Heimat 1952, S. 48, Kr.<br />
Jägerhaus auf dem Schwandel bei Burladingen. Am 9.<br />
Oktober 1739 ist das fürstliche Zeughaus auf dem Schwandel<br />
von Wilddieben mordbrennerischer nächtlicher Weise angezündet<br />
worden und abgebrannt: 100 Gulden Belohnung<br />
wurden für Ergreifung der Täter ausgesetzt. Fahnungsblatt<br />
im Fürstl. Hohenz. Archiv Sigmaringen. (Vgl. dazu Heimatklänge<br />
des „Zoller", Hechingen 1935. S. 35.) Kr.<br />
Abzeichen des Kapitels-Pedellen. Wenn hier 1955 S. 16 vermutet<br />
wurde, das barocke Kupferblättchen mit Kette, auf dem<br />
der Kapitelspatron Johannes Nepomuk für das alte Dekanat<br />
Trochtelfingen gemalt ist, sei ein Abzeichen des Dekans gewesen,<br />
si dürfte dies (nach Aussage des 1949 verstorbenen<br />
erzbischöfl. Archivars Dr Josef Clauss in Freiburg) nicht<br />
richtig sein. Es handle sich vielmehr um das Abzeichen .und<br />
den Ausweis des ehemaligen Kapitelsdieners oder Pedellen<br />
auf der Reise zur Bischofsstadt, zum Abholen des hl. Oels,<br />
usw. Eine ähnliche Kupferplatte mit barocken Treibarbeiten<br />
befindet sich im Erzbischöflichen Archiv. Sie trägt den Namen<br />
des Kapitels Breisach ind wurde vom Pedell auf der<br />
Bru ; getragen. Das des Kap. Trochtelfingen befindet sich<br />
im Dekanatsarchiv Gammertingen. Kr.<br />
An das<br />
in<br />
Postamt
32 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
Eine bescheidene Ergänzung zu „Karl Schoy zum Gedenken"<br />
in Nr. 1 des Jahres 1955:<br />
In der spitz auslaufenden, stadtwärtsgerichteten Ecke des<br />
Friedhofs in Meersburg am Bodensee steht unter einer mächtigen<br />
Trauerweide das schlichte Grabmal unseres Karl Schoy.<br />
Auf dem hochkantgestellten Granitquader ist folgendes zu<br />
lesen:<br />
Carl SCHOY<br />
1877—1925<br />
DR. ING. DR. PHIL.<br />
DOZENT AN DER<br />
UNIVERSITÄT<br />
FRANKFURT AM MAIN<br />
Das Grab ist immer mit einem Blumenstrauß geschmückt, an<br />
Allerheiligen mit einem prächtigen Lorbeerkranz. X. Sch.<br />
Veringenstadter Urkunden (Pfarramt)<br />
1335 25. Mai: „Schultheiß und Rat der Stadt Veringen beurkunden,<br />
daß die Buochwis des Machtli Loucher dieselben<br />
Rechte habe, wie die Güter der andern Bürger.<br />
1348 10. April: Ritter Burkart von Jungingen gibt<br />
die Lehenschaft des Gartens zu Tilstetten (Deutstetten) bei<br />
der Gassen, den Konrad der Halbgraf dem Katharinenaltar<br />
in der St. Nikolauskapelle zu Veringenstadt übermachte, an<br />
diese Pfründe.<br />
1380 21. Januar: Ulrich Hergesell, Heinrich Nünbrunner<br />
und Cuntz Alwich entscheiden zwischen der Stadt Veringen<br />
und dem Grafen Wolfran von Veringen betr. Eigenleute,<br />
wem sie gehören sollen (ohne Namen!).<br />
1359 15. November: Herzog Friedrich von Teck<br />
erlaubt im Namen der Herzöge von Oesterreich der Stadt<br />
Veringen, auf den Altar der hl. Ursula in der (Nikolaus?)<br />
Kapelle daselbst einen Priester zu präsentieren.<br />
1369 20. April: Gertrud die Schmidin, Cuntz des Pfisters<br />
Weib, gibt als Seelgerät an die Katharinen- und Ursula-<br />
Altäre 25 Pfund Heller und ans St. Nikolaus-Licht 5 Pfd.<br />
Heller nach ihrem Tod. Die Jahreszeit sollen 4 Priester halten<br />
mit Vigil. Zeugen: Oswald Helman Bürgermeister, Walter<br />
Richli, Kunradt Kling, Cunz Dietrich, Hans Sopper, Benz<br />
Ruodger. Das Siegel der Stadt fehlt.<br />
1371 25. Mai: Hans Dietrich und seine Frau Anna Remp<br />
stiften einen Jahrtag mit Einkünften aus des Sprengers Wies<br />
unter dem Stadtacker und aus einer Wies in Fachen.<br />
1372 9. April: Graf Wolfrad von Veringen leiht<br />
Katharina der Söpperin das Gut, das heißt „Kunz des Maisers<br />
Gut" und Hans Gänslin innehatte, das jetzt der jung<br />
Kümeller baut, zu Kettenacker gelegen. Falls die Brüder<br />
des Hans Sepper das Gut nach Seppers Tod an sich ziehen<br />
wollen, müssen sie der Katharina dafür 30 Pfund Heller<br />
zahlen.<br />
1375 3. Mai: Ritter Konrad von Buwenburg leiht<br />
Hans lern Piister, Burger zu Veringen, eine Wiese an Stetten<br />
(Flurname).<br />
BESTELL-SCHEIN<br />
zum Bezug der „Hohenzollerischen Heimat"<br />
Ich/wir besteile(n) ab sofort zum laufenden Bezug durch<br />
die Post Stück „Hühenzollerische Heimat", Veriags-<br />
postamt Gammertingen, zum halbjährigen Bezugspreis<br />
von 60 Pfennig.<br />
Vor- und Zuname<br />
Genaue Anschrift<br />
Dieser Bestellschein ist bei Neubestellung bezw. Nachbestellungen<br />
der nächsten Poststelle aufzugeben. Um deutliche<br />
Schrift wird gebeten.<br />
1374 23. Mai: <strong>Der</strong> Reutlinger Bürger Heinz Spiegel verkauft<br />
an Hans den Alten Schultheiß sein Gut zu Niederveringen<br />
dem Dorf, das sein Vater (der Ritter) von<br />
Ursula der Witwe des Ernst Steffiers, und diese von ihrem<br />
Sohn Kuon erwarb. Preis 50 Pfund Heller. Zeugen: Eberhard<br />
der alt Ungelter und Walter der Kötscheler, Richter zu Reutlingen.<br />
Zwei Glasgemälde auf Burg Hohenzollern, die aus dem<br />
Kloster Stein a. Rh. um 1520 stammen, sind beschrieben und<br />
abgebildet in „Schaffhauser Beiräge zur Vaterländischen Geschichte",<br />
Bd. 27, 1950, S. 136 und 143. Die eine Scheibe stellt<br />
die Madonna mit St. Meinrad dar, gestiftet vom Einsiedler<br />
Pfleger Diebold von Hohengeroldseck, die andere zeigt die<br />
Apostelfürsten mit dem wohl späteren Wappen der Diözese<br />
„Die Deutsche Berufs- und Fachschule", Monatsschrift für<br />
Wirtschaftspädagogik, Wiesbaden, bringt in ihrem Januarheft<br />
1955 aus der Feder von Stephan Wiest, Gewerbeschulrat<br />
an der Gewerblichen und Kaufmännischen Berufsschule<br />
in Hechingen einen wertvollen Beitrag „Ueber<br />
hundert Jahre berufliche Schulen in Hohenz<br />
o 11 e r n", der einen guten Einblick in die Entwicklung des<br />
beruflichen Schulwesens in Hohenzollern gewährt. Besondere<br />
Anerkennung verdient dabei die warme Würdigung der<br />
Verdienste der zwei Männer, an deren Schaffen und Wirken<br />
die Entwicklung des beruflichen Schulwesens in Hohenzollern<br />
in erster Linie gebunden ist, des Gewerbeschuldirektors<br />
Anton Bumiller in Sigmaringen und des Berufsschuldirektors<br />
Otto Fritz in Hechingen. Beide Männer<br />
widmeten die Mußestunden, die ihnen der Ruhestand gewährt,<br />
in erfreulicher und erfolgreicher Weise der Erforschung<br />
der lieben, teuren hohenzollerischen Heimat.<br />
Hätze (Hedwig) von Steinhilben war 1370—1380 Cisterziensernonne<br />
zu Heiligkreuztal. Nach Fr. Eisele (Zollerheimat II.<br />
38) und E. von Hornstein—Hertenstein S. 53, 100, 101) soll<br />
ihre Mutter Anna von Steinhilben geheißen haben, die mit<br />
Konrad von Hornstein verehelicht war. Dieser bezeichnet<br />
tatsächlich die Hätze als „die Tochter seiner Gattin<br />
Ann a". Aber daraus ist doch noch lange nicht bewiesen,<br />
daß letztere eine „von Steinhilben" war, sondern<br />
doch wohl nur, daß ihr erster (unbekannter) Mann und<br />
Hätzes Vater so hieß. Aus Urkunden finden wir lediglich als<br />
Anna Mutter: eine Anna Kaibin (Heiligkreuztaler Urkb.<br />
I, 494, 541). Eisele und E. v. Hornstein haben also geirrt,<br />
und es bleibt der künftigen Forschung vorbehalten, Hätzens<br />
Vater ausfindig zu machen. Dabei dürfte an Illegitimität<br />
schwerlich zu denken sein. I. A. Kr.<br />
Beuroner Besitz im Breisgau wird in einem Aufsatz von<br />
K. Martin in der Freiburger Zeitschrift „Schauinsland" (Jg.<br />
72, 1954, S. 43—49) behandelt. Dabei stellt sich die heutige<br />
Glöcklehofkapelle bei Bad Krozingen, in der man uralte<br />
Wandmalereien entdeckte, als ehemals beuronisch heraus.<br />
Lesenswert sind ferner vor allem die Ausführungen von P.<br />
Priesner über den kulturgeschichtlichen Wert der Totenbücher<br />
von Sölden, Bollschweil und St. Ulrich.<br />
Namen Register zu den „Mitteilungen des Vereins für Geschichte<br />
und Altertumskunde in Hohenzollern". Von den 62<br />
Jahrgängen der Mitteilungen des obengenar nten Vereins<br />
wurde von Dr. Alex Frick in Tettnam? ein alphabetisches<br />
Namensregister in Zettelform hergestellt. Darin sind alle<br />
Personennamen, auch die bürgerlichen, dieser Mitteilungen<br />
enthalten. <strong>Der</strong> Verfasser ist bereit, gegen Rückporto, über<br />
das Vorkommen von Personennamen in diesen Heften gerne<br />
Auskunft zu geben. A. Walter.<br />
Berichtigungen: 1952 S. 2 rechts: „Musquetieren"<br />
statt Musterdiener, 1953, 44 Kirchfahrten statt KirchenfannenI<br />
1954, 21 rechts: Uestert runn statt Üsterbrunn,<br />
S. 31 links Zeile 31 v. unten: Petrus Lut; 1954,<br />
63 links: Weiler bei Mariazell liegt in der bad. Pfarrei Tennenbronn!<br />
1955, 5 links: Weiler-tal liegt südlich von<br />
Hausen, der „von Süden kommende Hauserbarh". Stoazla<br />
statt Stoizla. Seite 6: Felben, schwäbisch Fäaiba, die<br />
Fehla 1464 „F e 1 g' 1 geschrieben. Man hat auch an Feldach-<br />
Felach gedacht. Zu Seckach vgl. 1952, 48. <strong>Der</strong> Scherra-gau<br />
war nicht nach einem F'lüßcnen Schere genannt, das<br />
es n i e gab .sondern nach den F'elsr' .fen oder Schären. 1955<br />
10. Zeile 36 v. unten: „...Anteil die Baulast trugen.."<br />
1955. S. 16 links. Zeile 24: Zollerheimat 194 1, 13—17.<br />
Kr.
' L<br />
Hohenzollertsche Heimat<br />
Vierteljahresblatter für Schule und Haus<br />
Herausgegeben vom Verein für Geschichte,<br />
in Verbindung mit<br />
Schriftleitung:<br />
Josef Wiest, Gammertingen<br />
Preis halbjährlich 0.60 DM<br />
Kultur- und Landeskunde in Hohenzollern<br />
der hohenz. Lehrerschaft<br />
Druck:<br />
Buchdruckerei S. A c k e r, Gammertingen<br />
Postverlagsort Gammertingen<br />
Nummer 3 Gammertingen, Juli 1955 5. Jahrgang<br />
I. Teil Aus der Geologie von Hohenzollern<br />
Ueber dem Stubensandstein folgt eine dritte Mergelschicht,<br />
die Knollenmergel. Sie unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht<br />
von den beiden anderen Mergelablagerungen, den Gipsmergeln<br />
und den Bunten Mergeln. Zunächst zeigen sie nicht<br />
die schöne, regelmäßige Schichtung mit ihrem lebhaften Farbenwechsel,<br />
die wir bei den zwei anderen wahrnehmen können.<br />
Sie sind ungeschichtet und haben durchgehends eine<br />
blut- bis violettrote Färbung, welche die ganze Ablagerung<br />
durchdringt und sie von allen ähnlichen Bildungen scharf<br />
scheidet.<br />
Auch nach ihrer Entstehung scheiden sie sich von den<br />
anderen Mergelablagerungen. Während diese ihre Entstehung<br />
dem Transport ihres Grundmaterials durch das Wasser verdanken,<br />
das selbst wieder im Wasser oder an einer feuchten<br />
Meeresküste abgelagert wurde, sind die Knollenmergel ein<br />
Produkt des Windes, also eine ä o 1 i s c h e Bildung wie etwa<br />
der Dünensand oder der Löß. Das in einem heißtrockenen<br />
Klima zu einem ziegelroten Staub verwitterte Gesteinsmaterial<br />
wurde durch gewaltige Staubstürme in ein Trockengebiet,<br />
in eine Wüste getragen und dort abgelagert. <strong>Der</strong> Staub<br />
bestand in der Hauptsache aus feinen, gerundeten Kalkkörnchen,<br />
die sich später durch einsickerndes Wasser ähnlich den<br />
sogenannten Lößkindchen im Löß in steinharten Knollen<br />
ausschieden, die diesen Ablagerungen den Namen Knoilenmergei<br />
verliehen haben.<br />
In dieses gewaltige Staubmeer verirrten sich manchmal aus<br />
der bewohnbaren Nachbarschaft riesige, kroicodilartige Landechsen<br />
von 10—12 m Länge,- die wie das Känguruh auf zwei<br />
Beinen hüpften und sich dabei auf den Schwanz stützten.<br />
Diese Ungetüme trugen auf einem langen Hals einen kleinen<br />
Kopf und hatten an den Füßen lange, scharfe Krallen, mit<br />
denen sie ihre Beute festhielten. Beim Durchwandern der<br />
beutelosen roter' Sandwüste mögen sie oft elendiglich verhungert<br />
oder in den Staubstürmen umgekommen sein. In den<br />
Knoiienmergeln der Harmonikastadt Trossingen sind eine<br />
Reihe von diesen vorweltlichen Tieren gefunden worden.<br />
Friedricti August Quenstedt, der von 183'—1889 als Professor<br />
der Geologie an der Universität in Tübingen wirkte, hat<br />
dieses Ungetüm den „Schwäbischen Lindwurm" genannt. Professor<br />
Freiherr Friedrich von Huene, der Hauptkonservator<br />
der geologischen Sammlungen in Tübingen, der am 22. März<br />
1955 seinen 80. Geburtstag feiern konnte, der in mehreren<br />
Erdteilen in unermüdlicher und erfolgreicher Forscherarbeit<br />
so manchen wertvollen Schatz aus der Erde gehoben und<br />
ihn in seinem Museum in vorbildlicher Weise wieder aufgebaut<br />
hat, hat auch unseren Lindwurm, dem er den wissenschaftlichen<br />
Namen Plateosaurus quenstedti gab, mit Hilfe<br />
der in sorgfältiger Weise geborgenen Funde von Trossingen<br />
in seiner ganzen Große in einem eigenen Raum des geologischen<br />
Instituts in Tübingen, dem „Trossinger Zimmer" wiedererstehen<br />
lassen. Außerdem hat er in einem anschaulichen<br />
Gemälde, das in demselben Zimmer aufgehängt ist, nicht<br />
nur den „Lindwurm" selbst dargestellt, sondern auch die<br />
Wüstenlandschaft der Knollenmergelzeit, in der so manches<br />
dieser Urwelttiere einen jämmerlichen Tod gefunden hat.<br />
Professor Georg Wagner hat dieses Gemälde in seinem emp-<br />
(14. Fortsetzung)<br />
<strong>III</strong>. <strong>Der</strong> <strong>Keuper</strong><br />
d) <strong>Der</strong> Knollenmergel<br />
von Michael Walter<br />
fehlenswerten Buche „Einführung in die Erd- und Landschaftsgeschichte<br />
mit besonderer Berücksichtigung Süddeutschlands"<br />
auf der Tafel 173 wiedergegeben.<br />
Trotzdem der Knollenmergel uns in dem „Schwäbischen<br />
Lindwurm" einen wertvollen Schatz erhalten hat, müssen<br />
wir ihn doch den „Schwäbischen Landschaden" nennen, weil<br />
der Schaden, den er anrichtet, ungeheuer ist. Wege, Straßen,<br />
Eisenbahnanlagen, Wasserleitungen, Mauern, Bäume, Wälder,<br />
Häuser, ja ganze Dörfer hat er schon zerstört. <strong>Der</strong> Knollenmergel<br />
ist sehr stark den Witterungseinflüssen unterworfen.<br />
In regenarmen, heißen Sommern trocknet er aus. Sein Boden<br />
wird in lauter quadratmetergroße Erdstücke zerrissen, die<br />
von Spalten umgeben sind, in die man mit dem Fuß metertief<br />
hineintreten kann. Folgt auf einen trockenen Sommer ein<br />
schneereicher Winter, dann füllen sich bei der Schneeschmelze<br />
die Trockenspalten mit Wasser, die Letten quellen auf und<br />
vermehren ihr Volumen oft auf das zwei- und dreifache<br />
ihres bisherigen Umfanges. <strong>Der</strong> Druck, der auf diese Weise<br />
erzeugt wird, bringt die durch die Trockenrisse im Sommer<br />
gelockerten Massen auf den durch das eingedrungene Wasser<br />
aufgeweichten und schmierig gewordenen Letten in Bewegung.<br />
Das Gelände fängt an zu rutschen und nimmt alles<br />
mit sich, was auf ihm wächst und steht. Es ist eine unheimliche<br />
Kraft, die in diesen oft meterdicken, in Bewegung befindlichen<br />
Erdschollen steckt. An den Hängen bilden sich<br />
Wülste und Aufwölbungen, die Landschaft wird zur „buckeligen<br />
Welt", in 1er die zahlreichen Bäume mit geknickten<br />
Stämmen deutlich erkennen lassen, daß der Boden in Bewegung<br />
ist. Manchmal hält die Bewegung inne. Das Gelände<br />
sieht dann mit den Stufen, die sich während der Bewegung<br />
gebildet haben, aus, als ob die anwälzenden Wassermassen<br />
eines Hochwassers plötzlich zu Eis erstarrt wären. Trotzdem<br />
diese Dinge bekannt sind und auf die Gefahren immer wieder<br />
aufmerksam gemacht wird, können es die Unbelehrbaren<br />
doch nicht unterlassen, in den Knoiienmergeln Wege anzulegen,<br />
Häuser zu bauen usw. Wenn die Villa dann gebaut ist,<br />
kann man oft bald nachher das Plakat lesen: „Betreten wegen<br />
Einsturzgefahr verboten!" <strong>Der</strong> Oesterberg in Tübingen<br />
bot vor einigen Jahren Beispiele dafür. Die Straße, die vom<br />
Eyachtal durcn Knollenmergel hinauf nach Ostdorf führt, war<br />
zu 126 000 Mark veranschlagt, sie kam aber auf 426 000 Mark<br />
zu stehen, also fast auf das Vierfache, infolge der während<br />
des Baues einsetzenden Rutschungen n den Knollenmergel.<br />
<strong>Der</strong> Name Millionensträßchen ist nicht ganz unberechtigt.<br />
Als der Fabrikant Peuker nach dem letzten Kriege ein Haus<br />
oben bei Bechtoldsweiler bauen wollte, sagte ich ihm, daß er<br />
ein gutes Fundament legen müsse, wenn er unbedingt dorthin<br />
bauen wolle; denn der Bauplatz liege gerade am Rande<br />
des leicht rutschenden Knollenmergels. Das Haus hat bH<br />
jetzt ziemlich standgehalten; aber das später weiter gegen<br />
die Halde vorgeschobene kleine Fabrikgebäude zeigt schon<br />
recht deutliche Risse.<br />
<strong>Der</strong> Knollenmergel folgt unmittelbar auf den Stubensandstein.<br />
Ueberall steigt man von der Ebene des Sandsteins die<br />
welligen und buckeligen Hänge des Knollenmergels hinauf<br />
zu seiner Deck- und Schutzschicht, die durch den oberen Keu-
34 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
per als letztes Glied des <strong>Keuper</strong>s und damit auch der Trias<br />
gebildet wird. Die oberste <strong>Keuper</strong>schicht ist wieder ein Sandstein,<br />
der Rätsandstein, der aber in Hohenzollern nur an<br />
wenigen Stellen und auch da nur schwach zur Ausbildung<br />
kommt. Deshalb schließt bei uns in der Regel der <strong>Keuper</strong><br />
mit der untersten Schicht des Schwarzen Jura ab. Wo der<br />
Schwarze Jura oder Lias vorhanden ist und seine normale<br />
Lagerung nicht durch Verwerfungen gestört wurde, da liegt<br />
unter ihm der Knollenmergel, so auf den Gemarkungen von<br />
Heiligenzimmern, Gruol, Owingen, Grosselfingen, Stetten,<br />
Rangendingen, Weilheim, unter dem Hausener Hof und Lindich,<br />
bei Stein und Bechtoldsweiler.<br />
Die Mächtigkeit mag etwa 30 m betragen. Sie ist<br />
nicht leicht festzustellen, da die Letten oft weit über die Ebene<br />
des Stubensandsteins hinauskriechen und andererseits von<br />
oben her öfters ganze Schollen am Rande der Liasdecke abbrechen,<br />
die Hänge hinunterrutschen und den Knollenmergel<br />
zudecken, so an mehreren Stellen in dem geologisch so<br />
interessanten Tale des Krebsbaches von Grosselfingen und<br />
am Nordhange des Waidenbühl von Stein. Bei diesem ständigen<br />
Kriechen des Bodens kommt es oft zu Grenzverschiebungen,<br />
die häufig zu Grenzstreitigkeiten führen, besonders<br />
wenn ein Wald mit seinem ganzen Bestand auf den Nachbar<br />
abwandert. Wer einmal das buckelige Gelände westlich vom<br />
Friedhof von Bechtoldsweiler durchwandert, der versteht es,<br />
weshalb die Bewohner des einst dort gelegenen Dörfchens<br />
Schönrain ihre Heimat verließen und sich auf sicherem Boden<br />
in der Nachbarschaft ansiedelten. Auch das Dorf Hausen<br />
bei Weilheim, das dem Hausener Hof den Namen gegeben<br />
hat, lag auf Knollenmergel.<br />
Die Böden des Knollenmergels sind kalk- und kalireich<br />
und deshalb nicht unfruchtbar. An steileren Halden und bei<br />
größerer Entfernung von den Ortschaften werden sie als<br />
Wald genutzt. An flacheren Hängen und zwar besonders da,<br />
wo die vielen kleinen Quellen, die unter dem Lias entspringen,<br />
sie bewässern, geben sie ein gutes, wenn auch unruhiges<br />
Wiesengelände. Wo aber die Bewässerung fehlt, da dienten<br />
sie früher dem Ackerbau. Sie mußten aber im Frühjahre,<br />
wenn der Boden naß und schmierig war, mit der Hacke bearbeitet<br />
werden. Mit dem Einzug der Industrie hat diese<br />
mühsame und zeitraubende Bearbeitungsweise aufgehört,<br />
und jetzt werden diese Hänge ebenfalls als Wiesen verwendet,<br />
wenn auch oft nur als Einmähder oder das Gelände<br />
wurde aufgeforstet, wie z. B. in der „Geiß" in Grosselfingen,<br />
deren Aufforstung um die Jahrhundertwende begann. Heute<br />
wandert man schon durch stattliche Wälder, die auf Gelände<br />
stehen, das in meiner Kinderzeit noch dem Ackerbau diente<br />
oder Hopfengärten trug.<br />
Was Großvaters Wanderbuch erzählt<br />
Vor mir auf dem Tisch steht eine altertümliche, tabakbraune<br />
und rechteckige Eichentruhe, die Zunftlade der ehemaligen<br />
Gammertinger Zimmermeisterzunft. Auf dem erhabenen<br />
Deckel findet sich ein Schubfach, dem ich einen<br />
handgeschmiedeten Schlüssel entnehme und mit dem ich die<br />
Truhe öffne. Zuerst fällt das schöne, kunstvolle Schloß auf.<br />
Auf dem Boden der Lade liegen wohlgeborgen alte, teilweise<br />
etwas vergilbte Schriftstücke, wertvolle Dokumente für die<br />
Familiengeschichte. Es sind u. a. Kaufbriefe, die bis zum<br />
Jahre 1806 und sogar noch weiter zurückgehen, abgefaßt in<br />
dem jener Zeit eigentümlichen Stil, aber alles sauber geschrieben,<br />
unterzeichnet und mit den Siegeln der damaligen<br />
Herrschaft versehen. Ein Schriftstück erweckt besonderes<br />
Interesse. Es handelt sich um den Lehrbrief des am 21. Dez.<br />
1892 geborenen Baltas Burkarth, meines im Jahre 1911 verstorbenen<br />
Großvaters. Das obere Drittel des seltsamen Dokumentes<br />
schmückt ein Kupferdruck des alten Städtchens<br />
Gammertingen. Von Süden her betrachtet, sah es damals<br />
noch recht bescheiden aus. Besonders schön hebt sich die<br />
Stadtkirche heraus, mit dem leider im Jahre 1935 abgebrochenen<br />
stilvollen Kaplaneihaus. Am obern Rande des Bildes<br />
sieht man das fürstlich hohenzollerische Wappen, am untern<br />
Rande das ehemalige Gammertinger Stadtwappen (mit Bracke<br />
und Hirschstange). <strong>Der</strong> Wortlaut des Lehrbriefes ist:<br />
<strong>Der</strong> unterzeichnete Zunftvorstand des Zimmerhandwerks<br />
des fürstlich hohenzollern Sigmaringischen Oberamts Gam-<br />
V ;<br />
Gammertingen um rlas Jahr 1850. von Osten gesellen<br />
mertingen beurkunden hiermit, daß Vorweiser dieses Baltassar<br />
Burkarth, gebürtig von Gammertingen, nach Vorschrift<br />
und Ordnung den 17. März 1845 in das hiesige Zunftbuch eingeschrieben,<br />
die Profession zünftig erlernt und sich während<br />
der Zeit klaglos betragen habe. Zugleich wird bezeugt, daß<br />
wir dem Inhaber dieses Lehrzeugnis wie seinem Vater Leodegar<br />
Burkarth den Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Februar<br />
1829 sowie die Verordnung vom 19. Februar 1834 gehörig eröffnet<br />
und demselben aufgetragen, die angeordnete, auf drei<br />
Jahre festgesetzte Wanderzeit unverzüglich anzutreten, widrigenfalls<br />
spätere Dispensgesuche auf Grund des Gesetzes<br />
vom 27. März 1830 unberücksichtigt bleiben müssen.<br />
Gammertingen, den 2. März 1847 . Zunftvorstand.<br />
(Unterschriften): Bürgermeister Reiser<br />
Zunftmeister Stähle<br />
Zimmermeister Doldinger<br />
Zimmerm. Leodegar Burkarth<br />
Soweit der Lehrbrief. Jetzt erst bemerkte ich ein in grauem<br />
Karton gebundenes Büchlein mit braunem Lederrücken und<br />
Lederecken. Ich blättre im Wanderbuch meines Großvaters,<br />
der in den Jahren 1847 bis 1849, in jener politisch so sturmund<br />
drangvollen Zeit, als blutjunger Zimmergeselle durch<br />
die schönsten Gegenden Deutschlands, Oesterreichs und der<br />
Schweiz zünftig gewandert ist. Manchmal ist er beherzt mitten<br />
durch die 48er Revolution hindurchgegangen. Von allen<br />
größeren Plätzen, die er auf seiner Wanderung berührt hat,
Jahrgang 1955 H O II E N Z O L L E R X S t H E HEIMAT 3»<br />
sind kurze polizeiliche Einträge und Stempel vorhanden. Das<br />
Büchlein umfaßt 64 Seiten, von denen 28 Seiten beschrieben<br />
sind. Auf der ersten Seite steht: Wanderbuch des Baltas Burkarth,<br />
Zimmermann, gebürtig aus Gammertingen, Fürstentum<br />
Hohenzollern Sigmaringen, 18 Jahre alt. Ausgestellt am<br />
2. März 1847 durch das Hochfürstlich Hohenzollern-Sigmaringische<br />
Oberamt in Gammertingen. Hinter dieser Seite folgen<br />
dann die für einen wandernden Handwerksgesellen<br />
wichtigen gesetzlichen Verordnungen. Da heißt es z. B. . . . ,<br />
daß der Wandergeselle erst nach Ledigsprechung (nach vollendeter<br />
Lehrzeit und nach genügender Befähigung) die<br />
Wanderschaft antreten kann. Die Wanderzeit wird auf 3<br />
Jahre festgesetzt, und der Aufenthalt muß jeweils 6 Stunden<br />
von der Heimat entfernt sein. Will der Geselle Meister werden,<br />
so muß er sich über die vollstreckte Lehr- und Wanderzeit<br />
ausweisen und sich durch sittliches und arbeitsames<br />
Verhalten auf der Wanderschaft durch Vorlegen des Wanderbuches<br />
und von Zeugnissen rechtfertigen. Dann kommt<br />
noch eine Bestimmung, die den Besuch der Wiederholungsschule<br />
bis zum zurückgelegten 18. Lebensjahr und den Besuch<br />
der Christenlehre bis zum 24. Lebensjahr vorschreibt.<br />
Endlich folgen Bestimmungen über den abzuleistenden Militärdienst.<br />
Vor Antritt der Wanderung wird die Ausrüstung zusammengestellt.<br />
In einem in Leder gebundenem Wandertagebuch,<br />
das leider nicht mehr gut leserlich ist, findet sich ein<br />
Verzeichnis der mitzunehmenden Sachen, teilweise mit Wertangabe.<br />
(1 Gulden [süddeutsch] 1,714 Mark; 60 Kreuzer<br />
• 1 Gulden). So sind aufgezeichnet: 2 neue Hemden (2 Guld.),<br />
1 Paar alte Hosen (12 Kreuzer), 1 Paar neue Hosen (4 Gulden),<br />
2 neue Westen (6 Gulden), 1 neuer schwarzer Tuchrock<br />
(17 Gulden), 3 Halsbinden (1 Gulden), 6 Nastücher (1 Gulden,<br />
1 Reißzeug (3 Gulden). Fernfer 5 Paar Strümpfe, 2<br />
Handtücher, 1 Paar Handschuhe, 1 Aderlaßbinde, 1 Däumling,<br />
1 Unter- und 1 Oberwams, 1 Gebetbuch, 2 Paar Stiefel,<br />
2 Kappen, 1 Schurzfell, 2 Bürsten, 1 Schmotzbüchse. Alles,<br />
was nicht auf dem Leibe getragen wurde, mußte im Felleisen<br />
(Reisetornister) kunstgerecht verpackt werden. Wie<br />
aus einem Brief an seinen Sohn hervorgeht, hatte ihm sein<br />
Vater Leodegar als Allheilmittel noch eine Büchse Dachsschmalz<br />
in den Tornister gesteckt.<br />
Am Tage vor Antritt der Wanderung wird von den Verwandten,<br />
Bekannten und besonders von den maßgebenden<br />
Persönlichkeiten Abschied genommen. Es mag damals in<br />
einem so weltabgeschiedenen Ort wie Gammertingen ein<br />
Ereignis gewesen sein, wenn ein junger Mann für drei Jahre<br />
auf Wanderschaft ging. Ueberall, wo der junge Zimmermann<br />
sich verabschiedete, wurde ihm neben den besten Wünschen<br />
noch etwas Greifbares an Geld oder sonst Nützlichem<br />
zugesteckt. Natürlich sagte er auch dem würdigen alten<br />
Pfarrnerrn Lebewohl Sein letzter, liebster und längster Besuch<br />
galt aber seinem Onkel, dem Musterlehrer Heinrich<br />
Reiser, der seinem besten Schüler in der Realschule und in<br />
der Fortbildungsschule kostbare Lebensweisheiten auf den<br />
Weg gab.<br />
Am 3. März 1847, an einem Mittwoch, trat unser Wandersmann<br />
in aller Frühe seine erste selbständige große Reise an.<br />
Kurz, aber herzlich war der Abschied von der Familie gewesen.<br />
In der Nacht war frischer Schnee gefallen, and es<br />
war recht kalt. Das machte aber lern angehenden jungen<br />
Wanderer nichts aus und frohen Herzens und mit offenen<br />
Augen, den Kno+enstock in der Rechten, nahm er den Weg<br />
unter die Füße,'die in neuen genagelten und wohlgeschmierten<br />
Stiefein steckten. Bald hatte er die Landesgrenze des<br />
hohenzollerischen Fürstentums Sigmaringen hinter sich und<br />
kgl. württembergisches Geoiet betreten. Wo heute auf breiter<br />
asphaltierter Straße die Vertreter des 20. Jahrunderts in<br />
Kraftwagen und auf Motorrädern dahinrasen, und wo daneben<br />
auf eisernen Schienen am Fuße des Wendeisteins um<br />
sc gemütlicher die Landesbahn fauchend und schnaubend<br />
dahinrollt, da lief damals durch das obere Laucherttal einzig<br />
und allein ein holpriger Landweg,i^ner über eine altersschwache<br />
Holzbrücke in das Dörfchen Bronnen führte. Unser<br />
junger Freund war bisher noch niemanden begegnet, und in<br />
dem württembergischen Fiecken schlief man allenthalben<br />
noch den Schlaf der Gerechten. Nach einer Talbiegung sah<br />
er oben links auf der Höhe das alte, ehemalige Frauenkloster<br />
Mariaberg liegen, das seit seiner Aufhebung im Jahre 1803<br />
einige Jahrzehnte lang in einem Dornröschenschlaf gelegen<br />
hatte. Jetzt aber regte es sich seit einigen Wochen in dem<br />
dicken Gemäuer. Man werkte und schaffte ununterbrochen,<br />
denn am 1. Mai 1847 sollte dort eine Heil- und Pflegeanstalt<br />
für Geistesschwache aufgemacht werden. Seitdem sind über<br />
hundert Janre vergangen, und in stiller und verantwortungsvoller<br />
Arbeit ist hier vieles zum Segen des schwäbischen<br />
und deutschen Vaterlandes geleistet worden. — Hinter dem<br />
Städtchen Trochtelfingen mit seinen klobigen Türmen und<br />
Mauern sah der erwachende Tag einen einsamen Wanderer<br />
über die schneeverwehte Haid marschieren. Damals noch<br />
eine richtige Einöde, fast hundert Jahre später in tiefen<br />
Waldesgründen versteckt ein riesiges Munitionsarsenal, von<br />
wo aus in den unheilvollen Tagen des April 1945 gewaltige<br />
Explosionen das Land ringsum in seinen Grundfesten erschütterte<br />
und die Menschen beunruhigte.<br />
Bald rutschte unser Freund .auf abschüssigem, vereistem<br />
Pfad hinab ins Echatztal. Links oben in der Morgensonne sah<br />
er auf schroffem Fels die Fenster des romantischen Schlosses<br />
Lichtenstein blitzen, das vor 9 Jahren neu erbaut worden<br />
war. Unten im Tal war der Weg besser und fast schneefrei,<br />
so daß er rascher vorwärtskam und zur Mittagszeit nicht<br />
mehr weit von der ehemaligen freien Reichsstadt Reutlingen<br />
war. Sie hatte sich damals noch hinter den schützenden<br />
Mauern und Türmen verkrochen, die Stadt der Gerber und<br />
Färber. Diese Gerber und Färber und die übrigen tüchtigen<br />
zünftigen Handwerker haben dann viele Jahrzehnte später<br />
die Stadt zu dem gemacht, was sie heute ist, eine moderne<br />
Stadt der Arbeit. Alles lag damals noch mehr oder weniger<br />
im Schatten der aus dem 15. Jahrhundert stammenden Marienkirche,<br />
mit dem weitausschauenden Turm, dem Wahrzeichen<br />
von Reutlingen. Aber weiter ging die Wanderung<br />
über das alte Städtchen Metzingen nach Neckartailfingen, wo<br />
unser Freund am späten Nachmittag ankam und in der dortigen<br />
Gesellenherberge übernachtete. Tags darauf ging es mit<br />
frischer Kraft und neuem Mut den Berg hinauf auf die Fildern<br />
mit Richtung auf die Landeshauptstadt Stuttgart. Gegen<br />
Mittag rastete er im Dorfe Degerloch vor Stuttgart. Damals<br />
war es von Degerloch nach Stuttgart eine gute Wegstunde<br />
auf rauhem und steinigem Pfade, denn die neue<br />
Weinsteige war noch nicht gebaut, und Stuttgart war noch<br />
keine Großstadt nach heutigem Begriff. Drunten im Nesenbachtal<br />
lag dichter Nebel, als der junge Zimmermann von<br />
der Degerlocher Höhe der Stadt zustrebte. Wie staunte er, als<br />
er das alte Schloß mit seinen massigen Rundtürmen sah und<br />
alle die stattlichen Gebäude der königlichen Residenz. Das<br />
barocke neue Schloß, das breit und majestätisch vor dem<br />
weiten Schloßplatz lag, war des Wanderers höchstes Entzücken.<br />
Er meldete sich auf dem Polizeiamt Stuttgart und<br />
wurde von Polizeiamt Kelberer nach Heidelberg in Marsch<br />
gesetzt. Nach Uebernachtung in der Gesellenherberge machte<br />
er sich am andern Tag auf den Weg nach Heidelberg. Einige<br />
Jahrzehnte später oder gar heute wäre man zum Bahnhof<br />
gegangen, hätte sich eine Fährkarte gelöst und wäre in kurzer<br />
Zeit in Heidelberg aus dem Zug gestiegen. Im Jahre 1847<br />
war das nicht möglich, da keine Eisenbahn in Richtung Heidelberg<br />
fuhr. Genau ein halbes Jahr vorher, im September<br />
1846, war von Cannstatt her der allererste Eisenbahnzug in<br />
den kleinen Stuttgarter Sackbahnhof eingefahren Wie in jenem<br />
Jahr 1847 die Verkehrsverhältnisse auf der heute auch<br />
international so wichtigen Strecke war, schilderte der berühmte<br />
Professor der inneren Medizin, Dr. Kußmaul in seinen<br />
„Jugenderinnerungen eines alten Arztes" wie folgt: Mai<br />
1847. ¡jDen Weg von Heidelberg nach München legt man<br />
heute (1890) mit dem Schnellzug bequem in 8 Stunden zurück.<br />
Damals war von der ganzen Strecke, die wir von Wiesloch<br />
nach München durchfahren mußten, nur der kleine Teil<br />
von Wiesloch nach Bruchsal und der größere am Ende der<br />
Reise von Augsburg bis München mit Schienen belegt. Durch<br />
ganz Württemberg und von Ulm nach Augsburg mußten wilden<br />
Eilwagen benutzen. Wir kamen am ersten Tage abends<br />
nach Stuttgart, führen eng zusammengepfercht die Nacht hindurch<br />
nach Ulm, wo wir halb gerädert ankamen."<br />
Für einen Wanderburschen kam aber auch dgT Eilwagen<br />
nicht in Frage, nicht nur aus rem geldlichen Gründen, sondern<br />
weil eben ein zünftiger Geselle wandern mußte, wenn<br />
er die Welt sehen und etwas lernen wollte. Am 11. März kam<br />
er rechtschaffen müde in der Musenstadt Heidelberg an. Unterwegs<br />
hatte er viele Städte und Dörfer gesehen und manches<br />
in sich aufgenommen, was ihm später von Nutzen sein<br />
sollte. Besonderen Eindruck scheint auf ihn das herrliche Barockschloß<br />
in Bruchsal, die ehemalige Residenz der Fürstbischöfe<br />
in Speier, gemacht zu haben. Leider ist etwa 100<br />
Jahre später das herrliche Bauwerk durch feindliche Bomber<br />
zerstört worden. — Tfl Heidelberg begab sich unser Wandersmann<br />
zum Zunftmeister, der ihn freundlich aufnahm<br />
und ihm sofort Arbeit bei einem Zimmermeister vermittelte.<br />
Hier werkte er dann bis tief in den Winter hinein zur<br />
größten Zufriedenheit des Meisters. Aber auch er selbst war<br />
z jfrieden, mit dem t /äs er gelernt und auch verdient hatte.<br />
Natürlich ging an einem Platze, wie Heidelberg, die Arbeit<br />
nicht aus, da immer wieder neue Universitätsinstitute und<br />
Landhäuser gebaut wurden. Daneben hatte unser Geselle<br />
viel Interesse an den schönen alten Bauwerken, besonders
36 HOHENZOLLEHCSCHEHEIMAT Jahrgang 1955<br />
an dem um das Jahr 1690 durch die Franzosen zerstörten<br />
Kurfürstenschloß. Trotz der Zerstörung zeigte die Ruine immer<br />
noch das Bild edelster deutscher Renaissancearchitektur.<br />
Die Zeiten begannen damals sehr unruhig zu werden. Besonders<br />
gärte es auch unter den Studenten, die sich als<br />
Bannerträger einer neuen Zeit und Freiheit fühlten. Das Revolutionsjahr<br />
1848 warf seine Schatten voraus. Allenthalben<br />
erhoben sich die Forderungen nach einem geeinten Deutschland<br />
mit Volkskammer, Versammlungs- und Pressefreiheit<br />
und Schwurgerichten. Um diese politischen Dinge kümmerte<br />
sich unser junger Freund wenig. Und doch wurde er in den<br />
nächsten zwei Jahren immer wieder daran erinnert, als er<br />
durch Gegenden wanderte, welche die Brennpunkte der 48er<br />
Revolution waren.<br />
Am 13. Dezember 1847 verließ er Heidelberg, wo er eine<br />
schöne Zeit verlebt hatte, von der er noch bis in sein hohes<br />
Alter zehrte. Sein Weg ging über Heilbronn, Stuttgart, Eßlingen,<br />
Kirchheim u. Teck, über die Höhen der Schwäbischen<br />
Alb nach Blaubeuren. Am 21. Dezember 1847 rutschte er<br />
mehr als er ging auf dem stark verschneiten und teilweise<br />
vereisten Weg ins Blautal am Blautopf vorbei, wo er als<br />
Realschüler vor 6 Jahren oft in tiefem Sinnen gesessen hatte,<br />
vorbei an der alten Klosterkirche mit dem weltberühmten<br />
Altar. Etwas beklommen betrat er das ihm so' wohl bekannte<br />
Städtchen, und dann ließ er an einer bestimmten Haustür den<br />
Türklopfer fallen. <strong>Der</strong> ihm öffnete, war sein alter, hochverehrter<br />
Reallehrer Speidel, der sich über den Besuch seines<br />
ehemaligen Schülers herzlich freute. Zwar wunderte er sich<br />
darüber, einen seiner besseren Schüler als wandernden Zimmergesellen<br />
zu sehen, aber dann erfuhr er, daß des Vaters<br />
dürftige Verhältnisse den Jungen gezwungen haben, ein<br />
Handwerk zu erlernen. Das schade aber nichts, denn man<br />
brauche auch beim Handwerk tüchtige Männer. — In der<br />
eichenen Zunfttruhe fand ich ein Schulzeugnis über den<br />
Realschüler zu Blaubeuren, Baltas Burkarth vom 5. Dezember<br />
1841. von Reallehrer C. Speidel unterzeichnet. Es ist ein<br />
ganz vorzügliches Zeugnis über Französisch, Deutsch, Geometrie,<br />
Arithmetik, Geographie, Geschichte, Physik, Zeichnen<br />
und Schönschreiben mit mehreren „gut" und „recht gut". Als<br />
Bemerkung steht dabei: „Hinsichtlich seines Betragens zeigte<br />
er sich immer als stiller, ordentlicher und bescheidener<br />
Knabe, wodurch er sich die Liebe seines Lehrers in nicht<br />
unbedeutendem Grade erwarb." Wenn man bedenkt, daß in<br />
der rein evangelischen Realschule der kleine Burkarth zu<br />
den wenigen katholischen Schülern gehörte und damals die<br />
religiösen Gegensätze noch eine größere Rolle spielten als<br />
heute, so muß man zugeben, daß dieses Zeugnis den Lehrer<br />
genau so ehrte wie den Schüler. — Nach vielen Fragen des<br />
alten Lehrers über sein weiteres Reiseziel entließ er seinen<br />
früheren Schüler mit den besten Wünschen und einem guten<br />
Zehrgeld.<br />
<strong>Der</strong> Weg führte ihn weiter über Herrlingen und Söflingen<br />
nach Ulm. Mit ehrfürchtigem Staunen stand der Wandergeselle<br />
vor dem Ulmer Münster <strong>Der</strong> Eindruck war damals<br />
vielleicht noch imposanter und massiver, da der durch<br />
brochene Pyramidenaufbau noch nicht vorhanden war. Durch<br />
enge Straßen an prachtvollen Patrizierhäusern vorbei kam er<br />
zu dem herrlichen Rathaus, wo er auf der Polizeiwache den<br />
Stempel zum Weitermarsch nach Neu-Ulm im Bayrischen bekam.<br />
lieber die Donaubrücke gehend, sah er links drüben<br />
die Adierbastion, vor der aus vor 36 Jahren im Angesichte<br />
seines Königs und Landesherrn, Albrecht Berblinger, der<br />
„Schneider von Ulm" seinen ersten Freiflug in die kühle<br />
Donau machte. Von Neu-Ulm aus ging es in flottem Marsch<br />
nach Günzburg, wo er in der Gesellenherberge, einsam, der<br />
Lieben in der Heimat gedenkend, den heiligen Abend 1847<br />
verbrachte. Den 27. und 28. Dezember verbrachte er in der<br />
schönen alten Reichsstadt Augsburg, wo er die herrlichen<br />
kirchlichen und profanen Bauten besichtigte, Seme ganz besondere<br />
Aufmerksamkeit galt der Fuggerei, jenen ersten sozialen<br />
Wohnungsbauten Deutschlands. Ueber Friedberg und<br />
Dachau kam er dann am 29 Dezember nach München, der<br />
Hauptstad' des Königreichs Bayern. In seinem Wandertagebuch<br />
erwähnt er als besondere Sehenswürdigkeit die alte<br />
und die neue Pinakothek, die Ludwigskirche, die Residenz,<br />
das Schwabinger Tor und den Odeonsplatz. Man sieht, daß<br />
auf den Wandersmann diese Bauten einen größeren Eindruck<br />
machten als die verschiedenen Bierkeller. Politisch gesehen<br />
war damals gerade München ein recht unruhiges Pflaster. <strong>Der</strong><br />
kunstsinnige König Ludwig I., dem München so viele stolze<br />
Bauwerke und Kunstdenkmäler verdankte, wurde — Alter<br />
schützt vor Torheit nicht — von einer irischen Tänzerin, die<br />
sich Lola Montez nannte, eingefangen. In München kam es<br />
um die Jahreswende 1847/48 zu Straßenansammiungen und<br />
Ausschreitungen, an denen sich besonders die Studenten be-<br />
teiligten, welche die Entlassung des „königlichen Mensches"<br />
forderten. Die Gemüter erbitterten sich immer mehr, und<br />
auch die bayrische Regierung stellte sich gegen den König,<br />
bis dieser am 20. März 1848 zugunsten seines Sohnes Maximilian<br />
II. abdankte.<br />
Um diesen Unruhen in München zu entgehen, ließ sich<br />
Burkarth schon am 2. Januar 1848 über Mittenwald nach<br />
Scharnitz in Marsch setzen. Am 7. Januar überschritt er die<br />
bayrisch-österreichische Grenze. Natürlich war der Marsch<br />
bei strenger Kälte und hohem Schnee auf manchmal recht<br />
schlechten Wegen alles andere als angenehm. Aber der junge<br />
Zimmermann überwand mit Leichtigkeit alle Strapazen. Am<br />
10. Januar treffen wir ihn schon in Innsbruck, wo ihn besonders<br />
die Hofkirche mit dem Grab Kaiser Maximilians I.<br />
interessierte. Ueber Imst, Landeck und Bludenz erreichte er<br />
am 20. Januar 1848 die Stadt Bregenz. Zum erstenmal in<br />
seinem Leben sah er das „schwäbische Meer", aber ausgerechnet<br />
von österreichischer Seite. Am 21. Januar trat er bei<br />
St. Margarethen auf Schweizergebiet über. Am 24. I. sehen<br />
wir ihn in St, Gallen die Klosterkirche und die herrliche Bibliothek<br />
besichtigen. Auf Zick-Zackwegen wanderte er über<br />
Rapperswyl am Zürichersee nach Zürich und von dort nach<br />
Schaff hausen, wo er am 31. Januar von dem gewaltigen<br />
Schauspiel des Rheinwasserfalls sich beeindrucken ließ. Von<br />
dort ging es weiter dem Rhein entlang bis Basel, und hier<br />
überschritt er am 4. Februar die Grenze zum Großherzogtum<br />
Baden. In zügigem Marschtritt ging es dem Rhein entlang<br />
über Freiburg, Karlsruhe nach Speyer, wo er am 19. 2.<br />
eintraf. Alles, was dieses schöne Land seinem durstigen<br />
Auge bot, ließ er auf sich einwirken. Zuletzt den altehrwürdigen<br />
Speyrer Dom. Am 20. Februar trifft er in Mannheim<br />
ein und findet dort sofort Arbeit. Hier kommt er zum erstenmal<br />
mit der 48er Revolution in Berührung, denn am 27.<br />
Februar 1848 war die größte und wichtigste Versammlung in<br />
Mannheim einberufen worden, wo der Revolutionsführer<br />
Struve sehr radikale Forderungen stellte. Da unserm Zimmermann<br />
der Boden in Mannheim von Tag zu Tag heißer<br />
wurde, ließ er sich am 20. März wieder nach Basel in Marsch<br />
setzen, weil die Schweiz, wie er bei seinem Durchmarsch<br />
selbst feststellen konnte 1 , politisch am ruhigsten war. Denn<br />
schon im April 1848 kam es bei Kandern zu einem Zusammenstoß<br />
zwischen den Revolutionären unter Führung von<br />
Hecker und Struve einerseits und den einmarschierten Bundestruppen<br />
andererseits. Als erster fiel vor der Front der<br />
Befehlshaber der Bundestruppen, General Friedrich von Gagern,<br />
der vermitteln wollte. Die revolutionären Unruhen zogen<br />
sich bis ins Jahr 1849 hin, bis dann preußische Truppen<br />
unter Führung des nachmaligen Kaiser Wilhelm I, die von<br />
den Revolutionären besetzte badische Festung Rastatt einnahmen.<br />
Ein großer Teil der revolutionären Führer wurde<br />
damals zum Tode verurteilt und auch erschossen. Einem<br />
von ihnen, dem späteren Deutsch-Amerikaner Karl Schurz<br />
gelang es zu fliehen. Doch darüber später näheres.<br />
Am 26. März 1848 wurde Burkarth von Basel aus nach<br />
Zürich in Marsch gesetzt. Dort arbeitete er vom 5. April 1848<br />
bis 4. Mai 1848. Von diesem Tage an bis zum 6. Mai wanderte<br />
er dem Zürchersee entlang und arbeitete vom 7. Mai<br />
1848 bis zum 12. März 1949 „klaglos 17 bei Zimmermeister<br />
Staub in Rifferschwyl. Während dieser Zeit nahm er auch<br />
wieder engere Verbindung mit der Heimat auf. In der Zunftlade<br />
fanden sich zwei Briefe seines Vater Leodegar, welche<br />
am 15. Juli bzw. am 15. Oktober 1848 an seine Adresse in<br />
Riffersschwy) gerichtet sind. <strong>Der</strong> erste Brief erfolgte anscheinend,<br />
nachdem er seinem Vater mitgeteilt hatte, daß<br />
er vom Baugerüst gefallen wäre und sich tücntige Muskelquetschungen<br />
im Rücken una an den Beinen zugezogen hätte.<br />
Unser junger Zimmermann mußte wohl deswegen einige<br />
Zeit das Bett hüten. Sein Vater schreibt ihm in diesem Brief<br />
u a.: „Mit nassen Augen haben wii den Brief, auf den wir<br />
mit Sehnsucht gewartet haben, gelesen. Gott sei Dank ist es,<br />
Wie Du schreibst, noch gut gegangen. Schon oft habe ich Dir<br />
gesagt, Du sollst auf Dich selber achtgeben, derm niemand<br />
gibt auf einen andern acht. Das soli Dir eine Warnung sein.<br />
Doch bete zu Gott, daß er Dich in diee^r Zeit nicht verlassen<br />
soll. Daß Du viel Schmerzen gehabt hast, das glaube ich<br />
wohl, aber du hättest deine Schmerzen lindern können mit<br />
dem Dachsschmalz, das ich Dir mitgegeben habe. Du wirst<br />
es wohl gebraucht haben. Ich soll Dir sehreiben, wie es bei<br />
uns geht. Ich habe bis dato noch alleweil Arbeit, aber jetzt<br />
wird es weniger. Auch der Gemeinde geht die Arbeit aus.<br />
<strong>Der</strong> Nazi ist auch zu Haus, aber er ist nichts und weiß nichts<br />
und kann nichts,... ,<br />
In einem Brief vom 15. Oktober schreibt sein Vater: „Daß<br />
Du von dem Herunterfallen nichts mehr spürst, das ist Gott<br />
zu verdanken. Es sind einige nach Einsiedeln gegangen, und
Jahrgang 1955 H O H E N Z O L L E R I S C H E HEIMAT 37<br />
ich habe ihnen einen Brief an Dich mitgegeben, aber sie<br />
haben ihn wieder mitgebracht. Man wisse dort nicht, wo Rifferschwyl<br />
liege. Ich glaube, daß sie ihn nur vergessen haben.<br />
Ich solle Dir von der Politik schreiben, aber alles was sich<br />
in der ganzen Welt tut, ist nichts als Lüge. In Sigmaringen<br />
ist es so zugegangen, daß die Regierung samt dem Fürsten<br />
fort ist. Sie sind in Konstanz gewesen, aber jetzt ist alles<br />
wieder da. In Sigmaringen liegen 800 Mann bayrisches Militär.<br />
Die Revoluzzer sind sofort inhaftiert worden. Bei uns in<br />
Gammertingen ist es soweit noch ruhig. In Veringenstadt hat<br />
es am 22. August gebrannt, und es sind 36 Gebäude abgebrannt<br />
und 42 Haushaltungen obdachlos geworden. Das Feuer<br />
war so schnell, daß in iE Stunden alles in Asche lag. Die<br />
Ernte ist vorbei, und wir haben gut geschnitten und alles<br />
gut heimgebracht. Kartoffeln hat es wenig gegeben. In Deinem<br />
letzten Brief habe ich gelesen, daß Dich das Brieflein<br />
von Musteriehrer Reiser gefreut hat, absonder in Deiner<br />
Krankheit. Ich glaube, es würde den Musterlehrer gefreut<br />
haben, wenn sein Schreiben auch eine Antwort bekommen<br />
könnte. Auf Ehre gehört auch Ehre. Weiter weiß ich nicht, als<br />
daß wieder streng exerziert wird und bei 80 Stück Gewehre<br />
angeschafft wurden. Vom 20. bis zum 50. Lebensjahr muß<br />
alles exerzieren, die Montur muß jeder selber anschaffen<br />
usw. Wenn Dir die Arbeit ausgeht oder es in der Schweiz<br />
auch unruhig wird, so komm nach Haus!"<br />
So schrieb sein Vater Leodegar, ein alter Soldat, der im<br />
Jahre 1810 unter Napoleon I. in Spanien kämpfte.<br />
Am 12. März 1849 wird unser junger Zimmermann von<br />
Rifferswyl aus nach Aarwangen im Kanton Bern in Marsch<br />
gesetzt. Dort arbeitete er 6 Wochen „klaglos" und marschierte<br />
am 30. April 1849 über Bern nach Lausanne, von dort nach<br />
Neuchâtel, von wo er am 6. Mai 1849 in seiner letzten Arbeitsstation,<br />
Le Locle einzog. Sicherlich war der Weg durchs<br />
Gebirge zum Genfersee um diese Jahreszeit ein prächtiges<br />
Erlebnis. Le Locle liegt in der französischen Schweiz. Wie er<br />
als alter Mann uns Enkeln erzählte, habe er damals absichtlich<br />
die französische Schweiz aufgesucht, um seine französischen<br />
Sprachkenntnisse weiter zu verbessern.<br />
Am 14. Okt. 1849 ist in seinem Wanderbuch als letzter Eintrag<br />
zu lesen: „Mr. Burkhart a travaillé au Locle plusieurs<br />
mois au contentement de son maître. Vu pour retourner<br />
dans sa patrie pour satisfaire à 'la Loi militaire". Er mußte<br />
also heimwärts ziehen, um seiner Militärpflicht zu genügen.<br />
Hier noch ein kleiner Ausflug in die Zeitgeschichte: Die 48er<br />
Revolution brachte Preußen eine kleine Gebietserweiterung<br />
in Süddeutschland, weil die Fürsten von Hohenzollern Sigmaringen<br />
und Hechingen ihr vom Revolutionsfieber ergriffenes<br />
Ländchen am 7. Dez. 184P an Preußen abtraten. Dav<br />
gegen verlor der König von Preußen sein oranisches Fürstentum<br />
Neuen bürg (Neuchätel), das sich im März 1848 eine republikanische<br />
Verfassung gegeben hatte. So wanderte unser<br />
Freund in jenen Tagen direkt durch die Weltgeschichte, indem<br />
er aus dem Preußen verloren gegangenen Neuchâtel in<br />
das von Preußen gewonnene Hohenzollern zo,g.<br />
Wohlgemut ging er dem Bielersee entlang in Richtung Heimat<br />
Trotz der vorgerückten Jahreszeit beglückte noch ein<br />
lieblicher „Altweioersommer" die romantische Gegend. <strong>Der</strong><br />
Weg staub Le, und es wurde dem W andersmann so schön<br />
warm, da' er sich zur Ivlarscherleichterung den Kragen<br />
öffnete PlÖtzlicl sah er am Wegrande einen jungen Mann<br />
liegen, der die Hände hinter dem Kopf, in den blauen Himmel<br />
starrte. Sofort sah er, daß es sich hier um keinen zünftigen<br />
Wandersmann handelte. Oben trug er ein graues,<br />
flauschiges und verschnürtes Wams, an den Beinen Lederhosen<br />
und lange Stiefel. Alles sah sehr mitgenommen aus.<br />
Mit einem: „Guten Tag" und „Ist's gestattet?" ließ er sich an<br />
der Seite des Liegenden nieder. <strong>Der</strong> nickte nur und sagte:<br />
„Ich heiße Karl", während unser Freund sich mit „Baltes"<br />
vorstellte. An der Sprache merkte er, daß der Kamerad ein<br />
Deutscher war. Burksrth zog aus seinem Tornister ein mächtiges<br />
Brot, Speck una Wurst und zudem noch eine Flasche<br />
guten Wein, den ihm der Meister in Le Locle zum Abschied<br />
verehrt hatte. <strong>Der</strong> andere aß und trank tüchtig, und man<br />
merkte, daß er sicntlich ausgehungert war. Als sie beide satt<br />
waren, unterhielten sie sich angeregt, und bald stellte sich<br />
Wer das Tal der Bära durchwandert, dem werden die Tuffsteinbrüche,<br />
die auf der Gemarkung Bärental liegen, auffallen<br />
und sicherlich ein gewisses Interesse abringen. Da im<br />
Laufe der Jahre .ine verstärkte mechanische Ausbeutung<br />
der bekannten Brüche eingesetzt hat. werden in absehbarer<br />
Zeit diese Stellen landschaftlich und arbeitsmäßig ein ganz<br />
Die Tuffsteinbrüche bei Bärental<br />
heraus, daß sie beide im Jahre 1829 geboren waren. Nun erzählte<br />
ihm der Kamerad eine fast unglaubliche Geschichte,<br />
daß er in der von preußischen Truppen eroberten badischen<br />
Festung Rastatt zum Tode verurteilt worden sei. Es sei ihm<br />
aber gelungen, vor Vollzug des Urteils nachts durch einen<br />
Abwasserkanal zu entfliehen. Dann sei er über das Elsaß<br />
nach der Schweiz ausgerückt. Er warte jetzt nur auf eine<br />
günstige Gelegenheit, in den nächsten Monaten wieder nach<br />
Deutschland zu kommen, um einen bestimmten Plan auszuführen.<br />
Auch Baltas erzählte seine Wandererlebnisse. So<br />
kam es, daß die beiden sich gut anfreundeten und in ihrem<br />
jugendlichen Uebermut in dem See ein kühles, aber erfrischendes<br />
Bad nahmen. Nachher wuschen sie ihre Hemden<br />
und, solange diese trockneten, trieben sie allerhand<br />
Schabernack und führten gegenseitige Ringkämpfe auf. Sie<br />
wanderten noch einen Tag miteinander, dann trennten sie<br />
sich. Zwei Lebenslinien berührten sich zufällig am Bielersee,<br />
liefen kurze Zeit nebeneinander, um sich für immer wieder<br />
zu trennen. Karl Schurz, sein gleichaltriger Wanderfreund,<br />
ging im Jahre 1850 nochmals über den Rhein nach<br />
Deutschland. Sein Lehrer und Freund, der Dichter Gottfried<br />
Kinkel war inzwischen zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt<br />
und von Rastatt nach Spandau bei Berlin gebracht<br />
worden. Karl Schurz gelang es, bis dorthin vorzudringen<br />
und Kinkel mit einem abenteuerlichen und kühnen Handstreich<br />
aus dem Zuchthaus zu befreien. Ueber Holland flohen<br />
die beiden nach England, und von dort aus fuhr Schurz über<br />
das große Wasser nach Nordamerika. Er trat bald der republikanischen<br />
Partei bei, und seiner Werbung ist es hauptsächlich<br />
zu verdanken gewesen, daß Abraham Linkoln im<br />
Jahre 1860 zum Präsidenten der S.U.A. gewählt wurde, wofür<br />
er von Linkoln als Gesandter nach Spanien geschickt<br />
wurde. Schon 1862 kehrte er nach U.S.A. zurück und wurde<br />
General im Unionsheer im Krieg gegen die Südstaaten. 1877<br />
bis 1881 war er Minister des Innern. Als solcher ging er<br />
energisch gegen die Beamtenkorruption vor und trat für die<br />
Negerbefreiung ein. Bis zu seinem Tode war er unbestritten<br />
der große Führer der Deutschamerikaner in Nordamerika.<br />
Burkarth überschritt bei Basel den Rhein und marschierte<br />
auf dem schnellsten Wege seiner Heimat Gammertingen zu.<br />
Dort wurde aus dem Gesellen ein tüchtiger Meister. Später<br />
baute er nach eigenen Plänen öffentliche und private Gebäude,<br />
und noch heute zeugt manches Bauwerk von der<br />
großen Sachkenntnis seines Baumeisters. Das Vertrauen seiner<br />
Mitbürger betraute ihn lange mit dem Amt des Gemeinderechners<br />
und später des Bürgermeisters der Stadt<br />
Gammertingen. Unbeirrt um Lob oder Tadel ging er durch<br />
sein langes Leben stets den geraden Weg der Pflicht. A ,ls er<br />
im Jahre 1911 starb, brachte die Tageszeitung u. a. folgenden<br />
Nachruf:<br />
„Dem ehrsamen Handwerk zugeteilt, auf das er sein Leben<br />
lang mit Freude und Stolz blickte und das ihm dankbarer<br />
Lebensberuf war, sehen wir Ende der Vierziger jähre des<br />
letzten Jahrhunderts den Zimmergesellen im In- und Ausland<br />
seinem Handwerk mit Fleiß und Geschick obliegen. Bis<br />
in sein hohes Alter erzählte er gerne von der Poesie, aber<br />
auch von den Entbehrungen und Strapazen des Wanderlebens<br />
von damals. Ein besonderer Lichtblick in jener Zeit war<br />
sein Zusammentreffen im Jahre 1849 in der Schweiz mit dem<br />
gleichaltrigen Karl Schurz, dem berühmten späteren Deutsch-<br />
Amerikaner, den Bismarck den größten Deutschen Amerikas<br />
nannte. Burkarth teilte mit dem Flüchtling seine Habe und<br />
ließ sich von seinen Schicksalen erzählen. Seinen späteren<br />
Lebensgang verfolgte B. stets mit besonderem Interesse. Er<br />
freute sich der großen Erfolge seines ehemaligen Freundes,<br />
den er im tiefsten Elend sah und den er später auf der Sonnenhöhe<br />
der Erfolge schaute.' r<br />
Zum Schluß obiger Ausführungen noch ein Wort aus<br />
Goethe, Iphigenie, I. 3.:<br />
Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt,<br />
der froh von ihren Täten, ihrer Größe<br />
den Hörer unterhält und still sich freuend<br />
am Ende dieser schönen Reihe sich<br />
geschlossen sieht!<br />
Erwin Burkarth.<br />
anderes Bild abgeben. Es soll deswegen über die Tuffsteinbrüche<br />
und deren Ausbeutung in den letzten 100 Jahren kurz<br />
einiges berichtet werden.<br />
Die Tuff Steinbrüche verdanken ihr Entstehen und ihr Dasein<br />
den unmittelbar in ihrer Nahe aus dem Kalkgestein<br />
hervorbrechenden Quellen, die ihren Kalkreichtum an derrs
¿H HOHÜNZOLLERISCHE HEIMAT T;,..rgang 1.955<br />
vorhandenen Moos und der übrigen Pflanzenwelt ablagern.<br />
Jedes Jahr wuchs eine neue Schicht hinzu, was man im<br />
kleinen Maßstab auch heute noch in der Nähe der Quellen<br />
beobachten kann. Auf Grund von immer wieder gemachten<br />
Funden von Tieren, die ehemals in das noch schwachverkrustete,<br />
nasse Gelände einbrachen und versteinerten, ist festzustellen,<br />
daß recht lange Zeiträume erforderlich waren, bis die<br />
Tuffsteinbrüche ihr gewaltiges Ausmaß erreicht hatten.<br />
Auf der Gemarkung Bärental liegen zwei mächtige Brüche<br />
mit diesem bekannten Gestein. <strong>Der</strong> eine befindet sich im<br />
„Schlößle", der andere liegt etwa 200 Meter westlich des<br />
Dorfes Bärental, unweit der Durchgangsstraße nach Fridingen<br />
a. D. <strong>Der</strong> „Schlößlesteinbruch", wie er kurz genannt<br />
wird, ist Eigentum der fürstlich hohenzollerischen Verwaltung.<br />
Eine Ausbeutung beider Brüche in größerem Umfange<br />
hat in früheren Zeit nicht stattgefunden. Man entnahm ihnen<br />
lediglich Steine und Sand zum Bau der Häuser im Dorfe sel=<br />
ber. Erst nach 1870, als der Bau von Eisenbahnen, Tunnels<br />
und Bahnhofsgebäuden auch in unserer Gegend in wachsendem<br />
Umfange einsetzte, zeigte sich in beiden Steinbrüchen<br />
ein reges Leben. Ende der 80iger Jahre erschienen im Schlößlesteinbruch<br />
auch einmal 12 Italiener mit ihrem Capo, die beim<br />
Bau der Donautalbahn beschäftigt waren und begannen mit<br />
Steinbrechen. Da sie aber als Werkzeuge nur Pickel und Schaufeln<br />
mitbrachten und auch die besonderen Methoden nicht<br />
kannten, die zum Brechen des Tuffsteins angewandt werden<br />
mußten, war ihre Arbeit fast erfolglos. An ihre Stelle traten<br />
dann etwa 30 Mann aus Bärental, Renquishausen und Irrandorf.<br />
<strong>Der</strong> Taglohn für einen Arbeiter lag damals zwischen<br />
1.80 und 2 RM. Nach Abschluß des Bahnbaues stockte der<br />
Absatz. In den darauffolgenden Jahren pachtete ein Bärentaler<br />
Bürger, Xaver Griebele, Schuhmacher, den Bruch im<br />
Schlößle. Die Steine konnten aber nur bei privaten Kunden<br />
abgesetzt werden, und die Beschäftigungsmöglichkeiten waren<br />
entsprechend gering. Nachher ruhte wieder lange Zeit die<br />
Arbeit in diesem Bruch. Zwischendurch fanden kurzfristige<br />
Verpachtungen an verschiedene Abnehmer statt, bis dann im<br />
Jahre 1935 die bekannte Firma Wilhelm Schwarz, Gönningen,<br />
den Schlößlebruch endgültig in Pacht nahm. Schwarz richtete<br />
sich maschinell ein und betreibt seit damals bis heute die<br />
Ausbeutung. Neben Steinen und Sand liefert er auch selbsthergestellte<br />
Kunststeine. Seit kurzer Zeit haben auch die<br />
Stallitwerke in Radolfzell einen Teil des Bruches in Pacht.<br />
<strong>Der</strong> Tuffsteinbruch in der Nähe des Ortes gehört eigentümlich<br />
in verschiedenen Parzellen Bürgern aus dem Dorfe<br />
Bärental. Sie schlossen sich zu einer Gesellschaft zusammen<br />
und betrieben den Bruch gemeinsam. Den größten Anteil besaß<br />
der im Jahre 1909 verstorbene Friedrich Stöhr, der auch<br />
lange Jahre der Leiter und Geschäftsführer des Unternehmens<br />
war. Nach 1870 herrschte mehrere Jahrzehnte reges<br />
Leben in diesem Bruch, und zahlreiche Männer fanden dort<br />
Verdienst. Mit „Huppen" (Hacken an liegen Stielen) und Sägen<br />
ging man den Felsen zu Leibe. <strong>Der</strong> Abfall wurde damals<br />
als wertloses Material aufgeschichtet, die Steine hingegen<br />
mit Pferdegespannen an ihren Bestimmungsort gebracht.<br />
Diese luden meist Felsblöcke mit 2 und 3 Kubikmetern und<br />
waren Tag und Nacht unterwegs. Ein Kubikmeter Tuffstein<br />
kostete damals ca. 14.— RM, heute durchweg das Zehnfache.<br />
Nach dem Tode von Friedrich Stöhr wurde Meinrad Mehner<br />
Nachfolger in der Leitung der Gesellschaft. Da die einzeln<br />
nen Parzellen immer weiter ausgebrochen wurden und die<br />
Anlieger ihre Stücke nicht mehr abgaben, ging der Betrieb<br />
immer mehr zurück. In dieser Zeit kam nun in Oelmüller<br />
Wilhelm Beck ein weiterer Interessent. Er pachtete zu seinem<br />
Eigentum den Anteil der Gemeinde und erstellte ein<br />
einfaches Stampfwerk, das mit Wasserkraft betrieben wurde.<br />
Aus dem einst so wertlosen Abfallmaterial stampfte er Sand,<br />
der guten Absatz fand. Sein Sohn, Joachim Beck, baute nach<br />
dem 2. Weltkrieg das Pochwerk in moderner Weise um und<br />
belieferte darauf Privatkunden und Unternehmer in der<br />
ganzen Umgegend mit dem wertvollen Sand. Seit einem<br />
Jahre hat die Firma Steinwand, Tuttlingen, den Gemeindeanteil<br />
des Bruches in Pacht. Die Tuffsteinbrüche, die in der<br />
Vergangenheit der Gemeinde schon manche Sorgen bereiteten,<br />
sind in der Gegenwart für sie eine gute Einnahmequelle<br />
und bieten für zahlreiche Arbeiter lohnende Beschäftigungsmöglichkeiten.<br />
J. Wannenmacher.<br />
Die gelungene Flucht einer Pietä<br />
AU die Dörflein über den Bergen im Lauchert- und Donautale<br />
sind imstande, mit dem erhaltenen künstlerischen Gehalt<br />
ihrer Stätten der Andacht eine schon im Mittelalter<br />
ihnen gegenüber bedeutende Stadt wie Ebingen heute in den<br />
Schatten zu stellen. Woher kam das und ist das immer so<br />
gewesen?<br />
Die Höhe einer Kultur wird vor allem am Eigenwert und<br />
Gehalt ihrer Baudenkmäler, Weihestätten, Tempel oder Kirchen<br />
wahrgenommen. Aber tatsächlich leben wir gerade in<br />
Deutschland noch zu einem Teil im Nachhall des Lärms der<br />
Bilderstürmer vor über 400 Jahren.<br />
„Ambrosius Blarer, Tübingen", so lesen wir bei G. Bossert,<br />
„war gegen den Gebrauch der Bilder in den Kirchen und<br />
nennt sie schlechtweg „Götzen". Er säuberte 1536 die Kirchen<br />
seines Gebietes mit großer Gründlichkeit. Am 10. September<br />
1537 wurde in Urach ein „Götzentag" abgehalten. Herzog<br />
Ulrich gab darauf den Befehl zur Entfernung der Bilder aus<br />
den Kirchen und Klöstern ". <strong>Der</strong> Ebinger Marktbrun<br />
nen mit dem Standbild eines Ritters, von Herzog Ulrich 1S45<br />
errichtet, ist also der schnöde Ersatz für viele Kunstwerte<br />
des hohen Mittelalters, die bis dahin in den Ebinger Kirchen<br />
von Größe und Würde gezeugt hatten. Ulrichs Nachfolger,<br />
Gotische Pietä, soll aus Ebingen stammen Haus des Kolonialwarznhänd'.ers Glas in Sigmaringen
Jahrgang 1955 39<br />
Herzog Christoph, als es zu spät war, erhob die Klage: „Wo<br />
wir auf dem Lande in den Kirchen Predigt hören, sind dieselben<br />
dermaßen zugericht und ausgeputzt, als ob sie gestürmt<br />
und ausgeplündert worden, sonderlich schier kein<br />
Fenster mehr außerhalb des Chores in den Kirchen ist. (Janssen<br />
HI/7 Virg. sacr. Mon.)<br />
Die Ebinger St. Martinskirche hatte anno 1465 allein 4<br />
Altäre: den „St. Niclaussen-, den aller Haylligen-, Unserer<br />
lieben Frauen Mariä- und den St. Catharinä-Altar", dicht<br />
daneben im Beinhaus stand der „St. Michel-Altar", im Spital<br />
der „Haylligen Geist-Altar" und in „Unserer Frawen Capellen<br />
usserhalb dem Chor der St. Johannessen-Altar". Mit<br />
dem Gnadenaltar der in Laiz wiederentdeckten Wallfahrts-<br />
Pietä hatte also Ebingen 8 Altäre, die kultgemäß das Beste,<br />
was Hand, Herz und Geist namenloser Künstler der Münsterbauzeiten<br />
zu schaffen imstande waren, trugen. Was ist<br />
nun von jenem geahnten Reichtum wirksamer Kunst- und<br />
Kultbilder den Fährnissen seitheriger kunstfeindlicher Jahrhunderte<br />
entgangen? In den Ebinger Kirchen hat sich kein<br />
bewegliches Stück erhalten. Im Ebinger Spital wurde die<br />
St. Martinsbüste von 1490 still beiseite gestellt und dadurch<br />
gerettet (jetzt Heimatmuseum Ebingen), nach Laiz wurde das<br />
Wallfahrtsgnadenbild, die Pietä aus der Ebinger Kapellkirche<br />
von Nonnen „bei Nacht und Nebel entführt". Sie ist heute<br />
noch dort.<br />
Wenn wir die mündliche Ueberlieferung für wahr nehmen<br />
dürfen, so ist jetzt das vielleicht beste gotische Altarbildwerk,<br />
das Ebingen je besaß, wieder ins Blickfeld gerückt.<br />
Geht man in Sigmaringen stadteinwärts über die Laizer<br />
Donaubrücke links ab am Gasthof zum Bären vorbei die Gasse<br />
hinunter, dann gelangt man auf einen idyllischen Hof mit<br />
fließendem Brunnen unter einer Linde. Im Rücken hinter<br />
einigen Häusern steigt jäh der das Schloß tragende Felsen<br />
auf, etliche Schritte voraus plätschern die Wasser der Donau.<br />
Dicht beim Brunnen steht ein Giebelhaus mit einem merkwürdigen<br />
Kapellenanbau. In der Kolonialwarenhandlung des<br />
Hauses treffen wir Herrn Glas, den Heiligenpfleger von Sigmaringen.<br />
Bereitwillig führt er uns in ein kleines, besonntes<br />
Zimmer, wo blumen- und kerzenumstanden vor dunkelbraunem<br />
Samtvorhand eine gotische Pietä ihren eigenartigen<br />
Zauber ausstrahlt.<br />
Bis vor einigen Jahrzehnten", so erzählt der Besitzer des<br />
Bildwerks", war es auch bei uns noch da und dort üblich,<br />
Hausandachten zu halten. So auch hier im elterlichen Hause<br />
meiner verstorbenen Frau aus Sauter'schem Geschlecht, in<br />
deren Besitz das Haus einst durch Kauf gekommen ist. Das<br />
Kapellchen war schon angebaut und dieses „Vesperbild" darin<br />
wurde mit übernommen, da nach alter Sitte ein geweihtes<br />
Bild zum Haus gehört. Die früheren Hauseigentümer waren<br />
Fischer und Bauern gewesen.<br />
Eines Tages vor langer Zeit waren die Fischer wieder mit<br />
dem Kahn auf der Hochwasser führenden Donau. Während<br />
iKer Arbei' gewahrten sie etwas in den Fluten daher<br />
Schwimmendes. Ihnen fuhr der Schreck in die Glieder, denn<br />
sie glaubten ; m ersten Moment, es käme eine Leiche angeschwon<br />
u en. Beim Nähertreiben wurden sie von dem Irrtum<br />
glücklich befreit; sie erkannten es als bemaltes Holz und<br />
faßten beherzt zu. Da tauchte zuerst das Köpfchen unserer<br />
Muttergottes mit diesem unnennbar feinen schmerzlichen<br />
Ausdruck im Antlitz — ein Dichter würde sagen — aus einem<br />
Meer von Tränen auf. Die Donauwasser verrannen schnell<br />
darauf, perlten über die blassen Wangen und glitten mit den<br />
Schlängelfalten des Kopftuches auf die rotumkleidete Brust<br />
und diese grüngraue Ummantelung. Ergriffen von dem<br />
schmerzlich-innigen Ausdruck in dem zierlichen Gesicht entrissen<br />
die Fischer mit verdoppelter Kraft das Bildwerk den<br />
reißenden Fluten der Donau. Sie stellten es daheim auf und<br />
hielten es in großen Ehren. Es vererbte sich von Geschlecht<br />
zu Geschlecht, und auf diesem Wege von Mund zu Mund hat<br />
sich auch überliefert, daß diese Pietä aus Ebingen stamme."<br />
Für den Herkunftsort haben die weiteren Nachforschungen<br />
einen schriftlichen Beleg von relativem Gewicht erbracht. Im<br />
„Donauboten" von Sigmaringen vom 16. Oktober 1888 stand<br />
ein Artikel über das „Frauenkäppele" am Frauenküfer'schen<br />
Haus in der Vorstadt. Darin stand: „Von Ebingen sei es her<br />
und zur Zeit, wo man dort mit den Bildern der Muttergottes<br />
und der Heiligen gründlich aufgeräumt, sei es in die Schmeie<br />
geworfen .... " Weiter lesen wir: „Sehr alt scheinen die aus<br />
Holz geschnitzten Figuren zu sein, wohl älter noch als die<br />
gleiche Darstellung am Schloßportal... Die Fürstin-Mutter<br />
hat das Kapellchen mit einem schönen Bild bedacht... Möge<br />
das Bewußtsein, etwas so Ehrwürdiges zu besitzen, jene zur<br />
Hochschätzung desselben antreiben und ihnen zum christlichen<br />
Frieden dienen!<br />
Stammt die Pietä des Sigmaringer Heiligenpflegers und<br />
Kolonialwarenhändlers nun mündlicher Ueberlieferung .'.ufolge<br />
aus Ebingen, so kann angenommen werden, daß ihr<br />
Platz einst in der St. Martinskirche gewesen war, da die Laizer<br />
Pietä einwandfrei aus der Ebinger Kapellkirche, die jetzt<br />
ein getreues Abbild erhalten hat, stammt. — Das Andachtsbild<br />
ist 70 em hoch aus Lindenholz. Die alte Fassung wurde<br />
um 1942 von dem Sigmaringer Gustav Steidle freigelegt und<br />
etwas ergänzt. Außer der linken Hand von Maria und den<br />
Füßen von den Knieen abwärts des Christus, die ungeschickt<br />
einmal erneuert wurden, ist alles im Original erhalten. Die<br />
Entstehung dürfte um 1430 liegen. Die Art der Formung weist<br />
nach Ulm. In die Erhabenheit der hochgotischen Tradition<br />
mengen sich Formgebungen, die jene einschränken durch<br />
Hereinspielenlassen dekorativer und zierlicher Ausgestaltungen,<br />
also Kennzeichen der Spätgotik nach 1420. Aber die Geistesweite<br />
der Hochgotik hallte noch kräftig nach. Noch bestand<br />
in deutschen Landen die mittelalterliche „Große Koalition"<br />
von Bauern, Bürgern, Rittern und Geistlichen. Es gab<br />
glücklicherweise noch keine freischaffenden Künstler; so<br />
konnte in den Bauhütten aus dem Ueberschuß der Kraft bei<br />
allgemein gleicher Weltanschauung trotz der sozialen Unterschiede<br />
ein begeisterter Lebens- und Schaffensrhythmus zu<br />
den kühnsten Gestaltungen ausreifen und das zeitigen, was<br />
das 19. und 20. Jahrhundert vergeblich sucht, die einheitliche<br />
Art der Formung. Die Maier und Bildhauer brauchten nicht<br />
auf Lager arbeiten; sie, die namenlosen Größen, hatten ihre<br />
Aufträge für die Gesamtkunstwerke, die Münster und Dome,<br />
welche vom später vorherrschenden Bürgertum als „gotisch",<br />
d. h. barbarisch beschimpft wurden, welcher Ausdruck hängen<br />
blieb, aber heute ein Ehrenname ist.<br />
Ernst Louis Beck.<br />
Sonntägliche Suche nach den „Dreibannmarken"<br />
Von den ältesten Marksteinen und der Schönheit des Heubergs<br />
Als ich ihn so daliegen sah, den Wehrlosen, von einem<br />
tonnenschweren Panzer Umgefahrenen, da merkte ich wohl,<br />
daß das menschliche Herz auch für einen Stein schlagen<br />
kann. Er erregte Mitleid in mir, so, ls wär er zu den leidunc<br />
freudempfindenden Wesen zu zählen, wie etwa jene im<br />
dunklen Tann des Fasenbochs sich immer noch haltenden,<br />
wenigen Rehe es sind oder eben diese Rottannen mit den ins<br />
Lebensmark ihrer Jahresringe eingedrungenen Stahlkugeln<br />
und -splittern, J eh bückte mich also zu dem alten Markungsstein<br />
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg hinunter, nicht<br />
anders wie ein Polizist es bei einem auf freiem Felde in<br />
einsamer Gegend ruf gefundenen Toten tut, tastete seinen<br />
Körper ab und forschte nach einem Ausweis. Danach zückte<br />
ic'i den Bleistift und das Notizbuch und begann mit meinen<br />
Eintragungen und Aufzeichnungen: geboren 1 5 9 9, Eltern:<br />
Straßber, und Et Ingen, besondere Kennzeichen:<br />
die Initialen E F. Eine Zeichnung war notwendig. Die Auswertung<br />
des Eh'-iger Geschichtsexperten ergab dann: Wie<br />
eine 1715 verfaßte Urkunde (Staatsarchiv Ludwigsburg A<br />
301) belegt, wurde an 1. September 159C ein „Marckh- und<br />
• ,oachungsbrief zwischen dem Edlen Eytel-Friderich von<br />
Westerstetten und Trackhenstein, zu Straßberg und der Wil-<br />
denthierberg, für Straßberg, Frohnstetten und Kaiseringen,<br />
und der Statt Ebingen" unterschrieben und ausgetauscht.<br />
Für Straßberg hatte der Lautlinger Graf, für Ebingen hatten<br />
2 Bürgermeister und Stadträte, außerdem als Unparteiische<br />
etliche Feldmesser und Untergänger unterschrieben. Das<br />
Ganze war nach Setzung dieses und andrer neuer Markungssteine<br />
erfolgt. Zu den Wappen war zu sagen: Ebingen<br />
ist durch das bekannte Hirschhornwappen vertreten. Straßberg<br />
durch den westerstettischen, dreigeteilten Schild, der<br />
nich L s anderes als einen „umfangenen Waagbalken" darstellt,<br />
was wohl niemand geahnt hätte.<br />
Ueber 350 Jahre hat der Brave aufrecht und unangefochten<br />
die Markungsgrenze gehütet; das Vernängms war, daß<br />
der Stein auf einem „vertrackt" kriegerisch gewordenen<br />
Platze stand, auf einem mit friedvollen Lämmern seit je<br />
bevölkerten, jetzigen Marsfeld. Vor dem Weitergehen redete<br />
ich ihm noch gut zu: „Hauptsache, dir widerfuhr nichts<br />
Schlimmeres' Wenn die Ebinger Stadträte hier mal wieder<br />
was zu melden haben werden, dann wird dies der frohe<br />
Tag deiner Wiederauferstehung werden und auch des Wiedersehens<br />
mit den Bürgern, die ihre eigene Markung nicht<br />
mehr kennen dürfen."
40 H O H E N Z O L L E R I S C H E HEIMAT Tp.hreang 1955<br />
Es zog mich weiter. <strong>Der</strong> Tag war strahlend schön und<br />
schießfrei.. Ein alter Sonderausweis in der Tasche gaukelte<br />
mir vor: Dir kann nichts passieren; gehe hin, wo immer du<br />
möchtest; wohin Erinnerungen aus fernen Tagen dich locken.<br />
Sieh auf zu der kreiseziehenden Gabelweihe dort oben im<br />
blauen Azur! Ja, die gibt's also noch, freue dich der lautlosen<br />
Kurven wie einst! Einst? Als Kind scheuchten wir<br />
mal ein ganzes Rudel Rehe hier oben im Niederholz auf;<br />
es war hinterher ein lustiges Hüpfen der Geißen, Böcke und<br />
Kitzen über die jungen Tännchen. immerhin sah ich heute<br />
im dunkelsten Waldtälchen westlich der Reiberhufr<br />
u i n e n die hellen Spiegei zweiei Jungtiere in hohen<br />
Fluchten durch das Gestänge flitzen. Euch mag der hl. Franz<br />
von Assisi in seine besondere Obhut nehmen! Ob's wohl<br />
noch immer die schwarzweißen Tiefbauer hier draußen gab?<br />
Einen mächtigen Dachsbau mit gutem Röhrensystem und<br />
einigen Wagenladungen Aushub hatte mir als Bub mein<br />
Bruder im niederen Föhrenbestand nahe der idyllischen<br />
Waldlichtung der ehemaligen Lenzhütte leise f!ü=<br />
sternd und lautlos anschleichend gewlesen. Keine Spur mehr<br />
zu entdecken, aber beim Aufstieg aus dem Tal in der<br />
Schlucht, also jenseits der Platzgrenze, da hatte ich doch<br />
einen Bau gesehen. Am Ende haben die Fettwänste zur<br />
„chasse allemande" doch größeres Vertrauen und haben sich<br />
demzufolge dorthin evakuiert.<br />
Apropos „Jagd", da hätte ich beinahe zu erwähnen vergessen,<br />
daß mir schon vor Eintritt in den Fasenbochwald<br />
nur etwa 200 m westlich des Markungsgrenzsteins von 1599<br />
ein eigenartiger andrer Stein mit beidseitiger Einkerbung<br />
der Jahreszahl 1714 dadurch besonders aufgefallen war, daß<br />
auf der Nordwestseite, also der Stadt zu, über dieser Zahl<br />
noch etwas eingeritzt war. Es war schlecht zu erkennen,<br />
schon besser mit dem Finger zu erfühlen: das Ergebnis ist<br />
aus Nr. 2 der Zeichnung zu ersehen. Und wieder deutete der<br />
Fachmann das verschlungene Wortgepräge klar und überzeugend<br />
mit: Pirsch. Von hier ab, 200 m von der eigentlichen<br />
Markungsgrenze weg, hatten alle Ebinger Bürger das R e ch t,<br />
der freien, frisch-fröhlichen Jagd auf alles, was da<br />
„kreucht und fleucht", auf Meister Lampe, flinke Rehe und<br />
Wildsauen vor allem, auf Schnepfen und Wildtauben, auch<br />
auf Raubzeug wie Reineke Fuchs, Marder und Iltis. Isegrim,<br />
der reißende Wolf, sehr zur Freude der einsamen<br />
Schafhirten, war damals schon ausgerottet, aber der letzte<br />
seines Geschlechts auf Ebinger Markung war gerade in jenem<br />
Gäu beim Ehestetter Berg gestellt, gejagt und zur<br />
Strecke gebracht worden, ich ahne, daß der Setzung des<br />
Pirschsteines von 1714 lange Streitigkeiten wegen überwech-<br />
* > IMMAtiMrfjW»*<br />
5(K<br />
«mnGW - m m i w m t<br />
selnden Wildes voraufgegangen sein müssen. Die Edlen derer<br />
zu Trackhenstein werden den Ebingern schon den<br />
punkt klar gemacht haben.<br />
Stand-<br />
Doch zurück zur Lenzhüttenau und weiter über den Spritzbrunnenrain<br />
ins Pfaffentai mit dem Großen und dem Kleinen<br />
Hohlen Felsen. <strong>Der</strong> erstere ist vermauert worden und<br />
bietet samt Umgebung einen schlechten Anblick. Weiter südlich,<br />
wo rechts der Schwenninger Weg abzweigt, liegen gegenüber<br />
kahle zerschossene Hügel mit Artillerieatrappen<br />
obenauf. Sonst aber mußte ich mich Iber den verhältnismäßig<br />
guten Eindruck, den die ausgedehnten T men- uad<br />
Buchenwälder boten, wundern. Von den rund 2000 ha<br />
Wald des Truppenübungsplatzes gehörten etwa 500 ha der<br />
Stadt Ebingen; die Nutznießung dieses enormen Forstbestandes<br />
haben die Stadtväter 1912 ieider nicht ausbedungen.<br />
Doch ich wollte ja liebe Erinnerungen nur wecken. Hatten<br />
nicht dort am Rain des Wa 1 dran des auf steinigem Grund die<br />
seltenen, gelben Enziane sich einmalig schön in Kraft und<br />
Schönheit erhoben? Dort fand ich keinr mehr, aber spät<br />
abends noch in einem verschwiegenen Nebentäichen, Meß=<br />
Stetten zu, gewahrte ich mit stiller Freude vor dunklem<br />
Waldgrund die leuchtendgelben Blütenst~Tie in ihren etagenförmig<br />
angeordneten, großen Blattschalen an stolzen, einmeterhohen<br />
Stengeln der Enzianpfianzen.<br />
Die Florabetrachtung will ich unterbrechen, denn meine<br />
Schritte wenden sich entschieden dem südlichsten Punkte<br />
der großen, auffallend tief in den Heuberg hineingreifenden<br />
Ebinger Markung zu. Dort unter jener zerfetzten, kahlen<br />
Birke neben dem Weg angesichts der zerschossenen Hügel<br />
fand ich „ihn". Etwas müde eingesunken, auch etwas mitgenommen,<br />
kam er mir vor — er, des Heubergs klassischer<br />
Markungsstein, der einzige, der es zu einem<br />
eigenen Namen gebracht hat: „Dreibannmarke n".<br />
1604 nennt er als Geburtstag, aber daneben steht noch ein<br />
spitzer Stein, der 1715 ausdrücklich erwähnt ist und sicner<br />
den älteren, ursprünglichen, den „Vater" des jetzigen darstellt.<br />
<strong>Der</strong> „Sohn *st Markungsstein für vier Gemeinden:<br />
Nach SO für Frohnstetten (wieder mit dem Westerstetter<br />
Wappen), nach NO für Ebingen, nach NW für<br />
Meßstetten und nach SW für Stetten a. k. M. unter<br />
der Herrschaft der Fugger (H). Die Ziffer I, auf 3 Seiten<br />
sichtbar, ist die 1604 angegebene Nummer des Steins gewesen,<br />
die Buchstaben AP sind in jüngster Zeit durch die<br />
Artillerie beigefügt worden. Warum aber soricht die Ueberlieferung<br />
nicht von „Vierbannmarken"? Wir wissen nichts<br />
Genaues; der Ort hat seine dunklen Geheimnisse. Heute<br />
liegt er z'üdem für die vier einst anstoßenden Gemeinden<br />
in der Bannmeile des Niemandlandes. So<br />
nehme ich nicht unbekümmert Abschied<br />
von dein Alten am Wege nach Schwenningen<br />
über dem Pfaffental, woher die Granateinschläge<br />
dröhnen.<br />
Die ersten Sterne blinkten hoch oben,<br />
Schafherden blökten verschlafen im Pferch<br />
unten im kühlen Grunde, als ich mich wieder<br />
den Wacholder- und Traufbuchenhügeln<br />
des Ehestetter Berges näherte. Zur<br />
Rechten träumte schon hinter der Heidesenkung<br />
der kleine Hain mit seinen knorrigen,<br />
niederen Föhren im luftigen, lustigen<br />
Plänterbestand. Weithin durch die Abendlandschaft<br />
ergoß sich widerhallend das dunkelgründige,<br />
volltönende, mitunter rollende,<br />
manchmal zwitschernde, farbig aufschwingende,<br />
süß abklingende Liebeslied eines —<br />
Tieres, ja, gewiß, einer bl. unlich gesprenkelten<br />
Wacholderdrossel. Es wird schummrig,<br />
die Töne ersterben, die Heidelandschaft<br />
fällt in ihren leichten Schlaf. „Wie<br />
köstlich bist du, schlafende Heide, du<br />
nichtalternde Zwölftausend - JahreI Alte"<br />
schwärmte ich begeistert, „wie preise ich<br />
deine materielle, industrielle — Nichtsnutzigke<br />
; t!" Die Konturen verschwammen,<br />
ein helles Band, die Ringstraße am Rande<br />
'.es Truppenübungsplatzes, geisterte daher.<br />
Eben wollte ich „Du ewig junge Unberührte!"<br />
flöten, da trat im Dunkeln mir<br />
wohl Ares ir den Weg und ließ mich stolpern<br />
— es hatte hell geklungen und etwas<br />
rollte von dannen. Schnell machte ich einige<br />
Sätze nach vorn — es war nicht nötig gewesen,<br />
keine Detonation folgte, aber<br />
Schweiß war auf meine Stirne getreten.<br />
Hinter mir ag es wie ein Gekicher in der<br />
*** d l »<br />
Luft... „Von wegen nichtsnutzige Jung-
Jahrgang 1955 HOHENZOLLEHISCHEHEIMAT 41<br />
frau! Du Schafskopf! Weder das eine noch das andere! Haha!"<br />
Wie ich gleich darauf die Ringstraße und den Schlagbaum<br />
hinter mir hatte, faßte ich mich schnell wieder.<br />
Gar nicht müde und zufrieden mit meiner sonntäglichen<br />
Suche nach markanten Steinen auf dem geliebten Berg im<br />
IL Teil<br />
Wer war der Baumeister der St.<br />
Als Baumeister der schönsten und edelsten Rokokirche<br />
Hohenzollerns wird in allen einschlägigen Quellenwerken<br />
der berühmte Münchner Baumeister: Johann Michael Fischer<br />
genannt. (Vgl. Laur, Kunstdenkmäler der Stadt Haigerloch,<br />
Stuttgart 1913, Hodler, Geschichte des Oberamts<br />
Haigerloch 1928, sowie Genzmer, Kunstdenkmäler Hohenzollerns,<br />
Bd. I Hechingen, 1939.)<br />
In der Einleitung zu den Kunstdenkmälern, Seite 21 heißt<br />
es sogar: „Mit größerer Sicherheit ist die Urheberschaft Johann<br />
Michael Fischer bei der St. Annakirche in Haigerloch<br />
verbürgt." In anderen Quellenwerken lesen wir, daß Johann<br />
Michael Fischer mündlicher Ueb er lieferung zufolge der<br />
Baumeister von St. Anna gewesen sei. Landeskonservator<br />
Genzmer betont besonders die starke stilistische Verwandtschaft<br />
der Haigerlocher St. Annakirche mit der Zwiefalter<br />
Klosterkirche hinsichtlich der Raum- und Fenstergestaltung<br />
und ist der festen Ueberzeugung, daß der leitende Bau=<br />
meister nur Michael Fischer gewesen sein kann. Ohne gegen<br />
die stilkritische Zuweisung an Michael Fischer Sturm laufen<br />
zu wollen, muß doch darauf hingewiesen werden, daß<br />
kein einziges Dokument bisher gefunden werden konnte,<br />
welches die Zuweisung der Autorschaft an Michael Fischer<br />
quellenmäßig belegt.<br />
Diesen archivalischen Beleg für die stilkritische Zuweisung<br />
an Michael Fischer zu finden, wäre eine lohnende Auf-<br />
•gabe. Bei allen ausgiebigen Recherchen in dem fast lückenlos<br />
erhaltenen Bestand der Haigerlocher Rentamtsrechnungen<br />
im Fürstlichen Archiv, habe ich keinen Hinweis auf<br />
Michael Fischer finden können.<br />
Dagegen begegnete mir bei Ordnungsarbeiten unter den<br />
Rechnungsbeilagen zur Geldrechnung der Herrschaft Haigerloch<br />
ein merkwürdiger Fascikel mit einer eigenhändigen<br />
Rechnungsstellung des Vorarlberger Baumeisters Tiberius<br />
Mosbrugger für den Fürsten Josef Friedrich, welcher mindestens<br />
ein Beteiligtsein des Vorarlberger, in Obermarchtal<br />
beheimateten Baumeisters Tiberius Mosbrugger bei der Erbauung<br />
der Haigerlocher St. Annakirche sicher vermuten läßt.<br />
Dieses Rechnungskonto soll in seinen wichtigsten Punkten<br />
veröffentlicht und zur Diskussion gestellt werden. Die gei<br />
mnre Aufstellung trägt den Titel: „Conto an Seiner Hochfürstlichen<br />
Durchlaucht zue Haigeriocn Anno 1768. Verzeiclinus,<br />
waß icl Endtsunterzogner vor Arbeiten und Taglohn<br />
von Anno 1754—1768 abverdienet, wie volgt".<br />
Mosbrugger sagt zunächst, der Fürst habe 1758 mit ihm<br />
eine Abrechnung vorgenommen über die Arbeiten seit 1754,<br />
und habe alle Arbeiten durchgesehen, und es habe sich gezeigt<br />
daß er noch 1 fl schuldig geblieben sei. Dann heißt es<br />
in lern Conto wörtlich weiter: „Von dar an habe ich an<br />
Zaichnungen und Modellen item Raisskösten und<br />
verdienet, wie volgt:<br />
Taglohn<br />
Vor das gibsene Modell von St. J'.nna 30 fl<br />
Vor den Riss zue dem Gebeu St. Anna 20 fl<br />
Vor den Haubtplan, grundt und Aufriss auch<br />
Durchschnitt St r ä 36 fl<br />
Vor 'ie Cupp I Modell, von Zimmermanns arbeithen<br />
sambt Dachstill rissen 25 fl<br />
175R in 3 mai.en 18 Tag ä li/2 fl 27 fl<br />
Vor arei tvc' >sen " 15 fl<br />
1756, H "-n 8. November 5 Tag 7,30 fl<br />
Vor 3Te "aiss 5 fl<br />
Vor den haupt grundt riß sar bt faciata und<br />
lurchschnitt vom neuen Sohlt [5 40 fl<br />
Vor das Modell vom neuen Schloß sambt dene<br />
Raissk'isten 50 fl<br />
1759, den 4. „pril C ''ag samt), der Raiss 14 fl<br />
den 5. OktC ris, 5 Tag sambt der 1 jiss 12,30 fl<br />
Vor unterschidliche Za chnungen auf dene baubläz<br />
vor Maurer, Zimmerleute und steinhauer 27 fl<br />
Es folgen in dem Manuskript unter 1760/61 eingetragen weitere Reisen.<br />
Zum ihr 1761 ist in dem Conto vermerkt:<br />
„Vor das Cuppel-Modell dem Moller nachher<br />
Sigmaring i sambt dene Raisskösten<br />
Vor den Schloß riß zu Langenenslingen<br />
Vor den Riß zum Jägerhaus<br />
Meine Ma rer an dero Hofkapellen: Franz Mayer<br />
20 Tag ä 18 Kreuzer<br />
Fidely Na° old 15 Tag ä 16 kr<br />
1762 zue Haigerloc'_ den 28. Juni, 9 ag sambt der<br />
Raiß vor da- Provill der Faciata und P genwerk"<br />
Es folgen 1763 G4 weitere Reisen. Noch 1765 notiert<br />
Viosbrugger „den 28. Juni 5 Tag sambt der Raiss<br />
24<br />
20<br />
10<br />
6<br />
4<br />
15<br />
fl<br />
fl<br />
fl<br />
fl<br />
fl<br />
fl<br />
vor die Archütecttur riss vom anderen durchfartssall" 10 fl<br />
Süden Ebingens kam ich im Tal zu Hause an, machte später<br />
nach Norden eine ähnliche Exkursion, wovon Nr. 4) der Zeichnung<br />
mit dem 1705 gesetzten Stein an der Truchtelfinger<br />
Markung oben am Felsentrauf nördlich vom Waldheim ein<br />
Beispiel gibt. Ernst Louis Beck.<br />
Anna-Kirche in Haigerloch?<br />
Unter 1766 ist notiert:<br />
Vor den bedeckten Bruckhen riss 30 fl<br />
1767 ist notiert:<br />
„Vor Bogenstellungs und gesimbs lehren" 10 fl<br />
Das Gesamtconto von Mosbruggers eigner Hand beläuft<br />
sich auf 782 fl, eine für damalige Zeit erkleckliche Summe.<br />
Im Jahre 1768 ist der Fürst Josef Friedrich Mosbrugger<br />
noch 317 fl schuldig und macht auf dem Rechnungsconto den<br />
eigenhändigen Vermerk:<br />
Zu mehrerer Sicherhait Ends-underschribenen Baumeisters<br />
Tiberi Mosbrugger haben Wür eigenhändig annoch bey=<br />
setzen sollen, das, da Wür alle ohne Underschied der person<br />
sterblich und übermächtig, so fern Gott Uns von diser Weltt<br />
abfordern solte und annoch ahn disem aussstand etwas zu<br />
bezahlen seyn solte Unser Erbprintz Solches abzufiehren<br />
verbunden seyn solle.<br />
Haigerloch den 21. Februar<br />
gez.<br />
Joseph Friedrich<br />
Fürst zu H'Zollern.<br />
Fürst Joseph Friedrich ist das Jahr darauf in Haigerloch<br />
gestorben. Im Jahre 1771 sind lt. Bescheinigung Mosbruggers<br />
sämtliche Schulden beglichen.<br />
Soweit die wortgetreuen Auszüge aus diesem Rechnungssconto<br />
des Baumeisters Mosbruggers für den Fürsten Josef<br />
Friedrich. Es ergibt sich nun die wichtige Frage, wie man die<br />
Bedeutung dieses Beschäftigtseins Mosbruggers für den Fürsten<br />
Josef Friedrich seit dem Jahre 1754 einschätzt. Die<br />
größte Schwierigkeit in der Bewertung des Dokuments besteht<br />
darin, daß Mosbrugger in der Einleitung zu dem Rechnungssconto<br />
sagt, der Fürst habe mit ihm über die Leistungen<br />
von 1754 an im Jahre 1758 abgerechnet und es sei ein Gulden<br />
Rest verblieben. Die Arbeiten an St. Anna, die Mosbrugger<br />
dann im nachfolgenden aufführt, allerdings ohne<br />
Datum, müssen doch auch vor der Abrechnung im Jahre<br />
1758 gelegen haben, als die St. Annakirche am 26. Juli 1757<br />
benediciert wurde Eines wird man mit Sicherheit aus dem<br />
Conto entnehmen müssen, daß Mosbrugger neben Großbayer<br />
laufend an St. Anna und später bei anderen Bauwerken<br />
für den Fürsten Josef Friedrich beschäftigt war. Zu denken<br />
gibt einem auch immerhin der Eintrag, daß Mosbrugger für<br />
den Maler von Sigrnaringen, Meinrad von Aw das Kuppelmoacll<br />
für seine Malerarbeit verfertigt hat.<br />
Gewiß wird man Mosbrugger seinen sonstigen Bauten zufolge<br />
wie an dem Konveritflügel in Obermarcntal nicht unter<br />
die Großen der Vorarlberger Baumeister einreinen können.<br />
Aber Mosbrugger muß doch ein besonderes Vertrauen<br />
des Fürsten Josef Friedrich besessen haben weicher übrigens<br />
in der Auswahl der beschäftigten Künstler sehr wählerisch<br />
war. Aus dem Rechnungsskonto geht hervor, daß<br />
Mosbrugger nicht nur an dem Bau vo. • St. Anna, sondern<br />
auch am Haigerlocher Schloß, bei dem Jägerhaus in Josefslust<br />
und dem Schloß m Langenenslingen beschäftigt wurde.<br />
Wir haben ja in der Melchinger Pfarrkirche, welche nach<br />
dem Riß von Mosbrugger in den Jahren 1767—19 unter 1er<br />
Bauleitung von Großbayer gebaut wurde, eine Leistung Mos=<br />
bruggers vor uns, weiche allerdings mit dem Bau von St.<br />
Anna wohl kaum einen Vergleich zuläßt<br />
In einem neuerdings im Fürstlichen Archiv aufgefundenen<br />
Verzeichnis von Ausgaben der Haigerlocher Rentei für das<br />
Jahr 1759/60 begegnet uns der hochinteressante Eintrag:<br />
„Herrn Mosbrugger zu einem ganzen Kleith laut Spezii'ication<br />
51 fl 50 kr und für einen Hut 2 fl 30 kr. Für die Summe<br />
von 51 fl bekam man Mitte des 18. Jahrhunderts sicherlich<br />
ein sehr senönes Kleid, ein Ehrenkleid. In demselben Verzeichnis<br />
sind auch Kosten notiert fü" eine Reise des Fürsten<br />
Josef Friedrich vom Jahre 1760, die über Gammertingen<br />
nach Zwiefalten und Obermarchtal führte. In Obermarchtal<br />
war Tiberius Mosbrugger ansäßig und hat auch dort an<br />
dem Konventbau gearbeitet. Er ist dort geboren am 3. V.<br />
1727 als Sohn des Josef Mosbruggers und ist am 6. X. 1799<br />
in Obermarchtal gestorben. Mosbrugger war 2 mal verheiratet,<br />
aus beiden Ehen stammten keine Kinder. (Lt. Mitteilung<br />
des kath. Pfarramts von Obermarchtal.)
42 HOHENZOl.LISRISuHB HEIMAT Jahrgang 1955<br />
Es ist sehr zu bedauern, daß sieh von dem Bau der St.<br />
Annakirche keine geschlossene Baurechnung erhalten hat,<br />
wie wir dies von der Stiftskirche in Hechingen haben. Die<br />
Ausgaben für den Bau sind aus lauter Einzelposten aus den<br />
Jahrgängen der Haigerlocher Renteirechnung zusammenzusuchen.<br />
So werden 212 Malter Kalk von dem Ziegler Augustin<br />
Stifel in Owingen bezogen, weitere 328 Malter von<br />
dem Ziegler Johannes Kleindienst zu Empfingen. 16 600 Ziegel<br />
zur St. Annakirche wurden geliefert von Augustin Stifel<br />
in Owingen und weitere 15 000 gebackene Steine von dem<br />
Ziegler Christian Kleindienst in Haigerloch. In der Renteirechnung<br />
1757/58 sind erst die Ausgaben vermerkt für 23 t /a<br />
Faß Gips, welche zur Ausmalung der Annakirche benötigt<br />
wurden. Alle diese Posten wurden von der Rentei einzeln<br />
bezahlt wie auch die erhaltenen Rechnungen des Bildhauers<br />
Johann Georg Weckenmann.<br />
Nicht nur ein Lehr / sondern auch ein Bitt-Haus ist dieser<br />
herrliche Heiliger Annä zu Ehren erbaute Ort.<br />
Es ist wahr / daß man niemahlen / als durch d Mißhandlung<br />
der Gebotten / aus Gottes Gnad falle. Es ist aber<br />
auch gewis T daß man zu selber nirgends ehender als in<br />
Kirchen / und Gottes-Häuseren; durch nichts hurtiger / dann<br />
durch die Fürbitt der Heiligen zuruck schreiten kann. Sollte<br />
ein Sünder den Schaden erkennen / so ihme die Widerspenstigkeit<br />
Gott zu gehorchen zugezogen / wurde er sicherlich in<br />
ein helleres Zetter-Geschrey / als Esau bei Verlust der Erst-<br />
Geburt ausbrechen / und in einen heftigeren Thränen-Guß<br />
zerfließen / als David, da ihme die Amaleciter die Stadt Siceleg<br />
abgebrennet haben.<br />
Schöner Himmel! ein ewiger Genuß bist du allen / und<br />
jeden / welche den Gebotten Gottes nachzuleben sich beeiferen.<br />
Peynliches Hol] i-Teich! ein ewiger Qualen-Kerker bist<br />
du allen und jeden / welche selben zuwider handien. Christi<br />
Wort lassen sich nicht änderen. Willst du zum Leben eingehen<br />
J so halte die Gebott. Nicht allen / die mir sagen Herr!<br />
Herr! steht das Land der Seligen offen. Jenen allein ist der<br />
Eintritt gestattet 7 welchen es beliebt dem Willen meines<br />
Vaters nachzuleben. Wie viele lassen sich antreffen / die Gottes<br />
Verordnungen so wenig / als den Alcoran der Saracenen /<br />
den Talmud der Rabbiner / den Foquexus des Heydnischan<br />
Japons, oder den Confutius der Chineseren achten. Wie<br />
schlecht ehret -ian den Allerhöchsten; und wie schwach ist<br />
der Glauben 7*"ds sich dessen heut zu Tag viele als einer<br />
Larven >edienen / um von dem. Umgang mit Christen nicht<br />
ausgeschlossen zu werden. Wie lau ist die Liebe des Vollkomrr<br />
nsten Guts in den meisten Herzen. / daß sie wie das<br />
geheiligte Feuer der Hebräer in den Jahren des Babylonischen<br />
Jochs zu Wasser worden; und wie gering ist die Hoffnung<br />
auf den Allmächtigen / ; ndeme man in Noth I und Bedra-Sinussen<br />
ehender dem Gözen zu Accaron mit Ochozia,<br />
als dem lebendigen Gott in Israel zulauft; und mit größerer<br />
Zuversicht mit Saul in zweifelhaften Umständen bey einer<br />
rußigen Gabi-Prophetin ',u Endor, als bey dem Allwissenden<br />
sich Raths erhollet. Ist der anbei: ans-würdige Namen Gottes<br />
nicht durchgehends also verächtlich C daß man ihne zum<br />
Schauder der Höllen / und zur Betrübnuß der lieben Englen<br />
wie einen HE q er unter den Füßen herumziehet? Ist der<br />
Christliche Sabbat den Sonntag samt den Feyertägen verstehe<br />
ich / nicht aller Andacht beraubt? wendet man diese<br />
dem Gottes-Dienst allein gewiedmete Zeit / da Lamnen in<br />
den Templen / Wax-Toirschen auf den Altären brinnen / nicht<br />
zu den verächtlichen Werken der Finsternüssen an? was<br />
Ehrfurcht tragt ma' für die Eiteren / welche doch der zärtlichste<br />
*(ntheil der Natur eines Menschen seynd; welche nicht<br />
lieben / Seneca lediglich bey dem Stoischen Licht eine Gott-<br />
I isigkeit / nicht erkennen eine Tobsucht nennet ! ist nicht<br />
der größte fheil der Kinderen wie die Viperen(T die ihrar<br />
Mutter in der Geburt den Leib zerreissen; oder gleichen sie<br />
nicht denen Motten / welche die Wolie anbeissen [ aus welcher<br />
sie herstammen? Schonet m^n dem theuren Mensehen-<br />
"Rlut; schmieden doch Zomß Haß i und Neid drey wohl bekannte<br />
Cycloren / Schwerder / und Donner-Keile. Den Weltberuffeiien<br />
Gebott-Sechser wechselt man alle Augenblick<br />
räch belieben. Sünden / so darwider gehen / streicht man das<br />
elende Färblein menscnlicher Schwachheit / oder den Fürniß<br />
einer Gesundheits-Beförderung an. Das kranke Herz wird<br />
von der fallende Seuche böser Gewohnheit in dem Schlamm<br />
garstiger Begierden umgewelzet: und findet man zur Augenweyde<br />
nichts mehr / als Dinge / welche zur bösen Lust<br />
reitzen. Wie viele setzen sich mit Anrühmung ihrer Schand-<br />
Unsere Absicht der Veröffentlichung des Mosbruggerschen<br />
Rechnungskontos im Jahre des 200jährigen Jubiläums der<br />
Einweihung der St. Annakirche geht lediglich dahin, die<br />
Aufmerksamkeit darauf zu lenken, daß Tiberius Mosbrugger<br />
an dem Bau der St. Annakirche in Haigerloch nicht unmaßgeblich<br />
beteiligt war. Es sei damit nicht behauptet, daß<br />
die künstlerische Conception des Baues der St. Annakirche<br />
von Mosbrugger stammen muß, da er ja wohl nur als ein<br />
Baumeister von mittlerem Rang angesprochen werden kann.<br />
Aber man kommt an diesem Conto nicht herum, und wie<br />
man es auch immer bewertet, so ist es eben doch vorhanden<br />
und regt zum Nachdenken und Weiterforschen an. Für die<br />
Autorschaft Michael Fischers, so verlockend die Zuweisung<br />
der St. Annakirche an den großen Barockbaumeister sein<br />
mag, gibt es bis jetzt keinen archivalischen Beleg.<br />
Dr. Johs. Maier.<br />
200 Jahre St. Annakirche in Haigerloch<br />
von M. Guide, Stadtpfarrer<br />
1. Forts.<br />
Thaten wie der Wiedhopf in deft, Morast noch einen Buschen<br />
auf den Kopf. Falsche Anklagen /' und grobe Verleumdungen<br />
seynd so rar / als die Mucken-Stich in den Sommer-Tägen;<br />
und zehlet man ja der Ehrabschneideren eben so viel als<br />
Schnacken / und Frösche in Aegypten zu Moysis Zeiten.<br />
Raub r und Diebstahl fangen an eine Meße^oder Jahrmarkt<br />
zu machen. Lange Finger greifen nach dem fremden Gut /<br />
wie die Harpyien bei Virgilio in die Speisen der Trojaner.<br />
Abscheulichkeiten seynd diese / wider welche Gottes Gerechtigkeit<br />
die unauslöschliche Flammen angeschafft / die<br />
Geschöpfe aufgebotten ¿Krankheiten / und Unglük abgelassen.<br />
Weh! den Verbrecheren^ wann die Ruthen niemand in<br />
Palm-Zweige; und die Keile m Olivien-Aest umwechselt. Es<br />
ist zwar Gott von selbsten zur Barmherzigkeit geneigt. <strong>Der</strong><br />
große Welt-Ring wurde sonders Zweifl vorlängsten in Trimmer<br />
zerschnellet seyn / wann die Barmherzigkeit dem Zorn<br />
kein Ziel gestecket hätte: und wurden sicherlich die Straffen<br />
nach den Worten Valerii des heiligen Bischofen noch nicht zu<br />
Ende gegangen seyn *wann Christus dem blutigen Gesätze<br />
das Oel der Erbarmungen nicht angesprengt hätte. Die<br />
edelste der Gottes-Künsten ist diesej daß er dem Beleydiger<br />
seiner Majestät verschonen kann f und auch will. Er vergibt<br />
dem Sünder seinen Frevl / wann er noch in dem Harnisch<br />
ist; und so fern ein solcher von ihme zu seyn scheinet / bauet<br />
er ihme / wie Augustinus redet / eine Brucken £ um den<br />
Zuruckgang zu erleichteren. Seine Milde erstreckt sich oft<br />
auf jene / welche nach Art rasender Kranken die Arzney-<br />
Schaalen ausschütten / und den Ärzten verletzen / das ist /<br />
von selber nichts wissen wollen. Eine Barmherzigkeit von<br />
Gott ist es / daß Er ihne aus der Sünd / und dero Folgen<br />
herausziehet.<br />
Alles dieses l.eydet keiner Wiederspruch / jedoch stellt<br />
er sich nicht seiter unversöhnlich 7 bis der Sünder einen Fürbitter<br />
findet J"welcher / wie Moyses auf dem Sina, dem aufgebrachten<br />
Zorn in die Aerme fallet. Ich habe da keine<br />
Ketzer vor mir / welchen ich mir Erweisung dieser Wahrheit<br />
auf die Fersen trette. Wir Catholische gestehen alle / daß die<br />
Heilige Gottes unsere Bedürfnußen erkennen / und als Fürsprecher<br />
ihnen entgeger können.<br />
Mir seye aber erlaubt / auch dieses hinzu zuthun rdaß diejenige<br />
hierin allemahl mehr Gewalt haben / welche näher an<br />
die Biuts-Freundschaft Christi gerucket seynd.<br />
Freunde / die Tan sich wählet 2 und Freunde [, die von<br />
Natur dazu geschnizelt worden / seynd nicht eines. In deme<br />
S daß wir sie als Vertraute lieben / haben sie viele Achnlichkeit,;<br />
erfüllen aber die letztere ihre Schuldigkeit / können<br />
sie von uns billig den Rang forderen. Das Herz folget dem<br />
Geblüte / welches von einer Quell zugeflossen. Sayten von<br />
einem Scnaaf betragen sich freundlicher auf einer Lauten;<br />
und Bäche von einem Ursprung vereinigen bälder ihre Gewässer<br />
in einem Rinn-Saal. Fin Biuts-Freund siehet in dem<br />
anderen etwas / so niemand / als ein Unmensch ^zerstöhren<br />
kann; wie wir von einem Cain, Esau, den Jacobs Söhnen<br />
und endlich auch von einem Nero wißen. Die Wind sehen<br />
wir gegeneinander kämpfen £da sie doch Gescnwistere aus<br />
einer Kruft in Acolien seyn sollen / und haben es die Meer-<br />
Wellen schon hergebracht, daß sie Kinder einer See sich gegen<br />
einander zerschlagen. Blut ist nicht Wasser gj sagen wir<br />
in dem Kern-Spruch, Es ist ein Gesuch der Natur H daß wir<br />
jenen mehrer geneigt seyenj/ 1 und ihrem Anbringen willfähriger<br />
beytretten / welche an unserem Stammen-Baum gewachsen.<br />
Sehen wir nicht / daß die Früchten eines Baums<br />
die Zeitigung unter sich beschleunigen Tjand wann alle zumahl<br />
nach dem Stammen 7 und Wurzel sehen zLsoHen wir
Jahrgang 1955<br />
HOHERZOLLEEISCHBHEIMAT<br />
fassen unsere Erkanntlichkeit dorten in aller Vollkommenheit<br />
ruchbar zu machen / wann die Freunde uns an Jahren übergehen<br />
/ und in der Reihe der Voreltern stehen. Diesen haben<br />
wir wenigist mittelbar das Leben zu danken / und behalten<br />
sie allemahl das Vorrecht ihrer Bitte mit der Art eines<br />
Gebotts zu versieglen. Wer kann laugnen / äaß Jaooib dem<br />
Patriarchen vom Joseph seinem Sohn / als er den anderen<br />
Purpur in Aegypten getragen / jede Bitt gewähret worden?<br />
und wann auch Rebecca seine Groß-Mutter noch gelebt hätte<br />
/' was Gnaden wurde sie vor anderen nicht erhalten haben?<br />
Wer weißt nicht / was Salomon auf seinem Thron Bethsabee<br />
seiner Mutter / und vielleicht auch Eliam seinem Groß-Vater<br />
zugesagt? und wer darf zweifeln / laß Mardochaeus bey<br />
Edissa, oder Ester seiner Enkelin in allen Anträgen seye erhöret<br />
worden.<br />
Glück ist dir zu wünschen große Mutter heilige Anna. <strong>Der</strong><br />
Namen einer Ahnfrauen des Sohnes Gottes / der Titl einer<br />
Mutter der Gebährerin Jesu erheben dich nicht zu einer<br />
Herrlichkeit / auf dero Stuffen keine auch gecrönte Frauen<br />
gestiegen ist. Die nahe Pflegung / der vertrauliche Umgang /<br />
die enge Sippschaft / so du mit Christo auf der Welt gehabt /<br />
seynd Ursach daß er als dein Enkel dein Für-Wort in dem<br />
Himmel für uns Sünder, vor anderen anhöret,<br />
Wohlgewis / Hochansehnliche! A n n a ist die Groß-Mutter /<br />
die Mit-Stifterin unseres prächtigen Catholischen Christenthums.<br />
Wer in dem alten Bund etwas von Gott erbitten<br />
wollte / gebrauchte sich gemeiniglich der Worten: Gott Abrahams,<br />
Gott Isaacs, Gott Jacobs. Diese Männer waren noch<br />
ferne Stammen-Väter / und Geschlecht-Stifter Jesu Christi.<br />
Mit etwas größerem Recht mögen wir ein gleiches hoffen /<br />
wann wir heilige Annam zu einer An waldin in dem. Him:nel<br />
bestellen / welche durch ihre unvergleichliche Tochter nächstens<br />
an den Messias gekommen. Sie ist nicht in der Behaltnuß<br />
der Vorhölle wohnhaft / wie angezogne Groß-Väter des<br />
Judenthums damahls waren t sonder sie sitzet in dem Licht<br />
ewiger Glori in dem vollkommenen Genuß der Anschauung<br />
Gottes. Große / und sichere Zuversicht^ die wir auf die<br />
Fürbitt Annä die Barmherzigkeit Gottes zu erhalten setzen<br />
können.<br />
Wir haben dessen ein Gezeugnuß aus den vergangenen<br />
Jahrs-Zeiten. So weit der Christen Nam in die Welt ausgeflogen<br />
/ wäre auch die Verehrung heiliger Annä bekannt.<br />
Männiglich suchte unter ihrem Schutz-Mantel wider alles<br />
Unheil eine Sicherheit. Zeugen dessen / so viele Tempi /<br />
welche zu Ehren dieser Gnaden-Mutter erbauet worden. Gregorius<br />
der dreyzehende versicheret mit Päbstlichen Worten /'<br />
daß sie schon von dem ersten Christenthum zu Hilff / und<br />
Trost in besonders hierzu aufgestellten Bett-Häuseren geruffen<br />
worden. Radzivil, und Charesme bey den Fortsetzeren<br />
Bollandi, welcher sich mit einem einzigen Blatt seines unverbeßerlichen<br />
Werks von den Heiligen Gottes mehrer Ehre gemacht<br />
/ als alle Ketzerische Kiügling mit einer halben Welt<br />
.loll ihrer Schriften sich immer erwerben könnend erweisen jk<br />
daß zu Ehren Annä schon in dem Palästiner-Land Kirchen<br />
zu finden gewesen. Kayser .Tustinianus beschenkte sie '[ wie<br />
Procopius schreibet / mit einem herrlichen Tempi zu Cons<br />
tantinopel / und daß Basilius cm anderer Kayser selben wieder<br />
erneueret /sagt uns Cedrenus Das vor Zeiten so gut<br />
Christliche Gräcien hielte Jährlich drey Fest-Täg zu Ehren<br />
Annä. Den ersten bestimmte es ihrer Empfängnuß; den anderen<br />
ihrer Vermählung; den dritten ihrer Entschlafung<br />
Wandere nan durch den Catholischen Occident, Frankreich L<br />
Spau.'en / Portugall } Welschland / Flandern / Ungarn und<br />
endlich unser liebes Schwaben: was eine Menge der Kirchen /<br />
und Capellen werden sich finden lassen / in welchem das<br />
andächtige Christen-Volk vor den Bildnußen Annä sein Gebett<br />
zinset.<br />
Wie viele auch aus hohem Adl J wiedmen ihr alle Wochen<br />
den Zinstag. Wie glüksehg schätzen sich Königreiche J Provinzen<br />
/ und Städte von dem Leib dieser heiligen Groß-<br />
Mutter einen Theil / oder doch nur einen Bein-/Splitter zu<br />
besitzen. Von ihrem heiligen HauptV oder besser zu reden /<br />
dessen Theilen rühmen sich die Städte Apt in Provence, Düren<br />
in dem Herzogthum Jülich ? Chartre in der Landschaft<br />
68. iarnhau. Walddistrikt im Südosten der Markung.<br />
Das Wort Garn wurde früher und wird heute noch in der Jäger-<br />
und Fischersprache für Netz gebraucht.<br />
69. Gas';enäcker*. Lagen nördlich vom Brenzkoferberg<br />
beim Schererweg.<br />
70. G a u s e 1 i s Wies. <strong>Der</strong> Name dieser Wiese, welche in<br />
Beauce. Cöln erfreuet sich von ihr einen Finger zu haben P<br />
welcher noch mit Fleisch gedeckt seyn solle. Rom hat ihren<br />
Braut-Ring samt dem Daumen in die Kirchen-Schätze hinterlegt.<br />
Bellen nun die Widersacher unserer Kirche gegen die Verehrung<br />
der Heiligen Gebeine. Lästeren sie uns als Thorrechte<br />
^und Abgötter / die wir selber in Gold und Silber<br />
einfassen. Legen sie uns eine Dummheit zur Last / daß wir<br />
uns von selben eine Hilfe versprechen. Nicht nur der wunderthätige<br />
Schatten Petri verfinsteret ihre eingebildete Erleuchtung<br />
in Glaubens Wahrheiten / nicht nur die Gürtl Pauli<br />
schleuderet ihnen Stein' f und Kiesel an die Stirne. Nicht nur<br />
Gregorius der Nazainzener, schlägt ihnen ein Schloß an das<br />
freche Maul.7" wann er den Gebeineren der Gottes-Dieneren<br />
so viele Kraft in ihren Sorgen / als ihren Seelen in dem<br />
Himmel zugibt. Nicht nur der alte Theodoretus macht sie zu<br />
Schanden / welcher der Länge t und Breite nach uns berichtet<br />
P mit was Fleiße die erste Glaubige die Leiber der Heiligen<br />
öfters nicht in den Catacumben beygesetzt / sondern<br />
durch Städte / und Dörfer ausgetheilt haben: sonder Anna<br />
unser heilige Mutter fertiget sie in das Land der Lugneren /<br />
ja in die Provinz der Arcadischen Renn-Thieren / von deren<br />
einem Samson ein Kien-Beine genommen / und mit selbem<br />
nicht nur die Philistaeische Schaaren erlegt / sonder sich<br />
selbst aus diesem dürren Beine einen frischen Wasser-Trunk<br />
angeschaft hat. Dahin / sage ich K weiset sie Anna; damit sie<br />
lernen / wie Gott das ehrwürdige Geripp / und Leibs-Theile<br />
der Seinigen ehre / der dem todten Kiefer eines Thiers so<br />
große Vortheil verliehen.<br />
Und in der Sach selbsten / wie viele der Gutthaten geben<br />
uns nicht sichere Geschicht-Schreiber an die Hand / welche<br />
Gottes Barmherzigkeit durch die kostbare Ueberbieibseln<br />
heiliger Annä gewürket hat. Durch dero Betastungen die<br />
Blinde heitere Augen; die Taube gesunde Ohren; die P :sthafte<br />
Entledigung von ihren Wehetagen erhalten. Was Wunder<br />
/ da auch auf bloße Anruffung dieser Gnaden-Mutter das<br />
Anbegehrte erlangt worden; und Anna ihren Dieneren in dem<br />
Unheil wie die Sonne dem verfinsterten Mond zu Hilfe geeilet<br />
ist.<br />
<strong>Der</strong> Gnaden-Thron / dessen Gestalt Gott Moysis auf dem<br />
Berg gezeichnet hat / kann auch Muth machen. Das beste<br />
Goldblech mußte hierzu gebraucht werden; zween aus eben<br />
diesem Metall verfertigte Cherub waren der schöne Aufsatz<br />
zu beyden Seiten / so sich gegeneinander wenden sollten;<br />
und da verspräche Gott nach Vatabli Dollmetschung dem Sünder<br />
Verzeyhung; der Andacht ihre Würkung. Sünder! welche<br />
die Bosheit beynahe in wilde Tiere verkehret. Sünder! deren<br />
steinene Hartnäckigkeit sich noch von Thau / noch von Regen<br />
verbesseren läßt. Sünder! welchen die böse Gewohnheit zu<br />
einer Natur; die sündliche Gelegenheit zu Feßeln geworden.<br />
Sünder 1 deren Fuß-Sühlen schon in der glimmenden Asche<br />
der Höllen-Porten Stapfen eingetretten 7 und die Stirne bereits<br />
mit dem Zeichen der Bestien in heimiict er Offenbarung<br />
bemercket haben. Gehet / ach! gehet in das Haus eurer Muttern<br />
dorten wird euch Gott auf die Bitt Annä geben / was<br />
ihr in dem Morast eurer Bosheiten noch zu Nutzen der gebogenen<br />
Seele wünschen könnet.<br />
Zween Cherub zur Seiten / der Gnaden-Thron in der Mitte<br />
/ das ist / Jesus, und Maria auf den Aermen Annä erwarten<br />
euch. Gehet! ach gehet / was verweilet ihr euch Unselige!<br />
Jesus als der Erlöser der Sünderen / der Arzt der Kranken<br />
zur Rechten; Maria als die Zuflucht der Sünderen zur Linken<br />
seynd die / dero Willen Anna in der Mitte ais der Gnaden-Thron<br />
in Gewalt / und Vollmacht hat.<br />
Jener kleine Knab zu Rom in Zeit der Burgemeisteren<br />
machte sich groß. Er rühmte sich von seinem Gewalt über<br />
das ganze Wesen der sieben Bergen. Niemand konnte s begreifen<br />
öer erklärte sich aber also: Was mir beliebi / dieses<br />
tnut meine Mutter; und wie sie gesinnet ist / zu dem entschließt<br />
sich auch mein Vater: da nun unter dessen Beiel<br />
Hulz-Buschl der Burger in dem Friedenc-Rock; und der Soldat<br />
in dem Kriegs-Kleide sich neigen W ist der Zusammenhang<br />
ja ein Probe meines Ansehens. Schluß folgt.<br />
Flurnamen der Markung Sigmaringen<br />
von Dr. Alex F r i c k - Tettnang<br />
3. Fortsetzung<br />
der Nähe vom Bahnhof Hanfertal liegt, kommt wohl von<br />
einem Familiennamen her.<br />
71. Geisenberg. 1526 heißt es: „3 juchart lygen an dem<br />
Gayßenberger". Es ist die Haid*, welche südlich vom Hanfertal<br />
zwischen Donau und dem Weg nach Bingen liegt. Hier<br />
war die Ziegenweide, welche im Jahre 1680 auf Befehl des
44 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
Fürsten abgeschafft wurde. Ziegen durften nur noch von<br />
solchen Leuten gehalten werden, welche sich keine Kuh leisten<br />
konnten.<br />
72. Genglis Grab*. 1441: „3 juchart, die man nempt zu<br />
Genglis grab". 1658 heißt es „Emelges Grab" und im 18.<br />
Jahrhundert wurde daraus „Engelsgrab". Die Flur lag südlich<br />
des Laizer Kirchwegs, der heutigen Bergstraße. Es war<br />
schon lange bekannt, daß dort der Friedhof des alten Alamannendorfes<br />
Hedingen lag. Denn schon beim Bau vom<br />
Weinkeller Neil und des Hauses von Maler Lorch wurden<br />
Alamannengräber gefunden. Nun fand sich beim Bau des<br />
Hauses Herzog im Jahre 1951 in der deshalb genannten Alamannenstraße<br />
wieder einige Gräber. Vermutlich ging der<br />
Friedhof von Hedingen bis zur Höhe hinauf. Da in dieser<br />
Gegend die Flur „Genglis Grab" liegt, kann es sich hier<br />
wohl um ein besonders markantes Grab dieses Alamannenfriedhofes<br />
gehandelt haben.<br />
73. G e r e c k h a u *. Lag zwischen Gorheim und Laiz.<br />
74. Gerlingberg*. Kommt 1359 vor, Lage unbekannt.<br />
75. Glaseräcker. Die Felder südlich vom Gansbrunnen<br />
an der Jungnauer Straße. Vielleicht hatten dort die Glaser<br />
ein Stück Wald, wo sie das zu ihrem Beruf notwendige Holz<br />
holen konnten.<br />
76. Glashart*. <strong>Der</strong> Name kommt bis zum 16. Jahrh. vor<br />
und ist der alte Name für das Ziegelholz. Hart bezeichnet ursprünglich<br />
das große (die Feldmark umgebende) Waldgebiet<br />
eines Dorfes, das oft der gemeinschaftlichen Weide mehrerer<br />
Dörfer dient. Buck meint, daß es sich bei dem Namen Glashart<br />
um Stellen handelt, wo man viele Glasscherben als Ueberbleibsel<br />
einstiger Besiedlungen findet. Dort befanden sich<br />
viele Grabhügel aus der Hallstattzeit, von denen allerdings<br />
der größte Teil im 2. Weltkrieg eingeebnet wurden.<br />
77. Glückshafenacker*. 1791 wird ein Acker auf<br />
dem Tannenwäldle, der sogenannte Glückshafenacker genannt.<br />
Glückshäfele nennt man ein Unkraut, das Kornkästlein.<br />
Wenn es sich viel auf einem Acker findet, gibt es in<br />
diesem Jahre viel Korn.<br />
78. Gögginger Weiher. Liegt westlich vom Ablacher<br />
Weiher im Tierpark Josefslust.<br />
79. Gor heim. 1304: Gorhan, Habsb. Urb. Gorheim; 1359:<br />
Gorhain; 1701: Gohren. Gorheim war urspüngl. ein Dorf, jetzt<br />
Stadtteil von Sigmaringen. Die Orte auf -heim sind nach den<br />
-ingen Orten zu den ältesten Siedlungen der Alamannen zu<br />
rechnen. Ueber dem Dorfe Gorheim gründeten 1303 einige Sigmaringer<br />
Bürgerstöchter ein Tertiarinnenkloster. Dieses stand<br />
höher auf dem Berg als das jetzige Kloster. Die Orte auf -heim<br />
sind meistens auch mit einem Personennamen zusammengesetzt.<br />
Das Wort Gorheim dürfte wohl mit dem Namen Goro<br />
zusammengesetzt sein. Wie wir schon bei der Deutenau gesehen<br />
haben, kommen die Namen des Ortsgründers oft noch<br />
in einem Flurnamen vor. Auch der Name Goro kommt in<br />
der Flur Gorzland vor (siehe Nr. 85). Auch von Gorheim wissen<br />
wir nicht, wann das Dorf und seine Markung in Sigmaringen<br />
aufgegangen sind Schuld war wohl auch hier die<br />
allgemeine Landflucht im 14. Jahrhundert, vielleicht, auch die<br />
Pest, welche um die Mitte jenes Jahrhunderts stark wütete.<br />
80. Gorheimer Galgenwies*, Wiese beim Galgenbühl<br />
zu Gorheim.<br />
81. Gorheimer Garten. Die Flur zwischen Kloster<br />
Gorheim und der Kaserne.<br />
82. Gorheimer Grabenwies*. Lage unbekannt.<br />
83. Gorheimerhalde. <strong>Der</strong> Abhang über Goiheim.<br />
Hier stand im 14. Jahrhundert eine alte MichPelskapelle, bei<br />
weicher 1303 das Kloster gegründet wurde. Erst m Jahre<br />
1683 wurde der alte Teil des jetzigen Klosters, tiefer gegen<br />
die Straße zu angelegt. Michaelskapellen auf Bergen wurden<br />
sehr oft an Stelle von alten heidnischen Opferstätten erbaut.<br />
84. Gorheimertal*. Wohl die heutige Flur „Hinter<br />
Gorheim".<br />
85. Gorzland*. Urk. Gorheim 1350. „dritteil f ch. auf<br />
Miilegarden heißt das Gorzland". Mühlegerten ist der alte<br />
Name für den heutigen Gaigenbühl. Gorzland ist wohi aus<br />
Goros-Land entstanden; in dem Worte steckt ein Personenname<br />
Goro, der auch in dem Worte Gorheim steckt.<br />
86. Gräben. Flur zwischer Hohenkreuz und der Pfanne<br />
wird nach dem dort befindlichen Graben benannt. Dreser<br />
Graben heißt auch Römergraben.<br />
87. Grünsteig*. War 1511 ein Weg in der Nähe des<br />
Großwiesnofs.<br />
88. H a a g a c k e r *. Lag am Laizer Kirch weg iBergstr.),<br />
wo sich der sogenannte Schöne Haag befand. Die einzelnen<br />
Esche wurden durch Hecken oder künstliche Haage umgeben,<br />
um die Frucht vor dem Vieh zu schützen.<br />
89. Hasenacker*. Kommt 1359 vor; kommt vielleicht<br />
von dem Familienname Haas, der im Habsburger Urbar zu<br />
Laiz vorkommt.<br />
90. H a g e n w i e s *. Ein Wiesenstück auf den Käppeleswiesen<br />
lieferte das Futter für den Farren.<br />
91. Hanfertal. <strong>Der</strong> Name entstand erst im 19. Jahrhundert<br />
im Anschluß an die dortige Wirtschaft zum Pfauen<br />
(abgebrannt August 1911). <strong>Der</strong> ursprüngliche Name war<br />
Ampfertal, weil in den dortigen sumpfigen Wiesen viel<br />
Sauerampfer wuchs. Hanf wurde hier nie gepflanzt.<br />
92. Hasenriedle*. 1651 verkauft die Stadt Sigmaringen<br />
an das Kloster Inzigkofen den Wald im Hasenriedle.<br />
Es ist vermutlich Distr. 126, beim Oberjägerhaus, der jetzt<br />
Nonnenbirken heißt.<br />
93. Hasenriedsoppen. Walddistr. 133 östlich vom<br />
Göppinger Weiher. Sowohl das Wort Ried, wie auch Soppen<br />
bedeuten ein sumpfiges Gelände.<br />
94. H ä s h e n k e *. Wegen der Feuergefahr war innerhalb<br />
der Stadt das Waschen verboten und oft liest man in den<br />
Ratsprotokollen, daß eine Bürgerin bestraft wurde;„,weil sie<br />
eine Wasch im Haus gehabt hatte". Dafür stand seit alter<br />
Zeit hinter der Laizer Brücke beim Baur'schen Anwesen das<br />
städtische Waschhaus. Die Wiese dort, auf der die gewaschenen<br />
Kleider zum Trocknen aufgehängt wurden, hieß Häshenke.<br />
Häs ist das alte schwäbische Wort für Kleider.<br />
95. H ä u s 1 e h a u. Walddistr. 83 und 84 südlich vom Großwieshof.<br />
96. H e d i n g e n. Altes Dorf, dem Namen nach wohl die<br />
älteste Siedlung auf der heutigen Markung der Stadt Sigmaringen.<br />
In dem Namen steckt der Personenname Hedu von<br />
hadu der Kampf. Die Markung des Dorfes umfaßte ursprünglich<br />
wohl nur den rechts der Donau liegenden Teil<br />
der heutigen Markung Sigmaringen. Wir wissen heute, daß<br />
die Alamannen innerhalb der Markung oft verschiedene<br />
Siedlungen errichtet haben. Jede dieser Siedlungen hatte<br />
dann ihren eigenen Friedhof. Während der Friedhof des<br />
Hauptdorfes Hedingen der Bergstraße entlang ging, fand<br />
man beim Bau des Ständehauses am Leopoldplatz ebenfalls<br />
alamannische Gräber. Dieser Friedhof gehörte wohl zu einer<br />
kleinen Nebensiedlung, welche etwa in der Gegend der<br />
späteren Mühlenvorstadt zu suchen ist. Die Mühle dort,<br />
welche im Habsburger Urbar zu Sigmaringen gehört, hat<br />
wohl ursprünglich zum Dorfe Hedingen gehört. Denn es ist<br />
merkwürdig, daß im Habsburger Urbar wohl Mühlen zu<br />
Brenzkofen und Gorheim, auch in Laiz erwähnt werden, daß<br />
aber keine Mühle in dem doch viel größeren Dorfe Hedingen<br />
ist. Deshalb möchte ich annehmen, daß die Mühte beim<br />
Schioßfelsen die ursprüngliche Mühle des Dorfes Hedingen<br />
war, die schon vor 1300 zur Stadt Sigmaringen kam. Nach<br />
dem Abgang einer Siedlung Dettingen lmks der Donau, kam<br />
deren Markung wohl vor dem Jahre 1000 an Hedingen. Zwei<br />
Ursachen kamen zusammen, daß Hedingen als Dorf zu bestehen<br />
aufhörte. Zuerst bauten die Grafen von Sigmaringen,<br />
die bisher im Dorfe Sigmaringen ihren Sitz hatten, dfer Sitte<br />
•er Zeit entsprechend innerhalb ihrer Grafschaft auf einem<br />
Felsen auf der Markung Hedingen eine Burg, welche nach<br />
ihnen Burg Sigmaringen genannt wurde. Im Anschluß an<br />
diese Burg entstand dann in der Mitte des 13. Jahrhunderts<br />
die Stadt Sigmaringen auch auf der Markung Hedingen.<br />
2'weitens gründeten in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts<br />
der Ritter Itel Volkwin von Hedingen dort ein Dominikanerinnenkloster.<br />
Wie Gorneim und Brenzkofen, kam auch<br />
Hedingen im Verlaufe des 14. Jahrhunderts in das Niedergericht<br />
(Zwing und Bann) der Stadt Sigmaringen. In einer<br />
Urkunde vom Jahre 1.369 (Mitt, Hohenz. Jahrg. 1 S, 5) bestätigt<br />
Graf Eberhard von Württemberg seiner Stadt Sigmaringen<br />
die Verpflichtung des Klosters Hedingen, von<br />
ihren gegenwärtigen und zukünftigen Gütern, von denen der<br />
Stadt bisher Steuern bezahlt wurden,, diese auch in Zukunft<br />
zu zahlen. Damals gehörte also Hedingen zur Stadt Sigmaringen.<br />
97. Hedinger Brunnenstube*. Hedingen hatte zur<br />
Wasserversorgung eine eigene Brunnenstube im Ziegelösch<br />
bei der dortigen Quelle. Das Wasser wurde in hölzernen Teucheln<br />
nach Hedingen geführt. <strong>Der</strong> verst. Landwirt Gregor<br />
Glas erzählte mir noch, daß er in seiner Jugend beim Hedinger<br />
Steg diese alte Teuchelleitung gesehen hat.<br />
98. Hedingei-gassen*. Alte Gasse, welche vom Mühltor<br />
aus nach Hedingen führte. Dort hatten die meisten Bürger<br />
Krautgärten.<br />
Die mit einem * bezeichneten Namen sind ausgestorben.
Jahrgang 1.955 H O H E N Z O L, L E R I S C H E HEIMAT 45<br />
Zur Pfarrgeschichte von Ostrach<br />
Bei der neuerlichen Renovation der Pfarrkirche zu Ostrach<br />
kam hinter dem vermutlich 1704 erstellten Chorgestühl ein<br />
Stein mit lateinischer Inschrift zutage, die bezüglich des Lesens<br />
und auch Uebersetzens einige Rätsel aufgab. Man glaubte,<br />
es handle sich um eine Schrift des 17. Jahrunderts, aber in<br />
der seit 1593 vollständigen Pfarrerliste fehlte der hier zu<br />
lesende Name H. Frauendienst. Aus der mir zugänglichen<br />
Abschrift war, auch wenn man wußte, daß Phoebus soviel<br />
wie Sonnenwagen bedeutet, mit den letzten zwei Zeilen und<br />
der Lesart „numerat (oder migraverat) cum Christi secta"<br />
nichts Befriedigendes anzufangen. Vor allem fehlte eine Jahreszahl.<br />
Herr Pfarrer Gg. Moser hatte die Freundlichkeit,<br />
mir nach der Abschrift auf Ansuchen auch noch eine Fotokopie<br />
zu übersenden. Und da entpuppte sich „numerat cum<br />
Christus sécla" und das Ganze einwandfrei in altklassischem<br />
Versmaß folgendermaßen :<br />
„Hieronymus Frawendienst<br />
Undeciés lustrüm uixit, plenösque perégit<br />
Phoebi très cursüs, cum uolat ad superös.<br />
Viginti hic septém parochüs uigiläuit in ännos,<br />
Séptenis lustris chrismata sacra tulit.<br />
Octo bis numerat cum Christus sécla, reciso<br />
Anno sépdeciés, öccidit in Domino."<br />
Verskundige werden nun unschwer erkennen, daß die 6<br />
auf den Namen folgenden Zeilen abwechselnd im daktylischen<br />
Hexameter und Pentameter gebaut sind<br />
Phöbus ist, wie schon bemerkt, der Sonnenwagen, secla =<br />
saecula Jahrhunderte, lustrum Zeitraum von 5 Jahren,<br />
Christus steht vielleicht für Christianus. Somit ergäbe sich<br />
auf deutsch:<br />
„Hieronymus Frauendienst lebte elfmal 5 Jahre und<br />
durchmaß 3 ganze Sonnenläufe (also 55 + 3 58 Jahre),<br />
als er zu den Himmlischen emporstieg. Er wachte hier gegen<br />
27 Jahre als Pfarrer. Siebenmal 5 Jahre trug er die hl.<br />
Weihechrisame (war 35 Jahre Priester). Als Christus (oder<br />
vielleicht eher „der Christ") zweimal 8 Jahrhunderte unter<br />
siebzehnmaligem Wegschnitt eines Jahres zählte, starb Fr.<br />
im Herrn (also 1600 — 17 = 1583).<br />
Es bleibt dem geneigten Leser unbenommen, selbst nach<br />
Belieben den feurigen Pegasus, das sagenhafte Dichterroß,<br />
zu besteigen und diesem Bericht eine dichterische Form zu<br />
geben!<br />
Tatsächlich kommt der Pfarrer Frauendienst (auch (Frondienst<br />
geschrieben, wie früher Fraunstetten für heutiges<br />
Fronstetten) als Seelsorger Ostrachs von 1557 bis 1583 vor,<br />
wie wir unten zeigen werden. Die Steintafel wurde inzwi<br />
scher ms Kirchenschiff versetzt.<br />
DP die Ostrachern Pfarrliste bisher erst seit 1593 vollständig<br />
feststand, seien hier einige ältere Geistliche zusammengestellt:<br />
851 8. Oktober. Im Dorf Hostrachun gibt Engeitruda<br />
ihrem Leibeigenen Sigimar zum Empfang der hl. Weihen fürs<br />
Kloster St. Gallen die Freiheit. Daoei waren als Zeugen auch<br />
6 Priester namens Pero, Adalman. Hiltiger, Radpot, Paldolt<br />
und Randolf. Einer davon dürfte damals hier Seelsorger<br />
gewesen sein. Die Bedenken gegen Gleichsetzung von Hostrachun<br />
und Ostrach erscheinen mir nicht als sticnhaltig<br />
(Mitt Hohz.12, 78).<br />
1204 11. V. wird als Zeuge genannt C(onrad) plebanus<br />
(Leutpriester) de Ostrahi (Wirtbg. Urkb. 4).<br />
1246—1257 F r i d e r i c u s plebanus de Ostrach (ebenda<br />
4 utld 5 und 6 und Zeitschr. Oberrh. 35, 266).<br />
1272- 1279 ist Kirchrektor (eigentlicher Pfarrer, der einen<br />
Leutpriester hier sitzen hatte) zu Ostrach : Heinrich von<br />
Gundelfingen, zugleich noch Rektor anderer Kirchen<br />
"ad Kanonikus zu Straßburg (FDA T. Codex Salemit. ^on<br />
Weech).<br />
1278 24. IV. Conradus plebanus de O s t e r a c h,<br />
genannt Herrer (Regesten Kernler).<br />
1279 verkauft Konrad von Gundelfingen, Heinrichs Bruder,<br />
das Ostracher Patronatsrecht ans Kl. Salem (weiteres<br />
reiches Material in Cod. Salemit. 4 Bde., hgg. von Weech).<br />
1281 5. V. E irtholdus von Gundelfingen ist<br />
Kirchrektor zu Ostrach.<br />
132^ die Ostrache: Kirche wird Salem förmlich inkorporiert.<br />
Von da an heißt der Pfarrer „Ewiger Vikar".<br />
1326 ist ein Heinrich von Ostrach Leutpriester zu Pfullendorf.<br />
1338 24. Febr. C o n r a d us, Dekan zu Ostrach (Regesten<br />
Kernler).<br />
Vor 1462 Kirchrektor zu Ostrach ist Johannes Schwarz<br />
(Erzb. Archiv, Copiar T, Seite 10).<br />
Um 1462, nach dem Tod des Johannes Schwarz, wird genannt:<br />
Johannes Oswald Pleban zu Ostrach (ebenda).<br />
1463 25. VII. Johannes Oswald, Rektor oder Vikir<br />
der Kirche zu O., erhält auf ein Jahr Absenzbewilligung,<br />
ebenso 1464 (Krebs, Investiturprotokolle 640).<br />
1466 30. IV. Ludwig Tugwas (auch Dugwais) wird<br />
nach Oswalds Verzicht zum Pfarrer von O. proklamiert und<br />
am 13. Mai investiert. 1469—1482 erhielt er mehrmals Absenzerlaubnis.<br />
Am 11. Juni tauscht er mit dem Kaplan von<br />
Rickenbach, Sündelin. Ein Tügwais Ludwig (unserer?) ist<br />
1497 „Organista" in Ueberlingen.<br />
1488 11. VI. Georg Sündelin von Süigen wird Pleban<br />
von Ostrach (Krebs 640). G. Sindelin zahlt als Rektor am 11.<br />
6. 88. als Erstfrüchte seiner Pfarrei dem Bischof 25 fl, wegen<br />
des Tausches wurden ihm zuvor 5 fl nachgelassen (Erzb.<br />
Arch. Ha. 19, 314).<br />
1491 10. <strong>III</strong>. wird die vom Abt von Salem dotierte Frühmeßpfründe<br />
in Ostrach zur Ehre Mariens und der hl. Katharina<br />
vom Bischof bestätigt. Krebs 640.<br />
1491 22. IV. wird Berthold Diem von Horb auf diese<br />
Frühmesse investiert (ebenda). 1497 zahlt er als subsidium an<br />
den Bischof 2 Pfd. Heller (FDA 25, 110).<br />
1497 zahlt der Pleban Georg Maurici zu Ostrach<br />
als subsidium 2 Pfd. 10 Schilling Heller (ebenda).<br />
1501 15. II. Herr Lienhard Miog (Mogi) zahlt als<br />
neuinvestierter Pfarrer oder Pleban zu Ostrach 25 fl Erstfrüchte<br />
nach Erlaß von 5 fl (Ha 19, 314 im Erzb. Arch.) Im<br />
Jahre 1497 war dieser Lienhard Mueg Pleban in Burgweiler<br />
gewesen.<br />
1518 25. II. wird als Pfarrer in Ostrach proklamiert: Franziskus<br />
Benz von K. (Ortsname war zu Kernlers Zeit<br />
unleserlich, heute fehlt das ganze Blatt im Invest. Protokoll<br />
Freiburg). <strong>Der</strong> Vorgänger Leonhard Mieg ist tot, Bentz<br />
wird am 6. März 1518 investiert und zahlt als Erstfrüchte<br />
25 fl.<br />
1523 18. V.: Erlaubnis auf 4 Altären der Pfarrkirche Ostrach<br />
zu zelebrieren, aber nur für 4 Monate, ebenso 1524 (Regesten<br />
Kernler).<br />
1526 20. Juni resignierte der Frühmesser (irrig Pfarrer)<br />
Blasius Spindler zu Ostrach. (Investiturprotokolle<br />
Freiburg, auch folgende Notizen daraus.)<br />
1526 20. Juni wird als Frühmesser proklamiert G e o r -<br />
gius Schillinger, präsentiert durch den Abt von Salem,<br />
investiert am 10. September.<br />
1534 22 IV. Nach Resignation des Georg Schillinger wird<br />
heute Conradus Krug auf die hiesige Frühmesse proklamiert.<br />
Er resigniert am 24. Febr. 1537.<br />
1536 9. <strong>III</strong>. Herr Jakobus Benz vor Ostrach erhält anläßlich<br />
der Priesterweihe Dispens super defectu nataiium.<br />
1541 zahlt dieser Jakobus Bentz als neuer Pfarrer<br />
von Ostrach 25 fl als Erstfrüchte. Wird hier auch 16. 1. 1546<br />
erwähnt, erhält am 15. Juni J'353 den Auftrag zum Beichthören<br />
und zur Seelsorge im Frauenkloster Habstal als Nebenaufgabe.<br />
1557 25. Okt. wird proklamiert und investiert: obige- Herr<br />
Hieronymus Frawendienst nach dem Rücktritt des<br />
Jakob Bentz (Vgl. den eingangs erwähnten Gedenkstein!)<br />
1581 19. April werden erwähnt: Pfarrer Hieronymus Frondienst<br />
und Frühmesser Johannes N zu Ostrach.<br />
1581 1. XII. wird Johannes Löb (Lew) auf die Kaplanei<br />
BVM und Katharina in der Pfarrkirche Ostrach proklamiert,<br />
nach Rücktritt des Herrn Simon Eckh.<br />
1583 7. Okt. Nach dem Tod des Pfarrers Hieronymus Frawendienst<br />
wird A u g u s t i n Molitor, alias Müller, mf die<br />
Pfarrei proklamiert. Frühmesser ist Johannes Lew oder Leo.<br />
Müller ist am 1. August 1593 tot.<br />
1593 7. Okt. wird auf die Kaplanei des Dorfes Ostrach<br />
Michael Bemperlin proklamiert, nach Rücktritt des<br />
obigen Johannes Löwen. Bemperlin noch 1596 hier genannt.<br />
Er hatte als Erstfrüchte 2 fl 48 kr zu zahlen gehabt.<br />
1593 5. Oktober: Nach dem Tod des Augustin Müller -wird<br />
Magister Georg Weiß auf die Pfarrei des Dorfes<br />
Ostrach proklamiert, und am 6. April 1594 investiert. Auch<br />
er zahlt 25 fl 54 kr als Erstfrüahte,<br />
1596 30. Januar wira Georg Weiß zu Ostrach als Dekan<br />
des Kapitels Mengen nach Absetzung des Mag. Jodok Lerch<br />
bestätigt.<br />
1608. In Ostrach ist Kirchenheiliger St. Pankratius. Pfarrer<br />
Mag, Jakob Seitz, 32 Jahre alt; Kaplan ist Michael<br />
Bemperlin, 40 Jahre alt und sehr bresthaft. (Visitationsakten<br />
im Erzb. Arch.).
46 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
1615 25. Januar: Matthias Gegginger wird auf die<br />
Frühmesse Ostrach investiert.<br />
1648 16. IV. wird Bartholomäus Graff auf die<br />
Pfarrei Ostrach proklamiert, dielange wegen Kriegst<br />
r u b e 1 n unbesetzt gewesen (multo in tempore ob bellicas<br />
incommoditates vacantem). Investitur am 25. Mai 1648.<br />
1651 27. Juni. Pfarrer zu Ostrach ist Barthol Graff<br />
von Ueberlingen, 34 Jahre alt, seit 9 Jahren hier. Einkommen<br />
jährlich 12 Malter Frucht, 1 plaustrum (Wagenlast) und<br />
5 Eimer Wein, 30 fl baar und die Pfarrgüter und den Großzehnt<br />
von Unterweiler. Hier sind 200 Kommunikanten (d. h.<br />
Einwohner über 14 Jahren) und einige andersgläubige<br />
Knechte. Die Altäre sind profaniert, einer hat ein Portatile.<br />
Monstranz und Taufgefäße fehlen ganz, sonst sind die Paramente<br />
hinreichend. <strong>Der</strong> Pfarrer beichtet in Burgweiler. Die<br />
Kaplanei ist unbesetzt, deren Einkünfte nimmt der Salemer<br />
Beamte in Pfullendorf. Die Kaplaneigebäude sind schlecht<br />
gedeckt. Die Einkünfte der Rosenkranzbruderschaft verwaltet<br />
der Heiligenpfleger. <strong>Der</strong> Pfarrer hat in die Heiligenrechnungen<br />
keine Einsicht. (Visitationsberichte Erzb. Archiv,<br />
Freiburg).<br />
1662 3. August. Nach dem Tod des Pfarrers Bartholomäus<br />
Graff wird heute Magister Johann Rudolf Berger<br />
als Seelsorger proklamiert, am 5. September 1662<br />
dann investiert.<br />
1665 18. August. Pfarrer hier ist M. Johann Rud. Berg'<br />
e r aus Reichennau, 32 Jahre alt, 3 Jahre dahier investiert<br />
(bald darauf wird er Dekan des Kap. Mengen), versieht auch<br />
Tafertsweiler, hat zusammen 550 Seelen, erhält von<br />
Salem ein fixes Gehalt, da die Pfarrei inkorporiert ist.<br />
Die Frühmeßeinkünfte bezieht der Herr Marius von Salem.<br />
Die Pfarrgebäude sind ruinös. Einige alte Jahrtage werden<br />
mangels Stipendien nicht gehalten. Sie sollten von Konstanz<br />
reduziert werden. Pfr. Berger soll 1665 noch 30 fl. 54 kr für<br />
seine Erstfrüchte zahlen, mit denen er im Rückstand ist.<br />
1680 hat Ostrach vier Filialkirchen: „Laupach, Jeckhofen,<br />
Wangen und Kalchenreithe".<br />
1688 Pfr. Jakob Heitzmann.<br />
1689 präsentiert das Kl. Salem für die Pfarrei Ostrach am<br />
23. März den Herrn Tiberius Geiger, der am 25. 3.<br />
89 verkündet wird. Auch 1701 ist er noch hier erwähnt.<br />
1702 14. Juni. Kaplan Johannes Prasser zu Ostrach<br />
zahlt die Erstfrüchte mit 4 fl 48 kr; war präsentiert durch<br />
Abt Stephan von Salem, wurde proklamiert am 1. Juli 1702.<br />
1706 8. Januar. Frühmesser Dr. Johannes Buol zahlt<br />
als Erstfrüchte 4 fl 48 kr, war seit 1695 Pfarrer in Tafertsweiler<br />
gewesen.<br />
1720 18. Febr. Salem präsentiert auf die Frühmesse in<br />
Ostrach den Herrn Gabriel Winter. Er zahlt 4 fl 48 kr<br />
und wird am 21. Februar verkündet.<br />
Soweit die Freiburger Akten. Ein kulturgeschichtlich interessantes<br />
Schriftstück aus dem Pfarrarchiv, nämlich der<br />
Nachlaß des Pfarrers Müller von 1593, soll später folgen.<br />
Johann Ad. Kraus.<br />
Zur Familien- und Namenskunde in der Grafschaft Zollern 1622<br />
Grosselfingen (71): Beck Michel - Bogenschitz Jakob<br />
- Braun Hans - Cammerer Hans - Cammerer Michel -<br />
Cammerer Kaspar - Conrad Hans - Döner Hans - Döner<br />
Joachim - Dollenmayer Hans - Haug Melchior - Haug Kaspar<br />
- Hewis Conrad - Hewis Jakob - Hodler Michel - Im<br />
Hof Melchior - Kantz Kaspar - Kantz Matheus - Kessler<br />
Adam - Kessler Hans - Killmayer Diepold - Klingler Hans -<br />
Klotz Jerg - Koch Hans - Koch Jakob - Koch Hans II. -<br />
Krummholz Hans - Krummholz Hans II. - Lefler Michel -<br />
Lefler Martin - Linder Jakob - Linder Hans - Linder Adam -<br />
Marx Conrad - Marx Hans - Marx Jakob - Marx Hans II. -<br />
Max Jakob II. - Maurer Matheus - Mesner Hans -<br />
Mesner Melchior - Mesner Martin - Mesner Hans II. -<br />
Oth Ludwig - Ostertag Adam, Vogt - Ostertag Melch -<br />
Ostertag Matheus - Rentz Hans - Ruef Jerg - Ruef Jakob<br />
Seher Kaspar - Seher Hans - Sautter Hans - Sautter Michel -<br />
Senner Hans - Sultzer Han- - Sultzer Jakob - Schneider<br />
Jakob - Schneider Hans - Schneider Konrad - Sintz Hans -<br />
Schweitzer Hans - Spieß • Hans - Vischer Jerg - Volckh Jakob<br />
- Weißhaar Vesen Jakob - Weißhaar Daniel - Wann<br />
Hans - Wann Martin - Wann Hans II. - Weinstein Kaspar.<br />
Hausen i. K. (40): Bachmann Kaspar - Bürckle Jakob -<br />
Burkhardt Hans - Daickker Jakob - D;rck Peter - Eminger<br />
Jakob Flad Kaspar - Flad Urban - Flad Hans - Fiad Jakob<br />
- Gamertinger Jakob - Gretzinger Matheus - Guldin<br />
Jakob - Haasis Hans - Hewer Hans - Hewer Martin - Kinkkele<br />
Hans - Luchs Barthle - Pfender Melcli - Renner Bastian<br />
- r> oth Hans - Ruef Hans - Rueff Jerg - Schall Christ -<br />
Schall Hans - Schmid Adam - Schmid .Caspar - Schmid<br />
Jerg - Schneider Abraham - Schnerder Hans - Schneider<br />
Ottmar - Schueler Jakob - Schwartz Jakob Schweitzer<br />
Thoma - Seit? Michel - Steimer Andreas - Utz Jakob -<br />
Weyt Hans - Weith Claus - Weith Jakob.<br />
Hechingen (156): 1.) In der Stadt: Bachmann Kaspar<br />
- Barth Zimprecht - Barthleme Friedrich - Bausch<br />
(Pausch) Hans Georg - Beck Konrad - Bihler Hans, Färber<br />
- Boll Hans, Beck - Buckenmayer Hans - Buelach Georg,<br />
des Scherers Erben - Burkhardt Georg - Emich Hans - Fechtig<br />
Hans Georg - Fehlenschmied Conrad - Fischer Theuss -<br />
Fixlin jg. Jakob - Fixlin alt Jakob - Fixlin Kaspar - Fixlin<br />
Hans - Freudenmann Georg - Fromm Matheus - Fromm<br />
Veit - Gegauf Barthlin - Gfrörer Bernhardt - Glocker Peter<br />
- Göser Moriz - Göser Martin - Greutter Jakob - Hanen<br />
(Hahn) Hans - Hennenlotter Jakob - Hürschauer Hans -<br />
Jos Balthas - Kepner Becnthold - Kindtler Johann - Kipft<br />
alt Hans - Kleinmann Michael - Koch Erasmus - Lindt Philipp<br />
- Mayer's Bastian Witwe - Mayer Bastian - Mayer<br />
Paulin - Matter Bernhard - Matter Hans Ow von, Werner -<br />
Pfaff Michael - Pfefferlin Matheus - Preiel Jakob - Rausch<br />
Simon - Rempp Stephan - Saiiin Hans - Sailin Kaspar -<br />
Schell Hans - Schmalacker alt Hans - Schmid Michel, Seiler -<br />
Schmid Michael, Kutscher - Schmidt alt Gall - Schmidt jg.<br />
Gall - Schmidt Hans - Schmidt Jakob - Steger Jakob -<br />
von M. Schaitel 1. Fortsetzung<br />
Stenglin Hans - Stifel Hans - Ströblin Georg - Strobels<br />
Hans Witwe - Strobel Barthlin - Stoz Thoma, Beck - Taubenschmid's<br />
Joachim Witwe - Taubenschmid Zachäus - Tannenmann<br />
Konrad - Traber Anna - Traber Stoffel - Uricher<br />
Melchior - Vogt Adam - Weinmann Carlin - Wolf Melchior<br />
Ehefrau - Weiß Samuel - Wullin's Hans Witwe -<br />
2.) In der Altstadt: Aichgasser Jakob - Bausinger<br />
(Pausinger) Theus - Berbich Matheus - Boll Hans, Boll's<br />
Hans Witwe - Breiel (Preiel) Hans - Buckenmayer Bastian -<br />
Buelach Georg - Buelach Simon - Buelach Georg, Metzger -<br />
Bürcklin Michael - Füchslin Stephan, Glaser - Gegauf Jakob<br />
- Gegauf Konrad - Geuger Stoffel - Göser's Reinhardt<br />
Witwe - Gulden Jakob - Häfelin Hans - Heß Hans - Heß<br />
Konrad - Hurrer Lorenz - Hohenloch Stoffel - Holzhauer<br />
Georg - Kipft jg. Hans - Kipft's Claus Witwe - Kleinmann<br />
Hans - Kleinmann Martin - Kleinmann Melchior - Kratwohl<br />
alt Hans - Kratwohl jg, Hans - Kuech alt Michael - Kuech<br />
jg. Michael - Kuech alt Hans - Kuech jg. Hans - Lewe Hans<br />
- Matheus Barthlin - Merz Barthlin - Mutschier alt Michael -<br />
Mutschier Jg Michael - Mutsehler Michael Gabel - Mutschier<br />
Jakob Gabel - Mutscriler Jakob - Mutschier Georg -<br />
Rausch Hans - Sautter Georg - Singer Jakob - Schmidt Martin<br />
- Schweinler Kaspar - Stengelin Thoma - Stoz Thoma,<br />
Seile) - Stoz alt Tnnma - Stoz Hans - Ströblin Wendel -<br />
Schwat Stephan - Wagner Christ - Wagner Philipp Wendelins<br />
Hans - Ziegler Melchior — '<strong>Der</strong> Spital).<br />
3.) Vor dem Oberen Tor: Bayler Georg - Costanzer<br />
Stephan - Emich Konrad - Fixlin Melchior - Göckinger<br />
Michael - Harrer Gall - Kleinmann Hans - Merz Hans -<br />
Mutschier Kaspar - Ströblin Jos, der Wiestenmüller.<br />
4.) P f 1 e g ? c h a f t e n : Hans Bayler's Kinder - Bastian<br />
Euckenmayer's Sohn - Claus Buelachs Kinder - Konrad<br />
Emich's Kinder - Hans Gfrörer's Kinder - Hans Jerg Hauser's<br />
Kinder - Hans Kinaler's Kind - Ursula von Ow, Klau- •<br />
senschaft - Hans Sailin's Kinder - Hans Stozens Sohn - Ludwig<br />
Paur's Kinder - Barthlin Ziegler.<br />
Hörschwag (23). Bader Theis - Borhaupt Hans - Borhaupt<br />
Melchior - Eberlin Hans - Fuchsloch Hans - Geckeier<br />
Hans - Gnupfer Jerg - Gunckel Hans - Haiifinger Hans -<br />
Holzhawer Hans - Kimich Jakob - Kimich Marx - Korr Jakob<br />
- Kraus Claus - Lorch Hans - Pfeiffer Hans - Rauscher<br />
Georg - Reitter Peter - Schall H^ns - Soon Theis - Vischer<br />
Jerg - Weber Christa - Wertz Hans, Vogt,<br />
Jungingen (58): Albers Hans Witwe - Boll Hans - Bosch<br />
Hans - Bosch Jakob - Buemiller Hans - Burckhardt Balthas<br />
Witwe - Conantz Martin - Conantz Michel - Daiker Jakob -<br />
Daiker Hans Witwe - üierheimer Balthas - Dietsch Balthas -<br />
Dietsch jg Balthas - Dietsch Balthas Witwe - Ehemarin alt<br />
Hans - Ehemann jg. Hans - Flad Hans - Flad Konrad -<br />
Gamertinger Martin - Gseil Theis - Grösser Jakob - Hebich<br />
Barthlin - Helle Jakob - Hennenlotter Hans - Hennenlotter<br />
Michel - Hennenlotter Adam - Hering Hans - Hering Jakob -<br />
Hewis Jakob - Hewis Konrad - Hewis alt Hans - Hewis Hans -
Jahrgang 1955 HOHENZOLLEEISCEEHEIMAT 47<br />
Hoß Balthas - Kientzler Stoffel - Kleinmann Martin • • Kohler<br />
Hans • • Kohler Balth. - Lorch Hans - Mayer Dauid-Pf ister Hans<br />
- Pfister jg. Hans - Pfister Gedion - Rauscher Christ - Res<br />
Melchior - Schueler Hans - Schueler jg. Hans - Schueler<br />
Barth' Kinder - Seitz Theiß - Seitz Martin - Seitz Bastian,<br />
Vogt - Speidel alt Bastian •• Speidel Martin - Speidel jg. Bastian<br />
- Thoma Melchior - Vogt Adam - Vogt Hans - Winter<br />
Hans - Winter Ludwig.<br />
Killer (14): Beck Stephan - Diepolt Kaspar - Flad<br />
Hans - Kelle Hans - Locher Christ - Lorch Hans - Lorch<br />
Michel - Mayer Hans - Mayer Jerg - Miller Simon -<br />
Schwartz Michel - Stummp Kaspar - Stummp Hans - Steir<br />
Hans.<br />
O w i n g e n (70): Bertsch Michel - Birckle Michel - Bürckle<br />
Hans - Cammerer Michel - Costanzer Hans - Costanzer<br />
Adam - Edelin Kaspar - Edelin Hans • Edelin Martin - Edelin<br />
alt Jakob Witwe - Edelin Jakob - Fritz Jakob • Gleri<br />
Konrad - Haug Hans - Haug Martin - Henni Hans - Henni<br />
Jerg - Hewis Hans - Hohenloch Balthas - Hohenloch Michel<br />
- Keller Jerg - Kleck Hans - Kleck Ludi - Klein Jerg<br />
- Lefler Hans - Maurer Kaspar - Maurer Hans - Maurer<br />
Konrad - Maurer Jakob - Metzger Jerg - Mockh Peter -<br />
Mockh Wendel Kinder - Negele Hans - Pf äff Stoffel - Pfeiffer<br />
Melchior - Rockh Enderis - Rockh Hans - Semble Hans -<br />
SiclJnger Jak - Sintz Simon - Sintz Jerg - SintzJergH - Singer<br />
Hans - Schawer Kaspar, gen. Capel - Schawer Jak. - Schawer<br />
alt Kaspar - Schawer jg. Kaspar - Schawer Ludi Wtw. -<br />
Schawer Jerg - Schawer Michel - Schawer Christ - Schawer<br />
Hans - Schawer Endris - Schawer Ludwig - Schick Hans -<br />
Schick Theiß - Schmid Hans - Schott Jakob - Schweitzer<br />
Bastian - Schweitzer Stoffel - Schweitzer Peter - Spieß<br />
Michel Witwe - Stifel Barthle - Stifel Jerg - Stifel alt Hans -<br />
Stifel Jakob - Vischer Hans - Vischer Jerg - Walch Martin,<br />
Vogt - Weißhaar Hans. Schluß folgt.<br />
Alte Gemeinderechnung von Jung'ngen 1794—95<br />
Augustin Bosch Vor 2 Neue Hagen Strick und andere Pfosten<br />
laut Conten zalt<br />
Vor ein Schaufel in Hagenstall zalt<br />
<strong>Der</strong> Schitz 6 Tiecher voll Esper geholt den Hägen<br />
Mehr dem Selben wegen Hagen fuoteren Hundert Tag a 3 Xer<br />
4.33<br />
—.16<br />
—.18<br />
macht<br />
Mehr der Vogt den Zoll Haber auf Hechingen gefihrt ihm z.<br />
<strong>Der</strong> Vogt zu Hechingen gewesen und eine Consignation der<br />
ledigen Buoben eingeben<br />
Mehr Vogt und der Joseph Buomiller mit den oberen Vögt n 1<br />
zu Hechingen gewesen Wegen dem Hand gelt geben zalt<br />
Wie die ledigen Buoben das letzte mal zu Hechingen beym<br />
Spiellen gewesen denselben samt dem Vogt und Burger<br />
5.—<br />
—.30<br />
—.30<br />
—.50<br />
Maister jedem 12Xer 41 Buoben 9.06<br />
Denen 3 Reguruten wegen Zehrung 3.—<br />
Weil man Lebold Schullers das Bauholtz angewißen dem Vogt z. —.20<br />
Von der Zug Specification zu machen und einzugeben dem<br />
Vogt Burger Maister und Schitzen zalt<br />
Wie man das Hagen Embt Heim gethan denen Burger Maister<br />
und Schitzen zalt<br />
Dem Schitzen beym Umhieten über sein gebühr gehiet und 11<br />
Nächt Bezalt<br />
—.44<br />
—.50<br />
2.12<br />
<strong>Der</strong> Joseph Buomiller 5 nächt<br />
Dem Vogt über ssin gebühr 4 Nächt zalt —.4»<br />
Vor ein Bres Zedel zalt —.0 '<br />
<strong>Der</strong> Heb Mutter ihr Wart gelt zalt 1.20<br />
Dem Andreas Mayer ein Gang auf Hechingen mit den ledigen<br />
Buoben —.16<br />
Wie die letzten Soldaten im Spat Jahr Hier gewesen dem<br />
Krämer und Remigi Glamser und Vitali Deckel nachher<br />
Wurmling n mit 6 Pferd auf jedes ä 30 Xer Beysatz z. 3.—<br />
Dem Vogt Sein Wartgeldt zalt 4.—<br />
Wegen Schreiben zalt 3.—<br />
Dem Todengräber Sein Wartgeld 1.20<br />
Wegen Kis auf Brucken fihren und Stein Schlagen bey Krämers<br />
Haus zalt dem Schitzen 1.32<br />
Mehr dem Schitzen Wegen underschidlichen Gängen im<br />
Friedrichstal und Wald laut seinem Conto 1.50<br />
Hohenzollerische Bruderschaftsmitglieder<br />
in Maria Schray bei Pfullendorf<br />
von Dr. Johann Schupp, Zell am Andelsbach<br />
Mottschieß: Johann Nepomuk chappeler<br />
1772; Magdalena SchabciMn 1802; Anna Maria Scheür ..änn: . 1748;<br />
Anna Maria ! .rklln 1749; Katharina S "i'cierin (=. Strobel) 1754;<br />
Joseph Strobe: 1761; Anastasia 3 ;roblerin 1762; Valentin Strobel 1763;<br />
i iulf Streb? 1 1765; Wendelin Strebel, Beatrix Streblerin 1766; Mar-<br />
Taritha Streblerin 1769; Tobias S + -ebel 1771 Maria Ursula Sträublin,<br />
Teodora Streblin 1776; Luzia Streblerin 177. : ' Helens Streblin. 1T5MS<br />
Anna Streblin 1790; / ;atha Streblin 1796. Ost räch: Anna Maria<br />
Aichin 1760, " atheiß \rn',.d, Eli'-.beth Arnold 1764; Joseph Arnold<br />
1768; Katharina . ,jlü 1769; Maria 'Jrsula Arnold 1773; r anziska<br />
Bachmann 1766; Mari Ann' Berger 1766; Jakob Bernhard 1790;<br />
Viktoria Bez 1754; Theresia Birkhofer 1762; Magdalena Birkho f r<br />
1763; Katharina Bremin 1771; Maria Anna Jrie in 1764; Johanna<br />
Buschauin 1771; Anna Maria Butscherin 1773; Elisabeth Fenkerin<br />
1760; Agatha Frey 1773; Theresia Fric 1 " 1771; Bari -:a Frick 1776; Joseph<br />
Gaup 1778; Waldburga Geiger 1760, Kunigu, de iger 1750; Maria<br />
Anna Geiger 1780; Maria Anna Grob 1763; Elisabetha Güettin<br />
1757; Joseph Ha ^n 1I> 16; Ursula Haitzlerin, Anna Maria Heizlerin<br />
1763; Fidelis H ter 1765; Maria Anna Haug J771: Fidelis Heilig<br />
Maria Anna Heilig .66; Ag„,ha Heilig 1798: Waldburga Hübschlin<br />
1762; Waldburga Kt ;i erin 179? Katharina Kern 1758; Margaretha<br />
Keßerin 1761; Anna Maria Keßerin 1764; Waldburga Keßerin ;<br />
Joseph Klein 1772; Walpurga Kocheil .'n 1764; Joseph T * -:heisen, S<br />
bastian Kocheisen 1768; Fidelis Koch, Ben, Ilans Micha < Kocheißen<br />
1770; Johann Georg Xrez,, -n 1757; Anna Krueg 1764; K^iha<br />
rina Langenberger 176i, Walburga Langenberger 1766; Anna MS a<br />
Leidhartin 1766; Josepha Leyherrin 1764; Theresia Lieb 1768; AHrfa<br />
Maria Lieb 1771; Genovefa Mat:- 1760; Vikti.ria Maurwizlerin 1770;<br />
Ursula Müller 1774; Anna Mari Neubörger, Phil'pp -.euberger 1766:<br />
Anna Barbara Riescher 1774; Johann Rietlerin 1761; Mathi?« Sauter<br />
1760; Genovefa Sauter 1773: Anna Maria Schelk 1774; M. Magdalem<br />
Schießerin 1763; Anna Maria Schmid 1793; Anna : äria Senn 1764;<br />
Ursula Senn 1766; Anna Maria Spjnnagl - in "757; Katha.ina Spannaglerin<br />
1760; Johanna Stemhaußei i748; Mai Lnna una Walpurga<br />
Steyerer 1763; Maria Anna Steurinin 1764; Agatha Steurin 1769; The<br />
resia Uhlerin 1749; Maria Anna Vonihr 1785; Johann lartin Vomer<br />
1767. Otterswang: Maria Anna Biechlerin (= Biecheler) 1753;<br />
von Casimir B u m i 1 1 e r<br />
1 . -<br />
Dieses Jahr den Armen Almosen geben 2.04<br />
Weil die Bronen glofen Bey Casimir Riester und Johannes<br />
Bosch verzehrt 3.36<br />
Dem Anderes Mayer sein Guthaben Laut seiner Rechnung<br />
am Gleretstag 1794 zalt mit 6.22<br />
Dem GestiftsPfleger aus dem Weiler Wald zalt 1.12<br />
Dieses Jahr denen Wucher Rend Vor Salz zalt 2.04<br />
Dem Meßmer aus seinem Wagen zalt —.15<br />
Dem Hatschier Eberle Breßgelt zalt —.15<br />
Wie Man dem Vogt und Burger Maister Von ihren Lihnen<br />
gethan Hat dem Gericht z. 2.36<br />
Den 28. Merz hat Jungingen ihren Antheil an der Comißion<br />
Bezalt 66.40<br />
Dem Doctor von Wetzlar bey der Comißion Bezalt 59.—<br />
Denen Deputierten Weil sie nacher Wetzel gereist Bezalt 32.—<br />
Wider zalt die Gemeinde Jungingen 8.—<br />
Wider Vor die Gemeind zalt<br />
Mehr zum Proceß zalt 30.--<br />
Mehr dem Friedrich Greßer und Philipp Seiz von der Vollmacht<br />
Reutlingen getragen 3.36<br />
Ferner den Notari Wunderle Von der Ververtigung der Vollmacht<br />
und Gost gelt zalt 3.24<br />
Dem Jerg Riester Comißionsdeputierter Vor seine Gang und<br />
Botten Lohn Laut Seinem Conto zalt 15.54<br />
Dem Remigi Glamser 5 gäng auf Stetten und Hausen und 2<br />
Boten 1.52<br />
Mehr dem Gemeindsburger Maister 6 geng zur Landschaft zalt 2.—<br />
<strong>Der</strong> Joseph Duomiller 6i/o Tag Beym Bronen Machen gewesen<br />
des Tags 24 zu Xer macht 2.36<br />
Von der Burger Maister Rechnung machen<br />
Dem Schitzen zahlt —.30<br />
Summarum des Ausgab 725 Fl 11 Kr.<br />
Einnahm 705 Fl 9 Kr.<br />
Bleibt als Guthaben 20 Fl 2 Kr.<br />
welches Guthaben Dem Joseph Buomiller Gemeindsburgermeister<br />
zufällt. (Fortsetzung folgt!)<br />
An das<br />
in<br />
Postamt
48 H HENZOLLERISCHEHEIMAT .Tf,i-irgang 19b.<br />
Anna Maria Biechlerin 1750; Helena Braun 1758; Maria Anna Braun<br />
1761; Katharina Braun 1762; Maria Anna Bugg 1809; Agatha Canal,<br />
Lorenz Canal, Johann Georg Canal 1749; Philipp Canal 1750; Jerg<br />
Canal, Anna Ma - a Canal 1755; Franz Joseph Canal, Stephan Canal,<br />
Johann Martin Canal, Joseph Canal 1756; Katharina Canal 1759; Anna<br />
Maria Canal 1770; Fidel Kanal 1809; Maria Anna Canal 1834; Kunigunda<br />
Halder 1765; Johann Martin Kramer 1749; Maria Krenklerin<br />
(= Krenkel) 1750; Christina Maßalin 1750; Antoni Miller 1748; Walburga<br />
Moser 1809; Marx Antoni Restle 1750; Johann Georg Restle,<br />
Katharina Restle 1769; Johann Georg Restle 1801; Antoni Schweickhart<br />
1769; Anton Schweickhart 1765; Maria Josepha Schweickart 1775;<br />
Jakob Schweikert 1816; Anna Maria Sigle 1748; Magdalena Sigle 1751;<br />
Mathä Straub 1834; Luzia Walz 1801; Anna Maria Weißhaupt 1753;<br />
Maria Katharina Weißhaupt 1790; Agatha Wirner 1755. Rangendingen:<br />
Johann Turinger 1795. Reischach: Kunigunde Eramin<br />
(= Ammann) 1809; Katharina Endres 1798; Kunigunda Fetscher<br />
1793; Bernhard Gall (Grall?) 1793; Lorenz Gall 1789; Barbara Glaser<br />
1801; Helena Glöckler 1781; Mathias Grall 1794; Theresia Grau 1858;<br />
Anna Maria Halmer 1792; Elisabeth Halmer 1798; Johannes Häusler<br />
1798; Helena Keller 1786; Elisabeth Moser 1815; Antoni Nothhelfer<br />
1791; Johann Martin Rebmüller 1776; Verena Reich 1781; Theresia<br />
Restle 1754; Anna Maria Restle 1764; Maria Ursula Riedmiller 17'<br />
Magdalena Riedmüller 1785; Ar na Maria Schenk 1748; Magdalei.^<br />
Schenk 1754; Katharina Schenk 1761; Anna Maria Schenk 1767; Ursula<br />
Schenk 1773; Franziska Schenk 1785; Maria Anna Schweikart<br />
1798; Konstantin Waldenspuehl 1780; Anton Walderbuehl 1798; Eva<br />
Walk 1754; Theresia Walk 1768; Joseph Walk 1794; Cacilia Weiblin<br />
(= Weibel) 1789; Anna Maria Zwinglerin 1754. — Bei Anna Maria<br />
Herzog 1795 fehlt Ortsangabe. Vermutlich wohnte sie in Reischach.<br />
Rengetsweiler: Magdalena Bauhofer 1750; Isidor Behler 1788;<br />
Elisabeth Blum 1797; Theresia Burth 1787; Walburga Diener 1806; The<br />
res Dobler 1798; Franz Joseph Fischer 1764; Katharina Guldin 1764;<br />
Chrysostomus Kiernler 1752; Magdalena Kuen 1760; Johann Baptist<br />
Lambert 1754; Theodor Lampert 1770; Sebastian Lambert 1773, Kasr~t<br />
Lambert 1786; Thaddäus Lener 1769; Katharina Liener 1757; Mon<br />
Liener 1757; Stephan Liener 1758; Mathias Liehner 1786; Kunegund<br />
Liehner 1786; Thad. Liener 1806; Anna Maria Liener 1818; Chrysostomus<br />
Lozer 1763; Kunigunda Lozer 1809; Maria Maurwizlerin 1758; Genovefa<br />
Mutscheller 1760; Maria Anna Peter 1749; Johann Baptist Rettich<br />
1763; Karl Anton Rettich 1763: Theresia Schmid 1753; Maria Anna<br />
Schmid 1763; Joseph Schmid 1763; Kunigunde Schneider 1749; Franziska<br />
Schneider 1754; Maria Eva Schneider 1778; Maria Anna und<br />
Kunegund Schneider 1780; Jakob und Agnes Schneider 1787; Agnes<br />
Schneider 1795; Katharina Schneider 1818; Maria Agatha Strobel 1750;<br />
Philipp Strobel 1786; Maria Anna Strot" 1 1818; Cacilia Vochinger<br />
1757; Kunegund Vochzerin (= Vochazer) 1818; Katharina Wanner<br />
1750; Kunigund Wanner 1758; Stephan Zipfler 1798. R i e d e t s<br />
weiler: Johann Georg Lautenschlager 1782; Johann Adam Restle<br />
1805. Ringgenbach: Mathias Bayer 1786; Theresia Gebsin<br />
1768; Christina Henßerin 1756; Anna Maria Heußler 1749; Rosina<br />
Häußler 1754; Verena Heüßler 1768; Anna Maria Krez 1749; Agnes<br />
Längle 1907; Elisabeth Lehmann 1757; Maria Maister 1753; Joseph<br />
Schneider 1804; Jakob Scholl 1754; Kunigunda Steyin 1753; Johann<br />
Georg Veeser 1780; Michael Veeser, Waldburg Veeser 1778; Wa. aurga<br />
Waldenspul 1817. Rosna: Al o».» Dinßer 1773; Magdalena Handgrätin<br />
1749; Joseph Handgrad 1761: i^aria 1 isa Kneplerin ' = Knepple)<br />
1752; Maria Rosa Ridtin (= Rid) 1787. Rothenlachen:<br />
Maria Franziska Kempf 1763; Agatha Miller 1769; Anna Maria Restle<br />
1809. Ruhestetten: Agnes Blocherin 1795; Elisabeth Blochin<br />
1805; Adam Brugger 1763; Rosina Burt 1799; Therese Endres 1794; Rosina<br />
Hönin (Hahn?) 1793; Jakob Heüßler 1748; Maria Häusler, Tneresia<br />
Häusler 1788; Johann Häusler 1796; Franziska Kempf 1772; An"a<br />
Maria Keßler 1806; Maria Anna Lengle 1816; Maria Agatha Möh i.<br />
1817; Konrad Ren; 1777; Theresia Riedmiller 1797; Franziska Rigger<br />
1795; Theres Rieger 1806; Jonann Rieger 1816; Johannes Rieckher 1768;<br />
Jakobäa Schmid 1779. Ri fingen: Joseph Alt 1796; Kunigunda<br />
Arnold 1798: Judith Benglerin (= Bengel) 1765; Antoni Grueber 1771;<br />
Genovefa Madiener 1802; August-n Ot f '80. Bhristina Rock 1769;<br />
Kreszent : a Sar =r 179S; Franziska und Magdalena Waiiraf 1798; Katharina<br />
Wildhaber 1802. Schernegg: Maria Ursula Winter 1770.<br />
BESTELL-SCHEIN<br />
zum Bezug der „Hohenzollerischen Heimat"<br />
Sch' ß folgt.<br />
Ich/wir bestelle(n) ab sofort zum laufenden Bezug durch<br />
die Post Stück „Hohenzi_llerische Heimat"', Verlagspostamt<br />
Gammertingen, zum halbjährigen Bezugspreis<br />
von 60 Pfennig.<br />
Vor- und Zuname<br />
Genaue Anschrift<br />
Dieser Bestellschein ist bei Neubestellung bezw. Nachbestellungen<br />
der nächsten Poststelle aufzugeben. Um deutliche<br />
Schrift wird gebeten.<br />
Kurznachrichten<br />
Kirchliche Pläne in Hechingen 1699. „Es ist sattsam bekannt,<br />
daß das Collegiatstift Hechingen kaum zwei Priester -<br />
kongrua trägt. Sobald nämlich die Früchte in Abschlag kommen,<br />
bleiben den Canonikern namhafte Ausstände, die allerdings<br />
bei guten von Gott gesegneten Jahren nicht nachgetragen<br />
werden mögen. Trotzdem das Stift bisher in drei Canonikern<br />
bestand, so war dies nur dem Namen nach, da<br />
außer der hl. Messe weder das kanonische Stundengebet<br />
noch das tägliche Amt gesungen werden, wie es sonst bei<br />
dergleichen Kirchen hergebracht wird. Auch ist gar keine<br />
Hoffnung, das Stift wieder in die vorige Blüte zu bringen,<br />
da die meisten Renten durch den 30jährigen Krieg verloren<br />
gingen und daraus in Ewigkeit nichts mehr zu gewinnen ist,<br />
da die Einkünfte in besetzten und unbesetzten Gefällen bestehen.<br />
Wenn man nun zwei der gegenwärtigen ohnehin kranken<br />
Canoniker abschaffte, und Herr Max Molitor sowieso sich<br />
nach Kloster (Maria-)Berg verdingt und Herr Hubert N... .<br />
besser für einen Hofkaplan als einen Canoniker taugt, so<br />
bliebe der Pfarrer und sein Kaplan übrig, welchen außer<br />
seinem Pfarreinkommen aus den Stiftsmitteln jährlich 200<br />
für die Kaplanhaltung und aus den übrigen Stiftseinkünften<br />
ein Kantor, Organist, vier Chorschüler und der Mesner provisioniert<br />
werden, auch was sonst dem Stift aus unentbehrlichen<br />
Ausgaben bisher zugegangen, bestritten werden könnte.<br />
erauf wäre mit den Jesuitenpatres ein Vertrag zu machen,<br />
daß von ihnen mit 3 Priestern samt einem Bruder zui obigem<br />
Zweck hierhergetan und die Prädikatur (Predigtamt)<br />
abwechselnd mit den Franziskanerpatres von St. Luzen ihnen<br />
aufgetragen würde, die unteren Studien bis zur Rhetorik<br />
einschließlich von ihnen doziert, Katechese gehalten und<br />
alles zur Seelsorge nötig, nach den Statuten des Ordens getan<br />
wird. Ihnen würden die sämtlichen Gebäude des Spitals<br />
mit dem dabei liegenden Garten und der Kirche, auch die<br />
Spitalwaldungen eingeräumt und der bisher dem Stift zustehende<br />
große Fruchtzehnt von Bisingen, Steinhofen und<br />
Thanheim übergeben, den sie dann selbst einheimsen oder<br />
verleihen oder verkaufen können. Um die Intention der<br />
Stifter des Spitals zu wahren, sollen die Spitalgüter und<br />
Einkünfte dem Almosen inkorporiert und das Almosen daraus<br />
bestritten werden, die Stadt Hechingen aber soll dem<br />
Anerbieten gemäß ein ganz neues Armenhaus bauen.<br />
Es ist in Stadt und Land bekannt, wie schlecht bisher der<br />
Eifer der Stiftsherren war, auch wie viele Bürgerkinder mit<br />
den ihnen von Gott verliehenen Tälenten verliegen müssen,<br />
weil sie keinen Unterricht hatten, überhaupt, daß die ganze<br />
Bürgerschaft in der Christkatnoiischen Lehre gar schlecht<br />
profitiere. Das alles könnte durch die Herren Patres der<br />
Gesellschaft Jesu verbessert und in einen andern, zu Seelund<br />
Leibeswohlfahrt abzweckenden Stand eingerichtet werden.<br />
Dabei würde auch dem commercio publico durch die<br />
zu erwartenden fremden Kostgänger merkliche a^antage zugehen<br />
und jedem Burger unaer seinem Mueß und Brot<br />
die Kinder sonder große Spesen in den Studien erhalten<br />
und zu weiterem Glück fortgebracht, ganz zu schweigen von<br />
andern emolumentis welche dieser vorhabenden Disposition<br />
infallibiliter folgen werden..." (Erzb. Archiv Freiburg<br />
Ha 67.) Kr.<br />
Hinweis. Zu 1955 S, 20 ist nachzutragen, daß das Melchinger<br />
Fleckenbuch inzwischen im llohenzoii. Jahresheft Jg. 14,<br />
Seite 172 veröffentlicht ist. <strong>Der</strong> kleine Beitrag des Heimatblattes<br />
hätte zeitlich vorausgehen sollen, was aus technischen<br />
Gründen aber unterblieb.<br />
Ueoer „das Bruderschattswesen am Oberrhein im Spätmittelalter"<br />
schrieb Herrn. Hoberg einen 12seitiren Aufsatz<br />
im Histor. Jahrbuch der Görresgesellschaft, 72 Jg 1953, S.<br />
238 ff mit vielen Literaturangaben. Im Gebiet der Erzdiözese<br />
Freiburg, um die es sich hauptsächlich handelt, begegnen uns<br />
Bruderschaften vereinzelt seit Beginr des 15. Jahrhunderts<br />
und gingen im 16 Jahrhundert wieder unter. Die meisten<br />
sind im wesentlichen nur von Gemeinschaften getragene<br />
Anniversarien. Die „Elende Kerze" zu Ringingen dürfte wohl<br />
für die „Elenden armen Seelen" gestiftet gewesen sein, ..licht<br />
für die Fremden (1525); damals gabs auch eine solche zu Salmendingen!<br />
Interessant waren ehemals auch die silbernen<br />
Bruderschaftsabzeichen, z. B. der Pfeil des hl. Sebastian.<br />
Zu neuer Blüte erwachte das Bruderschaftswesen im 17. und<br />
18. Jahrhundert. Man vergleiche die weitgespannten Ausführungen<br />
von Herrn. Tüchle, Schwäbische Kirchengeschichtc,<br />
Bd. 2, 1954, S. 273 ff.
Hohenzollerlsche Heimat<br />
tu<br />
Vierteljahresblätter für Schule und Haus<br />
Herausgegeben vom Verein für Geschichte,<br />
in Verbindung mit<br />
Schriftleitung:<br />
Josef Wiest, Gammertingen<br />
Preis halbjährlich 0.60 DM<br />
Kultur- und Landeskunde in Hohenzollern<br />
der hohenz. Lehrerschaft<br />
Druck:<br />
Buchdruckerei S.Acker, Gammertingen<br />
Postverlagsort Gammertingen<br />
Nummer 4 Gammertingen, Oktober 1955 5. Jahrgang<br />
L Teil<br />
<strong>Der</strong> <strong>Keuper</strong> ist in seinem mittleren und oberen Teil eine<br />
ausgesprochene Waldlandschaft. Ganz mit Wald bestanden<br />
sind der Schilfsandstein, die Bunten Mergel und der Stubensandstein.<br />
<strong>Der</strong> Gipskeuper gehört in seinen oberen Teilen<br />
auch dem Walde an, der allmählich die alten Weinbaugebiete<br />
hier erobert. Auch auf den Knollenmergel ist ein ständiges<br />
Vordringen des Waldes festzustellen, so z. B. auf der Gemarkung<br />
Groisselfingen in der sogenannten „Geiß", wo in<br />
dem letzten Halbjahrhundert mehrere Hektar mit Wald bepflanzt<br />
wurden, die einst dem Ackerbau dienten oder Oedland<br />
waren. Abgerundet wird das <strong>Keuper</strong>waldgebiet nach<br />
obenhin noch durch die Wälder, welche die äußersten Ränder<br />
des anstoßenden Lias bedecken.<br />
<strong>Der</strong> Waldcharakter des <strong>Keuper</strong>s in dem angedeuteten Umfange<br />
ist in der Hauptsache durch die Geländeform und<br />
durch die Bodenzusammensetzung bedingt. Die steilen Hänge<br />
sind mit Wald bestanden, da eine andere Ausnützung des<br />
Bodens in vielen Fällen nicht möglich ist. Bei dem Stubensandstein<br />
ist die Bodenart die Hauptursache, daß er dem<br />
Wald überlassen bleibt. Doch mag auch die Lage über den<br />
vom Tale aus schwerersteigbaren Bunten Mergel bei der Erlaltung<br />
seines Waldcharakters mitwirken. Die sich auf der<br />
Liasplatte anschließenden Wälder liegen auf dem stark entkalkten<br />
Angulatensandstein und außerdem meist weit entfernt<br />
von den ¿ugehörenden Ortschaften, so daß man diese<br />
Geoiete gern dem Walde überläßt.<br />
Aus der Geologie von Hohenzollern<br />
(15. Fortsetzung)<br />
<strong>III</strong>. <strong>Der</strong> <strong>Keuper</strong><br />
Durch die starke Waldbedeckung wird die Verkehrs- und<br />
Siedlungsfeindlichkeil des <strong>Keuper</strong>gebirges, das schon durch<br />
seinen Reichtum an Schluchten und seine Neigung zu Bodenbewegungen<br />
T ür Verkehr und Siedlung hemmend wirkt, noch<br />
verstärkt, nicht minder aber auch sein Grenz- und Schutzcharakter.<br />
An ihm schieden sich einst die in ihrem Ursprünge<br />
stammesgle'chen Hohenzoller und Hohenberger. <strong>Der</strong> Streit<br />
um dieses Grenzgebiet wurde nach harten und verlustreichen<br />
Kämpfer unter Mitwirkung von Rudolf von Habsburg, desser<br />
Gemahlin eine Hohenbergerin war, dadurch geschlichtet,<br />
daß in dem strttigen Grenzgebiet zunächst ein kleiner Puffer-<br />
und Zwergstaat, die Herrschaft Hainburg, gebildet wurde,<br />
die in eine Seitenlinie der Grafen von Zollern kam, die hier<br />
in diesem Waidgebiet um das Jahr 1340 auf einer Stubensandsteinnase<br />
beim Unteren Homburger Hof eine Wald- und<br />
J igdbur;. erbauten. Die Herrschaft Hainburg umfaßte die<br />
Dörfer Grosselfingen, Owingen und Stetten bei Haigerloch,<br />
deren große Waldgebiete ganz dem <strong>Keuper</strong>gebirge angehören.<br />
Aber nicht nur in politischer Hinsicht bildeten <strong>Keuper</strong>irald<br />
'md <strong>Keuper</strong>gebirge eine Grenze, sondern auch in der<br />
Mundart. r»ls mir Professor Dr. Helmut Dölker im Januar<br />
1954 der Vorschlag machte, für den Rundfunk eine Mundartenprobe<br />
für Rangendingen oder Grosselfingen aufnehmen<br />
zu lassen, da sagte ich- Nicht Rangendingen oder Grosselfingen,<br />
sondern Bangendingen und Grosselfingen; denn die<br />
Mundarten dieser beiden, nur durch die <strong>Keuper</strong>stufe getrennten<br />
alten Marktflecken, sind derart verschieden, daß<br />
man in Ranger_dingen ausgelacht wird, wenn man den breiten,<br />
unverfälschten Grosselfinger Dialekt spricht. Bis vor<br />
3U iahren fünrte keine Straße von Rangendingen nach Grosseifingen.<br />
Als sie gebaut wurde, hatte man bei der Führung<br />
e. <strong>Der</strong> <strong>Keuper</strong> als Waldlandschaft<br />
Von Michael Walter<br />
durch den Knollenmergel im oberen Rangendinger Tal unmittelbar<br />
vor dem Austritt aus dem Wald in das Weilheimer<br />
buckelige Wiesengelände Schwierigkeiten zu überwinden,<br />
weil die vom Hang herabgleitenden Knollenmergel die Stützmauern<br />
gegen die Straße hin drücken. Aber nicht diese Geländeschwierigkeiten<br />
allein waren es, welche die Grosselfinger<br />
von dem Straßenbau abhielten, sondern die Aufhebung<br />
des Schutzcharakters des <strong>Keuper</strong>waldes und des <strong>Keuper</strong>gebirges<br />
durch die Anlegung einer Straße. „Auf den<br />
Straßen kommt der Feind ins Land"; mit diesen Worten<br />
lehnte der alte Schuhmacher Andreas Karsch von Grosselfingen<br />
jeden Straßenbau nach Rangendingen ab. Steckte in<br />
dieser schroffen Ablehnung nicht ein Körnchen Wahrheit?<br />
Hätte die Mauleselkarawane der Marokkaner Ende April<br />
1945, die so namenloses Elend in Grosselfinger Familien<br />
brachte, ihren Weg nach Grosselfingen gefunden, wenn die<br />
Straße noch nicht gebaut gewesen wäre? Alles menschliche<br />
Schaffen und Wirken hat immer eine Licht- und eine Schattenseite,<br />
wie wir an so verschiedenen Erfindungen und Errungenschaften<br />
der Neuzeit deutlich genug erkennen!<br />
In den Besitz des <strong>Keuper</strong>waldes teilen sich der Fürst von<br />
Hohenzollern, die Gemeinden, die Kirchen, Genossenschafte"<br />
und Private. Da dieses große Waldgebiet zwischen zwei waldarmen<br />
Ackerbauebenen, der Gäulandschaft und • er Liasebene<br />
liegt, so finden wir auch weiter entfernte Gemeinden<br />
und Genossenschaften als Waldbesitzer im <strong>Keuper</strong>gebiet. Die<br />
Erwerbung all dieses Besitzes aufzuklären, wäre eine reizende,<br />
aber auch sehr schwierige Aufgabe, da hier Geschichte<br />
und Sage zu einem fast unentwirrbaren Knäuel verwickelt<br />
sind. Welche Ausmaße oft die Kämpfe um den Waldbesitz<br />
und Nutzungsrechte annahmen, das zeigt rui . deutsch<br />
der Streit um den Kirnberger Wald, der um '""ie Mitte des<br />
18. Jahrhunderts zwischen 1er Gemeinden 7 :ili«,enzit iii.ern<br />
und Rosenfeld geführt wurde, der zu einem förmlichen Krieg<br />
zwischen den beiden Gemeinden ausartete. Dieser Kampf<br />
hat uns F. X. Hodler in dem 51. Jahrgang der „Mitteilungen<br />
des Vereins- für Geschichte und Altertumskunde in Honenzollern"<br />
eingehend geschildert. Manchr-al ging es a>- ;h<br />
ganz friedlich zn, so hat z. 3. Fräulein Margarei- Kessler<br />
'on Haigerloch (f 1944) den Haigerlocher Stadtwaid auf ^ ir<br />
Gemarkung Weildorf durch eine Schenkung erweitert. Die<br />
Gemeinde Iöfendorf nat ihren Gemeindewal^ im Dürrenberg<br />
auf der Gemarkung Grosselfingen erst im Lauf der<br />
letzten hundert Jahre durch allmählichen Aufkauf erwarben.<br />
Von besonderem Interesse ist die Geschichte der Walderwerbung<br />
der württembergischen Gemeinde Hirrlingen im<br />
Wolfei.iil auf der Gemarkung Rangendingen. Dieser Wald<br />
gehörte ursprünglich den Herren von Ow-Hirriingen, aie Irti<br />
Jahre 1720 ausstarben, Die Erbtochter war mit dem Reichsgrafen<br />
Anton von Attems verheiratet, der so auch in den<br />
Besitz dieses Waldes kam, wie wir heute noch an m; . ich m<br />
A auf den alten Grenzsteinen sehen können. )ie Graf ;n<br />
von Attems verkauften ihren Besitz und damit au^h den<br />
Wald im Wolfental an den Freiherrn von Wächter, 1er dänischer<br />
Gesandter in Stuttgart war. Ar dieser in Schulden<br />
kam und seinen Besitz verkaufen mußte, erwarb ihn d<<br />
König von Dänemark. So wurde der König von Dänemark
50 H O H E N Z O L L E R I S C H E HEIMAT rahrgang 1955<br />
zum Waldbesitzer in Rangendingen. Aber schon im Jahre<br />
1810 verkaufte er sein Hirrlinger Gut mitsamt dem Rangendinger<br />
Wald an den Herzog Wilhelm von Württemberg, von<br />
dem er dann an die Gemeinde Hirrlingen kam, die so Besitzer<br />
des einstigen von Owischen Waldes im Wolfental<br />
wurde und es bis heute blieb.<br />
Außer den Hirrlinger hatten oder haben noch andere<br />
„Ausländer" teil am Rangendinger <strong>Keuper</strong>wald, so die Grafen<br />
von Wolkenstein, deren Stammburg im Grödnertal in<br />
Südtirol liegt und derem Geschlecht der Minnesänger Oswald<br />
von Wolkenstein angehört. Sie hatten zeitweise die Herrschaft<br />
Poltringen (Kreis Tübingen) inne und kamen wohl<br />
als österreichische Lehensträger in den Besitz jenes Waldes<br />
auf der Gemarkung Rangendingen, der heute noch „Poltiinger<br />
Hau" heißt. Da aber die „Hochgräflichen Gnaden von Wolkenstein<br />
zu Bioltringen" oder deren Nachfolger anscheinend<br />
das auf dem Walde lastende Frongeld nicht mehr entrichteten,<br />
fiel der Wald an die Gemeinde Rangendingen, wie<br />
wir im alten Fleckenbüchlein von Rangendingen noch lesen<br />
können. So hatten also zwei alte Minnesängergeschlechter,<br />
die Herren von Ow mit dem Minnesänger Hartmann von<br />
Aue und die Herren von Wolkenstein mit Oswald von<br />
Wolkenstein einst Anteil am Rangendinger Wald.<br />
Auch die Karmeliter von Rottenburg am Neckar waren<br />
einst Teilhaber am Rangendinger Wald, das sagt uns der<br />
Name „Karmeliterwald" und zeigen uns Grenzsteine aus der<br />
Zeit des 30jährigen Krieges. Die Karmeliter hatten dafür<br />
jährlich sechs Gulden und 30 Kreuzer Frongeld an die Gemeinde<br />
Rangendingen zu zahlen.<br />
Das Rottenburger Spital besitzt heute noch den „Spitalwald"<br />
im Rangendinger <strong>Keuper</strong>wald, dessen schöne Grenzsteine<br />
aus dem 17. und 18. Jahrhundert das Zeichen des<br />
Spitals, zwei gekreuzte Krücken tragen.<br />
Wie sehr oft bei den Besitzwechseln und Walderwerbungen<br />
Sage und Geschichte durcheinander gehen, das zeigt uns ein<br />
Beispiel von Rangendingen. Die Sage weiß zu berichten, daß<br />
der Wald „Schlechtenhardt" einst einem Fürsten von Hohenzollern<br />
bei seiner Vermählung als Morgengabe geschenkt<br />
worden sei, von diesem aber sehr geringschätzig als „Schlechter<br />
Hardt" angenommen worden wäre. Das Wort „schlecht"<br />
hatte aber früher mit dem heutigen Wortsinn nichts zu tun,<br />
sondern bedeutete schlicht oder eben; der „Schlechtenhardt"<br />
ist also der „ebene Wald", und tatsächlich liegt ei auch auf<br />
der Ebene des Stubensandsteins und war schon im Jahre<br />
1435 im Besitze der Grafen von Zollern, die diesen Besitz<br />
durch spätere Zukäufe erweiterten.<br />
Aehnliche Fälle von Besitzveränderungen wie in Rangendingen<br />
lassen sich auch in anderen <strong>Keuper</strong>waldgemeinden<br />
feststellen. Es sei nur noch der „Kesselwald" ron Gruol genannt,<br />
der einst den Herren von Wehrstein gehörte, dann in<br />
die Hände der Herren von Ow und der Gemeinde Hirrlingen<br />
überging und schließlich vom Fürsten Anton Alois von Hohenzollern-Sigmaringen<br />
käuflich erworben wurde.<br />
Nicht minder vielseitig ist die Jagdgeschichte unserer <strong>Keuper</strong>wälder.<br />
Als das Schloß auf dem Lindich gebaut wurde,<br />
umzäunte man den ganzen <strong>Keuper</strong>wald vom Lindich bis<br />
zum Owinger Bauernwald zu einem Tiergarten, zu dessen<br />
Umgehung man acht Stunden brauchte.<br />
Aus dem Hexenprozeß<br />
der Adlerwirtin Katharina Memler von Melchingen<br />
Anno 1597 sitzt der Adlerwirt Michael Memler von Melchingen,<br />
Haus Nr. 99, ein aufrechter, gutgesinnter Mann, in<br />
der Gaststube, wo vor ihm, da gerade wenig Gäste da sind,<br />
3 brave Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren spielen. Herein<br />
tritt die Adlerwirtin Katharina mit ihrem Kleinsten, ihrem<br />
Liebling auf dem Arm, und es zeigt sich ein Bild von häuslichem<br />
Glück, an dem jeder Gast Freude haben konnte. Das<br />
Glück sollte allerdings nicht lange dauern. Andern Tags erkrankten-die<br />
2 ältesten Knaben an den Pocken und starben<br />
5 Tage hernach, beide in derselben Stunde. Doch nicht genug,<br />
denn kurze Zeit darauf erkrankte auch das 4i ährige Töchterchen,<br />
und auch diese Blume wurde nach wenigen Tagen geknickt.<br />
<strong>Der</strong> Vater bekam das Nervenfieber und folgte einige<br />
Wochen hernach seinen Kindern ins Grab. Untröstlich und<br />
furchtbai weheklagend wandelte und wankte die Adlerwirtin<br />
zwischen den Gräbern ihrer Toten und konnte nur mit Gewalt<br />
vom Friedhof entfernt werden. Das Schicksal aber<br />
wurde noch härter gegen sie, und in wenigen Wochen später<br />
sank auch ihr letztes Kind, bei dem sie immer wieder Trost<br />
gesucht hatte, ins Grab. — Die Adierwirtin weinte nicht<br />
mehr. Stumm und mit gepreßten Lippen und stieren Augen<br />
betrachtete sie das Kind und liebkoste es immer wieder, als<br />
wollte sie an seinen Tod nicht glauben. 2 / r age lang versagte<br />
sie sich Speise und Schlaf, Und als das Kind beerdigt werden<br />
sollte, widersetzte sie sich aus Leibeskräfter und beschwor<br />
die Anwesenden bei Gott und allen Heiligen, ihr<br />
docii ihr Einziges, ihr Liebstes, was sie noch auf Erden habe,<br />
zi lassen. Die Unglückliche mußte gewaltsam aus der Stube<br />
gebracht werden, daß man die Kindsieiche, um die siel die<br />
Adlerwirtin krampfnaft wehrte, wegnehmen konnte. — Nun<br />
wars um die Frau geschehen. — Sie kümmerte sich nicht<br />
mehr um den Haushalt, schloß sich in eine Kammer ein,<br />
grübelte und sinnierte wochenlang und versetzte sich im Geiste<br />
in den Kreis ihrer vorausgegangenen Lieben. — Nach 2<br />
Monden kam die Adlerwirtin — ganz überraschend — ins Haus<br />
ihres Nachbarn, des Kirchhofbauern und erzählte voller<br />
Freude „Hör, Marianne, jetzt bekomme ich meinen Balthas<br />
wieder! Gestern mittag stand ich in meiner Küche, da kam<br />
ein jrün gekleideter I rr, tröstete mich über mein Unglück<br />
urd sagte: . :h will dir deinen Baltas wiederbringen und<br />
äif verschaffen, was du willst, wenn du Gott und die Heiligen<br />
verleugnest. Ün ä das nabe ich eingegangen." — Schnellen<br />
Schrittes entfernte sie sich wieder. — Die Kirchenbäuerin<br />
befragte sich bei der alten Adlermagd, was das für ein Herr<br />
gewesen sei, der bei d« • Adlerwirtin gewesen wäre und ihr<br />
in der Roche solche Versprechungen gemacht hätte. Die<br />
Adlermagd mußte ihr zur Antwort geben, daß niemand da-<br />
von Matthias Heinzelmann<br />
gewesen wäre und daß sich die Adlerwirtin schon monatelang<br />
nicht mehr in der Küche gezeigt hätte. -— Als die Kirchhofbäuerin<br />
den Vorfall ihrem Mann erzählte, verbot ihr<br />
dieser, irgend jemand etwas davon zu sagen, da die Adlerwirtin<br />
in ihrem Schmerz doch nicht mehr zurechnungsfähig<br />
sei. Die Kirchhofbäuerin konnte den Mund nicht halten<br />
und erzählte das Vorgefallene ihren Freundinnen. Die erste<br />
gab dem grünen Herrn noch einen Bockfuß bei und die zweite<br />
machte ihm auch noch Hörner. — Kurz und gut! In einer<br />
Woche wußte das ganze Dorf, daß die Adlerwirtin mit dem<br />
leibhaftigen Gottseibeiuns einer Pakt abgeschlossen hätte<br />
und von ihm erhalte, was sie wünschte. — Die Adierwirtin<br />
lebte wieder auf, denn sie hoffte. — Sie ging wieder zu den<br />
Leuten und in die Wirtschaft, — aber die Leute mieden sie<br />
und ihr Haus. — Als sie eines Tages unter aer Haustüre<br />
stand und zwei vorübergehende Frajen einlud zu ihr zu<br />
kommen und die eine d-.von Miene machte, der Einladung zu<br />
folgen, rief die andere: „Hab doch nichts mehr mit der Hexe<br />
zu tun und laß sie stehen!" Da fiel es der Adlerwirtin wie<br />
ein Schieier von den Augen und sie rief zornig: „Ihr gottlosen<br />
Personen! Wenn es eine Gerechtigkeit gibt, dann wird<br />
eure Bosheit noch gestraft, in der ihr ein unglückliches Weib<br />
noch verhöhnt." — Da nach einer Woche bei jeder der beiden<br />
Frauen die beste Kuh im stalle einging, war die Drohung<br />
der Adierwirtin in Erfüllung gegangen, und diese<br />
mußte also doch nun eine Hexe sein, da sie die Machte hatte,<br />
den Leuten Loses zuzufügen bezw. weil durch den Bund mit<br />
dem bösen Geist ihre böswilligen Wünsche in Erfüllung<br />
gingen. —<br />
Die Geschichte machte großes Aufsehen in Melchinten und<br />
in der ganzen Umgebung und kam dem Schultheißen von<br />
Melchingen zu Ohren. Als er eines Abends in voller Bekümmernis<br />
und Ratlosigkeit über den Fall ?u Hause saß, k?m<br />
der Dorfknecht (Polizeidiener) zu ihm und erzählte, daß der<br />
Graf von Hohenzollern 20 Soldaten unter Pünrung eines<br />
Leutnants nach Ringingen geschickt hätte, weil die Rin 'irger<br />
in den Hechinger Forsten gewildert hätten. Die Wilderer<br />
seien gestern mit der Fioirstwache zusammengestoßen. Sechs<br />
Soldaten seien gefallen, der Leu tnant sei verwundet, aber<br />
auch die Ringinger seien elendiglich zu Schanden geschossen<br />
worden.. — „<strong>Der</strong> Fall ist schlimm", sagte der Schultheiß,<br />
„und würde mich interessieren, wenn wir selber im Dorfe<br />
licht noch Schlimmeres hätten." — „Ach so, der Fall mit<br />
der Adierwirtin", entgegnete der Dorfknecht, — „die ist und<br />
bleibt eine Hexe! Sie hat den beiden Frauen ihre Kühe verhext,<br />
hat 2in vorübergehendes Kind grimmig angeschaut,<br />
daß es nach dem Nachhausekommen krank ins Bett gebracht
Jahrgang 1955 HOHENZOLLERISCHE HEIMAT 51<br />
werden mußte und die Schweine in der ganzen Nachbarschaft<br />
verwünscht, daß viele krank und schon mehrere eingegangen<br />
sind. Die Leute meiden die Wirtin und gehen, wie<br />
ich selbst auch, nicht mehr am Adler vorbei, weil alles weiß,<br />
daß die Käther eine Hexe ist." „Was soll ich. tun?" entgegnete<br />
in seiner Aufregung der Schultheiß. „Ich fürchte mich,<br />
mich mit Hexen einzulassen. So schlimm wird es denn doch auch<br />
nicht sein. Bedenket doch, was die Adlerwirtin in der letzten<br />
Zeit alles gelitten und mitgemacht hat und ich soll sie jetzt<br />
noch auf den Scheiterhaufen liefern?" „Ach, so schnell wird<br />
das gerade doch nicht gehen," erwiderte der Jörg. „So",<br />
antwortete der Schultheiß, „weißt du, wie es dem Steublin<br />
vor 10 Jahren erging?" „Ich war," entgegnete Jörg, „damals<br />
in der Fremde und kenne den Fall nicht genau, erzählt mir<br />
davon." <strong>Der</strong> Schultheiß stand auf, durchsuchte einen Pack<br />
Papiere und sagte: „Jörg, ich habe hier das Protokoll, das<br />
will ich dir vorlesen:"<br />
„Vrgicht. (d. h. Bekenntnis) Bastian Steublin von Meldungen<br />
guetlich und Peinlich bekhandt 21. März 1588.<br />
1. Erstlich habe er vor Etlich Jahren einem Schuemacher<br />
zue Hechingen ein Paar Schue abgekauft und ein Paar kleine<br />
Schue dazu gestollen. 2. Hin und wieder bis in die 20 Layb<br />
Broth gestollen, die er mit seinem Weib und Kindern verspeiset.<br />
3. Item Ainem Küfer zu Trochtelfingen ain klains<br />
Kübelein gestollen. 4. Als er in einer Nacht off seinem Lotterbett<br />
gelegen, da sey der böse Geist in höflicher Gestalt<br />
zu ihm khommen ond habe ihn befragt, ob er sein aygen<br />
sein wolle. <strong>Der</strong> Steublin habe dies bejahht, darauf habe der<br />
böse Geist begehrt, er solle sich Gottes, Allerheiligen ond<br />
des himmlischen Heeres verleugnen, was er auch getan. Nun<br />
haben sie sich die Hände geboten, worauf Steublin von dem<br />
Teufel 2 Gulden Baslergeld empfangen. Dann trug ihm der<br />
böse Geist auf, eine Scheuer anzuzünden, was er auch getan.<br />
Aber alldieweil man das Feuer bald bemerkte, wurde es gelöscht<br />
und kam nicht zum Ausbruch. 5. <strong>Der</strong> böse Geist gab<br />
ihm eine Salbe, er schlüge damit seinen Nachbarn im Namen<br />
des Teufels auf die Achsel, um ihn zu lähmen, gelang aber<br />
nicht. Er versuchte dasselbe auch bei anderen Leuten, richtete<br />
aber nicht viel damit aus. 6. Hielt einen Roßbuben an,<br />
seinem Meister Frucht zu stehlen, wofür er ihm 2 Batzen<br />
bezahlte. 7. <strong>Der</strong> Teufel brachte ihm wieder 2 Gulden, darunter<br />
der ain nit guet geweset.<br />
Urtheil:<br />
Daß Ermellter Bastian Steublin dem Nachrichter an sein<br />
Handt und Bandt geandtwurtet, wurde derselbe Ime Alßdann<br />
seine handt off den Buekhen Binden, demnach hinauß<br />
an die gewohnlich Richtstatt führe, Daselbsten Im mit feuer<br />
vom Leben zum Tode Richten ond Bringen, fürter auch sein<br />
Toter Cerpel zu Pulver ond Aschen verprennen und dieselbe<br />
begraben sollte. Auf geschehene Fürbitte wurde Malcfikmt<br />
zum Schwerdte begnadigt ond hingerichtet d. 29. März 1588."<br />
Nach einer kleinen Weile sagte Jörg: „Schultheiß, ich will<br />
ei ch sagen, wie wir die Sache nun angehen wollen. Mir<br />
scheint es, die Wirtin steht nicht allein, es ist ein ganzes<br />
Kor ilott, das den Flecken ruinieren will. Ich will hehlings<br />
die Teufelsges^Ien, die mit der Adlerwirtin im Bund stehen<br />
und im Adler aus- und eingehen, beobachten und mich<br />
mit dei Adlermagd, die eine Bas ! von mir ist, ins Vernehmen<br />
setzen una werde euch bald Neues mitteilen." Darauf<br />
verließ er die Stube des Schultheißen.<br />
E . vergingen einige Wochen und neues Unheil trug sich im<br />
Dorfe zu. Mehrere Kinder erkrankten plötzlich und eines<br />
starb. Nachdem behauptet wurde, diese Kinder hätten alle<br />
in der 1 .tzten Zeit ir Adler Getränke geholt, mußte ihnen die<br />
Adierwirtin ein ^eid zugefügt haben. Weiter erkrankte eine<br />
Anzahl Stück Vie> w
52 HOHENZOLLE Ii ISCHE HEIMAT Jahrgang i955<br />
scheinen würden, so die ganze Sache nicht so furchtbar tragisch<br />
und ernst gewesen wäre. — Die Adlerwirtin erkannte,<br />
daß sich die Menschen, aber noch mehr die Tatsachen gegen<br />
sie verschworen hatten. Die in Melchingen vorgekommenen<br />
Unglücksfälle konnte sie nicht bestreiten, konnte aber ihre<br />
Schuldlosigkeit daran auch nicht beweisen. Ihre Lage und<br />
der Schrecken waren die Ursache, daß sie fast zusammenbrach<br />
und über Nacht graue Haare bekam. Als sie gefragt<br />
wurde, was sie gegen die Zeugenaussage der Magd zu e:<br />
widern hätte, konnte sie lange kein Wort hervorbringen,<br />
erwiderte jedoch zuletzt: „Ich bin unschuldig an all dem, was<br />
man mir zur Last legt; ich stelle namentlich entschieden in<br />
Abrede, mit dem bösen Geist ein Bündnis eingegangen zu<br />
haben." <strong>Der</strong> Richter: „Laßt ihr das Zeugnis eurer Magd<br />
nicht gelten, habt ihr dieselbe als Lügnerin erfunden? Die<br />
Adierwirtin. „Ich habe die Magd noch an keiner Lüge ertappt,<br />
was sie aber hier über mich aussagt, ist vollständig<br />
unwahr." — Er: „Wenn ihr also sagt, eure Magd lügt nicht,<br />
dann ist auch das wahr, was sie über euch aussagt oder was<br />
für ein Beweggrund möchte wohl hinter diesen Aussagen<br />
stecken?" Sie: „Das weiß ich nicht, aber ich rufe Gott zum<br />
Zeugen an, daß ich an allem, was man mir vorwirft, unschuldig<br />
bin." Er: „Gut, ich werde euch Zeit geben, über die<br />
Sache nachdenken zu können. Führt die Angeschuldigte zurück'ins<br />
Gefängnis." — Dies geschah. — In der Zwischenzeit<br />
wurden zwei weitere Zeugen gegen die Adlerwirtin verhört,<br />
die die Angaben der Magd bestätigten, sodaß sich die<br />
Lage für die Angeklagte steigerte, und der Richter glaubte<br />
nun, die Angeklagte ohne weiteres verurteilen zu können. —<br />
Nach 20 Tagen ließ er sie Vorführesa. Er entbot den Scharfrichter,<br />
der ihn mit seinem fürchterlichen Apparat unterstützen<br />
sollte. — Im Seelenzustand der Adlerwirtin war eine<br />
große Veränderung vorgegangen. Sie wußte, um was es ging<br />
und war entschlossen und gefaßt, ihre Unschuld bis in den<br />
Tod zu verteidigen. <strong>Der</strong> Richter stellte sich als vollständig<br />
überzeugt von ihrer Schuld und betrachtete nun den Widerstand<br />
als eine Beleidigung seiner Amtsehre und seiner Persönlichkeit.<br />
Er wollte also die Angeklagte ihrer Schuld überführen<br />
und sie deshalb verurteilen. In seiner Kanzlei erwartete<br />
er die Angeklagte, die vorgeführt wurde. Er fragte<br />
sie kurz, ob sie bekennen wolle, Auf ihre entschiedene Erklärung,<br />
daß sie nichts zu bekennen hätte, ließ er sie kurzerhand<br />
in die Folterkammer abführen. In dem dunklen<br />
Gewölbe brannten einige Lampen, auf dem Tisch lager die<br />
Folterwerkzeuge. Richter, 2 Beisitzer, Schreiber, Gerichtsdiener<br />
und Wächter waren zugegen. Es herrschte die Stille<br />
des Grabes. — Das geschwärzte Gewölbe war von dicken<br />
Mauern, so daß kein Schrei der Unglücklichen nach außen<br />
dringen konnte. <strong>Der</strong> Richter eröffnete an Katharina Memler,<br />
daß sie der Hexerei überführt sei, bisher aber geleugnet<br />
habe und daß sie nunmehr bekennen solle, damit ihr Bund<br />
mit dem Teufel gelöst werden und ihre Seele zu Christo<br />
zurückgeführt werden könne. Man hätte in ihrem Hause in<br />
Melchingen eine Hexensalbe gefunden und iamit sei erwiesen,<br />
daß sie eine Hexe und somit des Todes schuldig sei.<br />
Sie solle bekennen, damit ihre Glieder nicht-durch die Folter<br />
zerrissen werden müßten. Katharina Memler erwiderte hierauf:<br />
„Herr Richter! Mein Gewissen bezeugt mir, daß ich<br />
unschuldig bin, und meiner Ehre und meines Rufes wegen<br />
werde ich keine Missetat eingestehen, die ich nicht begangen<br />
haue. <strong>Der</strong> allmächtige Gott wird mich stärken, die unvt<br />
dienten Qualen zu ertragen. Die Salbe, von der Sie sprachen,<br />
ist nichts anderes als eine Salbe gegen Brandwunden. Weiter<br />
habe ich nichts zu sagen." <strong>Der</strong> Richter, verärgert über diese<br />
Entgegnung, übergab die Unglückliche dem Scharfrichter.<br />
Nachdem auch auf seine Aufforderung zu bekennen, die<br />
Adierwirtin die Wahrheit beteuerte, wurden die Folterwerkzeuge<br />
in Anwendung gebracht. Sie wurde auf den Schemel<br />
gesetzt, die Arme wurden ihr rückwärts gezogen und ihre<br />
Daumen in Eisenstangen gelegt und zugeschraubt sodaß ihr<br />
spitze Zacken in die Daumen eindrangen und das Blut herabträufelte.<br />
Die Unglückliche schrie entsetzlich, blieb aber auf<br />
weitere^ Befragen bei ihren gemachten Aussagen. <strong>Der</strong> Aktuar<br />
mußte das aei Hexenfoltern übliche Gebet verrichten. Als<br />
die Angeklagte auch hierauf nicht zugab, wurden ihr die<br />
Schnüre öfters um die Arme gewunden und so angezogen,<br />
daß sie tief in das Fleisch eindrangen und dasselbe hoch<br />
zwischen den Schnüren hervorquoll. Die Gefolterte jammerte<br />
furchtbar und schrie: „Hört doch auf ich will alies sagen,<br />
was ich von Hexerei weiß." Ais die Folter aufhörte und sie<br />
befragt wurde, erwiderte sie: „Ich habe keine Hexerei verübt,<br />
nur habe ich von meiner Großmutter das Spruchlein<br />
geger Gicht gelernt: „Turteltäubchen ohne Gallen, liebes<br />
Grchtchen du sollst fallen" und weiter weiß ich absolut nichts<br />
einzugestehen." — Als der Richter voil Zorn die Schnüre<br />
wieder anziehen ließ und die Gequälte vor Schmerz auf die<br />
Zähne biß und die Lippen bewegte, fragte sie der dichter,<br />
warum sie das tue. Sie antwortete: „Weil ich eine Christenfrau<br />
bin, bete ich in meiner Not zu Gott, und ich kann keine<br />
Unwahrheit zugeben und diese Lugen gegen mich bejahen."<br />
Nun befahl der Richter, sie auf die Leiter zu binden. Mit<br />
einer Walze wurden ihre Körperglieder so auseinandergezogen,<br />
daß ihre Gelenke krachten und die Muskeln, Sehnen<br />
und Knochenbänder sich ausrenkten; eine ganze Viertelstunde<br />
lang, denn länger durfte diese Tortour nicnt angewandt<br />
werden. Die Adlerwirtin schrie und jammerte herzzerreißend<br />
in ihren Schmerzen und furchtbaren Qualen.<br />
Als der Richter ihr zurief, ob sie bekennen wollte, gab sie in<br />
Verzweiflung zur Antwort, sie wolle bekennen. — <strong>Der</strong> Richter<br />
befahl: „Scharfrichter, hört auf!" <strong>Der</strong> Aktuar nahm das<br />
Protokoll auf. — Die Untersuchung war geschlossen. — Das<br />
bleiche Schicksal traf jene Weiber, welche man als die Mit-<br />
.huldigen der Adlerwirtin betrachtete: Agathe Huber und<br />
Anna Burkhart. Auch sie weigerten sich anfänglich, die 3escnuldigungen<br />
zu bejahen. Als ihnen die Folterwerkzeuge<br />
angelegt wurden, erklärten sie aber alles zu bejahen, was<br />
man von ihnen verlangte. So taten sie auch unc' hätten am<br />
Ende noch zugegeben, daß sie an der Sündflut oder der Erschaffung<br />
der Welt schuldig gewesen wären, wenn man es<br />
ihnen zur Last gelegt hätte. Man war glücklich und atmete<br />
erleichtert auf, ais man auf einmal mehrere Hexen dem Gerichte<br />
zur Bestrafung überliefern konnte. Das noch vorhandene<br />
amtliche Protokoll führt noch folgende mit Namen auf:<br />
Barbara Schmidin, Margarethe Kromerin, Barbara Emlerin<br />
und Anna Felekin von Salmendingen, dann Anna Klinglerin<br />
und Barbara Schweizerin von Ringingen. Diese unglücklichen<br />
Frauen wurden ohne viel Umstände samt und sonders zum<br />
Feuertod verurteilt. „Da hat uns aber", berichtet der betreffende<br />
Beamte, „die Katharina Memlerin, Wirthin von Melchingen,<br />
zum thail böse Arbeit machen wollen, indem sie<br />
die andern Weiber dafür beredt, ihre Bekenntnisse zurückzunehmen;<br />
zwei Weiber haben aber nit zugestimmt, sondern<br />
sind standhaft geblieben." — Das Gericht mußte nun zurückgestellt<br />
werden. <strong>Der</strong> Richter versuchte wieder alle Schreckund<br />
Drohmittel, und so brachte man es wieder soweit, daß<br />
alle Weiber, mit Ausnahme der Adlerwirtin, das gewünschte,<br />
reumütige Bekenntnis ablegten. Infolgedessen wurden am<br />
27. Juni 1598 diese acht Weiber auf dem Kallenberge in<br />
Trochtelfingen zu Pulver und Asche verbrannt. „Sie starben,"<br />
heißt es in den Akten, „geduldig und christlrch. <strong>Der</strong> Allmächtige<br />
Gott verzeihe ihnen semptlich Ire synden und Unrechtueng."<br />
—<br />
Ueber die Adlerwirtin wurde ein neues Gericht mit 7 unparteiischen<br />
Zeugen gehalten. Natürlich gab es auch für sie<br />
keine Rettung. Sie wurde ungeachtet ihres Widerspruchs<br />
ebenfalls zum Scheiterhaufen verurteilt. — <strong>Der</strong> zur Hinrichtung<br />
bestimmte Tag nahte heran. — Drei Tage vorher wurde<br />
es der Adlerwirtin eröffnet und nahegelegt, sie soile sich<br />
christlich darauf vorbereiten. Zugleich wurde ihr ein Geistlicher<br />
zugewiesen, der ihr die Beichte abnehmen sollte. Die<br />
Adlerwirtin, im Hochgefühl ihrer Unschuld erwiderte:<br />
„Hochwürdiger Herr! Wenn ihr mich auch als eine Uebeltäterin<br />
betrachtet, so muß ich wohl darauf verzichten, aus<br />
eurem Munde die Tröstungen unserer hl. Religion zu empfangen.<br />
Ich erkläre auch euch, daß ich an all dem, was mir<br />
zur Last gelegt wird, so unschuldig oin wie sie." Als nach<br />
einem weiteren Versuch des Geistlichen die Wirtin bei ihrer<br />
Gesinnung blieb, verließ der Geistliche die Arme, und sie<br />
mußte auf ihrem letzten, schweren Gange die Tröstungen<br />
der Religion entbehren. — <strong>Der</strong> Hinrichtungstag brach an. —<br />
Da die Adlerwirtin weitum bekannt war, kamen Leute aus<br />
allen Himmelsrichtungen. 6000 Personen hatten sich in Trochtelfingen<br />
eingefunden. Auf der Richtstätte war ein Holzstoß<br />
errichtet. Morgens 9 Uhr bewegte sich ein langer Zug aus<br />
den Toren der Stadt; voran die Beamten und Gemeindebehörden,<br />
dann die Verurteilte in schwarzes Gewand gehüllt,<br />
begleitet von der Bewaffneten. Auf dem Richtplatz angekommen,<br />
verlas der Richter folgendes Urteil: „Sintemalen<br />
die Adlerwirtin Katharina Memlerin von Melchingen sich<br />
durch die List des Satans zu Hex und Zauberei hat verleiten<br />
lassen, dieses abscheuliche Verbrechen auch gerichtlich<br />
einbekannt, solches aber wiederum geläugnet hat, dann<br />
durch 7 unparteiliche Zeugen ihrer missetat überwiesen woran:<br />
sc hat das hießige, gräflich fürstenbergische Gericht zu<br />
Recht erKannt, daß besagte Katharina Memlerin durch Feuer<br />
vom Leben zum Tod gebracht werden solle." — Dann brach<br />
der Richter einen Stab und warf ihn der Verurteilten vor die<br />
Füße mit den Worten: „So soll euer Leben gebrochen wer<br />
den. — Meister Sepp! Waltet eures Amtes." — Dei Scharfrichter<br />
ergriff das Opfer. Die Aderwirtin suchte ihn von<br />
sich zu wehren und bestieg freiwillig den Holzstoß. — Hier<br />
stand nun das unglückliche Weib, — totenbleich, aber gefaßt.
Jahrgang 1955 H O H E N Z O L L, E R I S C H E HEIMAT 53<br />
— Es herrschte Totenstille, — aller Augen waren auf sie<br />
gerichtet. — Da begann sie: „Ich sterbe unschuldig. — Hier<br />
im Angesichte des Todes bekenne ich: Vor Gott bin ich eine<br />
Sünderin, aber die Menschen haben mir nichts vorzuwerfen;<br />
ich habe keines der Verbrechen verübt, um deren Willen<br />
man mich verurteilt hat. Ich verzeihe allen, die mich aus<br />
Unverstand angeklagt haben, lade aber jene vor den Thron<br />
Gottes, die mich aus Bosheit dem Tode überlieferten.<br />
Eine mächtige, emporsteigende Rauchsäule erstickte ihre<br />
Stimme. — Nach wenigen Augenblicken sank sie nieder und<br />
die Flammen schlugen über ihr zusammen. —• Das Feuer<br />
hatte sie aufgenommen. —<br />
Ein dumpfes Gemurmel ging durch die bisher lautlose<br />
Volksmenge. <strong>Der</strong> Richter setzte unter das Protokoll die<br />
Worte: „Ist zu besorgen, genannte Katharina sei übel gefahren."<br />
— Georg Breßamer, der unglückliche Schneidergeselle<br />
aus der Mark Brandenburg, wurde bald nachher durch<br />
das Schwert hingerichtet.<br />
i L t b 1 - Hundert Jahre Pfarrkirche in Hausen am Andelsbach<br />
Die Pfarrkirche in Hausen a. A. kann heuer ihr hundertjähriges<br />
Jubiläum feiern. Sie ist die dritte Kirche in der Geschichte<br />
der Pfarrei. Ueber die erste Kirche fehlen zwar zuverlässige<br />
geschichtliche oder urkundliche Nachweise, doch<br />
darf man mit Sicherheit annehmen, daß die Pfarrei, die erstmals<br />
im Jahre 1275 urkundlich genannt wird, schon im 12. bis<br />
14. Jahrhundert ein Kirchlein oder eine Kapelle gehabt hat.<br />
Das eine aber wissen wir, daß damals auf dem Frauenberg<br />
eine Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes gestanden hat.<br />
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts, in der Zeit der ausgehenden<br />
Gotik, ist dann die zweite Kirche mit dem heute noch stehenden<br />
Kirchtum erbaut worden. Nachdem Bittelschieß schon im<br />
Jahre 1429, bis dahin selbständige Pfarrei, und Ettisweiler im<br />
Jahr 1822, vorher Filialort von Zell a. A., als Filialen der<br />
Pfarrei Hausen incorporiert worden waren und die Einwohnerzahl<br />
des Kirchspiels stark zugenommen hatte, war<br />
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie der Chronist<br />
schreibt, das alte Kirchlein für die Bedürfnisse der Pfarrei<br />
zu klein geworden. Es war auch baufällig, und so mußte es<br />
im Jahre 1853 abgebrochen werden, um einer neuen größeren<br />
Kirche Platz zu machen. Nur die alte 1758 erbaute Sakristei<br />
blieb stehen. <strong>Der</strong> Neubau, von Pfarrer und Kammerer Johann<br />
Georg Engel mit Energie betrieben, wurde im Mai 1853<br />
in Angriff genommen. Um das Zustandekommen und die<br />
Durchführung des Neubaues haben sich auch der Patronatsherr<br />
der Kirche, Fürst Carl-Anton von Hohenzollern-<br />
Sigmaringen, und Regierungspräsident von Sydow verdient<br />
gemacht.<br />
Die Pläne für den Neubau wurden vom Fürstl. Hofkammerbauinspektor<br />
Josef Laur gefertigt. Die Aufsicht und Leitung<br />
der Bauarbeiten lagen bei Bauführer Eduard Hanner aus<br />
Gammertingen. Die Maurer-, Zimmer- und Schreinerarbeit in<br />
wurden von einheimischen Meistern ausgeführt. Das Holz<br />
lieferte der Patronatsherr aus den herrschaftlichen Waldungen,<br />
die Bausteine Johann Viktor Seeger aus seinem Steinbruch<br />
an der Straße nach Pfullendorf. Meister von Sigmaringen,<br />
Krauchenwies und Rulfingen besorgten die Glaser-, Schlosserund<br />
Steinhauerarbeiten. Zur Einebnung des Bauplatzes sowie<br />
zum Kirchenbau selbst haben die Angehörigen der zum<br />
Krrchspiel gehörenden drei Gemeinden verständnisvoll und<br />
aufgeschlossen für deren Notwendigkeit und in bestem friedvollen<br />
Einvernehmen Frondienste geleistet. Am 16. Juni 1853<br />
konnte in einem feierlichen Akt der Grundstein zur rechten<br />
Seite des westlichen Hauptportals gelegt werden. <strong>Der</strong> Grundstein<br />
enthält in einer kupfernen Kapsel eine Pergamenturkunde<br />
mit eingehenden Angaben über den Kirchenbau,<br />
über die Verwaltung der Pfarrgemeinde und die Verhältnisse<br />
der politischen Gemeinde, über das Einkommen der<br />
Pfarrpfründe, weitere interessante, teilweise weit ausholende<br />
Ausführungen und Gedanken über die allgemein wirtschaftlichen,<br />
politischen und sozialen Verhältnisse in Deutschland,<br />
soweit sie irgendwie die Heimatgemeinde berührten. In die<br />
Kapsel wurden außer der Pergamenturkunde an Geldmünzen,<br />
Kreuzer und Gulden der damaligen Währung eingelegt. Als<br />
Zeugen der Grundsteinlegung sind in der vom 12. Juni 1853<br />
datierten Urkunde genannt: Pfarrer und Kammerer Johann<br />
Georg Engel; Josef Laur, Hofkammerbauinspektor von<br />
Sigmaringen; Eduard Hanner, Bauführer von Gammertingen;<br />
die Bürgermeister Willibald Mayenberger in Hausen, Johann<br />
Vogler in Bittelschieß und Bernhard Fischer in Ettisweiler.<br />
<strong>Der</strong> Gottesdienst wurde während der Bauzeit zunächst in<br />
einer auf dem Gottesacker beim Oelberg errichteten Holzhalle,<br />
später in dem wenigstens trockenen und gegen Regen<br />
und Schnee geschützten Rohbau gehalten.<br />
Das in seiner großzügigen Raumgestaltung eindrucksvolle<br />
Langhaus mit Rundbogenfenstern steht — in West-Ostrichtung<br />
— beherrschend auf der Höhe im Oberdorf am südlichen<br />
Talhang, auf dem östlichen Ausläufer des Frauenberges.<br />
Imponierend ist der in edler, ausgeglichener Rundung<br />
sich hoch aufschwingende Chorbogen, der das 29 m lange, 17<br />
m breite und 9,5 m hohe Langhaus mit dem Chor verbindet.<br />
Je fünf Säulen in der rechten und linken Langhaushälfte<br />
stützen die flach gewinkelte Satteldecke, die links mit Bildnissen<br />
Moses und der vier großen Propheten Isaias, Jeremias,<br />
Daniel und Ezechiel, rechts mit Bildnissen Christi und der<br />
vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes,<br />
geziert war.<br />
<strong>Der</strong> erst im Jahre 1865 aufgestellte Hochaltar in neugoticher<br />
Form mit einer Statue der Hl. Ottilie, der Kirchenpatronin,<br />
auf aer Evangelienseite und einer solchen des Hl.<br />
Bischofs Erhard auf der Epistelselte, war ein Werk der kirchlichen<br />
Kunstwerkstätte Marmon in Sigmaringen, gestiftet von<br />
Pfarrei und Dekan Engel.<br />
<strong>Der</strong> rechte Seitenaltar bekam als Xvlittelfigur eine aus<br />
Lindenholz geschnitzte Statue des Hl. Petrus, des zweiten
54 H O H E N Z O L L E R I S C H E H E I M A T sa Ti 1^55<br />
Kirchenpatrons. Sie war eine Früharbeit des damals 23-jährigen<br />
Peter Lenz aus Haigerloch, des Begründers der Neuroner<br />
Kunstschule und späteren Benediktinerpaters Desiderius<br />
Lenz, rechts und links davon Statuen des Hl. Antonius von<br />
Padua und des Hl. Franz von Assisi. Das Hauptbildwerk des<br />
linken Seitenaltars war eine Marienfigur von Bildhauer<br />
Blaim aus München, flankiert von Statuen des Hl. Johannes<br />
von Nepomuk und des Hl. Franziskus Xaverius.<br />
Die Säulen und Wände des Langhauses tragen in halber<br />
Höhe Statuen der zwölf Apostel, Gipsabgüsse der bekannten<br />
Apostelreihe in Blutenburg bei München, der als typischem<br />
Werk der deutschen Holzschnitzerei des ausgehenden Mittelalters<br />
in der christlichen Kunst künstlerische und kulturgeschichtliche<br />
Bedeutung zukommt. Das alte Hochaltarbild<br />
von Maler Fuchs aus Saulgau (1723): die Hl. Ottilie als Aebtissin<br />
mit der Hl. Familie, bekam nach Restaurierung durch<br />
Kunstmaler Fidel Schabet in Waldsee, dem Schöpfer der<br />
Deckengemälde in der Stiftskirche Hechingen, seinen Platz<br />
im Chor an der Wand gegen den Turm. An der nördlichen<br />
Langhauswand war das Wallfahrtsbild der schmerzhaften<br />
Muttergottes, ein Holzbildwerk aus der Zeit um 1420, das in<br />
der alten Kirche auf dem Marienaltar gestanden hatte, angebracht.<br />
Die gleiche Langhauswand zierte die aus der alten<br />
Kirche übernommene Kreuzigungsgruppe: ein Kruzifix mit<br />
den Statuen der Muttergottes und des Hl. Johannes, eine in<br />
künstlerischer Hinsicht wertvolle Schöpfung aus dem 17.<br />
Jahrhundert. Sie soll von den Angehörigen der Pfarrgemeinde<br />
zum Dank dafür gestiftet worden sein, daß das<br />
Dorf im dreißigjährigen Krieg von größeren Schäden und<br />
Greueln verschont geblieben ist. Auch die Hiolzstatuen der<br />
Hl. Katharina und der Hl. Verena, die im Chor zu Seiten des<br />
Hochaltars angebracht wurden, stammen aus der alten Kirche.<br />
Den oder die Schöpfer dieser Bildwerke muß man wohl in<br />
Künstlerkreisen des oberschwäbischen Raumes suchen. Weiter<br />
sind aus der alten Kirche die Kreuzweg-Stationsbilder in die<br />
neue Kirche übernommen worden. Die beiden Chorfenster<br />
zeigten in kräftigen, leuchtenden Farben in Lebensgröße<br />
Herz-Jesu- und Herz-Mariä-Bilder.<br />
Aus der Zeit um 1754 stammt eine Votivtafel auf der<br />
Empore an der Rückwand, das Bildnis der Ehefrau Barbara<br />
des Franz Josef von Wocher mit einem Wickelkind auf dem<br />
Schoß, in Oel auf Leinwand gemalt. Wertvoller als das Bildnis<br />
ist der ungewöhnlich reichgeschnitzte, vergoldete Rahmen<br />
mit Akanthus, Weintrauben und Blumen. Die Familie von<br />
Wocher aus Vorarlberg war von 1688 bis 1816 neben dem<br />
Fürsten von Hohenzollern-Siemaringen Kompatron der Pfarrkirche.<br />
(Franz Josef von Wocher hat zusammen mit dem<br />
Arzt Jakob Hermann Obereit aus Lindau 1755 in Schloß<br />
Hohenems in Vorarlberg die jetzt im Fürstenbergischen Archiv<br />
in Donaueschingen befindliche Handschrift C des<br />
Nibelungenliedes entdecKt.) Das Bild wurde gestiftet zum<br />
Dank für die Errettung aus Seenot bei einer stürmischen<br />
Fahrt über den Bodensee. Anstelle der alten Orgel aus dem<br />
Jahre 1763 von Orgelbauer Aichgasser. Ueberlingen, die beim<br />
Abbruch der alten Kirche um 280 Gulden nach Hoßkirch verkauft<br />
worden ist. wurde im Jahre 1857 eine neue Orgel aus<br />
der Orgelbauwerkstätte Josef Klingler in Stetten bei Haigerloch<br />
mit '¿is Registern um 2322 Gulden angeschafft. <strong>Der</strong> Neubau<br />
der Kirche ist zum Patrozinium 1855, demFesi der Hi.<br />
Ottilie, vollendet worden. Die neue Kirche wurde am 17,<br />
August 1869 vom Hochwürdigsten Herrn Weihbischof Lothar<br />
Kübel eingeweiht, nachdem sie vom damaligen Ortspfarrer<br />
und Dekan Engel schon zum Ottilienfest 1859 benediciert<br />
worden war. Die Ausmalung und Innenausstattung der Pfarrkirche<br />
wai nach neunzig Jahren für das seitdem von Grund<br />
aus gewandelte und anspruchsvoller gewordene Kunstempfinden<br />
recht veraltet, und wenn mai noch sehen mußte,<br />
wie am Innenraum sich immer mehr Schäden zeigten, so war<br />
es an d°r Zeit, eine umfassende Renovation des Gotteshauses<br />
vorzunehmen, um der Kirche 'tls geweihten Stätte des Betens<br />
und der frommen, erhebenden Andacht eine ihr gemäße<br />
würdige Ausgestaltung zu geben. Aus dieser Notwendigkeit<br />
heraus ist 1946 und 1947 eine Renovation durchgeführt<br />
worden, die nach ihrer Vollendung aufs höchste überrascht<br />
und Langhaus und Chor in beglückender Schönheit neu erstehen<br />
läßt.<br />
Ansteile der alten, kleinen, dem Chor ostwärts angebauten<br />
Sakristei ist ein neuer, geräumiger zweigeschossiger Sakristeibau<br />
erstellt worden. De" Raum im Obergeschoß dient<br />
als Sakristei, der Raum im Untergeschoß als Gemeinschaftsund<br />
Versammlungsraum für Vorträge, Schulungen, für Unterricht<br />
« der religiöse Feiern in kleinem Rahmen. Mit dem Neubav<br />
der Sakristei wurde der Einbau einer Luftheizung für<br />
die Kirche verbunden. Das Langhaus bekam eine neue Flach-<br />
decke. <strong>Der</strong> Boden des Chol es, der vorher fast in gleicher<br />
Ebene mit dem des Langhauses lag, wurde um sechs<br />
Treppenstufen höher gelegt, so daß sich dem Kirchenbesucher<br />
jetzt eine freie Schau auf den Hochaltar bietet. Weiter wurde<br />
der alte Hochaltar, der in neugotischer Form mit einer unruhigen<br />
Häufung von Türmchen, Fialen und -Nischen und mit<br />
den zwei einfachen Heiligenfiguren veraltet war, durch einen<br />
würdigen Hochaltar in schlichter, geschmackvoller Ausführung<br />
ersetzt, ebenso sind die beiden Seitenaltäre durch neue<br />
wertvolle Altäre ersetzt worden. Die Wände des Langhauses<br />
und Chores erhielten einen hellgrauen, fast ins Weiße übergehenden<br />
Farbton, die die Decke tragenden Säulen auf der<br />
Männer- und Frauenseite, die Brüstung der Empore und das<br />
Orgelgehäuse einen solchen in belebender, hellgrauer, leichter<br />
Marmorierung. Die lichte Tönung gibt dem Innenraum eine<br />
überraschende Weiten- und Tiefenwirkung. Eine helle Lichtfülle,<br />
weich gedämpft durch die neuen Fenster aus Antikglas,<br />
durchflutet den weiten Raum. Die Fülle des Lichtes fängt<br />
sich in der Kreuzigungsgruppe, die an der östlichen Chorwand<br />
als Hintergrund des Hochaltars, Auge und Herz des<br />
Beters und Beschauers zwingend auf sich zieht und zum erhebenden<br />
Mittelpunkt der Schau aus dem Langhaus wird.<br />
Sie ist in weise gemäßigten Farben der neuen Fassung von<br />
Restaurator Andreas Knupfer in Jungnau in vollendeter<br />
Schönheit neu erstanden.<br />
Von den beiden neuen, hoch emporgehobenen scheibenförmigen<br />
Fenstern in zarter, weicher Farbtönung zeigt das<br />
eine auf der rechten Chorseite die Attribute der Hl. Ottilie<br />
als der Kirchenpatronin: Aebtissinen-Stab und das Buch der<br />
göttlichen Weisheit, darauf ein Auge, das andere links als<br />
Attribut des Hl. Petrus, des zweiten Kirchenpatrons, zwei<br />
gekreuzte Schlüssel. Eine ausnehmend feine Zier des stimmungsvollen<br />
Chorraumes bilden die holzgeschnitzten, aus<br />
dem Ende des 17. Jahrhunderts stammenden Statuen der Hl.<br />
Verena und der Hl. Katharina rechts und links des Hochaltars<br />
an den eingewickelten Chorwänden. Die neue Fassung<br />
in hellzarten Farben und Mattgold, die zum größten Teil die<br />
ursprüngliche Fassung beibehalten hat und nur in kleineren<br />
Teilen im Sinne der alten erneuert ist, offenbart in überraschender<br />
Weise die Schönheit der alten Skulpturen. Die<br />
Verehrung der beiden heiligen Jungfrauen in unserer Pfarrkirche<br />
ist schon Jahrhunderte alt; bereits im 16. bis 18. und<br />
noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind von<br />
Hausen aus jährlich Wallfahrtsprozessionen zur Wallfahrtskirche<br />
der Hl. Verena in Engelswies gemacht worden. Die<br />
besondere Verehrung der beiden Heiligen hat auch darin<br />
Ausdruck gefunden, daß die mittlere 1779 gegossene Glocke<br />
u. a. mit einem Relief der Hl. Verena und die große, im<br />
gleichen Jahr gegossene Glocke mit einem solchen der Hl.<br />
Katharina geziert ist Die Verehrung der Hl. Katharina mit<br />
dem Rad in unserer Kirche geht wohl auf das hohe und<br />
späte Mittelalter, in dem diese Heilige allgemein hochverehrt<br />
worden ist, zurück. Die Hl. Verena hat sich in der gleichen<br />
Zeit und auch später im alemannischen Raum besonderer<br />
Verehrung erfreut, Die alte Kasettendecke des Chores wurde<br />
von Kunstmaler Lorch-Sigmaringen im Farbton der Stimmung<br />
des Chorraumes angepaßt. In sieben neu gemalten<br />
Feldern zeigt sie die Symbole der sieben heiligen Sakramente<br />
Eine künstlerisch wertvolle Bereicherung haoen die beiden<br />
Seitenaltäre der Kirche durch neue Bildtafeln, denen man<br />
vielleicht ein größeres Format hätte wünschen mögen, erhalten.<br />
<strong>Der</strong> Altar auf der Männerseite zeigt den Hl. Petrus,<br />
den zweiten Kirchenpatron der Pfarrkirche, in fünf Einzelbildern.<br />
Im Mittelstück der Hl. Petrus, sitzend, mit dem Gesicht<br />
zum Beschauer, eine kraftvolle, würdige Männergestait,<br />
in der Recnten die Schlüssel haltend, die Linke auf das<br />
Evangelienbuch gestützt; die vier kleinen Tafeln, zwei rechts<br />
und zwei links, zeigen charakteristische Einzelbilder aus dem<br />
Leben des Heiligen: den reichen Fischfang, die Reue des Hl.<br />
Petrus nach der Verleugnung seines Herrn, die Berufung<br />
des Apostels durch Christus 2U seinem Stellvertreter auf<br />
Erden \ind den Martyrertod des Apostelfürsten am Kreuz.<br />
Die Bildtafel des Marienaltars auf der Frauen: -ite ist ebenfalls<br />
in fünf Einzeigemälde gegliedert: das Hauptstück in<br />
der Mitte zeigt die Muttergottes Im blauen Mantel mit dem<br />
Kind in anmutiger Schönheit, von .feinste.* Adel überhaucht<br />
und erhebend in ihrer lieblichen Mütterlichkeit, im Hintergrund<br />
deutsche Hügellandschaft, im blauen Aether zwei<br />
schwebende Engei, der Muttergottes die Krone : -ichend.<br />
Auf den kleineren, das Hauptgemälde umrahmenden Bildern<br />
sind Szenen aus dem Marienleben dargestellt: Marit und<br />
Elisabeth bei ihrer Begrüßung vor dem Hause Elisabeths,<br />
die Verkündigung, die Geburt Christi, Maria und Josef n*it<br />
dem Kind auf der Flucht nach Ägypten. <strong>Der</strong> Schöpfer der
• ahrgang 1955 H O H E N Z O L L E R I S C H E H E I M A T 55<br />
beiden Bildwerke, Kunstmaler Albert Burkart aus Riedlingen-<br />
München, heute Professor am Städel-Institut in Frankfurt a.<br />
M., fand sich — nach der neuesten Wertung seines Kunstschaffens<br />
— in seiner Kunst zu einem an große frühitalienische<br />
Vorbilder gemahnenden' Stil voll reiner Klarheit und<br />
Empfindungstiefe. Außer den oben genannten Figuren der<br />
Hl. Katharina und Verena sind auch die Holzstatue des Hl.<br />
Johannes von Nepcmuk, das alte Muttergottes-Wallfahrtsbild<br />
sowie die Statuetten der vier Evangelisten und des Hl.<br />
Sebastian an der Kanzel, die aus dem 17. Jahrhundert stammen,<br />
ferner die Figuren der an den Säulen und Seitenwänden<br />
im Langhaus angebrachten zwölf Apostel von Kunstmaler<br />
Josef Lorch-Sigmaringen neu gefaßt worden. Das<br />
Langhaus erhielt zwei neue gemalte Fenster, das eine mit<br />
dem auferstandenen Christus zum Gedenken an die Gefallenen<br />
der beiden Weltkriege, das andere mit dem hl. Franz<br />
von Assisi zum Gedenken an den 1950 verstorbenen, aus<br />
Hausen gebürtigen Pater Gentiiis Arnold O.F.M. Die letzte<br />
Vollendung erfuhr die Renovation durch den völligen Umbau<br />
der unter Denkmalschutz stehenden Orgel im Jahr 1954<br />
durch die Orgelbauwerkstätte Stehle in Bittelbronn.<br />
Die künstlerische Oberleitung über die Kirchenrenovation<br />
lag bei Landeskonservator Regierungs- und Baurat Genzmer-<br />
Sigmaringen, die bauliche Oberleitung bei Landesbauinspektor<br />
Deutschmann, Sigmaringen, als Erzbischöfl. Baurevisor.<br />
Die Leitung der Bauarbeiten hatte Bauingenieur<br />
Josef Sänger, Krauchenwies. Die einheimischen Handwerksmeister<br />
haben dabei, so u. a. in der Gestaltung der neuen<br />
Das Künstler-Kleeblatt<br />
St. Annakirche<br />
Ein Beitrag zum diesjährigen 200<br />
Hofmaler Meinrad von Aw, der bedeutende Freskomaler<br />
der Barockzeit, schenkte uns im Deckengemälde über dem<br />
Langhaus der St. Annakirche sein schönstes Werk. Die Widmung<br />
der neuerbauten Kirche an die Hl. Mutter Anna<br />
durch den Erbauer Fürst Joseph von Sigmaringen ist das<br />
Thema dieses Gemäldes. <strong>Der</strong> fürstliche Erbauer, gekleidet<br />
in den blauen Fürstenmantel, kniet auf dem festlichen Teppich<br />
und weist mit der Hand auf den Grundriß der St. Annakirche<br />
hin, die er mit eigenen Mitteln erbaute. Ueber seinem<br />
Haupt stehen die Widmungsworte: Con Ce De t Vte La M:<br />
rewähre uns Schutz. Von des Himmels Höhen gibt die Hl.<br />
Mutter Anna oe Antwort: Con Ce Da M L Vbens: Ich will<br />
die Bitte gern erfüllen. Die groß geschriebenen Buchstaben<br />
ergeben jedesmal die Jahreszahl der Vollendung der Kirche<br />
= 1755. Beide Sätze sinn also Chronogramme. In den Buchstaben<br />
von nur zwei Worten die Jahreszahl eines Ereignisses<br />
anzugeben, ist sehr schwer. Aber geradezu ein Kunststück<br />
ist es, in zwei Inschriften von je nur zwei Worten jedesmal<br />
die gleiche Jahreszahl wiederzugeben. Diese Chronogramme<br />
sind zugleich ein historisches Dokument und beweisen<br />
eindeutig, daß die St. Annakirche genau vor 200 Jahren<br />
vollendet wurde.<br />
Auf dem genannten Deckengemälde stehen rechts vom<br />
Fürsten Joseph drei 1 "anner: der erste hält den Fürstenhut<br />
in der Hand und ist Meinrad von Aw, der Sigmaringer Hofmaler,<br />
der die farbenfrohen und figurenreichen Fresken der<br />
Schloß- und St. Annakirche gemalt hat. Neben ihm steht<br />
Christian Großbayer, der Architekt, und hält den Grundriß<br />
der Kirche in der Hand Die Reihe schließt lohann Georg<br />
Weckenmann, aer geniale Bildhauer, der eine Büste der<br />
Hl. Mutter Anna hochhält, von dem sämtliche Pkstiken und<br />
Putten in der St. Annakirche und die Büsten und Vasen der<br />
Umfassungsmauer stammen.<br />
Christian Großbayer war der Baumeister. Er war<br />
schon bei seiner Geburt ein Glückskind: an Neujahr 1718<br />
wurde er geboren und getauft. Sein Vater war ein tüchtiger<br />
Maurermeister. Früher lebten die Großbayer in armen Verhältnissen<br />
als Kuhhirten, Totengräber und Nachtwächter. <strong>Der</strong><br />
junge Christian hatte sich in der Fremde tüchtig weitergebildet<br />
und dabei seine Ehefrau Theresia Diemanstein in Donauwörth<br />
kennengelernt, die er 1739 heiratete. Im Jahre<br />
1746 arbeitete Großbayer beim Umbau des Turmaufsatzes<br />
des Römerturmes. Zwei Jahre später hat er wesentlich Anteil<br />
am wohlgelungenen Umbau der Schloßkirche. Von 1753<br />
bis 1755 ist der Bau der neuen St Annakirche der Glanz-<br />
von M. G u 1 d e, Stadtpfarrer<br />
Koimmunionbank und der neuen Beichtstühle in vorzüglichen<br />
Leistungen ihr hohes Können bewiesen.<br />
Das Hauptverdienst an der großzügigen Renovation gebührt<br />
dem damaligen Pfarrverweser Pater Dr. Franz Josef<br />
Volk P. S. M. (Pallotinerorden). In schwierigsten Zeiten nach<br />
dem Zusammenbruch 1945 hat er, unterstützt von verständnisvollen<br />
Förderern, unter Ueberwindung größter<br />
Schwierigkeiten, in unermüdlicher Tatkraft das Gelingen<br />
des großen Werkes ermöglicht, eines Werke.;, das ihm den<br />
bleibenden Dank der Pfarrgemeinde sichert und seinen Namen<br />
in der Geschichte der Pfarrkirche ehrend in die Zukunft<br />
trägt. Daß der größere Teil der Geldmittel für die Renovation<br />
— die Orgel ausgenommen — zur Verfügung stand, dankt die<br />
Pfarrgemeinde dem am 31. Dezember 1945 verstorbenen Ortspfarrer<br />
Paul Faiß, der in weiser Vorsorge iurch die Ansammlung<br />
der- Geldmittel in mehreren Jahrzehnten die<br />
finanziellen Voraussetzungen für die Kirchenrer ovation geschaffen<br />
hat.<br />
Die Kunst als Darstellung des Göttlichen, als Vermittlerin<br />
des Irdischen mit dem Himmel, offenbart sich in dieser<br />
Wesensform in der schlichten Dorfkirche nicht minder als in<br />
der prachtvollen Kathedrale. Hier wie dort ist sie Ausdruck<br />
des sehnsüchtigen Aufschwingens des Gemütes, der Seele,<br />
von der Erde zum Himmel, vom Menschen zu Gott. In<br />
diesem Sinne ist die Kunst auch in unserer Dorfkirche nicht<br />
mehr Selbstzweck, hier stellt sie sich bewußt in den Dienst<br />
Gottes, will den Beter hinführen zu Gott, hier ist sie in ihrem<br />
höchsten Sinne Gottesdienst. Josef Mühlebach.<br />
im Deckengemälde der<br />
zu Haigerloch<br />
Jahrjubiläum der St. Annakirche<br />
punkt seiner Tätigkeit. Er erlitt dabei einen Beinbruch.<br />
Kaum wieder hergestellt, ließ er sich auf den Bauplatz führen<br />
und leitete, auf einem Stuhle sitzend, die Bauarbeiten,<br />
wie ein noch heute vorhandenes Oelgemälde zeigt. Beim Bau<br />
der St. Annakirche hat sich Großbayer so bewährt, daß ihm<br />
auch die Ausführung der neuen Stadtkirche in Sigmaringen<br />
im Jahre 1757 übertragen wurde. In rascher Folge ist er weiterhin<br />
als Baumeister erfolgreich tätig bei den Kirchenbauten<br />
in Weilheim, Melchingen, Hirrlingen, Höfendorf, Oberndorf,<br />
Schramberg, Inzigkofen und Hechingen. In Haigerloch<br />
erbaute er 1747 den alten Schloßbrunnen; 1765 den Hirschbrunnen;<br />
1772 -
56 H O H E N Z O L L E R I S C H E HEIMAT Jahrgang 1955<br />
Grabstein auf dem alten Friedhof von ihm. Weckenmann<br />
starb im Jahre 1795 im Alter von 70 Jahren.<br />
Meinrad von Aw tritt als Hofmaler ebenbürtig an die<br />
Seite der beiden genannten Künstler. 1712 war er in Sigmaringen<br />
geboren und wurde an den Fürstenhof übernommen.<br />
Den Höhepunkt seiner Meisterschaft erreichte er mit<br />
den Deckengemälden in der St. Annakirche. An der Halbkuppel<br />
des Chores stellte er das Leben der Hl. Mutter Anna<br />
nach der Schilderung des Proto-Evangeliums Jakobi dar; in<br />
der Vierungskuppel die Hl. Anna im Kreise ihrer Vorfahren<br />
und Verwandten als Mutter Mariens; an der Decke des Langhauses<br />
die Widmung des Kirchenbaues an die Hl. Anna<br />
durch den fürstlichen Erbauer. Die reiche Einfassung setzt<br />
sich aus symmetrischen Kurven zusammen, an deren Ansatzpunkten<br />
das umspielende Ornament in das Bild eindringt<br />
und von ihm in verschiedener Art aufgenommen wird. Eine<br />
himmlische und eine irdische Zone werden durch eine große<br />
perspektivische Triumphbogenarchitektur verbunden, die in<br />
goldbraunen Tönen in das Himmelblau hereinragt. Die geschmackvolle<br />
und vornehme, teils kräftige, teils lichte Farbengebung<br />
Meinrad von Aws fügt sich vorzüglich in die<br />
Farbenstimmung des Gesamtraumes ein, der durch das Weiß<br />
der Wände und Holzfiguren, die feinen Stuckmarmortöne,<br />
das Gold der Kapitäle, die zarten Farben der Stukkaturen<br />
und der Kartuschen und das Dunkelbraun des Gestühls bestimmt<br />
wird: eine wunderbare Einheit von seltener Vollkommenheit.<br />
Außer in St. Anna befinden sich Bilder von<br />
ihm in den Kirchen von Sigmaringen, Pfullendorf, Klosterwald,<br />
Langenenslingen, Meßkirch, Otterswang bei Aulendorf,<br />
Zwiefalten, Roth bei Leutkirch, in der Schloßkirche zu Haigerloch<br />
und in der Stiftskirche zu Hechingen. Altarblätter<br />
schuf er für die Altäre der Schloßkirche in Haigerloch und<br />
für die Kirchen von Bittelschieß, Storzingen, Harthausen<br />
a. Sch. und die Dominikanerkirche in Rottweil. Auch das<br />
Freskobild über dem Hauptportal des Sigmaringer Schlosses<br />
ist sein Werk. Meinrad von Aw starb in Sigmaringen im<br />
Jahre 1792 im begnadeten Alter von 80 Jahren.<br />
Am diesjährigen St. Annafest waren es 200 Jahre her, seitdem<br />
diese drei großen Künstler die herrlichen Kunstwerke<br />
der weitbekannten und vielbesuchten St. Anna-Wallfahrtskirche<br />
geschaffen haben, die in gleicher Weise die Gläubigen,<br />
Wallfahrer und Kunstfreunde erbaut und erfreut. In harmonischer<br />
Zusammenarbeit haben diese Künstler mit der St.<br />
Annakirche eine einzigartige Stätte religiöser Andacht, Erhebung<br />
und Erbauung und zugleich ein wunderbares künstlerisches<br />
Kleinod uns geschenkt, das weit und breit nicht<br />
seinesgleichen hat. Diesen verehrungswürdigen Künstlern<br />
wollen wir in diesem Jubiläumsjahr ein pietätvolles Gedenken<br />
widmen und jedesmal, wenn wir die St. Annakirche<br />
mit ihrem unvergleichlichen Kunstreichtum bewundern, wenn<br />
wir in unserer seelischen Not und Ausweglosigkeit an diesen<br />
Ort der Gnaden und göttlichen Hilfe kommen und die Seele<br />
wieder weit und stark für die schweren Aufgaben des täglichen<br />
Lebens geworden ist, dann wollen wir auch die Porträts<br />
der drei Künstler an der Decke über dem Langhaus<br />
mit ehrfurchtsvollem Staunen betrachten und in Dankbarkeit<br />
ihrer gedenken. Ihr Gedächtnis aber kann nicht erneuert<br />
werden, ohne den kunstsinnigen und opferfreudigen<br />
Fürsten Joseph von Sigmaringen zu erwähnen, der in<br />
Wahrheit diesen Künstlern ein Führer und hochgesinnter<br />
Förderer war. Er war buchstäblich die Seele dieser künstlerischen<br />
Entfaltung, die so wunderbare Blüten hervorgebracht<br />
hat. Ihm: dem Fürsten Joseph von Sigmaringen, dem<br />
verdienstvollen Stifter und Erbauer der St. Anna-Wallfahrtskirche,<br />
sowie den drei Künstlern: Großbayer •— Wekkenmann<br />
— Meinrad von Aw — soll diese Arbeit zum 200<br />
Jahrjubiläum der St. Annakirche ein Denkmal der dankbaren<br />
Nachwelt sein.<br />
200 Jahre St. Annakirche in Haigerloch<br />
Heilige Mutter Anna hat die Willfahrigkeit ihrer Tochter<br />
nicht verlohren. Sie ehret sie noch mehrer in dem Himmel /<br />
als sie auf Erden gethan. Um was Anna bittet / bringt Maria<br />
Christo zu; und da dieser / wie es sicher istu Mariä nichts<br />
weigeren kan; muß ja der Wunsch Annä erfüllet seyn. Anna<br />
in der Mitte Christus zur Rechten / und Maria zur Linken!<br />
Sünder! der Gnaden-Thron ist für euch zugerichtet. Verzweifelt<br />
nicht an Viele / und Größe eurer Missethaten. Laßt<br />
euch das Hirn von den traurigen Schröck-Bilderen ewiger<br />
Verdammnuß nicht verwirren. Habt ihr einmahl die Gunst<br />
Annä mit reumüthigem Herzen / mit brinnendem Eifer euere<br />
zukünftige Lebens-Täg besser nach den Gebotten Gottes einzurichten<br />
gewonnen / so liegt die Holl unter eueren Füßen L<br />
uhd kriecht euere Seele aus den Fuß-ächellen ies erbärmlichen<br />
Sünden-Standes in die süße Freyheit der Kinderen<br />
Gottes hervor. Eine Tochter kan der Mutter nichts abschlagen;<br />
und der Sohn darf der Mutter keine Bitte ohne Zusag<br />
abweisen. Gehet! gehet! in das Haus eurer Mutter J Gott wird<br />
euch Barmherzigkeit erweisen.<br />
Erfahren hat es Emericus jener verdorbene Bursch von<br />
Nuceria. Dieser war näch dem Tod seiner Elteren ein Strafl-<br />
Gutl / welches nach dem verschwenderischen Sohn in dem<br />
Evangelio gebildet wäre. Das Väterliche Vermögen w - e in<br />
seiner Willkuhr 7 was die Schnee-Flocken in dem Wasser.<br />
In wenig Zeit verfioße alles in einem Wendel / den das<br />
Luder-Leben befleckt hatte. Die Armutn f Jund enge Noth<br />
lieferten ihne nicht zwar zu dem Schweintrog, / wie das<br />
berührte Muster schlimmer Kinderen / sonder beynahe gar<br />
zu Pech 7 und Schwefel der Höllen. Ein einziger Gedanken zu<br />
Compostell in Gallicien vor seinen Befreundeten unsichtbar<br />
zu werden gehe ihme den Pilger-Stecken in die leere Hand /<br />
'welchen m'ihin wohl nicht die Andacht zu dem Apostl der<br />
Iberischen Reichen zugeschnitten hatte. Wohlan! die Reise<br />
wird angetretten. Emericus, der so lang in den Sünden herumgewanderet<br />
/ ziehet die Pilger-Kutten an; und der so<br />
wenig von der Reinigkeit eines Perl an sich hatte 7 trüge die<br />
Mn schier an Hut / uno Schulteren. Kaum war er in 1er<br />
Kleinmuth fortgeruckt / zeigte sich Jacobus der Größere<br />
diesem n der Frommkeit so kleinen Zwergen. Er rathete<br />
nme die Andacht zur Hl. Anna ein^ und brachte ihme bey<br />
/ selbe jeden Zinstag / als die Zeit ihrer Geburt / und Tods<br />
nit Aufsteckung einer Wax-Kerzen zu oeehren. Emericum<br />
kunte die Kleinmuth nicht also verdunklen / daß ihme der<br />
Stern ius Jacob nicht eingeleuchtet hat. Er hatte kaum ein<br />
Schiffe bestiegen / da Wind und Wasser sich wider selbes<br />
von M. Guide, Stadtpfarrer<br />
(Schluß)<br />
verschworen. Blitze von oben / Abgrund von unten waren<br />
die leidige Vorbotten des nahen Tods. Die krachende Bretter<br />
waren die Gesellen / so die Seufzer des beängstigten Emerici<br />
begleiteten; und die zerschmetterte Mast-Stange gäbe<br />
ihme einen Fingerzeig / er werde bald dorten versinken /<br />
wohin sie gefallen. Die zerrißene Segeln bv ':en sich ihme<br />
schon zu Leich-Tücheren an; er stellte sich / so viele sich<br />
Wellen aufgeworfen / Gräber eines Freythofs vor; und es<br />
gedunkte ihme zuweilen er höre aus dem Getös des schaumenden<br />
Meers einen Vers aus der Todten-Vigil. Jonas<br />
schleife in dem Sturm auf dem Fä. r-Zeug nach Tarsus:<br />
Emericus, so stark er vor dem unruhigen Element in dem<br />
Schifte gewieget wurde / konnte nicht einmahi schlummeren.<br />
Die feurige Meteoren in der schwarzen Luft bißen ihne ohne<br />
Unterlaß in die Augen. Er zitterte wie die Apostel auf der<br />
See Genesareth, und das böse Gew' sen verursachte ihme ein<br />
Fieber / derne das gesalzene Meer-Wass-- zur Arzney dienen<br />
sollte. In der That / wo Anker und Hoffnung verbrochen /<br />
waren wenige Wort Emeriti, Heilige Anna niiff mir Armseligen!<br />
genug; das tobende Wasser zu besänftigen das<br />
nothleidende Schiffe aus der Gefahr zu setzen / da selbes<br />
das Fluchen der Matrosen / und Boots-Knechte fast in den<br />
Grund gesenkt hatten. Hier hatte sich nun Emericus gefunden<br />
/ wo er beynahe sein Leben verlohren. Das bestiegene<br />
Land wäre der erste Tritt in das Buß-Leben / in weichem<br />
er festen Fuß gesetzt. So viele Thränen seine Augen ausgeschüttet<br />
/ so viele Wellen waren selbe die booshafte Jugend<br />
an einen anderen Port zu lenken; und hatte er endlich das<br />
Glüke nach noch mehreren / und großen Liebs-Bezeugungen<br />
heiliger Annä in den Himmel zu seglen.<br />
Erfahren hat es jener Türkische Bacha, welcher nach einer<br />
Hi. Anna zu Ehren gestifteten Kirdien umsonst angelegtem<br />
Feuer bey der Bildnuß dieser barmherzigen Mutter innerlich<br />
gerührt 7 den Alcoran abgeschworen / von dem dunklen<br />
Mond-Schein der Musul-Männeren zu dem Sinnen-Licht<br />
unseres Christlichen Glaubens übergegangen / und anstatt<br />
der hohen 7 ,und glänzenden Porten / die Thür<br />
des Himmels gesucht hat. Erfahren haben es unzahlbare<br />
/ welche aus den Händen des Höliiscnen Würg-<br />
Engels mit durch Annam erworbene Buße entronnen,<br />
Trithemius der große Abbt / und Annä besonderer Liebling<br />
aus dem großen Benedictine : Orden sagt endlich alles für<br />
mich: Es kann nicht erweislich seyn / daß Gort A nam,<br />
wann sie für ihre Pflegkinder zu bitten kommet / nicht erhöre<br />
£ welche ihme von ihrem Herzen ein kostbares Ruhe-
Jahrgang 1955 H O H E N Z O L L S R I S C I E H E I M A T 57<br />
Bethe zugerichtet hat; und kan ich schlüßlichen mit dem<br />
gottseligen Thomas von dem Hl. Cyrillo einem Carmeliten<br />
nicht mehrer sprechen als dieses: Alles / was der Sohn<br />
fi-ottes durch Mariam seine Mutter den Sterblichen erweiset<br />
/ kan er eben auch / wann Anna die Bittende in das Mitte 1<br />
gehet / nicht abschlagen; hat der Sünder nach so langer /<br />
und gewißer Erfahrnuß von Maria sich alles Guten zu vertrösten;<br />
ist sie ein Mutter der Barmherzigkeit / wird dieser<br />
große Ehren-Namen Annä abzusprechen seyn? Keineswegs<br />
Hochansehnliche! folget den Worten meines Vorspruchs. Es<br />
ist ein Rath von mir dem geringsten / und eine Einladung<br />
von Anna der Größten. Gehet in das Haus eurer Mutter:<br />
Gott erweise euch Barmherzigkeit. Gehet in die Lehr / so<br />
euch Anna die Groß-Mutter des Christenthums gibt / und<br />
hoffet zugleich durch sie als eine Fürbitterin die Erbarmungen<br />
Gottes zu fühlen.<br />
Anna lehret uns insgesamt zwey Stuck: Gottes Gebot zu<br />
halten / wie wir von ihr gehört; auf den vorsichtigen Gott<br />
zu trauen / wie wir an ihr bewunderet haben. Die Planeten<br />
seynd den Gewächsen nicht so nöthig / als die Vorsichtigkeit<br />
Gottes uns Menschen. Was wir für Zufälle ansehen f<br />
und Geschicke des Glücks nennen / seynd ihr ungebundene<br />
Anordnungen: welche doch unserer Freyheit keine Band<br />
schmieden. Nichts geschieht ohne sie / so gering es ist / weilen<br />
sie auch dem Sperling / der von dem Tach fällt / das<br />
Ende spricht. Und von Niemand a 1 * eben von ihr mögen<br />
wir hoffen / was uns an Kleidung / Kost / und Wohlfahrt<br />
ermanglet. <strong>Der</strong> Ackersmann erkennet sie / da er das Saamen-<br />
Korn mehr in ihre^ als der Erden Schoos ausstreuet. <strong>Der</strong><br />
Weingärtner läßt den Rebstock an dem Geländer ihrer Sorge<br />
über; und ja der Hirt auf dem Feld über seine Herden<br />
wacht / wird er selbsten von ihr gehütet. Sie pflegt den Abgang<br />
mit Reichthumen / und den Ueberfluß mit dem Mangel<br />
zu mäßigen; und da sie den Reichen Kästen / Keller und<br />
Speicher füllet /' schickt sie auch die Arme dahin / das Nothwendige<br />
zu begehren. Was wir in der Welt sehen / ist ein<br />
großes Buch der Vorsichtigkeit / in deme auch jene lesen<br />
mögen / welche die Buchstaben nicht erkennen. Obwohlen<br />
sie wie Cassiodorus sagt — auf alles sihet / was da schwimmet<br />
I flüget / kriechet / und gehet; seynd wir Menschen doch<br />
der größte Merk dieses großen Augs. Es schauet also zu reden<br />
allein auf unser Wohl; weil alle übrige Geschöpfe zu<br />
unseren Diensten bestimmet seynd. Wer solle also mit Anna<br />
unserer heiligen Mutter nicht alles hoffen / wann wir mit<br />
Anna auch ihren Gebotten nachleben?<br />
Ja Hochansehnliche! dieses ist was uns Anna zuforderst<br />
lehret. Versichere sich nur keiner Gottes Vorsichtigkeit durch<br />
durch Annam sich günstig zu machen / wann er nach der<br />
Mütterlichen Anlaitung diese Bedingnuß nicht erfüllet. Petrus<br />
der Damianer lacht derjenigen ' welche ohne Befolgung<br />
der Gebotten sich alles Gutens vertrösten. E vergleicht sie<br />
einen. Soldaten / welcher sich den L 'beer-Cram vor dem<br />
Gefechte aufsetzen will; und einem "aursmann / der den<br />
Dresch-Flegel ergreifet / ehe er das Feld mit dem Pflugeisen<br />
umackeret hat. Nicht so / 'Hochansel nliohe! durch < ien<br />
Weg der Gebotten allein gewinnen wir die Güter der Vorsichtigkeit<br />
Gottes J wie uns Anna gelehret hat. Sie seynd<br />
nicht unmöglich zu halten / wie die Ketzer dichten; und<br />
auch nicht schwer / wie die weiche Welt-Kinder träumen.<br />
Die Liebe Gottes vermag alles Augustinus der Hipponenser<br />
sihet in ihr eine solche Stärke / welche entweder alle Arbeit<br />
nebet / oder selbe doch nicht empfindet; und wann wir noch<br />
dazu den Lohn einer Ewigkeit ansehen / sollen wir unsere<br />
Achsel-Beiner einem so süßen Joch mit Freude nicht unterlegen?<br />
Muth und Herz zusammen Hochansehnliche! daß wir durch<br />
Annä Lehr ein mahl ergreifen / die Gebott zu halten "J und<br />
die Schätze Göttlicher Vorsichtig- und Barmherzigkeit an<br />
uns zu reissen. Seynd wir bishero aus der Straße geloffen /<br />
ist wiederum durch Annä Fürbitt Hilf zu finden. Sie wird<br />
uns mit Gott aussöhnen / und auch alles / was wir uns durch<br />
dessen Erzörnung zugezogen / von dem Hals abnemmen.<br />
Kranker! der du dich selbst durch deine sündliche Unordnung<br />
zu Bette geworffen. Verachteter! der du selbst mit deinem<br />
unfrommen Wandel die Ungunst der Geschöpfe wider<br />
dich aufgehetzt. Armer! der du dir selbsten durch deine<br />
schlimme Aufführung den Bettel-Ranzen auf die Schulteren<br />
gebunden. Auf! auf! gehet in das Haus eurer Mütter! Gott<br />
wird euch Barmherzigkeit erweisen / wann ihr wahrhaftig<br />
gesinnet seyd von der so lieben Sünd einmahl Urlaub zu<br />
nemmen. Sünder! verzage nicht / Anna wird deinem Untergang<br />
vorbeugen / so bald du dich einmahl entschlossen hast<br />
das Leben zu änderen! Dann merke: Anna<br />
Eine recht Lehrende und recht Bittende.<br />
Sie wurde nicht recht lehren / wann sie uns etwas anderes<br />
als die Gebott vorlegte; und sie wurde nicht recht<br />
bitten f'wann sie jene zu Pfleg-Kinderen erkieste / welche<br />
sich nicht besseren wollen. Die Wittwe von Theene mag bey<br />
David für Absalon den Betrüger wohl etwas ausgewürket<br />
haben. Anna wird sich deren nicht einmahl annemmen / die<br />
in Sünden zu verharren gedenken / und unter der traurigen<br />
Buß-Larve ein dem Laster geneigten Willen herumtragen.<br />
Anna eine Lehrerin / Anna eine Fürbitterin hat nunmehro<br />
dieses ausbündige Haus bezogen. Sie hat alles Fleißes ihre<br />
Burg auf eine Höhe gesetzt / damit sie uns / wie die Weisheit<br />
in der Schrift in ihrem Pallast von sieben Säulen / also<br />
in die Schul berieffe; und unser Elend / selbes abzunemmen<br />
/ in der Tiefe dieses Zäher-Thaies erblicke. Männiglich<br />
hat sich hierob zu erfreuen; und solle ja keiner diesen Berg<br />
antretten / ohne Gott für eine so kluge Lehrerin / und mächtige<br />
Fürbitterin zu danken.<br />
Du insbesondere / durchlauchtiger Reichs-Fürst ha^' von<br />
uns tausend Dank verdienet / weil zu unserem Nutzen / und<br />
Trost das gethan / was die Römer an Vespasiano und Trajano<br />
gerühmt haben; das ist / eine Schul tund Tempi erbauet.<br />
Du hast dich insbesondere Annä Schutz zu erfreuen B<br />
und nebst diesem auch der Fürbitt Meinradi, und Fidelis zu<br />
getrösten: deren der erste aus deinem Fürsten-Haus; der<br />
andere aus deiner Fürstlichen Herrschaft das Marter-Cränzlein<br />
erfochten f und von dir auf beyden Neben-Altären allhier<br />
einen Neben-Raum erhalten haben.<br />
Hohen-Zolleren 7 das uralte Berg-SchloßW und Stammen-<br />
Haus wird unter dem Schirm-Mantl Annä gegen alle Unfäll<br />
unbeweglich stehen; und dein Fürstlicher Wappen-Hirsch in<br />
dem Thau des Himmels / und Fette der Erden wayden: und<br />
was kan wohl widriges einem Joseph begegnen / v/o Jesus<br />
Maria, und Anna sich einfinden. Ich gehe nun von dem Red-<br />
Platz / und lasse einen Hochwürdigen Gnädigen Dom Herrn<br />
aus dem Haus Hohen-Zolieren mit dem Keich das erstemahl<br />
zu dem Opferstein ziehen. Werfen wir uns unter dem Göttlichen<br />
Opfer zu den Füssen Anna, und laßt uns durch Sie<br />
bey Gott um Hilff / seinen Gebotten zu gehorchen; Nachlaß<br />
unserer Verbrechen zu erhalten J demütliigst anflehen Das<br />
Ende meiner Rede seynd geringe Gedanken / die ich ob der<br />
Porten dieses schönen Orts mit goldnen Buchstaben zu<br />
schreiben mich erkühne:<br />
Quam Princeps Divae fabricam construxerat Annae,<br />
Doctrinae domus est; Gratiae et aula simul.<br />
Hic discas mandata Dei; tunc Anna juvabit:<br />
Et sie utrinque a Principe concta fluent.<br />
Was hier ein Fürstliche Hand der heiligen Anna thut<br />
schenken / Ist uns ein Hause der Lehr / der Gnaden ein<br />
herrlicher Saal. / Hier lerne dann Gottes Gebott / so wird<br />
deiner Anna gedenken;^ Und so wird beyderseits auch nach<br />
Wunsch alles flüßen zumahl.<br />
Flurnamen der Markung Sigmaringen<br />
99. Hedinger Halden*. Nach der Beschreibung die<br />
Halde, welche von Hedingen aus über den heutigen Friedhof<br />
gegen den Suggenstein hinaufführt.<br />
100. Hedinger Kirchweg*. Alter Name für die heutige<br />
Bergst -aße, weiche von Hedingen aus zum Hohenkreuz<br />
geht. Sie führte früher weiter zur Donau und auf dem rechten<br />
Donauufer nach Laiz. Wie die Stadt Sigmaringen, Gorheiin<br />
und Brenzkofen, war auch Hedingen nach der Mutterkirche<br />
Laiz eingepfarrt. Während das Kloster Hedingen 1385<br />
vom Pfarrverband Laiz gelöst wurde, blieben die übrigen<br />
Bewohner von Hedingen auch nach Errichtung der Pfarrei<br />
Sigmaringen im Jahre 1464 bei der Kirche zu Laiz,<br />
von Dr. Max F r i c k, Tettnang 3. Fortsetzung<br />
101. Hedingersteg. Außer den drei Brücken zi - Sigmarin^en<br />
wird seit dem 16. Jahrhundert auch bei Hedingen<br />
eine kleine Brücke erwähnt, doch hat es sich hier immer<br />
nur um einen kleinen Steg gehandelt. Größere Wagen mußten<br />
über die Furt bei der Deutenau<br />
102. Hedinger Wiesen. Die Wiesen liegen unterhalb<br />
der Hohenwaghslde an der Markungsgrenze gegen Sigmaringendorf<br />
und sind von drei Seiten von der Donau umflossen.<br />
Sigmaringendorf hatte hier das Weidrecht.<br />
103. Heidenacker*. Lage unbekannt. Als Heiden wurden<br />
oft Fluren genannt, auf welchen sich römische Ueberreste<br />
fanden.
58 HÖH F. NZOLLERISCHE HEIMAT JahüSgang 195o<br />
104. Hengstgründ*. War die Fortsetzung des Pfaffenteiches<br />
im Tiergarten; hier war wohl die Weide für die<br />
Hengste.<br />
105. Herhatzbrunnen*. Wo sich Hedingerwiesen und<br />
Ammerwiesen unterhalb der Hohenwaghalde treffen, beim<br />
Eingang in das Bachtal, befindet sich eine Quelle, die früher<br />
(1511) den Namen Herhatzbrunnen hatte. Im ersten Teil des<br />
Namens steckt wohl ein Personenname.<br />
106. Herren garten (Oberer und Unterer). Die<br />
Flur liegt beim heutigen Bahnhof Hanfertal; der obere Herrengarten<br />
gegen den Vogelherd zu, der untere gegen den<br />
Frauenstock. Um 1600 hießen die Felder in den Akten Hergarten.<br />
Wir haben hier das alte Gut Hargarten, welches im<br />
Lehensbuch des Grafen Eberhard um die Mitte des 14. Jahrhunderts<br />
genannt wird: „Item Haintz Schultheiß, Bentzen<br />
des Schultheißen seligen sune von Sigmaringen hat ze lehen<br />
empfangen das gute, das man nemt Hargarten". Har bedeutet<br />
Flachs und wurde im Dialekt här gesprochen; daraus wurde<br />
später Hergarten und Herrengarten.<br />
107. Hessenhaid*. Es ist der Walddistrikt 137 und 146<br />
beim Oberjägerhaus. Es kommen zwei Bedeutungen in Betracht.<br />
Die Heß = das Schwein, dann wäre hier eine<br />
Schweineweide gewesen, oder es kommt von hessen, das im<br />
Schwäbischen eine Art Hetzjagd bedeutet und zwar mit vorgestelltem<br />
Garn. Man sprach von „hessen und hetzen".<br />
108. Hinter der Buchhalde. Die Flur zwischen<br />
Buchhalden und Katzenbuckel.<br />
109. Hinter Dreißig Jaucher t. Die Flur westlich<br />
von Dreißig Jauchert.<br />
110. Hinter Gor heim. Das kleine Tal westlich von<br />
Gorheim.<br />
111. Hinter Hedingen. Die Flur südöstlich von Hedingen.<br />
112. Hinterm Breinzkotferberg*. Die Gegend<br />
nördlich vom Brenzkoferberg.<br />
113. Hinterm Josefsberg. Diese Flur hieß früher<br />
„Hinter dem Waldberg" (siehe Nr. 115).<br />
114. Hinterm Mühlberg. Diese Flur ist heute zum<br />
großen Teil von den Gebäuden des Fürst-Carl-Landeskrankenhauses<br />
überbaut. <strong>Der</strong> Weg, welcher von Hitzkofen her<br />
am Dettingerberg vorbei hinter dem Mühlberg hinunterführt<br />
und weiter über Brenzkofen nach Laiz, ist ein alter vorrömischer<br />
Weg.<br />
115. Hinter dem Waldberg*. Dieser Name wird vom<br />
15. Jahrhundert an bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts erwähnt.<br />
Es war die Flur zwischen Josefsberg und der Bergstraße<br />
(Siehe Nr. 290).<br />
, 116. Hintertal. Das Tal an der neuen Jungnauer Straße<br />
zwischen der Metzgerhalde und dem Brenzkoferberg.<br />
117. Hirschlen*. Das Wort ist entstanden aus Hursten<br />
(siehe Nr. 132).<br />
118. Hohkreuz. Das Kreuz dürfte wohl im 16. Jahrhundert<br />
errichtet worden sein, denn 1526 im Hed. Urbar<br />
kommt der Name noch nicht vor, dagegen 1614 heißt es: „uff<br />
Kleeb beim hohen Kreuz".<br />
Ueber eine vermutliche römische Siedlung dort schreibt<br />
Archivar Schwarzmann in einem Bericht dat. Sigmaringen<br />
den 23. Okt. 1861: „Grundmauern von Gebäuden wurden<br />
ebenfalls aufgefunden hinter der Buchhalde zu Sigmaringen<br />
rechts am Wege nach Krauchenwies in der Nähe des Kreuzes,<br />
dabei auch Scherben von Gefäßen. Im Sommer, wenn<br />
die Früchte zeitigen, sieht man deutlich die Plätze, unter<br />
welchen sich Mauern befinden müssen, weil diese Stellen<br />
nicht so ergiebig sind, namentlich am Acker der Witwe Frick<br />
von hier." Im Kataster aus jener Zeit konnte jedoch in der<br />
Nähe des Kreuzes kein Feld der Witwe Johann Georg Frick<br />
festgestellt werden.<br />
119. Hochsträß. Eine alte Römerstraße, welche von<br />
Laiz aus nach Norden führt. Auf der Sigmaringer Markung<br />
geht sie durch den Straßenhau und am Stilzereich vorbei.<br />
<strong>Der</strong> Name Hochsträß wird sehr häufig für alte Römerstraßen<br />
gebraucht, weil diese sich durch ihre steinerne Fundamentierung<br />
von ihrer Umgebung abhoben.<br />
120. Hof*. Alter Name für die Gegend beim Hohkreuz;<br />
die Flur „uff dem Hof" ging von der Krauchenwieser Straße<br />
bis zur Laizer Markung und noch im 18. Jahrhundert wird<br />
die Breite des Burghofes (Dreißig Jauchert) genannt auf dem<br />
Hof. Vielleicht kommt der Name daher, weil der Burghof<br />
dort seine Felder hatte.<br />
121. Hofgarten. Zwischen Schloß und der heutigen<br />
Bauhoferbrücke befand sich seit dem 17. Jahrhundert eine<br />
große Gartenanlage, der fürstliche Hofgarten. Heute wird<br />
mit diesem Namen nur noch der letzte Rest dieser Gartenanlage,<br />
nämlich die kleine Anlage beim Gebäude der früheren<br />
Museumsgesellschaft mit den Tennisplätzen genannt.<br />
122. Hohe Schönebergs Sack. Die Halde auf dem<br />
Schönenberg gegen das Nonnenhölzle zu. Sie hieß 1511 „Volkwinshalden"<br />
(siehe Nr. 286).<br />
123. Hohensteig*. Im 15. Jahrhundert genannt, Lage<br />
unbekannt.<br />
124. Hohenwaghalde. <strong>Der</strong> bewaldete Abhang von<br />
Hedingen an der Donau entlang bis zur Sigmaringerdorfer<br />
Markungsgrenze. 1497 heißt es: „wie in titenow an der Thonaw<br />
zwischen den wagen". Wag bedeutet ein stehendes Wasser,<br />
meist einen Wassergumpen, der sich im Kreise herumdreht<br />
(Buck). Die Donau macht hier verschiedene Einbuchtungen<br />
in die Ufer und hat viele kleine Wirbel. Bergnamen<br />
wurden gerne von der Beschaffenheit des Wassers an seinem<br />
Fuße benannt (Werenwag, Mühlberg).<br />
125. Hohe Tannen. <strong>Der</strong> mit Tannen bewachsene Abhang<br />
über Gcrheim. Hier befand sich eine sehr alte Michaelskapelle<br />
und bis 1685 das alte Tertiarinnenkloster.<br />
126. Hohlenstein*. 1497 heißt es: wis in der Ow under<br />
dem Holenstein". Die Au ging früher bis zum Fuße des<br />
Josefsberges und unter dem Hohlenstein dürfte wohl die<br />
Höhle im Prinzengarten beim Weiher zu verstehen sein.<br />
127. Hoppenzinkenacker* Name eines Ackers im<br />
Zieg
Jahrgang 1955 H O H E N Z O L L E R I S C H E H E I M A T 59<br />
ren. Ain Badhuot von Lavender Stengel. (Statt Lavendel<br />
sonst oft Stroh, vgl. Hohz. Jahresheft 1951, S. 71)<br />
In ainer schwarzen Raystruchen mit seinem Wappen im<br />
Stübel: Ain schwarz liderin Par Hosen (Lederhosen) und<br />
Warnas (Wams) mit christallin Knöpfen und äschenfarben<br />
Schnieren. Zway Par liderlin Stimpf (so immer statt<br />
S t r i m p f !) Ain gelb liderin Par Hosen und Wammas mit<br />
schwarzen Schnieren und Knöpfen. Ain silberfarb Par gestrickt<br />
Strimpf. Ain äschenfarb lindisch (lündisch aus<br />
London!) Par Hosen und Stimpf samt ainem Par tafetin Hosenbendeln.<br />
(Taffet = Seidenstoff.) Ain schwarz doppeltafetin<br />
Wammas. Ain schwarz barchetin Par Hosen. Ain Wammas<br />
mit einem liderin (ledernen) Leyb und grobgrüenen<br />
Ermbeln (Aermeln). Zwen schwarz gestrickte Strimpf. Ain<br />
schwarz lindisch Par Hosen mit lindischen Strimpfen. Ain<br />
Par negelinpraun gestrickte Strimpf.<br />
In ainem Lädlin: Drey unbeschlagene Par oder Schayden<br />
mit Messer.<br />
In der Kammer am Stüblin: Ain Bettlad und ain Karr,<br />
darin zwen Stroseck. Ain beschlissiger Trog, und darin zwen<br />
lindisch Rock, ain lindisch Tischröcklin, ain bursatin (pur<br />
Satin) Tischröcklin, ain schamlotin (Schamblat = Art Seidenstoff),<br />
Tischröcklin mit füchsin Fuetter. Ain wullin Röcklin<br />
mit schäfim Fueter. Ain lindischer Mantel mit ainem silberig<br />
Kettemlin (Kettlein). Ain Paar wullin Hendtschuech<br />
mit schäfim Fuetter. Ain engelsaytiner (wollener) Nachtbeiz<br />
mit aim schäfin Fuetter. Ain Gamsfeel (Gamsfell). Ain Bürsbüchs<br />
(Pirschbüchse). Ain Feünstling (Pistole) sampt der<br />
Hulffter (Futteral) und 3 Builuer Fläschen (Pulverflaschen).<br />
In der Cammer am Stüblin: Zwo Seytenwehren<br />
mit Silber beschlagen. Ain Handäxtlin. Ain Tachsgebelin.<br />
Ain zinine Nachtkachel. Zway Wäschsayler. Ain liderin Fällis<br />
(Felleisen) und ain Sattelbullen (Bulge = Ledersack).<br />
Ain schwarze Raystruchen. Ain beschlagne Lad. Zway Better<br />
mit zwilichin Federritten (Tuchbehälter für Federn?<br />
Leinwand auf einer Seite federartig anzufühlen). Ain Pfulben<br />
(großes Kissen).<br />
In der großen Stuben: Ain gefüerter Tüsch (gevierter<br />
= quadratisch?). Zway angehenkte Täfelin. Ain<br />
Kopfhäusle sampt ainem zinin Gießfaß und küpferin Handbecket.<br />
Ain küpferin Schwenkbecket. Ain zini Weyh Krüeglin.<br />
Drey mössin (aus Messing) ainfach Leüchter. Sechs messin<br />
Vintaussen (Schröpfköpfe aus Messing, lat. ventosa, mhd.<br />
Vintus). Ain Gautsch (Faulbett) sampt ainem Strosack, Küssin<br />
und Deckin. Ain Lehnenstuol und sechs Scabellen (Fußschemel).<br />
Auf der Lauben zwischen den Stuben: Zwen gedoppelt<br />
beschlagen Flügelcasten. Ain Hellenbarten. Ain Speyströglin.<br />
Ain Gläslin und klaine stürzin (eisenblechern) Laternen.<br />
Auf der oberen Lauben: An Bettgewand: Zway<br />
Underbott Ain barchatin Oberbett, zwen barchatin Pfulben.<br />
Ain Pfulben mit ainem reistln (Reiste Tuch = feines Linnen<br />
zwilchen Ueberzup Fünf barchatin Küssin, klain und<br />
groß. Am grüener Tischteppich.<br />
Zinngeschirr : Beschlagne Zin, groß und klain, sechse.<br />
Gemaine Zin grgß und k -in, ailfe (11). Ain Flaischteller.<br />
Zwelf Tischteller in ainem Fuetter. Zway Sai2büchslin. Ain<br />
quärtige Kandten (quart = Vi Maß haltend). Zwo messig<br />
Steütze-
60 HOHENZOLLEEISCHE HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
Unter den verschiedenen frühgeschichtlichen Befestigungsanlagen<br />
in Nähe der hohenzollerischen Grenze bei Riedlingen<br />
nimmt die Heuneburg am Talhof zwischen Hundersingen<br />
und Binzwangen dadurch eine besondere Stellung ein, daß<br />
sie durch mehrjährige Ausgrabungen allmählich ihre Geheimnisse<br />
preisgeben mußte. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
und das Land Baden-Württemberg finanzieren dieses<br />
zur Zeit größte Grabungsunternehmen auf deutschem Boden,<br />
das noch lange nicht zu Ende sein wird. Aber schon jetzt<br />
nimmt ein Bericht von diesem „deutschen Troja" die Zuhörer<br />
ganz gefangen, besonders wenn man ihn aus berufenem<br />
Munde in meisterhaft aufgebautem und streng durchgearbeitetem<br />
Farbbildervortrag hören durfte, wie ihn im Januar der<br />
jetzt nach Tübingen berufene Freiburger Professor Dr. Wolfgang<br />
K i m m i g im Breisgauverein einer atemlos lauschenden<br />
Zuhörerschaft gab.<br />
Dabei sind bis jetzt im wesentlichen erst die zwei (von<br />
3) noch erhaltenen Abschnittsgräben und der dahinter aufgeschüttete<br />
Wall der dreieckigen Landzunge, die sich etwa 300<br />
zu 180 Meter ausdehnt, näher untersucht, deren Fuß früher<br />
von der Donau und deren einstigen Seitenarmen umspült<br />
und gesichert war. Umso stärker erscheint die Abschirmung<br />
nach der Gefahrenseite. Die beiden Gräben selbst sind trotz<br />
Einrutschungen im Lauf der Jahrhunderte noch so imposant,<br />
daß ein kleineres Haus darin völlig verschwindet. Die Grabungen<br />
und Durchschnitte föidertenzur größten Überraschung<br />
der Gelehrten und interessierten Besucher Befestigungen zutage,<br />
die vom ausgehenden s e ch s t e n vorchristlichen Jahrhundert<br />
bis um 400 in sechsmaliger Folge' aufgebaut<br />
und immer wieder durch Feuer, Gewalt oder Witterungseinflüsse<br />
zerstört worden sind. Neben den verschiedenen Trokkenmauerwerken<br />
mit Balken- und Rahmenverstärkung zeigte<br />
sich die zweitunterste Periode für die Ausgräber dadurch am<br />
aufregendsten, weil das Fundament aus behauenen Kalkquadern<br />
mit gut 50 000 Kubikmeter Steinen (nach griechischem<br />
Vorbild) hergestellt ist, die aus 7 km Entfernung durch<br />
ein Riesenaufgebot von Menschen (ähnlich den ägyptischen<br />
Pyramiden) herbeigeschafft sein müssen. Und darauf war<br />
eine Mauer aus luftgetrockneten Lehmziegelsteinen<br />
in Art und Einzelausmaß errichtet worden, die<br />
nur auf einen griechischen Festungsbaumeister zurückgehen<br />
kann oder die von einem barbarischen Baumeister der<br />
Kelten, wie man die damalige hier einheimische Bevölkerung<br />
nennt, in Griechenland kennen gelernt sein muß.<br />
Unserem nordischen Klima freilich waren diese Lehmsteine<br />
nicht gewachsen, weswegen man bei der folgenden Anlage<br />
wieder zur bewährten Form der Balkenmauer zurückkehrte.<br />
Gegen die Donauniederung springen aus der Mauer immer<br />
wieder mächtige viereckige Türme vor, die einst mit Zinnen<br />
Heuneburg und Hünengrab<br />
ein imposantes Bild für die Wanderer auf der südufrigen<br />
alten Straße geboten haben müssen. In deren Innerem fand<br />
man Herdanlagen mit Geräten und Gefäßen, die erst unmittelbar<br />
bei der Zerstörung verlassen wurden. Dabei ist die<br />
Fläche der dreieckförmigen, etwa 3 ha messenden Burganlage<br />
noch gar nicht erforscht. Aber die bisherigen Funde, unter<br />
denen schön bemalte griechische Gefäßscherben und ein goldener<br />
Sieblöffel hervorragen (wie solche auch aus Hügelgräbern<br />
zutage kamen) zeigen, daß wir es vermutlich mit<br />
dem Sitz von keltischen Fürsten zu tun haben.<br />
Rings um die Heuneburg findet man noch eine Reihe von<br />
Hügeln, die wohl einst den Herren dieser Burg als letzte<br />
Ruhestätte dienen sollten. Auch sie müssen durch ein Riesenaufgebot<br />
von Menschen zusammen getragen sein. Manche<br />
sind schon früh ausgeraubt worden. Als man letztes Jahr<br />
einen, der unberührt schien, wissenschaftlich abhob, stellte<br />
auch dieser sich als nicht mehr unberührt heraus und das<br />
Skelett fand sich in einer Lage, die darauf schließen ließ,<br />
daß Grabräuber bald nach der Bestattung alle Kostbarkeiten<br />
des beigesetzten fürstlichen Toten entfernt haben. Doch fanden<br />
sich Reste eines Wagens, wie er in gleicher Form aus<br />
derselben Zeit mit einem 1,50 Meter hohen Bronzegefäß (einer<br />
Art riesigem Mischbottich) im Grab einer jungen Fürstin auf<br />
dem Mont Lassois bei Chatillon sur Seine in Frankreich<br />
entdeckt wurde. Ebenso erschienen Reste einer hölzernen<br />
Grabkammer, wie man sie im nahen Hohmichele und im<br />
Magdalenenmergel bei Villingen und weiterhin bis in die Gegend<br />
des genannten Seineflusses zutage gefördert hat. Durch<br />
die griechischen Scherben, deren Gefäße vermutlich aus dem<br />
Mittelmeergebiet über Marseille (alt Massilia) in unsere Gegend<br />
importiert wurden, wird ein einheitliches Kulturgebiet<br />
gekennzeichnet, das vorerst durch die beiden Eckpfosten Heuneburg<br />
und Mont Lassois abgesteckt ist. Vielleicht tauschten<br />
die Kelten diese Kostbarkeiten für Sklaven oder Bernstein<br />
ein. Dabei sind die Bronzegefäße des genannten Mont Lassois<br />
wahre Protzenstücke, wie sie bei Mittelmeerkünstlern<br />
gar nicht üblich waren.<br />
Von der Heuneburg, über die eine Gesamtdarstellung natürlich<br />
noch nicht möglich ist, schweift der Blick bei klarem<br />
Wetter südlich bis an die Alpengipfel. Dorther aus dem Süden<br />
kamen die Reichtümer, nach denen die Keltenfürsten so<br />
sehnlich verlangten. Sollten sie nicht von selbst auf den<br />
Gedanken gekommen sein, mit ihren Kriegern von dort selbst<br />
zu holen, was bis dahin nur von Händlern unter vielen<br />
Schwierigkeiten zu erhalten war? Tatsächlich brechen 'Jims<br />
Jahr 400 vor Christus alle Bodenfunde an der Heuneburg<br />
ab, just in der Zeit, wo keltische Kriegerscharen vor den<br />
Toren Roms auftauchten! Joh. Ad. Kraus.<br />
Zur Familien- und Namenskunde in der Grafschaft Zollern 1622<br />
Rangendingen (114). Bausmger Melchior - Reck<br />
Hans - Beck Michel - Beck Jerg - Beck Jakob - Beiter Hans,<br />
der jung - Beiter Conrad - Beiter Martin - Beiter Hans,<br />
Schütz - Bopp Jerg - Bürckie alt Jerg - Buelach Hans - Dieringer<br />
Balthas - Dieringer Hans - Dieringer Veit - Edelmann<br />
Hans - Edelmann Jak. - Dentz Hans Wtw - Fehl Hans -<br />
Fuchsjäger Michel - Fuchsjäger Mart. - Gietle Christ - Gindter<br />
Hans, Schulmeist. - Greß Hans - Halder Hans - Haug' Jakob -<br />
Haug Ciaus - Hausch Jakob Witwe - Hausch Michel der<br />
jung - Heckh Hans - Heckh Jakob - Heckh Hans Witwe -<br />
Hermann Andreas - Hermann Hans, Heiligenpfleger -<br />
Hermann Hans, der iung - Hermann Baltiias - Hermann<br />
Peter, Vogt - Hermann Hang des Steffens - Hermann Martin<br />
- Hewis Hans - Hiriinger Hans - Hiriinger Barthle -<br />
Hipp Jerg der alt - Hipp Jerg der junf - Hipp alt Hans,<br />
Wagn. - Hipp Hans, Wagn. - Hipp Hans d. jüngst - Hipp Jak. -<br />
Hohenberge! Dauid - Jeger Martin - Kalbauiier Martin - Kern<br />
Jakob • Kern Hans Frieß - Kern jg. Hans - Klaffenschenkei alt<br />
Hans - Klaffenschenkei Gall - Knüttel Jerg - Knittel Michel -<br />
Koler Bernhard - Klotz Lienhard - Klotz Christ - Kost Jakob<br />
der alt - Kost Jakob der jung - Küster Christ - Maurer<br />
Paule - Mayer Kaspar Witwe - Mayer Hans - Mayer Onrist -<br />
Metzger Hans - Miller Jerg - Pfister Balthas - Raad Hans -<br />
Rager Hans - Ripp Ar.thoni - Ruef Martin - Ruef Michel<br />
Raisle Marx - Saile Hans - Saur Hans - Saur Ludwig -<br />
Seher Hans - Scholl Hans - Scnmid Benedikt - Scnuemacher<br />
Jerg - Schuemacher Hans - Scnuemacher Kaspar - Spengler<br />
von M. Schaitel 2. Fortsetzung und Schluß<br />
Hans - Schweitzer Hans - Schwenk Dionysius der alt -<br />
Schwenk Dionysius der jung - Strooel Balthas der ait -<br />
Strobel Jakob Witwe - Strobel Balthas der jung - Strobel<br />
Jakob - Strobel Hans - Wannenmacher Andreas - Wannenmacher<br />
Christ - Wannenmacher Claus - Wannenn '•her Jakob<br />
- Wannenmacher Hans - Wild Hans, Hafner - Widmayer<br />
Kaspar - Widmayer Ludi - Widmayer Gall - Widmayer Gall,<br />
Schäfer - Widmayer Jakob - Widmann Marx - Wiest Martin<br />
- Zopp Claus - (Pflegschaften in Rangendingen): Bernhard<br />
Fuchsjegers Kinder - Michel Hauscn'es Kinder - S.offel<br />
Haug's Kinder - Hans Sailin's Tochter - Hans Saile's,<br />
des Millers, Kinder - Hans Saur's Kinder.<br />
Schlatt (45). Alber Jerg - Bechtold Jakob - Becntold<br />
Barthle - Beciüoid Enderis - Berner Hans - Conantz Martin<br />
- Conantz Christ - Conantz JakoD - Conantz Hans - Conantz<br />
David - Diepolt Hans - Diepolt Balthas - Diepolt Jakob<br />
- Diepolt Hans II. — Diepolt Balthas II. - Glambser<br />
Hans - Glottis Jerg - Hoch Balthas - Khaimer Kaspar -<br />
Klingler Balthas - Laib Michel - Lang Stephan - Lang Bastian<br />
- Maurer Jakob - Miller jasoh - pflumm Hans -<br />
Pflumm Thoma - Pleyel Hans - Rieckher Hans - Riecicher<br />
Hans II. - Schefer Hans - Schmid Hans - Schueler Hans -<br />
Schueler Jakob - Schueler Dionysi - Schueler Hans II. —<br />
Schueler Hans <strong>III</strong>. - Vogt Hans - Volmer Hans - Polmer<br />
Michel - Walter Hans - Walter Martin - Zanger Hans -<br />
Zeifer Hans - Zeifer Hans II.
Jahrgang 1955 HOHENZOLLE II ISCHE HEIMAT 61<br />
Sickingen (14). Anstatt Michel - Arnolt Hans - Beckh<br />
Jakob - Beckh Erasimus - Groß Melchior - Guldin Friedrich<br />
- Humel Hans - Kleinmann Adam - Kleinmann Michel<br />
- Raath Hans - Scher Hans - Schlotterer Jerg -<br />
Schweinle Philipp - Treipe Hans.<br />
Starzein (23). Aichelin Hans - Aigner Hans - Bach Jacob<br />
- Bengele Virich - Bintz Claus - Bosch Jakob - Burckhardt<br />
Hans - Diepolt Kaspar - Diepolt Christ - Flad Jakob<br />
Witwe - Flad Jakob - Gauß Jakob - Hardtmann Peter -<br />
Khaimer Hans - Kipft Ursula - Koch Hans Witwe - Leitterer<br />
Hans - Pfeffer Hans - Reginer Martin - Stumpp Hans -<br />
Stumpp Melchior - Vnmueth Jerg Witwe - Wickher Barthle.<br />
Stein (19). Anstatt Elias - Belser Hans, Vogt - Costanzer<br />
Martin - Haan Hans - Haarer Hans - Hardtmann<br />
Martin - Haut alt Hans - Haut jung Hans - Haut Melchior -<br />
Kohler Hans - Lemelin Friedrich - Poppel Jerg - Ruef<br />
Hans - Schmid Hans - Schmid Hans II - Schneider Martin -<br />
Stahlecker Augustin - Vetter Jakob - Vetter Jerg.<br />
Steinhofen (31). Baur (Paur) Hans - Baur Kaspar<br />
Witwe - Doner Jakob - Dreher Hans - Helle Kaspar - Helle<br />
Hans - Hohenloch Gall - Killmayer Balthas - Killmayer<br />
Michel - Krieger Hans - Marx Theis - Mertz Hans - Metzger<br />
Michel - Linder Michel - Linder Martin - Lomiller<br />
Marx - Oth Martin - Oth Jakob - Oth Martin, Vogt - Rager<br />
Hans - Rein Michel - Sautter Melchior - Sautter Konrad<br />
- Vecker Martin - Vecker Hans - Vecker Hans II. -<br />
Vecker Michel - Vecker Michel, Metzger - Vecker Kaspar -<br />
Vogt Hans - Wildberger Stoffel.<br />
Stetten bei Hechingen (39). Bachmann Melchior -<br />
Bausinger Hans - Bausinger Jerg - Bausinger Theis -Bukkenmayer<br />
alt Jerg • Buckenmayer alt Melchior - Finck Jerg<br />
- Flach Hans - Flach Jerg - Flach Thoma - Geller Hans -<br />
Gfrerer Michel - Gfrerer Stephan - Gfrerer alt Stephan -<br />
Gfrer jung Stephan - Groß Melchior - Haiber Hans - Klotz<br />
Jerg - Kohler Jerg - Komer (Kummer) Jakob - Preyel<br />
Hans - Rebstock Hans - Renz Jerg - Rueff Kaspar - Sch.intz<br />
Jerg, Vogt - Schneider Hans Witwe - Schneider alt Hans -<br />
Schurer Martin - Silber Michel - Volmer Hans - Weinundbrot<br />
Stoffel - Ziegler Bernhard - Ziegler Balthas.<br />
Stetten u. Holstein (43). Borhaubt Konrad - Borhaupt<br />
Martin - Bosch Hans - Brienck Hans - Deufel Balthas<br />
- Eberle Hans - Eberlin Michel - Eberlin Conrad -<br />
Gretzinger Hans - Hauser Martin - Herdle Michel - Holzhauer<br />
Jerg - Holzhauer Balthas - Knebel Jakob - Koler<br />
Martin - Krauß Hans - Locher Hans - Locher Hans II. -<br />
Locher Hans <strong>III</strong>. - Locher Jerg - Locher Martin - Mayer<br />
Blesi - Mayer Martin - Mayer Theis - Mayer Hans - Mayer<br />
Hans II. - Mayer Bastian - Mayer Werner - Nef Konrad -<br />
Rehm Theis - Behm Hans - Schefer Jerg - Schefer Hans -<br />
Schefer Hans II. - Schefer Jakob - Schefer Gall - Schwenck<br />
Michel - Schwenck Hans - Schwenck Blesi - Schwenck Michel<br />
II. - Schwenck Bastian - Vetzer Konrad - Wertz Kaspar.<br />
Thanheim (29). Beck Michel, Wagner - Beck Jerg der<br />
alt - Beck Hans, Sohn des Vogts - Beck Jakob - Beck Han -<br />
Beck Michel - Beck, der Vogt - Binder Christ - Binder<br />
Jakob - Binder Oswald - Buckenmayer Melch - Buckenmayer<br />
Kaspar - Buckenmayer Hans, Tochlermann des Vogtes<br />
- Fatz Hans - Ehemann Hans - Gsell Hans - Gsell Michel<br />
- Gsell Martin - Gsell Martin, Kuhhirt - Haug Oswald<br />
- Kantz Christ - Kantz Michel - Mayer Balthas -<br />
Obermayer Andreas - Oth Hans - Roth Hans - der Kremer -<br />
der Schütz - der Wagner - der Vogt.<br />
W e i 1 h e i m (40). Beitter Hans Witwe - Bindel Martin -<br />
Dintz Martin - Groß Hans - Guldin Jerg - Halder Stephan -<br />
Halder jung Stephan - Haider Balthas - Heckenhawer Balthas<br />
- Heckenhawer Peter - Henni Martin - Henni Theis -<br />
Hewis Martin - Kantz Christ - Kantz Michel - Kantz Balthas<br />
- Klotz Jacob - Linder Melchior - Riester Hans - Ruef<br />
Jakob - Schueler alt Hans - Schueler jung Hans - Schuler<br />
Ulrich - Schuler Georg - Sickinger Hans - Speidel Hans - Stingel<br />
Jerg - Vecker Martin - Walter Hans - Walter Jak. - Waltz<br />
alt Hans - Waltz jung Hans - Waltz jung Hans, des Martin<br />
Sohn - Waltz Martin - Weinstein Hans - Wiest Jakob -<br />
Wiest Hans - Wiest Konrad - Wiest Michel - Wolff Hans.<br />
Wessingen (25). Beck Christ - Beck Melchior - Beck<br />
Hans - ßertsch Peter - Bogenschütz Jakob - Haug Melchior<br />
Hausch Bernhard - Hausch Jakob der Ober - Hausch Jakob<br />
der Unter - Hausch Melchior - Hausch Michel - Heinlir Jakob<br />
- Hirlinger Claus - Hohenloch Hans, Vogt - Keßler<br />
Martin - Lohmiller Adam - Mayer Hans - Ruefs's Melchior<br />
Witwe - Ruef jg. Melchior - Ruef Balthas - Sickinger lans<br />
- Sickinger Jakob - Sickinger Martin - Vogt Stephan - Wanner<br />
Kaspar.<br />
Zimmern bei Hechinge r. (21). Baur (Paur) Hans -<br />
Baur Gall - Baur Michel - Bogenschütz Hans - Bogenschütz<br />
Hans II - Bogenschütz Hans <strong>III</strong> - Bogenschütz Hans IV -<br />
Bogenschütz Jerg - Bogenschütz Melch, Vogt - Bogensch itz<br />
Melchior - Bogenschütz Michel - Bogenschütz Martin Kinder<br />
- Bogenschütz Martin - Halder Balthas - Kayser Hans -<br />
Kayser Hans jg. - Kayser Martin - Pflumm Melchior -<br />
Mauser Melchior - Ulrich Hans - Vecker Gleri.<br />
Alte Gemeinderechnung von Jungingen 1799-1800<br />
Verzeichnus was die B« e le Burger Moyster . "hannes Winter und<br />
Johannes Speydel vom Glerp at 1799 Bis widerum am Gleretstag<br />
1800 aus gegen la'ien. Erstlich i". Kr,<br />
Am Gleretstag iem Herrn ärr Vo Ein Hl. Meß zolt —.22<br />
Denen Schuol Kinder und Lehrer zolt 1.24<br />
rem Johannes Winter Vor i/o Clafter Holtz zolt 2.30<br />
1/en. Alexander Fflom Von Schlat zolt —.48<br />
Wie Mon die Holtz Thoil aus gegeben hat dem Hechinger<br />
Ober Jager denen Vorgesetzten und Depentierten zolt 6.16<br />
Wie Mon die Vieh Ordnung gemacht denen Depentierten zolt 3.44<br />
<strong>Der</strong> I'.^ara Kuonar ;en auf Hechingen zolt —.10<br />
Dem Casimiry Riester wegen Haut Mon Hora laut Conto<br />
Vor 3 Johren zolt 21.49<br />
Vor die Gemynt Zins zalz auf Tübingen 22.Ii<br />
Vor Ein Riß Papier zalt 5.48<br />
Dem Johannes Schuoller wegen Schantz fahren auf Freyenstadt<br />
nebst 2 Man Schantzer in all^m z :1t 25.58<br />
Dem J. Matheis Buomiller Vor 3 Scheffel Haber • Vor die<br />
Frantzosen zolt 13.30<br />
Dem Fryt 'rieh Greßer Vor 1 Scheffel 4.30<br />
Gregori Riester des gleichen 1 Sehr Efe f.'<br />
* ugustin Sc. aolle >r Ein Tai te Holtz 1 is Schuol Haus - .0<br />
Dem ugusiin Win' r Vor 6 Claiter ' loltz zu machen 3 i2<br />
Dem S( yeitz
62 H O H E N Z O L L E E I S C H E HEIMAT .Tahrgyng 1955<br />
Quartiermacher von Plankhenstein Husaren Beym Ein Quartier<br />
und zwoy Fuoterage gefaßt in allem Kost 6.32<br />
Vor 3 Rokhen Scheib zuom Hay benden zolt —.48<br />
Dem Landdepentierten von Hausen zolt —.20<br />
Einer K. Exekution gelt zolt wegen Einlliferen 1.14<br />
Wie Mon die 43 Scheffel Haber ins Magazin eingelifert denen<br />
Fuhrleiten, Trenkhgelt im Magazin, in allem kostet 6.18<br />
Gotfried Winter Vor 3 Klaffter Bren Holtz zu machen zolt 1.30<br />
Simon Kohler ist bey der Nacht auf Bodelshausen zolt 1.—<br />
Dem Dionißy Bosch Vor Ii/. Scheffel Haber zolt 12.—<br />
Dem Carle Bosch Vor Schriid arbeit zolt 2.5<br />
Dem Herrn Pfarr Vor Haber zolt zur Requisition 22 Scheffel<br />
und 6 Vitel a 8 Fl. Macht 182.—<br />
Dem Longinus Buomiller Haber zur Requisition 13 Scheffel<br />
3 Vitel den Scheffel a 8 Fl. Macht 106.56<br />
Wie Mon Schamat Leget (Flurname, eigentlich Liaget,<br />
von Äaget, unbebautes Land, Weide n. Krauß)<br />
6 M. ietem 3 Tag zolt 10.10<br />
Wie Mon Ein Tobel (?) (vielleicht Tabell) wegen geholten<br />
Soldaten und Forstrov (?) gemacht 2.45<br />
Dem Lehrer vor die Consignation zu machen zolt ^24<br />
Dem Hillary Zanger vor Leichter (?) saltz und gewürtz zolt 2.17<br />
Dem Toni Schuoller vom Pferch Flikherlon zolt 2.40<br />
Von Einem Buoch zu machen wegen dem Fort Span (Vorspann?)<br />
2.<br />
Dem Gestiftts Pfleger aus dem Weiller Wald zolt 1,12<br />
Dem Hl. Hellerzins zolt —4i/2<br />
Dem Herrn Pfarr vor 12 Creutz ging in die Anna Capel 4.—<br />
Mehr ihme zolt —.48<br />
Dem Herrn Pfarr sein Preßentgeiz zolt 2.—<br />
Dem Schitzen sein Johres Ion zolt 40.—•<br />
Dem Schitzen vor Hay zolt für die Plankhenstein Husaren<br />
11 Centner 16 Pfund der Centner a Fl l. 30 Xer macht 27.46<br />
Dem Vogt sein Wartgelt zolt 4.—<br />
Vors Schreiben zolt 3.—<br />
Dem Rößleswirth Bernhart Buomiller von Einen! Veracordierten<br />
Wagen von Tibingen auf Stokhach zolt 85.12<br />
Wie der Schitz mit 5 Wegen Hoy Von hier auf Balingen<br />
gefahren Trenkhgelt und Zehrung Kostet 11.—<br />
Ime Lon zolt 3 Tag 3.—<br />
Dem Brono Schuoller vor Frucht zolt wegen Weiler Hof —.36<br />
Dem Caminfeger vom Schuollhaus zolt —.12<br />
Dem Burger Meister von Schlat wegen Weiler Hof zolt 1.14<br />
Vor die Gemeynd Jungingen in 3 Losen und urbari Zins z. 3.16<br />
2 Corporal um Abwendung 2 Wegen —.48<br />
Vor einen Brief trogen auf Hechingen zolt —.12<br />
Einem Großelfinger Vor 24 Seg Haber _ if Rottweil z.<br />
Leobolt Zanger vor Hay benden und Holtz machen zolt<br />
Dem a: Johannes Schuoller vor 52 Centner Naturali von<br />
Hechingen nocher Donaueschingen zu fihren vom<br />
Centner a 1 Fl. 23 Xer<br />
Dem Burger Moister Vor 23 geng auf Hechingen und Stetten<br />
Laut Beylog den Tag a 24 X Macht<br />
Dem Burger Moister Speidel Vor 16 Geng auf Hechingen und<br />
Stetten zolt<br />
Dem Schitzen vor 28 Geng auf Hechingen zolt Laut Beyl g<br />
Dem Vogt vor 39 Geng auf Hechingen ieten Tag 40 X Macht<br />
Wie Man die Lo Wegen Hay ins Magazin gefiert 4 Mon, und<br />
Trenkhgelt in allem Kostet<br />
Dem Xaveri Buomiller Vor 14 Stukh Breter zolt a 16 X Macht<br />
Mehr dem selben vor 2 seeg Kopf zolt<br />
Dem Caspar Bosch vor 6 Breter a 23 X zolt<br />
Mehr demselben vor Stein fihren auf die Land stros<br />
Dem Lorentz Schuoller vor Ein X Korn Laden und ein<br />
Hauen hollen<br />
Dem Ponkratzi Riester wegen seinem Stirle zolt<br />
Mehr dem selben wegen Krommen Hagen zolt<br />
Vom Hagen zu metzgen zolt<br />
Dem Sylvester Buomiller Vor 6 Dutzet F= i_. len zolt<br />
Tobias Dekhel, Johannes Buomiller und . lasy Speydel naturali<br />
auf Tuoneschingen (Donaueschingen) gefirt item<br />
zolt 21 Fl Macht<br />
Von 48 Centner Hay von Hechingen nochher Stockach zu<br />
fieren z.<br />
Vor 20 Centner Hay auf Duoneschingen fuhrlon zolt<br />
Ferner widerum 20 Zentner auf Duoneschingen veracordiert<br />
und zolt<br />
Dem Johann Speydel von 5 Klofter Holtz Macherion zolt<br />
Im Früojohr Vors Hoy benden auf immerdingen, und Blankenstein<br />
Husaren 5 Man 4 Tag zolt<br />
Im Spotj ohr widerum Hoybenderlon zolt<br />
Zwey Kaiserlichen Soldaten im Embten zolt um abwendig<br />
der Forspan (Vorspann?)<br />
Ferner einem Corporal um abwendig der Forspan z.<br />
Einem Corporal und 10 Weger auf Killer getan<br />
Ferner widerum einem zolt<br />
Dem Schitzen vor Schaub ubd Heib aushenkchen zolt<br />
Wie man die Windfehl versteigeret 2 Mohl im Wald geweßen<br />
denen Vorgestzten und Oberjeger zolt<br />
Wie man dem Herrn Pfarr das Holtz gegeben und Haib aus-<br />
gehenkht<br />
Hohenzollerische Bruderschaftsmitglieder in Maria Schray bei Pfullendorf<br />
Sigmaringen: Maria Elisabeth Banwarth 1753; Maria Ursula<br />
Booß 1752; Katharina Cartinin 1756; Maria Anna Dannegger 1755:<br />
Joseph Antoni Ebisch, Buchbinder, 1751; Franziska Ebisch geb. Herburger<br />
1751; M. Agatna Filßer 1753; Anton Friedrich Frick 1753; Johann<br />
Michael Fueterer aus der Ziegelhütte bei Sigmaringen 1748;<br />
Franziska Gauglerin (Gauggel!) 1746; Brigitta Gauglerin 1750; Maria<br />
Anna Hafner 1751; Johannes Hafner, Rotgerber, 1752; Maria Anna<br />
Holderrüedin 1756; Sebastian Huggli 1749; Anna Maria Lehle 1762;<br />
Joseph Loos 1749; Petrus Loos 1749; Anna Barbara Looß geb. Brawin<br />
1750; Fidelis Nolli 1754; Maria Anna Rauch 1749; Anna Maria<br />
Reißer 1750; Anna Maria Schmid 1762; Katharina Schneider 1749;<br />
M. Agatha Stahl 1749; Anna Maria Stahl 1768; Wunibald Wahl 1780;<br />
Barbara Werner 1750; Fidelis Wez, Franz Xaveri Wez 1753; M. Anna<br />
Wez, M. Barbara Wez, M. Elisaoeth Wez, M. Josepha Wez 1772.<br />
Sigmaringendorf: Walpurga Blaicher 1769; Walpurga Restle<br />
1766; Anna Maria Rübsamen 1832; Johannes Scheb 1783; Walburga<br />
Späh 1832; M. _ gatha Turnerin 1795. Spöck: Katharina Frick<br />
17": Michael Latne- 1748. Steinhofe : Christ^ Hueber 1777.<br />
Sto. z i n g n : \nton Groin 1832. Straßbef : Sophia<br />
lin, Jorunn Laur 1774. Tafertswei'er: fieli ,a Fenker 1757;<br />
Anna Maria Fürstin 1' 7; Wendelin He-i>zler 1753; Al -ia Maria<br />
...annl^przin 1785. Tauft jbronn: Helena Bürstel : 50; Maris<br />
Anna Burster 1764, An a M; „ia Burster 1766; Martha Burs er 1770;<br />
ivr ia ' ina Burtscher 79C Kunigunda Endreß 174s; Iada Feineren<br />
1790; i akob T nieisen l'Ei; Mic iael Fröhlich 1781; Anna Maria Fröh<br />
35; wnJbald Tslde 1759; Anna Maria Halder 1768; Johannes<br />
Halder 1771; Maria A atha "aide 1780; . Tagdalena Hai 1905;<br />
Maria Rosa ?7>rnstein 1 754; Franzislt Kl'ckier, Elisab-*' "^leckler,<br />
Mathias Klejkler : 34 Ivi-thias Klückler, Maria Anna Klockier 3 794;<br />
JG. ."•ui Reutling. . 1758; Loren: Sif 1 ^ 1758- Wina ria Sigle 1760;<br />
Katharn. i - igle 1765; J ;eph Sigl 17u4; Maria Arnla c fle 176t, Mag-<br />
'alena Sigle 1770; Maris, üiina Steffin (- SfsphäflJ 1749. r laleim:<br />
Genovefa Frick 1752; t jbin; ffal 1 herr 1766; B rbtra Miller<br />
1764: " na Ms na Strohe 1"6.'. Trilll 'ngen: Jakob ätelzer 1841;<br />
Eremi Dominikus Zuderoll. T r o c t e finfen: Mi -,a Antonia<br />
Bommer 1752; Xatl Irina Brur ier 1806; Katharina Fischer L760;<br />
-lisab Q+1 ^ Freud°mann 1800; Mrria t i na Hierlinger 1 761; Mari;<br />
Anna Konler 1760; Agatha Sachs 1767; Maria Gertruds Schosser 175C<br />
Kurznachrichten<br />
Beim Abbruch der Kirche von Kettenacker, die zwischen<br />
1608 und 1612 erbaut und geweiht gewesen war (FDA 73,<br />
'54), fand man im Frühling dieses Jahres 1955 jeweils in<br />
den drei Altären unter der Altarplatte gegen das Schiff<br />
zi das „Reliquiengrab", das vom weihenden Bischof ver-<br />
:hlossen worden war. In der kleinen Höhlung stand je ein<br />
kleines Glas (in Form eines Trinkglases (zwei je 8 cm und<br />
eines 6,5 cm hoch) außen mit Knaupen, das mittels eines<br />
W=ichskuchens abgedeckt war. Auf 2 dieser Wachsdeckel hatte<br />
sich das Siegel des Bischofs mit Mitra und Stab in rotem Siegellack<br />
erhalten mit der Umschrift „Joannes Jakobus episcopo<br />
Sebastiensis. y Dieser Wappenschild ist viergeteilt: Feld<br />
1 und 4 zeigt wieder .Mitra und Stab. 2 einer Pelikan mit<br />
Jungen, 3 drei dreizackige Kronen (2, 1.). Es handelt sich hier<br />
um den Konstanzer Weihbischof J o h a n n Jak. Mirgel,<br />
der 1597—1619 nachzuweisen ist (FDA 8, 8). In einem<br />
22.—<br />
— 30<br />
71.56<br />
t.1?<br />
6.24<br />
11.12<br />
26.—<br />
3.48<br />
—.12<br />
2.18<br />
—.12<br />
—.18<br />
1.—<br />
—.15<br />
1.30<br />
4.20<br />
44.8<br />
18.38<br />
22.—<br />
3.—<br />
4.24<br />
1.12<br />
—.48<br />
—.48<br />
28.—<br />
—.36<br />
4.44<br />
1.52<br />
(Fortsetzung folgt!)<br />
Me Einträge JI5 -1767 haben „Trc .elfingen". Unterschmeien:<br />
Anton Ziegler 1791. Veringendorf: Anna Maria Geiger von<br />
Verendorf 1796. Veringenstadt: Martha Eckstein 1773; Joachim<br />
Falchner 1787. Vilsingen: Franziska Klerer 1788; Rosa Rebholz<br />
1861; Genovefa Restle 1861. Walbertsweiler: Karl Booß t800<br />
Maria Anna Bregenzer 1762; Gregori Burth 1750; Fidelis Burth 1756<br />
Maria Burt 1763; Kunigunda Burt 1794; Hyacintha Fueterin 180)<br />
Judith Häusler 1786; Waldburga Kuen 1759; Kunigunda Kuon 1793<br />
Matthäus Lutz 1777; Margaretha Mayer 1798; Helena Restle 1778.<br />
Kunegund Restle 1779: Maria Restle 1749; Theres Restle 1797; Sauberger<br />
Agnes 1796; Maria Anna Schuelin 1796; Maria Schweigert<br />
1800. Wald: Maria Katharina Barrin 1749: Servulus Biechler; Eremit<br />
beim geschossenen Bild 1756: Barbara Büehler 1770; Antonia<br />
Ehrart 1877; Maria Anna Endreß 1789; Maria Franziska Fueterknecht<br />
1763; Konstantia Galler 1786; Theresia Galler 1789; Anna Maria<br />
Greßle 11 ,: Theodor Grueber 1762; Bernhard Gruber 1777; Antoni<br />
Hueber 1' 6; Maria Anna Kaltenbach 1763; Bibiana Kaltenbach *763;<br />
Vnselm Ll^oruj v. Kolb 17/"; Oberamtmännin Maria i.hei jsia v.<br />
XoL 1763; Mc -ia Dioscora V. KQ i 1763; Johanna iMepomucena v.<br />
Kolb Franziska Lenden 1802; Antor Ren: 1748; Anna Maria<br />
Rotmund 1794; Maria Ar., ,a Schmie 1789; Rosa ' chneider 1! i; Karolina<br />
Schweickert 76C; MarTTW Schwenk 1809; J.„¡eph £ ".tle 17t-;<br />
Elisabeth Vogel 1881; Mar' Anna Zech 1789; die Reichsäbti in<br />
Maria Dioscora 175C. Weihwang: Eleonora Bied -mann 1748;<br />
Eleonora Biechlerin : 748; Hyacintha Biechlerin 1748; Katharina I rt<br />
1765; Magdalena Burth 1790; Helena Burth 1793; Anna Maria Ct il<br />
1763; Andreas "'anal 1790; Rosina Kanal 1Y93; Juliana Seßler 175'<br />
" .viel süßxer 1796; Katharina Ww 174b. Wilflinfen: Maria<br />
Johanna Holzingin 1754; Katharina Mayerhofer 1755; VI. 'Jria Seherin<br />
1755; itharil Seifried 1752; Elisabeth Seifri.'d 1754; Pfarrer<br />
t .Jiann iviartin .:trobel 1749. Zielfingen. Maria Anna Feineiglerin<br />
(= Feineigle) 1764.<br />
Anmerkung: ei allen bekannter. Frauennamen wie Schderin,<br />
1 rthin 'isw ' ich die Machsilbe -in iveggelasst.,. Wenn<br />
mänr' che Vamlienname nicht Jhne weiteres zu
Jahrgang 1955 hohenzollerischeheimat gg<br />
und weihte die Marienkapelle in Hingingen., 1680 weilte er<br />
wieder in Zwiefalten. Bei einem dieser Anlässe wird er<br />
auch den Altar in Kettenacker konsekriert haben, der vielleicht<br />
im 30jährigen Krieg entweiht worden war. J. A. Kraus.<br />
Alexander Kesselring, Hofschreiber zu Trochtelfingen, im<br />
Dienst des Grafen Johann von Werdenberg, schrieb am 30.<br />
Mai 1516 die 1945 im Ringinger Rathaus verbrannte Heufeldurkunde,<br />
die den Prozeß zwischen Ringingen und Salmendingen<br />
enthielt. 1520 und 1522 begegnet er als Vogt zu<br />
Trochtelfingen (Pfarrakten daselbst). Neuestens fand man<br />
einen Brief von ihm an Junker Wendel Hemlinger zu Pfullendorf<br />
in einer Spalte des bekannten fachwerklichen Schoberhauses<br />
zu Pf Ullendorf, der im Jahre 1513 von ihm (noch<br />
Hofschreiber) geschrieben wurde. Doch handelt es sich darin<br />
nur um den Umtausch eines rinnenden Topfes. Die Kesselring<br />
seien zu Ueberlingen seßhaft und den bedeutenden Familien<br />
der Ebinger und Besserer verwandt gewesen, schreibt<br />
Rud. Keller S. 77 im Nachrichtenblatt der öff. Kultur- und<br />
Heimatpflege Südbadens 1954.<br />
Kleinhans Schwelher zu Ringingen. Am 18. Mai 1437 schulden<br />
Konrad Vogt der ältere und Konrad Vogt der jüngere,<br />
beide Bürger zu Veringen (deren Schild ein gebogenes<br />
Hirschhorn zeigt), dem vesten Hansen Schwelhern,<br />
genannt Klainhans, zu Ringingen gesessen, 200 rheinische<br />
Gulden in Gold, welche Schuld herrührt von dem<br />
vesten Konrad von Renhartswyler und zuvor von den festen<br />
Egk und Hainrich von Ryschach, Gebrüdern, die sie aufgebracht<br />
haben von der ehrbaren Barbara Füßlerin. Davon<br />
sollen sie jährlich 10 Gulden Zins reichen, wie der genannte<br />
Hans Schwelherr sich verschrieben hat gegen Jörgen von<br />
Ryschach, als Träger der Söhne Rudolfs von Ryschach selig.<br />
Es soll der Zins gen Trochtelfingen oder Hechingen geliefert<br />
werden. Sie setzen zu Bürgen zwei Burger von Ebingen.<br />
(Gabelkofer, Cod. hist 8, 16c, Seite 208 in de - Württbg. Landesbibliothek<br />
Stuttgart; Vgl. Württbg. Regesten I, 6186). Krs.<br />
Eine Speerspitze von Eisen, 10 cm lang mit Widerhaken<br />
von 5 cm (der zweite Haken fehlt) fand Bürgermeister Heinr.<br />
Hochsticher von Ringingen auf seiner Wiese auf Heufeld<br />
neben Dieterkaries Wäldle. Bei den Artillerieschießen im<br />
März, die von den Franzosen jeden Freitag durchgeführt<br />
wurden, war die Spitze durch einen Granatsplitter aus der<br />
Erde gerissen worden. Da an dieser Stelle nichts auf ein<br />
ehemaliges Grab hindeutet, wird man an eine Jagdwaffe<br />
denken können, wobei freilich das Alter völlig unbekannt ist.<br />
Krs.<br />
Dekanatswahl Trochtelfingen. Ein Schreiben des Generalvikars<br />
des Bischofs Hugo von Hohenlandenberg zu Konstanz<br />
beauftragt den Kammerer des Kapitels Trochtelfingen um<br />
1503—10 (Jahreszahl fehlt!), die wegen Krankheit oeantragte<br />
Resignation des Dekans Melchior Bäck (Beck)<br />
zu Salmendingen entgegenzunehmen, die Kapituiare<br />
zusammenzurufen und Neuwahl zu veranstalten (Erzb. Archiv<br />
Ha 320, fol. 212).<br />
Am 6. August 1563 erging der gleiche Auftrag an den<br />
Kammerer und Pfarrer Franziskus Fauding (Fuding)<br />
zu Oberstetten: Da durch den Tod des Magisters Renhard<br />
Linck, Pfarrer und Dekan zu Ringingen, das Dekanatsamt<br />
schon länger verwaist sei, und damit das Kapitel<br />
weiterhin keinen Schaden leide, soll er die Kapituiare<br />
zur Wahl zusammenrufen und das Ergebnis so bald als möglich<br />
nach Konstanz zur Bestätigung melden (Erzb. Archiv Ha<br />
329, S. 96).<br />
M. Renhard Link von Münsingen kam am 13. 6. 1495 an<br />
die Universität Heidelberg, wurde Bakkalaur am 9. 1. 1947,<br />
Magister 1498/99, und noch dort 1504 Toepke, Matrikel I.<br />
US Iii. 425. 428], Am 8. März 1505 zahlt er als Erstfrüchte<br />
der Pfarrei Gächingen bei Münsingen 12 fl. Etwa 150?—35<br />
war er Pfarrer und Dekan zu Erpfingen. wurde durch die<br />
Reformation vertrieben, 1535—40 in .Tunginpen. 1540—43 in<br />
Oberstetten, 1543- -63 in Ringingen. (Freibg. Diös.-Arcniv 70,<br />
154.) Krs.<br />
Alte Altäre tragen, trotzdem sie vom Bischof geweiht und<br />
mit einem ^eliquiengrab ausgestattet sind, oben auf der<br />
Platte keinerlei Kreuzlein! Daher erregen sie beim Abbruch<br />
immer wieder das Interesse, wenn vorn, unterhalb der Steinplatte,<br />
aus dem Unterbau eine kleine Höhlung zum Vorschein<br />
kommt, die in einen altertümlichen Glas die Re =<br />
liquien mit der We iheurkunde enthält (was un /erletzt<br />
an den Bischof einzusenden ist!). Um 1910 hat man<br />
weitnir in Unkenntnis obiger Tatsache auf die alten Altäre<br />
neue Altarsteine gelegt, so in Trillfingen, Kettenacker und<br />
anderswo. Krs.<br />
Ein Albertus de Kirwilre erscheint am 17. Aug. 1241 in einer<br />
Urkunde des Kaisers Friedrich II. fürs Kloster Rheinau unter<br />
den Zeugen an letzter Stelle (Cartular von Rheinau, Quellen<br />
z. Schweizer Geschichte Bd. 3, Abt. 2. Seite 66). Da es<br />
außer unserem Killer noch im Speirischen einen Ort Kirrweiler<br />
gibt, von dem jedoch kein Adel bekannt ist, wissen<br />
wir vorerst nicht, ob dieser Albert zu unserem Geschlecht<br />
Ringelstein-Killer gehört (Hohz. Jahresheft 1954 S. 116).<br />
J. Ad. Kraus.<br />
Eine Affenschmalz-Urkunde findet sich nach Kernler versteckt<br />
im Hechinger Stiftslagerbuch von 1593, wo von einem<br />
Hanfgarten am Stettenerbach berichtet wird, der im Besitz<br />
der Heiligkreuzpfründe war. Darauf mag man 6 Viertel<br />
Hanfsamen säen und erträgt im Verleihen jährlich 2 Pfd.<br />
8 Schilling oder 1 fl. 8 bazen und 1 hlr. Die Pfründe besitzt<br />
den Hanfgarten laut Verkaufsbrief vom 18. Mai 1413, der<br />
beginnt: „Ich Wilhelm von Killer, Heinrich von<br />
Killer seligen, den man nennt Affenschmalz<br />
ehelicher Sohn bekenne datum Donnerstag vor<br />
Sonntag Cantate 1413.<br />
<strong>Der</strong> Verkauf geschah also bald nach Heinrichs Tod, der am<br />
14. Januar 1413 erfolgte. Wilhelm war sonst erst seit 1420<br />
als Bruder des Kaspar bekannt. Ergänzend zu Hohz. Jahresheft<br />
1954 S. 116. Eventuelle weitere Funde dringend erbeten!<br />
Joh. Ad. Kraus.<br />
Ein neuer Friedhof zu Neufra durfte laut Erlaubnis des<br />
Konstanzer Generalvikars vom 2. August 1565 eingeweiht<br />
werden. Allerdings könnte auch Neufra an der Donau gemeint<br />
sein, da das Dekanat nicht angegeben ist. (Erzb.<br />
Archiv Ha 329, S. 138). Krs.<br />
Heimatliteratur<br />
Die Klösterlein Haigerloch, Stetten, (Heiligen-) Zimmern<br />
und Weildorf finden Erwähnung in „Monumenta ord. fratr.<br />
praedicatorum", tom XI, 1902, S. 152 zum Jahre 1611. Es<br />
heißt dort (in deutscher Uebersetzung): „Das Generalkapitel<br />
von Paris dieses Jahres (auf dessen Beschluß hin auch das<br />
Kloster Stetten bei Hechingen ein neues Profeßbuch anlegte)<br />
trug dem Ordensprokurator der Dominikaner in Deutschland<br />
auf, beim Papst den Auftrag zu erwirken, daß die zeitlichen<br />
Güter der vier Schwesternkongregationen der dritten<br />
Regeil Dominikanerordens, die zu Haigerloch,<br />
Stetten b. Haig., (Heiligen-) Zimmern und Weildorf in der<br />
Herrschaft des Grafen von Haigerloch bestanden haben,<br />
nicht den Weltpriestern daselbst, sondern dem Orden zum<br />
Unterhalt von Studenten zugewiesen würden". (Vgl. dazu<br />
Hodler, Gesch. d. Oberamts Haigerloch 1928, S. 560 betr.<br />
Haigerloch, S. 816 Weildorf, Heiligenzimmern S. 766 und<br />
Stetten S. 786 und zu letzterem auch Krebs, Investiturprotokolle<br />
S. 817.). Am 9. Juni 1612 hat dann der Orden beschlossen,<br />
die Güter der obigen vier Klausen dem Bischof<br />
von Konstanz zur Verfügung zu stellen. (Monum. ord. fratr.<br />
praedic. XI, 1902, S. 206). Krs.<br />
An das<br />
in<br />
Postamt
fi4 HOHENZOLLE1ISCHE HEIMAT Jahrgang 1955<br />
„Feste und Volksbräuche im Jahreslauf europäischer Völker"<br />
Das ist der Titel eines schönen und inhaltsreichen Buches,<br />
das der bekannte Volkskundler Professor Dr. Eugen F e h r 1 e<br />
in Heidelberg vor kurzem im Johann Philipp Hinnental-Verlag<br />
in Kassel erscheinen ließ.<br />
Das Buch umfaßt 219 Seiten, kostet kartoniert 6.50 DM, in<br />
Leinen gebunden 9.00 DM und ist mit zahlreichen Abbildungen<br />
im Text und auf 36 Kunstdrucktafeln, sowie mit einigen<br />
Notenbeigaben ausgestattet.<br />
Es beginnt mit den Winterfesten und zeigt, welche Sitten<br />
und Bräuche sich nicht nur in Deutschland, sondern auch bei<br />
einer Reihe anderer europäischer Völker im Laufe der Jahrhunderte<br />
im Wechsel des Jahres herausgebildet haben. Dabei<br />
wird auch auf das Rügerecht eingegangen und dabei besonders<br />
auf das alte Narrengericht in Grosselfingen hingewiesen<br />
und den damit verbundenen Kampf um den Sommervogel,<br />
den Fehrle versehentlich an den Anfang des Spieles legt,<br />
während er in Wirklichkeit am Ende steht und dort wegen<br />
seiner hohen volkskundlichen Bedeutung und seiner dramatischen<br />
Wirkung den öffentlichen Höhe- und Schlußpunkt des<br />
ganzen Spieles bildet. Auf der Tafel 12 sehen wir zwei Stabläufer<br />
des Grosselfinger Narrengerichts als Vertreter der Jugend<br />
und des Frühlings.<br />
<strong>Der</strong> Wunsch, den ich in meiner Schrift über „Das ehrsame<br />
Narrengericht zu Grosselfingen" ausgesprochen habe, daß in<br />
Zukunft das Grosselfinger Narrengericht in der Fachliteratur<br />
eine ihm gebührende Beachtung finden möge, scheint sich<br />
allmählich zu erfüllen, wie die in den letzten Jahren erschie-<br />
Sachregister des Jahrganges 1955<br />
nenen Schriften von Eris Hermann Busse, Johannes Künzig<br />
und jetzt auch die von Eugen Fehrle zeigen. Michael Walter.<br />
Kirchenführer Hechingen. Zum Schluß des Vorjahres erhielt<br />
die katholische Stadtpfarrei durch Geistl. Rat Carl Baur<br />
und einigen Helfern einen hübschen Führer von 36 Seiten<br />
(Liberias Verlag Hubert Braun, Erolzheim/Wtbg.). Er enthält<br />
auf 11 Seiten eine kurze Chronik von der Römerzeit bis<br />
heute, eine Beschreibung der verschiedenen Kirchen und Kapellen,<br />
nämlich Stiftskirche, St. Luzen, Spittel, Heiligkreuz,<br />
Christi Ruh, Marienkapelle, sowie eine Geschichte und Beschreibung<br />
des Klosters Stetten, wobei F. Staudacher und<br />
H. A. Buckenmaier beisteuerten. Ein Verzeichnis der Hechinger<br />
Pfarrer und einiger von dort stammender Geistlichen beschließt<br />
das Büchlein, das mit seinen 16 sehr guten Bildern<br />
sich von selbst empfiehlt. Kr.<br />
Von einer Mystikerin Haila von Gruol (verschrieben Gruen)<br />
des Klosters Kirchberg bei Haigerloch, und ihren Schauungen<br />
im 14. Jahrhundert berichtet die „Alemannia" Jg. 21,<br />
1893, S. 117—118. Kr.<br />
Die Flurnamenkunde von Jos. Schnetz, ein 112 Seiten<br />
umfassendes Büchlein, herausgegeben vom Verlag Bayerische<br />
Heimatfoirschung, München-Pasing, Dachstraße 23V2, ist<br />
allen Freunden der Heimat wegen seiner gediegenen Erforschung<br />
und klaren Darbietung der Flurnamen bestens zu<br />
empfehlen, zudem im Preis auch für den kleinen Mann erschwinglich<br />
(3 DM).<br />
Affenschmalzurkunde 63 Hausen-Jungingen, Pfarrer 31 Rangendingen, Kelch 9<br />
Albertus von Kirwilre 63 Hechingen, Kirchenführer 64 Rangendingen, Mundart 19<br />
Alemannisches Jahrbuch 1954 12 Hechingen, Kirchl. Pläne 1699 48 Ringingen, Fund 63<br />
Allmand 3 Hechingen, St. Ottilien 11 St, Luzius-Hechingen 16<br />
Altar-Reliquiengräber 63 Heuberg, Dreibannmarken 39 St. Luzen, Kalvarienberg 14<br />
Bärental, Tuffsteinbrüche 37 Heuliecher 4 Schilf sandstein 1<br />
Berufsschulen Hohenzollerns 32 Heuneburg 60 Schoy Karl 8, 32<br />
Beuron, Besitz in Breisgau 32 Immaculata-Bilder 6 Schwarz Michael 31<br />
Bruderschaftswesen 48 Jungingen, Gemeinderechnung 13, 27, 47, U Schwelher-Ringingen 63<br />
Bunte Mergel 17 Jungingen, Pfarrkirche 4 Sigmaringen, Flurnamen 15, 28, 43, 57<br />
Burg Hohenzollern, Glasgemälde 32 Kesselring-Trochtelfingen 63 Sigmaringen, Pietä 38<br />
Burg Hohenzollern, Pfarrkirche 16 Kettenacker, Kirche 62 Starzein, Klosterglöcklein 20<br />
Burladingen, Jägerhaus 31 <strong>Keuper</strong> als Waldlandschaft 49 Stauffenberg 31<br />
Dreikönigsbuben 4 Killer, Kirchturm 31 Steinhilben, Hedwig von 32<br />
Feste und Volksbräuche 64 Killertal, Urkunden 16 Straßberg 1806 29<br />
Flurnamenkunde, Schnetz 64 Kirchberg Kloster, Mystikerin 64 Stubensandstein 17<br />
Flußnamen in Hohenzollern 5 Knollenmergel 33 Trochtelfingen, Dekanatswahl 63<br />
Gammertingen, Burkarth Baltas 34, F4 Maria Schray, Hohenz. Bruderschafts- Trochtelfingen, Landkapitel 16, 31<br />
Gammertingen, Burladinger Adel 31 mitglieder 12, 30, 47, 62 Veringenstadt, Urkunden 32<br />
Grafschaft Zollern, Namenskunde 26, 46, 60 Melchingen, Fleckenbuch 20 Weihnachts-Brauchtum Rangendingen 2<br />
Grosselfingen - Sage 18 Meldungen, Hexenprozeß 50 Weiler ob Schlatt 11<br />
Hagen, Wortfamilie 20 Melchingen, Kirche 21 Weilheim, Kirchenpatron 31<br />
Haigerloch, Baumeister St. Anna-Kirche 41 Neufra-Friedhof 63 Wessingen, Käpfle 16<br />
Haigerloch, St. Annakirche 22, 42, 55, F6 Ostrach, Nachlaß des Pfarrers 1593 58 Wilflingen, Sagen 19<br />
Hausen a. Andelsbach, Kaufbrief .6 Ostrach, Pfarrgeschichte 45 Zehnten 10<br />
Hausen a. Andelsbach, Pfarrkirche 53<br />
BESTELL-SCHEIN<br />
zum Bezug der „Hohenzollerischen Heimat"<br />
Ich/wir bestelle(n) ab sofort zum laufenden Bezug durch<br />
die Post Stück „Hohenzollerische Heimat", Verlagspostamt<br />
Gammertingen, zum halbjährigen Bezugspreis<br />
von 60 Pfennig.<br />
Vor- und Zuname<br />
Genaue Anschrift<br />
Dieser Bestellschein ist bei Neubestellung bezw, Nachbestellungen<br />
der nächsten Poststelle aufzugeben. Um deutliche<br />
Schrift wird gebeten.<br />
Hohenzollerische Jahreshefte 1955<br />
Band 15 (der ganzen Reihe 78 Bard) Jahrgang lf^S „Hohenzollerische<br />
Jahreshefte" enthält folgende Abhandlungen:<br />
Vorwort: S. K. H. Prinz Franz Joseph von Hohenzollern.<br />
Mitgliederverzeichnis.<br />
Walter Michael, Regierungsdirektor i. R. (Ranger Lngen):<br />
Glaube und Kirche in den Ortsnamen von Hohenzollern.<br />
Schmelzeisen G. K., Professor, Dr. (Hechingen):<br />
Nachschöpfung einer Skulptur Weckenmanns.<br />
Pfeffer Anton, Kustos i. R. ,Weilheim bei Hechingen):<br />
Dekan Fridolin Stauß-Steinhofen.<br />
M a i e r J o h s., Dr. phil. (Sigmaringen):<br />
Ein Hochstapler am Hechinger Hofe des 18. Jahrhunderts.<br />
Kraus J o h. Ad., Ordinariatssekretär (Freiburg i. B.):<br />
Stetten unter Holnstein.<br />
Kraus J o h. Ad., Ordinariatssekretär (Freiburg i. B.):<br />
Urkunden des Dominikanerinnenklosters Stetten im<br />
Gnadental.<br />
Berichtigung: Nr. 3 Seite 34 Geburtsjahr des Baltas<br />
Burkarth 1 8 2 9. - • Seite 3b: Hacken an langen Stiel jn. —<br />
Seite 41: Rokokokirche.