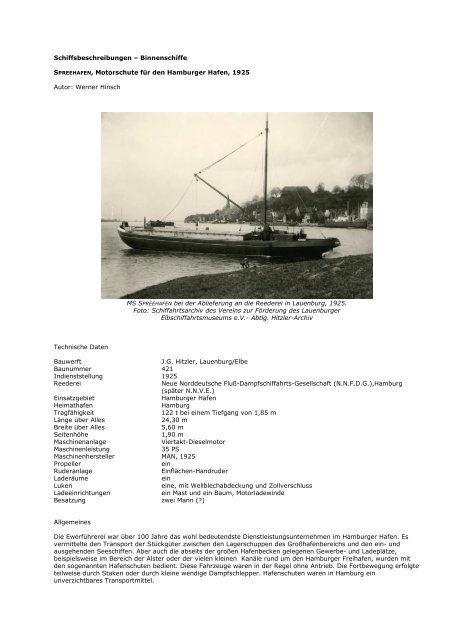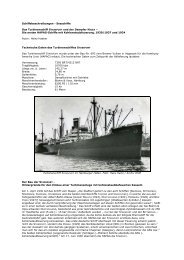Hinsch - Spreehafen\374
Hinsch - Spreehafen\374
Hinsch - Spreehafen\374
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schiffsbeschreibungen – Binnenschiffe<br />
SPREEHAFEN, Motorschute für den Hamburger Hafen, 1925<br />
Autor: Werner <strong>Hinsch</strong><br />
Technische Daten<br />
MS SPREEHAFEN bei der Ablieferung an die Reederei in Lauenburg, 1925.<br />
Foto: Schiffahrtsarchiv des Vereins zur Förderung des Lauenburger<br />
Elbschiffahrtsmuseums e.V.- Abtlg. Hitzler-Archiv<br />
Bauwerft J.G. Hitzler, Lauenburg/Elbe<br />
Baunummer 421<br />
Indienststellung 1925<br />
Reederei Neue Norddeutsche Fluß-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (N.N.F.D.G.),Hamburg<br />
(später N.N.V.E.)<br />
Einsatzgebiet Hamburger Hafen<br />
Heimathafen Hamburg<br />
Tragfähigkeit 122 t bei einem Tiefgang von 1,85 m<br />
Länge über Alles 24,30 m<br />
Breite über Alles 5,60 m<br />
Seitenhöhe 1,90 m<br />
Maschinenanlage Viertakt-Dieselmotor<br />
Maschinenleistung 35 PS<br />
Maschinenhersteller MAN, 1925<br />
Propeller ein<br />
Ruderanlage Einflächen-Handruder<br />
Laderäume ein<br />
Luken eine, mit Wellblechabdeckung und Zollverschluss<br />
Ladeeinrichtungen ein Mast und ein Baum, Motorladewinde<br />
Besatzung zwei Mann (?)<br />
Allgemeines<br />
Die Ewerführerei war über 100 Jahre das wohl bedeutendste Dienstleistungsunternehmen im Hamburger Hafen. Es<br />
vermittelte den Transport der Stückgüter zwischen den Lagerschuppen des Großhafenbereichs und den ein- und<br />
ausgehenden Seeschiffen. Aber auch die abseits der großen Hafenbecken gelegenen Gewerbe- und Ladeplätze,<br />
beispielsweise im Bereich der Alster oder der vielen kleinen Kanäle rund um den Hamburger Freihafen, wurden mit<br />
den sogenannten Hafenschuten bedient. Diese Fahrzeuge waren in der Regel ohne Antrieb. Die Fortbewegung erfolgte<br />
teilweise durch Staken oder durch kleine wendige Dampfschlepper. Hafenschuten waren in Hamburg ein<br />
unverzichtbares Transportmittel.
Zwei der bedeutendsten Reedereien des Elbstromgebietes - die Neue Norddeutsche Fluß-Dampfschiffahrts-<br />
Gesellschaft (N.N.F.D.G.) und die Neue Deutsch-Böhmische Elbeschiffahrts-Gesellschaft (N.D.B.E.) - unterhielten<br />
wichtige Eildampfer-Linienverkehre zu den markantesten Plätzen entlang der Elbe und über Berlin hinaus ins<br />
ostdeutsche Stromgebiet. Befördert wurden Stückgüter aller Art. Zum Sammeln und Zwischenlagern der<br />
verschiedenartigen Güter unterhielten beide Gesellschaften im Hamburger Hafen eigene Kaianlagen, Kaischuppen und<br />
auch eigene Hafenschuten. Letztere mussten, wie üblich, entweder durch eigene oder angemietete Schlepper bei<br />
Bedarf verholt werden.<br />
Mit der Einführung des Dieselmotors entwickelten beide Gesellschaften einen völlig neuen Typ einer Hafenschute: ein<br />
von einem kleinen Dieselmotor angetriebenes stählernes Fahrzeug, welches darüber hinaus auch noch eigenes<br />
Ladegeschirr und eine Wellblechlukenabdeckung hatte. Diese neuen Fahrzeuge waren nun unabhängig von den<br />
üblichen Schleppern, konnten spontan ohne Zeitverlust überall hin dirigiert werden, sogar zu Kunden, die keine<br />
eigenen Ladegerätschaften besaßen!<br />
Während die N.D.B.E. um 1928 sieben derartige Motorschuten auf der Werft in Dresden-Laubegast erbauen ließ,<br />
orderte die N.N.F.D.G. 1924/25 vier Motorschuten bei der Werft von J.G. Hitzler in Lauenburg. Von dieser Werft hatte<br />
sie bereits 1914 die ersten beiden motorgetriebenen Schuten WESTHAFEN und OSTHAFEN erhalten und probeweise für<br />
Transporte im Berliner Hafenbereich eingesetzt.<br />
Die modernen, mit Dieselmotoren ausgerüsteten Schuten leisteten einen wichtigen Beitrag zur Hamburger<br />
Hafenschifffahrt. Sie waren teilweise bis in die 1950er Jahre in Betrieb.<br />
Geschichte der Motorschute SPREEHAFEN<br />
Die N.N.F.D.G. hatte das Schiff zusammen mit drei weiteren Neubauten bei der Werft J. G. Hitzler in Lauenburg<br />
bestellt. Es erhielt die Baunummer 421 und wurde 1925 abgeliefert. Die Kosten für den Neubau betrugen damals<br />
insgesamt 27.893,28 Mark.<br />
Bis 1953 blieb das Schiff im Hamburger Hafen unverändert im Einsatz. 1953 verkaufte die Reederei es an den<br />
Partikulier E. Pagel aus Hamburg. Fortan hieß das Schiff TANGERLAND, und der neue Eigner setzte es außerhalb des<br />
Hamburger Hafens auf der Oberelbe und manchmal auch auf den westdeutschen Kanälen ein. Dazu waren<br />
umfangreiche Veränderungen nötig: 1952 war bereits ein stärkerer 4-Takt Deutz-Dieselmotor mit 120 PS eingebaut<br />
worden; 1955 und 1962 wurde das Schiff auf 39,16 m und 49,20m verlängert. Damit vergrößerte sich die<br />
Tragfähigkeit auf 260 t bzw. 344 t. 1963 erfolgte nochmals eine Neumotorisierung mit einem 300 PS starken Daimler-<br />
Benz 4-Takt Dieselmotor.<br />
MS MARTHA ex SPREEHAFEN des Partikuliers Nürnberg im Bleckeder Hafen, 1989.<br />
Foto: W. <strong>Hinsch</strong>, Hohnstorf<br />
1975 verkaufte Pagel das Schiff an den Partikulier Willi Nürnberg aus Bleckede, der es unter dem Namen MARTHA<br />
weiterhin im Elberaum einsetzte. Im Rahmen einer europaweiten Abwrackaktion für Altfahrzeuge wurde das Schiff<br />
1991 bei der Firma Neumann in Hamburg verschrottet.
Schiffbau<br />
Der Schiffskörper entsprach in seinen Linien mit Ausnahme des Hecks der typischen Form einer Hamburger<br />
Hafenschute. Die Spanten waren gerundet und gingen mit einem Kimmradius von 400 mm in den flachen Boden über.<br />
Das Heck jedoch war entsprechend der Form maschinengetriebener Schiffe konstruiert. Die Hinterschiffslinien<br />
erlaubten einen guten Wasserzufluss zur Schiffsschraube und zum Einflächenruder.<br />
Generalplan eines typgleichen Schwesterschiffes der SPREEHAFEN.<br />
Schiffahrtsarchiv des Vereins zur Förderung<br />
des Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums e. V., Bestand U 7.3<br />
Die in Nietkonstruktion erstellte Außenhautbeplattung hatte im Bereich der Seitenwände eine Stärke von 7 mm, in der<br />
Kimm 8 mm und im Boden 7 mm. Die Spanten bestanden aus L 75x50x7mm. Die 180 mm hohen Bodenwrangen<br />
hatten eine Blechstärke von 6 mm mit Anschlusswinkeln 75x50x7 und L 50x50x6 mm als Gegenspant. Die 600 mm<br />
breite Gangbord bestand aus 6 mm Riffelblech, das anschließende Lukensüll war 600 mm hoch und hatte eine Stärke<br />
von 6 mm. Der Laderaumboden war mit einem Streck aus 50 mm starken Fichtenbohlen ausgelegt. Bei Spant 24 war<br />
der Laderaum durch ein stählernes Querschott unterteilt. Das Logis für die Besatzung befand sich in der Vorpiek.<br />
Antriebsanlage<br />
Der direkt mit der Schiffsschraube verbundene erste Antriebsmotor hatte eine Leistung von 35 PSe (!). Es handelte<br />
sich um einen einfachwirkenden MAN 4-Takt Dieselmotor mit 3 Zylindern von 150 mm Durchmesser und 220 mm<br />
Hub.<br />
Die Anordnung erfolgte im Heck in einem recht großzügig erscheinenden Maschinenraum mit versenktem<br />
Decksaufbau und Oberlicht. Wie auf dem Ablieferungsfoto erkennbar, wurde auch die auf dem Deck an der Vorkante<br />
des Maschinenraums angeordnete Ladewinde mittels Kettentrieb vom Hauptmotor angetrieben.<br />
Schwesterschiffe<br />
Neubau 340 WESTHAFEN 1914 (zunächst für Berlin)<br />
Neubau 341 OSTHAFEN 1914 (zunächst für Berlin)<br />
Neubau 413 MOLDAUHAFEN 1925<br />
Neubau 414 OBERHAFEN 1925<br />
Neubau 422 NIEDERHAFEN 1925<br />
Benutzte Quellen<br />
- Baulisten der Schiffswerft von J. G. Hitzler, Lauenburg<br />
- Geschäftsbücher der damaligen Zeit im Besitz der Werft<br />
- Hauptspantzeichnung der Werft, Nr. 0487, im Schiffahrtsarchiv des Vereins zur Förderung des Lauenburger<br />
Elbschiffahrtsmuseums e.V., Bestand U 7.8<br />
- Generalplan der Werft, Nr. 0424/2074, der Schute WESTHAFEN (Neubau 340) im Schiffahrtsarchiv des Vereins zur<br />
Förderung des Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums e.V., Bestand U 7.3<br />
- Halbmodell des Schwesterschiffes MOLDAUHAFEN (Modellsammlung Lauenburger Elbschiffahrtsmuseum)<br />
- Abwrackbescheinigung der Firma H. Neumann, Hamburg, vom 23.9.1992