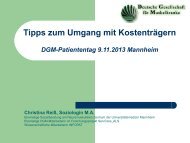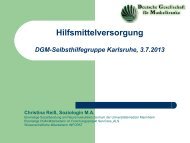Psychosoziale Beratung im Auftrag der DGM an den
Psychosoziale Beratung im Auftrag der DGM an den
Psychosoziale Beratung im Auftrag der DGM an den
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Konsensuspapier <strong>der</strong> bayerischen Muskelzentren<br />
„<strong>Psychosoziale</strong> <strong>Beratung</strong> <strong>im</strong> <strong>Auftrag</strong> <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft für<br />
Muskelkr<strong>an</strong>ke e.V. <strong>an</strong> <strong>den</strong> bayerischen Neuromuskulären Zentren“<br />
(St<strong>an</strong>d 4/2002)<br />
Angelika Eiler, Sozialberatung <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> am Neuromuskulären Zentrum Würzburg,<br />
Sus<strong>an</strong>ne Werkmeister, Sozialberatung <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> am Neuromuskulären Zentrum Erl<strong>an</strong>gen,<br />
Albertine Deuter, Sozialberatung <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> am Neuromuskulären Zentrum München<br />
Erschienen: Nervenheilkunde 2002; 21: 320-5<br />
Inhalt<br />
1. Einleitung<br />
2. <strong>Auftrag</strong>, Ziele und Rahmenbedingungen<br />
2.1. Grundsätze<br />
2.2. Zielgruppe<br />
2.3. Ziele <strong>der</strong> psychosozialen <strong>Beratung</strong><br />
2.4. Überweisungskontext<br />
2.5. Rahmenbedingungen<br />
3. Arbeitsformen <strong>der</strong> Pychosozialen <strong>Beratung</strong><br />
3.1. Prinzipien <strong>der</strong> psychosozialen <strong>Beratung</strong><br />
3.2. <strong>Beratung</strong> und Begleitung<br />
3.3. Themen <strong>der</strong> <strong>Beratung</strong><br />
3.4. Informations- und Begegnungsver<strong>an</strong>staltungen<br />
3.5. Initiierung und Begleitung von Selbsthilfegruppen<br />
3.6. Anleitung und Begleitung Ehrenamtlicher<br />
3.7. Öffentlichkeitsarbeit<br />
3.8. Fortbildungen für Fachkräfte <strong>an</strong><strong>der</strong>er Institutionen<br />
4. Grenzen <strong>der</strong> <strong>Psychosoziale</strong>n <strong>Beratung</strong>
Zusammenfassung:<br />
Seit 1996 wird die ambul<strong>an</strong>te medizinische Diagnostik und Beh<strong>an</strong>dlung <strong>an</strong> drei<br />
Neuromuskulären Zentren in Bayern durch das Angebot psychosozialer <strong>Beratung</strong> ergänzt, die<br />
Patienten mit neuromuskulären Erkr<strong>an</strong>kungen und ihre Angehörigen in Anspruch nehmen<br />
können. Träger <strong>der</strong> <strong>Beratung</strong>sstellen ist die Deutsche Gesellschaft für Muskelkr<strong>an</strong>ke -<br />
L<strong>an</strong>desverb<strong>an</strong>d Bayern e.V..<br />
Sozialarbeiterinnen unterstützen die Ratsuchen<strong>den</strong> bei <strong>der</strong> Kr<strong>an</strong>kheitsverarbeitung, bei <strong>der</strong><br />
Vermittlung konkreter Hilfen zur Alltagsbewältigung und in sozialrechtlichen Fragen. Dabei<br />
ermöglicht die Konzeption eine kontinuierliche Begleitung vom Zeitpunkt <strong>der</strong><br />
Diagnosestellung <strong>an</strong> bis hin zur Trauerbegleitung Hinterbliebener.<br />
Patienten, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind, können zu Hause aufgesucht<br />
wer<strong>den</strong>.<br />
Das <strong>Beratung</strong>s<strong>an</strong>gebot wird ergänzt durch die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, die<br />
Org<strong>an</strong>isation von Ver<strong>an</strong>staltungen und Workshops zu unterschiedlichen Themen sowie die<br />
Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter <strong>der</strong> <strong>DGM</strong>.<br />
Im vorliegen<strong>den</strong> Konsensuspapier wer<strong>den</strong> St<strong>an</strong>dards zur psychosozialen <strong>Beratung</strong> <strong>an</strong><br />
Bayerischen Neuromuskulären Zentren dokumentiert.<br />
Schlüsselwörter: Neuromuskuläre Erkr<strong>an</strong>kungen, psychosoziale <strong>Beratung</strong>, St<strong>an</strong>dards,<br />
Konsensuspapier<br />
Summary:<br />
Since 1996 three Bavari<strong>an</strong> Neuromuscular Centres are offering psychosocial counselling in<br />
addition to outpatient medical diagnostics <strong>an</strong>d treatment for patients with neuromuscular<br />
disor<strong>der</strong>s.<br />
The counselling centres are org<strong>an</strong>ized by the Deutsche Gesellschaft für Muskelkr<strong>an</strong>ke –<br />
L<strong>an</strong>desverb<strong>an</strong>d Bayern e.V.-.<br />
Social workers support clients in affairs of disease m<strong>an</strong>agement, they advise how to org<strong>an</strong>ize<br />
daily life <strong>an</strong>d help in affairs of social law.<br />
The conception allows a continual counselling from the first t<strong>im</strong>e patients are informed about<br />
their diagnosis up to the support of family members who have to h<strong>an</strong>dle with grief reactions.<br />
Patients with reduced mobility are offered visits at home.<br />
Additionally self-help-groups are supported, meetings <strong>an</strong>d workshops are org<strong>an</strong>ized to inform<br />
about special topics <strong>an</strong>d volunteers of the <strong>DGM</strong> are trained.<br />
The following consensus statement shows st<strong>an</strong>dards of psychosocial counselling on<br />
Neuromuscular Centres in Bavaria.<br />
Keywords: Neuromuscular disor<strong>der</strong>s, psychosocial counselling, st<strong>an</strong>dards, consensus<br />
statement<br />
2
Im Laufe <strong>der</strong> verg<strong>an</strong>genen Jahre wur<strong>den</strong> von Ver<strong>an</strong>twortlichen <strong>der</strong> neuromuskulären Zentren<br />
in Bayern Konsensuspapiere zu unterschiedlichen Fragestellungen erarbeitet, die darauf ausgerichtet<br />
sind, hinsichtlich des diagnostischen und therapeutischen Vorgehens St<strong>an</strong>dards zu<br />
setzen.<br />
Erstmals liegt nun eine Übersicht über „<strong>Psychosoziale</strong> <strong>Beratung</strong> <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft<br />
für Muskelkr<strong>an</strong>ke <strong>an</strong> neuromuskulären Zentren in Bayern“ (PSB) vor. Dabei h<strong>an</strong>delt es sich<br />
um ein grundlegendes Konsensuspapier. Längerfristig könnte es sinnvoll sein, dies um<br />
Arbeiten zu best<strong>im</strong>mten Themenschwerpunkten zu ergänzen (z.B. PSB <strong>im</strong> Zusammenh<strong>an</strong>g<br />
mit He<strong>im</strong>beatmung, PSB in Familien mit muskelkr<strong>an</strong>ken Kin<strong>der</strong>n, PSB in <strong>der</strong> Begleitung von<br />
Angehörigen).<br />
Dieses Konsensuspapier hat zum Ziel, psychosoziale <strong>Beratung</strong> <strong>an</strong> neuromuskulären Zentren<br />
nach außen tr<strong>an</strong>sparent zu machen, ihre Einbindung in die interdisziplinäre Arbeit zu för<strong>der</strong>n<br />
und stellt gleichzeitig eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Sozialarbeiterinnen <strong>der</strong> <strong>DGM</strong><br />
dar.<br />
1. Einleitung<br />
Die Sozialberatungsstellen <strong>an</strong> <strong>den</strong> neuromuskulären Zentren in Erl<strong>an</strong>gen, München und<br />
Würzburg wur<strong>den</strong> <strong>im</strong> Dezember 1995 eingerichtet. Die fin<strong>an</strong>zielle För<strong>der</strong>ung durch das<br />
bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit<br />
sowie durch die bayerischen Bezirke ermöglichte es, ein direktes und unmittelbares<br />
Hilfe<strong>an</strong>gebot für alle Muskelkr<strong>an</strong>ken und ihre Angehörigen innerhalb und außerhalb <strong>der</strong><br />
Klinikbereiche zu etablieren.<br />
Die psychosoziale <strong>Beratung</strong> (PSB) <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft für Muskelkr<strong>an</strong>ke (<strong>DGM</strong>) -<br />
LV Bayern - ist räumlich <strong>den</strong> neuromuskulären Zentren (NMZ) <strong>an</strong>geglie<strong>der</strong>t. Dadurch<br />
wer<strong>den</strong> für Ratsuchende kurze Wege geschaffen und psychosoziale <strong>Beratung</strong> k<strong>an</strong>n parallel<br />
zur medizinischen Diagnostik eingeleitet wer<strong>den</strong>. PSB findet <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> ambul<strong>an</strong>ten<br />
Vorstellung von Patienten <strong>an</strong> <strong>den</strong> neuromuskulären Zentren, <strong>im</strong> Rahmen von Ver<strong>an</strong>staltungen<br />
<strong>der</strong> <strong>DGM</strong>, aber auch wohnortnah, z.B. in <strong>der</strong> häuslichen Umgebung <strong>der</strong> Betroffenen statt.<br />
2. <strong>Auftrag</strong>, Ziele und Rahmenbedingungen<br />
2.1. Grundsätze<br />
Die psychosoziale <strong>Beratung</strong> <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft für Muskelkr<strong>an</strong>ke e.V. <strong>an</strong><br />
neuromuskulären Zentren orientiert sich <strong>an</strong> <strong>den</strong> Grundsätzen <strong>der</strong> <strong>DGM</strong>. Ziel dieser<br />
Selbsthilfeorg<strong>an</strong>isation ist die För<strong>der</strong>ung einer aktiven Bewältigung von Kr<strong>an</strong>kheit und<br />
Behin<strong>der</strong>ung sowie die Unterstützung <strong>der</strong> Betroffenen bei einer selbstbest<strong>im</strong>mten<br />
Lebensführung.<br />
Die <strong>DGM</strong> för<strong>der</strong>t <strong>den</strong> Informations- und Erfahrungsaustausch unter Gleichbetroffenen,<br />
unterstützt die wechselseitige Hilfeleistung <strong>im</strong> Alltag sowie die Bereitschaft zum Engagement<br />
von Betroffenen für Betroffene, auch <strong>im</strong> Rahmen einer längerfristigen ehrenamtlichen<br />
Mitarbeit. Die <strong>DGM</strong> bietet Informationen zu sozialen und sozialrechtlichen Fragen, för<strong>der</strong>t<br />
die Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit <strong>den</strong> Lebensbedingungen behin<strong>der</strong>ter Menschen und engagiert<br />
sich in sozial- und gesundheitspolitischen Bereichen.<br />
Die Wurzeln des <strong>Beratung</strong>s<strong>an</strong>gebotes <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> liegen in <strong>der</strong> Ehrenamtlichkeit. Steigende<br />
Mitglie<strong>der</strong>zahlen und die zunehmende Komplexität <strong>der</strong> <strong>Beratung</strong>sinhalte zeigten jedoch die<br />
Notwendigkeit von professioneller Unterstützung auf. Das Leben mit einer chronisch<br />
fortschreiten<strong>den</strong> Kr<strong>an</strong>kheit bzw. Behin<strong>der</strong>ung erfor<strong>der</strong>t Kontinuität bzgl. <strong>Beratung</strong> und<br />
Begleitung und Verlässlichkeit hinsichtlich <strong>der</strong> <strong>Beratung</strong>squalität.<br />
3
Seit 1983 ergänzt das Angebot von psychosozialer <strong>Beratung</strong> durch Fachkräfte das Engagement<br />
<strong>der</strong> ehrenamtlich tätigen Kontaktpersonen. Eine ausschließlich hauptamtliche <strong>Beratung</strong><br />
aller Mitglie<strong>der</strong> ist innerhalb einer Selbsthilfeorg<strong>an</strong>isation jedoch we<strong>der</strong> wünschenswert noch<br />
fin<strong>an</strong>zierbar. Vor diesem Hintergrund wird auch die Arbeit <strong>der</strong> psychosozialen <strong>Beratung</strong> vom<br />
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ geleitet. Das heißt unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em, dass best<strong>im</strong>mte Aufgaben<br />
von Ehrenamtlichen unter Anleitung von Hauptamtlichen übernommen wer<strong>den</strong>.<br />
2.2. Zielgruppe<br />
Die psychosoziale <strong>Beratung</strong> <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> in Bayern steht Menschen mit neuromuskulären<br />
Erkr<strong>an</strong>kungen und <strong>der</strong>en Angehörigen zur Verfügung, soweit sie <strong>im</strong> Einzugsgebiet <strong>der</strong><br />
neuromuskulären Zentren leben o<strong>der</strong> <strong>an</strong> diesen medizinisch betreut wer<strong>den</strong>. Sie ist<br />
unabhängig vom Alter <strong>der</strong> erkr<strong>an</strong>kten Person und von einer Mitgliedschaft in <strong>der</strong> Deutschen<br />
Gesellschaft für Muskelkr<strong>an</strong>ke.<br />
Darüber hinaus begleiten Sozialarbeiterinnen die in <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> ehrenamtlich Tätigen und<br />
stehen Ärzten, Therapeuten, Mitarbeitern <strong>an</strong><strong>der</strong>er Fachdienste sowie weiteren Interessierten<br />
als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.<br />
2.3. Ziele <strong>der</strong> psychosozialen <strong>Beratung</strong><br />
Neuromuskuläre Erkr<strong>an</strong>kungen führen zu körperlicher Behin<strong>der</strong>ung und sind häufig mit <strong>der</strong><br />
Abhängigkeit von technischer o<strong>der</strong> personeller Hilfe verbun<strong>den</strong>. Auch innerhalb dieses<br />
Rahmens ist jedoch eine selbstbest<strong>im</strong>mte Lebensführung und die Integration in die soziale<br />
Gemeinschaft möglich. Die Grundlagen selbstbest<strong>im</strong>mter Lebensführung auf Seiten <strong>der</strong><br />
Betroffenen und ihrer Angehörigen sind<br />
• eine weitgehende emotionale Stabilität<br />
• die Übernahme von Ver<strong>an</strong>twortung für die eigenen Bel<strong>an</strong>ge<br />
• die realistische Einschätzung <strong>der</strong> eigenen Perspektiven und Möglichkeiten<br />
• die Fähigkeit, das Zusammenleben mit Angehörigen, Freun<strong>den</strong> und professionellen<br />
Helfern zu regeln<br />
• die Fähigkeit, Ressourcen zu entdecken und zu nutzen<br />
• die Fähigkeit und Bereitschaft, in krisenhaften Situationen Unterstützung zu suchen und in<br />
Anspruch zu nehmen.<br />
Ziel <strong>der</strong> psychosozialen <strong>Beratung</strong> ist es, Ratsuchende auf dem Weg (zu) einer<br />
selbstbest<strong>im</strong>mten Lebensführung zu begleiten. Hierfür bedient sie sich unterschiedlicher<br />
Instrumente, z.B. <strong>der</strong> <strong>Beratung</strong> und Begleitung, <strong>der</strong> Begleitung von Selbsthilfegruppen, <strong>der</strong><br />
Org<strong>an</strong>isation und Durchführung von Informations- und Begegnungsver<strong>an</strong>staltungen, <strong>der</strong><br />
Anleitung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitern usw. (siehe 3.).<br />
2.4. Überweisungskontext<br />
Neuromuskuläre Erkr<strong>an</strong>kungen beeinträchtigen Patienten zunächst körperlich. Darüber hinaus<br />
sind l<strong>an</strong>gfristig nahezu alle Lebensbereiche <strong>der</strong> Erkr<strong>an</strong>kten und ihrer Angehörigen vom<br />
Kr<strong>an</strong>kheitsgeschehen betroffen. Deshalb muss psychosoziale <strong>Beratung</strong> und Begleitung neben<br />
medizinischer Diagnostik und Therapie zum St<strong>an</strong>dard eines neuromuskulären Zentrums<br />
gehören.<br />
4
Die psychosoziale <strong>Beratung</strong> <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> <strong>an</strong> neuromuskulären Zentren steht grundsätzlich allen<br />
Patienten mit neuromuskulären Erkr<strong>an</strong>kungen und ihren Angehörigen <strong>im</strong> Einzugsgebiet des<br />
jeweiligen NMZ zur Verfügung.<br />
Der Kontakt zwischen Ratsuchen<strong>den</strong> und <strong>Psychosoziale</strong>r <strong>Beratung</strong> kommt z.B.<br />
• durch Vermittlung von Ärzten und <strong>an</strong><strong>der</strong>en Berufsgruppen am neuromuskulären Zentrum<br />
• durch Vermittlung von nie<strong>der</strong>gelassenen Ärzten (Hausärzte, Neurologen) und Therapeuten<br />
(z.B. Ergotherapeuten, Physiotherapeuten)<br />
• über <strong>den</strong> Kontakt mit <strong>der</strong> Geschäftsstelle <strong>der</strong> <strong>DGM</strong><br />
• durch die Vermittlung von ehrenamtlichen Mitarbeitern <strong>der</strong> <strong>DGM</strong><br />
• durch die Vermittlung von sozialen Diensten<br />
• über Medieninformationen und Beipackzettel von Medikamenten<br />
zust<strong>an</strong>de.<br />
Generell sollten alle neuromuskulär Erkr<strong>an</strong>kten (unabhängig von <strong>der</strong> Schwere des<br />
Kr<strong>an</strong>kheitsbildes und <strong>der</strong> jeweiligen klinischen Symptomatik) vom beh<strong>an</strong>deln<strong>den</strong> Arzt auf<br />
das Angebot aufmerksam gemacht wer<strong>den</strong>. Nach <strong>der</strong> erstmaligen Diagnosestellung einer<br />
neuromuskulären Erkr<strong>an</strong>kung ist das Angebot einer psychosozialen <strong>Beratung</strong> jedoch<br />
grundsätzlich notwendig.<br />
Unmittelbar nach <strong>der</strong> Diagnosestellung fällt es Patienten oft schwer, Kontakt zu einer<br />
unbek<strong>an</strong>nten <strong>Beratung</strong>sstelle aufzunehmen. Die Konfrontation mit dem Thema<br />
„Behin<strong>der</strong>ung“ (z.B. Be<strong>an</strong>tragung eines „Schwerbehin<strong>der</strong>tenausweises“) und <strong>der</strong> Hinweis auf<br />
eine Selbsthilfeorg<strong>an</strong>isation (einen Verein, <strong>der</strong> möglicherweise Mitglie<strong>der</strong> werben möchte)<br />
lösen nicht selten Abwehr aus. Deshalb ist die Art und Weise <strong>der</strong> Vorinformation durch <strong>den</strong><br />
Arzt über die PSB von großer Bedeutung. Hier soll es vor allem darum gehen,<br />
Schwellenängste zu nehmen und ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen.<br />
Ein Erstgespräch <strong>der</strong> PSB beinhaltet<br />
• das Erheben einer psychosozialen Anamnese<br />
• die Vorstellung des <strong>Beratung</strong>s<strong>an</strong>gebotes - bei Bedarf erste <strong>Beratung</strong> zu ausgewählten<br />
Fragestellungen sowie<br />
• die Vorstellung <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> als Selbsthilfeorg<strong>an</strong>isation und ihrer Angebote bzw. das<br />
Angebot einer Kontaktvermittlung zu Gleichbetroffenen.<br />
Zur Vermittlung des Kontaktes wird folgendes Vorgehen für sinnvoll erachtet:<br />
1. Der Arzt teilt dem Patienten mit, dass er eine Vorstellung bei <strong>der</strong> PSB für sinnvoll hält<br />
und empfiehlt ihm, Kontakt aufzunehmen.<br />
2. Der Arzt informiert die Sozialarbeiterin nach Rücksprache mit dem Patienten.<br />
Wie<strong>der</strong>holungskontakte kommen auf Wunsch <strong>der</strong> Ratsuchen<strong>den</strong> zust<strong>an</strong>de (Anfrage in<br />
Problemsituationen) o<strong>der</strong> sind durch Initiative <strong>der</strong> PSB möglich (siehe „Begleitung“).<br />
Grundsätzlich ist psychosoziale <strong>Beratung</strong> als lebensbegleitende <strong>Beratung</strong> konzipiert. Sie k<strong>an</strong>n<br />
vom Erstkontakt mit Patienten und/o<strong>der</strong> Angehörigen bis hin zur Trauerbegleitung<br />
Hinterbliebener reichen.<br />
Beson<strong>der</strong>e Bedeutung kommt <strong>der</strong> Mitteilung <strong>der</strong> Diagnose <strong>an</strong> <strong>den</strong> Patienten zu.<br />
Nach Möglichkeit sollte <strong>im</strong> Verlauf des Aufklärungsprozesses ein Gespräch stattfin<strong>den</strong>, das<br />
Arzt und Sozialarbeiterin gemeinsam mit dem Patienten und seinen Angehörigen führen.<br />
Inhalt des gemeinsamen Gespräches sollten<br />
5
- die Benennung <strong>der</strong> Diagnose<br />
- die Erklärung des Kr<strong>an</strong>kheitsgeschehens und seiner Auswirkungen<br />
- das Benennen von Unterstützungssystemen (medizinische, therapeutische Angebote,<br />
psychosoziale <strong>Beratung</strong>, Kontakte zu Gleichbetroffenen, Folgegespräche)<br />
sein. Ein telefonischer/persönlicher Wie<strong>der</strong>holungskontakt des Patienten / Angehörigen mit<br />
<strong>der</strong> Sozialarbeiterin sollte individuell vereinbart wer<strong>den</strong>.<br />
Vorteile eines gemeinsamen Gesprächs von Arzt und Sozialarbeiterin mit Patienten/<br />
Angehörigen:<br />
• Patienten und Angehörige erleben PSB als selbstverständliche Ergänzung <strong>der</strong><br />
medizinischen <strong>Beratung</strong>. Die Schwelle für Wie<strong>der</strong>holungskontakte wird deutlich<br />
gesenkt.<br />
• Die Sozialarbeiterin weiß darüber Bescheid, welche Informationen dem<br />
Patienten/Angehörigen mitgeteilt wur<strong>den</strong>. Sie k<strong>an</strong>n dazu beitragen, das Verständnis<br />
dieser Information zu sichern (gegebenenfalls Fragen stellvertretend für Patienten und<br />
Angehörige stellen) und <strong>den</strong> Patienten/Angehörigen bei <strong>der</strong> Informationsverarbeitung<br />
bzw. bei <strong>der</strong> Org<strong>an</strong>isation weiterer Hilfen unterstützen.<br />
• Die Kooperation zweier Berater unterschiedlicher Disziplinen schafft eine erweiterte<br />
Wahrnehmung für Fragen, Anliegen und Interaktionen von Patienten und<br />
Angehörigen.<br />
• Das gemeinsame Gespräch mit dem Patienten stellt eine wichtige Grundlage für einen<br />
Dialog zwischen Arzt und Sozialarbeiterin dar. Dieser ermöglicht die gemeinsame<br />
Reflexion, eine gegenseitige Entlastung und die Erarbeitung eines Hilfepl<strong>an</strong>s für die<br />
Ratsuchen<strong>den</strong>.<br />
2.5. Rahmenbedingungen<br />
Die wesentlichen Rahmenbedingungen für die psychosoziale <strong>Beratung</strong> <strong>an</strong> neuromuskulären<br />
Zentren in Bayern sind in <strong>den</strong> Stellenbeschreibungen für die Sozialberatung, in Verträgen<br />
zwischen <strong>den</strong> neuromuskulären Zentren und <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> - L<strong>an</strong>desverb<strong>an</strong>d Bayern e.V. - und in<br />
<strong>der</strong> Geschäftsordnung <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> - LV Bayern e.V. - geregelt.<br />
Im übrigen sind sie durch die strukturellen Bedingungen <strong>der</strong> einzelnen NMZ und die<br />
Unterschiedlichkeit <strong>der</strong> Einzugsgebiete geprägt.<br />
Die örtliche Zuständigkeit <strong>der</strong> drei bayerischen Sozialberatungsstellen verteilt sich wie folgt:<br />
PSB am Neuromuskulären Zentrum München: Regierungsbezirke Oberbayern, Nie<strong>der</strong>bayern<br />
und Schwaben<br />
PSB am Neuromuskulären Zentrum Erl<strong>an</strong>gen: Regierungsbezirke Mittelfr<strong>an</strong>ken und<br />
Oberpfalz<br />
PSB am Neuromuskulären Zentrum Würzburg: Regierungsbezirke Unterfr<strong>an</strong>ken und Ober-<br />
Fr<strong>an</strong>ken.<br />
Die Mitarbeiterinnen <strong>der</strong> PSB sind eigenver<strong>an</strong>twortlich und unabhängig für ihr Fachgebiet<br />
tätig. In <strong>der</strong> Erfüllung ihrer Aufgaben kooperieren sie eng mit <strong>an</strong><strong>der</strong>en Berufsgruppen (z.B.<br />
Ärzten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten etc.) innerhalb und außerhalb <strong>der</strong> NMZ. Die<br />
regelmäßig wie<strong>der</strong>kehren<strong>den</strong> Abläufe hinsichtlich <strong>der</strong> interdisziplinären Betreuung von<br />
Patienten <strong>an</strong> NMZ sind in verbindlichen Strukturen (dazu gehören z.B. Teambesprechungen)<br />
geregelt. Darüber hinaus sind die Mitarbeiterinnen <strong>der</strong> PSB in die Arbeit des<br />
L<strong>an</strong>desverb<strong>an</strong>des <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> (dieser ist Anstellungsträger) und des Bundesverb<strong>an</strong>des (hier liegt<br />
u.a. die Fachaufsicht) eingebun<strong>den</strong>.<br />
6
In Erfüllung ihrer Aufgaben bauen die Mitarbeiterinnen <strong>der</strong> PSB ein Multiplikatorennetz auf.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e arbeiten sie mit sozialen Diensten (Sozialdiensten von Kliniken und<br />
Einrichtungen, <strong>Beratung</strong>sstellen, ambul<strong>an</strong>ten Diensten, Wohlfahrtsverbän<strong>den</strong>, <strong>an</strong><strong>der</strong>en<br />
Selbsthilfeorg<strong>an</strong>isationen), Ärzten und Therapeuten, Behör<strong>den</strong> und Kostenträgern (z.B.<br />
Kr<strong>an</strong>kenkassen, Pflegekassen, Hauptfürsorgestellen, Sozialhilfeträgern, Versorgungsämtern )<br />
zusammen.<br />
3. Arbeitsformen <strong>der</strong> <strong>Psychosoziale</strong>n <strong>Beratung</strong><br />
3.1. Prinzipien <strong>der</strong> <strong>Psychosoziale</strong>n <strong>Beratung</strong><br />
<strong>Psychosoziale</strong> <strong>Beratung</strong> will eine Basis schaffen, auf <strong>der</strong> Ratsuchende selbst entschei<strong>den</strong> und<br />
tätig wer<strong>den</strong> können. Stellvertretendes H<strong>an</strong>deln durch die Sozialarbeiterin ist nur dort <strong>an</strong>ge<br />
bracht, wo Eigeninitiative nicht möglich ist, d.h. die Arbeit <strong>der</strong> PSB ist vom Grundsatz her<br />
aktivierend, nicht versorgend. Sie ermutigt Ratsuchende und mutet es ihnen zu, eigene Bel<strong>an</strong><br />
ge soweit als möglich selbst zu regeln.<br />
<strong>Beratung</strong> setzt ein<br />
• wenn <strong>der</strong> Ratsuchende eine Frage, ein Problem o<strong>der</strong> Anliegen formuliert,<br />
• wenn <strong>im</strong> Kontakt mit ihm eine akute o<strong>der</strong> drohende Krisensituation offenkundig wird<br />
• wenn professionelle Helfer Grund zur Annahme haben, dass spezielle Sachinformationen<br />
die Voraussetzung dafür bil<strong>den</strong>, dass Ratsuchende ihre Bel<strong>an</strong>ge wahrnehmen können.<br />
<strong>Beratung</strong> findet telefonisch, schriftlich o<strong>der</strong> persönlich - <strong>im</strong> Bereich des jeweiligen neuro<br />
muskulären Zentrums, <strong>im</strong> Rahmen von Hausbesuchen, <strong>im</strong> Rahmen von Ver<strong>an</strong>staltungen <strong>der</strong><br />
Deutschen Gesellschaft für Muskelkr<strong>an</strong>ke o<strong>der</strong> während Selbsthilfegruppentreffen statt.<br />
In Folge von <strong>Beratung</strong>skontakten o<strong>der</strong> unabhängig von diesen ist Begleitung von Patienten<br />
und/o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Angehörigen durch die Sozialarbeiterin möglich. Grundlage dieser Begleitung<br />
ist in erster Linie eine längerfristig <strong>an</strong>gelegte persönliche Beziehung zwischen Ratsuchen<strong>den</strong><br />
und <strong>der</strong> Mitarbeiterin <strong>der</strong> PSB. In <strong>der</strong> Begleitung geht es unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em darum, psychische<br />
Entlastung <strong>der</strong> Ratsuchen<strong>den</strong> zu ermöglichen, sie zu ermutigen bzw. zu motivieren, ihre Inte-<br />
ressen zu vertreten, positive Erfahrungen zu ermöglichen und die In<strong>an</strong>spruchnahme von Bera-<br />
tung zu erleichtern.<br />
3.3. Themen <strong>der</strong> <strong>Beratung</strong><br />
<strong>Beratung</strong>s- und Begleitgespräche <strong>der</strong> PSB beziehen die physische und psychische Befindlich-<br />
keit <strong>der</strong> Ratsuchen<strong>den</strong>, soziale/interaktionelle Zusammenhänge <strong>der</strong> betroffenen Familien so-<br />
wie rechtlich-org<strong>an</strong>isatorische Fragestellungen ein. Sie orientieren sich in ihrem Verlauf <strong>an</strong><br />
Fragen <strong>der</strong> Ratsuchen<strong>den</strong> und <strong>der</strong>en aktueller Lebenssituation. Sachliche Fragestellungen<br />
wer<strong>den</strong> häufig zum Anlass für die Kontaktaufnahme mit <strong>der</strong> PSB genommen, <strong>im</strong> Verlauf <strong>der</strong><br />
<strong>Beratung</strong>/ Begleitung gewinnen meist persönliche Themen <strong>an</strong> Bedeutung.<br />
Kaum ein Thema k<strong>an</strong>n <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> PSB endgültig bearbeitet und vollständig abgeschlos<br />
sen wer<strong>den</strong>. In <strong>der</strong> Regel ist ein Wie<strong>der</strong>aufgreifen von Themen <strong>im</strong> Kr<strong>an</strong>kheitsverlauf<br />
erfor<strong>der</strong>lich, da aufgrund <strong>der</strong> Progredienz <strong>der</strong> Erkr<strong>an</strong>kungen fortlaufend<br />
Anpassungsleistungen notwendig wer<strong>den</strong>.<br />
Die nachfolgende Übersicht stellt einen Versuch dar, das Themenspektrum zu erfassen, in<br />
dem PSB tätig wird. Dies schließt die Kooperation mit <strong>an</strong><strong>der</strong>en Fachdiensten bzw. bei Bedarf<br />
die Vermittlung <strong>der</strong> Ratsuchen<strong>den</strong> zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Institutionen ein.<br />
7
(1) Verarbeiten von Diagnose und Kr<strong>an</strong>kheitsgeschehen<br />
(2) Auswirkung <strong>der</strong> Erkr<strong>an</strong>kung und ihrer Folgen (z.B. Pflegebedürftigkeit) auf das soziale<br />
Umfeld<br />
(3) Neuorientierung <strong>im</strong> persönlichen und sozialen Bereich<br />
(4) Sexualität und Kin<strong>der</strong>wunsch<br />
(5) Einglie<strong>der</strong>ung in Kin<strong>der</strong>garten, Schule und Beruf<br />
.<br />
(6) Org<strong>an</strong>isation des Wohnens<br />
(7) ökonomische Situation<br />
(8) Mobilität<br />
(9) Urlaub und Freizeit<br />
(10) Pflege und Assistenz<br />
(11) Entlastungs<strong>an</strong>gebote für pflegende Angehörige<br />
(12) sozialrechtliche Fragen<br />
(13) Rehabilitation<br />
(14) Hilfsmittel<br />
(15) Hinweis auf Stellen, die Information o<strong>der</strong> Unterstützung bieten - Hilfe be<strong>im</strong> Aufbau<br />
eines Betreuungsnetzes<br />
(16) Herstellen von Kontakt zu Gleichbetroffenen<br />
3.4. Informations- und Begegnungsver<strong>an</strong>staltungen<br />
Informations- und Begegnungsver<strong>an</strong>staltungen beinhalten die Möglichkeit, innerhalb eines<br />
kurzen Zeitraums Informationen <strong>an</strong> einen größeren Personenkreis weiterzugeben, ein<br />
niedrigschwelliges <strong>Beratung</strong>s<strong>an</strong>gebot zu schaffen und Kontakte zwischen gleichartig o<strong>der</strong><br />
ähnlich Betroffenen herzustellen. Die Begegnung mit Gleichbetroffenen ermöglicht unter<br />
Umstän<strong>den</strong> eine erste Solidarisierung, schafft Zug<strong>an</strong>g zu einem großen Wissens- und Erfah<br />
rungspool und ist damit ein erster Schritt hin zur Selbsthilfe.<br />
Das Angebot von Informations- und Begegnungsver<strong>an</strong>staltungen orientiert sich am Bedarf,<br />
<strong>der</strong> sich <strong>im</strong> Rahmen von <strong>Beratung</strong>sgesprächen zeigt, <strong>der</strong> bei Selbsthilfegruppentreffen laut<br />
wird o<strong>der</strong> aufgrund von regionalen Entwicklungen sinnvoll erscheint. Informations- und Be-<br />
gegnungsver<strong>an</strong>staltungen können zielgruppenorientiert (z.B. ALS-Gesprächskreise) o<strong>der</strong> the-<br />
menzentriert ausgerichtet sein (z.B. Ver<strong>an</strong>staltung zum Thema "Pflege und Assistenz <strong>im</strong><br />
häuslichen Bereich").<br />
8
Mitarbeiterinnen <strong>der</strong> PSB übernehmen Pl<strong>an</strong>ung, Org<strong>an</strong>isation und Mo<strong>der</strong>ation von Ver<strong>an</strong>staltungen,<br />
gestalten inhaltliche Angebote (z.B. in Form von Vorträgen o<strong>der</strong> durch die Leitung<br />
von Gesprächskreisen) und bieten Einzelgespräche am R<strong>an</strong>de von Patiententreffen <strong>an</strong>.<br />
Die Sozialberaterinnen orientieren sich generell <strong>an</strong> <strong>der</strong> Nachfrage durch Patienten und Ange-<br />
hörige, gestalten Angebote aber auch auf <strong>der</strong> Grundlage ihrer unterschiedlichen beruflichen<br />
Qualifikationen. Sie arbeiten dabei mit Kolleginnen und Kollegen innerhalb <strong>der</strong> <strong>DGM</strong>,<br />
mit<br />
Mitarbeitern <strong>der</strong> neuromuskulären Zentren, mit Ehrenamtlichen aus Bundes und L<strong>an</strong>desverb<strong>an</strong>d<br />
<strong>der</strong> <strong>DGM</strong> sowie <strong>an</strong><strong>der</strong>en Institutionen zusammen.<br />
3.5.<br />
Initiierung von und/o<strong>der</strong> Begleitung von Selbsthilfegruppen<br />
<strong>Psychosoziale</strong> <strong>Beratung</strong> in einer Selbsthilfeorg<strong>an</strong>isation sieht Ratsuchende<br />
nicht allein als<br />
hilfebedürftige Personen. Menschen mit neuromuskulären Erkr<strong>an</strong>kungen und ihre Angehöri<br />
gen benötigen zwar regelmäßig o<strong>der</strong> gelegentlich Unterstützung durch <strong>an</strong><strong>der</strong>e, bleiben<br />
jedoch<br />
kompetent dafür, eigene Bel<strong>an</strong>ge zu regeln und ihr Leben zu gestalten. Im Laufe ihres Lebens<br />
mit einer chronisch fortschreiten<strong>den</strong> neuromuskulären Erkr<strong>an</strong>kung sammeln viele Betroffene<br />
ein reichhaltiges Erfahrungswissen, das für <strong>an</strong><strong>der</strong>e in einer ähnlichen Lage - ebenso wie für<br />
Mitarbeiterinnen <strong>der</strong> PSB - von unschätzbarem Wert ist. In diesem Sinn ist es Ziel <strong>der</strong> PSB<br />
<strong>den</strong> Kontakt zwischen gleichartig o<strong>der</strong> ähnlich Betroffenen herzustellen.<br />
Auf Wunsch <strong>der</strong> Ratsuchen<strong>den</strong> können individuelle Kontakte zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Patienten/Familien<br />
hergestellt wer<strong>den</strong>.<br />
D<strong>an</strong>eben wer<strong>den</strong> alle Ratsuchen<strong>den</strong> auf die Möglichkeit hingewiesen, <strong>an</strong><br />
Selbsthilfegruppentreffen teilzunehmen o<strong>der</strong> - falls es ein entsprechendes Angebot in Wohnortnähe<br />
o<strong>der</strong> Ratsuchen<strong>den</strong> nicht gibt - selbst am Aufbau einer Gruppe mitzuwirken.<br />
Der Charakter von Selbsthilfegruppen variiert in Abhängigkeit von <strong>der</strong> Zusammensetzung<br />
des<br />
Teilnehmerkreises und <strong>den</strong> Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Gruppentreffen. Dementsprechend fin<strong>den</strong><br />
sie unter <strong>den</strong> Begriffen „Selbsthilfegruppe für Muskelkr<strong>an</strong>ke“, Gesprächskreis, „Muskelstammtisch“<br />
o<strong>der</strong> „Kontaktgruppe“ statt. Themen, Aufgaben und Ziele wer<strong>den</strong> ebenso wie<br />
Arbeitsformen dem Gruppenprozess <strong>an</strong>gepasst.<br />
Die <strong>DGM</strong>-Sozialarbeiterinnen arbeiten eng mit <strong>den</strong> Selbsthilfegruppen<br />
für Muskelkr<strong>an</strong>ke<br />
zusammen.<br />
Nach ihrer Erfahrung suchen Teilnehmer von SHG seltener als <strong>an</strong><strong>der</strong>e die PSB<br />
auf, gegebenenfalls mit klarer definierten Fragen. Sie nutzen in erster Linie <strong>den</strong> Wissenspool<br />
<strong>der</strong> Gruppe o<strong>der</strong> suchen das Gespräch mit <strong>der</strong> PSB <strong>im</strong> unverbindlichen Rahmen eines<br />
Gruppentreffens. An<strong>der</strong>erseits sind sie auch diejenigen, die am ehesten bereit sind,<br />
Gleichbetroffene zu unterstützen und sich innerhalb <strong>der</strong> Selbsthilfeorg<strong>an</strong>isation ehrenamtlich<br />
zu engagieren.<br />
3.6. Anleitung und<br />
Begleitung Ehrenamtlicher<br />
Der<br />
größte Teil aller Ehrenamtlichen, die sich für die <strong>DGM</strong> engagieren, sind direkt o<strong>der</strong> indi-<br />
rekt<br />
(als Angehörige) von einer neuromuskulären Erkr<strong>an</strong>kung betroffen. Positive Erfahrungen<br />
mit PSB und/o<strong>der</strong> Selbsthilfegruppen führen häufig zur Solidarisierung mit<br />
<strong>der</strong> Selbsthilfeor-<br />
g<strong>an</strong>isation und zur Mitgliedschaft in <strong>der</strong> <strong>DGM</strong>. Gleichzeitig wer<strong>den</strong> durch eigene Erfahrun<br />
gen und <strong>im</strong> Kontakt zu Gleichbetroffenen spezielle Kompetenzen erworben. Es kommt<br />
zur<br />
Rollenverschiebung ( Ratsuchende wer<strong>den</strong> nach und nach zu Beraten<strong>den</strong>) und damit zur Übernahme<br />
von Aufgaben und Funktionen.<br />
Anleitung und Begleitung von Ehrenamtlichen durch die PSB beinhaltet:<br />
• Motivation zur Übernahme von Aufgaben<br />
• Unterstützung bei <strong>der</strong> Entscheidung für o<strong>der</strong> gegen ehrenamtliches Engagement<br />
• Bereitstellen von Informationen zu unterschiedlichen Fragestellungen<br />
9
• Informationstr<strong>an</strong>sfer zu vereinsspezifischen Fragen<br />
• Unterstützung bei <strong>der</strong> Reflexion <strong>der</strong> ehrenamtlichen Arbeit<br />
• Fortbildung <strong>der</strong> ehrenamtlichen Mitarbeiter<br />
• praktische Unterstützung bei <strong>der</strong> Übernahme von Aufgaben (z.B. am Informationsst<strong>an</strong>d,<br />
bei <strong>der</strong> Org<strong>an</strong>isation von Ver<strong>an</strong>staltungen, be<strong>im</strong><br />
Erstellen von Materialien)<br />
3.7.<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Eine<br />
wichtige Aufgabe <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft für Muskelkr<strong>an</strong>ke e.V. besteht darin, die<br />
Öffentlichkeit über Muskelkr<strong>an</strong>kheiten<br />
zu informieren, auf die Beson<strong>der</strong>heiten <strong>im</strong> Leben von<br />
Familien mit einem neuromuskulär Erkr<strong>an</strong>kten aufmerksam zu machen, und sich für die Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Lebenssituationen von Betroffenen einzusetzen.<br />
Weitere Aufgaben <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> bestehen in <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> Forschung (Erforschung von<br />
Kr<strong>an</strong>kheitsursachen und Beh<strong>an</strong>dlungsmöglichkeiten) sowie in <strong>der</strong> psychosozialen<br />
<strong>Beratung</strong><br />
<strong>der</strong> Betroffenen. Gerade die bei<strong>den</strong> letztgen<strong>an</strong>nten Aufgaben sind ohne fin<strong>an</strong>zielle Mittel<br />
nicht zu erfüllen. Diese müssen größtenteils als Spen<strong>den</strong> eingeworben wer<strong>den</strong> (Auch ca. 10%<br />
<strong>der</strong> Personalkosten für Mitarbeiter/innen <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> <strong>an</strong> NMZ wer<strong>den</strong> aus Eigenmitteln des<br />
Vereins, d.h. aus Spen<strong>den</strong> fin<strong>an</strong>ziert.). Somit gehören auch Öffentlichkeitsarbeit und Spen<strong>den</strong>werbung<br />
zum gemeinsamen Aufgabenbereich von <strong>Psychosoziale</strong>r <strong>Beratung</strong> und Ehren-<br />
amtlichen.<br />
Die Aktivitäten <strong>der</strong><br />
PSB <strong>im</strong> Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind eng in die Arbeit <strong>der</strong> <strong>DGM</strong>, <strong>der</strong><br />
regionalen<br />
Selbsthilfegruppen, sowie <strong>der</strong> neuromuskulären Zentren eingebun<strong>den</strong>. Ohne eine<br />
Beteiligung von Selbstbetroffenen ist eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit <strong>der</strong> PSB nicht möglich.<br />
3.8.<br />
Fortbildungen für Fachkräfte <strong>an</strong><strong>der</strong>er Institutionen<br />
Wie<br />
schon eing<strong>an</strong>gs erwähnt, ist es für die <strong>DGM</strong> als Selbsthilfeorg<strong>an</strong>isation nicht möglich,<br />
Patienten mit neuromuskulären Erkr<strong>an</strong>kungen und ihre Angehörigen<br />
in allen Lebensbereichen<br />
umfassend professionell zu beraten und begleiten. Sie ist deshalb auf eine gute Zusammenar-<br />
beit mit Mitarbeitern <strong>an</strong><strong>der</strong>er Fachdienste <strong>an</strong>gewiesen. Erklärtes Ziel <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> ist, die Kollegen<br />
<strong>der</strong> betreffen<strong>den</strong> Institutionen und Multiplikatoren über Muskelkr<strong>an</strong>kheiten zu informieren<br />
und das spezifische Erfahrungswissen über ein Leben mit neuromuskulären Erkr<strong>an</strong>kungen<br />
weiterzugeben.<br />
4.<br />
Grenzen <strong>der</strong> <strong>Psychosoziale</strong>n <strong>Beratung</strong><br />
• <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Beratung</strong> k<strong>an</strong>n keine Therapie (Psychotherapie, Paar- o<strong>der</strong> Familientherapie)<br />
ersetzen.<br />
• Mitarbeiterinnen <strong>der</strong> PSB ersetzen keine Bezugspersonen.<br />
• Vielfach stoßen Ratsuchende und Beraterin gemeinsam <strong>an</strong> die Grenzen <strong>der</strong> rechtlichen,<br />
sozialen und politischen Bedingungen.<br />
• Mitarbeiterinnen <strong>der</strong> PSB wer<strong>den</strong> auf Anfrage und <strong>im</strong> <strong>Auftrag</strong> <strong>der</strong> Ratsuchen<strong>den</strong> tätig.<br />
Dabei wer<strong>den</strong> sie nicht in jedem Fall <strong>den</strong><br />
Erwartungen <strong>der</strong> Überweisen<strong>den</strong> gerecht. Ebensowenig<br />
können sie allen Wünschen und Hoffnungen von Ratsuchen<strong>den</strong> (z.B. nach stell-<br />
vertretendem H<strong>an</strong>deln) entsprechen.<br />
• Weitere Grenzen für die <strong>Beratung</strong>s- und H<strong>an</strong>dlungsmöglichkeiten <strong>der</strong> PSB fin<strong>den</strong> sich in<br />
<strong>den</strong> institutionellen Bedingungen <strong>der</strong> <strong>DGM</strong> sowie <strong>der</strong> neuromuskulären Zentren. Diese haben<br />
z.B. Einfluss auf <strong>den</strong> Zeitpunkt des Erstkontaktes zwischen Ratsuchen<strong>den</strong> und Mitar-<br />
10
•<br />
beiterinnen <strong>der</strong> PSB, auf das <strong>Beratung</strong>ssetting und ähnliches mehr.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e jedoch wer<strong>den</strong> <strong>der</strong> PSB durch die personellen Kapazitäten Grenzen gesetzt.<br />
Alle Mitarbeiterinnen <strong>der</strong> PSB haben eine vergleichbare Grundqualifikation (Berufsabschluss<br />
als Dipl. Sozialpädagoge (FH)), sie unterschei<strong>den</strong> sich jedoch<br />
hinsichtlich ihrer<br />
persönlichen und beruflichen Entwicklung. Entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen<br />
haben alle Kolleginnen weitere Qualifikationen erworben und setzen diese in ihren Tätigkeitsfel<strong>der</strong>n<br />
ein. Diese individuelle Spezialisierung k<strong>an</strong>n unterschiedliche Her<strong>an</strong>gehensweisen<br />
<strong>an</strong> best<strong>im</strong>mte Aufgabenstellungen bedingen bzw. die Wahl von unterschiedli-<br />
chen inhaltlichen Schwerpunkten <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Tätigkeit zur Folge haben.<br />
Eine<br />
kurze Anmerkung zum Schluss:<br />
Im Interesse <strong>der</strong> Leserinnen und Leser wurde <strong>im</strong> Text darauf verzichtet, jeweils die männliche<br />
und<br />
weibliche Bezeichnung einer Personengruppe <strong>an</strong>zuführen. Die Begriffe „Patienten“,<br />
„Therapeuten“ und <strong>an</strong><strong>der</strong>e <strong>im</strong> Text erwähnte<br />
Bezeichnungen schließen selbstverständlich die<br />
weiblichen Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> entsprechen<strong>den</strong> Personenkreise ein.<br />
Da die wenigen Stellen <strong>der</strong> <strong>Psychosoziale</strong>n <strong>Beratung</strong> <strong>an</strong> <strong>den</strong> Neuromuskulären Zentren in<br />
Bayern jedoch ausschließlich von Frauen besetzt sind, haben die Verfasserinnen sich erlaubt,<br />
hier auch die weiblichen Formen <strong>der</strong> Begriffe zu verwen<strong>den</strong>.<br />
11