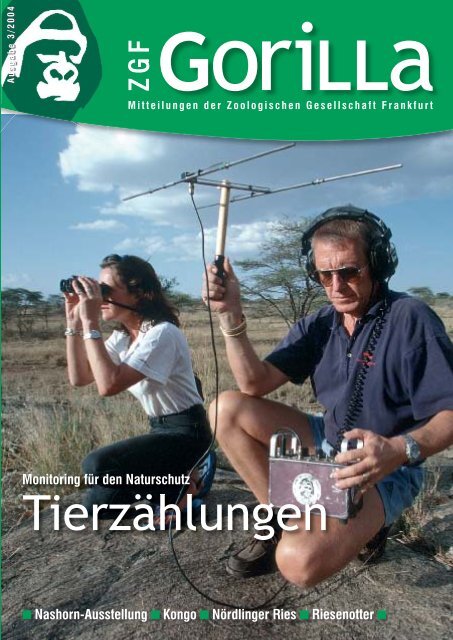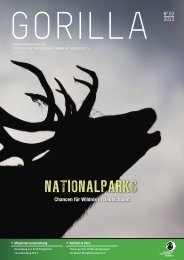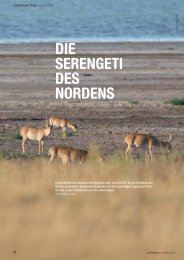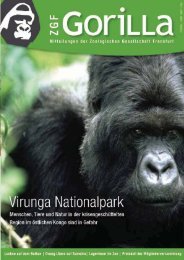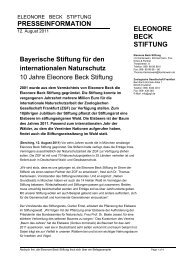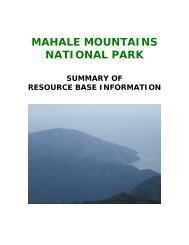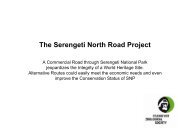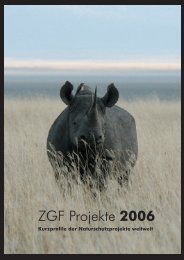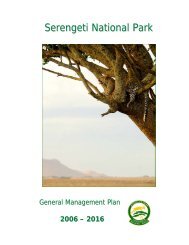ZGF Gorilla 3/2004 - Frankfurt Zoological Society
ZGF Gorilla 3/2004 - Frankfurt Zoological Society
ZGF Gorilla 3/2004 - Frankfurt Zoological Society
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ausgabe 3/<strong>2004</strong><br />
Z<strong>ZGF</strong> G F<br />
GoriLLa Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong><br />
Monitoring für den Naturschutz<br />
Tierzählungen<br />
Nashorn-Ausstellung Kongo Nördlinger Ries Riesenotter
Vorstand & Stiftungsrat<br />
Vorstand der Zoologischen Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong> (<strong>ZGF</strong>)<br />
und Stiftungsrat der Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt<br />
(HbT):<br />
Gerhard Kittscher (Präsident <strong>ZGF</strong>; HbT)<br />
Dr. Christian R. Schmidt (Vizepräsident <strong>ZGF</strong>, HbT)<br />
Herrmann Clemm, Oberfinanzdirektor a.D. (HbT)<br />
IKH Prinzessin Alexandra von Hannover (<strong>ZGF</strong>, HbT)<br />
Dr. Rudolf Kriszeleit (HbT)<br />
Renate von Metzler (<strong>ZGF</strong>)<br />
Prof. Dr. Manfred Niekisch (<strong>ZGF</strong>)<br />
Generalkonsul Bruno H. Schubert (<strong>ZGF</strong>, HbT)<br />
Prof. Dr. Fritz Steininger (<strong>ZGF</strong>)<br />
Joachim Suchan (<strong>ZGF</strong>)<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Zoologische Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong> von 1858 e.V.<br />
Alfred-Brehm-Platz 16, 60316 <strong>Frankfurt</strong><br />
Tel.: (069) 94 34 46 0 Fax: (069) 43 93 48<br />
E-Mail: info@zgf.de<br />
www.zgf.de<br />
Redaktion & Layout:<br />
Dipl.-Biol. Dagmar Andres-Brümmer,<br />
Zoologische Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong><br />
Tel.: (069) 94 34 46 11 Fax: (069) 43 93 48<br />
E-Mail: andres-bruemmer@zgf.de<br />
Redaktion des Zoo-Teils: Dr. Christian R. Schmidt<br />
Mit Beiträgen von: Dr. Christof Schenck (cs), Dagmar<br />
Andres-Brümmer (ab), Wolfgang Fremuth (wf), Antje<br />
Müllner (am), Paquita Hoeck (ph), Markus Borner (mb),<br />
Eva Barth (eb), Dr. Christian R. Schmidt (crs), sowie<br />
namentlich gekennzeichneten Autorinnen und Autoren.<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> (ehemals Mitteilungen) ist die Mitgliederzeitschrift<br />
der Zoologischen Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong><br />
von 1858 e.V. Der Bezugspreis ist im Mitglieds beitrag<br />
enthalten.<br />
Erscheinungsweise: vierteljährlich<br />
Auflage: 5.000 Exemplare<br />
Druck: Hassmüller Graphische Betriebe, <strong>Frankfurt</strong>,<br />
gedruckt auf 100% Recyclingpapier<br />
Fotos: alle Bilder <strong>ZGF</strong> sofern nicht anders vermerkt<br />
Zeichungen: Abbildungen aus Brehms Tierleben<br />
von 1882 mit freundl. Genehmigung von Directmedia<br />
Publishing GmbH, Digitale Bibliothek<br />
Titelfoto: M. & A. Shah<br />
© <strong>ZGF</strong>; Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe<br />
und gegen Belegexemplar gestattet.<br />
Projekt des Monats<br />
In dieser Rubrik stellen wir<br />
Ihnen konkrete Projekte vor,<br />
die aktuell einer besonderen<br />
Unterstützung bedürfen.<br />
ding im Nördlinger Ries in Baden-<br />
Württemberg haben dank Jahrzehnte<br />
langem Einsatz ehrenamtlicher Naturschützer<br />
ihren ursprünglichen Feuchtwiesencharakter<br />
bewahren können (siehe Beitrag<br />
auf Seite 6). Sie bieten heute vielen<br />
Tieren und Pflanzen eine Heimat - denn<br />
diese Flächen sind im Besitz des Rieser<br />
Naturschutzvereins und der <strong>ZGF</strong>. Im Laufe<br />
des Jahres wollen der Verein und die <strong>ZGF</strong><br />
weitere Flächen aufkaufen, rund 3,4 Hektar<br />
Feuchtgrünland sollen so renaturiert<br />
werden.<br />
Für den Erwerb dieses Stückchens Natur<br />
vor der eigenen Haustür brauchen wir<br />
jedoch Ihre Unterstützung. Spenden können<br />
Sie ganz bequem mit dem beiliegenden<br />
Überweisungsträger, Stichwort: Nördlinger<br />
Ries.<br />
Nördlinger Ries Die Wiesen in Pfäfflingen und Wem
Liebe Leserinnen<br />
und Leser, liebe Mitglieder und<br />
Freunde der ZG F,<br />
Den Schwerpunkt dieses Heftes haben wir einem Thema gewidmet, das in fast allen<br />
unseren Projekten ebenfalls einen wichtigen Platz einnimmt, egal ob es sich um<br />
die Riesenotter im peruanischen Urwald oder die Huftiere in den Savannen Ostafrikas<br />
handelt. Der Fachbegriff dafür lautet Monitoring – die Überwachung von Tierbeständen<br />
und ihrem Lebensraum. So jedenfalls verstehen es die Biologen. Wenn Sie jedoch in diversen<br />
Lexika nach dem Begriff suchen, stoßen Sie auf recht unterschiedliche Erläuterungen.<br />
Für Mediziner verbirgt sich dahinter beispielsweise die Patientenüberwachung, für Geographen<br />
die Beobachtung und Kontrolle von Landschaften mittels Fernerkundung und Techniker<br />
nennen so die Beschallungstechnik für Bühnenkünstler.<br />
Trotz aller Unterschiede lassen sich Gemeinsamkeiten erkennen. Allgemein versteht man<br />
unter Monitoring die Überwachung von Abläufen mit der Möglichkeit einzugreifen, sofern<br />
dies notwendig sein sollte. Genau darum geht es in unserer Naturschutzarbeit vor Ort. Wir<br />
wollen wissen, wo sich bedrohte Arten aufhalten, wie viele Individuen es noch gibt und wie<br />
die Bestände sich langfristig entwickeln. Wir versuchen einzugreifen, wenn menschlicher<br />
Einfluss dramatische Konsequenzen hat. Dafür ist es unabdingbar, das Monitoring langfristig<br />
durchzuführen. Nur so lässt sich erkennen, was menschlichen Ursprungs ist und was<br />
auf natürlichen Schwankungen basiert. Nur so lassen sich Erfolge und Misserfolge messen.<br />
Erst mit ihrem speziellen Ansatz, Projekte oft über Jahrzehnte durchzuführen, erschließen<br />
sich für die <strong>ZGF</strong> und ihre Partner die Möglichkeiten eines sinnvollen Monitorings. Was für<br />
die <strong>ZGF</strong> mit den ersten Tierzählungen von Bernhard und Michael Grzimek in der Serengeti<br />
begann, ist heute aus kaum einem Projekt mehr wegzudenken. Begleiten Sie uns mit diesem<br />
Heft zu den Tierzählern an die Flüsse Amazoniens und in die Savanne der Serengeti.<br />
Herzlichst, Ihr<br />
Dr. Christof Schenck, <strong>ZGF</strong> Geschäftsführer<br />
Inhalt 3/<strong>2004</strong><br />
<strong>ZGF</strong> Notizen<br />
Projekthäppchen 2<br />
Auf Darwins Spuren 3<br />
Notizen aus Afrika 4<br />
Aus den Projekten<br />
Das Brachvogelparadies 6<br />
99 Nashörner & eifrige Naturforscher 7<br />
Dramatische Entwaldung im Kongo 9<br />
Schwerpunkt Tierzählung<br />
Gnuwanderung: Dem Grün entgegen 13<br />
Luftzählung: Elefanten auf elf Uhr 16<br />
Riesenotter: Zeigt her eure Kehlen 18<br />
<strong>ZGF</strong> intern<br />
Vortragsreihe Biodiversität 20<br />
Herbstexkursion für Mitglieder 22<br />
Aus dem Zoo <strong>Frankfurt</strong><br />
Nilpferd & <strong>Gorilla</strong> Nachwuchs 24<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Editorial<br />
1
<strong>ZGF</strong> aktuell<br />
Für ihre Verdienste um die Erhaltung der<br />
Mönchsgeier auf Mallorca, wurde Evelyn<br />
Tewes vor Kurzem von der Inselzeitung<br />
„Diario de Mallorca“ mit einem Preis<br />
bedacht. Eine schöne Anerkennung für<br />
viel persönlichen Einsatz.<br />
2 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
ProjektHäppchen<br />
Kurzmeldungen aus den <strong>ZGF</strong> Projekten<br />
Mönchsgeier<br />
Adoptiveltern gesucht<br />
Das Jahr <strong>2004</strong> war ein Rekordjahr für<br />
die Mönchsgeier auf Mallorca. Sieben<br />
Nestlinge konnten Evelyn Tewes und<br />
ihr Team aus dem Mönchsgeierprojekt bei<br />
der Nachzucht im Freiland<br />
zählen. Das ist die höchste<br />
Nachwuchsquote in den letzten<br />
20 Jahren. Vier der Jungvögel<br />
konnten bereits beringt<br />
und markiert werden.<br />
Um den Nachwuchs in den<br />
Bergen zukünftig gut im Auge<br />
behalten zu können, haben<br />
sich die Tewes und ihr Partner<br />
Juan Sanchez in diesem Jahr<br />
etwas Neues einfallen lassen.<br />
Für 3.000 Euro im Jahr bieten<br />
sie Privatpersonen sowie Firmen an, einen<br />
der Nestlinge zu „adoptieren“. Mit dem<br />
Geld lässt sich die Markierung und das so<br />
genannte Monitoring der Tiere finanzieren,<br />
d.h. die kontinuierliche Beobachtung<br />
der Vögel über einen langen Zeitraum. Die<br />
Adoptiv elten dürfen dem Geier einen Namen<br />
geben und erhalten regelmäßig Beobachtungsberichte,<br />
so dass sie stets<br />
auf dem Laufenden sind, wie es „ihrem<br />
Geier“ in den Tramuntanabergen geht.<br />
Bartgeier<br />
Ausflug in die Berge<br />
Auch in diesem Sommer konnten<br />
wieder acht junge Bartgeier<br />
im Alpenraum freigelassen werden.<br />
Vier Junggeier wurden im Mai/Juni in Italien<br />
(Argentera/Cuneo und Martell/Südtirol)<br />
in ihren neuen Lebensraum entlassen, zwei<br />
Tiere auf der Doran-Alp im französischen<br />
Hochsavoyen und zwei im österreichischen<br />
Kals Anfang Juli. Mittlerweile haben<br />
16 Paare feste Brutterritorien im Alpenraum<br />
bezogen. Allerdings haben nur acht Paare<br />
in diesen Territorien gebrütet und insgesamt<br />
wurden dieses Jahr fünf Jungvögel in Freiheit<br />
geboren. Besonders erfolgreich waren<br />
die Bartgeier auf der italienischen Alpenseite,<br />
dort sind drei Jungvögel geschlüpft,<br />
in Frankreich zwei. Leider waren die übrigen<br />
Brutpaare nicht so erfolgreich. Über die<br />
Gründe lässt sich nur mutmaßen.<br />
Die Zahl der im Alpenraum freigesetzten<br />
Bartgeier ist damit auf insgesamt 129 gestiegen.<br />
Weit über 80 Tiere werden in einem<br />
internationalen Monitoringprogramm<br />
ständig beobachtet. Um die Tiere im Flug<br />
mit dem Fernglas identifizieren zu können,<br />
werden den Junggeiern die Schwung- bzw.<br />
die Schwanzfedern mit Haarfärbemittel gebleicht.<br />
So hat jedes Tier seine individuelle<br />
Markierung. Wer markierte Geier beobachtet,<br />
kann seine Sichtung dem Internationalen<br />
Monitoringzentrum per E-Mail mitteilen:<br />
monitoring@aon.at. Über den aktuellen<br />
Bartgeierbestand und das Monitoring kann<br />
man sich außerdem im Internet informieren:<br />
www.bartgeier.ch/monitoring<br />
Die Karte zeigt die Entfärbungsmuster<br />
in den Schwanz- und Schwungfedern der<br />
Junggeier, die im Sommer <strong>2004</strong> ausgewildert<br />
wurden. (wf)
Wildkatzen<br />
Wanderwege schaffen<br />
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt<br />
(DBU) hat ein umfangreiches Projekt<br />
zur Vernetzung von Wildkatzenlebensräumen<br />
zwischen den Bundesländern Thüringen,<br />
Bayern und Hessen bewilligt. Das<br />
Projekt läuft zunächst über drei Jahre und<br />
hat das Ziel, geeignete Wanderkorridore für<br />
die isolierte Wildkatzenpopulation im thüringischen<br />
Nationalpark Hainich zu schaffen.<br />
Hierdurch soll den Katzen die Wanderung in<br />
den Thüringer Wald, aber auch nach Bayern<br />
und Hessen ermöglicht werden. Wanderhindernisse<br />
müssen abgebaut bzw. umgestaltet<br />
werden, um den Katzen den Weg in<br />
die noch unbesiedelten Gebiete zu ermöglichen.<br />
Das Projekt wird vom BUND-Thüringen<br />
getragen und von dem Diplombiologen<br />
Thomas Möhlich geleitet, der bereits seit<br />
vielen Jahren mit Wildkatzen arbeitet. (wf)<br />
Pinguine<br />
Einsatz in Chile gefragt<br />
Auf Darwins Spuren<br />
Aktuelles aus dem Galápagos Archipel<br />
Seegurkenkrieg<br />
Am 3. August <strong>2004</strong> genehmigte die<br />
Autoridad Interinstitucional de Manejo<br />
(AIM) als höchstes Entscheidungsgremium<br />
zur Regulation der Ressourcennutzung<br />
im Marine Reservat den<br />
Seegurkenfang für 60 Tage ab dem 12.<br />
August. Es gelten die bisherigen Bestimmungen<br />
einer Fangquote von 4 Millionen<br />
Tieren bei 20 cm Mindestgröße.<br />
Zudem wird es 2005/2006 keinen Fang<br />
geben, und für einige Regionen gelten<br />
Fangverbote. Die Freigabe erfolgte auf<br />
Druck der Fischer. Sie hatten Verfassungsklage<br />
eingereicht, nachdem sie<br />
die ursprüngliche Fangsaison vom 31.<br />
Mai an und die festgelegten Restriktionen<br />
nicht akzeptiert hatten. Die Klage<br />
hatte dazu geführt, dass während des<br />
laufenden Verfahrens kein Fang erlaubt<br />
war. Die Fischer hatten sich selbst ein<br />
Bein gestellt.<br />
Jetzt wird nach alternativen Einkommensquellen<br />
für die Fischer gesucht, da<br />
F ür den Zeitraum zwischen Ende Oktober<br />
<strong>2004</strong> und Anfang Februar 2005 sucht<br />
die chilenische Fundacíon Otway freiwillige<br />
Helfer für den Pinguinschutz. Die Helfer<br />
überwachen Brutkolonien von Magellan-<br />
und Humboldtpinguinen in einer kleinen<br />
Bucht im Nordwesten der chilenischen Insel<br />
Chiloé und betreiben Aufklärungsarbeit<br />
bei Touristen. Wichtige Voraussetzungen<br />
sind neben körperlicher Fitness und der<br />
Bereitschaft anzupacken, Grundkenntnisse<br />
in Spanisch sowie die Beherrschung einer<br />
weiteren Fremdsprache. Geboten werden<br />
freie Unterkunft und Verpflegung, sowie<br />
eine spannende Arbeit. Ausführliche Informationen<br />
finden Sie auf unserer Webseite<br />
www.zgf.de. Die Zoologische Gesellschaft<br />
<strong>Frankfurt</strong> unterstützt auch in diesem Jahr<br />
die Arbeit der Otway Stiftung in Chile. (ab)<br />
deutlich wird, dass es für die 1.000 lizensierten<br />
Fischer auf Galápagos, von denen<br />
ein Großteil erst in den letzten Jahren und<br />
Monaten zugewandert ist, keine nachhaltige<br />
Nutzung mariner Ressourcen geben kann.<br />
Aus Sicht der <strong>ZGF</strong> ist dies ein wichtiger Ansatz,<br />
der allerdings voraussetzt, dass zuerst<br />
die Einwanderungsgesetze für Galápagos<br />
konsequent umgesetzt werden, sonst strömen<br />
wie bisher ungebremst Menschen vom<br />
Festland nach Galápagos. (cs)<br />
Problemfall Ziege<br />
In der Ausgabe 2/04 des <strong>ZGF</strong>-<strong>Gorilla</strong> hatten<br />
wir vom endlosen Kampf gegen die unzäh-<br />
ligen Ziegen auf der Insel Isabela berichtet.<br />
Nun haben die Ziegenjäger eine<br />
erste Zwischenbilanz vorgelegt. Bislang<br />
wurden auf Isabela 500.000 Ziegen geschossen.<br />
Weitere 400.000 Tiere leben<br />
laut Schätzungen noch im Norden der<br />
Insel.<br />
Die Ziegen zerstören den Lebensraum<br />
für die einmaligen Galápagos Riesenschildkröten,<br />
indem sie großflächig alles<br />
kahl fressen. (am)<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
<strong>ZGF</strong> aktuell<br />
3
<strong>ZGF</strong> aktuell<br />
Foto: R. Faust<br />
Vom Nördlichen Breitmaulnashorn<br />
(Ceratotherium simum cottoni) leben<br />
schätzungsweise noch 17-22 Individuen<br />
im Garamba Nationalpark im Kongo. Das<br />
ist alles was von etwa 2.250 Tieren in<br />
den 60er Jahren noch übrig ist. Wenn<br />
die Krise im Garamba anhält, könnte das<br />
in Kürze das endgültige Aus für diese<br />
Unterart bedeuten. Das Foto zeigt ein<br />
Nördliches Breitmaulnashorn aus einer<br />
lang ausgelöschten Population im Sudan<br />
- aufgenommen in den 1960er Jahren.<br />
4 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Notizen aus Afrika<br />
aus den <strong>ZGF</strong> Projekten & darüber hinaus<br />
DR Kongo<br />
Dramatische Wilderei auf<br />
seltene Nashörner im Kongo<br />
Aus dem Kongo wollen zurzeit überhaupt<br />
keine guten Nachrichten kommen. Arabische<br />
Reitermilizen, die in der sudanesischen<br />
Dafur Region eine humanitäre<br />
Katastrophe heraufbeschworen haben, treiben<br />
auch in der Demokratischen Republik<br />
Kongo ihr Unwesen und wildern dort massiv<br />
Nashörner und Elefanten. Wie Fraser Smith<br />
vom Garamba National Park Project berichtet,<br />
fallen die berittenen Milizen von Norden<br />
her in den kongolesischen Garamba Nationalpark<br />
ein und transportieren mit Eselskaravanen<br />
ganze Berge von Elfenbein und<br />
Nashorn-Horn in Richtung Sudan davon.<br />
Fraser Smith hatte Anfang August öffentlich<br />
Alarm geschlagen, nachdem bei einer<br />
Befliegung des Gebietes die ganze Dramatik<br />
der Lage sichtbar geworden war. Etwa 14-<br />
19 Individuen des Nördlichen Breitmaulnashorns<br />
sind in den letzten 14 Monaten<br />
gewildert worden. Das mag nicht dramatisch<br />
viel klingen, ist es aber, wenn man<br />
weiss, dass dies über die Hälfte des Bestandes<br />
ist, den es von dieser Art weltweit<br />
überhaupt noch gibt. Smith geht nach den<br />
Ergebnissen der Beobachtungen aus der<br />
Luft davon aus, dass im Moment noch etwa<br />
17-22 Tiere der Art im Park leben. „Wir wissen,<br />
dass seit der Befliegung noch ein weiteres<br />
Nashorn geschossen wurde und dass<br />
in den letzten Tagen weitere Wilderer beobachtet<br />
wurden, wie sie in den Park kamen“,<br />
sagt Smith. Zwei arabische Milizionäre<br />
seien bei einer Schießerei mit Parkrangern<br />
ums Leben gekommen, ebenso wie zwei<br />
Ranger. Zahlreiche weitere Ranger wurden<br />
bisher in Kämpfen mit Wilderen verletzt.<br />
Der kriegsgeschüttelte Kongo ist das<br />
drittgrößte Land Afrikas und gehört zu den<br />
Ländern mit einer enormen biologischen<br />
Vielfalt. „Wir haben 23 Jahre lang dafür<br />
gekämpft, die Nashörner und Elefanten<br />
im Garamba zu retten“, sagt Kes Hillman<br />
Smith vom Garamba Projekt, „und jetzt,<br />
wo endlich Frieden in die Region zu kommen<br />
scheint, eskaliert die Ausbeutung der<br />
großen Säuger.“<br />
Während das Südliche Breitmaulnashorn<br />
heute wieder in großen Beständen vorkommt,<br />
ist das Nördliche Breitmaulnashorn<br />
extrem selten und entsprechend hochgradig<br />
vom Austerben bedroht. In den 1960er<br />
Jahren lebten noch geschätzte 2.250 Tiere<br />
der Unterart in fünf afrikanischen Staaten.<br />
Heftige Wilderei reduzierte sie bis zum Jahr<br />
1984 auf etwa 15 Tiere - alle im Garamba<br />
Nationalpark. „Die Schutzbemühungen<br />
zeigten vor dem Krieg bereits ihre Wirkung.<br />
Mitte der 1990er Jahre hatten sich Elefanten<br />
und Rhinos im Garamba wieder verdoppelt.<br />
Aber mit den aktuellen Ereignissen laufen<br />
wir Gefahr, auch die letzten verbleibenden<br />
Nashörner zu verlieren“, sagt Smith. (ab)<br />
Serengeti<br />
Zwei kleine Nashörnchen<br />
G ute Nachrichten in Sachen Nashornnachwuchs<br />
gibt es aus der Serengeti<br />
und dem Ngorongoro Krater. Im Krater hat<br />
die Spitzmaulnashornkuh „Papagena“ ihr<br />
erstes Kalb bekommen. Die Population ist<br />
mit dem kleine Bullen auf 18 Tiere angewachsen.<br />
Auch die Serengeti kann junges<br />
Mutterglück vermelden, „Seronera“ bekam<br />
Ende Juli ihren ersten Nachwuchs. Damit<br />
leben nun 13 Spitzmaulnashörner im Moru-<br />
Gebiet des Nationalparkes. (mb)
Serengeti<br />
Großer Managementplan<br />
Seit Januar 2003 ist in der Serengeti ein<br />
intensiver Prozess zur Erarbeitung eines<br />
so genannten „General Management Plans“<br />
im Gange. In diesem wird die langfristige<br />
Perspektive und Politik zur Entwicklung des<br />
Serengeti National parkes festgeschrieben.<br />
Der zweite Workshop des inter disziplinären<br />
Planungsteams mit Vertretern u.a. der <strong>ZGF</strong><br />
und des Nationalparkes fand im August<br />
in Tansania statt. Der Managementplan<br />
schreibt zum einen die strategische Ausrichtung<br />
der Naturschutzpolitik für den Park<br />
fest, gibt aber auch ganz konkrete Handlungschritte<br />
im Drei-Jahres-Rhythmus vor.<br />
Abweichend von der bisherigen Politik wird<br />
in dem neuen Plan in der Zielsetzung des<br />
Nationalparks explizit die Rolle des Parkes<br />
für die Entwickung der Gemeinden im<br />
Umland herausgehoben. Nicht nur die nationale<br />
und internationale Bedeutung des<br />
Schutzgebietes und seiner einzig artigen<br />
Lebensräume und biologischen Vielfalt wird<br />
gewürdigt, sondern auch der kulturelle Wert<br />
für die Menschen im Umfeld des Parks festgeschrieben.<br />
Der langwierige Prozess der Erstellung<br />
des Managementplans liegt in den Händen<br />
des Conservation Development Centers in<br />
Nairobi. Finanziert wird er mit Mitteln<br />
der Zoologischen Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong>.<br />
Neu im Team<br />
Projektleiter in Äthiopien<br />
Seit Anfang diesen Jahres ist die lange<br />
Liste der <strong>ZGF</strong>-Projekte um noch eines<br />
reicher - das neue Bale Mountains<br />
Schutzprojekt in Äthiopien. Alastair Nelson,<br />
der durch seine Arbeit<br />
in verschiedenen<br />
Natur schutzprojekten<br />
in zahlreichen Ländern<br />
Afrikas trotz seiner<br />
jungen Jahre über<br />
viel Erfahrung verfügt,<br />
zog im Mai nach Äthi-<br />
Bergnyala<br />
opien, um fortan seine<br />
neue Aufgabe als <strong>ZGF</strong>-<br />
Projektleiter anzupacken. Ziel des Projektes<br />
ist die Entwicklung eines gut geführten und<br />
sicheren Bale Mountains Nationalpark.<br />
Die Bale Berge sind das größte zusammenhängende<br />
afroalpine Gebiet Afrikas.<br />
Neben noch unerforschten tropischen Wäldern,<br />
beherbergen die Bale Berge die Hälfte<br />
der letzten 3.000 Bergnyalas (Tragelaphus<br />
buxtoni), einer endemischen Antilope, und<br />
etwa 300 der insgesamt rund 500 Äthiopischen<br />
Wölfe (Canis simensis) sowie viele<br />
weitere äthiopische Endemiten. Des weiteren<br />
entspringen dem Gebiet drei beachtliche<br />
Flüsse, die etwa eine Million Menschen<br />
in Südostäthiopien und Süd- und Zentralsomalia<br />
mit Wasser versorgen. Gut zu wissen,<br />
dass ein großer Teil dieses einzigartigen Gebietes<br />
(2.200 km²) durch den Bale Mountains<br />
Nationalpark geschützt ist – könnte<br />
man meinen. Leider ist der Parkschutz in<br />
Schwierigkeiten. Eine zunehmende Zahl<br />
von Menschen und deren Nutztiere leben<br />
im Park, überbeanspruchen dessen natürliche<br />
Ressourcen und schleppen Krankheitserreger<br />
ein. Zudem ist der rechtliche Status<br />
des Nationalparks aufgrund neuer politischer<br />
Ver hältnisse ungewiss, und die derzeitige<br />
Parkverwaltung fühlt sich mit der<br />
Kontrolle dieser Gefahren überfordert. Deshalb<br />
haben sich Alastair Nelson und die <strong>ZGF</strong><br />
zum Ziel gesetzt, die Parkkräfte zu stärken,<br />
die dort lebenden Menschen in die Aktivitäten<br />
des Parks sowie in die aus dem Park<br />
resultierenden Gewinne (z.B. durch Tourismus)<br />
mit ein zubinden. Glücklicherweise ist<br />
die Lokalregierung von dem Projekt begeistert<br />
und unterstützt es so gut es geht. (ph)<br />
Abgeholzt<br />
von Andreas Güde<br />
Der Brite Alastair Nelson ist seit Kurzem als<br />
Projektleiter für die <strong>ZGF</strong> in Äthiopien. Der<br />
Biologe hat zuvor schon in Botswana, Südafrika,<br />
Mosambique, Kenia und Äthiopien<br />
gearbeitet und spricht mehrere afrikanische<br />
Sprachen.<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
<strong>ZGF</strong> aktuell<br />
5
aus den Projekten<br />
6 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Schwäbisches Brachvogelparadies<br />
Die hellen Balken zeigen die lang fristig<br />
stabile Entwicklung des Großen Brachvogels<br />
auf den renaturierten Flächen<br />
von 1965 bis heute. Die dunklen<br />
Balken verdeutlichen den Absturz der<br />
Art auf der Vergleichs fläche. Oben:<br />
Feuchte Flächen im Nördlinger Ries<br />
Seit gut 25 Jahren unterstützt die <strong>ZGF</strong> ein Renaturierungsprojekt im schwäbischen<br />
Nördlingen. Von Wolfgang Fremuth.<br />
Wiesenbrütende Vögel haben in den<br />
vergangenen Jahren überall erhebliche<br />
Bestandseinbrüche hinnehmen<br />
müssen. Der Grund hierfür liegt<br />
in einer Intensivierung der Landnutzung.<br />
Feuchtwiesen wurden trocken gelegt, teilweise<br />
sogar zu Ackerflächen oder zu Baugebieten<br />
umgewandelt. Dadurch wurde ihr<br />
Charakter als Lebensraum dramatisch verändert.<br />
Darunter hatten nicht nur die Wiesenbrüter<br />
der Vogelwelt erheblich zu leiden,<br />
sondern auch die Amphibien-, Reptilien-<br />
und Insektenfauna.<br />
Die Wiesen in Pfäfflingen und Wemding,<br />
im so genannten Nördlinger Ries liegen<br />
etwa fünf Kilometer nördlich des schwäbischen<br />
Städtchens Nördlingen. Sie haben zu<br />
einem guten Teil den ursprünglichen Charakter<br />
von Feuchtgrünland bewahrt. Das<br />
durch einen Meteoriteneinschlag entstandene<br />
Nördlinger Ries war über eine lange<br />
Zeit durch ausgedehnte Feuchtwiesen geprägt.<br />
Diese waren Brutgebiet des Großen<br />
Brachvogels, des Kiebitz, der Bekassine<br />
und anderer Wiesenbrüter. Durch die Trockenlegung<br />
der Riedwiesen hätten diese<br />
Vogelarten ihren Lebensraum fast verloren,<br />
wenn es da nicht die Aktivisten der<br />
Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und<br />
des Rieser Naturschutzvereins gäbe. Seit<br />
Anfang der 1980er Jahre bemühen sich<br />
die Ehrenamtlichen des Vereins unter der<br />
Leitung von Johannes Ruf, die wertvollen<br />
Riedwiesen aufzukaufen und in ihren ursprünglichen<br />
Zustand zurückzuversetzen.<br />
Die <strong>ZGF</strong> unterstützt dieses Vorhaben bereits<br />
seit 1981. Mittlerweile sind die beiden<br />
Rieser Naturschutzvereine Eigentümer<br />
von über 250 Hektar der sensiblen Feuchtgrünländereien<br />
und erste Renaturierungsmaßnahmen<br />
wurden begonnen.<br />
Seit Mitte der sechziger Jahre beobachten<br />
die Aktiven der beiden örtlichen<br />
Naturschutzvereine den Bestand der Wiesenbrüter<br />
in und außerhalb ihres Projektgebietes.<br />
Anhand der Bestände des<br />
Großen Brachvogels zeigte sich die Wirksamkeit<br />
ihrer Maßnahmen sehr deutlich. In<br />
einem Vergleichsgebiet entlang des Flusses<br />
Wörnitz beobachteten die Rieser Naturschützer<br />
den dramatischen Rückgang<br />
der Bachvogelbruten. Dort war der Flusslauf<br />
aktiv vertieft worden, und die folglich<br />
austrocknenden Feuchtwiesen waren für<br />
den Brachvogel zunehmend unattraktiv geworden.<br />
Verschärft wurde die Bestandssituation<br />
durch die Ende der 1960er und Anfang<br />
der 1970er Jahre durchgeführte Flurbereinigung,<br />
die zu Trockenlegung und Intensivierung<br />
der Grünlandproduktion führte. Auf<br />
den renaturierten Flächen der beiden Rieser<br />
Naturschutzorganisationen konnten sich die<br />
Bestände des Großen Brachvogels stabilisieren.<br />
Ein sehr schöner Erfolg jahrelanger<br />
privater Naturschutzarbeit. Durch eine Förderung<br />
des Bayerischen Naturschutzfonds<br />
ist es den Rieser Ehrenamtlichen gelungen,<br />
für insgesamt sechs Jahre Mittel zum weiteren<br />
Ankauf wertvoller Flächen zu erhalten.<br />
Die Zoologische Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong> unterstützt<br />
auch diesen Abschnitt des Projektes<br />
(siehe auch Projekt des Monats).
99 Nashörner<br />
und eifrige Naturforscher<br />
In dem gemeinsamen Projekt „Globalen Naturschutz lokal erleben“ versuchen<br />
<strong>ZGF</strong> und Zoo <strong>Frankfurt</strong> die weltweite Naturschutzarbeit der <strong>ZGF</strong> in spannender<br />
und unterhaltsamer Weise den Besuchern des Zoos nahe zu bringen. Im Sommer<br />
wurde die interaktive Ausstellung zum Schutz der Nashörner eröffnet und beim Tag<br />
der Artenvielfalt gab es überraschende Entdeckungen. Von Eva Barth.<br />
Als Mitte Mai Nashorn Hama vom Zoo<br />
<strong>Frankfurt</strong> nach Südafrika reiste, war<br />
das öffentliche Interesse groß. Das<br />
Thema Schutz der Nashörner war in allen<br />
Zeitungen und die Zoobesucher fragten neugierig<br />
nach. Warum wird denn der <strong>Frankfurt</strong>er<br />
Nachwuchs nach Südafrika gebracht?<br />
Was hat das mit der Wiederansiedlung in<br />
Sambia zu tun? Und wie bekommt man ein<br />
dickköpfiges Nashorn in seine Transportkiste?<br />
Diese und noch mehr Fragen beantwortet<br />
seit Anfang Juli die neue Ausstellung<br />
„Die Rückkehr der Nashörner“ auf unterhaltsame<br />
Art und Weise.<br />
Wer neugierig durch die Gucklöcher in<br />
den originalgetreuen Nachbau einer Nashorn-Transportkiste<br />
schaut, bekommt die<br />
Geschichte von Akura erzählt: Dieses Nashorn<br />
wurde als erstes von <strong>Frankfurt</strong> nach<br />
Südafrika gebracht und hat im August 2003<br />
in der Wildnis Nachwuchs bekommen - eine<br />
weltweite Premiere für ein ehemaliges Zoonashorn.<br />
Drei „<strong>Frankfurt</strong>er Mädels“ wurden<br />
bisher nach Südafrika gebracht. Im Tausch<br />
stellten die südafrikanischen Nationalparks<br />
Tiere zur Wiederansiedlung in Sambia zur<br />
Verfügung. Dieser Ringtausch wird auf einer<br />
großen Weltkarte erläutert und macht klar,<br />
welchen wichtigen Beitrag die <strong>Frankfurt</strong>er<br />
Zootiere für die Erhaltung ihrer Art leisten.<br />
Schüler halfen bei der Konzeption<br />
Damit „Die Rückkehr der Nashörner“ gut<br />
beim Publikum ankommt und auch von jüngeren<br />
Menschen verstanden wird,<br />
haben Schülerinnen und Schüler<br />
bei der Konzeption mitgewirkt. Die<br />
siebten Klassen der Wöhlerschule in<br />
<strong>Frankfurt</strong> und zwei Klassen des Hessenkollegs<br />
aus Wiesbaden haben<br />
Textentwürfe studiert, Bilderpräsentationen<br />
begutachtet und spielerische<br />
Elemente getestet. Viele Vorschläge<br />
der Schüler wurden in die Ausstellung<br />
übernommen. Während der Eröffnung<br />
bemalten diese Schüler<br />
99 Gipsnashörner in individueller<br />
Weise. Sie zeigten damit: Auch wenn<br />
auf den ersten Blick ein Nashorn dem anderen<br />
gleicht, jedes ist doch einzigartig.<br />
Die Erlebnis-Station zum Schutz der<br />
Nashörner ist die erste von zwei Zoo-Ausstellungen,<br />
die im Rahmen des Projektes<br />
„Globalen Naturschutz lokal erleben“<br />
verwirklicht wurde. Ziel dieses Kooperati-<br />
Blick in die Kiste: Hinter den Gucklöchern<br />
verbirgt sich die spannende Geschichte<br />
von Akuras Reise nach Afrika.<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
aus den Projekten<br />
7
aus den Projekten<br />
Den Forschergeist zu wecken und auf die<br />
kleinen Wunder der Natur vor unserer<br />
Haustür aufmerksam zu machen, ist das<br />
Ziel des GEO-Tages der Artenvielfalt. Am<br />
12. Juni wurde er zum sechsten Mal vom<br />
Hamburger Magazin GEO veranstaltet.<br />
Über 200 Projekte waren bundesweit<br />
angemeldet worden. Überall erforschten<br />
an diesem Juniwochenende Schülergruppen,<br />
Hausfrauen, Wissenschaftler,<br />
Vereine, Sportskollegen oder Naturfreunde<br />
die Kleinode der Natur oder schauten auf<br />
scheinbar tristen Plätzen nach Lebendigem.<br />
In <strong>Frankfurt</strong> gab es<br />
nur eine einzige<br />
Aktion: die im Zoo<br />
<strong>Frankfurt</strong>. Übrigens<br />
die einzige in einem<br />
Zoo.<br />
8 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
onsprojektes von Zoo und <strong>ZGF</strong> ist es, mit<br />
verschiedenen Aktionen Aufmerksamkeit<br />
auf die Notwendigkeit internationaler Naturschutzarbeit<br />
zu lenken. „Zwischen Zoo und<br />
Zoologischer Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong> besteht<br />
eine traditionsreiche und enge Verbindung“,<br />
sagte <strong>ZGF</strong>-Präsident Gerhard<br />
Kittscher bei der Ausstellungseröffnung.<br />
„Diese für Deutschland einzigartige Kombination<br />
einer international tätigen Naturschutzorganisation<br />
und eines städtischen<br />
Zoos soll der Öffentlichkeit transparent gemacht<br />
werden“. Die Erhaltung biologischer<br />
Vielfalt als Grundlage des Lebens auf unserer<br />
Erde steht dabei im Mittelpunkt. Doch<br />
nicht nur mittels Ausstellungen, sondern<br />
mit den eigenen Händen wollte das Projekt<br />
den Zoobesuchern Mitte Juni Natur vermitteln.<br />
Anlässlich des bundesweiten GEO Tages<br />
der Artenvielfalt durften die Besucher<br />
erkunden, welche Arten neben den „offiziellen<br />
Zootieren“ noch im Zoo leben.<br />
Bergmolche im Kamelgraben<br />
So etwas hatte der junge Zebrahengst<br />
im Zoo <strong>Frankfurt</strong> noch nicht erlebt! Ein gutes<br />
Dutzend Kinder machte sich mit großen<br />
Keschern im Wassergraben seines Geheges<br />
zu schaffen. Die ganze Aufmerksamkeit<br />
galt dem Fang in ihren Netzen: Unter der<br />
Anleitung eines Experten der HGON (Hessische<br />
Gesellschaft für Ornithologie und<br />
Naturschutz) fischten die Freilandforscher<br />
allerlei Kurioses aus dem seichten Nass.<br />
Käfer, Fische und Schnecken wurden vorsichtig<br />
in Aquarien gesetzt, bestaunt und<br />
bestimmt. Die Sensation waren unbestrit-<br />
ten die vielen Bergmolche, die sich in dieser<br />
außergewöhnlichen Umgebung richtig<br />
wohlzufühlen schienen. Nicht nur das Leben<br />
im Wasser wurde näher unter die Lupe<br />
genommen: Insektenkundler des entomologischen<br />
Vereins Apollo kescherten in den<br />
Wiesen des Zoos, und bei der Station des<br />
Kindermuseums des Historischen Museums<br />
wurden eifrig Forscherbögen ausgefüllt<br />
und Pflanzen gepresst. Mit ein wenig Hilfestellung<br />
wurde das Bestimmen der Pflanzen<br />
zum Kinderspiel. Der Blick durch das<br />
Binokular öffnete Jung und Alt neue Welten:<br />
„Das ist ja alles voller Blüten“ staunte<br />
die neunjährige Hannah.<br />
Die Aktionen zum Tag der Artenvielfalt,<br />
die Nashorn-Ausstellung und die neue Veranstaltungsserie<br />
zur biologischen Vielfalt<br />
(siehe Veranstaltungsprogramm Seite 20)<br />
sind Bestandteile des Projektes „Naturschutz<br />
erleben“ und werden mit Mitteln der<br />
Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.
Dramatischer Kahlschlag<br />
Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit begann im Kongo im Mai/Juni der systematische<br />
Angriff auf ein UNESCO Weltnaturerbe. Innerhalb kurzer Zeit wurden<br />
rund 15 km² Wald im Virunga Nationalpark, dem Refugium der letzten Berggorillas,<br />
gerodet. Massiver Druck von Naturschutzorganisationen konnte dem Abholzen<br />
zwar vorläufigen Einhalt gebieten, die Lage in der Region bleibt jedoch äußerst<br />
prekär. Von D. Andres-Brümmer.<br />
Die letzte Ausgabe unseres <strong>ZGF</strong>-<strong>Gorilla</strong>s,<br />
in der Robert Muir und Helen<br />
Hague ihre neue Aufgabe als <strong>ZGF</strong>-<br />
Projektleiter im Kongo schildern war gerade<br />
gedruckt, da erreichten uns in <strong>Frankfurt</strong> zunehmend<br />
beängstigende E-Mails aus dem<br />
Kongo. Robert und Helen hatten gerade angefangen,<br />
sich in ihre neue Aufgabe, die<br />
Koordination des <strong>Gorilla</strong>sschutzes im Virunga<br />
Nationalpark, einzufinden, da kam<br />
es im Mai und Juni auf der kongolesischen<br />
Seite des Nationalparks zu heftigen<br />
Unruhen und Überfällen<br />
durch Milizen, Militär<br />
und ruandische Siedler.<br />
Im Verlauf der Unruhen<br />
wurden 15 Quadratkilometer<br />
des wertvollen<br />
und geschützten Waldes<br />
kurzerhand abgeholzt.<br />
Das Holz wurde zu kontinuierlich<br />
steigenden<br />
Preisen verkauft, das gerodete<br />
Land sofort landwirtschaftlich<br />
genutzt.<br />
Das betroffene Gebiet,<br />
der Mikeno Sektor, ist ein wichtiges Nahrungsgebiet<br />
für die <strong>Gorilla</strong>s. Denn in den<br />
Wäldern des Grenzgebietes zwischen der<br />
Demokratischen Republik Kongo, Ruanda<br />
und Uganda leben die letzten Berggorillas<br />
unserer Erde. Mit insgesamt etwa 670 Tieren<br />
ist der Berggorilla (<strong>Gorilla</strong> beringei beringei)<br />
eines der seltensten und bedrohtesten<br />
Säugetiere überhaupt. Die Hälfte der Tiere<br />
im Wald der <strong>Gorilla</strong>s<br />
„93 kongolesische<br />
Parkranger sind in<br />
den letzten acht<br />
Jahren ermordet<br />
worden. Das ist fast<br />
einer pro Monat.“<br />
lebt an den Hängen der Virunga Vulkane im<br />
Kongo. Ihr Lebensraum, der Virunga Nationalpark<br />
ist UNESCO Weltnaturerbe und damit<br />
eigentlich durch internationales Recht<br />
geschützt. Eigentlich. Doch die Lage ist<br />
auch nach dem Ende des Bürgerkrieges in<br />
der Region gefährlich. Bewaffnete Kämpfer<br />
nutzen den Park, um sich zu verstecken und<br />
von dort aus in alle drei Länder einzufallen.<br />
„Es ist eine wilde Mischung aus Milizen und<br />
Truppen und alle machen das gleich. Sie<br />
überfallen Dörfer und schüren Aufstände“,<br />
sagt Robert Muir.<br />
Fast täglich berichten<br />
uns die beiden von<br />
Überfällen und Morden<br />
in der Nachbarschaft,<br />
von Hinterhalten auf<br />
der Straße, denen sie<br />
nur durch Glück entgangen<br />
sind und von<br />
Parkrangern, die kurzerhand<br />
umgebracht<br />
wurden, weil sie versuchten,<br />
den marodierenden<br />
Horden Ein halt<br />
zu gebieten. „93 kongolesische Parkranger<br />
sind in den letzten acht Jahren ermordet<br />
worden,“ berichtet Robert Muir, „das ist<br />
fast einer pro Monat.“ Naturschutz im Park<br />
ist wahrlich kein einfacher Job im Moment,<br />
doch die beiden wollen trotz allem bleiben.<br />
Sie wollen tun, was in ihrer Macht steht,<br />
dem Park, den Berggorillas und den Menschen<br />
vor Ort zu helfen.<br />
Helen Hague (hinten rechts) und ihre<br />
Mitarbeiter begutachten die Schäden der<br />
gnadenlosen Rodungen. Der Wald am<br />
Fuße des Mount Mikeno (oben) ist bis auf<br />
das letzte Bäumchen verschwunden.<br />
DR Kongo<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
aus den Projekten<br />
9
aus den Projekten<br />
„Fast jede Nacht hören wir Schüsse“<br />
Der Brite Robert Muir beim Interview mit<br />
BBC World. Erst der internationale Druck<br />
bewegte die Regierungen Ruandas und<br />
des Kongo, vor Ort einzugreifen und den<br />
Rodungen Einhalt zu gebieten.<br />
10 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Die beiden <strong>ZGF</strong> Projektleiter Robert Muir und Helen Hague wollen trotz der Krise<br />
im Kongo bleiben. Paquita Hoeck sprach mit den beiden über den nicht alltäglichen<br />
Alltag in einem gefährlichen Umfeld.<br />
Robert, wie sicher wohnt Ihr bei<br />
all den Unruhen um Euch herum ?<br />
Wir leben in einem schönen Haus in<br />
Goma, unweit vom Stadtzentrum. Eines unserer<br />
freien Zimmer haben wir in ein Büro<br />
umgestaltet, und wenn unser Gästezimmer<br />
nicht in Gebrauch ist, dient es als Lagerraum<br />
für unsere Feldausrüstung und den<br />
Medikamentenvorrat. Wir mussten einen<br />
Stacheldrahtzaun um unsere Hauswände<br />
legen und haben einen Wächter angestellt,<br />
der in der Nacht mit Taschenlampe, Funkgerät<br />
und Handy ausgerüstet auf uns aufpasst.<br />
Fast jede Nacht hören wir Schüsse in<br />
unserer Gegend – die als eine der sichersten<br />
von Goma bekannt ist!<br />
Wie sieht Euer Arbeitsalltag aus ?<br />
Normalerweise arbeiten wir zwei bis drei<br />
Tage pro Woche im Park, wo wir Tainingsprogramme<br />
durchführen, technische Unterstützung<br />
leisten und den Aufbau wichtiger<br />
Parkinfrastruktur koordinieren. In Goma arbeiten<br />
wir vor allem in unserem Büro, wo<br />
wir uns mit anderen Naturschutzorganisationen,<br />
Regierungsdienststellen und humanitären<br />
Hilfsorganisationen per E-Mail<br />
austauschen. Zurzeit sind neun internationale<br />
Naturschutzorganisationen in Goma<br />
stationiert, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen.<br />
Deshalb ist regelmäßiger persönlicher<br />
Kontakt sehr wichtig, um Arbeit nicht<br />
doppelt zu verrichten und eine maximale<br />
Zusammenarbeit zu gewährleisten.<br />
Seid Ihr dazu viel unterwegs ?<br />
Tagsüber ist es sicher genug, um in Goma<br />
mit dem Auto herumzufahren, aber die Vereinten<br />
Nationen raten von jeglichen Ausflügen<br />
nachts ab. Wir versuchen, uns so gut wie<br />
möglich daran zu halten. Im Park selbst sind<br />
die Risiken tags wie nachts weitaus größer.<br />
Man muss sich vor Überfallen durch die<br />
zahlreichen Rebellengruppen in Acht nehmen.<br />
Diese Gruppen haben es gezielt auf<br />
Stationen des Parks und Tankstellen abgesehen,<br />
um an Waffen, Geld, Feldausrüstung,<br />
Kleidung, Essen und Kochutensilien<br />
zu gelangen. Ganze Stationen werden leer<br />
geräumt und manchmal sogar bis auf die<br />
Grundmauern abgebrannt. Daher haben wir<br />
uns in letzter Zeit vor allem um die humanitären<br />
Bedürfnisse der Parkranger bemüht.<br />
Zudem liegt die praktische Durchführung<br />
der Mauerarbeiten in <strong>ZGF</strong>-Hand, weshalb<br />
wir mindestens zweimal pro Woche vor Ort<br />
sind, um Gehälter zu zahlen, Nahrung und<br />
medizinische Versorgung zu bringen, Werkzeuge<br />
zu verteilen, die Qualität der Arbeit<br />
zu inspizieren und Probleme zu diskutieren.<br />
Bis jetzt sind wir die einzigen Leute, die die<br />
kritische Grenzregion zwischen Ruanda und<br />
der DRK beschritten haben. Dies war auch<br />
erst nach langen Verhandlungen mit dem<br />
ruandischen Militär möglich. Dadurch haben<br />
wir aber entscheidende Informationen<br />
zum wirklichen Zerstörungsgrad erhalten,<br />
was für den Wiederaufbau des Parks von<br />
großer Wichtigkeit ist.<br />
Seid Ihr jederzeit bereit zu gehen,<br />
sollte die Lage sich verschlechtern ?<br />
Wir verfolgen die aktuellen Geschehnisse<br />
sehr genau und legen Wert auf gute Notfallplanung.<br />
Die Sicherheitslage schwankt<br />
ständig zwischen relativ stabil und heftigen<br />
militärischen Konflikten. Deshalb kennen<br />
wir mehrere Stufen der Notfallplanung,<br />
z.B. Arbeitsreduktion, die Verlagerung nicht<br />
essentieller Gegenstände an einen Ort außerhalb<br />
des Landes, 24-Stunden-Alarmbereitschaft<br />
und Evakuierung. Die letzte Phase<br />
kann je nachdem recht schnell gehen.
Goma<br />
Demokatische<br />
Republik Kongo<br />
Virunga Volcano<br />
National Park<br />
(Kongo)<br />
Mikeno Sektor<br />
Bei Robert und Helen liefen folglich die<br />
Drähte heiß. Ständig waren und sind sie im<br />
Austausch mit den Nationalparkstellen, Regierungsverantwortlichen,<br />
Militärs, anderen<br />
Naturschutzorganisationen und natürlich mit<br />
der internationalen Presse. Die wenigen, im<br />
von Unruhen geprägten Kongo verbliebenen<br />
Naturschutzorganisationen versuchten sehr<br />
schnell, durch intensive Verhandlungen mit<br />
den Verantwortlichen auf beiden Seiten der<br />
Grenze und durch massive Lobbyarbeit auf<br />
internationaler Ebene dem Angriff auf den<br />
Nationalpark Einhalt zu gebieten. Anfang<br />
Juli wurde die Abholzungswelle durch die<br />
Regierungen Ruandas und des Kongo erst<br />
einmal gestoppt. Robert Muir sieht den Erfolg<br />
vor allem im Engagement der verschiedenen<br />
Naturschutzorganisationen und der<br />
Intervention der UNESCO, der EU und des<br />
US State Department. Letztendlich führte<br />
der Inspektionsbesuch einer UN Delegation<br />
dazu, dass die beiden Regierungen Order<br />
gaben, die Rodungen zu stoppen.<br />
Mittlerweile wird eine große Mauer entlang<br />
der Grenze gebaut. „Damit versuchen<br />
wir, die ursprünglichen Grenzen des Nationalparks<br />
wieder herzustellen“, kommentiert<br />
Robert die ungewöhnliche Maßnahme.<br />
Sowohl die <strong>ZGF</strong> als auch die EU und das<br />
International <strong>Gorilla</strong> Conservation Programme<br />
(IGCP) hatten Mittel zum Bau bereitgestellt.<br />
Sinn der Mauer ist zum einen<br />
die deutlich sichtbare Grenzmarkierung des<br />
Parkes. Zum anderen soll sie aber auch verhindern,<br />
dass Kühe in das gerodete Gebiet<br />
getrieben werden, und dass Elefanten aufgrund<br />
der Zerstörung ihres Lebensraumes<br />
den Park verlassen und sich über die Felder<br />
hermachen, was zusätzliche Konflikte mit<br />
den Bauern bedeuten würde.<br />
Volcano National<br />
Park (Ruanda)<br />
Ngahinga<br />
National<br />
Park<br />
Uganda<br />
Ruanda<br />
Zerstörtes Gebiet von rund 15 Quadratkilometer<br />
innerhalb des Nationalparks<br />
Die Lage im Nationalpark selbst ist noch<br />
immer unübersichtlich. „Es gibt täglich<br />
Überfälle“, berichtet Robert Muir. „Die Parkranger<br />
stehen unter ständigem Beschuss<br />
und haben einen Großteil ihrer Kommunikationsausrüstung<br />
nach Goma zurückgebracht,<br />
damit nicht alles gestohlen wird.“<br />
Die <strong>ZGF</strong> hatte erst im Mai 2003 ein Kommunikationsnetz<br />
mit UKW Sendemasten im<br />
Virunga Nationalpark installiert. „Ohne Funk<br />
ist die Arbeit für die Ranger hier sehr gefährlich“,<br />
sagt Robert Muir, der nun versuchen<br />
will, ein alternatives Kommunikationsnetz<br />
aufzubauen, um die Sicherheit der Parkranger<br />
zu erhöhen.<br />
Der Kongo beherbergt fast so viele Berggorillas,<br />
wie die beiden Nachbarländer zusammen.<br />
Während der <strong>Gorilla</strong>-Tourismus in<br />
Ruanda und Uganda mehr als zwei Millionen<br />
Dollar jährlich direkt in die Kassen der<br />
dortigen Nationalparks spült, ist der Tourismus<br />
auf kongolesischer Seite vor fast<br />
zehn Jahren aufgrund der Unruhen zum Erliegen<br />
gekommen. Ein sanfter Naturtourismus<br />
böte für den Virunga Nationalpark<br />
jedoch eine enorme Chance zur wirtschaftlichen<br />
Entwicklung der Region und könnte<br />
somit eine solide und nachhaltige Lebensgrundlage<br />
für die sehr arme Bevölkerung<br />
darstellen.Die <strong>ZGF</strong> hat daher an die Bundesregierung<br />
appelliert, sich dafür einzusetzen,<br />
dass die bereits im Kongo stationierten UN<br />
Truppen in den Konflikt eingreifen und die<br />
Lage im Nationalpark unter Kontrolle bringen.<br />
Die Bewahrung dieses UNESCO Weltnaturerbes<br />
ist auch Teil ihres Auftrages. Nur<br />
so ist zu verhindern, dass der Lebensraum<br />
der letzten <strong>Gorilla</strong>s zerstört und den Menschen<br />
vor Ort ihr einzig wahres Kapital für<br />
die Zukunft zunichte gemacht wird.<br />
Rund 1.700 Arbeiter sind zurzeit damit<br />
beschäftigt, durch den Bau einer Mauer<br />
die Grenzmarkierung des Nationalparks<br />
deutlich zu machen. Zudem verhindert die<br />
Mauer, dass Vieh in den Park getrieben<br />
wird, und dass Elefanten den Park verlassen<br />
und Felder verwüsten. Fotos: R. Muir<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
aus den Projekten<br />
11
Foto: A & M Shah Schwerpunkt<br />
Dem frischen Grün<br />
12 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong>
Versuchen Sie einmal, sich 1,2<br />
Millionen Gnus vorzustellen. Und<br />
dazu noch rund 300.000 Zebras,<br />
Garzellen und und und. Eine unvorstellbare<br />
Zahl? Das sind Tiere so weit das Auge reicht<br />
- und noch sehr viel weiter. Die jährliche<br />
Wanderung dieser gigantischen blöckenden,<br />
muhenden und wiehernden Herden<br />
durch die Serengeti ist eines der letzten<br />
großen Wunder unserer Erde. Und es ist eines<br />
der Hauptkriterien für den Schutz des<br />
Parkes, aber auch dafür, dass kontinuierlich<br />
neue Zonen um den eigentlichen Nationalpark<br />
herum einen gewissen Schutzstatus<br />
bekommen haben.<br />
Tiere wie etwa Berggorillas, die in einem<br />
bestimmten Areal leben, zu schützen und<br />
ihren Lebensraum zu erhalten, ist schwierig<br />
genug. Doch wie soll man Tiere schützen,<br />
die große Strecken zurücklegen und dabei<br />
durch ungeschützte Gebiete wandern? Voraussetzung<br />
für Schutzkonzepte, die wandernde<br />
Arten bzw. ihre Gebiete betreffen,<br />
ist das Wissen um die Wanderwege. Darüber<br />
hinaus geben erst langjährige Beobachtungen<br />
Aufschluss darüber, ob und wie sich<br />
solche Wanderwege verändern bzw. von äußeren<br />
Faktoren beeinflusst werden.<br />
Die ersten, die sich die Frage nach der<br />
Größe und den Routen der wandernden Tierherden<br />
der Serengeti stellten, waren Bernhard<br />
und Michael Grzimek in den 1950er<br />
Jahren. Sie experimentierten mit Zebras,<br />
die sie versuchten, Gelb einzufärben, um<br />
sie in der Herde wiedererkennen zu können.<br />
Später legten sie ihnen farbige Halsbänder<br />
an - gewissermaßen die Vorläufer der<br />
heutigen Sendehalsbänder. Die Grzimeks<br />
hatten damals begonnen, mit ihrem Flugzeug<br />
die Serengeti streifenweise abzuflie-<br />
überhaupt im Dezember die gleichen Zebras<br />
im Nationalpark wie im Juni? Wir sind<br />
dabei Mittel zu finden, um einzelne Zebras<br />
und ganze Herden wiederzuerkennen. Das<br />
ist gar nicht so einfach“, schrieb Bernhard<br />
Grzimek 1959.<br />
Jahrein, jahraus die gleiche Route?<br />
Heute stehen den Wissenschaftlern mit<br />
computer- und satellitengestützter Technik<br />
zahlreiche Methoden zur Verfügung, diese<br />
Fragen präzise zu beantworten. Doch all die<br />
technischen Errungenschaften dürfen nicht<br />
darüber hinwegtäuschen, dass auch heute<br />
noch jede Menge schweißtreibender Feldarbeit<br />
notwendig ist, um all die Daten zu gewinnen,<br />
die letztendlich die Grundlage für<br />
Karten mit Wanderrouten liefern.<br />
Simon Thirgood und Grant Hopcraft aus dem<br />
<strong>ZGF</strong> Büro in der Serengeti wollten herausfinden,<br />
wann, wie oft und wie lange die wandernden<br />
Gnuherden außerhalb der Grenzen<br />
des Nationalparkes stehen. Zusammen mit<br />
kanadischen Wissenschaftlern und Mitarbeitern<br />
von Tanzania National Parks haben<br />
sie die Ergebnisse ihrer Untersuchung vor<br />
Kurzem im Fachmagazin „Animal Conservation“<br />
veröffentlicht. „Wir wollten wissen,<br />
wie gut die wandernden Herden in dem aktuellen<br />
Netzwerk von Schutzgebieten denn<br />
nun eigentlich wirklich geschützt sind“, erläutert<br />
Simon Thirgood das Ziel der Studie.<br />
Nachdem die letzten Wasserlöcher von<br />
den Kurzgras-Steppen im Süden des Serengeti<br />
Ökosystems verschwunden sind,<br />
ziehen die Tiere Richtung Norden, um dort<br />
während der langen Trockenzeit Futter und<br />
Wasser zu finden. Gegen Ende der Trockenzeit<br />
ziehen sie erneut in den Süden, um<br />
stets entgegen<br />
Wohin wandern die riesigen Herden aus Gnus und Zebras<br />
in der Serengeti im Lauf des Jahres ? Von Christine Mentzel.<br />
gen und die großen Herden zu zählen. Doch<br />
ihnen war klar, dass sie stets Momentaufnahmen<br />
hatten, und nicht wussten, welche<br />
Tiere sich wie im Raum bewegten. „Weiden<br />
dort ihre Jungen zur Welt zu bringen und<br />
das nahrhafte kurze Gras zu genießen. „Wir<br />
wollten herausfinden, wie lange sich die<br />
Tiere außerhalb der geschützten Gebiete<br />
Tansania<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Schwerpunkt<br />
13
Schwerpunkt<br />
Grant Hopcraft legt einem Gnu das Sendehalsband<br />
an. Die Halsbänder wiegen etwa 1,6 Kilo und<br />
speichern im optimalen Fall über zehn Monate<br />
viermal täglich Positionsdaten.<br />
14 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
aufhalten, und ob es daher notwendig ist,<br />
weitere Gebiete unter Schutz zu stellen”,<br />
sagt Simon Thirgood.<br />
Das Serengeti Ökosystem wird im wesentlichen<br />
von drei Schutzzonen abgedeckt:<br />
dem Serengeti Nationalpark, der<br />
Ngorongoro Conservation Area und des<br />
Masai Mara National Reserve. Alle drei lassen<br />
lediglich Foto-Tourismus zu. Um diese<br />
Kernzone herum gliedern sich Gebiete mit<br />
unterschiedlichem Schutzstatus an, von<br />
den so genannten Game Reserves, die neben<br />
Foto-Tourismus auch Jagd zulassen, bis<br />
hin zu den Game Controlled Areas, wo Tourismus<br />
und Jagd gestattet sind und zudem<br />
Besiedlung sowie Vieh- und Landwirtschaft<br />
stattfindet. So weit, so gut, aber wissen die<br />
Gnus, wo es lang geht? Halten sie<br />
sich an geschützte Gebiete?<br />
Positionsbestimmung<br />
per Satellit<br />
Mithilfe der Tierärzte des Nationalparks<br />
wählten die Wissenschaftler<br />
in den weiten Ebenen<br />
acht Gnus aus, die für einige<br />
Monate ein GPS-Sendehalsband<br />
(GPS: Global Positioning System)<br />
tragen sollten. Um den Tieren das<br />
Halsband anzulegen, müssen sie<br />
mit dem Betäubungsgewehr kurzfristig<br />
in Narkose gelegt werden.<br />
„Ist der Sender befestigt, bekommt<br />
das Tier ein Gegenmittel<br />
und ist innerhalb weniger Minuten<br />
in der Menge verschwunden“,<br />
erläutert der zuständige Veterinär<br />
Dr. Titus Mlengeya. Genau wie<br />
die heutigen Navigationssysteme<br />
im Auto bekommt das GPS-Halsband<br />
seine Position ständig über verschiedene<br />
Satelliten mitgeteilt. Jedes Halsband<br />
speichert in definierten Zeitabständen (in<br />
unserem Fall einmal alle sechs Stunden)<br />
seine genaue Position - und damit die des<br />
Tieres. Viermal am Tag wird also der Standort<br />
in Längen- und Breitenangaben vermerkt.<br />
Wie jedoch kommen die Forscher<br />
an die wertvollen Daten im Halsband eines<br />
Gnus irgendwo in den Weiten der Serengeti<br />
wieder ran?<br />
Wie schon zu Grzimeks Zeiten kommt an<br />
dieser Stelle das <strong>ZGF</strong>-Flugzeug zum Ein-<br />
satz. Heute muss jedoch niemand mehr<br />
nach gelb gefärbten Tieren Ausschau halten.<br />
Vielmehr sitzt Grant Hopcraft bei Markus<br />
Borner in der Cessna und versucht,<br />
seine Tiere akustisch zu orten. Die Halsbänder<br />
senden ein UKW Signal aus, das Grant<br />
mithilfe der am Flugzeug befestigten Antennen<br />
empfangen kann. So wissen die beiden<br />
nach einigen Runden über ein infrage<br />
kommendes Gebiet, wo ihre Tiere stehen.<br />
Um die Daten auszulesen, ist keine Landung<br />
notwendig. Die Werte können während des<br />
Überflugs direkt auf einen tragbaren Computer<br />
an Bord übertragen werden. Einmal<br />
pro Monat müssen die beiden in die Luft<br />
aufsteigen und die Daten der Gnuhalsbänder<br />
abrufen.<br />
Kaum gelandet, schon sitzt Grant Hopcraft<br />
hinter seinem Rechner, um die Daten<br />
in eine so genannte GIS-Datenbank einzugeben.<br />
GIS bedeutet „Geografisches Informationssystem“,<br />
und dahinter verbirgt sich<br />
ein komplexes System, in das viele verschiedene<br />
Daten über ein Gebiet, wie z.B.<br />
Vegetation, Tierbestände, Bebauung oder<br />
Wasser eingegeben werden können, um<br />
sie später selektiv wieder darzustellen. All<br />
diese Daten sind die Grundlage für die Erstellung<br />
von Karten, in unserem Falle Karten<br />
von den Wanderrouten der Gnus im Serengeti<br />
Ökosystem. „Diese Karten für die Diskussion<br />
um den Schutz der Gnu-Wanderung<br />
sind das Resultat vieler Arbeitsstunden in der<br />
Luft und am Computer“, sagt Hopcraft.<br />
Und was haben die Gnus mit den Sendern<br />
den Wissenschaftlern nun Neues verraten?<br />
„Wir wissen jetzt,“ sagt Simon Thirgood,<br />
„dass sich die Tiere 90 Prozent ihrer Zeit in<br />
den gut geschützten Gebieten des Serengeti<br />
Nationalparks, des Masai Mara National<br />
Reserve und des Ngorongoro Schutzgebietes<br />
aufhalten. Aber viel wichtiger für uns ist<br />
die Erkenntnis, dass sie immerhin zehn Prozent<br />
des Jahres außerhalb dieser Schutzgebiete<br />
verbringen. Zudem ist es bedenklich,<br />
dass die Tiere rund ein Drittel des Jahres<br />
innerhalb eines 10 km-Radius von weniger<br />
oder gar nicht geschützten Gebieten stehen,<br />
hauptsächlich im Westen der Serengeti und<br />
im Norden des Masai Mara National Reserve.“<br />
Und dort kommt es zwangsläufig<br />
zu Konflikten mit den dort lebenden Menschen,<br />
direkt in Form von Wilderei oder indirekt<br />
bei der Landwirtschaft.
Die Bevölkerung an der westlichen Grenze<br />
des Nationalparks wächst zurzeit um fünf<br />
Prozent pro Jahr. „Im Moment scheint die<br />
Anzahl gewilderter Tiere noch verträglich<br />
zu sein“, so Thirgood „aber in den nächsten<br />
Jahren wird sich diese Zahl verdoppeln,<br />
da Wilderei eng mit Bevölkerungswachstum<br />
gekoppelt ist. Dann wird es kritisch für die<br />
Wildtier-Populationen.“ Nördlich des Masai<br />
Mara National Reserve bedroht Landwirtschaft<br />
die Tierwanderung. Bestellte Felder<br />
können die Route als Barriere blockieren<br />
bzw. die zur Verfügung stehenden Grasflächen<br />
werden schlichtweg zu klein. Eine<br />
kleinere Wanderung der Mara Gnus in diesem<br />
Gebiet ist in den letzten Jahren bereits<br />
um 75 Prozent dezimiert worden. Landwirtschaft<br />
scheint die Hauptursache hierfür zu<br />
sein. Deshalb wird es immer wichtiger, alle<br />
Gebiete auf der Wanderroute der Gnus zu<br />
schützen, um somit das Überleben der Tiere<br />
und der großen Migration zu sichern.<br />
Die Einrichtung von Wildlife Management<br />
Areas (WMAs), an der die <strong>ZGF</strong> bereits seit<br />
einigen Jahren arbeitet, wird die Lage für die<br />
wandernend Gnus sicherlich entschärfen.<br />
Ziel der WMAs ist es, der lokalen Bevölkerung<br />
die Möglichkeit zu geben, die Ressourcen<br />
auf ihrem eigenen Land zu schützen<br />
und zu nutzen – einschließlich eines kontrollierten<br />
Abschusses von Gnus. „Solche<br />
WMAs sind auch in der Ikoma Region geplant,<br />
die sich in unserer Studie als besonders<br />
kritisch im Hinblick auf die Wanderung<br />
herausgestellt hat,“ sagt Thirgood, „und wir<br />
hoffen, dass der Umschwung von unkontrollierter<br />
Wilderei zu nachhaltiger Nutzung<br />
der Tiere die Schutzzone effektiv vergrößert,<br />
um letztlich die gesamte Wanderungsroute<br />
der Gnus in Tanzania abzudecken.”<br />
Christine Mentzel ist Biologin. Sie hat in<br />
Südafrika studiert und arbeitet als Wissenschaftlerin<br />
in der Serengeti.<br />
Januar /<br />
Februar März / April Mai / Juni<br />
Juli /<br />
August<br />
1<br />
2<br />
September /<br />
Oktober<br />
Die Datenpunkte der markierten Gnus<br />
zeigen die Wanderung über das Jahr. Einen<br />
Großteil der Zeit verbringen sie im Serengeti<br />
Nationalpark (1) und im Ngorongoro<br />
Schutzgebiet (2).<br />
Grafik nach: S. Thirgood, A. Mosser, S.<br />
Tham, G. Hopcraft, E. Mwangomo, T.<br />
Mlengeya, M. Kilewo, J. Fryxell, A.R.E.<br />
Sinclair & M. Borner; <strong>2004</strong>: Can parks<br />
protect migratory ungulates? The case of<br />
the Serengeti wildebeest. Animal Conservation<br />
7; 113 – 120.<br />
November /<br />
Dezember<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Schwerpunkt<br />
15
Schwerpunkt<br />
Elefanten auf elf Uhr<br />
Die Zählung der großen Tierbestände<br />
gehört zum festen Repertoir der Aufgaben<br />
von Dr. Markus Borner (links), dem Leiter<br />
des Afrika Referats der <strong>ZGF</strong>. Mit seiner<br />
Cessna fliegt er die Beobachter, die zum<br />
Zählen rechts und links aus dem Fenster<br />
schauen müssen, stundenlang im Zickzack<br />
über die Ebenen der Serengeti.<br />
Foto: B. Siering<br />
16 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Seit Jahrzehnten versorgt die <strong>ZGF</strong> den Serengeti Nationalpark mit Daten zu<br />
seinen Großtierbeständen. Gezählt wird dabei größtenteils aus der Luft. Paquita<br />
Hoeck erläutert die verschiedenen Methoden des Monitorings per Flugzeug.<br />
Der Pilot kontrolliert peinlichst genau<br />
den Kurs und die aktuelle Flughöhe<br />
über Boden auf dem Radarhöhenmeser.<br />
Es ist eng in dem viersitzigen<br />
Kleinflugzeug von Markus Borner, dem erfahrensten<br />
Piloten der <strong>ZGF</strong>. Vier Leute arbeiten<br />
seit Stunden unter höchster Konzentration:<br />
Zeit messen, Tiere suchen, fotografieren,<br />
aufschreiben - und bloß nicht den Blick von<br />
den imaginären Landstreifen zu beiden Seiten<br />
des Flugzeugs abwenden! Der Teamgeist<br />
stimmt, die Tierzählung verspricht spannende<br />
Resultate. Aber nach einer Weile werden die<br />
Augen trocken und die Blase drückt.<br />
Tiere zählen? Wozu? Manche mögen ein<br />
solches Unterfangen als sinnlos betrachten,<br />
aber Tierzählungen und –überwachungen,<br />
kurz Monitoring genannt, sind heute<br />
aus Forschung und Naturschutz nicht mehr<br />
wegzudenken. Monitoring liefert generell<br />
wichtige Einblicke in die Entwicklung von<br />
Tier- und Pflanzenvorkommen oder sogar<br />
ganzer Ökosysteme, wie z.B. der Serengeti<br />
in Tansania. Für ein sinnvolles Management<br />
und den Schutz des Nationalparks sind solche<br />
Erkenntnisse von großer Wichtigkeit.<br />
Sie liefern Einblicke in die Struktur und das<br />
Funktionieren des Ökosystems und lassen<br />
Veränderungen erkennen – eine wichtige<br />
Voraussetzung für die langfristige Erhaltung<br />
des Gebietes.<br />
Wissenschaftler verwenden unterschiedliche<br />
Methoden der Tierzählung: Populationsgrößen<br />
können geschätzt oder effektiv<br />
bestimmt werden. Natürlich spielen bei der<br />
Wahl der Zählmethode Faktoren wie Habi-<br />
tat, Lebensweise und Körpergröße der Art<br />
eine entscheidende Rolle. Die Riesenotter<br />
in Peru können individuell bestimmt und<br />
gezählt werden, bei Hunderttausenden von<br />
Gnus aber ist dies wenig sinnvoll.<br />
Lange bevor sich der Begriff des Monitorings<br />
etablierte, haben Bernhard und Michael<br />
Grzimek eine entsprechende Technik<br />
in der Serengeti entwickelt und begonnen<br />
die Bestände großer Wildtiere zu erfassen.<br />
Die beiden überflogen in zuvor festgelegten<br />
Linien - sogenannten Transekten - die großen<br />
Ebenen und zählten die Tiere links und<br />
rechts des Flugzeugs. Ihre Arbeit, die eindrucksvoll<br />
den Tierreichtum der ostafrikanischen<br />
Steppengebiete dokumentierte, war<br />
der Grundstein für den Aufbau von Großschutzgebieten<br />
in Tansania. Diese Methode<br />
ist noch heute in den Grundzügen erhalten,<br />
wenn auch der technische Fortschritt einige<br />
wichtige Verbesserungen ermöglichte.<br />
Bei niedriger Flughöhe werden die Gebiete<br />
in einem Kleinflugzeug abgeflogen.<br />
Um für die Zählmannschaft ein gleich großes<br />
Blickfeld zu gewährleisten, ist es wichtig,<br />
stets die gleiche Höhe über dem Boden<br />
einzuhalten. Während zu Grzimeks Zeiten<br />
die Orientierung anhand grober Karten<br />
und persönlicher Geländekenntnis erfolgen<br />
musste, erleichtern heute Radar und<br />
Satellitennavigation (GPS) die Arbeit. Die<br />
GPS-Geräte empfangen Signale von verschiedenen<br />
Satelliten und errechnen daraus<br />
ihre Position in Längen- und Breitengrade<br />
- metergenau. Doch trotz modernster Technik<br />
sind Tierzählungen aus dem Flugzeug
eine komplizierte und zeitaufwändige Angelegenheit.<br />
Manchmal sind die Gebiete, die<br />
untersucht werden sollen einfach zu groß,<br />
um sie systematisch abfliegen zu können<br />
oder eine Tierart tritt in so großen Herden<br />
auf, dass es utopisch wäre, alle Tiere einzeln<br />
erfassen zu wollen. Dem muss das Zählsystem<br />
Rechnung tragen.<br />
Elefanten und Büffel sind große, in Herden<br />
lebende Tiere und damit relativ einfach<br />
zu sehen. Für die Bestimmung ihrer Populationsgrößen<br />
ist die Totalzählung die Methode<br />
der Wahl, d.h. alle Individuen werden<br />
gezählt. Mit dem Flugzeug wird das Gebiet<br />
abgesucht, und sobald die Beobachter ein<br />
Einzeltier oder eine Gruppe sichten, werden<br />
die Koordinaten vom GPS abgelesen und<br />
ein Foto der Tiergruppe geschossen. Anhand<br />
der Fotos können einzelne Individuen<br />
später exakt ausgezählt werden.<br />
Um hingegen einen Eindruck der breit gestreuten<br />
Gazellen- und Antilopenbestände<br />
in der Serengeti zu erlangen, werden nicht<br />
alle Tiere des gesamten Gebietes gezählt.<br />
Der Pilot fliegt parallele Transekte über das<br />
Gebiet, wobei beidseits des Flugzeugs definierte<br />
Streifen von 150 Metern Breite nach<br />
Tieren abgesucht werden. Die darin vorkommenden<br />
Individuen werden bestimmt<br />
und das Resultat wird später auf die Gesamtfläche<br />
hochgerechnet. Der Gesamtbestand<br />
wird also geschätzt. Diese Methode<br />
wird unter Fachleuten als systematischer<br />
Erkundungsflug (SRF, Systematic Reconnaissance<br />
Flight) bezeichnet. Werden dabei<br />
die entsprechenden Voraussetzungen<br />
eingehalten und wird mathematisch exakt<br />
gearbeitet, dann kann eine solche Hochrechnung<br />
ein gutes Ergebnis liefern.<br />
Eine besondere Herausforderung stellt<br />
die Zählung der Gnus in der Serengeti dar.<br />
Die Herden sind zu groß, um in ihrer Gesamtheit<br />
exakt gezählt oder auch nur fotografiert<br />
bzw. gefilmt zu werden. Stattdessen<br />
nutzt man die Fotografie und die Videokamera,<br />
um Teile einer Herde stichprobenartig<br />
zu erfassen. Wenn sich die Gnus in der Regenzeit<br />
in riesigen Herden im südlichen Teil<br />
der Serengeti aufhalten, wird das Gelände<br />
systematisch in Streifen über den Herden<br />
abgeflogen und eine am Flugzeugboden<br />
montierte digitale Videokamera macht in<br />
regelmäßigen Abständen jeweils ein Bild<br />
(sog. Aerial Point Sampling APS). Mit Hilfe<br />
der gleichzeitig registrierten Flughöhe kann<br />
für jedes Foto die Größe des abgelichteten<br />
Gebietes bestimmt werden. Zudem können<br />
die Daten des GPS direkt ins Bild eingespeist<br />
werden. Später wird die Kamera an<br />
den Computer angeschlossen und mit einer<br />
speziellen Standbildfunktion holen<br />
sich die Wissenschaftler die<br />
Tierherden auf den Bildschirm.<br />
Doch ganz ohne „Handarbeit“<br />
geht es dann doch nicht: Ausgezählt<br />
werden die Tiere letztendlich<br />
per Hand - am Bildschirm,<br />
auf dem Ausdruck oder an einem<br />
projizierten Dia. Der Computer<br />
ist schlicht zu „dumm“, um<br />
zwischen verschiedenen Tierarten,<br />
Vegetation, Schatten oder<br />
hintereinander stehenden Tieren<br />
zu unterscheiden. Aus der Anzahl<br />
der Tiere auf dem Bild wird<br />
die Dichte ihres Vorkommens errechnet<br />
und dann ihre Gesamtzahl<br />
hochgerechnet.<br />
In Arusha im tansanischen<br />
Naturschutz-Forschungszentrum<br />
TAWIRI (Tan zania Wildlife Research<br />
Institute) laufen wichtige<br />
Daten und Ergebnisse, wie die<br />
aus den Flugzählungen, zusammen.<br />
TAWIRI unterhält die so<br />
genannte Conservation Information<br />
Monitoring Unit (CIMU), ein<br />
von der <strong>ZGF</strong> unterstütztes Programm,<br />
das Informationen über<br />
Wildtierbestände und Entwicklungstendenzen<br />
in den tansanischen<br />
Schutzgebieten sammelt<br />
und auswertet. Wie viele Individuen<br />
einer Art gibt es überhaupt<br />
in der Serengeti? Wie haben sich<br />
die Bestände in den letzten Jahren<br />
entwickelt? Gab es Einbrüche<br />
in den Populationen, Epidemien<br />
gar? Solche Fragen versucht das<br />
CIMU zu beantworten und die<br />
Resultate den Entscheidungsträgern,<br />
vom Parkchef bis zum<br />
Minister, zu präsentieren. So<br />
werden wichtige Informationen<br />
zugänglich gemacht, die letztendlich<br />
die Basis für sinnvollen<br />
und langfristigen Naturschutz<br />
darstellen.<br />
Totalzählung<br />
Solitär oder in Gruppen lebende Tiere wie<br />
Elefanten werden fotografiert und jedes<br />
einzelne Tier gezählt.<br />
Systematischer Erkundungsflug SFR<br />
Antilopenbestände werden in 150 Meter<br />
breiten Streifen rechts und links der Flugbahn<br />
erfasst und später hochgerechnet.<br />
Aerial Point Sampling<br />
Die riesigen Gnuherden werden digital<br />
fotografiert, die Bilder später am Computer<br />
ausgezählt und der Bestand hochgerechnet.<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Schwerpunkt<br />
17
Schwerpunkt<br />
Jeder Riesenotter hat sein individuelles weißes<br />
Fleckenmuster auf der Kehle. Die Beobachter<br />
verfügen über eine Datenbank mit den Mustern<br />
der Otter eines Gebietes - aufgebaut in jahrelanger<br />
mühsamer Feldarbeit. So können sie „ihre“ Otter<br />
wiedererkennen.<br />
Im Feldprotokoll<br />
rechts vermerken<br />
sie, welchen<br />
Otter sie wann<br />
wo gesehen<br />
haben.<br />
18 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Zeigt her eure Kehlen<br />
Seit Anfang der 90er Jahre beobachten <strong>ZGF</strong> Mitarbeiter immer wieder die Riesenotter<br />
in Peru und vermerken das Wohlergehen einzelner Tiere und ihrer Familien.<br />
Erst über längere Zeiträume vorliegenden Daten erlauben Rückschlüsse über die<br />
Entwicklung der Populationen. Von Raphael Notin.<br />
Als Jessica Groenendijk und Frank Hajek,<br />
die beiden <strong>ZGF</strong> Projektleiter des<br />
Riesenotter-Schutzprojektes in Peru<br />
mich fragten, ob ich die Otterzählung im<br />
unteren Bereich des Flusses Heath übernehmen<br />
könnte, war mir klar, dass dies<br />
eine spannende Aufgabe werden würde. Bis<br />
dahin hatte sich meine Arbeit mehr auf die<br />
touristisch genutzten Gebiete im Tambopata<br />
Reservat konzentriert. Der Heath River<br />
verläuft zwischen dem peruanischen Bahuaja-Sonene<br />
Nationalpark und dem Madidi<br />
Nationalpark in Bolivien. Er ist nicht<br />
nur die Grenze zwischen zwei Staaten. Dieser<br />
Fluss, der sich da so träge durch vier<br />
Millionen Hektar geschützten Regenwald<br />
schlängelt, ist auch der Zugang zu einem<br />
endlosen Dschungel und zu unzähligen Altarmen.<br />
Dieses Gebiet, so hoffte ich, würde<br />
sicherlich ein wahres Paradies für Riesenotter<br />
sein, die man hier übrigens „Lobo<br />
del Rio“ (Flusswölfe) nennt.<br />
Die organisatorischen Vorbereitungen<br />
brauchten, wie immer, ihre<br />
Zeit. Da wir wussten, wie bedeutsam<br />
die binationale Zusammenarbeit<br />
zwischen den beiden<br />
Schutzgebieten ist, besorgten<br />
wir uns die notwendigen<br />
Genehmigungen von<br />
der zuständigen Naturschutzbehörde<br />
(IN-<br />
RENA) in Peru und<br />
dem Nationalpark<br />
Service in Bolivien<br />
(SERNAP).<br />
Freundlicherweise übernahm die Wildlife<br />
Conservation <strong>Society</strong> in Bolivien den ganzen<br />
Papierkrieg für uns. So konnten wir uns<br />
auf unsere Aufgabe konzentrieren und starteten<br />
Ende Juli letzten Jahres voller Aufregung<br />
und mit hohen Erwartungen auf die<br />
einmonatige Expedition in den Dschungel.<br />
Mit zu dieser aufregenden Atmosphäre beigetragen<br />
hat sicherlich auch die Tatsache,<br />
dass wir wussten, wir wandern auf den Spuren<br />
– oder vielmehr Wellen – von Christof<br />
Schenck, der vor elf Jahren in diesem Gebiet<br />
am Heath Fluss gearbeitet und geforscht<br />
hatte. Wir hofften, wir würden vergleichbare<br />
Daten gewinnen und so viele Otter bzw. Otterfamilien<br />
wie möglich identifizieren<br />
können. Auch von<br />
ihren Territorien<br />
wollten
wir einen Eindruck erhalten. Um all diese<br />
Daten zu gewinnen, und sie mit den Daten<br />
von vor vielen Jahren vergleichen zu können,<br />
hielten wir uns an die internationale<br />
Standardzählmethode für Otter, wie sie Jessica<br />
Groenendijk gerade publiziert hat.<br />
Die Expedition zu den Riesenottern fand<br />
in der Trockenzeit statt, da wir hofften, auf<br />
diese Weise auch die Jungen, die im Laufe<br />
der ersten Jahreshälfte geboren worden waren,<br />
beobachten und filmen zu können. Unser<br />
Team war in diesem trockensten Monat<br />
des Jahres auf das beschränkt, was unser<br />
11-Meter Boot maximal laden konnte.<br />
Und das waren neben mir noch die Biologin<br />
Kimberly Failor, Dario Cruz, der am Heath<br />
Fluss lebt und Remberto Chihuapuri, ein<br />
Ranger des Madidi Nationalparks. Der Wasserstand<br />
des Flusses war dann auch extrem<br />
niedrig. Zusätzlich lagen unzählige Baumstämme<br />
im Wasser, was dazu führte, dass<br />
wir ständig ins Wasser mussten, um unser<br />
Boot zu ziehen, zu schieben oder gar teilweise<br />
zu entladen, um die Fahrt flussaufwärts<br />
fortsetzen zu können. Neben unserer<br />
eigentlichen Zählarbeit, bildeten Kimberly<br />
und ich noch Roberto aus, denn als verantwortlicher<br />
Parkranger sollte er gut Bescheid<br />
wissen über Biologie, Ökologie, Verhalten<br />
und Gefährdung der Riesenotter, ebenso<br />
wie über die Richtlinien zur korrekten Zählung<br />
der Tiere. Und unsere Mühen wurden<br />
schließlich belohnt: die Ergebnisse sollten<br />
besser werden als erwartet.<br />
Im Laufe der Untersuchung waren wir<br />
mit einem aufblasbaren Schlauchboot in<br />
37 Altarme und drei Nebenflüsse vorgedrungen.<br />
Wir zählten und filmten sieben<br />
Familiengruppen und einen einzeln lebenden<br />
Otter, alles in allem also 42 Individuen,<br />
zehn davon Jungtiere.<br />
Von diesen 42 Tieren konnten wir<br />
bei 34 die charakteristischen weißen<br />
Kehlmuster erkennen und dokumentieren.<br />
Anhand dieser Kehlflecken<br />
lassen sich die Individuen wie bei einem<br />
Fingerabdruck ganz eindeutig wiedererkennen.<br />
Im Durchschnitt bestanden<br />
die Gruppen aus sechs Tieren, die größte,<br />
die wir beobachten konnten, aus acht. Insgesamt<br />
konnten wir während der Expedition<br />
16 Stunden lang Otter beobachten und eine<br />
Stunde an Filmmaterial gewinnen. Bei drei<br />
der sieben Ottergruppen stellten wir fest,<br />
dass sie mehr als einen Altarm als ihr Territorium<br />
betrachteten. Dies mag daran liegen,<br />
dass hier am Heath Fluss die Altarme nur<br />
halb so weit vom Fluss entfernt sind, wie am<br />
Manu Fluss oder am Tambopata.<br />
Im Vergleich mit den Beobachtungsdaten,<br />
die Christof Schenck Anfang der 1990er<br />
Jahr hier gewinnen konnte, belegt unsere<br />
aktuelle Zählung eine größere Otterpopulation<br />
und gleichzeitig auch einen Rückgang<br />
in der Anwesenheit von Menschen im Gebiet.<br />
Auch war damals der Madidi Nationalpark<br />
in Bolivia noch nicht existent und<br />
wurde daher nicht in der Zählung<br />
mit eingeschlossen.<br />
Während der ganzen vier Wochen,<br />
die wir am Heath verbrachten,<br />
begegneten wir fünf Gruppen<br />
von Einheimischen (je zwischen<br />
drei und 25 Personen), die campierten<br />
und zum Fischen und<br />
Jagen unterwegs waren. Nicht immer<br />
werden dabei die Regeln des<br />
Schutzgebietes respektiert. Der<br />
untere Bereich unseres Untersuchungsgebietes<br />
wird zudem touristisch<br />
genutzt. Alles in allem ist<br />
die Nutzung des Flussgebietes zwar nicht<br />
sehr intensiv, eine Zonierung bzw. räumliche<br />
Regelung für Nutzung durch Menschen<br />
wäre jedoch ein bedeutender und wichtiger<br />
Schritt für den Schutz des Flusssytems.<br />
Aus der Anzahl von Riesenottern, die wir<br />
gesehen haben, können wir hochrechnen,<br />
dass die Population des Heath die größte<br />
innerhalb des Bahuaja-Sonene Nationalparks<br />
und des Tambopata Schutzgebietes<br />
in Peru sein dürfte. Daher ist es sowohl für<br />
den Schutz der Art, wie für die Forschung<br />
sehr wichtig, dass diese Zählung in naher<br />
Zukunft wiederholt wird. Außerdem befindet<br />
sich der Heath Fluss im Herzen des so genannten<br />
Vilcabamba Amboro Korridors, der<br />
sich entlang der Anden von Peru nach Bolivien<br />
erstreckt. Die positiven Ergebnisse<br />
unserer Untersuchung belegen, wie bedeutsam<br />
solche Schutzgebietskorridore<br />
sind und wie wichtig, die binationale Zusammenarbeit<br />
zwischen Peru und Bolivien<br />
für das Wohlergehen der Riesenotter ist.<br />
Raphael Notin arbeitet in Peru für das<br />
<strong>ZGF</strong> Riesen otterprojekt.<br />
Riesenotter leben in Altarmen von Flüssen im peruanischen<br />
und bolivianischen Regenwald.<br />
Peru<br />
Bolivien<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Schwerpunkt<br />
19
<strong>ZGF</strong> intern<br />
20 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Veranstaltungsort<br />
Alle Veranstaltungen finden statt<br />
im Ausstellungssaal des Zoo-<br />
Gesellschaftshauses Zoo <strong>Frankfurt</strong>,<br />
Alfred-Brehm-Platz 16, <strong>Frankfurt</strong>.<br />
Der Eintritt ist frei. Über eine Spende<br />
freuen wir uns.<br />
Mehr Informationen<br />
www.naturschutz-erleben.de<br />
Eva Barth, Tel.: 069 943446-17<br />
E-Mail: barth@zgf.de<br />
Die Veranstaltungsreihe wird präsentiert<br />
vom Projekt Globalen Naturschutz lokal<br />
erleben, einem Kooperationsprojekt der<br />
<strong>ZGF</strong> und des Zoo <strong>Frankfurt</strong>, gefördert<br />
durch die Deutsche Bundesstiftung<br />
Umwelt.<br />
Der Reichtum unserer Erde hat einen Namen: Biologische Vielfalt. Ohne die Millionen<br />
von Tier- und Pflanzenarten, die vielen kleinen Unterschiede innerhalb der<br />
Arten und die Fülle unterschiedlicher Lebensräume wäre die Erde ein unwirtlicher<br />
Ort. Eine Veranstaltungsreihe im <strong>Frankfurt</strong>er Zoo Gesellschaftshaus beleuchtet ab<br />
Mitte September Aspekte der bedrohten Mannigfaltigkeit unseres Planeten.<br />
Schätze unserer Erde<br />
Die biologische Vielfalt erhalten<br />
14. September <strong>2004</strong>, 18:30 Uhr<br />
Arche Noah Zoo? Aufgaben im<br />
Zeitalter des Artenschwundes<br />
Welchen Beitrag leisten Zoos für die Erhaltung<br />
der biologischen Vielfalt?<br />
Podiumsdiskussion mit: Prof. Dr. Manfred<br />
Niekisch (Universität Greifswald), Dr. Madeleine<br />
Martin (Landestier schutz beauftragte),<br />
Dr. Christian R. Schmidt (Zoo <strong>Frankfurt</strong>), Dr.<br />
Christof Schenck (<strong>ZGF</strong>)<br />
Moderation: Pia Zimmermann (HR)<br />
30. September <strong>2004</strong>, 18:30 Uhr<br />
Vernissage: Wandernde Tierarten -<br />
grenzenloser Schutz?<br />
Eröffnung der Ausstellung anlässlich des<br />
25-jährigen Jubiläums der Bonner Konvention<br />
zum Schutz wandernder Arten.<br />
Vortrag: Arnulf Müller-Helmbrecht (ehem.<br />
Geschäftsführer Bonner Konvention)<br />
9. Oktober <strong>2004</strong>, 17:30 Uhr<br />
Angstzination: Entkriminalisierung<br />
der Haie als Beitrag zum Haischutz<br />
Ein spannender Multimedia-Vortrag mit zum<br />
Teil erstmals gezeigten Bildern und Filmen<br />
Vortrag: Dr. Erich Ritter (Hai-Verhaltensforscher,<br />
Miami) und Gerhard Wegner (Präsident<br />
Sharkproject e.V., Offenbach)<br />
9. November <strong>2004</strong>, 18:30 Uhr<br />
Geheimnisse der Natur entdecken:<br />
Welche Chancen birgt die biologische<br />
Vielfalt?<br />
Über welche Erkenntnisse zur Vielfalt des<br />
Lebens die Forschung heut verfügt und<br />
wie diese genutzt werden, ist Thema des<br />
Abends.<br />
Vortrag: Prof. Dr. Wilhelm Barthlott (Universität<br />
Bonn) und Prof. Dr. Elisabeth Kalko<br />
(Universität Ulm)<br />
Grußwort: Prof. Dr. Fritz Steininger (Naturmuseum<br />
Senckenberg)<br />
14. Dezember <strong>2004</strong>, 18:30 Uhr<br />
Wissen, erleben, genießen: Chancen<br />
zur Erhaltung unserer Obstwiesen<br />
Die Streuobstwiesen vor den Toren <strong>Frankfurt</strong>s<br />
sind Kleinode der biologischen Vielfalt.<br />
Verkostet werden Apfelweinspezialitäten<br />
aus heimischen Streuostwiesen.<br />
Vortrag: Stefan Nawrath (Universität <strong>Frankfurt</strong>)<br />
und Gerhard Weinrich / Barbara Fiselius<br />
(Streuobstzentrum MainÄppelHaus)<br />
Verkostung: Jörg Stier (Keltermeister)<br />
11. Januar 2005, 18:30 Uhr<br />
Orang Utans: Die Heimkehr unserer<br />
haarigen Verwandten<br />
Im Gespräch mit Focus TV Redakteurin<br />
Stephanie Krüger berichtet Peter Pratje von<br />
seinem Arbeitsalltag in der <strong>ZGF</strong> Orang Utan<br />
Station auf Sumatra.<br />
Ein Erlebnisbericht mit Bildern und Filmen:<br />
Dr. Peter Pratje (<strong>ZGF</strong>-Projektleiter) und<br />
Stephanie Krüger (Focus TV)<br />
Dienstag, 8. Februar 2005, 18:30<br />
<strong>Frankfurt</strong> für den Dschungel<br />
- Initiativen im Regenwaldschutz<br />
In <strong>Frankfurt</strong> arbeiten zahlreiche Organisationen<br />
aktiv für die Erhaltung der artenreichsten<br />
Gebiete unserer Erde.<br />
Diskussion mit: Monika Anton (Tropica<br />
Verde), Dr. Andreas Kress (Klimabündnis),<br />
Dr. Rolf Mack (GTZ), Antje Müllner (<strong>ZGF</strong>),<br />
Dr. Christof Schenck (<strong>ZGF</strong>), Dr. Peter Prokosch<br />
(WWF Deutschland), Dr. Volkhard<br />
Wille (Oro Verde)<br />
Moderation: Prof. Dr. Manfred Niekisch<br />
(Universität Greifswald)
Fernseh Tipp:<br />
Nashorns Weg nach Afrika<br />
Hama kurz vor ihrem Abflug im Mai<br />
Eineinhalb Jahre hat ein Team des Bayerischen<br />
Fernsehens den großen Nashorn<br />
Ringtausch der <strong>ZGF</strong> zwischen <strong>Frankfurt</strong>,<br />
Südafrika und Sambia begleitet. Die Kamera<br />
war stets dabei wenn Nashörner mit<br />
großem Aufwand in Flugzeuge verfrachtet<br />
wurden oder erstmals die Luft ihrer neuen<br />
Heimat schnuppern durften. Am 1. Oktober<br />
(19 Uhr) zeigt ARTE das Abenteuer in einer<br />
45-minütigen Dokumentation.<br />
DVD Tipp:<br />
Zwei Grzimek Klassiker digital<br />
Darauf haben wir gewartet: Grzimeks<br />
Klassiker „Serengeti darf nicht sterben“<br />
und „Kein Platz für wilde Tiere“ auf DVD.<br />
Bislang musste die <strong>ZGF</strong> die regelmäßigen<br />
Anfragen, ob man wisse, wo man denn die<br />
Filme noch kaufen könnte, beantworten mit<br />
„Die gibt‘s nicht mehr“. Außer ein paar vereinzelten<br />
gebrauchte Exemplaren, die gelegentlich<br />
bei E-Bay zu ergattern waren, gab<br />
es die Video kassetten seit ein paar Jahren<br />
nicht mehr zu kaufen. Seit Ende August<br />
kommen alle, die bisher leer ausgegangen<br />
sind jedoch auf ihre Kosten.<br />
Die neue DVD präsentiert die alten Filme<br />
in digitaler Qualität, garniert mit ein paar zusätzlichen<br />
Tierbildern und Bildern der bei-<br />
Autor Christian Herrmann und<br />
sein Fernsehteam haben im Mai<br />
selbstverständlich das <strong>Frankfurt</strong>er<br />
Nas horn Hama nach Südafrika begleitet<br />
und sich dort auch gleich<br />
auf die Suche nach Hamas älterer<br />
Schwester gemacht, die mittlerweile<br />
mit ihrem ersten Nachwuchs<br />
durch den Busch zieht. Bereits im<br />
Frühjahr 2003 waren die bayerischen<br />
Kameras bei der Ankunft<br />
der ersten Nashörner zur Wiederansiedlung<br />
in Sambia dabei gewesen.<br />
Gut ein Jahr später reiste das<br />
Team erneut in das ostafrikanische<br />
Land, um im North Luangwa Nationalpark zu<br />
sehen, was aus den fünf Neuankömmlingen<br />
mittlerweile geworden ist.<br />
Neben ARTE ist auch bei Spiegel TV auf<br />
Vox ein Beitrag über Hamas Abflug vom Zoo<br />
<strong>Frankfurt</strong> zu sehen. In Insa Müllers Reportage<br />
über Luftfracht spielt das <strong>Frankfurt</strong>er<br />
Nashorn eine wahrlich gewichtige Rolle.<br />
den Grzimeks, die man so bisher vielleicht<br />
noch nicht kennt. Das beste an der DVD<br />
ist jedoch, dass beide Filme auch in englischer<br />
Sprache gespielt werden können.<br />
Das wird viele der afrikanischen Grzimek<br />
Fans begeistern, die uns immer wieder<br />
bei der verzweifelten Suche nach einer<br />
Kopie per E-Mail um Hilfe gebeten<br />
hatten. Zu bekommen ist die DVD bei<br />
Amazon, sie kostet 14,99 Euro.<br />
Prof. Dr. Bernhard Grzimek<br />
Serengeti darf nicht sterben &<br />
Kein Platz für wilde Tiere<br />
Universal Family Entertainment, <strong>2004</strong><br />
ISBN: 3-89945-721-8<br />
Laufzeit: 170 Minuten<br />
Vox: Spiegel TV Extra<br />
mit einer Reportage über Hamas Abflug<br />
30. September <strong>2004</strong>, 22.05 Uhr<br />
ARTE: Wenn Nashörner fliegen<br />
eine Dokumentation von C. Herrmann<br />
1. Oktober <strong>2004</strong>, 19.00 Uhr<br />
Neue auf DVD, die beiden Klassiker des<br />
Tierfilms von 1959<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
!<br />
<strong>ZGF</strong> intern<br />
21
<strong>ZGF</strong> intern<br />
22 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Zum Verwechseln ähnlich. Diese Dornier<br />
27 entspricht dem Orginal in der<br />
Lackierung und vielen Details. Ab Ende<br />
September wird ist sie im Zoo <strong>Frankfurt</strong><br />
zuhause sein.<br />
Herbstexkursion für <strong>ZGF</strong> Mitglieder<br />
Das Projekt RHÖN IM FLUSS bietet eine eintägige Herbstexkursion in die Rhön an<br />
Eine Tagestour durch die schöne herbstliche<br />
Rhön bietet das Projektbüro RHÖN<br />
IM FLUSS für Mitglieder der <strong>ZGF</strong> am Freitag<br />
den 15. Oktober <strong>2004</strong> an. Das Programm<br />
beginnt schon früh am Morgen mit einer<br />
Birkhuhnbeobachtung, weshalb sich<br />
die Anreise am vorherigen Tag und Übernachtung<br />
im Gasthof Krone in Ehrenberg-<br />
Seiferts anbietet. Anschließend werden mit<br />
einer Waldwanderung und einer Wanderung<br />
durch das obere Ulstertal verschiedene Aspekte<br />
des Projektes besichtigt, jeweils geführt<br />
durch Projektmitarbeiter vor Ort.<br />
Die Anreise zur Wasserkuppe erfolgt in Eigenregie,<br />
ab da geht es gemeinsam mit<br />
dem Bus weiter. Nähere Informationen und<br />
Anmeldung bei: Matthias Metzger<br />
Telefon 0175 - 415 1616<br />
E-Mail: metzger@rhoen im fluss.de<br />
Rhön Exkursion, 15. Okt. <strong>2004</strong><br />
6.30 Uhr Treffen Wasserkuppe<br />
Begrüßung und Weiterfahrt mit Bus<br />
7.15 Uhr Birkhuhnbeobachtung<br />
9.00 Uhr Frühstück Gasthof Krone<br />
10.15 Uhr Treffen Wasserkuppe<br />
Einführung ins Projekt, Multivisionsschau,<br />
Einkaufsmgl. im Rhönladen<br />
11.00 Uhr Waldexkursion zum Thema<br />
Artenschutzkonzept<br />
13.15 Uhr Mittagessen Gasthof Krone<br />
14.45 Uhr Rhön im Fluss; Wanderung<br />
durch Ulstertal; Themen schwerpunkt<br />
Quellen und naturnahe Uferstreifen<br />
17.00 Uhr Abschluss<br />
Das geflügelte Zebra „fliegt“ wieder<br />
Ende September wird der Zoo <strong>Frankfurt</strong> mit dem Grzimek Camp um eine Attraktion<br />
reicher<br />
Noch steht sie auf<br />
einem kleinen<br />
Flugplatz in Hessen,<br />
doch in wenigen Tagen<br />
wird die zebragestreifte<br />
Dornier 27<br />
ihren Weg in den<br />
Zoo <strong>Frankfurt</strong> antreten.<br />
Ende September<br />
können <strong>ZGF</strong> und Zoo<br />
auf ein gemeinsames<br />
Projekt anstoßen, das<br />
mit viel persönlichem Engagement aller<br />
Beteiligten gestemmt wurde, und das einen<br />
Mann und sein Lebenswerk würdigen wird,<br />
der für beide Institutionen eine zentrale Figur<br />
war: Bernhard Grzimek.<br />
Stolz können vor allem Matrin Rulffs und<br />
seine Kollegen auf das frisch lackierte Flugzeug<br />
sein. In zwei Jahren Feierabend- und<br />
Wochenendarbeit hatten sie die Do 27 restauriert<br />
und orginalgetreu lackiert.<br />
Nun wird sie also bald über das Dach des<br />
Affenhauses in das neue „Grzimek Camp“<br />
einschweben. Dort erfahren die Zoobesucher<br />
zukünftig, wer der große <strong>Frankfurt</strong>er<br />
war, warum er und sein Sohn Michael einstmals<br />
überhaupt nach Afrika aufbrachen, und<br />
was das alles mit der <strong>ZGF</strong> Naturschutzarbeit<br />
von heute zu tun hat. Die gemeinsam<br />
mit der <strong>Frankfurt</strong>er Agentur Exposition konzipierte<br />
Ausstellung ist lebendig und anschaulich,<br />
es gibt Dinge zu entdecken und<br />
Rätsel zu lösen, doch allem voran steht die<br />
fundierte Information.<br />
Den genauen Termin der „Landung“ und der<br />
Eröffnung des Camps finden Sie auf unserer<br />
Internetseite (www.zgf.de), er stand bei<br />
Drucklegung noch nicht fest.
Jahresbeiträge<br />
für 2005<br />
Eine Bitte in eigener Sache richtet unser<br />
Ressort Mitgliederbetreuung an alle, die<br />
ihre Jahresbeitäge selbst - d.h. nicht per<br />
Einzugsermächtigung - überweisen. Bitte<br />
leisten Sie keine Vorauszahlungen für den<br />
Beitrag 2005 bereits im Dezember <strong>2004</strong>.<br />
Denn eingehende Beiträge, die noch nicht<br />
fällig sind, werden in der Regel automatisch<br />
als Spende verbucht. Daher: überweisen<br />
Sie den Beitrag 2005 bitte erst ab dem<br />
1. Januar 2005.<br />
Für Beiträge wie Spenden können Sie in<br />
Deutschland den in jedem Heft befindlichen<br />
Überweisungsträger nutzen. Mitglieder aus<br />
der Schweiz und Österreich nutzen bitte die<br />
unten stehenden Konten.<br />
Konto Schweiz:<br />
Konto Nr. 40-290-6, Die Post, Basel<br />
Konto Österreich:<br />
Konto Nr. 697 589 406, Bank Austria,<br />
Wien, BLZ: 12 000<br />
IBAN: AT 40 12 00 0006 9758 9406<br />
BIC: BK AUA TWW<br />
Erinnerung<br />
Nashorn<br />
in Sandstein<br />
Eine Ausstellung des <strong>Frankfurt</strong>er Künstlers<br />
und Bildhauers Jörg Engelmann, der<br />
das Nashorn Hama kurz vor seiner Abreise<br />
in Sandstein verewigt hatte,<br />
wird im Rahmen der <strong>ZGF</strong> Mitgliederversammlung<br />
zu sehen<br />
sein. Engelmann präsentiert<br />
im Ausstellungssaal des Zoo<br />
<strong>Frankfurt</strong> Skulpturen - und natürlich<br />
auch Hama.<br />
Die Nashornstatue aus rotem<br />
Sandstein ziert zurzeit den Rasen<br />
vor dem Zoogesellschaftshaus.<br />
Doch sie kann noch bis<br />
zum 26. September ersteigert<br />
werden. Gebote können<br />
schriftlich oder per E-Mail an<br />
die <strong>ZGF</strong> gerichtet werden. Das aktuelle Gebot<br />
finden Sie jeweils auf unserer Internetseite<br />
www.zgf.de.<br />
Gebote an: Zoologische Gesellschaft<br />
<strong>Frankfurt</strong>, Alfred-Brehm-Platz 16, 60316<br />
Frankfrut oder info@zgf.de<br />
<strong>ZGF</strong> MITGLIEDERVERSAMMLUNG <strong>2004</strong><br />
Datum Montag, 4. Oktober <strong>2004</strong><br />
Beginn 16:00 Uhr<br />
Ort Ausstellungssaal im Zoo <strong>Frankfurt</strong>, Zoo<br />
Gesellschafthaus (Haupteingang), Alfred-Brehm-<br />
Platz 16, <strong>Frankfurt</strong> am Main<br />
Ihr<br />
Gerhard Kittscher, Präsident<br />
Tagesordnung<br />
Noch steht sie im Zoo: Hama in Sandstein<br />
Hiermit möchten wir Sie nochmals hinweisen auf die bereits im <strong>Gorilla</strong> 2/04 veröffentlichte herzliche Einladung an alle Mitglieder<br />
der Zoologischen Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong> von 1858 e.V. zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung.<br />
1. Begrüßung<br />
2. Geschäftsbericht 2003<br />
3. Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2003<br />
4. Entlastung des Vorstandes<br />
5. Wahl des Abschlussprüfers W+ST Wirtschaftsprüfung GmbH<br />
6. Verschiedenes<br />
Kaffeepause<br />
Präsentation der Naturschutzarbeit der <strong>ZGF</strong> im Jahre 2003<br />
durch die Referate und anschließende Diskussion<br />
<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
<strong>ZGF</strong> intern<br />
23
Zoo <strong>Frankfurt</strong><br />
Flusspferdmutter Petra mit dem Anfang Juli<br />
geborenen Kiboko. Foto: S. Hilsberg<br />
24 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />
Ein kleines Flusspferd<br />
erfreut die Besucher<br />
Nachwuchs Kiboko kam Anfang Juli. Von Dr. Christian R. Schmidt.<br />
Flusspferde sind bei uns auch als Nilpferde<br />
und in Ostafrika als Kiboko bekannt. Im<br />
Unterlauf des Nils ist die Art allerdings<br />
schon lange verschwunden, und kürzlich<br />
wurde auch festgestellt, dass der Bestand<br />
im östlichen Kongo (Virunga-Nationalpark)<br />
erschreckend zurückgegangen ist. Mit einem<br />
Gewicht von über 4.000 Kilogramm<br />
bei den Bullen und mehr als 3.000 Kilogramm<br />
bei Weibchen sind Flusspferde eindeutig<br />
Großtiere. Ihre nächsten Verwandten<br />
sind allerdings die Schweine. Ihre Heimat<br />
Männliche <strong>Gorilla</strong>s – so genannte Silberrücken<br />
– können über 250 kg schwer<br />
werden und sind damit die schwersten Primaten<br />
(zu denen auch wir Menschen gehören)<br />
überhaupt. Unser stadtbekannter<br />
Silberrücken MATZE ist ein ausgesprochen<br />
schlanker Kerl und bringt 189 kg auf<br />
sind Flüsse und Seen in den Steppen und<br />
Savannen Afrikas. Tagsüber ziehen sie sich<br />
ins Wasser zurück, nachts grasen sie an<br />
Land. Flusspferde leben in kleineren oder<br />
größeren Gruppen. Neben den Walen und<br />
Seekühen ist das Flusspferd das einzige<br />
Säugetier, das seine Jungen unter Wasser<br />
zur Welt bringt – sogar das Zwergflusspferd<br />
und die viel stärker ans Wasser angepassten<br />
Robben gehen zur Geburt an Land.<br />
Am 1. Juli <strong>2004</strong> ist mit KIBOKO nach einer<br />
Tragzeit von 245 Tagen das 20. Flusspferd<br />
im Zoo <strong>Frankfurt</strong> geboren worden, und zwar<br />
aus unbekannten Gründen an Land. Es hätten<br />
noch viel mehr Jungtiere geben können,<br />
aber unser Weibchen PETRA (geboren<br />
24.04.1976 auf Mallorca) bekam seit 1997<br />
die Pille. Da Flusspferde über 50 Jahre alt<br />
werden, glücklicherweise selten erkranken<br />
und jährlich Nachwuchs bringen könnten,<br />
setzt man in Zoos eine spezielle Antibabypille<br />
ein, um eine Überproduktion an Flusspferden<br />
zu vermeiden. PETRA nahm dadurch<br />
jedoch dermaßen an Umfang zu, dass die<br />
Pille im Herbst 2003 abgesetzt wurde. Vater<br />
des kleinen KIBOKO ist MAIKEL, der 1975<br />
im Zoo Amsterdam geboren wurde.<br />
<strong>Gorilla</strong>-Nachwuchs<br />
die Waage. Das Gewicht von <strong>Gorilla</strong>weibchen<br />
liegt bei 70–100 kg, das von Neugeborenen<br />
nur 2–2,5 kg, d.h. etwa drei Prozent<br />
vom Muttergewicht. MATZE ist nicht nur der<br />
älteste <strong>Gorilla</strong>mann in Europa, sondern mit<br />
seinen 47 Jahren weltweit der älteste <strong>Gorilla</strong>vater.<br />
Sein jüngstes und 16. Kind KABULI
(was „Anerkennung“ in Kiswahili bedeutet)<br />
ist am 13. Juni 04 geboren. Mutter ist<br />
die am 01. September 1982 im Zoo Krefeld<br />
geborene (und vom befreundeten Krefelder<br />
Zoo bei uns eingestellte) REBECCA. Auch<br />
REBECCA ist außergewöhnlich und einmalig,<br />
indem sie innerhalb von 12 ½ Jahren<br />
sechs Kinder (fünf Söhne, eine Tochter) zur<br />
Welt brachte und allen auch eine ausgezeichnete<br />
Mutter war und ist. Die üblichen<br />
Geburtsintervalle von vier bis fünf Jahren<br />
betrugen bei ihr nur 35, 30, 30, 28, 27 Monate!<br />
Damit lebt bei uns wieder eine neunköpfige<br />
<strong>Gorilla</strong>gruppe. Seit der deutschen<br />
Erstzucht 1965 sind damit bei uns schon 20<br />
<strong>Gorilla</strong>s geboren worden. Zusammen mit 21<br />
Bonobos, 23 Schimpansen und 32 Orang-<br />
Utans wurden im Zoo <strong>Frankfurt</strong> schon 96<br />
Menschenaffen nachgezogen, eine Spitzenleistung<br />
zur Einhaltung der von der Ausrottung<br />
bedrohten Arten. Menschenaffen werden<br />
vor allem bedroht durch die Zerstörung<br />
des Lebensraumes, durch Wilderei („bushmeat“)<br />
und durch Krankheitsübertragung<br />
(z.B. Ebola) vom Menschen. Diese <strong>Frankfurt</strong>er<br />
Spezialität wird unterstrichen durch<br />
das bei uns geführte internationale <strong>Gorilla</strong>-Zuchtbuch<br />
(Dr. Dr. Sabine Hilsberg) und<br />
das bei uns koordinierte <strong>Gorilla</strong>-EEP (Europäisches<br />
Erhaltungszucht-Programm, Koordinator<br />
Dr. Christian R. Schmidt). Das<br />
<strong>Gorilla</strong>-EEP umfasst 386 <strong>Gorilla</strong>s in 59 Zoos<br />
Europas, Israels und Australiens. Letztes<br />
Jahr wurden 17 <strong>Gorilla</strong>s geboren, 8 starben,<br />
was ein Populationswachstum von zwei Prozent<br />
bedeutet.<br />
Nachwuchs & Veränderungen im Zoo<br />
Geboren<br />
1 Kurzschnabeligel, 2 Kurzohr-Rüsselspringer,<br />
2 Moholigalagos, 2<br />
Zwergseidenäffchen, 1 Kaiserschnurrbart-Tamarin,<br />
1 Nachtaffe, 1,0 Gelbbrustkapuziner<br />
KOBOLD, 1,0 Westlicher<br />
Flachlandgorilla KABULI (von REBEC-<br />
CA), 1,0 Bonobo KELELE , 1 Votsotsa,<br />
2 Große Maras, 3 Capybaras, 3,1 Rostkatzen<br />
(1,0 KALU von IRANA; 2,1 von<br />
LANKA), 1,0 Flusspferd KIBOKO, 1 Chinesischer<br />
Muntjak, 0,2 Netzgiraffen (KI-<br />
BURI von CHIRA; KIBALI von MONIQUE),<br />
1,0 Ostafrikanischer Bongo, 1,0 Rappenantilope,<br />
1 Schopftinamu, 2 Eselspinguine,<br />
3 Kahnschnäbel, 6 Rote Ibisse, 4<br />
Brandgänse, 10 Mandarinenten, 2 Weißkopf-Seeadler,<br />
1 Straußwachtel, 1 Kaptriel,<br />
5 Säbelschnäbler, 2 Kiebitze, 1<br />
Blauracke, 1 Socorrotaube, 2 Bartlett-<br />
Dolchstichtauben, 2 Russköpfchen, 1<br />
Blassfuß-Töpfervogel, 4 Rotohrbülbüls,<br />
6 Purpurtangaren, 3 Königsglanzstare, 3<br />
Gouldamadinen, 2 Östliche Zierschildkröten,<br />
3 Home’s Gelenkschildkröten,<br />
12 Schlangenhals-Schildkröten,<br />
11 Australische Süßwasserkrokodile,<br />
1 Blaue Bambusphelsume, 2 Mexikanische<br />
Krallengeckos, 28 Bartagamen,<br />
Erläuterung: 2,3 Tiere bedeutet: 2 Männchen und 3 Weibchen<br />
Im Exotariums leben seit 1959 Eselspinguine.<br />
Doch erst einmal -1999 - schlüpfte ein Jungvogel.<br />
Dieses Jahr schlüpften zwei Pinguine.<br />
4 Maskenhelmleguane, 5 Kronenbasilisken,<br />
5 Walzenskinke, Süßwassernadeln,<br />
Schmetterlingsbuntbarsche<br />
Zugänge<br />
0,1 Braunhaar-Gürteltier (Geschenk Zoo<br />
Poznan). 1,0 Grévyzebra ALAN (Tausch Zoo<br />
Dvur Kralove), 1.0 graues Alpaka JONAH<br />
(Tausch Wilhelma Stuttgart), 0,1 Südafrikanischer<br />
Strauß KLEO (Tausch Allwetterzoo<br />
Münster), 1,1 Cope’s Klapperschlangen, 4<br />
Schwarze Gabelbärte<br />
<strong>Gorilla</strong>mutter Rebecca mit Jungtier Kabuli.<br />
Foto: S. Hilsberg<br />
Gestorben<br />
0,1 Bonobo SALONGA, 31jährig, 0,1<br />
Fleckenroller, 0,1 Zwergseebär HERZ-<br />
CHEN 27jährig, 1,0 Seehund OTTO,<br />
0,1 Gänsesäger, 1 junger Weißkopf-<br />
Seeadler, 2,1 + 1 Fetzenfische<br />
Abgegeben<br />
1,0 Kaiserschnurrbart-Tamarin (Einstellung<br />
im Vallée des Singes, Romagne),<br />
2,1 Mähnenwölfe (Zoos<br />
Melbourne, Amsterdam, Heidelberg),<br />
1,0 Grévyzebra JOHARI (Einstellung<br />
Zoo Köln), 0,1 Südliches Spitzmaul-<br />
Nashorn HAMA (Geschenk South African<br />
National Parks), 1,0 Trampeltier<br />
BARKO, 1,0 Netzgiraffe JITU (Tausch<br />
Zoo Dvur Kralove), 6 Afrikanische<br />
Schnabelbrust-Schildkröten (Einstellung<br />
Reptilium Landau, 6 Europäische<br />
Sumpfschildkröten (Wiederansiedlung<br />
bei Ranstadt)<br />
Zoo <strong>Frankfurt</strong>
September Juni - 2/<strong>2004</strong> - 3/<strong>2004</strong><br />
Lichtblicke für die Natur<br />
Die Naturschutzarbeit der <strong>ZGF</strong> hat im Zoo<br />
<strong>Frankfurt</strong> sichtbaren Einzug gehalten.<br />
Direkt neben der Nashornanlage informiert<br />
seit Juli diesen Jahres die Ausstellung<br />
„Die Rückkehr der Nashörner“ über die Wiederansiedlung<br />
der Spitzmaulnashörner im ostafrikanischen<br />
Sambia -ein Projekt, das schließlich<br />
sehr eng an die Nashörner des Frank furter<br />
Zoos gekoppelt ist. Was liegt also näher, als<br />
diese spannende und erfolgreiche Geschichte<br />
den Zoobesuchern erlebbar zu machen?