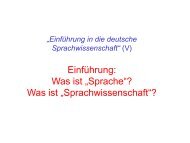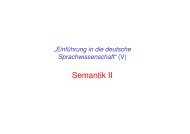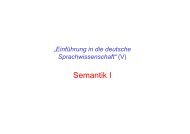VORLESUNGEN - Germanistisches Seminar
VORLESUNGEN - Germanistisches Seminar
VORLESUNGEN - Germanistisches Seminar
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>VORLESUNGEN</strong><br />
050273 Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft<br />
2-std., Mi 8.15-9.45 M. Hundt<br />
Modul A<br />
Die Vorlesung versteht sich als grundlegende Einführung in das Studium der germanistischen<br />
Sprachwissenschaft. Es werden die Grundlagen und Gegenstände der germanistischen Linguistik<br />
behandelt. Das Themenspektrum zur gegenwartsbezogenen Sprachwissenschaft umfasst folgende<br />
Themen: Semiotik, Phonetik/Phonologie, Morphologie (Wortarten, Flexion, Wortbildung), Syntax des<br />
einfachen und des komplexen Satzes, Semantik, Graphematik und Orthographie.<br />
Materialien: Die Lehrmaterialien zur Vorlesung stehen zum Herunterladen im Internet<br />
(www.germsem.uni-kiel.de/hundt) bereit. Alle Teilnehmer der Vorlesung werden gebeten, die<br />
Materialien vor Vorlesungsbeginn herunterzuladen.<br />
050268 Geschichte der deutschen Sprache<br />
2-std., Fr 10.15-11.45 M. Elmentaler<br />
Modul B<br />
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte der hochdeutschen und niederdeutschen<br />
Sprache von den Anfängen bis zur Gegenwart. Als Begleitlektüre wird empfohlen: Wilhelm Schmidt,<br />
Geschichte der deutschen Sprache, 10., neu bearb. Aufl. Stuttgart 2006, sowie für das Niederdeutsche:<br />
Willy Sanders, Sachsensprache – Hansesprache – Plattdeutsch, Göttingen 1982.<br />
050269 Niederdeutsch in Geschichte und Gegenwart<br />
2-std., Do 10.15-11.45 M. Elmentaler<br />
Modul A, B<br />
Die Vorlesung vermittelt einerseits grundlegende Kenntnisse über die Entwicklung der<br />
niederdeutschen Sprache von der altsächsischen Zeit über die mittelniederdeutsche Periode bis zum<br />
Neuniederdeutschen. Darüber hinaus wird die gegenwärtige Situation des Niederdeutschen und seiner<br />
Dialekte unter dem Dach des Standarddeutschen beschrieben.<br />
050463 Einführung in die Ältere deutsche Literatur<br />
2-std., Do 14.15-15.45 W. Achnitz<br />
Modul C<br />
Die Vorlesung vermittelt Grundlagen und Verständnisperspektiven zur Beschäftigung mit Sprache<br />
und Literatur des Mittelalters und führt in zentrale Gegenstände, Themen und Methoden der<br />
Germanistischen Mediävistik ein.<br />
Begleitende Lektüre: Hartmut Beckers: Mittelniederdeutsche Literatur. In: Niederdeutsches Wort 17<br />
(1977) S. 1–58; 18 (1978) S. 1–47; 19 (1979), S. 1–28. Max Wehrli: Geschichte der deutschen<br />
Literatur im Mittelalter bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Stuttgart 2. Aufl. 1997. [ISBN 3-15-<br />
010431-9].
050487 Einführung in die Ältere deutsche Literatur<br />
Der Orient in der deutschen Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit<br />
2-std., Fr 8.30-10.00 U. Kundert<br />
Modul C<br />
Die Vorlesung vermittelt Grundlagen und Verständnisperspektiven zur Beschäftigung mit Sprache<br />
und Literatur des Mittelalters und führt in zentrale Gegenstände, Themen und Methoden der<br />
Germanistischen Mediävistik ein.<br />
Der Orient vom Hellespont bis nach Indien spielt in der deutschen Literatur des Mittelalters und der<br />
frühen Neuzeit eine zentrale Rolle: Antike Stoffe über Troja und Alexander den Großen werden in<br />
mittelhochdeutsche Verse verarbeitet, geografische Punkte dienen in Weltkarten und Pilgerberichten<br />
als Erinnerungsorte für die Etappen der christlichen Heilsgeschichte, Epen erzählen von Glaubenskriegen,<br />
von kulturtechnischen Wundern und fremdartigen Bewohnern des Morgenlandes. So gibt das<br />
Thema Anlass zu einer Rundschau über 800 Jahre älterer deutscher Literatur.<br />
Passend zum übergreifenden Thema der Vorlesung werden zwei weitere Veranstaltungen angeboten:<br />
‚Herzog Ernst B‘ (C1-Kurs/ Übung) und ‚Lambrechts Alexanderlied‘ (Hauptseminar/Übung im<br />
Hauptstudium)<br />
Begleitende Lektüre: Hartmut Beckers: Mittelniederdeutsche Literatur. In: Niederdeutsches Wort 17<br />
(1977) S. 1–58; 18 (1978) S. 1–47; 19 (1979), S. 1–28. Max Wehrli: Geschichte der deutschen<br />
Literatur im Mittelalter bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Stuttgart 2. Aufl. 1997. [ISBN 3-15-<br />
010431-9].<br />
050284 Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache<br />
2-std., Mi 10.15-11.45 J. Kilian<br />
Modul E<br />
„Sprachdidaktik ist die Kunst und Wissenschaft, wie man Kindern und Erwachsenen beim Lernen<br />
einer neuen Sprachform oder Sprache überhaupt helfen kann, in systematischem Vorgehen, d.h. auf<br />
klare sprachtheoretische, psychologische und pädagogische Grundlagen gestützt und mit ständigem<br />
Beobachten der sprachlichen Reaktionen sowie der dahinterliegenden Verstehensleistungen möglichst<br />
bei jedem einzelnen Lernenden.“ (H. Glinz: Geschichte der Sprachdidaktik, in: U. Bredel [u.a.]<br />
(Hrsg.): Didaktik der deutschen Sprache I, 2003, 17). Dieser Versuch einer Definition des Wortes<br />
Sprachdidaktik folgt formal der klassischen Definitionslehre: Es wird zuerst der nächsthöhere Begriff<br />
gewählt: „Kunst und Wissenschaft“. Damit wird die – als institutionelle Disziplin relativ junge –<br />
Sprachdidaktik in den Rahmen einer älteren Tradition gestellt, nämlich die Tradition der didaktiké<br />
techné, der Kunst (und Wissenschaft) des Lehrens (und Lernens). Sodann wird die spezifische<br />
Differenz formuliert, die die Sprachdidaktik zu anderen (Fach)didaktiken aufweist: Gegenstand der<br />
Sprachdidaktik ist die Erkundung von systematischen Hilfen „beim Lernen einer neuen Sprachform<br />
oder Sprache“. In einem weiteren Sinne ist also das Lehren und Lernen von Sprache(n), das Lernen in<br />
und mit Hilfe der Sprache Gegenstand der Sprachdidaktik. In einem engeren Sinne wird<br />
Sprachdidaktik weiter differenziert in Mutter- bzw. Erstsprachendidaktik, Fremdsprachendidaktik<br />
und Zweitsprachendidaktik. Die Vorlesung widmet sich der Didaktik der deutschen Sprache<br />
vornehmlich als Didaktik des Deutschen als Muttersprache (DaM), bezieht allerdings vor dem<br />
Hintergrund der in den meisten Schulklassen anzutreffenden inneren und äußeren Mehrsprachigkeit<br />
auch Aspekte der Didaktik des Deutschen als Zweitsprache (DaZ) mit ein.<br />
Die eingangs angeführte Glinz’sche Definition deutet schließlich auch Bezugswissenschaften, Inhalte<br />
und Methoden der Sprachdidaktik (im vorliegenden Zusammenhang also der Didaktik der deutschen<br />
Sprache) an: Da werden als Bezugswissenschaften die (germanistische) Sprachwissenschaft, die<br />
(Lern)psychologie und die (allgemeine) Pädagogik angesprochen; da wird – mit dem Stichwort<br />
„Sprachform“ – vage auf Lernbereiche des Deutschunterrichts und auf Forschungsgegenstände der<br />
Didaktik der deutschen Sprache angespielt (zu verstehen wohl als „Sprachformen“ im Rahmen des<br />
Sprechens und Hörens, des Schreibens und Lesens, der Rechtschreibung, der Grammatik, der<br />
Semantik, der Pragmatik u.a.m.); und da wird schließlich – mit dem Verweis auf das „Beobachten der<br />
sprachlichen Reaktionen“ – die Sprachdidaktik auch als empirische Wissenschaft eingeführt, die<br />
neben der theoretisch begründeten Auswahl und Modellierung der Inhalte auch die Voraussetzungen
und Methoden sprachlichen Lehrens und Lernens empirisch erforscht. – Die Vorlesung führt in<br />
Fragestellungen, Erkenntnisinteressen und Methoden dieser so aspektualisierten Sprachdidaktik ein.<br />
Literaturhinweise: Ursula Bredel/Hartmut Günther/Peter Klotz/Jakob Ossner/Gesa Siebert-Ott<br />
(Hrsg.): Didaktik der deutschen Sprache. Ein Handbuch. 2 Bde., Paderborn 2003. Juliane<br />
Eckhardt/Hermann Helmers (Hrsg.): Theorien des Deutschunterrichts, Darmstadt 1980. Horst Jochim<br />
Frank: Geschichte des Deutschunterrichts von den Anfängen bis 1945, München 1973. Dietlinde H.<br />
Heckt/Karl Neumann (Hrsg.): Deutschunterricht von A bis Z, Braunschweig 2001. Hermann Helmers:<br />
Didaktik der deutschen Sprache [...], Darmstadt 1997 [zuerst 1966]. Dietrich Homberger: Lexikon<br />
Deutschunterricht, Stuttgart 2002. Hubert Ivo: Deutschdidaktik [...], Baltmannsweiler 1999. Michael<br />
Kämper van den Boogaart (Hrsg.): Deutschdidaktik [...], Berlin 2 2004. Günter Lange/Karl<br />
Neumann/Werner Ziesenis (Hrsg.): Taschenbuch des Deutschunterrichts, Bd. 1 [...], Baltmannsweiler<br />
8 2003. Günter Lange/Swantje Weinhold (Hrsg.): Grundlagen der Deutschdidaktik [...]<br />
Baltmannsweiler 2005. Ernst Nündel (Hrsg.): Lexikon zum Deutschunterricht [...], München 1979.<br />
Wolfgang Steinig/Hans-Werner Huneke: Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einführung, Berlin 2 2004.<br />
Winfried Ulrich: Didaktik der deutschen Sprache [...], 3 Bde., Stuttgart 2001 (Fotom. Nachdr. Herne<br />
2007). – Weitere Literatur in der Vorlesung.<br />
Teilnahme- und Leistungsnachweis: Die Teilnahme an dieser Vorlesung ist für alle Studentinnen und<br />
Studenten der traditionellen Lehramtsstudiengänge verbindlich. Mit dem Besuch dieser Vorlesung<br />
werden die 2 SWS im Bereich der Sprachdidaktik im Grundstudium erbracht, die in der Studien- und<br />
Prüfungsordnung aufgeführt werden und eine der Voraussetzungen für die Zulassung zur<br />
Zwischenprüfung bilden. Durch die erfolgreiche Teilnahme an der Abschlussklausur kann der für das<br />
Grundstudium erforderliche (benotete) Leistungsnachweis in der Fachdidaktik Deutsch erworben<br />
werden. Für einen unbenoteten Teilnahmenachweis ist regelmäßige Anwesenheit, aktive Mitarbeit<br />
sowie die Erledigung einer kleinen Hausaufgabe zur Terminologie der Sprachdidaktik erforderlich.<br />
Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft<br />
PROSEMINARE<br />
051074 2-std., Mo 16.15-17.45 Ch. A. Anders<br />
051073 2-std., Mi 10.15-11.45 Ch. A. Anders<br />
050290 2-std., Do 14.15-15.45 C.-P. Becke<br />
050479 2-std., Di 14.15-15.45 Y. Dittmann<br />
Modul A1<br />
In dem Proseminar findet zunächst eine Auseinandersetzung mit den allgemeinen Grundbegriffen der<br />
Erfassung und Beschreibung sprachlicher Kommunikation statt. Danach wird die Anwendung der<br />
linguistischen Methoden in den Bereichen Semiotik, Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax,<br />
Semantik und Graphematik/Orthographie praktisch geübt. Der parallele Besuch der Vorlesung<br />
„Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft“ wird für die <strong>Seminar</strong>diskussion vorausgesetzt. Die<br />
erfolgreiche Teilnahme an dem Proseminar wird in einer Abschlussklausur (Teilklausur) nachgewiesen.<br />
Die Materialien werden im Internet zur Verfügung gestellt (www.germsem.uni-kiel.de/hundt). Alle<br />
Teilnehmer des <strong>Seminar</strong>s werden gebeten, sich die Materialien vor Beginn der Veranstaltung<br />
herunterzuladen.
Synchrone Beschreibung der deutschen Sprache<br />
050478 2-std., Do 16.15-17.45 C.-P. Becke<br />
050341 2-std., Mo 10.15-11.45 H. Jessen<br />
050276 2-std., Mo 12.15-13.45 G. Rudolph<br />
Modul A2<br />
Das Proseminar schließt an die Lehrinhalte des Proseminars „Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft“<br />
an und ergänzt sie durch wichtige Teilgebiete der Linguistik anhand der hochdeutschen<br />
Gegenwartssprache: Funktionale Satzanalyse, Semantik, Pragmatik, Text- und Gesprächsanalyse und<br />
Soziolinguistik/Varietätenlinguistik. Voraussetzung für den Erwerb eines (Teil-)Leistungsnachweises<br />
ist das Bestehen einer Abschlussklausur (Teilklausur).<br />
Die Materialien werden im Internet zur Verfügung gestellt (www.germsem.uni-kiel.de/hundt). Alle<br />
Teilnehmer des <strong>Seminar</strong>s werden gebeten, sich die Materialien vor Beginn der Veranstaltung<br />
herunterzuladen.<br />
050465 Einführung in das Mittelhochdeutsche<br />
2-std., Do 8.15-9.45 C. Banneck<br />
Modul B1<br />
Das <strong>Seminar</strong> B1, das vor dem <strong>Seminar</strong> C1 "Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik"<br />
besucht werden sollte, führt in die Grundlagen der mittelhochdeutschen Grammatik, Lexikologie und<br />
Semantik ein. Lernziel ist die Fähigkeit zur selbstständigen Lektüre sowie zur stilistisch und<br />
grammatisch korrekten Übersetzung mittelalterlicher Texte in die neuhochdeutsche Gegenwartssprache.<br />
Außerdem werden Grundkenntnisse auf dem Gebiet der metrischen Analyse erworben.<br />
Statt einer „Einführung in das Mittelhochdeutsche“ kann alternativ eine „Einführung in das Mittelniederdeutsche“<br />
gewählt werden.<br />
050497 Einführung in das Mittelniederdeutsche<br />
2-std., Do 12.30-14.00 V. Wilcken<br />
Modul B1<br />
Anhand von ausgewählten Texten werden die Grundzüge der mittelniederdeutschen Grammatik behandelt.<br />
Ausführliche Lese- und Übersetzungsübungen vertiefen das Gelernte. Auf diese Weise wird<br />
die Grundlage für eine weitere Beschäftigung mit der Literatur der mittleren Sprachstufe (ca. 1225-<br />
1650) des Niederdeutschen gelegt. Zu Beginn dieser Epoche löste das Mittelniederdeutsche nicht nur<br />
das Latein als wichtigste Schriftsprache in Norddeutschland ab, sondern stieg auch zur Handels- und
Verkehrssprache im Nord- und Ostseeraum auf. Eine Beschäftigung mit den historischen Quellen<br />
dieses Raumes erfordert deshalb Mittelniederdeutsch-Kenntnisse. Aufgrund der starken Stellung zu<br />
dieser Zeit ist aber auch eine Vielzahl mittelniederdeutscher Wörter in die skandinavischen Sprachen,<br />
insbesondere das Schwedische, übernommen worden. Die Lehrveranstaltung kann deshalb<br />
insbesondere auch Studenten mit entsprechendem Zweitfach - Historikern und Nordisten - empfohlen<br />
werden. Auszüge aus den wichtigsten Textzeugen des Mittelniederdeutschen werden im <strong>Seminar</strong> zur<br />
Verfügung gestellt (Sachsenspiegel, Reynke de vos, Redentiner Osterspiel u. a. m.). Die Auswahl<br />
kann auf Wunsch geändert oder ergänzt werden. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch eine<br />
Abschlussklausur nachgewiesen. Nach den Studienordnungen kann das Mittelniederdeutsche anstelle<br />
des Mittelhochdeutschen erlernt werden.<br />
Empfohlene Literatur: Peters, R.: Mittelniederdeutsche Sprache. In: Goossens, J. (Hg.): Niederdeutsch.<br />
Sprache und Literatur. Bd. 1. 2. Aufl. Neumünster 1983, S. 66-115.<br />
Diachrone Beschreibung der deutschen Sprache<br />
050409 2-std., Mi 8.15-9.45 Ch. A. Anders<br />
050291 2-std., Mi 14.30-16.00 C.-P. Becke<br />
050297 2-std., Do 16.15-17.45 A. Lasch<br />
Modul B2<br />
Das <strong>Seminar</strong> zur Geschichte der deutschen Sprache zeigt die Entwicklung von den ältesten<br />
Sprachstufen des Deutschen bis in die Gegenwart auf und führt dabei auch allgemein in die Methoden<br />
der diachronen Sprachwissenschaft ein. Ausgehend von den Sprachebenen Phonologie, Morphologie,<br />
Syntax und Semantik werden die verschiedenen historischen Entwicklungsstufen des Hochdeutschen<br />
und des Niederdeutschen kontrastiv in den Blick genommen, wobei die Laut- und Formenlehre von<br />
besonderem Interesse ist. Neben den externen Faktoren hoch- und niederdeutscher Sprachgeschichte<br />
stehen vor allem das Sprachsystem und die Sprachwandelprozesse im Mittelpunkt der Betrachtung.<br />
Den unterschiedlichen Entwicklungen im deutschen Sprachraum wird ebenso Rechnung getragen wie<br />
der fortschreitenden Differenzierung im Bereich der volkssprachlichen Textsorten.<br />
Die Materialien werden im Internet zur Verfügung gestellt (http://germa.germsem.unikiel.de/hundt/stud-material.shtml).<br />
Alle Teilnehmer des <strong>Seminar</strong>s werden gebeten, sich die<br />
Materialien vor Beginn der Veranstaltung herunterzuladen.<br />
Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik<br />
Modul C1<br />
Das <strong>Seminar</strong> vertieft die in der "Einführung in das Mittelhochdeutsche" (B1) erworbenen<br />
Grundkenntnisse durch eine Verbreiterung der Textbasis und führt anhand eines Beispieltextes aus<br />
verschiedenen literatur- und kulturhistorischen sowie literaturtheoretischen Perspektiven in das<br />
Studium der Germanistischen Mediävistik ein.<br />
Dieses <strong>Seminar</strong> wird in 7 parallelen und gleichwertigen Kursen angeboten, die jeweils mit unterschiedlichem<br />
Textmaterial arbeiten (vgl. die folgenden Einzelveranstaltungen).<br />
050458 <strong>Seminar</strong>: Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik<br />
2-std., Mi 10.15-11.45 W. Achnitz<br />
Das <strong>Seminar</strong> vertieft die in der Einführung in das Mittelhochdeutsche (PS 1) erworbenen<br />
Grundkenntnisse durch eine Verbreiterung der Textbasis und führt anhand ausgewählter Texte in<br />
Themen, Formen und Problemfelder der deutschsprachigen Liebeslyrik des 12. bis 15. Jahrhunderts<br />
und auf diese Weise aus verschiedenen literatur- und kulturhistorischen sowie literaturtheoretischen<br />
Perspektiven in das Studium der Germanistischen Mediävistik ein. Gelesen, übersetzt und interpretiert<br />
werden repräsentative und prominente Lieder von Friedrich von Hausen über Heinrich von
Morungen, Reinmar, Wolfram von Eschenbach, Walther von der Vogelweide und Neidhart bis hin zu<br />
Oswald von Wolkenstein. Texte werden in Kopien zur Verfügung gestellt.<br />
Zur Einführung: Günther Schweikle, Minnesang. 2., korr. Aufl. Stuttgart, Weimar 1995 (Sammlung<br />
Metzler 244); Rüdiger Schnell, Unterwerfung und Herrschaft. Zum Liebesdiskurs im Hochmittelalter,<br />
in: Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche, hg. von Joachim Heinzle.<br />
Frankfurt/M. 1994, S. 103-133.<br />
050531 <strong>Seminar</strong>: Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik<br />
Blockveranstaltung, Einzeltermine: Fr., 18.04., 16.00-20.00;<br />
Fr., 09.05., 16.00-20.00; Fr., 27.06., 10.00-16.00; Sa, 28.06., 10.00-16.00 J. Hamm<br />
Das 'Nibelungenlied' gehört aufgrund seiner herausragenden Stellung in der heldenepischen Tradition,<br />
seiner komplexen Stoffgeschichte, seiner erzählerischen Brüche und Verwerfungen und seiner<br />
vielfältigen Rezeption zu den bedeutendsten und meistdiskutierten Werken der mittelhochdeutschen<br />
Literatur. Ausgehend von der Übersetzung des 'Nibelungenlieds' will das <strong>Seminar</strong> grundlegende<br />
Aspekte der mittelalterlichen deutschen Literatur ansprechen und in zentrale literatur- und kulturwissenschaftliche<br />
Themenfelder der germanistischen Mediävistik einführen.<br />
Ausgabe (bitte zur ersten Sitzung mitbringen): Das Nibelungenlied. Nach der Ausgabe von Karl<br />
Bartsch hg. v. Helmut de Boor. 22., revidierte und von Roswitha Wisniewski ergänzte Auflage.<br />
Mannheim 1996.<br />
Zur Anschaffung empfohlen: Dorothea Klein: Mittelalter. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart, Weimar<br />
2006.<br />
<strong>Seminar</strong>: Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik<br />
050410 2-std., Mo 8.30-10.00 H. Jessen<br />
051190 2-std., Di 8.30-10.00 H. Jessen<br />
In dem <strong>Seminar</strong> findet zunächst eine Auseinandersetzung mit den allgemeinen Grundbegriffen der<br />
Erfassung und Beschreibung sprachlicher Kommunikation statt. Danach wird die Anwendung der<br />
linguistischen Methoden in den Bereichen Semiotik, Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax,<br />
Semantik und Graphematik/Orthographie praktisch geübt. Der parallele Besuch der Vorlesung<br />
„Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft“ wird für die <strong>Seminar</strong>diskussion vorausgesetzt. Die<br />
Materialien werden im Internet zur Verfügung gestellt (www.germsem.uni-kiel.de/hundt). Alle<br />
Teilnehmer des <strong>Seminar</strong>s werden gebeten, sich die Materialien vor Beginn der Veranstaltung<br />
herunterzuladen.<br />
050327 <strong>Seminar</strong>: Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik<br />
2-std., Do 14.15-15.45 U. Kundert<br />
Textgrundlage dieser Veranstaltung bildet das Epos über den Empörer Herzog Ernst, der u. a. an<br />
einem Kreuzzug teilnimmt und Abenteuer im Orient besteht. Zur übergreifenden Thematik ›Der<br />
Orient in der deutschen Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit‹ findet als sinnvolle<br />
Ergänzung eine Vorlesung statt (s. Vorlesungen bzw. Modul 1 B-ÄDL V).<br />
Empfohlene Literatur: Bitte kaufen Sie bereits vor der ersten Sitzung folgende Textausgabe: Herzog<br />
Ernst B. Mhd.-Nhd. Hg. von Karl Bartsch, übers. von Bernhard Sowinski. Stuttgart 1998 (Reclams<br />
Universal-Bibliothek 8352). [ISBN: 978-3-15-008352-9].<br />
050330 <strong>Seminar</strong>: Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik<br />
2-std., Do 16.15-17.45 S. Stahmer-Wusterbarth<br />
Literatur: Der Stricker: Verserzählungen, hrsg. V. Hanns Fischer. 5. Aufl. Tübingen 2000, (ATB).
050602 <strong>Seminar</strong>: Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik<br />
2-std., Do 8.30-10.00 (an mnd. Texten) U. Weber<br />
Das <strong>Seminar</strong> soll das Übersetzen aus dem Mittelniederdeutschen<br />
bzw. dem Mittelhochdeutschen üben sowie<br />
grundlegende literar- und kulturhistorische Kenntnisse<br />
vermitteln. Anhand einschlägiger Texte und Textausschnitte<br />
werden deshalb u.a. die folgenden Themen besprochen:<br />
Aufbau der mittelalterlichen Gesellschaft; Bedingungen der<br />
literarischen Kommunikation; mittelalterliche Interpretationsverfahren;<br />
mittelalterliche Literatur als ars rhetorica; die<br />
wichtigsten Gattungen um 1200. Die Einführung dient der<br />
Modellanalyse ausgewählter Textbeispiele aus verschiedenen<br />
für die Mediävistik wichtigen literar- und kulturhistorischen<br />
sowie literaturtheoretischen Perspektiven. Wichtige Grundbegriffe<br />
aus Literatur- und Kulturgeschichte des Mittelalters<br />
sowie aus für die Mediävistik wichtigen Literaturtheorien<br />
werden erlernt und zur Textanalyse verwendet.<br />
Der Schwerpunkt dieses <strong>Seminar</strong>s wird auf der<br />
mittelniederdeutschen Überlieferung liegen. Dementsprechend<br />
stehen hier spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Texte im<br />
Vordergrund. Diese gehören nur selten in den höfischen<br />
Bereich, entstammen weitestgehend der bürgerlichen Welt der Städte.<br />
Literatur: BECKERS, Hartmut: Mittelniederdeutsche Literatur – Versuch einer Bestandsaufnahme. In:<br />
Niederdeutsches Wort 17 (1977), S. 1-58; 18 (1978), S. 1-47; 19 (1979), S. 1-28.<br />
CORDES, Gerhard: Mittelniederdeutsche Dichtung und Gebrauchsliteratur. In: Cordes, Gerhard /<br />
Möhn, Dieter (Hrsg.): Handbuch zur niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Berlin 1983.<br />
S. 351-390.<br />
MEIER, Jürgen / Dieter MÖHN: Literatur: Formen und Funktionen. In: Bracker, Jörgen / Henn, Volker<br />
/ Postel, Rainer (Hrsg.): Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos. Textband zur Hamburger Hanse-<br />
Ausstellung von 1989. 3. Aufl. Lübeck 1999. S. 524-534. Und dieselben: Spiegelung der Konflikte in<br />
der Literatur. Ebenda S. 844-860.<br />
MENKE, Hubertus: „Ghemaket vmme der eyntvoldighen vnde simpel Mynschen Willen“. Zur<br />
Lübecker Druckliteratur in der frühen Neuzeit. In: Eickhölter, Manfred / Hammel-Kiesow, Rolf<br />
(Hrsg.): Ausstattungen Lübecker Wohnhäuser. Raumnutzungen, Malereien und Bücher im<br />
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Neumünster 1993. S. 299-316.<br />
050456 Heinrich von Veldeke, Eneasroman<br />
2-std., Di 12.15-13.45 W. Achnitz<br />
Modul C2<br />
Mit seiner wohl vor 1170 entstandenen Übertragung des afrz. ‚Roman d’Eneas’ ins Deutsche galt<br />
Heinrich von Veldeke schon dem jüngeren Zeitgenossen Gottfried von Straßburg als Begründer<br />
höfischer Dichtkunst. Die Erzählung von der Zerstörung Trojas und der beiden Liebesbeziehungen<br />
des Eneas ist wohl als Prototyp des höfischen Versromans anzusehen. Das Proseminar 1 im<br />
Vertiefungsmodul, dessen Besuch die erfolgreiche Absolvierung des Basismoduls ÄDL voraussetzt,<br />
vermittelt am Beispiel des ‚Eneasroman’ einen vertieften Einblick in die Gegebenheiten mediävistischer<br />
Literaturwissenschaft. Lernziel ist der selbstständige und wissenschaftliche Umgang mit<br />
deutscher Literatur älterer Sprachstufen, etwa der kritische Umgang mit Forschungsliteratur sowie der<br />
Gebrauch von Nachschlagewerken und Datenbanken. Darüber hinaus werden die Fähigkeiten zu<br />
mündlicher und schriftlicher Vermittlung des Erlernten bzw. Erworbenen eingeübt. Für den<br />
erfolgreichen Abschluss sind das Anfertigen eines Referates sowie eines schriftlich vorzulegenden<br />
Handouts oder Protokolls notwendig.
051076 Spätmittelalterliche Legendendichtung<br />
2-std., Fr 12.30-14.00 J. Bockmann<br />
Modul C2<br />
Legenden sind Berichte über besondere Menschen, die zu ihren Lebzeiten Wunder(bares) vollbracht<br />
oder erlebt haben und nach ihrem Tod von Gott erhöht wurden. Diese Heiligen der Legenden galten<br />
den mittelalterlichen Menschen als Vorbilder und Mittler. Legenden und Legendenstoffe waren vor<br />
allem im Spätmittelalter sehr beliebt; dies zeigt eine reiche Überlieferung einzelner Texte wie auch<br />
größerer Sammlungen (Passional, Der Heiligen Leben). Die Legendendichtungen berühren sich<br />
immer wieder mit anderen Erzähltraditionen und unterscheiden sich im Auserzählen oftmals kurios<br />
anmutender Geschichten erheblich voneinander.<br />
Im <strong>Seminar</strong> werden neben einigen kleineren Texten exemplarisch vor allem die Brandan- und die<br />
Zeno-Legende in markanten Fassungen (mnd. und mhd.) behandelt. Um sich dem Sinnpotential der<br />
Stoffe annähern zu können, werden uns die historischen und die Überlieferungszusammenhänge, vor<br />
allem aber die konkreten Erzählweisen einzelner Fassungen beschäftigen.<br />
Die Texte werden in Form von Kopiervorlagen zur Verfügung gestellt. Ein <strong>Seminar</strong>apparat steht zu<br />
Beginn des Semesters bereit<br />
Zur Einführung empfohlen: Legenden. Heiligengeschichten vom Altertum bis zur Gegenwart. Hg. von<br />
Hans-Peter Ecker. Stuttgart: Reclam 2001 (RUB 18147).<br />
050331 Kleinere Erzählungen Konrads von Würzburg<br />
2-std., Blockveranstaltung: Freitag, 20. Juni, 12–18.30 Uhr;<br />
Samstag, 21. Juni, 10–16.30 Uhr; Freitag, 4. Juli, 12–18.30 Uhr,<br />
Samstag 5. Juli, 10–16.30 Uhr. Ch. Putzo<br />
Modul C2<br />
Konrad von Würzburg als den vielseitigsten und produktivsten Autor der weltlichen deutschen<br />
Literatur des 13. Jahrhunderts zu bezeichnen, ist mehr als nur der appetizer für einen Lehrveranstaltungskommentar.<br />
Aus seiner Feder ist ein umfangreiches Œuvre überliefert, das an Themen-,<br />
Form- und Gattungsbreite, nicht zuletzt aber auch an Quantität, in der mittelhochdeutschen Literatur<br />
seinesgleichen sucht. Es mischen sich darin Traditionsgebundenheit und Innovation, Schlichtheit und<br />
Raffinesse, sprachliche Stereotypie und stilistische Formkunst. Nicht wenige seiner – in der jüngeren<br />
Forschung mit neuem Interesse bedachten – Texte haben zu kontroversen Interpretationen geführt. Ins<br />
Blickfeld rücken sie damit nicht nur als Gegenstand literaturwissenschaftlichen Interesses, sondern<br />
auch als Beispiele möglicher Verfahren und Probleme literaturwissenschaftlichen Arbeitens. Anhand<br />
dreier kurzer Erzählungen aus Konrads Werk möchte das <strong>Seminar</strong> so in ausgewählte Methoden- und<br />
Theoriefelder der germanistischen Mediävistik exemplarisch einführen.<br />
Empfohlene Literatur: Konrad von Würzburg: Heinrich von Kempten. Der Welt Lohn. Das<br />
Herzmaere. Mittelhochdeutscher Text nach der Ausgabe von Edward Schröder. Übersetzt, mit<br />
Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Heinz Rölleke. Stuttgart 1968 u.ö. (Reclams UB<br />
2855) – bitte anschaffen. Hinweis: Die nhd. Übersetzung dieser Leseausgabe ist oft sehr frei und<br />
ungenau. Zur wissenschaftlichen Arbeit mit dem Text ist sie ungeeignet. Bitte bemühen Sie sich, die<br />
Erzählungen auf mhd. vorzubereiten. (Für das ‚Herzmære‘ kann ergänzend die zuverlässige<br />
Übersetzung von Klaus Grubmüller, Novellistik des Mittelalters. Märendichtung. Frankfurt am Main<br />
1996, S. 262–295 nebst Kommentar ebd., S. 1120–1132 hinzugezogen werden.)<br />
Einführendes zu Konrad: Brunner, Horst: Konrad von Würzburg. In: ²VL Bd. 5, 1985, Sp. 272–304,<br />
bes. Sp. 291–294 zu den Kurzerzählungen; Brandt, Rüdiger: Konrad von Würzburg. Kleinere epische<br />
Werke. Berlin 2000 (Klassiker-Lektüren 2).<br />
Da das begleitende Lektürepensum hoch ist, ist es unabdingbar, dass Sie sich bereits im Laufe des<br />
Semesters vorbereiten. Ein Leseplan sowie eine Liste mit Referatthemen wird ab etwa Mitte April<br />
vorliegen. Die Anmeldung für Referate ist ab dann möglich, am besten per E-Mail:<br />
christine.putzo@uni-hamburg.de
050682 Das Nibelungenlied<br />
2-std., Do 14.15-15.45 S. Stahmer-Wusterbarth<br />
Modul C2<br />
Verrat, Machtgier und Gnadenlosigkeit versus positive Werte, höfische Werte sind Inhalt des<br />
Nibelungenlieds. Ein radikal desillusionierender Realismus kennzeichnet dieses Heldenepos, über das<br />
Goethe schrieb, es sei so „furchtbar, weil es eine Dichtung ohne Reflex ist, und die Helden wie eherne<br />
Wesen nur durch und für sich existieren“.<br />
Eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Epos lohnt sich, zumal Begriffe wie Nibelungenhort<br />
und Nibelungentreue die Jahrhunderte überdauert haben und bis ins 21. Jahrhundert Assoziationen<br />
hervorrufen.<br />
Im <strong>Seminar</strong> wird durch Übersetzungsarbeit der mhd. Text zugänglich gemacht, die formalen<br />
Besonderheiten dieses Epos werden erarbeitet und die verschiedenen Ebenen dieses Werkes<br />
aufgezeigt. Außerdem muss der Rezeption besondere Beachtung geschenkt werden. Zu Beginn des<br />
<strong>Seminar</strong>s wird Textkenntnis vorausgesetzt, und die Lektüre muss in der 1. Veranstaltung vorliegen.<br />
Literaturhinweis: Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung. Hrsg. und<br />
übersetzt von Helmut Brackert. Bd. 1 und Bd. 2, 29. Aufl. Frankfurt a. Main 2004.<br />
050338 Fachliteratur in mittelniederdeutscher Sprache<br />
2-std., Mo 8.30-10.00 U. Weber<br />
Modul C2<br />
Die niederdeutsche Philologie hat von Beginn an<br />
besonders auch die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche,<br />
volkssprachliche Fachliteratur als Forschungsgegenstand<br />
angenommen. Ansonsten geriet dieser<br />
Bereich der Textüberlieferung weitestgehend in der<br />
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Blick der<br />
Mediävistik. Zu den Gegenständen dieses Wissenschaftszweiges<br />
gehören die Werke aus dem Bereich der<br />
sieben freien Künste (artes liberales) mit dem Trivium:<br />
Grammatik, Rhetorik, Dialektik und dem Quadrivium:<br />
Arithmetik, Musik, Geometrie, Astronomie sowie die<br />
Eigenkünste (artes mechanicae). Zu letzteren gehören<br />
Handwerk, Kriegswesen, Seefahrt, Landbau, Heilkunde<br />
u. a. m. Hiervon sind noch die verbotenen Künste zu<br />
unterscheiden. Aus den meisten genannten Bereichen<br />
sind Texte in mittelniederdeutscher Sprache überliefert,<br />
die Gegenstand des <strong>Seminar</strong>s sein sollen.<br />
Gegenstand eines Referates könnten beispielsweise sein:<br />
Glossare und Vokabulare (Wörterbücher); Arzneibücher;<br />
Rezepte für Farben etc.; Rezepte gegen die Pest und andere Krankheiten; Das Seebuch; Kochbuch;<br />
Fibeln; Rechenbücher; Rechnungsbücher; Rechtsbücher; Reiseliteratur; Entdeckungsberichte;<br />
Praktiken und Prognostica; historische Werke; theologische Werke der Reformationszeit.<br />
Literatur: EIS, Gerhard: Mittelalterliche Fachliteratur. 2. Aufl. Stuttgart 1967.<br />
HAAGE, Bernhard Dietrich und Wolfgang WEGNER: Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter<br />
und Früher Neuzeit. Berlin 2007.
051077 Stilistik der deutschen Sprache<br />
ÜBUNGEN (Grund- und Hauptstudium)<br />
2-std., Mo 8.15-9.45 Ch. A. Anders<br />
Modul A<br />
Die Beschäftigung mit Stilistik auf Gesprächs- und Textebene ist nicht im Sinne einer präskriptiven<br />
Stillehre zu verstehen sondern als kritische Auseinandersetzung in den Bereichen Stiltheorie,<br />
Stilforschung und Stilanalyse. Im <strong>Seminar</strong> wird der Fokus auf die stilistische Textanalyse gerichtet, es<br />
geht darum, wie Text im Hinblick auf seine Verwendung gestaltet ist und ob die intendierten<br />
Funktionen der Textgestaltung erreicht werden. Neben der gemeinsamen Lektüre der Grundlagenliteratur<br />
und kleineren Übungen zur Stilanalyse sollen textbezogene Stilphänomene synchron und<br />
diachron v. a. aus dem Bereich der Mediensprache beobachtet, beschrieben und interpretiert werden.<br />
Empfohlene Literatur: Sandig, Barbara (2006): Textstilistik des Deutschen. 2., völlig neu bearb. und<br />
erw. Auflage. Berlin u.a.: de Gruyter. Spillner, Bernd (Hrsg.) (1984): Methoden der Stilanalyse.<br />
Tübingen: Narr.<br />
050289 (Historische) Textlinguistik<br />
2-std., Fr 8.15-9.45 A. Lasch<br />
Modul A<br />
Text: alerter Tod der Möglichkeiten - grenzt er doch<br />
mehr Worte aus, als ihm zusteht.<br />
Andreas Egert<br />
Die Textlinguistik widmet sich transphrastischen sprachlichen Einheiten – eine Definition dessen,<br />
was darüber hinaus als „Text“ zu verstehen sei, ist stets vom Fokus des Fragenden und seines<br />
Forschungsinteresses abhängig. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch grundsätzlich die Perspektive,<br />
die die Forschung einnimmt: Betritt man das Feld der historischen Textlinguistik, die transphrastische<br />
sprachliche Einheiten in ihrer diachronen Entwicklung analysiert, sind die Gegenstände (Sind<br />
Beschwörungsformeln „Texte“?) und ihre Charakteristika vor dem Hintergrund der allgemeinsprachlichen<br />
Entwicklung differenzierter zu beschreiben.<br />
Im <strong>Seminar</strong> werden theoretische Grundlagen der historischen Textlinguistik reflektiert, die an<br />
ausgewählten Textzeugnissen, Textroutinen und Textsortentraditionen erprobt werden.<br />
Zur einführenden Lektüre wird empfohlen: Klaus Brinker (2005): Linguistische Textanalyse. Eine<br />
Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin. - Wulf Oesterreicher (1993): Verschriftung und<br />
Verschriftlichung im Kontext medialer und konzeptioneller Schriftlichkeit. In: Ursula Schaefer (Hg.):<br />
Schriftlichkeit im frühen Mittelalter. Tübingen, S. 267-292 (ScriptOralia 53). - Wulf Oesterreicher<br />
(1998): Textzentrierung und Rekontextualisierung: Zwei Grundprobleme der diachronischen Sprach-<br />
und Textforschung. In: Christine Ehler/Ursula Schaefer (Hgg.): Verschriftung und Verschriftlichung.<br />
Aspekte des Medienwechsels in verschiedenen Kulturen und Epochen. Tübingen 1998, S. 10-39<br />
(ScriptOralia 94). - Arne Ziegler (2003): Städtische Kommunikationspraxis im Spätmittelalter.<br />
Historische Soziopragmatik und Historische Textlinguistik. Berlin.<br />
050339 Altsächsisch<br />
2-std., Mi 16.15-17.45 R. Langhanke<br />
Modul B, C<br />
In <strong>Seminar</strong>en zur Sprachgeschichte des Deutschen kann den ältesten Sprachstufen Althochdeutsch<br />
und Altsächsisch aus Zeitgründen in der Regel nur wenig Raum gegeben werden. Besonders das<br />
Altsächsische, oder auch Altniederdeutsche, kann nur selten in den Mittelpunkt des Interesses rücken,<br />
an dieser Stelle möchte diese Veranstaltung Abhilfe schaffen. Die Forschung lässt die altsächsische<br />
Periode auf Grundlage der im Vergleich überschaubaren Überlieferung um 800 beginnen und um
1100 enden, wobei Schwerpunkte der Textüberlieferung im 9. Jahrhundert mit den großen<br />
Sprachdenkmälern „Heliand“ und „Genesis“ und im 10. und 11. Jahrhundert mit dem größten Teil der<br />
sonstigen Überlieferung liegen. Die Veranstaltung möchte die altsächsische Sprachepoche in ihrer<br />
Gesamtheit in den Blick nehmen und sowohl die sprachsystematischen Ebenen des Wortschatzes und<br />
der Grammatik als auch die Sprachdenkmäler, diese unter literaturwissenschaftlichen Aspekten,<br />
behandeln, wobei die Stabreimdichtung des „Heliand“ (nach Stammler ist diese Bibeldichtung „das<br />
schönste geistliche Epos des ganzen deutschen Mittelalters“) eine Schwerpunktstellung einnehmen<br />
soll. Ebenso sollen die Abgrenzung vom Althochdeutschen, historische Hintergründe und die<br />
Bedingungen von Schriftlichkeit in dieser Zeit behandelt werden. Von Interesse wird auch ein Blick<br />
auf die lange Forschungstradition zum Altsächsischen sein, da er über Veränderungen von<br />
Schwerpunktsetzungen in der Sprachgeschichtsforschung informiert. Die Behandlung der Grammatik<br />
des Altsächsischen soll auch einen exemplarischen Charakter haben, da hier erarbeitete<br />
Zusammenhänge auch für das systematische Verständnis der weiteren Sprachstufen des Deutschen<br />
hilfreich sein können. Insgesamt bedeutet die Beschäftigung mit dem Altsächsischen die Begegnung<br />
mit einer faszinierenden und durch ihren Formenreichtum ansprechenden Sprachstufe des<br />
Niederdeutschen.<br />
Literatur: Primärliteratur: Heliand und Genesis, hrsg. von Otto Behaghel, 10. überarb. Aufl. v.<br />
Burkhard Taeger, Tübigen 1996 (Altdeutsche Textbibliothek. Bd. 4). Köbler, Gerhard, Sammlung<br />
aller altsächsischen Texte, Gießen 1987 (Arbeiten zur Rechts- und Sprachwissenschaft. Bd. 31).<br />
Steinmeyer, Elias von, Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler, 3. Aufl. Dublin und Zürich<br />
1971 (1. Aufl. Berlin 1916). Sekundärliteratur: Cordes, Gerhard, Altniederdeutsches Elementarbuch.<br />
Wort- und Lautlehre, mit einem Kapitel „Syntaktisches“ von Ferdinand Holthausen, Heidelberg 1973<br />
(Germanische Bibliothek). Gallée, Johan Hendrik, Altsächsische Grammatik. Register von Johannes<br />
Lochner. 3. Aufl. mit Berichtigungen und Nachträgen von Heinrich Tiefenbach, Tübingen 1993<br />
(Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. A. Hauptreihe Nr. 6). Holthausen,<br />
Ferdinand, Altsächsisches Wörterbuch, 2. Aufl. Köln und Graz 1967 (Niederdeutsche Studien. Bd. 1).<br />
Grundlegend ist das Kapitel IX. Ergebnisse der Sprachgeschichtsforschung zu den historischen<br />
Sprachstufen II: Das Altniederdeutsche (Altsächsische) in dem Band Sprachgeschichte: Ein<br />
Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Halbband 2, hrsg. von<br />
Werner Besch u. a. 2. Aufl. Berlin und New York 2000 (HSK. Bd. 2), Sp. 1240-1293, mit den<br />
Beiträgen verschiedener Autoren zum Altsächsischen, so Thomas Klein, (80.) Phonetik und<br />
Phonologie, Graphetik und Graphemik des Altniederdeutschen (Altsächsischen), Sp. 1248-1252.<br />
050344 Neuniederdeutsche Kurzprosa<br />
2-std., Mo 12.15-13.45 U. Weber<br />
Modul D<br />
Neben der Lyrik ist sicherlich die Kurzprosa heute der<br />
produktivste Bereich literarischen Schaffens im<br />
Niederdeutschen. Ausgehend vom Neubeginn in der<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts soll der Entwicklung auf<br />
diesem Gebiete nachgegangen werden, wobei der<br />
Schwerpunkt auf dem Zeitraum der letzten fünfzig<br />
Jahre liegen soll. Neben wichtigen Autoren und ihren<br />
Texten (Wolfgang Sieg mit seinen Satiren in niederdeutscher<br />
Sprache und auf Missingsch; Harald<br />
Karolczak mit Grotesken und Satiren; Jochen Steffen<br />
alias Kuddl Schnööf mit Politsatiren auf Missingsch u.<br />
a. m.) sollen hier auch einige Spezialformen behandelt<br />
werden: Novellen; Radioglossen der Hör-mal-‘n-betento-Reihe,<br />
„Von der gereimten Anekdote zur trivialen<br />
Erfolgsprosa“. Eine Sitzung soll Norbert Johannimloh<br />
gewidmet werden, der eine Reihe von Kapiteln aus<br />
seinem hochdeutschen Prosaband „Appelbaum-
chaussee“ in niederdeutscher Sprache als eigene Texte veröffentlichte. Schließlich werden auch die<br />
Übersetzungsliteratur und die Sachprosa betrachtet.<br />
Literatur: CORDES, Gerhard: Niederdeutsche Mundartdichtung. In: Stammler, Wolfgang (Hrsg.):<br />
Deutsche Philologie im Aufriß. Bd. II. 2. überarb. Aufl.. 2. unveränderter Nachdruck. Berlin 1978. Sp.<br />
2405-2444.<br />
GRAMBOW, Jürgen: Erinnern und Erzählen. Mundartprosa in der DDR. In: Herrmann-Winter,<br />
Renate (Hrsg.): Heimatsprache zwischen Ausgrenzung und ideologischer Einbindung. Niederdeutsch<br />
in der DDR. Frankfurt am Main 1998. S. 171-182.<br />
MEIER, Jürgen: Erzählende Dichtung. In: Cordes, Gerhard / Möhn, Dieter (Hrsg.): Handbuch zur<br />
niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Berlin 1983. S. 436-465.<br />
ÜBUNGEN IM BEREICH SPRACHDIDAKTIK<br />
050566 Begleitseminar zum dreiwöchigen Schulpraktikum 2: Sprachunterricht<br />
(Sekundarstufe I, nur für das Grundstudium)<br />
2-std., Mo 14.15-15.45 A. Hoppe<br />
Modul E<br />
Didaktisch–methodische Überlegungen und Entscheidungen beim Erstellen von thematischen Unterrichtseinheiten<br />
und Unterrichtsstunden, Arbeit mit dem Lehrplan, Kriterien der Stoffauswahl, Erstellen<br />
von Unterrichtsentwürfen, Methodenreflexion sowie Einsatz von Medien.<br />
Erwerb einer Bescheinigung als Voraussetzung zur Anerkennung des Schulpraktikums.<br />
050285 Begleitseminar zum fachdidaktischen Semesterpraktikum<br />
(Sekundarstufe II, nur für das Grundstudium)<br />
2-std., Di 10.15-11.45 H. Jessen<br />
Modul E<br />
Didaktisch–methodische Überlegungen und Entscheidungen beim Erstellen von thematischen Unterrichtseinheiten<br />
und Unterrichtsstunden, Arbeit mit dem Lehrplan, Kriterien der Stoffauswahl, Erstellen<br />
von Unterrichtsentwürfen, Methodenreflexion sowie Einsatz von Medien.<br />
Erwerb einer Bescheinigung als Voraussetzung zur Anerkennung des Schulpraktikums<br />
050332 Reflexion über Möglichkeiten des Einsatzes der "Neuen Medien"<br />
(Internet, Intranet, Suchmaschinen, CD, DVD) in der Sekundarstufe II<br />
2-std., Mi 16.15-17.45 C.-P. Becke<br />
Modul E<br />
Im Schuljahr 2008/09 wird die so genannte Profil-Oberstufe eingeführt. Damit ändert sich die<br />
Organisationsform des Oberstufenunterrichts erheblich. In Zukunft wird es keine Leistungs- und<br />
Grundkurse mehr geben, sondern Kernfächer und Profile. Zu den Kernfächern gehört auch das Fach<br />
Deutsch. Profile werden von Schulen je nach ihren Möglichkeiten angeboten. Als Profiltypen stehen<br />
ein sprachliches, ein mathematisch-naturwissenschaftliches, ein gesellschaftswissenschaftliches und<br />
ein ästhetisches zur Wahl. In der Regel wird jede Schule versuchen, verteilt auf vier Klassen, vier<br />
verschiedene Profile anzubieten. Die Kernfächer stehen als profilgebende Fächer nicht zur<br />
Verfügung.<br />
Natürlich gelten weiterhin die bestehenden Lehrpläne. Darüber hinaus aber ist den Schulen die<br />
Aufgabe gestellt, Profilthemen zu formulieren, die Themen finden, zu denen mehrere Fächer
zusammenarbeiten. Welchen Platz kann das Fach Deutsch als Kernfach im Rahmen eines<br />
sprachlichen Profils mit Blick auf die Erfüllung der Lehrplanforderung, Reflexion über Sprache zu<br />
initiieren, finden? Diese Frage soll im Zentrum des <strong>Seminar</strong>s stehen. Angesichts der Tatsache, dass<br />
das Fach seine Rolle unter den veränderten Voraussetzungen neu festlegen muss, ergibt sich für die<br />
Lehrveranstaltung der Charakter eines nach neuen Wegen suchenden Experiments. Es gibt<br />
insbesondere zu den Themen, die ich im Folgenden beschreiben möchte, wenig, auf das aufgebaut<br />
werden kann, in vielen Bereichen werden neue Wege beschritten werden müssen.<br />
Leitend für die Arbeit in der Lehrveranstaltung ist die Perspektive, dass es ein sprachliches Profil<br />
"Texttechnologie" gibt, innerhalb dessen z.B. zwei Fremdsprachen, Philosophie und Informatik<br />
zusammenarbeiten; Deutsch und Mathematik sind als Kernfächer ohnehin während der gesamten<br />
dreijährigen Oberstufe dabei.<br />
Folgende Themenstellungen möchte ich anbieten:<br />
1. Ausgehend von den Werkzeugen, die die 'Text Encoding Initiative' (TEI) bereitstellt, werden<br />
Editionsprojekte in den Unterricht, die dazu dienen sollen, Texte im Web zugänglich zu machen,<br />
einbezogen. In den 80iger Jahren wurde die TEI in den USA begründet, um Probleme zu lösen, die<br />
sich für die elektronische Bearbeitung von Texten ergeben, wenn in unterschiedlichen Einrichtungen<br />
Rechner mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Textverarbeitungssystemen arbeiten.<br />
2. Seit vielen Jahrzehnten nimmt in der Syntax das Parsing-Problem breiten Raum ein. Eine<br />
Grammatik als Erzeugungssystem für sprachliche Ausdrücke ist die Grundlage dafür, Automaten zu<br />
entwickeln, mit deren Hilfe sprachliche Ausdrücke maschinell analysiert werden können. Die<br />
Aufgaben, die im Verfolg dieser Themenstellung zu lösen sind, finden in vielen Bereichen praktische<br />
Anwendung: Suchmaschinen müssen Eingaben parsen, um auf eine Anfrage reagieren zu können;<br />
Telekommunikationsfirmen parsen Emails, um die gewaltigen Textmengen, die via email eingehen,<br />
bewältigen zu können.<br />
Technische Vorkenntnisse in den genannten Bereichen sind hilfreich, aber nicht notwendig. Allen<br />
Interessierten werden die Grundlagen, die zum Verständnis der zu diskutierenden Fragestellungen<br />
benötigt werden, vermittelt. Zu Beginn des Semesters müssen wir im Abgleich unserer Interessen und<br />
Kenntnisse abstimmen, wie wir vorgehen wollen.<br />
Eine Anmeldung per email bei mir (azcpb@gmx.de) ist wünschenswert, um Literaturhinweise zur<br />
Vorbereitung zu erhalten.<br />
050281 Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten<br />
2-std., Di 14.15-15.45 J. Kilian<br />
Modul E<br />
In dieser Veranstaltung werden nach einer grundlegenden Einführung in das äußerst komplexe und<br />
facettenreiche Themenfeld „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten“ verschiedene Möglichkeiten einer<br />
wechselseitig aufeinander bezogenen Diagnose und Förderung von Rechtschreibschwierigkeiten im<br />
Bereich des Erwerbs und der Entwicklung orthographischer Kompetenzen erarbeitet. Auf dieser<br />
Grundlage sollen im <strong>Seminar</strong> Diagnose und Förderung an authentischen Fällen exemplarisch<br />
diskutiert und kritisch reflektiert werden.<br />
Literaturhinweise: Ein Reader mit den der Arbeit im <strong>Seminar</strong> zugrunde liegenden Texten kann zu<br />
Beginn des Semesters im Sekretariat des Lehrstuhls für Deutsche Philologie/Didaktik der deutschen<br />
Sprache (Frau Zander-Röpstorff, LS 8, Zi. 407) erworben werden. Weitere Literaturhinweise in der<br />
Veranstaltung und in den Texten.<br />
Teilnahme- und Leistungsnachweis: Für einen unbenoteten Teilnahmenachweis ist regelmäßige<br />
Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie die Anfertigung eines Förderplans für die Förderung der<br />
orthographischen Kompetenz am Beispiel der Daten eines Realschülers (6. Jahrgangsstufe)<br />
erforderlich.
050563 Von der Lautschreibung bis zur Getrennt- und Zusammenschreibung:<br />
Überlegungen zu einem effektiven Rechtschreibunterricht<br />
2-std., Mo 14.15-15.45 G. Rudolph<br />
Modul E<br />
In der Lehrveranstaltung, die für alle Lehramtskandidaten geeignet ist, steht die Erörterung<br />
linguistischer und didaktischer Fragen der Rechtschreibung und des Rechtschreibunterrichts auf der<br />
Sekundarstufe I und II im Mittelpunkt. Nach der Klärung des Orthographie-Begriffes werden – in<br />
Anlehnung an Eisenbergs System der orthographischen Prinzipien – ausführlich lautbedingte, silbisch<br />
bedingte sowie morphologisch bedingte Schreibungen diskutiert.<br />
Vorausgesetzt wird die Kenntnis der im Rahmen der Rechtschreibreform vollzogenen Veränderungen.<br />
Literatur: Deutsche Rechtschreibung in der Fassung vom 01.08.2006. Regeln und Wörterverzeichnis.<br />
Amtliche Regelung.<br />
050282 Linguistisches und Didaktisches zur Kommasetzung<br />
2-std., Di 8.15-9.45 G. Rudolph<br />
Modul E<br />
Die Zeichensetzung ist bekanntlich der Bereich der deutschen Orthographie, in dem am häufigsten der<br />
Begriff „Sprachgefühl“ bemüht wird, wenn etwa das Setzen von Kommas begründet werden soll.<br />
Zudem ist der Anteil von Kommafehlern (25 %) an der Gesamtfehlerzahl vergleichsweise sehr hoch.<br />
Die Übung verfolgt zunächst das Ziel, den Ursachen für diese Tatbestände nachzugehen und die<br />
syntaktisch-strukturelle Bedingtheit der Kommasetzung, die im Dienste der Leser stehen sollte, zu<br />
erörtern. In einem zweiten Teil sollen didaktische Überlegungen zur Vermittlung und Aneignung im<br />
Sprachunterricht im Mittelpunkt stehen. Dabei werden verschiedene Vermittlungsmodelle nach ihrer<br />
Praktikabilität diskutiert.<br />
Literatur: Afflerbach, S.: Grammatikalisierungsprozesse bei der Entwicklung der Kommasetzungsfähigkeiten.<br />
In: Grammatikalisierung, Spracherwerb und Schriftlichkeit / hrsg. von Helmut Feilke.<br />
Tübingen, 2001.<br />
Primus, B.: Satzbegriff und Interpunktion. In: Zur Neuregelung der deutschen Orthographie / hrsg.<br />
von Gerhard Augst u.a. Tübingen, 1997.<br />
Menzel, W.; H. Sitta: Interpunktion – Zeichensetzung in der Schule. In: Praxis Deutsch, Heft 55 /<br />
1982.<br />
050277 Repetitorium: Grundbegriffe der deutschen (Schul-)Grammatik II: Morphologie<br />
2-std., Di 10.15-11.45 G. Rudolph<br />
Modul E<br />
Diese Veranstaltung ist die Fortführung der Übung Grundbegriffe der deutschen (Schul-)Grammatik<br />
I: Syntax. Hier sollen die wesentlichen morphologischen Phänomene, die im Lernbereich „Reflexion<br />
über Sprache“ zu behandeln sind, Gegenstand der Diskussion und praktischer Übungen sein. Im<br />
Einzelnen geht es um den Erwerb von Fähigkeiten, schülerorientiert und schülergemäß das<br />
Wortartensystem, Funktionen und Formen der einzelnen Wortarten, dabei vor allem die der Verben,<br />
darstellen und vermitteln zu können. Grundlage aller Überlegungen wird die Frage sein, mit welchen<br />
Verfahren und Operationen sich die Lernenden die notwendigen Kenntnisse zu den einzelnen<br />
Wortarten aneignen können.<br />
Literatur: Ulrich, W. (Hg.): Grammatik, Braunschweig 1997. Ulrich, W. (Hg.): Wort Satz Text,<br />
Braunschweig 1998.
050343 Modernes Niederdeutsch<br />
HAUPTSEMINARE (Hauptstudium)<br />
2-std., Do 14.15-15.45 M. Elmentaler<br />
Modul A<br />
Bei gezielten Befragungen älterer, dialektkompetenter Sprecher aus Schleswig-Holstein lässt sich<br />
häufig feststellen, dass die heutigen niederdeutschen (= plattdeutschen) Ortsmundarten in Aussprache<br />
und Grammatik noch erstaunlich große Übereinstimmungen mit den Mundarten aufweisen, die vor<br />
mehr als einem Jahrhundert von Dialektologen beschrieben worden sind. Einen anderen Eindruck<br />
bekommt jedoch, wer sich das spontan gesprochene Niederdeutsch von Sprechern der mittleren und<br />
jüngeren Generation anhört. In diesem modernen Niederdeutsch lassen sich einerseits deutliche<br />
Einflüsse des Hochdeutschen feststellen, andererseits zeigen sich aber auch Tendenzen, wie sie sich<br />
in vielen gesprochenen Sprachen der westlichen Welt nachweisen lassen: Entlehnungen aus dem<br />
Englischen, Internationalismen, Fachwörter, Einflüsse aus der sog. Jugendsprache usw. Im <strong>Seminar</strong><br />
werden wir anhand von Tonaufnahmen aus dem aktuellen Projekt "Sprachvariation in Norddeutschland"<br />
versuchen, diese verschiedenen Charakteristika des modernen Niederdeutschen auf<br />
verschiedenen Ebenen (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik) herauszuarbeiten und zu untersuchen,<br />
wie diese Neuerungen in den traditionellen Dialekt "eingepasst" werden. Voraussetzung für<br />
die Teilnahme am <strong>Seminar</strong> ist ein Interesse an der niederdeutschen Sprache und an gegenwärtigen<br />
Sprachwandelprozessen. Eine aktive Beherrschung des Niederdeutschen wird nicht vorausgesetzt.<br />
050340 Missingsch<br />
2-std., Mi 10 15-11.45 M. Elmentaler<br />
Modul A, B<br />
Mit dem Begriff "Missingsch" bezeichnet man in der Sprachwissenschaft ein gesprochenes<br />
Hochdeutsch, das in Aussprache, Grammatik und Wortschatz starke Einflüsse aus den niederdeutschen<br />
Dialekten aufweist. In der Schriftlichkeit sind derartige Sprachformen sicher seit dem 18.<br />
Jahrhundert greifbar, möglicherweise lassen sich jedoch auch schon ältere Sprachzeugnisse aus dem<br />
niederdeutschen Raum in dieser Weise interpretieren. Bei Autoren wie Fritz Reuter oder John<br />
Brinckman wird Missingsch häufig zur Personencharakterisierung eingesetzt. Diese Entwicklungslinie<br />
lässt sich bis heute im Bereich von Literatur und Kabarett weiterverfolgen, während ein<br />
ausgeprägtes Missingsch im Alltag kaum noch zu hören ist. Im <strong>Seminar</strong> werden wir uns anhand einer<br />
Reihe von fiktionalen Texten mit den verschiedenen Erscheinungsformen und möglichen Funktionen<br />
des Missingsch beschäftigen sowie mit der Frage, inwiefern die heutigen Umgangssprachen des<br />
norddeutschen Raumes davon abweichen.<br />
050275 Linguistische Pragmatik<br />
2-std., Do 8.15-9.45 M. Hundt<br />
Modul A<br />
Ziel dieses <strong>Seminar</strong>s ist es, die wichtigsten Gegenstandsbereiche der lingustischen Pragmatik sowohl<br />
in ihrer theoretischen Fundierung als auch in unterschiedlichen Anwendungsfällen darzustellen und<br />
kritisch zu diskutieren. Ausgehen werden wir von der Frage, was man sich unter einer linguistischen<br />
Pragmatik überhaupt vorzustellen hat (kommunikative Handlungskompetenz vs. grammatische<br />
Sprachkompetenz, Sprache als Handeln, der Einfluss von Kontextfaktoren auf die sprachliche<br />
Kommunikation usw.). Daran schließen sich die mittlerweile als klassisch zu bezeichnenden<br />
Anwendungsgebiete der linguistischen Pragmatik an, die sich u. a. mit folgenden Fragen beschäftigen:<br />
Welche Funktion haben personale (ich, du, er/sie/es), lokale (hier, da, dort...), temporale (gestern,<br />
heute, morgen ...) und andere Deiktika in der Alltagsskommunikation? (Deixis) Welche Schlüsse<br />
müssen wir ziehen, um vom Gesagten, von der sprachlichen Oberfläche einer Äußerung zum<br />
tatsächlich Gemeinten zu gelangen? (Präsuppositionen, konversationelle Implikaturen, logische<br />
Folgerungen) Wie sieht das Spektrum an Sprechhandlungstypen in der Alltagskommunikation aus
(Sprechakttheorie)? Welche Voraussetzungen und Grundannahmen müssen zwischen Sprecher und<br />
Hörer gelten, wenn Kommunikation erfolgreich sein soll? Oder: Warum missverstehen wir uns nicht<br />
viel häufiger, als dies tatsächlich der Fall ist? (Konversationsmaximen) Nach welchen Regularitäten<br />
richten sich unterschiedliche mündliche Gesprächssorten? Oder: Woher wissen wir, wie ein typischer<br />
Streit, ein Small-Talk, eine Beschwerde, eine Paradie etc. strukturiert ist (Gesprächsanalyse)? Wie<br />
bestimmt unser Textmuster- und Textsortenwissen die Wahrnehmung und Interpretation konkreter<br />
Textexemplare? (Textgrammatik) Welche kulturspezifischen Faktoren regeln die Alltagskommunikation?<br />
(z. B. Formen sprachlicher Höflichkeit)<br />
Materialien: Die Materialien zum <strong>Seminar</strong> werden zu Beginn des Semesters im Internet zum<br />
Herunterladen zur Verfügung gestellt. Alle <strong>Seminar</strong>teilnehmer werden gebeten, die Unterlagen vor<br />
der ersten Sitzung unter der Adresse www.germsem.uni-kiel.de/hundt herunterzuladen!<br />
Literatur: Levinson, Stephen C. (2000): Pragmatik. 3. Auflage. Tübingen. Meibauer, Jörg (1999):<br />
Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen. Ernst, Peter (2002): Pragmalinguistik. Grundlagen.<br />
Anwendungen. Probleme. Berlin/New York.<br />
050272 Historische Syntax der deutschen Sprache<br />
2-std., Fr 10.15-11.45 M. Hundt<br />
Modul A, B<br />
In der Geschichte der deutschen Sprache haben sich seit dem Althochdeutschen zahlreiche<br />
Veränderungen in der Morphologie und Syntax vollzogen. Wenn man davon spricht, dass sich die<br />
deutsche Sprache von einer synthetischen zu einer eher synthetisch-analytischen Sprache entwickelt<br />
hat, ist dies nur eine recht grobe Orientierung. Spannend wird es eigentlich erst dann, wenn man sich<br />
einzelne syntaktische Phänomene in ihrer historischen Entwicklung und im Sprachenvergleich<br />
ansieht. Weshalb entwickelt z. B. das Deutsche ein grammatikalisiertes werden-Futur erst vergleichsweise<br />
spät? Wie entwickelte sich das heute so vielfältig ausgebaute Konjunktionensystem? Wir<br />
werden uns mit diesen und anderen Phänomenen wie der Entstehung der Artikel, der Relativsatzanschlüsse,<br />
der dass-Objektsätze, der periphrastischen Verbalformen (Perfekt, Futur, Passiv), der<br />
Ausbildung des Satzrahmens, dem Konjunktionensystem beschäftigen.<br />
Materialien: Die Materialien zum Hauptseminar werden zu Beginn des Semesters im Internet zum<br />
Herunterladen zur Verfügung gestellt.<br />
Alle <strong>Seminar</strong>teilnehmer werden gebeten, die Unterlagen vor der ersten Sitzung unter der Adresse<br />
www.germsem.uni-kiel.de/hundt herunterzuladen!<br />
Literatur: Nübling, Damaris et al. (2006): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine<br />
Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. Tübingen. Behaghel, Otto (1923-1932): Deutsche<br />
Syntax. Eine geschichtliche Darstellung. 4 Bände. Heidelberg. Betten, Anne (1987): Grundzüge der<br />
Prosasyntax. Stilprägende Entwicklungen vom Althochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Tübingen.<br />
Ebert, Robert Peter (1978): Historische Syntax des Deutschen. Stuttgart. Ebert, Robert Peter (1986):<br />
Historische Syntax des Deutschen II: 1300–1750. Bern/Frankfurt am Main/New York. Admoni,<br />
Vladimir G. (1990): Historische Syntax des Deutschen. Tübingen.<br />
050280 Sprache und Sprachgebrauch in neuen Medien – aus linguistischer<br />
und didaktischer Perspektive<br />
2-std., Di 10.15-11.45 J. Kilian<br />
Modul A, E<br />
Seit rund zwanzig Jahren erfahren die beiden prototypischen Medien für sprachliches Handeln – die<br />
gesprochene Sprache und die geschriebene Sprache – eine immense Veränderung ihrer<br />
Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der technischen Entwicklung der so genannten neuen Medien.<br />
Strukturen der gesprochenen Sprache werden verschriftet in privatsprachlichen Chats, E-Mails und im<br />
Short Message Service (SMS); Bausteine schriftlicher Texte werden beliebig kopiert und variiert und<br />
in Hypertextstrukturen eingebettet; mimische und gestische Mittel des natürlichen Gesprächs werden
typographisch oder mit Hilfe neuer Zeichen (z.B. Akronymen, Inflektiven oder Emoticons) in<br />
schriftliche „Gespräche“ gebracht; Computerprogramme bieten für viele gesellschaftliche<br />
Sprachhandlungsanlässe vorgeformte Textmuster an; die Bilderwelt ergreift immer weiteren Raum<br />
der Sprachwelt, Ikonisches und Pikturales bedrängen Sprachlich-Symbolisches.<br />
Viele Schüler/innen produzieren tagtäglich außerhalb ihrer Schulzeit Mengen schriftlicher Texte, die<br />
sie sich in schulischem Kontext oft kaum vorstellen können; an die Stelle von eloquenten Referaten<br />
und Vorträgen sind vielerorts kommentierte Beamer-Präsentationen getreten; Schüler/innen gestalten<br />
im privaten Bereich sprachlich und ikonographisch oft anspruchsvolle Homepages und stellen darin<br />
Text-Bild-Bezüge her, die ihnen im Unterricht oft schwer fallen; bei Anfragen an Suchmaschinen<br />
berücksichtigen sie oft unbewusst Hypertextstrukturen und wählen ganz andere lexikalischsyntaktische<br />
Strukturen als bei Anfragen z.B. an Lexika.<br />
Insofern die Schrift die prototypische sprachliche Existenzform der neuen Medien ist und dort<br />
vornehmlich der Gebrauch der Schriftsprache weit reichenden Veränderungen ausgesetzt ist, werden<br />
in der ersten Hälfte des Hauptseminars schrift- und pragmalinguistische Grundlagen jeweils am<br />
konkreten Beispiel erarbeitet (u.a. zur gesprochenen und geschriebenen Sprache, Graphematik,<br />
Sprechakttheorie, Textlinguistik, Gesprächslinguistik) und wird im Rahmen der neueren deutschen<br />
Sprachgeschichte der Einfluss untersucht, den die neuen Medien auf die deutsche Sprache und den<br />
Sprachgebrauch in einzelnen gesellschaftlichen Kommunikations- und Praxisbereichen bislang<br />
ausgeübt haben. Die zweite Hälfte des Hauptseminars soll der didaktischen Modellierung der<br />
Bewusstmachung dieses Einflusses sowie Untersuchungen eines sprachdidaktisch begründeten<br />
Einsatzes neuer Medien im Deutschunterricht gewidmet sein.<br />
Literaturhinweise: Beißwenger, Michael (Hrsg.): Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion,<br />
Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein<br />
interdisziplinäres Forschungsfeld, Stuttgart 2001. Bittner, Johannes: Digitalität, Sprache,<br />
Kommunikation [...], Berlin 2003. Frederking, Volker/Josting, Petra (Hrsg.): Medienverbund und<br />
Medienintegration im Deutschunterricht. Baltmannsweiler 2005. Höflich, Joachim R./Gebhardt,<br />
Julian (Hrsg.): Vermittlungskulturen im Wandel. Brief, E-mail, SMS, Frankfurt/M. [usw.] 2003.<br />
Josting, Petra/Hoppe, Heidrun (Hrsg.): Mädchen, Jungen und ihre Medienkompetenzen. Aktuelle<br />
Diskurse und Praxisbeispiele für den (Deutsch-) Unterricht. München 2006. Kilian, Jörg: Literarische<br />
Gespräche – online. Facetten des „dramatischen Dialogs“ im Computer-Alltag, in: ZGL 28, 2000,<br />
223-236. Kilian, Jörg: DaF im Chat. Zur Grammatik geschriebener Umgangssprachen als Ergänzung<br />
zum Erwerb standardsprachlichen Wissens, in: Michael Beißwenger/Angelika Storrer (Hrsg.): Chat-<br />
Kommunikation in Beruf, Bildung und Medien: Konzepte – Werkzeuge – Anwendungsfelder,<br />
Stuttgart 2005, 201-220. Kilian, Jörg: Standardnorm versus „Parlando“ in Schüler/innen-Chats und<br />
-SMS. Neue Wege der Sprachkritik im Deutschunterricht am Beispiel kontrastiver Spracharbeit im<br />
Bereich mündlich und schriftlich entfalteter Schriftlichkeit, in: Eva Neuland (Hrsg.): Sprachkritik (=<br />
Der Deutschunterricht 58, 2006, H. 4), 74-83. Kurzrock, Tanja: Neue Medien und Deutschdidaktik.<br />
Tübingen 2003. Möbius, Thomas/Ulrich, Stefan (Hrsg.): Virtuelle Lernumgebungen im<br />
Deutschunterricht. Grundlagen, didaktische Konzepte, Lehreinsatz. Baltmannsweiler 2005. Runkehl,<br />
Jens/Schlobinski, Peter/Siever, Torsten: Sprache und Kommunikation im Internet [...], Opladen 1998.<br />
Schlobinski, Peter (Hrsg.): Von *hdl* bis *cul8r*. Sprache und Kommunikation in den neuen Medien<br />
(Thema Deutsch, Bd. 7), Mannheim [usw.] 2006. Schmitz, Ulrich: Sprache in modernen Medien.<br />
Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen, Berlin 2004. Schmitz, Ulrich/Wyss, Eva<br />
Lia (Hrsg.): Briefkommunikation im 20. Jahrhundert, 2002 (= OBST 64) Schmitz, Ulrich: Neue<br />
Medien und Gegenwartssprache. Lagebericht und Problemskizze, in: Osnabrücker Beiträge zur<br />
Sprachtheorie 50, 1995, 7-51. Weingarten, Rüdiger (Hrsg.): Sprachwandel durch Computer, Opladen<br />
1979. Ziegler, Arne/Dürscheid, Christa (Hrsg.): Kommunikationsform E-Mail, Tübingen 2002.<br />
Weitere Literatur im Hauptseminar und unter www.mediensprache.net<br />
Teilnahme- und Leistungsnachweis: Für einen benoteten Leistungsnachweis: regelmäßige Teilnahme,<br />
aktive Mitarbeit, Referat und darauf aufbauende schriftliche Hausarbeit (entweder mit<br />
sprachwissenschaftlichem oder mit sprachdidaktischem Erkenntnisinteresse). Für einen<br />
Teilnahmenachweis: regelmäßige Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie ein Kurzreferat zu einer<br />
wissenschaftlichen Fragestellung oder die Anfertigung eines kritischen Abstracts zu einem<br />
wissenschaftlichen Aufsatz.
050421 Kognitive Semantik<br />
2-std., Mi 12.00-13.30 S. Vandermeeren<br />
Modul A<br />
Nachdem einleitend der kognitiv-semantische Ansatz beschrieben wird, werden corpuslinguistische<br />
Untersuchungen, für welche die Kognitive Semantik den theoretischen Rahmen bildet, vorgestellt. Es<br />
handelt sich dabei um 6 Corpora bestehend aus<br />
1. Präpositionalphrasen (z.B. in Schwierigkeiten) und<br />
2. Partikelverben (z.B. einschiffen),<br />
3. Komposita mit Personen-,<br />
4. Verwandtschafts- und<br />
5. Körperteilbezeichnungen (z.B. Frauengefängnis, Leihmutter, Flussarm) sowie<br />
6. Metaphern in der Fachsprache der Teilchenphysik (z.B. linkshändige Elementarteilchen).<br />
Die Teilnehmer an diesem Hauptseminar lernen empirisch zu arbeiten, indem sie als Materialgrundlage<br />
für ihre Hausarbeit ein Corpus anlegen, um es mit Hilfe der Erkenntnisse der Kognitiven<br />
Semantik zu kategorisieren. In Kurzreferaten können sie ihre ersten Ergebnisse präsentieren und<br />
eventuelle Kategorisierungsschwierigkeiten ansprechen.<br />
051175 Lambrechts Alexanderlied<br />
2-std., Do 10.15-11.45 U. Kundert<br />
Modul C<br />
Das Alexanderlied des Pfaffen Lambrecht ist – wenn die Überlieferung nicht trügt – eine zweifache<br />
Pionierleistung: Es ist die erste erhaltene schriftliche Großdichtung mit weltlichem Thema, „der erste<br />
deutschsprachige ‚Roman‘“ (Ruh). Und erstmals bedient sich ein Autor nicht einer lateinischen,<br />
sondern einer volkssprachigen, nämlich französischen Vorlage, womit ein Rezeptionsprozess<br />
angestoßen ist, der in der Herausbildung des höfischen Romans und des Minnesangs eine<br />
einflussreiche Rolle spielen wird. Auf Lambrechts Bearbeitung des Stoffes vom Welteroberer<br />
Alexander folgen zahlreiche andere mittel- und frühneuhochdeutsche Adaptationen. Der punktuelle<br />
Quervergleich wird Gelegenheit bieten, spezifische Dimensionen mittelalterlicher Literatur<br />
(Verhältnis zur Vorlage, Geschichte der Romanpoetik) sowie ihr Verhältnis zu Geschichtsschreibung<br />
und Enzyklopädik zu erkunden und nach der literarischen Wahrnehmung des antiken Nahen Ostens<br />
aus der Perspektive eines christlich-europäischen Mittelalters zu fragen.<br />
Zur übergreifenden Thematik ›Der Orient in der deutschen Literatur des Mittelalters und der frühen<br />
Neuzeit‹ findet als sinnvolle Ergänzung eine Vorlesung statt (s. Vorlesungen). Das <strong>Seminar</strong>programm<br />
steht ab 1. Februar im <strong>Seminar</strong>ordner in der Bibliothek des Germanistischen <strong>Seminar</strong>s. Die Hausarbeit<br />
kann auch im Voraus geschrieben werden; eine Voranmeldung in der Sprechstunde ist nur in diesem<br />
Fall nötig.<br />
Zur Einführung: Trude Ehlert: Der Alexanderroman. In: Mittelhochdeutsche Romane und<br />
Heldenepen. Interpretationen, hg. von Horst Brunner. Stuttgart 1993 (Reclams Universal-Bibliothek<br />
8914), S. 21–42.<br />
Bitte kaufen Sie bereits für die erste Sitzung folgende Textausgabe: Lambrecht der Pfaffe:<br />
Alexanderroman. Mhd.-Nhd. Hg., übers. und komm. von Elisabeth Lienert. Stuttgart 2007 (Reclams<br />
Universal-Bibliothek 18508). [ISBN: 978-3-15-018508-7].<br />
050543 Graf Dracula in frühneuhochdeutschen Texten<br />
2-std., Di 16.15-17.45 W. Achnitz<br />
Modul C<br />
Fürst Vlad III. 'Draculea', der dem irischen Schriftsteller Bram Stoker als Namengeber für seinen 1897<br />
erschienenen Roman diente, regierte im 15. Jahrhundert die Walachei (der Beiname weist sein<br />
Geschlecht als Mitglied des Drachenordens aus). Er galt als blutrünstiger Herrscher, der dafür
erüchtigt war, Feinde mit einem Holzpflock pfählen zu lassen, was ihm den Beinamen 'Tepez' ('der<br />
Pfähler') einbrachte; der Legende nach soll er das Blut seiner Opfer getrunken haben. Vlads<br />
Herrschaft endete, als er verraten und von türkischen Soldaten erschlagen wurde. Als man 1931 sein<br />
Grab öffnete, das sich in einem Kloster in der Nähe Bukarests befand, war es angeblich leer…<br />
Das Hauptseminar wird die historischen Wurzeln der Draculalegende aufspüren und sich vorwiegend<br />
mit den deutschsprachigen Zeugnissen des Spätmittelalters beschäftigen.<br />
Da die Dracula-Erzählung zu den meistverfilmten Stoffen der Weltliteratur gehört, werden wir uns<br />
außerhalb des <strong>Seminar</strong>s an mehreren Abenden gemeinsam einige Höhepunkte der Filmgeschichte<br />
ansehen.<br />
Zur Einführung: Dieter Harmening, Der Anfang von Dracula. Zur Geschichte von Geschichten.<br />
Würzburg 1983 (Quellen und Forschungen zur europäischen Ethnologie 1); ders., Art. Drakula, in:<br />
²VL Bd. 2 (1980), Sp. 221-223; Helmut Birkhan, Der grausame Osten. Mentalitätsgeschichtliche<br />
Bemerkungen zum Dracula-Bild bei Michel Beheim, in: Wenn Ränder Mitte werden. Zivilisation,<br />
Literatur und Sprache im interkulturellen Kontext, hg. von Chantal Adobati u.a. Wien 2001, S. 485-<br />
499.<br />
HAUPTSEMINARE IM BEREICH DER SPRACHDIDAKTIK<br />
050360 Empirische Sprachdidaktik: Sprachförderung im Bereich Wortschatz und Semantik<br />
2-std., Mo 14.15-15.45 J. Kilian<br />
Modul E<br />
Gegenstand des Hauptseminars sind Ansätze und Methoden der Erweiterung und Vertiefung der<br />
Wortschatzkompetenz von Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer systematischen Wortschatzarbeit<br />
im Deutschen als Erst- und Zweitsprache. Folgende Aufgabenstellungen werden die Arbeit im<br />
Hauptseminar leiten:<br />
� Erarbeitung linguistischer, entwicklungspsychologischer und sprachdidaktischer Grundlagen für<br />
die Sprachförderung im Bereich Wortschatz und Semantik.<br />
� Zusammenstellung und kritische Bewertung vorhandener Tests zur Ermittlung produktiver und<br />
rezeptiver Wortschatzkenntnis.<br />
� Erarbeitung neuer (reliabler, valider, objektiver/standardisierter) Ansätze und Methoden der<br />
empirischen Erhebung von Wortschatz- und lexikalisch gebundenem Bedeutungswissen zu<br />
förderdiagnostischen Zwecken (Sprachstandsmessung relativ zu Lernaltern; bezogen auf<br />
schulische Phasen: Vorschule, Primarstufe, Sekundarstufe; unterschiedliche Schultypen);<br />
Erarbeitung von Ansätzen zur Dokumentation von Sprachbiographien; Erhebung produktiver und<br />
rezeptiver Wortschatzkompetenz u.a.<br />
� Feststellung und Beschreibung der Einflussmöglichkeiten unterschiedlicher Ansätze und<br />
Methoden der Sprachförderung im Bereich Wortschatz- und lexikalisch gebundenes<br />
Bedeutungswissen.<br />
� Definition des Begriffs „Sprachförderung“ in Bezug auf Wortschatz- und lexikalisch gebundenes<br />
Bedeutungswissen (Förderung zum Zwecke der Befähigung zur Lösung kommunikativer,<br />
kognitiver, rezeptiver/perzeptiver, produktiver/konzeptueller u.a. Aufgaben).<br />
� Formulierung von Kompetenzen, Standards und Aufgaben in Bezug auf Wortschatz- und<br />
lexikalisch gebundenes Bedeutungswissen relativ zu Lernaltern sowie sozio- und varietätenlinguistischen<br />
Abgrenzungen von Wortschatzbereichen; dabei sind sowohl empirische wie auch<br />
normative Aspekte des „Kompetenz“-Begriffs zu berücksichtigen („Ist- und Soll-Zustand“).<br />
Definition, Zusammenstellung und kritische Prüfung eines lexikologisch und lexikalisch-semantisch<br />
begründeten „Grundwortschatzes“ relativ zu Lernaltern.
Literaturhinweise: Aitchison, Jean: Wörter im Kopf – eine Einführung in das mentale Lexikon.<br />
Tübingen, Niemeyer 1997. Anglin, Jeremy M.: The acquisition of word meaning II: Later lexical and<br />
semantic development, in: HSK 21.2, 2005, 1789-1800. Augst, Gerhard/Bauer, Andrea/Stein, Anette:<br />
Grundwortschatz und Idiolekt [...], Tübingen 1977. Bartnitzky, Horst/Christiani, Reinhold (Hrsg.):<br />
Materialband: Grundwortschätze […], Bielefeld 1983. Butzkamm, Wolfgang/Butzkamm, Jürgen: Wie<br />
Kinder sprechen lernen. Tübingen, Franke 1999. Clark, Eve V.: The Lexicon in Acquisition.<br />
Cambridge 1993. Clark, Eve V.: Über den Erwerb von Antonymien in zwei semantischen Feldern<br />
durch das Kind, in: Wolfgang Eichler/Adolf Hofer (Hrsg.): Spracherwerb und linguistische Theorien<br />
[...], München 1974, 399-414. Elben, Cornelia Ev: Sprachverständnis bei Kindern. Untersuchungen<br />
zur Diagnostik im Vorschul- und frühen Schulalter, Münster 2002. Füssenich, Iris: Semantik, in:<br />
Stephan Baumgartner/Iris Füssenich (Hrsg.): Sprachtherapie mit Kindern. Grundlagen und Verfahren.<br />
2. Aufl. München, Basel 1994, 80-122. Grohnfeldt, Manfred (Hrsg.): Störungen der Semantik (=<br />
Handbuch der Sprachtherapie, Bd. 3), 3. Aufl. Berlin, Ed. Marhold 2002. Hesse, Harlinde/Wagner,<br />
Klaus R.: Der Grundwortschatz der Primarstufe [...] Dorsten 1985. Kauschke, Christina. Der Erwerb<br />
des frühkindlichen Lexikons, Tübingen, Narr 2000. Kühn, Peter (Hrsg.): Wortschatzarbeit in der<br />
Diskussion, Hildesheim, New York 2000. Meibauer, Jörg/Rothweiler, Monika (Hrsg.): Das Lexikon<br />
im Spracherwerb, Tübingen 1999. Niedersteberg, Ingrid: Aufbau eines Grundwortschatzes: Klasse 1<br />
und 2, Bielefeld 1983. Pregel, Dietrich/Rickheit, Gert: Der Wortschatz im Grundschulalter [...],<br />
Hildesheim [...], 1987. Szagun, Gisela: Bedeutungsentwicklung beim Kind. Wie Kinder Wörter<br />
entdecken, München 1983. Szagun, Gisela: Sprachentwicklung beim Kind. 6., vollständig überarb.<br />
Aufl. Weinheim 1996. Ulrich, Winfried: Förderung von Ambiguitätstoleranz. Zum Umgang mit<br />
sprachspielerischen Texten in der Sekundarstufe I, in: Deutschunterricht 48, 1995, H. 1, 2-11. Ulrich,<br />
Winfried: Wortschatzerweiterung und Wortbildungskompetenz, in: Klaus Detering (Hrsg.):<br />
Wortschatz und Wortschatzvermittlung, Frankfurt/M. 2000, 9-27. Weinert, Sabine: Sprach- und<br />
Denkentwicklung, in: Grimm, Hannelore (Hrsg.): Enzyklopädie der Psychologie, Bd. 3: Sprachentwicklung,<br />
Göttingen 2000). Weitere Literatur im Hauptseminar.<br />
Teilnahme- und Leistungsnachweis: Für einen benoteten Leistungsnachweis: regelmäßige Teilnahme,<br />
aktive Mitarbeit, Referat und darauf aufbauende schriftliche Hausarbeit. Für einen<br />
Teilnahmenachweis: regelmäßige Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie ein Kurzreferat zu einer<br />
wissenschaftlichen Fragestellung oder die Anfertigung eines kritischen Abstracts zu einem<br />
wissenschaftlichen Aufsatz.<br />
050280 Sprache und Sprachgebrauch in neuen Medien – aus linguistischer<br />
und didaktischer Perspektive<br />
2-std., Di 10.15-11.45 J. Kilian<br />
Modul A, E<br />
Seit rund zwanzig Jahren erfahren die beiden prototypischen Medien für sprachliches Handeln – die<br />
gesprochene Sprache und die geschriebene Sprache – eine immense Veränderung ihrer Einsatzmöglichkeiten<br />
im Rahmen der technischen Entwicklung der so genannten neuen Medien. Strukturen<br />
der gesprochenen Sprache werden verschriftet in privatsprachlichen Chats, E-Mails und im Short<br />
Message Service (SMS); Bausteine schriftlicher Texte werden beliebig kopiert und variiert und in<br />
Hypertextstrukturen eingebettet; mimische und gestische Mittel des natürlichen Gesprächs werden<br />
typographisch oder mit Hilfe neuer Zeichen (z.B. Akronymen, Inflektiven oder Emoticons) in<br />
schriftliche „Gespräche“ gebracht; Computerprogramme bieten für viele gesellschaftliche Sprachhandlungsanlässe<br />
vorgeformte Textmuster an; die Bilderwelt ergreift immer weiteren Raum der<br />
Sprachwelt, Ikonisches und Pikturales bedrängen Sprachlich-Symbolisches.<br />
Viele Schüler/innen produzieren tagtäglich außerhalb ihrer Schulzeit Mengen schriftlicher Texte, die<br />
sie sich in schulischem Kontext oft kaum vorstellen können; an die Stelle von eloquenten Referaten<br />
und Vorträgen sind vielerorts kommentierte Beamer-Präsentationen getreten; Schüler/innen gestalten<br />
im privaten Bereich sprachlich und ikonographisch oft anspruchsvolle Homepages und stellen darin<br />
Text-Bild-Bezüge her, die ihnen im Unterricht oft schwer fallen; bei Anfragen an Suchmaschinen<br />
berücksichtigen sie oft unbewusst Hypertextstrukturen und wählen ganz andere lexikalischsyntaktische<br />
Strukturen als bei Anfragen z.B. an Lexika.
Insofern die Schrift die prototypische sprachliche Existenzform der neuen Medien ist und dort<br />
vornehmlich der Gebrauch der Schriftsprache weit reichenden Veränderungen ausgesetzt ist, werden<br />
in der ersten Hälfte des Hauptseminars schrift- und pragmalinguistische Grundlagen jeweils am<br />
konkreten Beispiel erarbeitet (u.a. zur gesprochenen und geschriebenen Sprache, Graphematik,<br />
Sprechakttheorie, Textlinguistik, Gesprächslinguistik) und wird im Rahmen der neueren deutschen<br />
Sprachgeschichte der Einfluss untersucht, den die neuen Medien auf die deutsche Sprache und den<br />
Sprachgebrauch in einzelnen gesellschaftlichen Kommunikations- und Praxisbereichen bislang<br />
ausgeübt haben. Die zweite Hälfte des Hauptseminars soll der didaktischen Modellierung der<br />
Bewusstmachung dieses Einflusses sowie Untersuchungen eines sprachdidaktisch begründeten<br />
Einsatzes neuer Medien im Deutschunterricht gewidmet sein.<br />
Literaturhinweise: Beißwenger, Michael (Hrsg.): Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion,<br />
Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein<br />
interdisziplinäres Forschungsfeld, Stuttgart 2001. Bittner, Johannes: Digitalität, Sprache,<br />
Kommunikation [...], Berlin 2003. Frederking, Volker/Josting, Petra (Hrsg.): Medienverbund und<br />
Medienintegration im Deutschunterricht. Baltmannsweiler 2005. Höflich, Joachim R./Gebhardt,<br />
Julian (Hrsg.): Vermittlungskulturen im Wandel. Brief, E-mail, SMS, Frankfurt/M. [usw.] 2003.<br />
Josting, Petra/Hoppe, Heidrun (Hrsg.): Mädchen, Jungen und ihre Medienkompetenzen. Aktuelle<br />
Diskurse und Praxisbeispiele für den (Deutsch-) Unterricht. München 2006. Kilian, Jörg: Literarische<br />
Gespräche – online. Facetten des „dramatischen Dialogs“ im Computer-Alltag, in: ZGL 28, 2000,<br />
223-236. Kilian, Jörg: DaF im Chat. Zur Grammatik geschriebener Umgangssprachen als Ergänzung<br />
zum Erwerb standardsprachlichen Wissens, in: Michael Beißwenger/Angelika Storrer (Hrsg.): Chat-<br />
Kommunikation in Beruf, Bildung und Medien: Konzepte – Werkzeuge – Anwendungsfelder,<br />
Stuttgart 2005, 201-220. Kilian, Jörg: Standardnorm versus „Parlando“ in Schüler/innen-Chats und<br />
-SMS. Neue Wege der Sprachkritik im Deutschunterricht am Beispiel kontrastiver Spracharbeit im<br />
Bereich mündlich und schriftlich entfalteter Schriftlichkeit, in: Eva Neuland (Hrsg.): Sprachkritik (=<br />
Der Deutschunterricht 58, 2006, H. 4), 74-83. Kurzrock, Tanja: Neue Medien und Deutschdidaktik.<br />
Tübingen 2003. Möbius, Thomas/Ulrich, Stefan (Hrsg.): Virtuelle Lernumgebungen im<br />
Deutschunterricht. Grundlagen, didaktische Konzepte, Lehreinsatz. Baltmannsweiler 2005. Runkehl,<br />
Jens/Schlobinski, Peter/Siever, Torsten: Sprache und Kommunikation im Internet [...], Opladen 1998.<br />
Schlobinski, Peter (Hrsg.): Von *hdl* bis *cul8r*. Sprache und Kommunikation in den neuen Medien<br />
(Thema Deutsch, Bd. 7), Mannheim [usw.] 2006. Schmitz, Ulrich: Sprache in modernen Medien.<br />
Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen, Berlin 2004. Schmitz, Ulrich/Wyss, Eva<br />
Lia (Hrsg.): Briefkommunikation im 20. Jahrhundert, 2002 (= OBST 64) Schmitz, Ulrich: Neue<br />
Medien und Gegenwartssprache. Lagebericht und Problemskizze, in: Osnabrücker Beiträge zur<br />
Sprachtheorie 50, 1995, 7-51. Weingarten, Rüdiger (Hrsg.): Sprachwandel durch Computer, Opladen<br />
1979. Ziegler, Arne/Dürscheid, Christa (Hrsg.): Kommunikationsform E-Mail, Tübingen 2002.<br />
Weitere Literatur im Hauptseminar und unter www.mediensprache.net<br />
Teilnahme- und Leistungsnachweis: Für einen benoteten Leistungsnachweis: regelmäßige Teilnahme,<br />
aktive Mitarbeit, Referat und darauf aufbauende schriftliche Hausarbeit (entweder mit<br />
sprachwissenschaftlichem oder mit sprachdidaktischem Erkenntnisinteresse). Für einen<br />
Teilnahmenachweis: regelmäßige Anwesenheit, aktive Mitarbeit sowie ein Kurzreferat zu einer<br />
wissenschaftlichen Fragestellung oder die Anfertigung eines kritischen Abstracts zu einem<br />
wissenschaftlichen Aufsatz.<br />
KOLLOQUIEN/OBERSEMINARE (Hauptstudium)<br />
050283 Examenskolloquium<br />
2-std., Mi 10.15-11.45 M. Hundt<br />
Dieses Kolloquium ist für alle Studierenden gedacht, die sich in den kommenden Semestern auf<br />
sprachwissenschaftliche Themen fürs Examen (Staatsexamen, Magister) vorbereiten möchten. Wir<br />
werden im Kolloquium sowohl Ausschnitte aus dem Spektrum der mündlichen Prüfungsthemen als
auch wichtige Schritte für die Klausurvorbereitung besprechen. Dabei werden sowohl gegenwartsbezogene<br />
als auch sprachhistorische Themen diskutiert.<br />
Materialien: Alle Teilnehmer des Kolloquiums werden gebeten, die für diese Lehrveranstaltung zur<br />
Verfügung gestellten Materialien vor der ersten Sitzung aus dem Internet herunterzuladen<br />
(www.germsem.uni-kiel.de/hundt).<br />
050274 Oberseminar: Neuere Forschungen zur germanistischen Sprachwissenschaft<br />
2-std., Do 14.15-15.45 M. Hundt<br />
Das Oberseminar ist als Diskussionsforum für alle gedacht, die sich mit aktuellen Fragestellungen der<br />
germanistischen Sprachwissenschaft auseinandersetzen.<br />
Gedacht ist das <strong>Seminar</strong> für alle Studierenden im Bereich der deutschen Sprachwissenschaft,<br />
insbesondere auch für diejenigen, die eine Examensarbeit oder eine Dissertation im Bereich der<br />
deutschen Sprachwissenschaft verfassen. Das <strong>Seminar</strong> ist jedoch nicht nur auf die Vorstellung solcher<br />
Arbeiten beschränkt, sondern auch offen für die Diskussion neuer Publikationen (z. B. Rödel,<br />
Michael: Doppelte Perfektbildungen und die Organisation von Tempus im Deutschen. Stauffenburg:<br />
Tübingen 2007; Köller, Wilhelm: Perspektivität und Sprache. Zur Struktur von Objektivierungsformen<br />
in Bildern, im Denken und in der Sprache. Berlin/New York: de Gruyter 2004; Clark, Eve:<br />
First Language Acquisition. Cambridge u.a.: CUP 2003/2006; Welke, Klaus: Tempus im Deutschen.<br />
Berlin/New York: de Gruyter 2005; u.v.a.m.). Vorschläge der <strong>Seminar</strong>teilnehmer sind willkommen!<br />
Materialien: Alle Teilnehmer des Kolloquiums werden gebeten, die für diese Lehrveranstaltung zur<br />
Verfügung gestellten Materialien vor der ersten Sitzung aus dem Internet herunterzuladen<br />
(www.germsem.uni-kiel.de/hundt).<br />
050333 Oberseminar: Tannhäuser übersetzen<br />
2-std., Sa 15.00-18.00 (alle zwei Wochen) R.-H. Steinmetz<br />
In einer Reihe von Oberseminaren wurden 2006 und 2007 die<br />
Texte des Tannhäusers neu ediert und öffentlich zugänglich<br />
gemacht. Als nächstes sollen alle Texte der Edition in das<br />
Deutsch der Gegenwart übersetzt werden. Auch die fertigen<br />
Übersetzungen werden anschließend im Internet publiziert.<br />
Teilnahmenachweise für den Veranstaltungstyp Hauptseminar<br />
können wie üblich erworben werden, jedoch keine<br />
Leistungsnachweise. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 beschränkt.<br />
Textausgabe(n): Tannhäuser: Die lyrischen Gedichte der<br />
Handschriften C und J. Abbildungen und Materialien zur<br />
gesamten Überlieferung der Texte und ihrer Wirkungsgeschichte<br />
und zu den Melodien. Hg. v. Helmut Lomnitzer und Ulrich<br />
Müller. Göppingen: Kümmerle, 1973 (Litterae 13); Johannes<br />
Siebert: Der Dichter Tannhäuser. Leben – Gedichte – Sage. Halle<br />
a.d. Saale: Niemeyer, 1934. Nachdruck Hildesheim u. New York:<br />
Olms, 1980; Deutsche Lyrik des Spätmittelalters. Hg. v. Burghart<br />
Wachinger Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker-Verlag, 2006<br />
(Bibliothek des Mittelalters 22, Bibliothek deutscher Klassiker<br />
191), S. 172–217 u. 717–737; Die Dichtungen des Tannhäusers.<br />
Unter Mitarbeit von Elisabeth Axnick u.a. hg. v. Ralf-Henning Steinmetz. Kiel 2006–2007 (Kieler<br />
Online-Ausgabe).<br />
Literatur zur Einführung: Burghart Wachinger: Tannhäuser. In: Die deutsche Literatur des<br />
Mittelalters. Verfasserlexikon. Bd. 9. Hg. v. B.W. Berlin, New York: de Gruyter, 1995, Sp. 600–610.
Persönliche Anmeldung erforderlich. Anfragen bitte per E-Post.<br />
<strong>Seminar</strong>unterlagen: Die folgenden Dokumente liegen als PDF-Ausdrucke vor, die Sie mit vielen<br />
Programmen öffnen können, z. B. mit dem Programm ›Adobe Reader‹, dessen neueste Version Sie<br />
hier kostenlos auf Ihren Rechner laden können.<br />
Tannhäuser – Dichter, Sagen- und Opernheld<br />
Wenn Sie Fragen zu dieser Veranstaltung haben, schreiben Sie mir bitte.<br />
Zur Hauptseite oder zu den Lehrveranstaltungen<br />
ZERTIFIKAT "DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (DAF)"<br />
Wegen völliger Überlastung der Veranstaltungen ist im Sommersemester eine Online-SVS-<br />
Anmeldung für den DaF-Bereich nicht möglich. Die DaF-Veranstaltungen sind nur zugänglich<br />
für Studierende, die bereits DaF-Scheine erworben haben. Nähere Informationen bezüglich<br />
dieser Anmeldung erhalten diese in der jeweils ersten Sitzung.<br />
050872 Grammatik des Deutschen: Ausgewählte Probleme der deutschen<br />
Grammatik für Deutsch als Fremdsprache<br />
2-std., Mi 16.15-17.45 B. Probst<br />
Die Grammatik des Deutschen wird unter den Aspekten der wissenschaftlichen Grammatik betrachtet<br />
und insbesondere der Begriff „Grammatik“ als Kategorie für verschiedene Gebrauchsformen<br />
(Lehrbuchgrammatik, Übungsgrammatik, Lernergrammatik, …) geklärt. Die Besonderheiten des<br />
Deutschen in den Teilbereichen des Lautlichen, Wortschatz /Wortbedeutung / Wortbildung sowie<br />
Morphologie und Syntax werden in einem Überblick erörtert. Sodann beschäftigen wir uns vorrangig<br />
mit ausgewählten Problemen der deutschen Grammatik, die nicht-muttersprachlichen Lernenden<br />
erfahrungsgemäß große Schwierigkeiten bereiten. Die Verb-Valenz-Grammatik wird ausführlich<br />
besprochen, weil sie als grammatisches Modell „Einzug in Lehrwerke und den Unterricht gehalten<br />
hat“. Weiterhin soll auch ein Blick auf Lehrwerke mit „interkultureller Ausrichtung“ geworfen und<br />
auch die Entwicklung und die besondere Schwerpunktsetzung bei solchen Lehrwerken thematisiert<br />
werden (Sprachbrücke, Sichtwechsel,…). Die zugelassenen Lehrwerke für die Sprachkurse der<br />
Integrationskurse (BAMF / neues Zuwanderungsgesetz) kommen nicht zu kurz, denn im mehr<br />
„praktischeren“ Teil untersuchen wir die neueren Lehrwerke für DaF / DaZ (Delfin, Lagune, Schritte,<br />
Berliner Platz 1, Passwort Deutsch, Tangram, Eurolingua, Stufen, Moment mal) wie auch „bewährte“<br />
Lehrwerke (Themen neu / aktuell, Deutsch aktiv und Lehrwerke des Mittelstufen-Niveaus: em,<br />
unterwegs, Blick) auf ihren „Umgang mit Grammatik“ hin: In Gruppenarbeit nach der Methode Open-<br />
Space. Nicht nur DaF/DaZ-Lehrwerke für Erwachsene / Jugendliche stehen für diese Gruppenarbeit<br />
zur Verfügung, sondern auch die gängigen DaZ-Lehrwerke für Kinder / Schüler und auch DaZ-<br />
Lehrpläne (Bayern, Sachsen).<br />
050879 Leistung der Semantik für den DaF-Unterricht (= Angewandte Linguistik<br />
für den DaF-Unterricht: vertiefend)<br />
2-std., Mi 10.15-11.45 S. Vandermeeren<br />
Bei der Semantisierung lexikalischer Einheiten in der Zielsprache Deutsch werden die<br />
paradigmatischen Beziehungen zu anderen lexikalischen Einheiten berücksichtigt, für welche die<br />
traditionelle Semantik Begriffe entwickelte (Homonymie, Synonymie, usw.). Die strukturelle<br />
Semantik versteht die Bedeutung eines Lexems als Struktur, die aus einzelnen Komponenten<br />
aufgebaut ist. Der DaF-Unterricht berücksichtigt auch diese Komponenten bei der Semantisierung<br />
deutscher Lexeme. Außerdem können bestimmte kognitiv-linguistische Erkenntnisse auf den Bereich
der Semantisierung übertragen werden. So bedient sich die kognitive Linguistik der Prototypentheorie.<br />
Kenntnisse dieser Theorie lassen u.a. DaF-Lehrer und -Lehrerinnen auf kulturell<br />
bedingte Unterschiede aufmerksam werden. Die kognitive Linguistik setzt sich auch mit der<br />
Konzeptualisierung auf der Basis metaphorischer Kategorisierung auseinander. DaF-Lehrer und<br />
-Lehrerinnen, die sich konzeptioneller Metaphern bewusst sind, können Lernenden dieses<br />
Bewusstsein vermitteln. So können sie z.B. ihren Schülern und Schülerinnen bewusst machen, dass<br />
Zeit als Behälter konzeptualisiert wird (z.B. In den fünfziger Jahren).<br />
Die theoretischen Erörterungen werden durch Beispiele, Wortfeldanalysen, Analysen von<br />
Worterklärungen und Unterrichtsmaterialien (u.a. Wörterbuch-Rallyes) anschaulich gemacht.<br />
050871 Deutsch in der Wirtschaft: Interkulturelle Kommunikation<br />
2-std., Di 12.15-13.45 S. Vandermeeren<br />
Ausgehend vom Fremdsprachenbedarf im Wirtschaftsbereich richtet sich die Veranstaltung auf die<br />
Frage nach der Vermittlung von Deutschkenntnissen an Deutschlerner aus diesem Bereich. Der erste<br />
Teil der Veranstaltung bietet ein Gesamtbild des betrieblichen Fremdsprachenbedarfs an, und zwar<br />
des Bedarfs an grammatischem, kommunikativem, interkulturellem und fachsprachlichem Wissen. So<br />
vorbereitet werden im zweiten Teil die Teilnehmer Unterrichtsentwürfe für interkulturelles Training<br />
konzipieren und präsentieren.<br />
050876 Wirtschaftsdeutschdidaktik<br />
2-std., Di 14.00-15.30 S. Vandermeeren<br />
Zunächst werden grundsätzliche Fragen angesprochen, welche die Fachsprache der Wirtschaft als<br />
Gegenstand im DaF-Unterricht und die Anforderungen, die an Methoden gestellt werden, betreffen.<br />
Dann wird der Einsatz verschiedener Methoden (u.a. des Plan- und Rollenspiels) im Wirtschaftsdeutschunterricht<br />
vorgestellt. Zu jeder behandelten Methode werden einfache Anwendungsmaterialien<br />
bereitgestellt. Auch Mediendidaktik (u.a. didaktisch-methodische Überlegungen zum<br />
Internet im Unterricht) und Leistungsmessung werden auf den Unterricht Wirtschaftsdeutsch bezogen.<br />
Außerdem beschäftigen sich die Dozentin und die Teilnehmenden gemeinsam mit Lernzielen,<br />
Stoffplänen und Lehrwerken sowie mit Unterrichtseinheiten (z.B. Telefontraining, Geschäftsreise zur<br />
Messe, usw.).<br />
SPRACHKURSE<br />
050489 <strong>Seminar</strong>: Wi lehrt Platt (Plattdeutsch für Anfänger)<br />
2-std., Do 14.15-15.45 S. Schuppenhauer<br />
Voraussetzungen: Keine. Inhalt: In diesem Kurs sollen Grundkenntnisse der niederdeutschen Sprache<br />
vermittelt werden. Schwerpunkte sind dabei neben der Sprachentstehung grammatische Grundlagen<br />
sowie kurze sprachliche Einheiten; auch das freie Sprechen sowie das gemeinsame Lesen und Übersetzen<br />
verschiedener niederdeutscher Texte werden nicht zu kurz kommen. Darüber hinaus werden<br />
gemeinsam Möglichkeiten für den Einsatz der niederdeutschen Sprache im Unterricht erarbeitet.<br />
050345 <strong>Seminar</strong>: Nedderdüütsch in’n Düütschünnerricht - Niederdeutsch<br />
im Deutschunterricht (zugl. Niederdeutsch für Fortgeschrittene)<br />
2-std., Do 16.15-17.45 S. Schuppenhauer
Voraussetzungen: Besuch der Veranstaltung „Niederdeutsch für Anfänger“ oder entsprechende<br />
Vorkenntnisse. Inhalt: In dieser Veranstaltung sollen gemeinsam vielfältige Möglichkeiten zur<br />
Einbeziehung des Niederdeutschen in den Deutschunterricht der Klassen 5-13 erarbeitet werden. Ziel<br />
wird es sein, für den unterrichtlichen Einsatz geeignete Texte zusammenzustellen und einzelne<br />
Unterrichtsstunden oder ganze Unterrichtseinheiten für verschiedene Klassenstufen gemeinsam zu<br />
planen. Angestrebt ist zudem eine praktische Umsetzung der Planung an einer Schule im Kieler Raum<br />
durch freiwillige Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit anschließender Besprechung (in kleineren<br />
Gruppen). Auf individuelle Wünsche der Teilnehmenden wird eingegangen; eine Teilnahme ist auf<br />
Hoch- oder (bei entsprechenden Vorkenntnissen) auf Niederdeutsch möglich.<br />
050844 Sprachkurs: Niederländisch für Anfänger<br />
2-std., Mi 16.15-17.45 R. Kok<br />
In dem Sprachkurs werden Grundkenntnisse der niederländischen Sprache vermittelt. Schwerpunkte<br />
sind dabei neben landeskundlichen Aspekten grammatische Grundlagen, wobei das freie Sprechen<br />
und Hörverstehen, die Lektüre und Übersetzung niederländischer Texte sowie das Verfassen eigener<br />
Texte eingeübt werden.<br />
Der Kurs ist Teil des Fachergänzungsmoduls FE-NL "Niederländisch Spracherwerb". Weitere<br />
Teilnehmer können nur aufgenommen werden, wenn die für den Fachergänzungsbereich reservierten<br />
Plätze nicht vollständig belegt werden.<br />
050846 Sprachkurs: Niederländisch für Fortgeschrittene<br />
2-std., Mi 18.00-19.30 R. Kok<br />
Der Kurs ist Teil des Fachergänzungsmoduls FE-NL "Niederländisch Spracherwerb". Voraussetzung<br />
für den Besuch dieses Fortgeschrittenenkurses ist der nachgewiesene Besuch des Kurses "Niederländisch<br />
für Anfänger".<br />
Empfohlene Literatur: Pons, Grammatik kurz & bündig, Niederländisch<br />
WEITERE FACHÜBERGREIFENDE ANGEBOTE<br />
050503 Antike für Literaturwissenschaftler<br />
2-std., Mi 16.15-17.45 S. Feddern<br />
[Angebot des Instituts für Klassische Altertumskunde]<br />
Die Antike hat in den Literaturen der Neuphilologien vielfältige Spuren hinterlassen. Diesen Spuren,<br />
die sich bei so bedeutenden Schriftstellern wie Goethe, Shakespeare, Dante, Cervantes und Camões –<br />
um nur einige zu nennen – finden, wollen wir in diesem Kurs gemeinsam nachgehen.<br />
Um dieses Anliegen zu erfüllen, werden wir zunächst einen Blick auf die Antike werfen, um mit den<br />
Vorbildern, die in der Neuzeit rezipiert wurden, vertraut zu werden. Hierbei wird es darum gehen, ein<br />
gewisses Basiswissen über die Antike zu erlangen (z.B. in Bezug auf die Götter, auf griechische und<br />
römische Autoren und auf literarische Gattungen), v.a. aber darum, die für die Rezeption zentralen<br />
Motive kennenzulernen. Die Lektüre der griechischen und römischen Texte wird in deutscher<br />
Übersetzung erfolgen. In einem zweiten Schritt wenden wir uns der Frage zu, wie dieses Erbe aus der<br />
Antike in den Literaturen der Neuphilologien rezipiert wurde. Da dies ein weites Feld ist, werden wir<br />
uns zu Beginn des Semesters auf einige Schwerpunkte einigen, wobei die studentischen Interessen<br />
gerne berücksichtigt werden.<br />
Sowohl Studenten der Alt- als auch der Neuphilologien sind herzlich eingeladen, an diesem Kurs<br />
teilzunehmen.
050462 <strong>Seminar</strong>: Bibelkunde für Germanisten – Die Bibel als Quelle literarischer Arbeit<br />
2-std., Mo 10.15-11.45 U. Gradert<br />
Zahlreiche Bücher sind auf dem Hintergrund biblischer Texte entstanden. Für ein umfassendes Verständnis<br />
vieler Kunstwerke sind Kenntnisse in der Bibelkunde unerlässlich. Die Lehrveranstaltung<br />
vermittelt Grundwissen für den Umgang mit dem Buch der Bücher und will die Wahrnehmung für<br />
biblische Motive in literarischen Werken schärfen. Es werden exemplarische Texte aus dem AT und NT<br />
behandelt, wobei bibelkundliche Aufrisse ein Gerüst der Arbeit bilden werden. Literaturhinweise folgen<br />
am Beginn des Semesters. Geeignet für Studierende aller Studiengänge und Semester, besonders auch<br />
für Lehramtsanwärter/innen.<br />
050473 <strong>Seminar</strong>: Plattdeutsch in der Kirche<br />
2-std., Mo 12.15-13.45 U. Gradert<br />
„Plattdeutsch in der Kirche“ ist einer der vitalsten sprachkulturellen Bereiche. Eine eigene Zeitung<br />
berichtet über die Aktivitäten auf diesem Sektor. Die Bibel sowie eine Fülle von geistlichen Liedern,<br />
Gebeten und Schriften wurden übersetzt, plattdeutsche Andachtstexte wurden gesammelt und<br />
veröffentlicht. Im Mittelpunkt dieses <strong>Seminar</strong>s soll die Beschäftigung mit der Urgeschichte aus dem<br />
1. Buch Mose (Genesis) stehen.<br />
Voraussetzung: Die plattdeutsche Sprache sollte verstanden werden. Exegetische Grundkenntnisse<br />
sind nützlich, aber keine Teilnahmebedingung. Ansonsten richtet sich dieses <strong>Seminar</strong> an Hörer aller<br />
Semester und Studiengänge, gern auch an Senioren.<br />
Zur Einführung wird auf die diversen Bibelausgaben in niederdeutscher Sprache verwiesen,<br />
beispielsweise: K.-E. Schade (Übers.): Dat Ole Testament. Neumünster 3 1996. De Apokryphen,<br />
verborgen Schriften to dat Ole Testament. Neumünster 2001. Dat Niee Testament. Neumünster 2003.<br />
Literaturhinweis (weitere im <strong>Seminar</strong>): H. Kröger: Plattdüütsch in de Kark in drei Jahrhunderten. Bd.<br />
1: 1700-1900. [Hannover] 1996. Bd. 2: 20. Jahrhundert. Hermannsburg 2001. Bd. 3: Quellen und<br />
Lesetexte. 18. bis 20. Jh. Hermannsburg 1998.<br />
TUTORIEN<br />
Die Tutorien richten sich in erster Linie an Studienanfänger im Bereich der Germanistik, aber auch<br />
Fortgeschrittene sind herzlich willkommen. Sie finden begleitend zu den Proseminaren „Einführung<br />
in die deutsche Sprachwissenschaft“ und „Einführung in das Mittelhochdeutsche“ statt und sollen<br />
Möglichkeiten bieten, intensiv über die dort behandelten Themen zu sprechen. Einen Schwerpunkt<br />
bildet ferner die Vorbereitung auf die Abschlussklausuren.<br />
050481 Tutorium zum <strong>Seminar</strong> zur Einführung in die Sprachwissenschaft<br />
2-std., Do 16.15-17.45 W. Schäfke<br />
050480 Tutorium zum <strong>Seminar</strong> zur Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik<br />
2-std., Z. n. V. S. A. Haupt<br />
050972 Tutorium zum <strong>Seminar</strong> zur Diachronen Beschreibung der deutschen Sprache<br />
2-std., Do 14.15-15.45 K. Eichhorn