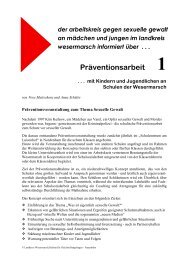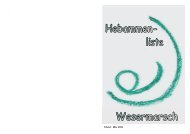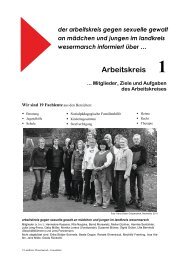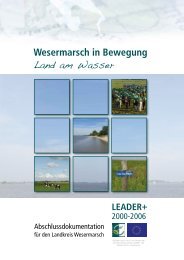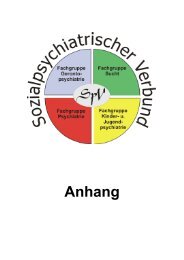REK „Siellandschaft Wesermarsch“ – Langform - Landkreis ...
REK „Siellandschaft Wesermarsch“ – Langform - Landkreis ...
REK „Siellandschaft Wesermarsch“ – Langform - Landkreis ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Siellandschaft Wesermarsch<br />
Wesermarsch in Bewegung<br />
Regionales<br />
Entwicklungskonzept 2007-2013<br />
Gefördert durch die EU im Rahmen der<br />
Gemeinschaftsinitiative LEADER und<br />
„Wesermarsch in Bewegung“.
Leader im <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch<br />
<strong>–</strong> Ein Beitrag zur ganzheitlichen Wirtschaftsförderung <strong>–</strong><br />
Die wirtschaftsstrukturellen Eigenarten des <strong>Landkreis</strong>es Wesermarsch und die damit verbundene<br />
„Zweigesichtigkeit“ <strong>–</strong> ländlicher Raum mit Grünlandwirtschaft einerseits und hoch verdichteter<br />
Industriestandort entlang der Weser andererseits <strong>–</strong> geben die Denkrichtung für einen<br />
pragmatischen Wirtschaftsförderungsansatz vor: Eine pro-aktive Begleitung des sozioökonomischen<br />
Wandels ist so zu organisieren, dass die Entwicklungsmöglichkeiten der lokalen<br />
Wirtschaft und die Standortpotenziale der Wesermarsch trotz oder gerade wegen einer<br />
Monostrukturierung der Branchen genutzt werden können.<br />
Da positive und negative Entwicklungen in der Regel gleichzeitig stattfinden, also ein Arbeitsplatzabbau<br />
in der Industrie und das „Höfesterben“ in der Landwirtschaft einhergehen mit der<br />
Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bereich der maritimen Wirtschaft und dem Tourismus, gibt<br />
es auch kein Entweder-oder in der Wahrnehmung der Aufgaben einer Wirtschaftsförderung.<br />
Vor allen Dingen zählt die Kommunikation mit den beteiligten Unternehmen bzw. den Unternehmern,<br />
den Aktiven aus Wirtschaft, Vereinen, Verbänden, der Verwaltung und nicht zuletzt<br />
der Politik, will man die „Menschen in Bewegung“ bringen. Hierbei hat man es natürlich<br />
immer sowohl mit dem Einzelnen als auch mit größeren Gruppen von engagierten<br />
Menschen zu tun. Die Herangehensweise reicht dabei vom vertraulichen Einzelgespräch mit<br />
einem Unternehmer bis zum offenen Open-Space-Prozess einer Zukunftswerkstatt mit<br />
offenem Ergebnis.<br />
Die Menschen für Ideen zu gewinnen und sie zu motivieren, sich für die wunderbare Wesermarsch<br />
einzusetzen, um konkret messbare Ergebnisse zu erzielen, beschreibt die Philosophie<br />
der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH. Dieser Haltung gegenüber den hier<br />
lebenden und arbeitenden Menschen wird mit dem nötigen Respekt und der Bereitschaft, sich<br />
auf die Eigenarten der Wesermarsch einzulassen, Rechnung getragen.<br />
Somit hat der Geschäftsbereich des EU-Aktionsprogramms Leader <strong>–</strong> sinngemäß etwa „Verbindung<br />
zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ <strong>–</strong> in der Wesermarsch<br />
seine volle Berechtigung erlangt. Das gemeinschaftliche Herangehen an die Aufgaben und<br />
Projekte zur „Inwertsetzung der Natur- und Kulturlandschaft“ im LEADER+ Prozess<br />
2000-2006 haben gezeigt, wozu engagierte Menschen in der Region fähig sind. Das Wir-<br />
Gefühl wurde gestärkt und die interkommunale Zusammenarbeit deutlich verbessert. Der gemeinsam<br />
bewirtschaftete Fördertopf, in den alle neun Kommunen und der <strong>Landkreis</strong> den sogenannten<br />
Zehnten einzahlen, ist mittlerweile Vorbild für andere und wird ebenfalls bei der<br />
Einrichtung des Regionaliserten Teilbudgets für die Wesermarsch im Bereich der<br />
„klassischen“ Wirtschaftsförderung angewandt.<br />
Mit Leidenschaft und Engagement erreichen wir die Herzen der Menschen in der Region.<br />
Leader zeigt, was möglich ist.<br />
Die Wesermarsch ist in Bewegung! Und bleibt es auch!<br />
Jörg Wilke<br />
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
- III -
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
- IV -
Siellandschaft Wesermarsch<br />
Regionales Entwicklungskonzept 2007-2013<br />
der LAG Wesermarsch in Bewegung<br />
Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH,<br />
Poggenburger Str. 7, 26919 Brake<br />
www.wesermarsch.de<br />
im September 2007<br />
www.wesermarsch-in-bewegung.de<br />
erstellt von<br />
Meike Lücke<br />
Martin Müller<br />
Jörg Wilke<br />
mit Unterstützung von<br />
Gabriele Duwe<br />
Johann Gelder<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
- V -<br />
Marion Hauschild<br />
Ingrid Marten<br />
Martin Stein<br />
und Beratung durch<br />
KoRiS <strong>–</strong> vertreten durch<br />
Dieter Frauenholz und<br />
Bettina Obst
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
- VI -
INHALTSVERZEICHNIS<br />
0 Zusammenfassung ...................................................................................................................1<br />
1 1 1 Lage Lage und und Abgrenzung Abgrenzung des des Gebiets ................................<br />
................................................................<br />
................................ ................................<br />
.....................................................<br />
................................ .....................<br />
.....................6<br />
.....................<br />
1.1 Lage des Gebiets im Raum ............................................................................................................. 6<br />
1.2 Abgrenzung des Gebiets .................................................................................................................. 7<br />
2 2 Struktur Struktur und und Eignung Eignung der Lokalen Aktionsgruppe ................................<br />
............................................................<br />
................................<br />
............................<br />
............................9<br />
............................<br />
2.1 Zusammensetzung der LAG ............................................................................................................ 9<br />
2.2 Kompetenz und Funktion der LAG................................................................................................11<br />
3 3 Methodik Methodik und und Erarbeitung Erarbeitung des des <strong>REK</strong> <strong>REK</strong>................................<br />
<strong>REK</strong> <strong>REK</strong>................................<br />
................................................................<br />
................................ ................................<br />
.................................................<br />
................................ ................. 13<br />
3.1 Maßnahmen zur Information und Mobilisierung der Bevölkerung .........................................13<br />
3.2 Methoden der <strong>REK</strong>-Erstellung .......................................................................................................13<br />
3.3 Beteiligte an der <strong>REK</strong>-Erstellung...................................................................................................15<br />
4 4 4 Ausgangslage Ausgangslage und und und Bestandsaufnahme Bestandsaufnahme ................................<br />
................................................................<br />
................................<br />
................................ ................................<br />
..........................................<br />
................................ .......... 17<br />
4.1 Raum- und Siedlungsstruktur .......................................................................................................17<br />
4.2 Bevölkerungsstruktur und -entwicklung ......................................................................................18<br />
4.3 Wirtschaftsstruktur .........................................................................................................................19<br />
4.3.1 Wirtschaftslage.....................................................................................................................19<br />
4.3.2 Landwirtschaft ......................................................................................................................22<br />
4.3.3 Industrie.................................................................................................................................24<br />
4.3.4 Tourismus ..............................................................................................................................25<br />
4.4 Arbeitsmarkt und Einkommen......................................................................................................27<br />
4.5 Umweltsituation Siellandschaft Wesermarsch ..........................................................................28<br />
4.6 Übergeordnete Planungen.............................................................................................................32<br />
4.7 Evaluierungsergebnisse .................................................................................................................33<br />
4.7.1 LEADER+ Evaluierung..........................................................................................................33<br />
4.7.2 Evaluierung Regionen Aktiv................................................................................................35<br />
5 5 SW SWOT SW SWOT<br />
OT-Analyse OT Analyse Analyse................................<br />
................................................................<br />
................................ ................................<br />
................................................................<br />
................................ ................................<br />
....................................................<br />
................................ .................... 36<br />
5.1 Zentrale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken................................................................36<br />
5.2 Handlungsbedarf.............................................................................................................................38<br />
6 6 Entwicklungsstrategie<br />
Entwicklungsstrategie................................<br />
Entwicklungsstrategie<br />
Entwicklungsstrategie................................<br />
................................................................<br />
................................ ................................<br />
................................................................<br />
................................ ................................<br />
.......................................<br />
................................ ....... 40 40<br />
6.1. Leitbild und Entwicklungsziele.....................................................................................................40<br />
6.1.1 Rahmenbedingungen ..........................................................................................................40<br />
6.1.2 Leitthema und Leitbild ........................................................................................................42<br />
6.1.3 Entwicklungsziele .................................................................................................................44<br />
6.1.4 Kooperationen ......................................................................................................................46<br />
6.2. Handlungsfelder und Projekte .....................................................................................................48<br />
6.2.1 Ableitung und Entwicklung .................................................................................................48<br />
6.2.2 Handlungsfeld A: Natur .......................................................................................................51<br />
6.2.3 Handlungsfeld B: Dorfleben................................................................................................55<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
- VII -
6.2.4 Handlungsfeld C: Kultur ...................................................................................................... 59<br />
6.2.5 Handlungsfeld D: Regionale Produktion .......................................................................... 63<br />
6.2.4 Handlungsfeld E: Tourismus............................................................................................... 67<br />
7 7 Finanzierungskonzept Finanzierungskonzept ................................<br />
................................................................<br />
................................<br />
................................<br />
................................................................<br />
................................ ................................<br />
.......................................<br />
................................ ....... 71 71<br />
8 8 Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle und und Prozesssteuerung<br />
Prozesssteuerung................................<br />
Prozesssteuerung<br />
Prozesssteuerung................................<br />
................................................................<br />
................................ ................................<br />
...........................................<br />
................................ ........... 75 75<br />
8.1 Monitoring ........................................................................................................................................ 75<br />
8.2 Erfolgskontrolle ............................................................................................................................... 75<br />
8.3 Prozesssteuerung............................................................................................................................ 76<br />
Literatur Literatur- Literatur und Quellenve Quellenverze<br />
Quellenve<br />
rze rzeichnis rze ichnis ................................<br />
................................................................<br />
................................<br />
................................<br />
........................................................<br />
................................ ........................ 79<br />
Anhang<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
- VIII -
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS<br />
Abb. 1.1 Räumliche Lage des <strong>Landkreis</strong>es Wesermarsch<br />
Abb. 2.1 Mitglieder der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ am 11. September 2007 in Brake<br />
Abb. 4.1 Siellandschaft Wesermarsch<br />
Abb. 4.2 Entwicklung der Steuerkraft im Landes- und Bezirksvergleich in €<br />
Abb. 4.3 Entwicklung und Höhe der Steuerkraft der Kommunen in der Wesermarsch in €<br />
Abb. 4.4 Schuldenstand pro Kopf der Wohnbevölkerung in €<br />
Abb. 4.5 Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe nach Art der Viehhaltung in der Wesermarsch<br />
Abb. 6.1<br />
Schematischer Aufbau der Entwicklungsstrategie<br />
Tab. 2.1 Stimmberechtigte Mitglieder (WiSo-Partner) der LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
Tab. 2.2 Stimmberechtigte Mitglieder (kommunale Partner) der LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
Tab. 2.3 Nicht stimmberechtigte Mitglieder der LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
Tab. 3.1 Veranstaltungen zur Einbindung regionaler Akteure bei der <strong>REK</strong>-Erstellung<br />
Tab. 3.2 Bei der <strong>REK</strong>-Erstellung beteiligte Akteure und ihre Aufgaben<br />
Tab. 4.1 Bevölkerungszahlen, Einwohnerdichte und Bevölkerungsrückgang 2006<br />
Tab. 4.2 Bruttowertschöpfung der Wirtschaftssektoren im Jahr 2005 im Vergleich zum Bezirks- und Landesdurchschnitt<br />
Tab. 4.3 Eckdaten der Landwirtschaft im Länder- und Bezirksvergleich<br />
Tab. 4.4 Touristische Struktur anhand von Kenndaten<br />
Tab. 4.5 Entwicklung der touristischen Nachfrage im Zeitraum von 2000 und 2006 im Vergleich mit dem Land<br />
Niedersachsen und den benachbarten Ferienregionen<br />
Tab. 4.6 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum 30.6 im Vergleich der Jahre 1999 und 2006<br />
Tab. 4.7 Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Regionsvergleich<br />
Tab. 4.8 Geschützte Natur- und Landschaftsbereiche<br />
Tab. 6.1 Kooperationspartner und -themen der LAG Wesermarsch in Bewegung<br />
Tab. 7.1 Mittelaufteilung des Finanzvolumens auf die Handlungsfelder<br />
Tab. 7.2 Indikativer Finanzplan der LAG Wesermarsch in Bewegung. Aufteilung nach Jahren<br />
Tab. 7.3 Indikativer Finanzplan der LAG Wesermarsch in Bewegung. Aufteilung nach Handlungsfeldern für die<br />
gesamte Laufzeit<br />
Hinweis: Die erste Ziffer einer Tabelle bzw. Abbildung entspricht dem Kapitel, in dem die Tabelle<br />
bzw. Abbildung zu finden ist.<br />
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS<br />
LAG Lokale Aktionsgruppe<br />
LEADER Liaison entre actions de développement de l’economie rural<br />
(Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft)<br />
<strong>REK</strong> Regionales Entwicklungskonzept<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
- IX -
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
- X -
0<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 0 � ZUSAMMENFASSUNG<br />
Die <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong> liegt im nördlichen Niedersachsen und wird von der Nordsee<br />
und den Flüssen Weser und Jade sowie dem Jadebusen aus drei Himmelsrichtungen umschlossen.<br />
Die Region erhält dadurch einen ausgeprägten halbinselartigen Charakter.<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch zeichnet sich durch eine hohe naturräumliche, kulturlandschaftsgeschichtliche,<br />
landwirtschaftliche und soziokulturelle Homogenität aus. Im einheitlichen<br />
Naturraum der See- und Flussmarschen bilden Sedimente der Nordsee und der Weser den<br />
Marschboden. Die besonderen Erfordernisse an das Leben in einer Küstenregion wie Deichbau<br />
und Entwässerung erzeugten besondere Kulturtechniken, traditionelle Siedlungs- und Sozialstrukturen,<br />
und formte einen Menschenschlag, der sich mit seinem Leben und Wirtschaften dem<br />
von Wasser und Gewässern geprägten Naturraum angepasst hat.<br />
Die Besonderheit der Siellandschaft Wesermarsch ist das Sielsystem. Dieses künstlich geschaffene,<br />
weitläufige Wassermanagementsystem durchzieht den Natur- und Landschaftsraum auf<br />
einer Länge von 20.000 Kilometern. Es ermöglicht ganzjährig die Abfuhr des binnenländischen<br />
Niederschlagswassers Richtung Weser und Nordsee <strong>–</strong> wodurch die feuchten Böden der Siellandschaft<br />
Wesermarsch erst besiedelbar und landwirtschaftlich nutzbar werden <strong>–</strong>, und verhindert<br />
in den Sommermonaten durch Zuwässerung aus der Weser die Austrocknung der Gräben.<br />
Das Sielsystem in der Wesermarsch ist Ausdruck einer historisch gewachsenen Anpassungsstrategie<br />
des wirtschaftenden Menschen an einen besonderen Lebensraum, das bis heute Natur,<br />
Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft der Region prägt.<br />
Die 822 Quadratkilometer große, langgestreckte Wesermarsch teilt sich administrativ in neun<br />
Kommunen (Berne, Brake, Butjadingen, Elsfleth, Jade, Lemwerder, Nordenham, Ovelgönne und<br />
Stadland) auf. Die Bevölkerungsdichte beträgt durchschnittlich 113 Einwohner pro Quadratkilometer,<br />
wobei die Raumstruktur der Siellandschaft Wesermarsch durch eine starke Differenzierung<br />
zwischen einem Siedlungsband längs der Weser und dem dünn besiedelten Hinterland<br />
gekennzeichnet ist. Kulturhistorisch bedingte Siedlungsformen und -strukturen sind vielfach<br />
noch intakt. Die Verkehrsinfrastruktur ist aufgrund überlasteter Bundesstraßen, einem beschränkten<br />
ÖPNV- und Schienenverkehrsangebot sowie durch unzulängliche Möglichkeiten, die<br />
Weser zu queren, schwach ausgeprägt. Eine Autobahn und Oberzentren existieren in der Siellandschaft<br />
Wesermarsch nicht.<br />
Die Bevölkerungsentwicklung ist seit Jahren gleichbleibend rückläufig. Viele junge Menschen<br />
zwischen 18 und 24 Jahren verlassen als Ausbildungsabwanderer die Wesermarsch, dagegen<br />
konzentrieren sich in den Küstengemeinden Bewohner der Altersgruppe über 60 Jahren.<br />
Die Finanzlage der Siellandschaft Wesermarsch ist ambivalent. Einem hohen Bruttoinlandsprodukt<br />
stehen hohe kommunale Schulden- und Ausgabelasten gegenüber, die im Wesentlichen<br />
auf den Strukturwandel mit einhergehenden Arbeitsplatzverlusten und auf den hohen Anteil von<br />
Langzeitarbeitslosen zurückgehen. Wenige große Industriebetriebe erzielen nahezu die Hälfte<br />
der Bruttowertschöpfung, dagegen ist die Wirtschaftsleistung der Landwirtschaft mit rund drei<br />
Prozent gering, obwohl sie in der Fläche die Landschaft dominiert. Der Dienstleistungssektor ist<br />
unterrepräsentiert, lediglich die Tourismuswirtschaft stellt ein bedeutsames Segment im tertiären<br />
Sektor dar.<br />
Umwelt und Natur der Siellandschaft Wesermarsch sind stark vom Element Wasser geprägt:<br />
Die Ökosystemtypen der Küstenbiotope, der Grünland-Graben-Areale und der Still- und Fließ-<br />
1<br />
LAGE DES GEBIETES<br />
HOMOGENITÄT<br />
NATUR- UND KULTURPRÄ-<br />
GENDES SIELSYSTEM<br />
RAUM- UND<br />
SIEDLUNGSSTRUKTUR<br />
BEVÖLKERUNGS-<br />
ENTWICKLUNG<br />
FINANZLAGE UND WIRT-<br />
SCHAFTSKRAFT<br />
UMWELT UND NATUR
DOMINIERENDE GRÜN-<br />
LANDWIRTSCHAFT<br />
LAG WESERMARSCH IN<br />
BEWEGUNG<br />
ERSTELLUNG DES <strong>REK</strong><br />
WEITERENTWICKLUNG DES<br />
KONZEPTES<br />
SWOT-ANALYSE<br />
STÄRKEN<br />
� 0 � ZUSAMMENFASSUNG<br />
gewässer dominieren die Region. Das Feuchtgrünland sowie die Watt- und Salzwiesenflächen<br />
an der Nordsee gelten <strong>–</strong> auch international <strong>–</strong> als bedeutsamer Lebensraum für Vögel. Unlängst<br />
sind beträchtliche Anteile der Siellandschaft im Rahmen von Natura 2000 als Schutzgebiete<br />
gemeldet worden, zudem stehen mehrere tausend Hektar unter Vertragsnaturschutz. In den<br />
Sekundärbiotopen der von der Landwirtschaft geprägten Kulturlandschaft finden auch viele<br />
gefährdete Tier- und Pflanzengruppen der Feuchtgebiete einen Rückzugsraum.<br />
Insgesamt 95 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in der Wesermarsch werden als Grünland<br />
mit Rindvieh- und Schafhaltung bewirtschaftet. Die Siellandschaft Wesermarsch ist mit rund<br />
60.000 Hektar das größte zusammenhängende Grünlandareal in Deutschland.<br />
Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Wesermarsch in Bewegung“ ist ein Zusammenschluss aus<br />
regionalen Akteuren, die einen gesellschaftlichen Querschnitt der Siellandschaft Wesermarsch<br />
repräsentieren. Die im August 2001 gegründete LAG besteht seit September 2007 aus 25<br />
stimmberechtigten Mitgliedern, die sich aus zehn kommunalen Partnern und 15 Wirtschafts- und<br />
Sozialpartnern zusammensetzen. Ergänzt wird die LAG durch vier nichtstimmberechtigte Mitglieder<br />
mit Beratungsfunktion. Die LAG-Mitglieder besitzen aufgrund ihres Fachwissens, ihren<br />
zentralen Positionen in der Kommunal- und Kreisverwaltung, in Institutionen, Vereinen und Verbänden<br />
sowie ihrer Berufs- und LEADER+ Erfahrung eine hohe Kompetenz im Projektmanagement.<br />
Der regionale Entwicklungsprozess wird zusätzlich durch ein Regionalmanagement professionell<br />
unterstützt und koordiniert.<br />
Das vorliegende Regionale Entwicklungskonzept (<strong>REK</strong>) <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong> der LAG<br />
Wesermarsch in Bewegung ist Ausdruck eines breit angelegten demokratischen Beteiligungsverfahrens,<br />
zum dem das Regionalmanagement einen dreistufigen Ansatz entworfen und durchgeführt<br />
hat:<br />
1. In der Evaluierungsphase zwischen Januar und Mai 2006 wurden in mehreren SWOT-<br />
Analyse-Workshops von Akteuren die regionalen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken<br />
für vier zentrale Themenbereiche der Regionalentwicklung (Kultur, Natur, Regionale<br />
Produkte, Tourismus) erarbeitet.<br />
2. In der Mobilisierungsphase zwischen Juli 2006 und April 2007 wurden verstärkt Maßnahmen<br />
zur Informierung und Mobilisierung der Bevölkerung ergriffen, beispielsweise die Erstellung<br />
eines Newsletters, die Publikation der Abschlussdokumentation LEADER+ sowie<br />
die Auftaktveranstaltung Leader 2007-2013.<br />
3. In der Entwicklungsphase ab November 2006 wurde die Strategie für das vorliegende<br />
<strong>REK</strong> in Perspektivgesprächen mit Vertretern gesellschaftlicher Gruppierungen, einem Strategieworkshop,<br />
mehreren Kommunalen Workshops und einer Zukunftskonferenz erarbeitet.<br />
Das Regionale Entwicklungskonzept <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong> ist eine Weiterentwicklung<br />
des im Jahr 2001 erarbeiteten Konzeptes „Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Land am Wasser“.<br />
Nach Aufnahme in das LEADER+ Programm im Jahr 2003 konnten in der Wesermarsch 67 Projekte<br />
mit einem Gesamtfinanzvolumen von vier Millionen Euro umgesetzt werden.<br />
Aus der Bestandsaufnahme der Ausgangslage und aus Beiträgen des Regionalentwicklungsprozesses<br />
wurden zentrale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Siellandschaft Wesermarsch<br />
herausgearbeitet.<br />
Zu den besonderen Stärken der Siellandschaft Wesermarsch gehört der homogene, von Gewässern<br />
geprägte Naturraum. Er bietet Tieren und Pflanzen der Feuchtlebensräume einen wichtigen<br />
Lebens- und Rückzugsraum, Maßnahmen zu seinem Schutz werden auf großen Flächen<br />
durch kooperativen Vertragsnaturschutz verwirklicht. Im Bereich des Kulturerbes liegen die<br />
zentralen Stärken im maritimen Erbe, in der Vielzahl von Gebäuden mit regionaltypischer Bauweise<br />
und im engen Zusammenhalt dörflicher Gemeinschaften. Land- und Fischereiwirtschaft<br />
2<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 0 � ZUSAMMENFASSUNG<br />
prägen das Bild der Kulturlandschaft und tragen mit ihren Produkten zur regionalen Wertschöpfung<br />
bei. Der Tourismus ist in die Natur- und Kulturlandschaft eingebettet und wartet mit authentischen<br />
Freizeitangeboten und einer guten Fahrradroutenstruktur auf.<br />
Als Schwächen werden die schlecht zugänglichen Naturräume und mangelnde Naturerlebnismöglichkeiten<br />
gesehen, ebenso fehlende Landschaftselemente und der suboptimale Gewässerzustand<br />
des Sielsystems. Die ländliche und dörfliche Lebensqualität wird durch eine unzureichende<br />
Grundversorgung und eine unvollständige öffentliche Infrastruktur beeinträchtigt. Aufgrund<br />
des wirtschaftlichen Strukturwandels existieren eine verfestigte Arbeitslosenquote und<br />
hohe kommunale Schuldenlasten. Die Landwirtschaft hat mit erschwerten Produktionsbedingungen<br />
zu kämpfen, der Dienstleistungssektor ist unzureichend entwickelt.<br />
Der Erhalt des Natur- und Kulturraumes wird als Chance gesehen, um die Grundlage für Arbeiten<br />
und Leben in der Siellandschaft Wesermarsch sicherzustellen. Die Lebensqualität kann<br />
durch eine verbesserte Infrastruktur, den Erhalt regionstypischer Gebäude und die Förderung<br />
des sozialen Dorflebens gesichert und verbessert werden. Für die regionale Wirtschaft liegen<br />
Chancen im Ausbau des naturverträglichen Tourismus und in Diversifizierungsmöglichkeiten im<br />
landwirtschaftlichen Sektor.<br />
Als Risiko gelten dagegen Verlust und Qualitätsbeeinträchtigungen von Feuchtlebensräumen<br />
und Konflikte zwischen Landwirten, Wasser- und Bodenverbänden sowie Naturschützern. Gefahren<br />
birgt für die Siellandschaft Wesermarsch als tiefliegende Küstenregion auch der sich<br />
vollziehende Klimawandel. Weiterhin drohen der Attraktivitätsverlust des Orts- und Landschaftsbildes<br />
durch Gebäudeleerstand und -verfall, der Abbau öffentlicher Infrastruktur sowie weitere<br />
Arbeitsplatz- und Bevölkerungsverluste.<br />
Als Handlungsbedarf für die Entwicklung der Siellandschaft Wesermarsch resultiert, dass im<br />
ökologischen Bereich der Naturraum zu erhalten ist. Der ökologische und strukturelle Zustand<br />
von Natur, Landschaft und Landschaftsbild ist durch <strong>–</strong> weitgehend freiwillige Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
<strong>–</strong> zu erhalten und zu verbessern. Kooperationen zwischen Naturnutzern<br />
und Naturschützern sind zu fördern, das Bewusstsein für die Belange des Naturraumes der<br />
Siellandschaft und die Akzeptanz für Schutzmaßnahmen ist zu steigern. Als sozialer Handlungsbedarf<br />
folgt, dass die öffentliche Infrastruktur zu verbessern, ein lebendiges Dorfleben zu<br />
unterstützen und kulturgeschichtliche Werte zur Steigerung des Regionalbewusstseins zu erhalten<br />
sind. Im Bereich Ökonomie besteht der Handlungsbedarf darin, die Wertschöpfung regionaler<br />
Produkte und Dienstleistungen zu steigern. Dazu sollen landwirtschaftliche und touristische<br />
Infrastruktureinrichtungen verbessert werden, Anbieter und Dienstleister qualifiziert werden.<br />
Langfristig sind neue Arbeitsplätze zu schaffen.<br />
Die Entwicklungsstrategie als Kernstück des Entwicklungsprozesses zur Realisierung einer<br />
nachhaltigen Regionalentwicklung der Siellandschaft Wesermarsch setzt sich zusammen aus<br />
dem Leitthema, dem Leitbild und drei Entwicklungszielen sowie fünf Handlungsfeldern mit den<br />
ihnen zugeordneten Zielen und Maßnahmen. Die Entwicklungsstrategie für die Siellandschaft<br />
Wesermarsch berücksichtigt übergeordnete internationale und nationale Strategien und Planungen<br />
sowie die im Bottom-up-Prozess mit rund 450 regionalen Akteuren erarbeiteten Vorgaben.<br />
Weiterhin eingeflossen sind Evaluationsergebnisse aus LEADER+, so dass die vorliegende<br />
Entwicklungsstrategie einer konsequenten Weiterentwicklung des Regionalen Entwicklungskonzeptes<br />
der Wesermarsch von 2001 entspricht.<br />
Das Leitthema der Entwicklungsstrategie lautet: <strong>„Siellandschaft</strong> Wesermarsch <strong>–</strong> Natur- und<br />
Kulturlandschaft bilden die Grundlage für ein nachhaltig gestaltetes Sozial- und Wirtschaftsleben.“<br />
Das auf Grundlage dieses Leitthemas skizzierte Leitbild für die Siellandschaft Wesermarsch<br />
beschreibt die Zukunftsvision, die durch die Umsetzung der Entwicklungsstrategie erreicht<br />
werden soll. Demnach charakterisiert sich die Siellandschaft Wesermarsch durch ihre<br />
3<br />
SCHWÄCHEN<br />
CHANCEN<br />
RISIKEN<br />
HANDLUNGSBEDARF<br />
ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
LEITTHEMA UND LEITBILD
ENTWICKLUNGZIELE<br />
ZIELÜBERPRÜFUNG<br />
KOOPERATIONEN<br />
HANDLUNGSFELDER<br />
HANDLUNGSFELD<br />
NATUR<br />
HANDLUNGSFELD<br />
DORFLEBEN<br />
HANDLUNGSFELD<br />
KULTUR<br />
� 0 � ZUSAMMENFASSUNG<br />
Grünlandweiden, ihr Sielsystem sowie durch die sie umgebenden Gewässer als außergewöhnliche<br />
Natur- und Kulturlandschaft. Ihre Bewohner identifizieren sich stark mit Leben, Arbeiten und<br />
Wirtschaften in ihrer Region und engagieren sich für die Inwertsetzung des regionalen Natur-<br />
und Kulturerbes ein. Die Lebensqualität wird durch regionalwirtschaftliche Prosperität, Arbeitsplätze,<br />
Bildungsmöglichkeiten und ein lebendiges, gemeinschaftsorientiertes Dorfleben als hoch<br />
eingeschätzt. Die Landwirtschaft als wirtschaftliches und landschaftsprägendes Rückgrat der<br />
Siellandschaft hat sich zum Partner für Belange des Naturschutzes, des Kulturerbes und des<br />
Tourismus bekannt. Die Siellandschaft Wesermarsch ist als erlebbare, gastliche Natur- und<br />
Kulturlandschaft überregional bekannt und hat ein positives Image.<br />
Drei übergeordnete Entwicklungsziele, die sich an das global akzeptierte Prinzip der Nachhaltigkeit<br />
anlehnen, dienen als Leitlinien für die Verwirklichung des Leitbildes:<br />
1. Der ökologische Zustand von Natur und Landschaft soll optimiert und das Naturerleben in der<br />
Siellandschaft Wesermarsch soll gefördert werden.<br />
2. Die Lebensqualität des Dorflebens, die Wahrung des kulturellen Erbes und die Identifikation<br />
der Menschen mit der Siellandschaft Wesermarsch sollen verbessert werden.<br />
3. Die Wertschöpfung von Produkten und Dienstleistungen der Siellandschaft Wesermarsch soll<br />
im Bereich von Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Tourismus gesteigert werden.<br />
Mit Wirkungsindikatoren kann die Erreichung dieser gesetzten ökologischen, sozialen und ökonomischen<br />
Zielsetzungen zukünftig überprüft werden.<br />
Einen besonderen Stellenwert nehmen Kooperationen in der Siellandschaft Wesermarsch ein,<br />
besonders aufgrund der räumlich isolierten Lage der Region. Bisherige Kooperationserfahrungen<br />
belegen, dass regionale und gebietsübergreifende Kooperationen besonders positive Effekte<br />
für die nachhaltige Regionalentwicklung hervorgerufen haben. Daher werden neben räumlichgeografischen<br />
auch thematisch-strategische gebietsübergreifende Kooperationen angestrebt,<br />
für die entsprechende Finanzmittel eingeplant werden.<br />
In den fünf Handlungsfeldern Natur, Dorfleben, Kultur, Regionale Produktion und Tourismus, die<br />
von regionalen Akteuren in einem Strategieworkshop identifiziert wurden, sind in enger Zusammenarbeit<br />
des Regionalmanagements mit einer Vielzahl von regionalen, engagierten Akteuren<br />
Ziele und Aktivitäten definiert worden, durch die die übergeordneten Entwicklungsziele erreicht<br />
werden sollen.<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch will für ihr reichhaltiges und bedeutsames Naturerbe eine besondere<br />
Verantwortung übernehmen. Daher dienen im Handlungsfeld Natur verschiedene Aktivitäten<br />
zum Erhalt und zur Gestaltung von Natur und Landschaft mit ihren typischen Arten und<br />
Lebensräumen sowie zum Ausbau von Naturerlebnisangeboten. Durch innovative Anpassungsstrategien<br />
an den Klimawandel und Bewusstseinsbildung möchte die Siellandschaft als Küstenregion<br />
die Bereitschaft zum Klimaschutz fördern.<br />
Das Handlungsfeld Dorfleben fokussiert sich auf die Steigerung der Lebensqualität und Attraktivität<br />
der Dörfer, auf die Sicherstellung der Grundversorgung und auf den Erhalt von historischen,<br />
orts- oder landschaftsprägenden Gebäuden sowie auf deren nachhaltige Nutzung.<br />
Im Handlungsfeld Kultur soll das kulturelle Angebot weiter ausgebaut werden, besonders im<br />
Bereich der allgemeinen Kulturgeschichte und der Museen durch anschauliche und spannende<br />
Vermittlung der Regionalgeschichte. Ein vernetztes Marketing für bestehende und neue<br />
Kulturangebote soll Synergien zwischen Kulturschaffenden und kulturellen Einrichtungen fördern.<br />
Als Teil des bedeutenden Kulturerbes besteht weiterhin das Ziel, die regionale Baukultur<br />
zu bewahren und zu fördern.<br />
4<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 0 � ZUSAMMENFASSUNG<br />
Das Handlungsfeld Regionale Produktion schließt die Bedingungen und Strukturen zur Erzeugung,<br />
Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte sowie die Produkte selbst und ihre<br />
Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter mit ein. Neue regionale Produkte und Produktionszweige<br />
sollen entwickelt und gefördert sowie Anbieterstrukturen und Vermarktung regionaler Produkte<br />
optimiert werden. Um das Image der Siellandschaft Wesermarsch und die Wertschöpfung zu<br />
fördern, sollen Schnittstellen zwischen regionalen Produkten und der Tourismuswirtschaft geschaffen<br />
werden.<br />
Im Handlungsfeld Tourismus ist es erforderlich, die Qualität der touristischen Infrastruktur und<br />
von Angeboten zu verbessern. Hierzu zählen die Schaffung qualitativ höherwertiger und regionaltypisch<br />
ausgestatteter Übernachtungsmöglichkeiten <strong>–</strong> speziell für Gruppen <strong>–</strong>, die Verbesserung<br />
landwirtschaftlicher Wege für die touristische Freizeitnutzung und die Qualifizierung von<br />
Tourismusakteuren in den Bereichen Service, Dienstleistung, Marketing und Kommunikation.<br />
Ebenso werden Strategien für eine gezielte regionale und überregionale Informationsverbreitung<br />
und regionale Informationssysteme für Gäste benötigt. Thematisch ist insbesondere der wassergebundene<br />
und maritime Tourismus zu fördern.<br />
Für alle Handlungsfelder extrahierten das Regionalmanagement und die LAG aus den im Regionalentwicklungsprozess<br />
hervorgegangenen Anregungen, Ideen und Wünschen mehrere Projektideen.<br />
Diejenigen von ihnen, die die erforderlichen Projektauswahlkriterien im Rahmen der<br />
Entwicklungsstrategie in besonderem Maße erfüllten, wurden von der LAG in demokratischer<br />
Abstimmung als Leitprojekte ausgewählt. Im Laufe des Regionalentwicklungsprozesses wird<br />
anhand von ausgewählten Wirkungs- und Ergebnisindikatoren überprüft werden, ob durch diese<br />
und weitere Projekte nach ihrer Umsetzung ein Beitrag zur Erreichung der Entwicklungsziele<br />
geleistet wurde.<br />
Zur Erfolgskontrolle und zur Steuerung des Regionalentwicklungsprozess dient ein Monitoring,<br />
bei dem das Regionalmanagement nach Maßgabe der ausgewählten Wirkungs- und Ergebnisindikatoren<br />
sowie weiterer geeigneter Parameter kontinuierlich Daten sammelt. Diese werden<br />
dokumentiert, analysiert, bewertet und publiziert. Auf Grundlage der Berichterstattung des Regionalmanagements<br />
überprüft die LAG, ob Änderungen in der Projektumsetzung oder Prozessgestaltung<br />
erforderlich sind. Die Ergebnisse und Anpassungserfordernisse werden dem Land<br />
Niedersachsen in Bewertungsberichten vorgelegt.<br />
Im Rahmen der Bundesinitiative „Regionen aktiv <strong>–</strong> Land gestaltet Zukunft“ von 2002 bis 2007<br />
hat die Wesermarsch als Teil der Modellregion „Weserland“ mit angrenzenden Städten und<br />
<strong>Landkreis</strong>en von einer Stadt-Land-Kooperation zur Stärkung des Verbrauchervertrauens in die<br />
Erzeugnisse der regionalen Landwirtschaft profitiert. Zu den daraus hervorgegangenen positiven<br />
Effekten gehören Wirkungen im Bereich der Markterschließung für regionale Produkte.<br />
Die Finanzierung für die Umsetzung der Entwicklungsstrategie ist gesichert. Im Falle der Teilnahme<br />
an Leader 2007-2013 erfolgt die Kofinanzierung über den von allen Gebietskörperschaften<br />
der Wesermarsch mit einer Million Euro gefüllten Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“,<br />
über private Mittel und Stiftungsgelder. Ebenfalls wird zur Projektfinanzierung auf weitere Strukturfonds<br />
(EFRE, ESF, EFF) zurückgegriffen. Unter Berück¬sichtigung der LEADER+ Evaluationsergebnisse<br />
und nach Maßgabe der Entwicklungsstrategie werden den Handlungsfeldern<br />
unterschiedlich hohe Finanzvolumina zugeteilt.<br />
5<br />
HANDLUNGSFELD<br />
REGIONALE PRODUKTION<br />
HANDLUNGSFELD<br />
TOURISMUS<br />
PROJEKTE<br />
MONITORING<br />
SYNERGIEN<br />
FINANZIERUNG
HALBINSELARTIGE LAGE<br />
REGIONSZUSCHNITT<br />
STRUKTUREN<br />
ENTFERNTE OBERZENTREN<br />
� 1 � ABGRENZUNG UND LAGE DES GEBIETS<br />
1<br />
6<br />
LAGE UND ABGRENZUNG DES<br />
GEBIETS<br />
1.1 Lage des Gebiets im Raum<br />
Im nördlichen Niedersachsen liegt der <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch, der aus drei Himmelsrichtungen<br />
von Gewässern umschlossen wird: Im Norden von der Nordsee, im Osten von der Weser und im<br />
Nordwesten vom Fluss Jade sowie dem Jadebusen. Die Gewässerumschließung bewirkt eine<br />
halbinselartige Randlage des Landstrichs. Die südliche und südöstliche Begrenzung der Wesermarsch<br />
erfolgt durch den höher gelegenen Sandrücken der Oldenburgisch-Ostfriesischen<br />
Geest.<br />
Mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von rund 80 km und einer Ost-West-Dimension von rund 25 km<br />
hat die Wesermarsch einen langen, schmalen Regionszuschnitt. Der <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch<br />
umfasst eine Gesamtfläche von 822 km², auf der 93.094 Einwohner leben (NLS 2007a). Dies<br />
entspricht einer Dichte von 113 Einwohnern pro Quadratkilometer.<br />
Die neun Kommunen des <strong>Landkreis</strong>es setzen sich zusammen aus den Städten Brake, Elsfleth<br />
und Nordenham sowie den Gemeinden Berne, Butjadingen, Jade, Lemwerder, Ovelgönne und<br />
Stadland. Die Hafenstädte Brake, Elsfleth und Nordenham bilden eine konzentrierte Siedlungsachse<br />
entlang der Unterweser, dagegen herrscht in der übrigen Wesermarsch eine gestreute<br />
Siedlungsstruktur mit stark ländlichem Charakter vor.<br />
Abb. 1.1: Räumliche Lage des <strong>Landkreis</strong>es Wesermarsch.<br />
(Quelle: Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH, 2004)<br />
Die Städte Nordenham und Brake werden als Mittelzentren eingestuft, ein Oberzentrum ist in<br />
der Wesermarsch nicht vorhanden. Außerhalb des <strong>Landkreis</strong>es grenzen die vier Oberzentren<br />
Bremen, Bremerhaven, Oldenburg und Wilhelmshaven an, die von der Mitte der Wesermarsch<br />
aus in Entfernungen zwischen 35 und 60 Kilometern zu erreichen sind.<br />
Brake<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
1.2 Abgrenzung des Gebiets<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 1 � ABGRENZUNG UND LAGE DES GEBIETS<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch ist das Gebiet, auf das sich das vorliegende Regionale Entwicklungskonzept<br />
bezieht. Aufgrund der ausgeprägten naturräumlichen, landwirtschaftlichen<br />
und soziokulturellen Homogenität des <strong>Landkreis</strong>es ist die Siellandschaft Wesermarsch nahezu<br />
deckungsgleich mit dem <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch.<br />
Zum Leader-Antragsgebiet gehören auch Ortsteile von Städten, die insgesamt über 10.000<br />
Einwohner zählen. Die Stadt Brake mit insgesamt 16.595 Einwohnern (Stand 03.09.2007) setzt<br />
sich zusammen aus den drei Gemarkungen Golzwarden (2.440 Einw.), Hammelwarden (5.198<br />
Einw.) sowie der Kernstadt Brake, in der lediglich 8.957 Einwohner leben. Keine der historisch<br />
gewachsenen, ehemals selbstständigen Gemarkungen erreicht die 10.000-Einwohner-Marke,<br />
die zum Ausschluss aus der der Gebietskulisse führen würde. Der Kern der Stadt Nordenham<br />
wird dagegen von 12.123 Menschen bewohnt (Stand 30.06.2007), so dass die Kernstadt Nordenham<br />
nicht zur Antragsgebietskulisse gehört. Die Nordenhamer Ortsteile Abbehausen (3.346<br />
Einw.), Atens (1984 Einw.), Blexen (8.859 Einw.) und Esensham (1.072 Einw.) liegen unter der<br />
Grenze von 10.000 Einwohnern und gehören aufgrund ihres ländlichen Charakters zum Leader-<br />
Antragsgebiet.<br />
Die im vorliegenden <strong>REK</strong> verwendeten statistischen Daten beziehen sich auf die gesamte Fläche<br />
der Gebietskörperschaft „<strong>Landkreis</strong> <strong>Wesermarsch“</strong>. Da der aus dem Leader-Antragsgebiet<br />
getilgte besiedelte innerörtliche Bereich Nordenhams nur einen sehr geringen Anteil an der<br />
<strong>Landkreis</strong>fläche hat, und da ökologische, ökonomische und soziale Wirkungen aus dem nicht<br />
zum Leader-Gebiet gehörigen Ortskern auf das gesamte Antragsgebiet <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong><br />
ausstrahlen, dienen die <strong>Landkreis</strong>daten unverändert als Datengrundlage für das <strong>REK</strong>.<br />
Die Besonderheit der Wesermarsch ist ihre ausgeprägte naturräumliche <strong>–</strong> und damit einhergehend<br />
ihre kulturlandschaftsgeschichtliche <strong>–</strong> Homogenität. Im einheitlichen Naturraum der See-<br />
und Flussmarschen bilden Sedimente der Nordsee und der Weser den Marschboden. Im Hinterland<br />
finden sich zudem Moormarsch- und Moorböden. Somit sind die Geländeverhältnisse durch<br />
feuchte bis nasse Böden, geringe Reliefunterschiede und gleichartiges Mikroklima geprägt.<br />
Insgesamt 150 Kilometer Gewässergrenze bzw. Deichlinie isolieren die Wesermarsch von umliegenden<br />
Regionen und verstärken den peripheren, in sich abgeschlossenen Gebietscharakter<br />
der Siellandschaft Wesermarsch.<br />
Aufgrund der extremen geomorphologischen und hydrologischen Bedingungen hat sich in der<br />
Wesermarsch über Jahrhunderte ein Wassermanagementsystem entwickelt, das das Leben und<br />
die landwirtschaftliche Nutzung im niedrig gelegenen, eingedeichten Marschengebiet ermöglicht:<br />
das Sielsystem. Erst der gezielte Wasserabtransport ermöglicht die Bewirtschaftung der feuchten<br />
Böden als Grünland. Insgesamt 95 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in der Wesermarsch<br />
werden in dieser Form bewirtschaftet. Damit birgt die Siellandschaft Wesermarsch das<br />
größte zusammenhängende Grünlandareal in Deutschland (LANDKREIS WESERMARSCH 2003).<br />
Das Sielsystem …<br />
… ist ein künstlich angelegtes Zu- und Entwässerungssystem aus einem weitläufigen<br />
Netz von breiten Sielzügen und schmaleren Sielgräben. Ihnen angeschlossen<br />
sind Gräben und schmale oberflächliche Entwässerungsfurchen der Gründländereien,<br />
die Grüppen. Mit seiner Länge von rund 20.000 Kilometern ermöglicht das<br />
Sielsystem der Wesermarsch durch 87 Schöpfwerke und zehn in die Deiche eingelassene<br />
Sieltore ganzjährig die Abführung des binnenländischen Niederschlagswassers<br />
in Richtung Weser und Nordsee.<br />
(LANDKREIS WESERMARSCH 2003, CORNELIUS 2003)<br />
7<br />
SIELLANDSCHAFT<br />
WESERMARSCH<br />
ORTE > 10.000<br />
EINWOHNER<br />
STATISTISCHE<br />
DATENGRUNDLAGE<br />
NATURRÄUMLICHE<br />
HOMOGENITÄT<br />
SIELSYSTEM
HOMOGENE SOZIO-<br />
KULTURELLE IDENTITÄT<br />
ILEK- UND<br />
KONVERGENZGEBIETE<br />
� 1 � ABGRENZUNG UND LAGE DES GEBIETS<br />
Aufgrund der Bodenverhältnisse und der landwirtschaftlichen Nutzung herrscht in der Siellandschaft<br />
Wesermarsch eine weiträumig offene Kulturlandschaft ohne ausgeprägte Gehölzanteile<br />
vor. Die Landschaft ist flach, Geländeerhebungen liegen maximal 2,5 Meter über Normalnull,<br />
weite Teile der Landschaft haben ein Geländeniveau unter Normalnull (bis -1,5 m NN).<br />
Seit jeher ist die Wesermarsch nur durch Maßnahmen gegen Überflutungen besiedelbar. Frühe<br />
Siedler bauten ihre Wohnplätze auf künstlich aufgeschütteten Erdhügeln (Wurten), ab dem<br />
1. Jahrhundert nach Christi setzte der Bau von Deichen ein. Im Mittelalter brachen mehrere<br />
schwere Sturmfluten in das Marschland ein und spülten große Teile des Festlandes fort. Der<br />
Jadebusen zeugt noch heute von diesen gewaltigen Meereseinbrüchen. Durch sukzessive Vordeichungen<br />
in Meeresrichtung gelang es den Menschen im Laufe der letzten Jahrhunderte, viele<br />
Quadratkilometer Land zurückzugewinnen. Derzeit schützen See- und Flussdeiche auf rund<br />
150 Kilometern Länge die Wesermarsch vor Überflutungen. Im Bewusstsein der Wesermarschbewohner<br />
bleibt verankert, dass ihre Region erst durch menschliche Kulturtechniken besiedelbar<br />
wurde und bis heute ist, daher messen sie der Deichsicherheit in der Wesermarsch eine<br />
besondere Bedeutung bei.<br />
Überschneidungen mit Gebieten des Planungsansatzes „Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte“<br />
(ILEK) gibt es nicht, da sich keine der neun Wesermarsch-Kommunen an einem ILEK-<br />
Verfahren beteiligt. Der Regionszuschnitt gegenüber der LEADER+ Förderphase bleibt unverändert.<br />
Somit liegt auch keine Überschneidung mit einem Konvergenzgebiet (hier: Lüneburg)<br />
vor.<br />
8<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
2<br />
� 2 � STRUKTUR UND EIGNUNG DER LOKALEN AKTIONSGRUPPE<br />
STRUKTUR UND EIGNUNG<br />
DER LOKALEN AKTIONSGRUPPE<br />
2.1 Zusammensetzung der LAG<br />
Ein Querschnitt aus Vertretern regionaler Wirtschafts-, Sozial-, Naturschutz-, Kultureinrichtungen<br />
und -organisationen (WiSo-Partner) der Siellandschaft Wesermarsch sowie aus Vertretern<br />
der zehn kreisangehörigen Gebietskörperschaften bildet die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Wesermarsch<br />
in Bewegung“. Zur Sicherung der kontinuierlichen Beschlussfähigkeit (vgl. Kap. 4.7)<br />
bei den LAG-Sitzungen beträgt der Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der LAG<br />
60 Prozent. Zu einem Drittel wird die LAG durch weibliche Mitglieder vertreten.<br />
Die LAG „Wesermarsch in Bewegung“ ist ein nicht wirtschaftlicher Verein ohne Rechtsfähigkeit<br />
nach § 54 BGB. Ihre Geschäftsstelle ist in der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH mit<br />
Sitz in der Kreisstadt Brake angesiedelt. Die Geschäftsstelle wird mit einem Regionalmanager<br />
und einer Assistenz im Regionalmanagement besetzt.<br />
Tab. 2.1: Stimmberechtigte Mitglieder (WiSo-Partner) der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ (Stand:<br />
11.09.2007)<br />
Handlungsfeld Institution/Organisation Person (Funktion)<br />
A<br />
Natur<br />
B<br />
Dorfleben<br />
C<br />
Kultur<br />
D<br />
Regionale<br />
Produktion<br />
E<br />
Tourismus<br />
Nationalpark-Haus Fedderwardersiel Gabriele Speckels (Leiterin)<br />
Naturschutzverein Nordenham /<br />
AK Feuchtgrünlandschutz<br />
Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und<br />
Bodenverbände<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Peter Nottelmann (Vorsitzender /<br />
Mitglied)<br />
Leenert Cornelius (Verbandsvorsteher)<br />
Ländliche Erwachsenenbildung Annegret Martens (Vorsitzende)<br />
Interessengemeinschaft „Unser Dorf hat Zukunft“ Regine Böseler (Sprecherin)<br />
Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch Walter Janssen (Kreispfarrer)<br />
Interessengemeinschaft Bauernhof Bärbel Logemann (Sprecherin)<br />
Stellvertretende Vorsitzende der LAG<br />
Rüstringer Heimatbund e.V. Hans-Rudolf Mengers (Vorsitzender)<br />
Himmelfahrt Wesermarsch e.V. Dieter Seidel (Vorsitzender)<br />
Kreisarbeitsgemeinschaft der Landfrauenvereine<br />
Wesermarsch<br />
Annegret Schildt (Vorsitzende)<br />
Kreislandvolkverband Wesermarsch Manfred Ostendorf (Geschäftsführer)<br />
proRegion e.V. Gerfried Hülsmann (Vorsitzender)<br />
Touristikgemeinschaft Wesermarsch /<br />
Region Unterweser <strong>–</strong> Maritime Landschaft e.V.<br />
Elsflether Tourismus- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br />
mbH /<br />
Region Unterweser <strong>–</strong> Maritime Landschaft e.V.<br />
Tourismus Service Butjadingen GmbH & Co. KG /<br />
Region Unterweser <strong>–</strong> Maritime Landschaft e.V.<br />
Gabriele Duwe (Leiterin /<br />
Mitglied)<br />
Birgit Krüger (Leiterin /<br />
Mitglied)<br />
Ansgar Manal (Marketingleiter /<br />
Mitglied)<br />
9<br />
GESELLSCHAFTLICHER<br />
QUERSCHNITT<br />
RECHTSFORM UND<br />
GESCHÄFTSSTELLE<br />
STIMMBERECHTIGTE<br />
LAG-MITGLIEDER
STIMMBERECHTIGTE<br />
LAG-MITGLIEDER<br />
ERGÄNZENDE<br />
LAG-MITGLIEDER<br />
MITGLIEDER-<br />
ZUSAMMENSETZUNG<br />
� 2 � STRUKTUR UND EIGNUNG DER LOKALEN AKTIONSGRUPPE<br />
Tab. 2.2: Stimmberechtigte Mitglieder (kommunale Partner) der LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
(Stand: 11.09.2007)<br />
10<br />
Kompetenzfeld Gebietskörperschaft Person (Funktion)<br />
Kommunen Gemeinde Berne Bernd Bremermann (Bürgermeister)<br />
Stadt Brake Roland Schiefke (Bürgermeister)<br />
Gemeinde Butjadingen Rolf Blumenberg (Bürgermeister)<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Vorsitzender der LAG<br />
Stadt Elsfleth Wolfgang Böner (Ordnungsamtsleiter)<br />
Gemeinde Jade Andreas Pöpken (Stellv. Gemeindedirektor)<br />
Gemeinde Lemwerder Regina Neuke (Kämmerin)<br />
Gemeinde Ovelgönne Thomas Brückmann (Bürgermeister)<br />
Stadt Nordenham Jürgen B. Mayer (Wirtschaftsförderer)<br />
Gemeinde Stadland Boris Schierhold (Bürgermeister)<br />
<strong>Landkreis</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch Hans Kemmeries (Erster Kreisrat)<br />
Finanzvorstand der LAG<br />
Tab. 2.3: Nicht stimmberechtigte, beratende Mitglieder der LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
(Stand: 11.09.2007)<br />
Kompetenzfeld Institution / Organisation Person (Funktion)<br />
Landentwicklung GLL Geoinformation, Landentwicklung und<br />
Liegenschaften (Oldenburg)<br />
Biosphärenreservat Nationalparkverwaltung Niedersächsisches<br />
Wattenmeer (Wilhelmshaven)<br />
Regionalmanagement<br />
Carsten Fischer (Sachbearbeiter<br />
Amt für Landentwicklung)<br />
Klaus Wonneberger<br />
(Dezernent Biosphärenreservat)<br />
Geschäftsstelle „Wesermarsch in Bewegung“ Martin Müller (Regionalmanager)<br />
Geschäftsstelle „Wesermarsch in Bewegung“ Meike Lücke (Assistenz Regionalmanagement)<br />
Seit ihrer neuordnenden Sitzung am 11. September 2007 besteht die LAG aus 25 stimmberechtigten<br />
Mitgliedern und vier nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Zu den stimmberechtigten Mitgliedern<br />
zählen Vertreter aus Organisationen und Institutionen, die regional aktiv sind und deren<br />
Themenspektrum sich mit den einzelnen Handlungsfeldern des <strong>REK</strong> deckt, sowie je ein Verwaltungsvertreter<br />
der neun Kommunen und des <strong>Landkreis</strong>es. Zu den nicht stimmberechtigten Mitgliedern<br />
zählen u.a. die Vertreter der Geschäftsstelle „Wesermarsch in Bewegung“. Bei Bedarf<br />
ist die Zahl der beratenden Mitglieder erweiterbar.<br />
Abb. 2.1: Mitglieder der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ am 11. September 2007 in Brake.
2.2 Kompetenz und Funktion der LAG<br />
� 2 � STRUKTUR UND EIGNUNG DER LOKALEN AKTIONSGRUPPE<br />
Die Mitglieder der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ bringen aus ihrer beruflichen und/oder<br />
privaten Biografie umfangreiches Wissen und mehrjährige Erfahrungen im Bereich der Planung,<br />
Begleitung, Umsetzung, Abwicklung und Evaluierung von Projekten mit. Die LAG-Mitglieder<br />
decken mit ihrem Fachwissen aus Ökonomie, Land- und Tourismuswirtschaft, Naturwissenschaften,<br />
Kultur und Bildung sowie aus Politik und Verwaltung ein breites Spektrum an wirtschaftlichen,<br />
sozialen und ökologischen Themenfeldern ab.<br />
Aufgrund ihrer zentralen Positionen in Institutionen, Vereinen und Verbänden weisen viele Mitglieder<br />
eine beträchtliche Methoden- und Sozialkompetenz sowie ein hohes bürgerschaftliches<br />
Engagement auf. Viele Mitglieder sind zudem in regional und überregional agierende Netzwerke<br />
eingebunden. Sie sind damit gute Multiplikatoren und Kontaktvermittler und haben ihre Kooperationsfähigkeit<br />
bewiesen.<br />
Die LAG „Wesermarsch in Bewegung“ begleitete seit ihrer Gründung am 5. August 2001 die<br />
Auswahl und Umsetzung von 67 Projekten im Rahmen von LEADER+ zur nachhaltigen Regionalentwicklung,<br />
die mit den Zielen des Regionalen Entwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2001<br />
im Einklang stehen. Zudem ist es der LAG gelungen, mit der Einrichtung eines gemeinsamen<br />
„Finanztopfes <strong>Wesermarsch“</strong>, den alle Kommunen und der <strong>Landkreis</strong> paritätisch füllten, ein<br />
innovatives, flexibles Finanzierungsmodell für die Kofinanzierung interkommunaler Projekte zu<br />
schaffen. Zwölf der 20 LAG-Gründungsmitglieder stehen der LAG auch für den Zeitraum von<br />
2007-2013 mit ihrem Erfahrungsschatz aus LEADER+ und ihrem Engagement zur Verfügung.<br />
In ihrer Gesamtheit repräsentiert die LAG alle wichtigen Themenbereiche des gesellschaftspolitischen<br />
Lebens in der Wesermarsch. Im Rahmen der Geschlechtergleichstellung sind gezielt<br />
Frauen in die LAG berufen worden. Allen Mitgliedern ist gemein, dass sie die nachhaltige Regionalentwicklung<br />
in der Siellandschaft Wesermarsch aktiv unterstützen und fördern möchten. Die<br />
LAG teilt sich organisatorisch auf in Geschäftsstelle und LAG-Gremium mit einem gewählten<br />
Vorstand, seinem Stellvertreter und einem Finanzvorstand (vgl. Tab. 2.2).<br />
Die LAG fungiert als Entscheidungs- und Steuerungsgremium bei der Umsetzung von Zielen,<br />
Strategien und Maßnahmen, die im Regionalen Entwicklungskonzept <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong><br />
festgeschrieben sind. Ihr obliegt die Auswahl der beantragten Projekte und die Entscheidung<br />
über die Gesamtstrategie in der Regionalentwicklung. Die Mitglieder der LAG engagieren<br />
sich zudem für einen intensiven Austausch mit regionalen Akteuren und der Öffentlichkeit,<br />
um dem Bottom-up-Ansatz Rechnung zu tragen und so den Prozess nachhaltig mit kreativen<br />
Ideen aus der Region zu stärken. Weiterhin übernehmen sie die Initiierung von Projekten<br />
und die Beratung, Begleitung und Bewertung von Inhalten des Regionalen Entwicklungsprozesses.<br />
Die Aufgaben, welche die Geschäftsstelle der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ durch den<br />
Regionalmanager und die Assistenz im Regionalmanagement wahrnimmt, sind vor allem:<br />
� Steuerung des regionalen Entwicklungsprozesses,<br />
� Koordinierung, Begleitung, Umsetzung und Erfolgskontrolle der Entwicklungsstrategie,<br />
� Erarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzeptes,<br />
� Unterstützung des LAG-Vorstandes bei allen Aufgaben,<br />
� Initiierung, Koordinierung, Begleitung und Umsetzung von Projekten,<br />
� Betreuung und Beratung von Projektantragstellern, Akteuren und Projektträgern,<br />
� Vernetzung aller beteiligten Akteure, Organisationen und Institutionen,<br />
� Initiierung, Unterstützung und Steuerung gebietsübergreifender Kooperationen,<br />
� Mobilisierung und Qualifizierung der Akteure durch Exkursionen, Workshops, Vorträge,<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
11<br />
FACHKOMPETENZ<br />
SCHLÜSSEL-<br />
KOMPETENZEN<br />
ERFAHRUNG AUS<br />
LEADER+<br />
AUFGABEN DES<br />
LAG-GREMIUMS<br />
AUFGABEN DES<br />
REGIONALMANAGEMENTS
ÖFFENTLICHKEIT UND<br />
TRANSPARENZ<br />
KOMPETENZBÜNDELUNG<br />
GEMEINSCHAFTSSINN<br />
GESCHÄFTSORDNUNG<br />
� 2 � STRUKTUR UND EIGNUNG DER LOKALEN AKTIONSGRUPPE<br />
� Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,<br />
� Kontrolle und Darstellung der Budgetverteilung sowie<br />
� Erstellung von Bewertungs- und Selbstevaluierungsberichten.<br />
Damit Entscheidungsprozesse transparent gemacht werden und damit die interessierte Öffentlichkeit<br />
die Möglichkeit erhält, sich aktiv in die Regionalentwicklung einzubringen, werden die<br />
Arbeitsergebnisse der LAG periodisch auf der Website (www.wesermarsch-in-bewegung.de)<br />
veröffentlicht. Dazu gehören Projektideen und umgesetzte Projekte, Protokolle der LAG-Sitzungen,<br />
der Newsletter „Wesermarsch in Bewegung“, Studien sowie zukünftig Pressemitteilungen,<br />
Kooperationspartnergesuche und gegebenenfalls aktuelle Ergebnisse von Arbeitsgruppensitzungen.<br />
Eine enge Zusammenarbeit des Regionalmanagements besteht mit den einzelnen Fachabeilungen<br />
der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH. Besonders in den Themenbereichen Wirtschaftsentwicklung,<br />
Europäische Union, Förderberatung, Tourismus und Ländlicher Raum ergeben<br />
sich durch die Bündelung der Kompetenzen wertvolle Synergieeffekte. Vertreter der LAG,<br />
des Regionalmanagements und die Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Wesermarsch<br />
GmbH übernehmen kontinuierlich auf regionaler und überregionaler Ebene Vortrags- und Referententätigkeiten.<br />
Dies trägt zur Wahrnehmung der Wesermarsch-Aktivitäten im Bereich der<br />
ganzheitlichen Regionalentwicklung bei. Zur Kompetenzsteigerung und zur Mobilisierung der<br />
LAG-Akteure sind Teilnahmen an Fortbildungen und Workshops zu Themen der Regionalentwicklung<br />
sowie gemeinsame Exkursionen zu überregional ansässigen Kooperationspartnern<br />
vorgesehen.<br />
Ein wichtiges Element, welches weder mit Geschäftsordnungen noch mit Verwaltungsverfahren<br />
festgeschrieben oder verordnet werden kann, ist das Vertrauen, der mitmenschliche Umgang<br />
und der Respekt, mit dem sich die Mitglieder der LAG und des Regionalmanagements begegnen<br />
(vgl. WILKE 2000). Der Gemeinschaftssinn von „Wesermarsch in Bewegung“ schwingt bei<br />
vielen Unternehmungen mit und führt unter anderem dazu, dass gemeinsame Aktivitäten wie<br />
Dorffeste, regionale Märkte oder lokale Kulturveranstaltungen begangen werden und sich die<br />
Menschen in der Wesermarsch gegenseitig bei Problemen und Schwierigkeiten unterstützen<br />
und nach pragmatischen Lösungen suchen. Auch im regionalen politischen Raum sind Leader<br />
und „Wesermarsch in Bewegung“ unstrittig und allgemein anerkannter Ausdruck für das Überwinden<br />
von kommunalen Grenzen.<br />
Die Geschäftsordnung der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ ist im Anhang angefügt.<br />
12<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
3<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 3 � METHODIK UND ERARBITUNG DES <strong>REK</strong><br />
METHODIK UND ERARBEITUNG<br />
DES <strong>REK</strong><br />
3.1 Maßnahmen zur Information und Mobilisierung der<br />
Bevölkerung<br />
Die LAG „Wesermarsch in Bewegung“ räumt dem im LEADER-Programm verankerten Bottomup-Ansatz<br />
und dem Regionalentwicklungsprozess einen hohen Stellenwert ein. So wurde bei<br />
der Erarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzeptes eine möglichst breite Bevölkerungsbeteiligung<br />
angestrebt (vgl. WILKE 2004). Um die Menschen in der Siellandschaft Wesermarsch<br />
über den Regionalentwicklungsprozess zu informieren und für eine aktive Beteiligung zu mobilisieren,<br />
verfolgten die LAG „Wesermarsch in Bewegung“ und das Regionalmanagement eine<br />
kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die durch folgende Maßnahmen umgesetzt<br />
wurde:<br />
� Erstellung und Verbreitung des Informationsflyers „LEADER+ Land am Wasser <strong>–</strong> Wesermarsch<br />
in Bewegung“ zur Darstellung der Inhalte, Ziele und Themenfelder von LEADER+,<br />
� Berichterstattung über LEADER+ Projekte und die Prozessentwicklung in der regionalen<br />
Presse (Friesländer Bote, Kreiszeitung Wesermarsch, Nordwest-Zeitung, Wesermarsch am<br />
Sonntag, Wesermarsch am Mittwoch, Weser-Kurier),<br />
� Informationsveranstaltungen für Kreis- und Kommunalpolitiker, Auftaktveranstaltung Leader<br />
2007-2013, Öffentliche Präsentation der Imageanalyse Wesermarsch (vgl. IUW 2006),<br />
� Mobilisierung von Akteuren an der Teilnahme zu Informationsveranstaltungen und Workshops<br />
durch persönliche Einladungen sowie über Veranstaltungsankündigungen in der regionalen<br />
Presse,<br />
� Bereitstellung der Internetseite www.wesermarsch-in-bewegung.de mit Informationen und<br />
Downloads zu LEADER+, den Aktivitäten der LAG und der Geschäftsstelle sowie zu allen<br />
Projekten,<br />
� Erstellung des Newsletters „Wesermarsch in Bewegung“ (ab 2007) und Direktmailversand<br />
an rund 200 Abonnenten,<br />
� Publikation der Abschlussdokumentation „LEADER+ 2000-2006“ für die Wesermarsch.<br />
3.2 Methoden der <strong>REK</strong>-Erstellung<br />
Das Regionalmanagement „Wesermarsch in Bewegung“ hat einen dreistufigen Ansatz zur Erstellung<br />
des <strong>REK</strong> mit intensiver Einbindung regionaler Akteure entworfen und umgesetzt:<br />
1. Evaluierungsphase: SWOT-Analyse der Themenfelder und der LAG aus der LEADER-<br />
Förderperiode 2000-2006 (Januar 2006 <strong>–</strong> Mai 2006),<br />
2. Mobilisierungsphase: verstärkte Informierung und Mobilisieurung der Bevölkerung<br />
(Juli 2006 <strong>–</strong> April 2007),<br />
3. Entwicklungsphase: Erarbeitung der Entwicklungsstrategie, Erstellung von Zielen, Maßnahmen<br />
und Projektideen zur Regionalentwicklung in Zusammenarbeit mit der LAG, den<br />
Kommunen und Akteuren der Region (November 2006 <strong>–</strong> September 2007).<br />
13<br />
UMFASSENDE BÜRGER-<br />
BETEILIGUNG<br />
MASSNAHMEN<br />
DREISTUFIGER ANSATZ
PARTIZIPATION<br />
DER LAG<br />
<strong>REK</strong>-BESCHLUSS DER LAG<br />
� 3 � METHODIK UND ERARBEITUNG DES <strong>REK</strong><br />
Tab. 3.1: Veranstaltungen zur Einbindung regionaler Akteure bei der <strong>REK</strong>-Erstellung<br />
Evaluierungsphase Zeitraum/-punkt<br />
SWOT-Workshop „Tourismus“ (17 Akteure);<br />
Seminarhaus Habbinga Ovelgönne<br />
SWOT-Workshop „Regionale Produkte“ (15 Akteure);<br />
Seminarhaus Habbinga Ovelgönne<br />
SWOT-Workshop „Kultur“ (14 Akteure);<br />
Seminarhaus Habbinga Ovelgönne<br />
SWOT-Workshop „Natur“ (14 Akteure);<br />
Seminarhaus Habbinga Ovelgönne<br />
LAG-Sitzung zur Auswertung der „SWOT-Analyse LEADER+“ und zur<br />
Ausarbeitung von Leitlinien der zukünftigen Regionalentwicklung (14 Akteure);<br />
Wirtschaftsförderung Wesermarsch Brake<br />
14<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
12. Januar 2006<br />
13. März 2006<br />
28. März 2006<br />
20. April 2006<br />
24. Mai 2006<br />
Mobilisierungsphase Zeitraum/-punkt<br />
Informationsveranstaltung für Vertreter der Kreis- und Kommunalpolitik<br />
(ca. 50 Teilnehmer) zu den LEADER+ Projekten in der Wesermarsch<br />
Kreishaus Brake<br />
Öffentliche Präsentation der wissenschaftlichen Studie „Imageanalyse <strong>Wesermarsch“</strong><br />
zu den Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenzialen der<br />
Wesermarsch (ca. 100 Teilnehmer); Kreishaus Brake<br />
Auftaktveranstaltung Leader 2007-2013 mit Informationen zu den Erfolgen<br />
aus LEADER+ für die Regionalentwicklung in der Wesermarsch und mit Ausblick<br />
auf die Leader-Förderperiode 2007-2013 (ca. 200 Teilnehmer);<br />
Markthalle Rodenkirchen<br />
12. Juli 2006<br />
13. Februar 2007<br />
25. April 2007<br />
Entwicklungsphase Zeitraum/-punkt<br />
25 Perspektivgespräche mit Vertretern unterschiedlicher gesellschaftspolitischer<br />
Gruppierungen zur Auslotung von Projektansätzen (ca. 75 Akteure) und<br />
Berücksichtigung schriftlicher Eingaben und Projektanregungen von Einzelpersonen<br />
(ca. 5 Akteure); Wirtschaftsförderung Wesermarsch Brake<br />
Strategieworkshop Leader 2007-2013 zur Erarbeitung von Strategie, Zielen<br />
und Eckpunkten des <strong>REK</strong>s (ca. 30 Akteure); Kreishaus Brake<br />
9 Kommunale Workshops zur Entwicklung von Projektideen innerhalb der<br />
aus dem Strategieworkshop erarbeiteten Gesamtstrategie (ca. 140 Akteure);<br />
diverse kommunale Veranstaltungsorte<br />
Zukunftskonferenz zur Verdichtung aller Projektideen zu Leitprojekten<br />
(ca. 80 Akteure), König von Griechenland Ovelgönne<br />
LAG-Sitzung zur Begleitung und Abstimmung der Konzeptentwicklung<br />
(25 Akteure); Kreishaus Brake<br />
November 2006<br />
<strong>–</strong> Juli 2007<br />
15. Mai 2007<br />
12. Juni<br />
<strong>–</strong> 26. Juni 2007<br />
29. Juni 2007<br />
11. September 2007<br />
Eng in den Abstimmungsprozess zur Profilierung des <strong>REK</strong> wurde die LAG einbezogen. Die<br />
Vorarbeiten zur Erstellung des <strong>REK</strong>s begannen bereits zu Anfang des Jahres 2006 mit SWOT-<br />
Workshops für die in LEADER+ vorhandenen Themenfelder, deren Auswertung durch die LAG<br />
„Wesermarsch in Bewegung“ Leitlinien für die zukünftige Regionalentwicklung ergaben. An den<br />
weiteren Schritten der Entwicklungsphase (Strategieworkshop, Kommunale Workshops, Zukunftskonferenz)<br />
beteiligten sich gleichfalls zahlreiche Mitglieder der LAG.<br />
Die endgültige Abstimmung über die Strategien, Ziele und Handlungsfelder der Regionalentwicklung<br />
für den Zeitraum von 2007 bis 2013, die im vorliegenden <strong>REK</strong> festgeschrieben sind,<br />
nahmen die LAG-Mitglieder auf der 29. LAG-Sitzung am 11. September 2007 vor.
3.3 Beteiligte an der <strong>REK</strong>-Erstellung<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 3 � METHODIK UND ERARBITUNG DES <strong>REK</strong><br />
Um die Interessen und Ansprüche verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen möglichst<br />
vollständig und gleichgewichtet in der Regionalentwicklung zu berücksichtigen, wurden folgende<br />
Akteursgruppen gezielt in den Entwicklungsprozess eingebunden:<br />
� Politik: Landrat, Bürgermeister, Ratsherren und Ratsfrauen aller Kommunen,<br />
� Verwaltung: Kommunal- und <strong>Landkreis</strong>vertreter aus Bau- und Finanzverwaltung, aus Umwelt-,<br />
Bau- und Denkmalschutzfachbehörden,<br />
� Tourismus: Mitarbeiter von Tourismusorganisationen, Gästeführer, Übernachtungsanbieter,<br />
� Landwirtschaft: Vertreter der Landvolk- und Landfrauenverbände, des AK Biomilch sowie<br />
Melkhusbetreiberinnen,<br />
� Natur und Umwelt: Vorsteher der Wasser-, Boden-, Sielachts- und Deichverbände, Vorsitzende<br />
und aktive Mitglieder aus Naturschutzvereinen und Agenda-Gruppen,<br />
� Soziales und Bildung: Vorsitzende und aktive Mitglieder aus Bürger- und Kulturvereinen,<br />
Vertreter der Landeskirche, der Kirchengemeinden sowie der Ländlichen Erwachsenenbildung,<br />
Museumsfachleute, Umweltpädagogen,<br />
� Sonstige: Architekten, Künstler, Wirtschaftsförderer.<br />
Das Regionalmanagement „Wesermarsch in Bewegung“ hat aufgrund seiner Kenntnis der regionalen<br />
Verhältnisse und Strukturen sowie seiner Erfahrung aus dem LEADER+ Förderzeitraum<br />
(2000-2006) und der damit einhergehenden fachlichen und methodischen Kompetenz die Entwicklung<br />
und Erstellung des Regionalen Entwicklungskonzeptes federführend übernommen.<br />
Als beratende Kooperationspartner unterstützen die Fachabteilungen der Wirtschaftsförderung<br />
Wesermarsch GmbH (EU-Büro, Existenzgründungs- und Förderberatung, Regionalmarketing<br />
und Ländlicher Raum) das Regionalmanagement mit ressortbezogenen Fachinformationen zur<br />
Abwägung geeigneter Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Regionalentwicklungsstrategie.<br />
Das Büro für Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung KoRiS aus Hannover begleitete<br />
den Prozess durch die Leitung von Workshops und durch Beratungsleistungen im Zuge der<br />
Konzepterstellung.<br />
Die Evaluierung des LEADER+ Prozesses in der Wesermarsch, deren Ergebnisse die Grundlage<br />
für die Fortschreibung des <strong>REK</strong>s in Leader 2007-2013 bilden, übernahmen die Forum GmbH<br />
aus Oldenburg im Rahmen von SWOT-Analyse-Workhops zu allen Themenfeldern des Regionalen<br />
Entwicklungskonzeptes 2001-2006, sowie KoRiS im Rahmen einer Abschlussevaluation.<br />
Tab. 3.2: Bei der <strong>REK</strong>-Erstellung beteiligte Akteure und ihre Aufgaben.<br />
Beteiligte Aufgaben<br />
Akteure aus der<br />
regionalen Bevölkerung<br />
Regionalmanagement<br />
„Wesermarsch in<br />
Bewegung“<br />
� Einschätzung lokaler und regionaler Potenziale, Stärken und<br />
Schwächen<br />
� Beiträge zu Strategie, Zielen, Maßnahmen und Projektideen<br />
� Steuerung der Prozessarbeit: Entwicklung von Strategien, Zielen<br />
und Maßnahmen zur nachhaltigen Regionalentwicklung<br />
� Durchführung von Gesprächen mit Vertretern regionaler Interessensgemeinschaften<br />
� Durchführung Kommunaler Workshops<br />
� Durchführung der Zukunftskonferenz Wesermarsch<br />
� Erstellung des <strong>REK</strong><br />
� Abstimmung des <strong>REK</strong> mit der LAG<br />
15<br />
REPRÄSENTATIVER BEVÖL-<br />
KERUNGSQUERSCHNITT<br />
GESCHÄFTSSTELLE FEDER-<br />
FÜHREND<br />
KOOPERATIONEN<br />
EVALUATION
BOTTOM-UP-ANSATZ<br />
PERSPEKTIVGESPRÄCHE<br />
STRATEGIEWORKSHOP<br />
KOMMUNALE WORKSHOPS<br />
ZUKUNFTSKONFERENZ<br />
� 3 � METHODIK UND ERARBEITUNG DES <strong>REK</strong><br />
Forum GmbH � Durchführung der SWOT-Workshops LEADER+ Wesermarsch<br />
LAG „Wesermarsch in<br />
Bewegung“<br />
16<br />
� Ausarbeitung von Leitlinien und Zielen des <strong>REK</strong><br />
� Abstimmung des <strong>REK</strong><br />
Planungsbüro KoRiS � Evaluierung LEADER+ Wesermarsch<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Wesermarsch GmbH<br />
� Durchführung des Strategieworkshops Wesermarsch<br />
� Durchführung der Zukunftskonferenz Wesermarsch<br />
� Begleitende Beratung bei der Erstellung des <strong>REK</strong><br />
� Verfassen des Evaluationsberichtes für das <strong>REK</strong><br />
� Fachberatung im Bereich der einzelnen Handlungsfelder<br />
Insgesamt sind rund 450 Akteure 1 aktiv an der Ausarbeitung von Leitlinien, der Strategie, den<br />
Zielen und den Leitprojekten des <strong>REK</strong> einbezogen worden. Die Ideen, Wünsche und Anregungen<br />
der Menschen in der Siellandschaft Wesermarsch für die Regionalentwicklung konnten<br />
somit auf breiter Basis ausgeschöpft werden, wodurch der Bottom-up-Ansatz in Leader mit der<br />
demokratischen Einbindung der Bevölkerung in hohem Maße Berücksichtigung findet.<br />
Die Partizipation der regionalen Bevölkerung an der Erarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzeptes<br />
erfolgte auf mehren Ebenen. Schon frühzeitig wurden durch intensive Perspektivgespräche<br />
zwischen Vertretern von regional relevanten Organisationen und Institutionen aus ökologischen,<br />
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und administrativen Verantwortungsbereichen<br />
mit dem Regionalmanagement Entwicklungsperspektiven zu Fragen der Regionalentwicklung<br />
der Wesermarsch geklärt und ausgelotet.<br />
Die strategische Ausrichtung der zukünftigen Regionalentwicklung wurde im Rahmen eines<br />
Strategieworkshops erarbeitet. Hier wurden durch regionale Akteure gemeinschaftlich Strategien<br />
und Ziele zu sieben wichtigen Themenbereichen ausgearbeitet. Aus den Arbeitsergebnissen<br />
konnten fünf Haupthandlungsfelder extrahiert werden.<br />
Weiterhin wurden in Kommunalen Workshops in allen neun Gemeinden der Wesermarsch von<br />
Vertretern aus Kommunalverwaltung und -politik, Bürger- und Dorfvereinen sowie weiteren kommunal<br />
bedeutsamen Akteuren Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken der Gemeinden evaluiert<br />
sowie erste Projektideen erarbeitet.<br />
Die abschließende Zukunftskonferenz ermöglichte es, aus den Arbeitsergebnissen der vorherigen<br />
Workshops Schwerpunkte der Regionalentwicklung anhand konkreter Ziele und Maßnahmen<br />
in den fünf Handlungsfeldern festzulegen und hierzu konkrete Projektideen zu sammeln.<br />
Die Kriterien, nach denen Auswahl die der Projekte erfolgte, die Eingang in das vorliegende Regionale<br />
Entwicklungskonzept fanden, sind in Kapitel 6.2.1 dargestellt.<br />
1 Die angegebene Anzahl der regionalen Akteure ergibt sich aus der Summe der Veranstaltungs- und Workshopteilnehmer.<br />
Diese kumulierte Summe ist nicht jedoch nicht gleichzusetzen mit unterschiedlichen Individuen, da einige<br />
der regionalen Akteure an mehreren Veranstaltungen teilgenommen haben.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
4<br />
AUSGANGSLAGE UND<br />
BESTANDSAUFNAHME<br />
4.1 Raum- und Siedlungsstruktur<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch besitzt aufgrund<br />
der geographischen Verhältnisse eine ausgeprägte<br />
räumlich isolierte Randlage. Die dreiseitige Umschließung<br />
von großen Gewässern (Nordsee, Weser,<br />
Jadebusen) erschwert räumliche Beziehungen<br />
und infrastrukturelle Verflechtungen zu benachbarten<br />
Gebieten.<br />
Die siedlungsstrukturelle Entwicklung der Siellandschaft<br />
Wesermarsch ist heterogen: Aufgrund<br />
der geomorphologischen Voraussetzungen und der<br />
daraus hervorgehenden wirtschaftlichen Vorteile<br />
bildete sich auf dem Uferwall der Weser ein Siedlungsschwerpunkt,<br />
der sich gegenüber den weitläufigen<br />
Streusiedlungen im Hinterland deutlich abhebt.<br />
Aufgrund der historischen Entwicklung befinden<br />
sich entlang dieses schmalen Siedlungsbandes<br />
die beiden Mittelzentren Nordenham und Brake,<br />
die eine höhere Dichte an Industrie, Verwaltung,<br />
Dienstleistungs- und Versorgungsmöglichkeiten<br />
sowie allgemeiner Infrastruktur aufweisen.<br />
Oberzentren existieren in der Wesermarsch nicht.<br />
Der überwiegende, ländlich geprägte Teil der Sielandschaft<br />
Wesermarsch ist dünn besiedelt und<br />
weist infrastrukturelle Defizite auf, die die wohnortnahe<br />
Grundversorgung beeinträchtigen (LANDKREIS<br />
WESERMARSCH 2006).<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Charakteristische, historisch gewachsene Siedlungsformen entlang der Weser und der Nordsee<br />
sind Deichnischensiedlungen, bei denen die Häuser der (Siel-)Ortschaften nahe am Deichfuß<br />
liegen bzw. sogar in ihn hineinragen. Im nördlich gelegenen Butjadingen prägen Wurtensiedlungen<br />
und Einzelhofwurten die Landschaft <strong>–</strong> ein Siedlungstyp auf anthropogen aufgeschichteten<br />
Erdhügeln, mit denen sich Menschen vor Beginn des Deichbaus vor Meeresüberflutungen zu<br />
schützen suchten. Die historischen Wurtensiedlungen sind begrifflich an der Namensendung<br />
„-warden“ (z.B. Eckwarden) zu erkennen und stehen vielfach unter Denkmalschutz. Im Binnenland<br />
sind Moor- und Marschhufensiedlungen Zeugen der Kultivierungsgeschichte der Feuchtgebiete.<br />
Kennzeichnend für diese Siedlungsform sind in Reihen eng beieinander liegende Hofstellen,<br />
von denen aus das rückwärtige Land in langen (bis 10 km), aber nur sehr schmalen (bis 200<br />
m) Flurstücken <strong>–</strong> den sogenannten Hufen <strong>–</strong> kultiviert wurde (LOGEMANN 2005).<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Abb. 4.1: Siellandschaft Wesermarsch (dunkler gefärbt)<br />
(Quelle: eigene).<br />
17<br />
HISTORISCHE<br />
SIEDLUNGSFORMEN
VERKEHRSANBINDUNG<br />
WASSERSTRASSEN<br />
RADWEGENETZ<br />
BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR<br />
UND -DICHTE<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Die dominierende überregionale verkehrliche Anbindung der Siellandschaft Wesermarsch erfolgt<br />
über drei Bundesstraßen (B 211, B 212, B 437) als stark frequentierte Hauptverkehrsachsen.<br />
Diese verlaufen in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung. Die Querung der Weser wird durch fünf<br />
Fährverbindungen ermöglicht sowie durch Wesertunnel bei Kleinensiel, der seit seiner Fertigstellung<br />
im Jahr 2004 als einziger Verkehrstunnel die zeitlich uneingeschränkte Querung der<br />
Weser für PKW und LKW ermöglicht. Eine Autobahn ist nicht vorhanden, jedoch nach Planfeststellungsbeschluss<br />
für die Zukunft zur Erreichbarkeit der Region über die West-Ost-Achse geplant.<br />
Der genaue Trassenverlauf der A 22 und der Realisierungszeitpunkt sind aufgrund zu<br />
erwartender Widerstände in der Bevölkerung derzeit nicht vorhersehbar. Über den Schienenverkehr<br />
sind lediglich die an der östlichen Regionsgrenze weserbegleitend liegenden Städte mit<br />
Regionalverkehrszügen erreichbar, wobei zwar eine unmittelbare Bahnanbindung von Bremen<br />
existiert, nicht aber vom angrenzenden Oberzentrum Oldenburg. Der ÖPNV mit Bussen ist in<br />
der Region aufgrund eines weitmaschigen Streckennetzes und langer Fahrt- und Taktzeiten von<br />
untergeordneter Bedeutung, lediglich die Mittelzentren Brake und Nordenham profitieren von<br />
einer Schnellbuslinie, die sie mit der kreisfreien Stadt Oldenburg verbindet.<br />
Die Weser ist in ganzer Länge Bundeswasserstraße, ebenso dient die untere Hunte mit ihrer<br />
Verbindung zum Küstenkanal als Seeschifffahrtsstraße. Die Ochtum als weiterer Nebenfluss der<br />
Weser und kleinere Flüsse wie Jade, Berne und Ollen werden von Wassersportlern genutzt.<br />
Das Radwegenetz der Siellandschaft Wesermarsch ist gut ausgebaut. Viele Bundes- und Kreisstraßen<br />
verfügen über verkehrssichere Radwege. Zudem ist eine Verknüpfung an überregionale<br />
Tourenradwege (Radrundweg Unterweser, North Sea Cycle Route, Weser-Radweg) gegeben.<br />
4.2 Bevölkerungsstruktur und -entwicklung<br />
Im <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch leben 93.094 Einwohner (Stand 31.12.2006). Die Hafenstädte an<br />
der Weser (Brake, Elsfleth, Nordenham) bilden mit insgesamt 52.908 Einwohnern eine konzentrierte<br />
Siedlungsachse, dagegen herrscht in der übrigen Wesermarsch (zusammen 40.186 Einwohner)<br />
eine dünne Besiedelung mit gestreuter Bevölkerungsstruktur. Die Gesamtbevölkerungsdichte<br />
beträgt 113 Einwohner pro Quadratkilometer (NLS 2007a). Im niedersächsischen<br />
Vergleich (168 Einwohner pro Quadratkilometer) ist die Einwohnerdichte der Siellandschaft<br />
Wesermarsch als unterdurchschnittlich zu sehen, insbesondere wenn man ihre zentrale Lage<br />
zwischen den Oberzentren Bremerhaven, Bremen, Oldenburg und Wilhelmshaven bedenkt.<br />
18<br />
Tab. 4.1: Bevölkerungszahlen, Einwohnerdichte und Bevölkerungsrückgang 2006 (Stand<br />
31.12.2006) (NLS 2007a, NLS 2007b, eigene Berechnungen)<br />
Gebietskörperschaft Anzahl Einwohner Einw./qm Abnahme in % im Jahr<br />
in Prozent<br />
Wesermarsch 93.094 113,3 0,7<br />
Berne 7.082 83,1 0,5<br />
Brake 16.133 422,6 0,4<br />
Butjadingen 6.504 50,4 0,8<br />
Elsfleth 9.303 80,8 0,5<br />
Jade 5.922 63,3 0,9<br />
Lemwerder 7.169 197,1 0,5<br />
Nordenham* 27.472 315,0 0,4<br />
Ovelgönne 5.717 46,2 0,9<br />
Stadland 7.792 68,7 2,4<br />
* Ortskerne über 10.000 Einwohner zählen nicht zum Leader-Antragsgebiet.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Die Bevölkerungsentwicklung ist aufgrund eines Geburtenratendefizits und Abwanderungen seit<br />
Jahren gleichbleibend rückläufig, die Verluste betrugen im Jahr 2006 ebenso wie im vorherigen<br />
Zeitraum von 2000 bis 2006 rund 0,7 %. Dieser Trend läuft den benachbarten <strong>Landkreis</strong>en entgegen.<br />
Die Auswirkungen des demografischen Wandels treten damit in der Siellandschaft Wesermarsch<br />
früher zutage als in den Nachbarregionen (Metropolregion Bremen-Oldenburg im<br />
Nordwesten e.V. 2007).<br />
Der Anteil der unter 18-Jährigen sowie der Anteil von Einwohnern über 65 Jahren in der Siellandschaft<br />
Wesermarsch entspricht mit jeweils rund 20 % dem niedersächsischen Durchschnitt<br />
(19 %) (Forum GmbH 2007). Ein Großteil der Menschen zwischen 18 und 24 Jahren verlassen<br />
als sogenannte Ausbildungsabwanderer die Wesermarsch, um außerhalb der Region Ausbildungsplätze<br />
zu erhalten und Bildungsabschlüsse zu erlangen. Für die Zukunft geht damit qualifiziertes<br />
Arbeitskräftepotenzial verloren. Lediglich Elsfleth als Studienort (Fachbereich Seefahrt<br />
der FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven) stellt diesbezüglich eine Ausnahme dar.<br />
Im Gemeindevergleich haben die Küstengemeinden ein hohes Durchschnittsalter, bedingt durch<br />
den erhöhten Anteil von Senioren. Gerade landschaftlich attraktive Küstenräume werden als<br />
Altersruhesitze in Anspruch genommen, was zukünftig auf wachsende Infrastrukturanforderungen<br />
für ältere Menschen hindeutet (Forum GmbH 2007).<br />
Die demografische Entwicklung durch Überalterung und Wegzug junger Menschen stellt die<br />
Siellandschaft Wesermarsch vor besondere Herausforderungen im Hinblick auf den lokalen Arbeitsmarkt,<br />
die öffentliche Infrastruktur und die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven.<br />
4.3 Wirtschaftsstruktur<br />
4.3.1 Wirtschaftslage<br />
Die Finanzlage der Siellandschaft Wesermarsch ist ambivalent. Zwar liegt das Bruttoinlandsprodukt<br />
je Erwerbstätigem mit 61.822 Euro im Jahr 2005 rund 14,2 % über dem Durchschnitt des<br />
Landes Niedersachsen (NLS 2006a), jedoch ist die scheinbare Finanzkraft aufgrund einer parallel<br />
vorhandenen hohen Schulden- und Ausgabenlast real nicht existent. Über dieses Phänomen<br />
hinaus relativiert sich die scheinbare Stärke deutlich, wenn man berücksichtigt, dass insbesondere<br />
die Zahl der industriellen Arbeitsplätze seit 1993 merklich rückläufig war, dass jedoch für<br />
diese in der Summe geringer gewordenen Arbeitsplätze wegen der überproportionalen Abhängigkeit<br />
vom sekundären Sektor überdurchschnittliche Löhne gezahlt und Wertschöpfungsquoten<br />
erzielt wurden. Dieser überproportionale Anteil an der regionalen Lohnsumme und Wertschöpfung<br />
wirkt sich erheblich auf den Basiswert aus.<br />
Die Steuereinnahmen sind in der Siellandschaft Wesermarsch im überregionalen Vergleich als<br />
durchschnittlich <strong>–</strong> mit jedoch sinkender Tendenz <strong>–</strong> anzusehen: Während der Trend im Land<br />
Niedersachsen und im Bezirk Weser-Ems zwischen den Jahren 2000 und 2005 steigt, sind die<br />
Steuereinnahmen in der Wesermarsch in diesem Zeitraum rückläufig und erreichen im Jahr<br />
2005 nur 95,9 % des Landesdurchschnitts gegenüber 101,4 % im Jahr 2000 (vgl. Abb. 4.2).<br />
Auf kommunaler Ebene variiert die Steuereinnahmekraft in der Wesermarsch und damit einhergehend<br />
der lokale finanzielle Handlungsspielraum sehr stark. Sechs ländlich geprägte Kommunen<br />
(Berne, Butjadingen, Elsfleth, Jade, Ovelgönne, Stadland) zeichnen sich durch wenig gewerbliche<br />
Betriebe und eine dementsprechend geringe Steuereinnahmekraft aus. Dagegen<br />
erlangen die drei entlang des industriellen Siedlungsbandes an der Weser gelegenen Kommunen<br />
(Brake, Lemwerder, Nordenham) höhere Steuereinnahmen (vgl. Abb. 4.3). Jedoch schwanken<br />
diese von Jahr zu Jahr stark, was zur Folge hat, dass sie vorausschauend nicht kalkulierbar<br />
sind und dass zum Teil erhebliche Rückzahlungen von den Kommunen zu leisten sind.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
19<br />
BEVÖLKERUNGSENT-<br />
WICKLUNG<br />
DEMOGRAFISCHE<br />
BESONDERHEITEN<br />
ALLGEMEINE FINANZLAGE<br />
STEUEREINAHMEN<br />
INSGESAMT<br />
GEMEINDESTEUER-<br />
EINNAHMEN
VERSCHULDUNG<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Abb. 4.2: Entwicklung der Steuerkraft im Landes- und Bezirksvergleich in € (Realsteueraufbringungskraft<br />
abzüglich Gewerbesteuerumlage, zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />
und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) (Quelle: NLS 2006b)<br />
20<br />
Steuereinnahme pro Einw. (in Euro)<br />
1600<br />
1500<br />
1400<br />
1300<br />
1200<br />
1100<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
Steuereinnahme pro Einw. (in Euro)<br />
0<br />
640<br />
620<br />
600<br />
580<br />
560<br />
540<br />
617<br />
621<br />
Steuereinnahmekraft<br />
576<br />
Land Niedersachsen Bezirk Weser-Ems <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch<br />
St euereinnahmekraf t<br />
Ber ne Br ake* Butj adi ngen El sf l eth Jade Lemwer der Nor denham* Ovel gönne Stadl and<br />
Abb. 4.3: Entwicklung und Höhe der Steuerkraft der Kommunen in der Wesermarsch in € (Realsteueraufbringungskraft<br />
abzüglich Gewerbesteuerumlage, zuzüglich Gemeindeanteil an<br />
der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) (Quelle: NLS 2006b).<br />
Den Steuereinnahmen gegenüber steht die Schuldenlast. Während das Land Niedersachsen<br />
und der Bezirk Weser-Ems seit dem Jahr 2000 eine deutliche Tendenz zur Schuldenreduzierung<br />
aufweisen, hat sich der Schuldenstand der Gemeinden und des <strong>Landkreis</strong>es in der Siellandschaft<br />
Wesermarsch überdurchschnittlich negativ entwickelt (vgl. Abb. 4.4). Im Jahr 2006<br />
lag die Pro-Kopf-Schuldenlast um 21,7 % höher als im Landesschnitt und sogar um 41,9 %<br />
höher als im Bezirksvergleich. Aufgrund der hohen Pro-Kopf-Verschuldung, die im Wesentlichen<br />
auf den Strukturwandel mit einhergehenden Arbeitsplatzverlusten zurückgeht, ist die Finanzlage<br />
im <strong>Landkreis</strong> weiterhin als angespannt einzustufen.<br />
604<br />
626<br />
596<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Jahr<br />
2000<br />
2005<br />
2000<br />
2005
Höhe (Euro)<br />
1.300<br />
1.200<br />
1.100<br />
1.000<br />
900<br />
800<br />
1.173<br />
1.072<br />
1.080<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Abb. 4.4: Schuldenstand pro Kopf der Wohnbevölkerung in € (Quellen: NLS 2000-2002,<br />
Transferstelle dialog & regio institut 2005, regio institut 2007, eigene Berechnung)<br />
Die anhand der Bruttowertschöpfung dargestellte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Wesermarsch<br />
wird vor allem durch das produzierende Gewerbe geprägt, dem innerhalb der Region<br />
eine starke Rolle zukommt. Mit 48,4 % liegt dessen Beitrag zur BWS weit über dem Wert für den<br />
Bezirk Weser-Ems und dem des Landes Niedersachsen. Ursächlich hierfür sind große Industriebetriebe<br />
im Luftfahrt-, Schiff- und Metallbau. Dagegen ist die Wirtschaftsleistung der Milch-<br />
und Mastviehhaltung mit nur 3,2 % sehr gering (vgl. Tab. 4.2), obwohl die landwirtschaftliche<br />
Grünlandnutzung die Siellandschaft Wesermarsch in der Fläche dominiert.<br />
Tab. 4.2: Bruttowertschöpfung der Wirtschaftssektoren im Jahr 2005 im Vergleich zum Bezirks- und<br />
Landesdurchschnitt (Quellen: NLS 2006c, eigene Berechnungen)<br />
<strong>Landkreis</strong>.<br />
Wesermarsch<br />
Bezirk<br />
Weser-Ems<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Land<br />
Niedersachsen<br />
Bruttowertschöpfung (in Mio. Euro) 1.978,3 Mio € 52.425,3 Mio € 172.613,9 Mio €<br />
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei<br />
(Prozent des Primärsektors an BWS)<br />
Produzierendes Gewerbe<br />
(Prozent des Sekundärsektors an BWS)<br />
Dienstleistungsbereich<br />
(Prozent des Tertiärsektors an BWS)<br />
992<br />
1.029<br />
926<br />
Pro-Kopf-Schuldenlast<br />
1.115<br />
934<br />
1.029<br />
1.170<br />
937<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
3,2 % 2,8 % 1,8 %<br />
48,4 % 30,9 % 30,5 %<br />
48,4% 66,3 % 67,6 %<br />
Aufgrund der unterdurchschnittlichen Repräsentanz des Dienstleistungssektors im Bezirks- und<br />
Landesvergleich (vgl. Tab. 4.2) wird die Tertiärisierung in der Siellandschaft Wesermarsch als<br />
unzureichend angesehen. Als problematisch gelten auch die auf hohem Niveau strukturell bedingten<br />
Verluste im produzierenden Sektor sowie der deutliche Strukturwandel im Primärsektor,<br />
der im Vergleich der Jahre 1999 und 2004 einen Rückgang um über 15 % der BWS ausmacht.<br />
Das Wirtschaftswachstum hat sich zwar im gleichen Zeitraum um 7,8 % erhöht, lag damit aber<br />
nur knapp über dem niedersächsischen Landesdurchschnitt von 6,8 % und weit unter dem<br />
Wachstum des Bezirks Weser-Ems mit 11,6 % (NLS 2006c; eigene Berechnungen).<br />
1.032<br />
Zeitraum (Jahr)<br />
927<br />
1.248<br />
1.021<br />
997<br />
1.237<br />
855<br />
841<br />
1.193<br />
980<br />
<strong>Landkreis</strong> Wesermarsch<br />
Land Niedersachsen<br />
Bezirk Weser-Ems<br />
21<br />
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG<br />
SEKTORALE PROBLEME
GRÜNLANDWIRTSCHAFT<br />
AGRIBUSINESS<br />
LANDWIRTSCHAFTLICHER<br />
STRUKTURWANDEL<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
4.3.2 Landwirtschaft<br />
Über die rein ökonomische Funktion hinaus hat die Landwirtschaft für die Siellandschaft Wesermarsch<br />
eine starke landschaftsprägende, landschaftsgeschichtliche und ökologische Bedeutung.<br />
Insgesamt werden 81,4 % der Fläche des <strong>Landkreis</strong>es Wesermarsch landwirtschaftlich genutzt<br />
(NLS 2006d), von dieser landwirtschaftlichen Nutzfläche (LF) werden rund 95 % als Dauergrünland<br />
(Futterbaubetriebe) und rund 4 % der Flächen als Ackerland bewirtschaftet. Die Wesermarsch<br />
ist damit eines der größten Grünlandgebiete Deutschlands und Europas (LANDKREIS<br />
WESERMARSCH 2003). Dennoch spielt die Wirtschaftsleistung der Milch- und Mastviehhaltung<br />
mit einem Anteil von 3,2 % an der regionalen Bruttowertschöpfung nur eine untergeordnete<br />
Rolle. Im Vergleich zur Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft in Niedersachsen mit nur 1,8 %<br />
hat der primäre Sektor in der Wesermarsch jedoch eine vergleichsweise hohe Bedeutung (vgl.<br />
Kap. 4.3.1, Tab. 4.2).<br />
Über den primären Sektor hinaus haben vor- und nachgelagerte Bereiche der Landwirtschaft<br />
(Agribusiness) einen großen Anteil an der Bruttowertschöpfung und Erwerbstätigenquote. Allgemein<br />
gilt, dass von einem landwirtschaftlichen Arbeitsplatz 3-4 Arbeitsplätze im Agribusiness<br />
abhängen, wie Futtermittel-, Landmaschinen, Pflanzenschutzindustrie sowie Nahrungsmittel-<br />
und Gastgewerbe (DEUTSCHER BAUERNVERBAND 2007). Eine hervorgehobene Stellung nimmt<br />
die in der Wesermarsch angesiedelte Nordmilch-Molkerei ein, die im Jahr 2006 Milch von 69 %<br />
aller 435 milcherzeugenden Betriebe in der Wesermarsch und zusätzlich von 132 Milcherzeugern<br />
aus den angrenzenden <strong>Landkreis</strong>en Friesland und Ammerland verarbeitet hat (LWK<br />
2007b).<br />
Tab. 4.3: Eckdaten der Landwirtschaft im Länder- und Bezirksvergleich (Quellen: NLS 2006d, eigene<br />
Berechnungen)<br />
22<br />
Dauergrünlandanteil<br />
an<br />
LF<br />
Milchkühe pro<br />
Betrieb (durchschnittlich)<br />
Betriebe<br />
50 <strong>–</strong> < 75 ha<br />
in Prozent<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Betriebe<br />
75 <strong>–</strong> 100 ha<br />
in Prozent<br />
Niedersachsen 29,8 % 43 14,9 % 9,5 % 12,9 %<br />
Weser-Ems 38,1 % 42 16,6 % 8,1 % 6,6 %<br />
Wesermarsch 94,6 % 62 21,7 % 16,8 % 13,2 %<br />
Insgesamt existierten 1053 landwirtschaftliche Betriebe im Jahr 2005, davon rund 60 % im<br />
Haupterwerb (NLS 2006d). Davon umfassen 21,7% der Höfe Betriebsgrößen zwischen 50 bis<br />
75 Hektar, dies entspricht rund 25 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die 13,2 % der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe über 100 ha bewirtschafteten mit 18 920 ha insgesamt rund 33 % der<br />
Nutzfläche. Dagegen summieren sich die 507 Betriebe (48,1 %) unter 50 ha auf insgesamt nur<br />
15 % Landwirtschaftsfläche. Diese Zahlen spiegeln die Entwicklung des landwirtschaftlichen<br />
Strukturwandels in den letzten Jahrzehnten wider. Die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe sank<br />
kontinuierlich <strong>–</strong> im Zeitraum von 1949 bis 1994 verringerte sich die Betriebszahl im Kreisgebiet<br />
um 73 % (NLS 2007c) <strong>–</strong>, und die Abnahme hält weiter an. Aktuell beträgt der Rückgang der<br />
landwirtschaftlichen Höfe 3,3 % zum Vorjahr (NLS 2006d). Besonders kleine und mittlere Betriebe<br />
schwinden. Die Aufgabe von Landwirtschaftsbetrieben und Hofstellen verursacht Leerstand<br />
und den Verfall von Gebäuden, die teilweise einen hohen kulturhistorischen und landschaftsprägenden<br />
Wert haben. Der Kaufwert landwirtschaftlich genutzter Grundstücke gehört<br />
mit unter 7.500 €/ha zur untersten Kaufwertklasse in Niedersachsen (NMELV 2007).
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Aufgrund der naturräumlichen Gegebenheit müssen landwirtschaftliche Betriebe in der Siellandschaft<br />
Wesermarsch eine besondere Kostenbelastung beim Erhalt des Sielsystems tragen. Als<br />
Anlieger haben Landwirte für den Unterhalt des Entwässerungssystems Sorge zu tragen und<br />
müssen Grüppen und Gräben regelmäßig von Bewuchs freihalten (Kosten: rund 50 Euro/ha/Jahr).<br />
Zusätzlich werden von den Sielachtsverbänden Beiträge von rund 30-40 Euro/ha/Jahr<br />
für die Aufreinigung der Gewässer 1. und 2. Ordnung erhoben (LWK 2007a). Hinzu<br />
kommen Energiekosten für die elektrische Abpumpung des Grabenwassers. Die durch die historische<br />
Entwässerungstechnik bedingten schmalen, langen Flurstücke (Hufen) stellen eine weitere<br />
Erschwernis bei der maschinellen Bearbeitung der Flächen dar. Zudem entsprechen viele<br />
landwirtschaftliche Wege in Qualität und Quantität nicht mehr den Anforderungen moderner<br />
Landmaschinen.<br />
Die Landwirtschaft der Wesermarsch wird von der Rinderhaltung dominiert. Im Jahr 2003 existierten<br />
926 Betriebe (vgl. Abb. 4.5), auf denen insgesamt 129.081 Rinder gehalten wurden,<br />
darunter 42.362 Milchkühe. Mit einer Viehdichte in der Rinderhaltung von 1,7 Großvieheinheiten<br />
pro Hektar liegt die Wesermarsch über dem niedersächsischen Landesschnitt (1,2 GV/ha). Die<br />
traditionelle Form der Weidemast, die Ochsenmast, ist eine Besonderheit der Siellandschaft, die<br />
auch heute noch praktiziert wird.<br />
Vieh Vieh<br />
Schweine<br />
Geflügel<br />
Schafe<br />
Pferde<br />
Rinder<br />
52<br />
132<br />
205<br />
320<br />
Abb. 4.5: Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe nach Art der Viehhaltung in der Wesermarsch<br />
(Quellen: NLS 2006d, eigene Berechnungen).<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch wird im Sommer zudem von Schafen und Pferden geprägt. Im<br />
Jahr 2003 wurden auf den Deichen und Grünländereien 26.843 Schafe, davon rund die Hälfte<br />
Mutterschafe, gehalten. Allein zehn Deichschäfereien bewirtschaften mit rund 18.000 Schafen in<br />
den Sommermonaten 1.000 ha landwirtschaftlich genutzte Deichflächen (CORNELIUS 2003).<br />
Deichschafe sind vor allem für die Deichsicherheit von Bedeutung, da sie durch ihr gleichmäßiges<br />
Weideverhalten die Grasnarbe geschlossen halten und den Deichkörper durch ihren Tritt<br />
stabilisieren. In der Pferdehaltung spielen vor allem die Pferdezucht und die Pensionspferdehaltung<br />
eine Rolle: Zu den rund 2.200 Pferden, die zu den Betrieben der Wesermarsch gehören,<br />
werden in den Sommermonaten jährlich rund 5.000 Pensionspferde <strong>–</strong> vor allem aus Hessen und<br />
Nordrhein-Westfalen <strong>–</strong> versorgt (LWK 2007a). Rindern, Schafen und Pferden fällt als Weidevieh<br />
eine besondere Rolle bei der Weidepflege und beim Erhalt der Offenlandschaft zu.<br />
Zusätzliche Einkommensquellen für Landwirte sind Ferienzimmervermietung (70 Betriebe mit<br />
„Urlaub auf dem Bauernhof“) und die Errichtung von Windkrafträdern (KREISLANDVOLKVERBAND<br />
WESERMARSCH 2007). Insgesamt befinden sich in der Wesermarsch 150 Windkraftanlagen mit<br />
einer installierten Leistung von rund 150 Megawatt.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
926<br />
0 200 400 600 800 1.000<br />
Anzahl Anzahl der der Betriebe<br />
Betriebe<br />
23<br />
ERSCHWERTE PRODUK-<br />
TIONSBEDINGUNGEN<br />
SCHWERPUNKT RIND-<br />
VIEHHALTUNG<br />
SCHAF- UND PFERDE-<br />
HALTUNG<br />
NEBENEINKOMMEN
ÖKOLOGISCHER LANDBAU<br />
REGIONALE PRODUKTE<br />
FISCHEREIWIRTSCHAFT<br />
MARITIME VERMARKTUNG<br />
GROSSBETRIEBE<br />
ENTWICKLUNG DES<br />
INDUSTRIESEKTORS<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Dem ökologischen Landbau haben sich rund 3,5 % der landwirtschaftlichen Betriebe verschrieben.<br />
Sie bewirtschaften rund 3,3 % der LF nach den entsprechenden Richtlinien. Damit liegt die<br />
Region über dem niedersächsischen Landesdurchschnitt von 2 % ökologisch bewirtschafteter<br />
Fläche (NLS 2006d). Der Anteil an Biomilch beträgt rund 3 Mio. kg von insgesamt 283 Mio. kg<br />
im Jahr 2006 (LWK 2007b). Etwa 10.000 ha <strong>–</strong> und damit rund 15 % der landwirtschaftlichen<br />
Nutzfläche in der Wesermarsch <strong>–</strong> werden zudem im Rahmen von Extensivierungsprogrammen,<br />
Vertragsnaturschutz, Feuchtgrünlandschutzprogrammen oder freiwilligen Kooperationsmaßnahmen<br />
extensiv genutzt (KREISLANDVOLKVERBAND WESERMARSCH, 2007).<br />
Regionaltypische landwirtschaftliche Produkte der Wesermarsch werden vom Regionalverein<br />
proRegion Wesermarsch/Oldenburg e.V. <strong>–</strong> einem Zusammenschluss von regional ansässigen<br />
Erzeugern, Fleischern und Gastronomen <strong>–</strong> hergestellt, verarbeitet und vermarktet. Im Jahr 2006<br />
wurden innerhalb der regionalen Wertschöpfungskette durch Ochsenfleisch, Lammfleisch und<br />
die „Regionale Kiste“ schätzungsweise 530.000 Euro umgesetzt (PROREGION 2007). Für seine<br />
Arbeit wurde der Verein im bundesweiten Wettbewerb „natürlich regional“ des Deutschen Verbandes<br />
für Landespflege und des Naturschutzbundes im Jahr 2005 mit dem 2. Platz ausgezeichnet.<br />
Im Primärsektor der Siellandschaft Wesermarsch spielen zwei gewerbliche Fischereiorte mit<br />
Fischereigenossenschaften eine bedeutende Rolle. Im Jahr 2006 sind hier innerhalb der Küsten-<br />
und Kleinen Hochseefischerei 173 Tonnen Fisch im Wert von 323.000 Euro in Brake und<br />
681 Tonnen im Wert von 1.815.999 Euro in Fedderwardersiel angelandet worden. Zusammen<br />
entspricht der monetäre Wert des Fangs 9,7 % der Gesamtanlandungen im Fischwirtschaftsgebiet<br />
Niedersächsische Nordseeküste. Wichtigste angelandete Art ist dabei die Nordseegarnele<br />
(Crangon crangon), die landläufig als „Krabbe“ bezeichnet wird. Die Krabbenfischerei ist unter<br />
den verschiedenen Sparten der Küstenfischerei die gedeihlichste. Probleme ergeben sich dagegen<br />
aufgrund von Überfischung oder konkurrierender Meeresflächennutzung (Offshore-Windkraft)<br />
bei Kabeljau und Dorsch. Durch die Weservertiefung und die zunehmende Schlickproblematik<br />
sind auch Degradierungen der Fanggründe zu erwarten. Die Verarbeitung des Fisches spielt<br />
aufgrund von Exporten (z.B. Marokko, Holland, Polen) kaum eine Rolle (COFAD GMBH 2007).<br />
Einige Kutter- und Fischereibetriebe in der Wesermarsch haben sich als zweites Standbein eine<br />
Einkommensquelle im Tourismus durch Direktverkauf von Krabben und Fisch erschlossen.<br />
Insbesondere im Hafen von Fedderwardersiel wird das maritime Erbe durch Kutterregatten und<br />
Krabbenpulmeisterschaften touristisch vermarktet.<br />
4.3.3 Industrie<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch weist neben dem <strong>Landkreis</strong> Vechta den stärksten Industrialisierungsgrad<br />
im Land Niedersachsen auf. Sie ist jedoch gleichzeitig bezogen auf die Grundfläche<br />
überwiegend von Grünland und darauf betriebener landwirtschaftlicher Milch- und Weidewirtschaft<br />
geprägt.<br />
Vom Arbeitsplatzvolumen her besonders bedeutsam sind große Industriebetriebe im Luftfahrt-,<br />
Schiffbau- und Metallsektor. In hafenzugewandten Bereichen gehören hierzu auch die damit<br />
zusammenhängenden Logistikunternehmen und teilweise auch die chemische Industrie.<br />
Der ehemals starke Industriesektor der Siellandschaft Wesermarsch ist jedoch deutlich rückläufig,<br />
und auch für die Zukunft sind ein Fortschreiten des sozialökonomischen Strukturwandels<br />
und weniger Arbeitsplätze im direkt produzierenden Sektor zu erwarten. Denn obwohl auch<br />
durch den gezielten Einsatz von Fördermitteln eine Stärkung der Unternehmen und der Ausbau<br />
der Infrastruktur vorgenommen wird, kann eine regional orientierte Wirtschaftsförderungsstrategie<br />
bei konzerngesteuerten Großbetrieben in der Wesermarsch (z.B. Airbus) nur sehr bedingt<br />
Einfluss auf interne Entscheidungsprozesse nehmen.<br />
24<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Die Struktur der aktuellen Situation im Industriesektor wird in der Fachdiskussion von zwei Seiten<br />
aus als bedenklich angesehen: Einerseits wird der Rückgang der nach wie vor prägenden<br />
industriellen Beschäftigung vor allem durch Großunternehmen realisiert, die ihren Geschäftssitz<br />
außerhalb der Region haben. Andererseits wird die hierdurch ausgelöste Problematik noch<br />
dadurch vergrößert, dass ein „Gegenpol“ in Gestalt endogen verwurzelter mittelständischer<br />
Betriebe mit Innovations- und Wachstumspotenzial noch merklich zu schwach ausgeprägt ist<br />
(vgl. SEEBER 2004).<br />
4.3.4 Tourismus<br />
Aufgrund der naturnahen Kulturlandschaft und der Nähe zur Nordsee ist die Tourismuswirtschaft<br />
in der Siellandschaft Wesermarsch ein bedeutsames Segment im tertiären Wirtschaftssektor,<br />
rund 20 % der Wertschöpfung im <strong>Landkreis</strong> werden durch den Tourismus erzielt (LANDKREIS<br />
WESERMARSCH & WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG WESERMARSCH GMBH 2006).<br />
Die Wesermarsch ist Urlaubs- und Erholungsregion für Touristen aus nahen und weiter entfernten<br />
Quellgebieten, wobei zu letzteren besonders Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und<br />
Bayern zählen (TGW 2007). Im Jahr 2006 wurden allein in gewerblichen Übernachtungsbetrieben<br />
mit mehr als 8 Betten 569.654 Gästeübernachtungen verzeichnet. Die hierdurch erreichte<br />
durchschnittliche Bettenauslastung lag mit 36,8 % etwas über dem Landesschnitt von 35,2 %<br />
(NLS 2007d). Hinzu kommen Übernachtungen in kleineren, privaten Beherbergungsbetrieben<br />
sowie auf Camping- und Reisemobilstellplätzen, die quantitativ bisher nicht erfasst wurden. Ihr<br />
Anteil liegt bei rund 60 % an der Gesamtübernachtungszahl (IFT 2007).<br />
In der Tourismuswirtschaft der Siellandschaft Wesermarsch existiert ein Gefälle von der Küste<br />
zum Binnenland. Der Süden der Siellandschaft Wesermarsch fungiert vorwiegend als Naherholungsgebiet<br />
für Tagesgäste und Kurzurlauber, die bevorzugt in der Sommersaison an den Wochenenden<br />
aus den umliegenden Oberzentren Bremen und Oldenburg in die Region kommen.<br />
Erholungsurlauber (Altersgruppe „50+“) sowie Familien mit Kindern, die vor allem in den Ferien<br />
ein bis zwei Wochen die Wesermarsch aufsuchen, finden sich überwiegend an der Nordseeküste<br />
(WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG WESERMARSCH GMBH 2002): Die Küstengemeinde Butjadingen<br />
hält einen Anteil von 83 % der gewerblichen Bettenkapazitäten und 87 % der gewerblichen<br />
Übernachtungen im Vergleich zu allen übrigen Wesermarsch-Gemeinden (NLS 2007e).<br />
Tab. 4.4: Touristische Struktur anhand von Kenndaten (im Jahr 2006) (Quelle: NLS 2007e)<br />
Bettenzahl Bettenzahl in % Gewerbl. Übernachtungen<br />
absolut*<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Gewerbl. Übernachtungen<br />
in %*<br />
Wesermarsch 4.418 100 % 569.654 100,0 %<br />
Butjadingen 3.663 82,9 % 498.231 87,5 %<br />
Nordenham 364 8,2 % 31.998 5,6 %<br />
Stadland 151 3,4 % 14.724 2,6 %<br />
Berne 42 1,0 % 3.766 0,7 %<br />
Brake 56 1,3 % 5.416 1,0 %<br />
Jade 0 0,0 % 0 0,0 %<br />
Ovelgönne 0 0,0 % 0 0,0 %<br />
Elsfleth 0 0,0 % 0 0,0 %<br />
Lemwerder 0 0,0 % 0 0,0 %<br />
* in Einrichtungen mit mehr als 8 Betten, ohne Campingübernachtungen.<br />
25<br />
KLEINE UND MITTELSTÄN-<br />
DISCHE UNTERNEHMEN<br />
ÜBERNACHTUNGEN<br />
TOURISMUSSTRUKTUR
ÜBERNACHTUNGSZAHLEN<br />
ÜBERNACHTUNGS-<br />
EINRICHTUNGEN<br />
MARITIMER TOURISMUS<br />
FAHRRADTOURISMUS<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Die Urlaubsregion Wesermarsch <strong>–</strong> insbesondere die Teilregion Butjadingen <strong>–</strong> befindet sich seit<br />
einigen Jahren in einem intensiven Prozess der Restrukturierung. Die Infrastruktur der Nordseebäder<br />
und die Übernachtungseinrichtungen genügen den heutigen Erwartungen der Gäste nicht<br />
mehr in vollem Umfang, so dass die Anzahl der Gästeankünfte und Übernachtungen im Verlauf<br />
der letzen sechs Jahre insgesamt rückläufig war. Zwar indizieren die touristischen Kennzahlen<br />
mit einer Steigerung der Gästeankünfte um 19,4 % in den letzten zwei Jahren, dass die Talsohle<br />
durchschritten ist, jedoch hält der Rückgang der Übernachtungszahlen, welcher insbesondere<br />
durch den Trend zu mehr Kurzreisen sowie durch die Investitionswelle im Tourismus an der<br />
Ostsee verstärkt wurde, ungebrochen an. Nur ein verringertes Bettenangebot konnte die vergleichsweise<br />
gute Auslastung der Beherbergungsbetriebe von 36,9 % bei Abnahme der Übernachtungen<br />
um 12,1 % aufrechterhalten (vgl. Tab 4.5).<br />
Tab. 4.5: Entwicklung der touristischen Nachfrage im Zeitraum von 2000 und 2006 im Vergleich mit<br />
dem Land Niedersachsen und den benachbarten Ferienregionen (NLS 2007e).<br />
26<br />
Bettenzahl Übernachtungen Aufenthaltsdauer Auslastung<br />
Niedersachsen - 2,4 % - 10,1 % Von 4,7 auf 4,1 Tage - 2,8 %<br />
Cuxhaven + 4,2 % - 6,4 % Von 5,4 auf 5,0 Tage - 3,4 %<br />
Friesland - 7,6 % - 10,7 % Von 6,2 auf 5,1 Tage - 0,8 %<br />
Wesermarsch - 8,2 % - 12,1 % Von 4,7 auf 4,1 Tage +/- 0 %<br />
Die Übernachtungseinrichtungen in der Siellandschaft Wesermarsch werden vorwiegend von<br />
Privatvermietern betrieben. Dadurch sind die Quartiere räumlich gestreut, für größere zusammengehörige<br />
Reisegruppen existieren nur wenige Unterkünfte. Problematisch stellt sich weiterhin<br />
die Qualität der Privatzimmerausstattung dar. Oft sind die Einrichtungen veraltet, und nur<br />
wenige Unterkünfte befinden sich im 3-Sterne-Plus-Segment. Besonders für den Fahrradtourismus<br />
erweisen sich die in Qualität und Quantität mangelhaften Übernachtungsmöglichkeiten als<br />
Hemmnis. Unterkünfte für Mehrpersonengruppen fehlen, vorhandene Privatunterkünfte sind<br />
häufig mit Leiharbeitskräften aus der Industrie belegt, und ein Großteil der Privatvermieter bevorzugt<br />
Mehrtagesgäste gegenüber Radfahrtouristen, die nur für eine einzelne Übernachtung im<br />
Quartier bleiben.<br />
Die Fluss- und Küstenlandschaft der Wesermarsch weist eine ausgeprägte maritime Tradition<br />
auf. Nordsee und Weser waren und sind die Grundlage für das historische und zeitgenössische<br />
maritime Kulturerbe, das geprägt wird durch Seeschifffahrt und Seehäfen, Fischfang, Schiffs-<br />
und Bootswerften, Traditionssegler, Plattbodenschiffe und Sportboote, durch maritimes Handwerk,<br />
Deichbau, Leuchttürme und Sielanlagen. Maritime Aspekte durchziehen ebenfalls die<br />
regionale Küche und Kulinaria, Architektur und Brauchtum. Dieses maritime Profil birgt ein hohes<br />
touristisches Potenzial. Die maritime Kultur und die naturräumlichen Gegebenheiten der<br />
Flüsse, wie die ausgedehnten Sandstrände der Weser, ihre Flussinseln und die wassersportgeeigneten<br />
ruhigen Fließgewässer im Binnenland sind starke Anziehungspunkte für die Freizeitnutzung.<br />
Jedoch ist die touristische Infrastruktur im Bereich des Bade- und Wassertourismus<br />
stark ausbaufähig (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG WESERMARSCH GMBH 2002).<br />
Ein bedeutender touristischer Faktor in der Siellandschaft ist der Radtourismus. Die ebene<br />
Landschaft und ein weitläufiges Radwegenetz bieten einer großen Zielgruppe gute Bedingungen<br />
zum Fahrradfahren (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG WESERMARSCH GMBH 2002). Die wichtigsten<br />
Radrouten, die die Wesermarsch durchziehen, sind die Deutsche Sielroute mit 200 Streckenkilometern,<br />
entlang derer das Sielsystem thematisch aufgearbeitet wird, die transnationale North<br />
Sea Cycle Route, die die Nordsee-Anrainerstaaten verbindet sowie der Weser-Radweg, der mit<br />
rund 150.000 Radtouristen pro Saison zu den beliebtesten deutschen Fernradwegen zählt (We-<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
serKontor GmbH 2007). Rastmöglichkeiten und Wegweiser sind <strong>–</strong> wenn auch in unterschiedlicher<br />
Qualität <strong>–</strong> meist vorhanden. Jedoch bestehen teilweise auf den schmalen landwirtschaftlichen<br />
Wegen, welche als Radwege bereits genutzt werden oder genutzt werden könnten, mangelhafte<br />
Wege- bzw. Oberflächenbeschaffenheiten. Die geringe Wegesbreite speist zudem<br />
Nutzungs- und Zielkonflikte zwischen Landwirtschaft und Tourismuswirtschaft.<br />
4.4 Arbeitsmarkt und Einkommen<br />
Der wirtschaftliche Strukturwandel der letzten Jahre mit Schließungen und Verlagerungen von<br />
Betrieben im produzierenden Sektor verursachte in der Siellandschaft Wesermarsch gravierende<br />
Arbeitsplatzverluste. Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen den<br />
Jahren 1990 und 2006 weist ein Minus von mehr als 14 % auf. Dies entspricht einem konkreten<br />
Verlust von rund 3.900 Arbeitsplätzen.<br />
Dagegen nahm der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bezirks- und landesweit<br />
im gleichen Zeitraum merklich zu (vgl. Tab. 4.6), so dass der Arbeitsplatzverlust in der Wesermarsch<br />
besonders schwer wiegt.<br />
Tab. 4.6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort zum 30.6 im Vergleich der Jahre<br />
1999 und 2006 (Quellen: IHK 2007, eigene Berechnungen).<br />
1990 2006 Veränderung<br />
absolut<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Veränderung<br />
prozentual<br />
Land Niedersachsen 2.285.238 2.320.167 34.929 1,5 %<br />
Bezirk Weser-Ems 655.672 716.210 60.538 9,2 %<br />
<strong>Landkreis</strong> Wesermarsch 27.689 23.822 - 3.867 -14,0 %<br />
Die Quote der in der regionalen Landwirtschaft sozialversicherungspflichtig Erwerbstätigen lag<br />
2006 mit 1,9 % leicht über dem Landesdurchschnitt von 1,6 %. Im produzierenden Gewerbe<br />
(inklusive Baugewerbe und Energieversorgung) fanden 2006 noch 48,6 % der sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigten einen Arbeitsplatz. Im Vergleich dazu waren es auf Landesebene<br />
nur 33,0 %. Im Dienstleistungssektor arbeiteten 49,5 % der sozialversicherungspflichtig beschäftigten<br />
Arbeitnehmer, im Landesvergleich zu 65,4% ist dieser Sektor deutlich unterrepräsentiert<br />
(IHK 2007; NLS 2006e).<br />
Die Gründungsintensität zeigt sich über die Jahre 2003 bis 2006 uneinheitlich. Ein Anstieg im<br />
Jahr 2004 erfolgte im Zuge einer allgemein feststellbaren Zunahme an Gewerbeanmeldungen<br />
bzw. Gründungen. Diese Aktivität ist im Kontext der verstärkten Förderung der Selbständigkeit<br />
durch die Agentur für Arbeit zu sehen. Möglicherweise erklärt sich daraus der anschließende<br />
Rückgang auf Landesebene und im Weser-Ems-Bezirk für die Jahre 2005 und 2006, da die<br />
Wirtschaftlichkeit der Gründungen nicht gegeben war. Von dieser allgemein negativen Entwicklung<br />
zeigt sich die Wesermarsch jedoch unbeeindruckt. Das Jahr 2006 bleibt mit einem deutlichen<br />
Zuwachs von 10,5 % im Plus. Die Potenziale der Selbständigkeit scheinen damit noch<br />
nicht ausgeschöpft zu sein.<br />
Die Arbeitslosenquote in der Wesermarsch kann als durchschnittlich beschrieben werden. Betrachtet<br />
man jedoch den Anteil der Langzeitarbeitslosen, so ist diese Gruppe deutlich größer als<br />
im Regionsvergleich (vgl. Tab. 4.7). Es lässt sich daher von einer drohenden Verfestigung der<br />
Arbeitslosigkeit sprechen. Problematisch wirkt sich der hohe Anteil der Langzeitarbeitslosen auf<br />
die Höhe der Sozialausgaben aus, da die Integration in den Arbeitsmarkt unter erschwerten<br />
Rahmenbedingungen (Rückgang an Beschäftigungsmöglichkeiten) stattfinden muss.<br />
27<br />
ARBEITSPLATZVERLUSTE<br />
BESCHÄFTIGTE NACH<br />
WIRTSCHAFTSSEKTOREN<br />
EXISTENZGRÜNDUNGEN<br />
ARBEITSLOSIGKEIT
SOZIALHILFEEMPFÄNGER<br />
SOZIALGELD<br />
NATURRAUM<br />
GEWÄSSER<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Tab. 4.7: Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Regionsvergleich (Quelle: NLS 2000-2006, Bundesagentur<br />
für Arbeit 2007, eigene Berechnungen)<br />
28<br />
Arbeitslosigkeit<br />
Langzeitarbeitslosigkeit*<br />
Raumeinheit 1995 2000 2005 2007<br />
Niedersachsen 10,9 % 10,3 % 12,2 % 8,8%<br />
Bezirk Weser-Ems 11,2 % 10,1 % 10,9 % k.A.*<br />
Wesermarsch 10,9 % 10,6 % 11,0 % 9,0 %<br />
Niedersachsen 34,4 % 38,7 % 27,5 % k.A.*<br />
Bezirk Weser-Ems 31,2 % 36,1 % 38,2 % k.A.*<br />
Wesermarsch 31,2 % 41,3 % 36,1 % 39,0 %<br />
* Anteil der Langzeitarbeitslosigkeit an der Arbeitslosigkeit insgesamt; (k.A. = keine Angaben)<br />
In diesem Zusammenhang ist auch die im Jahr 2004 erfasste Anzahl von Sozialhilfeempfängern<br />
zu sehen. Im Vergleich zum Land Niedersachsen und dem Bezirk Weser-Ems ist der Anteil von<br />
Menschen, die Hilfe zum Lebensunterhalt benötigten, als weit überdurchschnittlich anzusehen.<br />
Dabei sind es insbesondere die beiden Städte Brake (5,9 %) und Nordenham (5,7 %) aber auch<br />
die Gemeinde Berne (5,7 %), die Spitzenwerte aufweisen. Für die Wesermarsch betrug die<br />
Quote an sozialhilfebedürftigen Menschen im Jahr 2004 insgesamt 4,5 %, dies ist im Vergleich<br />
mit dem Bezirk Weser-Ems (3,6 %) und dem Land Niedersachsen (3,9 %) als überdurchschnittlich<br />
einzustufen (TRANSFERSTELLE DIALOG & REGIO INSTITUT 2005).<br />
Mit der Reformierung der Sozialgesetzgebung im Jahr 2005 werden vor allem anhand der Bezieher<br />
von existenzsichernden Leistungen (ALG II und Sozialgeld) der Umfang der sozialen<br />
Schräglage im <strong>Landkreis</strong> und die Zwänge der Haushaltsplanung deutlich: Nach Auskunft des<br />
Fachdienstes für Soziales der <strong>Landkreis</strong>verwaltung (LANDKREIS WESERMARSCH 2007a) sind<br />
aktuell circa 10 % der Bevölkerung von Leistungen aus dem Sozialhaushalt abhängig, dies<br />
entspricht absolut etwa 9.000 Personen. In der Konsequenz sind für das laufende Jahr über 50<br />
% der Haushaltsmittel allein für dieses Budget (Soziales, Jugend, Gesundheit) gebunden. Daraus<br />
ergibt sich, dass der Finanzbedarf des Sozialhaushalts alle weiteren Aufgaben im <strong>Landkreis</strong><br />
dominiert und den Handlungsspielraum entsprechend verengt.<br />
4.5 Umweltsituation Siellandschaft Wesermarsch<br />
4.5.1 Abiotische Umweltfaktoren<br />
Umwelt und Natur der Siellandschaft Wesermarsch sind stark vom Element Wasser geprägt, die<br />
hydrologischen Verhältnisse beeinflussen alle weiteren Faktoren des Naturhaushaltes in hohem<br />
Maße.<br />
Aufgrund der geologischen Verhältnisse ist der Naturraum der Siellandschaft Wesermarsch<br />
außerordentlich homogen: Er besteht zu 99 % aus der naturräumlichen Einheit der Watten und<br />
Marschen. Die Böden sind überwiegend feucht, das hoch anstehende Grundwasser ist aufgrund<br />
des Meerwassereinflusses teilweise versalzt. Das atlantische Klima bedingt geringe Jahrestemperaturschwankungen<br />
(milde Winter, mäßig warme Sommer), einen relativ hohen Feuchtegehalt<br />
der <strong>–</strong> teilweise salzhaltigen <strong>–</strong> Luft und hohe Niederschläge um 720 mm pro Jahr (LANDKREIS<br />
WESERMARSCH 1992).<br />
Ein weitverzweigtes Gewässernetz durchzieht die Siellandschaft Wesermarsch. Große Teile der<br />
Fließgewässer in der Küstenzone sind durch Ebbe und Flut der Nordsee tidebeeinflusst und<br />
weisen somit einen schwankenden Wasserstand und Salzgehalt sowie wechselnde (bidirektio-<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
nale) Fließrichtungen auf. Neben den natürlich entstandenen Fließgewässern (Weser, Jade,<br />
Hunte, Ochtum, Berne, Ollen) existiert ein künstlich angelegtes, anthropogen unterhaltenes<br />
Gewässernetz mit einer Gesamtlänge von rund 20.000 km. Dieses Sielsystem aus Grüppen,<br />
Gräben und Sieltiefs (Sielkanäle) dient der Oberflächenentwässerung, um die landwirtschaftliche<br />
Flächennutzung zu ermöglichen. Die Entwässerung des binnenländischen Oberflächenwassers<br />
in die Vorfluter Richtung Weser und Nordsee erfolgt vornehmlich in den Wintermonaten.<br />
Dagegen steht im Sommer eine Zuwässerung der Gräben mit Süßwasser aus der Weser im<br />
Vordergrund, um das Tränken des Weideviehs zu ermöglichen und um die Viehquerung zu<br />
verhindern. Stillgewässer spielen eine untergeordnete Rolle in der Siellandschaft Wesermarsch.<br />
Sie sind in geringer Anzahl und Größe vorhanden, entweder als natürlich entstandene Braken<br />
und Kuhlen oder als anthropogen entstandene Pütten (Entnahmestellen zur Kleigewinnung für<br />
den Deichbau). Wasserschutzgebiete sind aufgrund der geringen Grundwasserneubildungsrate<br />
der bindigen, undurchlässigen Marschböden in der Wesermarsch nicht vorhanden.<br />
Nach POTTGIESSER & SOMMERHÄUSER (2006) werden die Wasserzüge des Sielsystems dem<br />
Fließgewässertyp „Marschengewässer“ des Norddeutschen Tieflandes zugeordnet. Insgesamt<br />
sind Uferbewuchs und faunistischer Besatz in Abhängigkeit von Gewässergröße, Salzgehalt und<br />
Tidebeeinflussung stark heterogen. Die breiten, tiefen Sielzüge zumindest sind in ihren hydromorphologischen<br />
Merkmalen relativ einheitlich und lassen sich wie folgt charakterisieren:<br />
� schwankender Sauerstoffgehalt,<br />
� Nährstoffreichtum,<br />
� kaum Vegetationsstruktur,<br />
� hohe Strömungsgeschwindigkeiten und wechselnde Wasserstände.<br />
Die Wasserqualität der natürlichen Fließgewässer in der Siellandschaft Wesermarsch wird<br />
überwiegend mit Klasse II-III (kritisch belastet) angegeben(LANDKREIS WESERMARSCH 1992), der<br />
Belastungszustand der Sieltiefs von Gewässergüteklasse Klasse II-III (kritisch belastet) bis III<br />
(stark verschmutzt), wobei örtlich auch nur mäßig belastete Sielkanäle mit Güteklasse II vorhanden<br />
sind (GFL/BIOCONSULT/KÜFOG 2007). Andererseits existieren auch Sielgewässer der Güteklasse<br />
III-IV (sehr stark verschmutz), die die besondere Empfindlichkeit dieser Gewässer hinsichtlich<br />
der Belastung mit organischen und mineralischen Stoffen zeigen (LANDKREIS WESER-<br />
MARSCH 1992, NLWKN 2000). Der Stoffeintrag <strong>–</strong> insbesondere von Stickstoff und Phosphaten <strong>–</strong><br />
ist überwiegend auf die intensive landwirtschaftliche Grünlandnutzung in der Wesermarsch<br />
zurückzuführen.<br />
Eine weitere stoffliche Belastung der Grabengewässer ist durch die anstehende Vertiefung der<br />
Außen- und Unterweser zu erwarten, aus der sich ein flussaufwärts steigender Salzgehalt ergeben<br />
wird. Mit steigender Salinität der Grabenwässer werden sich die Lebensbedingungen für die<br />
Gewässerflora und -fauna grundlegend ändern (GFL/BIOCONSULT/KÜFOG 2007). Negative<br />
Auswirkungen auf die Lebensraumqualität für Flora und Fauna der Marschengewässer ergeben<br />
sich zudem durch das intensive Wassermanagement des Sielsystems mit seinen stark schwankenden<br />
Wasserständen.<br />
Da das Sielsystem anthropogen angelegt wurde, ist die Gewässerstruktur überwiegend naturfern.<br />
Durch gerade Linienführung, steile Ufer, Verbauung und Ausräumung der Vegetation sind<br />
nach der Klassifizierung für Gewässerstrukturklassen, die den Fließgewässerzustand in morphologisch-struktureller<br />
Hinsicht beschreibt, 52 % aller Marschgewässer stark verändert (Klasse<br />
5), sowie 45 % sehr stark bis vollständig verändert (Klassen 6-7). Naturnahe Gewässer der<br />
Strukturklassen 1 (unverändert) und 2 (gering verändert) sind nicht vorhanden (GFL/BIOCON-<br />
SULT/KÜFOG 2007).<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
29<br />
SIELGEWÄSSER<br />
GEWÄSSERGÜTE<br />
BELASTUNGSFAKTOREN<br />
GEWÄSSERSTRUKTUR
STOFFBELASTUNGEN<br />
WASSERRAHMENRICHTLINIE<br />
ÖKOSYSTEMTPYEN<br />
GRÜNLAND-GRABEN-AREALE<br />
WATT UND RÖHRICHTE<br />
GEHÖLZE<br />
SEKUNDÄRBIOTOPE<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
4.5.2 Umweltschutz<br />
Der Schutz der abiotischen Ressourcen (Boden, Wasser, Luft) wird vorwiegend durch raumordnerische<br />
Maßnahmen und Durchsetzung bundesrechtlicher Vorgaben (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz,<br />
TA Luft) sichergestellt.<br />
Aufgrund des ozeanischen Einflusses und von vorherrschenden Westwinden ist eine starke<br />
Durchmischung der Luftmassen gegeben, so dass die generelle Immissionsbelastung als gering<br />
einzustufen ist. Flächenhafte Geruchsbelastungen treten lediglich temporär durch landwirtschaftliche<br />
Düngung (Gülle) auf (LANDKREIS WESERMARSCH 2006). Stoffeinträge in Gewässer<br />
durch die landwirtschaftliche Nutzung werden im Rahmen der guten fachlichen Praxis sowie<br />
durch Einhaltung der Düngesperrfristen und -mengen geregelt.<br />
Zukünftig sollen die Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ein nachhaltiges<br />
und umweltverträgliches Wassermanagement gewährleisten. Aufgrund der natürlichen Bedingungen<br />
und der kulturellen Umformung der Siellandschaft sind die Inhalte und Vorgaben von<br />
großer Relevanz. Zielkonflikte zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und nachhaltigem und umweltgerechtem<br />
Wassermanagement sind dabei zu erwarten.<br />
4.5.3 Biotische Faktoren<br />
Der Naturraum der Siellandschaft Wesermarsch lässt sich nach Arten und Lebensgemeinschaften<br />
in sechs Ökosystemtypen einteilen: Küstenbiotope, Grünland-Graben-Areale, Still- und<br />
Fließgewässer, unkultivierte Moore, Trockenstandorte, Gehölzbestände, besiedelter Bereich<br />
(LANDKREIS WESERMARSCH 1992).<br />
Den flächenmäßig größten Anteil nehmen die anthropogen geformten Grünland-Graben-Areale<br />
ein, deren Vegetationstyp der Fettwiesen und -weiden vorwiegend der landwirtschaftlichen<br />
Grünlandnutzung mit intensiver Mähweide dient. Als größtes zusammenhängendes Grünlandareal<br />
Deutschlands bilden die weiträumigen Flächen des Feuchtgrünlandes einen außerordentlich<br />
bedeutsamen, einzigartigen Lebensraum für Wiesenvögel wie beispielsweise Kiebitz und<br />
Uferschnepfe.<br />
Eine Besonderheit mit hoher Bedeutung für Natur und Umwelt sind weiterhin die außendeichs<br />
liegenden Watt- und Salzwiesenflächen an Nordsee und Weser inklusive ihrer Schilfröhrichte.<br />
Sie sind seltene und gefährdete Biotoptypen, die einer Vielzahl von Wasservögeln, Wirbellosen<br />
und Lurchen einen Lebensraum bieten.<br />
Größere Gehölzbestände sind in der Siellandschaft kaum zu finden (Waldanteil < 1 %); lediglich<br />
auf degenerierten Mooren und auf Gehöften, zu denen Gehölzanpflanzungen gehören, existieren<br />
zusammenhängende Baumbestände (LANDKREIS WESERMARSCH 1992).<br />
Insgesamt ist die Siellandschaft Wesermarsch eine intensiv genutzte Kulturlandschaft, aus der<br />
wertvolle Sekundärbiotope für gefährdete Tier- und Pflanzenarten hervorgegangen sind. Eine<br />
Gefährdung für die Arten des Feuchtgrünlandes besteht in der Intensivierung der landwirtschaftlichen<br />
und wasserwirtschaftlichen Nutzung sowie in der räumlichen Einengung der biozönotischen<br />
Lebensräume durch menschliche Siedlungsräume und deren Infrastruktur (z.B. Verkehrswege).<br />
4.5.4 Naturschutz<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch trägt aufgrund ihrer Naturraumausstattung für Tier- und Pflanzenarten<br />
der Feuchtlebensräume eine hohe Verantwortung, wobei insbesondere die Grünland-<br />
30<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
und Wattareale für verschiedene Wiesenvogelarten und Rastvögel von internationaler Bedeutung<br />
sind.<br />
Den flächenmäßig größten Anteil nehmen Landschaftsschutzgebiete ein, darauf folgen die zum<br />
Schutzgebiet des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer gehörenden Teile der Wesermarsch,<br />
die gleichzeitig UNESCO-Biospährenreservat sind. Naturschutzgebiete liegen mit 0,7 %<br />
der <strong>Landkreis</strong>fläche weit unter dem Durchschnitt des Landes Niedersachsen mit 3,0 %. Weiterhin<br />
sind Naturdenkmale, geschützte Biotope und Landschaftsbestandteile nach § 28 a NNatG<br />
und Wallhecken geschützt, die jedoch flächenmäßig zu vernachlässigen sind. Naturparke existieren<br />
nicht.<br />
Tab. 4.8: Geschützte Natur- und Landschaftsbereiche (Quelle: LANDKREIS WESERMARSCH 2007)<br />
Schutzgebietskategorie Anzahl Flächenanteil % der <strong>Landkreis</strong>fläche<br />
Nationalpark Niedersächsisches<br />
Wattenmeer (+ Biosphärenreservat)<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
1 2.388 ha 2,9 %<br />
Naturschutzgebiete 8 582 ha 0,7 %<br />
Landschaftsschutzgebiete 8 3.650 ha 4,4 %<br />
Vertragsnaturschutz/Kompensationsfläche - 1.300 ha 1,6 %<br />
Gesamt 7920 ha 9,5 %<br />
Beträchtliche Anteile der Siellandschaft sind im Rahmen von Natura 2000 als FFH-Gebiete und<br />
EU-Vogelschutzgebiete ausgewiesen bzw. nachgemeldet worden. Teilweise überlagern sich die<br />
Gebietskulissen mit Gebieten nationaler Schutzkategorien, so dass eine Summierung statistisch<br />
nicht zulässig ist. Mit dem Stand vom 8. August 2007 sind 5018 ha Fläche (17,7 % der <strong>Landkreis</strong>fläche)<br />
als Flora-Fauna-Habitat und 14.541 Hektar (6,1 % der <strong>Landkreis</strong>fläche) als EU-<br />
Vogelschutzgebiet ausgewiesen bzw. nachgemeldet worden (LANDKREIS WESERMARSCH 2007).<br />
Eine Besonderheit stellt der Vertragsnaturschutz im Feuchtwiesenareal „Stollhammer Wisch“<br />
dar. Hier werden seit 1992 insgesamt 1.200 ha im Rahmen des vertraglich festgelegten Feuchtgrünlandschutzes<br />
von Landwirten im Sinne des Natur- und Wiesenvogelschutzes bewirtschaftet<br />
(LANDKREIS WESERMARSCH 2007).<br />
Zur Aufwertung des Naturraumes tragen weiterhin Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der<br />
Eingriffsregelung bei. Durch die Flächenagentur des <strong>Landkreis</strong>es sind bereits über 1.000 ha<br />
Fläche einer ökologischen Aufwertung zugeführt worden.<br />
Aus naturschutzfachlicher Sicht birgt die Wesermarsch ein weitaus höheres schützenswertes<br />
Naturraumpotenzial als bisher per Verordnungs- und Vertragsnaturschutz berücksichtigt ist. Laut<br />
Landschaftsrahmenplan (LANDKREIS WESERMARSCH 1992) sind zwei Drittel der <strong>Landkreis</strong>fläche<br />
würdig, mit Schutzgebietskategorien versehen zu werden.<br />
Zukünftig ergeben sich Gefährdungspotenziale für Flora und Fauna der Feuchtwiesen durch<br />
Eutrophierung der Gewässer, Lebensraumzerschneidung und Intensivierung des Sielmanagements.<br />
Negative Auswirkungen werden insbesondere beim Artbestand der Fischfauna (Bitterling,<br />
Schlammpeitziger) und beim Vorkommen seltener Pflanzenarten erwartet, wie der Krebsschere,<br />
die die einzig akzeptierte Eiablagepflanze der vom Aussterben bedrohen Libelle „Grüne<br />
Mosaikjungfer“ ist. Auch der wesermarschtypische Weißstorch ist weiterhin in seinem Bestand<br />
gefährdet.<br />
31<br />
SCHUTZGEBIETE<br />
VERTRAGSNATURSCHUTZ<br />
KOMPENSATIONS-<br />
FLÄCHEN<br />
SCHUTZWÜRDIGKEIT<br />
GEFÄHRDUNGEN
EUROPÄISCHE<br />
PLANUNGSEBENE<br />
NATIONALE<br />
RAUMORDNUNG<br />
LANDES- UND<br />
REGIONALPLANUNG<br />
REGIONALES RAUM-<br />
ORDNUNGSPROGRAMM<br />
FACHPLANUNGEN<br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
4.6 Übergeordnete Planungen<br />
Bei der Erstellung des <strong>REK</strong> wurden raumrelevante Aussagen aus unterschiedlichen transnationalen,<br />
nationalen und regionalen raum- und fachplanerischen Vorgaben berücksichtigt.<br />
Auf europäischer Ebene ist die Siellandschaft Wesermarsch in das Europäische Raumentwicklungskonzept<br />
EU<strong>REK</strong> (1999) als ein raumordnerisches Gesamtkonzept ohne Rechtsbindung<br />
eingebunden. Im Zeitraum von 2000-2006 gehörte die Wesermarsch zum Kooperationsraum der<br />
Europäischen Raumentwicklungspolitik durch Teilnahme an der EU-Gemeinschaftsinitiative<br />
INTERREG mit dem Programm für den Nordseeraum INTERREG III B.<br />
Zur Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen des Bundes unter Einbezug<br />
europäischer Planungen wurden auf Ebene der nationalen raumordnerischen Grundsätze die im<br />
Raumordnungsbericht 2005 für die Prognose der mittelfristig bis 2015/2020 absehbaren Tendenzen<br />
der Raumentwicklung berücksichtigt. Obwohl nicht planungsrelevant wurden die „Leitbilder<br />
und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ als raumordnungspolitischer<br />
Orientierungsrahmen für zukünftige planerische raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen<br />
zugrunde gelegt. Ihm liegen als Leitbilder „Wachstum und Innovation“, „Daseinsvorsorge<br />
sichern“ sowie „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten“ vor. Für die nahe Zukunft<br />
wird der Wesermarsch demnach ein hohes Funktionspotenzial zur Sicherung der landschaftlichen<br />
Attraktivität und des Naturschutzes, zur Entwicklung von Erholung und Tourismus<br />
sowie der gewerblichen Wirtschaft und der Dienstleistungen und ein hohes Potenzial zur Bereitstellung<br />
von Ressourcen für Agglomerationsräume zugeschrieben (BBR 2005).<br />
Auf Länder- und Regionsebene liegt als Vorgabe das Regionale Raumordungsprogramm<br />
(RROP) für den <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch zugrunde, das aus den Landesraumordnungsprogramm<br />
(LROP) des Landes Niedersachsen entwickelt worden ist und auf dem Stand des Jahres<br />
2003 die Grundsätze und Ziele der Raumordnung für diesen Planungsraum festlegt (vgl. LAND-<br />
KREIS WESERMARSCH 2003). Die darin beschriebenen Inhalte bilden die Grundlage für die Koordinierung<br />
aller raumbeanspruchenden und raumbeinflussenden Planungen und Maßnahmen im<br />
Kreisgebiet. Regionsübergreifend gilt seit 2006 die gemeinsame Regionalentwicklungsplanung<br />
der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten, die aus der gemeinsamen Landesplanung<br />
Bremen-Niedersachsen hervorgegangen ist.<br />
Die im RROP genannten Grundsätze der Raumordnung, die Ziele der Raumordnung zur allgemeinen<br />
Entwicklung des Landes sowie diejenigen zur Entwicklung der räumlichen Struktur (vgl.<br />
LANDKREIS WESERMARSCH 2003) bilden die Basis für die im vorliegenden Regionalen Entwicklungskonzept<br />
entworfene Entwicklungsstrategie (vgl. Kap. 6). Entwicklungsziele und Maßnahmen<br />
gehen mit den Festlegungen im RROP konform. Als regionale Entwicklungsziele und endogenen<br />
Entwicklungspotenziale des ländlichen Raumes nennt das RROP u.a.:<br />
� die leistungsstarke Landwirtschaft mit Grünlandnutzung,<br />
� die hohe Umweltqualität sowie<br />
� Weser-, Küsten- und Marschenlandschaft als Erholungsraum.<br />
Die festgeschriebenen Vorranggebiete und Vorsorgegebiete für die Bereiche Erholung, Natur<br />
und Landschaft, Landwirtschaft, Grünlandbewirtschaftung und Freiraumfunktion stellen die Planungsgrundlage<br />
für die Umsetzung der geplanten Projekte (vgl. Kap. 6.2) im Raum dar.<br />
32<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
Relevante raumbedeutsame Fachplanungen und Leitbildvorgaben liegen aus dem Bereich Küste<br />
und Fischerei vor. Dies sind:<br />
� das Raumordnungskonzept für das niedersächsische Küstenmeer (ROKK) des Niedersächsischen<br />
Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz von 2005,<br />
� das Integrierte Küstenzonenmanagement IKZM von 2006 als Raumordnungsstrategie im<br />
Küstenbereich,<br />
� der Nationale Strategieplan Fischerei der Bundesregierung von 2006 sowie<br />
� die im Rahmen des Europäischen Fischereifonds entworfene, in Vorbereitung befindliche<br />
Strategie für eine integrierte örtliche Entwicklung des Fischwirtschaftsgebietes Niedersächsische<br />
Nordseeküste (COFAD 2006).<br />
4.7 Evaluierungsergebnisse<br />
4.7.1 LEADER+ Evaluierung<br />
Für die Erstellung des Regionalen Entwicklungskonzeptes <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong> und<br />
seine Weiterentwicklung sind die Erfahrungen, Wirkungen und Ergebnisse aus dem vorangegangenen<br />
LEADER+ Zeitraum von 2000-2006 von großer Bedeutung. Hier waren dem Oberthema<br />
„Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes“ insgesamt sechs gleichrangige Themenfelder<br />
zugeordnet: Bildung, Kultur, Jugend, Natur, Regionale Produkte und Tourismus. Die zentralen<br />
Ergebnisse der extern durch das Büro KoRiS und intern durch das Regionalmanagement „Wesermarsch<br />
in Bewegung“ vorgenommenen Evaluierung sowie ihre Auswirkungen auf die Fortschreibung<br />
des Regionalen Entwicklungskonzeptes ab 2007 werden im Folgenden aufgeführt.<br />
Der ausführliche Evaluierungsbericht ist dem Anhang zu entnehmen.<br />
Eine flexible Kofinanzierung wurde durch die Einrichtung des Finanztopfes „Wesermarsch in<br />
Bewegung“ ermöglicht, den alle neun Kommunen und der <strong>Landkreis</strong> mit je 125.000 € zu gleichen<br />
Teilen füllten. Durch diesen Finanzgrundstock konnten insbesondere interkommunale<br />
Projekte sowie querschnittsorientierte Projekte gegenfinanziert werden, so dass keine bürokratischen<br />
Hürden die Umsetzung von Projekten verzögerten. Insgesamt wurde für die Finanzierung<br />
von LEADER+ Projekten ein hoher Anteil von Drittmitteln (Landesmittel, Stiftungsmittel) in Höhe<br />
von rund 600.000 € eingeworben.<br />
Insgesamt 70 % der Finanzmittel wurden in Kulturprojekte investiert. Grund war unter anderem<br />
das außergewöhnliche Engagement der Kulturakteure bei der Ideenfindung und Umsetzung von<br />
Projekten. Durch die LEADER+ Projekte als Katalysator haben sich <strong>–</strong> über die Förderperiode<br />
hinaus <strong>–</strong> drei Vereine und zwei Arbeitsgruppen im Bereich Kultur gebildet, die durch ihre intensive<br />
Arbeit zur überregionalen positiven Wahrnehmung der Wesermarsch im Kultursektor beigetragen<br />
haben.<br />
Insbesondere Projekte zur Verknüpfung von wertvollen Naturräumen mit touristischen oder<br />
umweltpädagogischen Themen wurden erfolgreich umgesetzt. Insgesamt waren Naturprojekte<br />
gegenüber dem im Oberthema gleichrangig genannten Bereich Kultur jedoch unterrepräsentiert.<br />
Die potenziell mögliche Inwertsetzung des Naturerbes wurde in LEADER+ nicht annähernd<br />
ausgeschöpft.<br />
Obwohl nur 3 % der LEADER+ Mittel in die Förderung regionaler Produkte geflossen sind, konnte<br />
mit dem Projekt „Melkhus“ ein überregional bedeutsames Vorzeigeprojekt realisiert werden.<br />
Das Projekt, das der Vernetzung zwischen Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte der Milchwirtschaft<br />
und dem Tourismus dient, wurde von der Deutschen Vernetzungsstelle LEADER+ in<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
33<br />
FINANZIERUNG<br />
THEMFELD KULTUR<br />
THEMFELD NATUR<br />
THEMFELD<br />
REGIONALE PRODUKTE
THEMENFELD TOURISMUS<br />
THEMENFELD BILDUNG<br />
THEMENFELD JUGEND<br />
WERTSCHÖPFUNG<br />
KOOPERATION<br />
PARTIZIPATION<br />
INITIIERUNG VON ORGA-<br />
NISATIONEN<br />
WEITERENTWICKLUNG<br />
DES <strong>REK</strong><br />
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
die Auswahl der 100 besten LEADER+ Projekte in Deutschland aufgenommen (vgl. DVS 2006).<br />
Über das Ende der Förderperiode hinaus finden die Melkhüs großen Anklang bei Einheimischen<br />
und Radtouristen und werden in mehreren anderen Regionen nachgeahmt.<br />
Mit 26 % aller Mittel gelangte das zweitgrößte Finanzteilvolumen in die Umsetzung von Tourismusprojekten.<br />
Hervorzuheben ist, dass es sich dabei um viele punktuell realisierte Projekte mit<br />
einem geringen Finanzvolumen handelt, die zur Vernetzung zwischen den Themenfeldern Tourismus,<br />
Kultur und Natur beitrugen. Da optimale strukturelle und organisatorische Grundvoraussetzungen<br />
in der Tourismuswirtschaft der Wesermarsch nicht gegeben sind, musste auf die<br />
Umsetzung von Großprojekten verzichtet werden.<br />
Obwohl eine Förderung durch LEADER+ nicht möglich war, wurden zwei Projekte im Themenfeld<br />
Bildung realisiert. Wie die Evaluierung gezeigt hat, wird von regionalen Akteuren den Themen<br />
Bildung und Qualifizierung ein hoher Stellenwert zugemessen.<br />
Innerhalb eines finanzstarken Leitprojektes für die gesamte Wesermarsch konnte ein Grundstein<br />
für die Stärkung der regionalen Identität von Jugendlichen mit ihrem Lebensumfeld gegeben<br />
werden.<br />
Die bisherigen Möglichkeiten zur regionalen Wertschöpfung in allen Themenfeldern wurden von<br />
den Mitgliedern der LAG als unzureichend angesehen.<br />
Unabhängig vom Realisierungsgrad der Projektideen oder von der Erfolgsquote eines Projektes<br />
wurde als ein maßgeblich positiver Effekt gesehen, dass die Zusammenarbeit zwischen kommunalen<br />
Partnern sowie zwischen öffentlichen und privaten Akteuren initiiert, gefördert und<br />
verbessert wurde, beispielsweise durch den Austausch von Fach- und Methodenwissen, durch<br />
die Übernahme organisatorischer Aufgaben von einer Kommune für alle Kommunen des Kreises<br />
sowie durch Gründung von Vereinen und informellen Arbeitsbündnissen. Dadurch leistete<br />
LEADER+ einen hohen Beitrag zur Stärkung des Wir-Gefühls und zur Identifikation mit der Region.<br />
Nachteilig bewertet wurde dagegen die relativ geringe Beteiligung von Akteuren bei der<br />
konkreten und arbeitsintensiven Umsetzung von Projekten.<br />
Die Arbeit des Regionalmanagements wurde in der Evaluation aufgrund der Dienstleistungsorientierung<br />
und der umfassenden organisatorischen und fachlichen Begleitung der Akteure sowie<br />
der aktiven Netzwerkbildung als sehr positiv bewertet. Kritisiert wurden dagegen mangelnde<br />
Partizipationsmöglichkeiten bei der inhaltlichen Bewertung von Projekten.<br />
Durch LEADER+ haben sich im Zeitraum von 2003-2006 insgesamt neun thematisch orientierte<br />
Interessensgemeinschaften gebildet, darunter sechs eingetragene Vereine und drei informelle<br />
Arbeitsgruppen.<br />
Die Ergebnisse der Evaluierung haben folgende Konsequenzen auf die Bestrebungen zur nachhaltigen<br />
Entwicklung der Region ab 2007:<br />
� Aufgrund der breiten Zustimmung durch eine Vielzahl regionaler Akteure und den bisherigen<br />
Projekterfolgen werden Bestrebungen und Aktivitäten zur Förderung einer nachhaltigen<br />
Regionalentwicklung beibehalten. Das Regionale Entwicklungskonzept wird unter Berücksichtigung<br />
der erlangten Erfahrungen aus LEADER+ fortgeschrieben. Die Region bemüht<br />
sich um eine Aufnahme in das Leader-Förderprogramm von 2007 bis 2013.<br />
� Erfolgreiche Bausteine wie der Finanztopf, das Regionalmanagement und die Themenfelder<br />
Kultur, Natur, Regionale Produkte und Tourismus werden als Handlungsfelder aufrechterhalten.<br />
Die Felder Bildung und Jugend sollen als Querschnittsthemen übernommen werden.<br />
� Zur Herstellung der Finanzgerechtigkeit zwischen den förderwürdigen Bereichen Natur und<br />
Kultur werden Projekte im Handlungsfeld Natur zunächst in besonderem Maße berücksich-<br />
34<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 4 � AUSGANGSLAGE UND BESTANDSAUFNAHME<br />
tigt, und finanzintensive Kulturprojekte werden gegenüber anderen Handlungsfeldern zurückgestellt.<br />
� Die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung regionaltypischer Produkte bietet ein großes<br />
Potenzial zur ideellen und monetären Inwertsetzung regionaler Erzeugnisse. Die Bezeichnung<br />
des Handlungsfeldes wird unter „Regionale Produktion“ auf die Produktionsbedingungen<br />
zur Erzeugung und Verarbeitung regionaler Produkte ausgeweitet. Zur Verbesserung<br />
der Produktionsbedingungen gehört explizit der landwirtschaftliche Wegebau.<br />
� Als neues Themenfeld der sozialen Dimension, das insbesondere gesellschaftliche und<br />
kommunikative Belange berücksichtigt, wird das Handlungsfeld „Dorfleben“ eingeführt.<br />
� Die regionale Wertschöpfung, der Aufbau von Wertschöpfungsketten und -partnerschaften<br />
soll eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Regionalentwicklung spielen.<br />
� Die Partizipation der regionalen Akteure wird durch stärkere Einbindung der LAG-Mitglieder<br />
bei der Projektbewertung sowie durch vermehrte Bottom-up-Verfahren erweitert.<br />
� Die zuvor paritätische Zusammensetzung der LAG mit 10 WiSo-Partnern und 10 Kommunalen<br />
Partnern wird zur kontinuierlichen Sicherstellung der Beschlussfähigkeit derart geändert,<br />
dass sich der Anteil der WiSo-Partner auf 15 erhöht.<br />
4.7.2 Evaluierung Regionen Aktiv<br />
Der <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch hat sich an der Bundesinitiative „Regionen aktiv <strong>–</strong> Land gestaltet<br />
Zukunft“ von 2002 bis 2007 beteiligt. Die Wesermarsch war Bestandteil der Modellregion „Weserland“,<br />
in der sie mit den Städten Bremen, Delmenhorst sowie den <strong>Landkreis</strong>en Osterholz und<br />
Verden eine Stadt-Land-Kooperation einging, die eine verbraucherorientierte natur- und umweltschonende<br />
regionale Landwirtschaft fördern und das Verbrauchervertrauen stärken sollte.<br />
Durch Projekte zum Angebot von nachhaltigen touristischen Dienstleistungen und zur Vermarktung<br />
regionaler, landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte sowie einem umweltpädagogischen Angebot<br />
zum interaktiven, außerschulischen Lernen brachte sich die Wesermarsch in die Kooperation<br />
ein.<br />
Die das Programm „Regionen aktiv“ begleitende Evaluierung der ersten Phase bis 2005 auf<br />
Bundesebene hat ergeben, dass die integrierten Förderansätze von Region aktiv eine effiziente<br />
Ergänzung zur konventionellen Förderung im ländlichen Raum sind. Zu den positiven Effekten<br />
gehören insbesondere geschaffene Synergien und Netzwerkbeziehungen zwischen Erzeugern,<br />
Verarbeitern und Vermarktern entlang der regionalen Wertschöpfungskette sowie Ansätze im<br />
Bereich von Marketingkonzeptionen und Logistikkonzepten.<br />
Im Rahmen von Leader 2007-2013 ergeben sich Wirkungen für die Wesermarsch durch Region<br />
aktiv speziell für den Verein proRegion e.V. (vgl. Kap. 4.3.2) zur Markterschließung für regionale<br />
Produkte, in erster Linie für die Vermarktung der schon in der Region etablierten Produkte von<br />
Lamm und Ochse.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
35<br />
MODELLREGION WESER-<br />
LAND<br />
PROJEKTE<br />
SYNERGIEN<br />
MARKTERSCHLIESSUNG
DATENBASIS<br />
WERTVOLLER<br />
NATURRAUM<br />
REICHES KULTURELLES<br />
UND MARITIMES ERBE<br />
LANDWIRTSCHAFT UND<br />
LANDTOURISMUS<br />
� 5 � SWOT-ANALYSE<br />
5<br />
36<br />
SWOT-ANALYSE<br />
5.1 Zentrale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken<br />
Die SWOT 2 -Analyse dient als Basis für die Herausarbeitung des Handlungsbedarfes zur Erreichung<br />
einer nachhaltigen Regionalentwicklung. Grundlage für die im Folgenden aufgeführten<br />
zentralen Stärken und Schwächen sind die in der Ausgangslage beschriebenen Fakten, die<br />
Ergebnisse der vom Institut für Umweltwissenschaften der Universität Vechta vorgelegten wissenschaftlichen<br />
Studie „Imageanalyse <strong>Wesermarsch“</strong> (2006) sowie quantitativ gewichtige Beiträge<br />
regionaler Akteure im Prozess der Erstellung des <strong>REK</strong> (insbesondere im Strategieworkshop,<br />
in Kommunalen Workshops und auf der Zukunftskonferenz). Die Chancen und Risiken<br />
wurden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zukunftsentwicklung aus den Stärken und<br />
Schwächen der Siellandschaft Wesermarsch abgeleitet. Die tabellarische Übersicht der Stärken,<br />
Schwächen, Chancen und Risiken befindet sich im Anhang.<br />
Zentrale Stärken der Siellandschaft Wesermarsch<br />
Der insgesamt homogene Naturraum der Wesermarsch mit den weltweit seltenen Ökotopen des<br />
Wattenmeeres und Buchtenwattes, mit den Fließgewässern Weser, Hunte und Jade sowie den<br />
Marschenweiden inklusive des Sielsystems birgt ein hohes ökologisches Potenzial. Der von<br />
Gewässern geprägte Naturraum bietet insbesondere Wiesenvögeln sowie weiteren seltenen<br />
und geschützten Tier- und Pflanzensippen der Feuchtlebensräume einen wichtigen Lebens- und<br />
Rückzugsraum. Naturschutzmaßnahmen werden soweit als möglich in Kooperation mit der<br />
Landwirtschaft durchgeführt und erreichen dadurch eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz.<br />
Das einzigartige Kulturerbe der Siellandschaft Wesermarsch findet sichtbaren Ausdruck in den<br />
Bauwerken des Sielsystems, den ortsbildprägenden Profanbauten und Kirchen, den landwirtschaftlichen<br />
Gehöften und reetgedeckten Häusern sowie in den intakten Siedlungsstrukturen<br />
aus Wurtendörfern, Marschhufensiedlungen und Sielhäfen. Das maritime Erbe mit Traditionsschiffen,<br />
Fischerbooten, Werften und Häfen an Weser, Hunte und Nordsee ist ein weiteres bewahrenswertes<br />
Charakteristikum der Küstenregion. Attraktive kulturelle Einrichtungen und qualitativ<br />
hochwertige Kulturveranstaltungen mit Regionsbezug sind vorhanden. Ein reges Vereinsleben,<br />
bürgerschaftliches Engagement und die Zusammenarbeit der Menschen in der Siellandschaft<br />
Wesermarsch tragen maßgeblich zur engagierten Umsetzung von Projekten und damit<br />
zur nachhaltigen Entwicklung der Region bei.<br />
Die Landwirtschaft als primärer Wirtschaftssektor prägt durch Rinder- und Schafhaltung die<br />
Kulturlandschaft der Wesermarsch als die größte zusammenhängende Grünlandregion<br />
Deutschlands. Die Krabbenkutterfischerei ist rentabel und gleichzeitig attraktiv für den maritimen<br />
Tourismus. Die regional erzeugten Produkte und Lebensmittel aus Land- und Fischereiwirtschaft<br />
sind kulinarischer Ausdruck der Natur- und Kulturlandschaft. Die Tourismuswirtschaft wartet mit<br />
einer Vielzahl qualitativ hochwertiger touristischer Einrichtungen, authentischen Freizeitangeboten<br />
und einer guten Routenstruktur im Fahrradtourismus auf.<br />
2 Abkürzung für englisch: Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
Zentrale Schwächen der Siellandschaft Wesermarsch<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 5 � SWOT-ANALYSE<br />
Der Naturraum ist für Besucher nicht in ausreichendem Maße zugänglich, es mangelt an naturverträglichen<br />
Beobachtungs- und Erlebnismöglichkeiten sowie an qualifizierten Naturführern, die<br />
die Besonderheiten der regionalen Natur anschaulich vermitteln können. Charakteristische,<br />
landschaftsgeschichtlich bedeutsame Landschaftselemente sind lediglich rudimentär vorhanden.<br />
Ökologische Qualität und Gewässerstruktur von Sielzügen und Gräben des Be- und Entwässerungssystems<br />
befinden sich in einem suboptimalen Zustand.<br />
Im öffentlichen Raum sind technische und soziale Infrastrukturen aufgrund des demografischen<br />
Wandels unvollständig ausgeprägt, die Grundversorgung der Bevölkerung ist in Teilen des ländlichen<br />
Raumes nicht mehr sichergestellt, die Bevölkerungszahlen sind rückläufig. Die Lebensqualität<br />
in den Dörfern und die Identifikation der Menschen mit ihrem Dorfleben und Lebensumfeld<br />
sinken zunehmend, insbesondere für Jugendliche fehlen Freizeiteinrichtungen und attraktive<br />
Freizeitangebote.<br />
Aufgrund des Strukturwandels im primären und sekundären Wirtschaftssektor existiert in der<br />
Siellandschaft Wesermarsch eine verfestigte Arbeitslosenquote. Die Finanzsituation der kommunalen<br />
Haushalte ist demzufolge durch geringe Einnahmen und hohe Schuldenlast angespannt.<br />
Die Landwirtschaft leidet unter erschwerten Rahmenbedingungen in der Produktion und<br />
unter Betriebsaufgaben, die Fischereiwirtschaft unter Fangeinbrüchen bei einigen Fischarten.<br />
Der Dienstleistungssektor ist unterentwickelt, die Tourismuswirtschaft wird mit einem beträchtlichen<br />
Anpassungsdruck und hohen Qualitätsansprüchen konfrontiert.<br />
Zentrale Chancen der Siellandschaft Wesermarsch<br />
Ökologische, naturschutzrechtliche und landschaftspflegerische Maßnahmen sind eine Chance,<br />
um den weiteren Erhalt des Natur- und Kulturraumes langfristig sicherzustellen. Damit wird der<br />
faunistische und floristische Artbestand gesichert, ebenso die Erholungsfunktion von Natur und<br />
Landschaft für Touristen und Einheimische. Insbesondere international bedeutsame Schutzgebiete<br />
im Wattenmeer und in den Grünlandregionen können dauerhaft erhalten werden, dies<br />
kann in hohem Maße durch die Schaffung von Synergien und Kooperationen zwischen Naturschutz,<br />
Landwirtschaft und ländlichem Tourismus gelingen. Durch eine intensive Öffentlichkeits-<br />
und Umweltbildungsarbeit kann die gesellschaftliche Akzeptanz von Naturschutzprojekten weiter<br />
erhöht werden.<br />
Durch den Erhalt regionaltypischer Gebäude und durch neue, innovative Formen ihrer Nutzung<br />
kann sich die Siellandschaft Wesermarsch zu einem bevorzugten Wohn- und Arbeitsstandort<br />
entwickeln, insbesondere im Kontext mit dem Landtourismus und der Diversifizierung von Handel<br />
und Gewerbe. Landschafts- und ortsbildprägende Gebäude erhöhen zudem die Authentizität<br />
der Region und bedienen den Nachfragetrend im Tourismus. Starkes bürgerschaftliches Engagement<br />
und regionalkulturelle Veranstaltungen in den Dörfern fördern die regionale Identität und<br />
sorgen für eine stärkere endogene Generierung von Ideen und Umsetzungsaktivitäten für die<br />
dörfliche Entwicklung. Unter Berücksichtigung einer verbesserten Mobilität und von besserer<br />
dörflicher Infrastruktur bietet sich die Chance, Lebendigkeit und Lebensqualität in ländlichen und<br />
dörflichen Bereichen der Siellandschaft Wesermarsch zu erhöhen.<br />
Entwicklung und Ausbau von nachhaltigen, authentischen Freizeit- und Erholungsangeboten,<br />
die sich an den Gegebenheiten der Natur- und Kulturlandschaft orientieren, sowie die Verbesserung<br />
touristischer Qualitätsstandards bieten der Siellandschaft Wesermarsch eine Chance, auf<br />
Grundlage des Natur- und Kulturerbes die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region zu erhöhen<br />
und gleichzeitig langfristig auf dem touristischen Markt zu bestehen. Die Fischereiwirtschaft<br />
und Diversifizierungsmöglichkeiten im landwirtschaftlichen Sektor können zukünftig ein<br />
37<br />
ERLEBNISWERT UND<br />
ÖKOLOGISCHE QUALITÄT<br />
SINKENDE<br />
LEBENSQUALITÄT<br />
WIRTSCHAFTLICHER<br />
STRUKTURWANDEL<br />
ERHALT DES NATUR- UND<br />
KULTURRAUMS<br />
ATTRAKTIVES DORFLEBEN<br />
REGIONALE<br />
WERTSCHÖPFUNG
LANDBEWIRTSCHAFTUNG<br />
ABNAHME DER<br />
LEBENSQUALITÄT<br />
STRUKTURELLER WANDEL<br />
HANDLUNGEN IM<br />
ÖKOLOGISCHEN BEREICH<br />
� 5 � SWOT-ANALYSE<br />
Bindeglied zwischen Landwirtschaft und Tourismuswirtschaft darstellen und dazu beitragen, die<br />
Landwirtschaft mit ihren regionalen Produkten als Wirtschaftsfaktor zu erhalten und somit gleichzeitig<br />
die Pflege der Kulturlandschaft sicherzustellen.<br />
Zentrale Risiken der Siellandschaft Wesermarsch:<br />
Stoffeinträge aus landwirtschaftlicher Nutzung sowie ein intensives Wassermanagement können<br />
zu einem Rückgang typischer Arten des Feuchtgrünlandes führen und damit den Verlust an<br />
landschaftlicher Attraktivität bedeuten. Konflikte zwischen Landwirten, Wasser- und Bodenverbänden<br />
sowie Naturschützern drohen, die Zusammenarbeit zwischen Akteuren und damit die<br />
nachhaltige Entwicklung der Region zu behindern. Nachteilige Veränderungen des Landschaftsbildes<br />
durch fehlende Landbewirtschaftung oder durch Zerschneidung der Landschaft<br />
können zum Verlust der bislang ausgeprägten landschaftlichen Attraktivität führen. Der zu erwartende<br />
Klimawandel wird in der küstennahen, tiefliegenden Marschenregion besonders gravierende,<br />
in naher Zukunft einsetzende Auswirkungen verursachen, die sich besonders intensiv<br />
in den Bereichen Landwirtschaft und Tourismus zeigen werden<br />
Den noch zahlreich vorhandenen landschafts- und ortsbildprägenden Gebäuden droht aufgrund<br />
fehlender Nutzung und aufgrund hoher Renovierungskosten beim Einsatz regionaltypischer<br />
Baumaterialien der Verfall. Dies zieht den schleichenden Verlust der Baukultur, Beeinträchtigungen<br />
des Orts- und Landschaftsbildes und ein gemindertes Regionalbewusstsein nach sich.<br />
Zusammen mit der Gefahr des weiteren Abbaus öffentlicher Infrastruktur, der Abwanderung<br />
insbesondere junger, aktiver Menschen ist eine immense Senkung der dörflichen Lebensqualität<br />
zu befürchten.<br />
Aus wirtschaftlichem Blickwinkel muss mit einem weiteren Arbeitsplatzabbau vor allem im industriellen<br />
und im produzierenden Sektor gerechnet werden, der eine verstärkte Abwanderung von<br />
qualifizierten Fachkräften nach sich ziehen wird. In der Landwirtschaft sind weitere Betriebsaufgaben,<br />
erschwerte Produktionsbedingungen (z.B. unzureichende Wirtschaftswege) sowie Konflikte<br />
mit dem ländlichen Tourismus in Bezug auf die Nutzung landwirtschaftlicher Wege zu erwarten.<br />
5.2 Handlungsbedarf<br />
Um die Stärken der Region und darauf basierende Entwicklungschancen zu nutzen, und um<br />
Schwächen auszuloten und die darauf aufbauenden Entwicklungsrisiken abzumildern, wird ein<br />
spezifischer Handlungsbedarf für die Regionalentwicklung der Siellandschaft Wesermarsch<br />
abgeleitet. Nach den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 21 wird der Handlungsbedarf im Folgenden<br />
in die Bereiche Ökologie, Soziales und Ökonomie untergliedert.<br />
Ökologischer Handlungsbedarf<br />
� Erhalt des Naturraumes mit seinen überregional besonders bedeutsamen Ökotopen durch<br />
Bewahrung der naturräumlichen Gegebenheiten sowie durch freiwillige Maßnahmen zum<br />
Schutz von Natur und Landschaft.<br />
� Verbesserung des ökologischen und strukturellen Zustandes von Natur, Landschaft und<br />
Landschaftsbild durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie insbesondere durch die<br />
intensive Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.<br />
38<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 5 � SWOT-ANALYSE<br />
� Förderung von Kooperationen zwischen Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz<br />
zur Entwicklung von innovativen, kreativen und konstruktiven und zudem nachhaltigen Bewirtschaftungsvarianten<br />
des Sielsystems sowie aktive Einbindung aller relevanten Akteure in<br />
die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutze von Natur und Landschaft.<br />
� Sensibilisierung, Bewusstseins- und Umweltbildung von Einheimischen und Gästen <strong>–</strong> speziell<br />
auch im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels <strong>–</strong> durch Informationskampagnen,<br />
Workshops und vielfältige Naturerlebnismöglichkeiten sowie Qualifizierung von regionalen<br />
Akteuren zur Wissens- und Informationsvermittlung über die ökologischen Gegebenheiten<br />
der Siellandschaft Wesermarsch.<br />
� Akzeptanzsteigerung für Naturschutzmaßnahmen durch gezielte Kommunikation von Inhalten,<br />
Zielsetzungen und Notwendigkeiten mittels moderner Didaktik sowie Schaffung von<br />
Schnittstellen zu touristischen Angeboten.<br />
Sozialer Handlungsbedarf<br />
� Erhalt, Ausbau und Förderung der öffentlichen technischen Infrastruktur unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Attraktivitätssteigerung von Orten.<br />
� Attraktivierung dörflicher sozialer Infrastrukturen durch Förderung dörflicher Identität, Aufarbeitung<br />
der Dorfgeschichte, Bewahrung der Baukultur unter intensiver Einbindung der örtlichen<br />
Bevölkerung zum Erhalt lebendiger dörflicher Strukturen.<br />
� Förderung eines lebendigen Dorflebens durch Unterstützung aktiver Dorfgemeinschaften<br />
und Bürgervereine.<br />
� Erhalt des kulturgeschichtlich wertvollen Sielsystems und der dazugehörigen Siedlungsstrukturen<br />
sowie Aufwertung von Sielbauwerken zur touristischen Nutzung und zur Verhinderung<br />
von baulichem Leerstand.<br />
Ökonomischer Handlungsbedarf<br />
� Erhöhung der Wertschöpfung regionaler Produkte und Dienstleistungen sowie Erschließung<br />
zusätzlicher Einkommensquellen für landwirtschaftliche Betriebe.<br />
� Vernetzung zwischen den Handlungsfeldern Regionale Produktion, Kultur und Tourismus zur<br />
Ausweitung der regionalen Wertschöpfungskette und zum Ausbau von regionalen Produkten<br />
zum sinnlichen Merkmal der Region.<br />
� Entwicklung, Förderung und Ausbau von touristischen Infrastruktureinrichtungen und Angeboten<br />
sowie Aufbau von Netzwerken und Qualitätszirkeln zur Verbesserung von Qualität,<br />
Service und Leistungen in Beherbergungsbetrieben und Gastronomie.<br />
� Qualifizierungen und Netzwerkbildung in Form von Workshops, Exkursionen und gebietsübergreifenden<br />
Kooperationen zur Qualitätsverbesserung von regionalen Produkten und<br />
Dienstleistungen, zur Erhöhung des Produktabsatzes und zur organisatorischen Weiterentwicklung<br />
von regionalen Partnerschaften sowie zur Optimierung von Produktvermarktung<br />
und -vertrieb und unternehmerischen Fähigkeiten.<br />
� Schaffung neuer Arbeitsplätze und Förderung von Beschäftigungseffekten durch Diversifizierung<br />
sowie Unterstützung des Tourismussektors unter besonderer Berücksichtigung des<br />
Aufbaus einer professionellen, umfassenden und überregional wirkenden Marketingstrategie.<br />
39<br />
HANDLUNGEN IM<br />
SOZIALEN BEREICH<br />
HANDLUNGEN IM ÖKO-<br />
NOMISCHEN BEREICH
EXTERNE PARAMETER<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
6<br />
40<br />
ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
6.1. Leitbild und Entwicklungsziele<br />
6.1.1 Rahmenbedingungen<br />
Die Entwicklungsstrategie ist das zentrale Instrumentarium, mit dem die nachhaltige Regionalentwicklung<br />
für die Siellandschaft Wesermarsch gelingen soll. Das hierin dargestellte Leitbild<br />
und die Entwicklungsziele sind langfristig erwünschte Ziele, die durch den Anstoß kurz- bis mittelfristig<br />
umzusetzender Maßnahmen erreicht werden sollen. Die vorliegende Entwicklungsstrategie<br />
wurde entwickelt aus den ermittelten Entwicklungschancen und -risiken, die auf den Stärken<br />
und Schwächen der Region basieren. Neben planungshierarchisch übergeordneten Strategien<br />
und parallelen sektoralen Entwicklungszielen, die im Folgenden aufgeführt werden, berücksichtigt<br />
sie in besonderem Maße die aus der Partizipation regionaler Akteure hervorgegangenen<br />
und in der Entwicklungsphase (vgl. Kap. 3.2) geäußerten Ansprüche.<br />
Als wesentliche Rahmenbedingungen der Entwicklungsstrategie für die Siellandschaft Wesermarsch<br />
liegen internationale und nationale Strategien, Konventionen, Programme und Planungen<br />
zugrunde, deren Inhalte und Zielsetzungen bei der Ausarbeitung der regionalen Entwicklungsstrategie<br />
Beachtung finden. Neben den in Kapitel 4.6 aufgeführten raumplanerischen und<br />
raumordnenden Vorgaben gehören weiterhin dazu:<br />
� die auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro<br />
1992 beschlossene Agenda 21,<br />
� die nationale Nachhaltigkeitsstrategie „Perspektiven für Deutschland“ der Bundesrepublik<br />
Deutschland aus dem Jahr 2002,<br />
� die Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland von der<br />
Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) von 2006 als gemeinsame Strategie für die<br />
Raumordnungs- und Raumentwicklungspolitik von Bund und Ländern,<br />
� die strategischen Leitlinien der Europäischen Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen<br />
Raums (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 2006),<br />
� der Nationale Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher<br />
Räume (BMELF 2006),<br />
� das Konzept „Region Unterweser <strong>–</strong> Förderung des maritimen Tourismus an der Unterweser“,<br />
das die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH im Jahr 2002 als Leitlinie und<br />
Handlungsrahmen für zur Entwicklung und Förderung des maritimen Tourismus und der<br />
Traditionsschifffahrt an der Unterweser (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG WESERMARSCH GMBH<br />
2002),<br />
� der Strategieplan für eine nachhaltige Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete an der Niedersächsischen<br />
Nordseeküste gemäß der Prioritätsachse 4 des Europäischen Fischereifonds<br />
EFF (COFAD GMBH 2007).<br />
Bei der zukünftigen Umsetzung der Projekte soll ebenfalls das in Vorbereitung befindliche touristische<br />
Zukunftskonzept „Masterplan Tourismus“ (IFT 2008) berücksichtigt werden.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
In die Entwicklungsstrategie für die Siellandschaft Wesermarsch fließt zudem folgendes regionsspezifisches<br />
Wissen ein:<br />
� Ergebnisse des Konzeptes zur Entwicklung der Baukultur in der Wesermarsch (LOGEMANN<br />
2005),<br />
� Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Studie „Imageanalyse <strong>Wesermarsch“</strong> des Institutes<br />
für Umweltwissenschaften der Universität Vechta aus dem Jahr 2006,<br />
� Resultate aus LEADER+Projekten, die in der Wesermarsch von 2003 bis 2006 umgesetzt<br />
wurden,<br />
� Evaluierung der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ und des LEADER+ Programmes in der<br />
Wesermarsch,<br />
� Ergebnisse des Strategieworkshops, der Kommunalen Workshops und der Zukunftskonferenz<br />
als Konzentrat regionaler Kenntnisse und regionsspezifischen Wissens.<br />
Durch einen intensiven Informationsaustausch von Regionalmanagement und LAG mit einer<br />
Vielzahl regionaler Akteure (vgl. Kap. 3.3) sowie durch die LEADER+ Evaluierung (vgl. Kap. 4.7)<br />
konnte Gewissheit erlangt werden, dass die in LEADER+ begonnene Umsetzung zur Erreichung<br />
einer nachhaltigen Regionalentwicklung Zustimmung auf breiter Basis findet <strong>–</strong> sowohl in der<br />
Bevölkerung als auch auf politischer Ebene. Die in LEADER+ umgesetzten Maßnahmen zur<br />
Zielerreichung stoßen auf starkes Interesse und große Akzeptanz. Menschen möchten sich<br />
weiterhin intensiv in den Prozess der Regionalentwicklung einbringen wie die Beteiligung und<br />
das Engagement von mehreren hundert regionalen Akteuren bei der Erarbeitung des vorliegenden<br />
<strong>REK</strong>s bewiesen haben. Aus diesen Gründen wird der mit LEADER+ eingeschlagene Weg<br />
zu einer nachhaltigen Entwicklung der Region in seinen wesentlichen Grundzügen beibehalten<br />
und fortgesetzt.<br />
Die oben aufgeführten externen und regionalinternen Einflussgrößen haben zu einer Anpassung<br />
und Weiterentwicklung der Entwicklungsstrategie gegenüber derjenigen geführt, die im Regionalen<br />
Entwicklungskonzept „Land am Wasser <strong>–</strong> Wesermarsch in Bewegung“ im Jahr 2001 entworfen<br />
worden war. Nach externen und internen Evaluierungsschritten und einem intensiven Abstimmungsprozess<br />
mit einer Vielzahl von regionalen Akteuren wurde das Regionale Entwicklungskonzept<br />
<strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong> von der Lokalen Aktionsgruppe „Wesermarsch in<br />
Bewegung“ auf ihrer 29. Sitzung am 11. September 2007 unter Zusage ihrer inhaltlichen und<br />
organisatorischen Unterstützung einstimmig beschlossen.<br />
Mit der im vorliegenden Regionalen Entwicklungskonzept erarbeiteten Strategie wird ein übergeordnetes<br />
Leitbild als Zukunftsvision für die Siellandschaft Wesermarsch und ein Leitthema<br />
festgelegt. Aus diesen beiden leiten sich Entwicklungsziele ab, die die Leitlinien für die zukünftige<br />
Entwicklung darstellen. Den konkreten Rahmen, innerhalb dessen die Entwicklungsziele<br />
verfolgt werden, bilden die Handlungsfelder. Für diese werden handlungsfeldspezifische Ziele<br />
und Maßnahmen zur Zielerreichung definiert, die durch konkrete Projekte ausgestaltet werden.<br />
Die Ebenen der Entwicklungsstrategie sind in Abbildung 6.1 grafisch veranschaulicht.<br />
Die Entwicklungsstrategie für die Regionalentwicklung der Siellandschaft Wesermarsch ab dem<br />
Jahr 2007 lautet wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.<br />
41<br />
INTERNE PARAMETER<br />
STRATEGISCHE<br />
AUSRICHTUNG<br />
WEITERENTWICKLUNG<br />
DER STRATEGIE<br />
STRUKTUR DER ENTWICK-<br />
LUNGSSTRATEGIE
HERLEITUNG DES<br />
LEITTHEMAS<br />
BEDEUTUNG DES<br />
SIELSYSTEMS<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Handlung Handlungsfeld<br />
Handlung feld<br />
A<br />
42<br />
Ziele<br />
Maßnahmen<br />
Projekte<br />
Entwicklungsziel Entwicklungsziel 1 1<br />
Entwicklungsziel Entwicklungsziel 2 2<br />
Entwicklungsziel Entwicklungsziel 33<br />
3<br />
Handlung Handlungsfeld<br />
Handlung feld feld<br />
B<br />
Ziele<br />
Maßnahmen<br />
Projekte<br />
Abb. 6.1: Schematischer Aufbau der Entwicklungsstrategie (Quelle: eigene Darstellung).<br />
6.1.2 Leitthema und Leitbild<br />
LEITTH LEITTHEMA<br />
LEITTH MA<br />
LEITBILD<br />
LEITBILD<br />
Hand Handlung Hand Handlung<br />
lungsfeld lung feld feld<br />
C<br />
Ziele<br />
Maßnahmen<br />
Projekte<br />
Handlung Handlungsfeld<br />
Handlung feld feld<br />
D<br />
In der Wesermarsch nimmt das Sielsystem eine herausragende Rolle ein. Es ist Ausdruck einer<br />
über Jahrhunderte entwickelten, herausragenden kultur- und ingenieurtechnischen Leistung der<br />
Wesermarschbewohner. Es überformte den Naturraum und prägt kulturlandschaftstypische<br />
Biotope mit den ihnen angepassten Arten und Lebensgemeinschaften. Es gibt der Landschaft<br />
ein eigenes, unverwechselbares Landschaftsbild.<br />
Das Sielsystem der Wesermarsch war in der Vergangenheit Grundlage allen Lebens und Wirtschaftens<br />
<strong>–</strong> und ist es noch heute im Bereich der Landwirtschaft. Ohne die Be- und Entwässerung<br />
wäre die Rindviehhaltung, die die Wesermarsch als größtes zusammenhängendes Grünlandgebiet<br />
Deutschlands auszeichnet, nicht möglich.<br />
Das Sielsystem durchzieht den gesamten Landschaftsraum als raumprägendes Netz. Wege-<br />
und Flächenstrukturen ordnen sich seinem Verlauf unter.<br />
Das Wassermanagement des Sielsystems ist abhängig von den Wasserständen der natürlichen<br />
Fließgewässer, die die Wesermarsch umschließen. Es verbindet somit die binnenländische und<br />
die maritime Wasserlandschaft und das dazugehörige Kulturerbe mit seinen Traditionen und<br />
seiner Entwicklungsgeschichte.<br />
Auch in Zukunft werden Natur und Landschaft, Kultur und menschliches Leben und Wirtschaften<br />
in der Wesermarsch von Wasser, Gewässern und einem geeigneten Wassermanagement abhängig<br />
sein. Das übergeordnete Leitthema der Entwicklungsstrategie lautet daher:<br />
Ziele<br />
Maßnahmen<br />
Projekte<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Handlung Handlungsfeld<br />
Handlung Handlung feld<br />
E<br />
Ziele<br />
Maßnahmen<br />
Projekte
Siellandschaft Wesermarsch<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Natur- und Kulturlandschaft bilden die Grundlage für ein nachhaltig<br />
gestaltetes Sozial- und Wirtschaftsleben<br />
Auf Grundlage dieses Leitthemas wurde durch Regionalmanagement und LAG unter Berücksichtigung<br />
der Ergebnisse des Bottom-up-Verfahrens ein Leitbild als angestrebte Zukunftsvision<br />
der Siellandschaft Wesermarsch entworfen. Dieses wird wie folgt charakterisiert:<br />
Leitbild der Siellandschaft Wesermarsch<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch bildet mit ihren Grünlandweiden, ihrem Sielsystem<br />
und den Flüssen Jade, Hunte und Weser sowie dem Wattenmeer der<br />
Nordsee eine außergewöhnliche Natur- und Kulturlandschaft.<br />
Die Bewohner der Siellandschaft Wesermarsch identifizieren sich in hohem<br />
Maße mit dem Leben, dem Arbeiten und dem Wirtschaften in ihrer Region.<br />
Sie schätzen die natürlichen und kulturellen Werte ihres Lebensumfeldes und<br />
setzen sich gemeinsam intensiv für den Erhalt und die Entwicklung des regionalen<br />
Natur- und Kulturerbes ein.<br />
Durch gemeinschaftliches Engagement und attraktive Dorfkerne existiert ein<br />
lebendiges Dorfleben mit hoher Lebensqualität. Zusammenarbeit und Kooperationen<br />
sind den Menschen besonders wichtig.<br />
Die Landwirtschaft als wirtschaftliches und landschaftsprägendes Rückgrat<br />
der Siellandschaft ist eng in die regionale Zusammenarbeit eingebunden und<br />
mit den Bereichen Naturschutz, Kulturerbe und Tourismus verzahnt. Unternehmerisches<br />
Handeln in der Siellandschaft Wesermarsch stärkt mit regional<br />
erzeugten Produkten und Dienstleistungen die Wirtschaftskreisläufe und die<br />
Wertschöpfung in der Region.<br />
Ihren Bewohnern bietet die Siellandschaft Wesermarsch alle Voraussetzungen<br />
in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Arbeitsmarkt für Leben, Lernen<br />
und Arbeiten in der Region.<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch ist als Natur- und Kulturlandschaft überregional<br />
bekannt und hat ein positives Image. Die Menschen aus der Siellandschaft<br />
Wesermarsch überzeugen mit Gastlichkeit und touristischen Angeboten,<br />
die sich an den regionalen Gegebenheiten der Natur- und Kulturlandschaft<br />
ausrichten und ein echtes Erlebnis bieten.<br />
43<br />
LEITTHEMA<br />
LEITBILD
ÖKOLOGISCHE<br />
ZIELSETZUNG<br />
ÖKOLOGISCHE<br />
WIRKUNGSINDIKATOREN<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
6.1.3 Entwicklungsziele<br />
Im Konsens zu dem Prinzip der Nachhaltigkeit als 1992 verabredetes Leitprinzip der globalen<br />
Staatengemeinschaft werden für die Siellandschaft Wesermarsch folgende drei übergeordnete<br />
Entwicklungsziele festgelegt, mit denen die Realisierung des Leitbildes erreicht werden soll. Im<br />
Folgenden werden diese Entwicklungsziele aufgeführt und erläutert.<br />
Ihnen werden Wirkungsindikatoren zugeordnet, anhand derer eine Überprüfung der Zielerreichung<br />
ermöglicht wird. Dabei werden von vielen potenziell möglichen Wirkungsindikatoren nur<br />
diejenigen aufgeführt, die geeignet sind, eine quantitative Überprüfung anhand spezifischer<br />
Messgrößen und realistisch durchführbarer Messmethoden zu gewährleisten.<br />
44<br />
Entwicklungsziel 1 (Ökologische Zielsetzung)<br />
Der ökologische Zustand von Natur und Landschaft soll optimiert<br />
und das Naturerleben in der Siellandschaft Wesermarsch<br />
soll gefördert werden.<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch möchte für ihr reichhaltiges und bedeutsames Naturerbe eine<br />
besondere Verantwortung übernehmen. Das Entwicklungsziel 1 bezweckt daher, Natur- und<br />
Landschaft mit ihren typischen Lebensräumen und dem gebietsspezifischen Arteninventar für<br />
nachfolgende Generationen qualitativ und quantitativ langfristig zu sichern. Dies schließt die<br />
Erhaltung von Freiräumen des Naturraumes sowie die Berücksichtigung aller abiotischen und<br />
biotischen Faktoren der regionaltypischen Ökosysteme ein. Der stoffliche Zustand von Luft,<br />
Gewässern und die Gewässerstruktur sollen erhalten bzw. wenn notwendig, gegenüber ihrer<br />
jetzigen Situation verbessert werden. Gebietstypische Tiere und Pflanzen sollen in einer ihrem<br />
natürlichen bzw. kulturlandschaftsgemäßen Lebensraum in angemessener Populationsgröße<br />
etabliert sein. Das Landschaftsbild soll kulturlandschaftliche, historisch begründete und an den<br />
Naturraum angepasste Landbewirtschaftungsformen widerspiegeln. Da die Wesermarsch eine<br />
küstennahe Region ist, soll bei der Optimierung des ökologischen Zustandes insbesondere der<br />
bevorstehende Klimawandel berücksichtigt werden. Als sensibler Gradmesser für eintretende<br />
Auswirkungen des Klimawandels kann die Region frühzeitig auf globale Trends reagieren, aufmerksam<br />
machen und überregional zum konstruktiven Handeln anregen.<br />
Für den langfristigen Erhalt von Natur und Landschaft ist eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz<br />
notwendig. Um mittel- und langfristig eine Lobby für die Natur aufzubauen, soll durch positiv<br />
wahrgenommenes Erleben des Naturraumes für das Thema des Natur- und Landschaftserhaltes<br />
sensibilisiert werden. Naturerlebnismöglichkeiten sollen sowohl für die einheimische Bevölkerung<br />
als auch für Gäste der Region bereitgehalten werden. Die touristische Nutzung ermöglicht<br />
zum einen, die Natur der Siellandschaft Wesermarsch überregional bekannt zu machen,<br />
und zum anderen <strong>–</strong> durch den Ausbau des Naturtourismus <strong>–</strong> eine Verknüpfung zur regionalen<br />
Wertschöpfung zu schaffen.<br />
Als Wirkungsindikatoren, die geeignet sind, die Erreichung des gesetzten ökologischen Zieles<br />
zu überprüfen, werden gesehen:<br />
� die Bestandsentwicklung von Leitarten regionstypischer Biotope,<br />
� die Anzahl und Größe von Schutzgebieten,<br />
� die Struktur- und Stoffgüte von Gewässern.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
Entwicklungsziel 2 (Soziale Zielsetzung)<br />
Entwicklungsziel 3 (Ökonomische Zielsetzung)<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Die Lebensqualität des Dorflebens, die Wahrung des kulturellen Erbes und<br />
die Identifikation der Menschen mit der Siellandschaft Wesermarsch<br />
sollen verbessert werden.<br />
Voraussetzung für eine aktive, engagierte Teilhabe an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes<br />
ist die Identifikation der Einwohner mit ihrer Region. Das Entwicklungsziel 2 strebt an, die<br />
infrastrukturellen und kulturellen Sozialaspekte in der Siellandschaft Wesermarsch zu verbessern.<br />
Dazu dient die Steigerung der Lebensqualität in den Dörfern durch die Sicherstellung der<br />
Grundversorgung in den Bereichen Ver- und Entsorgung, Kommunikation und Verkehr sowie<br />
Dienstleistungen, Verwaltung, Gesundheit, Bildung und Kultur. Um ein lebendiges, authentisches<br />
Dorfleben zu fördern, sollen Einwohner der Siellandschaft Wesermarsch darin unterstützt<br />
werden, miteinander zu kommunizieren, zu kooperieren und ihre Interessen, Anregungen und<br />
Wünsche für die zukünftige Entwicklung der Region in Form des bürgerschaftlichen Engagements<br />
und der politischen Partizipation mit einzubringen.<br />
Überlieferung und Bewahrung von Wissen über regionale Gepflogenheiten, regionaltypisches<br />
Brauchtum, Traditionen, Regionalgeschichte, handwerkliche und kulinarische Besonderheiten<br />
sowie der kulturelle Werterhalt sind Grundlage für die Wahrung des kulturellen Erbes. Dieses<br />
Wissen fördert die Verwurzelung von Menschen in ihrer Region. Alle Bestrebungen, die die<br />
Identifikation von Menschen mit ihrem unmittelbaren Lebensumfeld und der Kulturlandschaft, in<br />
der sie leben, direkt oder indirekt verbessern, sollen durch Aktivitäten, die dem Entwicklungsziel<br />
2 Rechnung tragen, ermöglicht werden.<br />
Als Wirkungsindikatoren, die geeignet sind, die Erreichung des gesetzten sozialen Zieles zu<br />
überprüfen, dienen:<br />
� die Bevölkerungszahl,<br />
� der Partizipationsgrad,<br />
� das Regionalbewusstsein.<br />
Die Wertschöpfung von Produkten und Dienstleistungen der Siellandschaft<br />
Wesermarsch soll im Bereich von Landwirtschaft, Handwerk, Handel und<br />
Tourismus gesteigert werden.<br />
Eine funktionierende regionale Wirtschaft bildet die Basis für das Leben und Arbeiten in der<br />
Region unter Berücksichtigung der regionstypischen Potenziale. Mit dem Entwicklungsziel 3 ist<br />
beabsichtigt, die Siellandschaft Wesermarsch als einen Wirtschaftsstandort zu etablieren, der<br />
seinen Bewohnern im unmittelbaren Lebensumfeld eine stabile Wirtschaftsstruktur bietet und<br />
durch regionale Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten ein finanzielles Auskommen<br />
ermöglicht.<br />
Die regionale Wertschöpfung von Produkten und Dienstleistungen der Siellandschaft Wesermarsch<br />
soll gesteigert werden, um Geldflüsse in der Region zu halten und um die regionale<br />
Wirtschaft zu stärken. Insbesondere die eng mit der Natur- und Kulturlandschaft verbundenen<br />
Wirtschaftszweige wie Landwirtschaft und Tourismuswirtschaft befinden sich im Fokus des ökonomischen<br />
Entwicklungzieles, ebenso das in der Region ansässige Handwerk und der Handel.<br />
45<br />
SOZIALE ZIELSETZUNG<br />
SOZIALE<br />
WIRKUNGSINDIKATOREN<br />
ÖKONOMISCHE<br />
ZIELSETZUNG
ÖKONOMISCHE<br />
WIRKUNGSINDIKATOREN<br />
STELLENWERT VON<br />
KOOPERATIONEN<br />
GRÜNDE FÜR<br />
KOOPERATIONEN<br />
KOPPERATIONS-<br />
STRATEGIEN<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Besonders in diesen Bereichen sollen die Produktionsbedingungen, die Anbieterstrukturen, die<br />
Betriebswirtschaftlichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Um am regionalen<br />
und überregionalen Markt bestehen zu können, soll mit dem ökonomischen Entwicklungsziel<br />
auch erreicht werden, dass die Vielfalt von Produkten zunimmt, die regional erzeugt, verarbeitet<br />
oder vermarket werden. Die Stärkung der regionalen Wirtschaft soll ebenso geschehen durch<br />
die Förderung von Allianzen, Kooperationen, Interessensgemeinschaften und Netzwerken im<br />
Rahmen von regionalen Wertschöpfungsketten und -partnerschaften, die regionale Wirtschaftspartner<br />
untereinander oder mit regionalen Partnern vernetzen.<br />
Als Wirkungsindikatoren, die geeignet sind, die Erreichung des gesetzten ökonomischen Zieles<br />
zu überprüfen, dienen:<br />
� der Absatz regionaler Produkte,<br />
� die Mitgliederzahl von Vereinen zur Förderung regionaler Produkte,<br />
� die Anzahl von Existenzgründungen innerhalb regionaler Wertschöpfungsketten,<br />
� die Übernachtungszahlen von Touristen.<br />
6.1.4 Kooperationen<br />
Sowohl regionale als auch gebietsübergreifende Kooperationen sollen bei der Regionalentwicklung<br />
der Siellandschaft Wesermarsch in Zukunft eine wichtige Stellung einnehmen. Wie die<br />
Kooperationserfahrungen in LEADER+ gezeigt haben, wurden durch die Zusammenarbeit in<br />
inhaltlicher und finanzieller Hinsicht nachhaltige Synergieeffekte und Folgeaktivitäten erreicht,<br />
die die Region in besonderem Maße positiv beeinflusst haben. Daher will die LAG „Wesermarsch<br />
in Bewegung“ den Kooperationsansatz kontinuierlich fortführen und gebietsübergreifende<br />
Kooperationen ausbauen. Diese Absicht wird mit der Fortführung des Finanztopfes „Wesermarsch<br />
in Bewegung“ als Finanzierungsinstrument und mit dem Mittelanteil für Kooperationsprojekte<br />
in Höhe von mehr als 14 % untermauert (vgl. Kap. 7).<br />
Der gebietsübergreifende Kooperationsansatz bedeutet für die Siellandschaft Wesermarsch mit<br />
ihrer in naturräumlicher, geografischer und politisch-administrativer Hinsicht isolierten Lage,<br />
dass die begrenzten Verflechtungsmöglichkeiten zu benachbarten Regionen überwunden werden.<br />
Daher wird auf gebietsübergreifende überregionale und transnationale Kooperationsbemühungen,<br />
die einen Mehrwert für die Siellandschaft Wesermarsch und ihre Partnerregionen<br />
schaffen, ein besonderes Augenmerk gelegt.<br />
Zur Ausgestaltung des Kooperationswillens mit Partnern aus Leader- und ILEK-Gebieten dienen<br />
zwei strategische Ansätze:<br />
1. Naturräumlich-geografische gebietsübergreifende Kooperationen:<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch will Kooperationsmöglichkeiten nutzen, wo sich naturräumlichgeografische<br />
Überschneidungen oder Gemeinsamkeiten ergeben. Dies sind beispielsweise<br />
zusammengehörige naturräumliche Einheiten wie der Flussverlauf der Weser oder die Küstenbiotope<br />
der Nordsee im Bereich des Nationalparks und Biosphärenreservats Niedersächsisches<br />
Wattenmeer. Konkret sind folgende naturräumlich-geografische gebietsübergreifende Kooperationsvorhaben<br />
geplant:<br />
� Zwei Kooperationsprojekte sind mit der LAG Nordseemarschen und der LAG VoglerRegion<br />
vereinbart. In der Siellandschaft Wesermarsch haben diese Projekte den Stellenwert von<br />
Leitprojekten (vgl. S. 53 und S. 70).<br />
46<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
� Mit der niederländischen LAG Hoogeland ist ein Kooperationsprojekt verabredet, das thematisch<br />
auf die in LEADER+ gemeinsame Machbarkeitsstudie „Old Skipper Towns“ zur<br />
nachhaltigen touristischen Nutzung kleiner Küstenorte aufbaut.<br />
� Mit der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer ist eine Kooperation zum<br />
Themenbereich „Nachhaltigkeit“ in der geplanten Entwicklungszone des Biosphärenreservates<br />
Wattenmeer besprochen.<br />
� Mit der Leader-Antragsregion Wesermünde-Nord ist innerhalb einer Kooperationsvereinbarung<br />
die Zusammenarbeit hinsichtlich der Vernetzung von Projekten im Biosphärenreservat<br />
Niedersächsisches Wattenmeer geplant.<br />
� Mit dem Kooperationsnetzwerk Nordwest, in dem zwölf deutsche und fünf niederländische<br />
Regionen zusammengeschlossen sind, hat die LAG Wesermarsch in Bewegung in der „Erklärung<br />
von Leer“ am 29. August 2007 ihre Kooperationsabsichten verbindlich zum Ausdruck<br />
gebracht und den Kooperationsrahmen abgesteckt.<br />
2. Thematisch-strategische gebietsübergreifende Kooperationen:<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch will unabhängig von naturräumlichen Gemeinsamkeiten Kooperationsmöglichkeiten<br />
ergreifen, sobald sich thematisch-strategische Gemeinsamkeiten im<br />
Bereich der fünf Handlungsfelder unter Berücksichtigung der dort definierten Ziele und Maßnahmen<br />
ergeben.<br />
Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Regionalen Entwicklungskonzeptes können zu<br />
den thematisch-strategischen gebietsübergreifenden Kooperationen folgende Aussagen gemacht<br />
werden:<br />
� Mit der Leader-Antragsregion Wesermünde-Nord sind Kooperationen zur Vermarktung regionaler<br />
Spezialitäten sowie zu Erlebniswegen geplant.<br />
� Die Regionalinitiative proRegion e.V. hat im Rahmen ihrer Arbeit zur Förderung regionaler<br />
Produkte Kontakte zum Wittelsbacher Land in Bayern aufgebaut. Daraus entstanden ist eine<br />
informelle Kooperationsabsprache mit der LAG Wittelsbacher Land.<br />
Tab. 6.1: Kooperationspartner und -themen der LAG Wesermarsch in Bewegung<br />
(nach Konkretisierungsgrad absteigend sortiert).<br />
Kooperationspartner Projekttitel/-thema<br />
LAG Nordseemarschen „Naturerleben Jadebusen … Am Herzen der Natur“<br />
LAG VoglerRegion „Flussplätze an der Weser“<br />
LAGs des Kooperationsnetzwerkes<br />
Nordwest<br />
Informations- und Erfahrungsaustausch<br />
LAG Hoogeland (NL) „Old Skipper Towns“<br />
LAG Wesermünde-Nord „Kulinarisches Netzwerk Küste“<br />
(in Wesermünde-Nord: „Wesermünde schmeckt“)<br />
Vernetzung der Projekte im Biosphärenreservat<br />
Entwicklung von Natur- und Kulturerlebniswegen für<br />
Fußgänger und Radfahrer<br />
LAG Wittelsbacher Land Vermarktung von Ochsenfleisch<br />
Biosphärenreservat Niedersächsisches<br />
Wattenmeer<br />
„Route der Nachhaltigkeit“<br />
47
HANDLUNGSFELDER<br />
ZIELE UND MASSNAHMEN<br />
PROJEKTAUSWAHL-<br />
KRITERIEN<br />
MINDESTKRITERIEN<br />
QUALITÄTSKRITERIEN<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
6.2. Handlungsfelder und Projekte<br />
6.2.1 Ableitung und Entwicklung<br />
Den drei Entwicklungszielen der Siellandschaft Wesermarsch werden Handlungsfelder zugeordnet,<br />
in denen die Umsetzung der Ziele erfolgt. Die Erarbeitung der Handlungsfelder gelang in<br />
enger Zusammenarbeit zwischen dem Regionalmanagement und Akteuren der Region. Um die<br />
Entwicklungsziele strategisch umzusetzen, wurden von regionalen Akteuren im Rahmen des<br />
Strategieworkshops fünf maßgebliche Handlungsfelder identifiziert: Dorfleben, Kultur, Natur,<br />
Regionale Produktion und Tourismus. Zur besseren Systematisierung werden die Handlungsfelder<br />
mit den Buchstaben A-E gekennzeichnet.<br />
Aktivitäten in diesen Handlungsfeldern dienen dazu, die Entwicklungsziele für die Siellandschaft<br />
Wesermarsch zu erreichen. Dabei erfolgt die Umsetzung des ökologischen Entwicklungszieles<br />
mit dem Schwerpunkt im Handlungsfeld Natur (A). Der Verwirklichung des sozialen Zieles dienen<br />
insbesondere Aktivitäten in den Handlungsfeldern Dorfleben (B) und Kultur (C). Die Bestrebungen,<br />
das ökonomische Entwicklungsziel zu erreichen, erfolgen in den Handlungsfeldern<br />
Regionale Produktion (D) und Tourismus (E). Bei der Identifizierung der Handlungsfelder wurde<br />
darauf geachtet, dass von jedem Handlungsfeld sinnvolle inhaltliche Verknüpfungen zu den<br />
jeweils vier anderen Handlungsfeldern möglich sind. Die Gesamtheit der fünf Handlungsfelder<br />
deckt alle wesentlichen gesellschaftspolitischen Themenbereiche ab, mit denen die Erreichung<br />
der Entwicklungsziele für die Siellandschaft Wesermarsch durchgesetzt werden kann. Die im<br />
Regionalen Entwicklungskonzept für die Wesermarsch von 2001 definierten Themenfelder „Bildung“<br />
und „Jugend“ sind in allen fünf neu definierten Handlungsfeldern relevant und gehen als<br />
Querschnittsthemen in ihnen auf.<br />
In jedem der fünf Handlungsfelder wurden in drei themenzentrierten Arbeitsgruppen (Arbeitstitel<br />
„Natur + Regionale Produkte“, „Dorfleben + Kultur“, „Tourismus“) auf der Zukunftskonferenz<br />
Siellandschaft Wesermarsch von den anwesenden regionalen Akteuren prioritäre Handlungsfeldziele<br />
ausgearbeitet, die im Anschluss vom Regionalmanagement näher spezifiziert und aufeinander<br />
abgestimmt wurden. Jedem Ziel im Handlungsfeld werden Maßnahmen zugeordnet,<br />
die benennen, welche Aktivitäten zur Zielerreichung geplant sind. Jede Maßnahme innerhalb<br />
eines Handlungsfeldes soll durch mehrere konkrete Projekte in die Realität umgesetzt werden.<br />
Bis zum Zusammentreffen der LAG am 11. September 2007 sind in enger Zusammenarbeit mit<br />
zahlreichen Akteuren aus der Region und den potenziellen Projektträgern vom Regionalmanagement<br />
auf Grundlage der regionalen Prozessentwicklung und unter Berücksichtigung der Entwicklungsziele<br />
17 umsetzungsreife Projekte erarbeitet worden, die zur Umsetzung der Regionalentwicklungsstrategie<br />
beitragen. Die Erarbeitung der Projektvorschläge erfolgte unter Berücksichtigung<br />
von Mindestkriterien, ohne deren Erfüllung ein Projekt nicht in die Auswahl aufgenommen<br />
wurde. Als Mindestkriterien gelten:<br />
� Unterstützung der Entwicklungsstrategie: Übereinstimmung mit Leitbild, Leitthema und<br />
Entwicklungszielen,<br />
� Finanzierung: Kofinanzierung durch Projektträger vorhanden, Projektfinanzierung kann<br />
durch Stiftungsmittel ergänzt werden,<br />
� Regionale Trägerschaft: öffentliche oder private Projektträger (Kommunen, Vereine o.ä.)<br />
aus der Region.<br />
Weiterhin wurden Qualitätskriterien bei der Projektauswahl zugrunde gelegt, durch deren Erfüllung<br />
sich ein Projekt zur Eignung als ein Leitprojekt qualifizierte:<br />
� Kooperationscharakter: Das Projekt fördert die Zusammenarbeit von Akteuren unterschiedlicher<br />
gesellschaftlicher, institutioneller, öffentlicher und privater Gruppierungen. Das<br />
48<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projekt hat eine möglichst weitreichende geografische Abdeckung innerhalb der Siellandschaft<br />
und kann innerhalb von mindestens drei Kommunen durchgeführt werden. Das Projekt<br />
eignet sich als gebietsübergreifendes Kooperationsprojekt über die Grenzen der Siellandschaft<br />
Wesermarsch hinaus.<br />
� Innovationscharakter: Das Projekt repräsentiert ein neues Angebot, neues Verfahren oder<br />
neues Produkt; Eignung des Projektes als Pilot- und Modellprojekt.<br />
� Vernetzungsmöglichkeit: Verknüpfungsmöglichkeit eines Handlungsfeldes zu einem zweiten<br />
Handlungsfeld, Verknüpfung des Projektes zu weiteren Projekten.<br />
� Ökologische Dimension: Das Projekt erfüllt besondere Natur- und Umweltbelange wie<br />
Klimaneutralität, Artenschutz, nachhaltig produzierte Rohstoffe und regenerative Energien.<br />
� Soziale Dimension: Das Projekt berücksichtigt in besonderem Maße Jugendliche, ältere<br />
Menschen oder Menschen mit Behinderung und berücksichtigt Gender-Aspekte.<br />
� Ökonomische Dimension: Das Projekt zeichnet sich durch enges Kosten-Nutzen-<br />
Verhältnis aus, oder ist mittel- bis langfristig geeignet, Einnahmen zu schaffen.<br />
� Tragfähigkeit: Eine langfristige personelle und finanzielle Tragfähigkeit über die Förderperiode<br />
hinaus ist gegeben.<br />
� Private Beteiligungen: Public-Private-Partnership bei Projektfinanzierung.<br />
� Kontinuität der Regionalentwicklung: Das Projekt hat inhaltlichen Bezug zu einem bereits<br />
erfolgreichen LEADER+ Projekt.<br />
Für die Darstellung im vorliegenden <strong>REK</strong> wurden durch die LAG in anonymer Abstimmung aus<br />
17 Projektvorschlägen, die die oben angeführten Kriterien in besonderem Maße erfüllten, exemplarisch<br />
elf Projekte als Leitprojekte nach Stimmenmehrheit ausgewählt. Die Leitprojekte sind in<br />
den thematisch zugehörigen Handlungsfeldern (Kap. 6.2.2 bis 6.2.6) als Steckbriefe mit folgenden<br />
Rubriken dargestellt:<br />
� Handlungsfelder: Aufgeführt sind die fünf aus der Entwicklungsstrategie abgeleiteten<br />
Handlungsfelder A-E. Das Handlungsfeld, welches dem Projekt schwerpunktmäßig zugeordnet<br />
ist, ist mit einem Kreuz und fett formatierter Schrift gekennzeichnet. Weitere Handlungsfelder,<br />
die das Projekt thematisch berührt, sind mit einem Kreuz und normalem Schriftschnitt<br />
gekennzeichnet.<br />
Zusätzlich werden in dieser Rubrik Kooperationsprojekte gekennzeichnet, die in Zusammenarbeit<br />
mit Regionen außerhalb der Siellandschaft Wesermarsch durchgeführt werden<br />
sollen. Mit der Angabe „Aufbauprojekt zu LEADER+“ wird an ein Projekt aus LEADER+ angeknüpft.<br />
In diesem Fall ist die Kenn-Nummer des LEADER+ Projektes angegeben.<br />
� Kurzbeschreibung des Projektes: Die Inhalte des Projektes werden hier kurz beschrieben.<br />
Wenn es zum Verständnis des Projektes nötig ist, werden Angaben zur Ausgangslage<br />
und zu besonderen Hintergründen gemacht.<br />
� Bedeutung für die Siellandschaft Wesermarsch: Hier werden die Bedeutung des Projektes<br />
für die naturräumlichen, soziokulturellen und wirtschaftlichen Bedingungen der Siellandschaft<br />
Wesermarsch erläutert sowie die maßgeblichen Qualitätskriterien des Projektes aufgeführt.<br />
� Zielbezug: Aufgeführt ist das vorrangige Entwicklungsziel (vgl. Kap. 6.1), dem die Umsetzung<br />
des beschriebenen Projektes dienen soll. Weiterhin aufgeführt sind Ziele der Handlungsfelder<br />
(vgl. Kap. 6.2) sowie projektspezifische Ziele.<br />
� Arbeitsschritte: Die wichtigsten Arbeitsschritte, die zur Realisierung des Projektes notwendig<br />
sind, werden hier aufgelistet.<br />
49<br />
ABSTIMMUNG DER<br />
LEITPROJEKTE<br />
STECKBRIEFRUBRIKEN
STRUKTURFONDS<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
� Projektträger: Als Projektträger wird die Organisation oder Institution genannt, die voraussichtlich<br />
den Projektantrag stellen wird.<br />
� Projektpartner: Als Projektpartner werden alle Organisationen oder Institutionen aufgeführt,<br />
die voraussichtlich in Kooperation mit dem Projektantragsteller das Projekt entwickeln<br />
und durchführen werden. Kreisangehörige Kommunen gelten grundsätzlich als potenzielle<br />
Projektpartner und werden daher nicht gesondert aufgeführt.<br />
� Beteiligte Gebietskörperschaften: Generell gilt, dass alle Projekte organisatorisch wie<br />
physisch möglichst paritätisch und flächendeckend realisiert werden sollen. Hier wird aufgeführt,<br />
welche der maximal zehn Gebietskörperschaften der Wesermarsch sich am Projekt<br />
beteiligen können. Die beteiligten Gebietskörperschaften sind fett ausgezeichnet.<br />
� Zeitplan: Hier ist der Zeitraum benannt, in dem das beschriebene Projekt realisiert werden<br />
soll.<br />
� Projektkosten: Die Projektkosten können zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden<br />
Regionalen Entwicklungskonzeptes nur in ungefährer Höhe aufgeführt werden. Die Finanzierungsanteile<br />
ergeben sich aus den geltenden Leader-Förderrichtlinien, potenzielle Finanzträger<br />
werden so konkret wie möglich angegeben.<br />
� Ansprechpartner: Ansprechpartner sind in der Regel Vertreter der antragstellenden Institution<br />
bzw. Organisation sowie die Vertreter der Geschäftsstelle Wesermarsch in Bewegung.<br />
Im Folgenden werden für jedes Handlungsfeld Ziele, Maßnahmen und Aktivitäten sowie deren<br />
beabsichtigte Wirkungen erläutert. Soweit möglich werden Aussagen zur Finanzierung der geplanten<br />
Aktivitäten getroffen. Hierzu werden passende Maßnahmencodes aus dem Programm<br />
PROFIL 2007-2013 (NIEDERSACHSEN/BREMEN 2007) bzw. Maßnahmen anderer Strukturfonds<br />
unter den Abschnitten der beschriebenen Aktivitäten in Klammern angegeben.<br />
Neben den umsetzungsreifen, von der LAG beschlossenen Leitprojekten werden weitere Projektaktivitäten<br />
in Kurzform aufgeführt, die aus dem Ideenpool der Bottom-up-Prozessentwicklung<br />
(vgl. Kap. 3) mit Akteuren der Region entstanden sind.<br />
50<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
6.2.2 Handlungsfeld A: Natur<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Ziele Maßnahmen / Aktivitäten<br />
1. Erhalt und Gestaltung von Natur<br />
und Landschaft mit ihren typischen<br />
Arten und Lebensräumen<br />
2. Ausbau von Angeboten zum<br />
Naturerleben<br />
a) Zusammenarbeit von Landnutzern und Naturschützern zur<br />
Landschaftserhaltung und -gestaltung fördern.<br />
b) Lebensräume und -bedingungen für typische Arten und<br />
Lebensgemeinschaften des Kulturlandschaftsraumes entwickeln<br />
und fördern.<br />
a) Erlebnisqualität von Natur und Landschaft entwickeln, ausbauen,<br />
steigern.<br />
b) Sensibilisierung und Wissensgrundlage für den Natur- und<br />
Kulturlandschaftsraum fördern.<br />
3. Förderung des Klimaschutzes a) Innovative Anpassungsstrategien und Bewusstseinsbildung<br />
zu den Auswirkungen des Klimawandels entwickeln.<br />
Dem ökologischen Entwicklungsziel (vgl. Kap. 6.1) dienen im Handlungsfeld A unter anderem<br />
der Erhalt und die Gestaltung von Natur und Landschaft mit ihren typischen Arten und Lebensräumen.<br />
Dazu gehören die küstennahen Ökosystemtypen (Wattenmeer, Buchtenwatt, Deichvorland,<br />
Salzwiesen) und die Gewässerbiotope der Flüsse und Siele (Röhrichte, Flachwasserzonen,<br />
Flusswatt, Gräben), Moore sowie die ausgedehnten extensiven Feuchtgrünlandbiotope.<br />
Neben der Förderung und Entwicklung der Lebensräume und -bedingungen des typischen Arteninventars<br />
dient auch die Zusammenarbeit zwischen Landnutzern und Naturschützern zur<br />
Erreichung akzeptierter, langfristig wirkender Lösungen in diesem Bereich.<br />
(Maßnahmencodes: PROFIL 323-A, 323-B, 323-C).<br />
Der Ausbau von Angeboten zum Naturerleben soll durch die Verbesserung der Erlebnisqualität<br />
von Natur und Landschaft sowie der gezielten Sensibilisierung und Förderung des Wissens über<br />
den Natur- und Kulturlandschaftsraum erreicht werden.<br />
(Maßnahmencodes: PROFIL 323-A, 331 sowie EFRE 3.6.5.1).<br />
In einer Küstenregion wie der Wesermarsch, deren Binnenland in weiten Teilen unter Meeresspiegelhöhe<br />
liegt, werden sich die Folgen des anstehenden Klimawandels besonders früh und<br />
gravierend bemerkbar machen. Die Einflussmöglichkeiten für eine ländliche Region, auf den<br />
Klimawandel selbst Einfluss zu nehmen sind begrenzt, daher konzentriert sich die Siellandschaft<br />
Wesermarsch in der Hauptsache darauf, mit innovativen Anpassungsstrategien an den Klimawandel<br />
und Bewusstseinsbildung die Bereitschaft zum Klimaschutz auf lange Sicht zu fördern.<br />
(Maßnahmencode: EFRE 3.6.5.1).<br />
Zur zukünftigen Überprüfung, ob die im Handlungsfeld A gesetzten Ziele erreicht wurden, dienen<br />
folgende Ergebnisindikatoren:<br />
� Artenzahl typischer Leitarten des Feuchtgrünlandes (z.B. Weißstorch, Rotschenkel, Uferschnepfe,<br />
Kiebitz, Bekassine) sowie der Gräben (z.B. Krebsschere, Schlammpeitziger),<br />
� Flächengröße von Vertragsnaturschutzflächen und Anzahl der Vertragsnaturschutzpartner,<br />
� Anzahl von Naturerlebnismöglichkeiten und -angeboten.<br />
Die folgenden drei Leitprojekte (vgl. S. 52 - 54) dienen der kurzfristig möglichen Umsetzung der<br />
Maßnahmen zur Erreichung der Unterziele und Entwicklungsziele im Bereich Ökologie und<br />
Natur.<br />
51<br />
AKTIVITÄTEN,<br />
WIRKUNGEN,<br />
MASSNAHMENCODES<br />
ERGEBNISINDIKATOREN<br />
LEITPROJEKTE
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Ökotop ... Grüppen, Gräben, Siele“<br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft<br />
Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
52<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+<br />
Das über 20.000 km lange Be- und Entwässerungssystem der Siellandschaft Wesermarsch<br />
ermöglicht seinen Bewohnern Leben und Wirtschaften in der Marsch. Das Wassermanagement<br />
des Sielsystems geht jedoch mit einem stark schwankenden Wasserstand einher, der den optimalen<br />
ökologischen Zustand von Pflanzen- und Tierlebensräumen mindert. Daher soll ein Sielzug<br />
von seinem Ursprung im Binnenland bis zum Sieltor auf Grundlage der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie<br />
naturnah entwickelt werden. Dazu gehört die Anlage von Nebengewässern<br />
mit gleich bleibendem Wasserstand, in denen aquatische Tiere mit besonderen ökologischen<br />
Ansprüchen (z.B. Schlammpeitziger, Bitterling, Gemeine Teichmuschel, diverse Krautlaicher)<br />
eine Rückzugsmöglichkeit finden. Weiterhin sollen modellhaft Maßnahmen entwickelt und umgesetzt<br />
werden, die geeignet sind, das ökologische Potenzial von Sielgewässern und der Gewässerflora<br />
und -fauna zu erhöhen, um die Gewässerqualität insgesamt zu verbessern und um<br />
gefährdeten Pflanzenarten (z.B. Krebsschere) weiteren Lebensraum zu erschließen.<br />
Das Sielsystem sichert die Lebensgrundlage des Menschen in der Wesermarsch. Um den Rückgang<br />
der Tiere und Pflanzen der Feuchtgebiete zu mindern, soll ein Modell geschaffen werden,<br />
das eine nachhaltiges, naturverträgliches und ökologisch sensibles Wassermanagement ermöglicht,<br />
ohne die Interessen von Landwirten und Flächeneignern zu beeinträchtigen.<br />
Das Projekt fördert die Kooperation zwischen regionalen Akteuren, kann in der gesamten Siellandschaft<br />
Wesermarsch realisiert werden und erfüllt mit seinem Beitrag zum Arten- und Biotopschutz<br />
die ökologische Dimension in besonderem Maße.<br />
� Der ökologische Zustand von Natur und Landschaft soll optimiert und das Naturerleben in<br />
der Siellandschaft Wesermarsch soll gefördert werden.<br />
� Erhaltung und Gestaltung von Natur und Landschaft mit ihren typischen Arten und Lebensräumen.<br />
� Erstellung eines Konzeptes zur ökologischen Qualitätsverbesserung von Sielgewässern<br />
� Modellhafte Umsetzung von Maßnahmen an einem Sielgewässer (z.B. Anlage von dauerhaft<br />
wasserführenden Nebengewässern)<br />
Projektträger Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverbände<br />
Projektpartner BUND, NABU, <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch FD 68, Angler Wesermarsch<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
10 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
Zeitplan 01.04.2008 <strong>–</strong> 15.12.2009<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
100.000 € 50 % Leader<br />
Ansprechpartner Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und<br />
Bodenverbände<br />
Leenert Cornelius<br />
Franz-Schubert-Str. 31<br />
26919 Brake<br />
50 % öffentliche Mittel (Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“, Wasser-<br />
und Bodenverbände)<br />
Telefon: 04401-92850<br />
Fax: 04401-26 87<br />
E-Mail: verwaltung@wabo-brake.de
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Naturerleben Jadebusen … Am Herzen der Natur!“<br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft<br />
Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+ 24-004<br />
Der Jadebusen ist ein herausragender Naturraum, der administrativ an drei Gebietskörperschaften<br />
angrenzt. Bisher wird der Jadebusen nicht ganzheitlich gesehen. Mit einem gemeinsamen<br />
Konzept und der Erstellung einer Informationskarte, einer Internetseite sowie<br />
einem Markierungssystem sollen die Unikatpunkte des Jadebusens sichtbar und erlebbar<br />
gemacht werden. Für eine nachhaltige Bildung und die stärkere Identifikation mit dem Jadebusen<br />
sollen sich Schüler der Region in Schulprojekten mit Themen zum Jadebusen gezielt<br />
auseinandersetzen. In diesen Prozess sollen zahlreiche Akteure eingebunden werden, von<br />
Fährschiffern, Busunternehmern, Touristikern, Übernachtungsanbietern, Natur- und Umweltakteuren<br />
bis hin zu Schulvertretern. Alle Projektmaßnahmen zielen darauf ab, den Jadebusen<br />
in die touristische Entwicklung mit buchbaren Angeboten erfolgreich einzubinden.<br />
Durch die Verzahnung von Tourismus, Natur und Kultur soll auf breiter Basis eine Sensibilisierung<br />
für die Besonderheiten der Region und die ganzheitliche Betrachtung eines zusammenhängenden<br />
Naturraumes erreicht werden. Durch die aktive Einbindung junger Menschen<br />
soll das Projekt nachhaltige Wirkungen erzielen. Die Nachhaltigkeit des Projektes<br />
wird zudem dadurch verdeutlicht, dass bereits junge Menschen (Schüler) die Möglichkeit<br />
erhalten, aktiv an der Projektgestaltung mitzuwirken.<br />
Das Projekt fördert die regionale und gebietsübergreifende Kooperation zwischen regionalen<br />
Akteuren, es vernetzt Ziele aus den Bereichen Natur- und Kulturerbe mit der touristischen<br />
Nutzung und erfüllt die soziale Dimension durch Einbindung von Jugendlichen in<br />
besonderem Maße. Es erweitert den LEADER+ Skulpturenpfad „Deichgeschichten“.<br />
� Der ökologische Zustand von Natur und Landschaft soll optimiert und das Naturerleben<br />
in der Siellandschaft Wesermarsch soll gefördert werden.<br />
� Ausbau von Angeboten zum Naturerleben.<br />
� Entwicklung eines Corporate Designs für den Naturraum Jadebusen.<br />
� Markierung von Unikatpunkten und Darstellung in einer Infokarte sowie im Internet.<br />
� Anschaffung eines Info-Mobils.<br />
� Konzipierung und Realisierung von Schülerprojekten zum Thema Jadebusen.<br />
Projektträger <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch, <strong>Landkreis</strong> Friesland, Stadt Varel<br />
Projektpartner LAG Nordseemarschen, RUZ Schortens, Nationalparkhaus Dangast, Tourismus Service<br />
Butjadingen GmbH & Co. KG<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
Zeitplan 01.03.2008 <strong>–</strong> 01.03.2010<br />
3 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
Ansprechpartner Geschäftsstelle „Wesermarsch in Bewegung“<br />
c/o Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH<br />
Poggenburger Str. 7<br />
26919 Brake<br />
150.000 € 50 % Leader (je 25 % LAG Nordseemarschen und LAG Wesermarsch<br />
in Bewegung)<br />
50 % LK Wesermarsch, Stadt Varel, Wattenmeerstiftung, evtl.<br />
weitere Stiftungen<br />
Telefon: 04401-996911<br />
Fax: 04401-996920<br />
E-Mail: mueller@wesermarsch.de<br />
53
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Tidefenster Siellandschaft <strong>Wesermarsch“</strong><br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft<br />
Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
54<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+<br />
Die Geländehöhe der Siellandschaft Wesermarsch liegt in weiten Teilen unter Normalnull. Nur<br />
durch den Schutz der Deiche ist die Wesermarsch bewohnbar. Um diese Tatsachen <strong>–</strong> auch im<br />
Binnenland <strong>–</strong> präsent zu machen, soll mit einem interaktiven, elektronischen Informationssystem<br />
der Blick für die Gezeiten und Wasserstände an zehn geomorphologisch wichtigen Orten<br />
(z.B. tiefster Punkt der Region unter NN, Vordeichbereich) der Siellandschaft geschärft werden.<br />
An diesen Orten werden Informationen zu Meeresspiegelhöhen, Gezeiten, Sturmfluten<br />
und zu den Auswirkungen des Klimawandels (Anstieg des Meeresspiegels) durch moderne<br />
akustische und optische Installationen kommuniziert. Das System wird mit dem touristischen<br />
Routenangebot vernetzt. Sowohl die einheimische Bevölkerung als auch Touristen werden für<br />
den Naturraum, den Küstenschutz und den Klimawandel sensibilisiert.<br />
Die Deiche ermöglichen Wirtschaften, Leben und die kulturelle Entwicklung in der Wesermarsch.<br />
Das Wissen um die Bedeutung der Deiche, der Deichsicherheit und der Aufgaben des<br />
Deichbandes soll gestärkt werden, die Folgen des bereits sichtbaren Klimawandels sollen ins<br />
Bewusstsein der Menschen gerückt werden, um eine nachhaltige und umweltgerechte Lebensweise<br />
fördern.<br />
Das Projekt vernetzt Ziele aus den Bereichen Naturerbe mit der touristischen Nutzung, es hat<br />
Innovations- und Modellcharakter und kann in der gesamten Siellandschaft Wesermarsch<br />
realisiert werden.<br />
� Der ökologische Zustand von Natur und Landschaft soll optimiert und das Naturerleben in<br />
der Siellandschaft Wesermarsch soll gefördert werden.<br />
� Förderung des Klimaschutzes.<br />
� Optimierung von Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Tourismus.<br />
� Ideenwettbewerb zur innovativen Umsetzung der Projektziele.<br />
� Realisierungskonzept mit Standortauswahl.<br />
� Installierung des elektronischen Informationssystems.<br />
Projektträger Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Wesermarsch<br />
Projektpartner Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Wesermarsch, <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch und<br />
Touristikgemeinschaft Wesermarsch<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
10 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
Zeitplan 01.03.2008 <strong>–</strong> 15.12.2009<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
100.000 € 50 % Leader<br />
Ansprechpartner Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und<br />
Bodenverbände<br />
Leenert Cornelius<br />
Franz-Schubert-Str. 31<br />
26919 Brake<br />
50 % öffentliche Mittel (Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“,<br />
Wasser- und Bodenverbände)<br />
Telefon: 04401-92850<br />
Fax: 04401-26 87<br />
E-Mail: verwaltung@wabo-brake.de
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Neben dem als Leitprojekt definierten Kooperationsprojekt „Jadebusen … Am Herzen der Natur“<br />
ist eine Kooperation mit dem Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer anvisiert. In<br />
der geplanten Entwicklungszone, die voraussichtlich Teile von vier küstennah gelegenen Kommunen<br />
umfassen wird, sollen Projekte im Rahmen des Biosphärenreservat-Projektes „Routen<br />
der Nachhaltigkeit“ verwirklicht werden (vgl. BIOSPHÄRENRESERVAT 2007). Zum gleichen Thema<br />
ist eine Kooperationsvereinbarung mit der LAG Wesermünde-Nord unterzeichnet.<br />
Aus der Arbeit der regionalen Akteure sind Projektideen hervorgegangen, die kurz- bis mittelfristig<br />
verwirklicht werden sollen:<br />
Beim Erhalt von typischen Arten und Lebensgemeinschaften sollen die Existenz von Kulturlandschaftselementen<br />
wie Kopfweiden und Pütten (Kleientnahmestellen) sowie ihre Ausgestaltung<br />
durch gezielte Pflege- und Entwicklungsprojekte umgesetzt werden. Angedacht sind ein Kopfweidenpflege-<br />
und -schutzprogramm sowie die Ausgestaltung von Pütten zu Fischrückzugslebensräumen<br />
und ihre Anbindung an touristisch genutzte Wege.<br />
Zum Ausbau von Naturerlebnissen sollen ein Schilflabyrinth und ein Birdwatching-Zentrum eingerichtet<br />
sowie ein interaktives Wiesenvogelsuchspiel realisiert werden. Weiterhin geplant sind<br />
Qualifizierungen von Naturerlebnisführern, ein Weißstorch-Informationszentrum und die Versorgung<br />
von Besuchern des Vogelbeobachtungspfades „Kiekpadd“ mit regionalen Lebensmitteln.<br />
Neben Projekten zur Sensibilisierung für den Klimawandel sollen auch Maßnahmen zur Eindämmung<br />
von Klimawirkungen umgesetzt werden. Dazu gehören investive Maßnahmen zum<br />
Klimaschutz im Zuge von Renovierungen baukulturell wertvoller Gebäude, Förderprojekte des<br />
ÖPNV zur Minderung des CO2-Ausstoßes, Anlage von Polderflächen (Wasserretentionsräume)<br />
sowie öffentlichkeitswirksame Informations- und Bildungsveranstaltungen der Küstengemeinden<br />
zur Klimawandelthematik.<br />
6.2.3 Handlungsfeld B: Dorfleben<br />
Handlungsfeld B Dorfleben<br />
Ziele Maßnahmen / Aktivitäten<br />
1. Steigerung der Attraktivität der<br />
Dörfer und der dörflichen Lebensqualität<br />
2. Ausweitung und Verbesserung<br />
von Grundversorgungseinrichtungen<br />
und -angeboten<br />
3. Erhalt und nachhaltige Nutzung<br />
historischer, orts- oder landschaftsprägender<br />
Gebäude<br />
a) Dörfliche Strukturen revitalisieren und die Aufenthaltsqualität<br />
dörflicher Treffpunkte attraktivieren.<br />
b) Regionaltypische, qualitativ hochwertige Gasthauskultur<br />
entwickeln und fördern.<br />
a) Versorgungseinrichtungen, -angebote, Infrastruktur und<br />
Mobilitätsangebote verbessern.<br />
a) Konzepte und Modellprojekte zur Nach- und Umnutzung<br />
historischer, orts- oder landschaftsprägender Gebäude entwickeln<br />
und umsetzen.<br />
Das soziale Entwicklungsziel (vgl. Kap. 6.1) wird durch Maßnahmen und Ziele des Handlungsfeldes<br />
B „Dorfleben“ erreicht. Mit dem Ziel, die Attraktivität der Dörfer und die dörfliche Lebensqualität<br />
zu steigern, sollen dörfliche Strukturen revitalisiert werden. Dies umfasst Maßnahmen<br />
zur Revitalisierung gewachsener, authentischer Dorfstrukturen, zur Schaffung attraktiver dörflicher<br />
Treffpunkte als Kristallisationspunkt sowie auch Bestrebungen, die sozialen Kontakte, die<br />
die zwischenmenschliche Kommunikation und damit die dörfliche Alltagskultur fördern. Eine<br />
bessere Aufenthaltsqualität und ein lebendiges Dorfleben sollen zudem durch die Schaffung<br />
55<br />
KOOPERATIONSPROJEKTE<br />
WEITERE PROJEKTIDEEN<br />
AKTIVITÄTEN,<br />
WIRKUNGEN,<br />
MASSNAHMENCODES
DORFERNEUERUNG<br />
ERGEBNISINDIKATOREN<br />
AKTIVITÄTEN,<br />
WIRKUNGEN,<br />
MASSNAHMENCODES<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
einer regionaltypischen und qualitativ hochwertigen Gasthauskultur unterstützt werden, die sich<br />
durch regionaltypisches Ambiente, regionale Produkte, die Wahrung überlieferter Traditionen<br />
(Sprachdialekte, Festivitäten) und Bezüge zum kulturellen Erbe auszeichnet.<br />
(Maßnahmencode: PROFIL 322).<br />
Einrichtungen und Angebote, die die Grundversorgung sicherstellen, müssen neu geschaffen<br />
bzw. verbessert werden. Dies betrifft insbesondere die soziale und technische Infrastruktur,<br />
ländliche Dienstleistungen sowie die Mobilität. Erst die hinlängliche Grundversorgung stellt eine<br />
ausreichende Lebensqualität <strong>–</strong> insbesondere für ältere, jugendliche oder mobilitätsbeeinträchtigte<br />
Menschen <strong>–</strong> im ländlichen Raum dar und ist die Grundvoraussetzung für die Sicherung der<br />
Einwohnerzahlen.<br />
(Maßnahmencode: PROFIL 321).<br />
Der Erhalt und die nachhaltige Nutzung von leerstehenden bzw. vom Leerstand bedrohten Gebäude<br />
verhindern die Schwächung dörflicher Strukturen. Die langfristige Nutzung historisch<br />
bedeutsamer, orts- oder landschaftsprägender Gebäude trägt zudem zur Wahrung des kulturellen<br />
Erbes sowie zur Attraktivierung von Dörfern und Siedlungen im ländlichen Raum bei. Maßnahmen<br />
zur Nachnutzung oder Umnutzung dieser Gebäude sollen ihren Erhalt langfristig sichern.<br />
(Maßnahmencodes: PROFIL 322, 323-D).<br />
In das Handlungsfeld B soll weiterhin die Dorferneuerung als strukturpolitische Maßnahme des<br />
Landes Niedersachsen zur Entwicklung von Dörfern als Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum<br />
integriert sein. Aus dem Beteiligungsprozess bei der Entwicklung des vorliegenden Regionalen<br />
Entwicklungskonzeptes ist hervorgegangen, dass sich lokale Initiativen, örtliche Vereine und die<br />
LAG „Wesermarsch in Bewegung“ aktiv und engagiert in die Dorferneuerungsplanung und<br />
-umsetzung einbringen möchten.<br />
Zur zukünftigen Überprüfung, ob die im Handlungsfeld B gesetzten Ziele erreicht wurden, dienen<br />
folgende Ergebnisindikatoren:<br />
� Absolute Bevölkerungszahl und Wanderungssaldo in den Kommunen,<br />
� Teilnehmerzahl an partizipativen Veranstaltungen (Zukunftskonferenz, Regionalworkshops),<br />
� Anzahl von teilnehmenden Dörfern bei Dorfwettbewerben („Unser Dorf hat Zukunft“).<br />
Neben den auf den Seiten 57 und 58 aufgeführten Leitprojekten sollen kurz-, mittel- und langfristig<br />
folgende Projektideen aus dem Bottom-up-Prozess umgesetzt werden:<br />
Zur Steigerung der Attraktivität der Dörfer und der dörflichen Lebensqualität sollen Dorfplätze<br />
<strong>–</strong> auch im Rahmen der Dorferneuerung <strong>–</strong> zu lebendigen Treffpunkten entwickelt werden, beispielsweise<br />
durch attraktives, kulturgeschichtlich authentisches Ambiente, Wetterschutz und<br />
kommunikationsfördernde Elemente wie Sitzgelegenheiten. Ein Erzählcafé soll in Form der Oral<br />
History die Dorfgeschichte durch Zeitzeugen lebendig halten und als Kristallisationspunkt für die<br />
Kommunikation zwischen unschiedlichen Generationen dienen. Das Thema „Regionale Gastlichkeit“<br />
soll durch Qualifizierungsveranstaltungen für Gastwirte aufgearbeitet werden, eine Zustandsanalyse<br />
und ein Wettbewerb zum Thema „Gasthauskultur <strong>Wesermarsch“</strong> sollen Kenntnis<br />
und Bewusstsein der regionalen Gasthauskultur fördern.<br />
Zur Verbesserung der Grundversorgung sollen Nahversorgungskonzepte entwickelt und Dorfladenprojekte<br />
verwirklicht werden, die außer Produkten auch Dienstleistungen für ältere Menschen<br />
anbieten. Angebote zur Kombination zwischen den Verkehrsmitteln Fahrrad und Kraftfahrzeug<br />
sollen die Mobilität im ländlichen Raum erhöhen. Ländliche Wege sollen revitalisiert<br />
oder zu multifunktionalen Wegen für eine möglichst breite Nutzergruppe ausgestaltet werden.<br />
56<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Dörfer der Siellandschaft mit Zukunft“<br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung des<br />
Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft<br />
Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
Projektträger Gemeinde Stadland<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+<br />
Es wird in fünf ausgewählten Dörfern der Siellandschaft (Berne, Ovelgönne, Schwei, Seefeld,<br />
Tossens) aktiv an Ansätzen zur Zukunftsfähigkeit der Dörfer gearbeitet. Durch professionelle<br />
Unterstützung (Moderation, inhaltliche Aufarbeitung), den regionalen Austausch und überregionale<br />
Exkursionen wird ein aktives Klima für eine zukunftsgerichtete Dorferneuerung geschaffen.<br />
In einem gemeinsamen Konzept werden die Vorarbeiten als Maßnahmen und Ansätze<br />
zusammengefasst und in weiteren Teilprojekten umgesetzt. Mit dem kooperativen Austausch<br />
zum Know-how-Transfer und zur Netzwerkbildung werden Identifikation und Kooperation<br />
sowie die Attraktivität und Lebensqualität in den Dörfern gestärkt.<br />
Das Thema Dorferneuerung wird in der Siellandschaft gestärkt, um mit neuen Ansätzen die<br />
Identität, die soziale Funktion und die wirtschaftliche Aktivität zu beleben. Dies sichert nachhaltig<br />
die Attraktivität vitaler Ortskerne und ist ein Treffpunkt für die lokale Bevölkerung sowie ein<br />
Anziehungspunkt für Naherholungssuchende und Touristen.<br />
Das Projekt fördert in hohem Maße die Kommunikation und Kooperation zwischen regionalen<br />
Akteuren und hat Innovationscharakter.<br />
� Die Lebensqualität des Dorflebens, die Wahrung des kulturellen Erbes und die Identifikation<br />
der Menschen mit der Siellandschaft Wesermarsch sollen verbessert werden.<br />
� Steigerung der Attraktivität der Dörfer und der dörflichen Lebensqualität für Einwohner und<br />
Gäste.<br />
� Dörflich Treffpunkte schaffen und erweitern.<br />
� Versorgungs- und Infrastruktur verbessern.<br />
Projektpartner Bürgervereine, Dorfgemeinschaften, AK „Unser Dorf hat Zukunft“<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
Zeitplan<br />
5 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
01.03.2008-15.12.2010<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
Ansprechpartner „Unser Dorf hat Zukunft“<br />
Regine Böseler<br />
Vareler Str. 2<br />
26936 Stadland<br />
250.000 € 50 % Leader<br />
50 % öffentliche Mittel (z.B. Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“,<br />
Kommunen)<br />
Telefon: 04737-920016<br />
Fax:<br />
E-Mail: regine@boeseler.de<br />
57
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Leerstandskataster Baukultur <strong>Wesermarsch“</strong><br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft<br />
Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
58<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+ 24-011<br />
Der landwirtschaftliche Strukturwandel führt in der Siellandschaft Wesermarsch unter anderem<br />
zu Leerständen landwirtschaftlicher und ortsbildprägender Gebäude und zu insgesamt niedrigen<br />
Immobilienpreisen. Daher soll ein Leerstandskataster zur Erfassung der baulichen Ressourcen<br />
angelegt werden, mit dem die im ländlichen Raum leerstehenden und mittelfristig von<br />
Leerstand bedrohten landwirtschaftlichen, ortsbildprägenden, denkmalwürdigen und denkmalgeschützten<br />
Gebäude auf Grundlage einer Kriterienliste ermittelt werden. Die Daten sollen in<br />
einer Datenbank gesammelt werden und über eine Internetseite abrufbar sein. Dabei sollen<br />
Zielgruppen wie Kommunen, Investoren und Hausbesitzer angesprochen und für die Vorteile<br />
einer Umnutzung historischer Gebäude gegenüber Neubauten sensibilisiert werden.<br />
Die im weitgehend intakten Landschaftsbild der Wesermarsch stehenden, ungenutzten ortsbildprägenden<br />
kaufgünstigen Immobilien stellen ein immenses Potenzial für die Siellandschaft<br />
Wesermarsch dar. Ihre Nutzung würde Rohstoffe schonen und den ländlichen Raum beleben.<br />
Weiterhin würde die Instandsetzung die regionale Baukultur erhalten, wodurch das Landschaftsbild<br />
aufgewertet wird. Somit trägt das Projekt zur sozialen, ökonomischen und ökologischen<br />
Weiterentwicklung der Siellandschaft Wesermarsch bei.<br />
Das Projekt hat als Pilotprojekt hohen Innovationscharakter und baut auf den Inhalten des<br />
LEADER+ Projektes „Baukultur <strong>Wesermarsch“</strong> auf. Darüber hinaus erfüllt es die ökologische<br />
Dimension in besonderem Maße durch Ressourcenschutz.<br />
� Die Lebensqualität des Dorflebens, die Wahrung des kulturellen Erbes und die Identifikation<br />
der Menschen mit der Siellandschaft Wesermarsch sollen verbessert werden.<br />
� Erhalt und nachhaltige Nutzung historischer, orts- oder landschaftsprägender Gebäude.<br />
� Förderung der regionaltypischen Baukultur.<br />
� Konzipierung und Umsetzung eines Leerstandskatasters.<br />
� Recherche geeigneter Gebäude und Einpflegen der Daten in die Datenbank.<br />
� Erstellung und Pflege eines Internetportals sowie Datenbankpflege.<br />
Projektträger <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch (Fachdienst Planen und Bauen)<br />
Projektpartner AK Baukultur, Obere Denkmalschutzbehörde<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
Zeitplan<br />
10 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
01.03.2008 <strong>–</strong> 15.06.2009<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
62.000 € 50 % Leader<br />
Ansprechpartner <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch, FD Planen und<br />
Bauen, Stephan Maaß<br />
Poggenburger Str. 15<br />
26919 Brake<br />
50 % Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“<br />
Telefon: 04401-927225<br />
Fax: 04401-3471<br />
E-Mail: stephan.maass@lkbra.de
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Dem Erhalt und der nachhaltigen Nutzung von Gebäuden, besonders solchen mit historischem,<br />
orts- oder landschaftsprägendem Charakter, soll die Einrichtung von Gäste- und Seminarhäuser<br />
dienen. Eine große Nachfrage besteht in der Wesermarsch nach Übernachtungsmöglichkeiten<br />
für Gruppen, so dass in unmittelbarer Nähe einer der überregionalen Radwege Gästehäuser mit<br />
einer ausreichenden Bettenzahl in regionaltypischer und kulturhistorisch authentischer Ausstattung<br />
geschaffen werden sollen. Auch gewerbliche Nutzungen (Büros, Ateliers, Werkstätten,<br />
Lagerräume) zur Nachnutzung für ehemals landwirtschaftliche Gebäude sollen gefördert werden,<br />
für Existenzgründer sollen Büro- und Officeräume für Bürogemeinschaften geschaffen<br />
werden. Eine leerstehende Gulfscheune soll mit Indoor-Freizeitangeboten für Kinder ausgerüstet<br />
werden, um das Schlechtwetterangebot für Touristen zu erweitern.<br />
Im Bereich der Dorferneuerung sind mehrere Dörfer mit hohem Handlungsdruck, ausreichenden<br />
dörflichen Potenzialen und aktiven Ortsvereinen genannt worden, in denen die Dorferneuerung<br />
vordringlich erscheint. Dazu gehören unter anderem: Blexen, Diekmannshausen, Golzwarden,<br />
Jade, Jaderaußendeich, Oberhammelwarden, Schmalenfleth, Schwei, Schweiburg, Seefeld,<br />
Stollhamm, Strückhausen und Tossens.<br />
6.2.4 Handlungsfeld C: Kultur<br />
Handlungsfeld C Kultur<br />
Ziele Maßnahmen / Aktivitäten<br />
1. Ausbau des Kulturangebotes a) Kulturgeschichte bewahren und erlebbar machen.<br />
2. Ausbau eines vernetzten Marketings<br />
für Kulturangebote<br />
3. Förderung der regionaltypischen<br />
Baukultur<br />
b) Museen und Museumsarbeit weiterentwickeln.<br />
a) Innovative, vernetzende Vermarktungsstrategien entwickeln<br />
und realisieren.<br />
b) Regionalkulturelle Veranstaltungen entwickeln, durchführen<br />
und vermarkten.<br />
a) Regionaltypische Baukultur, regionales Handwerk und regionale<br />
Baustoffe erhalten, entwickeln und fördern.<br />
Die Erreichung des sozialen Entwicklungszieles (vgl. Kap. 6.1) wird neben Maßnahmen und<br />
Zielen aus dem Handlungsfeld B „Dorfleben“ vor allem auch durch solche des Handlungsfeldes<br />
C „Kultur“ angestrebt.<br />
Der Ausbau des Kulturangebotes soll dadurch ausgestaltet werden, dass Kulturgeschichte<br />
durch die Bewahrung von Wissen gesichert und darüber hinaus erlebbar wird. Besonders die<br />
Arbeit von Museen kann durch anschauliche und spannende Vermittlung von Kultur- und Regionalgeschichte<br />
zur Wahrung des kulturellen Erbes und zur Identifikation der Menschen mit der<br />
Siellandschaft Wesermarsch beitragen.<br />
(Maßnahmencode: PROFIL 323-D)<br />
Durch den Ausbau eines vernetzten Marketings für bestehende und neue Kulturangebote sollen<br />
Synergien zwischen Kulturschaffenden und kulturellen Einrichtungen erzeugt werden. Wie die<br />
SWOT-Analyse gezeigt hat, sind qualitativ hochwertige Kulturangebote in der Siellandschaft<br />
Wesermarsch vorhanden, ihre regionale und überregionale Wahrnehmung ist jedoch begrenzt.<br />
Die Entwicklung und Durchführung regionalkultureller Veranstaltungen sollen dazu beitragen,<br />
durch moderne und traditionelle Kultur als Imageträger die Siellandschaft Wesermarsch als<br />
Region mit attraktiven Kulturangeboten zu vermarkten.<br />
(Maßnahmencodes: EFRE 3.6.4.3, 3.6.4.1)<br />
59<br />
DORFERNEUERUNG<br />
AKTIVITÄTEN,<br />
WIRKUNGEN,<br />
MASSNAHMENCODES
ERGEBNISINDIKATOREN<br />
LEITPROJEKTE<br />
WEITERE PROJEKTIDEEN<br />
KOOPERATIONSPROJEKTE<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Die regionaltypische Baukultur ist Teil des kulturellen Erbe, das Einflüsse aus Natur- und Kulturlandschaft,<br />
traditionellem handwerklichem Können und regionalen Produkten gesamtheitlich repräsentiert.<br />
Die regionale Baukultur selbst sowie das mit ihr verbundene regionale Handwerk<br />
und die benötigten traditionellen Baustoffe sollen durch Maßnahmen zu ihrer Erhaltung, Entwicklung<br />
und Förderung bewahrt werden.<br />
(Maßnahmencode: PROFIL 323-D)<br />
Als geeignete Ergebnisindikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung im Handlungsfeld C Kultur<br />
werden gesehen:<br />
� Besucherzahlen in Museen,<br />
� Regionale und überregionale Presseberichterstattung über Kulturveranstaltungen,<br />
� Einsatz regionaler Baustoffe (z.B. heimisches Reet) im Handwerk.<br />
Zusätzlich zu den auf S. 61 und 62 aufgeführten Leitprojekten sind aus der Prozessbegleitung<br />
von regionalen Akteuren weitere Aktivitäten und Projektideen genannt worden.<br />
Um die Kulturgeschichte der Siellandschaft Wesermarsch zu bewahren und um sie erlebbar zu<br />
machen soll die herausragende ingenieurtechnische Leistung des Sielsystems und seiner Bauten<br />
inwertgesetzt werden. Hier sollen interaktive Exponate wie Wasserspiele oder Entwässerungsmodelle<br />
die Bedeutung und physikalische Funktion erfahrbar werden lassen.<br />
Als neue Vermarktungsstrategie soll eine Kulturleitstelle als Informationszentrum für die Vermarktung<br />
und gegenseitige Abstimmung aller kulturellen Angebote eingerichtet werden, in der<br />
ein Kulturbotschafter als Imageträger für die Außendarstellung der Siellandschaft Wesermarsch<br />
eingesetzt wird. Die innovative Vermarktung soll auch durch vor-Ort-Marketing mit regionalkulturellen<br />
Veranstaltungen geschehen, diesbezüglich ist ein mobiles Wanderkino vorgesehen, das<br />
Filme in Scheunen landwirtschaftlicher Betriebe zeigt.<br />
Zur Förderung der regionaltypischen Baukultur sollen ein Leitfaden für Bauherren mit Informationen<br />
zu regionalen Baustoffen, Handwerkstechniken und baurechtlichen Leitlinien entwickelt<br />
werden. Zudem soll ein landschaftsprägendes Gebäude als Gästehaus mit kulturgeschichtlich<br />
authentischen Alkoven-Betten eingerichtet werden.<br />
Als Kooperationsprojekte im Bereich Kultur ergeben sich Schnittstellen zu der mit der LAG Wesermünde-Nord<br />
vereinbarten Entwicklung von Natur- und Kulturerlebniswegen für Fußgänger<br />
und Radfahrer.<br />
60<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „’Leuchttürme’“ der Siellandschaft Wesermarsch<br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft<br />
Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+<br />
Zum Sielsystem der Wesermarsch gehören mehrere Pumptürme, die als Schöpfwerke und<br />
Trafostationen dienten. Sie haben eine Grundfläche von 5 x 5 m und sind 10-15 m hoch. Da<br />
sie heute aufgrund fehlender Nutzung zusehends verfallen, will das Projekt „Leuchttürme<br />
Siellandschaft“ 10 Pumptürme in attraktiver, naturnaher Lage als Aussichtplattform nutzen<br />
und touristisch aufwerten. Hierfür müssen die Gebäudesubstanz saniert, die Türme ausgebaut<br />
und Beobachtungsplattformen installiert werden. Für die Öffentlichkeitsarbeit wird das Projekt<br />
durch interaktive Informationssysteme und einer Informationsbroschüre zum Be- und Entwässerungssystem<br />
der Siellandschaft Wesermarsch ergänzt. Mit dem Projekt sollen Anziehungspunkte<br />
innerhalb der Siellandschaft mit einem hohen touristischen Erlebnis- und Informationswert<br />
geschaffen werden.<br />
Ungenutzte Bestandteile des kulturtechnisch wertvollen Sielsystems werden erhalten, zum Teil<br />
handelt es sich bei den Pumptürmen um Bauten regionaltypischer Klinkerarchitektur. In der<br />
ebenen Landschaft gehören die Türme zu den wenigen Erhebungen, die eine hervorragende<br />
Aussicht über die weitere Umgebung ermöglichen. Die bestehende Radroute „Deutsche Sielroute“<br />
wird durch das Projekt aufgewertet.<br />
Das Projekt hat durch die Verbindung von Kultur und Tourismus sowie als interkommunales<br />
Projekt hohen Kooperations- und Vernetzungscharakter.<br />
� Die Lebensqualität des Dorflebens, die Wahrung des kulturellen Erbes und die Identifikation<br />
der Menschen mit der Siellandschaft Wesermarsch sollen verbessert werden.<br />
� Ausbau des Kulturangebotes.<br />
� Qualitätsverbesserung von Infrastruktur und Angeboten im Tourismus.<br />
� Abgestimmte Auswahl der Türme und Auflistung der Auswahl.<br />
� Konzepterstellung mit Maßnahmenliste sowie Auf- und Ausbau der Pumptürme.<br />
� Sanierung der Gebäude und Aufbau der Aussichtsplattform.<br />
� Konzipierung und Erstellung von Informationsmedien (inkl. Installation) und -broschüre.<br />
Projektträger Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverbände<br />
Projektpartner Touristikgemeinschaft Wesermarsch, Sielachtsverbände<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
Zeitplan<br />
10 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
01.03.2008 <strong>–</strong> 15.12.2009<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
Einmalige Kosten 200.000 € 50 % Leader<br />
Ansprechpartner Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und<br />
Bodenverbände,<br />
Kreisvorsitzender Leenert Cornelius<br />
Franz-Schubert-Str. 31<br />
26919 Brake<br />
50 % Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“<br />
Telefon: 04401-92850<br />
Fax: 04401-26 87<br />
E-Mail: verwaltung@wabo-brake.de<br />
61
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Padd up Padd“<br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft<br />
Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
Projektträger Gemeinde Ovelgönne<br />
62<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+<br />
Viele Touristen in der Siellandschaft Wesermarsch bevorzugen Freizeitaktivitäten wie Radfahren,<br />
Wandern, Spazierengehen und Reiten, die sie in der freien Landschaft ausüben können. Zwar<br />
durchzieht ein dichtes Netz verkehrsarmer Wege (Flurwege, Grüne Wege, Sielachtswege, historische<br />
Kirchwege) die Wesermarsch, doch ihr Zustand und die Wegeführung sind für die gewünschte<br />
Freizeitnutzung nicht durchweg geeignet. Weiterhin existiert eine starke Konkurrenz<br />
zwischen landwirtschaftlichem Verkehr und touristischer Wegenutzung.<br />
Eine Untersuchung der Wegeinfrastruktur mit Erfassung des Zustandes, der Besitzverhältnisse,<br />
des Untergrundes, der Streckenlängen, der geschichtlichen Bedeutung etc. soll als Grundlage für<br />
ein landkreisweites Konzept dienen, mit dem ein Optimierungskatalog zum Wegebau sowie zur<br />
nachhaltigen Wegenutzung erstellt werden soll. Anhand der Revitalisierung eines historischen<br />
Kirchweges sollen die Ergebnisse des Nutzungskonzeptes modellhaft umgesetzt werden.<br />
Die Wegestruktur in der Wesermarsch ist Ausdruck der Besiedelungsgeschichte des Menschen<br />
im Marschland und der daraus hervorgegangenen Landschaftskultur (Deichbau, Siedlungen,<br />
Landwirtschaft, Entwässerung). Mit dem Projekt wird das charakteristische Wegenetz einschließlich<br />
historischer Wegebeziehungen erhalten, touristisch erschlossen und für verschiedene Anspruchsgruppen<br />
konfliktarm nutzbar gemacht.<br />
Das Projekt hat Modellcharakter und berücksichtigt in besonderem Maße die soziale Dimension.<br />
� Die Lebensqualität des Dorflebens, die Wahrung des kulturellen Erbes und die Identifikation<br />
der Menschen mit der Siellandschaft Wesermarsch sollen verbessert werden.<br />
� Ausbau des Kulturangebots.<br />
� Qualitätsverbesserung von Infrastruktur und Angeboten im Tourismus.<br />
� Bestandsaufnahme (Kartierung) des Wegenetzes der Wesermarsch.<br />
� Entwicklung eines Optimierungskataloges und Nutzungskonzeptes.<br />
� Realisierung der Konzeption anhand eines modellhaften Teilprojektes (Kirchweg).<br />
Projektpartner Landvolk Wesermarsch, Touristikgemeinschaft Wesermarsch, Sielachten<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
10 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
Zeitplan 01.04.2008 <strong>–</strong> 15.12.2010<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
Ansprechpartner Gemeinde Ovelgönne<br />
Thomas Brückmann<br />
Rathausstr. 14<br />
26939 Ovelgönne<br />
150.000 € 50 % Leader<br />
50 % Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“<br />
Telefon: 044801-8224<br />
Fax: 04480-8232<br />
E-Mail: brueckmann@ovelgoenne.kdo.de
6.2.5 Handlungsfeld D: Regionale Produktion<br />
Handlungsfeld D Regionale Produktion<br />
Ziele Maßnahmen / Aktivitäten<br />
1. Entwicklung und Förderung neuer<br />
regionaler Produkte und<br />
Produktionszweige<br />
2. Optimierung der Anbieterstrukturen<br />
und der Vermarktung<br />
regionaler Produkte<br />
3. Verstärkung der Vernetzung<br />
zwischen regionalen Produkten<br />
und Tourismus<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
a) Neue Produkte regionaler Herkunft, Erzeugung und Verarbeitung<br />
entwickeln und vermarkten.<br />
a) Bedingungen für die Produktion regionaler Produkte verbessern<br />
und fördern.<br />
b) Strategien zur Vermarktung von regionalen Produkten entwickeln<br />
und fördern.<br />
a) Den Einsatz regionaler Produkte in Tourismuswirtschaft und<br />
Gastronomie fördern.<br />
Die Verwirklichung des ökonomischen Entwicklungszieles (vgl. Kap. 6.1) geschieht durch Maßnahmen<br />
und Ziele aus dem Handlungsfeld D „Regionale Produktion“. Dieses Handlungsfeld<br />
schließt die Bedingungen und Strukturen zur Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler<br />
Produkte sowie die Produkte selbst und ihre Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter mit ein.<br />
(Maßnahmencodes: PROFIL 311, 123)<br />
Zur Steigerung der Produktvielfalt sollen neue regionale Produkte entwickelt, bestehende regionale<br />
Produkte <strong>–</strong> insbesondere von Ochse und Lamm <strong>–</strong> sowie ihre Produktlinien und -zweige<br />
gefördert werden. Dabei stehen aufgrund ihrer Herkunft traditionelle, authentische und lebensmitteltechnisch<br />
sensible Produkte und Erzeugnisse im Vordergrund, ebenso die extensive und<br />
ökologisch nachhaltige Produktion. Die Förderung regionaler Produkte schließt ihre konkrete<br />
Vermarktung mit ein.<br />
(Maßnahmencode: PROFIL 311)<br />
Neben der Entwicklung von regionalen Produkten ist das Ziel, die Anbieterstrukturen und die<br />
Vermarktungswege zu optimieren. Explizit zu den Produktionsbedingungen in der von Grünlandwirtschaft<br />
geprägten Siellandschaft Wesermarsch gehören der landwirtschaftliche Wegebau<br />
und die Flurbereinigung, die die Grundlage aller örtlicher landwirtschaftlicher Produktions- und<br />
Bearbeitungsvorgänge darstellen. Es gilt gleichfalls, die Logistik zu optimieren, Wertschöpfungsketten<br />
und -partnerschaften zu identifizieren und zu etablieren. Die regionalen Produkte<br />
bedürfen zur Positionierung am lokalen und überregionalen Markt eines hohen Vermarktungs-<br />
und Werbeaufwands. Weiterhin zielführend ist, vermarktungsstrategisch effiziente Synergien zu<br />
schaffen und zu nutzen.<br />
(Maßnahmencodes: PROFIL 125-A, 125-B)<br />
Neben der Marktetablierung von regionalen Produkten für den identitätsstiftenden Alltagskonsum<br />
der Bevölkerung mit ihrer Region, sollen die heimischen Erzeugnisse gezielt im Tourismus<br />
ihren Platz finden. Dies trägt zur Intensivierung regionaler Wertschöpfung, zur überregionalen<br />
Imageförderung und Profilierung der Siellandschaft Wesermarsch bei. Vor allem die Gastronomie<br />
als Schnittstelle zwischen der Region und auswärtigen Gästen soll als Imageträger und<br />
Aushängeschild der Siellandschaft Wesermarsch dafür genutzt werden.<br />
(Maßnahmencodes: PROFIL 311, 313)<br />
63<br />
AKTIVITÄTEN,<br />
WIRKUNGEN,<br />
MASSNAHMENCODES
ERGEBNISINDIKATOREN<br />
LEITPROJEKTE<br />
WEITERE PROJEKTIDEEN<br />
KOOPERATIONSPROJEKT<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Ergebnisindikatoren, die sich zur Überprüfung der Zielerreichung im Handlungsfeld D Regionale<br />
Produktion eignen, sind:<br />
� Absatz regional erzeugter Lebensmittel,<br />
� Breite der Angebotspalette regionaler Produkte,<br />
� Anzahl der Partner in regionalen Wertschöpfungsketten.<br />
Die auf den Seiten 65 und 66 aufgeführten Leitprojekte ermöglichen die kurzfristige Umsetzung<br />
von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Handlungsfeldes „Regionale Produktion“.<br />
Weitere kurz-, mittel- und langfristig geplante Aktivitäten des Handlungsfeldes E Regionale Produktion<br />
sind folgende:<br />
Im Rahmen der Entwicklung und Förderung neuer regionaler Produkte und Produktionszweige<br />
sollen neben den bestehenden Ochsen- und Lammprodukten vor allem Fisch (Krabben, Weserstint),<br />
Imkerei-Erzeugnisse, Woll- und Webereiprodukte sowie Produkte regionalen Handwerks<br />
(z.B. Schilf) entwickelt, verarbeitet und vermarktet werden. Die regional erzeugte Milch soll an<br />
Milchtankstellen und über neue Veredelungsprodukte (z.B. „Wesermarsch-Eis“) an den Verbraucher<br />
gelangen. Die Herkunft und die Bedeutung von regionalen Produkten soll dem Verbraucher<br />
durch gezielte Informationskampagnen, Verkostungsveranstaltungen und Kochkurse nahe gebracht<br />
werden.<br />
Für die Optimierung der Anbieterstrukturen sind Markt-Umfeldanalysen, Netzwerkbildung und<br />
Qualifizierungsmaßnahmen für Erzeuger, Verarbeiter und Gastronomen vorgesehen. Projekte<br />
zur Etablierung regionaler Produkte am Markt beinhalten die Entwicklung regionaler Warenkörbe,<br />
die Einrichtung von Regionalregalen im Lebensmitteleinzelhandel und die Einbindung von<br />
touristischen Einrichtungen in die Regionalvermarktung. Ein Wesermarsch-Catering-Service mit<br />
mobilem Ochsengrill soll als kulinarischer Botschafter der Region die werbewirksame Schnittstelle<br />
zwischen angebotenen Produkten und Verbrauchern darstellen. Zur überregionalen Vermarktung<br />
soll ein Internet-Online-Shop als virtuelles Regionales Kaufhaus mit entsprechender<br />
Logistik im Hintergrund eingerichtet werden, über das alle Wesermarsch-Produkte bestellt werden<br />
können. Langfristig ist die Entwicklung einer Dachmarke für Produkte der Siellandschaft<br />
Wesermarsch geplant.<br />
Als Aktivitäten zur Verstärkung der Vernetzung zwischen Regionalen Produkten und Tourismus<br />
sollen in Gastronomieeinrichtungen regionaltypische Tellergerichte aus hochwertigen Lebensmitteln<br />
der heimischen Produktion angeboten werden, die als Regionalgerichte gekennzeichnet<br />
werden und für die entsprechende Informationsunterlagen über Herkunft und Bezugsquellen<br />
mitgegeben werden können. Auch in Übernachtungseinrichtungen und an touristischen Knotenpunkten<br />
sollen regionale Lebensmittel über Regionalregale oder regionale Lunchpakete angeboten<br />
werden.<br />
Im Rahmen einer Kooperation mit der LAG Wittelsbacher Land in Bayern werden Projekte zum<br />
Thema Vermarktung von Ochsenfleisch angestrebt.<br />
64<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Wesermarsch-Spezialitätenzentrum“<br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft<br />
Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
Projektträger proRegion e.V.<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+ 24-008<br />
Die als Regionalinitiative proRegion e.V. zusammengeschlossene Kooperation aus Landwirten,<br />
Fleischern und Gastronomen arbeitet daran, durch Erzeugung und Vermarktung regionaler Produkte<br />
die Wirtschafts- und Produktionskreisläufe in der Siellandschaft Wesermarsch nachhaltig zu<br />
sichern. Besonders Ochsen- und Lammfleisch als traditionelle Produkte der Grünlandwirtschaft<br />
konnten bisher erfolgreich am Markt positioniert werden. Ein „Dienstleistungszentrum Wesermarsch-Spezialitäten“<br />
soll an einem zentral gelegenen Ort aufgebaut werden, in dem regionale<br />
Produkte und Dienstleistungen gebündelt und in attraktivem Ambiente angeboten werden. Dazu<br />
soll eine ungenutzte Gulfscheune als Zeugnis regionaler Baukultur zu einem multifunktionalen<br />
Gebäude umgebaut werden, das als Logistikzentrum Lager- und Verkaufsräume für regionale<br />
Produkte enthält sowie Ausstellungs- und Seminarräume inklusive Schauküche für Informations-<br />
und Qualifizierungsveranstaltungen umfasst. Zudem sollen die Räumlichkeiten für ein Catering-<br />
Dienstleistungsangebot zur Verfügung stehen.<br />
Über die Verkaufs- und Lagerfunktion hinaus erfüllt das Spezialitätenzentrum eine wichtige Marketing-Aufgabe<br />
bei der öffentlichkeitswirksamen Darstellung der Bedeutung regionaler Produkte für<br />
die heimische Wirtschaft und Kultur. Besonderheiten der traditionellen regionalen Wirtschaftsweise<br />
und ihre Produkte können dargestellt, die Qualität der regionalen Dienstleistung verbessert sowie<br />
Einheimischen und Touristen die Spezialitäten der Wesermarsch authentisch präsentiert werden.<br />
Das Projekt hat Innovations-, Vernetzungs- und Kooperationscharakter. Die ökonomische Dimension<br />
ist in besonderem Maße erfüllt, das Projekt beruht zudem auf den Erfahrungen eines LEADER+<br />
Projektes zu regionalen Produkten.<br />
� Die Wertschöpfung von Produkten und Dienstleistungen der Siellandschaft Wesermarsch soll<br />
im Bereich von Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Tourismus gesteigert werden.<br />
� Optimierung der Anbieterstrukturen und der Vermarktung regionaler Produkte.<br />
� Verstärkung der Vernetzung zwischen regionalen Produkten und Tourismus.<br />
� Erwerb und Instandsetzung einer Gulfscheune als Dienstleistungszentrum.<br />
� Einrichtung des Gebäudes mit Lager-, Vertriebs-, Verkaufs- und Ausstellungsräumen sowie<br />
einer Schauküche.<br />
Projektpartner Kreislandvolk Wesermarsch, Fleischerinnung Wesermarsch, DEHOGA Wesermarsch, Kreishandwerkerschaft<br />
Wesermarsch<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
Zeitplan<br />
5 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
15.09.2008 <strong>–</strong> 15.05.2011<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
280.000 € 20 % Leader<br />
50 % Finanztopf Wesermarsch in Bewegung<br />
30% Stiftungen<br />
Ansprechpartner proRegion e.V., Gerfried Hülsmann<br />
Stadlander Platz 2<br />
26935 Rodenkirchen<br />
Tel.: 04732-92990<br />
Fax: 04732-929911<br />
E-Mail: info@hotel-huelsmann.de<br />
65
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Wesermarsch-Reet“<br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung<br />
des Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft<br />
Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
66<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+ 24-011<br />
Reetdächer sind ein typisches Element der regionalen Baukultur in der Siellandschaft Wesermarsch.<br />
Daher soll ein Konzept zum regionalen Anbau, zur Vermarktung und zur Nutzung heimischen<br />
Reets entwickelt werden. Der Anbau soll auf geeigneten fließgewässerbegleitenden Flächen<br />
(Siele, Weser) und auf Feuchtgrünland durchgeführt werden, bestenfalls in Kooperation von<br />
Landwirtschaft und Naturschutz. In Zusammenarbeit mit Reetschneidern, Reetdachdeckern und<br />
Architekten sollen die Erfordernisse an Qualität, Aufbereitung der Rohstoffe und Logistik ermittelt<br />
werden, so dass heimisches Reet mit guten Erfolgschancen am Markt positioniert werden kann.<br />
Durch Informationskampagnen sollen Vorbehalte gegenüber heimischem Reet (Qualität, Preis)<br />
ausgeräumt werden. Mit einer Programm-im-Programm-Förderung soll ein innovatives Instrument<br />
geschaffen werden, um für Besitzer landschaftsprägender Gebäude mit regionaltypischem<br />
Reetdach einen Anreiz zum Erhalt von Reetdächern durch Nutzung heimischen Reets zu geben.<br />
Getrocknetes Schilfrohr (Reet) wurde als regionaler Baustoff jahrhundertelang aus Feuchtgebieten<br />
der Wesermarsch geerntet. Der Anbau spielt heutzutage kaum noch eine Rolle, da zum<br />
einen marode Reetdächer aus Kostengründen gegen Hartbedachung ausgetauscht werden, und<br />
zum anderen Reet aus dem Ausland importiert wird. Die Wiederbelebung der Nutzung heimischen<br />
Reets stellt einen Betrag zur regionalen Wertschöpfung und zum Erhalt der Baukultur dar.<br />
Das Projekt fußt auf dem LEADER+ Projekt „Baukultur“, es hat für die Wesermarsch Innovationscharakter<br />
und vernetzt Handlungsfelder sowie Akteure. Das Projekt kann in der gesamten<br />
Wesermarsch durchgeführt werden.<br />
� Die Wertschöpfung von Produkten und Dienstleistungen der Siellandschaft Wesermarsch soll<br />
im Bereich von Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Tourismus gesteigert werden.<br />
� Förderung der regionaltypischen Baukultur.<br />
� Konzeptentwicklung für Anbau, Vermarktung und Nutzung heimischen Reets.<br />
� Auswahl von Schilfanbauflächen und Anbau von Schilf (Phragmitis australis).<br />
� Marktanalyse in Kooperation mit Reetschneidern, Reetdachdeckern, Architekten.<br />
� Öffentlichkeitsarbeit: Informationsabende, Internetpräsenz, Informationsflyer.<br />
� Programm-im-Programm-Fördererung für Hausbesitzer.<br />
Projektträger <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch (FD Bauen und Planen)<br />
Projektpartner Kreishandwerkerschaft Wesermarsch, Kreislandvolkverband Wesermarsch, NABU, Biosphärenreservat<br />
Niedersächsisches Wattenmeer, Wasser- und Bodenverbände, AK Baukultur<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
Zeitplan<br />
10 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
15.01.2008 <strong>–</strong> 15.12.2012<br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
Einmalige Kosten 160.000 € 50 % Leader<br />
Ansprechpartner <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch<br />
Maike Knöppler<br />
Poggenburger Str. 15<br />
26919 Brake<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
50 % öffentliche Mittel (z.B. Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“)<br />
Telefon: 04401-927393<br />
Fax: 04401-3471<br />
E-Mail: maike.knoeppler@lkbra.de
6.2.6 Handlungsfeld E: Tourismus<br />
Handlungsfeld E Tourismus<br />
Ziele Maßnahmen / Aktivitäten<br />
1. Qualitätsverbesserung von Infrastruktur<br />
und Angeboten im Tourismus<br />
2. Optimierung von Öffentlichkeitsarbeit<br />
und Marketing<br />
3. Stärkung und Ausweitung des<br />
wassergebundenen und maritimen<br />
Tourismus<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
a) Übernachtungsmöglichkeiten quantitativ ausbauen und<br />
qualitativ verbessern.<br />
b) Wegeinfrastruktur zur touristischen Nutzung erschließen,<br />
entwickeln und ausbauen.<br />
c) Be- und Ausschilderung im touristischen und kulturellen<br />
Bereich erweitern und verbessern.<br />
a) Strategien für eine gezielte Informationsverbreitung entwickeln.<br />
b) Tourismusakteure qualifizieren<br />
a) Angebote und Infrastruktur im Boots-, Schiffs- und Wassertourismus<br />
entwickeln, ausbauen und fördern.<br />
Als zweites Handlungsfeld, dessen Ziele und Maßnahmen in besonderem Maße zum Erreichen<br />
des ökonomischen Entwicklungszieles (vgl. Kap. 6.1) beitragen, dient das Handlungsfeld<br />
E Tourismus. Die Tourismuswirtschaft in der Siellandschaft Wesermarsch nutzt die Stärken des<br />
regionalen Natur- und Kulturerbes und stellt einen wichtigen wirtschaftlichen Sektor dar. Dennoch<br />
sind die Wertschöpfungsmöglichkeiten in der Tourismuswirtschaft nicht ausgeschöpft.<br />
Die Qualität von Infrastruktur und touristischen Angeboten soll sich erheblich verbessern. Wie<br />
aus der SWOT-Analyse hervorging, sind die beschränkten Übernachtungskapazitäten<br />
<strong>–</strong> besonders im qualitativ höherwertigen Bereich <strong>–</strong> ursächlich für die Abwanderung von Gästen<br />
in benachbarte Regionen. Daher sind die Übernachtungsmöglichkeiten in der Siellandschaft<br />
Wesermarsch in Anzahl und Qualitätsstandard zu steigern. Um weiteres Potenzial ausschöpfen<br />
zu können, soll die bisher schlechte Wegestruktur verbessert werden. Gerade landwirtschaftliche<br />
Wege werden von Touristen als Sekundärnutzer zum Wandern, Fahrradfahren oder Reiten<br />
gern genutzt. Aufgrund des schlechten Wegezustandes, fehlender Wegeverbindungen und der<br />
Konkurrenz zur landwirtschaftlichen Nutzung besteht hier starker Handlungsbedarf. Zudem ist<br />
die Hinführung von Gästen zu touristisch und kulturell relevanten Einrichtungen und Angeboten<br />
durch Schilder die Grundlage für Orientierung und Lenkung der Besucher. Sie soll ebenfalls<br />
durch Projekte verdichtet werden.<br />
(Maßnahmencodes: PROFIL 313, 125-B; EFRE 3.6.4.1)<br />
Zur Optimierung von Öffentlichkeitsarbeit und Marketing aus überbetrieblicher, ganzheitlicher<br />
Sicht werden Strategien für eine gezielte Informationsverbreitung zum touristischen Profil und zu<br />
Tourismusangeboten benötigt, sowohl regionsintern als auch überregional. Ein weiterer wichtiger<br />
Faktor, der der Verbesserung von Öffentlichkeits- und Marketingarbeit sowie des Binnenmarketings<br />
dient und der zur Qualitätssteigerung der touristischen Angebote in der Wesermarsch<br />
beiträgt, ist die Qualifizierung von Tourismusakteuren, insbesondere in den Bereichen<br />
Service, Marketing und Kommunikation.<br />
(Maßnahmencode: EFRE 3.6.4.1)<br />
67<br />
AKTIVITÄTEN,<br />
WIRKUNGEN,<br />
MASSNAHMENCODES
ERGEBNISINDIKATOREN<br />
LEITPROJEKTE<br />
WEITERE PROJEKTIDEEN<br />
KOOPERATIONSPROJEKTE<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Der charakteristische maritime Charme der Siellandschaft Wesermarsch sowie binnenländische<br />
Gewässer sind bisher nicht ausreichend touristisch erschlossen. Daher soll der wassergebundene<br />
und maritime Tourismus gestärkt und ausgeweitet werden. Diesbezüglich sind Angebote<br />
und Infrastruktur im Boots-, Schiffs- und Wassertourismus neu zu entwickeln, auszubauen und<br />
zu fördern.<br />
(Maßnahmencodes: PROFIL 313, EFRE 3.6.4.1)<br />
Als geeignete Ergebnisindikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung im Handlungsfeld E Tourismus<br />
sind ausgewählt:<br />
� Anzahl der Übernachtungsgäste,<br />
� Außenimage der Siellandschaft Wesermarsch (Wiederholung der Image-Analyse),<br />
� Anzahl von touristischen Angeboten mit Bezug zu Gewässern.<br />
Auf den Seiten 69 und 70 sind zwei Leitprojekte aufgeführt, mit deren Umsetzung kurzfristig<br />
begonnen werden kann. Weiterhin sind aus dem Partizipationsprozess mit regionalen<br />
Aktereuren kurz-, mittel- und langfristig umzusetzende Projektideen entstanden.<br />
Zur quantitativen und qualitativen Verbesserung der touristischen Übernachtungsmöglichkeiten<br />
sollen Gruppenunterkünfte für je mindestens 30 Gäste geschaffen werden, wobei ein gehobener<br />
Standard in Form eines Landhotels sowie ein einfacher Standard als Unterkunftsmöglichkeit für<br />
Fahrradfahrgruppen angedacht sind. Private Fremdenzimmer und Ferienwohnungen sollen zu<br />
„Wesermarsch-Zimmern“ mit landschaftstypischer Einrichtung ausgebaut werden. Weiterhin soll<br />
eine Konzeptionierung für ein einheitliches, eingängiges, erweiterbares und nicht landschaftsbeeinträchtigendes<br />
Ausschilderungssystem im Corporate Design für Sehenswürdigkeiten, Besonderheiten<br />
der Natur- und Kulturlandschaft sowie für Übernachtungsmöglichkeiten in der gesamten<br />
Siellandschaft Wesermarsch erstellt werden.<br />
Zur Optimierung des Marketings soll eine Internetplattform mit Bereichen zur interaktiven Erkundung<br />
der Siellandschaft Wesermarsch sowie mit einem Informations- und Reservierungssystem<br />
eingerichtet werden. Zur Qualifizierung von Tourismusakteuren dient unter anderem die Ausbildung<br />
von Naturerlebnis-Rangern, die durch ökologisches Fachwissen gepaart mit didaktischen<br />
und rhetorischen Kompetenzen ein innovatives, individuelles Naturerleben für Touristen sicherstellen<br />
können.<br />
Für die Stärkung und Ausweitung des wassergebundenen, maritimen Tourismus sollen die Binnengewässer<br />
über Hydrobikes touristisch erschlossen werden, Flussanlegestellen für Boote<br />
eingerichtet und Strandbäder aufgewertet werden. Bei mittel- und längerfristig umzusetzenden<br />
Aktivitäten werden die Erfordernisse aus dem Tourismuskonzept Unterweser (WIRTSCHAFTS-<br />
FÖRDERUNG WESERMARSCH GMBH 2002) berücksichtigt.<br />
Neben dem auf S. 70 aufgeführten kooperativen Leitprojekt „Flussplätze an der Weser“ soll auf<br />
die in LEADER+ begonnene Machbarkeitsstudie „Old Skipper Towns“ zur nachhaltigen touristischen<br />
Nutzung kleiner Küstenorte an der Nordseeküste zwischen den Niederlanden und der<br />
Wesermündung angeknüpft werden.<br />
68<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Radroute ‚Siellandschaftsystem erleben’“<br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung des<br />
Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
Projektträger Gemeinde Ovelgönne<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+<br />
Das 20.000 km umfassende Sielsystem mit Sielzügen, -türmen und -toren zur Zu- und Entwässerung<br />
der Marschländereien ist eine herausragende kulturtechnische Errungenschaft in<br />
der Wesermarsch, die Leben und Wirtschaften in dieser Region ermöglicht. Touristen sollen<br />
einen Einblick in die Funktion und den Ablauf des Sielsystems erhalten und dessen Bedeutung<br />
für die Kulturlandschaft erfahren. Modellhaft ist hierbei die konzeptionelle Entwicklung einer<br />
Fahrradroute zwischen 50 <strong>–</strong> 100 km, anhand derer ein ganzer Sielzug und seine Funktionsweise<br />
von der Grüppe im Binnenland bis zum Schöpfwerk der Weg des Wassers erläutert<br />
wird. Die Umsetzung erfolgt mit modernen interaktiven Medien (Audioguide, Audio on demand,<br />
iPod etc.), die eine flexible, individuelle Nutzung der Radroute ermöglichen und die über die<br />
klassische Zielgruppe der Radtouristen hinaus auch ein junges Publikum ansprechen.<br />
Sielsystem und Wassermanagement stellen die Lebensgrundlage der Siellandschaft Wesermarsch<br />
dar. Das Projekt soll <strong>–</strong> insbesondere junge <strong>–</strong> Einheimische und Gäste der Region auf<br />
innovative Art und Weise für die Bedeutung des Sielsystems sensibilisieren und die Zusammenhänge<br />
zwischen kulturtechnischer Leistung, Lebens- und Wirtschaftsweise im Naturraum<br />
der Marschen aufzeigen.<br />
Das Projekt zeichnet sich durch seinen Innovationscharakter, seine Vernetzungsmöglichkeiten<br />
und seine Kooperationsdimensionen aus.<br />
� Die Lebensqualität des Dorflebens, die Wahrung des kulturellen Erbes und die Identifikation<br />
der Menschen mit der Siellandschaft Wesermarsch sollen verbessert werden.<br />
� Qualitätsverbesserung von Infrastruktur und Angeboten im Tourismus.<br />
� Optimierung von Öffentlichkeitsarbeit und Marketing im Tourismus.<br />
� Konzipierung einer Radroute entlang eines Sielzuges<br />
� Entwicklung und Realisierung von Informationsmaterial (Text, Bild, Musik) für moderne<br />
didaktische Materialien<br />
� Entwicklung von informativem Begleitmaterial als Print- und Internetmedien<br />
Projektpartner Touristikgemeinschaft Wesermarsch, Wasser- und Bodenverbände Wesermarsch<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
Zeitplan<br />
10 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
01.03.2008 <strong>–</strong> 15.12.2009<br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
Einmalige Kosten 80.000 € 50 % Leader<br />
Ansprechpartner Gemeinde Ovelgönne<br />
Thomas Brückmann<br />
Rathausstr. 14<br />
26939 Ovelgönne<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne<strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
50 % Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“, Wasser- und Bodenverbände<br />
Tel.: 04480-8224<br />
Fax: 04480-8232<br />
E-Mail: brueckmann@ovelgoenne.kdo.de<br />
69
� 6 � ENTWICKLUNGSSTRATEGIE<br />
Projektsteckbrief Leitprojekt „Flussplätze an der Weser“<br />
Handlungsfelder A Natur<br />
B Dorfleben<br />
C Kultur<br />
Kurzbeschreibung des<br />
Projektes<br />
Bedeutung für die<br />
Siellandschaft Wesermarsch<br />
Zielbezug<br />
Arbeitsschritte<br />
Projektträger <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch<br />
70<br />
D Regionale Produktion<br />
E Tourismus<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
Kooperationsprojekt<br />
Aufbauprojekt zu<br />
LEADER+<br />
Die natürliche und kulturelle Entwicklung der Weser vom Oberlauf bis zur Mündung wird<br />
unter dem Motto „Flussplätze im Wandel“ an ausgewählten Punkten dargestellt. In der<br />
Leader-Region VoglerRegion und in der Siellandschaft Wesermarsch werden entlang des<br />
Weser-Radwegs an ausgewählten Stationen die thematischen Rahmenthemen „Wandel<br />
der Flusslandschaft vom Ober- und Unterlauf“ (Naturaspekt) und „Kultur und Siedlung im<br />
Wandel“ (Kulturaspekt) aufgearbeitet und an den Flussstationen erlebbar gemacht. Die<br />
Flussstationen bestehen aus Informationstafeln, Hütten, Sitzgelegenheiten und Sichtstelen.<br />
Das touristische Potenzial des Weser-Radwegs wird mit dem Ansatz des Natur- und<br />
Kulturerlebens weiter ausgeschöpft.<br />
Die Weser ist einer der großen Flüsse in Deutschland und hat eine enorme Bedeutung für<br />
die Regionen längs des Flusses. Mit dem Kooperationsprojekt werden die natürlichen und<br />
kulturellen Zusammenhänge von Regionen der Weserlandschaft aufgearbeitet und dargestellt.<br />
Die verbindenden Elemente wie Schifffahrt und Flussfischerei entfernt liegender<br />
Regionen werden sicht- und erlebbar.<br />
Das Projekt eignet sich als gebietsübergreifendes Kooperationsprojekt mit Innovationscharakter<br />
in hohem Maße als Leitprojekt.<br />
� Der ökologische Zustand von Natur und Landschaft soll optimiert und das Naturerleben<br />
in der Siellandschaft Wesermarsch soll gefördert werden.<br />
� Stärkung und Ausweitung des wassergebundenen und maritimen Tourismus.<br />
� Konzeption und Ausbau von Angeboten an 20 Flussstationen zur Steigerung des<br />
Naturerlebens.<br />
� Aufbau von 20 Infopunkten mit Schutzhütten, Sitzgelegenheiten und Sichtstelen.<br />
Projektpartner VoglerRegion, <strong>Landkreis</strong> Verden, Touristikgemeinschaft Wesermarsch, beteiligte Gemeinden<br />
an Unter- und Mittelweser<br />
Beteiligte Gebietskörperschaften<br />
Zeitplan 01.03.2008 <strong>–</strong> 15.12.2009<br />
6 von 10 Möglichen: <strong>–</strong> Berne <strong>–</strong> Butjadingen <strong>–</strong> Brake <strong>–</strong> Elsfleth <strong>–</strong> Jade <strong>–</strong> Lemwerder <strong>–</strong><br />
Projektkosten Betrag in Euro Finanzierungsanteile<br />
Einmalige Kosten 100.000 € 50 % Leader<br />
Ansprechpartner Stadt Elsfleth<br />
Wolfgang Böner<br />
Rathausplatz 1<br />
26931 Elsfleth<br />
<strong>–</strong> Ovelgönne <strong>–</strong> Stadland <strong>–</strong> Nordenham <strong>–</strong> <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch <strong>–</strong><br />
50 % z.B. Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“<br />
Tel.: 04404-50420<br />
Fax: 04401-50439<br />
E-Mail: boener@elsfleth.de
7<br />
FINANZIERUNGSKONZEPT<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
� 7 � FINANZIERUNGSKONZEPT<br />
Für den Zeitraum zwischen 2008 und 2013 wird für die Umsetzung von Projekten und Aktivitäten<br />
aus dem vorliegenden Regionalen Entwicklungskonzept ein Finanzierungskonzept inklusive<br />
indikativem Finanzplan vorgelegt, dem die potenzielle Zuwendung von rund zwei Millionen Euro<br />
Finanzmitteln aus dem Leader-Förderprogramm zugrunde liegt und welcher ein Gesamtvolumen<br />
von rund vier Millionen Euro umfasst.<br />
In der LEADER+ Förderphase 2000-2006 richteten die Gebietskörperschaften der Wesermarsch<br />
einen gemeinsamen, paritätisch gefüllten Finanztopf als flexibles, innovatives Instrument zur<br />
Finanzierung für gemeindeübegreifende Kooperationsprojekte ein. Dieses bewährte Finanzierungsmodell<br />
wird auch in Zukunft beibehalten. In einer Beschlussfassungserklärung haben sich<br />
alle zehn Gebietskörperschaften dazu verpflichtet, den Prozess für die nachhaltige Entwicklung<br />
der Siellandschaft Wesermarsch mit je 100.000 Euro für den Zeitraum von 2007 bis 2013 finanziell<br />
abzusichern. Insgesamt stehen mit dem Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“ für die<br />
nächsten sechs Jahre somit eine Million Euro zur Kofinanzierung von Fördergeldern bereit.<br />
Mehr als eine weitere Millionen Euro wird über einzelne Kommunen, regionale Organisationen,<br />
Vereine und Verbände sowie über Stiftungsgelder sichergestellt. Der LAG „Wesermarsch in<br />
Bewegung“ ist es bereits in dem vergangenen, für sie verkürzten Förderzeitraum von 2003 bis<br />
2006 gelungen, die Kofinanzierung von 2.055.000 Euro EU-Fördermitteln zu realisieren. Erstmalig<br />
wird für den Zeitraum nach 2007 der Einsatz privater Mittel anvisiert. Damit sollen mehr Akteure<br />
im Leader-Aktionsgebiet erreicht werden sowie unternehmerische Projektansätze modellhaft<br />
umgesetzt werden können.<br />
Die bei der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH angesiedelte Geschäftsstelle „Wesermarsch<br />
in Bewegung“ nutzt die im Hause vorhandene Kompetenz hinsichtlich der effizienten<br />
und optimierten Verwendung verfügbarer Finanzmittel. Die Wirtschaftsförderung Wesermarsch<br />
GmbH verfolgt das Prinzip der kohärenten Projektbetrachtung. Daher besteht hier die Möglichkeit,<br />
über einen Fördernavigator als dialogorientiertes Steuerungssystem zur Abprüfung von<br />
Förderinstrumenten die Finanzierung von Projekten, die zwar den Zielen des vorliegenden Regionalen<br />
Entwicklungskonzeptes dienen, die aber nicht nach Leader-konformen Richtlinien förderfähig<br />
sind, über andere Finanzierungstöpfe zu realisieren. So kann die ganzheitliche, nachhaltige<br />
Entwicklung der Siellandschaft Wesermarsch über den Förderrichtlinienrahmen hinaus<br />
gewährleistet und eine Doppelförderung durch den systematischen Abgleich mittels des Fördernavigators<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Die Siellandschaft Wesermarsch wird als ländliche Region im Schwerpunkt auf den angebotenen<br />
Maßnahmenpool aus dem niedersächsischen Programm PROFIL auf Grundlage des Europäischen<br />
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mit den Maßnahmen-Codes<br />
411-413, 421 und 431 zurückgreifen. Weiterhin wird aus dem Europäischen<br />
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) das Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und<br />
Beschäftigung“ des Landes Niedersachsen genutzt. In diesem Zusammenhang ist auch die<br />
Fördermöglichkeit „Naturerleben und Nachhaltige Entwicklung“ in besonderem Maße für das<br />
Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer als Finanzierungsbaustein zu nennen.<br />
Punktuell soll auf die Fördermöglichkeiten des Europäischen Sozialfonds (ESF) zurückgegriffen<br />
werden. Für die gewerblichen Fischereistandorte der Niedersächsischen Nordseeküste wird<br />
eine Förderung gemäß der Prioritätsachse 4 des Europäischen Fischereifonds (EFF) in Betracht<br />
gezogen.<br />
71<br />
SICHERSTELLUNG DER<br />
KOFINANZIERUNG<br />
DRITTMITTEL<br />
FINANZIERUNGS-<br />
INSTRUMENTE<br />
STRUKTURFONDS
INDIKATIVER FINANZPLAN<br />
KOOPERATIONSPROJEKTE<br />
� 7 � FINANZIERUNGSKONZEPT<br />
Der in den Tabellen 7.1 und 7.2 dargelegte indikative Finanzplan schlüsselt Finanzmittel in Höhe<br />
von rund vier Millionen Euro sowohl nach den einzelnen Jahren der Leader-Förderlaufzeit 2007-<br />
2013 als auch nach Handlungsfeldern auf.<br />
Unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus LEADER+ werden die Mittel ab Beginn des<br />
Jahres 2008 ansteigend eingeplant und erreichen ihren Höchststand im Jahr 2011. Sie nehmen<br />
dann kontinuierlich bis zum Ende der Leader-Förderperiode im Jahr 2013 ab.<br />
Inhaltlich richtet sich der indikative Finanzplan an der Entwicklungsstrategie des vorliegenden<br />
regionalen Entwicklungskonzeptes aus. Statt einer gleichgewichteten Splittung des Finanzvolumens<br />
in sechs Teile (fünf Handlungsfelder + Regionalmanagement) erfolgt die Mittelverteilung<br />
nach folgender Gewichtung (gerundet), die sich aus den Schwerpunktsetzungen der LAG auf<br />
Basis der LEADER+ Evaluierung ergibt.<br />
Tabelle 7.1: Mittelaufteilung des Finanzvolumens auf die Handlungsfelder (absteigend sortiert).<br />
72<br />
Anteil Handlungsfeld<br />
25 % Handlungsfeld A Natur<br />
Aufgrund der Evaluationsergebnisse aus LEADER+ (vgl. Kap. 4.7.1 sowie Anhang) und<br />
des Leitthemas (vgl. Kap. 6.1) liegt der Schwerpunkt des Mitteleinsatzes im Handlungsfeld<br />
Natur.<br />
20 % Handlungsfeld E Tourismus<br />
Aufgrund seiner Schnittstellenfunktion zu anderen Handlungsfeldern wird diesem Handlungsfeld<br />
der zweithöchste Mitteleinsatz zugebilligt.<br />
18 % Regionalmanagement<br />
Um die Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes professionell zu koordinieren<br />
und sicherzustellen soll das Regionalmanagement als Team aus zwei Personen die regionalen<br />
Akteure begleiten.<br />
15 % Handlungsfeld C Kultur<br />
Aufgrund der Evaluationsergebnisse aus LEADER+ (vgl. Kap. 4.7.1 sowie Anhang) und des<br />
Leitthemas (vgl. Kap. 6.1) wird das Handlungsfeld Kultur mit einem mittleren Finanzvolumen<br />
bedacht.<br />
12 % Handlungsfeld D Regionale Produktion<br />
Dem Bereich Regionale Produktion ist aufgrund der LEADER+ Evaluierungsergebnisse (vgl.<br />
Anhang) ein leicht unterdurchschnittlicher Mitteleinsatz zugeschrieben.<br />
10 % Handlungsfeld B Dorfleben<br />
Als neues Handlungsfeld sind hier keine Erfahrungen in der Projektumsetzung vorhanden.<br />
Daher wird diesem Handlungsfeld zunächst ein geringerer Mitteleinsatz zugeteilt.<br />
Da Kooperationen in der Entwicklungsstrategie für die Siellandschaft Wesermarsch eine besondere<br />
Bedeutung zukommt (vgl. Kap. 6.1.4) werden gebietsübergreifende Kooperationsprojekte,<br />
die thematisch in die fünf Handlungsfelder A-E integriert sind, mit 645.000 € belegt (vgl. Tab 7.1,<br />
Maßnahmencode 421), was einer Mittelausstattung von mehr als 14 % entspricht.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 7 � FINANZIERUNGSKONZEPT<br />
Tab. 7.2: Indikativer Finanzplan der LAG Wesermarsch in Bewegung. Aufteilung nach Jahren.<br />
öffentliche Aufwendungen<br />
nationale Aufwendungen<br />
Beteiligung kommunale sonst. öffentl. Private Aufwen-<br />
Jahre Gesamtkosten Gesamt<br />
ELER<br />
Mittel<br />
Mittel<br />
dungen<br />
1 2=3+7 3=6+5+4 4 5 6 7<br />
Maßnahme 41 (411-413) 2007 - € - € - € - € - € - €<br />
2008 120.000 € 120.000 € 60.000 € 48.000 € 12.000 € - €<br />
2009 526.000 € 486.000 € 243.000 € 194.400 € 48.600 € 40.000 €<br />
2010 570.000 € 510.000 € 255.000 € 204.000 € 51.000 € 60.000 €<br />
2011 650.000 € 570.000 € 285.000 € 228.000 € 57.000 € 80.000 €<br />
2012 625.000 € 530.000 € 265.000 € 212.000 € 53.000 € 95.000 €<br />
2013 552.000 € 492.000 € 246.000 € 196.800 € 49.200 € 60.000 €<br />
Total 3.043.000 € 2.708.000 € 1.354.000 € 1.083.200 € 270.800 € 335.000 €<br />
Maßnahme 421 2007 - € - € - € - € - € - €<br />
2008 30.000 € 30.000 € 15.000 € 12.000 € 3.000 € - €<br />
2009 130.000 € 120.000 € 60.000 € 48.000 € 12.000 € 10.000 €<br />
2010 149.000 € 124.000 € 62.000 € 49.600 € 12.400 € 25.000 €<br />
2011 164.000 € 134.000 € 67.000 € 53.600 € 13.400 € 30.000 €<br />
2012 115.000 € 110.000 € 55.000 € 44.000 € 11.000 € 5.000 €<br />
2013 54.000 € 54.000 € 27.000 € 21.600 € 5.400 € - €<br />
Total 642.000 € 572.000 € 286.000 € 228.800 € 57.200 € 70.000 €<br />
Maßnahme 431<br />
Regionalmanagement 2007 - € - € - € - € - € - €<br />
2008 100.000 € 100.000 € 55.000 € 45.000 € - € - €<br />
2009 100.000 € 100.000 € 55.000 € 45.000 € - € - €<br />
2010 100.000 € 100.000 € 55.000 € 45.000 € - € - €<br />
2011 100.000 € 100.000 € 55.000 € 45.000 € - € - €<br />
2012 100.000 € 100.000 € 55.000 € 45.000 € - € - €<br />
2013 100.000 € 100.000 € 55.000 € 45.000 € - € - €<br />
sonst. Projekte 2007 - € - € - € - € - € - €<br />
2008 5.455 € 5.455 € 3.000 € 2.455 € - € - €<br />
2009 7.273 € 7.273 € 4.000 € 3.273 € - € - €<br />
2010 12.727 € 12.727 € 7.000 € 5.727 € - € - €<br />
2011 7.273 € 7.273 € 4.000 € 3.273 € - € - €<br />
2012 7.273 € 7.273 € 4.000 € 3.273 € - € - €<br />
2013 14.545 € 14.545 € 8.000 € 6.545 € - € - €<br />
Total 654.545 € 654.545 € 360.000 € 294.545 € - € - €<br />
Gesamt 4.339.545 € 3.934.545 € 2.000.000 € 1.606.545 € 328.000 € 405.000 €<br />
73<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 7 � FINANZIERUNGSKONZEPT<br />
Tab. 7.3: Indikativer Finanzplan der LAG Wesermarsch in Bewegung. Aufteilung nach Handlungsfeldern für die gesamte Laufzeit.<br />
geplante Finanzierung<br />
private Mittel<br />
sonstige<br />
öffentl. Mittel<br />
kommunale<br />
Mittel<br />
Beteiligung<br />
ELER<br />
öffentliche Aufwendungen<br />
Gesamtkosten<br />
Maßnahmecode (ELER) oder<br />
ggf. Zuordnung zu Strukturfonds<br />
Handlungsfelder<br />
1 2 3=4+8 4=5+6+7 5 6 7 8<br />
ELER Code: 323-A, 323-B,<br />
323-C, 421; EFRE: 3.6.5.1<br />
1.000.000 € 1.000.000 € 500.000 € 400.000 € 100.000 € - €<br />
Handlungsfeld<br />
A Natur<br />
ELER Code: 321, 322<br />
400.000 € 400.000 € 200.000 € 160.000 € 40.000 € - €<br />
Handlungsfeld<br />
B Dorfleben<br />
ELER Code: 323-D, 421<br />
810.000 € 600.000 € 300.000 € 240.000 € 60.000 € 210.000 €<br />
Handlungsfeld<br />
C Kultur<br />
EFRE: 3.6.4.3<br />
545.000 € 480.000 € 240.000 € 192.000 € 48.000 € 65.000 €<br />
Handlungsfeld<br />
D Regionale Produktion<br />
ELER Code: 311, 331, 421<br />
930.000 € 800.000 € 400.000 € 320.000 € 80.000 € 130.000 €<br />
Handlungsfeld<br />
E Tourismus<br />
ELER Code: 313, 421<br />
654.545 € 654.545 € 360.000 € 294.545 € - € - €<br />
Regionalmanagement<br />
Gesamt 4.339.545 € 3.934.545 € 2.000.000 € 1.606.545 € 328.000 € 405.000 €<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
74
8<br />
� 8 � ERFOLGSKONTROLLE UND PROZESSSTEUERUNG<br />
ERFOLGSKONTROLLE UND<br />
PROZESSSTEUERUNG<br />
8.1 Monitoring<br />
Die LAG „Wesermarsch in Bewegung“ will den Regionalentwicklungsprozess und die Umsetzung<br />
des Regionalen Entwicklungskonzeptes zukünftig kontinuierlich beobachten, evaluieren<br />
und navigieren. Hierzu ist ein Monitoring des Prozesses und der Umsetzungsfortschritte erforderlich.<br />
Anhand geeigneter Indikatoren (s.u.) sollen diese Parameter gemessen und intern durch<br />
die LAG bzw. durch das Regionalmanagement sowie aus externer Sicht bewertet werden. Die<br />
Daten, die für die Erfolgskontrolle und Prozessteuerung erforderlich sind, werden durch das<br />
Regionalmanagement in regelmäßigen Abständen gesammelt, dokumentiert und für die Auswertung<br />
aufbereitet, analysiert, bewertet und publiziert.<br />
Für die Bewertung wird auf die im Programm PROFIL 2007-2013 festgelegten Kriterien sowie<br />
die in der Entwicklungsstrategie für die Siellandschaft Wesermarsch dargestellten Wirkungs-<br />
und Ergebnisindikatoren zurückgegriffen. Diese Datengrundlage dient zur Überprüfung, ob Änderungen<br />
in der Prozessgestaltung und Projektumsetzung für eine verbesserte Verwirklichung<br />
des Regionalen Entwicklungskonzeptes erforderlich sind. Die LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
legt zum 30.06.2010 und zum 30.06.2012 dem Land Niedersachsen Bewertungsberichte vor.<br />
Der Fokus des Bewertungsberichtes im Jahr 2010 liegt auf den ersten Erfahrungen mit der Umsetzung.<br />
Er beschreibt die bisherige Zielerreichung und stellt aus Sicht der LAG erforderliche<br />
Anpassungen zur Verbesserung der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes und<br />
Anregungen zur Verbesserung der Umsetzung auf Programmebene dar.<br />
Der zweite Bericht im Jahr 2012 beinhaltet die Bewertung der Umsetzung des <strong>REK</strong> Siellandschaft<br />
Wesermarsch. Dabei geht er auf Ergebnisse und Wirkungen im Hinblick auf die angestrebten<br />
Entwicklungsziele und die Ziele der Handlungsfelder ein und stellt weitere Entwicklungsperspektiven<br />
und Überlegungen zur Verstetigung des Prozesses nach Ende der Förderperiode<br />
dar.<br />
8.2 Erfolgskontrolle<br />
Bei der Erfolgskontrolle der Projektumsetzung knüpft die Siellandschaft Wesermarsch an die<br />
Erfahrungen aus dem Entwicklungsprozess im Rahmen von LEADER+ an. Die Geschäftsstelle<br />
bzw. das Regionalmanagement sammelt für die Kontrolle der Konzeptverwirklichung kontinuierlich<br />
Daten zur Projektumsetzung und zum Mittelabfluss in den einzelnen Handlungsfeldern.<br />
Dabei werden auch die von PROFIL vorgegebenen Indikatoren berücksichtigt wie beispielsweise:<br />
� Anzahl der durch geförderte Projekte angestoßenen Folgeaktivitäten,<br />
� Anzahl Projekte, die Wechselwirkungen zu anderen Projekten haben,<br />
� Art und Anzahl der durch Kooperationen angestoßenen Aktivitäten,<br />
� Anzahl der Aktivitäten zur Mobilisierung, Information und Qualifikation der Akteure,<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
75<br />
PRÜFKRITERIEN<br />
BEWERTUNGSBERICHT<br />
2010<br />
BEWERTUNGSBERICHT<br />
2012<br />
INDIKATOREN
DOKUMENTATION<br />
BASISDATEN<br />
INDIKATOREN<br />
ZIELERREICHUNGS- UND<br />
ERFOLGSANALYSE<br />
BEFRAGUNG<br />
INDIKATOREN<br />
� 8 � ERFOLGSKONTROLLE UND PROZESSSTEUERUNG<br />
� Art und Anzahl von Koordinierungsaktivitäten,<br />
� Anzahl von in der LAG und in Arbeitsgruppen der LAG beteiligten Akteure nach Art und<br />
Sektor.<br />
Diese Informationen zum Stand der Konzeptrealisierung werden in Jahresberichten zu Beginn<br />
eines jeden Kalenderjahres dokumentiert und der LAG sowie dem Land Niedersachsen vorgelegt.<br />
Die LAG entscheidet auf dieser Grundlage, ob Veränderungen im Prozess „Wesermarsch<br />
in Bewegung“ erforderlich sind.<br />
Als Basis für die spätere Messung der Zielerreichung ermittelt das Regionalmanagement zum<br />
Beginn des Jahres 2008 die Ausgangssituation in der Siellandschaft Wesermarsch anhand der<br />
in der Entwicklungsstrategie festgelegten Wirkungs- und Ergebnisindikatoren. Zudem werden<br />
die aktuellen Daten zur Gesamtgröße der Region und zur Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer<br />
als vorgegebene Indikatoren nach PROFIL ermittelt und dem Land mitgeteilt.<br />
Zur Vorbereitung der Bewertungsberichte in den Jahren 2010 und 2012 ermittelt das Regionalmanagement<br />
anhand der genannten Indikatoren, welche Ergebnisse und Wirkungen durch die<br />
bisherige Projektumsetzung erzielt werden konnten und wie sich die Situation der Siellandschaft<br />
Wesermarsch seit der Ermittlung der Ausgangssituation verändert hat.<br />
Ergänzend plant die LAG auch die externe Durchführung einer Zielerreichungs- und Erfolgsanalyse.<br />
Im diesem Zusammenhang soll an die bereits im Rahmen von LEADER+ durchgeführte<br />
Imageanalyse angeknüpft werden. Diese vom Institut für Umweltwissenschaften der Universität<br />
Vechta durchgeführte Studie zur Ermittlung der Innen- und Außensicht auf die Wesermarsch<br />
erhob unter anderem Daten auf Grundlage ausgewählter Expertengespräche, Telefon- und<br />
Onlinebefragungen und umfasste Ergebnisse von Touristenbefragungen sowie die Analyse von<br />
Presseberichterstattungen. Die Ergebnisse dieser Zielerreichungskontrolle werden der LAG<br />
präsentiert, die demnach entscheidet, ob und welche Anpassungen bei der inhaltlichen Schwerpunktsetzung<br />
im Entwicklungsprozess erforderlich sind.<br />
8.3 Prozesssteuerung<br />
Zur Vorbereitung der Bewertungsberichte führt die Geschäftsstelle eine schriftliche Befragung<br />
aller LAG-Mitglieder, Kommunen und ausgewählter regionaler Akteure in der Siellandschaft<br />
Wesermarsch durch, die am Leader-Prozess beteiligt waren. Durch Fragebögen, die bereits bei<br />
der LEADER+ Evaluierung zum Einsatz kamen, werden die Einschätzungen zur bisherigen<br />
Zusammenarbeit in der LAG, zu inhaltlichen Schwerpunkten der bisherigen Aktivitäten, zur Aktivierung<br />
und Mobilisierung der regionalen Akteure sowie zu Verbesserungsmöglichkeiten in der<br />
Zusammenarbeit ermittelt. Dabei werden auch Informationen zu folgenden von PROFIL vorgegebenen<br />
Indikatoren erfasst:<br />
� Einschätzung, ob Kooperationsprojekte der LAG einen Beitrag zur Optimierung der Strategie<br />
geleistet haben (PROFIL-Indikator: Anteil der LAG-Mitglieder, nach deren Einschätzung<br />
das der Fall ist),<br />
� Einschätzung, ob die Arbeit der LAG zu einer Verbesserung der regionalen Handlungskompetenz<br />
geführt hat (PROFIL-Indikator: Anteil der LAG-Mitglieder, nach deren Einschätzung<br />
das der Fall ist).<br />
76<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
� 8 � ERFOLGSKONTROLLE UND PROZESSSTEUERUNG<br />
Im Frühjahr 2010 wird die LAG „Wesermarsch in Bewegung“ eine Regionalkonferenz als öffentliche<br />
Großveranstaltung in der Region durchführen, die intensiv von der regionalen Presse begleitet<br />
werden soll. Die Regionalkonferenz <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong> wird folgende Eckpunkte<br />
umfassen:<br />
� Präsentation der Zwischenergebnisse der <strong>REK</strong>-Umsetzung,<br />
� Diskussion des Zwischenstandes auf breiter Basis und Ermittlung weiterer Entwicklungsperspektiven<br />
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in offenen Foren,<br />
� Sammlung von Anregungen für den Entwicklungsprozess,<br />
� Aktivierung neuer Akteure für den regionalen Entwicklungsprozess.<br />
Die Regionalkonferenz wird durch das Regionalmanagement konzipiert und geleitet und <strong>–</strong> wie<br />
bereits erfolgreich praktiziert <strong>–</strong> durch externe Sachverständige begleitet. Zur Regionalkonferenz<br />
werden die Partnerregionen eingeladen, mit denen Kooperationsprojekte bestehen, um den<br />
Erfahrungsaustausch zwischen den Regionen zu fördern und um externe Einschätzungen zu<br />
den bisherigen Aktivitäten zu erhalten.<br />
Das Regionalmanagement wird die Ergebnisse der Befragung und der Regionalkonferenz der<br />
LAG präsentieren, die auf dieser Grundlage erforderliche Anpassungen im Umsetzungsprozess<br />
beschließt und im Jahr 2012 zudem Perspektiven für die Verstetigung der regionalen Zusammenarbeit<br />
über das Ende der Förderperiode hinaus entwickelt. Die Beschlüsse der LAG werden<br />
zusammen mit den Ergebnissen der Befragungen und der Regionalkonferenz in den Bewertungsberichten<br />
dargestellt.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
77<br />
REGIONALKONFERENZ<br />
PROZESSANPASSUNG
� 8 � ERFOLGSKONTROLLE UND PROZESSSTEUERUNG<br />
78<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
LITERATUR- UND QUELLEN-<br />
VERZEICHNIS<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS<br />
AGSTA (Arbeitsgemeinschaft für Stadt- und Altbauerneuerung) (1982): Inventarium alter Sielanlagen. Ostfriesland,<br />
westlicher Jadebusen und Wesermarsch. Teil B: Wesermarsch. Hannover. [Studie, unveröffentlicht]<br />
BBR (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) (2005): Raumordnungsbericht 2005. Bonn.<br />
Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer (2007): Auf dem Wege … Ein Programm zur nachhaltigen<br />
Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer. Wilhelmshaven. [Programm,<br />
unveröffentlicht]<br />
BMELF (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) (2006): Nationaler Strategieplan<br />
der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher Räume. Bonn.<br />
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C26933158_L20.pdf<br />
noch abgleichen mit kap. 6..1.1<br />
BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) / BBR (Bundesamt für Bauwesen und<br />
Raumordnung) (Hrsg.) (2006): Integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM): Raumordnungsstrategien im<br />
Küstenbereich und auf dem Meer. Abschlussbericht, Berlin.<br />
http://www.bbr.bund.de/cln_005/nn_139622/DE/Veroeffentlichungen/Sonderveroeffentlichungen/2006/DL__I<br />
KZMAbschlussbericht,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_IKZMAbschlussbericht.pdf<br />
Bundesagentur für Arbeit (2007): Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Oldenburg. Arbeitsmarktreport<br />
Berichtsmonat August 2007, Oldenburg.<br />
Bundesregierung (2002). Perspektiven für Deutschland. Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung.<br />
Berlin.<br />
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/__Anlagen/perspektiven-fuer-deutschlandlangfassung,property=publicationFile.pdf<br />
cofad GmbH (2007): Entwurf: Strategie für eine integrierte örtliche Entwicklung des Fischwirtschaftsgebietes<br />
Niedersächsische Nordseeküste. Tutzing. [Studie, unveröffentlicht]<br />
www.cofad.de<br />
Cornelius, Leenert (2003): Der Küstenschutz und die Wasserwirtschaft in der Wesermarsch. Brake.<br />
http://www.landkreis-wesermarsch.de/pdf/KuestenschutzundWasserwirtschaft.pdf<br />
Deutscher Bauernverband (2007): Situationsbericht 2007. Berlin.<br />
http://www.situationsbericht.de/ (Stand 31.8.2007)<br />
DVS (Deutsche Vernetzungsstelle LEADER+) (2006): LEADER+ in Deutschland. Ausgewählte Projekte. Bonn.<br />
Europäische Kommission (1999): EU<strong>REK</strong> <strong>–</strong> Europäisches Raumentwicklungskonzept. Luxemburg.<br />
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_de.pdf<br />
Forum GmbH (2007): Demografischer Wandel in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten. Zwischenbericht<br />
zum Arbeitsschritt 1. Datenanalyse: Räumliche Ausdifferenzierung des demografischen Wandels<br />
in der Metropolregion. Oldenburg. [Studie, unveröffentlicht]<br />
GfL / BioConsult / KÜFOG (2007): Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenweser an die Entwicklungen im<br />
Schiffsverkehr mit Tiefenanpassung der hafenbezogenen Wendestelle. Auswirkungen auf die ökologische Situation<br />
des Grabensystems binnendeichs. Loxstedt.<br />
ift (Freizeit- und Tourismusberatung GmbH) (voraussichtlich 2008): „Masterplan Nordsee“. Touristisches Zukunftskonzept.<br />
Im Auftrag des Tourismusverbandes Nordsee e. V. Köln.<br />
IHK (Oldenburgische Industrie- und Handelskammer) (2007): Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer<br />
zum 30.06.2006.<br />
http://www.ihk-oldenburg.de/download/ths_soz_besch_ihk.pdf (Stand: 12.8.07)<br />
79
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS<br />
IUW (Institut für Umweltwissenschaften der Universität Vechta) (2006): Imageanalyse Wesermarsch.<br />
Vechta/Oldenburg.<br />
http://www.wesermarsch-inbewegung.de/projektdateien/Dokumente/Imageanalyse%20Wesermarsch/Imageanalyse_Wesermarsch.pdf<br />
Kreislandvolkverband Wesermarsch (2007): Zahlen, Daten, Fakten zur Landwirtschaft in der Wesermarsch.<br />
www.landvolk.net/1095.htm (Stand: 11.6.2007)<br />
<strong>Landkreis</strong> Wesermarsch (1992): Landschaftsrahmenplan <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch. Brake.<br />
<strong>Landkreis</strong> Wesermarsch (2003): Regionales Raumordnungsprogramm <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch 2003. Brake.<br />
<strong>Landkreis</strong> Wesermarsch & Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH (2006): Wirtschaftsstandort Wesermarsch.<br />
Nordhorn.<br />
<strong>Landkreis</strong> Wesermarsch (2007): Martin Stein, mündliche Auskunft vom 24.09.2007.<br />
<strong>Landkreis</strong> Wesermarsch, FD 50, (2007a): Horst Stolz, mündliche Auskunft vom 08.07.2007.<br />
<strong>Landkreis</strong> Wesermarsch, FD 68, (2007b): Thomas Garden, mündliche Auskunft vom 15.09.2007.<br />
Logemann, Gerd (2005): Konzept zur Entwicklung der Baukultur in der Wesermarsch. Berne. [Studie,<br />
unveröffentlicht]<br />
LWK (Landwirtschaftskammer Weser-Ems) 2007a: Uwe Ralle, mündliche Auskunft vom 30.07.2007.<br />
LWK (Landwirtschaftskammer Weser-Ems) 2007b: Daten und Fakten zur Landwirtschaft in Oldenburg-Nord.<br />
Broschüre der Bezirksstelle Oldenburg-Nord, Fachgruppe I. Oldenburg.<br />
Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e.V. (2007): http://www.bremen-niedersachsen.de/ (Stand: 15.5.07)<br />
Niedersachsen/Bremen (2007): PROFIL 2007-2013. Programm zur Förderung im ländlichen Raum Niedersachsen<br />
und Bremen. Hannover.<br />
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C31745952_L20.pdf<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) 2000-2002: NLS-Online. Tabellen Q0990206 (2000), Q0990106<br />
(2001), Q0990096.<br />
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C31745952_L20.pdf<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (2000-2006): NLS-Online: Tabellen K2070211, Tabelle K207011<br />
(Arbeitslose in Niedersachsen), Q0 990704, Q0990204 (Kreisfreie Städte und <strong>Landkreis</strong>e in Zahlen 2000)<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/mustertabelle.asp (Stand 26.7.07)<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (2006a): NLS-Online. Tabelle K9990122. Bruttoinlandsprodukt in<br />
Niedersachsen. Berechnungsstand: August 2006<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/mustertabelle.asp (Stand 14.8.07)<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (2006b): NLS-Online. Tabelle K9200012, Realsteuervergleich<br />
in Niedersachsen.<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/mustertabelle.asp (Stand 25.6.07)<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (2006c):NLS-Online: Tabelle Z9990221. Bruttoinlandsprodukt,<br />
Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen in Niedersachsen in jeweiligen Preisen 1991 <strong>–</strong> 2005.<br />
Berechnungsstand: August 2006<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/mustertabelle.asp (Stand 25.6.07)<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (2006d): NLS-Online: Tabelle K6080011. Agrarstrukturerhebung<br />
im Mai in Niedersachsen.<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/Statistik/html/mustertabelle.asp.<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (2006e): NLS-Online: Tabelle K70G3524. Sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigte am Arbeitsort in Niedersachsen.<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/Statistik/html/mustertabelle.asp<br />
80<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (2007a): NLS-Online. Tabelle K1000014, Bevölkerung und<br />
Katasterfläche in Niedersachsen.<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/mustertabelle.asp (Stand 26.7.07)<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (2007b): NLS-Online. Tabelle M1001696, Fläche, Bevölkerung<br />
und Bevölkerungsbewegung in Niedersachsen.<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/mustertabelle.asp (Stand 26.7.07)<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) (2007c): Niedersachsen - das Land und seine Regionen. Land -<br />
Bezirke - <strong>Landkreis</strong>e - Kreisfreie Städte. Hannover.<br />
http://www.nls.niedersachsen.de/html/nds-regionen.html<br />
http://www.nls.niedersachsen.de/Download/Nds_Regionen/461%20Wesermarsch.pdf<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) 2007d: NLS-Online. Tabelle K7350001, Beherbergung im Reiseverkehr<br />
in Niedersachsen. Beherbergungsbetriebe mit mindestens 9 Betten.<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/mustertabelle.asp (Stand 29.7.07)<br />
NLS (Niedersächsisches Landesamt für Statistik) 2007e: NLS-Online: Tabelle K7350126, Beherbergung im Reiseverkehr<br />
in Niedersachsen. Beherbergungsbetriebe mit mindestens 9 Betten.<br />
http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/html/mustertabelle.asp (Stand 29.7.07)<br />
NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasser-, Küsten- und Naturschutz) (2000): Gewässergütebericht.<br />
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/master/C7685882_N5742094_L20_D0_I5231158.html<br />
NMELV (Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)<br />
(2007): Die niedersächsische Landwirtschaft in Zahlen. Hannover.<br />
NMELV (Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)<br />
(2005): Raumordnungskonzept für das niedersächsische Küstenmeer. Hannover.<br />
Pottgießer, Tanja & Sommerhäuser, Mario (2006): Aktualisierung der Steckbriefe der Deutschen Fließgewässertypen.<br />
Essen.<br />
http://www.umweltbundesamt.de/wasser/themen/downloads/1_Begleittext.pdf<br />
Rat der Europäischen Union (2006): Beschluss des Rates vom 20. Februar 2006 über strategische Leitlinien der<br />
Gemeinschaft für die Entwicklung des ländlichen Raums (Programmplanungszeitraum 2007-2013). Brüssel.<br />
http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/eler_ll.pdf<br />
Transferstelle dialog & regio institut (2005): Strukturatlas 2005. Regionale Strukturen und Entwicklungen in Nordwestdeutschland.<br />
Oldenburg.<br />
regio institut (2007): mündliche Auskunft vom 27.7.2007.<br />
Seeber, Jobst (2004): Ideenskizze Wesermarsch. regio institut, Oldenburg. [Manuskript, unveröffentlicht].<br />
TGW (Touristikgemeinschaft Wesermarsch) 2007. Gabriele Duwe, mündliche Auskunft vom 29.7.2007.<br />
WeserKontor GmbH (2007): Weser-Radweg.<br />
http://weser.de/index.php?id=46 (Stand: 10.9.2007)<br />
Wilke, Jörg (2000): Zuhören bevor man redet. In leader forum. Heft 2/2000, S. 4-5.<br />
Wilke, Jörg (2004): LEADER+ in der Wesermarsch <strong>–</strong> Strategieentwicklung von unten. In: Berichte der Evangelischen<br />
Akademie Iserlohn, Bd. 5, S. 22-27.<br />
Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH (2002): Förderung des maritimen Tourismus an der Unterweser.<br />
Region Unterweser. Regionales Entwicklungskonzept. Elsfleth/Brake.<br />
81
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS<br />
82<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013
ANHANG<br />
� Geschäftsordnung Lokale Aktionsgruppe „Wesermarsch in Bewegung“<br />
� SWOT-Analyse Siellandschaft Wesermarsch<br />
� Handlungsfelder, Ziele, Maßnahmen, Projekte Siellandschaft Wesermarsch<br />
� Evaluierungsbericht LEADER+ 2000-2006<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
Geschäftsordnung<br />
Lokale Aktionsgruppe „Wesermarsch in Bewegung“<br />
§ 1 Name, Gebiet und Sitz der LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
(1) Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) führt den Namen „Wesermarsch in Bewegung“.<br />
(2) Das Aktionsgebiet der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ umfasst die Kommunen Berne, Brake, Butjadingen,<br />
Elsfleth, Jade, Lemwerder, Ovelgönne, Nordenham und Stadland.<br />
(3) Der Sitz der Geschäftsstelle ist die Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH in der Kreisstadt Brake<br />
(Unterweser).<br />
§ 2 Zweck der LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
(1) Zweck der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ ist die Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes<br />
(<strong>REK</strong>) <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong>.<br />
(2) Die LAG „Wesermarsch in Bewegung“ konstituiert sich, um in einer strukturierten und organisierten<br />
Form verschiedene Gruppen des Aktionsgebietes an der Entwicklung der Region zu beteiligen.<br />
(3) Das Leitbild der Siellandschaft Wesermarsch lautet: „Natur- und Kulturlandschaft bilden die Grundlage<br />
für ein nachhaltig gestaltetes Sozial- und Wirtschaftsleben.“<br />
§ 3 Aufgaben der LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
Die LAG „Wesermarsch in Bewegung“ übernimmt folgende Aufgaben:<br />
(1) Die Erstellung des Regionalen Entwicklungskonzeptes <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong> für die Leader-<br />
Förderperiode von 2007 bis 2013.<br />
(2) Die Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes nach Genehmigung durch das Land Niedersachsen<br />
bis mindestens 31.12.2013, grundsätzlich aber auch darüber hinaus.<br />
(3) Die Auswahl von Projekten nach Maßgabe der im <strong>REK</strong> festgelegten Ziele.<br />
(4) Die Initiierung und Koordinierung von Projekten.<br />
(5) Die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.<br />
(6) Die Motivation und Mobilisierung von Menschen zur Mitwirkung an der Umsetzung des Regionalen<br />
Entwicklungskonzeptes oder von Teilprojekten.<br />
(7) Die Beratung und die Beschlussfassung zu Förderanträgen aus dem Aktionsgebiet.<br />
(8) Die Unterstützung potenzieller Projektträger.<br />
(9) Die Begleitung und Bewertung des Regionalen Entwicklungskonzeptes.<br />
(10) Die Änderung und Anpassung des Regionalen Entwicklungskonzeptes entsprechend der Ergebnisse<br />
interner und externer Bewertungen.<br />
(11) Die Dokumentation der geförderten Projekte und die Weitergabe der Informationen an das Ministerium<br />
für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Niedersachsen, die von<br />
ihm benannten Organisationen sowie die nationale und europäische Vernetzungsstelle Leader.<br />
(12) Die Teilnahme an Kooperationsprojekten mit anderen Leader-Regionen oder Regionen mit vergleichbaren<br />
Planungsansätzen (z.B. Integriertes ländliches Entwicklungskonzept ILEK).<br />
§ 4 Organisation der LAG „Wesermarsch in Bewegung“<br />
Die LAG „Wesermarsch in Bewegung“ besteht aus folgenden Organisationseinheiten:<br />
(1) Die Lokale Aktionsgruppe (LAG).<br />
(2) Der Vorstand.<br />
(3) Die Geschäftsstelle.<br />
(4) Die projektbezogenen, temporären Arbeitsgruppen.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
§ 5 Zusammensetzung und Aufgaben der Organisationseinheiten<br />
(1) Die Lokale Aktionsgruppe<br />
(1) Zusammensetzung: Die Lokale Aktionsgruppe ist die Versammlung der Mitglieder, bestehend aus<br />
25 stimmberechtigten Mitgliedern sowie ergänzenden Mitgliedern. 15 Mitglieder sind WiSo-Partner<br />
(60 %), 10 Mitglieder (40 %) sind Vertreter der Kommunen im Aktionsgebiet. Nach Bedarf werden<br />
zusätzliche beratende Mitglieder integriert. Die beteiligten Organisationen entsenden, soweit fachlich<br />
und organisatorisch möglich, Frauen für die Mitgliedschaft in der Lokalen Aktionsgruppe. Zielsetzung<br />
soll dabei eine Frauenbeteiligung in Höhe von 30-50% sein. Die konkrete Zusammensetzung<br />
der LAG ist im <strong>REK</strong> der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ erläutert. Die Zusammensetzung<br />
der stimmberechtigten Mitglieder kann nur mit 2/3-Mehrheit der LAG geändert werden.<br />
(2) Aufgaben: Die Lokale Aktionsgruppe ist ein zentrales Steuerungs- und Entscheidungsgremium. Sie<br />
berät und entscheidet über die Gesamtstrategie, bringt neue Aspekte ein, sie berät und beschließt<br />
über alle Förderprojekte. Die Aktionsgruppe benennt zudem projektbezogene, temporäre Arbeitsgruppen<br />
und löst sie wieder auf.<br />
(3) Beschlussfassung: Die Lokale Aktionsgruppe wird von der Geschäftsstelle in Abstimmung mit dem<br />
Vorstand einberufen. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten<br />
Mitglieder und davon mindestens 50 % WiSo-Partner anwesend sind. Bei der Beschlussfassung<br />
entscheidet die einfache Mehrheit der mit „Ja“ lautenden Stimmen <strong>–</strong> Enthaltungen bleiben unberücksichtigt.<br />
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Jedes stimmberechtigte<br />
Mitglied hat eine Stimme. Über den Verlauf der Sitzungen der Aktionsgruppe wird ein Protokoll<br />
angefertigt.<br />
(2) Der Vorstand:<br />
• Zusammensetzung: Die Aktionsgruppe wählt mit einfacher Mehrheit aus ihrer Mitte einen Vorstand<br />
und einen stellvertretenden Vorstand sowie einen Finanzvorstand (3 Personen).<br />
• Aufgaben: Der Vorstand führt die Sitzungen und vertritt die Aktionsgruppe in der Öffentlichkeit. Der<br />
Finanzvorstand koordiniert und kontrolliert den Finanztopf „Wesermarsch in Bewegung“ und hat<br />
seinen Sitz beim <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch.<br />
• Der Vorstand wird vom Regionalmanagement unterstützt.<br />
(3) Projektbezogene, temporäre Arbeitsgruppen:<br />
• Zusammensetzung: Die projektbezogenen, temporären Arbeitsgruppen können sich sowohl aus<br />
Mitgliedern der LAG als auch aus weiteren Personen der Region zusammensetzen. Einberufen<br />
werden die Arbeitsgruppen durch die Lokale Aktionsgruppe.<br />
• Aufgaben: Die Aufgaben werden bei der Einberufung benannt. Grundsätzlich sollen sie Teilbereiche<br />
der Gesamtstrategie bearbeiten und Teilaufgaben lösen helfen.<br />
(4) Die Geschäftsstelle:<br />
• Zusammensetzung: Die Geschäftsstelle der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ setzt sich aus dem<br />
Regionalmanager/der Regionalmanagerin und einer Assistenz des Regionalmanagements zusammen.<br />
• Aufgaben: Die Geschäftsstelle unterstützt die Lokale Aktionsgruppe und den Vorstand bei allen<br />
Aufgaben. Sie bereitet die LAG Sitzungen vor und nach, klärt die Fördermöglichkeiten von Projektanträgen<br />
in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsstelle ab, koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit, berät<br />
potentielle Antragsteller, koordiniert die geförderten Projekte, organisiert und koordiniert insbesondere<br />
die gebietsübergreifenden Projekte, soweit sich keine sonstigen Projektträger finden, und<br />
arbeitet konkrete Aufträge der LAG und des Vorstandes ab. Weiterhin stellt sie die die Dokumentation<br />
der Informationen zur Projektumsetzung, die Organisation zur Prozessbewertung und die Erstellung<br />
von Jahresberichten und Bewertungsberichten sicher.<br />
Die LAG Mitgliederversammlung wird von der Geschäftsstelle viermal jährlich einberufen. Es gilt<br />
eine Ladungsfrist von 14 Tagen. Die Sitzungen sind öffentlich.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft<br />
(1) Grundsätzlich sollten alle Mitglieder bestrebt sein, eine kontinuierliche Mitarbeit sicherzustellen.<br />
(2) Die Beendigung der Mitgliedschaft in der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ kann auf eigenen Wunsch<br />
erfolgen. In der nächsten Versammlung der LAG wird dann auf Vorschlag ein neues Mitglied gewählt.<br />
(3) Verstößt ein Mitglied nachhaltig und wiederholt gegen die Grundsätze des regionalen Entwicklungskonzeptes<br />
oder gegen die Interessen der LAG „Wesermarsch in Bewegung“ kann das Mitglied mit einer 2/3-<br />
Mehrheit der LAG ausgeschlossen und sodann ein neues Mitglied benannt werden.<br />
§ 7 Dauer der LAG<br />
(1) Der Zeitraum der Mitwirkung der LAG richtet sich an der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes<br />
nach Genehmigung durch das Land Niedersachsen bis mindestens 31.12.2013 aus, zur endgültigen<br />
Abwicklung grundsätzlich aber auch darüber hinaus.<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
SWOT-Analyse Siellandschaft Wesermarsch<br />
SWOT-Analyse Siellandschaft Wesermarsch: Ökologie <strong>–</strong> Natur, Landschaft und Umwelt<br />
- Stärken - Schwächen - Chancen - Risiken<br />
- Klimawandel mit negativen Auswirkungen<br />
auf die Region<br />
- Mangelhafte Zugangs<strong>–</strong> und Erlebnismöglichkeiten<br />
in Naturteilräumen<br />
- Anhaltende Umweltbelastung<br />
- Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zur Akzeptanzsteigerung<br />
von Naturschutz- und Kulturlandschaftsprojekten<br />
- Homogener Naturraum der Watten und Marschen<br />
mit einem einheitlichen Landschaftsbild<br />
- Verbesserung der Erholungsfunktion durch<br />
ökologische und landschaftspflegerische<br />
Maßnahmen<br />
- Inhaltliche und methodische Defizite bei der<br />
Vermittlung von Natur- und Umweltthemen<br />
(z.B. Gästeführer, Lehrer)<br />
- Wattenmeer der Nordsee und Buchtenwatt<br />
des Jadebusens als weltweit seltene, wertvolle<br />
Ökotope<br />
- Umweltbildung durch Naturerleben<br />
- Schaffung von Synergien zwischen Landtourismus<br />
und den Schutzgebieten des Wattenmeeres<br />
(Nationalpark, Biosphärenreservat)<br />
sowie NATURA-2000-Flächen.<br />
- Fehlende Beobachtungssicherheit bei Wiesen-<br />
und Rastvögeln (Birdwatching)<br />
- Moore und Moormarschen in unterschiedlichen<br />
Ausprägungen<br />
- Flusslandschaft der Weser<br />
- Hohes Naturraumpotenzial für Wiesen-,<br />
Rastvögel und Störche<br />
- Stoffeinträge durch intensive landwirtschaftliche<br />
Nutzung<br />
- Mangelnde Qualität der Kulturlandschaftselemente<br />
Pütten, Kuhlen und Kopfweiden<br />
- Durch Landwirtschaft geprägte Kulturlandschaft<br />
mit traditioneller Rind- und Schafweidehaltung<br />
auf größter zusammenhängender<br />
Dauergrünlandfläche in Deutschland<br />
- Verlust an landschaftlicher Attraktivität<br />
- Konflikte zwischen Landwirtschaft, Wasserund<br />
Bodenverbänden und Naturschutz<br />
- Erhaltene Strukturen und Elemente der historisch<br />
gewachsenen Kulturlandschaft (Wurten,<br />
Kopfweiden etc. )<br />
- Kooperation zwischen Naturschutz und<br />
Landwirtschaft durch Vertragsnaturschutz<br />
- Weiterer Rückgang typischer Arten der Flora<br />
und Fauna in der Siellandschaft<br />
- WRRL zur ökologischen Verbesserung der<br />
Be- und Entwässerungssystems<br />
- Fehlende Gewässerstruktur und mangelnde<br />
Wassergüte der Siele und Gräben<br />
- Gewässernetz mit über 20.000 km Länge als<br />
ausgedehnter Lebensraum für Arten der<br />
Gewässer und Feuchtgebiete<br />
- Intensives Wassermanagement des Sielsystems<br />
mit negativen Auswirkungen für Fischfauna<br />
und Gewässerstrukturen<br />
-<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
SWOT-Analyse Siellandschaft Wesermarsch: Soziales: <strong>–</strong>Kulturerbe und Dorfleben<br />
- Stärken - Schwächen - Chancen - Risiken<br />
- Verfall regionaltypischer und landschaftsprägender<br />
Bausubstanz<br />
- - Nachfragetrend nach Authentizität in den<br />
Urlaubsgebieten<br />
- Gebäude mit hohem baukulturellem Wert<br />
als Standortvorteil (Landtourismus, Diversifizierung)<br />
-<br />
- Sielsystem mit Schöpfwerken, Pumptürmen und<br />
Sieltoren als herausragende Kulturlandschaftstechnik<br />
- Reiches Kulturerbe mit vielen historischen Kulturgütern<br />
(z.B. Kirchen- und Orgelbaukunst)<br />
- Intakte Moor- und Marschhufensiedlungen, Wurtendörfer<br />
und Deichrandsiedlungen<br />
- Hoher Anteil landschaftsprägender Gebäude und<br />
regionaltypischer Baukultur (Bauernhöfe, reetgedeckte<br />
Häuser etc.)<br />
- Maritimes Erbe der Küstenregion mit Traditionsschiffen,<br />
Fischerbooten, Werften und (Siel-)Häfen<br />
an Weser, Hunte und Nordsee<br />
- Verlust der dörflichen Lebensqualität<br />
bei weiteren Rückgang der Bevölkerung<br />
- Engagement der Menschen für ihre Region<br />
und durch gemeinsames Handeln <strong>–</strong> Stärkung<br />
der Lebensqualität<br />
- Früh eintretender und stark ausgeprägter<br />
demografischer Wandel<br />
- Starkes ehrenamtliches Engagement aktiver Bürgervereine,<br />
Feuerwehren, Kultur-, Naturschutzund<br />
Sportvereinen in der Region<br />
- Weiterer Abbau der sozialen und öffentlich<br />
Infrastruktur<br />
- Generierung von Ideen und Projektansätzen<br />
für die dörfliche Entwicklung durch Kooperationen<br />
- Unzureichende flächendeckende Grundversorgung<br />
im ländlichen Raum<br />
- Ausgeprägter Kooperationsgeist im Aktionsgebiet<br />
Siellandschaft Wesermarsch<br />
- Anhaltende Abwanderung junger und<br />
qualifizierter Menschen<br />
- Dienstleistungen werden in den Oberzentren<br />
außerhalb der Wesermarsch wahrgenommen<br />
- Hoher Wohnwert (Landschaftsbild, unbelastete<br />
Natur)<br />
- Verlust der Identifikation mit dem Dorf<br />
aufgrund mangelnder Attraktivität<br />
- Erhalt landschaftsprägender Gebäude<br />
durch gewerbliche Nutzungen (Ansiedlungen,<br />
Existenzgründungen)<br />
- Fehlende Mobilitätsangebote für die Bevölkerung<br />
- Lokale Veranstaltungen<br />
- Mobilitätsförderung<br />
- Weite Wege zwischen Wohnort und Arbeitsplatz<br />
- Bindungsschwäche der jüngeren Generation<br />
an die Wesermarsch<br />
- Fehlende attraktive Angebote und Einrichtungen<br />
für Jugendliche<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
SWOT-Analyse Siellandschaft Wesermarsch: Ökonomie <strong>–</strong> Regionale Produktion<br />
- Stärken - Schwächen - Chancen - Risiken<br />
- Anstieg der Arbeitslosigkeit durch weiteren<br />
Arbeitsplatzabbau im produzierenden Gewerbe<br />
- Anhaltendes Wirtschaftswachstum in den<br />
nächsten Jahren<br />
- Hohe Schuldenlast der kommunalen Haushalte<br />
und hohe Sozialausgaben<br />
- Abwanderung qualifizierter Fachkräfte<br />
- Marktpositionierung der Siellandschaft mit<br />
einem naturnahen Image<br />
- Kaufkraftabfluss in die außerhalb der Wesermarsch<br />
liegenden Oberzentren<br />
- Unterdurchschnittlicher Anteil an Beschäftigten<br />
im tertiären Dienstleistungssektor<br />
- Mängel in der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur<br />
und beim Know-how<br />
Entwicklung von Dienstleistungen und Unternehmungen<br />
- Arbeitslosigkeit mit erhöhtem Anteil an<br />
Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern<br />
- Konflikte zwischen landwirtschaftlicher Nutzung<br />
und Landtourismus<br />
- Diversifizierungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche<br />
Betriebe im Landtourismus<br />
- Anhaltender Strukturwandel und weitere<br />
Betriebsaufgaben landwirtschaftlicher Betriebe<br />
- Landwirtschaft mit wettbewerbsfähigen<br />
Strukturen in der Milchviehwirtschaft<br />
- Überfischung und Fischhabitatbeeinträchtigung<br />
durch Gewässerausbau der Weser<br />
- Touristische Vermarktung des maritimen<br />
Erbes und der Fischereitradition<br />
- Geringer Anteil von regionalen und ökologischen<br />
erzeugten Produkten im LEH<br />
- Regionaltypische Produkte aus Landwirtschaft<br />
(Milch, Käse, Ochse, Lamm) und Fischerei<br />
von hoher Qualität<br />
- Fangbeschränkungen und Bestandeseinbrüche<br />
- Leistungsfähige Fischereiwirtschaft, insbesondere<br />
im Bereich der Krabbenfischerei<br />
- Bedienung des Nachfragetrends im Tourismus<br />
zu Erholung, Entschleunigung, Naturnähe,<br />
Naturerlebnis<br />
- Zustand und Struktur ländlicher Wege aufgrund<br />
naturräumlicher Bedingungen für<br />
Landwirtschaft und Tourismus nicht optimal<br />
nutzbar<br />
- Vielzahl qualitativ hochwertiger touristischer<br />
Einrichtungen: Museen, Mühlen, Landcafés<br />
etc.<br />
- Naturnaher Tourismus<br />
- Förderung der Naturerlebnisqualität durch<br />
Qualifizierung von regionalen Akteuren im<br />
Bereich Natur- und Naturerleben<br />
- Fehlender Bezug von Rad- und Fußwegen<br />
zu Meer, Flüssen und Sieltiefs<br />
- Etablierter Radtourismus mit „Deutscher<br />
Sielroute“, „Weserradweg“ und „North Sea<br />
Cycle Route“<br />
- Unzureichende Anzahl von Übernachtungseinrichtungen<br />
und Bettenkapazitäten<br />
- Schaffung saisonunabhängiger touristischer<br />
Angebote<br />
- Qualitäts- und Servicedefizite bei Übernach-<br />
- Nordseeküste mit Bädertourismus<br />
- Den regionalen und landschaftstypischen<br />
Gegebenheiten, entsprechende touristische<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
- Erschließung neuer Zielgruppen im Tourismus<br />
(Altersgruppe 50+)<br />
- Maritime touristische Angebote längs der<br />
Weser<br />
tungseinrichtungen im Landtourismus<br />
- Unterschiedlicher Professionalisierungsgrad<br />
der touristischen Einrichtungen zwischen<br />
Nordseeküste und Binnenland<br />
Freizeitangebote<br />
- Stärkung des touristischen Sektors durch<br />
LEADER+ Projekte im Bereich Kulturerbe<br />
- Förderung des Wassertourismus im Binnenland<br />
- Defizite bei Qualität und Service in der Gastronomie<br />
- „Melkhüs“ als national beachtetes, erfolgreiches<br />
Projekt zur Verknüpfung von Landwirtschaft<br />
und Tourismus<br />
- Landschaftliche Erlebnisqualität der Siellandschaft<br />
durch Natur- und Gewässernähe<br />
- Starke Saisonalität im Tourismus<br />
- Unzureichendes Binnen- und Außenmarketing<br />
für touristische Produkte<br />
- Stärkere Nutzung der wasser- und landschaftsgebundenen<br />
Freizeitmöglichkeiten<br />
(Siele, Flüsse, Meer)<br />
- Uneinheitliche touristische Orientierungsund<br />
Beschilderungssysteme mit Quantitätsund<br />
Qualitätsmängeln<br />
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013 - Anhang
Anhang: Handlungsfelder, Ziele Maßnahmen, Projekte Siellandschaft Wesermarsch<br />
Handlungsfelder Ziele Maßnahmen / Aktivitäten Leitprojekte und Projektideen (kursiv: Ideenpool)<br />
A Natur 1. Erhalt und Gestaltung von Natur<br />
und Landschaft mit ihren typischen<br />
Arten und Lebensräumen<br />
2. Ausbau von Angeboten zum<br />
Naturerleben<br />
a) Zusammenarbeit von Landnutzern und Naturschützern zur<br />
Landschaftserhaltung und -gestaltung fördern.<br />
b) Lebensräume und -bedingungen für typische Arten und Lebensgemeinschaften<br />
des Kulturlandschaftsraumes entwickeln<br />
und fördern.<br />
a) Erlebnisqualität von Natur und Landschaft entwickeln, ausbauen,<br />
steigern.<br />
b) Sensibilisierung und Wissensgrundlage für den Natur- und Kulturlandschaftsraum<br />
fördern.<br />
3. Förderung des Klimaschutzes a) Innovative Anpassungsstrategien und Bewusstseinsbildung zu<br />
den Auswirkungen des Klimawandels entwickeln.<br />
B Dorfleben 1. Steigerung der Attraktivität der<br />
Dörfer und der dörflichen Lebensqualität<br />
2. Ausweitung und Verbesserung<br />
von Grundversorgungseinrichtungen<br />
und -angeboten<br />
3. Erhalt und nachhaltige Nutzung<br />
historischer, orts- oder landschaftsprägender<br />
Gebäude<br />
a) Dörfliche Strukturen revitalisieren und die Aufenthaltsqualität<br />
dörflicher Treffpunkte attraktiveren.<br />
c) Regionaltypische, qualitativ hochwertige Gasthauskultur entwickeln<br />
und fördern.<br />
a) Versorgungseinrichtungen, -angebote, und Infrastruktur und<br />
Mobilitätsangebote verbessern.<br />
a) Konzepte und Modellprojekte zur Nach- und Umnutzung historischer,<br />
orts- oder landschaftsprägender Gebäude entwickeln und<br />
umsetzen.<br />
C Kultur 1. Ausbau des Kulturangebotes a) Kulturgeschichte sichern und erlebbar machen.<br />
D Regionale<br />
Produktion<br />
2. Ausbau eines vernetzten Marketings<br />
für Kulturangebote<br />
3. Förderung der regionaltypischen<br />
Baukultur<br />
1. Entwicklung und Förderung neuer<br />
regionaler Produkte und Produktionszweige<br />
2. Optimierung der Anbieterstrukturen<br />
und der Vermarktung regionaler<br />
Produkte<br />
3. Verstärkung der Vernetzung<br />
zwischen regionalen Produkten<br />
und Tourismus<br />
E Tourismus 1. Qualitätsverbesserung von Infrastruktur<br />
und Angeboten im Tourismus<br />
2. Optimierung von Öffentlichkeitsarbeit<br />
und Marketing<br />
3. Stärkung und Ausweitung des<br />
wassergebundenen und maritimen<br />
Tourismus<br />
b) Museen und Museumsarbeit weiterentwickeln.<br />
a) Innovative, vernetzende Vermarktungsstrategien entwickeln und<br />
realisieren.<br />
b) Regionalkulturelle Veranstaltungen entwickeln, durchführen und<br />
vermarkten.<br />
a) Regionaltypische Baukultur, regionales Handwerk und regionale<br />
Baustoffe erhalten, entwickeln und fördern.<br />
a) Neue Produkte regionaler Herkunft, Erzeugung und Verarbeitung<br />
entwickeln und vermarkten.<br />
a) Bedingungen für die Produktion regionaler Produkte verbessern<br />
und fördern.<br />
b) Strategien zur Vermarktung von regionalen Produkten entwickeln<br />
und fördern.<br />
a) Den Einsatz regionaler Produkte in Tourismuswirtschaft und<br />
Gastronomie fördern.<br />
a) Übernachtungsmöglichkeiten quantitativ ausbauen und qualitativ<br />
verbessern.<br />
b) Wegeinfrastruktur zur touristischen Nutzung erschließen, entwickeln<br />
und ausbauen.<br />
c) Be- und Ausschilderung im touristischen und kulturellen Bereich<br />
erweitern und verbessern.<br />
a) Strategien für eine gezielte Informationsverbreitung entwickeln.<br />
b) Tourismusakteure qualifizieren.<br />
a) Angebote und Infrastruktur im Boots-, Schiffs- und Wassertourismus<br />
entwickeln, ausbauen und fördern.<br />
Ökotop … Grüppen, Gräben Siele; Naturerleben<br />
Jadebusen --- Am Herzen der Natur,<br />
Pütten und Kopfweiden, Strandfliedermahd …<br />
Flussplätze an der Weser<br />
Schilflabyrinth, Birdwachtching-Zentrum, interaktives<br />
Wiesenvogelsuchspiel …<br />
Tidefenster Siellandschaft Wesermarsch<br />
Polderflächen, Installationen zur Sensibilisierung,<br />
anderes Wassermanagement, Wiedervernässung<br />
von Mooren zur CO2-Bindung …<br />
Dörfer der Siellandschaft mit Zukunft<br />
Erzählcafé, Gasthauskultur Wesermarsch, Historische<br />
Pflasterungen…<br />
Dorfladen, Bell-Bus …<br />
Leerstandskataster Baukultur Wesermarsch<br />
Gästehäuser, Übernachtungseinrichtung…<br />
„Leuchttürme“ der Siellandschaft Wesermarsch,<br />
Padd up Padd<br />
Erzählstühle, Museums-Marketing…<br />
Kulturleitstelle, Internetpräsenz, Kulturbotschafter…<br />
Leitfaden Baukultur, Route der Kirchen …<br />
Wesermarsch-Reet<br />
Regionalregal, Regionale Gerichte, Picknickkorb,<br />
Lammwolle-Nutzung, Fischprodukte…<br />
Wesermarsch-Spezialitätenzentrum<br />
landwirtschaftlicher Wegebau, Wesermarsch-<br />
Catering-Service, Online-Kaufhaus…<br />
Radler-Teller, Storchenbrot und Storchenmilch,<br />
Vesper-Rucksack…<br />
Radroute <strong>„Siellandschaft</strong>ssystem erleben“<br />
Wesermarsch-Zimmer, Alkoven-Scheune,<br />
Internetbuchungssystem, Naturerlebnis-Ranger…<br />
Flussplätze an der Weser<br />
Boots-Anlegestellen, Schifffahrten, Hydrobiking,…
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 1<br />
LEADER+ "Wesermarsch in Bewegung"<br />
Evaluationsbericht 2003 - 2007<br />
Übersicht:<br />
1 Vorbemerkungen .......................................................................................................................1<br />
2 Vorgehen zur Evaluierung .........................................................................................................2<br />
3 Projektumsetzung und Mitteleinsatz..........................................................................................3<br />
3.1 Mitteleinsatz nach Themenfeldern ...................................................................................3<br />
3.2 Projektumsetzung nach Themenfeldern...........................................................................4<br />
3.3 Projektqualitäten...............................................................................................................6<br />
3.4 Einschätzung zur künftigen Ausrichtung ..........................................................................7<br />
4 Wirkungen in der Region ...........................................................................................................8<br />
4.1 Ergebnisse der Zwischenevaluierung ..............................................................................8<br />
4.2 Befragungsergebnisse 2007.............................................................................................8<br />
4.3 Wirkungen der Projekte und Vernetzung der Themenfelder ........................................ 10<br />
5 Kooperationsprozess .............................................................................................................. 11<br />
5.1 Einschätzung zur Zusammenarbeit in der Region ........................................................ 11<br />
5.2 Institutionalisierung und Verstetigung der Kooperation ................................................ 13<br />
1. Vorbemerkungen<br />
Die Region Wesermarsch in Bewegung hat sich 2001 im landesweiten Wettbewerb als LEADER+-<br />
Region beworben.<br />
In ihrem regionalen Entwicklungskonzept wählte die Region das Oberthema "Inwertsetzung des Natur-<br />
und Kulturerbes" und erarbeitete vier Hauptziele für die Region:<br />
• Inwertsetzung der Themen Natur und Kultur,<br />
• Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren in unterschiedlichen Projekten,<br />
• Stärkung einer regionalen Identität in der Region und eines positiven Images über die Grenzen<br />
hinaus,<br />
• Integration der Themen Bildung und Jugend in allen Themenfeldern.<br />
Nachdem die Wesermarsch bei der ersten Auswahl der LEADER+-Regionen nicht zum Zuge gekommen<br />
war, konnte sie 2003 als LEADER-Region nachrücken und mit einem verkürzten Förderzeitraum<br />
in die Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes einsteigen.<br />
Als Themenfelder für die Aktivitäten im Rahmen von LEADER+ wurden im <strong>REK</strong> "Wesermarsch in Bewegung"<br />
folgende Bereiche abgegrenzt:<br />
Kultur Natur Bildung<br />
Tourismus Regionale Produkte Jugend<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 2<br />
2. Vorgehen zur Evaluierung<br />
Der regionale Entwicklungsprozess in der Wesermarsch wurde durch verschiedene Maßnahmen evaluiert.<br />
Die Evaluierungsergebnisse flossen in die Arbeit der LAG "Wesermarsch in Bewegung" ein und<br />
wurden als Grundlage für Entscheidungen zur weiteren strategischen Ausrichtung der Region genutzt.<br />
Dokumentation der Projektumsetzung durch das Regionalmanagement<br />
Das Regionalmanagement hat über den gesamten Zeitraum der Konzeptumsetzung hinweg kontinuierlich<br />
die Daten über den Mitteleinsatz und die Projektumsetzung gesammelt und dokumentiert und<br />
die jeweiligen Projekte den Zielen und Handlungsfeldern des regionalen Entwicklungskonzeptes zugeordnet.<br />
Auf diese Weise kann der Erfolg der Konzeptumsetzung und der zielgerichtete Mitteleinsatz<br />
nachvollzogen werden und es lässt sich ablesen, in welchen Bereichen die LAG Schwerpunkte bei der<br />
Projektumsetzung gesetzt hat. Die Ergebnisse der Dokumentation der Projektumsetzung wurden regelmäßig<br />
in der LAG präsentiert um auf dieser Grundlage die Umsetzungsergebnisse einzuschätzen<br />
und ggf. Kurskorrekturen im Entwicklungsprozess vorzunehmen.<br />
Im Jahr 2007 hat das Regionalmanagement zudem eine Projektevaluation durchgeführt und die Projekte<br />
hinsichtlich Ihrer Wirkungen und Effekte eingeschätzt. Die Ergebnisse sind in den vorliegenden<br />
Evaluationsbericht eingeflossen und in der Anlage dargestellt.<br />
Befragungen im Rahmen der Halbzeitbewertung<br />
In den Jahren 2003 und 2004 wurden in der Wesermarsch ausgewählte Mitglieder der LAG und ausgewählte<br />
weitere Akteure aus der Region zu ihrer Einschätzung zur Entwicklung in der Region seit<br />
2001 befragt. Dabei wurden 2003 und 2004 die selben Fragen an die selben Personen gestellt, um<br />
eine Veränderung der Einschätzung ermitteln zu können. Für die mit LEADER+-Mitteln in der Region<br />
umgesetzten Projekte sind diese Einschätzungen in der Wesermarsch nur bedingt aussagekräftig, da<br />
hier erst ab 2003 Fördermittel aus LEADER+ eingesetzt werden konnten. Die Ergebnisse wurden in<br />
der LAG präsentiert und sind in Kapitel 4.1 bzw. 4.2 in der Übersicht dargestellt.<br />
Imageanalyse Wesermarsch<br />
2005 wurde als LEADER+-Projekt eine Imageanalyse für die Wesermarsch durchgeführt, bei der in<br />
einer repräsentativen Telefonbefragung 400 Einwohnerinnen und Einwohner der Wesermarsch befragt<br />
wurden, zusätzlich wurden Expertengespräche mit neun regionalen Experten geführt. In diesen Befragungen<br />
von Akteuren aus der Region wurde auch die Bekanntheit von LEADER+ und von LEADER+-<br />
Projekten erfragt. Die Ergebnisse sind in die Evaluierung des LEADER+-Prozesses eingeflossen und<br />
sind in Kapitel 5 dargestellt.<br />
Im Rahmen der Imageanalyse wurden darüber hinaus im Rahmen einer Passantenbefragung auch<br />
400 Touristen in der Region befragt. Die Befragung bezog sich dabei jedoch allgemein auf Zufriedenheit,<br />
Aktivitäten, Assoziationen mit der Region, Wünsche und Verbesserungsvorschläge und ging nicht<br />
direkt auf LEADER+ oder damit verbundene Projekte ein. Sie kann jedoch bei einer Wiederholung der<br />
Befragung in der neuen Förderperiode als Vergleichsmaßstab herangezogen werden, um einzuschätzen,<br />
wie sich die Situation seit der ersten Befragung verändert hat.<br />
SWOT-Analyse-Workshops zu den Handlungsfeldern 2006<br />
Im Sommer 2006 wurden zu den Themenfeldern 'Regionale Produkte', 'Kultur', 'Natur' und 'Tourismus'<br />
SWOT-Analyse-Workshops durchgeführt, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in den<br />
LEADER+-Prozess eingebunden waren, Ergebnisse und Erfolge von LEADER diskutierten und Perspektiven<br />
für die weitere Zusammenarbeit erarbeiteten. Die Ergebnisse sind in die Ausrichtung des<br />
neuen <strong>REK</strong> <strong>„Siellandschaft</strong> <strong>Wesermarsch“</strong> eingeflossen. Die Ergebnisse hinsichtlich der Evaluierung<br />
der bisherigen Projektumsetzung sind in Kapitel 3.2 eingeflossen.<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 3<br />
Befragung von LAG und Kommunen 2007<br />
Zum Abschluss der Förderperiode und als Grundlage für die Ausarbeitung des neuen regionalen Entwicklungskonzeptes<br />
für die Wesermarsch beauftragte die Region das Büro KoRiS <strong>–</strong> Kommunikative<br />
Stadt- und Regionalentwicklung, die Zusammenarbeit in der Wesermarsch im Rahmen von LEADER+<br />
zu bewerten. Hierzu wertete KoRiS die Projektdaten der Geschäftsstelle aus und befragte die LAG-<br />
Mitglieder und die Kommunen der Region anhand eines Fragebogens zu ihrer Einschätzung zum LE-<br />
ADER+-Prozess, zur Arbeit in der LAG und zu Perspektiven für den neuen Förderzeitraum. Die Ergebnisse<br />
der Auswertung der 21 Fragebögen sind in die folgenden Ausführungen eingeflossen.<br />
Abschlussdokumentation<br />
Im April 2007 wurden die Ergebnisse der Projektumsetzung in der Wesermarsch im Rahmen von LE-<br />
ADER+ in einer Abschlussdokumentation zusammengestellt. Die Broschüre enthält eine umfassende<br />
Darstellung der umgesetzten Projekte in allen Themenfeldern und liefert auch Informationen zum Fördermitteleinsatz<br />
und zu den Projektträgern. Damit macht sie den Entwicklungsprozess im Rahmen von<br />
LEADER+ für die Öffentlichkeit transparent und die Erfolge des Fördermitteleinsatzes sichtbar. Auf<br />
diese Weise hatten alle Akteure bei der Zusammenarbeit zur Fortschreibung des <strong>REK</strong> für die Förderperiode<br />
2007-2013 auch das bisher Erreichte im Rahmen von LEADER+ vor Augen und konnten an<br />
die Ergebnisse und Erfahrungen anknüpfen. Die Broschüre ist ergänzend zu diesem Evaluationsbericht<br />
dem <strong>REK</strong> für die Siellandschaft Wesermarsch als Anlage beigefügt.<br />
3 Projektumsetzung und Mitteleinsatz<br />
3.1 Mitteleinsatz nach Themenfeldern<br />
Die LAG "Wesermarsch in Bewegung" hat 67 Projekte in einem verkürzten Förderzeitraum von April<br />
2003 bis Dezember 2006 initiiert und umgesetzt. Damit konnten bei Gesamtprojektkosten in Höhe von<br />
4.110.000 € EU-Fördermittel in Höhe von 2.055.000 € in der Region eingesetzt werden.<br />
Die Region Wesermarsch hat sich dem Oberthema "Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes" verpflichtet<br />
und die Strategie sowie die Projekte daran ausgerichtet. Bei der Mittelverteilung wird ersichtlich,<br />
dass 58 % der LEADER+-Förderung in Projekte flossen, die einen Bezug zum Themenfeld Kultur<br />
haben. 25 % der Fördermittel erhielten Projekte mit einem Bezug zum Themenfeld Tourismus. Für<br />
Projekte mit Bezug zu den Themenfeldern Natur (7 %), Regionale Produkte (3 %), Bildung (3 %) und<br />
Jugend (4 %) wurden in erheblich geringerem Umfang Mittel aus LEADER+ investiert (vgl. Abb. 1).<br />
Finanzbudget<br />
5.000.000<br />
4.000.000<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
-<br />
Finanzmittelverteilung nach Themenfeldern<br />
100%<br />
Gesamt<br />
58%<br />
Kultur<br />
25%<br />
Tourismus<br />
KoRiS 08/2007<br />
7%<br />
Natur<br />
3%<br />
Regionale Produkte<br />
Abb.1: Mitteleinsatz nach Themenfeldern (Hinweis: Projekte können einen Bezug zu mehreren Themenfeldern<br />
aufweisen)<br />
3%<br />
Bildung<br />
4%<br />
Jugend
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 4<br />
3.2 Projektumsetzung nach Themenfeldern<br />
Themenfeld Natur<br />
Dem Themenfeld Natur können insgesamt fünf Projekte zugerechnet werden, die im Rahmen von<br />
LEADER+ umgesetzt wurden. In zwei dieser Projekte waren mehr als drei Kommunen eingebunden,<br />
davon ist das Projekt "Kiekpadd Wesermarsch" durch das Regionalmanagement als besonders wichtiges<br />
Leitprojekt eingestuft worden. Als Leitprojekte wurden Projekte gekennzeichnet, die im gesamten<br />
Aktionsgebiet stattfanden und wichtig für die strategische Umsetzung des <strong>REK</strong> „Wesermarsch in Bewegung“<br />
waren. Weiterhin sind dem Themenfeld drei Kleinprojekte zuzuordnen, die mit Initiativen und<br />
Akteuren vor Ort realisiert wurden. Insgesamt wurden 286.000 € im Themenfeld Natur investiert.<br />
Hiermit konnten erste Ansätze realisiert werden, von denen auch positive Wirkungen auf den Bereich<br />
Tourismus übergingen.<br />
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SWOT-Analyse-Workshops zum Themenfeld Natur im<br />
Sommer 2006 bewerteten die Arbeit insgesamt positiv. Aus ihrer Sicht ist es gelungen, das vorhandene<br />
Naturpotenzial aufzugreifen und thematisch aufzuarbeiten und ein flächendeckendes Angebot an<br />
interessanten Naturbeobachtungspunkten in der gesamten Wesermarsch zu realisieren. Positiv vermerkt<br />
werden die Bezüge zum Themenfeld Tourismus, da es gelungen sei, die Naturerlebnisangebote<br />
touristisch zu vermarkten. Daneben wird auch die als gelungen eingestufte Verknüpfung von Naturschutz<br />
und (land)wirtschaftlichen Aspekten als Erfolgsfaktor der Region gesehen, wobei die LEA-<br />
DER+-Aktivitäten an die Erfahrungen anknüpfen konnten, die im Rahmen der Umsetzung des Feuchtgrünlandschutzprogramms<br />
in der "Stollhammer Wisch" gesammelt wurden. Die Teilnehmerinnen und<br />
Teilnehmer des Workshops waren der Ansicht, dass das Potenzial für attraktive Projekte im Themenfeld<br />
Natur bislang nur zu einem sehr geringen Anteil ausgeschöpft werden konnte.<br />
Themenfeld Kultur<br />
Das Themenfeld Kultur weist 18 Projekte, mit einer Gesamtsumme von 2.397.000 € auf. In seiner Bedeutung<br />
liegt es mit dem Handlungsfeld Natur gleichauf.<br />
Drei Projekte sind durch das Regionalmanagement als Leitprojekte eingestuft worden. Sechs Projekte<br />
sind als Kooperationsprojekte, unter Einbeziehung von mindestens drei Kommunen umgesetzt worden<br />
und vier finanzstarke Projekte konnten in besonderem Umfang Fördermittel für die Region binden. Im<br />
Rahmen der Projektumsetzung wurden drei Vereine und zwei Arbeitsgruppen neu etabliert. Eine innovative<br />
Kulturveranstaltungsreihe, das kulturelle Bauerbe, kulturelle endogene Potentiale und die Museen<br />
haben von LEADER profitiert.<br />
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SWOT-Analyse-Workshops zum Thema Kultur waren sich<br />
einig, dass die Arbeit insgesamt positiv zu bewerten ist. Neben der Verbesserung der Kommunikation<br />
zwischen den Kulturschaffenden und daraus entstandenen Synergien konnten aus ihrer Sicht zahlreiche<br />
Infrastruktureinrichtungen und Einrichtungen nachhaltig gestärkt werden und von den Maßnahmen<br />
profitieren. Dadurch wurde aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein Marketingeffekt<br />
erzielt, durch den die positive überregionale Wahrnehmung der Region im Bereich Kultur verbessert<br />
wurde. Dazu habe auch die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Bereich Tourismus beigetragen.<br />
Themenfeld Regionale Produkte<br />
Der Bereich der Regionalen Produkte wird als wichtiges Themenfeld im Konzept "Wesermarsch in<br />
Bewegung" benannt. Diese Bedeutung spiegelt sich nicht in der geringen Anzahl von drei Projekten<br />
wider, die in diesem Handlungsfeld umgesetzt wurden. In die drei Projekte wurde durch die Region<br />
eine Gesamtsumme von 100.000 € investiert. Das diesem Themenfeld zugeordnete Leitprojekt „Melkhus<br />
<strong>Wesermarsch“</strong> ist jedoch nach Einschätzung der Mehrzahl der Akteure einer der größten Erfolge<br />
der LAG, das auch eine intensive Verknüpfung zum Tourismus herstellen konnte. Mit dem Projekt<br />
"Marketingmaßnahmen für Regionalprodukte" konnte in diesem Handlungsfeld ein Projekt ohne Un-<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 5<br />
terstützung durch LEADER+-Mittel umgesetzt werden. Die Finanzierung wurde aus dem Finanzierungstopf<br />
"Wesermarsch in Bewegung" (s. Kap. 5) und mit der Unterstützung der Centralen Marketing-<br />
Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA) realisiert.<br />
Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SWOT-Analyse-Workshops zum Themenfeld "Regionale<br />
Produkte" hoben das Projekt Melkhus als besonders erfolgreich heraus, nicht zuletzt, weil die<br />
Einrichtung der zehn Melkhüs besonders durch Touristen sehr gut angenommen wurde. Durch das<br />
Projekt werde auf diese Weise die sinnliche Wahrnehmung der touristischen Region Wesermarsch<br />
gefördert und auch zur Inwertsetzung der Kulturlandschaft beigetragen. Insgesamt hat sich aus Sicht<br />
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die verschiedenen Projekte eine Kontinuität und Kultur der<br />
Zusammenarbeit etabliert: neue Kontakte konnten geknüpft, bestehende gestärkt werden. Aus der<br />
guten Zusammenarbeit sei eine Reihe von Projektideen entstanden, die sich allerdings zu einem großen<br />
Teil als nicht förderfähig erwiesen haben.<br />
Themenfeld Tourismus<br />
Im Themenfeld Tourismus wurden 28 Projekte mit einer Gesamtsumme von 984.000 € umgesetzt.<br />
Dabei sind zwölf Projekte als Kooperationsprojekte einzustufen und fünf Projekte wurden von der LAG<br />
als Leitprojekte identifiziert, die den Prozess maßgeblich vorangetrieben haben. Die Projekte im Themenfeld<br />
Tourismus haben, bezogen auf die eingesetzten Mittel, nicht den Umfang der Aktivitäten im<br />
Themenfeld Kultur, wobei jedoch die enge Verflechtung der Themenfelder Natur, Kultur und Regionale<br />
Produkte mit dem Tourismus zu berücksichtigen ist. Im Themenfeld Tourismus wurden vorrangig viele<br />
kleine Projekte umgesetzt, was von Seiten des Regionalmanagements auch darauf zurückgeführt<br />
wird, dass in der Region Wesermarsch bisher die organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen<br />
für die Umsetzung größerer touristischer Projekte fehlen.<br />
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SWOT-Analyse-Workshops zum Themenfeld Tourismus<br />
stimmten darin überein, dass ohne LEADER+ eine ganze Reihe von touristischen Themen nicht hätte<br />
bearbeitet werden können. Durch die LEADER-Projekte sei es gelungen, das vielfältige touristische<br />
Angebot der Wesermarsch zu ergänzen und aufzuwerten. Zwar würden die geschaffenen Angebote<br />
überwiegend touristische Nischen bedienen (Natur-/Kulturtourismus im ländlichen Raum) und nicht die<br />
breite Masse ansprechen. Diese Vorhaben seien deshalb aber nicht weniger wichtig. Ähnlich wie beim<br />
Facheinzelhandel einer Innenstadt bildeten sie eine notwendige Ergänzung zu den vorhandenen Highlights<br />
und gehörten dauerhaft in die Tourismuskonzeption der Wesermarsch. Nach der Einschätzung<br />
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei es die große Angebotsvielfalt die es erst ermögliche, Dauergäste<br />
zu gewinnen, da diese die Angebotsvielfalt während ihres ersten Aufenthaltes in der Regel nur<br />
teilweise wahrnehmen könnten und daher auch in den folgenden Jahren immer etwas Neues finden.<br />
Im Rahmen von LEADER+ sei es gelungen, durch die Projekte touristische Anbieter zu motivieren<br />
und zusätzliche touristische Angebote und Dienstleistungen zu entwickeln. In diesem Bereich werden<br />
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops jedoch auch noch weitere ungenutzte Potenziale<br />
gesehen.<br />
Einige LEADER+-Projekte wurden als besonders erfolgreich hervorgehoben, da sie nachweislich zu<br />
einer Erhöhung des Gästeaufkommens beigetragen hätten. Aushängeschild seien dabei die Melkhüs<br />
sowie das Bronzezeithaus, welches seit seiner Eröffnung bereits ca. 4.000 Gäste verzeichnen konnten.<br />
Dabei kämen auch zunehmend mehr Gäste von außerhalb in die Wesermarsch. So seien beispielsweise<br />
2/3 aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Gästeführungen im Raum Burhave erstmalig<br />
in der Wesermarsch.<br />
Durch die LEADER+-Projekte und die ergänzenden Angebote; die geschaffen wurden, ist es aus Sicht<br />
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SWOT-Analyse-Workshops gelungen, einen „roten Faden“<br />
in die Angebotsvielfalt hineinzubringen. Es sei nun für Außenstehende wesentlich greifbarer, was die<br />
Wesermarsch auszeichne. Des Weiteren hätten einige der Vorhaben zu einer positiveren Wahrnehmung<br />
der Wesermarsch außerhalb der Region geführt (z.B. Himmelfahrt Wesermarsch).<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 6<br />
Als zentrales Erfolgskriterium hoben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das individuelle Engagement<br />
der Projektbeteiligten hervor. Auch eine das Projekt begleitende professionelle Pressearbeit habe<br />
in einigen Fällen maßgeblich zum Erfolg der Vorhaben beigetragen. Darüber hinaus wurde es als<br />
Vorteil der Projekte gesehen, dass sie individuell nutzbar seien und von Interessierten ohne großen<br />
Aufwand wahrgenommen werden könnten. Ein besonderer Erfolgsfaktor sei offensichtlich auch die<br />
Ungewöhnlichkeit und Authentizität eines Projektes. So würden etwa die Melkhüs wie auch das Bronzezeithaus<br />
Neugierde wecken und würden von den Gästen z.B. als 'spannend' oder 'urig' wahrgenommen.<br />
Themenfeld Bildung<br />
Im Themenfeld Bildung sind zwei Schwerpunktprojekte mit einer Summe von 70.000 € realisiert worden.<br />
Die beiden Projekte "Lernort Bauernhof" und "Zukunftsmarkt Radtourismus" konnten ergänzend<br />
ohne LEADER+-Förderung mit Hilfe des Finanztopfes "Wesermarsch in Bewegung" umgesetzt werden.<br />
Das Thema Bildung spielt jedoch auch in den Projekten der anderen Handlungsfelder eine Rolle.<br />
Im Prozess zeigte sich nach Einschätzung des Regionalmanagements, dass die Qualifizierungsansätze<br />
von den Akteuren sehr positiv aufgenommen wurden und die Projekte nachhaltig verbesserten.<br />
Das Thema Qualifizierung sollte daher aus Sicht der LAG "Wesermarsch in Bewegung" auch zukünftig<br />
eine wichtige Rolle spielen.<br />
Themenfeld Jugend<br />
Im Themenfeld Jugend ist mit dem Projekt "Aufwachen … jetzt wird geträumt" ein Projekt direkt mit<br />
LEADER+-Mitteln unterstützt worden. Insgesamt sind 72.000 € in dieses Leit- und Kooperationsprojekt<br />
geflossen. Die evangelische Kirche hat mit Jugendlichen in kreativer Art und Weise eine Perspektive<br />
für ihre Heimat erarbeitet. Die LAG wollte mit diesem Projekt unterstützen, dass die Jugendlichen<br />
zur intensiven Auseinandersetzung mit der Wesermarsch als ihrer Heimat angeregt werden. Das Projekt<br />
konnte nach Ansicht der Akteure erfolgreich umgesetzt werden. Nach Ansicht der Akteure konnte<br />
mit diesem einen Projekt der Bedeutung des Themas Jugend für die Entwicklung der Region nur sehr<br />
unzureichend Rechnung getragen werden. Es zeigte sich jedoch im Förderzeitraum, dass gerade in<br />
diesem Handlungsfeld zahlreiche Ideen und Projektansätze häufig an der Frage der Förderfähigkeit<br />
scheiterten.<br />
3.3 Projektqualitäten<br />
Das Regionalmanagement hat kontinuierlich Daten zur Projektumsetzung gesammelt und ausgewertet<br />
und sieben Kriterien entwickelt, anhand derer die Qualität der Projekte und ihr Beitrag zur Umsetzung<br />
der Entwicklungsstrategie ermittelt wurde:<br />
• Inwertsetzungsfaktor als Gradmesser für die Strategieumsetzung<br />
• Kooperationsfaktor bei der Einbindung von mind. drei kommunalen Gebietskörperschaften<br />
• Innovationsfaktor für neue Verfahren und Produkte sowie Umsetzung und Finanzierung<br />
• Wertschöpfungsfaktor von Projekten<br />
• Zukunftspotenzial von Projektansätzen durch Entwicklungsmöglichkeiten<br />
• Identitätsfaktor als Bewusstseinsanker für kulturelle und natürliche Werte<br />
• Imagefaktor durch Projekte mit positiver Außendarstellung<br />
Einen guten Überblick zur Projektqualität gibt die Einschätzung anhand der sieben Kriterien vom Regionalmanagement<br />
ermittelten Faktoren (vgl. Abb. 2).<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 7<br />
Wertschöpfungsfaktor<br />
Imagefaktor<br />
Zukunftspotenzial<br />
Innovationsfaktor<br />
Kooperationsfaktor<br />
Identitätsfaktor<br />
Inwertsetzungsfaktor<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
Abb. 2: Anteil der Projekte, die das jeweilige Projekteinstufungskriterium erfüllten; in Prozent<br />
Aus der Darstellung in Abb. 2 wird ersichtlich, dass 90 % der Projekte einen klaren Bezug zum Thema<br />
"Inwertsetzung des Natur- und des Kulturerbes" aufweisen. Dies korrespondiert mit dem hohen Anteil<br />
der Projekte, die das Kriterium "Identitätsfaktor" erfüllen und damit dazu beitragen das Bewusstsein<br />
der Einwohnerinnen und Einwohner der Region für das regionale Natur- und Kulturerbe zu schärfen.<br />
Das Kriterium "Imagefaktor" zeigt demgegenüber auf, welche Projekte zu einer positiven Darstellung<br />
der Region nach außen beitragen, es wurde von 35% erfüllt.<br />
42% aller Projekte sind in kommunalen Kooperationen mit mindestens drei Gemeinden realisiert worden,<br />
womit diese das Kriterium "Kooperationsfaktor" erfüllen. Weiterhin hatten fast die Hälfte aller Projekte<br />
einen innovativen Charakter in Bezug auf neue Verfahren, Produkte, Umsetzung oder Finanzierung.<br />
35 % der Projekte erfüllen das Kriterium "Zukunftspotenzial" und zeigen somit Entwicklungsmöglichkeiten<br />
über die Förderperiode hinaus auf. Das Kriterium "Wertschöpfung" das darauf hinweist, dass<br />
ein Projekt einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
leistet, wurde von lediglich 5% aller Projekte erfüllt.<br />
3.4 Einschätzung zur<br />
künftigen Ausrichtung<br />
Im Rahmen der Befragung<br />
der Kommunen und der<br />
LAG im Frühjahr 2007 wurden<br />
die Akteure auch nach<br />
ihrer Einschätzung zur Bedeutung<br />
der Themenfelder<br />
des <strong>REK</strong> 2001 für die weitere<br />
Entwicklung der Region<br />
in der Förderperiode<br />
2007-2013 befragt. Aus der<br />
Auswertung der Einstufungen<br />
ergab sich, dass die<br />
Rangfolge aus Sicht der<br />
Akteure sehr unterschied-<br />
lich ausfiel. Dies führt dazu, dass in der Zusammenführung die vier thematischen Themenfelder Natur,<br />
Kultur, Regionale Produkte und Tourismus relativ gleichrangig erscheinen, während die Themenfelder<br />
Jugend und Bildung etwas geringer gewichtet werden (vgl. Abb. 3). Am höchsten eingestuft wird das<br />
Themenfeld Tourismus.<br />
KoRiS 08/2007<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Kultur<br />
Tourismus<br />
Natur<br />
Regionale Produkte<br />
Bildung<br />
Jugend<br />
Abb. 3: Gewichtung der Handlungsfelder für die zukünftige Entwicklung<br />
der Region Wesermarsch
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 8<br />
Als wichtige Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung nannten die Akteure folgende Punkte:<br />
• Identität und Selbstbewusstsein stärken<br />
• Tourismusangebot ausbauen<br />
• Vermarktung verbessern<br />
• Arbeitsplätze sichern und schaffen<br />
• Wirtschaftsentwicklung initiieren und<br />
diversifizieren<br />
• Zusammenarbeit weiter ausbauen<br />
• Verkehrsanbindung verbessern<br />
4 Wirkungen in der Region<br />
4.1 Ergebnisse der Zwischenevaluierung<br />
KoRiS 08/2007<br />
• Ausbau von Kinder- und Jugendangeboten<br />
und Bildung<br />
• Lebensqualität im demografischen Wandel<br />
verbessern und bekannt machen<br />
• Belebung der Ortskerne<br />
• Barrierefreiheit<br />
• Überregionale Leuchtturmprojekte<br />
• Finanzielle Handlungsmöglichkeiten der<br />
Kommunen wiederherstellen<br />
Im Rahmen der Zwischenevaluierung wurde, wie bereits unter 2 dargestellt, durch die Firma MCON<br />
ermittelt, wie die Situation in der Region von LAG-Mitgliedern und ausgewählten Akteuren aus der<br />
Region in den Jahren 2003 und 2004 eingeschätzt wurde. Dabei wurden für 2003 17 und für 2004 19<br />
Fragebögen ausgewertet. Die Veränderungen in den Einschätzungen lassen sich in der Wesermarsch<br />
nur bedingt auf die Auswirkungen von LEADER+ zurückführen, da mit der Umsetzung von LEADER+-<br />
Projekten in der Wesermarsch erst 2003 begonnen wurde. Aufgrund der geringen Aussagekraft soll<br />
daher an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet werden. Sehr viel aufschlussreicher zeigt<br />
sich dem gegenüber eine Befragung aus dem Jahr 2007, deren Ergebnisse im nachfolgenden Kapitel<br />
wiedergegeben werden.<br />
4.2 Befragungsergebnisse 2007<br />
Im Rahmen der Befragung der LAG-Mitglieder und der<br />
Kommunen im Frühjahr 2007 wurden die Akteure auch zu<br />
ihrer Einschätzung zur Entwicklung im Zeitraum seit 2001<br />
befragt. Neben den Angaben auf einer Skala konnten die<br />
Befragten bei den meisten Fragen auch Kommentare<br />
ergänzen.<br />
Auf die Frage bezüglich der kommunalen Entwicklung<br />
gab eine Kommune eine "stark verbesserte" kommunale<br />
Situation an, die durch eine positive wirtschaftliche und<br />
touristische Entwicklung begründet wurde. Sieben Kommunen<br />
stuften die Entwicklung ihrer Kommune im Zeit-<br />
rahmen von 2001 bis 2006 als "etwas verbessert" ein<br />
(s. Abb. 4). Gründe für diese Einschätzungen wurden<br />
beispielsweise bei den LEADER-Projekten gesehen, die<br />
zu einer verbesserten Situation innerhalb der Kommunen<br />
beigetragen haben. Neben einer verbesserten<br />
Selbstwahrnehmung wurden zudem neu gewonnene<br />
finanzielle Spielräume angegeben. Zwei Kommunen<br />
gaben an, dass ihre Situation gleich geblieben sei während<br />
eine Kommune im Zeitraum eine leichte Verschlechterung<br />
wahrgenommen hatte.<br />
Eine Kommune stufte den Einfluss von LEADER+ auf<br />
die kommunale Entwicklung als 'sehr hoch' ein und gab<br />
18%<br />
27%<br />
9%<br />
0%<br />
0%<br />
46%<br />
9%<br />
9%<br />
64%<br />
18%<br />
stark verbessert<br />
etwas verbessert<br />
gleich geblieben<br />
etwas verschlechtert<br />
stark verschlechtert<br />
Abb. 4: Einschätzung der Entwicklung in den<br />
Kommunen 2001-2006<br />
1 sehr hoch<br />
2 hoch<br />
3 eher weniger hoch<br />
4 gering<br />
5 sehr gering<br />
Abb. 5: Einfluss von LEADER+ auf die Entwicklung<br />
in der Kommune
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 9<br />
dafür als Grund den Erhalt bedrohter Gebäude und Exponate durch ein LEADER+-Projekt an. Einen<br />
"hohen" Einfluss konnten aufgrund von Kooperationsprojekten (z.B. Melkhus) und Leuchtturmprojekten<br />
(z.B. Moorseer Mühle) zwei Kommunen feststellen. Fünf Kommunen stuften den Einfluss von LE-<br />
ADER+ auf die kommunale Entwicklung jedoch als "eher weniger hoch" ein. Angaben wie "es muss<br />
noch viel gemacht werden" oder "die LEADER-Projekte haben vor allem die Situation der Region verbessert"<br />
sowie "LEADER+ hat durch verschiedene kleinere Einzelmaßnahmen Akzente gesetzt" wurden<br />
als Erläuterungen zu dieser Einschätzung genannt. Drei Kommunen gaben einen "geringen" Einfluss<br />
von LEADER auf die Entwicklung der Kommune an (vgl. Abb. 5).<br />
Auf die Frage nach dem Beitrag von LEADER+ auf die Bereiche Beschäftigung, Chancengleichheit<br />
von Frauen und Männern,<br />
Umweltschutz, Kooperation<br />
in der Region und Kultur<br />
wurde ein positiver Betrag<br />
insbesondere in den<br />
Bereichen Kooperation und<br />
Kultur benannt (s. Abb. 6).<br />
Im Bereich Umweltschutz<br />
konnten nur sechs Befragte<br />
positive Wirkungen erkennen<br />
während auf die<br />
Bereiche "Chancengleichheit<br />
von Männern und<br />
Frauen" sowie "Beschäftigung"<br />
überwiegend kein<br />
Beitrag festgestellt werden<br />
konnte.<br />
Die befragten Wirtschafts-<br />
und Sozialpartner konnten<br />
in größerem Umfang auch<br />
positive Auswirkungen von<br />
LEADER+ in den beiden<br />
zuletzt genannten Bereichen<br />
feststellen (vgl. Abb.<br />
7)<br />
Die Frage nach dem Einfluss<br />
von LEADER+ auf die<br />
Entwicklung der Situation<br />
der Region Wesermarsch<br />
beantworteten 70% der<br />
Befragten Wirtschafts- und<br />
Sozialpartner mit "hoch",<br />
20% gaben sogar an, einen<br />
"sehr hohen" Einfluss<br />
von LEADER+ bemerkt zu<br />
haben (s. Abb. 8). Als ausschlaggebend<br />
für die positive<br />
Einschätzung wurden<br />
Kultur<br />
Kooperation in der<br />
Region<br />
Umweltschutz<br />
Chancengleichheit<br />
von Männern und<br />
Frauen<br />
Beschäftigung<br />
die Vernetzung der Akteure, die Ermöglichung von vielen Projekten (besonders im kulturellen Rahmen)<br />
sowie die Förderung des Tourismus genannt.<br />
Auf die Frage, welche Projekte besonders dazu beigetragen haben, die Entwicklungsziele der LEA-<br />
DER+-Region Wesermarsch zu erreichen, nannten die Akteure eine Vielzahl von Projekten. Am häufigsten<br />
wurden dabei die folgenden Projekte genannt:<br />
KoRiS 08/2007<br />
0 2 4 6 8 10 12<br />
positiv<br />
eher positiv<br />
kein Beitrag<br />
eher negativ<br />
negativ<br />
Abb. 6: Beitrag von LEADER+ für die Bereiche aus Sicht der Kommunen<br />
Kultur<br />
Kooperation in der<br />
Region<br />
Umweltschutz<br />
Chancengleichheit<br />
von Männern und<br />
Frauen<br />
Beschäftigung<br />
0 2 4 6 8 10 12<br />
positiv<br />
eher positiv<br />
kein Beitrag<br />
eher negativ<br />
negativ<br />
Abb. 7: Beitrag von LEADER+ für die Bereiche aus Sicht der Wirtschafts-<br />
und Sozialpartner
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 10<br />
• Melkhus<br />
• Himmelfahrt<br />
• Münstermann<br />
• Bronzezeithaus<br />
• Ochsen- und Lammwochen<br />
• Wege ins Moor<br />
• Sand' Art <strong>–</strong> Festival<br />
• Moorseer Mühle<br />
• Maritime Wege<br />
4.3 Wirkungen der Projekte und Vernetzung der Themenfelder<br />
Die einzelnen umgesetzten Projekte wurden im Jahr 2007 zudem einer Bewertung durch das Regionalmanagement<br />
hinsichtlich ihrer Wirkungen und ihrer abstrahierten Effekte unterzogen. Die Ergebnisse<br />
dieser Bewertung sind der Übersicht im Anhang zu entnehmen (siehe Anlage).<br />
Als weitere wichtige Wirkung der Projektumsetzung ist die Vernetzung der einzelnen Themenfelder in<br />
der Wesermarsch erreicht worden, die es ermöglichte zahlreiche Synergieeffekte für die Entwicklung<br />
der Region zu nutzen.<br />
So ist es aus Sicht der LAG Akteure gelungen, über den Tourismus die Potentiale im Natur und Kulturerbe<br />
in Wert zu setzen, indem die Projekte durch Printmedien und Internet touristisch vermarktet<br />
wurden. In der touristischen Vermarktung konnte zudem im Rahmen der LEADER+-Projekte eine<br />
Qualitätssteigerung in Inhalt und Layout erreicht werden. Die Region Wesermarsch hat zur Außendarstellung<br />
ein Corporate Design in den Farben grün und blau entwickelt.<br />
Die Vernetzung zwischen den Themenfeldern Regionale Produkte und Tourismus konnte nur punktuell<br />
realisiert werden, da die Förderfähigkeit im Bereich der Regionalen Produkte durch EU-Vorgaben<br />
begrenzt war. Mit Unterstützung des Finanzierungstopfes "Wesermarsch in Bewegung" und Drittmitteln<br />
konnten jedoch auch hier eine Vernetzung und die Umsetzung von Projekten realisiert werden.<br />
Hierdurch bot sich für den Tourismus der entscheidende Vorteil, dass die Region auch sinnlich und<br />
kulinarisch wahrgenommen werden kann. Dies waren weitere Schritte zu einer qualitätsorientierten<br />
Tourismusentwicklung dieser Region.<br />
Zwischen den Themenfeldern Kultur und Tourismus entstanden ebenfalls intensive Verflechtungen.<br />
Die Museen der Wesermarsch nehmen im Kultursektor eine wichtige Stellung ein. Durch die Restaurierung<br />
und Modernisierung der Häuser wurde eine Grundlage für die Steigerung der Gästezahlen<br />
geschaffen, die sich auch positiv auf den Bereich Tourismus auswirkt.<br />
Nachfolgend werden anhand einer Auswahl von Projekten die Wirkungsmechanismen im Prozess<br />
"Wesermarsch in Bewegung" und die Verflechtungen zwischen den Themenfeldern erläutert:<br />
• Melkhus Wesermarsch: Dieses Projekt <strong>–</strong> Milchausschank und touristische Information in grünen<br />
Holzhäuschen auf landwirtschaftlichen Betrieben - ist eines der erfolgreichsten Projekte von "Wesermarsch<br />
in Bewegung". Es wird von den Gästen sehr gut angenommen, schafft eine enge Verknüpfung<br />
zwischen den Themenfeldern Regionale Produkte und Tourismus und es ist überregional<br />
bekannt. Der Wertschöpfungsfaktor ist in dem Projekt verankert und auch eine Fortentwicklung<br />
durch die Initiierung eines Mobilen Melkhus ist sichergestellt.<br />
• Bronzezeithaus Wesermarsch: Bei diesem finanzstarken Projekt <strong>–</strong> Nachbau eines 5.000 Jahre<br />
alten Bauernhauses in experimenteller Bauweise und anschließender touristischer Nutzung -<br />
konnte nur eine Realisierung über den Finanzierungstopf "Wesermarsch in Bewegung" erfolgen,<br />
um in einer finanzschwachen Kommune den Verein als Projektträger zu unterstützen. Zahlreiche<br />
KoRiS 08/2007<br />
10%<br />
70%<br />
0%<br />
0%<br />
20%<br />
1 sehr hoch<br />
2 hoch<br />
3 eher weniger hoch<br />
4 gering<br />
5 sehr gering<br />
Abb. 8: Einfluss von LEADER+ auf die Entwicklung<br />
der Region aus Sicht der Wirtschafts-<br />
und Sozialpartner
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 11<br />
Aktivitäten von der Gästeführerschulung bis zur Einbindung von Jugendlichen sind nach der Fertigstellung<br />
dieses identitätsstiftenden archäologischen Gebäudes entwickelt worden, wodurch die<br />
Themenfelder Kultur, Tourismus, Bildung und Jugend eng miteinander verknüpft wurden.<br />
• Himmelfahrt Wesermarsch: Die Konzipierung und die Initiierung einer innovativen Kulturveranstaltungsreihe<br />
unter dem Titel "Himmelfahrt Wesermarsch" mit einer Vernetzung von Aktivitäten in der<br />
gesamten Region hat die Wesermarsch überregional bekannt gemacht. Mit der Verknüpfung von<br />
Tradition und Moderne bei der Umsetzung von Kulturveranstaltungen konnte die Region effektiv<br />
auf sich aufmerksam machen und die Themen Kultur und Tourismus effektiv verbinden. Die<br />
Grundfinanzierung wird inzwischen vom <strong>Landkreis</strong> Wesermarsch übernommen und das Projekt<br />
wird unabhängig von LEADER+ fortgeführt.<br />
• „Auf den Spuren von Münstermann“: Mit diesem Projekt wurde ein berühmter Bildschnitzer des<br />
Mittelalters dieser Region wieder entdeckt, konzeptionell aufgearbeitet sowie Marketing und Qualifizierung<br />
professionell umgesetzt. In der Kooperation lokaler und regionaler kirchlicher, kultureller<br />
und touristischer Organisationen sowie Qualifizierungseinrichtungen konnte ein qualitativ hochwertiges<br />
Produkt entwickelt werden. Es stößt auf große Resonanz bei zahlreichen kulturellen Zielgruppen<br />
und schafft insbesondere eine Verknüpfung zwischen den Themenfeldern Kultur und Bildung.<br />
• Unsichtbare Sehenswürdigkeiten - Langwarden: Ein finanziell kleines Projekt zur Belebung eines<br />
historischen Ortes - Schlacht bei Langwarden - mittels künstlerischer Mittel durch Skulpturen und<br />
einer audiovisuellen Umsetzung. Das Projekt wird innerhalb und außerhalb der Region sehr positiv<br />
wahrgenommen und stärkt die Verflechtung von Kultur und Tourismus.<br />
• Kiekpadd Wesermarsch: Das Projekt ist eine Naturbeobachtungsroute mit 25 Punkten. An den<br />
Punkten besteht die Möglichkeit zahlreiche typische Arten und Pflanzen der Region Wesermarsch<br />
kennen zu lernen. Es stößt bei Gästen und Touristen auf eine positive Wahrnehmung und vernetzt<br />
so die Themenfelder Natur und Tourismus. Die Akteure sehen insbesondere in diesem Themenfeld<br />
viele Ansätze, um das Projekt weiter zu entwickeln und auszubauen.<br />
5 Kooperationsprozess<br />
5.1 Einschätzung zur Zusammenarbeit in der Region<br />
Übergreifende Einschätzung<br />
In den vier Jahren des LEADER+-Prozesses haben über 20 Veranstaltungen zur Information und Mobilisierung<br />
in der Wesermarsch stattgefunden. Nicht eingerechnet sind dabei die Veranstaltungen im<br />
Rahmen der Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzeptes. Im LEADER+-Prozess hat sich<br />
nach Einschätzung des Regionalmanagements eine Kooperationskultur in der Region entwickelt und<br />
die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Die<br />
Kommunen haben wechselseitig Projektanträge für das gesamte Aktionsgebiet gestellt oder sie haben<br />
fachliches Know-how bei der Ausschreibung oder Umsetzung von Bauprojekten einfließen lassen,<br />
wovon das gesamte Gebiet profitierte. Die Projektplanung und Projektumsetzung wurde so zunehmend<br />
professioneller und effizienter.<br />
Auch bei der Befragung der LAG-Mitglieder und der Kommunen im Frühjahr 2007 wurde insbesondere<br />
die Vernetzung und Zusammenarbeit verschiedener Akteure, die gute interkommunale Zusammenarbeit,<br />
die Einbindung ehrenamtlich engagierter Akteure und die Stärkung der Identität und des Selbstbewusstseins<br />
der Region als positive Effekte von LEADER+ angeführt.<br />
Entsprechend dieser positiven Einschätzung haben sich die Kommunen und die LAG einstimmig dafür<br />
entschlossen, die Zusammenarbeit im Rahmen von Leader fortsetzen zu wollen.<br />
Im Rahmen der Imageanalyse der Wesermarsch wurde bei den Befragungen 2005 deutlich, dass die<br />
Aktivitäten der LAG "Wesermarsch in Bewegung" in der allgemeinen Bevölkerung nur wenig wahrge-<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 12<br />
nommen werden. Deutlich wurde jedoch auch, dass die Abgrenzung der LEADER-Region dem von<br />
der allgemeinen Bevölkerung wahrgenommenen Identifikationsraum Wesermarsch entspricht. Bei der<br />
Befragung der regionalen Experten in der Wesermarsch im Rahmen der Imageanalyse wurde deutlich,<br />
dass LEADER+ und die regionale Wirtschaftsförderung als positive Akteure wahrgenommen werden,<br />
die den Strukturwandel in der Region begleiten. Die Regionalen Experten betonten zudem, dass es<br />
notwendig sei, die Kooperation in der Region weiter auszubauen und Koordinierungsaktivitäten im<br />
Rahmen der regionalen Entwicklung besser zu bündeln.<br />
Erfolgsfaktoren bei der Zusammenarbeit der LAG<br />
Bei der Befragung der LAG-Mitglieder wurde die gute Zusammenarbeit der Kommunen untereinander<br />
und mit dem <strong>Landkreis</strong> als wesentlicher Erfolgsfaktor der LEADER+-Arbeit genannt. Die Befragten<br />
sahen zudem die produktive Arbeit in den Sitzungen, die auch auf die gute Vorbereitung durch den<br />
Regionalmanager zurückgeführt wird, als wesentlich für den Erfolg an. Ebenfalls positiv hervorgehoben<br />
wurde die professionelle und transparente Arbeitsweise des Regionalmanagements, das aus<br />
Sicht der Akteure einen guten Informationsfluss und eine informative Darstellung der Projektzusammenhänge<br />
gewährleistete, wodurch Einblicke in die Entwicklung und Umsetzung der Projekte vermittelt<br />
wurden. Als weitere Erfolgsfaktoren wurden die Zusammensetzung der LAG, die freundliche Atmosphäre,<br />
die eine Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bot, und gegenseitiges Verständnis<br />
und Akzeptanz genannt.<br />
Verbesserungsvorschläge für die Zusammenarbeit der LAG<br />
Als Verbesserungsvorschläge für die Zusammenarbeit der LAG wurde von befragten LAG-Mitgliedern<br />
genannt, dass eine größere Aktivität einzelner LAG-Mitglieder wünschenswert wäre und dass es gelte<br />
die interkommunale Kooperation weiter zu vertiefen. Bei der Projektauswahl wird eine stärkere Transparenz<br />
und die stärkere Gewichtung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit gewünscht. Der bereits eingesetzte<br />
Bewertungsbogen mit Punktesystem sollte aus Sicht der Akteure zukünftig stärker gewichtet<br />
werden und nicht nur empfehlenden Charakter haben. Die Projektumsetzung sollte auf breiteren<br />
Schultern verteilt werden und mehr Akteure sollten bei der Umsetzung beteiligt werden. Veranstaltungen<br />
mit großen Teilnehmerzahlen sollten aus Sicht der LAG-Mitglieder in stärkerem Maße für die regionale<br />
Entwicklung genutzt werden. Von Veranstaltungen mit überregionaler Wirkung versprechen sich<br />
die Akteure auch eine bessere Außenwirkung der Region und der realisierten Projekte.<br />
Einbindung neuer Partner in die Arbeit der LAG<br />
Die befragten LAG-Mitglieder äußerten in der Befragung den Wunsch, künftig in noch stärkerem Umfang<br />
Wirtschafts- und Sozialpartner in die Arbeit der LAG einzubinden. Als Beispiele wurden die Landfrauen<br />
und private Unternehmen genannt, wobei man sich von letzteren auch erhofft, dass sie z. B.<br />
durch finanzielle und nachhaltige Unterstützung mit zum Erfolg der Entwicklungsanstrengungen beitragen.<br />
Zudem besteht Interesse an der Einbindung der IHK, der Mittelstandsvereinigung, von "Haus<br />
und Grund", von Vereinen, von weiteren Tourismus-, Kultur- und Wirtschaftspartnern sowie von Kooperationspartnern<br />
von außerhalb der Wesermarsch.<br />
Wünsche für die weitere Zusammenarbeit<br />
Als Wünsche für die weitere Zusammenarbeit wurde von den Befragten ein Ausgleich für das hohe<br />
ehrenamtliches Engagement der WiSo-Partner, mehr Transparenz in den Entscheidungsprozessen<br />
und häufigeres Arbeiten in Workshops genannt. Zudem merkte ein Befragter an, dass die Mitglieder<br />
der LAG ihre Rolle als "Entscheider" ernster nehmen sollten. Ferner wurde der Wunsch geäußert, die<br />
gute Zusammenarbeit des Gremiums fortzusetzen und durch die Bildung von Arbeitsgruppen für einzelne<br />
Projekte die Zusammenarbeit bei der Projektumsetzung zu intensivieren.<br />
Für die Fortsetzung der Arbeit im Rahmen von Leader wünschen die befragten LAG-Mitglieder weitere<br />
Kooperationen auch mit Partnern aus anderen Regionen. Vor allem die Zusammenarbeit mit Nachbarregionen<br />
am Jadebusen oder entlang der Weser, wo naturräumliche Überschneidungen bestehen,<br />
wird als sinnvoll angesehen. Daneben werden auch Kooperationen mit Regionen als sinnvoll angese-<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 13<br />
hen, die in Strategie und Zielsetzung vergleichbar sind. Besonders unter dem Aspekt der hohen Bedeutung<br />
des Natur- und Kulturerbes sollten Partnerregionen gesucht werden, die bereits über Erfahrungen<br />
in diesem Bereich verfügen, die für die Wesermarsch genutzt werden könnten.<br />
5.2 Institutionalisierung und Verstetigung der Kooperation<br />
Institutionalisierung<br />
Ein wesentlicher Effekt im Prozess „Wesermarsch in Bewegung“ war die Initiierung neuer Organisationsformen<br />
im Rahmen der Projektrealisierung. So sind in den Jahren 2003-2006 insgesamt sechs<br />
Vereine gegründet worden. Daneben formierten sich drei informelle Zusammenschlüsse, die durch<br />
ihre Arbeit die Region profilieren und Projekt initiieren:<br />
• Vereine:<br />
proRegion Wesermarsch/Oldenburg e.V., Literaturplus e.V., Bronzezeithaus e.V.,<br />
Wege zum Moor e.V., Himmelfahrt Wesermarsch e.V., Region Unterweser e.V.<br />
• Informelle Arbeitsgruppen und Kreise:<br />
AK Baukultur, Melkhusverbund, Verbund der Museen in der Wesermarsch.<br />
Gemeinsamer Finanzierungstopf<br />
Eine Besonderheit der LAG "Wesermarsch in Bewegung" ist der Finanzierungstopf "Wesermarsch in<br />
Bewegung" in den alle Kommunen inklusive des <strong>Landkreis</strong>es jeweils 125.000 € also insgesamt<br />
1.250.000 € eingezahlt haben. Aus diesem Grundstock wurden Kooperationsprojekte und Leuchtturmprojekte<br />
kofinanziert und auch Projekte ohne LEADER+-Förderung finanziert. Die LAG konnte auf<br />
Grundlage der regionalen Entwicklungsstrategie Projekte für die Förderung aus dem gemeinsamen<br />
Finanzierungstopf auswählen. Durch dieses regionseigene Finanzierungsinstrument konnten wichtige<br />
Projekte besonders im Themenfeld Regionale Produkte (z.B. Lernort Bauernhof, Marketingmaßnahmen<br />
für Regionale Produkte) realisiert werden, die nicht durch EU-Förderrichtlinien abgesichert waren,<br />
und auf diese Weise einen Beitrag zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit leisteten. Die Bereitschaft zur<br />
Einzahlung in diesen Finanzierungstopf zeigt große Offenheit der Kommunen für die regionale Kooperation<br />
und untermauert das Vertrauen der Kommunen in die Entscheidungsstrukturen im Rahmen von<br />
LEADER+.<br />
In Zusammenhang mit der finanziellen Abwicklung im Rahmen von "Wesermarsch in Bewegung" ist<br />
der hohe Anteil an Drittmitteln durch Landesmittel und Stiftungen in Höhe von 600.000 € hervorzuheben.<br />
Der Umfang ist nach Einschätzung des Regionalmanagements auch darauf zurückzuführen, dass<br />
die Projektträger in Zusammenarbeit mit der LAG und durch die regionale Vernetzung größere und<br />
zugleich attraktive Vorhaben entwickeln konnten, die auch überregionale Institutionen auf die Wesermarsch<br />
aufmerksam machten. Insbesondere im Kultursektor konnten so die Wahrnehmung und das<br />
Image der Region entscheidend verbessert werden.<br />
KoRiS 08/2007
<strong>REK</strong> Siellandschaft Wesermarsch 2007-2013<br />
- IV -
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 14<br />
Anlage zum Evaluierungsbericht<br />
Ergebnisse der Wirkungsanalyse durch das Regionalmanagement im Rahmen der Projektevaluierung<br />
(Hinweis: in dieser Tabelle werden 53 Projekte, statt der insgesamt durchgeführten 67 Projekte, aufgelistet; diese Differenz ergibt sich dadurch, dass für die Darstellung<br />
Projekte zusammengefasst wurden.)<br />
Projektname Wirkungen Abstrahierte Effekte<br />
• Pilotprojekt<br />
• Abrundung touristisches Angebot<br />
• Keine Nachhaltigkeit<br />
• Projekt hat kaum Wirkungen entfaltet. Dissens zwischen Qualität der Wege<br />
und Qualität als reiterliche Region / reiterliche Aktivitäten<br />
• Keine ausreichende Aktivität bei den Akteuren und kein ausreichendes Marketing<br />
in der Breite und Tiefe = Ergebnis Befragung<br />
1. Reitwegenetz Wesermarsch<br />
• 1 Betrieb bietet Reittouren an<br />
• Projekterfolg<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte mit dem Tourismus<br />
• Arbeitsplätze ca. 5<br />
• Neues Produkt für die Region<br />
• Projekt ist von 8 auf 10 Melkhus erweitert worden<br />
• Projektträger haben ‚Mobiles Melkhus’ in 2 Varianten entwickelt: Kastenbausystem<br />
für touristische Messen und Melkhus-Anhänger für Veranstaltungen<br />
• Akteure „Melkhus <strong>Wesermarsch“</strong> präsentieren die Region bei Veranstaltung<br />
in der Öffentlichkeit und Politik<br />
• Melkhus-Landfrauen beschäftigen z.T. Aushilfskräfte<br />
2. Melkhus Wesermarsch<br />
• Pilotprojekt<br />
• Stärkung ‚Regionale Identität’<br />
• kleine Kulturveranstaltung, diente der Vorbereitung und Entwicklung von dem<br />
Projekt „Himmelfahrt <strong>Wesermarsch“</strong><br />
3. Kultur zwischen<br />
Weser und Watt<br />
• positiver Prozesscharakter<br />
• Leuchtturmprojekt<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Neues Produkt für die Region<br />
• Arbeitsplätze: ca. 0,5 (Gästeführer)<br />
• Vereinsgründung für Projektrealisierung, Bronzezeithaus Hahnenknoop e.V.<br />
• Qualifizierung Gästeführern<br />
• Anzahl Gästeführungen / Bustouren: 2006/25 und 2007/35<br />
• Entwicklung von interaktiven Angeboten mit Jugendlichen aus der Umgebung<br />
z.B. Archäologische Metallarbeit oder Kleidung<br />
4. Bronzezeithaus Hahnenknoop<br />
• Nachhaltigkeit: Vereinsgründung<br />
• Stärkung ‚Regionale Identität’<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Neues Verfahren für die Region<br />
• 1,5 Arbeitsplätze im Regionalmanagement<br />
• Management von Leitprojekten: Anzahl 12<br />
• Projektbegleitung von lokalen Projekten: 55<br />
• Organisation von Veranstaltungen: Anzahl 20<br />
• Organisation von Exkursionen: 5<br />
• Kooperationsanbahnung: 2 Regionen<br />
• Evaluierungsworkshops: 4 Themenfelder<br />
• Internetseite<br />
5. Regionalmanagement<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 15<br />
Projektname Wirkungen Abstrahierte Effekte<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
6. Kiekpadd Wesermarsch • Natur-Beobachtungsroute mit 23 Punkten und Marketing.<br />
• Akteure vor Ort haben weitere Initiativen entwickelt, um den Beobachtungsroute<br />
qualitativ zu verbessern mit insgesamt 3 Projekten<br />
• 1 Informationsveranstaltung<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
7. Wesermarsch kulinarisch • Vereinsgründung proRegion e.V. als Stadt-Land-Kooperation<br />
• Aufnahme einer Rubrik im Gastgeberverzeichnis „Wesermarsch entdecken“<br />
unter „Wesermarsch in aller Munde“ mit regionalen gastronomischen Betrieben<br />
• Akteure proRegion (Landwirte, Gastronomie, Metzger und Direktvermarkter)<br />
entwickeln und realisieren weitere Projekte … Eigeninitiative steigt!!<br />
• Neues Verfahren für die Region<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Entwicklung von 4 Bustouren entlang touristischer Sehenswürdigkeiten<br />
• Entwicklung von Kombitouren zwischen regionaler Gastronomie und Touristik/Gästeführung<br />
• Aufnahme einer Rubrik im Gastgeberverzeichnis „Wesermarsch entdecken“<br />
unter „Bei us tu hus …“<br />
• Die Veranstaltung wird durch die Touristik alle 2 Jahre wiederholt, mit unterschiedlicher<br />
Themensetzung und hat sich verselbstständigt.<br />
8. Infotag Wesermarsch /<br />
Kreuzfahrt Wesermarsch<br />
• Neues Produkt für die Wesermarsch<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Nachhaltigkeit: Vereinsgründung<br />
9. Himmelfahrt Wesermarsch • Das Projekt „Himmelfahrt <strong>Wesermarsch“</strong> als Kulturveranstaltungsreihe ist<br />
immer weiter entwickelt worden und wird nun eigenständig ohne LEADER+<br />
Förderung fortgeführt.<br />
• Steigende Kooperation und Austausch von Kultur-Akteuren<br />
• Vereinsgründung „Himmelfahrt Wesermarsch e.V.“<br />
• Entwicklung einer eigenständigen Kulturveranstaltungsreihe unter dem Motto<br />
„Himmelfahrt <strong>Wesermarsch“</strong><br />
• 60% Drittmittel in die Region eingeworben<br />
• Professionalisierung im Marketing, z.B. Partnerschaft mit Nordwestradio<br />
• Die Projektaktivitäten haben in der Veranstaltungsreihe Laborcharakter und<br />
werden oft dann regelmäßig durch das Jahr angeboten.<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 16<br />
Projektname Wirkungen Abstrahierte Effekte<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
10. Baukultur Wesermarsch • Gründung AK Baukultur Wesermarsch; 5 Treffen<br />
• Veranstaltung und Diskussion mit Öffentlichkeit und Fachbehörden<br />
• Umsetzung von Studienergebnissen: Entwicklung einer touristischen „Route<br />
der Baukultur“ durch LEADER+ - Förderung<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Nachhaltigkeit: Vereinsgründung<br />
11. Wege zum Moor • Vereinsgründung für Projektumsetzung<br />
• Angebote von heimatkundlichen Führungen mit Picknick<br />
• Beteiligung an der Veranstaltungsreihe „Himmelfahrt <strong>Wesermarsch“</strong> mit dem<br />
Thema Moor<br />
• Neues Produkt für die Wesermarsch<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung ‚Regionaler Wettbewerbsfähigkeit’<br />
12. Wesermarsch erleben • Realisierung einer Imagebroschüre für den Tourismus und Etablierung ‚Coporate<br />
Design’ für die touristischen Materialien.<br />
• Qualitätssteigerung der Imagebroschüre<br />
• Integration der LEADER+ Projekte und damit Realisierung von Vernetzung<br />
und Synergien<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
13. Gestaltung Abser Deichschaart • Das Projekt hat weitere Bürgervereine motiviert, das bauliche und kulturelle<br />
Erbe entlang der Sielroute instand zu halten.<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
14. Kulturgarten Lemwerder • Das Projekt hat die kulturelle Erlebnisfähigkeit entlang der Sielroute verbessert.<br />
15. Fahrradparker Butjadingen • keine weitere Wirkungen • Synergieeffekte für den Tourismus<br />
16. Regionalarchiv Nordenham • keine Wirkungen nach Projektabschluss bekannt • Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
17. Konzeption Fishery Towns • Hafenorte sind sich ihrer touristischen Wirkung bewusster geworden und sie<br />
werden an EU-Programme teilnehmen, um die touristische Qualität zu<br />
verbessern.<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Wettbewerbsfähigkeit’<br />
• Aus diesem Projekt sind weitere Aktivitäten zur Positionierung des Schifffahrtsmuseum<br />
an der Unterweser entstanden.<br />
• Das Projekt hat auch zur Gründung „Bund der Museen“ in der Wesermarsch<br />
geführt.<br />
• Museum mit modernen interaktiven Einrichtungen, die das kulturelle Erbe auf<br />
der Höhe der Zeit darstellt<br />
18. Instandsetzung maritimes Erbe <strong>–</strong><br />
Schiffahrtsmuseum Telegraf<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 17<br />
Projektname Wirkungen Abstrahierte Effekte<br />
• Neues Produkt für die Wesermarsch<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Arbeitsplätze ca. 0,5<br />
19. Steganlage Jade • Das Projekt hat zur Etablierung eines Kanuverleihs geführt.<br />
• Eine weitere Steganlage wurde aus privaten Mitteln gefördert.<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
20. Promenadenweg Elsfleth • keine Wirkungen nach Projektabschluss bekannt<br />
• weitere touristische Attraktivitätssteigerung entlang der Kaje mit dem Reisemobil-Stellplatz<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Das Projekt hat zu Folgeaktivitäten geführt. Ein Rastpavillon und entsprechende<br />
Möblierung ist mit Sponsoring, Unterstützung der Kreishandwerkerschaft<br />
Wesermarsch und der Berufsschule Brake realisiert worden.<br />
• Das Projekt motiviert den Bürgerverein zu weiteren Projektaktivitäten.<br />
21. Restaurierung<br />
Deichschaart Käseburg<br />
• keine Wirkungen nach Projektabschluss bekannt • Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Neues Produkt für die Wesermarsch<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
22. Sanierung Dorfplatz<br />
St. Marien Warfleth<br />
23. Exkursionsraum Butjadingen • Die Anzahl der Führungen sind gestiegen.<br />
• Das Nationalparkhaus soll aufgrund des großen Zuspruchs zukünftig erweitert<br />
werden.<br />
24. Lernort Salzwiese • Das Projekt hat einen Lernstandort in unmittelbarer Umgebung zum Nationalpark<br />
etabliert.<br />
• Es werden Natur-Führungen angeboten.<br />
• Es gibt die Vernetzung mit dem Nationalpark Wattenmeer und dem Projekt<br />
Kiekpadd Wesermarsch.<br />
25. Erlebnishütte Jade • Der Ort ist Ausgangspunkt für Natur-Führungen und Kanutouren.<br />
• Die Hütte stellt in den Räumlichkeiten die Natur- und Kulturlandschaft der<br />
Wesermarsch anhand des Projektes „Kiekpadd“ dar.<br />
26. Informationssystem Ovelgönne • Der Ort Ovelgönne ist in seiner ortsbildprägenden Substanz herausragend.<br />
Die Akteure arbeiten an der Attraktivitätssteigerung.<br />
• Aus diesem Projekt sind weitere Aktivitäten entstanden.<br />
27. Moorseer Mühle: Erwerb<br />
• Schwerpunkt Standort „Moorseer Mühle“<br />
Müllerhaus, Restaurierung Wind- • Das Projekt war Auftakt für weitere Aktivitäten, um die Ensemblewirkung der<br />
mühle, Restaurierung<br />
Moorseer Mühle zu erhalten und zu entwickeln.<br />
Nebengebäude<br />
• Die Moorseer Mühle hat sich zu einem „Lernort Kulturlandschaft“ entwickelt<br />
und ist mit dem Projekt „Kiekpadd <strong>Wesermarsch“</strong> vernetzt.<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 18<br />
Projektname Wirkungen Abstrahierte Effekte<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Projektansatz ist andere Regionen übertragbar<br />
28. Münstermann Route • Das Projekt hat zu Etablierung von Kirchenführungen rund um das Thema<br />
Münstermann geführt.<br />
• Es ist Arbeitskreis „Gästeführung Münstermann“ entstanden, der sich regelmäßig<br />
trifft und Erfahrungen austauscht.<br />
• Es sind weitere Tourenangebote entwickelt worden <strong>–</strong> z.B. 3 K-Tour Kirche-<br />
Kunst-Küche.<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Projektansatz ist andere Regionen übertragbar<br />
29. Imageanalyse Wesermarsch • Die Ergebnisse fließen in die Projektentwicklung mit ein. Die Projektentwicklung<br />
„Nordic Walking“ basiert auf den Ergebnissen der Studie.<br />
•<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
30. Kulturmühle Berne • Der Verein „Kulturmühle Berne“ wurde durch das Projekt zu weiteren Aktivitäten<br />
ermuntert. Die Kulturmühle wurde zum kommunikativen, ortsbildenden<br />
Punkt in Berne für Veranstaltungen und wesermarschweite Projekte.<br />
• Der Verein möchte das Ortsbild in den nächsten Jahren als Vorbild aktiv<br />
mitgestalten.<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
31. Sandartfestival • Die Veranstaltung hat sich inhaltlich weiter entwickeln. Es gibt Vernetzungsaktivitäten<br />
zwischen der Touristik Service Butjadingen und den Akteuren<br />
„Himmelfahrt <strong>Wesermarsch“</strong>.<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
32. Maritime Wege • Es sind im ersten Jahr 15 Führungen durchgeführt worden.<br />
• 1 Gästeführer hat sich eine historische Bekleidung schneidern lassen, um die<br />
Führung attraktiver zu gestalten<br />
• Pilotprojekt<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
33. Fußweg Jade • Der Fußweg erfreut sich großer Beliebtheit bei Gästen und der Bevölkerung.<br />
Die Gemeinde hat erkannt wie wichtig eine erlebnis-orientierte touristische<br />
Infrastruktur ist.<br />
• Das Projekt hat Auswirkungen auf weitere und damit weitere Projektaktivitäten.<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 19<br />
Projektname Wirkungen Abstrahierte Effekte<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Pilotprojekt<br />
34. Weg ans Watt • Der Fußweg erfreut sich großer Beliebtheit bei Gästen und der Bevölkerung.<br />
Die Gemeinde hat erkannt wie wichtig eine erlebnis-orientierte touristische<br />
Infrastruktur ist.<br />
• Das Projekt hat Auswirkungen auf weitere und damit weitere Projektaktivitäten.<br />
• Die Kooperation zwischen Nationalpark und Gemeinde Jade wurde gestärkt.<br />
• Der Nationalpark wird als touristischer Wert wahrgenommen und entsprechend<br />
unterstützt.<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Pilotprojekt<br />
• Das Projekt hat die kirchlichen Akteure vernetzt.<br />
• Die Ergebnisse fanden Unterstützung bei touristischen Vereinen sowie<br />
Kommunen und werden somit in zukünftige Projekte und Maßnahmen mit<br />
einfließen (z.B. interaktive Führungen oder Bewusstsein für historische ortsbildprägende<br />
Qualitäten)<br />
35. Jugendprojekt<br />
„Aufwachen jetzt wird geträumt“<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Pilotprojekt<br />
• Das Projekt hat „Initialwirkung“ für das Erleben der reichen Geschichte in der<br />
Wesermarsch.<br />
36. Unsichtbare<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
37. Walking Route Wesermarsch • Das Projekt ist noch nicht realisiert. • Synergieeffekte für den Tourismus<br />
38. Radwanderkarte Wesermarsch • Das Projekt ist realisiert. Es sind Rundrouten erarbeitet worden und die • Synergieeffekte für den Tourismus<br />
Nachbarkommunen sind in den Abstimmungsprozess miteinbezogen worden.<br />
Das Projekt ist nicht im CI-Design und eine kooperative Abstimmung ist nicht<br />
erfolgt.<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Wettbewerbsfähigkeit’<br />
39. Arp-Schnitger-Haus • Inwertsetzung des kulturellen Erbes „Orgelbaumeister Arp-Schnitgers“. Aufbau<br />
eines Zentrums mit der Thematik Arp-Schnitger. Realisierung eines<br />
Kommunikationszentrums.<br />
• In Golzwarden wird intensiv an dem Aufbau eines Arp-Schnitgers-Zentrum<br />
gearbeitet.<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Touristische Projektdarstellung der „Wesermarsch in Bewegung“ mit CI-<br />
Design.<br />
• Im Ergebnis gibt es eine enge Verknüpfung zwischen Tourismus und den<br />
Themen Natur, Kultur sowie Regionale Produkte.<br />
40. Regionspräsentation<br />
Wesermarsch<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 20<br />
Projektname Wirkungen Abstrahierte Effekte<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
41. Wegweiser Wesermarsch • Touristische Abrundung der Routenführung für zahlreiche LEADER+ - Projekte<br />
• Nicht innovativ und eher Beschaffungsprojekt.<br />
• Stärkung ‚Regionaler Wettbewerbsfähigkeit’<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Pilotcharakter<br />
• Innovativer Konzeptansatz zur freizeittechnischen und touristischen Inwertsetzung<br />
• Neue Zusammenarbeit mit der FH Osnabrück: Nutzung von innovativem<br />
Raumplanungsansätzen<br />
42. Nutzungskonzept<br />
Ritzenbüttler Sand<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
43. GEZEITEN Veranstaltungsreihe • Traditionelle Kulturveranstaltungsreihe in Butjadingen.<br />
• Unterstützung lokaler Aktivitäten und Initiativen.<br />
• Keine Entwicklung und Vernetzung mit anderen Aktivitäten.<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Pilotcharakter<br />
• Neues Verfahren<br />
44. Route der Baukultur • Inwertsetzung kulturelles Bauerbe.<br />
• Umsetzung von Ergebnissen aus Studie in Projekten.<br />
• Vernetzung der Region über drei Routen.<br />
• Umsetzung von Trends in kleineren Route: Fahrradträger und ab geht die<br />
Post!<br />
• Vernetzung zw. kulturellem Erbe und touristischer Inwertsetzung<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung ‚Regionaler Wettbewerbsfähigkeit’<br />
• Vernetzung und Kooperation der Museen zur Abstimmung und Entwicklung<br />
von Angeboten für regionale Schulen<br />
• Entwicklung neuer musealer Angebotspakete für die Schulen in der Region<br />
45. Museumspädagogik<br />
Wesermarsch<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung ‚Regionaler Wettbewerbsfähigkeit’<br />
• Neues Verfahren<br />
• Das Projekt ist in der Umsetzungsphase und 8 von 9 Kommunen werden<br />
Maßnahmen ergriffen, um die Qualität zu verbessern.<br />
• Eine abgestimmte und vernetzte touristische Realisierung.<br />
46. Qualitätssteigerung<br />
Reisemobil-Stellplätze<br />
Wesermarsch<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Erhaltung des kulturellen Bauerbes und Stärkung des besonderen Ortes<br />
Ovelgönne mit seinen reiterlichen Aktivitäten.<br />
47. Instandsetzung Reithalle<br />
Ovelgönne<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Neues Verfahren<br />
48. Radrund-Routen Jade • Entwicklung spezieller Radrundrouten für ½ oder 1 Tag<br />
• Trend wurde erkannt und in der Region umgesetzt.<br />
KoRiS 08/2007
Wesermarsch in Bewegung <strong>–</strong> Evaluationsbericht LEADER 2003-2007 21<br />
Projektname Wirkungen Abstrahierte Effekte<br />
49. Aussichtssteg Friesenstrand • Inwertsetzung des Naturerbes. • Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
50. Pastorengarten Schweiburg • Inwertsetzung des Kulturerbes.<br />
• Nicht innovativ.<br />
• LEADER als Finanzierungsinstrument.<br />
• Stärkung regionale Identität<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Leuchtturmprojekt<br />
51. Restaurierung Wilhelmi - Orgel • Inwertsetzung des Kulturerbes, insbesondere der Kirchen und deren Orgeln.<br />
• Herausragendes Erbe wird mit LEADER+ erhalten und entwickelt.<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Revitalisierung einer Bahntrasse und touristischen Nutzung in der Gemeinde<br />
Ovelgönne<br />
52. Touristische Nutzbarmachung<br />
Bahndamm<br />
• Synergieeffekte für den Tourismus<br />
• Stärkung ‚Regionaler Eigeninitiative’<br />
• Nachhaltigkeit: Vereinsgründung<br />
53. Aussichtspunkt „Harrier Kaje“ • Touristische Stärkung des Weserradwegs.<br />
• Umsetzung von Befragungsergebnissen aus Studien und Gutachten: Die<br />
Radfahrer suchen einen direkten Zugang zur Weser.<br />
KoRiS 08/2007