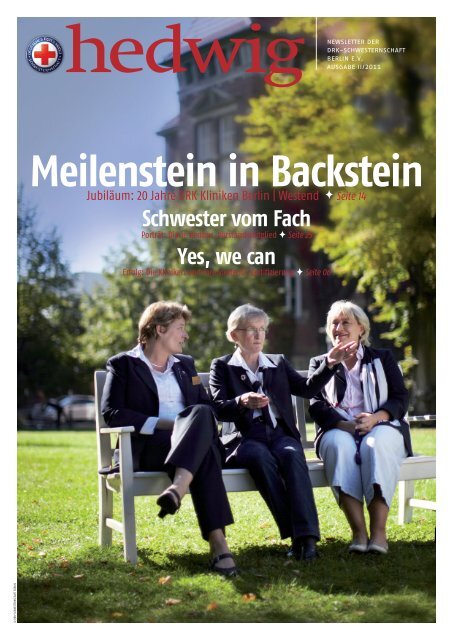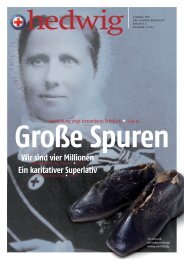Schwester vom Fach - DRK-Schwesternschaft Berlin
Schwester vom Fach - DRK-Schwesternschaft Berlin
Schwester vom Fach - DRK-Schwesternschaft Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
© <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN<br />
hedwig<br />
NEWSLETTER<br />
DER<br />
<strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT<br />
BERLIN E.V.<br />
AUSGABE II/2011<br />
Meilenstein in Backstein<br />
Jubiläum: 20 Jahre <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend Seite 14<br />
<strong>Schwester</strong> <strong>vom</strong> <strong>Fach</strong><br />
Porträt: Diane Bedbur, Vorstandsmitglied Seite 25<br />
Yes, we can<br />
Erfolg: Die Kliniken und ihre vierte JCI-Zertifi zierung Seite 06
04<br />
05<br />
06<br />
08<br />
10<br />
inhalt<br />
Geschlossene<br />
Gesellschaft<br />
270 Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n<br />
kamen zur 38. Mitgliederversammlung<br />
Willkommen<br />
auf der Enterprise<br />
In den <strong>DRK</strong> Kliniken<br />
<strong>Berlin</strong> | Mitte befindet<br />
sich <strong>Berlin</strong>s modernster<br />
OP-Saal<br />
Yes, we can<br />
Zum vierten Mal bestehen<br />
die <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong><br />
die JCI-Prüfung<br />
Mit Balgenkamera<br />
und Melone<br />
Eine Postkarte erzählt die<br />
Geschichte von Otto Krüger<br />
und dem Augusta-Hospital<br />
Aufbau Ost um 1900<br />
Clementine von Wallmenich<br />
gründete die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
Weißensee – im<br />
Auftrag der Kaiserin<br />
schwerpunktthema:<br />
Meilenstein<br />
in Backstein<br />
20 Jahre <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong><br />
Westend: die Geschichte<br />
einer Übernahme<br />
14<br />
16<br />
18<br />
20<br />
24<br />
25<br />
Das Westend-<br />
Krankenhaus<br />
107 Jahre Westend:<br />
Vom Städtischen Krankenhaus<br />
Charlottenburg zur<br />
<strong>Berlin</strong>er <strong>DRK</strong> Klinik<br />
„Mehr als gelungen“<br />
Ein Gespräch mit Oberin<br />
Heidi Schäfer-Frischmann<br />
über das Westend<br />
„Das macht<br />
einen stolz“<br />
1991 bis 2011:<br />
Drei Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n<br />
erinnern sich<br />
Auf die Breite<br />
kommt es an<br />
Adolf Muschg über<br />
den Sinn des Lebens und<br />
die Rolle der Kunst<br />
<strong>Schwester</strong><br />
<strong>vom</strong> <strong>Fach</strong><br />
Diane Bedbur, Mitglied<br />
im Vorstand der <strong>DRK</strong>-<br />
<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />
© HOLGER GROSS<br />
Und es wurde Sommer<br />
Seit 1993 hat es in Deutschland keinen so kühlen Sommer gegeben wie diesen.<br />
Als die <strong>Schwester</strong>nschaft Anfang des Jahres mit der Planung ihres Sommerfestes begann,<br />
konnte niemand ahnen, dass der Sommer 2011 zu kühl und zu nass werden würde.<br />
Die <strong>Schwester</strong>nschaft hatte Glück, denn pünktlich zur Veranstaltung am 25. August kündigten<br />
die Meteorologen eine Wetterberuhigung an. Noch in der Nacht zuvor war über <strong>Berlin</strong> eine<br />
Gewitterfront mit Starkregen gezogen. Ein paar Stunden später hörte man nur noch ent-<br />
ferntes Donnergrollen – das „<strong>Schwester</strong>nschaftssommerfest 2011“ wurde auch eines.<br />
Alle zwei Jahre lädt die <strong>Schwester</strong>nschaft in die Mozartstraße ein, 2008 fand die letzte<br />
Veranstaltung statt, die turnusmäßige im Jahr 2010 musste wegen der Krise ausfallen.<br />
Um so mehr freute sich<br />
Heidi Schäfer-Frisch-<br />
mann, endlich wieder<br />
zum Sommerfest ihre<br />
Gäste begrüßen<br />
zu dürfen – persönlich,<br />
mit Handschlag; gut<br />
dreihundert kamen<br />
in die Zentrale der<br />
<strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft.<br />
Veranstaltungsort war der Garten hinter dem Apartmenthaus, der Weg <strong>vom</strong> Eingangstor<br />
zu den Büros wurde zur „kulinarischen Meile“, hier hatte der Caterer das Büfett aufgebaut.<br />
„Ein Sommerfest mit Gästen, mit Freunden der <strong>Schwester</strong>nschaft, mit treuen Weggefährten<br />
und natürlich Mitarbeitern: das ist ein wichtiges Ereignis für uns“, so eröffnete die Gast-<br />
geberin das Fest. Sie nutzte die Gelegenheit zum Dank, denn „in der schweren Zeit haben<br />
wir erlebt, dass uns Viele ihr Vertrauen ausgesprochen haben und unterstützten“. Ihren<br />
Gästen wünschte Oberin Heidi Schäfer-Frischmann einen entspannten und unterhaltsamen<br />
Nachmittag. Den bekamen sie auch geboten: Der „King of Swing“ spielte auf, Andrej Hermlin.<br />
Er kam mit einigen seiner Musikerkollegen <strong>vom</strong> Swing Dance Orchestra und spielte<br />
Klassiker aus den dreißiger Jahren – Summerswing im Sommergarten.<br />
editorial<br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
„was wäre, wenn...“:<br />
Solche Gedankenspiele über veränderte<br />
geschichtliche Abläufe sind<br />
beliebt – ich mag sie nicht. Was<br />
wäre denn gewesen, hätten wir das<br />
Westend nicht bekommen? Wäre dann<br />
die <strong>Schwester</strong>nschaft eine ganz andere<br />
geworden? Ja, vielleicht, die Entwicklung<br />
der <strong>Schwester</strong>nschaft und ihrer<br />
Einrichtungen hätte durchaus einen<br />
anderen Verlauf genommen. Das<br />
Endergebnis – unverzichtbarer<br />
Gesundheitsversorger für die Region<br />
zu sein, wie wir es heute sind – wäre<br />
das gleiche, trotz der damals<br />
drohenden Konstellation, Träger<br />
von nur noch zwei Klinikstandorten<br />
zu sein. Und gerade deshalb:<br />
Wir können stolz sein auf unser<br />
Westend, es ist Teil unserer Identität<br />
und Geschichte – so wie Köpenick<br />
und Mitte, das Park-Sanatorium,<br />
die Wiegmann Klinik und natürlich<br />
Mariendorf. Genau zwanzig Jahre<br />
ist der Umzug <strong>vom</strong> Krankenhaus<br />
Jungfernheide ins Westend nun schon<br />
her, so schnell vergeht die Zeit.<br />
Und auch das Jahr 2011 ist fast<br />
vorbei: Ich wünsche Ihnen und Ihren<br />
Lieben besinnliche Weihnachtsfeiertage<br />
und uns allen einen guten<br />
Start in das neue Jahr.<br />
Ihre<br />
Oberin Heidi Schäfer-Frischmann<br />
Vorsitzende der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />
<strong>Berlin</strong> e.V.<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 03
© DANIEL FLASCHAR<br />
hedwig<br />
»Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern das er nicht tun muss, was er nicht will.« JEAN-JACQUES ROUSSEAU<br />
Geschlossene Gesellschaft<br />
Der Zusammenhalt der <strong>Schwester</strong>nschaft rung – für Jennifer Kirchner und Ralf Der Trend ist eindeutig, Pflegefachkräfte<br />
ist spürbarer denn je, trotz oder gerade Stähler war es übrigens eine Premiere, sie sind gefragt und viele Gesundheits-<br />
wegen der turbulenten Zeiten, die hinter nahmen das erste Mal an einer Mitgliederversorger spüren den Mangel. Nicht so<br />
Verein und Kliniken liegen. „Wir dachten versammlung teil. „Ich weiß, dass unsere die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong>: Zwar<br />
damals, dass könne alles nur<br />
Situation Sie alle sehr sieht die Oberin durchaus einen wachsen-<br />
ein Missverständnis sein, das<br />
belastet hat und manche den Bedarf an gut qualifizierten Pflege-<br />
sich noch am gleichen Tag<br />
noch immer belastet, personal, aber „wir steuern dagegen“:<br />
aufklären würde“, erinnerte<br />
trotzdem haben Sie sich mit dem schwesternschaftseigenen<br />
sich Oberin Heidi Schäfer-<br />
weiter wie bisher um Bildungszentrum zum Beispiel – „ich habe<br />
Frischmann auf der Mit-<br />
unsere Patienten geküm- immer an der Ausbildungseinrichtung<br />
gliederversammlung im Mai.<br />
mert, immer Rede und festgehalten“ – und der Abteilung Fort-<br />
270 Mitglieder waren gekom-<br />
Antwort gestanden“. und Weiterbildung. Neue Kurse bieten<br />
men, wie jedes Jahr begrüßte<br />
Oberin Schäfer-Frisch- „BiZ“ und „F&W“ an, „damit verschaffen<br />
sie die <strong>Schwester</strong>n am Einmann<br />
lobte die großartige wir uns einen Wettbewerbsvorteil“.<br />
gang zum Konferenzraum im<br />
Leistung ihrer Kollegen: Und auf die Frage, wie die qualifizierten<br />
Hotel Steglitz International.<br />
„Sie haben sich äußerst Pflegekräfte im Unternehmen gehalten<br />
Die Vorfälle <strong>vom</strong> Juni und<br />
professionell verhalten“, werden können, verweist die Oberin<br />
Oktober 2010 waren das<br />
trotz negativer Berichter- auf die Satzung: „Wir binden sie ein<br />
Thema dieser 38. Mitgliederversammlung. stattung in den Medien habe es keinen durch „mitgestalten – mitbestimmen –<br />
Für die Vorsitzende der <strong>Schwester</strong>nschaft Rückgang der Patientenzahlen gegeben. mitverantworten“.<br />
bot die Veranstaltung die Gelegenheit, sich Dem Rechenschaftsbericht fügt die Oberin<br />
zu bedanken: bei allen Mitgliedern, dem auch immer einen <strong>Fach</strong>vortrag an, diesmal<br />
Vorstand und der Kliniken-Geschäftsfüh- zum Thema „<strong>Fach</strong>kräfte“.<br />
In Mitte baute die <strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong>s modernsten OP-Saal<br />
Willkommen auf der Enterprise<br />
An ein Raumschiff muss der Bürgermeister denken, wenn er ein Foto <strong>vom</strong> neuen Hybrid-OP sieht, „der erinnert<br />
mich sehr an die Enterprise 4“. Christian Hanke ist Bezirksbürgermeister von Mitte, „dem einzigen Stadtbezirk,<br />
der kein Vivantes-Krankenhaus hat“.<br />
Aber in Mitte sind dafür die <strong>DRK</strong> Kliniken<br />
<strong>Berlin</strong>, zur Drontheimer Straße hat die<br />
<strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> eine über<br />
hundert Jahre andauernde Beziehung,<br />
erklärt Oberin Heidi Schäfer-Frischmann,<br />
denn „wo sich heute die <strong>DRK</strong> Kliniken<br />
<strong>Berlin</strong> | Mitte befinden, war damals eines<br />
der ersten Einsatzgebiete der Rot-Kreuz-<br />
<strong>Schwester</strong>n: die Heimstätte der Wöchnerinnen“.<br />
Und hier steht nun auch der<br />
modernste OP-Saal der Stadt, der an<br />
diesem 14. Mai mit einer Festveranstaltung<br />
eröffnet wird. Dass es hätte anders kommen<br />
können, auch daran erinnert die<br />
Oberin, „vor nicht einmal zwanzig Jahren<br />
haben wir noch gegen die Schließung<br />
dieses Krankenhauses gekämpft“ – mit<br />
Erfolg. „Mitte“ – oder „Dronte“, wie viele<br />
Mitarbeiter ihre Einrichtung nennen – ist<br />
nicht nur ein Kiezkrankenhaus geblieben:<br />
in seinen Schwerpunktzentren werden<br />
Patienten aus allen Ecken der Bundesrepublik<br />
betreut, „hier gibt es Regionalversorgung<br />
und überregionale Versorgung“,<br />
ergänzt Bürgermeister Hanke und<br />
spricht von vielen guten Erfahrungen,<br />
die er mit den freien Trägern seines<br />
Bezirkes gemacht habe. Hanke ist nicht<br />
der einzige Politiker, <strong>Berlin</strong>s Gesundheitssenatorin<br />
Katrin Lompscher will ebenfalls<br />
unbedingt bei der Eröffnungsfeier dabei<br />
sein wie auch die frühere Bundesgesundheitsministerin<br />
Andrea Fischer. Denn<br />
die Spitzen aus Landes- und Bezirkspolitik<br />
wissen um die Bedeutung dieses neu<br />
eröffneten Gebäudeteils. Zehn Millionen<br />
Euro hat der gesamte OP-Bereich gekostet;<br />
© DANIEL FLASCHAR<br />
eine Investition, die sich nicht nur für die<br />
<strong>Schwester</strong>nschaft gelohnt hat. „Ich bin<br />
überzeugt, dass auch Sie mit dem Ergebnis<br />
zufrieden sein werden“, meint Oberin<br />
Heidi Schäfer-Frischmann in Richtung<br />
Politik. Und die ist es, Christian Hanke<br />
bedankt sich bei der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />
<strong>Berlin</strong> „für diese mutige Investitionsentscheidung“.<br />
Was einige der Gäste erst<br />
später, beim Rundgang durch den Neubau<br />
erfahren: operiert wird hier bereits seit<br />
drei Wochen, den Umzug <strong>vom</strong> alten<br />
in den neuen OP organisierten die Mitarbeiter<br />
über Ostern. Am 26. April wurde<br />
im „Saal 3“der erste Patient operiert, ein<br />
17-Jähriger mit Hauttumor. Eine „Vorfuß-<br />
Wundrevision“ ließ sich der erste Patient<br />
des OP-Saal 2 behandeln. Den Hybrid-Saal<br />
nutzten Chefarzt Peter Dollinger<br />
und Kollegen erstmals am 11. Mai,<br />
für eine Gefäßoperation.<br />
Einen Tag später dann eine etwas<br />
größere OP mit allererstem Aorta Sten:<br />
beschichtete Gefäßstützen wurden in die<br />
Leistenschlagader des Patienten eingesetzt.<br />
Bei beiden OPs kam die neue Hybrid-<br />
Technologie zum Einsatz – diagnostische<br />
Untersuchungen und chirurgische<br />
Eingriffe können die Gefäßspezialisten<br />
nun parallel vornehmen. Und die müssen<br />
nicht nur Experten ihres medizinischen<br />
<strong>Fach</strong>gebietes sein, auch Fingerspitzengefühl<br />
und Computerkenntnisse sind für<br />
die Arbeit unerlässlich. Der Röntgentisch<br />
im Hybrid-OP, auf dem die Patienten<br />
liegen, ist drei Meter lang, er kann gekippt<br />
und verschoben werden. Dazu kommt das<br />
Durchleuchtungsgerät – hochauflösend<br />
und flexibel steuerbar – „Hightech pur“,<br />
sagt Heidi Schäfer-Frischmann. Und von<br />
der – so die Oberin – „werden alle<br />
Bürgerinnen und Bürger profitieren“.<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 05
Yes, we can Vier<br />
Mitarbeiter hatte die US-amerikanische<br />
„Joint Commission International“<br />
Ende Oktober nach Deutschland geschickt<br />
– die <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> sollten sie prüfen.<br />
Nach zwei Wochen stand ihr Ergebnis fest:<br />
„Sie können relaxen“, die „Surveyer“ hatten<br />
der JCI-Zentrale in Übersee empfohlen,<br />
den Kliniken das Prüfungszertifikat<br />
auszustellen. Die mussten dann nur noch<br />
die gesammelten Daten auswerten – ihr<br />
Ergebnis: Prüfung bestanden, die Kliniken<br />
der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft haben die<br />
Zertifizierung geschafft. Es ist damit die<br />
mittlerweile vierte: 2002 erhielten die<br />
<strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> als erster deutscher<br />
Krankenhausverbund die Akkreditierung<br />
der Joint Commission; die Einrichtungen<br />
der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> hatten<br />
nachgewiesen, dass sie auch internationale<br />
Standards erfüllen. 2005 wurde dieser<br />
Erfolg wiederholt, vor drei Jahren gelang<br />
den Kliniken die bislang letzte Zertifizierung<br />
durch die Amerikaner. Die Zertifizierung<br />
gilt in der Branche als überaus<br />
anspruchsvolles Verfahren. Besonders<br />
genau prüfen die Surveyer die Sicherheit<br />
der Patienten und wie diese in ihre Behandlung<br />
einbezogen werden. In den Kliniken<br />
der <strong>Schwester</strong>nschaft kontrollierten die<br />
JCI-Mitarbeiter sechs, von der Commission<br />
hedwig<br />
»Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun.« VOLTAIRE<br />
<strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong><br />
erneuern das Zertifikat<br />
// FOTOS VON WOLFGANG BORRS<br />
definierte Patientenziele: die korrekte<br />
Identifizierung des Patienten, eine<br />
verbesserte Kommunikation mit ihm,<br />
die Sicherheit im Umgang mit potenziell<br />
gefährlichen Medikamenten, die Vermeidung<br />
von Eingriffsverwechslungen,<br />
die Verringerung der Sturzgefahr und<br />
schließlich die Minderung des Risikos,<br />
sich im Krankenhaus zu infizieren.<br />
In den zwei Wochen bei den <strong>DRK</strong><br />
Kliniken <strong>Berlin</strong> haben die JCI-<br />
Prüfer hier „viele exzellente<br />
Beispiele für die gute medizinische<br />
und pflegerische Versorgung<br />
erlebt“. Oberin Heidi<br />
Schäfer-Frischmann ist mit dem<br />
Ergebnis mehr als zufrieden,<br />
die Joint Commission ist für sie<br />
„der Rolls-Royce unter den vielen<br />
Qualitätsmerkmalen, die wir<br />
haben“. Ein Kompliment, das<br />
die Prüfer gern zurückgaben:<br />
„Wenn wir krank geworden<br />
wären, wäre es mehr als okay<br />
gewesen, in eines Ihrer Krankenhäuser<br />
eingeliefert zu werden“.<br />
Gut drei Wochen brauchten<br />
die Kollegen der JCI-Zentrale<br />
für ihre Datenanalyse, dann<br />
bekam die Kliniken-Geschäftsführung<br />
Post aus Illinois, in<br />
dreifacher Ausführung teilte<br />
die Joint Commission dort mit:<br />
Die Einrichtungen der <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
sind reakkreditiert. Die <strong>DRK</strong> Kliniken<br />
<strong>Berlin</strong> bleiben damit deutschlandweit<br />
der einzige Klinikenverbund,<br />
der mit dem JCI-Zertifikat werben darf.<br />
Im Januar bringen die JCI-Verantwortlichen<br />
den Kliniken ihre Zertifizierungsurkunde<br />
persönlich vorbei.<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 07
hedwig<br />
»Lache und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst allein« ELLA WHEELER WILCOX<br />
In zwei Ausstellungsräumen wird die Geschichte der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> erzählt, dabei trennt das<br />
Jahr „1945“ beide nicht nur inhaltlich, auch räumlich markiert es eine Grenze – das Ende und einen Neuanfang.<br />
Das Zimmer links behandelt die Epoche von 1875 bis zum 8. Mai 1945. An seinem hinteren Ende hängt ein Bild,<br />
mitten im Raum: Richtung linker Wand zeigt es eine Gruppenaufnahme von Waldemar Titzenthaler,<br />
auf der anderen Seite sieht man ein Gebäude: das Kaiserin-Augusta-Hospital.<br />
Mit Balgenkamera<br />
und Melone<br />
© CHRISTIAN SCHULZE (1) / ARCHIV <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN (3)<br />
Otto und die drei Damen <strong>vom</strong> Hospital<br />
Otto Krüger war Fotograf, in Alt-Moabit 131 befand sich vor<br />
hundert Jahren sein Atelier; das Wohn- und Geschäftshaus<br />
wurde im Krieg schwer beschädigt, heute ist hier eine <strong>Fach</strong>hand-<br />
lung für „Arbeitsschutz und Gummiwaren“. Bis zum Kaiserin-<br />
Augusta-Hospital hatte es der Fotograf nicht weit, es waren nur<br />
zehn Minuten Fußweg. Krüger fotografierte das Krankenhaus<br />
einige Male. Die Aufnahme, die in der Ausstellung gezeigt wird,<br />
entstand zwischen 1898 und 1901. Drei Krankenschwestern<br />
sind auf dem Foto zu sehen – und ein Mann, der sich mit einer<br />
der Frauen unterhält: Es ist Otto Krüger, der Fotograf selbst.<br />
Die Voreinstellungen an seiner „Balgenkamera“ hat er persönlich<br />
übernommen: mit der Zahnstange verschob er punktgenau<br />
Objektiv- und Filmstandarte gegeneinander, alles musste präzise<br />
aufeinander abgestimmt werden. Die Kamera wird dann der<br />
Gehilfe ausgelöst haben, alle Anderen hatten sich für Sekunden<br />
nicht zu bewegen, nur <strong>Schwester</strong> Adelheid von Kall schien von<br />
einer „Fotosession“ nichts gewusst zu haben – rechts sieht man<br />
sie aus der Tür kommend. Die beiden anderen <strong>Schwester</strong>n waren<br />
Jenny von der Knesebeck – sie sitzt auf der Bank links am Eingang<br />
– und Helene von Massenbach, die sich mit dem Fotografen<br />
unterhält – eine gestellte Szene. Die Namen der fotografierten<br />
Personen wurden auf einer Postkarte notiert; von wem,<br />
ist nicht überliefert. Diese Karte diente als Vorlage für das<br />
über zehn Mal größere Ausstellungsexponat aus Canvas,<br />
einem mit Leinen bespannten Keilrahmen.<br />
„Herz“ der <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
Zum Kaiserin-Augusta-Hospital hat die <strong>Berlin</strong>er <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />
eine besondere Beziehung. Das Krankenhaus wurde<br />
zwischen 1869 und 1870 für den „<strong>Berlin</strong>er-Frauen-Lazareth-<br />
Verein“ gebaut. Die Schirmherrschaft übernahm dessen Namensgeberin,<br />
Kaiserin Augusta. Der zweigeschossige Backsteinbau<br />
stand auf einem <strong>vom</strong> Kriegsministerium überlassenen Grundstück<br />
an der Scharnhorststraße,<br />
im Norden des Invalidenparks.<br />
Kurz nach der Fertigstellung<br />
erhielt Hedwig von Rittberg von<br />
der Kaiserin das Angebot, Oberin<br />
des Krankenhauses zu werden;<br />
sie zögerte – „ich würde es für<br />
ein Unrecht halten, bei meiner Unkenntnis das Amt zu übernehmen,<br />
weil ich dem Hospital mehr Schaden als Nutzen bringen<br />
könnte“ –, willigte dann aber doch ein. Nach drei Jahren trat<br />
die Gräfin zurück, Probleme mit den Mitarbeitern waren<br />
wohl der Grund. Der 2. Februar 1891 war für vier <strong>Schwester</strong>n<br />
<strong>vom</strong> „Märkischen Haus“ der erste Tag am Augusta-Hospital:<br />
Die Einrichtung sollte später die wichtigste Ausbildungsstätte<br />
der Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>nschaft sein – und ihr Mutterhaus<br />
beherbergen. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm das Märkische<br />
Haus komplett die Klinikleitung, alle Augusta-<strong>Schwester</strong>n<br />
– so wohl auch Adelheid von Kall, Jenny von der Knesebeck<br />
und Helene von Massenbach – bekamen ein neues Mutterhaus,<br />
ihre Tracht und die Bezeichnung „Augusta-<strong>Schwester</strong>“ durften<br />
sie behalten. In der Nachkriegszeit und vor allem während der<br />
Inflation hatte die <strong>Schwester</strong>nschaft <strong>vom</strong> Märkischen Haus mit<br />
schweren wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, die durch<br />
ständige Reform der Vereins- und Krankenhausstrukturen<br />
gelöst werden konnten. Im November 1943 wurde<br />
das Augusta-Hospital von Bomben schwer getroffen.<br />
Wie durch ein Wunder wurde keine <strong>Schwester</strong><br />
verletzt, der Sachschaden jedoch war enorm.<br />
In der Nacht zum 30. April 1945 besetzen Rotarmisten<br />
das Krankenhaus, die Märkischen <strong>Schwester</strong>n<br />
arbeiteten auch dann noch unver-drossen<br />
weiter und versorgten die vielen Verwundeten und Kranken.<br />
Wenige Wochen nach dem Krieg waren die größten Kriegsspuren<br />
beseitigt und der Krankenhausbetrieb konnte halbwegs<br />
normal weiter gehen. Die Märkischen <strong>Schwester</strong>n waren<br />
optimistisch – bis die Sowjetische Militäradministration das<br />
Deutsche Rote Kreuz verbot und damit den <strong>Schwester</strong>n ihre<br />
Arbeitsgrundlage entzog; sie mussten das Gebäude räumen.<br />
Die Charité erhielt nun als Ersatz für ihre von der Militärkommandantur<br />
beschlagnahmte Strahlenklinik das Augusta-<br />
Hospital, 1948 zog die Orthopädie ein. Der komplette Wiederaufbau<br />
sollte sich bis weit in die sechziger Jahre hinziehen,<br />
historisch restauriert wurde das Klinikgebäude nie. 1982 wurde<br />
das Augusta-Krankenhaus in einen Bürokomplex umgewandelt,<br />
seit 1995 steht er leer. Im Jahr 2007 wollte ein Investor das Areal<br />
sanieren und in ein Hotel umwandeln, aber es blieb nur ein Plan.<br />
Vor einem Jahr kaufte ein Medizintechnik-Unternehmen aus<br />
Süddeutschland das ehemalige Kaiserin-Augusta-Hospital.<br />
Wenige Tage nach dem Auszug der Märkischen <strong>Schwester</strong>n schrieb<br />
Marie-Luise Laspeyres als Erinnerung an diesen schweren Schlag:<br />
„Und wenn das Schicksal dann auch so hart mit ihm umging, dass<br />
es aufgehört hat zu existieren, so doch niemals in den Herzen von uns<br />
Märkischen <strong>Schwester</strong>n. Es wird in uns fortleben als eine unvergessliche<br />
Heimat, die in unser Leben unendlich viel begleitende Arbeit,<br />
Liebe, Fürsorge und Segen gebracht hat.“<br />
<strong>Schwester</strong>nschaftsjahre<br />
<strong>Schwester</strong>nschaftsjahre<br />
<strong>Schwester</strong>nschaftsjahre<br />
S<br />
18<br />
75<br />
BIS HEUTE<br />
<strong>Schwester</strong>nschaftsjahre 1875<br />
bis heute. Die Ausstellung der<br />
<strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />
in den <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend, Haus S,<br />
Eingang Nord, Zugang über Spandauer Damm 130<br />
oder Fürstenbrunner Weg.<br />
Weitere Informationen zur Ausstellung<br />
finden Sie im Internet unter<br />
www.drk-schwesternschaft-berlin.de<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 09
© ARCHIV <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN<br />
hedwig<br />
»Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden.« SÖREN AABYE KIERKEGAARD<br />
Clementine von Wallmenich (1849 bis 1908), Oberin der <strong>Schwester</strong>nschaft Weißensee<br />
Aufbau Ost um 1900<br />
„Den starken, freudigen Arbeitsgeist neben der echten Atmosphäre<br />
des <strong>Schwester</strong>nberufs anwurzeln zu lassen“, im typisch verqueren Tenor<br />
des 19. Jahrhunderts ließ Kaiserin Auguste Viktoria diese Anweisung<br />
formulieren: die Kaiserin wünschte sich für Weißensee eine Rot-Kreuz-<br />
Klinik inklusive <strong>Schwester</strong>nschaft; Clementine von Wallmenich schien<br />
für sie die einzig Geeignete, die ein solches Projekt umsetzen konnte.<br />
Quer durch das Königreich Bayern<br />
Clementine von Wallmenich wurde am<br />
14. Juni 1849 in München geboren. Sie war<br />
das erste Kind von Karl und Regine von<br />
Wallmenich, später kamen noch vier<br />
Geschwister hinzu. Der Vater war Jurist,<br />
stammte aus Augsburg, die Mutter kam<br />
aus Nürnberg. Ihre Ehe war eine „ökumenische“:<br />
Offiziell nahm Vater Karl<br />
den evangelischen Glauben seiner Frau an,<br />
der Katholizismus sollte dennoch weiterhin<br />
eine große Rolle spielen. Diese religiöse<br />
Toleranz bestimmte so auch die Erziehung<br />
der fünf Kinder. Ein Jahr nach Clementines<br />
Geburt zog die Familie um, es sollte nicht<br />
der einzige Ortswechsel bleiben: In nicht<br />
einmal zehn Jahren änderten von Wallmenichs<br />
sechs Mal ihre Wohnanschrift –<br />
München, Erding, Landshut, Deggendorf,<br />
Bamberg, Augsburg; der Vater fand immer<br />
wieder eine neue Anstellung, in Augsburg<br />
wurde er zum Oberstaatsanwalt berufen.<br />
18 Jahre alt war da seine älteste Tochter,<br />
und hier in der Fuggerstadt kam es zu<br />
ihrer ersten Begegnung mit dem Roten<br />
Kreuz, mit 20 trat sie dem „Bayerischen<br />
Frauenverein <strong>vom</strong> Roten Kreuz“ bei.<br />
In Augsburg sollte die Familie nicht lange<br />
bleiben, wieder zogen sie um, zurück<br />
nach Bamberg. Tochter Clementine blieb<br />
im Haushalt der Eltern, hier konnte sie<br />
sorgenfrei leben und sich ihren Interessen<br />
widmen. Und dazu gehörte vor allem ihre<br />
Arbeit für den Frauenverein, 1881 wählte<br />
man sie in den Kreisausschuss Oberfranken,<br />
kurze Zeit später absolvierte sie eine<br />
Ausbildung zur freiwilligen <strong>Schwester</strong>nhelferin.<br />
Sie fand großen Gefallen an ihrer<br />
Arbeit, ihr Einsatz sprach sich herum.<br />
Clementine von Wallmenich wurde<br />
„Vorsitzende von 64 Damen“, für ihre<br />
„Beaufsichtigung der städtischen Kostkinder“<br />
ehrten sie später Magistrat und<br />
Frauenverein. Jede ihrer Tätigkeiten war<br />
ehrenamtlich, für Damen ihres gesellschaftlichen<br />
Standes war das vollkommen<br />
normal. Sie hatte viel Zeit, sie lernte<br />
Sprachen, reiste viel. Als erste Deutsche<br />
bestieg sie 1893 Europas höchsten Berg,<br />
den Mont Blanc.<br />
Sparfuchs und Systemreformerin<br />
1893 bekam die „Pflegerinnenanstalt des<br />
Bayerischen Frauenvereins <strong>vom</strong> Roten<br />
Kreuz“ in München<br />
erstmals eine<br />
Oberin, Prinzessin<br />
Ludwig von Bayern<br />
betraute Clementine<br />
von Wallmenich<br />
mit dieser<br />
Aufgabe. Der<br />
Verein steckte in<br />
Schwierigkeiten: Viele Außenstationen<br />
wurde von München aus betreut, in der<br />
Isarmetropole selbst arbeiteten die<br />
Pflegerinnen in der Uni-Klinik und im<br />
eigenen Krankenhaus. Aber die Entwick-<br />
lung stagnierte, von der neuen Oberin<br />
versprach sich die königliche Hoheit<br />
als Protektorin mehr Schwung. Die setze<br />
erstmal den Rotstift an, prüfte jede Ausgabe:<br />
„Ich ließ einmal, als ich vor Tisch auf<br />
meinem Zimmer war, das Licht brennen.<br />
Sie (Oberin von Wallmenich – d.Red.) kam<br />
nach Hause, sah es von draußen, und zwei<br />
Tage musste ich auf dem Erker allein<br />
essen“, erinnerte sich eine <strong>Schwester</strong> an<br />
den bisweilen pedantischen Sparwillen<br />
ihrer Oberin. Deren Änderungen gingen<br />
tatsächlich noch viel weiter, sie reformierte<br />
die <strong>Schwester</strong>nschaft von Grund<br />
auf und verpasste ihr professionelle,<br />
Das Städtische Krankenhaus Weißensee (1985)<br />
moderne Strukturen. Auf Mitbestimmung<br />
legte sie dabei großen Wert wie auch auf<br />
die materielle Absicherung ihrer Mitschwestern:<br />
Sie richtete eine Pensionskasse<br />
ein und ließ ein Erholungsheim bauen.<br />
Und sie merkte, wie sehr die Persönlichkeit<br />
einer Oberin die Entwicklung der<br />
<strong>Schwester</strong>nschaft bestimmt: Eine Oberin<br />
muss fachlich geschult sein, nur dann<br />
habe ihre Arbeit Erfolg. Clementine von<br />
Wallmenich initiierte daher die Gründung<br />
einer Oberinnenschule, der ersten<br />
in Europa überhaupt.<br />
Spreeathen statt Alpenglühen<br />
Selbst im fernen Preußen sprach sich dieses<br />
Engagement herum, die Kaiserin holte<br />
die erfolgreiche Oberin nach <strong>Berlin</strong>, hier<br />
sollte sie mit zwei Münchner Kolleginnen<br />
das Mutterhaus Weißensee aufbauen und<br />
ein Krankenhaus einrichten, „ein vortreffliches<br />
Gemeinde- und Kreiskrankenhaus“<br />
lobten vier Monate später Honoratioren<br />
aus Weißensee. Die Oberin musste aber<br />
zugeben, dass die Herausforderung ihr alles<br />
abverlangt hatte, trotzdem erledigte sie<br />
auch diesen Job mit gewohnt großer<br />
Begeisterung: „Mir ist das Schönste im<br />
Leben, dass es mir vergönnt ist, das, was<br />
ich im Süden des Reiches erprobt habe,<br />
hier im Norden lehren zu dürfen! Daheim<br />
in meinem lieben, schönen teuern<br />
Mutterhaus schauen die Alpen in die<br />
Fenster, die Zugspitze winkt herüber, und<br />
doch stehe ich als in vollkommener<br />
geistiger Heimat hier in der Hauptstadt<br />
des Reiches. Ist das nicht herrlich, macht<br />
das nicht starkgemut auch in Schwierigkeit<br />
und Mühe und Arbeitslast!“ Ein Jahr<br />
blieb Clementine von Wallmenich in<br />
<strong>Berlin</strong>-Weißensee. Kurz nach ihrer Rückkehr<br />
erwartete sie eine böse Überraschung:<br />
Das Pflegekomitee kündigte ihren Vertrag,<br />
die Oberin reagierte geschockt – sie wurde<br />
Opfer einer Rufmordkampagne und alten<br />
Zwistes verfeindeter Adelsfamilien.<br />
Aber sie fand neue Herausforderungen,<br />
wurde dann Oberin im Zentralkomitee<br />
der Deutschen Vereine <strong>vom</strong> Roten Kreuz,<br />
dazu Ausschussmitglied im Verband<br />
Deutscher Krankenpflegeanstalten – und<br />
zur offiziellen Beraterin der Mutterhäuser<br />
ernannt. 1905 versuchte sie sich als<br />
Designerin und entwarf das „hygienischrichtige<br />
Kleid für die Krankenpflege“,<br />
das – als Reichspatent angemeldet – zur<br />
Tracht aller Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n wurde.<br />
Drei Jahre später nahm sie den „sehr<br />
ehrenvollen Auftrag einer Inspektions-<br />
und Informationsreise an, zunächst nach<br />
den Kolonien Togo und Kamerun“, dort<br />
sollte sie nicht nur die Arbeitsbedingungen<br />
von Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n untersuchen,<br />
sie selbst wollte sich auch über die<br />
Lage der Frauen in anderen Ländern<br />
informieren. 59 Jahre alt war Oberin von<br />
Wallmenich, als sie sich via Hamburg<br />
nach Westafrika einschiffte. Auf der Fahrt<br />
zurück in die Heimat erkrankte sie an<br />
Typhus, am 14. Juli 1908 verstarb<br />
Clementine von Wallmenich.<br />
Im Jahr 1953 beschlossen die Mitglieder<br />
der „<strong>Schwester</strong>nschaft Niederbayern-<br />
Oberpfalz <strong>vom</strong> Bayerischen Roten<br />
Kreuz“ sich umzubennen in „<strong>Schwester</strong>nschaft<br />
Wallmenich-Haus <strong>vom</strong><br />
Bayerischen Roten Kreuz e.V.“<br />
(Zitate entnommen aus:<br />
Sigrid Schmidt-Meinecke „Clementine<br />
von Wallmenich – Leben und Vermächtnis<br />
einer bedeutenden Frau“,<br />
München 1991)<br />
In der Reihe „Oberinnen im Porträt“<br />
sind bereits erschienen:<br />
Elsbeth von Keudell (hedwig I/2007)<br />
Anna Maria Luise Scheld (hedwig II/2007)<br />
Rose Zirngibl (hedwig I/2008)<br />
Hedwig von Rittberg (hedwig II/2008)<br />
Hertha Janke (hedwig I/2009)<br />
Cläre Port (hedwig II/2009)<br />
Gerda von Freyhold (hedwig I/2010)<br />
Alexandrine von Üxküll-Gyllenband (hedwig II/2010)<br />
Ehrengard von Graevenitz (hedwig I/2011)<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 11<br />
© ARCHIV SCHWESTERNSCHAFT MÜNCHEN (2)
© <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN<br />
hedwig<br />
»Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.« HENRY FORD<br />
Ab in den Urlaub Letztes Jahr auf dem Archehof „Gut Falkenhain“, diesen Sommer nun<br />
Ruderer mit Brosche<br />
Vor zwei Jahren schickte die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />
das erste Mal ein Boot auf den Wannsee, damals holte<br />
das Ruderinnenteam Silber – trotz „Rollsitzklemmers“.<br />
Bei „Rund um Wannsee 2011“ unterstützte die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
jetzt einen Männer-Achter plus Steuerfrau:<br />
Aber auch diesmal kam das Team nicht als Erste ins Ziel,<br />
„RaW & Friends“ schafften es aber dennoch auf das<br />
Treppchen und holten die Bronzemedaille in ihrer<br />
Rennkategorie. Etwas mehr als eine dreiviertel Stunde<br />
hatten die acht Ruderer für die Rundfahrt um <strong>Berlin</strong>-<br />
Wannsee gebraucht, damit war „RaW & Friends“-Boot<br />
nur um Sekunden langsamer als die beiden Besserplatzierten.<br />
Mit einer Rennstrecke von fünfzehn Kilometern<br />
zählt „Rund um Wannsee“ zu den schwersten Ruderrennen<br />
weltweit – sieben Seen müssen die Sportler<br />
überqueren. Jedes Jahr am 3. Oktober veranstaltet<br />
der <strong>Berlin</strong>er Ruder-Club die Langstreckenregatta, dieses<br />
Jahr war es eine Jubiläumsveranstaltung: zum zehnten<br />
Mal fand „Rund um Wannsee“ statt.<br />
in der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte am Werbellinsee: Mit Hilfe der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />
konnten Kinder der KJP wieder ein paar Tage ihrer Sommerferien außerhalb <strong>Berlin</strong>s verbringen. 18 Kinder waren es,<br />
die im Juli mit ihren Betreuern Richtung Schorfheide reisten. Baden im<br />
Werbellinsee, Paddeltouren mit dem Kanu, Wandern durch Wald und<br />
Moor, abends Grillen und Stockbrotbacken am Lagerfeuer: die drei Tage<br />
waren für die Kinder kurzweilig und abwechslungsreich. „Danke,<br />
dass Sie den Kindern und auch uns diese wunderbare Fahrt ermöglicht<br />
haben“, bedankte sich die Pflegerische Abteilungsleitung der Kinderund<br />
Jugendpsychiatrie, Bärbel Zeran, bei der <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
für deren Unterstützung.<br />
In eigener Sache<br />
Zum vierten Mal haben die Surveyer unsere Kliniken geprüft:<br />
reine Routine, da kann uns nichts mehr überraschen – könnte<br />
man meinen. Aber das war es überhaupt nicht, die Zertifi-<br />
zierung war alles andere als „normal“: Die Anspannung war<br />
ungleich größer als bei dem Besuch der Joint Commission vor<br />
drei Jahren. Die Frage, die wir uns alle gestellt haben: Welche<br />
Auswirkungen hatte die Krise von 2010 tatsächlich? Der JCI-Survey war ein Lack-<br />
mustest. Die <strong>DRK</strong> Kliniken hatten sich wieder einem durch und durch unabhängigen<br />
Kontrollgremium zu stellen; nun sollte sich zeigen, wie es mit unseren Kliniken<br />
weiter geht. Sie können sich bestimmt vorstellen, wie groß unsere Erleichterung<br />
war, als die Surveyer uns schon an den letzten Prüfungstagen „leise“ zu ver-<br />
stehen gaben: „Sie können entspannt sein, es sieht ganz gut aus“. Und als dann<br />
Mitte November endlich die offizielle Bestätigung kam, da war die Freude<br />
natürlich riesig. Was heißt diese Zertifizierung nun übertragen auf die komplexe<br />
Situation im Unternehmen? Eigentlich nichts anderes, als dass die Versorgung<br />
unserer Patienten von der Krise unbeeinflusst blieb, dass sie – im Gegenteil –<br />
sogar eine weitere Steigerung erfahren hat. Dies ist für mich ein großartiger<br />
Erfolg: Für Ihren Beitrag daran bedanke ich mich, dies auch im Namen der<br />
Geschäftsführung der <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong>. Der aktuelle Survey ist damit auch<br />
als Aufarbeitung zu verstehen, die längst noch nicht abgeschlossen ist; sie wird<br />
uns wohl noch einige Monate beschäftigen, vielleicht sogar Jahre. Wir als Ver-<br />
antwortliche von <strong>Schwester</strong>nschaft und Kliniken sind selbstverständlich sehr daran<br />
interessiert, wir unterstützen und kooperieren vollumfänglich – die zuständigen<br />
Behörden haben sich mehrmals lobend über unseren Einsatz geäußert. In diesem<br />
Zusammenhang freut es mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Staatsanwaltschaft<br />
und Polizei sämtliche Ermittlungen gegen mich eingestellt haben: Ich sehe damit<br />
nicht nur meine Person, sondern vor allem das Amt einer Oberin als rehabilitiert<br />
an. In den genau fünfzehn Jahren, in denen ich die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />
als Vorsitzende führe, waren diese vergangenen achtzehn Monate mit Abstand<br />
am entbehrungsreichsten; und ich weiß, nicht nur für mich. Im nächsten<br />
Jahr stehen eine Reihe von Veränderungen an, neue und bekannte Gesichter<br />
in verantwortungsvollen Positionen wird es geben – und das sind dann<br />
tatsächlich „normale“, weil von uns gewünschte Veränderungen.<br />
// Oberin Heidi Schäfer-Frischmann<br />
Zuwachs chs<br />
Ordentliche Mitglieder<br />
der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />
seit dem 1. Juli 2011:<br />
<strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong><br />
Köpenick<br />
Diesner, Constanze (1. Juli)<br />
Pfeiffer, Josephine (1. August)<br />
Junghans, Nicole (1. August)<br />
Gast, Anja (1. September)<br />
Hoffmann, Jenny (1. September)<br />
Böhme, Selda (1. September)<br />
Latussek, Melanie (1. Oktober)<br />
Augustinski, Philine (12. Oktober)<br />
Diehl, Tatjana (1. November)<br />
Steinick, Alexandra (1. November)<br />
Mitte<br />
Dietrich, Franzisca (15. Mai)<br />
Richter, Nadine (24. Juni)<br />
Park-Sanatorium Dahlem<br />
Linke, Maria (16. Mai)<br />
Westend<br />
Heidtmann, Maxie (1. Juni)<br />
Lindner, Jenny (1. August)<br />
Weck, Tanja (1. September)<br />
Fiedler, Tanja (1. Oktober)<br />
Herforth, Sophie Anna (1. Oktober)<br />
Ahrens, Mareike (1. Oktober)<br />
von Thienen, Sandra (1. Oktober)<br />
Kaeks, Anne (1. Oktober)<br />
Dietrichkeit, Maria (1. November)<br />
Schade, Charleen (1. November)<br />
Hanschke, Nadine (1. November)<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 13
hedwig<br />
»Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen« ARISTOTELES<br />
Seit genau zwanzig Jahren ist das Westend-Krankenhaus bei der <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
Meilenstein<br />
in Backstein<br />
Fährt man auf der A100 Richtung Süden, dann überrascht rechts, kurz hinter dem Dreieck Charlottenburg<br />
die etwas andere Skyline aus vielen Türmchen – es sind die „Dachreiter“ der alten Gebäude der<br />
<strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend, verkleidete Rohre für das Entlüftungssystem des historischen Krankenhausteiles.<br />
Nicht zu übersehen ist auch ein fast vier Meter hohes, rotes Kreuz mit blauem Rand – auf dem Krankenhaushochhaus<br />
– der „Kopfklinik“ – zeigt es, wem dieses Areal gehört.<br />
Das Westend-Krankenhaus nach Fertigstellung des Hochhauses (1971)<br />
Seit dem 1. Oktober 1991 ist<br />
Rittberg-Krankenhaus wurde<br />
die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />
Aufschub gewährt. Aber auch<br />
<strong>Berlin</strong> Träger der Charlotten-<br />
über das Westend-Krankenhaus<br />
burger Klinik. Dabei hätte es<br />
gab es eine Mängelliste: Die<br />
auch anders kommen können,<br />
Freie Universität, die das Areal<br />
im „Jahr 1“ der deutschen Ein-<br />
bewirtschaftete, hatte Ende der<br />
heit stand der Verein kurz vor<br />
siebziger Jahre ein Sanierungs-<br />
seinem Aus. Zwei seiner vier<br />
konzept ausgearbeitet, der Senat<br />
Einrichtungen, das Jungfern-<br />
ergänzte die mit eigenen Aufheide-Krankenhaus<br />
in Charlotlagen.<br />
Auf eine halbe Milliarde<br />
tenburg-Nord und die Ritt-<br />
DM, also rund 256 Millionen<br />
berg-Klinik in Lichterfelde-Süd,<br />
Euro, summierten sich die<br />
sollten ihre Arbeit einstellen.<br />
Kosten. Diese Mängelliste kur-<br />
Der Senat hatte die Schließung<br />
sierte als internes Arbeitspapier,<br />
der beiden <strong>DRK</strong>-Krankenhäuser schon Dort hielt man sich jedoch bedeckt und Oberin Rohr kannte es nicht. Der CDU-<br />
in den achtziger Jahren geplant, die zögerte mit der Freigabe von Investitionsgeführte Senat wollte freie, gemeinnützige<br />
gewaltigen Kosten für die längst übermitteln. Später, bei einer eher inoffiziellen Träger für das Westend. Die <strong>Schwester</strong>nfällige<br />
Sanierung konnten das Land und Zusammenkunft in der Senatsverwaltung, schaft signalisierte Interesse, aus unver-<br />
auch die <strong>Schwester</strong>nschaft nicht stemmen. teilte man Oberin Christa Rohr die<br />
bindlichen Gesprächen wurden offizielle<br />
Es war so nur noch eine Frage der Zeit, bis Planänderung mit: Die <strong>Schwester</strong>nschaft Verhandlungen. Im März 1989 verlor die<br />
die <strong>Berlin</strong>er <strong>Schwester</strong>nschaft „Jungfern- schließt Jungfernheide und Rittberg, dafür CDU jedoch überraschend die Wahlen zum<br />
heide“ und „Rittberg“ aufgeben musste. bekommt der Verein das renommierte Abgeordnetenhaus, die Sozialdemokraten<br />
Ursprünglich wollte die <strong>Schwester</strong>nschaft Westend-Krankenhaus – wenn vorerst nur übernahmen mit der Alternativen Liste<br />
spätestens 1985 mit den Umbauten<br />
das Hochhaus, in das dann die Jungfernhei- die Regierungsverantwortung für <strong>Berlin</strong> –<br />
beginnen, der Senat hatte <strong>vom</strong> Verein de einzieht. Denn die Klinik am Tegeler und das wirkte sich aus auf die laufenden<br />
vorab eine Mängelliste bekommen:<br />
Weg sollte als erste schließen, dem<br />
Verhandlungen zwischen <strong>Schwester</strong>n-<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 14<br />
© DANIEL FLASCHAR<br />
schaft und Verwaltung. Die rot-grüne<br />
Koalition favorisierte einen kommunalen<br />
Träger für das Westend, die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
war plötzlich kein geeigneter<br />
Kandidat mehr und geriet in eine bedrohliche<br />
Situation: Sollte sich die Politik<br />
mit ihrem geänderten Plan durchsetzen,<br />
so blieben dem Verein nur das <strong>DRK</strong>-Krankenhaus<br />
Mark Brandenburg mit seinen<br />
Standorten „Mariendorf“ und „Drontheimer<br />
Straße“. Die Geschäftsführung der<br />
„Krankenhaus GmbH“ mit Heidi Schäfer-<br />
Frischmann, Gerhard Schwarz und<br />
Berthold Simons wollte so schnell nicht<br />
aufgeben, das konnte sie auch nicht – es<br />
standen hunderte Arbeitsplätze auf dem<br />
Spiel. Simons musste seinen Urlaub<br />
unterbrechen und kam aus Italien<br />
zurück nach <strong>Berlin</strong>; Geschäftsführerin<br />
Heidi Schäfer-Frischmann und ihr Kollege<br />
Gerhard Schwarz hatten mittlerweile<br />
begonnen, mit den Entscheidungsträgern<br />
ins Gespräch zu kommen: Nicht nur die<br />
Senatoren und ihre Staatssekretäre<br />
mussten die Geschäftsführer überzeugen,<br />
auch bei Abgeordneten der Charlottenburger<br />
Bezirksverordnetenversammlung<br />
warben sie um Unterstützung. In der<br />
Landespolitik gab es mittlerweile den<br />
nächsten Regierungswechsel: Die Alternative<br />
Liste verließ die Koalition, die<br />
<strong>Berlin</strong>er Christdemokraten stellten nach<br />
gewonnenen Neuwahlen wieder die<br />
Parlamentsmehrheit.<br />
Anfang des Jahres 1991 kam endlich der<br />
Durchbruch bei den Westend-Verhandlungen,<br />
beide Seiten einigten sich auf einen<br />
Kompromiss: Die FU <strong>Berlin</strong> verlegt ihren<br />
Krankenhausbereich in das Rudolf-<br />
Virchow-Klinikum, die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
übernimmt als neuer Träger das Westend.<br />
Die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> bekam<br />
eines der architektonisch reizvollsten<br />
Krankenhäuser Deutschlands. Und mit<br />
der fast gleichzeitigen Übernahme des<br />
Salvador-Allende-Krankenhauses wurde<br />
die <strong>Schwester</strong>nschaft zu einem der größten<br />
<strong>Berlin</strong>er Gesundheitsunternehmen.
© ARCHIV <strong>DRK</strong> KLINIKEN BERLIN<br />
hedwig<br />
»Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben« CICELY SAUNDERS<br />
Das Westend-Krankenhaus<br />
Charlottenburg, um 1900:<br />
Seit knapp 25 Jahren ist die Stadt<br />
eigenständig – der Provinziallandtag<br />
hatte Charlottenburg zum 1. Januar<br />
1877 aus dem Kreis Teltow ausgegliedert.<br />
Die Stadt hat ihre Einwohnerzahl<br />
in den vergangenen<br />
drei Jahrzehnten verzehnfacht,<br />
über 200.000 Menschen leben hier.<br />
Bis 1910 werden noch einmal hunderttausend<br />
hinzukommen. In der Provinz<br />
Brandenburg sind Charlottenburg und<br />
<strong>Berlin</strong> damit die einzigen Großstädte. Für<br />
die Krankenversorgung ist das Krankenhaus<br />
in der Kirchstraße längst zu klein.<br />
Einen Neubau hat die Stadtverordnetenversammlung<br />
1895 beschlossen – am<br />
Fürstenbrunner Weg soll er nun entstehen.<br />
Dort, wo sich früher der Pferdemarkt<br />
befand. Der Magistrat beauftragt den<br />
renommierten Architekten Heino Schmieden,<br />
zusammen mit Martin Gropius hat er<br />
„Gropius & Schmieden“ gegründet: das<br />
erste freie Architekturbüro <strong>Berlin</strong>s. Beide<br />
haben sich auf den Bau von Krankenhäusern<br />
spezialisiert. Nur zwei Jahre<br />
braucht Schmieden, dann sind seine<br />
Pläne für das neue Krankenhaus fertig<br />
gezeichnet und von der Stadt freigegeben.<br />
Der Architekt hat sich für die<br />
„Pavillonbauweise“ entschieden: Um eine<br />
grüne Mittelachse gruppiert er acht<br />
Krankenhauspavillons mit Sälen für die<br />
Patienten, hinzu kommen das Badeund<br />
Operationshaus und der wuchtige<br />
Verwaltungstrakt an der Spandauer<br />
Chaussee. Schmieden lässt sich von<br />
Fritz Karl Bessel-Hagen beraten – der<br />
Mediziner wird später zum Direktor<br />
des „Städtischen Krankenhauses Charlottenburg-Westend“<br />
ernannt. 1901 rücken<br />
die Bautrupps an, ein Jahr später steht<br />
der Rohbau – jetzt kann der Innenausbau<br />
beginnen. Wie bei der Gebäudeanordnung<br />
werden auch hier „Hygiene“ und<br />
„Desinfektion“ zu baulichen Vorgaben,<br />
von Bessel-Hagen formuliert und durch<br />
Schmieden zu Papier gebracht. Der Arzt<br />
bringt sich ein, er erfindet Geräte zur<br />
Desinfektion und veranlasst den Einbau<br />
einer hochmodernen Haustechnik.<br />
Das Team Bessel-Hagen/Schmieden entwickelt<br />
ein völlig neuartiges Lüftungssystem<br />
für das Westend – die Lüftungs-<br />
rohre, die bei den Kopfbauten aus der<br />
Dachmitte ragen, werden später mit<br />
ihren Verkleidungen die Silhouette der<br />
Klinik prägen. Es dauert zwei Generationen,<br />
bis sich das Westend der nächsten<br />
großen baulichen Veränderung unterzieht.<br />
1971 öffnet die „Kopfklinik“, ein<br />
funktionaler Zehnstöcker, der den<br />
Nordwestteil des Krankenhausgeländes<br />
dominiert. Der aber auch das neue<br />
„Wahrzeichen“ der Klinik ist und für die<br />
Spitzenmedizin steht, die im Westend<br />
angeboten wird. Ein Krankenhaus hat<br />
eine kurze Halbwertszeit. Medizin und<br />
Pflege verlangen ständig nach neuen<br />
Infrastrukturen für ihre Arbeiten.<br />
Ende der achtziger Jahre ist der historische<br />
Krankenhausteil veraltet: Umbauen<br />
und Renovieren ist immer teurer als<br />
neu bauen. Es wird laut darüber nachgedacht,<br />
die historischen Pavillons durch<br />
funktionale Betonbauten zu ersetzen.<br />
Die Pläne bleiben glücklicherweise in der<br />
Schublade: Backsteinhäuser und Plattenbau<br />
legen auch in den nächsten Jahrzehnten<br />
Zeugnis ab für das gelungene<br />
Miteinander von Tradition und Moderne<br />
– für die <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend.<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 17
hedwig<br />
»Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren« BERTOLT BRECHT<br />
„Man kann das nur als gelungen bezeichnen“<br />
Oberin Heidi Schäfer-Frischmann wurde im April 1986<br />
zur Geschäftsführerin der „<strong>DRK</strong> Krankenhaus GmbH I“,<br />
sechs Jahre später dann auch der „GmbH II“.<br />
Bei der Übernahme des Charlottenburger Westend-<br />
Krankenhauses war sie von Beginn an dabei.<br />
Frau Oberin, warum hatte sich die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
ausgerechnet für das Westend entschieden?<br />
Aussuchen konnten wir uns das nicht: Das Westend bot uns der<br />
Senat, dafür sollten wir das Jungfernheide-Krankenhaus und<br />
später das Rittberg-Krankenhaus schließen – so stand es im Krankenhausplan<br />
von 1990. Wir hatten einen Bauplan für beide Häuser<br />
ausgearbeitet: je 75 Millionen DM hätten wir investieren<br />
müssen, um die Kliniken auf den neuesten Stand umzurüsten.<br />
Genau die nun hätte der Senat nicht bewilligt, wir hätten demnach<br />
Jungfernheide und Rittberg ersatzlos schließen müssen.<br />
Der Senat mit Senator Fink, Staatssekretär Hasinger und besonders<br />
dem Staatsdirigenten Dr. Unger schlug vor, uns das Westend<br />
anzubieten. <strong>Berlin</strong> verfügte damals über zu viele Krankenhausbetten.<br />
Die Universität sollte ins Rudolf-Virchow-Klinikum<br />
ziehen, wir Jungfernheide und Rittberg schließen und das Westend-Gelände<br />
übernehmen.<br />
Hat Ihnen der Senat das komplette Gelände angeboten?<br />
Nur Teile, wir haben zuerst den operativen Bereich übernommen,<br />
auch einen Teil der inneren Bereiche und dann sukzessive<br />
ausgebaut: Kinderklinik und Frauenklinik waren erst in der<br />
Pulsstraße und sind 1996 umgezogen. Wir bekamen nur die Gebäude,<br />
die notwendig sind für den Krankenhausbetrieb.<br />
Wie lange hat die Übernahme gedauert:<br />
<strong>vom</strong> ersten Gespräch bis zur endgültigen Vertragsunterzeichnung?<br />
Gar nicht so lange – knapp fünf Jahre hat das gedauert, von 1986<br />
bis 1991.<br />
Eine Übernahme in der Größenordnung gab es bis dahin nicht.<br />
War sie wirtschaftlich riskant?<br />
Das würde ich nicht sagen. Für uns stand doch viel auf dem Spiel:<br />
Mit der Schließung von Rittberg und Jungfernheide wären uns<br />
nur noch Drontheimer und Mariendorf geblieben – eine gefährliche<br />
Konstellation für die <strong>Schwester</strong>nschaft! Wir bekamen doch<br />
auch die Zusage, 165 Millionen DM für die Sanierung der Gebäude<br />
des Westendes zu verwenden. Damit waren wir gesichert. Für<br />
uns als <strong>Schwester</strong>nschaft war das eine glückliche Fügung.<br />
Kulisse „Westend“: Oberin Heidi Schäfer-Frischmann<br />
mit dem ersten JCI-Zertifikat (2002)<br />
Ein Meilenstein für die <strong>Schwester</strong>nschaft, kann man das so sagen?<br />
Ja, ein Meilenstein. Wir dürfen nicht vergessen: In der Jungfernheide<br />
waren wir nur Mieter, das Gebäude gehörte Schering.<br />
Und das Rittberg-Krankenhaus wurde früher als Homöopathisches<br />
Krankenhaus genutzt und war von seiner Bausubstanz her<br />
für ein Krankenhaus nicht mehr zeitgemäß.<br />
Fand die Übernahme überall<br />
Zustimmung oder gab es auch Widerstand?<br />
Es gab natürlich auch Widerstände, sehr massiv dann 1991, kurz<br />
vor dem Umzug: Im Sommer ´91 war die politische Stimmung im<br />
Abgeordnetenhaus plötzlich eine andere. Und die Universität<br />
wollte auch nicht aus Charlottenburg weg. Das Projekt wurde<br />
also wieder in Frage gestellt. Wir Geschäftsführer – das waren<br />
Berthold Simons, Gerhard Schwarz und ich – sind in diesem Som-<br />
mer wirklich von Mann zu Mann, von Frau zu Frau marschiert<br />
– ob es nun Abgeordnete waren, Mitarbeiter der Senatsverwaltung<br />
oder auch der Universität – und haben dafür geworben,<br />
dass der Plan doch noch umgesetzt wird.<br />
Die Universität hat dann das Gelände<br />
fluchtartig verlassen: Haben Sie dafür eine Erklärung?<br />
Wir alle waren enttäuscht, wie die Stationen und Bereiche aussahen,<br />
als wir den ersten Rundgang nach der Übernahme machten<br />
– eine merkwürdige Situation war das. Dafür habe ich keine Erklärung,<br />
das muss man wahrscheinlich so hinnehmen. Ich habe<br />
damals auch nicht so viele Gedanken daran verschwendet, wir<br />
mussten doch innerhalb kürzester Zeit umziehen von der Jungfernheide<br />
auf das Gelände <strong>vom</strong> Westend. Ich war verantwortlich<br />
für den Umzug, zwei Tage hatten wir dafür eingeplant – mit<br />
180 Patienten von der Jungfernheide rüber ins Westend! Einen<br />
Tag vorher waren noch Bauleute im „Kopfhaus“. Ich bin der Firma<br />
Gegenbauer damals sehr dankbar gewesen, die haben eine<br />
Nachtschicht eingelegt, um noch das gesamte Gebäude zu putzen.<br />
Ich erinnere mich, wir haben Pizza und Cola ausgegeben,<br />
damit in der Nacht wirklich die Gebäude gereinigt werden. Wir<br />
hatten zuvor eine Art „Masterplan“ entwickelt, die <strong>Schwester</strong>n,<br />
die dann umgezogen sind aus der Jungfernheide, haben erst mal<br />
alles eingerichtet, dafür hatten sie in der Jungfernheide alles stehen<br />
und liegen gelassen, sind mit den Patienten umgezogen und<br />
haben dann eine Nachhut gebildet, die die Jungfernheide wieder<br />
aufgeräumt hat. Und das klappte sehr gut, in den zwei Tagen ist<br />
alles reibungslos abgelaufen.<br />
Woher kamen die vielen Mitarbeiter,<br />
die Sie für den Betrieb des Westends benötigen?<br />
Das Personal hatten wir schon vorher eingestellt. Wir haben die<br />
Stationen vollkommen neu zusammen gestellt, hunderte von<br />
Gesprächen gingen dem voraus. Schon zu dem Zeitpunkt hatten<br />
wir die Mitarbeiter des Rittberg-Krankenhauses einbezogen,<br />
auch einige aus der Drontheimer Straße. Die Personalplanung<br />
war ein echtes Bravourstück: Der Pflegenotstand war damals<br />
noch größer als heute. Wir haben in Zeitungen inseriert oder bei<br />
anderen <strong>Schwester</strong>nschaften nachgefragt. Irgendwie haben wir<br />
es geschafft, unser neues Krankenhaus bekam seine Mitarbeiter.<br />
1991 die Übernahme, kurz darauf begannen die Bauarbeiten, die<br />
sich bis 2003 hinzogen: immer wieder Umzüge, immer wieder neue<br />
Mitarbeiter: War da professionelles Arbeiten überhaupt möglich?<br />
Professionell gearbeitet haben wir immer, selbst wenn man<br />
manchmal das Gefühl hatte, auf einer Baustelle zu arbeiten.<br />
<strong>Schwester</strong>n und Ärzte, auch das andere Personal wie Putzfrauen<br />
oder Stationshilfen: Sie alle haben professionell gearbeitet. Das<br />
war eben auch unsere Stärke: im Provisorium gut zu arbeiten!<br />
Aber fertig mit den Baumaßnahmen – ich glaube, dass sind wir<br />
heute noch nicht. Wir sind immer noch dabei, alles zu verschönern,<br />
besser zu machen. Ich denke, so ein Krankenhaus ist, wenn<br />
es sich gut aufstellen will, immer auch eine Baustelle.<br />
Der Architekt Beer, der den Umbau des Westends<br />
mit plante, meinte: „Die durchschnittliche Lebensdauer<br />
eines Krankenhauses beträgt zwanzig Jahre“.<br />
Und dann fängt man wieder von vorne an, genau. Es war eben<br />
auch diese Besonderheit, dass wir auf einen universitären Standort<br />
gezogen sind. Ich finde, dass das ganz hervorragend geklappt<br />
hat und dass sich wirklich jeder eingebracht hat. Und die <strong>Schwester</strong>n<br />
haben das natürlich ganz besonders begleitet.<br />
Sind viele ehemalige Universitätsmitarbeiter geblieben?<br />
Sehr wenige, das ist fast zu vernachlässigen. Die hatten ihren Beamtenstatus<br />
und fast alle sind dann doch mitgezogen. Bei uns<br />
geblieben sind Dr. Schauwecker und dann später auch Prof. Kentenich<br />
und Prof. Grothe.<br />
Welchen Einfluss hatten Sie auf die großen Umbaumaßnahmen?<br />
Gab es da Vorgaben seitens der <strong>Schwester</strong>nschaft:<br />
„So stellen wir uns das vor“?<br />
Das ist ein Prozess gewesen, wir hatten sehr strenge Denkmalschutzauflagen<br />
zu beachten, gerade bei den Kämmen. Es gab eine<br />
Arbeitsgruppe aus Senat und Denkmalschutzbehörde, den Architekten<br />
und Bauingenieuren, der Geschäftsführung und dem<br />
Träger. Und da haben wir immer einen guten Konsens gefunden.<br />
Mit Ihrem heutigen Wissen: Hätten Sie irgendwas anders gemacht?<br />
Man kann immer alles noch besser machen! Aber ich denke, unter<br />
dem Strich ist das Westend-Krankenhaus sehr gelungen. Was<br />
mich sehr freut, dass es eine hohe Akzeptanz hat in der Bevölkerung,<br />
bei den Patienten und den Mitarbeitern – das kann man nur<br />
als gelungen bezeichnen, darauf kommt es doch letztendlich an.<br />
Können Sie spekulieren und sagen, wo die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
heute ohne das Westend stehen würde?<br />
Nein, das will ich nicht und das kann ich auch gar nicht. Ich<br />
denke, wir haben uns gut positioniert in den letzten zwanzig<br />
Jahren. Wir haben ein hervorragendes Krankenhaus – nicht nur<br />
baulich, sondern auch von den Menschen her, die es mit Leben<br />
füllen. Wenn wir das die nächsten zwanzig Jahre schaffen, dann<br />
können wir doch nur zufrieden sein. Ich denke nicht nur an die<br />
Vergangenheit, an der Zukunft müssen wir arbeiten, damit wir<br />
das, was wir erreicht haben, nicht verlieren.<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 19
hedwig<br />
»Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit« ERASMUS VON ROTTERDAM<br />
Drei Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n: Sie arbeiten in den <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend, haben zu drei verschiedenen<br />
Zeitpunkten dort angefangen. Seit seiner Übernahme verändert sich ihr Krankenhaus, auch wenn das Tempo der<br />
Veränderungen nicht mehr so rasant ist wie noch vor zehn Jahren. Sibylle Griebsch, Ellen Richter und<br />
Anette Skalla sind mehr als nur Augenzeugen, sie haben mitgewirkt an der Umwandlung der Universitätsklinik<br />
zu einer Einrichtung der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong>. // FOTOS VON DANIEL FLASCHAR //<br />
ELLEN RICHTER: Wir sind nach und nach ausgezogen. Wir hatten<br />
eine Kollegin, die bis zum Schluss blieb – sie hat noch die Station<br />
ausgefegt und alles sauber hinterlassen.<br />
Und wie lange hat es gedauert, bis so etwas wie Normalität einkehrte?<br />
ELLEN RICHTER: Ich denke, eine Woche, ganz genau weiß ich es<br />
nicht mehr. Wir hatten geputzt, alles sauber gemacht und uns so<br />
eingerichtet, wie wir es gern wollten. Wir haben viel organisiert.<br />
Und was wir benötigten, haben wir uns geholt.<br />
„Das macht einen stolz“<br />
Frau Richter, Sie waren damals beim Umzug dabei...<br />
ELLEN RICHTER: Ja, das war im September ´91. Wir hatten bereits<br />
vorher begonnen, unsere Sachen von der Jungfernheide hierher<br />
ins Westend zu bringen – mit unseren privaten PKWs. Wir haben<br />
auch nach dem Dienst gearbeitet, in der Freizeit sind wir<br />
hergekommen und haben alles aufgebaut. Die Anzahl der Patienten,<br />
die wir noch auf der Station im Krankenhaus Jungfernheide<br />
betreuten, hatten wir nach und nach reduziert – wir hatten<br />
ja noch nichts auf den neuen Stationen, die Betten wurden<br />
erst später geliefert.<br />
Was war Ihr erster Eindruck, als Sie hier ankamen?<br />
ELLEN RICHTER: Alles war so groß – aber unheimlich dreckig. Und<br />
das fand ich sehr, sehr negativ. Wir haben dann gründlich ge-<br />
„Natürlich sind wir auch stolz,<br />
Westendlerinnen zu sein“<br />
Ellen Richter<br />
putzt – wir wollten doch eine saubere Station! Volle Töpfe waren<br />
das Ekligste, was wir vorgefunden haben, überall war Dreck: Es<br />
sah so aus, als hätten sie die Häuser fluchtartig verlassen. Da waren<br />
so viele wertvolle Sachen, die sie haben liegen lassen: Sterilgut,<br />
das noch über Jahre gut war, doppelt und dreifach eingepackt<br />
– das haben wir dann genommen.<br />
SIBYLLE GRIEBSCH: Auch Wandanschlüsse haben sie da gelassen.<br />
Und wirklich wertvolle Dinge, die wir gut gebrauchen konnten:<br />
Defibrillatoren, EKG-Geräte – fahrbare, tragbare...<br />
ELLEN RICHTER: Eigentlich ein Wunder, dass sie nicht ihre Patienten<br />
auch noch da gelassen haben. Die <strong>Schwester</strong>nschaft hat das<br />
Jungfernheide-Krankenhaus sicherlich nicht von jetzt auf gleich<br />
verlassen.<br />
„Es hat sich einfach<br />
so viel und so oft verändert“<br />
Sibylle Griebsch<br />
War das Westend komplett leer, als die <strong>Schwester</strong>nschaft kam?<br />
SIBYLLE GRIEBSCH: Ich selbst bin damals nicht mit umgezogen, ich<br />
war im Mutterschutz zu der Zeit. Aber ich weiß, dass sich auf<br />
dem Westend-Gelände noch Einrichtungen der Charité befanden<br />
wie die Chirurgische Station, auch die Augenklinik wurde<br />
erst später übernommen. Die Chirurgen von Charité und <strong>DRK</strong><br />
Kliniken haben sich dann auch ein bisschen in den Haaren gehabt<br />
– es ging um die OP-Säle: da hat der alte Träger „geschubst“,<br />
wollte sie wie früher uneingeschränkt nutzen und der neue<br />
wollte das natürlich auch.<br />
ANNETTE SKALLA: September 1990 hatte ich mich im Virchow beworben<br />
und war zum Vorstellungsgespräch auf diesem Gelände.<br />
Danach habe ich mir die Intensivstation angesehen. Diese be-<br />
fand sich zu dieser Zeit noch in den Räumen der jetzigen Kinder-<br />
und Jugend-Psychiatrie. Es war eine sehr enge und verwinkelte<br />
Station, sie machte wirklich einen sehr unaufgeräumten Eindruck.<br />
Für mich stand fest: Hier will ich nie arbeiten. Und dann<br />
kam doch alles ganz anders...(lacht)<br />
Sind Sie damals freiwillig von der Jungfernheide ins Westend gezogen?<br />
ELLEN RICHTER: Natürlich, über Alternativen haben wir auch gar<br />
nicht nachgedacht. Für uns stand fest: Die Jungfernheide zieht<br />
geschlossen um.<br />
Ihr Team ist so geblieben wie es war?<br />
ELLEN RICHTER: Ja, das Team ist unverändert<br />
geblieben.<br />
Was hat Sie dann hier positiv überrascht?<br />
ELLEN RICHTER: Die Station war sehr<br />
übersichtlich und gut geschnitten: Da<br />
ist ein Gang, auf der rechten Seite sind<br />
die Patientenzimmer, auf der linken<br />
Seite die letzten beiden sind Einzelzimmer,<br />
dann war da ein Dienstzimmer,<br />
daneben befand sich unser kleiner<br />
Aufenthaltsraum, ein Durchgangszimmer,<br />
und wieder nebenan war das<br />
„Spritzenzimmer“ – also der reine Arbeitsraum<br />
– und wieder dahinter lag<br />
ein Arztzimmer – das gefiel mir sehr,<br />
alles war übersichtlich und zugleich<br />
komfortabel. In der Jungfernheide<br />
sind wir immer „Um-die-Ecke“ gelaufen:<br />
Auf der alten 2b zum Beispiel hatten<br />
wir den Fahrstuhl, da kam die Urologie<br />
nach oben, um in den OP zu<br />
gehen, nebenan war auch noch das<br />
Röntgenzimmer – es war eine stark<br />
frequentierte Station, im Jungfernheide-Krankenhaus<br />
ging es hin und her.<br />
Wann kamen die ersten „neuen“ Patienten?<br />
ELLEN RICHTER: Gleich mit dem Umzug – das war am 1. und 2.<br />
Oktober.<br />
Sie haben das aufmerksam verfolgt und auch befürwortet?<br />
ELLEN RICHTER: Dafür haben wir doch alle gekämpft, das war<br />
schon lange im Gespräch.<br />
SIBYLLE GRIEBSCH: Die Jungfernheide musste schließen – komplett.<br />
Dann hat sich die Fraktion der Grünen in Charlottenburg<br />
dafür stark gemacht, dass die Jungfernheide hier ins Westend<br />
kommt. Das Westend sollte ebenfalls geschlossen werden, zumindest<br />
große Teile. Aber Charlottenburg braucht doch ein ordentliches<br />
Krankenhaus: Und einige Politiker im Abgeordnetenhaus<br />
und in der Bezirksverordnetenversammlung hier in Char-<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 21
hedwig<br />
»Kein besseres Heilmittel gibt es im Leid als eines edlen Freundes Zuspruch« EURIPIDES<br />
lottenburg haben sich dafür stark gemacht. Die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
hat sich natürlich für das Gelände interessiert, und die<br />
Politik wollte uns letztlich doch auch erhalten. Trotzdem sind<br />
wir auf die Straße gegangen und haben demonstriert, dass die<br />
Jungfernheide bleibt: Wir sind raus mit Rollstühlen, mit Patienten<br />
und Betten; wir sind nach Siemensstadt gefahren in das<br />
Einkaufszentrum, haben dort Zettel verteilt, Unterschriften gesammelt,<br />
damit die Jungfernheide erhalten bleibt oder wir zumindest<br />
dann ins Westend umziehen können.<br />
Frau Griebsch, Sie kamen etwas später hierher?<br />
SIBYLLE GRIEBSCH: 1990 wurde meine Tochter geboren.<br />
'92, im Januar, habe ich dann schon wieder angefangen:<br />
1991 ist die <strong>Schwester</strong>nschaft ins Westend<br />
umgezogen und wegen des Personalmangels wurden<br />
die Mütter aus dem Erziehungsurlaub geholt, das<br />
musste unbedingt sein.<br />
Frau Skalla, auch Sie sind nach<br />
dem Umzug ins Westend gekommen?<br />
ANNETTE SKALLA: Ich bin im Dezember 1995 mit der<br />
Schließung des Rittberg-Krankenhaus hierher gekommen:<br />
Mit dem Team der Intensivstation aus dem<br />
Rittberg wurde die Intensivstation hier um fünf Betten<br />
erweitert. Es war eine tolle und spannende Zeit –<br />
und aus zwei doch sehr unterschiedlichen Teams<br />
wurde dann ein eingeschworenes.<br />
Fühlen Sie sich als „Westendlerinnen“, die<br />
sich von den Kolleginnen aus Mariendorf, Köpenick,<br />
Mitte unterscheidet?<br />
ELLEN RICHTER: Wir sind alle Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n,<br />
wir sind alle Kolleginnen. Natürlich sind wir auch<br />
stolz darauf, „Westendlerinnen“ zu sein: Wir haben<br />
sehr viel geschafft in diesen zwanzig Jahren.<br />
SIBYLLE GRIEBSCH: Ich denke, dass wir sehr stolz darauf<br />
sein können, dass es uns gelungen ist, bei den Patienten<br />
nicht nur in Charlottenburg, sondern auch weit über die<br />
Grenzen hinaus bekannt zu sein: für unser „Kümmern“ um und<br />
für die Patienten. Das gilt natürlich auch für die Medizin, ganz<br />
klar: über die Jahre konnten viele gute Ärzte gewonnen werden.<br />
Aber ich spreche da jetzt für uns: Wir <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>n, wir kümmern<br />
uns, sind immer freundlich. Und dazu dann in dieser Umgebung,<br />
unter diesen Bedingungen zu arbeiten – ich denke, auch<br />
darüber kann man nur glücklich sein und das macht einen stolz.<br />
Haben Sie in der Anfangszeit Vorbehalte gespürt:<br />
Jetzt kommt ein Verein, die Universität ist weg?<br />
SIBYLLE GRIEBSCH: Nein, im Gegenteil! Die Patienten haben gesagt:<br />
„Sie sind ja ganz anders, Sie sind ja viel netter, hier kümmert<br />
man sich ja um uns – Sie fragen, ob ich Schmerzen habe, Sie fra-<br />
gen, wie es mir geht“. Wir hatten natürlich anfangs unsere Befürchtungen,<br />
aber die traten überhaupt nicht ein. Lob bekommen<br />
wir auch heute noch täglich zu hören.<br />
ELLEN RICHTER: Wir bekommen überwiegend positive Briefe von<br />
den Patienten, die sich bei uns bedanken für die gute Pflege, eigentlich<br />
für alles. Die <strong>Schwester</strong> fängt im Grunde genommen<br />
doch alles auf: Der Arzt war gerade zur Visite da – und wen fragt<br />
der Patient nachher?<br />
ALLE (lachen): Die <strong>Schwester</strong>!<br />
„Wo man baut,<br />
da geht es weiter, es wird<br />
besser und schöner“<br />
Annette Skalla<br />
SIBYLLE GRIEBSCH: Also für mich bleiben die vielen Umbauarbeiten<br />
immer auch etwas ganz Besonderes. Mir gefällt das grüne<br />
Ambiente – und natürlich ein wenig die Kunst, die ja immer<br />
wieder für Diskussionen sorgt.<br />
ANNETTE SKALLA: Jeden Tag beim Betreten des Geländes <strong>vom</strong><br />
Spandauer Damm aus, wenn man durch den großen Torbogen<br />
geht, die mächtige Lampe sieht und dann auf die Aue schaut,<br />
denke ich: Wow, schön!<br />
Gibt es irgendwas für die Zukunft, was Sie sich noch wünschen<br />
für das Westend? Was könnte man zum Beispiel verbessern?<br />
ELLEN RICHTER: Besser kann man immer werden, und wir verbessern<br />
uns auch immer.<br />
ANNETTE SKALLA: Es hat sich so viel getan. Als ich ´95 hier ankam,<br />
waren die Häuser rechts und links der Aue leer. Es funktionierten<br />
nur das Hochhaus, die Rettungsstelle, das Haus 12 und<br />
Haus 14. Seitdem wurde so viel gebaut, verändert und erweitert.<br />
Es ist wirklich gut. Die Arbeitsbedingungen waren während der<br />
langen Umbauphase bestimmt alles andere als optimal.<br />
SIBYLLE GRIEBSCH: Ich bin mit der Unfallchirurgie von der Ebene<br />
22 und 23 auf die 8b gezogen: Dort wurden neue Schränke eingebaut,<br />
Modulsysteme eingeführt, daran musste man sich gewöhnen.<br />
Aber auch die Kollegen mussten wir oft erst mal suchen<br />
oder anrufen: „Wo sind denn die jetzt schon wieder?“ Wir wurden<br />
zwar über die Rundschreiben informiert, aber trotzdem: Es<br />
hat sich einfach so viel und so oft verändert.<br />
ELLEN RICHTER: Dann ist man vielleicht manchmal in die falsche<br />
Richtung gelaufen. Aber das war egal, irgendwann war doch der<br />
richtigen Weg gefunden. Dem Patienten konnte man dann erklären:<br />
„Ach, ich wollte Ihnen mal unser schönes Gelände zeigen“. Und<br />
wir sind doch immer angekommen, wo wir hinwollten.<br />
ANNETTE SKALLA: Die Bauarbeiten waren und sind wichtig – sie gehören<br />
zum Westend. Ich denke: wo man baut, da geht es weiter, es<br />
wird besser und schöner. Klar ist es jedes Mal ein Kraftakt und wie<br />
immer ist man hinterher klüger. Was mir vielleicht noch fehlt, ist<br />
eine Cafeteria, am besten oben im Hochhaus, mit Blick über <strong>Berlin</strong>...<br />
Annette Skalla (45), ist seit 1991 bei den <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong>, zuerst war sie im<br />
Rittberg-Krankenhaus, dort arbeitete sie drei Jahre lang als Stellvertretende Stationsleitung.<br />
1995 kam sie in das Westend auf die ITS, die sie von 1999 bis 2005 leitete. Seit Mai 2010<br />
ist Annette Skalla Stellvertretende Pfl egedienstleitung der <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend.<br />
Sibylle Griebsch (52), ihre erste Station bei den <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> war die Jungfernheide,<br />
zehn Jahre arbeitete sie in dem Krankenhaus der <strong>Schwester</strong>nschaft. 1992 wechselte sie ins<br />
Westend. Im Mai 2007 übernahm Sibylle Griebsch hier die Abteilungsleitung der Station<br />
27/28 Endoskopie.<br />
Ellen Richter (53), ist seit 1977 bei der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> und arbeitete ab 1984<br />
im <strong>DRK</strong>-Krankenhaus Jungfernheide. Sie zog als eine der ersten <strong>Berlin</strong>er Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n<br />
in das Westend-Krankenhaus. Ellen Richter arbeitet heute auf der Station 4B/Traumatologie.<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 23
hedwig<br />
»Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.« JOHANN WOLFGANG VON GOETHE<br />
Adolf Muschg und das Figurenfest im Westend<br />
Auf die Breite kommt es an<br />
„Die Kunst leistet gar nichts“, sagte Adolf Muschg, als er 1994 den<br />
wichtigsten Literaturpreis der Bundesrepublik bekam – den Georg-Büchner-<br />
Preis. Muschg gestand der Kunst aber zumindest zu, „so viel leistet sie<br />
vielleicht doch: Sie kann das dumme Spiel, das wir mit klügeren Apparaten<br />
spielen, ablösen durch ein Spielwissen, das nicht nur eine Alternative,<br />
sondern auch das ganz Andere kennt“. Für Muschg gibt es also nicht nur<br />
Leben und Tod, er meint, da wäre noch etwas Drittes.<br />
Adolf Muschg: Schweizer Schriftsteller,<br />
von 2003 bis 2005 Präsident der Akademie<br />
der Künste, Goethe-Experte, ein „öffentlicher<br />
Intellektueller“ wie die ZEIT ihn einmal<br />
beschrieb. Dem Publikum fiel es nicht<br />
immer ganz leicht, seinen Gedanken mit<br />
den vielen Analogien zu folgen, die Muschg<br />
als Gastredner des „Zweiten Figurenfestes“<br />
vortrug. Leben, Krankheit, Tod – und eben<br />
die Kunst, das waren Fixpunkte in seiner<br />
Rede, die der Schweizer mit „Kunst als<br />
Therapie?“ betitelt hatte. „Jeder ist sein<br />
Leben lang Patient“, jeder müsse sich darüber<br />
im Klaren sein, dass letztlich die<br />
Länge des Lebens nicht entscheidend sei –<br />
„es ist vielmehr seine Breite“, ermahnte<br />
Muschg seine mehr als einhundert Zuhörer.<br />
Kann die Kunst nun Patienten therapieren?<br />
Professor Ernst Kraas als Mediziner gab<br />
offen zu: „Ich weiß es nicht, auch hier im<br />
Krankenhaus ist das ein Experiment mit<br />
offenem Ausgang“. Kraas ist im Kuratorium<br />
der Stiftung „Figuren im Park“, der Chefarzt<br />
der Minimal-Invasiven Chirurgie und<br />
die anderen Kuratoren hatten in die <strong>DRK</strong><br />
Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend geladen. Nach<br />
2009 fand hier wieder ein „Figurenfest“<br />
statt, auf das Adolf Muschg mit seinem<br />
gut einstündigen Vortrag die Kunst- und<br />
Literaturliebhaber einstimmte. Das Figurenfest<br />
soll nicht nur unterhalten, es will<br />
auch zum Kauf von Kunst animieren.<br />
34.000 Euro hatte die Stiftung vor zwei<br />
Jahren eingenommen – Kleinplastiken und<br />
Grafiken wurden verkauft. Eine Großplastik<br />
konnte die Stiftung „Figuren im<br />
Park“ davon erwerben. Eines Tages sollen<br />
alle Figuren, die auf dem Gelände der <strong>DRK</strong><br />
Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend stehen, keine<br />
Leihgaben mehr sein. Deutlich weniger an<br />
Erlös kam jetzt nach der Neuauflage des<br />
Figurenfestes zusammen: zwölf Kunstobjekte<br />
verkauften die Veranstalter, lediglich<br />
12.800 Euro wurden eingenommen. Aber<br />
die Geschäftsführung der <strong>DRK</strong> Kliniken<br />
<strong>Berlin</strong> hat auch hier versprochen zu<br />
helfen: Die Einnahmen sollen verdoppelt<br />
werden, dann kann die Stiftung die „Gelbe<br />
Figur“ erwerben, eine Sandsteinskulptur<br />
von Berndt Wilde. Das Westend ohne<br />
seine Figuren – auch für Oberin Heidi<br />
Schäfer-Frischmann ist das undenkbar,<br />
„die Figuren gehören zum Westend“ hat<br />
sie schon vor dem Figurenfest verkündet.<br />
Sie vertritt die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft im<br />
Stiftungskuratorium, zur Veranstaltung<br />
kam die Oberin dann mit einer guten<br />
Nachricht: „In den nächsten drei Jahren<br />
kaufen wir die sieben Großplastiken,<br />
die auf der Parkaue stehen“ – und die<br />
dann dort für immer bleiben werden.<br />
Auch wenn nicht alle Kunstwerke Gefallen<br />
finden – Muschg: „Die Kunst im Park<br />
schmeichelt dem Betrachter nicht, sie<br />
macht ihm zu schaffen“ – jeder kennt sie,<br />
jeder spricht über die Figuren – und<br />
beschäftigt sich damit auf seine Weise<br />
mit dem Thema Kunst, „er begegnet ihr<br />
in einem Impuls der Brüderlichkeit“. Und<br />
Professor Kraas berichtet in dem Zusammenhang:<br />
„Viele Patienten erzählen, dass<br />
sie durch die Figuren eine Ablenkung<br />
erleben“, eine Ablenkung <strong>vom</strong> Alltag im<br />
Krankenhaus, in das man – nun wieder<br />
Adolf Muschg – zwar nie gern geht, wo<br />
man trotzdem immer mehr den Eindruck<br />
bekommt: „Die Götter in weiß, sie werden<br />
menschlich“.<br />
<strong>Schwester</strong> <strong>vom</strong> <strong>Fach</strong><br />
Diane Bedbur leitet die Personalabteilung und Buchhaltung<br />
der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong>. Seit elf Jahren ist sie Mitglied<br />
im Vorstand des Vereins<br />
Von <strong>Berlin</strong> nach <strong>Berlin</strong>:<br />
Eine Weltenreise<br />
Rückblende. Vor ihrer Karriere<br />
bei der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />
<strong>Berlin</strong>, hatte Diane Bedbur<br />
einen „steinigen Weg zurückzulegen“.<br />
Die Entscheidung,<br />
1980 mit Ehemann und Kind<br />
zu Angehörigen in die Bundesrepublik<br />
übersiedeln zu wollen,<br />
brachte persönliche Einschnitte<br />
und große Veränderungen:<br />
Dem Antrag auf Übersiedlung<br />
folgte umgehend die Exmatrikulation,<br />
ihr auf den erlernten<br />
kaufmännischen Beruf<br />
aufbauendes Studium durfte sie<br />
dann nicht mehr abschließen.<br />
Auch dem Mann verboten die<br />
DDR-Behörden als Englisch- und<br />
Russischlehrer tätig zu sein.<br />
Endlich, im März 1984, durften<br />
Bedburs die DDR verlassen, die<br />
junge Familie zog von Ost-<strong>Berlin</strong><br />
nach Hessen und schließlich<br />
weiter nach Bayern. Die erste<br />
Tätigkeit ihres Mannes endete<br />
dort – nach nur einem dreiviertel<br />
Jahr: die Firma des<br />
Cousins hatte Konkurs anmelden<br />
müssen. „Das war eine Zeit<br />
mit vielen Höhen und Tiefen“,<br />
Diane Bedbur bestärkte ihren<br />
Ehemann, wieder an einer<br />
Schule zu unterrichten. Schnell<br />
fand er eine Anstellung – in<br />
West-<strong>Berlin</strong>, als Referendar an<br />
einer Kreuzberger Hauptschule.<br />
Eine <strong>Schwester</strong>nschaftskarriere<br />
Seine Frau Diane sucht noch,<br />
sie liest den Stellenmarkt der<br />
„<strong>Berlin</strong>er Morgenpost“, spricht<br />
beim Arbeitsamt vor. Ihr Sachbearbeiter<br />
vermittelt Diane<br />
Bedbur drei offene Stellen.<br />
Zum ersten Gespräch muss<br />
Diane Bedbur in die Frobenstraße<br />
– zur Verwaltungszentrale<br />
der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />
<strong>Berlin</strong>. Sie soll in der Personalverwaltung<br />
des Vereins arbeiten,<br />
schon nach einer Woche<br />
bietet ihr Oberin Christa Rohr<br />
die Festanstellung an. Es ist der<br />
6. Mai 1985, „das Datum werde<br />
ich nie vergessen“. Die Schwessternschaft<br />
ist damals noch<br />
ein kleiner Verein mit gerade<br />
einmal vierhundert Mitgliedern,<br />
viele davon sind pensionierte<br />
Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n.<br />
„Es war so angenehm familiär“,<br />
sagt Diane Bedbur heute, „ die<br />
pensionierten <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>n<br />
lebten noch im Mutterhaus „<br />
und in einem „Frauenunternehmen<br />
zu arbeiten, das gefiel mir<br />
sehr“. Auch wenn Oberin Rohr<br />
streng in Mitglieder und<br />
Nicht-Mitglieder trennt und<br />
Diane Bedburs direkte Vorgesetzte<br />
– „das war damals Frau<br />
Gläßer“ – oft nicht ganz so<br />
einfach ist.<br />
Bald schon bekommt die Neue<br />
mehr Verantwortung zugeteilt<br />
– jetzt für den gesamten Bereich<br />
der Personalverwaltung. Das<br />
Vereinsleben gefällt ihr, sie<br />
zeigt großes Interesse an der<br />
<strong>Schwester</strong>nschaft, bringt sich<br />
mehr und mehr ein, „anders als<br />
viele meiner Kolleginnen“.<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 25<br />
© PRIVAT<br />
Das Vereinsleben gefällt<br />
Diane Bedbur, sie zeigt<br />
großes Interesse an<br />
der <strong>Schwester</strong>nschaft,<br />
bringt sich mehr und<br />
mehr ein.
hedwig<br />
»Glück misst man nicht nach der Länge, sondern nach der Tiefe.« CARL SANDBURG<br />
Oberin Renate Lawrenz, die<br />
mittlerweile Christa Rohr<br />
abgelöst hat, freut sich und<br />
kommt mit einem ungewöhnlichen<br />
Angebot: Diane Bedbur<br />
soll Mitglied der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />
werden. Zwar kann<br />
sie keine medizinische Ausbildung<br />
vorweisen, auch arbeitet<br />
die Personalsachbearbeiterin in<br />
keinem Gesundheitsberuf.<br />
Dennoch gäbe es da die<br />
Möglichkeit, als „<strong>Fach</strong>schwesster“<br />
einzutreten – am 1. Januar<br />
1993 wird Diane Bedbur die<br />
erste in <strong>Berlin</strong> aus der Verwaltung<br />
und Mitglied der <strong>DRK</strong>-<br />
<strong>Schwester</strong>nschaft. Sogar Tracht<br />
und Haube darf sie tragen, „die<br />
zeige ich heute auf den<br />
Einführungsveranstaltungen,<br />
die neuen <strong>Schwester</strong>n wollen<br />
die alte Tracht unbedingt<br />
sehen“. In den Vorstand wählen<br />
sie die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>n auf der<br />
Mitgliederversammlung im<br />
Herbst 2000, vier Jahre später<br />
nimmt die <strong>Fach</strong>schwester als<br />
„ständiger Gast“ teil an den<br />
Sitzungen des Geschäftsführenden<br />
Vorstands.<br />
Rechte Hand der Oberin<br />
Als Lisa Gläßer Anfang 1996 in<br />
Rente geht, soll Diane Bedbur<br />
die Nachfolge antreten und<br />
Finanzbuchhaltung und<br />
Personalverwaltung übernehmen.<br />
Zuerst zögert sie, dann<br />
geht sie auf das Angebot ein.<br />
Gemeinnützigkeitsrecht,<br />
Steuerrecht, Buchhaltung:<br />
aufbauend auf den bereits<br />
erworbenen Kenntnissen<br />
erarbeitet Diane Bedbur sich im<br />
Selbststudium die zum Teil<br />
unbekannte Materie. Oberin<br />
Heidi Schäfer-Frischmann, die<br />
ab Dezember 1996 die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
als Vorsitzende<br />
führt, hilft ihr, „schon seit dem<br />
ersten Tag ist unsere Zusammenarbeit<br />
sehr vertrauensvoll<br />
und offen“, die neue Oberin<br />
wird ihr eine besondere<br />
Vorgesetzte. Am 1. November<br />
2000 bittet Oberin Heidi<br />
Schäfer-Frischmann zum<br />
Gespräch: „Können Sie sich<br />
vorstellen, die gesamte Verwaltung<br />
und dazu die Buchhaltung<br />
zu übernehmen?“ Solch einen<br />
Aufgabenbereich gab es bislang<br />
nicht, Diane Bedbur sagt<br />
trotzdem „ja, das kann ich“.<br />
Obwohl sie auch weiß: mit der<br />
Verantwortung wächst der<br />
Berg an Arbeit. Und Diane<br />
Bedbur ist klar: „so eine<br />
Karriere wäre in einem<br />
anderen Unternehmen nicht<br />
möglich“, dort werden die<br />
entscheidenden Stellen eher<br />
mit Männern besetzt. Nicht so<br />
in der <strong>Schwester</strong>nschaft, beide<br />
Oberinnen – Renate Lawrenz<br />
und Heidi Schäfer-Frischmann<br />
– hätten sie immer gefördert,<br />
„sie haben mir den Weg<br />
geebnet, dafür bin ich sehr<br />
dankbar“. Seit ihrer Berufung<br />
in den Aufsichtsrat der<br />
Krankenhausgesellschaften im<br />
Januar 2006 wird sie immer<br />
mehr zur rechten Hand von<br />
Oberin Schäfer-Frischmann.<br />
Diesen neuen, weiteren Posten:<br />
sie findet ihn spannend – „hier<br />
bekomme ich einen tiefen<br />
Einblick in die Geschäfte der<br />
Gesellschaften“. Aber die Arbeit<br />
im Aufsichtsrat wird Diane<br />
Bedbur einiges abverlangen:<br />
Mittwochmorgen, 9. Juni 2010,<br />
das Landeskriminalamt<br />
durchsucht die Geschäftsstelle<br />
der Kliniken und die Einrichtungen<br />
in Mitte und Westend,<br />
„es begann die schlimmste Zeit<br />
hier im Unternehmen, ich<br />
hatte so ein Gefühl der Leere,<br />
alles ging mir sehr nah“.<br />
„So eine Karriere<br />
wäre in einem anderen<br />
Unternehmen nicht<br />
möglich“<br />
Die Krise ist für sie eine sehr<br />
emotionale und sie verlangt<br />
noch mehr Einsatz, statt sich<br />
ein Mal im Quartal zu treffen,<br />
kommen jetzt die Aufsichtsräte<br />
mindestens wöchentlich<br />
zusammen. „Die Zeit hat mich<br />
geprägt“ und dass jeder auch<br />
ersetzbar ist, wird ihr nun so<br />
richtig bewusst. Ein paar Jahre<br />
– „fünf, sechs, sieben“ – wird<br />
Diane Bedbur noch von der<br />
Mozartstraße aus die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />
verwalten, spätestens<br />
mit 63 Jahren soll Schluss<br />
sein. Als pensionierte <strong>Schwester</strong><br />
will sie aber auf jeden Fall für<br />
„meine <strong>Schwester</strong>nschaft“ da<br />
sein – „wenn ich gebraucht<br />
werde“, schränkt Diane Bedbur<br />
ein. Nach ihrer Nachfolgerin<br />
schaut sie sich schon jetzt um,<br />
sie weiß, dass die Einarbeitung<br />
viel Zeit in Anspruch nehmen<br />
wird. Auf die „Neue“ wartet<br />
eine „Arbeit, die mir viel<br />
Freude macht“, viel Anerkennung<br />
bekomme sie, spürt aber<br />
auch: „Die Batterie ist schneller<br />
leer als früher“. Diane Bedbur<br />
genießt daher jede freie<br />
Minute, sie liest viel: Biographien<br />
sind die bevorzugte<br />
Lektüre – über den Alten Fritz,<br />
Katharina die Große, Wilhelmine<br />
von Bayreuth – „Frauenschicksale<br />
finde ich besonders<br />
spannend“. Auch die Natur hat<br />
es ihr angetan, die Mark<br />
Brandenburg gefällt der<br />
55-Jährigen ganz besonders, „ich<br />
liebe diese Region“. So wie den<br />
Landstrich gut achttausend<br />
Kilometer westlich: Bedburs<br />
verbringen ihren Urlaub gern<br />
im Nordosten Floridas, in St.<br />
Augustine. Dort kann Diane<br />
Bedbur am besten ausspannen,<br />
„hier sind kaum Menschen,<br />
alles ist so schön ruhig“. Denn<br />
auch wenn es die, die sie gut<br />
kennen, nicht glauben wollen:<br />
„Ich bin ein Menschenflüchter“,<br />
sie brauche nun mal ab und zu<br />
eine Auszeit <strong>vom</strong> eher unruhigen<br />
Arbeitsalltag in der<br />
<strong>Schwester</strong>nschaft.<br />
© <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN<br />
Im Grunewald<br />
Vor einem Winter<br />
Ich mach ein Lied aus Stille<br />
Und aus Septemberlicht.<br />
Das Schweigen einer Grille<br />
Geht ein in mein Gedicht.<br />
Der See und die Libelle.<br />
Das Vogelbeerenrot.<br />
Die Arbeit einer Quelle.<br />
Der Herbstgeruch von Brot.<br />
Der Bäume Tod und Träne.<br />
Der schwarze Rabenschrei.<br />
Der Orgelfl ug der Schwäne.<br />
Was es auch immer sei,<br />
Das über uns die Räume<br />
Aufreißt und riesig macht<br />
Und fällt in unsre Träume<br />
In einer fi nstren Nacht.<br />
Ich mach ein Lied aus Stille.<br />
Ich mach ein Lied aus Licht.<br />
So geh ich in den Winter.<br />
Und so vergeh ich nicht.<br />
EVA STRITTMATTER wurde am<br />
8. Februar 1930 als Eva Braun<br />
in Neuruppin geboren.<br />
Von 1947 bis 1951 studierte sie<br />
Germanistik und Romanistik in<br />
Ost-<strong>Berlin</strong>. Danach arbeitete sie<br />
beim Deutschen Schriftstellerverband<br />
und beim Kinderbuchverlag<br />
der DDR. Seit 1954 war sie freie<br />
Schriftstellerin. Seither veröffentlichte<br />
sie 14 Gedichtbände, mehrere Kinderbücher<br />
sowie sechs Prosa-Bände,<br />
darunter die „Briefe aus Schulzenhof“-Trilogie.<br />
1956 heiratete sie den<br />
18 Jahre älteren Schriftsteller Erwin<br />
Strittmatter, der 1994 starb. Am 3.<br />
Januar 2011 verstarb Eva Strittmatter,<br />
sie wurde 80 Jahre alt. „Die Ausnahmepoetin<br />
vermochte den Reigen<br />
des Lebens in Verse zu kleiden, in<br />
denen die Menschen Halt finden“,<br />
hieß es im Nachruf ihres Verlages.<br />
© Herausgeber: <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> e.V., Mozartstraße 37, 12247 <strong>Berlin</strong>, Telefon: 030-3035-5450<br />
Telefax 030-3035-5473, www.drk-schwesternschaft-berlin.de | hedwig@drk-schwesternschaft-berlin.de<br />
Verantwortlich: Oberin Heidi Schäfer-Frischmann, Diane Bedbur, Doreen Fuhr (<strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> e.V.)<br />
Redaktion und Gestaltung: Brille und Bauch Agentur für Kommunikation: www.brilleundbauch.de<br />
NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 27
hedwig<br />
»Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun.« VOLTAIRE<br />
Endlich Schule „Als ich mich taufen ließ, dit fand der<br />
Guru fies“, sang Nina Hagen, Stargast auf der Eröffnungsfeier der neuen Arche-<br />
Grundschule. Die Sängerin hat sich vor zwei Jahren taufen lassen, seit kurzem<br />
ist sie Botschafterin für das evangelische Kinderhilfswerk. Wesentlich länger<br />
unterstützt die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> die Arche, seit 2005 hilft der Verein<br />
sozial benachteiligten Kindern aus <strong>Berlin</strong>. Die Arche-Schule hat in fünf Jahren<br />
die Schülerzahl fast verzehnfacht, 120 Kinder lernen hier fürs Leben. Viele<br />
Schüler, zu wenig Platz – die Arche-Schule in Hellersdorf musste daher umziehen.<br />
Im Sommer bezogen Lehrer und Schüler nun ihr neues Schulgebäude,<br />
in dem schon vorher eine staatliche Bildungseinrichtung untergebracht war.<br />
Die Eröffnung der neuen Arche-Schule feierten Schüler, Lehrer und Eltern<br />
im September ausgiebig. Arche lud auch alle ein, die das Projekt von Beginn<br />
an unterstützen. Wie die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong>; der Verein hat die<br />
Patenschaft für zehn Schüler übernommen.<br />
Zurück nach Nord-Nord-West Einige hunderttausend Kilometer werden es schon gewesen sein,<br />
die Hannelore Rebien in den letzten Jahren zurück-gelegt hat. Zwischen Travemünde und <strong>Berlin</strong> ist sie bis einschließlich<br />
1. Dezember 2011 gependelt: an dem Tag wurde nun die Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong> in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1975<br />
ist sie in der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong>, mehr als 25 Jahre lang arbeitete sie als Pflegedienstleitung der <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Mitte.<br />
Statt „Personalgespräch führen“ und „Stellenplan ausarbeiten“ heißt es nun „giepen“ und „gieren“: Hannelore Rebien<br />
wird <strong>Schwester</strong>nkittel gegen Friesennerz eintauschen und Segeltörns auf der Ostsee unternehmen.<br />
© ARCHE<br />
© <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN<br />
Familientreffen<br />
in der Mozartstraße<br />
Seit Mai 2009 begrüßt die „Stehende“ Besucher<br />
und Mitarbeiter der <strong>Schwester</strong>nschaftszentrale,<br />
im September kam jetzt ihre „<strong>Schwester</strong>“ hinzu.<br />
Auch die „Gestreckt Liegende“ gehörte zum<br />
„Figurenpark“, einer Dauerausstellung mit etwa<br />
dreißig Plastiken, die auf das Gelände der<br />
<strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend verteilt sind.<br />
In der Nähe des Hochhauses hatte sie ihren Platz,<br />
nun liegt die Bronze-figur im Garten der<br />
Mozartstraße. 1,85 Meter ist die Skulptur lang,<br />
erschaffen wurde sie 1958 von Ludwig<br />
G. Schrieber. Seine „Stehende“ ist drei Jahre älter,<br />
sie zählt zu den bekanntesten Werken<br />
des Bildhauers. Schrieber arbeitete unter anderem als Professor an der <strong>Berlin</strong>er Hochschule der Künste,<br />
er verstarb 1975 im Alter von 68 Jahren und wurde auf dem Friedhof in Dahlem in einem Ehrengrab<br />
beigesetzt. Einer seiner besten Freunde war Günter Grass; der Literaturnobelpreisträger<br />
widmete Schrieber ein ganzes Kapitel im Buch „Der Butt“.