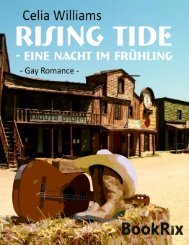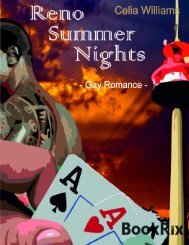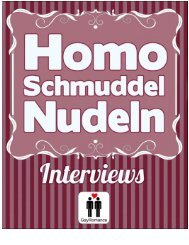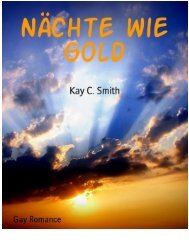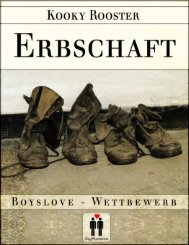Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kim Eisenheide<br />
Mein Sommer <strong>als</strong> Unsichtbarer: Anders<br />
Gay Erotic
Anders<br />
Ich arbeitete <strong>als</strong> freier Wissenschaftsjournalist in Berlin. Wildschutz durch Computer,<br />
Gesichtsscanner am Flughafen, Geothermiekraftwerk in Brandenburg – die Themen<br />
fanden sich im gleichen Maße leicht, wie sie schwer zu verkaufen waren. Meine Beiträge<br />
versuchte ich auf den Wissenschaftsseiten der Tageszeitungen unterzubringen, aber die<br />
Konkurrenz war groß, das Geld knapp, die Arbeit unbefriedigend.<br />
Und im heißesten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen (darüber musste<br />
man einfach eine Reportage schreiben, das dachten sich jedenfalls <strong>mein</strong>e Konkurrenten)<br />
machte sich der Frust über <strong>mein</strong>e berufliche Situation auch in <strong>mein</strong>er Beziehung zu<br />
<strong>mein</strong>em langjährigen Freund Julian bemerkbar.<br />
Nur seinetwegen war ich nach Berlin gezogen, weil er einen unglaublich guten Job in<br />
einem Bundesministerium bekommen hatte. Er bezahlte unsere Wohnung, unseren<br />
Urlaub, unser Leben. Und ich hoffte auf den Aufstieg in einer Branche, die von<br />
Selbstausbeutung lebte.<br />
Es war der Abend vor einer neuen Recherche, <strong>als</strong> er seinen Koffer packte und aus<br />
unserer stickigen Wohnung auszog. Der Schnitt, so überraschend er auch gezogen war,<br />
folgte einer schmerzvollen Konsequenz. Julian hatte sich nicht in einem Ausbruch von<br />
Wut und Enttäuschung für die Trennung entschieden: Dieser Schritt war wohlüberlegt.<br />
Kein Schreien, kein Flehen ging unserem Abschied voraus.<br />
Mit einer nüchternen Analyse, wie ich sie von Julian erwartet hatte, bilanzierte er die<br />
letzten Monate und zog daraus den logischen Schluss. Ich hatte versagt, hatte mit dem<br />
Schwanz gedacht und nicht mit dem Kopf, hatte nur daran gedacht, mit anderen<br />
Männern ins Bett zu steigen und so zu werden wie <strong>mein</strong> Vater. Mit dem kleinen<br />
Unterschied, dass er den Frauen hinterhergerannt war, bis <strong>mein</strong>e Mutter ihm den<br />
Laufpass gegeben hatte.<br />
Als Julian ging, brach die Welt noch nicht zusammen. Das tat sie erst ein paar<br />
Stunden später in der Hitze der Nacht. Ich hatte gesoffen, in der Schwulenkneipe die<br />
Straße runter, in der jetzt nur noch Heteros die Exotik suchten, und jeder Flirt ertrank<br />
dabei in einem neuen Bierglas. Einem Typen, der nicht sofort gegangen war, nachdem ich<br />
begonnen hatte, ihm <strong>mein</strong> Leid zu klagen,<br />
Während ich von der mühsamen Jagd nach Themen berichtete, spürte ich die<br />
permanente Unsicherheit, wie so häufig, wenn ich mit einem mir unbekannten Menschen<br />
redete. Ich analysierte jedes von mir gesagte Wort, wollte mich noch im Redefluss<br />
korrigieren und verhaspelte mich dabei. Es war wie ein Radwechsel in voller Fahrt.<br />
Der Typ hatte mir schließlich auf die Schulter geklopft und begonnen, von seiner Frau<br />
zu erzählen und dass er jetzt gehen müsse.<br />
Lasst mich doch alle in Ruhe, hatte ich nur gedacht und nicht gesagt, denn niemand<br />
war am Ende da gewesen, um mit mir zu ficken. Also hatte ich den Rest der Nacht im<br />
Internet nach Pornos gesucht, bis mir die Hand und der Arsch wehtaten. Der Alkohol<br />
betäubte nur <strong>mein</strong>en Schwanz, nicht den Schmerz.<br />
Hohl und leer legte ich mich in unser, in <strong>mein</strong> Bett, in das leere Bett.<br />
Die Nacht zog schmierige Schlieren, die hektisch zitternd verblassten.<br />
Ich war frei, nein, ich war verlassen. Ich konnte alles tun, was ich wollte, konnte
endlich, konnte was? Ich war wie <strong>mein</strong> Vater, ich war unfähig zu einer Beziehung, ich war<br />
unfähig, mit etwas anderem <strong>als</strong> mit <strong>mein</strong>em Schwanz zu denken.<br />
Schluchzend wälzte ich mich auf einem schweißnassen Laken, spürte eine nie<br />
gekannte Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit. Schlaflos starrte ich zum Mond,<br />
der durch das offene Fenster unseres Schlafzimmers schien. Warme Luft an <strong>mein</strong>er Haut.<br />
Mein Leben würde nie wieder so sein, wie es war.<br />
Pläne hatten ihre Gültigkeit verloren. Abmachungen waren wertlos geworden. Ficken,<br />
mit allem ficken, was jetzt in <strong>mein</strong>e Nähe kam - das konnte ich noch, doch was hatte<br />
das für einen Sinn?<br />
Jetzt konnte ich, doch jetzt wollte ich nicht mehr. Ich ekelte mich vor mir selber, vor<br />
dem Mann, der nur Schwanz war und nicht Kopf.<br />
Julians letzte Worte klangen wie die Warteschleife in einer Telefonanlage. »Ich habe<br />
versucht, dir zu helfen, aber du suhlst dich in deinem Selbstmitleid«, sagte er immer und<br />
immer wieder.<br />
Selbstmitleid. Wenn es nur das wäre. Ich hasste mich.<br />
Bald wich das Dunkel über der Stadt einem blassen Schimmer und einem hässlich<br />
heißen Morgen. Ich zog mich schwankend an, schlich die Treppe hinunter auf die Straße,<br />
kaufte mir einen Kaffee und setzte mich mit brennenden Augen in die S-Bahn. Mein Blick<br />
wollte ins Leere gehen und fing sich doch <strong>als</strong> blasse Reflexion in der Scheibe des Wagens.<br />
Das Gesicht kam mir seltsam fremd vor.<br />
Ein paar Monate früher: Wissenschaftsjournalist.<br />
Nachdem ich Dutzende von Bewerbungen geschrieben, verschickt und versucht hatte,<br />
irgendeine Festanstellung zu bekommen, wusste ich nur, was man mit einem<br />
Soziologiestudium alles nicht machen konnte. Auf Wissenschaftsjournalist wäre ich nie<br />
gekommen, bis mich ausgerechnet das Netzwerk von Julian auffing: Er kannte einen<br />
Redakteur im Ressort Wissen einer Berliner Tageszeitung. Die Redaktion beschäftigte<br />
immer wieder Freelancer. Jetzt sollte ich <strong>als</strong> freier Autor Themen vorschlagen.<br />
Also setzte ich mich mit <strong>mein</strong>em PC in eine stickige Büroge<strong>mein</strong>schaft von zwei jungen,<br />
dynamischen und ehrgeizigen Arschlöchern, einem Architekten und einem Kulturmanager,<br />
die so unerträglich produktiv waren, dass ich ihnen kaum bei der Arbeit zusehen konnte,<br />
und suchte nach Themen.<br />
Manchmal ging ich ins Büro, obwohl ich weder einen Artikel zu schreiben, noch Lust<br />
hatte, nach neuen Themen zu recherchieren. Nur Julians Ahnung, dass ich zuhause<br />
versumpfen würde, ginge ich nicht jeden Morgen vor die Tür, trieb mich an.<br />
Er sah die 50 Euro für den Arbeitsplatz <strong>als</strong> eine gute Investition in <strong>mein</strong><br />
Selbstbewusstsein, bestellte mir Visitenkarten und gab immer wieder Tipps, wenn er von<br />
einer Geschichte gehört hatte, die seiner Meinung nach einen guten Artikel ergab.<br />
Erdmagnetfeldsimulatoren. Kryobiologie. Wildwechsel-überwachung per Webcam. What<br />
the fuck.<br />
Erstaunlicherweise bekam ich nach einer Reihe von Themenvorschlägen die Aufgabe,<br />
über neue Methoden bei der Bekämpfung von Schuppenflechte zu schreiben, nach denen<br />
an der Charité geforscht wurde. In einer Sekunde hatte ich das Gefühl, voranzukommen,<br />
ein Ziel zu haben. Noch überraschender: Mein Artikel wurde gedruckt, zwar stark gekürzt<br />
und an mehreren Stellen umgeschrieben, aber Julian war begeistert, ich dagegen sah es
nur <strong>als</strong> eine Verzögerung vor dem Fall, <strong>als</strong> das retardierende Moment.<br />
Drei Tage später zertrümmerten drei abgelehnte Exposés, dumme Rechtschreibfehler<br />
und eine schludrige Recherche <strong>mein</strong> Selbstbewusstsein wie ein Vorschlaghammer einen<br />
Kieselstein.<br />
Ich war kein Wissenschaftsjournalist, ich war nicht mal Autor, ich war gar nichts, nur<br />
ein elender Hochstapler. Ich sagte auch nicht, ich sei Wissenschaftsjournalist, sondern ich<br />
sagte, ich würde <strong>als</strong> Wissenschaftsjournalist arbeiten. Ein kleiner, aber wie ich fand, feiner<br />
Unterschied. Meine Texte waren oberflächlich und schlecht geschrieben, sonst hätte der<br />
Redakteur sie nicht eigenhändig verändert.<br />
Manchmal stellte ich mir vor, wie ich etwas Großartiges tat, etwas Unfassbares<br />
greifen konnte. Mir kam es häufig so vor, <strong>als</strong> würde ich nur darauf warten, dass ich<br />
<strong>mein</strong>e Bestimmung fand. Irgendwo musste es das Leben geben, das für mich gemacht<br />
war, zu dem ich passte. Irgendwo musste ich doch zeigen können, was in mir steckte.<br />
Irgendwo musste es einen Platz geben, an dem <strong>mein</strong>e Narben kein Makel, sondern der<br />
Schlüssel waren.<br />
Saß ich an <strong>mein</strong>em alten PC im Büro, hatte ich das Gefühl, <strong>als</strong> seien <strong>mein</strong>e Hände mit<br />
Helium gefüllt. Zwei Minuten war das Maximum. Länger konnte ich mich nicht am Stück<br />
konzentrieren, konnte ich nicht über Kryobiologie nachdenken, weil nach zwei Minuten<br />
worldsex.com interessanter und jeder Klick geiler waren und jeder andere Gedanke <strong>als</strong><br />
der an <strong>mein</strong>e Arbeit mehr Befriedigung versprach.<br />
Manchmal dachte ich, ich würde die Daten aus dem Internet nur herunterladen, weil<br />
ich es konnte. Aber das war nur eine lahme Ausrede. In diesen Tagen kam es mir vor, <strong>als</strong><br />
säße ein anderer Mensch an <strong>mein</strong>em Arbeitsplatz, ein Mensch, der sich konzentrieren<br />
konnte. Manchmal sah ich ihn dort sitzen, während ich <strong>mein</strong>e Nägel feilte, weil mal<br />
wieder <strong>mein</strong> Rechner abgestürzt war. Dort saß ein dicklicher Typ und machte <strong>mein</strong>e<br />
Arbeit, während ich aus dem Fenster starrte, weil mir nichts einfiel. Er schrieb weiter,<br />
während ich in der Küche stand und Kaffee trank, weil mir zu warm war. Er suchte nach<br />
Themen, während ich auf Spiegel Online surfte, weil die Struktur des Textes laut Word<br />
plötzlich fehlerhaft war.<br />
Ich war nicht wirklich da, ich war nicht in dieser Welt. Nur wenn ich unbeobachtet auf<br />
Pornoseiten surfte, um mich für einen einzigen klaren Gedanken zu belohnen, wenn die<br />
Kollegen <strong>mein</strong>er Büroge<strong>mein</strong>schaft gingen und ich blieb, um <strong>mein</strong>e Hose auszuziehen,<br />
fühlte ich die Wirklichkeit durch <strong>mein</strong> Hirn schwemmen. Nur dann konnte ich mich<br />
konzentrieren, nur dann war es, <strong>als</strong> würde ich aufwachen. Doch nach jeder Rückkehr in<br />
die Welt der mit Helium gefüllten Hände wurde <strong>mein</strong> Denken immer unschärfer, konnte<br />
ich nicht mehr klarsehen. Es war wie ein ständiger Schwindel. Ich schwebte über allem,<br />
konnte nicht mehr zuhören, nicht richtig auf eine Frage eingehen, weil ich mit den<br />
Gedanken ständig bei den Files war, die ich noch runterladen musste.<br />
Wie krank muss man sein, wenn jedes Wort eine Assoziationskette auslöst, an deren<br />
Ende etwas steht, das mit Sex zu tun hat? Aus Arztpraxis wird Arztstuhl wird<br />
Doktorspielchen wird Latexhandschuh wird Faustfick. Aus Sommer wird Skater wird<br />
Shorts wird Beule wird Schwanz. Aus Autowerkstatt wird Hebebühne wird Schmiermittel<br />
wird Gleitmittel wird Analverkehr.<br />
Ich war so dauergeil und erregt – ich konnte an nichts Anderes mehr denken <strong>als</strong> an<br />
Sex. Ich fühlte mich wieder wie ein Motor, der auf vollen Touren im Leerlauf dreht; fühlte
mich, <strong>als</strong> hätte ich eine lose Schraube im Kopf. Ich wusste nicht, ob ich wach war oder<br />
träumte, fühlte mich müde und zugleich aufgekratzt, wollte mir ständig und überall<br />
einen runterholen. Auf dem Fahrrad, in der U-Bahn, in der Parkanlage, im Supermarkt,<br />
beim Telefonieren.<br />
Wo geht man hin, wenn die Reize nicht mehr aufhören? Ich spürte, wie <strong>mein</strong> Denken<br />
ausfranste. Mein Hirn war zu einem unübersichtlichen Schrottplatz geworden, in dem die<br />
Gedanken keine Ordnung mehr hatten, alt und rostig und nutzlos waren. Spürte, wie<br />
<strong>mein</strong>e Gedanken nicht mehr greifbar waren, wie ein Sandsturm, ein Schwarm Bienen, und<br />
wollte zugleich für mich alleine sein, <strong>mein</strong>e Gedanken glätten wie Putz an der Wand.<br />
Kam ich nach Hause, legte ich mich auf die Couch, drehte ABBA voll auf und<br />
versuchte, die Bilder aus dem Kopf zu bekommen. Ich hörte wieder und wieder das gleiche<br />
Lied, S.O.S. in Endlosschleife, manchmal zehnmal hintereinander. Ich konnte damit nicht<br />
aufhören. Die Musik hüllte mich wie eine warme Decke ein. Bilder einer an die Schläfe<br />
gehaltenen Pistole, <strong>mein</strong> Finger am Abzug. Ich spürte den Schlag der Kugel am Schädel.<br />
Aussitzen, wie Helmut Kohl die wichtigen Themen, dam<strong>als</strong> <strong>als</strong> Kanzler, aussitzen<br />
musste ich diese Phase, bis die Stimmen verschwanden, bis der schiefe Schuh wieder<br />
gerade gelaufen war, ich mich wieder konzentrieren, mit Begeisterung einer Sache<br />
widmen konnte.<br />
Irgendwann musste der Knoten platzen, bis dahin musste ich das Monster unter<br />
Kontrolle haben, es nicht aus seinem Käfig lassen oder zumindest in der virtuellen<br />
Gefangenschaft halten.<br />
Beruflich trat ich monatelang auf der Stelle. Kämpfte mit der Stagnation. Ein Artikel<br />
pro Monat, viele Anrufe und E-Mails an neue Redaktionen und so viel Mühe, einen Fuß in<br />
die Tür zu bekommen. Zu <strong>mein</strong>em Glück hatte mich noch niemand entlarvt.<br />
Der Crash im Straßengraben war vorprogrammiert.<br />
Ich merkte es, wenn ich bei <strong>mein</strong>en Interviewpartnern saß und f<strong>als</strong>che Fragen stellte.<br />
Jedes <strong>mein</strong>er Worte war mühsam über <strong>mein</strong>e Lippen gekommen und ich hatte gefürchtet,<br />
jeden Augenblick <strong>als</strong> der enttarnt zu werden, der ich war: ein Hochstapler, ein Usurpator,<br />
ein Nichtschwimmer beim Iron Man auf Hawaii. Immer wieder spürte ich, wie ich langsam<br />
nach hinten kippte, wie der Horizont nach unten abtauchte und erst der blaue Himmel<br />
<strong>mein</strong>e ganze Sicht einnahm, bevor von oben der harte Boden in <strong>mein</strong> Blickfeld stieß und<br />
ich die Orientierung verlor, in die Tiefe trudelte und den Aufprall erwartete.<br />
Wann merkten die Redakteure eigentlich, dass ich ein Hochstapler war? Julian war<br />
glücklich in seinem Job, scheffelte Kohle, kaufte sich einen Laptop und bekam<br />
Bestätigung. Mich hingegen brauchte niemand. Diese Unzufriedenheit machte sich endlich<br />
auch in unserer Beziehung bemerkbar. Nicht zugeschraubte Zahnpastatuben, zu hohe<br />
Telefonrechnungen, Socken auf dem Fußboden.<br />
Manchmal schrie mich Julian an, weil ich <strong>mein</strong> Handy nicht angeschaltet hatte und er<br />
vergeblich versuchte, mir den Einkaufszettel für den Abend zu diktieren.<br />
Ich schrie zurück, weil er mir immer das Gefühl gab, ein Idiot zu sein. Nein, er gab mir<br />
nicht das Gefühl, er entlarvte mich. Und dennoch starb <strong>mein</strong>e Liebe nicht, sie änderte sich<br />
nur. Ich spürte immer häufiger, dass ich ihn umso mehr liebte, je weiter weg er war. War<br />
er auf Dienstreise, hatte ich Sehnsucht nach ihm, stellte mir vor, wie es sich anfühlen<br />
musste, einen geliebten Menschen neben mir im Bett zu haben und morgens neben<br />
diesem aufzuwachen.
Lag er neben mir, spürte ich seine unausgesprochenen Vorwürfe und wünschte mich<br />
weit weg.<br />
Nachts träumte ich wieder davon, im Haus <strong>mein</strong>er Eltern Pornohefte zu finden;<br />
Pornos, die ich immer gesucht hatte, die sie vor mir verstecken wollten. Pornos waren in<br />
den Träumen der heilige Gral und alles, was ich zum Glück brauchte. Wenn ich<br />
aufgewacht war, mit einer Erektion in der Schlafanzughose, hatte ich mich hohl und<br />
krank gefühlt.Julian hatte mich am Ende erwischt. Mein Browserverlauf hatte mich<br />
verraten. Es war nur der berühmte Tropfen. Wir waren uns fremd geworden.<br />
Kriegsparteien in einem Stellungskampf der Gefühle. Wir waren Minensucher, und der<br />
andere war das Minenfeld. Jede f<strong>als</strong>che Bewegung löste eine Explosion aus und nahm<br />
sich mehr von unserer Liebe. Früher wollte ich mich ändern, weniger dem Schwanz <strong>als</strong><br />
vielmehr den Kopf das Denken überlassen, und früher wollte Julian sich ändern, sensibler<br />
mit mir umgehen.<br />
Doch um beim Bild zu bleiben: Seine Hände begannen immer mehr zu zittern, und<br />
<strong>mein</strong> Zünder reagierte immer sensibler auf Fehlgriffe. Ich reagierte explosiv, unbeherrscht,<br />
nichts konnte er richtigmachen, jede seiner Fragen war ein Vorwurf, jede Bemerkung ein<br />
Seitenhieb auf <strong>mein</strong> berufliches Versagen. Ich warf ihm Arroganz vor und<br />
Überlegenheitsgefühl, und war doch nur geprägt von Minderwertigkeitskomplexen und<br />
unzufrieden mit mir selbst.<br />
Und dann, eines Tages, am Vorabend zu <strong>mein</strong>er Recherche, hatte Julian die Taschen<br />
gepackt. Ich könne die Wohnung übernehmen, hatte er gesagt, aber eine WG sei<br />
vermutlich die bessere Alternative. Eine billigere Alternative für jemanden ohne richtigen<br />
Job – das hatte er eigentlich ge<strong>mein</strong>t. Aber er schien es <strong>als</strong> einen letzten Dienst an mir zu<br />
verstehen, eine nette Geste, es mir nicht zu sagen. Ich war auch so von alleine<br />
draufgekommen.<br />
Im Hahn-Meitner-Institut in Berlin-Wannsee wurde ich erwartet. Vom Pförtner bekam<br />
ich eine Plakette, an der die Strahlungsbelastung abzulesen war. Eine Physikerin namens<br />
Horkheimer begrüßte mich. In einem Fahrstuhl fuhren wir in das dritte Untergeschoss.<br />
Es ging bei diesem Artikel um Forschungen an Bildern. Mittels einer speziellen<br />
radioaktiven Strahlung wollten Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern<br />
herausfinden, wie viele Farbschichten sich unter einem Bild von Tizian wirklich verbargen.<br />
Ich konnte den Erläuterungen von Dr. Horkheimer nicht zuhören.<br />
In Gedanken war ich ständig bei Julian. Der Kloß in <strong>mein</strong>em H<strong>als</strong> schwand nicht. Wir<br />
gingen durch einige Türen und Gänge. Neonröhren an den Decken, grünes Linoleum auf<br />
dem Boden, weiße Wände. Schließlich gelangten wir zu einer schweren Stahlkammer. Das<br />
gelb-schwarze Zeichen für Radioaktivität darauf beeindruckte mich mehr <strong>als</strong> erwartet.<br />
Als sich die Tür hinter uns schloss, wirkte es wie das Finale in einem Film, wenn sich die<br />
letzten Menschen in einem Atomschutzbunker versteckten und die Atomraketen<br />
abgeschossen wurden.<br />
Fünf oder sechs Wissenschaftler wirbelten um den Forschungsreaktor herum. Der<br />
Kontrollraum hatte bemerkenswert wenig Ähnlichkeit mit dem, was ich aus Filmen<br />
erkannte. Keine große Schalttafel, sondern viele herkömmliche Computer, Monitore,<br />
unbekannte Maschinen. Ich musste zugeben – ich war schlecht vorbereitet auf dieses<br />
Experiment. Außerdem war mir übel.
Ob die Menschen um mich herum bemerkten, dass ich noch immer besoffen war? Ich<br />
hatte keine Ahnung, was genau dort vor sich ging. Bei den Telefonaten mit Frau Dr.<br />
Horkheimer hatte ich die Pressemitteilung vorliegen, und ich verstand, was die<br />
Wissenschaftler dort machten. Aber vom Wie hatte ich keine Ahnung. Ich war Journalist,<br />
kein Physiker. Jetzt fehlten mir die Infos der Mitteilung, und außerdem fochten Bier und<br />
Tequila einen unfairen Kampf gegen mich.<br />
Bald tauchte die Mitarbeiterin der Gemäldegalerie mit dem Bild auf. Neben ihr ein<br />
muskelbepackter Wachmann. Und schließlich gerieten die Wissenschaftler in Wallung.<br />
Drückten hier einen Knopf und gaben dort Befehle ein. Als Frau Dr. Horkheimer<br />
ankündigte, die Untersuchung würde um eine halbe Stunde verschoben, verlor ich den<br />
Kampf. Die Stahltür öffnete sich nur für mich, ich wankte in den Korridor dahinter. Dann<br />
fiel die schwere Pforte wieder ins Schloss. Die Toilette war ein erstaunlich schmuddeliger<br />
Raum. Penible Wissenschaftler waren wohl nur zu Hause und im Labor penibel, nicht<br />
jedoch in fremden Toiletten.<br />
Das weiße Toilettenbecken nahm mir nur zu gerne <strong>mein</strong>e Buße ab. Mit zitternden<br />
Händen umklammerte ich die Keramik und spürte, wie sich <strong>mein</strong> Magen wieder<br />
entkrampfte. Erschöpft hockte ich mich auf den Boden. Nach ein paar Minuten konnte ich<br />
<strong>mein</strong> Bild im Spiegel wieder klar fixieren, einen Schluck Wasser aus dem Hahn nehmen<br />
und mit festem Griff die Tür zum Korridor öffnen.<br />
Die roten Lichter auf dem Weg zurück zur Kammer fand ich zunächst nur<br />
überraschend. Als dann jedoch die Sirenen zu dröhnen begannen, packte mich die Panik.<br />
Die letzte Kurve vor der Stahltür nahm ich schon mit zitternden Knien.<br />
Mir brach der Schweiß aus. Was schiefgelaufen war, hat mich später nicht interessiert.<br />
Das Bild jedoch von der durchsichtigen Stahltür und den brennenden Menschen dahinter<br />
werde ich nie vergessen. Die Wissenschaftler, die Mitarbeiter, die Frau aus dem Museum,<br />
der Wachmann – sie alle rissen sich verzweifelt die lodernde Kleidung vom Körper. Ihre<br />
Haare brannten.<br />
Und die Stahltür: Sie war durchsichtig, doch man konnte die Konturen weiter<br />
erkennen. Sie wirkte wie aus Glas, brach das Licht, verzerrte die Perspektive auf das<br />
Drama dahinter. Der Schock riss mir fast die Füße weg. Als dann <strong>mein</strong> Hemd und <strong>mein</strong>e<br />
Hose zu qualmen begannen, konnte ich nur noch <strong>mein</strong> Leben retten. Ich riss mir die<br />
schmelzenden Schuhe von den Füßen, zog mir das bereits brennende Hemd über den<br />
Kopf, warf die Hose ab.<br />
Die Menschen hinter der Stahltür waren zusammengebrochen, <strong>als</strong> ich das nächste Mal<br />
hinsah. Ich wollte fliehen und wusste nicht wohin. Meine Boxershorts wurden brennend<br />
heiß. Sie folgten <strong>als</strong> nächste.<br />
Das Linoleum unter <strong>mein</strong>en Füßen wurde warm, wellte sich, löste sich auf. Ich rannte<br />
nackt den Korridor hinauf, <strong>als</strong> ich den Knall hörte. Etwas riss mich von den Füßen, ich<br />
prallte gegen eine Tür. Diese sprang auf, ich stürzte in den dunklen Raum dahinter und<br />
stieß mir den Kopf. Dann verlor ich das Bewusstsein.<br />
Zitternd wachte ich auf. Anfangs wusste ich nicht, wo ich war, hielt einen Feudel für<br />
<strong>mein</strong> Kopfkissen und ein altes Handtuch für <strong>mein</strong>e Decke. Dann spürte ich den Besen in<br />
<strong>mein</strong>em Rücken. Es war noch immer dunkel in der Besenkammer. Notbeleuchtung im<br />
Korridor. Rotes Blinken.
Die Ruhe war brutal.<br />
Ich rappelte mich auf. An <strong>mein</strong>en Füßen spürte ich den warmen Boden, im Gesicht den<br />
heißen Luftzug im Korridor, ich schmeckte den Rauch in der Luft und roch <strong>mein</strong>en eigenen<br />
Schweiß. Ich wagte kaum, den Blick zurück in den Korridor zu werfen. Doch es war<br />
weniger schlimm <strong>als</strong> befürchtet.<br />
Dort, wo der Forschungsreaktor gewesen war, gähnte ein tiefes Loch, in dem ein<br />
kleines Feuer flackerte. Rohre, verbogen wie krumme Äste, ragten aus der Wand, Kabel<br />
griffen ausgefranst ins Leere. Keine verbrannten Reste von Menschen, kein Blut, keine<br />
Knochen.<br />
Die Stahltür war verschwunden, <strong>mein</strong>e Kleidung auf dem Boden zu Asche verbrannt<br />
und mit dem Linoleum verschmolzen. Meine Brieftasche ein schwarzer Klumpen. Als ich<br />
mich bückte und danach griff, fasste ich ins Leere.<br />
Und dann bemerkte ich es. Der Schock überrollte mich wie ein Güterzug. Ich glaubte<br />
erst an eine optische Täuschung, blinzelte, wollte mir mit der Hand die Augen reiben und<br />
wurde noch panischer. Mein Herz raste wie eine Ratte in ihrem Käfig. Da war keine Hand,<br />
waren keine Finger. Ich konnte <strong>mein</strong>e Hände nicht sehen, nicht <strong>mein</strong>e Füße, nicht <strong>mein</strong>e<br />
Beine.<br />
Verblüfft fiel ich zurück auf <strong>mein</strong>en Hintern. Wieder blieb mir die Luft weg. Ich hob<br />
das, was ich <strong>als</strong> Hände spürte, vor <strong>mein</strong>e Augen und sah durch sie hindurch. Ich führte sie<br />
näher an <strong>mein</strong>e Augen und berührte plötzlich <strong>mein</strong> Gesicht. War ich tot? Ein Geist? Mein<br />
Herz raste, <strong>mein</strong>e Knie zitterten, der Kater war verschwunden.<br />
Ich musste mich berühren, <strong>mein</strong>e Hände kneten, um mich zu vergewissern, dass sie<br />
noch da waren. Ich fasste <strong>mein</strong>e Füße an, <strong>mein</strong>e Knie, <strong>mein</strong>e Oberschenkel, tastete nach<br />
<strong>mein</strong>em Penis und <strong>mein</strong>en Hoden, spürte erleichtert das Schamhaar, beruhigend den<br />
Bauch, <strong>mein</strong>e Oberarme, <strong>mein</strong> Gesicht, <strong>mein</strong>e Haare.<br />
Langsam erhob ich mich und griff erneut nach <strong>mein</strong>em verkohlten Portmonee im<br />
Linoleum. Die Koordination einer unsichtbaren Hand stellte <strong>mein</strong> Hirn vor eine schwere<br />
Aufgabe. Zweimal, dreimal griff ich daneben. Dann schließlich konnte ich die Lücke im<br />
Bild ersetzen und den steinharten schwarzen Klumpen, in dem <strong>mein</strong>e Kreditkarten, <strong>mein</strong><br />
Ausweis, <strong>mein</strong> Leben steckten, ungläubig betasten.<br />
Mir wurde schwindelig. Schmerzen nur im Kopf, ansonsten ging es mir gut. Und jetzt?<br />
Wo sollte ich hin? Was sollte ich machen? Hier war ein Reaktor explodiert. Das mussten<br />
doch Feuerwehr und Polizei, Katastrophenschutz und THW bemerkt haben? Vorsichtig lief<br />
ich barfuß den Gang hinauf.<br />
Wie hatte das geschehen können?<br />
Warum war ich nicht verbrannt wie die anderen?<br />
Und wie konnte ein Atomreaktor Materie unsichtbar machen?<br />
So viele banale Fragen von einem, der keine Ahnung hatte. Ich zog eine Tür auf, ging<br />
durch einen weiteren Gang und stand schließlich wieder vor dem Fahrstuhl. Er war außer<br />
Betrieb. Ich wollte nur raus aus diesem Labyrinth, geriet beinahe in Panik und fand<br />
schließlich die Tür zum Treppenhaus.<br />
Als ich im Erdgeschoss anlangte, war noch immer niemand zu sehen oder zu hören.<br />
Der Empfang war geräumt. Doch draußen auf der Straße standen eine Menge Menschen<br />
etwa 100 Meter vor dem Gebäude des Instituts in der prallen Sonne. Ich sah sie durch die<br />
Glastüren der Lobby.
Fahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr, des THW, Ambulanzen, Sanitäter, Männer in<br />
weiß, grün, blau sowie eine Menge Schaulustige. Durch eine offene Tür wehte heiße<br />
Sommerluft herein. Umschmeichelte mich.<br />
Da stand ich. Nackt. An einem Ort des größten anzunehmenden Unfalls. War am<br />
Leben und fühlte mich gut. Niemand konnte mich sehen.<br />
Mein Herz pochte bis zum H<strong>als</strong>.<br />
Was würde passieren, wenn ich mich zu erkennen gab? Welche Experimente würde<br />
man mit mir machen? Wieder sah ich an mir herab und sah – nichts. Ich war unsichtbar.<br />
Ich war alleine. Ich hatte kein Geld, keinen Freund und keine Ahnung, wie es weitergehen<br />
sollte.<br />
Meine Welt war zusammengebrochen. Es gab nur noch die Welt um mich herum. War<br />
es Zufall? Schicksal? Fantasie oder der Tod? Was es war, wusste ich nicht. Es war, und<br />
das begriff ich: Es war. Ich traf <strong>mein</strong>e Entscheidung im Bruchteil einer Sekunde.<br />
Ich holte tief Luft und trat in <strong>mein</strong> neues Leben.<br />
Bevor die Feuerwehr in Schutzanzügen das Institut betrat, hatte ich mich durch die Tür<br />
ins Freie geschlichen. Die Hitze eines regelwidrig <strong>sommer</strong>lichen Junitages raubte mir<br />
beinahe den Atem. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Die Sonne fühlte sich nach<br />
Mittag an. Sirenen heulten, Motoren brummten, Funkgeräte schnarrten Durchsagen.<br />
Die Sonne war immer noch gelb, die Bäume vor dem Institut grün, der Himmel blau<br />
und der kochende Asphalt auf der Straße schwarz. Nur ich war unsichtbar. Niemand<br />
bemerkte mich, niemand ahnte auch nur, dass ich über den Platz vor dem Institut zur<br />
Absperrung lief. Auf den Lippen der Ruf: »Hallo, hier bin ich, etwas Schreckliches ist<br />
passiert! Helft mir!«<br />
Doch ich sagte ihn nicht, war sprachlos. Vor mir die Welt. Und in mir nichts <strong>als</strong> der<br />
Wunsch, <strong>mein</strong> altes Leben hinter mir zu lassen.<br />
Meine nackten Füße gaben auf den warmen Granitplatten anfangs kleine, platschende<br />
Geräusche von sich, doch nach ein paar Schritten ging ich beinahe geräuschlos. Das<br />
Gefühl der Verlorenheit schwand mit jedem Zentimeter, den ich zurücklegte, und die<br />
Aufregung, die ich zuletzt in einem Kindheitstraum gespürte hatte, wuchs.<br />
Es war wie in dem Traum, den ich oft <strong>als</strong> Teenager hatte. Darin flog ich nackt und wie<br />
ein Vogel mit ausgebreiteten Armen in einer warmen Sommernacht über die Dächer<br />
<strong>mein</strong>er Kleinstadt, spähte durch hell erleuchtete Fenster in fremde Zimmer und spürte die<br />
Lust daran, im Schutze der Dunkelheit eine Erektion zu bekommen.<br />
Die Realität war jedoch nie so schön. Manchmal überkam mich die Lust, wenn ich in<br />
unserem Viertel Zeitungen austrug und von der Dunkelheit eingeholt wurde, und ich<br />
fummelte in einer dunklen Ecke einer kaum befahrenen Straße <strong>mein</strong>en harten Schwanz<br />
aus der Hose, um zu masturbieren.<br />
Ich konnte mich auch daran erinnern, wie ich mit 13 zum letzten Mal mit <strong>mein</strong>en<br />
Eltern Skifahren war und die Lust auf der Skipiste zu groß wurde, um ihr zu widerstehen.<br />
Dann glitt ich von der Piste in den Fichtenwald, schnallte die Skier ab und setzte mich<br />
hinter einen Baum um zu wichsen. Aber ich kam nie an dieses Gefühl in <strong>mein</strong>em Traum<br />
heran, in dem ich die warme Luft überall an <strong>mein</strong>em nackten Körper spürte und ich<br />
<strong>mein</strong>e Erektion stolz unter mir zur Schau trug.<br />
Das Prickeln in der Lendengegend wurde überraschend stark. Doch nicht die
Katastrophe geilte mich auf, sondern die Aussicht, einen Traum wahr machen zu können.<br />
Ich war frei. Julian hatte mich verlassen, weil ich nur Schwanz und nicht Kopf war.<br />
Na und?<br />
Dann war ich eben nur Schwanz.<br />
Ich stellte mich vor starrende Feuerwehrleute, nervöse Polizisten und schreiende<br />
Wissenschaftler. Keiner reagierte auf mich.<br />
Ich stellte mich hüpfend vor einen wartenden Sanitäter. Er sah durch mich hindurch<br />
zur Tür des Instituts. Die Wärme an <strong>mein</strong>en Füßen erinnerte mich wieder daran, dass ich<br />
anwesend und am Leben war. Die Sonne schien es jedoch nur zu ahnen. Ich sah hinter<br />
mich: kein Schatten. Die Sonnenstrahlen jedoch brannten auf <strong>mein</strong>er Haut, wärmten<br />
mich. Nur das sichtbare Licht ging durch mich durch. So würde ich <strong>als</strong>o noch einmal<br />
nahtlos braun werden in <strong>mein</strong>em Leben, und niemand konnte es sehen. Schade.<br />
Die warme Luft umschmeichelte mich.<br />
Ein paar Feuerwehrleute in Schutzanzügen gingen jetzt mit Messgeräten zum<br />
Eingang. Was auch immer nach der Explosion des Reaktors ausgetreten war – weit schien<br />
die Strahlung nicht gekommen zu sein, sonst hätte man das ganze Viertel geräumt.<br />
Neben mir begannen zwei Feuerwehrleute eine Unterhaltung. Der Sanitäter sah durch<br />
mich hindurch.<br />
Er hatte schöne Zähne, die immer wieder im Sonnenlicht aufblitzten. Je länger ich ihn<br />
anstarrte, umso größer wurde die Lust, ihn zu berühren, sie zu küssen. Ich hatte Julian so<br />
gerne geküsst. Und in diesem Moment fehlte er mir plötzlich. Oder fehlte mir die Nähe?<br />
Mein Herz schlug schneller.<br />
Ich überlegte, etwas zu sagen wie: He, ich bin unsichtbar.<br />
Rasch verwarf ich den Gedanken wieder. Denn <strong>als</strong> ich so vor dem Sanitäterin stand,<br />
mit dem Verlangen nach Julian und dem Wissen, dass alles vorbei war, dass es keine<br />
Möglichkeit gab, dort weiter zu machen, wo wir aufgehört hatten, wurde <strong>mein</strong>e Lust<br />
auch zwischen <strong>mein</strong>en Beinen spürbar.<br />
Nur Schwanz.<br />
Der heiße Wind an <strong>mein</strong>em Körper, die warmen Steine unter den Füßen, das Wissen,<br />
vollkommen nackt unter Dutzenden von Menschen zu stehen und nicht gesehen zu<br />
werden, erregte mich plötzlich. Die Geilheit überfiel mich regelrecht. Sie ließ <strong>mein</strong> Herz<br />
schneller schlagen, beschleunigte <strong>mein</strong>en Atem und pumpte Blut in <strong>mein</strong>e Lenden.<br />
Und dann fiel alles, fielen die ganze Traurigkeit, die Angst und die Unsicherheit von<br />
mir ab. Ich war am Leben. Ich war unsichtbar.<br />
Frei, ich war frei. Ich konnte all das machen, was ich schon immer machen wollte,<br />
ohne dabei erwischt zu werden. Konnte nur Schwanz sein, nur Geilheit, ohne dass mich<br />
jemand verurteilen würde.<br />
Konnte mich wichsend auf den Alexanderplatz stellen, in den besten Hotelbetten<br />
schlafen, in die Zimmer anderer Leute gucken, mich in den besten Restaurants<br />
vollfressen, gratis ins Kino gehen, Typen in die Dusche folgen.<br />
Ich hing am Gängelband der Gene? Ich war wie <strong>mein</strong> Vater? Natürlich war ich das.<br />
Und es war okay. Ich hatte einen dicken Schwanz und immer Lust, ich war Voyeur und<br />
liebte es, nackte Körper anzusehen, ich wollte mir immer und überall einen runterholen<br />
und konnte keine Beziehung führen.<br />
Als Unsichtbarer, so wurde mir jetzt bewusst, konnte ich alles und musste ich nichts.
Unsichtbar.<br />
Langsam bekam das Wort für mich einen neuen Geschmack im Mund.<br />
Ich trat einen Schritt zurück. Meine Erektion wuchs weiter. Ich konnte nicht <strong>anders</strong> <strong>als</strong><br />
<strong>mein</strong>e Hand daranlegen und mit ein paar schnellen Bewegungen zu kontern. Es war<br />
unglaublich. Ich stand vor so vielen Menschen und holte mir einen runter. Wirre Gedanken<br />
schossen mir in den Kopf. Ich wollte dem Sanitäter <strong>mein</strong>en Schwanz ins Gesicht pressen,<br />
in den Mund, zwischen die Lippen. Doch was dann? Mit Sicherheit würde er mir keinen<br />
blasen, so viel verstand ich. Er wartete nicht darauf, den Schwanz eines Unsichtbaren zu<br />
lutschen.<br />
Mein Herz pochte aufgeregt.<br />
Narrenfreiheit.<br />
Vorsichtig lief ich an der Absperrung entlang, bis die Menschen dahinter weniger<br />
wurden. Schließlich endete das Plastikband an einem hohen Metallzaun. Dahinter stand<br />
niemand. Ich bückte mich und glitt unter dem Plastikband hindurch. Dann war ich frei.<br />
Berlin war jetzt <strong>mein</strong> Spielplatz.<br />
Nur bei welchem Spielgerät fing ich an? Erst einmal musste ich weg vom Institut. Weg<br />
aus dieser Gegend.<br />
Das Institut lag am Ende einer exklusiven Wohnsiedlung. Deshalb hatten sich auch<br />
nur einige wenige Schaulustige eingefunden. Hinter einer zweiten Absperrung, standen<br />
Männer mit Bierbäuchen, alte Frauen in hässlichen Kleidern, kleine Kinder und dann auch<br />
ein paar vom Wohlstand verwöhnte Teenager und Twens, mit knappen Tops und engen<br />
Hosen.<br />
Ich überlegte, zurückzugehen und ein wenig am Rettungssanitäter zu fummeln, doch<br />
dann wurde <strong>mein</strong> Wunsch zu groß, so schnell wie möglich diese Gefahrenzone hinter mir<br />
zu lassen.<br />
Die Hitze umschmeichelte mich wie ein warmes Tuch. Ich kam mir vor, <strong>als</strong> sei ich in der<br />
Sauna. Nackt und schamlos, mit dem kleinen Unterschied, dass ich mich auf offener<br />
Straße befand.<br />
Winzige Steinchen bohrten sich in <strong>mein</strong>e Fußsohlen, an manchen Stellen war der<br />
Asphalt so heiß, dass ich Angst hatte, mich zu verbrennen. Auf dem Weg zur S-Bahn kam<br />
ich an den ersten Wohnhäusern vorbei. Hohe Hecken vor großen Gärten, dahinter alte<br />
Villen und schicke Einfamilienhäuser mit teuren Autos auf der Auffahrt.<br />
Ich hatte Durst. War neugierig. Und der Weg war <strong>mein</strong> Ziel.<br />
Je länger ich unterwegs war, umso deutlicher wurde mir, dass ich mit diesem Schicksal<br />
den Hauptgewinn gezogen hatte. Niemand wusste, dass ich noch lebte. Meine Brieftasche<br />
auf dem Boden, <strong>mein</strong>e Kleidung – all das waren deutliche Indizien, dass ich nicht mehr<br />
am Leben war, offiziell. Dabei war ich einfach nur unsichtbar und konnte alles machen,<br />
was ich wollte, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.<br />
Ich konnte gratis im Zug fahren, in fremde Häuser sehen.<br />
Mit jedem Schritt fielen mir neue Dinge ein.<br />
Ich hatte alles verloren, <strong>mein</strong>en Freund, <strong>mein</strong> altes Leben, <strong>mein</strong>en Job, <strong>mein</strong> Aussehen.<br />
Ich war endlich frei.<br />
Ich konnte ins Bundeskanzleramt, in die Zentr<strong>als</strong>tellen der Macht, ich konnte in die<br />
Hotels eindringen und Prominente, Schauspieler, Musiker beobachten und sehen, wie die<br />
Stars aussahen, wenn sie die Tür hinter sich zumachten.
Was wirst du machen, wenn du weißt, dass du nicht mit der Konsequenz leben musst?<br />
Gilt der kategorische Imperativ?<br />
Die Vielfalt der Möglichkeiten machte mich schwindelig. All die verschütteten Wünsche<br />
kamen in mir hoch. Doch was würde ich machen, wenn ich sie sah. Nur zusehen? Oder<br />
anfassen? Wie konnte ich anfassen, ohne entdeckt zu werden?<br />
Ratlos blieb ich stehen. Es war Sommer, wir hatten bestimmt 33° Celsius – wenn von<br />
diesen Villen nicht mindestens jede zweite mit einem Pool ausgestattet war, würde ich<br />
<strong>mein</strong>en Namen in Chevy Chase ändern.<br />
Ich betrat über die erste Auffahrt, die nicht mit einem Tor gesichert war, ein<br />
großzügiges Anwesen. Das Problem, vor das ich mich dann gestellt sah, war ein ganz<br />
banales: Auch <strong>als</strong> Unsichtbarer konnte ich nicht durch geschlossene Türen gehen. Und<br />
hinter das Haus, so stellte ich schnell fest, führte der Weg nur über einen spitzen Zaun.<br />
Diese Mühe wollte ich mir nicht machen, <strong>als</strong>o versuchte ich es beim nächsten Haus<br />
nebenan. Dort gelangte ich zwar hinter das Haus auf die Terrasse, doch niemand war<br />
zuhause und alle Türen waren verschlossen.<br />
Es war nicht so einfach wie gedacht, anderer Leute Privatsphäre zu missachten.<br />
Manchmal waren die Jalousien heruntergelassen, manchmal waren die Türen einfach nur<br />
verschlossen.<br />
Unbefriedigt schlich ich über den Rasen. Am liebsten wäre ich in den See gesprungen.<br />
Von irgendwo erscholl Musik. Ich kletterte über den Zaun und landete im Garten eines<br />
Familienanwesens mit Spielsachen auf dem Rasen. Daran hatte ich kein Interesse.<br />
Ich brauchte Penetration. Lust. Ich war doch nicht Unsichtbar, um Rentnern beim<br />
Feiern zuzusehen.<br />
Der Lärm nahm zu, und nach einer weiteren überwundenen Grundstücksgrenze<br />
erreichte ich die Quelle. Im Garten einer großen Villa mit Pool fand eine Grillparty statt.<br />
Viele gut angezogene Menschen saßen mit Flaschen, Gläsern, Tellern auf teuer<br />
aussehenden Gartenmöbeln. Zwischendurch lief ein Hund.<br />
Am Grill stand ein Mann, der wie der Herr des Hauses aussah. Lachen, Musik,<br />
Konversation. Viel zu viel für mich. Ein Englisch sprechender Depp trat mir beim<br />
Vorbeigehen auf den Fuß und merkte es nicht einmal, ein anderer Snob rannte mich<br />
beinahe um.<br />
Eine Party ist kein guter Ort für einen Unsichtbaren.<br />
Vor allem nicht ab dem Moment, an dem mich der Hund witterte und mich anbellte.<br />
Knurrend hockte er vor der Terrasse. Es sah zum Glück aus, <strong>als</strong> belle er den Grillmeister<br />
an.<br />
Ich schlich um den Grill herum, das blöde Vieh folgte mir. Der Herr des Hauses fluchte,<br />
der Hund bockte. Unauffällig stupste ich eine Wurst von einem Teller, auf dem sich das<br />
Fleisch türmte. Der Hund kannte, kläffte, schnappte sich die Wurst, der Hausherr<br />
schimpfte noch lauter und trat nach dem Köter, der jaulend verschwand.<br />
Blödes Vieh.<br />
Unter dem großen Proteststurm einiger anwesender Tierfreunde, den<br />
beschwichtigenden Worten des Grillmeisters und einem anschließenden Prösterchen (auf<br />
alle aussterbenden Tierarten, die nicht gegessen werden können) schnappte ich mir ein<br />
Schnitzel und verkroch mich in den Schatten einer Buchenhecke.<br />
Dort verschlang ich gierig das Schnitzel, vermied jeden Blick auf <strong>mein</strong>en Magen oder
esser: auf den Ort, an dem er sich befinden musste, wischte mir die Finger an Blättern ab<br />
und streunte fürs Erste gesättigt weiter.<br />
Ich pinkelte in den Pool des Nachbarhauses, streifte noch durch ein paar Gärten,<br />
rüttelte zunehmend frustriert an verschlossenen Türen und überlegte, wo ich ganz<br />
unauffällig noch einen wegstecken könnte, verwarf den Gedanken und ging, müde<br />
geworden, auf dem Grundstück eines verschlossenen Hauses ans Ufer.<br />
Dort ragte ein Gartenpavillon auf das Wasser. Ein Chaos empfing mich. Liegen, Sessel,<br />
Kissen, Handtücher. Da hatte wohl die Putzfrau frei. Ein laues Lüftchen wehte über den<br />
See. Motorboote, Segler, Kinderlachen. Ich spürte, wie das Adrenalin aus <strong>mein</strong>em Körper<br />
wich und die Müdigkeit in mich kroch.<br />
Unsichtbar.<br />
War ich das vorher nicht auch schon gewesen? Wer vermisste mich denn? Julian? Der<br />
hatte mit mir abgeschlossen. Unsere Wohnung war gekündigt, und er würde froh sein,<br />
wenn er seine Sachen abholen konnte, ohne dabei auf mich zu stoßen.<br />
Meine Mutter? Die rief nur alle Jubeljahre an. Mein kleiner Bruder? Wir hatten nicht<br />
mehr viel Kontakt, seit er in die USA gezogen war und dort bei einem großen IT-<br />
Unternehmen <strong>als</strong> Programmierer Karriere machte.<br />
Mein Vater? Bis der in seiner südfranzösischen Kommune von diesem Unglück erfuhr,<br />
konnten Wochen vergehen. Ihm fiel selten auf, dass ich mich wochenlang nicht meldete.<br />
Suchte man im Institut nach mir? Sollte ich zur Polizei? Sollte ich mich stellen und das<br />
Risiko eingehen, dass mit mir Experimente angestellt wurden? Was, wenn ich krank war,<br />
wenn mich die Strahlung langsam tötete?<br />
Na und, dachte ich, dann ist es eben so. Bis dahin, so beschloss ich, würde ich das<br />
Beste aus dieser Situation machen. Was auch immer das hieß.<br />
Nur ein kurzes Nickerchen, damit ich am Abend in irgendein Haus einbrechen und<br />
nackte Menschen beobachten konnte. Ich legte mich in eine Liege, in der ein weiches<br />
Polster verhinderte, dass mir der Bambus das Blut abschnürte.<br />
Hässliche Streifen, so wusste ich, würde er ja nicht hinterlassen.<br />
Ich legte mich zurück und schloss die Augen. Die Helligkeit blieb.<br />
So ein Scheiß.<br />
Ich sah mich um, nahm ein gebrauchtes Handtuch von einem der anderen Sessel und<br />
legte es mir über die Augen, damit es dunkel wurde.<br />
Wie spät mochte es sein? Die Sonne war hinter dem Haus versunken. Nach acht? Von<br />
Ferne brandete das Lachen der Party herüber. Noch immer war es heiß. Ich schwitzte und<br />
bekam Lust darauf, in den See zu springen und mich abzukühlen.<br />
Was, dachte ich noch, wenn ich aufwache und wieder sichtbar bin? Was, wenn dann<br />
die Besitzer des Pavillons auftauchten und mich so, nackt, vorfanden?<br />
Nur ein kurzes Nickerchen, ein Schläfchen, <strong>als</strong> Unsichtbarer.<br />
Würde ich ein Loch im Wasser hinterlassen?<br />
Über diesen Gedanken schlief ich ein.
Tag der Veröffentlichung: 13.12.2016<br />
https://www.bookrix.de/-hugluhuglu