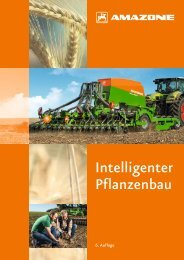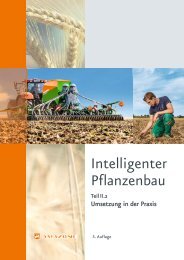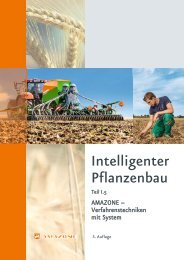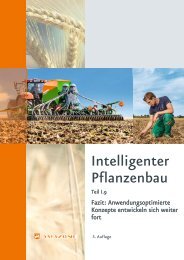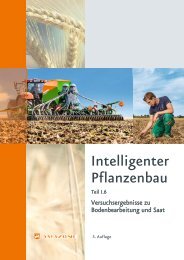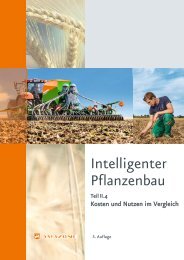Intelligenter Pflanzenbau Teil II.3 - Auswirkungen auf Düngung und Pflanzenschutz.
Hauptmerkmale der Mulchsaat sind die organischen Rückstände auf oder nahe der Bodenoberfläche sowie die dichtere Lagerung der Krume als Folge der reduzierten Eingriffsintensität bei der Bodenbearbeitung.
Hauptmerkmale der Mulchsaat sind die organischen Rückstände auf oder nahe der Bodenoberfläche sowie die dichtere Lagerung der Krume als Folge der reduzierten Eingriffsintensität bei der Bodenbearbeitung.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Intelligenter</strong> <strong>Pflanzenbau</strong><br />
3.2.2 Bekämpfung von Krankheiten <strong>und</strong><br />
Schädlingen<br />
Pfluglose Bodenbearbeitungsverfahren begünstigen als<br />
Folge der organischen Rückstände – vor allem Stoppel<strong>und</strong><br />
Strohreste – an der Bodenoberfläche (Tab. 3) folgende<br />
Faktoren:<br />
• die Entwicklung von Krankheiten, da eine direkte Infektion<br />
der jungen Kulturpflanzen durch Vorfruchtreste<br />
erfolgen kann;<br />
• die Verbreitung von Schädlingen, da durch die verringerte<br />
Eingriffsintensität die Lebensräume bestimmter<br />
Schädlinge nicht gestört werden.<br />
Insgesamt führt die verringerte Eingriffsintensität als<br />
Folge der Mulch<strong>auf</strong>lage zu Veränderungen beim Auftreten<br />
von Krankheiten <strong>und</strong> Schädlingen, was gezielte indirekte<br />
<strong>und</strong> direkte Bekämpfungsstrategien erfordert.<br />
Die wichtigsten Problembereiche „Fusarien“, „DTR“,<br />
„Virosen“ <strong>und</strong> „Ackerschnecken“ werden nachfolgend<br />
diskutiert (unter Mitwirkung von Dr. Elisabeth Oldenburg,<br />
Julius-Kühn-Institut (JKI), Institut für <strong>Pflanzenschutz</strong><br />
in Ackerbau <strong>und</strong> Grünland, Braunschweig, ehemals<br />
FAL).<br />
3.2.2.1 Fusarienpilze<br />
Das Problem, dass Getreide <strong>und</strong> Mais mit mykotoxinbildenden<br />
Pilzen der Gattung Fusarium befallen werden,<br />
wird in letzter Zeit hauptsächlich im Zusammenhang<br />
mit pfluglosen Bodenbearbeitungsverfahren sowie engen<br />
Mais-Getreide-Fruchtfolgen diskutiert. Ähreninfektionen<br />
mit Fusarium sind jedoch das Ergebnis eines<br />
multifaktoriellen Geschehens, bei dem witterungsbedingte<br />
Einflüsse wie auch zahlreiche andere Faktoren<br />
des gesamten Produktionssystems eine Rolle spielen<br />
<strong>und</strong> ineinander greifen (Abb. 33).<br />
Da die im Ernteprodukt vorhandene Mykotoxine durch<br />
die nachfolgenden Reinigungs- bzw. Verarbeitungsprozesse<br />
nur zum <strong>Teil</strong> entfernt werden können, kommt vorbeugenden<br />
Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu.<br />
Dazu zählen die Fruchtfolgegestaltung, die Sortenwahl,<br />
die Bodenbearbeitung <strong>und</strong> <strong>Pflanzenschutz</strong>maßnahmen.<br />
Fruchtfolge<br />
Bei engen Fruchtfolgen mit hohem Getreideanteil, insbesondere<br />
mit Mais, folgen Pflanzenarten <strong>auf</strong>einander,<br />
die bevorzugt von Fusarien befallen werden. Wird der<br />
Mais- bzw. Getreideanteil innerhalb einer erweiterten<br />
Fruchtfolge z.B. durch Einschaltung von Körnerleguminosen<br />
verringert, findet der Pilz deutlich weniger<br />
Tab. 3: Auftreten <strong>und</strong> Bekämpfung von Krankheiten <strong>und</strong> Schädlingen nach unterschiedlicher Bodenbearbeitung<br />
Krankheiten/Schädlinge<br />
parasitärer Halmbruch <strong>und</strong><br />
Schwarzbeinigkeit<br />
Fusarium-Arten<br />
DTR-Blattdürre<br />
(Drechslera tritici-repentis)<br />
Mäuse<br />
Ackerschnecken bei Winterraps,<br />
Zuckerrüben <strong>und</strong> Getreide<br />
Maiszünsler<br />
Auftreten <strong>und</strong> Bekämpfung<br />
Befall von Weizen nach Mulchsaat geringer als nach konventioneller Saat.<br />
Beschleunigter Abbau von Strohresten durch erhöhte mikrobielle Aktivität <strong>und</strong> antagonistische Mikroorganismen<br />
(= „antiphytopathogenes Potenzial“) wirkt Vermehrung von Schadpilzen entgegen (Bräutigam, 1994).<br />
Nach nichtwendender Bodenbearbeitung an Weizen <strong>und</strong> Mais z. T. vorhanden.<br />
Fruchtfolgegestaltung, weniger anfällige Sorten <strong>und</strong> gezielte Fungizidanwendung wirken dem entgegen. Bei Mulchsaat<br />
nach Mais ist das Nachhäckseln der Maisstoppeln eine der wichtigsten Maßnahmen, damit das Stroh schneller verrottet.<br />
Fruchtkörper an Strohresten infizieren unter feuchten Bedingungen die junge Weizenpflanze.<br />
Gezielte Fungizidstrategien in EC 31/32 <strong>und</strong> EC 49/ 51 mit kurativen <strong>und</strong> prophylaktischen Mitteln halten die Schaderreger<br />
in Grenzen (Bartels <strong>und</strong> Rodemann, 1998).<br />
Insbesondere bei konservierender Bodenbearbeitung ohne Lockerung <strong>und</strong> Direktsaat.<br />
Gezielte Bekämpfung durch Lockerungsmaßnahmen (zerstört Bauwerke) <strong>und</strong> Auslegen von Giftködern.<br />
Treten vermehrt in Bodenhohlräumen (auch nach Pflugfurche <strong>auf</strong> Tonböden), bei ständiger Pflanzengründecke <strong>und</strong> unter<br />
feuchten Bedingungen <strong>auf</strong>.<br />
Abhilfe schaffen gut rückverfestigter Böden, Ausbringung von AHL bzw. Walzengang bei Nacht, Applikation von Molluskiziden.<br />
Durch nichtwendende Systeme begünstigt, Schädigung des nachfolgenden Winterweizens.<br />
Wirkungsvolle Bekämpfung durch Unterflurhäcksler am Pflückvorsatz, intensive oberflächennahe Einarbeitung durch Zapfwellengerät<br />
<strong>und</strong> Verwendung von Trichogrammschlupfwespen. Pflug zählt zu den kurzfristig sichersten Bekämpfungsmaßnahmen.<br />
In intensiven Mais-Anbauregionen ist das Nachhäckseln der Maisstoppeln die wichtigste Bekämpfung des Maiszünslers.