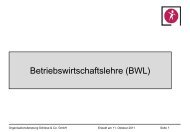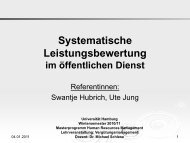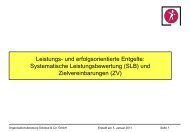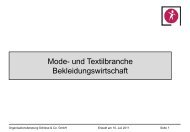Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - Organisation Sanierung
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - Organisation Sanierung
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - Organisation Sanierung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Allgemeines</strong> <strong>Gleichbehandlungsgesetz</strong> 7<br />
Wahrscheinlichkeit muss bei über 90 % liegen), reicht im Rahmen der Glaubhaftmachung schon, dass das Gericht<br />
die fragliche Tatsache für überwiegend wahrscheinlich hält (also reichen schon 51 %).<br />
Die im Gesetzgebungsverfahren erfolgten „Klarstellungen“ des Wortlauts des § 22 AGG waren also eher überflüssig,<br />
da eine bloße eidesstattliche Versicherung auch nach der alten Fassung nicht gereicht hätte. Nach der neuen<br />
Formulierung reicht es nun zunächst nicht mehr aus, „glaubhaft“ zu machen, vielmehr müssen Indiztatsachen (voll)<br />
bewiesen werden. Das Verlangen eines Vollbeweises dürfte jedoch mit den zugrunde liegenden europäischen<br />
Richtlinien nicht vereinbar sein, da diese ausdrücklich die eben beschriebene Einschränkung in der Überzeugung des<br />
Gerichts verlangen. Aber es ist ohnehin zweifelhaft, ob die „Klarstellung“ praktische Auswirkungen haben wird.<br />
Denn im praktischen Ergebnis kommt es darauf an, was der beurteilende Richter glaubt. Ob dieser Richter, wenn er<br />
eine Tatsache als überwiegend wahrscheinlich ansieht (also an sie zu 51 % glaubt), sie nur deshalb als nicht erwiesen<br />
ansieht, weil er von dieser Tatsache im Sinne des „Zweifel müssen schweigen“ nicht überzeugt ist, dürfte mindestens<br />
von Richter zu Richter unterschiedlich sein. Hinzu kommt, dass dem Richter im Alltag möglicherweise gar nicht<br />
genug Zeit bleibt, über seinen Glauben oder seine Überzeugung ausreichend zu reflektieren.<br />
Zentrale Fragen schafft die Neuformulierung des § 22 indessen auf der Rechtsfolgenseite. Eine Diskriminierung liegt<br />
nämlich nur vor, wenn eine Benachteiligung und eine verbotene Motivation („wegen eines in § 1 genannten<br />
Merkmals“) vorliegen. Nach der alten Fassung des Gesetzes stand außer Frage, dass die Beweislastumkehr lediglich<br />
die Frage betraf, welche Motivation einer Benachteiligung zugrunde lag. Die Benachteiligung selbst musste vom<br />
angeblich Benachteiligten voll bewiesen werden. Nunmehr erweckt § 22 AGG den Eindruck, als müsse nicht einmal<br />
mehr das Vorliegen einer Benachteiligung bewiesen werden. Liest man § 22 AGG unbefangen, so muss ein<br />
möglicherweise Diskriminierter nur Indiztatsachen beweisen, die eine verbotene Diskriminierung vermuten lassen.<br />
Eine solche Änderung war ausweislich der Begründung des für die Änderung letztlich verantwortlichen<br />
Rechtsausschusses allerdings nicht gewollt. Es ist also nunmehr unklar, wie die Beweislastregel zu verstehen ist.<br />
Vieles spricht aber dafür, dass die Benachteiligung nach wie vor voll zu beweisen ist.<br />
Praktische Auswirkungen<br />
Ein potenziell Diskriminierter muss deshalb zunächst den Vollbeweis führen, dass er gegenüber einer anderen<br />
Person ungünstig behandelt worden ist, d. h. er muss die Benachteiligung darlegen und ggf. beweisen. Das wird ein<br />
abgelehnter Bewerber um eine Wohnung oder einen Arbeitsplatz schon aufgrund der Ablehnung des<br />
Vertragsschlusses selbst unproblematisch können. Aber auch eine eventuelle Benachteiligung während des<br />
Verfahrens, z. B. eine verfrühte Ablehnung gegenüber anderen Bewerbern, ist von ihm voll zu beweisen. Für die<br />
eigentliche Diskriminierung, d. h. die Kausalität eines von § 1 AGG untersagten Kriteriums für die Benachteiligung<br />
(also die Motivation des Benachteiligenden), muss der Benachteiligte sog. Vermutungstatsachen vorbringen und –<br />
ggf. aufgrund richtlinienkonformer Auslegung mit der oben dargestellten Einschränkung in der notwendigen<br />
Überzeugung des Gerichts – beweisen. Dabei handelt es sich um Indizien, die darauf schließen lassen bzw. es<br />
nahelegen, dass die unterschiedliche Behandlung auf einem unzulässigen Grund beruht. Hält das Gericht das<br />
Vorliegen eines unzulässigen Grundes für überwiegend wahrscheinlich, trägt die beklagte Partei (der<br />
Benachteiligende) anschließend die volle Beweislast dafür, dass doch kein Verstoß gegen das<br />
Benachteiligungsverbot vorliegt oder dieser Verstoß nach den Bestimmungen des AGG gerechtfertigt ist.<br />
Der wichtigste Anhaltspunkt für eine solche Vermutung wird auch in der Begründung zum Gesetz genannt. Es<br />
handelt sich um die Stellenanzeige oder das Wohnungsinserat, auf dessen diskriminierungsfreie Gestaltung man<br />
deshalb einige Mühe verwenden sollte. Als Vermutungstatsache dürfte auch der Nachweis einer Lüge des<br />
Vermieters oder Arbeitgebers in Betracht kommen, wenn er etwa behauptet, die Wohnung (der Arbeitsplatz) sei<br />
bereits vergeben und dies erweislich nicht der Wahrheit entspricht.