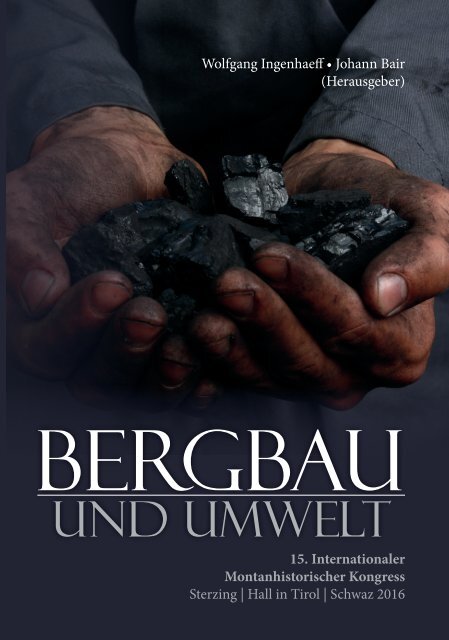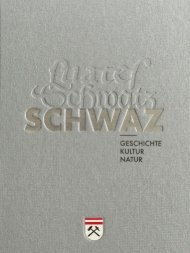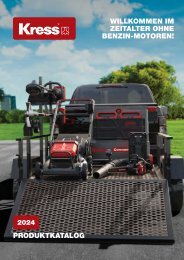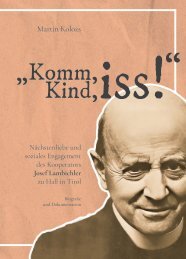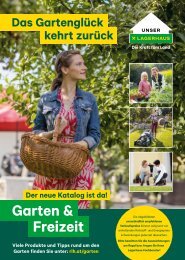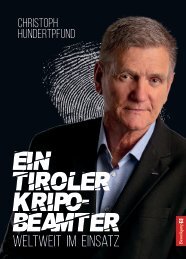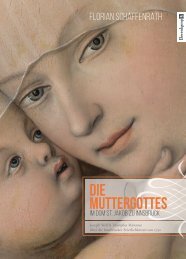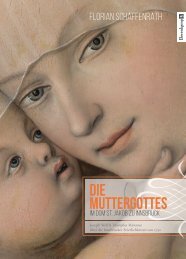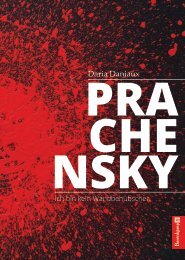TB 2016 Band 1_Leseprobe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wolfgang Ingenhaeff • Johann Bair<br />
(Herausgeber)<br />
Bergbau<br />
und Umwelt<br />
Bergbau<br />
und Umwelt<br />
15. Internationaler<br />
Montanhistorischer Kongress<br />
Sterzing | Hall in Tirol | Schwaz <strong>2016</strong><br />
– 1 –
– 2 –
Wolfgang ingenhaeff · Johann Bair<br />
(Herausgeber)<br />
Bergbau<br />
und umwelt<br />
15. internationaler<br />
Montanhistorischer Kongress<br />
Sterzing – Schwaz – Hall in Tirol<br />
<strong>2016</strong><br />
Tagungsband<br />
– 3 –
Alle Rechte vorbehalten<br />
Copyright © 2017<br />
Berenkamp Buch- und Kunstverlag<br />
www.berenkamp-verlag.at<br />
ISBN 978-3-85093-377-3<br />
Bildnachweis<br />
Sofern bei den Abbildungen nicht anderes angeführt, liegen die Bildrechte bei den<br />
jeweiligen Autoren. Außerdem: Hermann Wirth: S. 2, 8/9<br />
Den 15. Montanhistorischen Kongress unterstützten in dankenswerter Weise<br />
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek<br />
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in<br />
der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische<br />
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar<br />
– 4 –
die bisherigen montanhistorischen kongresse<br />
2002 Schwaz: Schwazer Silber – vergeudeter Reichtum? Verschwenderische<br />
Habsburger in Abhängigkeit vom oberdeutschen Kapital an der Zeitenwende<br />
vom Mittelalter zur Neuzeit<br />
2003 Schwaz: Wasser – Fluch und Segen<br />
2004 Schwaz: Bergvolk und Medizin<br />
2005 Schwaz: Bergbau und Holz<br />
2006 Schwaz: Bergbau und Recht<br />
2007 Schwaz: Bergbau und Religion<br />
2008 Hall in Tirol: Bergbau und Alltag<br />
2009 Schwaz & Sterzing: Bergbau und Berggeschrey<br />
2010 Sterzing & Schwaz & Hall in Tirol: Bergbau und Kunst I: Bildende<br />
Künste (Architektur, Grafik, Malerei, Glasmalerei etc.)<br />
2011 Hall in Tirol & Sterzing & Schwaz: Bergbau und Kunst II: Darstellende<br />
Künste (Musik, Theater, Film, Literatur, Brauchtum etc.)<br />
2012 Schwaz & Hall in Tirol & Sterzing: Bergbau und Kunst III: Technische<br />
Künste (Wasserkunst, Wetterkunst, Markscheidekunst,<br />
Förderkunst, Fahrkunst, Schmelzkunst etc.)<br />
2013 Sterzing & Schwaz & Hall in Tirol: Bergbau und Krieg<br />
2014 Hall in Tirol & Sterzing & Schwaz: Bergbau und Persönlichkeiten<br />
2015 Schwaz & Sterzing & Hall in Tirol: Bergbau und sein Erbe<br />
<strong>2016</strong> Sterzing & Hall in Tirol & Schwaz: Bergbau und Umwelt<br />
Die Organisatoren danken den drei Alt-Tiroler Bergbaustädten<br />
Sterzing, Bürgermeister Dr. Fritz Karl Messner<br />
Hall in Tirol, Bürgermeisterin Dr. Eva Maria Posch<br />
Schwaz, Bürgermeister Dr. Hans Lintner<br />
dass sie die jährliche Durchführung des Montanhistorischen Kongresses<br />
unterstützen und dadurch überhaupt erst möglich machen.<br />
– 5 –
inhaltsverzeichnis<br />
9 Grußworte des Bürgermeisters von Sterzing<br />
11 Vorwort der Herausgeber<br />
15 Werner Amrain Gruben- und Flotationsabwässer am Beispiel des Bergwerks<br />
am Südtiroler Schneeberg (Festvortrag)<br />
35 Johann Bair Über das Für und Wider des Bergbaus im Werk des Humanisten<br />
Paulus Niavis<br />
41 Wilhelm Brauneder Der Salzburger Bergbau im 16. Jahrhundert und die<br />
Umwelt<br />
45 Angelika Brunner Bergbau-Altstandorte – Erhebungen, Umweltbewertungen<br />
und Maßnahmen in Salzburg<br />
53 Peter Gstrein Vom Koglmooser Stier 1409 bis zu den Felsstürzen vom<br />
Eiblschrofen im Jahr 1999. Die Exkursion über die alten Bergbauhalden<br />
des Falkenstein zum Sigmund-Erbstollen<br />
75 Peter Gstrein Das rheinische Braunkohlerevier bei Köln und das Großbiotop<br />
der Sophienhöhe<br />
97 Ludwig H. Hildebrandt Umweltveränderungen durch das Ottonisch-Salische<br />
Silberbergwerk Wiesloch<br />
121 Claus-Stephan Holdermann Revierdarstellungen aus 450 Jahren Bergbaugeschichte<br />
am Schneeberg. Zum Potenzial einer Quellengattung der Montanärchäologischen<br />
Forschungen des Südtiroler Bergbaumuseums<br />
141 Harald Kofler Die Schmelzhütte Grasstein und ihre Folgen für die Umwelt<br />
– 6 –
153 Hermann M. Konrad Die Blei-Zink-Lagerstätten nördlich von Graz. Vom<br />
Bergbau bis zur Umweltbelastung<br />
173 Karl-Heinz Krisch Feuerfest. Die Geschichte eines Rohstoffs<br />
191 Miroslav Lacko Frühneuzeitlicher Bergbau und Umwelt in Mitteleuropa.<br />
Probleme und Perspektiven der Forschung<br />
213 Ulrich Obojes Betrachtungen zu Sicherheit und Umweltschutz bei aufgelassenen<br />
und aktuellen Bergbauhalden Südtirols<br />
229 Martina Pfandl Bergbau in Häring. Kohle- und Mergelbergbau im Untertagebetrieb.<br />
Bergschäden in den Nachkriegsjahrzehnten<br />
247 Andreas Rainer Die original erhaltene Erzaufbereitungsanlage aus den<br />
1920er-Jahren in Maiern/Ridnaun<br />
255 Wilhelm Rees Die Katholische Kirche und Umweltschutz: Berührungspunkte<br />
zum Bergbau<br />
301 Fritz Rosenstock Entwicklung und Organisation des Bergwerks Tiefer<br />
Stollen unter Berücksichtigung der Umwelt<br />
321 Markus Schlosser Bergbau und Umwelt. Zur Rechtsgeschichte eines (vermeintlichen)<br />
Spannungsverhältnisses<br />
371 Norbert Schuster Historische und aktuelle Umweltprobleme des Bergbaus<br />
in Deutschland. Auswirkungen, Risiken, Chancen<br />
389 Hermann Wirth Pingen – Schandmale oder Kulturdenkmale? (Schlussvortrag)<br />
397 Autorinnen & Autoren<br />
– 7 –
– 8 –
Grussworte<br />
des Bürgermeisters<br />
Als Bürgermeister der Stadt Sterzing freut es mich,<br />
dass es bereits vor Jahren gelungen ist, den Montanhistorischen<br />
Kongress nebst Schwaz und Hall auch in<br />
unserer Stadt auszutragen.<br />
Die wissenschaftliche Befassung mit dem Thema Bergbau<br />
von Seiten vieler Gelehrter auf diesem Gebiet trägt zweifelsohne<br />
zu einer Vertiefung der historischen Erkenntnisse<br />
über die Gewerken und unsere Städte bei. Darüber hinaus<br />
ist es möglich, eine Reihe von Querverbindungen herzustellen,<br />
welche die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle<br />
Bedeutung des Bergbaus nicht nur bestätigen, sondern<br />
vor allem ausführlich beleuchten.<br />
Mein Dank gilt den Professoren Dr. Wolfgang Ingenhaeff<br />
und Dr. Johann Bair für die jahrelange wissenschaftliche<br />
und organisatorische Betreuung der Veranstaltung. Die Herausgaben<br />
der Publikationen stellen bedeutend mehr dar als<br />
eine weitere Tirolensie, denn sie vermitteln Fachkenntnisse<br />
von europäischer Bedeutung. Ein weiterer Dank gilt allen<br />
Referenten und Autoren für ihre wissenschaftlichen Beiträge.<br />
Den Besuchern und Teilnehmern wünsche ich angenehme<br />
Tage und heiße sie hier in Sterzing sowie im benachbarten<br />
Bergwerk Ridnaun herzlich willkommen.<br />
Dr. Fritz Karl Messner<br />
Bürgermeister der Stadt Sterzing<br />
– 9 –
– 10 –
vorwort<br />
der herausgeber<br />
Der seit 2002 jährlich abgehaltene Internationale<br />
Montanhistorische Kongress stellt die<br />
Geschichte des Tiroler Berg- und Hüttenwesens<br />
in den Mittelpunkt der internationalen Diskussion.<br />
Darüber hinaus sollen Vergleiche zu anderen<br />
europäischen Bergwerken angestellt und die Ergebnisse<br />
dem wissenschaftlichen Fachpublikum und<br />
einer möglichst breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.<br />
Die vergangenen 14 Tagungen, an denen Referenten<br />
aus Deutschland, Großbritannien, Italien, aus<br />
Österreich, der Slowakei, Tschechien und Ungarn sowie<br />
aus den Vereinigten Staaten teilnahmen, beschäftigten<br />
sich unter anderem mit technischen, rechtlichen,<br />
wirtschaftlichen, sozialen und volkskundlichen<br />
Fragen.<br />
Bürgermeister Dr. Hans Lintner von Schwaz regte<br />
im Jahr 2008 an, die Tagung als gemeinsame Veranstaltung<br />
der drei Alttiroler Bergbaustädte Schwaz,<br />
Hall und Sterzing durchzuführen. Die Bürgermeister<br />
Leo Vonmetz von Hall in Tirol und Dr. Fritz Messner<br />
von Sterzing griffen diese Idee auf, sodass im Jahr<br />
2008 erstmals eine Tagungseinheit in Hall in Tirol<br />
und 2009 erstmals auch eine solche in Sterzing abgewickelt<br />
werden konnte. Nunmehrige Konzeption des<br />
Kongresses ist, dass jeweils eine Stadt als Hauptveranstalter<br />
fungiert, während die beiden anderen Städte<br />
Mitveranstalter sind und in einer Tagungseinheit besucht<br />
werden.<br />
Vom 28. September bis 1. Oktober <strong>2016</strong> war Sterzing<br />
Hauptveranstalter für den 15. Internationalen<br />
Montanhistorischen Kongress, der das Thema „Bergbau<br />
und Umwelt“ behandelte. Tagungseinheiten fanden<br />
in Hall in Tirol, Schwaz und Ridnaun statt. Der<br />
Kongress begann am Mittwoch, 28. September <strong>2016</strong>,<br />
mit dem Eröffnungsvortrag von Werner Amrain aus<br />
Ratschings/Südtirol; er sprach zum Thema „Grubenund<br />
Flotationsabwässer am Beispiel des Bergwerks<br />
am Südtiroler Schneeberg“.<br />
– 11 –
Bürgermeister Dr. Fritz Karl Messner<br />
von Sterzing hieß in der alten Ratsstube<br />
des Sterzinger Rathauses die Referenten<br />
und das zahlreich erschienene<br />
Publikum herzlich willkommen und<br />
eröffnete die Tagung offiziell. Durch<br />
den Abend führte Andreas Rainer von<br />
der BergbauWelt Schneeberg/Südtirol,<br />
die musikalische Begleitung besorgte<br />
eine Bläsergruppe der Knappenkapelle<br />
Ridnaun. Wolfgang Ingenhaeff-Berenkamp<br />
aus Wattens/Österreich stellte<br />
das Tagungsthema in den Mittelpunkt<br />
seiner Ausführungen und erinnerte<br />
in einem kurzen Streifzug durch die<br />
Geschichte des Kongresses an Rudolf<br />
Palme, der den ersten Montanhistorischen<br />
Kongress angeregt hatte, vor<br />
der Tagung aber verstorben war. Johann<br />
Bair aus Silz/Österreich stellte<br />
die Referentinnen und Referenten,<br />
Andreas Rainer den Tagungsband für<br />
den Kongress 2015 vor.<br />
Der Kongress fand am folgenden Tag<br />
im Rathaus von Sterzing mit der Begrüßung<br />
durch Bürgermeister Dr. Fritz<br />
Karl Messner seine Fortsetzung. Die<br />
vormittägliche Moderation besorgte Johann<br />
Bair aus Silz/Österreich. Vortragende<br />
waren Ulrich Obojes aus Kardaun/Südtirol<br />
(„Betrachtungen zu Sicherheit<br />
und Umweltschutz bei aufgelassenen<br />
und aktuellen Bergbauhalden<br />
Südtirols“), Harald Kofler aus Gossensass/Südtirol<br />
(„Die Schmelzhütte<br />
Grasstein und ihre Folgen für die Umwelt“),<br />
Wilhelm Brauneder aus Baden/<br />
Österreich („Der Rauriser Bergbau im<br />
16. Jahrhundert und seine Umwelt“) sowie<br />
Peter Gstrein aus Innsbruck/Österreich<br />
(„Gips is a Luader.“).<br />
Die Vorträge am Nachmittag fanden,<br />
von Hermann Wirth aus Potsdam/<br />
Deutschland moderiert, im Bergbaumuseum<br />
Schneeberg in Maiern/Süd-<br />
tirol statt. Als Vortragende wirkten Norbert<br />
Schuster aus Lüchow/Deutschland<br />
(„Historische und aktuelle Umweltprobleme<br />
des Bergbaus in Deutschland.<br />
Auswirkungen, Risiken, Chancen“),<br />
Fritz Rosenstock aus Aalen/Deutschland<br />
(„Entwicklung und Organisation<br />
des Bergwerks Tiefer Stollen“), Miroslav<br />
Lacko aus Bratislava/Slowakei („Frühneuzeitlicher<br />
Bergbau und Umwelt in<br />
Mitteleuropa: Probleme und Perspektiven<br />
der Forschung“), Konrad Bartzsch<br />
(„Saxonische Mineralisation und Lagerstättenbildung<br />
im Zechstein des Oberperm<br />
zwischen Saalfeld, Kamsdorf und<br />
Könitz, Ostthüringisches Schiefergebirge“)<br />
und Ludwig Hildebrandt aus Wiesloch/Deutschland<br />
(„Geschichte & Umweltveränderungen<br />
durch das ottonischsalische<br />
Silberbergwerk Wiesloch<br />
bei Heidelberg“). Zum Abschluss führte<br />
Paul Felizetti durch die Aufbereitungsanlage<br />
in Maiern.<br />
Am Freitag, 30. September <strong>2016</strong>, besuchte<br />
der Kongress die Silberstadt<br />
Schwaz, wo nach der Begrüßung durch<br />
Bürgermeister Dr. Hans Lintner Angelika<br />
Brunner aus Salzburg/Österreich<br />
(„Bergbau-Altstandorte – Erhebungen,<br />
Umweltbewertungen und Maßnahmen<br />
im Bundesland Salzburg“), Karl-Heinz<br />
Krisch aus Admont/Österreich („Feuerfest.<br />
Die Geschichte eines Rohstoffs“)<br />
und Hermann Konrad aus Graz/Österreich<br />
(„Die Blei-Zink-Lagerstätten<br />
nördlich von Graz. Vom Bergbau bis<br />
zur Umweltbelastung“) referierten; als<br />
Moderator fungierte Peter Gstrein aus<br />
Innsbruck/Österreich. Am Nachmittag<br />
führte Peter Gstrein die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer in einer Exkursion<br />
„Von Koglmoos zum Schaubergwerk<br />
Schwaz“.<br />
Die erfolgreiche und von allen Beteiligten<br />
mit großer Begeisterung begleite-<br />
– 12 –
te Tagung fand am Samstag, 1. Oktober<br />
<strong>2016</strong>, ihren Abschluss im Tagungshaus<br />
der Kreuzschwestern in Hall in Tirol.<br />
Nach der Begrüßung der Teilnehmer<br />
durch Bürgermeisterstellvertreter Werner<br />
Nuding von Hall in Tirol sprachen<br />
unter der Moderation von Miroslav<br />
Lacko Christian Neumann aus Absam/<br />
Österreich („Technik- und Umweltgeschichte<br />
des Tiroler Salzes im 18. Jahrhundert:<br />
Umbrüche und Innovationen<br />
bei der bergmännischen Gewinnung<br />
der Sole im Halltal und Versiedung in<br />
den Haller Pfannen“), Martina Pfandl<br />
aus Bad Häring/Österreich („Bergbauschäden<br />
in Bad Häring“), Wilhelm Rees<br />
aus Jenbach/Österreich („Die Katholische<br />
Kirche und Umweltschutz: Berührungspunkte<br />
zum Bergbau“), Peter<br />
Gstrein („Das Kölner Braunkohlerevier<br />
und das Großbiotop der Sophienhöhe“)<br />
und Hermann Wirth aus Potsdam/<br />
Deutschland („Durch mittelalterlichen<br />
bzw. frühneuzeitlichen Bergbau verursachte<br />
Pingen – Schandmale oder Kulturdenkmale?“).<br />
Die engagiert geführte<br />
Schlussdiskussion moderierte in bewährter<br />
Weise Hermann Wirth aus<br />
Potsdam/Deutschland.<br />
Der umfangreiche Beitrag von Christian<br />
Neuman wurde unter dem Titel<br />
„Zur Technik- und Umweltgeschichte<br />
der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert“<br />
in einem eigenen <strong>Band</strong> II des<br />
Tagungsbandes publiziert (ISBN 978-3-<br />
85093-380-3).<br />
Anzumerken ist, dass mangelnde<br />
Bildqualität dadurch verursacht ist,<br />
dass Bilddateien nicht in der für den<br />
Druck erforderlichen Auflösung zur<br />
Verfügung gestellt wurden – dies leider<br />
auch trotz entsprechender Hinweise<br />
und wiederholter Ersuchen. Bei entsprechender<br />
Bedeutung der Abbildung<br />
für den Beitrag wurden derartige Fotos<br />
in der bestmöglichen Art wiedergegeben.<br />
Herzlich gedankt wird den Sponsoren<br />
des Kongresses, ohne deren wohlwollende<br />
Unterstützung die Abhaltung<br />
des Kongresses nicht möglich wäre, es<br />
sind dies: Stadt Sterzing, BergbauWelt<br />
Ridnaun-Schneeberg, Stadt Schwaz,<br />
Raiffeisen-Regionalbank Schwaz, Stadt<br />
Hall in Tirol, Tourismusverband Region<br />
Hall–Wattens, Berenkamp Verlag,<br />
Schwazer Silberbergwerk und Universität<br />
Innsbruck.<br />
Konzeption, Organisation und Ausführung<br />
der Kongresse sowie die Herausgabe<br />
der Tagungsbände liegen in<br />
den Händen von Ass.-Prof. i. R. Mag.<br />
Dr. Wolfgang Ingenhaeff-Berenkamp<br />
(Institut für Römisches Recht und<br />
Rechtsgeschichte der Universität Innsbruck<br />
und Berenkamp Verlag) sowie<br />
Ass.-Prof. Mag. Dr. Johann Bair (Institut<br />
für Römisches Recht und Rechtsgeschichte<br />
der Universität Innsbruck); sie<br />
wurden vom Alt-Landesgeologen Dr.<br />
Peter Gstrein freundlichst unterstützt.<br />
Wolfgang Ingenhaeff & Johann Bair<br />
Innsbruck, im Sommer 2017<br />
– 13 –
– 14 –
Gruben- und Flotationsabwässer<br />
am beispiel des bergwerks<br />
am südtiroler schneeberg<br />
Werner Amrain<br />
Festvortrag anlässlich der Eröffnung des<br />
15. Internationalen Montanhistorischen Kongresses<br />
EINLEITUNG<br />
Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg liegt zwischen dem Ridnaunund<br />
dem Passeiertal und weist eine knapp 800-jährige, nur kurz unterbrochene<br />
Bergbautätigkeit auf. Während es zahlreiche historische und<br />
geologische Publikationen gibt, die sich mit dem Schneeberg beschäftigen,<br />
findet man über die Auswirkungen der Bergbautätigkeit auf die Umwelt<br />
nur wenige Informationen. Dazu gehören einerseits pflanzenökologische<br />
Befunde, 2 eine Abhandlung über das von den Grubenbedingungen beeinflusste<br />
mykologische Leben, 3 aber auch dem Thema dieser Arbeit sehr nahestehende<br />
Publikationen wie jene in der Zeitschrift Schlern erschienene<br />
Abhandlung über „Die Umweltbelastungen durch die Erzaufbereitung in<br />
Maiern. Ein Streitfall vor hundert Jahren“ von Rudolf Trenkwalder 4 . Bei<br />
Letzterem handelt es sich um einen ausführlichen Artikel über die Verschmutzung<br />
des Ridnauner Bachs und den damit einhergehenden Streitigkeiten<br />
zwischen den Grundeigentümern und Fischereiberechtigten mit der<br />
Bergwerksverwaltung in den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts. In einem<br />
von Baron Sternbach verfassten Artikel in der „Bozner Zeitung“ vom 23.<br />
Oktober 1894 wurde sogar von der vollständigen Vernichtung der Fischbestände<br />
und von toten Fischen bis nach Franzensfeste gesprochen. Seitens<br />
– 15 –
der Bergbautreibenden wurde der negative Einfluss auf den Ridnauner<br />
Bach als übertrieben dargestellt. Die Streitigkeiten wurden damals (zumindest<br />
teilweise) beigelegt, indem sich das Bergwerk verpflichtete, das<br />
eisenhaltige Material durch Absetzbecken zurückzuhalten und nicht mehr<br />
direkt in den Bach einzuleiten. 5 Die von Trenkwalder beschriebenen Streitigkeiten<br />
bezogen sich auf das Abwasser der im Jahr 1871 in Betrieb gegangenen<br />
Erzaufbereitung für Zink mittels elektromagnetischer Extraktion.<br />
Diese wurde in Ridnaun im Zuge umfassender Modernisierungsarbeiten<br />
in den Jahren 1924/25 vom Flotationsverfahren abgelöst. 6 Interessanterweise<br />
gibt es – nach dem Wissen des Autors – keinerlei Arbeiten, die sich<br />
mit den Auswirkungen der Flotationsabwässer auf den Ridnauner Bach<br />
beschäftigen, und mit Ausnahme eines Artikels in der Tageszeitung Dolomiten<br />
im Jahr 1970 7 sind ebenso wenig öffentliche Berichte bekannt.<br />
Ziel der vorliegenden Arbeit ist, den historischen Umgang mit den Flotationsabwässern<br />
aufzuarbeiten und die Auswirkungen ihrer Ableitung in<br />
den Ridnauner Bach abzuschätzen. Darüber hinaus wurde der Versuch unternommen,<br />
die Grubenwässer des Bergwerks zu charakterisieren.<br />
ÜBERBLICK: FLOTATIONSVERFAHREN IN MAIERN<br />
Die in Ridnaun angewandte Aufbereitungsmethode, die sich im Lauf<br />
der Jahrzehnte nur unmerklich änderte, wurde 1952 vom damaligen Direktor<br />
des Bergwerks am Schneeberg, Ing. Serafini, folgendermaßen beschrieben:<br />
Das abgebaute Roherz kam mit der Seilbahn in die Silos nach<br />
Maiern. Zu diesem Zeitpunkt hatte es eine Größe von wenigen Millimetern<br />
bis 20 cm. Im Anschluss wurde das Material mittels Backenbrecher auf eine<br />
Größe von < 30 mm zerkleinert und mittels Mühle inklusive Klassifizierer<br />
zermahlen. Die größenmäßig inhomogenen Körner wurden anschließend<br />
mit Wasser zu einem Schlamm (Flotationstrübe) vermengt und mittels<br />
Flotationsverfahren aufbereitet. 8 Hierbei wurden festgelegte Chemikalien<br />
zugegeben, die sich vor allem an die Erzkörner (Bleiglanz und Zinkblende)<br />
hafteten und dadurch das Aufschwimmen der Erzpartikel bedingten.<br />
Diese konnten daraufhin von der restlichen Trübe abgesondert werden.<br />
Die eingesetzten Chemikalien änderten sich in Zusammensetzung und<br />
Menge im Lauf der Zeit nur geringfügig. Zu den überlieferten chemischen<br />
Zusätzen gehören: Kalk, Natriumcyanid, Phosocreosol, Flottol, Pinienöl,<br />
Speltöl, Zinksulfat, Ammoniumsulfat, Ethylxanthat, Kupfersulfat und Natriummetasilikat.<br />
9<br />
Während die Erzkonzentrate nach erfolgter Trocknung mittels Filtration<br />
nach Bergamo oder Brescia zu den Schmelzhütten transportiert wurden,<br />
– 16 –
leitete man die zurückgebliebene sterile Trübe über lange Zeiträume direkt<br />
und ungeklärt in den Ridnauner Bach ab. Genauere, für das Bergwerk<br />
Schneeberg spezifischere Beschreibungen der Aufbereitungsmethoden finden<br />
sich u. a. bei Tasser 11 , Haller und Schölzhorn 12 , vor allem aber im 1958<br />
von der damaligen Betreiberfirma A.M.M.I. herausgegebenen Handbuch<br />
für Flotationsarbeiter 13 .<br />
HISTORISCH: EINLEITUNG DER FLOTATIONSABWÄSSER IN DEN<br />
RIDNAUNER BACH<br />
In der Zeit zwischen der Installation der Flotationsanlage (1924/1925)<br />
und den Jahren 1950/51 gibt es keine bekannten Aufzeichnungen darüber,<br />
dass es Beschwerden über die Beeinträchtigung der Qualität des Ridnauner<br />
Bachs durch die eingeleiteten Flotationsabwässer gegeben hätte. Ebenso<br />
scheint es von behördlicher Seite keine Interventionen oder besondere<br />
Auflagen gegeben zu haben (darauf lassen auch die ersten Reaktionen der<br />
späteren Betreibergesellschaft A.M.M.I. auf behördliche Anfragen bezüglich<br />
Einleitegenehmigung schließen). Dies erscheint wenig verwunderlich,<br />
da in diese Zeit auch die vorübergehende Einstellung des Betriebs zwischen<br />
1931 und 1937 14, 15 sowie der Zweite Weltkrieg inklusive deutscher<br />
Besatzungszeit und die turbulente Nachkriegszeit fallen.<br />
Mit Beginn der 1950er-Jahre tauchen in den Archiven erste Korrespondenzen<br />
zwischen Behörden und Bergwerk bezüglich der industriellen Abwässer<br />
auf. Ende Juni 1951 forderten zwei Unteroffiziere der Carabinieri<br />
von der Betreibergesellschaft A.M.M.I. die Einleiteerlaubnis für die Abwässer<br />
der Aufbereitung Maiern in den Ridnauner Bach. 16 Die schriftliche<br />
Antwort der A.M.M.I. erfolgte am 22. Juni 1951 durch Ing. Zaccagnini an<br />
das Büro des Vize-Regierungskommissars für die Region Trentino-Südtirol<br />
(und zur Kenntnisnahme an das Ministerium für Landwirtschaft, Zentralbüro<br />
für Jagd und Fischerei).<br />
In der Stellungnahme heißt es, dass es trotz intensiver Aktenrecherche<br />
nicht möglich war, die nötige Erlaubnis, die womöglich in den Kriegswirren<br />
verloren gegangen war, aufzutreiben. Gleichzeitig wird um eine Ausstellung<br />
der Erlaubnis ex novo gebeten. 17 Daraufhin wurde wenig später,<br />
am 12. Juli 1951, vom Vize-Regierungskommissar für die Region Trentino-Südtirol<br />
eine technische Beschreibung der Anlage angefordert. 18 Nach<br />
deren Durchsicht wurde in einem Projekt zur Umsiedlung der Aufbereitungsanlage<br />
in höhere, murengeschützte Bereiche die Auflage erteilt, Auffang-<br />
bzw. Absetzbecken für das Flotationsabwasser zu errichten (Prot. N°<br />
22081/III/San. vom 19. November 1951) 19 .<br />
– 17 –
Den Anstoß für die Einschaltung der Behörden haben, der Aktenlage<br />
nach, die lokalen Fischereigenossenschaften und Fischereiberechtigten gegeben.<br />
Bereits im Jahr 1950 wurde Prof. L. Scheurling aus München vom<br />
„Consorzio Tutela Pesca di Trento“ mit einer Analyse der Beschaffenheit<br />
der Flotationsabwässer beauftragt. 20 Das, zumindest in Teilen kryptische 21 ,<br />
Gutachten vom 9. September 1950 (Tab. 1) wurde damals mit großer Wahrscheinlichkeit<br />
auch den zuständigen Behörden vorgelegt. Ein Hinweis darauf<br />
ist die Tatsache, dass bei der ersten schriftlichen Korrespondenz des<br />
Assessorats für Landwirtschaft und Forst mit der A.M.M.I. am 8. Juli 1952<br />
von einer möglichen Phenol-Belastung gesprochen wurde. 22<br />
Tabelle 1<br />
Auszug der Analyse der Flotationabwässer vom 9. September<br />
1950 durch Prof. Scheurling.<br />
Quelle: Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883-1972, Miniera<br />
„Monteneve“ Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Allegato B, Anhang<br />
B eines Schreibens vom 12. Juli 1952 von Ing. Oreste Repetto (A.M.M.I.)<br />
an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere Capo del Distretto Minerarie<br />
Trento<br />
Sand, Ton, Silikate 7,35%<br />
Schwefel 0,35%<br />
Schwefel aus Sulfiden<br />
Cyanide, Nitrit, Nitrat<br />
Phenole<br />
Kupfer, Zink, Blei<br />
reichlich („abbondante“)<br />
Spuren („tracce“)<br />
anwesend („presente“)<br />
Spuren („tracce“)<br />
Das Bergbauamt Trient und die Direktion des Bergwerks am Schneeberg<br />
waren sich einig, dass gegen die erzwungene Errichtung der Absetzbecken<br />
alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten. Primär wurde von Ing.<br />
Repetto (A.M.M.I.) und vom Bergbauamt Trient versucht – und dies ist ein<br />
weiterer Hinweis darauf, dass die Fischereiberechtigten die treibende Kraft<br />
hinter den behördlichen Interventionen waren –, die Fischereiberechtigten<br />
zu beschwichtigen und den Bau der Absetzbecken in die Zukunft zu verschieben.<br />
So wurde bereits am 12. Juli 1952 angedacht, den Fischereibestand<br />
der Flüsse durch finanzielle Mittel des Bergwerks (100.000–150.000 Lire jährlich)<br />
mittels künstlicher Aussaat wieder aufzustocken. Ähnliches wurde damals<br />
in den A.M.M.I.-Bergwerken in Raibl und Pastarena praktiziert. 23<br />
– 18 –
In einem Schreiben vom 19. August 1952 versuchte die A.M.M.I., den<br />
vom Assessorat für Landwirtschaft und Forst beanstandeten Phenoleintrag<br />
in den Ridnauner Bach zu relativieren. Laut den Berechnungen würde<br />
der Ridnauner Bach im Februar, dem wasserärmsten Monat des Jahres,<br />
im Mittel mit nicht mehr als 0,35 mg/l Phenol2 belastet werden. Es wurde<br />
dabei von der Annahme ausgegangen, dass im finalen Erzkonzentrat kein<br />
Phenol zurückbleibt. 24 Die Tatsache, dass in den darauf folgenden Korrespondenzen<br />
das Phenol-Thema nicht mehr erwähnt wurde, lässt darauf<br />
schließen, dass sich die Behörde damit zufriedengegeben haben dürfte.<br />
Trotzdem rückte man nicht von der Forderung ab, dass die Absetzbecken<br />
errichtet werden müssen, denn bereits am 28. August 1952 wurde in einem<br />
Schreiben verlangt, eine Zusammenstellung der Zerkleinerungsprozesse<br />
und der Körnung des Flotationsabwassers zu liefern. 25 Anstatt der potenziell<br />
schädlichen Auswirkungen phenolischer Substanzen wurde nun mit<br />
dem schädlichen Eintrag von Schwebstoffen in den Ridnauner Bach argumentiert<br />
– dies geht aus den Akten zwar nicht explizit hervor, ist aber<br />
anzunehmen.<br />
An dieser Stelle erscheint erwähnenswert, dass die Tageszeitung „Dolomiten“<br />
am 23. Januar 1970 einen Artikel veröffentlichte, in dem davon die<br />
Rede ist, dass am 15. Dezember 1969 der gesamte Fischbestand durch die<br />
Einleitung von 1.400 Liter Phenolsäure vernichtet worden sei. 26 Die Herkunft<br />
der Phenolsäure scheint dabei unklar, denn in der Aufbereitungsanlage<br />
in Maiern wurde laut Betriebsunterlagen spätestens seit dem Jahr<br />
1963 ohne Phenolzugabe gearbeitet. 27<br />
Einen erfolgreichen Zeitgewinn für den Bau der Absetzbecken verschaffte<br />
sich das Bergwerk gegenüber des Vize-Regierungskommissariats<br />
vor allem durch die Argumentation, dass sich der Kauf des dafür nötigen<br />
Grundes als kompliziert herausstelle, da sich die Überschreibung bei Notar<br />
Hölzl in Sterzing schwierig gestaltete. Außerdem wurden die Arbeiten an<br />
dem Absetzbecken in das zweite Baulos verlegt und darüber hinaus wolle<br />
man die Vorschläge und Auflagen des Assessorats für Landwirtschaft und<br />
28, 29<br />
Forst abwarten.<br />
Um sich einen Überblick über die vorgelegten Unterlagen des Bergwerks<br />
bezüglich Aufbereitungsverfahren und des Antrags zur Einleitung<br />
der Flotationsabwässer in den Ridnauner Bach zu verschaffen, ordnete<br />
das Assessorat für Landwirtschaft und Forst am 21. Oktober 1952 für den<br />
30. Oktober 1952 eine Inspektion der Anlage und der Schäden vor Ort an.<br />
Auch die Gemeinde Ratschings, die Fischereigenossenschaft Sterzing, die<br />
Fischereigenossenschaft Brixen und Carlo Leitner wurden dazu bestellt. 30<br />
Das Bergwerk wurde von Anwalt Giuseppe Hippoliti aus Bozen vertreten.<br />
Inspiziert wurden die Aufbereitungsanlage in Maiern, der Ort der Einlei-<br />
– 19 –
tung des Flotationsabwassers, das Bachbett des Ridnauner Bachs unterhalb<br />
des Sonklarhofs, bei Mareit und am Zusammenfluss mit dem Eisack.<br />
Von den Fischereiinteressierten und vom Vizebürgermeister wurden die<br />
Schäden bekräftigt und nochmals darauf hingewiesen, dass es eine Anordnung<br />
gebe, die zum Bau eines Absetzbeckens verpflichte.<br />
Hippoliti kündigte an, seine Eingaben schriftlich zu machen. 31 Seine<br />
schriftliche Argumentation ging dahingehend, dass durch die Übernahme<br />
der Konzession vom Staat auch das Recht übernommen wurde, die Arbeitsweisen<br />
und im Speziellen die Einleitung der Abwässer in den Ridnauner<br />
Bach beizubehalten. Zudem habe die A.M.M.I. nicht große Geldmittel<br />
in den Bergbau am Schneeberg investiert, weil sich große Gewinne<br />
abgezeichnet hätten, sondern um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen (am<br />
Schneeberg arbeiteten immerhin 400 Bergleute). Angebracht wurde auch,<br />
dass nicht nur die Abwässer der Flotation schädlich für die Fische seien,<br />
sondern auch viele andere Wässer des Ridnauntals, die, vom Gletscher<br />
kommend, große Mengen an Suspension mit sich brächten und zu Ablagerungen<br />
führten. 32<br />
Nach mehrmaligem Verschieben des Baus wurde dem Vize-Regierungskommissariat<br />
am 8. Juni 1955 schließlich mitgeteilt, dass auf Grund<br />
der damaligen Preislage für Zink und Blei auf dem Weltmarkt der Bau der<br />
Speicherbecken nicht mehr finanzierbar sei und somit unbedingt verschoben<br />
werden müsse. Man hoffe auf Besserung auf dem Weltmarkt bzw. auf<br />
staatliche Subventionen. 33<br />
Am 12. Juni 1955 teilte das Vize-Regierungskommissariat mit, dass es<br />
laut ministeriellem Beschluss nicht mehr für die Angelegenheit zuständig<br />
sei und die Kompetenzen an das Assessorat für Landwirtschaft und Forst<br />
übergegangen seien. 34 Hintergrund war, dass am 10. Juni 1955 der Artikel 9<br />
des Gesetzes Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 Approvazione del testo<br />
unico delle leggi sulla pesca („Fischereigesetz“) novelliert und die Zuständigkeiten<br />
dezentralisiert worden waren.<br />
Was in den folgenden Jahren passierte, ist derzeit unklar. 35 Auf jeden<br />
Fall scheint es so, dass vom Landeslaboratorium von Trient am 23. Mai<br />
1961 (Nr. 1036) erneut eine Analyse der Wasserqualität durchgeführt wurde.<br />
Der Anlass für diese Untersuchung und der Inhalt des Analysen-Berichts<br />
sind dem Autor unbekannt. Die Verhandlungen scheinen diesmal<br />
zielstrebiger und lösungsorientierter geführt worden zu sein. Nach einem<br />
erneuten Gesuch des Direktors des Bergwerks Schneeberg vom 23. März<br />
1962 um die Erlaubnis für die Einleitung der Aufbereitungsabwässer in<br />
den Ridnauner Bach wurde diese schließlich mit Auflagen erteilt. Im Amtsblatt<br />
der Region Trentino – Tiroler Etschland (24. April 1962, XIV. Jahrgang<br />
Nr. 17) heißt es: „Die A.G. A.M.M.I. mit dem Sitz in Rom, Molisestraße 11,<br />
– 20 –
die das Domänenbergwerk von Schneeberg in den Gemeinden Ratschings<br />
und Moos in Passeier (Bozen) verwaltet, ist nur für die Fischereizwecke<br />
zur Ableitung der Abwässer der Werksanlage des Ridnauner Tales in den<br />
Ridnauner Bach ermächtigt.“ Die Auflagen damals waren pragmatisch<br />
und nicht sonderlich umweltschonend, aber durchaus gesetzeskonform: 36<br />
In Anbetracht der Feststellung, dass die Klärung des Abwassers (bedingt<br />
durch die Natur der Suspension) schwierig sei und besonderer Bauwerke<br />
bedürfe [Anm.: Absetzbecken], wurde auf deren Errichtung verzichtet.<br />
Stattdessen wurde ein von der A.M.M.I. intern schon 1952 diskutierter<br />
Vorschlag umgesetzt und die Betreiberfirma A.M.M.I. zu einer einmaligen<br />
Aussaat von 15.000 Forellen oder Saiblingen und einer jährlichen Aussaat<br />
von 6.000 Forellen verpflichtet – dies wurde für „zweckmäßiger gehalten“.<br />
Bis zum Jahr 1981 wurden nun jährlich 6.000 Forellen in den Seitenarmen<br />
des Ridnauner Bachs eingesetzt. Mit der effektiven Einstellung der Einleitung<br />
der Abwässer, bedingt durch die Einstellung des Betriebs, wurde die<br />
Betreiberfirma am 17. März 1981 durch das Assessorat für Landwirtschaft<br />
und Forstwesen (Prot. Nr. 459/V/14) von dieser Verpflichtung entbunden.<br />
37 Im Jahr 1980 beliefen sich die Kosten für die Forellen immerhin auf<br />
1.868.960 Lire. 38<br />
Der Kompromiss bezüglich der jährlichen Fischaussaat, durch den die<br />
Erlaubnis zur Einleitung gemäß „Fischereigesetz“ möglich wurde, hielt<br />
bis 1976. Im damals neu erlassenen Gesetz zur Gewässerverschmutzung<br />
(„inquinamento idrico“ Legge 10 maggio 1976, n. 319) wurden genaue Regelungen<br />
getroffen, unter welchen Voraussetzungen Abwässer in Oberflächengewässer<br />
bzw. in die Kanalisation eingeleitet werden dürfen. Jene<br />
Abwasserproduzenten, die nicht im Besitz einer Genehmigung waren,<br />
mussten diese binnen 120 Tagen anfordern, und jene, die im Besitz einer<br />
Erlaubnis waren, mussten diese erneuern. Für die A.M.M.I. bestand also<br />
unmittelbarer Handlungsbedarf. Laut Gesetz mussten festgelegte Grenzwerte<br />
für definierte Parameter genau eingehalten werden. Konnte dies<br />
nicht erreicht werden, waren die zuständigen Behörden angewiesen (nach<br />
entsprechend definierten Übergangszeiten), die Erlaubnis zu entziehen.<br />
Im Fall des Bergwerks Schneeberg muss davon ausgegangen werden, dass<br />
mit der damaligen Aufbereitungsmethode die Grenzwerte für eine ganze<br />
Palette an Parametern nicht einzuhalten waren.<br />
Relativ zeitnah zum erlassenen Gesetz zur Gewässerverschmutzung<br />
(10. Mai 1976) gibt es ein Schreiben der A.M.M.I. vom 24 Mai 1976 an das<br />
Ufficio Bacini Montani in Bozen, in dem um eine Erlaubnis angesucht<br />
wurde, das abgesetzte und geklärte Wasser aus dem Absetzbecken in den<br />
Ridnauner Bach einzuleiten. Gleichzeitig wird die Überquerung des Rid-<br />
– 21 –
nauner Bachs mittels eines Rohrs erwähnt, durch welches das Wasser zum<br />
Absetzbecken gelangen sollte. 39<br />
An dieser Stelle ist nicht klar, ob das Auffangbecken 1976 schon existierte,<br />
im Bau begriffen oder noch in Planung war. Während Tasser von<br />
einem Bau im Jahr 1974 spricht, 40 lässt eine Korrespondenz mit der Azienda<br />
Speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo darauf<br />
schließen, dass sich das Absetzbecken 1976 erst im Bau befunden hat.<br />
In dem erwähnten Schreiben vom 8. Juli 1976 geht es um die Erlaubnis<br />
der Überquerung des Ridnauner Bachs mit einem Rohr, das in Verbindung<br />
(wörtlich: „in nesso con la costruzione di un bacino di decantazione“) mit<br />
dem Bau eines Absetzbeckens errichtet werden sollte. 41 Bei allen Unklarheiten<br />
über die Datierung des Baus scheint es so zu sein, dass es bereits<br />
vor dem Bau des eigentlichen Absetzbeckens ein provisorisches Absetzbecken<br />
direkt im Flussbett gab. Dieses wurde aber regelmäßig bei Unwettern<br />
Tabelle 2<br />
1976 übermittelte Analyseergebnisse für die Erbstollen am Schneeberg und die Abwässer der<br />
Aufbereitungsanlage in Maiern<br />
Quelle: Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denuncie, E.I. 4. Acqua ad uso industriale,<br />
Doman-da di autorizzazione allo scarico di acque nel torrente Ridanna bzw. Nei torrenti Lazzago e Monteneve bzw.<br />
Nel Torrente di fleres, Schreiben der A.M.M.I. vom 10. August 1976 an die Provincia Autonoma Bolzano<br />
Parameter<br />
gesetzl. Grenzwert<br />
schneeberger<br />
Erbstollen<br />
Aufbereitung Maiern<br />
pH 5,5 - 9,5 6,4 9,9<br />
Zink (Zn) 0,5 mg/L 1,70 mg/L 1,50 mg/L<br />
Cadmium (Cd) 0,02 mg/L
und Schneeschmelze überschwemmt, wodurch schubweise große Mengen<br />
an Abraum in den Talbach gelangten. 42 Ob die Gründe für den Bau des<br />
Absetzbeckens in den neuen gesetzlichen Anforderungen zu suchen sind<br />
oder nicht, lässt sich auf Grund der Datenlage nicht eruieren.<br />
Am 9. August 1976 folgte das Bergwerk den gesetzlichen Forderungen<br />
und übermittelte die nötigen Untersuchungsdaten für die Abwässer der<br />
Aufbereitung in Maiern, für die Erbstollen am Schneeberg sowie für die in<br />
den Pflerer Bach fließenden Stollenwässer. Die A.M.M.I. gab dabei für alle<br />
Ansuchen an, nicht im Besitz einer Einleiteerlaubnis zu sein und diese nun<br />
beantragen zu wollen. Dies erscheint widersprüchlich, da gemäß Amtsblatt<br />
der Region Trentino – Tiroler Etschland (24. April 1962, XIV. Jahrgang<br />
Nr. 17) zumindest für die Abwässer der Aufbereitungsanlage eine<br />
Erlaubnis bestanden hatte. Folgende Daten über die Qualität der Wässer<br />
wurden den zuständigen Behörden übermittelt (Tab. 2) – im Hinblick auf<br />
die Objektivität gilt es zu bedenken, dass die Analyseergebnisse aus dem<br />
A.M.M.I.-eigenen Laboratorium in Porto Marghera stammten. 43<br />
Ob die Erlaubnis zur Einleitung erteilt wurde, obwohl einige Parameter<br />
die geforderten Grenzwerte überschritten, geht aus den Akten nicht hervor.<br />
Spätestens seit dem Jahr 1981 wurden keine Abwässer mehr in den<br />
Ridnauner Bach eingeleitet. 1985 kam es auf Grund mangelnder Rentabilität<br />
zur Schließung des Bergwerks. Das ehemalige Absetzbecken wurde<br />
inzwischen mit Erde aufgeschüttet.<br />
DIE SCHNEEBERGER GRUBENWÄSSER<br />
Nicht nur durch Aufbereitungs- und Verhüttungsprozesse können Wasserläufe<br />
beeinflusst werden, sondern auch durch die Abbautätigkeit an<br />
sich. Durch das Anlegen von Stollen und Halden werden enorme Gesteinsoberflächen<br />
der Verwitterung durch Luft und Wasser ausgesetzt. In der<br />
Folge können zum Teil große Mengen an Schwermetallen in Lösung gehen,<br />
und in speziellen Fällen führt die Oxidation von Sulfiden (hier ist vor allem<br />
Pyrit zu nennen) zu teils stark sauren Abwässern. 44, 45 Das Problem dieser<br />
sauren Grubenwässer wird in der Öffentlichkeit oft weniger wahrgenommen,<br />
wie z. B. die Abwasserproblematik durch Aufbereitungsanlagen.<br />
Daraus resultieren zum Teil fehlende Kontrollen, vor allem wenn es sich<br />
um bereits aufgelassene Bergwerke handelt, wo auch der rechtliche Aspekt<br />
nur schwer zu klären ist. Aktuelle Beispiele für diese Problematik gibt es<br />
zu Hauf, z. B. die Einleitung von mit PCB belasteten Grubenwässern durch<br />
die RAG in die Lippe, in die Emscher, in die Ruhr und in den Rhein – ohne<br />
das Vorliegen einer Erlaubnis dafür 46 – oder auch die Verschmutzung des<br />
– 23 –
Cement Creek durch einen Unfall der EPA („Environmental Protection<br />
Agency“), deren Mitarbeiter beim Versuch, das Grubenwasser zu Analysezwecken<br />
abzupumpen, 3,8 Millionen Liter verschmutztes Grubenwasser<br />
in den Fluss geleitet hatten. 47 Über den historischen Teil hinaus war es auch<br />
Ziel dieser Arbeit, die Grubenwässer des Bergwerks Schneeberg zumindest<br />
grob zu analysieren und zu klassifizieren. Zu diesem Zweck wurden<br />
die Wässer der Erbstollen Poschhaus-, Karl- und Andreasstollen sowie der<br />
Tabelle 3<br />
Gegenüberstellung der 26.06.<strong>2016</strong> bzw. 17.07.<strong>2016</strong> gezogenen Wasserproben der<br />
Erbstollen mit den 1976 geltenden gesetzlichen Grenzwerten für die Einleitung<br />
von Abwässern in Oberflächengewässer (pH nach EN ISO 10523:2012, eLF nach EN<br />
27888:1993, Nitrit nach EN26777:1993, sulfat nach EN ISO 10304-1:2012, Eisen und<br />
Mangan nach EN ISO 15586:2003 (unfiltriert, in HNO 3<br />
stabilisiert), Antimon, Arsen,<br />
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Uran und Zink nach EN ISO 17294-2 (unfiltriert, in<br />
HNO3 stabilisiert)<br />
Parameter<br />
gesetzl. Grenzwert<br />
1976<br />
Einheit<br />
Karlstollen<br />
Poschhausstollen<br />
Andreasstollen<br />
Seemoos<br />
pH 5,5 - 9,5 7,0 7,1 7,1 7,0<br />
eLF (25 °C) µS/cm 316 331 255 212<br />
Nitrit 2 mg/L 0,085 0,35
Abfluss des durch Haldenmaterial geprägten „Seemoos“ (Tab. 3, Auszug)<br />
untersucht.<br />
Die untersuchten Gruben- und Haldenwässer weisen einen neutralen<br />
pH-Wert auf und lassen sich in die Gruppen der neutralen bis alkalischen<br />
Grubenwässer einordnen. Charakteristisch dafür sind erhöhte Konzentrationen<br />
an Sulfat, Bicarbonat, Calcium, Magnesium und Natrium sowie<br />
Metallen (Cd, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, U, Zn) und Metalloiden (As, Sb).<br />
Die Grubenwässer des Schneebergs entsprechen dabei den typischen Wässern<br />
von Mono-Sulfiderz-Lagerstätten mit Erzen wie Galenit, Sphalerit,<br />
Arsenopyrit oder Chalkopyrit und wenig bis keinen säureproduzierenden<br />
Disulfiden wie Pyrit oder Pyrrhotin. 48 In Relation mit Lagerstätten mit<br />
sauren Abwässern (acid mine drainage) ist die Schwermetallbelastung der<br />
Schneeberger Stollenabwässer als relativ gering einzustufen – im Vergleich<br />
mit untersuchten Wässern der Trinkwasserversorgungsanlagen der näheren<br />
und weiteren Umgebung findet man deutlich höhere Werte. 49<br />
Erwähnenswert ist der Parameter Nitrit: Während in den Wässern des<br />
Seemooses und des Andreasstollens kein Nitrit nachweisbar war, wurden<br />
im Poschhaus- und Karlstollen deutlich erhöhte Werte gemessen (unter<br />
den Grenzwerten für Abwasser, aber im Fall des Poschhausstollens deutlich<br />
über den Grenzwerten für Trinkwasser). Diese erhöhten Nitritwerte<br />
sind anthropogen bedingt und primär das Produkt von Sprengungen mit<br />
stickstoffbasierten Sprengmitteln. Im Andreasstollen fehlt Nitrit, da dort<br />
zum einen seit spätestens 1967 keine Abbautätigkeit mehr stattfand und<br />
sich die derzeitigen Sprengarbeiten (v. a. Sicherungsarbeiten) auf den von<br />
Besuchern begangenen Bereich von Poschhaus- und Karlstollen beschränken.<br />
Unmittelbar vor den Probenahmen gab es über lange Zeit keine Sicherungsarbeiten<br />
mit Sprengeinsatz. Für die Grubenwässer des aktiven Bergbaus<br />
mit deutlich erhöhter Sprengtätigkeit muss man wesentlich höhere<br />
Konzentrationen annehmen. Über Kontaminationen vom Grundwasser<br />
durch den extensiven Einsatz von stickstoffbasierten Sprengmitteln wurde<br />
für andere Bergbaue bereits berichtet. 50<br />
INTERPRETATION<br />
Nach der Erörterung der historischen und rechtlichen Situation der<br />
Einleitung der Aufbereitungs-Abwässer soll an dieser Stelle noch – unabhängig<br />
von den historischen gesetzlichen Situationen – die tatsächliche<br />
potenzielle Auswirkung für den Ridnauner Bach beurteilt werden. Wie<br />
oben bereits beschrieben, sind vor allem die Parameter Frachteintrag und<br />
Flotations-Reagenzien relevant. Ohne Zweifel spielte der Eintrag von zu-<br />
– 25 –
sätzlicher Fracht in Form der sterilen Flotationsabfälle eine große Rolle für<br />
die Wasserqualität des Ridnauner Bachs. In einem normalen Produktionsjahr<br />
kann abgeschätzt werden (mit der Annahme, dass annähernd 20 %<br />
durch die Flotation aus dem Roherz entfernt werden), dass jährlich ca.<br />
30.000–40.000 Tonnen Material in den Ridnauner Bach eingetragen wurden.<br />
Bei einer geschätzten Wassermenge von 76,8 Milliarden Liter pro<br />
Jahr (Angaben der A.M.M.I. Anfang der 1950er Jahre) 51 führt das zu einer<br />
durchschnittlichen jährlichen Zusatzfracht von 500 mg/l. Zum Vergleich<br />
kann ein Gletscherbach durchaus maximale Frachten von einigen 1.000<br />
mg/l aufweisen, 52 so wurden am Oberlauf des Inn bei Untersuchungen bis<br />
zu 5.106 mg/l Schwebstoffe gemessen. 53<br />
Abb. 1: Aufbereitungsanlage in Maiern, Ridnaun (Diaarchiv BergbauWelt Ridnaun-Schneeberg)<br />
– 26 –
Abb. 2: Aufbereitungsanlage in Maiern (Ende 1970er- bzw. Anfang 1980er-Jahre) mit dem<br />
Absetzbecken im Hintergrund (Diaarchiv BergbauWelt Ridnaun-Schneeberg)<br />
Die Argumentation, dass das Abwasser annähernd die gleiche Qualität<br />
aufweist wie der Ridnauner Bach, ist aber trotzdem nicht stichhaltig, da<br />
sich der Eintrag auf ein wesentlich geringeres Wasservolumen bezieht. Insgesamt<br />
bleibt festzuhalten, dass sich der Eintrag pro Jahr um durchschnittlich<br />
ca. 500 mg/l erhöht hat.<br />
Welchen Einfluss der zusätzliche Eintrag für die Fische im Ridnauner<br />
Bach hatte, bleibt schwer abzuschätzen. Von erhöhten Schwebstoffeinträgen<br />
besonders stark betroffen sind kieslaichende Arten, bei uns insbesondere<br />
die Bachforelle, deren Eier über viele Monate im Winter im Interstitial<br />
liegen. Bereits geringste Schwebstoffkonzentrationen reichen aus, um in<br />
den Laichplätzen eine Versandung bzw. Verschlammung zu verursachen,<br />
– 27 –
Abb. 3: Aufräumungsarbeiten von Chemikalienfässern im Zuge der Museumserrichtung<br />
(Diaarchiv BergbauWelt Ridnaun-Schneeberg)<br />
Abb. 4: Produktionsdaten mit Chemikalienverbräuchen 1963–1979, stellvertretende Auswahl<br />
von Natriumcyanid und Kupfersulfat, da diese toxischen Chemikalien gemäß ihrer Funktion im<br />
Flotationsverfahren prädestiniert sind, mit der sterilen Trübe in den Vorfluter zu gelangen.<br />
– 28 –
die zu einem Absterben der Eier führt. Bei 500 mg/l wird bereits der Bereich<br />
erreicht, in dem sich das Verhalten und die Physiologie von Fischen<br />
verändern können. Zudem kann der Schlupferfolg von Eiern deutlich verringert<br />
sein, bei 500–1500 mg/l wurden bereits Mortalitäten bei Regenbogenforellen<br />
belegt. 54<br />
Eine fundierte Aussage über die Auswirkungen der Schwebstoffbelastungen<br />
durch das Bergwerk auf die Fischgesellschaften im Ridnauner Bach<br />
lässt sich auf Grund der vorhandenen Datenlage nicht treffen. Zum einen<br />
gab es sowohl jahreszeitliche Fluktuationen der Einleitemengen, andererseits<br />
auch kurzfristige Maxima (z. B. bei Hochwasser und Überschwemmung<br />
des provisorischen Absetzbeckens im Flussbett). Zum anderen ist<br />
der Grad der Beeinträchtigung auf Fische eine Folge vieler Faktoren wie<br />
Konzentration, Dauer, Partikelgröße und Lebensstadium, Temperatur,<br />
chemische und physikalische Beschaffenheit der Partikel, assoziierte toxische<br />
Stoffe, Akklimatisation sowie anderer Stressoren und deren Interaktionen,<br />
55 die sich nicht einfach abschätzen lassen.<br />
Ebenso schwierig wie die Auswirkung der Schwebstoffe auf die Ökologie<br />
des Ridnauner Bachs ist auch der Einfluss durch die Flotation eingetragener<br />
Chemikalien zu bewerten. Hier gibt es drei Unsicherheitsfaktoren:<br />
Erstens ist nicht bekannt, welcher Prozentsatz der eingesetzten Chemikalien<br />
effektiv in den Fluss gelangte (insbesondre der Filtrationsschritt stellt<br />
eine Unbekannte dar), des Weiteren dürfte der Eintrag in den Fluss azyklisch<br />
erfolgt sein, und zudem weist der Ridnauner Bach eine stark jahreszeitlich<br />
geprägte Flussmenge auf. Nicht zu unterschätzen war damals auch<br />
der Eintrag von feinst zermahlenem Eisen, hervorgerufen durch den Abrieb<br />
der Kugeln und Verschalungen der Kugelmühlen. Laut Betriebsunterlagen<br />
lag der Bedarf an Kugeln bei bis zu 50.000 kg/Jahr, hochgerechnet<br />
war dies ca. 1 kg/Tonne Roherz. 56<br />
•<br />
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass es auf Grund der<br />
Datenlage nicht möglich ist, die negativen ökologischen Effekte auf den<br />
Ridnauner Bach – die ohne Zweifel vorhanden waren – genauer zu ermessen.<br />
Mit Blick auf die Produktionsdaten (Abb. 4) kann man aber deutlich<br />
erkennen, dass sich die Belastung des Ridnauner Bachs durch die Verlagerung<br />
des Erzabbaus vom Schneeberg in den Poschhausstollen 1967 und<br />
dem damit einhergehenden Einbruch der Produktion bereits während der<br />
aktiven Bergbautätigkeit deutlich gebessert hat.<br />
– 29 –
ANMERKUNGEN<br />
1 Punz, Wolfgang et. al (1995), Pflanzenökologische Befunde zum Bergbaugebiet Schneeberg/Monteneve<br />
im Passeiertal (Südtirol/I), aus den Sitzungsberichten der österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaften Math.-Nat. Kl., Abt. I, 201. <strong>Band</strong><br />
2 Punz, Wolfgang (1994), Schwermetallstandorte im mittleren Alpenraum und ihre Vegetation<br />
– Neue Befunde, Sonderdruck aus Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen<br />
Gesellschaft in Österreich, 131. <strong>Band</strong><br />
3 Amrain, Werner (2012), Holzzersetzende Pilze im Bergwerk Schneeberg, Bachelorarbeit,<br />
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck<br />
4 Trenkwalder, Rudolf (1993), Die Umweltbelastungen durch die Erzaufbereitung in Maiern<br />
– Ein Streitfall vor hundert Jahren, Der Schlern – Monatszeitschrift für Südtiroler<br />
Landeskunde, 67. Jahrgang – Jänner/Februar 1993 – Heft ½, Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />
5 Trenkwalder, Rudolf (1993), Die Umweltbelastungen durch die Erzaufbereitung in Maiern<br />
– Ein Streitfall vor hundert Jahren, Der Schlern – Monatszeitschrift für Südtiroler<br />
Landeskunde, 67. Jahrgang – Jänner/Februar 1993 – Heft ½, Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />
6 Tasser, Rudolf (1994), Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg – Landesbergbaumuseum,<br />
Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />
7 Ungenannter Autor (1970), Zum großen Fischsterben in Ridnaun, Dolomiten, 23.01.1970,<br />
Nr. 18, S. 7<br />
8 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Relazione del processo di lavorazione per<br />
l`arricchimento del minerale piombo – zincifero della miniera di Monteneve – Frantumazione<br />
macinazione del minerale, Bericht vom 23. September 1952 von Ing. Serafini an<br />
die Regione Trentino Alto-Adige Giunta Regionale – Assessorato Agricoltura e Foreste<br />
– Uff. Pesca<br />
9 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Relazione del processo di lavorazione per<br />
l`arricchimento del minerale piombo – zincifero della miniera di Monteneve, Bericht<br />
vom 19. August 1952 von Ing. Serafini<br />
10 Schneebergarchiv, Maiern, X B, Daten Flotation<br />
11 Tasser, Rudolf (1994), Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg – Landesbergbaumuseum,<br />
Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />
12 Haller, Harald, Schölzhorn, Hermann (2000), Schneeberg – Geschichte-Geschichten-Museum,<br />
Südtiroler Bergbaumuseum<br />
13 Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) (1958), Manuale per operai flottatori<br />
14 Tasser, Rudolf (1994), Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg – Landesbergbaumuseum,<br />
Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />
15 Baumgarten, Beno, Folie, Kurt, Stedingk, Klaus (1998), Auf den Spuren der Knappen –<br />
Bergbau und Mineralien in Südtirol, Tappeiner Athesia<br />
16 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Persönlicher Brief vom 12. Juli 1952 von Ing.<br />
Oreste Repetto (A.M.M.I.) an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere Capo del Distretto<br />
Minerarie Trento<br />
17 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Schreiben vom 22. Juni 1951 von Ing. Zaccagnini<br />
(A.M.M.I.) an den Vice Commissario del governo per la regione Trentina e Alto<br />
Adige<br />
– 30 –
18 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Anmerkung im persönlichen Brief vom 12.<br />
Juli 1952 von Ing. Oreste Repetto (A.M.M.I.) an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere<br />
Capo del Distretto Minerarie Trento<br />
19 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Divisione III/San. Prot. N° I3374 vom 17. Juli<br />
1952, Schreiben des Commissariato del governo per la regione Trentino – Alto Adige Ufficio<br />
del Vice-Commissario – Bolzano an den Direttore dell´Azienda Minerali Metallici<br />
Italiani – Miniera di Monteneve - Ridanna<br />
20 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Anhang B eines Schreibens vom 12. Juli 1952<br />
von Ing. Oreste Repetto (A.M.M.I.) an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere Capo<br />
del Distretto Minerarie Trento<br />
21 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Prot. 223 /Pf/g Versamento rifiuto nel Torrente<br />
Ridanna – Autorizzazione T.U. Pesca Miniera Monteneve – Ridanna, Schreiben<br />
des Assessorato Agricoltura e Foreste – Ufficio Pesca – Bolzano an die Azienda Minerali<br />
Metallici Italiani A.M.M.I. (Rom)<br />
22 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Persönlicher Brief vom 12. Juli 1952 von Ing.<br />
Oreste Repetto (A.M.M.I.) an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere Capo del Distretto<br />
Minerarie Trento<br />
23 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Relazione del processo di lavorazione per<br />
l`arricchimento del minerale piombo – zincifero della miniera di Monteneve, Ing. Serafini<br />
am 19. August 1952<br />
24 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Prot. N° 237 PF/G – Relazione – processo<br />
lavorazione, Schreiben des Assessorato Agricoltura e Foreste – Ufficio Pesca an die Azienda<br />
Miniera Metallici Monteneve<br />
25 Ungenannter Autor (1970), Zum großen Fischsterben in Ridnaun, Dolomiten, 23. 01.<br />
1970, Nr. 18, S. 7<br />
26 Schneebergarchiv, Maiern, X B, Daten Flotation<br />
27 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Scaricamento rifiuti industriali nel torrente<br />
Ridanna e fiume Isarco, Schreiben vom 29. August 1952 an den Commissario del governo<br />
per la regione Trentino – Alto Adige Ufficio del Vice Commissario Bolzano<br />
28 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Scarico rifiuti Industriali nel torrente Ridanna<br />
e fiume Isarco, Schreiben vom 12. Dezember 1952 an den Commissario del Governo per<br />
la Regione Trentino – Alto Adige Ufficio del Vice Commissario<br />
29 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, No. 224 T.U. 8.10.931 n. 1604, Schreiben vom<br />
21. 10. 1952 vom Assessorato Agricoltura e Foreste Ufficio Pesca di Bolzano an die Azienda<br />
Minerali Metallici Italiani Monteneve Ridanna und weitere<br />
30 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Verbale, ohne Datum versehen, vom Assessorato<br />
Agricoltura e Foreste Reg. Ufficio reg. per la pesca della Provincia di Bolzano<br />
– 31 –
31 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Osservazioni, ohne Datum versehen, von Dr.<br />
G. Hippoliti, Avvocato<br />
32 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Scarico rifiuti Industriali nel torrente Ridanna<br />
e fiume Isarco, Schreiben vom 08. Juni 1955 vom Direttore A.M.M.I. Monteneve an den<br />
Commissario del Governo per la Regione Trentino – Alto Adige Ufficio del Vice Commissario<br />
33 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />
Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Lavori per lo scarico dei rifiuti industriali della<br />
Miniera di Monteneve nel torrente Ridanna, Schreiben vom 12. Juni 1955 vom Commissario<br />
del Governo per la Regione Trentino – Alto Adige Ufficio del Vice Commissario<br />
34 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />
ad uso industriale, Schreiben Termine obblighi ittogenetici, Schreiben des Assossorat<br />
für Landwirtschaft und Forstwesen vom 17. 03. 1981 an die SAMIN<br />
35 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />
ad uso industriale, Rechnung Fattura Nr. 49 ausgestellt von der Troticoltura Dolomiti<br />
am 31. 12. 1980<br />
36 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />
ad uso industriale, Schreiben der A.M.M.I. vom 8. Juli 1976 an die Azienda speciale per<br />
la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo<br />
37 Tasser, Rudolf (1994), Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg – Landesbergbaumuseum,<br />
Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />
38 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />
ad uso industriale, Schreiben der A.M.M.I. vom 24. Mai 1976 an das Ufficio Bacini Montani<br />
- Bozen<br />
39 Mündliche Überlieferung von Wild Hermann am 28. 09. <strong>2016</strong><br />
40 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />
ad uso industriale, Domanda di autorizzazione allo scarico di acque nel torrente Ridanna<br />
bzw. nei torrenti Lazzago e Monteneve bzw. nel Torrente di Fleres, Schreiben der<br />
A.M.M.I. vom 10. August 1976 an die Provincia Autonoma Bolzano<br />
41 Lottermoser, Bernd (2003), Mine Wastes – Characterisation, Treatment and Environmental<br />
Impacts, Springer<br />
42 Pentreath, R. J. (1994), The Discharge of Waters from Active and Abandoned Mines,<br />
erschienen in Issues in Environmental Science and Technology, herausgegeben von Hester,<br />
R. E. und Harrison R. M., Royal Society of Chemistry<br />
43 http://www.zdf.de/frontal-21/gift-im-grundwasser-gefahr-durch-geflutete-steinkohlebergwerke-44257208.html,<br />
Artikel von Anna Neifer und Kersten Schüßler vom 05. 07.<br />
<strong>2016</strong>, zuletzt aufgerufen am 23. 03. 2017<br />
44 http://www.n-tv.de/panorama/US-Umweltbeamte-verschmutzen-Fluss-article15674791.html,<br />
zuletzt aufgerufen am 23.03.2017<br />
45 Lottermoser, Bernd (2003), Mine Wastes – Characterisation, Treatment and Environmental<br />
Impacts, Springer<br />
46 Autonome Provinz Bozen Südtirol, Landesagentur für Umwelt, Wasserqualität der<br />
Trinkwasserleitungen in Südtirol (http://umwelt.provinz.bz.it/wasser/wasserqualitaet-trinkwasserleitungen-suedtirol.asp)<br />
47 Banks, David et. al. (1997), Mine-water chemistry: the good, the bad and the ugly, Environmental<br />
Geology 32 (3), Springer Verlag<br />
48 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve<br />
“Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Relazione del processo di lavorazione per<br />
– 32 –
l`arricchimento del minerale piombo – zincifero della miniera di Monteneve, Bericht<br />
vom 19. August 1952<br />
49 Braun, Ludwig (2007), Gletscherabfluss unter Bedingungen des Klimawandels und Einfluss<br />
auf die Sedimentführung der Gletscherbäche, Vortrag bei Bodenerosion in den<br />
Alpen vom 13.–14. 09. 2017 in Andermatt<br />
50 Schmutz, Stefan (2003), Einfluss erhöhter Schwebstoffkonzentrationen und Trübe auf<br />
Fische, im Auftrag des Niederösterreichischen Landesfischereiverbandes<br />
51 Schmutz, Stefan (2003), Einfluss erhöhter Schwebstoffkonzentrationen und Trübe auf<br />
Fische, im Auftrag des Niederösterreichischen Landesfischereiverbandes<br />
52 Sigler, J. W., Bjorn, T. C., Everest F. H. (1984), Effects of chronic turbidity on density and<br />
growth of teelheads und coho salmon. Transactions of the American Fisheries Society.<br />
113:142–150.<br />
53 Waters, T. F. (1995), Sediment in streams: sources, biological effects und control. American<br />
Fisheries Society Monograph 7. Bethesda, Maryland.<br />
54 Schneebergarchiv, Maiern, X B, Daten Flotation<br />
– 33 –
Im Jahr <strong>2016</strong> fand in den drei Alttiroler Bergbaustädten Sterzing, Schwaz und<br />
Hall in Tirol der 15. Internationale Montanhistorische Kongress unter dem<br />
Generalthema „Bergbau und Umwelt“ statt.<br />
Gruben- und Flotationsabwässer am Beispiel des Bergwerks am Südtiroler Schneeberg<br />
Über das Für und Wider des Bergbaus im Werk des Humanisten Paulus Niavis<br />
Der Salzburger Bergbau im 16. Jahrhundert und die Umwelt. Bergbau-Altstandorte –<br />
Erhebungen, Umweltbewertungen und Maßnahmen in Salzburg<br />
Vom Koglmooser Stier 1409 bis zu den Felsstürzen vom Eiblschrofen im Jahr 1999. Die<br />
Exkursion über die alten Bergbauhalden des Falkenstein zum Sigmund-Erbstollen<br />
Das rheinische Braunkohlerevier bei Köln und das Großbiotop der Sophienhöhe<br />
Umweltveränderungen durch das Ottonisch-Salische Silberbergwerk Wiesloch<br />
Revierdarstellungen aus 450 Jahren Bergbaugeschichte am Schneeberg. Zum Potenzial<br />
einer Quellengattung der Montanärchäologischen Forschungen des Südtiroler Bergbaumuseums<br />
Die Schmelzhütte Grasstein und ihre Folgen für die Umwelt<br />
Die Blei-Zink-Lagerstätten nördlich von Graz. Vom Bergbau bis zur Umweltbelastung<br />
Feuerfest. Die Geschichte eines Rohstoffs<br />
Frühneuzeitlicher Bergbau und Umwelt in Mitteleuropa. Probleme und Perspektiven<br />
der Forschung<br />
Betrachtungen zu Sicherheit und Umweltschutz bei aufgelassenen und aktuellen Bergbauhalden<br />
Südtirols<br />
Bergbau in Häring. Kohle- und Mergelbergbau im Untertagebetrieb. Bergschäden in -<br />
den Nachkriegsjahrzehnten<br />
Die original erhaltene Erzaufbereitungsanlage aus den 1920er-Jahren in Maiern/Ridnaun<br />
Die Katholische Kirche und Umweltschutz: Berührungspunkte zum Bergbau<br />
Entwicklung und Organisation des Bergwerks Tiefer Stollen unter Berücksichtigung<br />
der Umwelt<br />
Bergbau und Umwelt. Zur Rechtsgeschichte eines (vermeintlichen) Spannungsverhältnisses<br />
Historische und aktuelle Umweltprobleme des Bergbaus in Deutschland. Auswirkungen,<br />
Risiken, Chancen<br />
Pingen – Schandmale oder Kulturdenkmale?<br />
ISBN 978-3-85093-377-3<br />
www.berenkamp-verlag.at<br />
www.kraftplatzl.com<br />
– 34 –