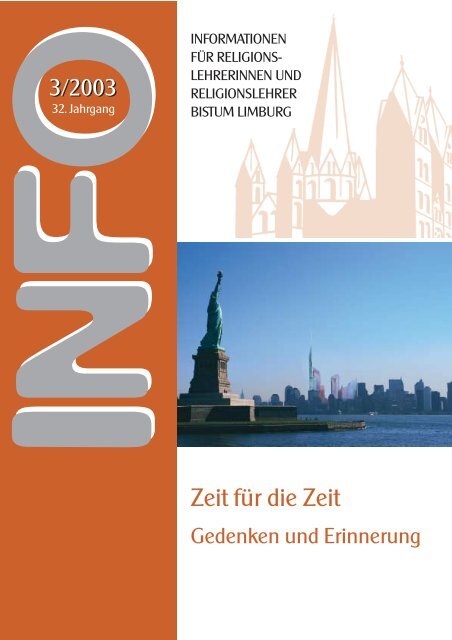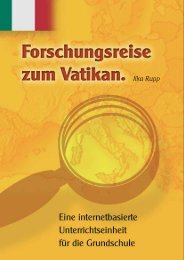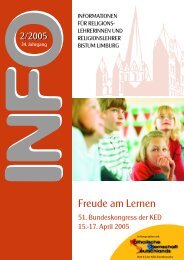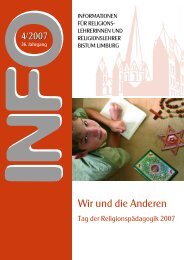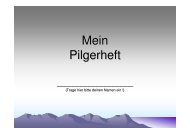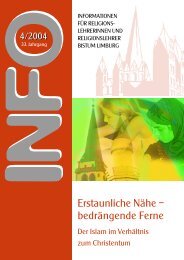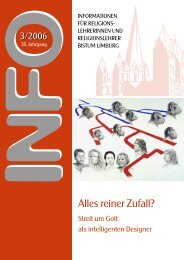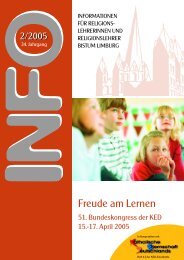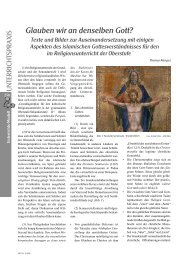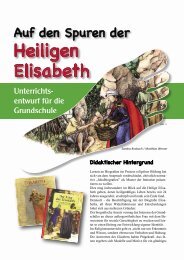Stand: 01.09.2003 - service.bistumlimburg.de - Bistum Limburg
Stand: 01.09.2003 - service.bistumlimburg.de - Bistum Limburg
Stand: 01.09.2003 - service.bistumlimburg.de - Bistum Limburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
INFO<br />
3/2003<br />
32. Jahrgang<br />
INFORMATIONEN<br />
FÜR RELIGIONS-<br />
LEHRERINNEN UND<br />
RELIGIONSLEHRER<br />
BISTUM LIMBURG<br />
Zeit für die Zeit<br />
Ge<strong>de</strong>nken und Erinnerung
EDITORIAL<br />
„Skyline“ New York © Studio Daniel Libeskind<br />
Die Zeit zieht. Sie zieht vorbei, und sie erzeugt jenes merkwürdige<br />
Ziehen an unserem Zwerchfell, das für die Griechen <strong>de</strong>r Sitz <strong>de</strong>r<br />
Seele ist. Frauen kämpfen gegen die Taten <strong>de</strong>r Zeit, gegen das Altern<br />
und Männer gegen <strong>de</strong>n physischen Verfall, vor allem Dichter, Ovid<br />
zum Beispiel, in <strong>de</strong>n Metamorphosen: „Keinem bleibt seine Gestalt“.<br />
Das Vergessen ist je nach<strong>de</strong>m ein Segen o<strong>de</strong>r ein Übel, das wir bekämpfen<br />
müssen. Zum Überleben benutzen wir im Interesse unserer<br />
psychischen Fitness einen Filter für die Erinnerung: Die schönen<br />
Sachen bleiben im Gedächtnis haften, beson<strong>de</strong>rs die hohen Momente,<br />
die wir dann unvergesslich nennen. Sie bleiben haften, weil wir sie geheftet<br />
haben wie Fotos an die Pinnwand, weil wir sie aufgeschrieben<br />
haben in Tagebüchern, weil wir sie uns wie Kultfilme, die wir uns immer<br />
wie<strong>de</strong>r anschauen, vor <strong>de</strong>m inneren Auge abspulen. Dazwischen<br />
aber die versunkenen Zeiten, in <strong>de</strong>nen nichts passierte, Unzeiten, in<br />
<strong>de</strong>nen unsere Erinnerung die Tage nicht unterschei<strong>de</strong>n kann ...<br />
So wie wir unser Gedächtnis organisieren, können wir aber auch versuchen,<br />
Erinnerung zu töten, vergessen zu machen: „Damnatio memoriae“.<br />
Das ist ein schweres Geschäft, wenn nicht gar unmöglich.<br />
Wo ein Name ausgeschlagen ist, bleibt ein blin<strong>de</strong>r Fleck. Wir sind we<strong>de</strong>r<br />
die Herren <strong>de</strong>r Zeit noch die Regenten unseres Bewusstseins, unser<br />
Hirn kein Computer, <strong>de</strong>r rückstandsfrei löschen kann. Im Kopf gibt es<br />
keine Taste „Delete“.<br />
Unter <strong>de</strong>n Momenten gibt es Klassiker. Es sind jene Augenblicke, zu<br />
<strong>de</strong>nen wir sagen: „Verweile doch, du bist so schön“. Doch wir leben<br />
nicht in <strong>de</strong>r Zeit, in <strong>de</strong>r das Wünschen geholfen hat.<br />
Da ist vom „Nunc stans“ <strong>de</strong>r Mystiker die Re<strong>de</strong>,<br />
vom Herausfallen aus <strong>de</strong>m Kontinuum <strong>de</strong>r Zeit, die<br />
Immanuel Kant eine „reine Anschauungsform“ genannt<br />
hat. Die Zeit als Koordinate unserer Wirklichkeit,<br />
im Ernst können wir aus ihr nicht heraus.<br />
Dennoch sind wir Zeitstrategen, und wir müssen es<br />
sein. Es gibt Erinnerungen, die wir um keinen Preis<br />
vergessen dürfen.<br />
Was hat Israel nicht alles unternommen, um seine<br />
Gründung im Exodus festzuhalten. Dabei ist Gott<br />
doch nur im Vorübergang im Schrecklichen wie im<br />
Herrlichen erschienen. Weil Gott nicht das Produkt unserer<br />
kontrafaktischen Fantasien, kein selbstgemachter<br />
Schein sein darf, bleibt er ein Rätsel. Ein Rätsel wie<br />
die Blutspur, die die jüdische Hausgemeinschaft am Se<strong>de</strong>r-Abend zeichnet,<br />
in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Finger in <strong>de</strong>n Becher mit rotem Wein getaucht einen Fleck<br />
auf das weiße Tischtuch setzt, zur Erinnerung an die erschlagene Erstgeburt<br />
Ägyptens. Der Gott, <strong>de</strong>r im Exodus aus <strong>de</strong>m Sklavenhaus befreit, ist<br />
keineswegs rätsellos. Weil er vorübergeht, müssen wir uns an ihn erinnern.<br />
Gottesre<strong>de</strong> braucht die Kunst <strong>de</strong>r Anamnese.<br />
Dr. Eckhard Nordhofen<br />
– Dezernent –
BEITRÄGE<br />
Der Bu<strong>de</strong>nzauber <strong>de</strong>r Erinnerungskultur. Daniel Libeskind<br />
bebaut Ground Zero / August Heuser 164<br />
Erinnern und Ge<strong>de</strong>nken als Leitkategorien religiösen<br />
Lernens / Holger Dörnemann 168<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
Erinnerung (auf-)bauen. Architektur <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens in Berlin<br />
und New York / Ute Lonny-Platzbecker 172<br />
Pascha und Eucharistie – jüdisches und christliches<br />
Erinnern / Thomas Menges 182<br />
Memini ergo sum. Gedächtnis und Erinnerung im<br />
Spielfilm / Franz-Günther Weyrich 189<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
Rezensionen 195<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
Zur Person 202<br />
Neue Vorsitzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Deutschen Katecheten-Vereins 202<br />
„Kirche fin<strong>de</strong>t Stadt“ 202<br />
Das Wesentliche fin<strong>de</strong>n 203<br />
Priesterseminar <strong>Limburg</strong> ausgezeichnet 204<br />
Kirchenführer für Muslime 204<br />
Das neue Bibelmuseum in Frankfurt 205<br />
Bischof ernennt Or<strong>de</strong>nsschwester zur Beauftragten bei<br />
Missbrauchsverdacht 206<br />
Stiftung DEY 207<br />
INFO online 208<br />
INFO Einzelheftbestellung 209<br />
Veranstaltungen 210<br />
SONSTIGES<br />
Übersicht <strong>de</strong>r Autoren/-innen und Rezensenten/-innen 217<br />
Adressen Dezernat und Ämter 218<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Dezernat Schule und Hochschule im<br />
Bischöflichen Ordinariat <strong>Limburg</strong><br />
Postfach 13 55, 65533 <strong>Limburg</strong><br />
Roßmarkt 12, 65549 <strong>Limburg</strong><br />
Fon 06431/295-235<br />
Fax 0 64 31 /295-237<br />
www.schule-und-hochschule.<strong>de</strong><br />
E-Mail: schule@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
Schriftleitung:<br />
Dipl.-Theol. Martin W. Ramb<br />
Dezernat Schule und Hochschule<br />
Postfach 13 55, 65533 <strong>Limburg</strong><br />
E-Mail: m.ramb@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
Redaktion:<br />
Franz-Josef Arthen, Christa Kuch,<br />
Bernhard Merten, Martin E. Musch-<br />
Himmerich, Martin W. Ramb, Franz-<br />
Günther Weyrich<br />
Offizielle Äußerungen <strong>de</strong>s Dezernates<br />
Schule und Hochschule wer<strong>de</strong>n als solche<br />
gekennzeichnet. Alle übrigen Beiträge drücken<br />
die persönliche Meinung <strong>de</strong>r Verfasser<br />
aus.<br />
Nachdruck, elektronische o<strong>de</strong>r photomechanische<br />
Vervielfältigung nur mit beson<strong>de</strong>rer<br />
Genehmigung <strong>de</strong>r Redaktion.<br />
Bei Abbildungen und Texten, <strong>de</strong>ren Urheber<br />
wir nicht ermitteln konnten, bitten wir<br />
um Nachricht zwecks Gebührenerstattung.<br />
Buchbesprechungen:<br />
Rezensionsexemplare bitte direkt an<br />
die Redaktion sen<strong>de</strong>n. Besprechung<br />
und Rücksendung nicht verlangter<br />
Bücher kann nicht zugesagt wer<strong>de</strong>n.<br />
Redaktionsanschrift:<br />
Bernhard Merten, Altheimstraße 18<br />
60431 Frankfurt am Main<br />
Fon 069/515057<br />
Layout:<br />
Ute Stotz, Kommunikations-Design,<br />
Westerwaldstr. 14, 56337 Ka<strong>de</strong>nbach<br />
Fon 0 2620/15211<br />
Druck:<br />
JVA Diez, <strong>Limburg</strong>er Straße 122<br />
65582 Diez<br />
Fon 06432/609-340<br />
Fax 0 64 32 /609 -3 43<br />
Für Interessierte haben wir die Ausgaben<br />
ab Jahrgang 1999 auf unserer<br />
Homepage archiviert.<br />
www.ifrr.<strong>de</strong><br />
Beilagenhinweis:<br />
Der Gesamtauflage ist ein Prospekt<br />
<strong>de</strong>s Markgrafen Verlages, Freiburg,<br />
beigefügt.<br />
Wir bitten um freundliche Beachtung.<br />
Titelbild:<br />
„Skyline“ New York © Studio Daniel Libeskind<br />
ISSN 0937-8162 (print)<br />
ISSN 1617-9234 (online)<br />
INHALT
BEITRÄGE<br />
164<br />
Der Bu<strong>de</strong>nzauber <strong>de</strong>r Erinnerungskultur<br />
Es ist unbezweifelbar, die Ereignisse<br />
<strong>de</strong>s 11. September 2001 in <strong>de</strong>n Vereinigten<br />
Staaten von Amerika haben<br />
bei <strong>de</strong>n Bürgern dieses Lan<strong>de</strong>s ein politisches<br />
Trauma hinterlassen. Die USA,<br />
das mächtigste Land <strong>de</strong>r Welt, wur<strong>de</strong> an<br />
diesem Tag zum ersten Mal in seiner Geschichte<br />
von außen angegriffen. Mehr<br />
als 3000 Menschen fan<strong>de</strong>n bei diesem<br />
Angriff, vor allem in New York, <strong>de</strong>n Tod.<br />
Die Ereignisse <strong>de</strong>s 11. September<br />
2001 haben aber nicht nur in <strong>de</strong>n Vereinigten<br />
Staaten von Amerika tiefe Spuren<br />
<strong>de</strong>r Erinnerung hinterlassen, son<strong>de</strong>rn<br />
auch bei Milliar<strong>de</strong>n Menschen auf<br />
<strong>de</strong>r ganzen Welt. Dieser Tag wird, wie<br />
viele Tage <strong>de</strong>r Zerstörung – im Zweiten<br />
Weltkrieg die Zerstörung Dres<strong>de</strong>ns, die<br />
Zerstörung Hiroshimas und Nagasakis<br />
durch die ersten Atombomben – in <strong>de</strong>n<br />
Annalen <strong>de</strong>r menschlichen Destruktion<br />
eingebrannt, ja, im kollektiven Gedächtnis<br />
<strong>de</strong>r Menschheit groß eingeschrieben<br />
sein.<br />
Bald nach <strong>de</strong>m 11. September 2001<br />
wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ruf laut, am Ort <strong>de</strong>r größten<br />
Zerstörung, bei <strong>de</strong>n Twin Towers <strong>de</strong>s<br />
World Tra<strong>de</strong> Centers, auf <strong>de</strong>m sogenannten<br />
Ground Zero, eine Ge<strong>de</strong>nkstätte<br />
zu schaffen. Diese Ge<strong>de</strong>nkstätte<br />
sollte einerseits Erinnerung wachhalten<br />
und Ge<strong>de</strong>nken ermöglichen, an<strong>de</strong>rerseits<br />
aber auch nach vorne blicken lassen<br />
und ein Zeichen eines neuen Aufbruchs<br />
„trotz allem“ setzen.<br />
1. Erinnerungskultur<br />
„Der Begriff <strong>de</strong>r Erinnerung hat<br />
Konjunktur. (...) Der Streit um das Holocaust-Denkmal<br />
stellt ja nur die symbolische<br />
Zuspitzung <strong>de</strong>r Frage dar, wie<br />
eine Gesellschaft mit ihrer kollektiven<br />
Erinnerung umgeht.“ 1<br />
Die Ge<strong>de</strong>nkkultur <strong>de</strong>s zwanzigsten<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts ist in Deutschland wesent-<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Daniel Libeskind bebaut Ground Zero<br />
lich geprägt von <strong>de</strong>n Ge<strong>de</strong>nkstätten an<br />
die Opfer <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Gewaltherrschaft,<br />
beson<strong>de</strong>rs die KZ-Ge<strong>de</strong>nkstätten<br />
in unserem Land, <strong>de</strong>ren öffentlich<br />
wirksamste die umstrittene, von<br />
<strong>de</strong>m amerikanischen Architekten Peter<br />
Eisenman entworfene Ge<strong>de</strong>nkstätte in<br />
Berlin ist. Die in Berlin auch entstehen<strong>de</strong><br />
Ge<strong>de</strong>nkstätte „Topographie <strong>de</strong>s Terrors“<br />
<strong>de</strong>s Schweizer Architekten Peter<br />
Zumthor könnte <strong>de</strong>m Netz <strong>de</strong>r Ge<strong>de</strong>nkstätten<br />
an die Naziherrschaft in ganz<br />
Deutschland <strong>de</strong>n Namen geben. In Israel<br />
verbin<strong>de</strong>t sich das Ge<strong>de</strong>nken an <strong>de</strong>n<br />
Holocaust mit <strong>de</strong>m Namen Yad Vashem<br />
in Jerusalem und <strong>de</strong>m dortigen<br />
Hain <strong>de</strong>r Erinnerung.<br />
In <strong>de</strong>n USA ist das Wort Erinnerung<br />
sehr stark mit <strong>de</strong>m Vietnamkrieg und<br />
<strong>de</strong>n damals gefallenen Soldaten verbun<strong>de</strong>n.<br />
Die dafür wichtigste Ge<strong>de</strong>nkstätte<br />
ist die große Granitwand mit <strong>de</strong>n Namen<br />
aller Gefallenen auf <strong>de</strong>m Friedhof<br />
von Arlington bei Washington. Nun soll<br />
dieser nationalen Ge<strong>de</strong>nkstätte eine neue<br />
in New York hinzugefügt wer<strong>de</strong>n, die an<br />
<strong>de</strong>n 11. September 2001 erinnern soll.<br />
Sie soll die Zuversicht <strong>de</strong>r Amerikaner<br />
in die Zukunft, das „Trotz allem“ symbolisieren,<br />
ein Unterfangen, das vielleicht<br />
die Quadratur <strong>de</strong>s Kreises be<strong>de</strong>utet<br />
und das zur Symbolik von Libeskinds<br />
Entwurf geführt hat.<br />
In Frankfurt fin<strong>de</strong>t diese Erinnerungs-<br />
und Ge<strong>de</strong>nkkultur in drei wichtigen<br />
Denkmälern ihren Ausdruck. Es ist<br />
zuerst die Ge<strong>de</strong>nkstätte für die im Nationalsozialismus<br />
ermor<strong>de</strong>ten Frankfurter<br />
Ju<strong>de</strong>n am Neuen Börneplatz. Das<br />
zweite Denkmal, das hier zu nennen ist,<br />
ist das für die durch die Nationalsozialisten<br />
ermor<strong>de</strong>ten homosexuellen Männer<br />
und Frauen. Das dritte Beispiel ist<br />
jenes für die in Frankfurt an AIDS gestorbenen<br />
Menschen. Alle drei Erinnerungsmale<br />
leben in ihrer Grundstruktur<br />
vom Erzählen und vom Verweis. 2<br />
2. Erinnerungsgegenwart<br />
August Heuser<br />
In einem unter vielen berühmten<br />
Architekten <strong>de</strong>r Welt ausgelobten Architekturwettbewerb,<br />
<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Ge<strong>de</strong>nkstätte<br />
und <strong>de</strong>m Wie<strong>de</strong>raufbau in gleicher<br />
Weise dienen sollte, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
polnisch-amerikanische Architekt Daniel<br />
Libeskind Sieger. Libeskind hatte<br />
schon früher Architekturen entwickelt,<br />
die einerseits <strong>de</strong>m Heute dienen und<br />
doch an<strong>de</strong>rerseits immer auch Zeichen<br />
<strong>de</strong>r Erinnerung sind. Zu nennen sind hier<br />
beson<strong>de</strong>rs das Felix-Nussbaum-Haus<br />
in Osnabrück und das Jüdische Museum<br />
in Berlin, aber auch das Imperial<br />
War Museum in Manchester (siehe Fotos<br />
Seite 166). Mit diesen drei Häusern<br />
wird <strong>de</strong>r Erinnerungsgegenwart ein Zeichen<br />
gesetzt. Es war <strong>de</strong>shalb wohl eine<br />
sehr gute Wahl, Daniel Libeskind <strong>de</strong>n<br />
Auftrag für die Bebauung <strong>de</strong>s Ground<br />
Zero in New York zu erteilen.<br />
In <strong>de</strong>n USA wird <strong>de</strong>r Ground Zero<br />
<strong>de</strong>rzeit immer mehr als ein quasi-sakraler<br />
Ort gehan<strong>de</strong>lt. Gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>shalb ist es<br />
angebracht, auch kritisch zu einer solchen<br />
be<strong>de</strong>utungsschweren Architektur,<br />
wie sie Libeskind entwirft, Stellung zu<br />
nehmen. Die Sakralität von Räumen und<br />
Zeichen <strong>de</strong>r Architektur ist immer auch<br />
doppel<strong>de</strong>utig und sehr vom Zeitgeist<br />
und Zeitstimmungen abhängig. So gesehen<br />
löst eine Kirche <strong>de</strong>r Gotik heute<br />
bei jungen Menschen weniger das Gefühl<br />
von Sakralität aus als <strong>de</strong>r Raum einer<br />
Disko o<strong>de</strong>r ein Bankhochhaus. Die<br />
Monumentalität eines Bauwerks aus <strong>de</strong>r<br />
Zeit <strong>de</strong>s Faschismus ist für uns heute nur<br />
noch Herrschaftsarchitektur. Man kann<br />
die Frage stellen, ob Libeskinds monströser<br />
Entwurf <strong>de</strong>s neuen World Tra<strong>de</strong><br />
Center wirklich hält, was er verspricht.<br />
Vielleicht ist die Erinnerung an die Zerstörungen<br />
am 11. September 2001 durch<br />
gebaute Zerstörung, also durch die polygon<br />
gesplitterten Hochhäuser, eher
View West Street<br />
peinlich als ernsthafte Erinnerung. Vielleicht<br />
ist <strong>de</strong>r 1776 Fuß hohe Turm<br />
(= 541 m !), dann höchster Turm <strong>de</strong>r<br />
Welt, mit einem Garten E<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />
Spitze schnell als eine Architektur gewor<strong>de</strong>ne<br />
Allmachtsphantasie <strong>de</strong>r Vereinigten<br />
Staaten zu entlarven. Der Name<br />
<strong>de</strong>s Entwurfs „Gar<strong>de</strong>n of the World“<br />
lässt einige politische Absichten ahnen.<br />
Und ist nicht gera<strong>de</strong> dieser Turm mit<br />
seinem geplanten Garten E<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />
Spitze ein babylonisches Symbol <strong>de</strong>r<br />
Verdrehung <strong>de</strong>r Wirklichkeit? Ist <strong>de</strong>r<br />
Garten im Himmel nicht eine muntere<br />
Projektion in ferne Zeiten, wenn <strong>de</strong>r<br />
Mond o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Mars von <strong>de</strong>n Menschen<br />
besie<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n können, wenn die<br />
Menschheit endgültig unter Führung<br />
<strong>de</strong>r USA <strong>de</strong>n zerstörten Planeten Er<strong>de</strong><br />
verlässt? Die Gärten „sollen in einem<br />
hybri<strong>de</strong>n Baukörper <strong>de</strong>n Gegenpol zu<br />
<strong>de</strong>m Memorial markieren, das Libeskind<br />
in 20 Metern Tiefe errichten will“,<br />
so die Frankfurter Rundschau am 28.<br />
Februar 2003 unter <strong>de</strong>r Überschrift:<br />
„Manhattan sucht <strong>de</strong>n Superstar“ 3 . Ist<br />
das Ge<strong>de</strong>nkfeld <strong>de</strong>s Ground Zero, jene<br />
Rasenfläche, die nach <strong>de</strong>m Willen von<br />
Libeskind an je<strong>de</strong>m<br />
11. September genau<br />
zwischen 8.48 Uhr<br />
und 10.28 Uhr, <strong>de</strong>m<br />
Zeitraum <strong>de</strong>r Zerstörung<br />
<strong>de</strong>r Twin-Tower,<br />
immer eine Sonnenfläche<br />
sein soll, nicht<br />
<strong>de</strong>r Wunsch nach<br />
<strong>de</strong>m Licht aus Amerika?<br />
Sind das nicht<br />
falsche Symbole allenthalben,<br />
o<strong>de</strong>r ist<br />
das nicht <strong>de</strong>r Symbolkitsch,<br />
an <strong>de</strong>n wir uns<br />
mittlerweile auch in<br />
an<strong>de</strong>ren Zusammenhängen<br />
gewöhnt haben?<br />
„Der New Yorker<br />
Pioniergeist“, so ist in<br />
<strong>de</strong>r o. a. Frankfurter<br />
Rundschau weiter zu<br />
lesen, „hat <strong>de</strong>n Turmbau<br />
auf Ground Zero<br />
stets auch <strong>de</strong>shalb als<br />
einen Extremsport angesehen, um seine<br />
eigene Gegenwartsfixierung transzendieren<br />
zu können“ 4 . Also doch, das säkulare<br />
Ge<strong>de</strong>nken als Fall von Projektion<br />
ohne eine religiöse Vision. Und die<br />
Rundschau fährt fort: „Was auch immer<br />
gebaut wer<strong>de</strong>n wird, meinte Daniel<br />
Libeskind: Es müsse ein Baukomplex<br />
sein, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Ge<strong>de</strong>nken an <strong>de</strong>n Verlust<br />
durch Leere respektiere.“ Das „Trauma<br />
erzwinge neue Antworten <strong>de</strong>r Architektur.“<br />
Diese Antwort <strong>de</strong>s Architekten<br />
Daniel Libeskind muss schon verwun<strong>de</strong>rn:<br />
Die traumatisierten Vereinigten<br />
Staaten müssen <strong>de</strong>n „Gedanken an <strong>de</strong>n<br />
Verlust durch Leere respektieren“. Ge<strong>de</strong>nkkultur<br />
sollte nun durch Leerkultur<br />
ersetzt wer<strong>de</strong>n, wenn uns Libeskinds<br />
Antwort <strong>de</strong>r Architektur damit nicht in<br />
einem großen architektonischen Zeichen<br />
die Säkularisierung unserer Welt<br />
und Zeit in ihrer Totalität <strong>de</strong>utlich machen<br />
wür<strong>de</strong>. Der Kosmos ist leer, so<br />
träumt Jean Paul in seiner berühmten<br />
„Re<strong>de</strong> <strong>de</strong>s toten Christus vom Weltgebäu<strong>de</strong><br />
herab“ 5 , und so schreibt auch<br />
Friedrich Nietzsche seinen Text vom<br />
„Tollen Menschen“ 6 © archimation<br />
. Libeskinds Ent-<br />
wurf nimmt das wahr, was Hermann<br />
Lübbe kritisch mit <strong>de</strong>m Begriff „Überbetonung<br />
<strong>de</strong>s Erinnerns“ in seiner ganzen<br />
Konsequenz meint. Dass eine solche<br />
Reduktion <strong>de</strong>r Erinnerung in die<br />
Leere führt, d. h. in ein Vakuum, zeigen<br />
die <strong>de</strong>m 11. September 2001 folgen<strong>de</strong>n<br />
politischen Entscheidungen <strong>de</strong>r US-<br />
Administration: Ein Sün<strong>de</strong>nbock muss<br />
her. So gesehen, ist nicht Erkenntnis<br />
die Frucht <strong>de</strong>r Erinnerung, son<strong>de</strong>rn die<br />
Verdrängung.<br />
Daniel Libeskind mag – mit welchem<br />
Aufwand auch immer – Erinnerungssymbolik<br />
herbeire<strong>de</strong>n bzw. herbeibauen<br />
wollen: Sein Entwurf für das neue<br />
World Tra<strong>de</strong> Center ist zunächst einmal<br />
<strong>de</strong>r Entwurf eines neuen Wirtschaftszentrums<br />
in New York. Die Investoren<br />
wer<strong>de</strong>n dabei nicht falsche Rücksichtnahmen<br />
auf eine, wie auch immer geartete<br />
Erinnerungskultur zulassen. 7 Ein<br />
Wirtschaftszentrum ist eben kein Ort <strong>de</strong>r<br />
Erinnerung. Das wäre dann auch ein Wi<strong>de</strong>rspruch<br />
in sich selbst. So <strong>de</strong>ckt <strong>de</strong>r eigentliche<br />
Zweck <strong>de</strong>r Planungen am<br />
Ground Zero das falsche Pathos <strong>de</strong>r Re<strong>de</strong><br />
und <strong>de</strong>r gebauten Zeichen von Daniel<br />
Libeskind schnell auf. So gesehen wird<br />
wenigstens dann Ehrlichkeit in <strong>de</strong>r Sache<br />
aufkommen, wenn das neue World<br />
Tra<strong>de</strong> Center gebaut ist.<br />
3. Erinnerungsinteresse<br />
Die Bebauungspläne zum Ground<br />
Zero lassen fragen, welches Erinnerungsinteresse<br />
sich in ihnen zeigt. Wollen<br />
die Architekturen, die in Plänen im<br />
vergangenen Jahr vorgelegt wur<strong>de</strong>n,<br />
wirklich <strong>de</strong>r Erinnerung an die Toten<br />
dieses Tages dienen, o<strong>de</strong>r wollen sie die<br />
Toten <strong>de</strong>s Ground Zero national vereinnahmen<br />
und so ein brauchbares politisches<br />
Zeichen setzen? „Gewiss ist das<br />
Bedürfnis, die offene Wun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt<br />
zu schließen, groß. Zu<strong>de</strong>cken will man,<br />
heilen, <strong>de</strong>r Welt die Zähne zeigen, mit<br />
einer neuen Skyline über <strong>de</strong>n Feind triumphieren“,<br />
so <strong>de</strong>r Rheinische Merkur<br />
zur Präsentation <strong>de</strong>s Libeskind-Entwurfes<br />
ebenfalls skeptisch 8 und legt damit<br />
auch die Absichten von Libeskind of-<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
BEITRÄGE<br />
165
BEITRÄGE<br />
166<br />
Daniel Libeskind<br />
Daniel Libeskind ist ein international<br />
renommierter Architekt und Stadtplaner.<br />
Er ist bekannt für einen neuen<br />
kritischen Diskurs in <strong>de</strong>r Architektur<br />
und für seinen multidisziplinären Ansatz.<br />
Sein Schaffen reicht von größeren<br />
kulturellen Einrichtungen wie<br />
Museen und Konzertgebäu<strong>de</strong>n über<br />
Landschafts- und Stadtplanungen bis<br />
hin zum Entwurf von Bühnenbil<strong>de</strong>rn,<br />
Installationen und Ausstellungen. Im<br />
Sommer 2002 hat er in Berlin auch<br />
erstmals eine Oper inszeniert, „Saint<br />
Francois d’Assise“ an <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Oper.<br />
1946 wur<strong>de</strong> Daniel Libeskind in<br />
Polen geboren, 1965 nahm er die amerikanische<br />
Staatsbürgerschaft an. Er<br />
studierte Musik in Israel und in New<br />
York, wur<strong>de</strong> professioneller Musiker<br />
und wechselte von <strong>de</strong>r Musik zur Architektur.<br />
Er schloss 1970 sein Architekturstudium<br />
an <strong>de</strong>r Cooper Union<br />
for the Advancement of Science and<br />
Art in New York ab und machte 1972<br />
einen Postgraduierten-Abschluss in<br />
Architekturgeschichte und -theorie<br />
an <strong>de</strong>r School of Comparative Studies<br />
in Essex.<br />
Daniel Libeskind arbeitet in Berlin<br />
als Architekt, seit er 1989 <strong>de</strong>n Wettbewerb<br />
für das Berlin Museum mit<br />
<strong>de</strong>m Jüdischen Museum gewonnen<br />
hat. Er ist Mitglied <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s Deutscher<br />
Architekten. Sein Museum für<br />
die Stadt Osnabrück, das Felix-Nussbaum-Haus,<br />
wur<strong>de</strong> im Juli 1998 eröffnet.<br />
Als jüngstes Bauwerk Libeskinds<br />
wur<strong>de</strong> im Juli 2002 das Imperial<br />
War Museum North in Manchester<br />
eröffnet.<br />
Im Februar 2003 ist Daniel Libeskind<br />
unter sieben Mitbewerbern für<br />
<strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>s World Tra<strong>de</strong><br />
Centers in New York City ausgewählt<br />
wor<strong>de</strong>n. Das zentrale Thema<br />
seines symbolträchtigen Entwurfs ist<br />
die Verbindung <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens an die<br />
Opfer mit <strong>de</strong>r Erschaffung eines neuen<br />
kommerziellen Zentrums rund um<br />
Ground Zero.<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
fen. Gera<strong>de</strong> diese<br />
politische Inanspruchnahme<br />
<strong>de</strong>r Erinnerung<br />
macht <strong>de</strong>n Entwurf<br />
von Libeskind<br />
für ein<br />
wirkliches Erinnern<br />
aber unbrauchbar.Libeskinds<br />
Denkmal<br />
lässt wohl kaum<br />
mehr <strong>de</strong>r Menschen<br />
ge<strong>de</strong>nken,<br />
die am 11. September<br />
2001 ums<br />
Leben gekommen<br />
sind. Dazu<br />
ist sein Entwurf<br />
zu sehr mit einer<br />
nationalen und<br />
säkular-kitschigen<br />
Symbolik<br />
(Turm und Garten<br />
E<strong>de</strong>n) überlastet,<br />
die monumental<br />
und leer zugleich ist. Mit <strong>de</strong>m<br />
Rheinischen Merkur kann man vom<br />
„symbolischen Brimborium“ 9 sprechen<br />
o<strong>de</strong>r auch von nationalem Erinnerungskitsch<br />
und politischem Bu<strong>de</strong>nzauber.<br />
4. Erinnern<br />
links oben: Felix-Nussbaum-Haus, Osnabrück © Felix Nussbaum<br />
rechts oben: Sackler-Treppe (Foto: Hans Grunert, Berlin) © Jüdisches Museum, Berlin<br />
unten: Imperial War Museum, Manchester © Len Grant<br />
Erinnern heißt zunächst einmal,<br />
<strong>de</strong>n Menschen o<strong>de</strong>r das historische Ereignis<br />
um seiner selbst willen in sich<br />
selbst erstehen und wirksam wer<strong>de</strong>n zu<br />
lassen. Dies geschieht in <strong>de</strong>r jüdischchristlichen<br />
Tradition am wirksamsten<br />
in <strong>de</strong>r Liturgie, in <strong>de</strong>r jüdisch <strong>de</strong>r Exodus<br />
und christlich <strong>de</strong>r Tod und die Auferstehung<br />
Jesu zur Sprache kommen<br />
und gefeiert wer<strong>de</strong>n. Verallgemeinert<br />
man die Modalitäten <strong>de</strong>r Erinnerung,<br />
die jüdisch in <strong>de</strong>r Feier <strong>de</strong>s Pessachs<br />
und christlich in <strong>de</strong>r Feier <strong>de</strong>s Abendmahles<br />
bzw. <strong>de</strong>r Eucharistie ihre gültige<br />
Formung gefun<strong>de</strong>n haben, dann<br />
geht es bei <strong>de</strong>r Erinnerung um das Erzählen<br />
<strong>de</strong>r Historie als präsentisch<br />
– hier ist jetzt – und um die Sinnge-<br />
bung dieser Historie in einem heilsgeschichtlichen<br />
Zusammenhang, also in<br />
<strong>de</strong>m, was hinter <strong>de</strong>r Nebelbank <strong>de</strong>r<br />
Historie liegt. In <strong>de</strong>r jüdisch-christlichen<br />
Tradition wird diese Nebelbank<br />
<strong>de</strong>r Historie durch das vertrauensvolle<br />
Gebet um Heil und Heilung durchbrochen,<br />
und es erscheint ein unsagbar<br />
An<strong>de</strong>res, das auch nicht mehr symbolisch<br />
zu fassen ist.<br />
„Es ist nicht sowohl vom An<strong>de</strong>nken<br />
die Re<strong>de</strong>, also von <strong>de</strong>r Person selbst,<br />
nicht von <strong>de</strong>r Erinnerung, son<strong>de</strong>rn von<br />
<strong>de</strong>r Gegenwart“, so heißt es in Goethes<br />
Wahlverwandschaften. Und Goethe fährt<br />
fort: „Ein geliebtes Abgeschie<strong>de</strong>nes umarme<br />
ich weit eher und inniger im Grabhügel<br />
als im Denkmal.“ 10 Goethe reklamiert<br />
damit gegen das Gedächtnis <strong>de</strong>r<br />
Gegenwärtigkeit von Personen und gegen<br />
das <strong>de</strong>r Monumente das Gedächtnis<br />
<strong>de</strong>r Orte. Gegenwärtigkeit ist damit<br />
das Schlüsselwort <strong>de</strong>r Beschreibung<br />
von Erinnerung bei Goethe. Diese aber<br />
muss eine personal geprägte Gegenwärtigkeit<br />
und keine politisch-i<strong>de</strong>ologische<br />
sein. Genau hier aber beginnt <strong>de</strong>r Libeskind-Entwurf.
Museum September 11 Place © Jock Pottle<br />
Was heißt dies aber für das Erinnerungszeichen<br />
auf <strong>de</strong>m Ground Zero?<br />
Dieses Zeichen muss einerseits von<br />
<strong>de</strong>n hier Gestorbenen erzählen, an<strong>de</strong>rerseits<br />
die Nebelwand <strong>de</strong>r Historie<br />
durchstoßen, also auf einen an<strong>de</strong>ren<br />
Sinn verweisen, als <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r gegenwärtig<br />
brauchbar und gesellschaftspolitisch<br />
korrekt ist. Dies geschieht schon<br />
am einfachen Grab. Der Grabstein erinnert<br />
und erzählt wenigstens in aller<br />
Kürze von <strong>de</strong>m Menschen, <strong>de</strong>r hier seine<br />
letzte Ruhe gefun<strong>de</strong>n hat. Früher<br />
stand auf <strong>de</strong>m Grabstein das die Nebelwand<br />
<strong>de</strong>r Historie durchstoßen<strong>de</strong> RIP<br />
(Requiescat In Pace – Er/Sie möge ruhen<br />
in Frie<strong>de</strong>n). Mehr ist zuletzt nicht<br />
zu sagen.<br />
Die Qualitäten <strong>de</strong>r jüdisch-christlichen<br />
Erinnerung offenzulegen und das<br />
christliche Totenge<strong>de</strong>nken genauer zu<br />
be<strong>de</strong>nken, dazu ruft das Ge<strong>de</strong>nk-Brimborium<br />
<strong>de</strong>s Daniel Liebeskind gera<strong>de</strong>zu<br />
auf. Der Libeskind-Entwurf und an<strong>de</strong>re<br />
Ge<strong>de</strong>nkstätten können aber auch<br />
Anlass sein, die Inhalte und Themen<br />
dieses Ge<strong>de</strong>nkens am Denkmal selbst<br />
zu überprüfen.<br />
Anmerkungen<br />
01 Ulrich Borsdorf/Heinrich T. Grütter, Einleitung, in: Orte<br />
<strong>de</strong>r Erinnerung. Denkmal, Ge<strong>de</strong>nkstätte, Museum,<br />
Frankfurt am Main/ New York. 1999. S. 1.<br />
02 Siehe: August Heuser: Banken, Plätze, Musentempel.<br />
Kunstgänge in Frankfurt am Main, Frankfurt<br />
am Main. 2000. S. 55 ff., S. 125 ff., S. 130 ff.<br />
03 Eva Schweitzer/Christian Thomas: Manhattan<br />
sucht <strong>de</strong>n Superstar. Daniel Libeskind gewinnt <strong>de</strong>n<br />
Wettbewerb zum Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>s World Tra<strong>de</strong><br />
Center in New York – und das ist nicht nur ein Gerücht,<br />
Frankfurter Rundschau. 28. Februar 2003. S. 9.<br />
04 Ebd.<br />
05 Jean Paul: Re<strong>de</strong> <strong>de</strong>s toten Christus vom Weltgebäu<strong>de</strong><br />
herab, dass kein Gott sei, in: <strong>de</strong>rs., Siebenkäs,<br />
Sämtliche Werke, Abt. I, Zweiter Band, Wiesba<strong>de</strong>n.<br />
2000. S. 270 – 275.<br />
06 Friedrich Nietzsche: Der tolle Mensch, in: <strong>de</strong>rs., Die<br />
fröhliche Wissenschaft, (Kap. 125), München. 1973.<br />
S. 128 f., So auch in Hubertus Halbfas: Religionsbuch<br />
für das 9./10. Schuljahr, Düsseldorf. 1991.<br />
07 Mittlerweile ist die hier geäußerte Vermutung von <strong>de</strong>r<br />
Realität eingeholt wor<strong>de</strong>n. Die F.A.Z. berichtete am<br />
19.07.03, dass <strong>de</strong>r Immobiliengigant und Pächter <strong>de</strong>s<br />
WTC-Areals, Larry Silverstein, allem Re<strong>de</strong>n ein En<strong>de</strong><br />
gemacht habe. Nach siebenstündiger Beratung gab<br />
er bekannt, dass David Childs, zuvor Wettbewerbskonkurrent<br />
Libeskinds, fortan <strong>de</strong>r Chefarchitekt sei.<br />
Den Ausschlag für Silversteins Entscheidung habe<br />
<strong>de</strong>r „Freedom Tower“ gegeben. Dem Bauherrn waren<br />
nicht nur die Weltlandschaften ein Ärgernis, die Libeskind<br />
als eine Art ökologischer Weltgemeinschaft statt<br />
Büros auf die Obergeschosse setzen wollte. Silverstein<br />
wolle nun <strong>de</strong>n Turm auch vom vorgesehenen<br />
<strong>Stand</strong>ort an einen an<strong>de</strong>ren in Nähe <strong>de</strong>r neuen Bahnstation<br />
versetzt sehen. Trotz dieser unerwarteten<br />
Wendung bleibt Daniel Libeskinds Entwurf weiterhin<br />
Grundlage <strong>de</strong>r Bauarbeiten und <strong>de</strong>r Architekt behalte<br />
die vage umrissene Position <strong>de</strong>r künstlerischen<br />
Leitung auf Ground Zero.<br />
08 Jutta Falke: Ground Zero, Daniel Libeskinds Entwurf<br />
heilt symbolisch, in: Rheinischer Merkur. 6. März 2003.<br />
09 Ebd.<br />
10 Johann Wolfgang Goethe: Die Wahlverwandschaften,<br />
Hamburg. 1968. S. 362. Goethes erstes Kapitel<br />
im zweiten Teil <strong>de</strong>r Wahlverwandschaften behan<strong>de</strong>lt<br />
die Frage <strong>de</strong>r Gedächtniskultur vorzüglich.<br />
Dr. August Heuser ist Direktor <strong>de</strong>s<br />
Dommuseums Frankfurt am Main.<br />
Außer<strong>de</strong>m plant und arbeitet Daniel<br />
Libeskind an mehreren weiteren<br />
Projekten: „Die Spirale“ als Erweiterungsbau<br />
<strong>de</strong>s Victoria & Albert Museums<br />
London; The Jewish Museum<br />
San Francisco, USA; „Westsi<strong>de</strong>“, ein<br />
Freizeit- und Einkaufszentrum in<br />
Brünnen, Schweiz; das Maurice Wohl<br />
Convention Centre <strong>de</strong>r Bar-Ilan-Universität,<br />
Tel Aviv; Atelier Weil, ein<br />
privates Galeriegebäu<strong>de</strong> auf Mallorca,<br />
Spanien; <strong>de</strong>r Erweiterungsbau <strong>de</strong>s<br />
Denver Art Museum, USA, und seit<br />
neuestem <strong>de</strong>r Erweiterungsbau <strong>de</strong>s<br />
Royal Ontario Museum in Toronto,<br />
Kanada.<br />
Daniel Libeskind hat an vielen<br />
Universitäten <strong>de</strong>r Welt gelehrt und<br />
Vorträge gehalten. Zurzeit ist er Professor<br />
an <strong>de</strong>r Hochschule für Gestaltung<br />
in Karlsruhe und Cret Chair an<br />
<strong>de</strong>r University of Pennsylvania sowie<br />
Frank O. Gehry Chair an <strong>de</strong>r University<br />
of Toronto. Er ist seit 1990 Mitglied<br />
<strong>de</strong>r Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Künste und<br />
Mitglied <strong>de</strong>r European Aca<strong>de</strong>my of<br />
Arts and Letters.<br />
Daniel Libeskind hat zahlreiche<br />
Auszeichnungen erhalten, zuletzt <strong>de</strong>n<br />
Hiroshima Art Prize, <strong>de</strong>r an Künstler<br />
vergeben wird, <strong>de</strong>ren Arbeit <strong>de</strong>m<br />
Frie<strong>de</strong>n dient. 1999 erhielt er <strong>de</strong>n<br />
Deutschen Architekturpreis für das<br />
Jüdische Museum Berlin, im Jahr<br />
2000 die Goethe Medaille. Sein Werk<br />
wur<strong>de</strong> ausführlich in großen Museen<br />
und Galerien auf <strong>de</strong>r ganzen Welt<br />
ausgestellt und war auch Thema<br />
zahlreicher internationaler Publikationen<br />
in vielen Sprachen. Seine I<strong>de</strong>en<br />
haben eine neue Architektengeneration<br />
und all die, die sich an <strong>de</strong>r zukünftigen<br />
Entwicklung von Städten<br />
und <strong>de</strong>r Kultur interessieren, beeinflusst.<br />
Daniel Libeskind ist mit Nina Libeskind<br />
verheiratet und hat drei Kin<strong>de</strong>r.<br />
Die Familie lebt zurzeit noch in<br />
Berlin, plant aber wegen <strong>de</strong>s Auftrags<br />
für das neue World Tra<strong>de</strong> Center<br />
nach New York umziehen.<br />
© Jüdisches Museum Berlin<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
BEITRÄGE<br />
167
BEITRÄGE<br />
168<br />
Erinnern und Ge<strong>de</strong>nken als<br />
Leitkategorien religiösen Lernens Holger Dörnemann<br />
Überholte Vergangenheit ?<br />
Nach einer Umfrage <strong>de</strong>s Instituts<br />
für Demoskopie Allensbach anlässlich<br />
<strong>de</strong>s Jahrtausendwechsels ist eine Mehrheit<br />
<strong>de</strong>r Deutschen mit Zuversicht in<br />
das Jahr 2000 und das neue Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
gewechselt. 1 Dem korrespondiert das<br />
Ergebnis einer weiteren Umfrage <strong>de</strong>sselben<br />
Instituts, nach <strong>de</strong>m 82 % <strong>de</strong>n<br />
Begriff „Zukunft“ sympathisch fin<strong>de</strong>n 2<br />
– eine <strong>de</strong>utliche Zunahme gegenüber einer<br />
Erhebung aus <strong>de</strong>m Jahr 1976 (70 %):<br />
keine Spur also von Endzeit- o<strong>de</strong>r Panik-Stimmung,<br />
ganz im Gegenteil und<br />
durchaus im Unterschied zum vorausgegangenen<br />
Jahrtausendwechsel.<br />
Dem bekun<strong>de</strong>ten Zukunftsoptimismus<br />
gegenüber wird <strong>de</strong>m Begriff „Vergangenheit“<br />
in <strong>de</strong>rselben Erhebung nur<br />
ein eingeschränktes Interesse entgegengebracht.<br />
Gera<strong>de</strong> einmal 43 % fin<strong>de</strong>n<br />
1999 diesen Begriff sympathisch<br />
(1973: 42 %). Vergangenheit, Ge<strong>de</strong>nken<br />
und Erinnerungsarbeit scheinen insgesamt<br />
nicht hoch im Kurs zu stehen. Geschichtsvergessenheit<br />
macht sich breit<br />
und fin<strong>de</strong>t ihre Gewährsleute sowohl<br />
bei gegenwartsorientierten Pragmatikern<br />
wie bei Rationalisten, die Geschichtliches<br />
– theorieimprägniert – per<br />
se nicht anficht; aber auch bei Traditionalisten,<br />
die „kein kritisches Verhältnis<br />
zur eigenen Geschichte“ und eine Abwehrhaltung<br />
gegen Lernprozesse haben,<br />
die sie „zu Korrekturen und Wandlungen<br />
im Selbstverständnis zwingen<br />
können“ 3 .<br />
Geschichtsvergessenheit als Leitphänomen<br />
<strong>de</strong>s Jahrtausendwechsels<br />
– nicht eben nur im Blick auf die Vergangenheit<br />
insgesamt o<strong>de</strong>r ferne geschichtliche<br />
Ereignisse, son<strong>de</strong>rn auch<br />
auf die jüngere und jüngste Geschichte<br />
und Einzelthemen. Das vermag eine<br />
weitere Untersuchung zu ver<strong>de</strong>utlichen:<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Nach einer im Dezember 1998 erhobenen<br />
Forsa-Meinungsumfrage wollen<br />
fast zwei Drittel (63 %) <strong>de</strong>r Deutschen<br />
einen Schlussstrich unter die<br />
Diskussion um die Ju<strong>de</strong>nverfolgung<br />
ziehen. 4 Nach dieser Erhebung waren<br />
sich Ost- und West<strong>de</strong>utsche in ihrer Einschätzung<br />
fast einig. Gegen einen<br />
Schlussstrich wandten sich 31 % <strong>de</strong>r<br />
Deutschen. Diese Stimmungslage geht<br />
einher mit zum Teil prominenten Meinungsäußerungen<br />
öffentlicher Stimmen<br />
in unserer Gesellschaft. Wer sich Martin<br />
Walsers Re<strong>de</strong> zur Verleihung <strong>de</strong>s<br />
Frie<strong>de</strong>nspreises <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Buchhan<strong>de</strong>ls<br />
1998 und <strong>de</strong>r auf sie folgen<strong>de</strong>n<br />
Diskussion hinsichtlich <strong>de</strong>s Sinns <strong>de</strong>utscher<br />
Ge<strong>de</strong>nkkultur erinnert – Walser<br />
ging in seiner ironisch zerquälten Re<strong>de</strong><br />
in <strong>de</strong>r Wahrnehmung vieler Zuhörer so<br />
weit, das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r öffentlichen Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>m Holocaust zu<br />
for<strong>de</strong>rn –, wird sofort an die von ihm<br />
beschworene Gefahr erinnert; dass öffentliches<br />
und – wie er sagt – instrumentalisieren<strong>de</strong>s<br />
Ge<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r Ritualisierung<br />
anheimfalle, bei <strong>de</strong>m das individuelle<br />
Gewissen notwendig stumm bleibe.<br />
Ähnlich hat auch <strong>de</strong>r Züricher Philosoph<br />
Hermann Lübbe in Anspielung<br />
auf die <strong>de</strong>utsche Vergangenheit vor einer<br />
„Überbetonung <strong>de</strong>s Erinnerns“ gewarnt.<br />
5 Bei einer Tagung zum Thema<br />
„Sich <strong>de</strong>r Toten erinnern“ erklärte Lübbe<br />
En<strong>de</strong> Oktober 1998, Erinnerung enthalte<br />
auch die Kunst <strong>de</strong>s Vergessens,<br />
um überhaupt eine I<strong>de</strong>ntität zu entwickeln.<br />
Allgemein müsse <strong>de</strong>r Mensch<br />
schlimme Erlebnisse vergessen, um sich<br />
weiterentwickeln zu können. Im Zusammenhang<br />
mit <strong>de</strong>r Geschichte einer<br />
Nation komme es darauf an, was sich<br />
<strong>de</strong>r Einzelne dabei zurechnen könne.<br />
Hier fän<strong>de</strong> <strong>de</strong>rzeit eine „Übermoralisierung“<br />
statt – so Lübbe.<br />
Zwei Beispiele prominenter Stellungnahmen<br />
im Konzert aller jener, die<br />
sich statt <strong>de</strong>r Vergangenheit lieber <strong>de</strong>n<br />
Ereignissen, Herausfor<strong>de</strong>rungen und Erfahrungen<br />
<strong>de</strong>r Gegenwart und Zukunft<br />
zuwen<strong>de</strong>n wollen. Vor diesem Hintergrund<br />
nimmt es nicht wun<strong>de</strong>r, dass auch<br />
kirchengeschichtlicher Erinnerung und<br />
zumal <strong>de</strong>m Arbeitsfeld Kirchengeschichte<br />
im Religionsunterricht ein zunehmend<br />
geringer wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Interesse<br />
entgegengebracht wird und dass Kirchengeschichte<br />
entwe<strong>de</strong>r im Lehrplan<br />
und in <strong>de</strong>r praktischen Umsetzung marginalisiert<br />
ist o<strong>de</strong>r aber <strong>de</strong>n O<strong>de</strong>m <strong>de</strong>s<br />
Langweilig-Überholten atmet. Immer<br />
mehr Schüler und Schülerinnen haben<br />
kein Interesse für Themen <strong>de</strong>r Christentumsgeschichte,<br />
„weil ihnen die etablierten<br />
Glaubensgemeinschaften traditionsüberfrachtet,<br />
gegenwartsfern und<br />
alltagsirrelevant erscheinen“ 6 . Wenn sie<br />
sich für <strong>de</strong>n Religionsunterricht interessieren,<br />
suchen sie nach Antworten<br />
auf ihre gegenwärtigen Probleme, Erfahrungen<br />
und Lebensfragen. Demgegenüber<br />
scheint „Kirchengeschichte“ im<br />
Religionsunterricht nur eine aus heutiger<br />
Sicht „überholte Vergangenheit“ 7<br />
anzubieten.<br />
Der Sinn von Erinnerungsarbeit<br />
Mit <strong>de</strong>m Hinweis auf gegenwärtige<br />
Trends in <strong>de</strong>n Erhebungen von Meinungsforschungsinstituten,<br />
die landläufige<br />
Praxis im kirchengeschichtlichen<br />
Unterricht und die damit einhergehen<strong>de</strong>n<br />
zum Teil prominenten Stellungnahmen<br />
konturiert sich eine „Zeitansage“,<br />
die im wahrsten Sinn <strong>de</strong>s<br />
Wortes „vergessen macht“, dass Ju<strong>de</strong>ntum<br />
und Christentum sowie die von ihnen<br />
geprägten Kulturen ganz wesentlich<br />
von einer Praxis <strong>de</strong>r Erinnerung<br />
und <strong>de</strong>s liturgischen Ge<strong>de</strong>nkens leben,<br />
und wie sehr darum Erinnerungsarbeit,<br />
Rituale und eine ausgearbeitete Ge-
<strong>de</strong>nkkultur auch für mo<strong>de</strong>rne Gesellschaften<br />
unverzichtbar sind. Spätestens<br />
in <strong>de</strong>r über sich und ihr Tun aufgeklärten<br />
Mo<strong>de</strong>rne wird klar, dass die kollektive<br />
Erinnerung min<strong>de</strong>stens zwei zu<br />
unterschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Aspekte besitzt, nämlich<br />
in kognitiver und normativer Hinsicht:<br />
8<br />
In kognitiver Hinsicht geht es in <strong>de</strong>r<br />
kollektiven Erinnerung darum festzustellen,<br />
was gewesen ist, wie es gewesen<br />
ist und warum es sich so und nicht<br />
an<strong>de</strong>rs ereignet hat. In normativer Hinsicht<br />
geht es zugleich auch darum, Maßstäbe<br />
und Prinzipien für das kollektive<br />
Han<strong>de</strong>ln zu fin<strong>de</strong>n und diese in Ritualen<br />
Gestalt gewinnen zu lassen. Rituale<br />
und Ge<strong>de</strong>nkfeiern sind im Unterschied<br />
zu rein geschichtlicher Forschung eine<br />
Form <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Vergangenheitsbezugs,<br />
die sich nicht darauf beschränkt<br />
zu schil<strong>de</strong>rn, wie o<strong>de</strong>r warum<br />
es gewesen ist. Sie haben <strong>de</strong>n Zweck,<br />
die Vergangenheit zu vergegenwärtigen<br />
und zu <strong>de</strong>monstrieren, wie sie in die<br />
Gegenwart übergehen, ein Teil von ihr<br />
wer<strong>de</strong>n und bleiben. An Ritualen und<br />
Ge<strong>de</strong>nkfeiern lässt sich ablesen, welche<br />
Teile <strong>de</strong>r vielen möglichen Vergangenheitsbewältigungen<br />
eine Gesellschaft<br />
als die ihren, als eine ihr Han<strong>de</strong>ln<br />
und Lei<strong>de</strong>n mit Sinn versehen<strong>de</strong> Vergangenheit<br />
ansieht. Rituale und Ge<strong>de</strong>nkfeiern<br />
tragen damit stets religiösen Charakter,<br />
ohne <strong>de</strong>swegen schon Religion<br />
zu sein.<br />
Doch soll es an dieser Stelle we<strong>de</strong>r<br />
in erster Linie darum gehen, die subkutan<br />
religiöse Grundierung unserer Gesellschaft<br />
über Gebühr zu betonen, noch<br />
<strong>de</strong>n falsch ansetzen<strong>de</strong>n Kritiken an <strong>de</strong>n<br />
Formen und <strong>de</strong>r Sinnhaftigkeit kollektiver<br />
Erinnerungsfeiern und -veranstaltungen<br />
weiter nachzugehen. Vielmehr<br />
soll über die mit Beginn <strong>de</strong>s neuen Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
vermehrt anstehen<strong>de</strong>n Anlässe<br />
für Ge<strong>de</strong>nkfeiern und Erinnerungsarbeit<br />
hinaus das spezifisch religionspädagogische<br />
Interesse in mehrfacher<br />
Hinsicht stark gemacht wer<strong>de</strong>n – und<br />
dies zunächst in <strong>de</strong>m besagten doppelten<br />
Sinn: Einerseits wegen <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung<br />
von kollektiver Erinnerung im Sinne<br />
eines unverstellten Wahrnehmens<br />
Aus: Gernot Candolini, Im Labyrinth – Aufbruch zur Mitte, Tyrolia 2001 © Foto: Gernot Candolini<br />
<strong>de</strong>r Vergangenheit, das <strong>de</strong>m Vergessen<br />
wi<strong>de</strong>rsteht, an<strong>de</strong>rerseits um die Vergangenheit<br />
zu vergegenwärtigen und ihre<br />
Themen für die Zukunft zu öffnen.<br />
Das dreifache kirchengeschichtliche<br />
Interesse <strong>de</strong>r Religionspädagogik<br />
Übertragen auf die Handlungsfel<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r Religionspädagogik müsste kirchen-<br />
bzw. christentumsgeschichtliche<br />
Erinnerungsarbeit vor <strong>de</strong>m Hintergrund<br />
<strong>de</strong>r im letzten Abschnitt vorgestellten<br />
Differenzierung einer dreifachen Fragestellung<br />
folgen: Muss sie im Blick<br />
auf die Kirchengeschichte Wert legen<br />
auf die – epochenbezogen zu applizieren<strong>de</strong><br />
– im Grun<strong>de</strong> immer ein und dieselbe<br />
Frage?<br />
Wie hat sich Christi Botschaft<br />
von <strong>de</strong>r Gottesherrschaft, die<br />
sich auf ihn berufen<strong>de</strong> Bewegung,<br />
wie hat sich das „spezifisch<br />
Christliche“, das „Proprium<br />
Christianum“... in <strong>de</strong>r jeweiligen<br />
Zeit übersetzt?<br />
Diese Frage birgt einen sachhaltigen<br />
Teil, <strong>de</strong>r oben bereits als <strong>de</strong>r kogni-<br />
tive Aspekt historischer Erinnerungsarbeit<br />
hervorgehoben wur<strong>de</strong> und grundlegend<br />
für jedwe<strong>de</strong> Form von Ge<strong>de</strong>nken,<br />
ritueller und historischer Erinnerungsarbeit<br />
ist. Die nüchterne, keinen<br />
Aspekt ausklammern<strong>de</strong> und historische<br />
Kontexte einbeziehen<strong>de</strong> Erinnerung <strong>de</strong>r<br />
Geschichte vorausgesetzt, verbirgt sich<br />
in dieser Frage jedoch mehr: Konkret<br />
wird zugleich auch nach <strong>de</strong>r Ausprägung<br />
<strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>s Christlichen in<br />
einem bestimmten historischen Kontext,<br />
in einem konkreten geschichtlichen Bezug<br />
gefragt. Es wird <strong>de</strong>utlich und gera<strong>de</strong>zu<br />
eingeübt, dass Christentum keine<br />
zeitenthobene Wirklichkeit ist, son<strong>de</strong>rn<br />
sich nur in einer je einzigen und spezifischen<br />
historischen Übertragung verwirklicht<br />
hat (und sich verwirklichen<br />
kann). Damit enthält die auf <strong>de</strong>n ersten<br />
Blick spezifisch kirchengeschichtlich ansetzen<strong>de</strong><br />
Fragerichtung bei näherem Hinsehen<br />
eine <strong>de</strong>r Kernfragen religionspädagogischer<br />
Bildungsarbeit schlechthin:<br />
Wie übersetze ich die Botschaft<br />
(für mich, für an<strong>de</strong>re)<br />
so, dass sie sowohl i<strong>de</strong>ntisch<br />
(im Sinne von unverfälscht,<br />
authentisch, original), als auch<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
BEITRÄGE<br />
169
BEITRÄGE<br />
170<br />
in <strong>de</strong>m jeweiligen Lebensbezug<br />
als be<strong>de</strong>utsam (relevant,<br />
heilsam, befreiend, herausfor<strong>de</strong>rnd)<br />
erfahren wird?<br />
Mit kürzestem Anlauf und auf gera<strong>de</strong>m<br />
Wege zeigt sich, dass kirchengeschichtliche<br />
Erinnerung eigentlich wie<br />
von selbst in <strong>de</strong>n Grundauftrag <strong>de</strong>r Religionspädagogik<br />
mün<strong>de</strong>t, religiöses Lernen<br />
zu ermöglichen – gera<strong>de</strong>zu ein paradoxes<br />
Ergebnis, vergegenwärtigt man<br />
sich <strong>de</strong>n zu Anfang erwähnten Ruf kirchengeschichtlichen<br />
Unterrichts als „gegenwartsfern<br />
und alltagsirrelevant“.<br />
Kirchengeschichtliche Erinnerungsarbeit<br />
kann so zugleich auch als Para<strong>de</strong>beispiel<br />
für die Explikation <strong>de</strong>ssen verstan<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n, was man als das „I<strong>de</strong>ntitäts-Relevanz-Dilemma“<br />
bei <strong>de</strong>r Umsetzung<br />
christlicher Existenz durch alle<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rte bezeichnen kann: Denn<br />
„wo (in <strong>de</strong>r Geschichte) die Faszination<br />
und Herausfor<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Gründungsimpulses<br />
in neue Situationen hinein übertragen<br />
wer<strong>de</strong>n sollte, da schien man vor<br />
die Entscheidung gestellt, das Eigentliche<br />
<strong>de</strong>s ‘damaligen’ Impulses auf Kosten<br />
seiner ‘aktuellen’Relevanz o<strong>de</strong>r die<br />
aktuelle Relevanz auf Kosten <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität<br />
<strong>de</strong>s zu Überliefern<strong>de</strong>n zur Geltung<br />
zu bringen“ 9 . Wer Relevanz <strong>de</strong>r christlichen<br />
Botschaft hier und heute will,<br />
<strong>de</strong>r muss zusammenbringen, was existenziell<br />
und von <strong>de</strong>n Anfängen an zusammengehört:<br />
I<strong>de</strong>ntität und Relevanz<br />
<strong>de</strong>r Botschaft Christi. Um <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität<br />
<strong>de</strong>r Botschaft willen muss das bisher<br />
Gesagte nun an<strong>de</strong>rs, neu gesagt wer<strong>de</strong>n,<br />
so dass je neu die Wahrheit für die<br />
Gegenwart aufgebrochen wird.<br />
Das I<strong>de</strong>ntitäts-Relevanz-Dilemma<br />
– nicht als Krisenphänomen 10 , son<strong>de</strong>rn<br />
als Benennung <strong>de</strong>r Ausgangslage christlicher<br />
Existenz heute betrachtet – steht<br />
formal, unthematisch und unmittelbar<br />
immer mit im Mittelpunkt kirchengeschichtlicher<br />
Erinnerungsarbeit. Über<br />
diese formale Einübung in die Grundaufgabenstellung<br />
christlicher Existenz<br />
hinaus trägt kirchengeschichtliche Erinnerung<br />
auch zum existenziellen Hinterfragen<br />
und Beantworten folgen<strong>de</strong>r<br />
Frage bei:<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Aus: Gernot Candolini, Im Labyrinth – Aufbruch zur Mitte, Tyrolia 2001 © Foto: Gernot Candolini<br />
Welche Themen und Inhalte <strong>de</strong>r<br />
Christentumsgeschichte sind für<br />
mich, die Kirche, die Gesellschaft<br />
... heute in <strong>de</strong>r Weise be<strong>de</strong>utsam,<br />
dass sie mein/unser<br />
Selbstbild, meine/unsere I<strong>de</strong>ntität<br />
und meine/unsere Zukunft<br />
bestimmen o<strong>de</strong>r auszumachen<br />
vermögen?<br />
Vergangenheit – so sie erinnert wird<br />
– ist nie nur eine „überholte, gegenwartsferne“<br />
Zeit, son<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r Erinnerungsarbeit<br />
zugleich immer auch<br />
Gegenwart. „Der Nobelpreisträger und<br />
Überleben<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Tragödie (<strong>de</strong>s Holocausts),<br />
Elie Wiesel, hat immer wie<strong>de</strong>r<br />
gemahnt, dass mit <strong>de</strong>m Verlust <strong>de</strong>s Erinnerns<br />
auch <strong>de</strong>r Verlust <strong>de</strong>s Seins einhergeht.<br />
Erinnern steht im Dienst <strong>de</strong>r<br />
Gegenwart und <strong>de</strong>r Zukunft. Sich erinnern<br />
geschieht nicht im ‘objektiven’Vorbeiziehenlassen<br />
vergangener Ereignisse.<br />
Erinnern setzt vielmehr voraus, dass<br />
aus <strong>de</strong>r Unzahl geschichtlicher Daten<br />
einige herausgegriffen wer<strong>de</strong>n, die ‘erinnerungswürdig’<br />
sind und die <strong>de</strong>shalb<br />
das gegenwärtige und zukünftige Leben<br />
prägen. Warum gera<strong>de</strong> Abraham und<br />
nicht Esau, warum die Propheten, warum<br />
die Geschichte Israels, warum das<br />
Kreuz Jesu, warum beson<strong>de</strong>re Ereignisse<br />
<strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts und warum<br />
schließlich die Shoah? Die Auswahl<br />
sagt etwas über <strong>de</strong>n eigenen <strong>Stand</strong>ort<br />
und entschei<strong>de</strong>t damit auch über die<br />
Zukunft.“ 11<br />
Erinnerung wird zur Selbstaussage<br />
– und in <strong>de</strong>r Vergegenwärtigung zugleich<br />
zur Vorhersage <strong>de</strong>ssen, was für<br />
die Zukunft angezielt ist, wie man sich<br />
auf Zukunft hin verstehen und geben<br />
will. Einleuchtend ist dies bei markanten<br />
i<strong>de</strong>ntitätsstiften<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r positiv<br />
be<strong>de</strong>utsamen Ereignissen – wie etwa<br />
die katholische Kirche in beson<strong>de</strong>rer<br />
Weise einzelner Kirchenväter und die<br />
evangelische Kirche am Reformationstag<br />
ihrer Ursprünge ge<strong>de</strong>nken;<br />
bei <strong>de</strong>r Erinnerung von Ereignissen<br />
und Zeitepochen, die Herausfor<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>de</strong>r Christenheit beschreiben, Herausfor<strong>de</strong>rungen,<br />
die sich heute genau<br />
so o<strong>de</strong>r ähnlich noch immer bzw. noch<br />
einmal stellen: etwa das sich herausbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
Verhältnis von Kirche und<br />
Staat in <strong>de</strong>n ersten Jahrhun<strong>de</strong>rten <strong>de</strong>r<br />
Kirchengeschichte und heute; o<strong>de</strong>r die
echte Weise <strong>de</strong>r Mission im „Zeitalter<br />
<strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckungen“ und in <strong>de</strong>r Gegenwart<br />
...<br />
In markanter Weise wird <strong>de</strong>r besagte<br />
Sinn kirchengeschichtlicher Erinnerungsarbeit<br />
<strong>de</strong>utlich im Ge<strong>de</strong>nken<br />
<strong>de</strong>r Leid- und Schuldgeschichte einer<br />
Gemeinschaft – etwa <strong>de</strong>r dunklen Seiten<br />
<strong>de</strong>r Kirchengeschichte. Wo dies<br />
geschieht (etwa im Schuldbekenntnis<br />
Papst Johannes Pauls II. am 1. Fastensonntag<br />
<strong>de</strong>s Jahres 2000 bezogen auf<br />
die Vergehen <strong>de</strong>r Inquisition, bei <strong>de</strong>n<br />
Kreuzzügen, im Gegenüber zum Ju<strong>de</strong>ntum<br />
...), wird weit mehr ausgesprochen<br />
– insofern damit ein Fehlen und<br />
Bedauern im Namen <strong>de</strong>r und bezogen<br />
auf die Gesamtkirche gemeint ist – als<br />
nur das Anerkenntnis einer historischen<br />
Faktenlage. Es wird zuvor Verdrängtes,<br />
Vergessenes, Abgewiesenes,<br />
Abgespaltenes offen ausgesprochen<br />
und in das Bewusstsein geholt, dass<br />
auch die dunklen Seiten <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />
in bleiben<strong>de</strong>r Trauerarbeit<br />
<strong>de</strong>m eigenen Selbstverständnis zugerechnet<br />
wer<strong>de</strong>n. Es drückt sich aus,<br />
was zukünftig sein und nicht sein soll,<br />
welchen Anspruch man für die Zukunft<br />
bei sich anlegen will. Nur auf<br />
diese Weise kann eine Versöhnung mit<br />
<strong>de</strong>r Vergangenheit und die Begründung<br />
eines neuen Verhältnisses mit<br />
<strong>de</strong>n Opfern <strong>de</strong>r Geschichte entstehen.<br />
Nur in <strong>de</strong>r auch die negativen und<br />
schmerzlichen Seiten <strong>de</strong>r eigenen Geschichte<br />
einbeziehen<strong>de</strong>n Erinnerungsarbeit<br />
kann entstehen und gelingen,<br />
was man als Kern <strong>de</strong>r christlichen<br />
Botschaft bezeichnen kann: ein Leben<br />
in Wahrheit.<br />
Eine An-Deutung<br />
Kirchen- bzw. christentumsgeschichtliche<br />
Erinnerungsarbeit, kollektive<br />
Erinnerung macht Sinn. Sie macht<br />
noch darüber hinausgehend für <strong>de</strong>n Bereich<br />
<strong>de</strong>r katholischen Theologie und<br />
<strong>de</strong>r Religionspädagogik Sinn – gera<strong>de</strong><br />
auch vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r unlängst<br />
erschienenen Philosophie-Enzyklika<br />
„Fi<strong>de</strong>s et ratio“ 12 –, ist sie doch zu-<br />
gleich auch eine Möglichkeit, neu nach<br />
Wegen zu suchen, von Gott in Kategorien<br />
unserer Zeit zu re<strong>de</strong>n.<br />
Gera<strong>de</strong> vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r<br />
Frage nach <strong>de</strong>m Umgang mit <strong>de</strong>m in<br />
<strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Nazi-Diktatur entstan<strong>de</strong>nen<br />
Leid ist sich die Theologie so mancher<br />
ihrer „zu starken Kategorien“<br />
(J.B. Metz) in Verkündigung und Theologie<br />
bewusst gewor<strong>de</strong>n. Die Frage<br />
nach <strong>de</strong>r Gerechtigkeit und nach einem<br />
möglichen Trost für die ungerecht Lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
ist nach <strong>de</strong>m Grauen von<br />
Auschwitz die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> und herausfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong><br />
Frage für Gläubige und<br />
Ungläubige. Mit Bezug auf Walter<br />
Benjamin hat vor allem Johann Baptist<br />
Metz als Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r sogenannten<br />
neueren „Politischen Theologie“ dafür<br />
plädiert, sich <strong>de</strong>r vergangenen Lei<strong>de</strong>n<br />
zu erinnern, um so die Vergangenheit in<br />
die Gegenwart zu holen und in <strong>de</strong>r „Erinnerung<br />
frem<strong>de</strong>n Leids“ (memoria<br />
passionis), in – wie er sagt – „anamnetischer<br />
Solidarität“ unsere zumeist<br />
selbstbezügliche Wahrnehmung auf<br />
gefährliche Weise stören zu lassen, in<br />
<strong>de</strong>r Weigerung, die Vergangenheit ein<br />
für alle Mal für abgeschlossen zu halten.<br />
Theologie im An<strong>de</strong>nken und Einge<strong>de</strong>nken<br />
geschichtlicher Erfahrung<br />
erschließt sich vor diesem Hintergrund<br />
als Reflexion auf ein kommunikatives<br />
Han<strong>de</strong>ln, das für die Vergangenheit und<br />
ihre Opfer Sinn behauptet, als Theorie<br />
kommunikativen Han<strong>de</strong>lns und <strong>de</strong>r in<br />
ihr erfahrenen Wirklichkeit (Helmut<br />
Peukert 13 ). Gott ist nicht einfachhin erfahrungsjenseitige<br />
Transzen<strong>de</strong>nz, son<strong>de</strong>rn<br />
<strong>de</strong>r in solidarischem Han<strong>de</strong>ln von<br />
Anfang an bzw. bis zuletzt Behauptete<br />
und Erfahrene: Gott <strong>de</strong>r behauptet wird,<br />
wenn und wo sich <strong>de</strong>r Lei<strong>de</strong>n erinnert<br />
wird.<br />
Bleibt zu hoffen, dass es diesem in<br />
<strong>de</strong>r gängigen Religionspädagogik wohl<br />
mit am meisten rezipierten fundamentaltheologischen<br />
Ansatz gelingt – gemäß<br />
<strong>de</strong>r Frageperspektive von „Fi<strong>de</strong>s<br />
et ratio“ –, Gott auf neue, alte Weise als<br />
„Menschheitsthema“ durchzubuchstabieren,<br />
nicht seinerseits zu einer Geschichtsvergessenheit<br />
führt. Aufgabe<br />
<strong>de</strong>r Religionspädagogik muss es sein, so<br />
manche „gefährliche Erinnerung“ und<br />
„Antitradition“ (J.B. Metz) wie<strong>de</strong>rzuent<strong>de</strong>cken.<br />
Anmerkungen<br />
01 Umfrage <strong>de</strong>s Instituts für Demoskopie Allensbach,<br />
veröffentlicht am 30.12.1999.<br />
02 Umfrage <strong>de</strong>s Instituts für Demoskopie Allensbach,<br />
veröffentlicht in „Die Zeit“ vom 29.12.1999.<br />
03 Hubertus Halbfas: Wurzelwerk. Geschichtliche Dimensionen<br />
<strong>de</strong>r Religionsdidaktik, Düsseldorf. 2 1997.<br />
148.<br />
04 Umfrage <strong>de</strong>s Meinungsforschungsinstituts Forsa, für<br />
die 2005 Deutsche befragt wur<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r<br />
Anteil <strong>de</strong>r 14-24-jährigen in dieser Frage genau so<br />
hoch wie bei <strong>de</strong>n Befragten über 65 Jahren war (65<br />
Prozent).<br />
05 Vgl.: KNA-Nachricht 13719 vom 27.10.1998: „Lübbe:<br />
Erinnern enthält die Kunst <strong>de</strong>s Vergessens“.<br />
06 Klaus König: Kirchengeschichtsdidaktische Grundregeln,<br />
in: Engelbert Groß/Klaus König (Hg.): Religionsdidaktik<br />
in Grundregeln. Leitfa<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n<br />
Religionsunterricht, Regensburg. 1996. 182.<br />
07 Halbfas: Wurzelwerk (s. Anm. 3). 139.<br />
08 Vgl. zum folgen<strong>de</strong>n Absatz: Micha Brumlik: Gewissen,<br />
Ge<strong>de</strong>nken und anamnetische Solidarität, in:<br />
Universitas 53, 1998. 1143-1153, hier bes. 1149f.<br />
09<br />
Jürgen Werbick: Vom entschei<strong>de</strong>nd und unterschei<strong>de</strong>nd<br />
Christlichen, Düsseldorf. 1992. 24.<br />
10 Vgl. ebd., 27.<br />
11 Erich Weitbach: Der Vatikan und die ‘unaussprechliche<br />
Tragödie’ <strong>de</strong>r Shoah, in: Materialdienst<br />
<strong>de</strong>s Konfessionskundlichen Instituts Bensheim 49<br />
(3 /1998) 51.<br />
12 Papst Johannes Paul II ruft in <strong>de</strong>r Enzyklika „Fi<strong>de</strong>s<br />
et ratio“ vom 15. September 1998 alle Philosophen<br />
und Theologen auf, „in einen kritischen und anspruchsvollen<br />
Dialog einzutreten sowohl mit <strong>de</strong>m<br />
philosophischen Denken unserer Zeit wie auch mit<br />
<strong>de</strong>r gesamten philosophischen Tradition, ob sie nun<br />
im Einklang mit <strong>de</strong>m Wort Gottes steht o<strong>de</strong>r nicht“.<br />
(Nr. 105).<br />
13 Vgl. Helmut Peukert: Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie<br />
– Fundamentale Theologie. Analysen<br />
zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung,<br />
Düsseldorf. 1976. bes. 346ff.<br />
Dr. Holger Dörnemann ist seit 1998<br />
Referent für Theologische Bildung im<br />
Erzbistum Köln und seit 1999 Lehrbeauftragter<br />
für Religionspädagogik und<br />
ihre Didaktik am Kath. Theologischen<br />
Seminar (Prof. Dr. H. J. Höhn) <strong>de</strong>r Philosophischen<br />
Fakultät <strong>de</strong>r Universität<br />
Köln.<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
BEITRÄGE<br />
171
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
172<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Erinnerung (auf-)bauen<br />
Architektur <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens in Berlin und New York<br />
Einleitung<br />
„Gar<strong>de</strong>ns of the World“<br />
Im Januar 2003 erhielt <strong>de</strong>r z. Zt. in<br />
Berlin leben<strong>de</strong> Amerikaner Daniel Libeskind<br />
(zur Person siehe Materialien) für<br />
seinen „Gar<strong>de</strong>ns of the World“ genannten<br />
Entwurf <strong>de</strong>n Zuschlag für die Wie<strong>de</strong>rbebauung<br />
<strong>de</strong>s Gelän<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s World<br />
Tra<strong>de</strong> Centers, das bei <strong>de</strong>n verheeren<strong>de</strong>n<br />
Attentaten vom 11. September 2001<br />
zerstört wur<strong>de</strong>. Nach eigenem Bekun<strong>de</strong>n<br />
suchte <strong>de</strong>r Architekt, <strong>de</strong>r auch das<br />
Jüdische Museum in Berlin entworfen<br />
hat, bei seinen Plänen nach einer Lösung,<br />
die scheinbar unüberwindbare Gegensätze<br />
miteinan<strong>de</strong>r verknüpft, nämlich<br />
die Erinnerung an die schrecklichen<br />
und zerstörerischen Anschläge, das<br />
Ge<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r Opfer, aber auch einen<br />
hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.<br />
Ohne das Bedürfnis <strong>de</strong>r Metropole<br />
nach Büro- und Geschäftsflächen zu vernachlässigen,<br />
enthält Libeskinds Entwurf<br />
daher eine Vielzahl symbolischer<br />
Räume und Stätten <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens. So<br />
versteht Libeskind <strong>de</strong>n mit einer metallenen<br />
Spitze 541 m (1776 Fuß) hoch in<br />
die New Yorker Skyline ragen<strong>de</strong>n, und<br />
damit weltweit höchsten Wolkenkratzer<br />
seines Entwurfs als eine Reverenz<br />
an das Jahr <strong>de</strong>r amerikanischen Unabhängigkeit<br />
und damit <strong>de</strong>r Geburtsstun<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Demokratien. Die in<br />
<strong>de</strong>ssen oberen Stockwerken angelegten,<br />
paradiesisch anmuten<strong>de</strong>n „Gar<strong>de</strong>ns<br />
of the World“ will er als permanente<br />
symbolische Bejahung <strong>de</strong>s Lebens verstan<strong>de</strong>n<br />
wissen, die in einer Hoffnung<br />
wecken<strong>de</strong>n Spannung stehen zu <strong>de</strong>n<br />
gleichsam als offene Wun<strong>de</strong> verbleiben<strong>de</strong>n<br />
Kratern in <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nwanne <strong>de</strong>s<br />
ehemaligen WTC, die durch die Flugzeugabstürze<br />
in diese hineingerissen<br />
wur<strong>de</strong>n und für <strong>de</strong>n Besucher <strong>de</strong>s neu<br />
entstehen<strong>de</strong>n WTC sichtbar und zu-<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
gänglich bleiben sollen.<br />
Deutet man die erhalten<br />
gebliebenen Wän<strong>de</strong> wie<br />
Libeskind als Symbol für<br />
die „Kraft <strong>de</strong>r US-Verfassung,<br />
die Demokratie und<br />
Leben“ garantiert, so vermischt<br />
sich auch hier die<br />
Erinnerung an die grausamen<br />
Attentate mit einem<br />
auf traditionellen<br />
amerikanischen Werten<br />
fußen<strong>de</strong>n, hoffnungsvollen<br />
Blick in die Zukunft.<br />
Libeskind plant verschie<strong>de</strong>ne<br />
Räume und Anlässe,<br />
an <strong>de</strong>nen die Erinnerung<br />
wachgehalten wer<strong>de</strong>n<br />
soll. So soll außer einem<br />
„Museum <strong>de</strong>r Freiheit“<br />
1 auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong><br />
auch ein Ge<strong>de</strong>nkparcours<br />
eingerichtet wer<strong>de</strong>n. Es<br />
sollen ein „Platz <strong>de</strong>s 11.<br />
September“ und ein „Park<br />
<strong>de</strong>r Hel<strong>de</strong>n“ entstehen.<br />
Schließlich soll auf <strong>de</strong>m „Wedge of<br />
Light“ (Licht-Keil) in je<strong>de</strong>m Jahr am<br />
11. September genau zwischen 8:48 Uhr<br />
und 10:28 Uhr – <strong>de</strong>m Zeitraum von <strong>de</strong>r<br />
ersten Flugzeugkollision bis zum Einsturz<br />
<strong>de</strong>s zweiten Twin Tower – die Sonne<br />
scheinen, ohne Schatten zu werfen,<br />
womit Libeskind die Lichtsymbolik<br />
babylonischer und altägyptischer Götterkulte<br />
aufgreift.<br />
Mag man bei <strong>de</strong>r Studie <strong>de</strong>s Libeskind-Entwurfs<br />
für die Neubebauung<br />
<strong>de</strong>s Ground Zero diesen mit seinen<br />
symbolträchtigen Räumen und Gebäu<strong>de</strong>n<br />
noch als eine allzu emotional bela<strong>de</strong>ne<br />
Reminiszenz an das „We shall not<br />
be moved“ <strong>de</strong>r Amerikaner nach <strong>de</strong>n<br />
fürchterlichen Anschlägen vom 11. September<br />
2001, die Wolkenkratzer gar als<br />
„babylonisch“ 2 empfin<strong>de</strong>n, so gewinnt<br />
das Moment <strong>de</strong>r Erinnerung in einem<br />
an<strong>de</strong>ren Bauwerk <strong>de</strong>sselben Architekten<br />
– <strong>de</strong>m Jüdischen Museum in Berlin<br />
– gera<strong>de</strong> durch sogenannte „Voids“<br />
(Leerstellen) „Between the Lines“ (so<br />
<strong>de</strong>r Titel <strong>de</strong>s Projektes) an Be<strong>de</strong>utung.<br />
„Between the Lines“<br />
Ute Lonny-Platzbecker<br />
View from Hudson River © Jock Pottle<br />
Nach Libeskind liegen <strong>de</strong>m Entwurf<br />
<strong>de</strong>s 1999 eröffneten Museumsbaus<br />
drei Gedanken zugrun<strong>de</strong>: Zunächst<br />
sei die Geschichte Berlins 3 ohne<br />
die Berücksichtigung <strong>de</strong>s be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n<br />
intellektuellen, ökonomischen<br />
und kulturellen Einflusses <strong>de</strong>r jüdischen<br />
Bewohner <strong>de</strong>r Metropole nicht<br />
zu verstehen. In das Ge<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r<br />
Stadtgeschichte sei dann aber die Be<strong>de</strong>utung<br />
<strong>de</strong>s Holocaust mit seiner Zerstörung<br />
<strong>de</strong>s jüdischen Lebens zu inte-
grieren. Zuletzt wen<strong>de</strong> sich <strong>de</strong>r Blick<br />
in die Zukunft, die in Berlin und darüber<br />
hinaus in Europa nur menschlich<br />
sein könne, wenn sowohl das Wissen<br />
um <strong>de</strong>n Aufstieg und die Be<strong>de</strong>utsamkeit<br />
jüdischen Lebens, aber auch<br />
um seine Auslöschung integriert sei.<br />
Architektonisch verwirklichen sich<br />
Libeskinds I<strong>de</strong>en in <strong>de</strong>m durch seinen<br />
Zickzackkurs an einen ausgerissenen<br />
Davidstern gemahnen<strong>de</strong>n Grundriss <strong>de</strong>s<br />
Museumsbaus, <strong>de</strong>r ausschließlich unterirdisch<br />
mit <strong>de</strong>m Berliner Stadtmuseum<br />
verbun<strong>de</strong>n ist und durch die unregelmäßige<br />
Raum- und Fensterfolge sowie<br />
die unterschiedlichen Geschosshöhen<br />
kaum Orientierung zulässt. Zentrales<br />
Element bil<strong>de</strong>n dabei die sechs vertikalen<br />
„Voids“, Hohl- o<strong>de</strong>r Leerräume,<br />
die von oben bis unten durch alle Geschosse<br />
als funktionslose Räume mit<br />
unverputzten Betonwän<strong>de</strong>n eine Art<br />
Schnitt bil<strong>de</strong>n. Immer wie<strong>de</strong>r kreuzt<br />
<strong>de</strong>r Besucher diese „Voids“ auf Brücken,<br />
und da, wo er sie im Museum übero<strong>de</strong>r<br />
unterläuft, sind Decke und Fußbo<strong>de</strong>n<br />
schwarz gefärbt. Diese Leerstellen<br />
als Platzhalter für das im Holocaust<br />
zerstörte jüdische Leben Berlins verwirklichen<br />
<strong>de</strong>n Grundgedanken Libeskinds,<br />
nämlich dass das Nicht-Sichtbare<br />
sich als Leere, als das Unsichtbare<br />
manifestieren solle. Die Wän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Museums<br />
seien gleichsam um einen leeren<br />
Raum herumgebaut, in <strong>de</strong>ssen Begehen<br />
und Erleben <strong>de</strong>r Besucher „between the<br />
lines“ eine Verbindung zu <strong>de</strong>r ausradierten<br />
Spur jüdischer Geschichte Berlins<br />
aufnehmen kann, womöglich mehr<br />
als bei <strong>de</strong>r Betrachtung <strong>de</strong>r wenigen erhalten<br />
gebliebenen Gegenstän<strong>de</strong> und<br />
Dokumente <strong>de</strong>r Ausstellung, die nach<br />
Libeskind eher eine Abwesenheit als eine<br />
Präsenz heraufbeschwören. Dem Verlust<br />
<strong>de</strong>r Erinnerung 4 tritt eine Architektur<br />
entgegen, in <strong>de</strong>r „das Unsichtbare und<br />
das Sichtbare die strukturellen Merkmale<br />
bil<strong>de</strong>n“ und „<strong>de</strong>r das Namenlose<br />
einbeschrieben ist wie ein Name, <strong>de</strong>r<br />
stumm bleibt“ (Libeskind). 5 Weitere Orte<br />
<strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens bil<strong>de</strong>n außerhalb <strong>de</strong>s<br />
Gebäu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r „Garten <strong>de</strong>s Exils und<br />
<strong>de</strong>r Emigration“ mit 49 sechs Meter<br />
hohen, leicht geneigten Betonstelen, in<br />
die Wei<strong>de</strong>n gepflanzt sind, sowie <strong>de</strong>r<br />
„Paul Celan-Hof“, <strong>de</strong>ssen Bo<strong>de</strong>n nach<br />
einer Grafik <strong>de</strong>r mit diesem be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n<br />
jüdischen Lyriker und Holocaustüberleben<strong>de</strong>n<br />
verheirateten Künstlerin<br />
Gisèle Celan-Lestrange gestaltet ist.<br />
Das Muster lässt sich <strong>de</strong>uten als die<br />
Spuren von Wegen, die Menschen gegangen<br />
sind, mit Kreuzungen und Verästelungen,<br />
Über- und Unterführungen,<br />
Neuanfängen und Abbrüchen sowie einem<br />
zum Ausgang <strong>de</strong>s Hofes hin gleichsam<br />
als Barriere o<strong>de</strong>r Stolperstein erhaben<br />
gestalteten Element.<br />
Zwei Bauten – Zwei Formen <strong>de</strong>r<br />
Erinnerung<br />
Bei<strong>de</strong> Entwürfe suchen das Vergangene<br />
nicht nur in seinem „Wie?“<br />
und „Warum?“ darzustellen – dazu<br />
dienen vor allem die Ausstellungen im<br />
Jüdischen Museum und in <strong>de</strong>m geplanten<br />
„Museum of Hope“ –, son<strong>de</strong>rn<br />
das Vergangene gera<strong>de</strong>zu physisch zu<br />
vergegenwärtigen und in seiner Be<strong>de</strong>utung<br />
für Gegenwart und Zukunft<br />
präsent zu halten. Bei<strong>de</strong> von einer<br />
Kommission ausgewählten Konzepte<br />
dürfen in diesem Sinne ge<strong>de</strong>utet wer<strong>de</strong>n<br />
als eine Art Vergangenheitsbewältigung,<br />
die das Vergangene in Gegenwart<br />
und Zukunft zu integrieren und<br />
so letztlich das vergangene, gegenwärtige<br />
und zukünftige Lei<strong>de</strong>n und<br />
Han<strong>de</strong>ln einer Gesellschaft in einen<br />
sinnvollen Kontext zu stellen sucht.<br />
Das Ge<strong>de</strong>nken wird dann zur Selbstaussage<br />
darüber, wie eine Gesellschaft<br />
sich verstan<strong>de</strong>n wissen und wie sie ihre<br />
Zukunft gestalten will, 6 bei<strong>de</strong>s Fragen,<br />
zu <strong>de</strong>ren Beantwortung die Entwürfe<br />
Libeskinds einen ausdrücklichen<br />
Beitrag leisten wollen. Verweist<br />
das Berliner Museum in mahnen<strong>de</strong>m<br />
Ge<strong>de</strong>nken an die Auslöschung jüdischen<br />
Lebens auf die Verantwortung<br />
zur Gestaltung einer humanen Zukunft,<br />
so betont <strong>de</strong>r New Yorker Entwurf<br />
das „Hel<strong>de</strong>ntum“ 7 <strong>de</strong>r von brutaler<br />
Gewalt betroffenen Amerikaner<br />
und zielt auf eine Zukunft, in <strong>de</strong>r die<br />
amerikanische Gesellschaft ihre tradi-<br />
tionellen Werte verteidigen und ihnen<br />
zu neuer Größe verhelfen soll.<br />
Bei<strong>de</strong> Entwürfe öffnen sich einer<br />
religiösen Perspektive, wenn sie in architektonischen<br />
Symbolen das scheinbar<br />
Sinnlose mit einem auf Sinn hoffen<strong>de</strong>n<br />
Blick in die Zukunft verbin<strong>de</strong>n<br />
wollen. Libeskind bezeichnet das Sichtbare<br />
und das Unsichtbare als wesentliche<br />
Strukturelemente <strong>de</strong>s Berliner Jüdischen<br />
Museumsbaus und greift damit<br />
auf zentrale Begriffe jüdischer Spiritualität<br />
zurück. Wenn Libeskind selbst<br />
seine Architektur als eine beschreibt,<br />
<strong>de</strong>r das „Namenlose einbeschrieben ist<br />
wie ein Name“, „was an<strong>de</strong>res kann<br />
dann im Letzten – d. h. über alle historisch<br />
anschaulichen Ereignisse ... und<br />
über alle Namen hinaus – gemeint sein<br />
als <strong>de</strong>r unsichtbare Gott selbst, <strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r<br />
hinter allen Namen seinen Namen verbirgt<br />
und stumm bleibt und sich selbst<br />
als JAHWE, Ich bin da, namenlos, jenseits<br />
aller Namen benennt“ 8 . Eine Libeskinds<br />
Architektur in ihrer Radikalität<br />
ernst nehmen<strong>de</strong> Deutung <strong>de</strong>r „Voids“<br />
als „Zeichen für das abwesend Präsente<br />
schlechthin, Zeichen für Gott“ 9 erscheint<br />
durchaus gerechtfertigt, auch wenn <strong>de</strong>r<br />
Architekt selbst eine ausdrückliche religiöse<br />
Zuschreibung vermei<strong>de</strong>t. Die<br />
Ehrfurcht im Ge<strong>de</strong>nken an die jüdischen<br />
Opfer <strong>de</strong>s Nationalsozialismus, die hier<br />
auch architektonisch im Verzicht auf<br />
vorschnell sinngeben<strong>de</strong> Bil<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r<br />
Namen durch die „Voids“ zum Ausdruck<br />
gebracht wird, steht in Kongruenz<br />
zur Ehrfurcht bei <strong>de</strong>r Verehrung <strong>de</strong>s<br />
„Namenlosen“, „Unaussprechlichen“,<br />
<strong>de</strong>s im Tetragramm symbolhaft ausgedrückten,<br />
verborgen Offenbaren im Ju<strong>de</strong>ntum.<br />
Bereits in die Berichterstattung<br />
über die Finalisten im Ausschreibungswettbewerb<br />
um die Wie<strong>de</strong>rbebauung<br />
<strong>de</strong>s WTC mischt sich religiöses<br />
Vokabular, wenn etwa <strong>de</strong>r Spiegel<br />
fragt, „wie babylonisch sich New York<br />
nach dieser Apokalypse in Zukunft<br />
wie<strong>de</strong>r geben dürfe“ 10 , o<strong>de</strong>r die FAZ<br />
die Spannung beschreibt, mit <strong>de</strong>r Amerika<br />
und darüber hinaus die ganze Welt<br />
auf das „Symbol einer Epiphanie“ 11<br />
warten, das am Ort <strong>de</strong>s ehemaligen<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
173<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
174<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Außenansicht Jüdisches Museum, Berlin © Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe, Berlin<br />
WTC wie<strong>de</strong>r aufragen soll. Eine Deutung<br />
<strong>de</strong>r „Gar<strong>de</strong>ns of the World“ als<br />
„Vorschein E<strong>de</strong>ns“ 12 legt <strong>de</strong>r gewählte<br />
Entwurf nahe, aber auch Libeskind<br />
selbst macht sich dieses Sprachspiel zu<br />
Eigen, wenn er die Reste <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nwanne<br />
als „heiligen Ort“ bezeichnet,<br />
<strong>de</strong>r als Symbol für die Stärke <strong>de</strong>r amerikanischen<br />
Demokratie begehbar gemacht<br />
wer<strong>de</strong>n soll und gleichzeitig einen<br />
„ruhigen, meditativen Raum“ beherbergen<br />
soll. In <strong>de</strong>mselben Interview<br />
gipfelt die ausdrücklich religiöse Symbolgebung<br />
in <strong>de</strong>m Resümee: „Diese<br />
aufregen<strong>de</strong> Architektur mit <strong>de</strong>m Museum,<br />
<strong>de</strong>r Lower-Manhattan Zugstation,<br />
Hotels, einem Theater, Büros, Geschäften<br />
und Restaurants wird die Auferstehung<br />
<strong>de</strong>s Lebens symbolisieren und zeigen,<br />
dass wir voll und ganz zu New<br />
York stehen.“ 13 Steht <strong>de</strong>r Bau <strong>de</strong>s Jüdischen<br />
Museums in Berlin ganz in <strong>de</strong>r<br />
Tradition jüdischer Spiritualität 14 , so<br />
kann im Hinblick auf <strong>de</strong>n Entwurf zur<br />
Neubebauung <strong>de</strong>s ehemaligen WTC-Gelän<strong>de</strong>s<br />
nur von einer Funktionalisierung<br />
religiösen Vokabulars im Dienste<br />
politischer und nationaler Interessen<br />
gesprochen wer<strong>de</strong>n, was gera<strong>de</strong> im Religionsunterricht<br />
durchaus kritisch hinterfragt<br />
wer<strong>de</strong>n sollte.<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Unterrichtssequenz<br />
Die Beschäftigung mit <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n<br />
vorgestellten Libeskind-Entwürfen unter<br />
<strong>de</strong>r Leitfrage, auf welche Weise und<br />
mit welcher Be<strong>de</strong>utung für Gegenwart<br />
und Zukunft das Erinnern bzw. das öffentliche<br />
Ge<strong>de</strong>nken möglichst fruchtbar<br />
gestaltet wer<strong>de</strong>n kann, bietet sich<br />
vor allem im RU <strong>de</strong>r Oberstufe im Rahmen<br />
eines Kurses zur Eschatologie 15<br />
an. Die Sequenz kann aber auch bereits<br />
ab Klasse 10 16 etwa in eine Unterrichtsreihe<br />
zum Sinn menschlichen Lebens<br />
eingebun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r als sinnvolle<br />
Ergänzung <strong>de</strong>r Einheit über Kirche und<br />
Nationalsozialismus vor <strong>de</strong>m Hintergrund<br />
<strong>de</strong>r Frage nach einem angemessenen<br />
Umgang mit dieser Vergangenheit.<br />
Ziel <strong>de</strong>r Reihe ist es zunächst, <strong>de</strong>n<br />
Schüler/-innen die Wichtigkeit <strong>de</strong>s Erinnerns<br />
und Ge<strong>de</strong>nkens in <strong>de</strong>r Bewältigung<br />
persönlicher Erfahrung zu ver<strong>de</strong>utlichen.<br />
Darüber hinaus soll ihnen<br />
von dieser persönlichen Perspektive<br />
ausgehend aber auch <strong>de</strong>r Sinn von Ge<strong>de</strong>nkstätten<br />
und Ge<strong>de</strong>nkfeiern exemplarisch<br />
anhand <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Libeskind-<br />
Entwürfe eröffnet wer<strong>de</strong>n. In<strong>de</strong>m die<br />
Schüler/-innen danach fragen, welche<br />
Aussage eine Gesellschaft mit einer be-<br />
stimmten Form <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens über ihre<br />
eigene Gegenwart und angezielte Zukunft<br />
macht, wer<strong>de</strong>n sie sensibilisiert<br />
für eine kritische Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>n so implizierten Selbstaussagen<br />
einer Gesellschaft. Die vorgeschlagene<br />
Sequenz umfasst, abhängig davon, ob<br />
eine Internet-Recherche durchgeführt<br />
wird o<strong>de</strong>r nicht, etwa 7-9 Unterrichtsstun<strong>de</strong>n.<br />
17<br />
Bei <strong>de</strong>r Schülerwelt ansetzend und<br />
einen zunächst recht offenen und individuellen<br />
Zugang zum Thema suchend,<br />
bietet sich als Einstieg <strong>de</strong>r Song<br />
„Mensch“ von Herbert Grönemeyer<br />
an. Das Lied sollte ohne Textblatt als<br />
Eingangsimpuls vorgespielt wer<strong>de</strong>n und<br />
die Schüler/-innen sollten beim Hören<br />
darauf achten, welche Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>m<br />
Erinnern, aber auch <strong>de</strong>m Vergessen für<br />
<strong>de</strong>n Menschen zugeschrieben wird 18 ;<br />
dies soll anschließend durchaus an eigene<br />
Erfahrungen anknüpfend im Unterrichtsgespräch<br />
diskutiert wer<strong>de</strong>n. Welchen<br />
Sinn/Trost kann Erinnerung auch<br />
an vergangenes Leid haben? Welche<br />
Erfahrungen/Erlebnisse suche ich zu verdrängen<br />
– warum, welche Gefahr liegt<br />
darin? Dieser schülerorientierte Einstieg<br />
stößt u.U. eine kontroverse Diskussion<br />
an, wenn etwa einzelne Schüler,<br />
durchaus <strong>de</strong>m Trend <strong>de</strong>r Zeit folgend,<br />
die Auffassung vertreten, dass man gera<strong>de</strong><br />
vergangenes Leid – sei es persönlich<br />
Erfahrenes o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Geschichte<br />
einer Gesellschaft Geschehenes – auch<br />
„einfach mal vergessen können“ muss,<br />
um <strong>de</strong>n Blick nach vorn zu wen<strong>de</strong>n.<br />
An<strong>de</strong>re wer<strong>de</strong>n vielleicht ebenso aus eigener<br />
Erfahrung die Be<strong>de</strong>utung von Erinnerung<br />
und ggf. auch Orten <strong>de</strong>r Erinnerung<br />
(z. B. Grabbesuch bei Verlust<br />
eines geliebten Menschen) betonen.<br />
Die aufgeworfenen Fragen spitzen<br />
sich im weiteren Verlauf <strong>de</strong>r Sequenz<br />
in <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit einem<br />
literarischen Beispiel zu. Zwei Textausschnitte<br />
aus Philip Roth „Der<br />
menschliche Makel“ dramatisieren und<br />
vertiefen die vor <strong>de</strong>m eigenen Erfahrungshintergrund<br />
<strong>de</strong>r Schüler/-innen<br />
aufgeworfenen Fragen am Beispiel <strong>de</strong>s<br />
zum Gewalttäter gewor<strong>de</strong>nen Vietnam-<br />
Veteranen Lester Farley 19 . Der erste
Textausschnitt zeigt repräsentativ und<br />
eindrücklich, wie nicht verarbeitete,<br />
grausame Erfahrungen und Erinnerungen<br />
ein ganzes Leben in Gegenwart<br />
und Zukunft 20 beeinträchtigen, ja zerstören<br />
können. 21 Die Be<strong>de</strong>utung und<br />
Notwendigkeit von bewusster Erinnerung<br />
und Verarbeitung wird von <strong>de</strong>n<br />
Schüler/-innen aus diesem Textausschnitt<br />
selbst erschlossen wer<strong>de</strong>n. Im<br />
Sinne <strong>de</strong>s ent<strong>de</strong>cken<strong>de</strong>n Lernens sollten<br />
sie mit <strong>de</strong>n Textausschnitten ohne<br />
Vorinformation über <strong>de</strong>n Romankontext<br />
o<strong>de</strong>r historische Hintergrün<strong>de</strong> 22<br />
konfrontiert wer<strong>de</strong>n, könnte dies doch<br />
die Motivation unnötig bremsen.<br />
Folgen<strong>de</strong> Impulse könnten als Leseauftrag<br />
für die Erarbeitungsphase –<br />
etwa in Partnerarbeit – dienen: Beschreibt<br />
Lester Farleys Situation!<br />
Zeichnet die Entwicklung dahin in einzelnen<br />
Stationen (äußerlich/innerlich)<br />
23 nach! Die Empathie <strong>de</strong>r Schüler/-innen<br />
ansprechend, wer<strong>de</strong>n hier die<br />
inneren und äußeren Verletzungen eines<br />
Menschen, <strong>de</strong>r brutale Gewalt und<br />
Leid erlebt hat, dargestellt, was bei aller<br />
Unvergleichbarkeit <strong>de</strong>n Spuren vergangenen<br />
Leids und Unheils in <strong>de</strong>r Geschichte<br />
einer Gesellschaft bzw. <strong>de</strong>s<br />
Einzelnen in dieser Gesellschaft so<br />
weit nahe kommt, dass <strong>de</strong>n Schüler/-innen<br />
ein auch affektiver Zugang eröffnet<br />
wird zu <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>r Notwendigkeit<br />
und <strong>de</strong>s Sinns öffentlichen Ge<strong>de</strong>nkens,<br />
wie es bei <strong>de</strong>n von Libeskind entworfenen<br />
Bauwerken angestrebt ist.<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bearbeitung <strong>de</strong>s ersten<br />
Textausschnitts könnte als Transfer die<br />
Frage nach Perspektiven für Lester<br />
Farley aufgeworfen wer<strong>de</strong>n: Gibt es<br />
Hilfe für ihn? Wie könnte diese aussehen?<br />
Was müsste er o<strong>de</strong>r könnten an<strong>de</strong>re<br />
dazu beitragen? In <strong>de</strong>r Folgestun<strong>de</strong><br />
schlägt <strong>de</strong>r zweite Textausschnitt <strong>de</strong>n<br />
Bogen zu öffentlichen Ge<strong>de</strong>nkstätten,<br />
wie sie auf je eigene Weise auch die<br />
bei<strong>de</strong>n Libeskind-Entwürfe darstellen,<br />
wenn von <strong>de</strong>m jeweils ersten Besuch<br />
von Vietnam-Veteranen an <strong>de</strong>r „Memorial<br />
Wall“, die die Namen <strong>de</strong>r im Vietnam-Krieg<br />
gefallenen amerikanischen<br />
Soldaten verzeichnet, die Re<strong>de</strong> ist. 24<br />
Wie<strong>de</strong>rum sollte von <strong>de</strong>n Schüler/-in-<br />
nen selbstständig erschlossen wer<strong>de</strong>n,<br />
dass es sich bei <strong>de</strong>n beschriebenen Personen<br />
– wie bei Lester Farley – um Vietnam-Veteranen<br />
han<strong>de</strong>lt, die die Namen<br />
ihrer gefallenen Kamera<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r<br />
Wand und damit die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit eigener Vergangenheit suchen.<br />
An die als Einstieg vorgesehene<br />
Lektüre <strong>de</strong>s Textausschnitts schließt<br />
sich zunächst eine solche Situierung<br />
<strong>de</strong>r Szene sinnvoll an, bevor in vertiefen<strong>de</strong>r<br />
Reflexion die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r<br />
Ge<strong>de</strong>nkstätte für die Besucher erarbeitet<br />
wer<strong>de</strong>n soll. Die nur knapp, aber ergreifend<br />
beschriebenen Szenen zeigen,<br />
wie <strong>de</strong>r Ge<strong>de</strong>nkstein die eigene Trauer<br />
spiegelt (die Wand weint), verdrängte<br />
Schuldgefühle wachruft („da sollte<br />
mein Name stehen“), aber auch Versöhnung<br />
mit <strong>de</strong>m eigenen Überleben, <strong>de</strong>r<br />
eigenen Gegenwart anstößt („Ist schon<br />
gut, Lou. Schon okay.“). Nach<strong>de</strong>m diese<br />
Aspekte im Unterrichtsgespräch ver<strong>de</strong>utlicht<br />
wor<strong>de</strong>n sind, sollen die Schüler/-innen<br />
aufgefor<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n<br />
Textausschnitt zu ergänzen, in<strong>de</strong>m sie<br />
sich ausmalen, was – innerlich und/<br />
o<strong>de</strong>r äußerlich – bei Lester Farleys ersten<br />
Besuch an <strong>de</strong>r Ge<strong>de</strong>nkstätte geschieht.<br />
25 Bei <strong>de</strong>r Lösung dieser Aufgabenstellung<br />
wird die angesprochene<br />
Komplexität <strong>de</strong>r Romanfigur zum Tra-<br />
gen kommen und die Schüler/-innen<br />
wer<strong>de</strong>n exemplarisch versuchen nachzuempfin<strong>de</strong>n,<br />
welche Be<strong>de</strong>utung ein<br />
Ort <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens für <strong>de</strong>n Besucher<br />
haben kann. Die Teilnahme an öffentlichen<br />
Ge<strong>de</strong>nkveranstaltungen und das<br />
Aufsuchen von Ge<strong>de</strong>nksteinen u. ä. wird<br />
<strong>de</strong>n Schüler/-innen in <strong>de</strong>r Regel fremd<br />
sein, daher wird auf diese Weise ein<br />
Vorverständnis für die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>n architektonischen Entwürfen<br />
geschaffen.<br />
Steht die Sequenz zu Beginn eher<br />
unter <strong>de</strong>r Frage „Was be<strong>de</strong>utet Erinnerung/Ge<strong>de</strong>nken<br />
an öffentlichen Plätzen<br />
für <strong>de</strong>n Einzelnen?“, so soll im Weiteren,<br />
im Blick auf die bei<strong>de</strong>n Entwürfe<br />
Libeskinds, gefragt wer<strong>de</strong>n, wessen<br />
hier gedacht wer<strong>de</strong>n soll, auf welche<br />
(architektonisch verwirklichte) Weise<br />
die Bauwerke zur Erinnerung anregen<br />
wollen und welche Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Erinnerung<br />
jeweils für Gegenwart und<br />
angezielte Zukunft zugewiesen wird.<br />
Insofern bei<strong>de</strong> Entwürfe wie gezeigt einen<br />
Sinnhorizont aufzureißen suchen,<br />
wird im RU schließlich die jeweils unterschiedliche<br />
Be<strong>de</strong>utung bzw. Funktionalisierung<br />
religiöser Symbolik anzusprechen<br />
sein.<br />
Beim Jüdischen Museum sollte <strong>de</strong>r<br />
Zugang über <strong>de</strong>n für ein Museum her<br />
Nina und Daniel Libeskind im Jüdischen Museum Berlin © Stephan Schraps<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
175<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
176<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Kontrapunkt:<br />
Die Architektur von Daniel Libeskind<br />
Das Jüdische Museum Berlin ehrt<br />
seinen berühmten Architekten im September<br />
2003 mit einer Son<strong>de</strong>rausstellung.<br />
Das spektakuläre Jüdische Museum<br />
Berlin war sein erstes Bauprojekt.<br />
Mit <strong>de</strong>m zinkverklei<strong>de</strong>ten Zickzackbau,<br />
<strong>de</strong>r schon als leeres Gebäu<strong>de</strong><br />
hun<strong>de</strong>rttausen<strong>de</strong> von Menschen<br />
angezogen hat und eines <strong>de</strong>r herausragen<strong>de</strong>n<br />
Wahrzeichen Berlins ist,<br />
wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Architekt Daniel Libeskind<br />
international berühmt. Im Februar<br />
2003 wur<strong>de</strong> ihm das <strong>de</strong>rzeit weltweit<br />
bekannteste Bauprojekt übertragen:<br />
<strong>de</strong>r Masterplan für die Neubebauung<br />
von Ground Zero und <strong>de</strong>m<br />
World Tra<strong>de</strong> Center-Gelän<strong>de</strong>. Zu Ehren<br />
seines herausragen<strong>de</strong>n Architekten<br />
zeigt das Jüdische Museum Berlin<br />
in Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>m Barbican<br />
Centre, London, ab <strong>de</strong>m 10. September<br />
2003 auf über 600 Quadratmetern<br />
die Son<strong>de</strong>rausstellung „Kontrapunkt:<br />
Die Architektur von Daniel<br />
Libeskind“ (bis 14. Dezember 2003).<br />
Darin wer<strong>de</strong>n vierzehn seiner Projekte<br />
anhand von Mo<strong>de</strong>llen, Plänen,<br />
Zeichnungen, Filmen, Fotos und Audiomaterial<br />
vorgestellt. Daniel Libeskinds<br />
Mo<strong>de</strong>ll für Ground Zero und<br />
das World Tra<strong>de</strong> Center-Gelän<strong>de</strong><br />
wird erstmals in Deutschland zu sehen<br />
sein. Neben berühmten Gebäu<strong>de</strong>n<br />
wie <strong>de</strong>m Jüdischen Museum<br />
Berlin, <strong>de</strong>m Felix-Nussbaum-Haus in<br />
Osnabrück und <strong>de</strong>m Imperial War<br />
Museum North in Manchester wer<strong>de</strong>n<br />
auch Bauten präsentiert über die<br />
weniger publiziert wur<strong>de</strong> – wie das<br />
Atelierhaus Weil auf Mallorca – sowie<br />
noch in Planung befindliche Projekte<br />
wie die Konzerthalle „Musicon“<br />
in Bremen und die Spirale als<br />
Erweiterungsbau zum Victoria & Albert<br />
Museum in London. Seine Entwürfe<br />
für <strong>de</strong>n Potsdamer Platz, <strong>de</strong>n<br />
Alexan<strong>de</strong>rplatz und die Ge<strong>de</strong>nkstätte<br />
Sachsenhausen in Oranienburg blieben<br />
nicht realisierte Wettbewerbsbei-<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
unerwarteten Titel <strong>de</strong>s Entwurfs gesucht<br />
wer<strong>de</strong>n, etwa mit <strong>de</strong>m Eingangsimpuls:<br />
Beschreibt eure Erwartungen<br />
an ein Museum, <strong>de</strong>ssen architektonischer<br />
Entwurf <strong>de</strong>n Titel „Between the<br />
Lines“/„Zwischen <strong>de</strong>n Zeilen/Linien“<br />
(Tafelanschrieb) trägt. Die Schüler/-innen<br />
wer<strong>de</strong>n bereits vermuten, dass das<br />
Wesentliche eventuell gar nicht in <strong>de</strong>n<br />
wie auch immer gearteten Ausstellungsstücken<br />
o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Mauern <strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>s<br />
selbst, son<strong>de</strong>rn in irgen<strong>de</strong>iner Weise<br />
dazwischen zu fin<strong>de</strong>n sein wird. In<strong>de</strong>m<br />
so ein Vorverständnis geschaffen ist, erfahren<br />
die Schüler/-innen, dass es sich<br />
um <strong>de</strong>n Titel <strong>de</strong>s Jüdischen Museums in<br />
Das Jüdische Museum in Berlin<br />
Bauelement Be<strong>de</strong>utung<br />
Grundriss: Zickzacklinie<br />
Gewun<strong>de</strong>ne Linie<br />
Gebrochene, gera<strong>de</strong> Linie<br />
3 Achsen im Untergeschoss:<br />
• Achse <strong>de</strong>r Kontinuität<br />
• Achse <strong>de</strong>s Exils (aufsteigend)<br />
• Achse zum Holocaustturm/-<br />
Sackgasse<br />
Garten <strong>de</strong>s Exils und <strong>de</strong>r Emigration:<br />
• 49 Betonstelen ...<br />
• ... mit eingepflanzten Ölwei<strong>de</strong>n<br />
Muster im „Paul Celan-Hof“<br />
Leerräume („Voids“)<br />
Holocaust-Turm<br />
Berlin han<strong>de</strong>lt. Während <strong>de</strong>r anschließen<strong>de</strong>n<br />
Erarbeitungsphase sollen in arbeitsteiliger<br />
Gruppenarbeit (3 Gruppen<br />
a, b, c) die wichtigsten symbolischen<br />
Elemente <strong>de</strong>s Museumsbaus anhand eines<br />
möglichst bebil<strong>de</strong>rten Textblatts<br />
(s. M 2) o<strong>de</strong>r bevorzugt einer Internet-<br />
Recherche 26 unter <strong>de</strong>r Aufgabenstellung:<br />
„Benennt die wichtigsten symbolischen<br />
Elemente <strong>de</strong>s Museumsbaus und<br />
erläutert ihre Be<strong>de</strong>utung kurz!“ erarbeitet<br />
wer<strong>de</strong>n. Beim Zusammentragen <strong>de</strong>r<br />
Ergebnisse durch kurze Schülerreferate<br />
ggf. in Form von Powerpoint-Präsentationen<br />
könnte folgen<strong>de</strong>s Tafelbild entstehen:<br />
Blitz – rüttelt Berlin auf<br />
Zerborstener Davidstern – Leid <strong>de</strong>s<br />
jüdischen Volkes<br />
Austausch jüdischer/nichtjüdischer<br />
Bevölkerung<br />
Leere<br />
• Jüdisches Leben in Deutschland<br />
• Ju<strong>de</strong>n in Exil und Emigration<br />
• Holocaust<br />
•7 x 7; Zahlensymbolik 7. Schöpfungstag/Vollendung<br />
1948 Gründung d. Staates Israel<br />
(49. Stele = Berlin)<br />
• Hoffnung / Frie<strong>de</strong>n<br />
Wegspuren von Menschen; Geschichte<br />
von Menschen<br />
Holocaust; Verlust jüdischen Lebens;<br />
Platzhalter für getötete und nie geborene<br />
Ju<strong>de</strong>n<br />
Ge<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r jüdischer Opfer <strong>de</strong>s<br />
Holocaust
Im anschließen<strong>de</strong>n vertiefen<strong>de</strong>n Unterrichtsgespräch<br />
sollten folgen<strong>de</strong> Fragen<br />
erörtert wer<strong>de</strong>n: Welchen Stellenwert<br />
hat Erinnerung? Sie ist nicht nur Inhalt<br />
<strong>de</strong>s Ausstellungsteils <strong>de</strong>s Museums,<br />
son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>m Bau architektonisch gera<strong>de</strong>zu<br />
eingeschrieben. Wie verknüpft <strong>de</strong>r<br />
Museumsbau Vergangenheit und Zukunft<br />
miteinan<strong>de</strong>r? Hier kann vor allem<br />
die Beschreibung <strong>de</strong>r Achsen, von <strong>de</strong>nen<br />
eine in eine „noch unbestimmte Zukunft“<br />
führt, weiterhelfen. Wie könnte<br />
sich diese Verknüpfung auf die Gestaltung<br />
von Gegenwart und Zukunft in<br />
Berlin/Deutschland/Europa auswirken?<br />
Der Bau verpflichtet gera<strong>de</strong>zu zum Einsatz<br />
für eine humane Gesellschaft und<br />
Lebenswelt. Was bringt die Verknüpfung<br />
<strong>de</strong>r drei Zeitebenen im Hinblick<br />
auf die Opfer? Sie wer<strong>de</strong>n nicht nur als<br />
unschuldig Ermor<strong>de</strong>te, son<strong>de</strong>rn auch als<br />
die Träger eines ungeheuren kulturellen,<br />
ja gesellschaftlichen Reichtums dargestellt;<br />
ihr schmerzhafter Verlust bleibt<br />
aber als Wun<strong>de</strong>, als „Leere“ spürbar,<br />
<strong>de</strong>nnoch beinhalten etwa die Zukunftsebene<br />
<strong>de</strong>r Achse <strong>de</strong>r Kontinuität o<strong>de</strong>r<br />
die Ölwei<strong>de</strong>n auch eine Hoffnungsperspektive.<br />
Die Schüler/-innen sollen dieses<br />
Miteinan<strong>de</strong>r von Trauer und Hoffnung<br />
und die daraus erwachsen<strong>de</strong> Dynamik<br />
für die verantwortliche Gestaltung<br />
einer humanen Zukunft erspüren.<br />
Zum Abschluss <strong>de</strong>r Beschäftigung<br />
mit <strong>de</strong>m Jüdischen Museum soll <strong>de</strong>n<br />
Schüler/-innen die religiöse Dimension<br />
<strong>de</strong>s Baus noch einmal in einer Phase <strong>de</strong>r<br />
Metareflexion explizit ver<strong>de</strong>utlicht wer<strong>de</strong>n.<br />
Dazu dient das folgen<strong>de</strong> Libeskind-<br />
Zitat, <strong>de</strong>ssen Be<strong>de</strong>utung die Schüler/-innen<br />
erschließen sollen, als Einstiegsimpuls:<br />
„Das Jüdische Museum ist als ein<br />
Bau konzipiert, in <strong>de</strong>m das Unsichtbare<br />
und das Sichtbare die strukturellen Merkmale<br />
bil<strong>de</strong>n ... in einer Architektur ..., <strong>de</strong>r<br />
das Namenlose einbeschrieben ist wie<br />
ein Name, <strong>de</strong>r stumm bleibt.“ Über die<br />
Gegensatzpaare Sichtbar – Unsichtbar/<br />
Namenlos – Namen können die Schüler/-innen<br />
<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Zitats näherkommen.<br />
Zwar sind auf einer ersten,<br />
von Libeskind angegebenen Deutungsebene<br />
das Unsichtbare, die Namenlosen,<br />
die im Holocaust vernichteten Ju-<br />
<strong>de</strong>n und mit ihnen ihr kultureller Reichtum<br />
sichtbar gewor<strong>de</strong>n, aber auch ihre<br />
nie geborenen Nachfahren, was die<br />
Schüler/-innen aufgrund ihrer Vorarbeit<br />
erschließen können. Hinter dieser konkreten<br />
Ebene verbirgt sich aber eine<br />
zweite, die die Schüler/-innen im Unterrichtsgespräch<br />
je nach Vorwissen durch<br />
geeignete Lehrer-Impulse o<strong>de</strong>r -Informationen<br />
gelenkt ent<strong>de</strong>cken können: Der<br />
Unsichtbare schlechthin ist in <strong>de</strong>r jüdischen<br />
Tradition Gott, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>nnoch als<br />
Urgrund <strong>de</strong>r Geschichte und als <strong>de</strong>r sich<br />
in ihr Offenbaren<strong>de</strong> geglaubt wird. Ein<br />
„Name, <strong>de</strong>r stumm bleibt“, ist ein Paradox<br />
wie etwa <strong>de</strong>r „brennen<strong>de</strong> Dornbusch,<br />
<strong>de</strong>r nicht verbrennt“. Auch <strong>de</strong>r<br />
„Gottesname“ im Ersten Testament<br />
„JAHWE / Ich bin da“, ist letztlich kein<br />
fassbarer Name, keine greifbare Bezeichnung<br />
o<strong>de</strong>r Zuschreibung an <strong>de</strong>n,<br />
<strong>de</strong>r sich letztlich als Verborgener offenbart.<br />
Die Voids als Platzhalter dieses<br />
„Namenlosen“, „Unsichtbaren“ symbolisieren<br />
die Trauer im ehrfürchtigen Ge<strong>de</strong>nken<br />
<strong>de</strong>r Opfer. So dunkel und kahl<br />
die „Voids“ auch sind, in diese Klage<br />
mischt sich zugleich eine Hoffnung auf<br />
<strong>de</strong>n verborgen offenbaren Namenlosen<br />
schlechthin, ohne diesen konkret fassen<br />
zu können o<strong>de</strong>r zu wollen.<br />
Als stummer Impuls zum Einstieg in<br />
die Beschäftigung mit <strong>de</strong>m Libeskind-<br />
Entwurf für ein neues World Tra<strong>de</strong> Center<br />
bietet sich eine Projektion <strong>de</strong>r Skyline<br />
<strong>de</strong>s Mo<strong>de</strong>lls von <strong>de</strong>r New Yorker<br />
Freiheitsstatue aus gesehen an. Nach einer<br />
zunächst stillen Betrachtung sollen<br />
die Schüler/-innen in einem kurzen Gespräch<br />
die Hintergrün<strong>de</strong> dieser Darstellung<br />
rekapitulieren: die Anschläge vom<br />
11. September als eine neue Dimension<br />
von Terrorakten mit tausen<strong>de</strong>n To<strong>de</strong>sopfern<br />
u. a. bei <strong>de</strong>r Zerstörung <strong>de</strong>r Twin<br />
Towers <strong>de</strong>s World Tra<strong>de</strong> Centers mit ihren<br />
politischen und gesellschaftlichen<br />
Folgen. Anschließend wer<strong>de</strong>n sie aufgefor<strong>de</strong>rt,<br />
einen Titel für das projizierte Mo<strong>de</strong>ll<br />
einer Neubebauung zu suchen und in<br />
<strong>de</strong>n Himmel über <strong>de</strong>r Skyline zu schreiben.<br />
Dazu muss das Bild auf ein leeres<br />
Plakat projiziert wer<strong>de</strong>n, so dass die<br />
Schüler/-innen nach vorn kommen und<br />
dieses beschriften können. 27 Im An-<br />
träge und zeigen die Vision <strong>de</strong>s Architekten<br />
für Berlin und die Erinnerungskultur<br />
in Deutschland.<br />
Daniel Libeskind – <strong>de</strong>r Visionär,<br />
<strong>de</strong>r mit seinem multidisziplinären Ansatz<br />
neue Wege in <strong>de</strong>r Architektur beschreitet<br />
und einen neuen kritischen<br />
Diskurs in <strong>de</strong>r Architektur inspiriert<br />
hat, <strong>de</strong>r stets Kontrapunkte setzt. Sein<br />
philosophischer Ansatz bezieht Architektur<br />
und Stadtplanung auf ihre<br />
gesellschaftliche Funktion und entwickelt<br />
sie im steten Dialog mit <strong>de</strong>n<br />
Menschen weiter. Er ist ein Musiker,<br />
<strong>de</strong>r sich von Bach über Schönberg<br />
bis zu Messiaen inspirieren lässt und<br />
im vergangenen Sommer erstmals eine<br />
Oper inszenierte, „Saint Francois<br />
d’Assise“ an <strong>de</strong>r Deutschen Oper in<br />
Berlin. Der Weltbürger und Brückenbauer:<br />
Daniel Libeskind wur<strong>de</strong> in<br />
Polen geboren und ist auch in Israel<br />
und <strong>de</strong>n USA aufgewachsen, wo er<br />
die amerikanische Staatsbürgerschaft<br />
angenommen hat. In Berlin hat er<br />
dreizehn Jahre lang gelebt und ist vor<br />
kurzem mit seiner Frau Nina und<br />
Tochter Rachel nach New York umgezogen.<br />
Die Werke, I<strong>de</strong>en und das Leben<br />
<strong>de</strong>s Daniel Libeskind können Besucher<br />
ab <strong>de</strong>m 10. September in „Kontrapunkt:<br />
Die Architektur von Daniel<br />
Libeskind“ im Jüdischen Museum<br />
Berlin kennenlernen. Die Ausstellung<br />
entsteht in Zusammenarbeit mit Barbican<br />
Art Galleries, London. Eine<br />
größere Ausstellung, die weitere Projekte<br />
präsentiert, wird in <strong>de</strong>r Barbican<br />
Gallery vom 16. September bis<br />
zum 23. Dezember 2004 gezeigt, und<br />
wird anschließend an weiteren Ausstellungsorten<br />
in Europa und <strong>de</strong>n Vereinigten<br />
Staaten zu sehen sein.<br />
Wann: Vom 10. September 2003<br />
bis 14. Dezember 2003<br />
Wo: Jüdisches Museum Berlin<br />
Altbau<br />
Ausstellungsräume 1.OG<br />
Lin<strong>de</strong>nstr. 9-14<br />
10969 Berlin<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
177<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
178<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
schluss sollen sie anhand eines Arbeitsblattes<br />
(M 3), das wesentliche Teile <strong>de</strong>s<br />
Libeskind-Entwurfs skizziert, diesen näher<br />
kennen lernen und die symbolische<br />
Be<strong>de</strong>utung o<strong>de</strong>r Wirkung <strong>de</strong>r aufgeführten<br />
Elemente in Partner- o<strong>de</strong>r Gruppenarbeit<br />
durch Austausch untereinan<strong>de</strong>r erschließen<br />
und zunächst auf <strong>de</strong>m Arbeitsblatt<br />
ergänzen. Zur Ergebnissicherung<br />
sollte wie<strong>de</strong>rum für je<strong>de</strong>s Element ein<br />
Plakat bereitgehalten wer<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>m in<br />
<strong>de</strong>r Mitte das jeweilige Bauelement benannt<br />
ist, so dass die Schüler/-innen die<br />
Ergebnisse ihrer Gruppen- o<strong>de</strong>r Partnerarbeit<br />
rundherum ergänzen können. Auf<br />
diese Weise entstehen im Unterricht 7<br />
Plakate („Titel“ 28 und „Bauelemente“),<br />
die wesentliche Elemente <strong>de</strong>s Entwurfs<br />
repräsentieren und darüber hinaus <strong>de</strong>ren<br />
Wirkung auf bzw. <strong>de</strong>ren Be<strong>de</strong>utung für<br />
die Schüler/-innen zeigen – gleichsam<br />
als Spiegel und Vorwegnahme <strong>de</strong>ssen,<br />
was ein zukünftiger Besucher <strong>de</strong>s neuen<br />
WTC empfin<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>nken könnte.<br />
Die eigenen Deutungsvorschläge <strong>de</strong>r<br />
Schüler/-innen sollten mit <strong>de</strong>n Interpretationen<br />
<strong>de</strong>s Architekten selbst verglichen<br />
wer<strong>de</strong>n, wozu sich wie<strong>de</strong>rum eine<br />
Internet-Recherche 29 anbietet, zumal die<br />
Schüler/-innen auf diese Weise weitere<br />
Eindrücke durch Bildmaterial erhalten<br />
können. Der Suchauftrag könnte lauten:<br />
Fin<strong>de</strong>t heraus, welche Be<strong>de</strong>utung Libeskind<br />
selbst <strong>de</strong>n wesentlichen Elementen<br />
seines Entwurfs zuschreibt und welche<br />
Grundaussagen er mit diesem verbin<strong>de</strong>t!<br />
Die Ergebnisse 30 können – vorzugsweise<br />
in einer eigenen Farbe – auf <strong>de</strong>n<br />
bereits erstellten Plakaten ergänzt und<br />
so gesichert wer<strong>de</strong>n. Dabei muss darauf<br />
geachtet wer<strong>de</strong>n, dass die Ergänzung <strong>de</strong>r<br />
Libeskind-Aussagen nicht als Verifizierung<br />
o<strong>de</strong>r Falsifizierung <strong>de</strong>r zuvor gesammelten<br />
Schülerbeiträge missverstan<strong>de</strong>n<br />
wird, <strong>de</strong>nn ein Bauwerk o<strong>de</strong>r in diesem<br />
Fall sein Entwurf will ja auf seinen<br />
Betrachter wirken, ohne dass dieser zunächst<br />
die Grundgedanken <strong>de</strong>s Architekten<br />
studiert hat. Daher haben die<br />
Schülereindrücke bei <strong>de</strong>r Ergebnissicherung<br />
dieselbe Berechtigung wie die<br />
Aussagen <strong>de</strong>s Architekten; bei<strong>de</strong>s verbin<strong>de</strong>t<br />
sich zu einem perspektivenreichen<br />
Gesamteindruck.<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Bei <strong>de</strong>r Beurteilung <strong>de</strong>s Entwurfs<br />
sollen die Schüler/-innen die eigenen<br />
Eindrücke durchaus kritisch mit Libeskinds<br />
Intentionen vergleichen. 31 Wie<strong>de</strong>rum<br />
sollen sie fragen, welchen Stellenwert<br />
die Erinnerung in <strong>de</strong>m Entwurf<br />
einnimmt und wie Vergangenheit und<br />
Zukunft hier miteinan<strong>de</strong>r verknüpft wer<strong>de</strong>n.<br />
Deutlich gewor<strong>de</strong>n ist, dass die Spuren<br />
<strong>de</strong>r schrecklichen Attentate offengehalten<br />
und <strong>de</strong>r Opfer gedacht wer<strong>de</strong>n<br />
soll, dass aber daraus zugleich <strong>de</strong>r Mut<br />
für ein noch größeres Bauwerk und damit<br />
das auch bei <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>r Zukunft<br />
<strong>de</strong>monstrative Festhalten an <strong>de</strong>n traditionellen,<br />
am 11. September 2001 mit<br />
angegriffenen Werten erwachsen soll.<br />
Zur Einleitung <strong>de</strong>r Metareflexion<br />
sollen die Schüler/-innen schließlich<br />
– am besten durch Projektion auf <strong>de</strong>m<br />
OHP – mit folgen<strong>de</strong>m, oben bereits erwähnten<br />
Libeskind-Zitat konfrontiert<br />
wer<strong>de</strong>n:<br />
„Diese aufregen<strong>de</strong> Architektur<br />
mit <strong>de</strong>m Museum, <strong>de</strong>r Lower-<br />
Manhattan Zugstation, Hotels,<br />
einem Theater, Büros, Geschäften<br />
und Restaurants wird die<br />
Auferstehung <strong>de</strong>s Lebens symbolisieren<br />
und zeigen, dass wir voll<br />
und ganz zu New York stehen.“ 32<br />
Kritisch sollen die Schüler/-innen<br />
die Verwendung religiöser Sprache analysieren<br />
– weitere Beispiele dafür (s. o.)<br />
könnten ins Unterrichtsgespräch einfließen<br />
– und <strong>de</strong>ren Funktion beschreiben.<br />
Ein<strong>de</strong>utig wer<strong>de</strong>n hier bloße Vorläufigkeiten<br />
bzw. Vergängliches wie Hotels,<br />
Theater, Büros, Geschäfte zum Symbol<br />
für Absolutes, nämlich <strong>de</strong>r Auferstehung<br />
<strong>de</strong>s Lebens, <strong>de</strong>m endgültigen Sieg <strong>de</strong>s<br />
Lebens über <strong>de</strong>n Tod, hochstilisiert. Das<br />
angegebene Ziel, <strong>de</strong>n rückhaltlosen Beistand<br />
für New York zu <strong>de</strong>monstrieren,<br />
macht die Funktionalisierung religiöser<br />
Symbolik im Dienste rein politischer Interessen<br />
<strong>de</strong>utlich. Wie schon das Bild<br />
<strong>de</strong>r Skyline von <strong>de</strong>r New Yorker Freiheitsstatue<br />
aus betrachtet nahe legt, geht<br />
es Libeskind um eine Hoffnungsperspektive<br />
für das amerikanische Volk, die<br />
sich ganz aus <strong>de</strong>r Rückbesinnung auf tra-<br />
ditionelle amerikanische Werte speist. 33<br />
Kritisch sollen die Schüler/-innen durch<br />
geeignete Impulsfragen motiviert hinterfragen,<br />
welchen Halt und welchen<br />
Trost in existentiellen Lebensfragen – etwa<br />
bei <strong>de</strong>r Trauer <strong>de</strong>r Angehörigen um<br />
die Opfer – eine solche Sinngebung verspricht<br />
und bieten kann. Diese sehr konkrete<br />
Sinnzuschreibung sollte abschließend<br />
verglichen wer<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n<br />
„Voids“ <strong>de</strong>s Jüdischen Museums angelegten<br />
und mit <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>s Ju<strong>de</strong>ntums<br />
verbun<strong>de</strong>nen Hoffnungsperspektive,<br />
die ein Absolutes glaubt, auch<br />
wenn ein Sinn vorläufig nicht beschreib-<br />
o<strong>de</strong>r erkennbar ist.<br />
Die Sequenz macht die Schüler/-innen<br />
mit <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n unterschiedlichen Libeskind-Entwürfen<br />
bekannt, eröffnet ihnen<br />
ein Gespür für die Be<strong>de</strong>utung von Erinnerung<br />
und Ge<strong>de</strong>nken und sensibilisiert<br />
sie zugleich für die in <strong>de</strong>r jeweiligen<br />
Art <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens enthaltenen<br />
Selbstaussagen. Damit wer<strong>de</strong>n sie angeregt,<br />
eine eigene Erinnerungs-Kultur<br />
– sowohl im privaten wie im öffentlichen<br />
Bereich – bewusst und verantwortlich<br />
mitzugestalten.<br />
Anmerkungen<br />
01 Dieses soll auf vier Etagen mit Fotos, Vi<strong>de</strong>os und Dokumenten<br />
die Terrorangriffe dokumentieren und zugleich<br />
die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r Freiheit unter sozialem, ökonomischem<br />
und politischem Blickwinkel im nationalen<br />
und internationalen Rahmen ergrün<strong>de</strong>n. (Vgl. FAZ<br />
2.04.2003, Nr. 78, 37).<br />
02 Spiegel 52/2002, 163.<br />
03 Das Jüdische Museum ist als Erweiterungsbau <strong>de</strong>s<br />
Berliner Stadtmuseums angelegt.<br />
04 Der Holocaust-Überleben<strong>de</strong> Eli Wiesel hat darauf<br />
hingewiesen, dass <strong>de</strong>r Verlust <strong>de</strong>r Erinnerung mit einem<br />
Verlust <strong>de</strong>s Seins einhergehe, und so die Dringlichkeit<br />
<strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens <strong>de</strong>r Opfer <strong>de</strong>s Nationalsozialismus<br />
betont.<br />
05 Das Zitat ist entnommen aus: Heuser, A. Das abwesend<br />
Präsente. Daniel Libeskinds Jüdisches Museum<br />
in Berlin, in: Meditation, Zeitschrift für christliche Spiritualität<br />
und Lebensgestaltung, 4/2001, Mainz 2001.<br />
06 Zur Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s öffentlichen Ge<strong>de</strong>nkens, <strong>de</strong>m im<br />
weitesten Sinne auch die hier beschriebenen architektonischen<br />
Bauwerke zugerechnet wer<strong>de</strong>n dürfen,<br />
zumal Libeskind u. a. die Einrichtung von festgelegten<br />
öffentlichen Ge<strong>de</strong>nkveranstaltungen zum 11. September<br />
in seinem Entwurf ausdrücklich anregt, siehe<br />
<strong>de</strong>n Beitrag von H. Dörnemann in diesem Heft.<br />
07 Es ist kritisch zu hinterfragen, warum die unschuldigen<br />
Opfer <strong>de</strong>r Attentate zu Hel<strong>de</strong>n stilisiert und im<br />
„Park of Heroes“ als solche verehrt wer<strong>de</strong>n. Dies
scheint im Dienst <strong>de</strong>s amerikanischen Nationalstolzes<br />
zu geschehen. Die Deutung <strong>de</strong>r Opfer als Hel<strong>de</strong>n,<br />
die ihr Leben im Dienste <strong>de</strong>r Nation, <strong>de</strong>r traditionellen<br />
Werte <strong>de</strong>r amerikanischen Gesellschaft und<br />
Demokratie verloren haben, vermittelt die Vorstellung<br />
eines politisch-eschatologischen Sinnhorizonts,<br />
in <strong>de</strong>m die Verstorbenen, aber auch die Leben<strong>de</strong>n<br />
aufgehoben zu sein scheinen. Ganz an<strong>de</strong>rs die Architektur<br />
<strong>de</strong>s ‚Namenlosen’, <strong>de</strong>r „Voids“ im Jüdischen<br />
Museum Berlin (s. u.).<br />
08 Vgl. Heuser, A. a.a.O.<br />
09 Ebd.<br />
10 Spiegel 52/2002, 163.<br />
11 FAZ 28.02.2003, Nr. 50, 37.<br />
12 Ebd.<br />
13 Daniel Libeskind in einem Interview in: Brücken-<br />
bauer, Nr. 6, 4.2.2003.<br />
14 Vgl. ebd.<br />
15 Die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>r Architektur <strong>de</strong>s Jüdischen<br />
Museums Berlin könnte beim Thema Gottesfrage<br />
zu<strong>de</strong>m einen herausfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Zugang zu<br />
jüdischer Spiritualität bieten.<br />
16 Zur Erarbeitung <strong>de</strong>s Libeskind-Entwurfs zum Jüdischen<br />
Museum Berlin sind gewisse historische Kenntnisse<br />
(Ju<strong>de</strong>n im Exil, Nationalsozialismus, Holocaust,<br />
Gründung <strong>de</strong>s Staates Israel) vorauszusetzen, die<br />
i.d.R. im Geschichtsunterricht <strong>de</strong>r 10. Klasse erworben<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
17 1. Baustein: Grönemeyer/ca. 1 Std.; 2. Baustein: Philip<br />
Roth (fakultativ)/ca. 2 Std.; 3. Baustein: Jüdisches<br />
Museum/ca. 2-3 Std.; 4. Baustein: „Gar<strong>de</strong>ns of the<br />
World“/ca. 2-3 Std.<br />
18<br />
In diesem nach <strong>de</strong>m Tod seiner Frau entstan<strong>de</strong>nen<br />
Song mit <strong>de</strong>r scheinbar zusammenhanglos wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong>n<br />
Zeile „du fehlst“ betont Grönemeyer zunächst<br />
die Gegenwart (momentan ist richtig/momentan<br />
ist gut/nichts ist wirklich wichtig/nach <strong>de</strong>r<br />
Ebbe kommt die Flut ... und <strong>de</strong>r Mensch heißt<br />
Mensch,/weil er vergisst, weil er verdrängt), erst <strong>de</strong>r<br />
fortlaufen<strong>de</strong> Text integriert das Vergangene, das<br />
durch <strong>de</strong>n schmerzhaft empfun<strong>de</strong>nen Verlust „du<br />
fehlst“ ohnehin präsent bleibt (oh, es ist schon ok/es<br />
tut gleichmäßig weh ... und <strong>de</strong>r Mensch heißt<br />
Mensch,/weil er erinnert, weil er kämpft/und weil er<br />
hofft und weil er liebt/weil er mitfühlt und vergibt).<br />
Den gesamten Text fin<strong>de</strong>t man auf <strong>de</strong>r CD o<strong>de</strong>r z. B.<br />
unter www.lyriks.<strong>de</strong> unter <strong>de</strong>m Link ‚Songtexte’.<br />
19 Die Figur besitzt eine gewisse Komplexität, da es<br />
sich zum einen um ein Opfer han<strong>de</strong>lt, da Lester unter<br />
<strong>de</strong>n Erfahrungen <strong>de</strong>s Krieges so lei<strong>de</strong>t, dass ihm<br />
ein „normales“ Weiterleben unmöglich ist. Zum an<strong>de</strong>ren<br />
ist er im Krieg aber auch zum Täter gewor<strong>de</strong>n<br />
und neigt später auch weiterhin zu Gewalttätigkeit.<br />
Dieser Aspekt bietet keinen Vergleichspunkt zu <strong>de</strong>n<br />
bei<strong>de</strong>n Libeskind-Entwürfen, die im weiteren Verlauf<br />
<strong>de</strong>r Sequenz behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n sollen. Die Figur Lester<br />
Farley transzendiert also die Schülerwelt in hohem<br />
Maße, <strong>de</strong>nnoch kann aus ihrer Perspektive ein<br />
persönlicher Zugang zu öffentlichen Ge<strong>de</strong>nkplätzen<br />
eröffnet wer<strong>de</strong>n (s. u.).<br />
20 Bemerkenswert in diesem Zusammenhang sind Formulierungen<br />
wie: „eben noch, ... gestern noch, ... und<br />
einen Tag später, ... und jetzt“, in <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>utlich wird,<br />
wie sehr das Vergangene die Gegenwart und auch<br />
die Zukunft – hier <strong>de</strong>s Einzelnen – prägt; ein Gedan-<br />
21<br />
ke, <strong>de</strong>n auch Libeskind im Hintergrund seiner Bauwerke<br />
verankert.<br />
Im Roman zerbricht die von Lester gegrün<strong>de</strong>te Familie,<br />
seine Kin<strong>de</strong>r sterben bei einem tragischen Unfall<br />
und er selbst wird immer wie<strong>de</strong>r gewalttätig – <strong>de</strong>r Ich-<br />
Erzähler schreibt ihm sogar einen Doppelmord zu.<br />
22 Diese können bei <strong>de</strong>r Besprechung im Anschluss an<br />
die Lektüre nachgeliefert wer<strong>de</strong>n.<br />
23<br />
Folgen<strong>de</strong> Tafelnotiz könnte beim Zusammentragen<br />
<strong>de</strong>r Ergebnisse entstehen:<br />
Entwicklung von Lester Farley<br />
Jugend in <strong>de</strong>n Berkshires viele Freun<strong>de</strong>,<br />
unauffällige Hobbies<br />
Erster Einsatz in Vietnam Konfrontation mit brutaler<br />
Gewalt, Verrohung, eigene<br />
Gewalttaten im Krieg<br />
Erste Heimkehr Isolation, stößt auf Ablehnung<br />
Zweiter Einsatz in Vietnam Bewusstes Aufsuchen von<br />
brutalen Grenzerfahrungen;<br />
fortschreiten<strong>de</strong> Verrohung<br />
Rückkehr lebt in eigener Welt, mei<strong>de</strong>t<br />
an<strong>de</strong>re, aggressiv,<br />
ängstlich<br />
24<br />
25<br />
Im Roman han<strong>de</strong>lt es sich um eine transportable<br />
Kopie <strong>de</strong>s Originals in Washington D. C., was bei <strong>de</strong>r<br />
Behandlung im Rahmen dieser Sequenz aber unerheblich<br />
ist.<br />
Im Roman empfin<strong>de</strong>t Lester Farley entgegen seinen<br />
eigenen Erwartungen und Hoffnungen nichts, was<br />
seine Depression – und damit letztlich seine Gesamtsituation<br />
– verschlimmert. Dieser Romanhintergrund<br />
kann aber wie<strong>de</strong>rum vernachlässigt wer<strong>de</strong>n,<br />
geht es doch vielmehr darum, <strong>de</strong>n Schüler/-innen<br />
einen persönlichen, affektiven Zugang zu <strong>de</strong>m ihnen<br />
voraussichtlich von ihrer Erfahrungswelt eher<br />
fernliegen<strong>de</strong>n Thema „Öffentliches Ge<strong>de</strong>nken“/„Bauwerke<br />
<strong>de</strong>r Erinnerung“ zu eröffnen.<br />
26 Der unersetzbare Besuch <strong>de</strong>s Museums selbst wird<br />
in <strong>de</strong>n wenigsten Fällen zu realisieren sein; vor einer<br />
anstehen<strong>de</strong>n Klassen-/Kursfahrt nach Berlin wäre<br />
dieser Unterrichtsbaustein aber in je<strong>de</strong>m Fall sinnvoll.<br />
Ergänzend zum Text sollten <strong>de</strong>n Schüler/-innen<br />
visuelle Eindrücke mit Hilfe von Fotos/Planzeichnungen<br />
vermittelt wer<strong>de</strong>n, etwa über die Homepage<br />
<strong>de</strong>s Jüdischen Museums www.jmberlin.<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r eine<br />
Suche z. B. über www.google.<strong>de</strong>. Über das Internet<br />
könnten zusätzlich auch Informationen über <strong>de</strong>n<br />
Architekten selbst recherchiert wer<strong>de</strong>n (alternativ<br />
dazu die Kurzinfo im Materialteil). Eine anschließen<strong>de</strong><br />
Darbietung <strong>de</strong>r Gruppenarbeitsergebnisse in<br />
Form einer Powerpoint-Präsentation mit eingefügten<br />
Bil<strong>de</strong>rn sollte, wenn es technisch möglich ist, unbedingt<br />
realisiert wer<strong>de</strong>n, zumal so die Medienkompetenz<br />
<strong>de</strong>r Schüler/-innen geschult wird.<br />
27 Denkbar sind Titel wie „Hoch hinaus“, „Amerika<br />
bleibt stark“ , „Wir lassen uns nicht unterkriegen“ ...,<br />
die einen ersten Eindruck <strong>de</strong>r neu entworfenen Skyline<br />
wi<strong>de</strong>rspiegeln, in die die Wettbewerbsteilnehmer<br />
um die Neubebauung <strong>de</strong>s WTC einen <strong>de</strong>utlichen<br />
Akzent setzen sollten.<br />
28 Auf dieses Plakat könnte bei <strong>de</strong>r Vertiefung <strong>de</strong>r gesicherten<br />
Ergebnisse im Unterrichtsgespräch <strong>de</strong>r Titel<br />
„Gar<strong>de</strong>ns of the World“ ergänzt wer<strong>de</strong>n.<br />
29 Alternativ, aber weniger motivierend könnte ein Interview<br />
mit Libeskind als Textblatt verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n,<br />
z. B. in: Der Spiegel 4/2003, S. 146ff., auch online herunterzula<strong>de</strong>n.<br />
30 Die Recherche-Ergebnisse <strong>de</strong>r Schüler/-innen wer<strong>de</strong>n<br />
im Wesentlichen mit <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Einleitung dieses Beitrags<br />
zu fin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Informationen übereinstimmen.<br />
31 In dieser Unterrichtsphase könnte beispielsweise<br />
u. a. hinterfragt wer<strong>de</strong>n, warum die Opfer zu „Hel<strong>de</strong>n“<br />
wer<strong>de</strong>n (s. o.).<br />
32 Daniel Libeskind in einem Interview in: Brücken-<br />
bauer, Nr. 6, 4.2.2003.<br />
33 Vgl. dazu u. a. auch seine Deutung <strong>de</strong>r erhalten gebliebenen<br />
Bo<strong>de</strong>nwannen (s. o.).<br />
Ute Lonny-Platzbecker (geb. 1967) ist<br />
Studienrätin für Katholische Religion,<br />
Deutsch und Biologie am Gutenberg<br />
Gymnasium in Bergheim/Erft.<br />
Literatur (außer <strong>de</strong>n oben genannten Artikeln)<br />
Heuser, August: Das abwesend Präsente. Daniel Libeskinds<br />
Jüdisches Museum in Berlin, in: Meditation, Zeitschrift<br />
für christliche Spiritualität und Lebensgestaltung,<br />
4/2001, Mainz 2001.<br />
Jüdisches Museum Berlin, Stadtwan<strong>de</strong>l Verlag, Berlin 2000.<br />
Libeskind, Daniel: Vortrag an <strong>de</strong>r Universität Hannover<br />
vom 5.12.1989, nach: www.archinform.<strong>de</strong>.<br />
Wendland, Johannes: Der totale Bruch, in: DS (Deutsches<br />
Allgemeines Sonntagsblatt) 29.1.1999.<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
179<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
180<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Materialien:<br />
M 1<br />
Der Zusammenstoß mit ... einem<br />
Milchfarmer, <strong>de</strong>r nicht Pleite machen<br />
wollte, aber <strong>de</strong>nnoch Pleite gemacht<br />
hatte, einem Straßenarbeiter, <strong>de</strong>r sein<br />
Bestes für seine Heimatstadt gab, ganz<br />
gleich, wie unwürdig und erniedrigend<br />
die ihm zugeteilte Arbeit war, einem<br />
guten Amerikaner, <strong>de</strong>r für sein Land<br />
nicht bloß eine, son<strong>de</strong>rn zwei Dienstzeiten<br />
geleistet hatte ... Der sich noch<br />
mal gemel<strong>de</strong>t hatte und rübergegangen<br />
war, <strong>de</strong>nn nach <strong>de</strong>m ersten Mal sagten<br />
alle, dass er nicht mehr <strong>de</strong>rselbe war<br />
und dass sie ihn gar nicht wie<strong>de</strong>rerkannten,<br />
und er merkte, dass es stimmte: Sie<br />
hatten alle Angst vor ihm. Er kehrt aus<br />
<strong>de</strong>m Dschungelkrieg nach Hause zurück<br />
und wird nicht nur nicht geehrt,<br />
son<strong>de</strong>rn sogar gefürchtet – also kann er<br />
eigentlich genauso gut wie<strong>de</strong>r rübergehen.<br />
... Beim ersten Mal war er noch<br />
nicht so scharf auf action. Beim ersten<br />
Mal war er <strong>de</strong>r nette Les, <strong>de</strong>r noch nicht<br />
wusste, was Hoffnungslosigkeit ist. Beim<br />
ersten Mal war er <strong>de</strong>r Junge aus <strong>de</strong>n<br />
Berkshires, <strong>de</strong>r viel Vertrauen zu an<strong>de</strong>ren<br />
Leuten und keine Ahnung hatte, wie<br />
billig ein Leben sein kann, <strong>de</strong>r nicht<br />
wusste, was Pillen aus einem machen<br />
können, <strong>de</strong>r sich keinem unterlegen<br />
fühlte, <strong>de</strong>r unbekümmerte Les, keine<br />
Gefahr für die Gesellschaft, je<strong>de</strong> Menge<br />
Freun<strong>de</strong>, schnelle Autos, das ganze<br />
Programm. Beim ersten Mal hatte er<br />
Ohren abgeschnitten, weil er eben da<br />
war und weil man das eben machte,<br />
aber das war´s dann auch. Er war keiner<br />
von <strong>de</strong>nen, die es, als man sie in dieser<br />
Gesetzlosigkeit abgela<strong>de</strong>n hatte, gar<br />
nicht erwarten konnten, endlich loszulegen,<br />
keiner von <strong>de</strong>nen, die von vornherein<br />
nicht so gut beieinan<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r<br />
ziemlich aggressiv waren und bloß auf<br />
eine Gelegenheit warteten, um richtig<br />
durchzudrehen. ... Aber beim zweiten<br />
Mal war er auch durchgedreht. ... beim<br />
zweiten Mal schießt er alles kurz und<br />
klein. Was das Zeug hält, immer an <strong>de</strong>r<br />
Grenze zwischen Leben und Tod, voll<br />
Angst und Erregung, und im Zivilleben<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
gibt es nichts, was da mithalten kann. ...<br />
aber dann kommt er nach Hause, und es<br />
ist nicht besser als beim ersten Mal,<br />
nein, es ist schlimmer. ... Eben noch war<br />
er Hubschrauber-Türschütze in Vietnam,<br />
hat Hubschrauber explodieren sehen,<br />
mitten in <strong>de</strong>r Luft, und seine Kumpels<br />
sind durch die Luft geschleu<strong>de</strong>rt wor<strong>de</strong>n,<br />
gestern noch ist er so tief geflogen,<br />
dass er die verbrannte Haut riechen, die<br />
Schreie hören, ganze Dörfer in Flammen<br />
aufgehen sehen konnte, und einen<br />
Tag später ist er wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Berkshires.<br />
Und jetzt gehört er wirklich nicht<br />
mehr dazu, und außer<strong>de</strong>m hat er inzwischen<br />
Angst, dass irgendwas über ihm<br />
zusammenschlägt. Er will nicht mehr<br />
mit an<strong>de</strong>ren Leuten zusammensein, er<br />
kann nicht mehr lachen o<strong>de</strong>r Witze reißen,<br />
nicht mehr zu ihrer Welt zu gehören.<br />
... Er ist ruhelos. Er trinkt. Es gehört<br />
nicht viel dazu, ihn wütend zu machen.<br />
(Quelle: Philip Roth: Der menschliche Makel. München,<br />
Wien 2002, S.79ff.)<br />
Der Name eines je<strong>de</strong>n Toten war<br />
nicht länger als ein Viertel eines kleinen<br />
Fingers. Größer durfte er auch nicht<br />
sein, wenn man alle dort unterbringen<br />
wollte, 58.209 Menschen, die nicht mehr<br />
spazieren o<strong>de</strong>r ins Kino gehen, die es<br />
aber geschafft haben, weiterzuexistieren,<br />
und sei es nur als Inschrift ...<br />
Als Swift das erste Mal an <strong>de</strong>r<br />
Wand gewesen war, hatte er nicht aussteigen<br />
können, und die an<strong>de</strong>ren hatten<br />
ihn aus <strong>de</strong>m Bus und bis dorthin zerren<br />
müssen, bis er direkt davor stand, und<br />
danach hatte er gesagt: „Man kann die<br />
Wand weinen hören.“ Als Chet das erste<br />
Mal an <strong>de</strong>r Wand gewesen war, hatte<br />
er mit <strong>de</strong>n Fäusten darauf eingeschlagen<br />
und geschrien. „Da soll nicht Billys<br />
Name stehen – nein, Billy, nein! – da<br />
sollte mein Name stehen!“... Als Louie<br />
das erste Mal an <strong>de</strong>r Wand gewesen<br />
war, hatte er nicht lange gebraucht, um<br />
zu merken, was hier los war, und seine<br />
Sache auf <strong>de</strong>n Punkt zu bringen.<br />
„Okay, Mikey“, hatte er laut gesagt,<br />
„hier bin ich. Ich bin hier“; und Mikey<br />
hatte mit seiner eigenen Stimme geantwortet:<br />
„Ist schon gut, Lou. Schon<br />
okay.“<br />
Les kennt alle Geschichten darüber,<br />
was beim ersten Mal passieren kann, und<br />
jetzt ist er zum ersten Mal hier und ...<br />
(Quelle: Philip Roth: Der menschliche Makel. München,<br />
Wien 2002, S.282f.)<br />
M 2<br />
„Between the Lines“ –<br />
Das Jüdische Museum in Berlin regt<br />
zum Ge<strong>de</strong>nken an.<br />
Der zinkverklei<strong>de</strong>te Libeskind-Bau<br />
<strong>de</strong>s Jüdischen Museums in Berlin, das<br />
als Erweiterungsbau zum barocken Altbau<br />
<strong>de</strong>s Museums für Berliner Stadtgeschichte<br />
entworfen wur<strong>de</strong>, ist ein ungewöhnliches<br />
Bauwerk, das neue Maßstäbe<br />
setzt; <strong>de</strong>nn die Beziehung zwischen<br />
Museumsinhalt und Architektur<br />
ist hier einmalig. Die Architektur, reich<br />
in ihrer Symbolkraft, macht <strong>de</strong>utsch-jüdische<br />
Geschichte erlebbar und spricht<br />
die Sinne und Gefühle <strong>de</strong>r Menschen an.<br />
a) Der Grundriss <strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>s – eine<br />
Zickzacklinie – lässt viele Deutungen zu.<br />
Von vielen wird er als ein Blitz gesehen,<br />
<strong>de</strong>r in die Stadt Berlin hineinfährt. Der<br />
Architekt Daniel Libeskind selbst <strong>de</strong>utet<br />
<strong>de</strong>n Grundriss als einen geborstenen<br />
Davidstern.<br />
Der Libeskind-Bau wird durch zwei<br />
Hauptlinien charakterisiert: Die Linie<br />
<strong>de</strong>r Verbun<strong>de</strong>nheit ist gewun<strong>de</strong>n – sie<br />
symbolisiert <strong>de</strong>n kulturellen Austausch<br />
zwischen Ju<strong>de</strong>n und Nichtju<strong>de</strong>n und<br />
die gegenseitige Beeinflussung. Eine<br />
zweite gera<strong>de</strong>, aber gebrochene Linie<br />
durchzieht <strong>de</strong>n Bau – die Linie <strong>de</strong>r Leere<br />
(Void).<br />
Im Untergeschoss <strong>de</strong>s Libeskind-<br />
Baus kreuzen sich drei unterirdische<br />
Achsen, die für drei Wirklichkeiten in<br />
<strong>de</strong>r Geschichte jüdischer Deutscher<br />
stehen.<br />
Die erste und längste Achse <strong>de</strong>r<br />
Kontinuität führt vom barocken Altbau<br />
zur lichten Haupttreppe, die steil nach<br />
oben führt – bis in die Gegenwart und<br />
eine noch nicht darstellbare Zukunft.<br />
Über diese Treppe erreichen Besucher<br />
die hellen Ausstellungsgeschosse. Dort
ietet die Dauerausstellung einen Überblick<br />
über die Vergangenheit und Gegenwart<br />
<strong>de</strong>r jüdischen Deutschen.<br />
Die zweite Achse führt nach draußen,<br />
in <strong>de</strong>n Garten <strong>de</strong>s Exils und <strong>de</strong>r<br />
Emigration. Der Gang steigt an – <strong>de</strong>r<br />
Weg in das Exil ist beschwerlich. Die<br />
Wän<strong>de</strong> sind leicht schräg, <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>n<br />
uneben. Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s immer niedriger<br />
wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Ganges ist Tageslicht sichtbar.<br />
Eine Tür führt in <strong>de</strong>n Garten <strong>de</strong>s<br />
Exils.<br />
Die dritte Achse ist eine Sackgasse,<br />
die im Holocaust-Turm en<strong>de</strong>t.<br />
b) Der Garten <strong>de</strong>s Exils und <strong>de</strong>r Emigration<br />
besteht aus 49 Stelen, die sechs<br />
Meter hoch sind. Sie sind in einem<br />
Quadrat angeordnet, in sieben Reihen<br />
mit jeweils sieben Stelen. Die Sieben<br />
ist in <strong>de</strong>r jüdischen Tradition eine be<strong>de</strong>utsame<br />
Zahl: Die Welt wur<strong>de</strong> in sechs<br />
Tagen erschaffen und am siebten Tag<br />
– <strong>de</strong>m Schabbat – soll <strong>de</strong>r Mensch ruhen.<br />
Die 49 Stelen verweisen auch auf<br />
das Jahr 1948, in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Staat Israel<br />
gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong> – ein Land, das jüdische<br />
Emigranten je<strong>de</strong>rzeit aufnimmt –<br />
während die 49. Stele in <strong>de</strong>r Mitte für<br />
Berlin steht. Aus <strong>de</strong>n Stelen wachsen<br />
Ölwei<strong>de</strong>n, die in <strong>de</strong>r jüdischen Tradition<br />
Frie<strong>de</strong>n und Hoffnung be<strong>de</strong>uten.<br />
Ein weiteres Außenelement <strong>de</strong>s Museumsbaus<br />
bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r „Paul Celan-Hof“,<br />
<strong>de</strong>ssen Bo<strong>de</strong>n nach einer Grafik <strong>de</strong>r mit<br />
diesem be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n jüdischen Lyriker<br />
und Holocaustüberleben<strong>de</strong>n verheirateten<br />
Künstlerin Gisèle Celan-Lestrange<br />
gestaltet ist. Das Muster lässt sich <strong>de</strong>uten<br />
als die Spuren von Wegen, die Menschen<br />
gegangen sind mit Kreuzungen<br />
und Verästelungen, Über- und Unterführungen,<br />
Neuanfängen und Abbrüchen<br />
sowie einem zum Ausgang <strong>de</strong>s Hofes<br />
hin gleichsam als Barriere o<strong>de</strong>r Stolperstein<br />
erhaben gestalteten Element.<br />
Die Fassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Libeskind-Baus ist<br />
mit Zink verklei<strong>de</strong>t, einem Material, das<br />
in <strong>de</strong>r Berliner Architektur eine lange<br />
Tradition hat. Das unbehan<strong>de</strong>lte, mit Titanium<br />
versetzte Zink wird oxidieren<br />
und sich im Laufe <strong>de</strong>r Jahre durch die<br />
Berliner Wetter- und Lichtbedingungen<br />
verän<strong>de</strong>rn.<br />
c) Die Leerräume, die <strong>de</strong>n gesamten<br />
Bau in seiner Mitte durchziehen, drücken<br />
die Leere aus, die durch die Vernichtung<br />
<strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n in Europa entstan<strong>de</strong>n<br />
ist. Sie erinnern an die Menschen,<br />
die <strong>de</strong>portiert wur<strong>de</strong>n, die aus Deutschland<br />
geflüchtet sind und an die Generationen,<br />
die nie geboren wur<strong>de</strong>n. Sie<br />
machen <strong>de</strong>n Verlust sichtbar.<br />
Im Altbau und <strong>de</strong>m Libeskind-Bau<br />
sind die Leerräume Hohlkörper aus<br />
nacktem Beton. Auf <strong>de</strong>n oberen Ausstellungsgeschossen<br />
<strong>de</strong>s Neubaus sind<br />
die Leerräume an ihren schwarzen Außenwän<strong>de</strong>n<br />
erkennbar.<br />
Eine schwere Stahltür öffnet <strong>de</strong>n<br />
Weg in <strong>de</strong>n Holocaust-Turm. Dieser<br />
Turm ist nur unterirdisch betretbar<br />
und besteht – wie alle Leerräume – aus<br />
Beton. Er ist we<strong>de</strong>r beheizt noch isoliert,<br />
so dass es hier selbst im Sommer<br />
kühl und feucht ist. Licht fällt nur<br />
tagsüber durch einen hohen, schmalen<br />
Fensterschlitz herein. Die Straßengeräusche<br />
sind im Turm <strong>de</strong>utlich zu hören,<br />
doch die Außenwelt ist unerreichbar.<br />
Es ist ein Ge<strong>de</strong>nkraum, <strong>de</strong>r mit<br />
seiner Nacktheit und Leere an die vielen<br />
jüdischen Opfer <strong>de</strong>s Massenmor<strong>de</strong>s<br />
erinnert.<br />
(Quelle: wenig variiert und ergänzt www.jmberlin.<strong>de</strong>)<br />
M 3<br />
Der Libeskind Entwurf für ein neues<br />
World Tra<strong>de</strong> Center.<br />
Neben Bürogebäu<strong>de</strong>n, Geschäften,<br />
Verkehrswegen, Hotels usw. sieht <strong>de</strong>r<br />
Entwurf u. a. folgen<strong>de</strong> Elemente vor:<br />
• Hochhauspfeil mit metallener Spitze<br />
(541 m) 1776 Fuß hoch (somit<br />
höchstes Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Welt)<br />
• Begehbare Gärten (Tropen, Wüste,<br />
Savanne, Laubwald, Taiga, Tundra)<br />
in <strong>de</strong>n oberen Etagen <strong>de</strong>s höchsten<br />
Wolkenkratzers<br />
• Sichtbar und zugänglich gemachte,<br />
durch die Flugzeugabstürze entstan<strong>de</strong>ne<br />
Krater in <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nwanne <strong>de</strong>s<br />
ehemaligen WTC, die ursprünglich<br />
vor <strong>de</strong>m Wasser <strong>de</strong>s Hudson River<br />
schützen sollte.<br />
• „Museum of Freedom“ (Geplante<br />
Ausstellungsthemen: Dokumentation<br />
<strong>de</strong>r Angriffe auf die Twin<br />
Towers; I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r Freiheit sozial,<br />
ökonomisch und politisch in nationalem<br />
und internationalem Rahmen)<br />
• „Platz <strong>de</strong>s 11. September“<br />
• „Wedge of Light“ (Hier soll je<strong>de</strong>s<br />
Jahr am 11. September genau zwischen<br />
8:48 Uhr und 10:28 Uhr –<br />
<strong>de</strong>m Zeitraum von <strong>de</strong>r ersten Flugzeugkollision<br />
bis zum Einsturz <strong>de</strong>s<br />
zweiten Twin Towers – die Sonne<br />
scheinen, ohne Schatten zu werfen).<br />
Zur Person: Daniel Libeskind<br />
• Daniel Libeskind, 1946 in Lodz/Polen<br />
geboren, emigriert als Teenager<br />
in die USA, seit 1965 amerikanischer<br />
Staatsbürger<br />
• Studium von Musik in Israel und<br />
New York; anschließend Architekturstudium<br />
(Abschluss 1970)<br />
• Lehraufträge an verschie<strong>de</strong>nen Universitäten<br />
<strong>de</strong>r Welt<br />
• Bauten: Felix-Nussbaum-Haus in<br />
Osnabrück (1998), Jüdisches Museum<br />
in Berlin (1999), Imperial War<br />
Museum in Manchester (2002).<br />
• Zahlreiche Auszeichnungen, u. a.<br />
Deutscher Architekturpreis 1999;<br />
Goethe-Medaille 2000; Hiroshima<br />
Art Prize für Künstler, <strong>de</strong>ren Arbeit<br />
<strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n dient.<br />
• Lebt seit 14 Jahren in Berlin; <strong>de</strong>mnächst<br />
Übersiedlung nach New York<br />
zur Durchführung <strong>de</strong>r Neubebauung<br />
<strong>de</strong>s World Tra<strong>de</strong> Centers.<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
181<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
182<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Pascha und Eucharistie<br />
– jüdisches und christliches Erinnern * –<br />
Theologische Annäherungen und didaktische Anschlussmöglichkeiten<br />
für <strong>de</strong>n Religionsunterricht in <strong>de</strong>r Gymnasialen<br />
Oberstufe und die Gemein<strong>de</strong>katechese<br />
1. Aufgabe Erinnerung 1<br />
Geschichtliche Religionen wie das<br />
Ju<strong>de</strong>ntum und das Christentum beziehen<br />
sich auf normative Geschehnisse,<br />
die forthin die Beziehung zwischen <strong>de</strong>n<br />
Gläubigen und Gott auf eine völlig neue<br />
Grundlage stellen. Sie offenbaren einen<br />
Gott, <strong>de</strong>r nicht nur die Kommunikation<br />
zu <strong>de</strong>n Menschen sucht, son<strong>de</strong>rn darüber<br />
hinaus aus souveräner Vollmacht in<br />
<strong>de</strong>r Geschichte zum Wohl seines Volkes<br />
interveniert. Für das Ju<strong>de</strong>ntum ist vornehmlich<br />
die von Gott initiierte Rettung<br />
aus <strong>de</strong>m Sklavenhaus Ägypten, für das<br />
Christentum die Selbstmitteilung Gottes<br />
in <strong>de</strong>r Person Jesus Christus das<br />
maßgebliche Geschehnis. 2<br />
Mit <strong>de</strong>r wachsen<strong>de</strong>n zeitlichen Entfernung<br />
zum Ursprungsereignis – <strong>de</strong>m<br />
Tod <strong>de</strong>r Zeugen und <strong>de</strong>rer, die die Zeugen<br />
noch kannten – stellt sich die verpflichten<strong>de</strong><br />
Aufgabe, die Erinnerung an<br />
die normative Vergangenheit über <strong>de</strong>n<br />
garstigen Graben <strong>de</strong>r Geschichte hinweg<br />
lebendig zu halten. Erinnerung wird<br />
nicht nur, aber sicherlich ausschlaggebend<br />
durch rituell strukturierte und zyklisch<br />
wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong> Feste transportiert.<br />
Feste unterbrechen die Anmutungen<br />
<strong>de</strong>s Alltags und erinnern an die Gegenwart<br />
<strong>de</strong>r Vergangenheit. Im Ju<strong>de</strong>ntum<br />
geschieht dies vor allem in <strong>de</strong>r familiären<br />
Paschafeier 3 , im Christentum<br />
im Abendmahl bzw. in <strong>de</strong>r Eucharistiefeier.<br />
4 Um diese bei<strong>de</strong>n Erinnerungsfeste<br />
geht es im Weiteren.<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Für Alexandra wegen Maja<br />
In <strong>de</strong>n Basistexten, welche <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n<br />
Feiern zugrun<strong>de</strong> liegen – Ex 12<br />
(und Dtn 16,1-8) einerseits und (außer<br />
Mk 14,22-25 und Mt 26,26-29) insbeson<strong>de</strong>re<br />
Lk 22,14-20 sowie 1 Kor 11,<br />
23-26 an<strong>de</strong>rerseits – fin<strong>de</strong>t sich die Auffor<strong>de</strong>rung,<br />
diese Feiern zum „Gedächtnis“<br />
5 zu begehen. Es gilt nun zu beachten,<br />
dass nach biblischer Auffassung<br />
<strong>de</strong>m Gedächtnis (hebr.: zikkaron; gr.:<br />
anamnesis; lat.: memoria) eine dreidimensionale<br />
Zeitstruktur 6 eigen ist: Ein<br />
singuläres Ereignis <strong>de</strong>r Vergangenheit,<br />
welches die I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r Glauben<strong>de</strong>n in<br />
<strong>de</strong>r Gegenwart verbürgt, wird sich erst<br />
in <strong>de</strong>r Zukunft vollen<strong>de</strong>n. Nicht nur das<br />
Hier und Heute, son<strong>de</strong>rn bereits die normative<br />
Vergangenheit hat einen eschatologischen<br />
Aspekt.<br />
Im rituellen Ablauf <strong>de</strong>r Gedächtnisfeiern<br />
Pascha und Abendmahl eingebettet<br />
sind Symbole. Unter einem<br />
„Symbol“ soll hier ein sinnlich wahrnehmbares<br />
Etwas – ein empirisches Zeichen<br />
– verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m eine unsichtbare<br />
Be<strong>de</strong>utung (bzw. Semantik)<br />
zukommt; das Eigentliche bleibt <strong>de</strong>m<br />
Auge verborgen. So erhält das Lebensmittel<br />
Brot, auf das wir uns im Folgen<strong>de</strong>n<br />
konzentrieren wer<strong>de</strong>n, erst im Kontext<br />
<strong>de</strong>r uns interessieren<strong>de</strong>n Feste durch<br />
erläutern<strong>de</strong> Worte und segnen<strong>de</strong> Gesten<br />
seine erinnern<strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung. Das,<br />
was sonst als ein Lebensmittel verzehrt<br />
wird, avanciert im Rahmen <strong>de</strong>r Gedächtnisfeier<br />
zu einem anamnetischen<br />
Symbol (Erinnerungssymbol).<br />
2. Das Pascha<br />
Thomas Menges<br />
2.1 Diesen Tag sollt ihr zum Gedächtnis<br />
begehen<br />
Ex 12 – „<strong>de</strong>r Basistext für die Gedächtniskultur<br />
Israels“ (Thomas Söding)<br />
– berichtet von <strong>de</strong>r Einsetzung<br />
<strong>de</strong>r Paschafeier. In diesem Text wird<br />
die übliche Chronologie auf <strong>de</strong>n Kopf<br />
gestellt. Denn bevor JHWH sein Volk<br />
Israel aus Ägypten herausführt (12,29-<br />
41.51), ordnet er die Einführung <strong>de</strong>s<br />
Paschafestes an – und das gleich dreifach<br />
(12,3-13; 15-20; 21-23). Die Feier<br />
nimmt eine Woche in Anspruch – eine<br />
Zeitspanne, die vor <strong>de</strong>m unmittelbar<br />
bevorstehen<strong>de</strong>n Exodus kaum zur Verfügung<br />
gestan<strong>de</strong>n haben dürfte. Die<br />
Anordnung, dass in <strong>de</strong>r Festwoche we<strong>de</strong>r<br />
Einheimische noch Frem<strong>de</strong> Gesäuertes<br />
verzehren dürfen (Ex 12,19), setzt<br />
die Sesshaftigkeit Israels voraus. Diese<br />
Einsicht erhellt die Blickrichtung von<br />
Ex 12: Aus <strong>de</strong>r Perspektive längst vollzogener<br />
Landnahme vergegenwärtigt<br />
sich Israel das normative geschichtliche<br />
Ereignis, welches seine I<strong>de</strong>ntität<br />
nicht nur hier und jetzt verbürgt, son<strong>de</strong>rn<br />
auch in Zukunft ausmachen wird.<br />
Das Paschafest wird „Jahr für Jahr,<br />
zur festgesetzten Zeit“ (Ex 13,10) im<br />
Kreise <strong>de</strong>r Familie gefeiert. Dabei<br />
kommt bestimmten Speisen – vornehmlich<br />
<strong>de</strong>m Lamm(knochen), <strong>de</strong>m ungesäuerten<br />
Brot und <strong>de</strong>m Bitterkraut – eine<br />
anamnetische Be<strong>de</strong>utung zu.
Blicken wir nochmals auf Ex 12:<br />
Dem Text scheinen zwei Frühlingsfeste<br />
und ein magischer Blutritus zugrun<strong>de</strong><br />
zu liegen, welche <strong>de</strong>r Pentateuch-Redaktor<br />
zu einer neuen Be<strong>de</strong>utung zusammengeschlossen<br />
hat. Ex 12,3ff. bewahrt<br />
die Erinnerung an ein altes Hirtenfest,<br />
an welchem ein neugeborenes,<br />
hüpfen<strong>de</strong>s bzw. springen<strong>de</strong>s (hebr.:<br />
p-s-ch) Lämmchen geopfert wur<strong>de</strong>. Ex<br />
12,15ff. scheint sich auf ein Bauernfest<br />
zu beziehen; ungesäuertes Brot (hebr.:<br />
mazza, mazzot) wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Gerste<br />
<strong>de</strong>r Frühlingsernte ohne Beigabe von<br />
altem gesäuerten Teig gebacken. Hinter<br />
bei<strong>de</strong>n Festen steht die Erfahrung, dass<br />
die von <strong>de</strong>n Fesseln <strong>de</strong>s Winters befreite<br />
Natur zu neuem Leben erwacht ist.<br />
In Ex 12 erhalten das nomadische<br />
Pascha- und das bäuerliche Mazzenfest<br />
in Verknüpfung mit <strong>de</strong>m apotropäischen<br />
(das Böse abwen<strong>de</strong>nd) Blutritual<br />
(Ex 12, 21-23) einen neuen Sinn: Das<br />
Schlachten <strong>de</strong>s Paschalammes und das<br />
Bestreichen <strong>de</strong>r Tür mit seinem Blut bewirkt,<br />
dass <strong>de</strong>r „Ich-bin-da“ die Häuser<br />
Israels verschont – sie überspringt<br />
(heb.: p-s-ch) bzw. an ihnen vorübergeht<br />
–, die Erstgeborenen Ägyptens aber<br />
tötet. Die aus <strong>de</strong>m ersten Gerstenschnitt<br />
gebackenen Mazzen repräsentieren<br />
im Kontext <strong>de</strong>s Exodus sowohl die<br />
„Speise <strong>de</strong>r Bedrängnis“ (Dtn 16,3) als<br />
auch das „Brot <strong>de</strong>r Befreiung“ (Ex 12,39).<br />
Durch ihre Historisierung haben die<br />
alten Naturfeste eine Be<strong>de</strong>utungsanrei-<br />
cherung erfahren: JHWH schenkt nicht<br />
nur die Frühlingsgaben – neue Wei<strong>de</strong>n<br />
und Lämmer sowie eine neue Ernte. Er<br />
ist darüber hinaus ein Gott, <strong>de</strong>r auch in<br />
<strong>de</strong>r Geschichte han<strong>de</strong>lt und seinem einst<br />
unterdrückten Volk <strong>de</strong>n Weg in die Freiheit<br />
eröffnet hat. Wir halten fest: Die<br />
durch „Jahweisierung“ (Erich Zenger)<br />
erfolgte semantische Anreicherung<br />
spielt die geschichtliche Erfahrung nicht<br />
gegen die Naturerfahrung aus, son<strong>de</strong>rn<br />
integriert sie in einen größeren Be<strong>de</strong>utungszusammenhang.<br />
2.2 Didaktische Anschlussmöglichkeiten<br />
2.2.1 Erarbeitung von Ex 12<br />
Eine bewährte Metho<strong>de</strong>, die Aufmerksamkeit<br />
für die Struktur und <strong>de</strong>n<br />
Gehalt eines Textes zu schärfen, besteht<br />
darin, ihn in Sinnabschnitte zu zerteilen<br />
und von <strong>de</strong>r Lerngruppe neu zusammensetzen<br />
zu lassen. Dazu wird Ex 12,1-32<br />
in sechs Abschnitte zerlegt (V1; VV2-<br />
13; VV14-20; VV21-23; VV24-28;<br />
VV29-32) und folgen<strong>de</strong> Aufgabe gestellt:<br />
„Die mutmaßlichen Quellen, die<br />
<strong>de</strong>r Pentateuch-Redaktor zu einem Text<br />
zusammengefügt hat, habe ich durcheinan<strong>de</strong>r<br />
gewirbelt. Spielen Sie Redaktor,<br />
in<strong>de</strong>m Sie einen Ihnen stimmig erscheinen<strong>de</strong>n<br />
Text zusammenstellen!“ Nach<br />
einer Stillarbeitsphase wer<strong>de</strong>n die Ergebnisse<br />
vorgestellt und diskutiert.<br />
Dirk Bouts (ca. 1410-1475) • Abendmahlsaltar (1464-1467), St. Peter, Loewen © akg-images<br />
Beim Vergleich mit <strong>de</strong>m biblischen Text<br />
wird die „falsche“ Chronologie und die<br />
Absicht rückblicken<strong>de</strong>r Vergegenwärtigung<br />
offensichtlich.<br />
2.2.2 Paschafeier<br />
Wie jüdische Familien heute Pascha<br />
– vornehmlich <strong>de</strong>n ersten Abend <strong>de</strong>s<br />
Festes: <strong>de</strong>n Se<strong>de</strong>rabend – feiern 7 , lässt<br />
sich gut durch einen Kurzfilm 8 veranschaulichen.<br />
Die vom Hausvater geleitete<br />
Feier orientiert sich an <strong>de</strong>r Pascha-<br />
Haggada, einem Buch mit Texten in einer<br />
Art Gottesdienstordnung. Es enthält<br />
ein didaktisches Programm jüdischen<br />
Erinnerns. 9 Die Frage <strong>de</strong>s Jüngsten <strong>de</strong>r<br />
Tischgemeinschaft „Wodurch unterschei<strong>de</strong>t<br />
sich diese Nacht von allen an<strong>de</strong>ren<br />
Nächten? ...“ beantwortet die Tischgesellschaft<br />
mit <strong>de</strong>r Erzählung vom Auszug<br />
aus Ägypten. In diesem Kontext<br />
wird die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r symbolischen<br />
Speisen erklärt, <strong>de</strong>nn sie sind nicht aus<br />
sich selbst heraus verständlich. Erst<br />
durch die Erläuterung mit Bezug auf <strong>de</strong>n<br />
biblischen Basistext wer<strong>de</strong>n sie zu<br />
anamnetischen Symbolen: Der Lammknochen<br />
steht für <strong>de</strong>n „Vorübergang“<br />
Gottes; das ungesäuerte Brot symbolisiert<br />
die Speise <strong>de</strong>r Bedrängnis und <strong>de</strong>r<br />
Befreiung; das Bitterkraut lässt die Sklaverei<br />
in Ägypten schmecken. Die von<br />
<strong>de</strong>r Pascha-Haggada vorgegebenen Gottesdienstordnung<br />
zielt auf die Vergegenwärtigung<br />
<strong>de</strong>r Taten Gottes ab: „In allen<br />
Zeitaltern ist je<strong>de</strong>r verpflichtet, sich zu<br />
betrachten, als ob er gleichsam selbst aus<br />
Ägypten gegangen wäre ...“<br />
2.2.3 Bildbetrachtung: Dirk Bouts,<br />
Paschamahl 10<br />
Von Dirk Bouts (ca. 1410-1475)<br />
stammt <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Abendmahlsaltar<br />
(1464-1467) in <strong>de</strong>r St. Peters Kirche<br />
zu Loewen, <strong>de</strong>n er im Auftrag <strong>de</strong>r örtlichen<br />
Bru<strong>de</strong>rschaft <strong>de</strong>s Heiligen Sakraments<br />
nach theologischen Vorgaben<br />
malte. Dieser Altar <strong>de</strong>monstriert eindrucksvoll<br />
die beson<strong>de</strong>re Qualität <strong>de</strong>s<br />
Mediums Bild, nämlich das, was in<br />
narrativen o<strong>de</strong>r diskursiven Texten in<br />
einem zeitlichen Nacheinan<strong>de</strong>r entwi-<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
183<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
184<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
ckelt wer<strong>de</strong>n muss, <strong>de</strong>m Auge gleichzeitig<br />
präsentieren zu können.<br />
Die Mitteltafel (150 x 180 cm) zeigt<br />
die Einsetzung <strong>de</strong>s Abendmahls, die<br />
bei<strong>de</strong>n Seitenflügel (je 71 x 180 cm) zeigen<br />
je zwei alttestamentliche Brotgeschichten,<br />
die gemäß <strong>de</strong>m Deuteschema<br />
Typos-Antitypos als Präfigurationen <strong>de</strong>s<br />
Abendmahls zu verstehen sind: Abraham<br />
und Melchise<strong>de</strong>k, Mannalese, Speisung<br />
<strong>de</strong>s Elija und das hier interessieren<strong>de</strong><br />
Paschamahl.<br />
Zu sehen sind keine armen Noma<strong>de</strong>n,<br />
son<strong>de</strong>rn sechs um einen Tisch versammelte<br />
flämische Bürger, die in andächtiger<br />
Ruhe das Mahl verzehren. Der<br />
Hausälteste mit <strong>de</strong>m spitzen Ju<strong>de</strong>nhut<br />
zerlegt auf einem großen Zinnteller das<br />
Lamm (vgl. Ex 12,9). Die ungesäuerten<br />
Brote, das Bitterkraut (vgl. Ex 12,8) und<br />
vier Weingläser sind auf <strong>de</strong>m Tisch erkennbar.<br />
In ruhiger Andacht sammeln<br />
sich die Personen angesichts <strong>de</strong>s unmittelbar<br />
bevorstehen<strong>de</strong>n Exodus: Im Raum<br />
fehlen die Stühle, das Essen wird stehend<br />
mit Stab in <strong>de</strong>r Hand und gegürteten<br />
Hüften eingenommen (vgl. Ex 12,11).<br />
3. Das letzte Abendmahl<br />
3.1 Tut dies zu meinem Gedächtnis<br />
Die Abendmahlsberichte sind in<br />
zwei Varianten – einer jerusalemer (Mk<br />
14, 22-25; Mt 26,26-29) und einer antiochenischen<br />
Gestalt (Lk 22,14-20; 1<br />
Kor 11,23-26) – überliefert. Den Kern<br />
bei<strong>de</strong>r Traditionen bil<strong>de</strong>n zwei Worte:<br />
mein Leib, mein Blut, und zwei Gesten:<br />
das Brotbrechen, das Trinken aus <strong>de</strong>m<br />
Weinkelch. Uns interessiert <strong>de</strong>r Abendmahlsbericht<br />
in seiner lukanisch-paulinischen<br />
Variante, weil diese für die<br />
christliche Gedächtniskultur von beson<strong>de</strong>rer<br />
Be<strong>de</strong>utung ist. 11<br />
Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern<br />
bil<strong>de</strong>t bei <strong>de</strong>n Synoptikern ein Element<br />
<strong>de</strong>r Passionsgeschichte; <strong>de</strong>shalb<br />
gehören Unverständnis, Verleugnung<br />
und tödlich en<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Verrat zur neutestamentlichen<br />
Eucharistietradition hinzu.<br />
Die synoptische Überlieferung legt<br />
nahe, dass Jesus mit <strong>de</strong>n Jüngern nicht<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
bloß ein Abschiedsessen unter <strong>de</strong>m Vorzeichen<br />
seiner bevorstehen<strong>de</strong>n Verhaftung<br />
ausgerichtet, son<strong>de</strong>rn ein Paschamahl<br />
gefeiert hat. Er stand <strong>de</strong>r Tischgemeinschaft<br />
vor, brach das Brot und<br />
reichte <strong>de</strong>n Becher im Rahmen <strong>de</strong>r üblichen<br />
Paschaliturgie. Bei <strong>de</strong>m gebrochenen,<br />
ausgeteilten und schließlich verzehrten<br />
Brot han<strong>de</strong>lt es sich also um das<br />
ungesäuerte Brot, welches an das Befreiungshan<strong>de</strong>ln<br />
Gottes erinnert.<br />
Auf diesem Hintergrund ist Jesu<br />
(Um-)Deutung <strong>de</strong>s Brotes zu verstehen,<br />
<strong>de</strong>m er eine weitere Be<strong>de</strong>utungsschicht<br />
hinzufügt. Das wird bewusst, wenn wir<br />
die biblische Formulierung „Mein Leib<br />
für euch“ adäquat als „Meine Person/<br />
mein Leben/ich für euch“ übersetzen.<br />
Was folgt daraus? Im christlichen Kontext<br />
erinnert das ungesäuerte Brot nicht<br />
nur an das Schöpfungs- und Befreiungshan<strong>de</strong>ln<br />
Gottes (Ex 12). Darüber hinaus<br />
– und das ist das entschei<strong>de</strong>nd Neue –<br />
steht es für <strong>de</strong>n gesamten Lebensvollzug<br />
Jesu Christi, <strong>de</strong>m „Ebenbild <strong>de</strong>s unsichtbaren<br />
Gottes“ (Kol 1,15).<br />
Im Neuen Testament erfährt das<br />
anamnetische Symbol ungesäuertes Brot<br />
<strong>de</strong>mnach eine wesentliche Be<strong>de</strong>utungsanreicherung:<br />
Der Gott, <strong>de</strong>r die Schöpfung<br />
am Leben erhält und aus <strong>de</strong>r Sklaverei<br />
befreit, ist zugleich <strong>de</strong>r Gott, <strong>de</strong>r sich in<br />
<strong>de</strong>r geschichtlichen Person Jesus von Nazareth<br />
geoffenbart hat. Das theozentrische<br />
Erinnerungssymbol Brot erfährt somit eine<br />
christologischeAkzentuierung.<br />
An die Adresse <strong>de</strong>r um ihn versammelten<br />
Mahlgemeinschaft richtet Jesus<br />
die Auffor<strong>de</strong>rung, diese Feier zu seinem<br />
Gedächtnis zu wie<strong>de</strong>rholen. Er wird so<br />
zum Stifter <strong>de</strong>r Eucharistiefeier, welche<br />
sich bei aller Nähe zur Paschafeier<br />
in charakteristischer Weise auch von<br />
ihr unterschei<strong>de</strong>t: Im Mittelpunkt <strong>de</strong>s<br />
Ge<strong>de</strong>nkens steht <strong>de</strong>r erhöhte Christus;<br />
vergegenwärtigt wird Leben, Tod und<br />
Auferstehung Jesu – seine Lebenshingabe<br />
für uns. Diese christologische<br />
Zentrierung schlägt auf die eschatologische<br />
Dimension <strong>de</strong>r christlichen Gedächtnisfeier<br />
durch, die ihre Vollendung<br />
fin<strong>de</strong>t, wenn <strong>de</strong>r Herr (1 Kor 11,<br />
26) und mit ihm das Reich Gottes (Lk<br />
22,18) gekommen sein wer<strong>de</strong>n.<br />
Eine weitere gegenüber <strong>de</strong>r Paschafeier<br />
zu beobachten<strong>de</strong> Differenz betrifft<br />
die ekklesiale Dimension. In ihrer universalen<br />
Ausrichtung überschreitet die<br />
Eucharistiefeier die Grenzen <strong>de</strong>r Familie<br />
und <strong>de</strong>s Volkes; sie fin<strong>de</strong>t im Kreis<br />
<strong>de</strong>rer statt, die sich zu Jesus als <strong>de</strong>m<br />
fleischgewor<strong>de</strong>nen Gott bekennen.<br />
3.2 Didaktische Anschlussmöglichkeiten<br />
3.2.1 Textarbeit<br />
Ein Vergleich <strong>de</strong>r Erinnerungstexte<br />
– Ex 12 mit Lk 22,14-20 und 1 Kor 11,<br />
23-26 – macht <strong>de</strong>n unterschiedlichen<br />
Gehalt jüdischen und christlichen Erinnerns<br />
offensichtlich. An <strong>de</strong>r von Jesus<br />
selbst vorgenommenen Neusemantisierung<br />
<strong>de</strong>s anamnetischen Symbols Brot<br />
lässt sich erkennen, dass die unterschiedlichen<br />
Gehalte <strong>de</strong>s Erinnerns in keinem<br />
Gegensatzverhältnis zueinan<strong>de</strong>r stehen.<br />
Denn dieses Erinnerungssymbol „verkörpert“<br />
<strong>de</strong>n Gott, <strong>de</strong>r seine Schöpfung<br />
erhält und in die Freiheit führt und in Jesus<br />
allen Menschen seine Liebe anbietet.<br />
3.2.2 Bildbetrachtung: Dirk Bouts, Einsetzung<br />
<strong>de</strong>s Abendmahls<br />
Bei komplexen Bil<strong>de</strong>rn, wie etwa<br />
<strong>de</strong>r theologisch anspruchsvollen Mitteltafel<br />
<strong>de</strong>s Abendmahlsaltars, wird die<br />
Betrachtung zur geistigen Anstrengung.<br />
Aus <strong>de</strong>r Fülle symbolischer Anspielungen<br />
12 befassen wir uns nur mit <strong>de</strong>nen,<br />
die das bislang Erarbeitete aufgreifen<br />
und zum Sakrament Eucharistie /Abendmahl<br />
überleiten.<br />
Die gesamte Komposition ist auf die<br />
Mittelachse ausgerichtet, welche Leuchter,<br />
Kamin, das Gesicht Jesu, sein Gewand,<br />
Hostie, Kelch, Tisch und Se<strong>de</strong>rteller<br />
vertikal schnei<strong>de</strong>t. Der Bildaufbau<br />
steht ganz im Dienst <strong>de</strong>s Themas, <strong>de</strong>r<br />
Einsetzung <strong>de</strong>s Abendmahls durch Jesus.<br />
Dieser sitzt etwas erhöht und ist<br />
die einzige Person in Frontansicht.<br />
Den Be<strong>de</strong>utungsfluchtpunkt bil<strong>de</strong>t<br />
<strong>de</strong>r hellste und kleinste, aber <strong>de</strong>nnoch<br />
klar erkennbare Gegenstand <strong>de</strong>s Bil<strong>de</strong>s:<br />
Es ist die weiße Hostie 13 , die Jesus gera-
<strong>de</strong> konsekriert. Er hält sie zwischen <strong>de</strong>n<br />
Fingern seiner linken Hand über einen<br />
Kelch; die rechte Hand ist im Segensgestus<br />
erhoben. Jesu leicht geöffneter<br />
Mund scheint soeben die Worte zu sprechen,<br />
welche das ungesäuerte Brot, die<br />
Hostie, und <strong>de</strong>n Wein in seinen Leib<br />
und in sein Blut verwan<strong>de</strong>ln.<br />
Die zwölf um einen großen Tisch<br />
gruppierten Jünger bil<strong>de</strong>n einen Kreis,<br />
<strong>de</strong>r wie eine Monstranz die Hostie umschließt.<br />
Der große Se<strong>de</strong>rteller auf <strong>de</strong>m<br />
Tisch und <strong>de</strong>r Kamin im Rücken Jesu<br />
spielen auf das Schlachten <strong>de</strong>r Lämmer<br />
am Vorabend <strong>de</strong>s Paschafestes im Tempel<br />
an: Der Teller ist leer, <strong>de</strong>r Kamin wegen<br />
seiner hölzernen Rückwand nicht<br />
länger als Feuerstelle benutzbar – <strong>de</strong>nn<br />
Jesus ist das wahre Paschalamm. Der<br />
Leuchter bedarf keiner Kerzen, <strong>de</strong>nn<br />
<strong>de</strong>r unter ihm sitzen<strong>de</strong> Jesus ist das Licht<br />
<strong>de</strong>r Welt. Der Becher <strong>de</strong>s Elija – <strong>de</strong>s<br />
Propheten, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Messias vorangeht<br />
– steht auf <strong>de</strong>m linken Kaminaufsatz;<br />
Elija wird nicht länger erwartet, weil<br />
sich die messianische Hoffnung in Jesus<br />
erfüllt hat (vgl. Mk 9,13).<br />
Bouts’ Gemäl<strong>de</strong> dreht sich nicht um<br />
die historische Abendmahlsgemeinschaft<br />
in Jerusalem um das Jahr 30. Vielmehr<br />
geht es um die Vergegenwärtigung dieses<br />
normativen Geschehnisses, genauer um<br />
die Präsenz Jesu Christi in <strong>de</strong>r gewan<strong>de</strong>lten<br />
Hostie. Deshalb werfen wir<br />
<strong>de</strong>n Blick in einen gotischen Raum in<br />
Brabant <strong>de</strong>s Spätmittelalters, in welchem<br />
die vier Vorsteher <strong>de</strong>r Bru<strong>de</strong>rschaft vom<br />
Heiligen Sakrament, die Stifter <strong>de</strong>s Bil<strong>de</strong>s,<br />
zu Zeugen <strong>de</strong>s Geschehens wer<strong>de</strong>n.<br />
Noch anschaulicher wird <strong>de</strong>r zentrale<br />
Gesichtspunkt <strong>de</strong>r Vergegenwärtigung,<br />
wenn man um die ursprüngliche<br />
Funktion <strong>de</strong>s Löwener Abendmahlsaltars<br />
als Zelebrationsaltar weiß. Das Bild<br />
stand auf <strong>de</strong>r Mensa. Beim Feiern <strong>de</strong>r<br />
Messe trat <strong>de</strong>r Zelebrant in die Lücke<br />
zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Jüngern im Vor<strong>de</strong>rgrund.<br />
Im Kreis <strong>de</strong>r Jünger und im<br />
Angesicht Jesu konsekrierte er die Hostie,<br />
um sie dann <strong>de</strong>n Gläubigen zu zeigen.<br />
Die Gläubigen konnten sehen, dass<br />
<strong>de</strong>r Priester im Auftrag Christi han<strong>de</strong>lt<br />
und gera<strong>de</strong> das vollzieht, was Jesus auf<br />
<strong>de</strong>m Bild tut.<br />
Der Abendmahlsaltar ist ein sichtbarer<br />
Ausdruck <strong>de</strong>r Eucharistiefrömmigkeit<br />
<strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Unser Bild<br />
zeigt, dass nicht <strong>de</strong>r Mahlgemeinschaft,<br />
son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Verehrung <strong>de</strong>r Hostie das<br />
beson<strong>de</strong>re Interesse galt. Dafür spricht<br />
bereits <strong>de</strong>r Anachronismus, dass Jesus<br />
kein Brot, son<strong>de</strong>rn eine Hostie in Hän<strong>de</strong>n<br />
hält. Diese wie<strong>de</strong>rum ist viel zu<br />
klein, als dass sie an die Tischgemeinschaft<br />
ausgeteilt wer<strong>de</strong>n könnte. Deshalb<br />
verfolgen die meisten Personen<br />
<strong>de</strong>s Gemäl<strong>de</strong>s gespannt das, was gera<strong>de</strong><br />
mit <strong>de</strong>r Hostie geschieht; sie sind<br />
Zeugen einer „geistigen Kommunion“.<br />
4. Eucharistie und Realpräsenz<br />
4.1 Sen<strong>de</strong> <strong>de</strong>inen Geist auf diese Gaben<br />
Für <strong>de</strong>n christlichen Glauben ist die<br />
Eucharistie in erster Linie kein Totenge<strong>de</strong>nken,<br />
son<strong>de</strong>rn eine Feier. Denn in<br />
ihr ist <strong>de</strong>r von Gott auferweckte und erhöhte<br />
Jesus Christus wirklich gegenwärtig.<br />
In <strong>de</strong>r Realpräsenz besteht das Spezifikum<br />
christlichen Erinnerns. Dazu<br />
einige erläutern<strong>de</strong> Hinweise. 14<br />
Die über die Jahrhun<strong>de</strong>rte hinweg<br />
tradierte Überzeugung von <strong>de</strong>r Gegenwart<br />
Christi im Abendmahl hat biblische<br />
Grundlagen. So sagt <strong>de</strong>r „vorösterliche“<br />
Jesus <strong>de</strong>n in seinem Namen Versammelten<br />
seine Gegenwart zu (Mt 18,20);<br />
diese Präsenz, so <strong>de</strong>r Auferstan<strong>de</strong>ne,<br />
wird „alle Tage bis zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Welt“<br />
(Mt 28,20) fortbestehen.<br />
Im Neuen Testament ist darüber hinaus<br />
von <strong>de</strong>r Gegenwart Jesu im Zusammenhang<br />
mit seinem Fleisch bzw. Leib<br />
und seinem Blut die Re<strong>de</strong>. Die sog. Einsetzungsworte<br />
– dieses Brot ist mein<br />
Leib, dieser Wein ist mein Blut – wur<strong>de</strong>n<br />
bereits angesprochen. Mit <strong>de</strong>r synoptischen<br />
und <strong>de</strong>r paulinischen Abendmahlstradition<br />
wird üblicherweise auch Jesu<br />
Re<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m Johannes-Evangelium in<br />
Verbindung gebracht (Joh 6, 22-59).<br />
Darin bezeichnet er sich (und sein Wirken)<br />
metaphorisch als „das Brot <strong>de</strong>s Lebens“<br />
(V 48), „das vom Himmel herabgekommen<br />
ist“ (V 51). In diesem Kontext<br />
verkün<strong>de</strong>t Jesus: „Mein Fleisch ist<br />
wirklich eine Speise, und mein Blut ist<br />
wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst<br />
und mein Blut trinkt, <strong>de</strong>r bleibt in mir,<br />
und ich bleibe in ihm“ (VV 55f).<br />
In je<strong>de</strong>r Eucharistiefeier wird die<br />
zugesagte Gegenwart stets aufs Neue<br />
aktualisiert. In<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r beauftragte<br />
Zelebrant vor <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Geist<br />
Gottes auf Brot und Wein herab bittet<br />
und dann die Einsetzungsworte Jesu<br />
nachspricht, wird nicht nur die normative<br />
Ursprungssituation im Saal<br />
bei Jerusalem vergegenwärtigt. Durch<br />
die Wandlung von Brot und Wein in<br />
Leib und Blut Jesu sowie <strong>de</strong>ren Verzehr<br />
im gemeinsamen Mahl ist Christus<br />
in seiner Gemein<strong>de</strong> wirklich gegenwärtig.<br />
Eine <strong>de</strong>rartige Wesensverwandlung<br />
(DH 1652) erfolgt durch <strong>de</strong>n Geist Gottes;<br />
sie ist keine Leistung <strong>de</strong>s Priesters,<br />
<strong>de</strong>r lediglich im Auftrag Jesu – als <strong>de</strong>m<br />
eigentlichen Gastgeber – die eucharistischen<br />
Gaben konsekriert. Die Gegenwart<br />
Christi setzt sicherlich die Bereitschaft<br />
<strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>, sich erinnern zu wollen<br />
voraus. Sie geschieht aber nicht als <strong>de</strong>ren<br />
eigene Leistung; vielmehr kommt <strong>de</strong>r<br />
Erinnerte auf die Erinnern<strong>de</strong>n zu.<br />
Die theologische Vorstellung von<br />
<strong>de</strong>r Realpräsenz verweist auf ein analogieloses,<br />
nur im Glauben zu erfahren<strong>de</strong>s<br />
Geschehen. In diesem Zusammenhang<br />
sei an die biblische Re<strong>de</strong> vom Auferstehungsleib<br />
(vgl. Mk 12, 18-27 parr;<br />
1 Kor 15, 35-55) erinnert. Diese Metapher<br />
verbin<strong>de</strong>t zwei Aspekte: Zum einen<br />
wird die Kontinuität von irdischem<br />
und überirdischem Leib bewahrt; zum<br />
an<strong>de</strong>ren wird die radikale Differenz bei<strong>de</strong>r<br />
Existenzweisen ausgedrückt – verdankt<br />
sich <strong>de</strong>r „himmlische“ Leib doch<br />
ganz <strong>de</strong>m unanschaulichen Han<strong>de</strong>ln<br />
Gottes, das <strong>de</strong>n radikalen Bruch <strong>de</strong>s<br />
To<strong>de</strong>s überwin<strong>de</strong>t und zu „ewigem“ Leben<br />
erweckt. Analoges lässt sich über<br />
die eucharistische Gegenwart Jesu Christi<br />
sagen: Es ist <strong>de</strong>r irdische Jesus, <strong>de</strong>r –<br />
nach seinem Tod und seiner Auferstehung<br />
– jetzt und immer als auferweckter<br />
Christus in einer ganz eigenen Existenzweise<br />
<strong>de</strong>n Menschen nahe ist.<br />
Ein überaus be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s und einflussreiches<br />
Vorstellungsmo<strong>de</strong>ll, wel-<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
185<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
186<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
ches die Wesensverwandlung von<br />
Brot und Wein in <strong>de</strong>n Leib und das<br />
Blut Christi gedanklich nachzuvollziehen<br />
versucht, stellt die hochmittelalterliche<br />
Lehre von <strong>de</strong>r Transsubstantiation<br />
dar. Auch wenn das äußere<br />
Erscheinungsbild von Brot und Wein<br />
(ihre Akzi<strong>de</strong>ntien) unverän<strong>de</strong>rt bleiben,<br />
so hat sich doch – für das Auge<br />
unsichtbar – ihr eigentliches Sein (ihre<br />
Substanz) in etwas ganz an<strong>de</strong>res – in<br />
<strong>de</strong>n Leib und in das Blut Christi – verwan<strong>de</strong>lt.<br />
Für diesen Versuch, die Realpräsenz<br />
<strong>de</strong>r Vernunft einsichtig zu machen,<br />
gilt, was wir oben im Zusammenhang<br />
<strong>de</strong>s anamnetischen Symbols<br />
bereits entwickelt haben: Das Eigentliche<br />
bleibt unsichtbar – es erschließt<br />
sich nur <strong>de</strong>n Glauben<strong>de</strong>n.<br />
Die theologische Reflexion unterschei<strong>de</strong>t<br />
bei <strong>de</strong>r Re<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Realpräsenz<br />
zumin<strong>de</strong>st drei Aspekte: In <strong>de</strong>r<br />
Eucharistiefeier gegenwärtig ist nicht<br />
nur die Person Jesus Christus (Personalpräsenz),<br />
son<strong>de</strong>rn auch seine Lebenshingabe<br />
für uns, seine „Proexistenz“, hier<br />
und heute (Aktualpräsenz) – und das bis<br />
zur endzeitlichen Vollendung <strong>de</strong>s Mahls<br />
im Reich Gottes (proleptische Finalpräsenz).<br />
Die Realpräsenz als die beson<strong>de</strong>re<br />
Weise christlichen Gedächtnisses<br />
hat – wie die jüdische Gedächtnisfeier<br />
Pascha – eine dreidimensionale Zeitstruktur.<br />
Wie aber kann eine wirkliche Gegenwart<br />
verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, ohne dass<br />
die gegenwärtige Person empirisch anwesend<br />
wäre? Eine stets genannte Annäherung<br />
bil<strong>de</strong>t das Beispiel <strong>de</strong>s Liebesbriefes,<br />
durch <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Absen<strong>de</strong>r die<br />
räumliche Distanz zu überbrücken versucht<br />
und gleichsam eine Spur seiner<br />
Anwesenheit zieht. Dem Adressaten<br />
wird durch diese Spur die weit weg<br />
weilen<strong>de</strong> Person gegenwärtig – und<br />
dies in weit intensiverer Weise als das<br />
bei <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Person <strong>de</strong>r Fall ist, die<br />
vor wenigen Minuten noch im voll besetzten<br />
Bus neben <strong>de</strong>m Briefempfänger<br />
gestan<strong>de</strong>n hat. Die Analogie en<strong>de</strong>t<br />
aber spätestens bei <strong>de</strong>m Umstand, dass<br />
die geliebte Person zurückkehren kann<br />
und dann auch wie<strong>de</strong>r empirisch präsent<br />
wäre.<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
4.2 Didaktische Anschlussmöglichkeiten<br />
Die bei<strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n didaktischen<br />
Sequenzen haben eine Annäherung an<br />
die Glaubensvorstellung <strong>de</strong>r Realpräsenz<br />
Christi zum Ziel.<br />
Sequenz 1<br />
(1) Je<strong>de</strong>r Teilnehmer erhält ein Kärtchen,<br />
auf <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Satz steht: „Wo zwei<br />
o<strong>de</strong>r drei in meinem Namen versammelt<br />
sind, da bin ich mitten unter ihnen“<br />
(Mt 18,20). Die Aufgabe lautet, sich zunächst<br />
in Stillarbeit, dann vor <strong>de</strong>r Lerngruppe<br />
zu dieser Zusage Jesu zu äußern.<br />
(2) Die Situation personaler Gegenwart<br />
trotz körperlicher Abwesenheit kann,<br />
sofern niemand sonst auf diesen Gedanken<br />
kommt, vom Leiter <strong>de</strong>r Gruppe am<br />
Beispiel eines Briefes erläutert wer<strong>de</strong>n.<br />
Ein letzter, kurz vor <strong>de</strong>m Tod an <strong>de</strong>n<br />
Freund abgeschickter Brief vergegenwärtigt<br />
<strong>de</strong>m Adressaten nicht nur die<br />
Person <strong>de</strong>s Absen<strong>de</strong>rs; <strong>de</strong>r Brief wird<br />
<strong>de</strong>m Empfänger zum Vermächtnis <strong>de</strong>s<br />
Verstorbenen.<br />
(3) Den gedanklichen Bogen zur Eucharistie<br />
schlägt die lukanische Erscheinungserzählung<br />
von <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Jüngern,<br />
die <strong>de</strong>r auferweckte Jesus auf ihrem<br />
Weg nach Emmaus begleitete (Lk<br />
24,12-35). Von ihnen heißt es: „Sie waren<br />
wie mit Blindheit geschlagen und<br />
erkannten ihn nicht“ (V16). Erst als Jesus<br />
das Brot segnete, brach und <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n<br />
Jüngern zu essen gab, „gingen ihnen<br />
die Augen auf, und sie erkannten<br />
ihn“ (V 31). Die Metaphern von <strong>de</strong>n<br />
mit Blindheit geschlagenen Jüngern,<br />
<strong>de</strong>nen erst beim Brotbrechen die Augen<br />
aufgehen, weisen darauf hin, dass in<br />
<strong>de</strong>r Emmaus-Erzählung von <strong>de</strong>r personalen<br />
Gegenwart <strong>de</strong>s erhöhten Herrn,<br />
nicht aber von seiner physischen Anwesenheit<br />
die Re<strong>de</strong> ist. Dafür spricht<br />
auch die Fortsetzung von V 31: Im Augenblick<br />
<strong>de</strong>r (Glaubens-) Erkenntnis sahen<br />
sie ihn nicht mehr, <strong>de</strong>nn war er verschwun<strong>de</strong>n.<br />
Die Erkenntnis geschieht<br />
im Nachhinein: „Brannte uns nicht das<br />
Herz in <strong>de</strong>r Brust, als er unterwegs mit<br />
uns re<strong>de</strong>te ..?“ (V 32)<br />
Sequenz 2<br />
(1) Die Teilnehmer erhalten ein Kärtchen,<br />
auf welchem folgen<strong>de</strong> Sätze aus<br />
<strong>de</strong>m Johannes-Evangelium in <strong>de</strong>r Übersetzung<br />
von Klaus Berger/Christiane<br />
Nord abgedruckt sind: „Ich bin das Lebensbrot<br />
vom Himmel ... Wer mein<br />
Fleisch kaut und mein Blut schlürft, lebt<br />
für immer ... Wer so isst und trinkt, <strong>de</strong>r<br />
bleibt bei mir und ich bleibe bei ihm“<br />
(Joh 6,41.54.56). Wie in Sequenz 1 besteht<br />
die Aufgabe darin, sich zunächst in<br />
Stillarbeit, dann in <strong>de</strong>r Gruppe zu diesen<br />
irritieren<strong>de</strong>n Formulierungen zu äußern.<br />
An <strong>de</strong>r drastischen Metaphorik, welche<br />
Jesus in seiner Re<strong>de</strong> über <strong>de</strong>s Himmelsbrot<br />
verwen<strong>de</strong>t, nahmen bereits die<br />
anwesen<strong>de</strong>n Zuhörer Anstoß. Im Gespräch<br />
mit <strong>de</strong>n ebenfalls verwirrten Jüngern<br />
räumte Jesus das mögliche Missverständnis<br />
eines kannibalistischen Verzehrs<br />
aus: „Lebendig macht doch nur <strong>de</strong>r<br />
Heilige Geist. Fleisch und Blut nützen<br />
nichts“ (V 63). Den Hintergrund bil<strong>de</strong>t<br />
die johanneische Vorstellung einer Bindung<br />
<strong>de</strong>s Wortes Gottes bzw. <strong>de</strong>s göttlichen<br />
Geistes an die Person Jesus; <strong>de</strong>shalb<br />
lautet die Auffor<strong>de</strong>rung, sich ganz<br />
auf seine Person einzulassen. 15 Wem dies<br />
gelingt, <strong>de</strong>m ist Jesus (und <strong>de</strong>r Geist Gottes)<br />
gegenwärtig – alltagssprachlich: „in<br />
Fleisch und Blut übergegangen“.<br />
(2) Bildbetrachtung: Harald Duwe<br />
(1926-1984), Abendmahl (1978) 16<br />
a) Im Anschluss an die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit Joh 6 wird <strong>de</strong>r Lerngruppe<br />
Harald Duwes Bild präsentiert, ohne<br />
dabei <strong>de</strong>n Titel „Abendmahl“ zu nennen.<br />
Dieses 160 x 280 cm große Ölgemäl<strong>de</strong><br />
hängt in <strong>de</strong>n Räumen <strong>de</strong>r Evangelischen<br />
Aka<strong>de</strong>mie Tutzing und hat<br />
für kontroverse Diskussionen gesorgt.<br />
Nach einer ersten Phase stiller Betrachtung<br />
wer<strong>de</strong>n die Teilnehmer aufgefor<strong>de</strong>rt,<br />
<strong>de</strong>m Bild einen Titel zu geben.<br />
Das Gespräch darüber leitet zu einer<br />
nächsten Phase intensiver gemeinsamer<br />
Bil<strong>de</strong>rschließung über.
Harald Duwe (1926-1984) · Abendmahl (1978) © Evangelische Aka<strong>de</strong>mie, Tutzing<br />
b) Der Betrachter schaut in einen düsteren<br />
Raum; <strong>de</strong>r Spalt eines heruntergelassenen<br />
Rollos lässt in eine unbestimmte<br />
Außenwelt blicken. Zwölf Männer,<br />
die in zeitgenössischen, etwas altmodischen<br />
Anzügen geklei<strong>de</strong>t sind, haben<br />
sich dicht gedrängt um einen Tisch<br />
gruppiert. Es han<strong>de</strong>lt sich übrigens um<br />
<strong>de</strong>n Maler (mit <strong>de</strong>m Löffel in <strong>de</strong>r Hand)<br />
und seine Freun<strong>de</strong>. Die Männer schweigen,<br />
sie schauen sich nicht an. Sie scheinen<br />
sich mit <strong>de</strong>m auseinan<strong>de</strong>r zu setzen,<br />
was sich auf <strong>de</strong>m Tisch befin<strong>de</strong>t.<br />
In einer großen Schüssel ist das<br />
Antlitz eines männlichen Kopfes zu sehen.<br />
Vom Betrachter aus links neben<br />
<strong>de</strong>r Schüssel liegt auf einem Teller ein<br />
abgetrennter Fuß. Hinter <strong>de</strong>r Schüssel<br />
ist eine geöffnete Hand mit einer tiefen<br />
Wun<strong>de</strong>, am rechten Bildrand ein weiterer<br />
Teller mit einem Herz zu erkennen.<br />
In <strong>de</strong>r daneben befindlichen geöffneten<br />
Konservendose liegen lange Nägel.<br />
Halb von einem Brötchen ver<strong>de</strong>ckt lassen<br />
sich die Buchstaben RI entziffern,<br />
welche sich zu INRI ergänzen lassen.<br />
Auf <strong>de</strong>r schmutzigen Tisch<strong>de</strong>cke liegt<br />
noch ein angeschnittenes Stangenbrot;<br />
in einem Dreieck um die Schüssel angeordnet<br />
stehen drei Weingläser mit rotem<br />
Inhalt.<br />
Die Mitte <strong>de</strong>s Bil<strong>de</strong>s, etwas durch<br />
<strong>de</strong>n sich auf <strong>de</strong>n Tisch aufstützen<strong>de</strong>n<br />
Mann ver<strong>de</strong>ckt, bil<strong>de</strong>t jedoch ein leerer<br />
Stuhl, <strong>de</strong>ssen Rücklehne buchstäblich<br />
aus <strong>de</strong>n Fugen geraten ist.<br />
Das finstere Szenario <strong>de</strong>r stumm vor<br />
<strong>de</strong>n Leichenteilen Jesu brüten<strong>de</strong>n zwölf<br />
nicht mehr ganz jungen Männer wird<br />
durch die ge<strong>de</strong>ckte Farbigkeit, die einem<br />
vergilbten Foto ähnelt, verstärkt.<br />
c) Die Provokation von Duwes Bild besteht<br />
darin, dass das Abendmahl keineswegs<br />
symbolisch, son<strong>de</strong>rn als ein<br />
reales Essen dargestellt wird. Hat <strong>de</strong>r<br />
Maler die krasse Metaphorik aus Joh 6<br />
wörtlich genommen, also missverstan<strong>de</strong>n<br />
wie zuerst auch die Jünger? Und<br />
wenn er sie missverstan<strong>de</strong>n haben sollte:<br />
Wie sind Jesu Worte in Joh 6 und seine<br />
Deutungsworte über Brot und Wein –<br />
bei<strong>de</strong> stehen ja für die Präsenz <strong>de</strong>s erhöhten<br />
Christus – zu verstehen?<br />
Bei <strong>de</strong>r Beantwortung dieser Fragen<br />
kann, wie in Sequenz 1 angeführt,<br />
die Emmaus-Erzählung weiter helfen.<br />
d) Eine vertiefte Interpretation stützt<br />
sich auf die Beobachtung, dass ein leerer<br />
Stuhl im Zentrum <strong>de</strong>s Bil<strong>de</strong>s steht.<br />
Diesen jetzt nicht mehr funktionstüchtigen<br />
Stuhl hat <strong>de</strong>nnoch niemand beiseite<br />
gestellt, vielmehr steht o<strong>de</strong>r sitzt<br />
die Abendmahlsgemeinschaft um ihn<br />
herum. Was gibt <strong>de</strong>r leere Stuhl <strong>de</strong>n<br />
Zwölf – und uns, <strong>de</strong>n Betrachtern <strong>de</strong>s<br />
Bil<strong>de</strong>s – zu <strong>de</strong>nken?<br />
Der leere Stuhl lässt sich als eine<br />
Spur lesen – als die Spur <strong>de</strong>ssen, <strong>de</strong>r zuvor<br />
noch auf diesem Stuhl gesessen hat;<br />
als Abwesen<strong>de</strong>r ist er <strong>de</strong>nnoch anwesend,<br />
als Person präsent. Als physisch<br />
Anwesen<strong>de</strong>r hingegen – als Haupt, Herz,<br />
Hand, Kopf und (im Glas aufgefangenes)<br />
Blut – ist er tot und nicht mehr als<br />
eine Leiche. Sinnt etwa je<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r zwölf<br />
„Jünger“ über diese <strong>de</strong>nkwürdige Dialektik<br />
von Anwesenheit und Abwesenheit<br />
nach, ohne bislang zu einer Lösung<br />
gekommen zu sein?<br />
5. Schlussbetrachtung<br />
Der österreichische Künstler Arnulf<br />
Rainer (geb. 1929) hat in <strong>de</strong>n Jahren 1995<br />
bis 1998 einen Zyklus von 160 Bibelübermalungen<br />
geschaffen. Sie sind das<br />
Ergebnis seiner Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit<br />
Bildvorlagen aus <strong>de</strong>m 10. bis 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt.<br />
Zwei Illustrationen widmen sich<br />
<strong>de</strong>m „Letzten Abendmahl“, wobei das<br />
hier vorzustellen<strong>de</strong> Bild sich am entschie<strong>de</strong>nsten<br />
von seiner Vorlage entfernt hat. 17<br />
Als Grundlage <strong>de</strong>s 18,4 cm hohen<br />
und 12,5 cm breiten Werkes dient ein<br />
künstlerisch eher schlicht gefertigter<br />
Holzschnitt aus <strong>de</strong>m „Spiegel menschlicher<br />
Behältnis“ von 1476. Er zeigt Jesus<br />
und seine zwölf Jünger, die sich zum<br />
Abendmahl um einen ovalen Tisch versammelt<br />
haben. Die gesamte Gruppe<br />
bil<strong>de</strong>t wie<strong>de</strong>rum ein großes, <strong>de</strong>n linken<br />
und rechten Bildrand berühren<strong>de</strong>s Oval,<br />
welches <strong>de</strong>r Künstler mit Aquarellkrei<strong>de</strong><br />
rot übermalt hat. Die darauf aufgetragene<br />
<strong>de</strong>cken<strong>de</strong> gelbe Ölkrei<strong>de</strong> macht<br />
aus <strong>de</strong>m Oval <strong>de</strong>r Jünger eine Mandorla.<br />
Das von ihr Umschlossene wird hierdurch<br />
beson<strong>de</strong>rs herausgehoben: Am<br />
oberen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Tisches sitzt Christus<br />
mit <strong>de</strong>m Kreuznimbus, in seinen Armen<br />
ruht <strong>de</strong>r Lieblingsjünger Johannes.<br />
Leicht oberhalb <strong>de</strong>r Bildmitte steht eine<br />
Schüssel mit <strong>de</strong>m Paschalamm auf<br />
<strong>de</strong>m Tisch. Am unteren En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Tisches<br />
sitzen drei Apostel; von <strong>de</strong>m mittleren<br />
ist nur <strong>de</strong>r Hinterkopf zu sehen, <strong>de</strong>m<br />
rechten fehlt <strong>de</strong>r Nimbus.<br />
Durch zwei relativ einfache malerische<br />
Eingriffe hat Rainer seine Bildvor-<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
187<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
188<br />
Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />
Arnulf Rainer (geb. 1929) · Letztes Abendmahl © Sammlung Frie<strong>de</strong>r-Burda<br />
lage zu einer ganz neuartigen Bibelillustration<br />
umgestaltet: Er hat die schwarzen<br />
Linien <strong>de</strong>s Holzschnittes mit roter<br />
Krei<strong>de</strong> übermalt und die sonnengelbe<br />
Mandorla hinzugefügt. Die starken Farben<br />
intensivieren die Aussage <strong>de</strong>r über<br />
fünfhun<strong>de</strong>rt Jahre alten Vorlage.<br />
In <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Mandorla umgriffenen<br />
Fläche ist das Rot bei <strong>de</strong>r Christusgestalt<br />
am tiefsten. Die rote Farbe verweist<br />
auf das aus Menschenliebe am<br />
Kreuz vergossene Blut Christi, auf die<br />
Hingabe seines Lebens für uns. Dem<br />
korrespondiert die Vorlage: Vor Jesus<br />
befin<strong>de</strong>t sich das gebratene, erbärmlich<br />
anzusehen<strong>de</strong> Paschalamm; als anamnetisches<br />
Symbol erinnert es an das Blut,<br />
mit <strong>de</strong>m die Israeliten vor <strong>de</strong>m Exodus<br />
ihre Türen bestrichen haben. Die Bildanordnung<br />
legt nahe, dass Jesus als das<br />
wahre Paschalamm 18 dargestellt ist.<br />
Die Abendmahlsgesellschaft wird<br />
von einer tief gelben Mandorla umfangen,<br />
die ihr Licht nach außen abstrahlt.<br />
Im Inneren <strong>de</strong>r Gloriole befin<strong>de</strong>t sich<br />
<strong>de</strong>r gesichtslose Jünger, <strong>de</strong>r genau gegenüber<br />
von Jesus auf diesen zu blicken<br />
scheint. Repräsentiert er vielleicht<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
<strong>de</strong>n Gläubigen, <strong>de</strong>r in<br />
<strong>de</strong>r Eucharistie auf <strong>de</strong>n<br />
mensch-gewor<strong>de</strong>nen<br />
Gott blickt? Dass außer<strong>de</strong>m<br />
noch <strong>de</strong>r einzige<br />
Jünger ohne Nimbus<br />
– vermutlich Judas –<br />
vom Licht umstrahlt<br />
wird, überrascht.<br />
Rainers sonnengelbe<br />
Übermalung hebt hervor,<br />
dass die Mandorla<br />
eine archetypische Form<br />
<strong>de</strong>s Weiblichen repräsentiert.<br />
Damit kommt<br />
<strong>de</strong>r mystische Aspekt<br />
<strong>de</strong>r (Wie<strong>de</strong>r-)Geburt<br />
zum Tragen. Denn das<br />
Geschehen, das stets neu<br />
im Herzen <strong>de</strong>r Gläubigen<br />
„geboren“ wer<strong>de</strong>n<br />
muss, fin<strong>de</strong>t in <strong>de</strong>r Eucharistiefeier<br />
seine liturgische<br />
Gestalt: Es ist die<br />
im Geist zu erkennen<strong>de</strong><br />
Gegenwart <strong>de</strong>s menschgewor<strong>de</strong>nen<br />
Gottes inmitten seiner<br />
Schöpfung – in einer Welt, die noch immer<br />
ihrer Vollendung harrt.<br />
Anmerkungen<br />
0*<br />
In <strong>de</strong>r nächsten Ausgabe <strong>de</strong>r INFO „Der Sinn für die<br />
Fülle“ wird das Thema durch einen Beitrag von Dr.<br />
Eckhard Nordhofen „Tut dies zu meinem Gedächtnis“<br />
– Unterrichtspraxis für das Sakrament <strong>de</strong>r Inkarnation<br />
– weiter vertieft.<br />
01 Meinem Kollegen Bruno Welter danke ich für die<br />
engagierten Diskussionen über das Thema.<br />
02 Für <strong>de</strong>n Islam ist die Herabsendung <strong>de</strong>s präexistenten<br />
Korans das normative Ereignis.<br />
03 Hebr.: pessach; aram.: pas’cha; gr.: pascha.<br />
04 Zur ersten Information siehe die Artikel Abendmahl/Se<strong>de</strong>r<br />
sowie Pesach/Ostern in: Jakob J. Petuchowski/Clemens<br />
Thoma: Lexikon <strong>de</strong>r jüdischchristlichen<br />
Begegnung. Freiburg/Basel/Wien. 1989.<br />
05 AT: Ex 12,14; 13,3; Dtn 16,3. – NT: Lk 22,19; 1 Kor 11,<br />
24.25.<br />
06 Siehe: Anamnese. III. Biblisch und IV. Theologisch.<br />
In: LThK 31993, Bd. 1, Sp. 590-592.<br />
07 Ausführlich informiert das Werk <strong>de</strong>s Rabbiners Israel<br />
Meir Lau: Wie Ju<strong>de</strong>n leben. Glaube, Alltag, Feste.<br />
Gütersloh 1988, 243-269. – Die jüngste Darstellung<br />
stammt von Susanne Galley: Das jüdische Jahr.<br />
Feste, Ge<strong>de</strong>nk- und Feiertage. München. 2003, 128-<br />
148. – Arbeitsmaterial: Ursula Rudnick/Michael<br />
Wermke (Hg.): Geborgen unter Gottes Flügeln. Ein<br />
Lese- und Studienbuch zum Pessachfest, zu Schabbat,<br />
Synagoge und Gottesdienst. Loccum. 1997. (Arbeitshilfe<br />
Gymnasium 9).<br />
08 Pessach – Gedanken zum jüdischen Fest <strong>de</strong>s ungesäuerten<br />
Brotes. 16 Min. Deutschland. 1993.<br />
(FWU). Pessach. Fest und Feier im Ju<strong>de</strong>ntum.<br />
15 Min. Deutschland. 1994. (Calwer Verlag und Matthias-Film).<br />
09 Dazu: Astrid Grewe: Erinnern lernen. Didaktische<br />
Ent<strong>de</strong>ckungen in <strong>de</strong>r jüdischen Kultur <strong>de</strong>s Erinnerns.<br />
Neukirchen-Vluyn. 1999.<br />
10 Den „disguised symbolism“ (Erwin Panowsky) <strong>de</strong>s<br />
Altbil<strong>de</strong>s entschlüsselt Aloys Butzkamm: Bild und<br />
Frömmigkeit im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Der Sakramentsaltar<br />
von Dirk Bouts in <strong>de</strong>r St.-Peters-Kirche zu Loewen.<br />
Pa<strong>de</strong>rborn. 1990. Als Diaserie in: Jörg Zink: Dia-<br />
Bücherei Christliche Kunst. Bd. 12 Taufe und<br />
Eucharistie. Eschbach. 1983. – Vorzügliche Abbildungen<br />
und <strong>de</strong>n <strong>Stand</strong> wissenschaftlicher Forschung<br />
bietet <strong>de</strong>r Katalog: Dirk Bouts (ca. 1410-1475), een<br />
Vlaams primitief te Leuven. Leuven. 1998.<br />
11 Wichtige Informationen auf knappen Raum bietet:<br />
Franz Mußner: Was hat Jesus Neues in die Welt gebracht?<br />
Stuttgart. 2001. 59-63 (Feier <strong>de</strong>r Eucharistie).<br />
Ausführlich: Thomas Söding: „Tut dies zu meinem<br />
Gedächtnis!“ Das Abendmahl Jesu und die Eucharistie<br />
<strong>de</strong>r Kirche nach <strong>de</strong>m Neuen Testament. In: <strong>de</strong>rs.<br />
(Hg.): Eucharistie. Positionen katholischer Theologie.<br />
Regensburg. 2002. 11-58. S. auch: „Zwei Gesten und<br />
zwei Worte“. Ein Gespräch mit <strong>de</strong>m Neutestamentler<br />
Thomas Söding über die Eucharistie. In: Her<strong>de</strong>r-<br />
Korrespon<strong>de</strong>nz 57 (2003) 285-291.<br />
12 Vgl. Butzkamm.<br />
13 Die Hostie (lat.: hostia, d. h. Schlacht- , Sühnopfer) wird<br />
aus Wasser und reinem Weizenmehl ohne Backtriebmittel<br />
wie etwa Hefe hergestellt. Darüber informiert<br />
anschaulich die Hostienbäckerei Kloster Vinnenberg:<br />
www.hostienbaeckerei.<strong>de</strong>.<br />
14 Ausführlich: Josef Wohlmuth: Eucharistie als liturgische<br />
Feier <strong>de</strong>r Gegenwart Jesu Christi. Realpräsenz<br />
und Transsubstantiation im Verständnis <strong>de</strong>r katholischen<br />
Theologie. In: Söding, Thomas (Hg.): Eucharistie.<br />
Positionen katholischer Theologie. Regensburg.<br />
2002. 87-119.<br />
15 Vgl.: Berger, Klaus: Im Anfang war Johannes. Datierung<br />
und Theologie <strong>de</strong>s vierten Evangeliums. Stuttgart.<br />
1997. 208-217.<br />
16 Abgebil<strong>de</strong>t in: Horst Schwebel: Die Bibel in <strong>de</strong>r Kunst.<br />
Das 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Stuttgart. 1994. 90f. – Als Dia<br />
Nr. 11 in: Mertin, Andreas/Schmidt, Heinz-Ulrich:<br />
„Nehmet hin und esset ...“ Das Abendmahl im Bild<br />
<strong>de</strong>r Zeit. 15 Dias zum Unterrichtsentwurf <strong>de</strong>r Ausgabe<br />
3/1986 von „forum religion“.<br />
17 Abgebil<strong>de</strong>t in: Arnulf Rainer: Bibelübermalungen.<br />
Aus <strong>de</strong>r Sammlung Frie<strong>de</strong>r Burda. Hrsg. von Helmut<br />
Frie<strong>de</strong>l. Ostfil<strong>de</strong>rn-Ruit. 2000. Nr. 126. Im Internet unter:<br />
www.sammlung-frie<strong>de</strong>r-burda.<strong>de</strong>.<br />
18 Vgl. 1 Kor 5,7; Joh 1,29.36 (Johannes <strong>de</strong>r Täufer bezeichnet<br />
Jesus als „Lamm Gottes“); Joh 19,28-30 (Tod<br />
Jesu zu <strong>de</strong>r Zeit, als die Paschalämmer im Tempel<br />
geschlachtet wer<strong>de</strong>n).<br />
Thomas Menges (Aachen) arbeitet<br />
seit 1994 als Dozent am Katechetischen<br />
Institut <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s Aachen mit<br />
<strong>de</strong>m Schwerpunkt Gymnasien/Gesamtschulen<br />
S II.
Memini ergo sum<br />
Christopher Nolans Spielfilm MEMENTO als filmisches<br />
Essay über Gedächtnis und Erinnerung Franz-Günther Weyrich<br />
Es ist das fast schon alltägliche Déjà-vu:<br />
Ich sehe mir <strong>de</strong>n neuesten Blockbuster<br />
aus Hollywood an, und irgendwie<br />
kommt es mir so vor, als hätte ich<br />
diesen Film schon einmal gesehen: Die<br />
Handlung, die Figuren, die dramatischen<br />
Verwicklungen <strong>de</strong>r Geschichte,<br />
all das ist so o<strong>de</strong>r so ähnlich schon unzählige<br />
Male vorher bereits verarbeitet<br />
wor<strong>de</strong>n. Die Griechen hatten doch<br />
Recht: Auch die Filmgeschichte ist<br />
nichts an<strong>de</strong>res als die ewige Wie<strong>de</strong>rkehr<br />
<strong>de</strong>s Immergleichen. Doch die<br />
Griechen kannten Christopher Nolan<br />
nicht. Zunächst lässt sich auch die Geschichte<br />
seines Films MEMENTO auf ein<br />
Muster reduzieren, das <strong>de</strong>m Kinogänger<br />
mehr als vertraut vorkommt: Eine<br />
Frau ist vergewaltigt und ermor<strong>de</strong>t<br />
wor<strong>de</strong>n, und da die Polizei <strong>de</strong>n Täter<br />
nicht fin<strong>de</strong>n kann, macht sich ihr Mann<br />
auf die Suche, um <strong>de</strong>n Tod seiner Frau<br />
zu rächen. Und <strong>de</strong>m Zuschauer bleibt<br />
in solchen Fällen zumeist nur die Frage:<br />
Wer war <strong>de</strong>r Täter? Wird er sie rächen<br />
können? Doch bei MEMENTO ist<br />
alles an<strong>de</strong>rs. Nolan entwickelt für seinen<br />
Film ein Strukturprinzip, für das es<br />
in <strong>de</strong>r gesamten Filmgeschichte kein<br />
Beispiel gibt, und er stellt damit <strong>de</strong>n<br />
Zuschauer vor Herausfor<strong>de</strong>rungen, die<br />
an die Grenze <strong>de</strong>ssen gehen, was in <strong>de</strong>r<br />
Filmrezeption möglich ist.<br />
Die Struktur <strong>de</strong>s Films wird bereits<br />
in <strong>de</strong>r Exposition <strong>de</strong>utlich: Wir sehen<br />
ein Polaroid-Foto, auf <strong>de</strong>m ein Toter zu<br />
sehen ist. Die Hand we<strong>de</strong>lt mit <strong>de</strong>m Foto<br />
und das Bild beginnt allmählich zu<br />
verschwin<strong>de</strong>n, bis schließlich nichts<br />
mehr darauf zu sehen ist – das Bild verschwin<strong>de</strong>t<br />
in <strong>de</strong>r Kamera – <strong>de</strong>r Fotograf<br />
nimmt das Bild auf – eine Patrone<br />
liegt auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n, sie fängt an zu<br />
rollen und verschwin<strong>de</strong>t in <strong>de</strong>r Pistole –<br />
<strong>de</strong>r Ermor<strong>de</strong>te steht auf und starrt mit<br />
Memento © cinetext<br />
angstverzerrtem Gesicht in die Kamera.<br />
Spätestens hier ist <strong>de</strong>m Zuschauer<br />
klar, dass die Szene im Rückwärtsgang<br />
abläuft. Was an dieser Stelle noch nicht<br />
erkennbar ist, son<strong>de</strong>rn sich erst im weiteren<br />
Verlauf <strong>de</strong>s Films erschließt, ist,<br />
dass hier am Anfang <strong>de</strong>s Films das En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Geschichte erzählt wird: Wir sehen<br />
die Rache <strong>de</strong>s Mannes und meinen<br />
<strong>de</strong>n Täter zu kennen. Was kann nun folgen?<br />
Nolans Konzept ist ebenso „einfach“<br />
wie genial: Was folgt, ist das, was<br />
vorher passiert ist, d. h. <strong>de</strong>r „Rückwärtsgang“<br />
ist das durchgängig und bis<br />
zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Films durchgehaltene<br />
Strukturmuster <strong>de</strong>s Films: Je<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Chronologie <strong>de</strong>s Films folgen<strong>de</strong> Szene<br />
liegt in <strong>de</strong>r Chronologie <strong>de</strong>r Geschichte<br />
genau vor <strong>de</strong>r zuletzt gesehenen Szene,<br />
und am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Films sehen wir <strong>de</strong>n<br />
Anfang <strong>de</strong>r Geschichte. Zugleich aber<br />
wird diese „Rückwärtsbewegung“ überlagert<br />
von einer (klassischen) Vorwärtsbewegung.<br />
In eingeschobenen Schwarz-<br />
weißszenen sehen wir die Hauptfigur<br />
<strong>de</strong>s Films in einem Zimmer ihre bzw.<br />
eine Vorgeschichte erzählen.<br />
Zweierlei dürfte an dieser Stelle bereits<br />
<strong>de</strong>utlich sein: 1. Eine klassische Inhaltsangabe<br />
<strong>de</strong>s Films ist hier nicht möglich.<br />
Denn welcher Chronologie sollte<br />
sie folgen: <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Films o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Geschichte? 2. Der Film erfor<strong>de</strong>rt ein<br />
Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration,<br />
das in <strong>de</strong>r Tat an die Grenzen<br />
<strong>de</strong>s Möglichen geht. Ein interessantes<br />
Konzept, ein strukturalistischer „Gag“,<br />
ein filmisches Experiment?! Zweifelsohne.<br />
Doch was die Auszeichnung „genial“<br />
bei Nolans Films m. E. rechtfertigt,<br />
liegt nicht allein in <strong>de</strong>r Struktur als<br />
solcher. Sie ist nicht Selbstzweck, son<strong>de</strong>rn<br />
steht im Dienst seiner Geschichte.<br />
Die Hauptfigur <strong>de</strong>s Films hat die Vergewaltigung<br />
und Ermordung ihrer<br />
Frau hilflos mit ansehen müssen. Der<br />
Schock hat bei ihr zu einer Gedächtnisbzw.<br />
Erinnerungsstörung geführt. An<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
189<br />
Religion & Populär-Kultur
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
190<br />
Religion & Populär-Kultur<br />
Memento © cinetext<br />
alles, was vor <strong>de</strong>r Tat passierte, erinnert<br />
sie sich noch „normal“, für die Ereignisse<br />
ab <strong>de</strong>r Tat jedoch reicht ihr Erinnerungsvermögen<br />
nur jeweils 15 Minuten<br />
zurück. Was vorher geschah, vergisst<br />
sie sofort. Was Nolan also mit seiner<br />
„Rückwärtserzählung“ erreicht, ist<br />
nichts an<strong>de</strong>res, als dass <strong>de</strong>r Zuschauer<br />
in die Situation <strong>de</strong>r Hauptfigur hineinversetzt<br />
wird. So wie diese, weil sie es<br />
vergessen hat, wissen auch wir nicht,<br />
was vorher geschehen ist, weil wir es<br />
erst in <strong>de</strong>r nachfolgen<strong>de</strong>n Szene erfahren.<br />
Damit verdichtet sich <strong>de</strong>r Film<br />
gleich in mehrfacher Hinsicht zu einer<br />
Reflexion über Gedächtnis und Erinnerung,<br />
die an Eindrücklichkeit und Tiefe<br />
ihresgleichen sucht.<br />
Zurück zur Geschichte: Die zentrale<br />
Aufgabe <strong>de</strong>r Hauptfigur, Leonard<br />
o<strong>de</strong>r Lennie, wie ihn seine Frau nannte,<br />
ist eine investigative. Er will herausfin<strong>de</strong>n,<br />
wer seine Frau getötet hat, um ihren<br />
Tod zu rächen. Ein solches investigatives<br />
Unternehmen heißt: Fakten sammeln,<br />
sie verbin<strong>de</strong>n, verarbeiten, um einen<br />
Vorgang, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />
liegt, zu rekonstruieren. Unabdingbar<br />
notwendig ist hier aber gera<strong>de</strong> eine Gedächtnisleistung,<br />
zu <strong>de</strong>r Leonard auf<br />
Grund seiner mentalen Störung gar nicht<br />
in <strong>de</strong>r Lage ist. So muss er seine Erinnerung<br />
„künstlich“ herstellen: Er nimmt<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Polaroid-Fotos von seinem Hotel und<br />
<strong>de</strong>n Menschen auf, die er kennt, und<br />
beschriftet sie. Sie wer<strong>de</strong>n mit Namen<br />
und Kommentaren versehen, um sie so<br />
in seine Untersuchung, in sein Leben<br />
einordnen zu können. Die beson<strong>de</strong>rs<br />
wichtigen Fakten – sie betreffen seine<br />
Aufgabe, die Ermittlung und Bestrafung<br />
<strong>de</strong>s Täters – tätowiert er sich auf<br />
seinen Körper. Den Ausgangspunkt <strong>de</strong>s<br />
Films, also <strong>de</strong>n Endpunkt <strong>de</strong>r Geschichte,<br />
kann <strong>de</strong>r Zuschauer bald einordnen:<br />
Es han<strong>de</strong>lt sich hier um <strong>de</strong>n Vollzug <strong>de</strong>r<br />
Rache. Leonard erschießt Teddy, die<br />
zweite Hauptfigur <strong>de</strong>s Films, als vermeintlichen<br />
Mör<strong>de</strong>r seiner Frau. Die<br />
Leitfragen für <strong>de</strong>n Zuschauer sind damit<br />
nicht mehr die klassischen eines je<strong>de</strong>n<br />
Krimis „Wer war es?“, „Wird <strong>de</strong>r<br />
Täter gefasst?“ son<strong>de</strong>rn „Wie kommt<br />
es dazu?“, „Warum tut er das?“ Dabei<br />
wird im Verlauf <strong>de</strong>s Films bald <strong>de</strong>utlich,<br />
dass Leonards „Ermittlungen“ eine<br />
unerwartete Wendung genommen haben,<br />
die die Zuverlässigkeit seiner „Aufzeichnungen“<br />
immer mehr in Frage<br />
stellt. Zu<strong>de</strong>m war es gera<strong>de</strong> jener Teddy,<br />
<strong>de</strong>r Leonard immer wie<strong>de</strong>r darauf<br />
aufmerksam machte, dass die Menschen<br />
seine Gedächtnisstörung ausnutzen,<br />
um ihn für ihre Zwecke zu benutzen.<br />
Doch da das Polaroid-Foto von<br />
Teddy Leonards Vermerk trägt „Trau<br />
seinen Lügen nicht“, glaubt er <strong>de</strong>ssen<br />
Warnungen nicht. Nicht nur, dass <strong>de</strong>r<br />
Portier in Leonards Hotel diesem gleich<br />
zwei Zimmer vermietet – „Die Zeiten<br />
sind schlecht“ –, gravieren<strong>de</strong>r für Leonards<br />
Rekonstruktion <strong>de</strong>r Ereignisse ist<br />
die Figur <strong>de</strong>r Nathalie, auf die er im<br />
Lauf seiner Ermittlungen stößt und die<br />
ihm ihre Hilfe anbietet. Sie liefert Leonard<br />
die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Indizien für<br />
Teddy als <strong>de</strong>m Mör<strong>de</strong>r von Leonards<br />
Frau. Für sie aber ist jener Teddy verantwortlich<br />
für <strong>de</strong>n Tod ihres Freun<strong>de</strong>s<br />
– seine Rache ist also in Wahrheit die<br />
ihre. Und auch auf einen weiteren ihrer<br />
„Fein<strong>de</strong>“ setzt Nathalie Leonard an. In<br />
einer Szene <strong>de</strong>s Films kommt sie mit<br />
bluten<strong>de</strong>m Gesicht ins Zimmer. Ein gewisser<br />
Dodd habe ihr die Verletzungen<br />
zugefügt, woraufhin sich Leonard auf<br />
die Suche nach ihm macht. Die folgen<strong>de</strong><br />
Szene zeigt die „Vorgeschichte“: Im<br />
gleichen Zimmer sammelt Nathalie in<br />
Eile alle Schreibutensilien ein und provoziert<br />
Leonard zugleich so, dass dieser<br />
sie blutig schlägt. Sie verlässt die<br />
Wohnung und wartet im Auto vor <strong>de</strong>m<br />
Haus so lange, bis Leonard, <strong>de</strong>r vergeblich<br />
nach einem Stift sucht um diese „Erinnerung“<br />
festzuhalten, alles vergessen<br />
hat. Als sie wie<strong>de</strong>r hereinkommt präsentiert<br />
sie ihm Dodd als ihren Peiniger.<br />
Die Schlusszene <strong>de</strong>s Films stellt<br />
<strong>de</strong>n letzten Wen<strong>de</strong>punkt <strong>de</strong>r Erzählung<br />
dar, <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong> Erzählstränge zusammenfügt.<br />
In <strong>de</strong>n Schwarzweißsequenzen <strong>de</strong>s<br />
Films befin<strong>de</strong>t sich Leonard in seinem<br />
Motelzimmer und telefoniert mit einem<br />
unbekannten Gesprächspartner. Dabei<br />
erfährt <strong>de</strong>r Zuschauer von Leonards<br />
(Vor-) Geschichte: Vor seiner Erkrankung<br />
arbeitet er als Versicherungsagent<br />
und ist dabei mit <strong>de</strong>m Fall eines gewissen<br />
Sammy Jenkis beauftragt. Dieser<br />
lei<strong>de</strong>t an <strong>de</strong>r gleichen Gedächtnisstörung<br />
wie später Leonard. Leonards<br />
Auftrag ist herauszufin<strong>de</strong>n, ob Sammy<br />
wirklich krank o<strong>de</strong>r nur ein Simulant<br />
ist, was seine Versicherung von Zahlungen<br />
entbin<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>. Verschie<strong>de</strong>ne<br />
Tests führen Leonard zu <strong>de</strong>r Schlussfolgerung,<br />
dass Sammy zwar tatsächlich<br />
krank, sein Lei<strong>de</strong>n aber nicht physischer,<br />
son<strong>de</strong>rn psychischer Natur ist.
Auch in diesem Fall braucht die Kasse<br />
nicht zu zahlen. Sammys Frau lei<strong>de</strong>t<br />
sehr unter <strong>de</strong>r Krankheit ihres Mannes<br />
und <strong>de</strong>r Unsicherheit, was <strong>de</strong>r Grund<br />
für sein Lei<strong>de</strong>n ist. Als sie von Leonard<br />
wissen will, ob ihr Mann simuliere, erhält<br />
sie von diesem die ausweichen<strong>de</strong><br />
Antwort: „Ich bin <strong>de</strong>r Meinung, er<br />
müsste neue Erlebnisse abspeichern<br />
können“. Das veranlasst sie, ihren Mann<br />
ein letztes Mal zu „prüfen“. Da sie zuckerkrank<br />
ist und Insulin braucht, das<br />
ihr Mann ihr auf ihre Auffor<strong>de</strong>rung hin<br />
spritzt, erinnert sie ihn „im Viertelstun<strong>de</strong>ntakt“<br />
an diese Spritze, um zu sehen,<br />
ob seine Liebe zu ihr <strong>de</strong>n Bann <strong>de</strong>s Vergessens<br />
sprengt. Sammy verweigert<br />
keine dieser Spritzen, und sie fällt<br />
durch diese Überdosis ins Koma und<br />
stirbt, was ihr Mann sich nicht erklären<br />
kann. In <strong>de</strong>n Erzählungen Leonards<br />
schimmert immer wie<strong>de</strong>r durch, dass er<br />
sich für dieses Geschehen (mit-)verantwortlich<br />
fühlt. In <strong>de</strong>r letzten <strong>de</strong>r<br />
Schwarzweißszenen, die nahtlos in<br />
Farbe übergeht, erhält Leonard dann<br />
von seinem Gesprächspartner einen Hinweis<br />
auf <strong>de</strong>n Mör<strong>de</strong>r seiner Frau. Er verlässt<br />
das Haus und trifft auf <strong>de</strong>m Weg<br />
Teddy, <strong>de</strong>r sich ihm als Polizist vorstellt.<br />
War er sein Gesprächspartner? In<br />
einem verfallenen Gebäu<strong>de</strong> trifft Leonard<br />
dann <strong>de</strong>n vermeintlichen Mör<strong>de</strong>r,<br />
<strong>de</strong>n Freund von Nathalie und er ermor<strong>de</strong>t<br />
ihn. Doch ein dahingehauchtes Wort<br />
„Sammy“ <strong>de</strong>s vermeintlich Toten weckt<br />
in Leonard Zweifel, ob er <strong>de</strong>n Richtigen<br />
getroffen hat. Als Teddy dazukommt,<br />
bedroht er diesen und stellt ihn<br />
zur Re<strong>de</strong>. Der angeschlagene Teddy offeriert<br />
Leonard daraufhin verschie<strong>de</strong>ne<br />
Versionen <strong>de</strong>s Geschehens: In Wahrheit<br />
habe Leonard selbst seine Frau getötet<br />
und zwar so, wie dies auch Sammy getan<br />
hat, <strong>de</strong>r in Wirklichkeit nur die Projektionsfläche<br />
für Leonards eigene Vergangenheit<br />
sei. Die zweite Version: Teddy<br />
sei <strong>de</strong>r ermitteln<strong>de</strong> Polizist in Mordfall<br />
seiner Frau gewesen. Der Täter sei<br />
ein Junkie gewesen, <strong>de</strong>n er Leonard als<br />
Täter präsentiert und <strong>de</strong>r sich daraufhin<br />
auch gerächt habe. Doch das Glücksgefühl<br />
auf Leonards Gesicht sei danach<br />
schnell verschwun<strong>de</strong>n, er habe sich an<br />
seine Rache nicht mehr erinnern können.<br />
So habe Teddy ihm immer weitere<br />
„Täter“ präsentiert, <strong>de</strong>ren Tötung gleichsam<br />
in „bei<strong>de</strong>rseitigem Interesse“ gelegen<br />
habe. Der so als „Killer“ missbrauchte<br />
Leonard legt daraufhin bewusst eine<br />
Spur, von <strong>de</strong>r er weiß, dass sie ihn später<br />
möglicherweise zu Teddy als Mör<strong>de</strong>r<br />
seiner Frau führen wird. Er lässt sich<br />
das Kennzeichen von Teddys Auto als<br />
Indiz für <strong>de</strong>n Mör<strong>de</strong>r seiner Frau auf<br />
<strong>de</strong>n Körper tätowieren.<br />
Wer auch immer von <strong>de</strong>n Lesern<br />
dieser Zeilen bis zu dieser Stelle durchgedrungen<br />
ist, <strong>de</strong>m wird sicherlich <strong>de</strong>utlich<br />
gewor<strong>de</strong>n sein, wie schwierig es<br />
ist, aus diesem Film eine Geschichte zusammenzusetzen.<br />
Und auch <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong><br />
Versuch behauptet nicht, <strong>de</strong>r (einzig)<br />
richtige zu sein. Es bedarf eines sehr<br />
hohen Maßes an Konzentration, verbun<strong>de</strong>n<br />
mit einem gewissen „kombinatorischen<br />
Vermögen“, um die Erzählung<br />
zu einem mehr o<strong>de</strong>r weniger sinnvollen<br />
Ganzen zusammenzufügen. Und<br />
auch am En<strong>de</strong> bleiben wohl noch mehr<br />
Fragen als Antworten. Hier liegt aber<br />
auch schon eine Stärke <strong>de</strong>s Films in religionspädagogischenZusammenhängen:<br />
Der Zuschauer ist gezwungen, über<br />
einen langen Zeitraum diese Konzentration<br />
aufrecht zu erhalten und aktiv<br />
eine „Sinnkonstruktion“ für sich herzustellen.<br />
Die Fragen, die er aufwirft, seien<br />
im Folgen<strong>de</strong>n in vier Themenkomplexen<br />
ange<strong>de</strong>utet.<br />
„Du blickst doch nicht durch“ –<br />
Erinnerung und Welt<strong>de</strong>utung<br />
Nolans Film ist ein düsterer Thriller.<br />
Die Welt, die wir durch Leonards<br />
Augen sehen, erscheint chaotisch, „wüst<br />
und leer“, bestimmt von Egoismen, von<br />
Mißtrauen, Ausbeutung und Rachsucht<br />
und im Letzten undurchschaubar und<br />
sinnlos. In dieser pessimistischen Weltsicht<br />
und einem nicht weniger pessimistischen<br />
Menschenbild trifft sich<br />
Nolans Film mit <strong>de</strong>m „film noir“, <strong>de</strong>r<br />
sogenannten „Schwarzen Serie“ im<br />
amerikanischen Film <strong>de</strong>r 40er Jahre, zu<br />
<strong>de</strong>m Werke wie DER GROSSE SCHLAF<br />
(USA1946), DIE SPUR DES FALKEN (USA<br />
1941) u. a. gehören. 1 Hier wie dort versuchen<br />
die Protagonisten, eine Ordnung,<br />
eine Struktur in <strong>de</strong>r Welt zu erkennen,<br />
um sich in ihr zurecht zu fin<strong>de</strong>n.<br />
Was Nolans Film von <strong>de</strong>n genannten<br />
unterschei<strong>de</strong>t, ist, dass in MEMENTO<br />
eine solche Strukturfindung <strong>de</strong>utlich<br />
als Konstrukt <strong>de</strong>s Ichs erkennbar wird.<br />
Eine Ordnung liegt nicht <strong>de</strong>r Welt gleichsam<br />
immanent zu Grun<strong>de</strong>, sie ist nicht<br />
aus <strong>de</strong>n „Fakten“ zu erheben, son<strong>de</strong>rn<br />
eine Leistung <strong>de</strong>s Individuums. Während<br />
Leonard anfangs noch das „Faktum“<br />
als allein zuverlässige Größe postuliert<br />
und die „Erinnerung“ als trügerisch<br />
und damit als unzuverlässig qualifiziert,<br />
wird er am En<strong>de</strong> doch konstatieren:<br />
„Wir alle brauchen eine Erinnerung<br />
...“ Ohne Erinnerung, ohne eine „ge<strong>de</strong>utete<br />
Vergangenheit“ ist die Gegenwart<br />
nicht zu verstehen, ist eine Orientierung<br />
in ihr nicht möglich. Dass Leonard<br />
am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Falschen erschießt,<br />
hat auch damit zu tun, dass er seine<br />
„Erinnerung“ als „Faktum“ auf seinen<br />
Körper tätowiert.<br />
Ein weiteres wesentliches Element<br />
für eine Orientierung in <strong>de</strong>r Welt liegt<br />
aber auch auf <strong>de</strong>r zwischenmenschlichen<br />
Beziehungsebene. Die Figur <strong>de</strong>r<br />
Nathalie ist für Leonard insofern wichtig,<br />
als sie ihm bei seiner Suche hilft<br />
und die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Hinweise liefert.<br />
Doch wie glaubwürdig ist sie? Leonard<br />
erfährt, dass sie ihn nur ausnutzt,<br />
doch er kann die Erinnerung daran nicht<br />
speichern. So erscheint sie ihm bei <strong>de</strong>r<br />
nächsten Begegnung gleichsam wie<strong>de</strong>r<br />
als „tabula rasa“. Ihre Glaubwürdigkeit<br />
kann er nur einem momentanen Eindruck<br />
entnehmen, <strong>de</strong>ssen Unzuverlässigkeit<br />
sich <strong>de</strong>m Zuschauer erschließt,<br />
als er die „Erinnerung“ nachgeliefert bekommt.<br />
Ohne Erinnerung ist also auch<br />
Vertrauen nicht möglich bzw. bleibt ein<br />
riskantes Unterfangen.<br />
Von solchen Überlegungen ausgehend<br />
lässt sich m. E. auch ein Bogen<br />
schlagen zur jüdisch-christlichen Tradition.<br />
Was hier auf einer individuellen<br />
Ebene angesprochen wird, gilt auch für<br />
die kollektive: In <strong>de</strong>r Erinnerung an die<br />
Geschichte <strong>de</strong>s Volkes Israel, die als<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
191<br />
Religion & Populär-Kultur
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
192<br />
Religion & Populär-Kultur<br />
Geschichte Israels mit <strong>de</strong>m einen Gott<br />
Jahwe interpretiert wird, entwickelt<br />
diese Tradition eine Deutung <strong>de</strong>r Welt<br />
und <strong>de</strong>r menschlichen Existenz, die von<br />
diesem Gott gewirkt, von ihm getragen<br />
und auf ihn ausgerichtet ist. Sie stiftet<br />
für <strong>de</strong>n Menschen individuell wie kollektiv<br />
Sinn und verhilft ihm damit zu<br />
einer Orientierung in seinem Leben.<br />
Und nicht zuletzt ist sie – gera<strong>de</strong> im jüdischen<br />
Kontext – <strong>de</strong>r zentrale Bestandteil<br />
kultureller I<strong>de</strong>ntität. Doch damit<br />
sind wir schon bei einem zweiten Themenkomplex:<br />
„Du weißt doch gar nicht, wer du bist“<br />
– Erinnerung und I<strong>de</strong>ntität<br />
Wer bin ich? Wer bist du? Leonard.<br />
Teddy. Sammy. Nathalie ... Namen auf<br />
Fotos, mit knappen und manchmal<br />
durchgestrichenen Kommentaren versehen.<br />
Angesichts <strong>de</strong>s To<strong>de</strong>s seiner geliebten<br />
Frau sind diese „I<strong>de</strong>ntitäten“ für<br />
Leonard nur mehr „Banalitäten, die ich<br />
auf kleinen Zettelchen festhalte“. Eine<br />
emotionale Beziehung kann er zu diesen<br />
Menschen nicht mehr herstellen.<br />
Doch sind sie überhaupt die, die sie zu<br />
sein scheinen? Wer ist Teddy? Ein Polizist?<br />
Ein Spitzel? Ein Freund? Wer ist<br />
Sammy? Der, als <strong>de</strong>n ihn Leonard schil<strong>de</strong>rt?<br />
O<strong>de</strong>r ist er nichts als eine Projektion<br />
von Leonards eigener Geschichte?<br />
Ohne Erinnerung verblassen auch die<br />
Biographien wie das Polariodfoto am<br />
Anfang <strong>de</strong>s Films. Und Teddy hat sicher<br />
recht, wenn er Leonard vorwirft:<br />
„Du weißt doch gar nicht, wer du bist!“<br />
Welche Verbindung gibt es zwischen<br />
<strong>de</strong>m lieben<strong>de</strong>n Mann, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Tod seiner<br />
Frau zu verarbeiten hat, und <strong>de</strong>m<br />
gna<strong>de</strong>nlosen Mör<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Tod seiner<br />
Frau immer und immer wie<strong>de</strong>r rächen<br />
wird? Leonard schafft sich künstlich<br />
eine solche Verbindung, in<strong>de</strong>m er<br />
nach <strong>de</strong>m Muster Schuld und Sühne sich<br />
selbst als Rächer <strong>de</strong>s To<strong>de</strong>s seiner Frau<br />
sieht. Alle auf Zetteln o<strong>de</strong>r Körper festgehaltenen<br />
„biographischen Splitter“<br />
dienen letztendlich nichts an<strong>de</strong>rem, als<br />
dieser selbstgeschaffenen I<strong>de</strong>ntität ein<br />
Kontinuum zu geben, das die Erinne-<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
rung nicht etablieren kann. Wie fragil<br />
dieses Unterfangen ist, wird im Film an<br />
vielen Stellen <strong>de</strong>utlich: Ist nicht vielleicht<br />
Leonard selbst <strong>de</strong>r „Mör<strong>de</strong>r“ seiner<br />
Frau, <strong>de</strong>r seine Tat auf eine an<strong>de</strong>re<br />
Person (Sammy Jenkis) projiziert? Wer<strong>de</strong>n<br />
weite Teile seines Lebens von ihm<br />
selbst nicht ausgeblen<strong>de</strong>t, da die Fixierung<br />
auf seine Aufgabe ihm alles an<strong>de</strong>re<br />
als unwichtig erscheinen lässt? Und<br />
selbst <strong>de</strong>n Vollzug seiner Rache kann er<br />
für sein „Selbstbewusstsein“ nicht nutzbar<br />
machen. Hier wird die zentrale Be<strong>de</strong>utung<br />
<strong>de</strong>s Erinnerns für die Ausbildung<br />
von I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>utlich, die zwar<br />
nicht „objektiv“, son<strong>de</strong>rn immer auch<br />
selektiv, verklärend o<strong>de</strong>r verdrängend,<br />
aber eben eine I<strong>de</strong>ntität konstruieren<strong>de</strong><br />
und konstituieren<strong>de</strong> Leistung <strong>de</strong>s Individuums<br />
ist, ohne die <strong>de</strong>r Mensch nicht<br />
auskommt.<br />
Auch von hier aus führt m. E. wie<strong>de</strong>r<br />
eine Linie zum Selbstverständnis<br />
<strong>de</strong>s Ju<strong>de</strong>ntums wie <strong>de</strong>s Christentums.<br />
Wesentliche Bezugspunkte jüdischchristlicher<br />
I<strong>de</strong>ntität sind die Exodus-<br />
Erfahrung <strong>de</strong>s Volkes Israel sowie Tod<br />
und Auferstehung Jesu Christi. Von hier<br />
aus verstehen sich Ju<strong>de</strong>n als Ju<strong>de</strong>n und<br />
Christen als Christen. Zugleich aber<br />
liegen diese „Gravitationszentren“ in<br />
einem geschichtlichen Kontinuum, das<br />
für die religiöse I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r Gemeinschaft<br />
<strong>de</strong>s Volkes Israel, <strong>de</strong>r Kirche als<br />
„Volk Gottes“ ebenso von Be<strong>de</strong>utung ist.<br />
Die in <strong>de</strong>r Geschichte sich ereignen<strong>de</strong><br />
Tat Gottes und die Geschichte <strong>de</strong>s<br />
Menschen mit Gott, die sich auf dieser<br />
Erfahrung grün<strong>de</strong>t und im Erinnern vergegenwärtigt<br />
wer<strong>de</strong>n, bil<strong>de</strong>n jenes geschichtliche<br />
Kontinuum, in das sich<br />
Christen bzw. Ju<strong>de</strong>n einordnen. Im<br />
christlichen Kontext gewinnt dies unter<br />
<strong>de</strong>n Begriffen Apostolizität, Sukzession,<br />
Tradition u. a. noch einmal eine<br />
ganz eigene Be<strong>de</strong>utung. Wesentlich<br />
in diesem Zusammenhang ist damit aber,<br />
dass ohne Erinnerung, ohne die Vergegenwärtigung<br />
<strong>de</strong>s Vergangenen, in <strong>de</strong>r<br />
sich nicht zuletzt auch eine Vision <strong>de</strong>r<br />
Zukunft verbirgt, religiöse I<strong>de</strong>ntität<br />
kaum zu erlangen ist. Der Mensch bleibt<br />
in sich selbst gefangen. Dies ist auch<br />
das Bild, das <strong>de</strong>r Film von Leonhard<br />
zeichnet: Er ist gleichsam in <strong>de</strong>r Gegenwart<br />
gefangen. Ein „sinngeben<strong>de</strong>r<br />
Bezugspunkt“ in seiner Vergangenheit<br />
ist zwar vorhan<strong>de</strong>n, doch kann er sich<br />
an diesen und „seine“ Geschichte nach<br />
<strong>de</strong>m Ereignis nicht mehr erinnern. Alle<br />
Versuche einer „Rekonstruktion“ bleiben<br />
fragwürdig. Und nicht zuletzt bleibt<br />
damit auch kaum eine Zukunftsperspektive.<br />
Dies wird an einem dritten<br />
Aspekt noch einmal <strong>de</strong>utlicher:<br />
„Ich hab’ dir einen Grund gegeben,<br />
weiter zu leben“ – Erinnerung und<br />
Sinn<br />
„Eine tote Frau, nach <strong>de</strong>r du dich<br />
sehnen kannst, das verleiht <strong>de</strong>inem Leben<br />
Sinn.“ „Ich hab’ dir einen Grund<br />
gegeben, weiter zu leben.“ Zwischen<br />
diesen bei<strong>de</strong>n Worten Teddys scheint<br />
die Lebens- und Sinnperspektive Leonhards<br />
zu liegen. Die Sehnsucht nach<br />
seiner Frau, die er durch Erinnerungsstücke<br />
(Buch, Bürste, etc.) und gestellte<br />
Szenen (mit Hilfe einer Prostituierten)<br />
in sein Leben wie<strong>de</strong>r hereinholen<br />
will, und sein Begehren, ihren Tod zu<br />
rächen, sind die zentralen Motive seines<br />
Han<strong>de</strong>lns. Die Menschen, die ihm<br />
auf diesem Weg begegnen, sind dabei<br />
nur insofern von Be<strong>de</strong>utung, als sie ihm<br />
nützlich sind. Folglich teilt er sie in<br />
Freun<strong>de</strong> (jene, die ihm bei seiner Rache<br />
behilflich sind) und Fein<strong>de</strong> (solche, die<br />
ihm falsche Informationen geben/Täter)<br />
ein. Da er seine Frau nicht wie<strong>de</strong>r<br />
lebendig machen kann, da er Beziehungen<br />
zu an<strong>de</strong>ren Menschen nicht aufbauen<br />
bzw. vertiefen kann, bleibt ihm<br />
als einzige Perspektive <strong>de</strong>r Vollzug seiner<br />
Rache. Doch die Erzählung Teddys<br />
am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Films macht <strong>de</strong>utlich:<br />
Diese Rache ist längst vollzogen, das<br />
„Glücksgefühl“ aber im Vergessen verblasst.<br />
So eröffnet ihm Teddy – wohl<br />
überwiegend aus ganz eigennützigen<br />
Motiven – die Möglichkeit, diese Rache<br />
immer und immer wie<strong>de</strong>r zu vollziehen.<br />
Leonhards Leben wird so ein<br />
Kreislauf aus Suche – Rache – Glücksgefühl.<br />
Ohne Erinnerung ist Leonard gezwungen,<br />
jenen „gerechten Ausgleich“
immer wie<strong>de</strong>r aufs Neue herzustellen.<br />
Doch ist es wirklich nur Teddy, <strong>de</strong>r ihm<br />
dazu verhilft? Leonard selbst legt sich<br />
„Spuren“, die seine Suche vorantreiben,<br />
er vernichtet Fotos, die sein Opfer<br />
zeigen. Bis zum Schluss lässt er sich<br />
nicht das „erlösen<strong>de</strong>“ „I’ve done it“ auf<br />
die Brust tätowieren 2 . Nichts ist zu erkennen,<br />
das aus diesem Kreislauf heraus<br />
führen könnte. Damit aber gibt es<br />
auch keine „übergreifen<strong>de</strong>“ Sinnperspektive.<br />
Leonard kann nicht glücklich<br />
wer<strong>de</strong>n. Es gibt keine „Erfüllung“ in<br />
seinem Leben – eben auch, weil es keine<br />
Erinnerung gibt. Sein „Glück“ sind<br />
Gefühlsmomente, die ebenso schnell<br />
entstehen wie sie verschwin<strong>de</strong>n; eine<br />
höhere Ebene, ein „Plateau“ 3 <strong>de</strong>r Freu<strong>de</strong><br />
und <strong>de</strong>s Glücks, wie Erich Fromm<br />
schreibt, kann Leonard nicht erreichen.<br />
Auch diese Beobachtungen zum<br />
Film liefern eine Perspektive, von <strong>de</strong>r<br />
aus theologische Überlegungen in <strong>de</strong>n<br />
Blick genommen wer<strong>de</strong>n können: Der<br />
„Kreislauf“ von Schuld und Sühne, die<br />
Opferrituale zur „Versöhnung Gottes“<br />
bil<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Hintergrund für viele alttestamentliche<br />
Texte. Auch die Talionsformel<br />
„Auge um Auge ...“ nimmt hierauf<br />
Bezug, in<strong>de</strong>m sie mit <strong>de</strong>m Gedanken<br />
<strong>de</strong>r Verhältnismäßigkeit das Ritual<br />
<strong>de</strong>r Rache begrenzen will. Die Opfertheologie<br />
<strong>de</strong>s Neuen Testaments vor allem<br />
im Hebräerbrief greift dies auf:<br />
Christus ist hier das wahre, das einzige<br />
und endgültige Opfer, das die Welt mit<br />
Gott versöhnt. Sein Opfertod erlöst die<br />
Welt und befähigt <strong>de</strong>n Menschen, diese<br />
Versöhnung Gestalt wer<strong>de</strong>n zu lassen.<br />
Dieses „Ein für allemal“ durchbricht<br />
jenen Kreislauf <strong>de</strong>r Rache. Bezeichnen<strong>de</strong>rweise<br />
ist gera<strong>de</strong> die Erinnerung<br />
an dieses Opfer Jesu Christi und <strong>de</strong>ssen<br />
Vergegenwärtigung in <strong>de</strong>r Eucharistie<br />
ein ganz zentrales Element christlichen<br />
Lebens- und Glaubensvollzugs.<br />
„Du bist schuldig und weißt nicht warum“<br />
– Erinnerung und Schuld<br />
Der letzte Aspekt, <strong>de</strong>r an dieser<br />
Stelle noch angesprochen wer<strong>de</strong>n soll,<br />
scheint auf <strong>de</strong>n ersten Blick <strong>de</strong>m Film<br />
Zitate aus <strong>de</strong>m Dialog und <strong>de</strong>r Off-Erzählung<br />
• Erinnerung ist Verrat.<br />
• ... setzt du all das zusammen, ist das Gefühl für <strong>de</strong>n Menschen da.<br />
• Nur mit Routine kann ich mein Leben über die Bühne bringen.<br />
• Man muss die Zusammenhänge erkennen.<br />
• Nathalie: Vertrau <strong>de</strong>inem eigenen Urteil! – Leonard: Es gibt Dinge, die<br />
stehen fest!<br />
• Sie ist tot, und die Gegenwart besteht aus Banalitäten, die ich auf kleinen<br />
Zettelchen festhalte!<br />
• Wie soll ich meine Wun<strong>de</strong>n heilen, wenn ich die Zeit nicht empfin<strong>de</strong>?!<br />
• Ich dachte man liest, weil man wissen will, was als nächstes passiert?!<br />
• Du bist ärgerlich ... du bist schuldig, und weißt nicht wieso.<br />
• Du erinnerst dich nur an das, was du für wahr halten willst!<br />
• Ich will mein Leben wie<strong>de</strong>r haben!<br />
• Ich hab’dir einen Grund geliefert, weiter zu leben.<br />
• Du erfin<strong>de</strong>st dir <strong>de</strong>ine eigene Wahrheit.<br />
• Eine tote Frau, nach <strong>de</strong>r du dich sehnen kannst, das verleiht <strong>de</strong>inem Leben Sinn.<br />
• Du erfin<strong>de</strong>st dir Rätsel, die du niemals lösen kannst.<br />
• Ich bin <strong>de</strong>rjenige, <strong>de</strong>r alles zusammenhält.<br />
• Ich bin kein Killer, ich bin nur jemand, <strong>de</strong>r etwas richtigstellen wollte.<br />
• Darf ich zulassen, dass ich vergesse, was ich <strong>de</strong>inetwegen getan habe?<br />
• Lüge ich mir etwas vor, um glücklich zu sein? In <strong>de</strong>inem Fall, Teddy, tue ich es!<br />
Leonards Schlussmonolog: „Ich muss an eine Welt außerhalb meiner eigenen<br />
Gedanken glauben. Ich muss daran glauben, dass das, was ich tue, auch einen<br />
Sinn hat, selbst wenn ich mich daran nicht erinnern kann. Ich muss daran glauben,<br />
dass, wenn ich die Augen schließe, die Welt noch da ist. Glaube ich, dass die<br />
Welt noch da ist? Ist sie immer noch da? Ja! Wir alle brauchen eine Erinnerung,<br />
damit wir nicht vergessen, wer wir sind. Das gilt auch für mich.“<br />
am nächsten zu liegen. Viel war bislang<br />
von Rache und Mord, von Ausbeutung<br />
und Lüge die Re<strong>de</strong>: Wie steht es also<br />
mit <strong>de</strong>m Thema „Schuld“ bei MEMEN-<br />
TO? Verstehe ich Schuld als moralische<br />
Kategorie, so mag <strong>de</strong>r Film beim ersten<br />
Sehen merkwürdig „a-moralisch“ erscheinen.<br />
Moralisch fragwürdiges Verhalten<br />
durchzieht die ganze Geschichte;<br />
keine Figur, die aus <strong>de</strong>m Panoptikum<br />
düsterer Charaktere als „Lichtgestalt“<br />
hervorstechen wür<strong>de</strong>. Auch wird<br />
ihr Han<strong>de</strong>ln kaum in Frage gestellt:<br />
Dass ein Mord durch einen Mord gerächt,<br />
dass einer <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren in <strong>de</strong>n<br />
Dienst ganz egoistischer Begier<strong>de</strong>n<br />
stellt, all das geschieht mit einer<br />
Selbstverständlichkeit, ja Beiläufigkeit,<br />
die manchmal Schau<strong>de</strong>rn macht.<br />
Ist die Welt so, wie sie <strong>de</strong>r Film zeigt?<br />
Gilt das Verdikt „homo homini lupus“<br />
für <strong>de</strong>n Film, für die Wirklichkeit?<br />
Auch hier, meine ich, darf nicht übersehen<br />
wer<strong>de</strong>n, dass die Perspektive <strong>de</strong>s<br />
Films die Perspektive einer Figur ist,<br />
die kein Gedächtnis hat, die <strong>de</strong>s Erinnerns<br />
nicht fähig ist. Und dieser Mangel<br />
prägt auch die Perspektive.<br />
„Du bist schuldig und weißt nicht<br />
warum“. Gera<strong>de</strong> uns Christen müsste<br />
dieser Satz vertraut sein. Dabei re<strong>de</strong> ich<br />
nicht davon, dass über Jahrhun<strong>de</strong>rte ein<br />
mehr o<strong>de</strong>r weniger begrün<strong>de</strong>tes Schuldbewusstsein<br />
ein prägen<strong>de</strong>r Bestandteil<br />
christlichen Lebensgefühls war. Es geht<br />
hier mehr um die Erfahrung, dass es<br />
Leid und auch Schuld(bewusstsein) gibt,<br />
ohne dass dies auf eine moralisch ein<strong>de</strong>utig<br />
zu qualifizieren<strong>de</strong> Handlung o<strong>de</strong>r<br />
Entscheidung <strong>de</strong>s Individuums zu beziehen<br />
ist. Der Begriff <strong>de</strong>r „strukturellen<br />
Sün<strong>de</strong>“ weist in diese Richtung<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
193<br />
Religion & Populär-Kultur
UNTERRICHTSPRAXIS<br />
194<br />
Religion & Populär-Kultur<br />
o<strong>de</strong>r auch viele konfliktethische Entscheidungen,<br />
die in moralischer Hinsicht<br />
nur schwer zu „beurteilen“ sind.<br />
Der Film weist noch in eine an<strong>de</strong>re<br />
Richtung: Sammy Jenkis setzt seiner<br />
Frau die tödliche Dosis Insulin, weil er<br />
nicht weiß, dass er ihr die Spritze bereits<br />
gegeben hat. Er kann nicht schuldig<br />
sein an ihrem Tod, weil ihm die Erinnerung<br />
fehlt, die sein Han<strong>de</strong>ln als<br />
todbringend aufzeigen könnte. Eher<br />
wird man wohl <strong>de</strong>n Tod seiner Frau als<br />
möglichen Selbstmord einstufen können.<br />
Aber Sammy kann sich schuldig<br />
fühlen. Ein ähnliches Muster ergibt sich,<br />
wenn man Teddys Version <strong>de</strong>r Geschichte<br />
aufgreift: Wenn es Leonard<br />
war, <strong>de</strong>r seiner Frau – aufgrund <strong>de</strong>r<br />
gleichen Gedächtnisstörung – todbringen<strong>de</strong><br />
Spritzen setzte, wäre seine Projektion<br />
dieser Tat auf Sammy vielleicht<br />
als Versuch einer Entlastung seines Gewissens<br />
zu sehen, auch wenn er nicht<br />
weiß, höchstens vermuten kann, worin<br />
genau seine Schuld bestehen könnte.<br />
Kann ich mich schuldig fühlen, wenn<br />
ich nicht weiß, warum? Ist Erinnerung<br />
an eigenes Leid wie an das Leid an<strong>de</strong>rer<br />
nicht auch ein konstituieren<strong>de</strong>s Element<br />
für die Entwicklung moralischen<br />
Bewusstseins? Kann Leonard nicht<br />
auch <strong>de</strong>shalb leicht im Kreislauf <strong>de</strong>r Rache<br />
leben, weil er sich an die vollzogene<br />
Rache nicht mehr erinnert? Man kann<br />
<strong>de</strong>n Gedanken auch noch einmal in <strong>de</strong>r<br />
„umgekehrten Richtung“ formulieren:<br />
Kann ich Verantwortung tragen, wenn<br />
ich mich nicht erinnern kann? Sammy<br />
kann die Verantwortung für seine Frau<br />
nicht übernehmen. Sie ist es, die dies<br />
mit ihrer Auffor<strong>de</strong>rung, ihr die Spritze<br />
zu geben, tut. Und auf Leonard bezogen:<br />
Kann er Verantwortung übernehmen<br />
für die Herstellung einer „Gerechtigkeit“,<br />
die er allein im Vollzug von<br />
Rache sehen kann? Kann er verzeihen?<br />
Fragt man – gleichsam in <strong>de</strong>r „Außenperspektive“<br />
– nach schuldhaftem<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Verhalten Leonards, so wird man das<br />
wohl am ehesten in <strong>de</strong>ssen Rachekategorien<br />
sehen können und auch in seiner<br />
ja sehr bewussten Entscheidung, sich<br />
Teddy als Opfer auszuwählen. Und auch<br />
bei <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Figuren <strong>de</strong>s Films kann<br />
man diese Kategorie anlegen. Es soll<br />
nicht suggeriert wer<strong>de</strong>n, solche Kategorien<br />
seien hier fehl am Platz o<strong>de</strong>r irrelevant.<br />
Wohl aber scheint es mir be<strong>de</strong>nkenswert,<br />
dass <strong>de</strong>r erinnerungslose<br />
Blick Leonards wie <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Zuschauers<br />
auf eine Welt schaut, die seltsam amoralisch<br />
erscheint und in <strong>de</strong>r Verantwortung<br />
kaum einen Platz erhält, kaum ein<br />
Subjekt fin<strong>de</strong>t.<br />
Ich kann mir vorstellen, dass manche<br />
Leser dieser Ausführungen diese<br />
mit einigem Befrem<strong>de</strong>n aufgenommen<br />
haben. Nach allem, was über <strong>de</strong>n Film<br />
gesagt wur<strong>de</strong>, erscheinen gera<strong>de</strong> die<br />
Verbindungen zu religiösen Fragen<br />
doch sehr gewagt und vielleicht auch<br />
vage. Und noch dazu wird sicher auch<br />
die Vorstellung, mit diesem Film im<br />
Religionsunterricht selbst in <strong>de</strong>r Sekundarstufe<br />
II zu arbeiten, als wenig<br />
naheliegend erscheinen. Nun, ich will<br />
gerne eingestehen, MEMENTO ist (auch<br />
für mich) kein religiöser und auch kein<br />
„spiritueller“ Film. Am ehesten könnte<br />
man ihn vielleicht noch als einen Film<br />
bezeichnen, <strong>de</strong>r philosophische Fragen<br />
aufwirft bzw. sich auf solche bezieht.<br />
Doch auch wenn die angesprochenen<br />
Verbindungslinien zu religiösen<br />
Themen eher auf struktureller Ebene<br />
liegen und weniger offensichtlich<br />
sind, scheint mir doch eine Arbeit mit<br />
<strong>de</strong>m Film durchaus sinnvoll zu sein.<br />
Gera<strong>de</strong> ein solcher ungewohnter, „unorthodoxer“<br />
Blick auf die Antworten<br />
<strong>de</strong>r christlich-jüdischen Tradition kann<br />
oftmals zu neuen bzw. vertiefen<strong>de</strong>n<br />
Einsichten verhelfen. Solche „Seitenwege“<br />
zu beschreiten, ist dabei wohl<br />
nicht nur für jene lohnenswert, <strong>de</strong>nen<br />
diese Antworten kaum mehr vertraut<br />
sind, son<strong>de</strong>rn sicher auch für Menschen,<br />
die sich ganz selbstverständlich<br />
darauf beziehen. In <strong>de</strong>m immer<br />
schwieriger wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n „Geschäft“ <strong>de</strong>s<br />
Religionsunterrichts (und nicht nur<br />
da) wäre es zumin<strong>de</strong>st einen Versuch<br />
wert.<br />
Abschließend noch ein Hinweis:<br />
In <strong>de</strong>r DVD-Ausgabe <strong>de</strong>s Films<br />
(2 DVDs mit ausführlichem Bonusmaterial)<br />
fin<strong>de</strong>t sich ein sogenanntes<br />
„Hid<strong>de</strong>n Feature“, ein Menü, mit <strong>de</strong>m<br />
man <strong>de</strong>n Film in <strong>de</strong>r Szenenreihenfolge<br />
<strong>de</strong>r Geschichte abspielen kann:<br />
Der Film beginnt mit <strong>de</strong>n Schwarzweißszenen<br />
in <strong>de</strong>r Reihenfolge <strong>de</strong>s<br />
Films, die letzte Schwarzweißszene<br />
geht dann in die letzte Farbszene<br />
über, es schließen sich die Farbszenen<br />
in umgekehrter Reihenfolge an.<br />
Dieses Feature kann wie folgt aufgerufen<br />
wer<strong>de</strong>n: Man drückt im Hauptmenü<br />
(Filmstart eingerahmt) zweimal<br />
die rechte Pfeiltaste <strong>de</strong>r Fernbedienung.<br />
Darauf erscheint im Menü<br />
(rechts unten) <strong>de</strong>r Begriff „Memento“<br />
eingerahmt, <strong>de</strong>r zweimal zu bestätigen<br />
ist 4 .<br />
Anmerkungen<br />
1<br />
vgl. dazu Paul Werner: Film noir. Die Schattenspiele<br />
<strong>de</strong>r „schwarzen Serie“, Frankfurt am Main 1985.<br />
2 In einer kurzen Sequenz – einem „Erinnerungsbild“<br />
Leonards – ist er aber einmal mit dieser Tätowierung<br />
zusammen mit seiner (noch leben<strong>de</strong>n) Frau zu sehen.<br />
3 Erich Fromm: Haben o<strong>de</strong>r Sein, München 5. Aufl.,<br />
1980, S. 115.<br />
4 Den Hinweis verdanke ich einem Schüler, Benedikt<br />
Schnei<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>m an dieser Stelle herzlich gedankt sei.<br />
Franz-Günther Weyrich ist Leiter <strong>de</strong>s<br />
Amtes für Katholische Religionspädagogik<br />
in Wetzlar.<br />
Besuchen Sie auch INFO-Online im Internet: www.ifrr.<strong>de</strong>
Rezensionen<br />
Trutwin, Werner<br />
ZZeeiitt d<strong>de</strong>err FFrreeuud<strong>de</strong>e<br />
Das neue Programm. Jahrgangsstufe<br />
5/6. – Düsseldorf: Patmos Verlag. 2000.<br />
272 S. ill., € 16.50 (ISBN 3-491-75700-2)<br />
Trutwin, Werner<br />
WWeeggee d<strong>de</strong>ess<br />
GGllaauubbeennss<br />
Das neue Programm. Jahrgangsstufe 7/8. – Düsseldorf:<br />
Patmos Verlag. 2001. 288 S. ill., € 16.50<br />
(ISBN 3-491-75701-0)<br />
Trutwin, Werner<br />
ZZeeiicchheenn d<strong>de</strong>err<br />
HHooffffnnuunngg<br />
Das neue Programm. Jahrgangsstufe 9/10. – Düsseldorf:<br />
Patmos Verlag. 2002. 289 S. ill., € 16.50<br />
(ISBN 3-491-75702-9)<br />
Nur die Titel sind geblieben – die Inhalte haben<br />
eine grundlegen<strong>de</strong> Neuerung erfahren. Dieses<br />
dreiteilige Werk ist seit mehr als 20 Jahren weit<br />
verbreitet. Nach einer gründlichen Überarbeitung<br />
erscheint das bewährte Unterrichtswerk nun in einer<br />
völlig neuen Aufmachung. Buchformat und<br />
die Anzahl <strong>de</strong>r Seiten sind etwas größer. Für die<br />
Texte gibt es mehrere verschie<strong>de</strong>ne Schrifttypen.<br />
In Spalten, Abschnitten und Blöcken aufgeteilt,<br />
teils farblich unterlegt, ergänzt durch reichliches<br />
Bildmaterial, fallen die einzelnen Seiten in einer<br />
angenehmen, anregen<strong>de</strong>n Weise ins Auge, ein<br />
Fortschritt, wenn man damit die, man darf es<br />
wohl so sagen, langweilige Gestaltung <strong>de</strong>r ersten<br />
Auflage vergleicht. Das Bildmaterial bietet die gesamte<br />
Vielfalt aller möglichen Darstellungsweisen:<br />
klassische und mo<strong>de</strong>rne Gemäl<strong>de</strong>, Fotografien,<br />
Comics, Zeichnungen, Plakate, Tabellen,<br />
Altes und Neues. Die verschie<strong>de</strong>nen Textarten –<br />
Lehrtext, Erklärung, Information, Zitat, Aufgabe,<br />
Bil<strong>de</strong>rklärung – sind durch verschie<strong>de</strong>ne Schrifttypen<br />
und oft durch farbigen Untergrund leicht<br />
erkennbar. Auch die Überschriften sind durchweg<br />
farbig wie<strong>de</strong>rgegeben. Dieser farbenfrohen äußeren<br />
Gestaltung entspricht <strong>de</strong>r lebendig und interessant<br />
dargebotene Inhalt <strong>de</strong>r einzelnen Kapitel.<br />
Die inhaltliche Glie<strong>de</strong>rung lässt eine Ten<strong>de</strong>nz weg<br />
von isoliert behan<strong>de</strong>lten speziellen Themen hin zur<br />
Darstellung größerer Zusammenhänge erkennen.<br />
Beson<strong>de</strong>rs auffallend reichlich sind die Querverweise<br />
zu behan<strong>de</strong>lten Stichwörtern, die in einem<br />
an<strong>de</strong>ren Zusammenhang auftauchen, auch bei Themen<br />
in vorausgegangenen Schuljahren. Solche beabsichtigten<br />
Wie<strong>de</strong>rholungen können auf fast<br />
schon spielerische Art und Weise einmal „Gelerntes“<br />
in Erinnerung bringen und in <strong>de</strong>m neuen<br />
sachlichen Zusammenhang zu einem gefestigten<br />
Wissen führen.<br />
Die Einteilung in große Themen ist bei allen<br />
drei Bän<strong>de</strong>n gleich. Das erste Kapitel „Horizont“<br />
befasst sich mit <strong>de</strong>m Titel <strong>de</strong>s jeweiligen Ban<strong>de</strong>s.<br />
So wird im ersten Band neben <strong>de</strong>r Freu<strong>de</strong> auch die<br />
Angst angesprochen, im zweiten Band <strong>de</strong>r Glaube,<br />
aber auch <strong>de</strong>r Zweifel, und im dritten Band die<br />
Hoffnung und als Gegenstück dazu die Verzweiflung.<br />
Überzeugend ist im zweiten Kapitel „Schülerinnen<br />
und Schüler“ die jeweilige Stufe <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung dargestellt: Wie Kin<strong>de</strong>r leben; kein<br />
Kind mehr – noch nicht erwachsen; Ansichten einer<br />
Jugend.<br />
Am folgen<strong>de</strong>n sehr grundlegen<strong>de</strong>n Kapitel<br />
„Bibel“ kann man die fortschreiten<strong>de</strong> Vertiefung<br />
biblischer Themen recht gut erkennen. Einer allgemeinen<br />
Einführung in <strong>de</strong>n „Bestseller – die<br />
Bibel“ folgt ein Gang durch die Geschichte <strong>de</strong>s<br />
Volkes Israel. Die Propheten, „Gottes Querköpfe“,<br />
und das „Evangelium“ sind die biblischen<br />
Themen <strong>de</strong>s zweiten Ban<strong>de</strong>s. Die Schwerpunkte<br />
<strong>de</strong>s dritten Ban<strong>de</strong>s sind zum einen Welt und<br />
Mensch und zum an<strong>de</strong>ren: Wie die Freiheit Sinn<br />
macht. Die drei nächsten Kapitel befassen sich<br />
mit Gott, mit Jesus und <strong>de</strong>m Menschen. Ein weiteres<br />
Kapitel hat die Geschichte <strong>de</strong>r Kirche zum<br />
Thema. Bisher nicht ganz selbstverständlich ist<br />
das hier für <strong>de</strong>n Unterricht angebotene Thema<br />
„Kunst“, schwerpunktmäßig dargestellt an <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung <strong>de</strong>s sakralen Gebäu<strong>de</strong>s bis hin zu<br />
einer recht guten Erklärung über <strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnen<br />
Kirchenbau. Diese bei<strong>de</strong>n Kapitel halten sich,<br />
was verständlich ist, an <strong>de</strong>n zeitlichen Ablauf <strong>de</strong>r<br />
angebotenen Inhalte.<br />
Bei <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Themen „Christentum“<br />
und „Ethik“ konnte wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r „vertiefen<strong>de</strong>“<br />
Weg gewählt wer<strong>de</strong>n. In „Zeit <strong>de</strong>r Freu<strong>de</strong>“ wird<br />
das Christentum als eine Gemeinschaft, aber<br />
auch als eine bunte Vielfalt durch die verschie<strong>de</strong>nen<br />
Konfessionen dargestellt. Das Gute und das<br />
Böse sind Inhalt <strong>de</strong>r Ethik. „Wege <strong>de</strong>s Glaubens“<br />
fragt, wozu die Kirche gut ist, und unter Ethik<br />
folgen Überlegungen zu Verantwortung und<br />
Wahrheit. Im Band „Zeichen <strong>de</strong>r Hoffnung“ wird<br />
unter Christentum über „Kirche heute und morgen“<br />
nachgedacht. Es bleibt dabei nicht bei berechtigter<br />
Kritik an verbesserungswürdigen Erscheinungsformen;<br />
Zukunftsperspektiven fin<strong>de</strong>n<br />
genügen<strong>de</strong> Beachtung. Das recht umfangreiche<br />
Kapitel „Ethik“ ist geglie<strong>de</strong>rt in: Das Gewissen;<br />
Das Recht auf Leben; Grundlagen <strong>de</strong>r Gesellschaft.<br />
Der in Band 2 und 3 vorgenommene Einschub<br />
„Zeitgeist“ befasst sich mit verschie<strong>de</strong>nen<br />
zeitgenössischen religiösen Bewegungen und<br />
mit <strong>de</strong>m Thema: Geld regiert die Welt – ganz sicher<br />
sehr aktuelle Fragen.<br />
Den Abschluss bil<strong>de</strong>n Informationen über <strong>de</strong>n<br />
Islam (Zeit <strong>de</strong>r Freu<strong>de</strong>), das Ju<strong>de</strong>ntum (Wege <strong>de</strong>s<br />
Glaubens) und Hinduismus und Buddhismus<br />
(Zeichen <strong>de</strong>r Hoffnung).<br />
Neben <strong>de</strong>r einla<strong>de</strong>nd äußeren Erscheinung ist<br />
es die lebendige Sprache, die ein Arbeiten mit diesem<br />
Werk erleichtert. Erwähnenswert sind dabei<br />
auch die vielen Vorschläge zu möglichen Projekten<br />
und zu Fächer übergreifen<strong>de</strong>m Unterricht,<br />
aber auch die richtige Einschätzung <strong>de</strong>r Schülersituation:<br />
Eine Bindung an die Kirche o<strong>de</strong>r ein<br />
vertieftes religiöses Wissen wer<strong>de</strong>n nicht als<br />
selbstverständlich vorausgesetzt. Kritische Fragen<br />
an die Kirche und an das Erscheinungsbild<br />
<strong>de</strong>s Christentums begünstigen eine offene und<br />
ehrliche Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit unserem Glauben.<br />
Genau so wichtig sind <strong>de</strong>ssen positive Seiten,<br />
die immer wie<strong>de</strong>r in überzeugen<strong>de</strong>r Weise zur<br />
Sprache kommen. Es ist mutig, aber auch höchst<br />
notwendig, wenn neue Erkenntnisse <strong>de</strong>r Theologie<br />
– vor allem im dritten Band – klar und <strong>de</strong>utlich<br />
ausgesprochen wer<strong>de</strong>n, auch wenn sie noch nicht<br />
Allgemeingut sind.<br />
Kleine festgestellte Ungenauigkeiten tun <strong>de</strong>r<br />
positiven Bewertung dieses Werkes keinen Abbruch.<br />
So wird die kleine Doxologie noch in <strong>de</strong>r alten<br />
Form zitiert (...wie es war im Anfang..., statt:<br />
...wie im Anfang...). Die alte griechische Stadt<br />
Thessalonich heißt heute wie<strong>de</strong>r: Thessaloniki<br />
(nicht Saloniki). Nicht die Evangelien, son<strong>de</strong>rn<br />
nur das Johannesevangelium nennt Jesus: „Weg“,<br />
„Licht“ o<strong>de</strong>r „Leben“. Wenn es heißt: „Der zweite<br />
Text erzählt, dass zuerst <strong>de</strong>r Mann erschaffen<br />
wird“, ist dies zumin<strong>de</strong>st nicht präzise genug.<br />
Das berüchtigte Werk von Rosenberg heißt: „Der<br />
Mythus (nicht: Mythos) <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts“.<br />
Auch scheint es nicht klug zu sein, Zölibat <strong>de</strong>r<br />
Priester und Ehelosigkeit <strong>de</strong>r Laien undifferenziert<br />
zu betrachten.<br />
Aber alles in allem: Mit diesem Werk lässt sich<br />
gut arbeiten. Helmut Bahr<br />
Thömmes, Arthur/Werner,<br />
Christiane<br />
WWiiee sscchhmmeecckktt<br />
ddaass LLeebbeenn??<br />
Band 1: Ich bin ich. Arbeitshilfe für <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
in <strong>de</strong>r Grundschule. – Kevelaer-<strong>Limburg</strong>:<br />
Lahn-Verlag. 2001. 80 S. m. zahlr. Ausmalvorlagen.<br />
Lie<strong>de</strong>rn und Noten. Format DIN A 4, € 12.90<br />
(ISBN 3-7840-3244-3)<br />
Thömmes, Arthur/Werner,<br />
Christiane<br />
WWiiee sscchhmmeecckktt ddaass<br />
LLeebbeenn??<br />
Band 2: Ich + Du = Wir. Arbeitshilfe für <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
in <strong>de</strong>r Grundschule. – Kevelaer-<strong>Limburg</strong>:<br />
Lahn-Verlag. 2002. 80 S., ill., Format DIN A 4,<br />
€ 12.90 (ISBN 3-7840-3245-1)<br />
Band 1 dieser Arbeitshilfe beschäftigt sich mit<br />
<strong>de</strong>m Lehrplanbereich „Ich in Gottes Hand“.<br />
Das Heft ist in 4 Teilbereiche geglie<strong>de</strong>rt:<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
195
LITERATUR & MEDIEN<br />
196<br />
1. Ich bin ich;<br />
2. Gefühle;<br />
3. Träume und Phantasien;<br />
4. Talente und Schwächen.<br />
Die Schüler sollen sich mit <strong>de</strong>r Frage „Wer bin<br />
ich?“ auseinan<strong>de</strong>rsetzen, ihre eigenen Gefühle<br />
wahrnehmen, mit ihnen umgehen und sie sinnvoll<br />
einsetzen lernen, aber auch Gefühle an<strong>de</strong>rer<br />
Menschen wahrnehmen und spüren lernen. Ziel<br />
ist es weiterhin, gemeinsam mit <strong>de</strong>n Schülern ihre<br />
Talente und Fähigkeiten zu ent<strong>de</strong>cken und zu entfalten.<br />
So gewinnen die Kin<strong>de</strong>r die Einsicht: Je<strong>de</strong>r<br />
kann etwas.<br />
Steht im ersten Band die Entwicklung <strong>de</strong>r Ich-<br />
Stärke im Vor<strong>de</strong>rgrund, geht es im Band 2 um das<br />
Einüben und Reflektieren <strong>de</strong>r sozialen Kompetenzen<br />
<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r (Lehrplanbereich „Zusammenleben<br />
und Nächstenliebe“). Die Arbeitshilfe ist in<br />
5 Bereiche geglie<strong>de</strong>rt:<br />
1. Ich + Du = Wir;<br />
2. Familie;<br />
3. Freundschaft;<br />
4. ...und mehr;<br />
5. Ich – Du – Wir (Ein Spiel).<br />
Im Hinblick auf verschie<strong>de</strong>ne Beziehungsfel<strong>de</strong>r<br />
wie Familie, Freundschaft und Gesellschaft<br />
beschäftigen die Schüler sich mit grundsätzlichen<br />
Werten, die für ein gelungenes Miteinan<strong>de</strong>r<br />
von Be<strong>de</strong>utung sind: Vertrauen, Ehrlichkeit, Toleranz,<br />
Hilfsbereitschaft, Zivilcourage, Rücksichtnahme,<br />
Dankbarkeit ...<br />
Die verschie<strong>de</strong>nen Themen wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Schülern<br />
mit Hilfe von Lie<strong>de</strong>rn, Geschichten, Malund<br />
Bastelvorlagen, Rätseln, Rollenspielen und<br />
Gedichten nahe gebracht. Angefügt sind methodisch-didaktische<br />
Hinweise zu je<strong>de</strong>m Arbeitsblatt.<br />
Lei<strong>de</strong>r sind hier jedoch weniger unterrichtspraktische<br />
Hinweise gemeint, son<strong>de</strong>rn Hintergrundinformationen,<br />
die es <strong>de</strong>m Lehrer erleichtern<br />
sollen, sich in die Gefühls- und Gedankenwelt<br />
eines Grundschulkin<strong>de</strong>s hineinzuversetzen<br />
und <strong>de</strong>n Einsatz <strong>de</strong>r Arbeitsvorlage begrün<strong>de</strong>n.<br />
Die Arbeitsblätter sind kopierfertig und sofort<br />
einsetzbar. Zur Bearbeitung <strong>de</strong>r genannten Bereiche<br />
o<strong>de</strong>r als Ergänzung zu eingeführten Religionsbüchern<br />
ist die Arbeitshilfe geeignet. Lei<strong>de</strong>r<br />
sind aber keine weiteren unterrichtspraktischen<br />
I<strong>de</strong>en zur Arbeit mit <strong>de</strong>m Heft beigefügt.<br />
Gabriele Hastrich<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Thömmes, Arthur<br />
ÜÜbbeerrLLeebbeenn<br />
88 Arbeitsblätter für <strong>de</strong>n Religionsunterricht.<br />
– München: Deutscher Katecheten-Verein<br />
e.V. 2002. 128 S., Format DIN A 4,<br />
€ 15,80 (ISBN 3-88207-338-1)<br />
„Die Sammlung versteht sich als Steinbruch<br />
und Fundgrube zum Ausprobieren und Experimentieren.“<br />
Mit diesem Satz aus <strong>de</strong>m Vorwort ist<br />
die hier vorliegen<strong>de</strong> Sammlung an Arbeitsblättern<br />
recht gut beschrieben. Sie ist kein in sich<br />
geschlossenes „Unterrichtswerk“, son<strong>de</strong>rn eine<br />
Zusammenstellung von Arbeitsblättern, die als<br />
Ergänzung zum laufen<strong>de</strong>n Unterricht eingesetzt<br />
wer<strong>de</strong>n können. Ausgehend vom Lebensgefühl<br />
heutiger Jugend versucht <strong>de</strong>r Autor, ganz konsequent<br />
neue Wege zu gehen. Arbeitsblätter im<br />
Unterricht einzusetzen ist nicht neu, wie auch<br />
schon verschie<strong>de</strong>ne Ausgaben mit Arbeitsblättern<br />
<strong>de</strong>m Religionsunterricht zur Verfügung stehen.<br />
Und die Gegenwartsbezogenheit ist selbstverständlich.<br />
Etwas, womit Jugendliche heute ganz<br />
unbefangen umgehen, was aber bisher zumin<strong>de</strong>st<br />
in Büchern für <strong>de</strong>n Religionsunterricht kaum<br />
o<strong>de</strong>r gar nicht berücksichtigt wur<strong>de</strong>, ist die Nutzung<br />
<strong>de</strong>s Internets. Bei dieser Sammlung wird ganz<br />
bewusst dieses neue Medium in die Unterrichtsgestaltung<br />
einbezogen.<br />
Die Inhalte kreisen um folgen<strong>de</strong> Themenschwerpunkte:<br />
Lebens-Wege, Lebens-Entwürfe,<br />
Lebens-Hilfen, Lebens-Werte, Lebens-Räume.<br />
Zentrale Ziele dieser Arbeitsblätter sind<br />
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit,<br />
die, nach Aussage <strong>de</strong>s Autors, „viel mit <strong>de</strong>m<br />
Fach Religionsunterricht zu tun“ haben. So<br />
wun<strong>de</strong>rt es nicht, wenn religiöse Fragen im engeren<br />
Sinn nur begrenzt thematisiert wer<strong>de</strong>n,<br />
hier fast nur beim Themenschwerpunkt: Lebens-Hilfen.<br />
Diese wer<strong>de</strong>n allerdings ohne Beschönigung<br />
aufgegriffen. So dient das „Credo-<br />
Projekt“ aus Publik-Forum als Grundlage für<br />
das Thema: Glaubensbekenntnis. Wer dieses<br />
Projekt kennt, weiß um <strong>de</strong>ssen Aktualität, aber<br />
auch Brisanz! Berechtigte Kritik an <strong>de</strong>r Kirche<br />
wird ergänzt durch die Auffor<strong>de</strong>rung, eine „eigene<br />
Kirche“ vorzustellen. Dem Wirken Jesu<br />
und <strong>de</strong>m „Markt <strong>de</strong>r Sinnstifter“, gemeint sind<br />
Religionen und religiöse Gruppen, ist je ein Arbeitsblatt<br />
gewidmet. Alles in allem eben ein ergänzen<strong>de</strong>s<br />
Angebot zum „normalen“ Religionsunterricht.<br />
Betrachtet man jedoch Lebenshilfe<br />
<strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nsten Arten als zum Religionsunterricht<br />
gehörig, dann gehört auch <strong>de</strong>r übrige<br />
größte Teil dieser Sammlung dazu. (Natürlich<br />
kann man das dann auch von an<strong>de</strong>ren Fächern<br />
sagen, die nicht nur vom Lernen von Inhalten<br />
geprägt sind). Großen Wert legt <strong>de</strong>r Verfasser<br />
auf die Einübung einer vernünftigen und sinnvollen<br />
Gesprächskultur. So erklärt er eingangs<br />
sage und schreibe fünfzehn Gesprächsformen!<br />
Immer wie<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n die Schülerinnen und<br />
Schüler auf geschickte Weise zum kreativen Arbeiten<br />
angeregt wie etwa beim Thema: Sekten<br />
und religiöse Gruppen. Da sollen einzelne Schülerinnen<br />
und Schüler sich „mit Hilfe unterschiedlicher<br />
Medien ... mit <strong>de</strong>m jeweiligen Thema<br />
vertraut machen“ und dann „auf einem<br />
Markt <strong>de</strong>r Möglichkeiten präsentieren“. Nicht<br />
zu unterschätzen sind Ansätze, Probleme von<br />
menschlichem Zusammensein ins Bewusstsein<br />
zu holen. Beson<strong>de</strong>rs beeindrucken<strong>de</strong>s Beispiel<br />
ist die fiktive Bildung einer Wohngemeinschaft.<br />
Aus vierzehn möglichen „Kandidaten“ in verschie<strong>de</strong>nsten<br />
Situationen können nur fünf ausgewählt<br />
wer<strong>de</strong>n. Wird eine fleißige Bankangestellt<br />
einem frustrierten Arbeitslosen vorgezogen?<br />
Hat eine Rollstuhlfahrerin mehr Chancen<br />
als ein aus <strong>de</strong>r Haft Entlassener? Hilfen zur<br />
Selbsterkenntnis im Umgang mit <strong>de</strong>r Angst, mit<br />
<strong>de</strong>m Gedanken an <strong>de</strong>n Tod und Überlegungen zu<br />
Werten im menschlichen Leben sind nur einige<br />
<strong>de</strong>r übrigen Themen. Und wenn auch noch „Daily<br />
Soaps“ auf <strong>de</strong>m Programm stehen, trifft dies<br />
mitten in <strong>de</strong>n Erfahrungshorizont unserer fernseherfahrenen<br />
Jugend. Mit vier Arbeitsblättern<br />
liegt hier ein<strong>de</strong>utig ein Schwerpunkt. Einer kritischen<br />
Analyse folgt ein Fragebogen für Soap-<br />
Zuschauer außerhalb <strong>de</strong>r Lerngruppe und ein<br />
an<strong>de</strong>rs konzipierter für die Teilnehmer selbst.<br />
Ein abschließen<strong>de</strong>s Arbeitsblatt zu diesem Thema<br />
enthält eine Anregung und organisatorische<br />
Tipps, selbst eine solche Seifenoper zu drehen,<br />
für <strong>de</strong>n Verfasser nicht nur eine Illusion, <strong>de</strong>nn:<br />
„Sie wer<strong>de</strong>n erstaunt sein, über wie viel Metho<strong>de</strong>nkompetenz<br />
Ihre Schülerinnen und Schüler<br />
verfügen ... Nicht alle Jugendlichen sind hilflos<br />
<strong>de</strong>n medialen Botschaften ausgeliefert“. Hier<br />
drückt sich auch eine weitere Stärke dieser<br />
Sammlung aus: Sie ist bis ins Detail aus <strong>de</strong>r Praxis<br />
entstan<strong>de</strong>n, und das macht sie so wertvoll für<br />
die Praxis. Dazu auch die abwechslungsreiche<br />
Art <strong>de</strong>r angebotenen Arbeitsblätter. So kann die<br />
Arbeit mit ihnen anregen und zu eigenen I<strong>de</strong>en<br />
weiter führen. Informationsblätter, Sprüche,<br />
Satzfetzen, Lie<strong>de</strong>r, Mandalas, unfertige Spiele,<br />
Ergänzungstexte, Fragebogen, Textvergleiche<br />
und viele I<strong>de</strong>en zur kreativen Weiterarbeit sind<br />
angeboten. Bestimmt für je<strong>de</strong>n etwas.<br />
Helmut Bahr<br />
Herzog, Daniela/Sten<strong>de</strong>r, Frank<br />
WWiiee sseehheenn d<strong>de</strong>ennnn<br />
wwoohhll EEnnggeell aauuss??<br />
Werkbuch für Familie, Kin<strong>de</strong>rgarten und Schule.<br />
– <strong>Limburg</strong>-Kevelaer: Lahn-Verlag. 2001. 88 S., ill.,<br />
€ 9.90 (ISBN 3-7840-3208-7)<br />
Engel sind uns aus <strong>de</strong>r Bibel als Boten Gottes<br />
bekannt. Sie übermitteln <strong>de</strong>m Menschen Aufträge,<br />
Schutz, Trost und Wegweisung. Doch die<br />
Botschaft von Daniela Herzog und Frank Sten<strong>de</strong>r<br />
lautet weiter: Wir alle können Engelboten sein.<br />
Die verschie<strong>de</strong>nen Kapitel bestehen aus einer<br />
Geschichte mit offenem En<strong>de</strong>. Dazu sind jeweils<br />
Impulse zum Weitererzählen gegeben. Im Anschluss<br />
daran haben die Autoren unter <strong>de</strong>m Begriff<br />
Puzzlesteine viele unterschiedliche I<strong>de</strong>en eingefügt:<br />
Bastelvorlagen, Verklanglichungen, Stegreifspiele,<br />
Bildbetrachtungen, Rezepte, Spiele, Geschenkvorschläge,<br />
Sprichwörter, Texte und Gebete.<br />
Das Buch unterteilt sich in 8 Teile:<br />
1. Ein beinahe echter Indianer-Kin<strong>de</strong>rgeburtstag;<br />
2. Lieber selber urteilen;<br />
3. Immer die gleiche „heilige Hetze“;<br />
4. Drei Freun<strong>de</strong> und ein Schutzhelm;<br />
5. Ein Urlaubsanfang mit Hin<strong>de</strong>rnissen;<br />
6. Kein Abschied für immer!<br />
7. Spiele mit Engeln;<br />
8. Texte und Gebete.<br />
Die einzelnen Geschichten <strong>de</strong>s Buches können<br />
unabhängig voneinan<strong>de</strong>r eingesetzt wer<strong>de</strong>n.
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Bild o<strong>de</strong>r zuerst<br />
nur die Geschichte verwen<strong>de</strong>t wird. Die Puzzelsteine<br />
dienen als I<strong>de</strong>enbörse. Am Beginn je<strong>de</strong>r<br />
Bastelanleitung wird kurz die pädagogische Absicht<br />
und <strong>de</strong>r Zweck <strong>de</strong>s Puzzlesteins erläutert.<br />
Die Puzzlesteine sind dabei so geordnet, dass die<br />
leichtesten Aufgaben am Beginn je<strong>de</strong>s Kapitels<br />
stehen. Dadurch lässt sich rasch für je<strong>de</strong>s Alter<br />
die passen<strong>de</strong> Bastelübung fin<strong>de</strong>n.<br />
Dieses Werkbuch bietet zahlreiche Anregungen<br />
für die Arbeit in Kin<strong>de</strong>rgarten und Schule<br />
zum Thema „Engel“. Ich <strong>de</strong>nke, dass das Buch<br />
sich als zusätzliche Materialsammlung auch durchaus<br />
eignet. Doch für die Arbeit in <strong>de</strong>r Grundschule<br />
wür<strong>de</strong> ich mir mehr grundlegen<strong>de</strong>s Material<br />
auch zur Vermittlung von Engelerscheinungen in<br />
<strong>de</strong>r Bibel wünschen. Da ein Großteil <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>en<br />
aus Bastelvorschlägen besteht, sind die Einsatzmöglichkeiten<br />
für <strong>de</strong>n Religionsunterricht begrenzt.<br />
Gabriele Hastrich<br />
Wolff, Uwe<br />
AAlllleess üübbeerr ddiiee ggee-ffaalllleenneenn<br />
EEnnggeell<br />
Aus <strong>de</strong>m Wörterbuch <strong>de</strong>s Teufels. – Stuttgart-Zürich:<br />
Kreuz Verlag. 2002. 254 S., €19.90 (ISBN 3-<br />
7831-2152-3)<br />
Nicht nur „Harry Potter“ und „Der Herr <strong>de</strong>r<br />
Ringe“ haben jüngst die Welt <strong>de</strong>r Magie wie<strong>de</strong>r<br />
salonfähig gemacht. Einschlägige TV-Serien bringen<br />
vielerlei Hexen, Zauberer und Dämonen nebst<br />
allerlei Übersinnlichem in die Wohnzimmer.<br />
Der Grund <strong>de</strong>r Faszination ist für Wolff relativ<br />
einfach: „Wir erkennen in ihm die an<strong>de</strong>re Seite<br />
unserer eigenen Natur wie<strong>de</strong>r“ (9). Insbeson<strong>de</strong>re<br />
allen, die mit Jugendlichen arbeiten, will das<br />
Buch „Mut machen, <strong>de</strong>n Hintergrund <strong>de</strong>s Geister-,<br />
Hexen-, Dämonen- und Teufelsglaubens zu erhellen“<br />
(10). So versteht W. die Ausführungen in<br />
<strong>de</strong>n über 90 lexikalischen Artikeln als „Kommentar<br />
zum Zeitgeist, zu <strong>de</strong>m, was zur Zeit ‚abgeht’“<br />
(ebd.). Er räumt auch gleich zu Beginn ein, die<br />
Auskünfte seien „manchmal ernst, gelegentlich<br />
heiter im Stil, doch stets informierend und aufklärend“<br />
(ebd.). Bei <strong>de</strong>n Anmerkungen zwischen<br />
„Angst“ und „Zombies“ gelingt diese Unterscheidung<br />
jedoch am ehesten <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r kein Neuling<br />
ist in diesem Schattenreich. Teils sind die<br />
Texte mehr eine assoziative Auflistung, teils<br />
wirkt die Darstellung doch etwas zu objektivierend.<br />
Neben <strong>de</strong>n religionsgeschichtlichen An<strong>de</strong>utungen<br />
bleibt oft eine zeitgemäße theologische<br />
Deutung aus.<br />
Dennoch hat W. hier kenntnisreich (und stellenweise<br />
sehr <strong>de</strong>tailfreudig) vieles zusammen getragen,<br />
was gera<strong>de</strong> auch religionspädagogisch von<br />
Nutzen ist. Der Leser erfährt einiges über die Varianten<br />
<strong>de</strong>s Satanismus, die Gothic-Szene, Marilyn<br />
Manson, <strong>de</strong>n Fall Ruda, Aleister Crowley und die<br />
Teufelssympathie <strong>de</strong>r frühen Rolling Stones<br />
u.v.a.m. Ein Register und eine entsprechen<strong>de</strong> Literaturauswahl<br />
erleichtern das Auffin<strong>de</strong>n und Vertiefen.<br />
Für Eltern, Erzieher, Lehrkräfte und Seelsorger<br />
von beson<strong>de</strong>rem Wert ist die abschließen-<br />
<strong>de</strong> Reflexion „Was ist ein gefallener Engel, und<br />
warum interessieren sich gera<strong>de</strong> junge Menschen<br />
für dieses Thema?“ (238-243). Hier wird in geraffter<br />
Form und in 14 plausiblen Thesen die<br />
Quintessenz <strong>de</strong>r Erkundungen gezogen. Darin wird<br />
<strong>de</strong>utlich, welche Schieflagen in bisheriger Theologie<br />
und Religionspädagogik das Mistbeet bereitet<br />
haben, auf <strong>de</strong>m all die okkulten Gewächse blühen.<br />
Aufarbeitungen am Menschen- und Gottesbild<br />
scheinen daher gera<strong>de</strong> aus pädagogischer Sicht nötig<br />
zu wer<strong>de</strong>n. Wenn die Neigung zum Aberglauben<br />
unleugbar zum Menschen gehört, sind „we<strong>de</strong>r<br />
Wegschauen noch grenzenlose Toleranz“ angebracht<br />
(238). Nur die integrieren<strong>de</strong> Kenntnis<br />
„<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite <strong>de</strong>r Wirklichkeit“ führt zu einem<br />
reifen Menschsein (ebd.). Auch aus <strong>de</strong>m „Wörterbuch<br />
<strong>de</strong>s Teufels“ gibt es etwas zu lernen, wie<br />
dieses Buch reichlich belegt.<br />
Reiner Jungnitsch<br />
Leitschuh, Marcus/Pfeiffer,<br />
Cornelia (Hg.)<br />
GGeemmeeiinnssaamm<br />
eennttd<strong>de</strong>ecckkeenn<br />
Ökumenische Gebete und Meditationen. Mit einem<br />
Vorw. v. Karl Kardinal Lehmann und Präses<br />
Manfred Kock. – Pa<strong>de</strong>rborn: Bonifatius Verlag/<br />
Frankfurt Verlag O. Lembeck. 2003. 196 S., € 9.90<br />
(ISBN 3-89710-242-0=Bonifatius/3-97476- 420-<br />
X=Lembeck)<br />
Den bei<strong>de</strong>n Herausgebern, <strong>de</strong>m Religionslehrer<br />
und Publizist Marcus Leitschuh und <strong>de</strong>r<br />
Netzwerkadministratorin und Lektorin Cornelia<br />
Pfeiffer, ist es gelungen über 100 Theologen und<br />
Laien, Frauen und Männer, bekannte und unbekannte<br />
Autoren, Deutsche und Auslän<strong>de</strong>r dazu zu<br />
bewegen, Gebete und Meditationen aus ihrem Alltag<br />
und Erleben für unseren Alltag nie<strong>de</strong>rzuschreiben.<br />
Sie la<strong>de</strong>n ein zum Mitbeten und damit<br />
zugleich zum Nachvollziehen ihrer meditativen<br />
Gedanken. Sehr unterschiedlich in Umfang und<br />
Aussagekraft sind zwar die einzelnen Texte, gemeinsam<br />
ist ihnen jedoch die Sehnsucht nach Gemeinschaft<br />
mit <strong>de</strong>m einen Gott und <strong>de</strong>n Menschen<br />
aller Kirchen. Die Einheit <strong>de</strong>r Christen, <strong>de</strong>r<br />
Wunsch nach einem friedlichen Miteinan<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Kirchen und Religionen, erst recht <strong>de</strong>r Menschen<br />
untereinan<strong>de</strong>r ist <strong>de</strong>r tragen<strong>de</strong> Gedanke aller Texte.<br />
In dieser Form möge die Gebetesammlung<br />
über <strong>de</strong>n ökumenischen Kirchentag 2003 hinaus<br />
wirksam bleiben. Bernhard Merten<br />
Rahner, Karl / Vorgrimler, Herbert<br />
(Hg.)<br />
KKlleeiinneess KKoonnzziillss-kkoommppeennddiiuumm<br />
– Freiburg u.a.: Verlag Her<strong>de</strong>r. 29. Aufl. 2002. 775 S.,<br />
€ 19.90 (ISBN 3-451-27735-2)<br />
Masse spricht nicht immer für Qualität, und<br />
Neuauflagen gibt es von schlechten Büchern<br />
genauso wie von guten. In diesem Fall ist die<br />
2002 erschienene 29. Auflage <strong>de</strong>s mittlerweile<br />
in über 100.000 Exemplaren verbreiteten „Kleinen<br />
Konzilskompendiums“ Ausweis <strong>de</strong>r bis<br />
heute kaum zu überschätzen<strong>de</strong>n Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s<br />
Konzils für Theologie und Kirche ebenso wie<br />
<strong>de</strong>r Güte <strong>de</strong>s Büchleins selbst, das „alle 16 Texte<br />
<strong>de</strong>s II. Vatikanischen Konzils in <strong>de</strong>utscher<br />
Übersetzung durch eine handliche Ausgabe<br />
möglichst vielen zugänglich machen [will], die<br />
sich dafür interessieren – o<strong>de</strong>r interessieren<br />
sollten“ (11).<br />
Sicher sind unzählige Fachbücher und Kommentare<br />
zum zweiten Vatikanum geschrieben wor<strong>de</strong>n,<br />
die in Forschung und Lehre ihre Verwendung<br />
und Berechtigung fin<strong>de</strong>n. Das vorliegen<strong>de</strong><br />
Konzilskompendium will diese Fachliteratur we<strong>de</strong>r<br />
ersetzen noch ein populärwissenschaftlicher<br />
Rundumschlag sein. Es ist Nachschlagewerk und<br />
erste Einführung zur sachgerechten und kritischen<br />
Übersetzung <strong>de</strong>s Konzils in das Leben <strong>de</strong>r konkreten<br />
Kirche. Es trägt <strong>de</strong>r Überzeugung Rechnung,<br />
dass „nur ein kritischer Leser <strong>de</strong>r Konzilstexte<br />
[...] sich Geist und Buchstaben <strong>de</strong>r Texte<br />
wirklich aneignen [kann] im freien Gehorsam <strong>de</strong>s<br />
mündigen Christen“ (12). Es bietet – aus erster<br />
Hand, in <strong>de</strong>r Verantwortung eines <strong>de</strong>r wichtigsten<br />
Konzilstheologen sowie seines Schülers und<br />
Konzilskenners – eine differenzierte, gehaltvolle<br />
Einführung, die <strong>de</strong>n Unkundigen ebenso wie <strong>de</strong>n<br />
Fachtheologen über <strong>de</strong>n ekklesiologischen Ort<br />
<strong>de</strong>s Konzils, seine formalen und inhaltlichen Beson<strong>de</strong>rheiten,<br />
über zeitlichen Verlauf, Schwerpunkte<br />
und Streitfragen, über Gestalt und Argumentationsgang<br />
<strong>de</strong>r Texte informiert. Es bietet alle<br />
Texte in <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Bischöfen approbierten<br />
Textgestalt sowie ein ausführliches<br />
Sachregister. Alles in allem: es bleibt unerlässliche<br />
Grundlage für alle interessierten Christen,<br />
Theologie-Studieren<strong>de</strong>n, Lehrer/-innen und Theologinnen<br />
und Theologen, die sich mit <strong>de</strong>m großen<br />
aggiornamento <strong>de</strong>r jüngeren Kirchengeschichte<br />
beschäftigen, mit <strong>de</strong>m Ereignis, mit <strong>de</strong>m die Kirche<br />
danach trachtete, „getreu <strong>de</strong>n heiligen Grundsätzen<br />
[...], mit herzhaftem Schwunge ihr Leben<br />
und ihren Zusammenhalt wie<strong>de</strong>r zu stärken, auch<br />
im Hinblick auf alle Gegebenheiten und Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>de</strong>s Tages“ (Papst Johannes XXIII. am<br />
30.06.1959). Julia Knop<br />
LLeexxiikkoonn d<strong>de</strong>err RReeffoorr-mmaattiioonnsszzeeiitt<br />
Redaktion: Klaus Grenzer u.<br />
Bruno Steiner (Lexikon für Theologie und Kirche<br />
kompakt). – Freiburg u. a.: Verlag Her<strong>de</strong>r. 2002.<br />
874 Sp. m. Karten, € 19.90 (ISBN 3-451-22019-9)<br />
Kritisches Hinschauen ist verlangt, wenn ein<br />
Verlag zur Zweitverwertung seiner Produkte<br />
schreitet. So auch hier im Fall <strong>de</strong>s „Lexikon <strong>de</strong>r<br />
Reformationszeit“. Es han<strong>de</strong>lt sich um eine Zusammenstellung<br />
von etwa 660 Stichwörtern aus<br />
<strong>de</strong>r dritten Auflage <strong>de</strong>s „Lexikon für Theologie<br />
und Kirche“. Verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Thema ist <strong>de</strong>r Zeitraum<br />
<strong>de</strong>r Reformation. Das schließt sowohl die<br />
Jahrzehnte unmittelbar vor <strong>de</strong>m Auftreten Martin<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
197
LITERATUR & MEDIEN<br />
198<br />
Luthers mit ein wie die katholische Reform und<br />
die reformatorische Bekenntnisbildung. Zu einer<br />
Vielzahl von Personen, Orten und Ereignissen erhält<br />
man soli<strong>de</strong> und umfassen<strong>de</strong> Information. Beson<strong>de</strong>rs<br />
hervorzuheben ist, dass die Literaturangaben<br />
auf <strong>de</strong>m neuesten <strong>Stand</strong> sind. Nachträge<br />
zu einzelnen Artikeln sind im Druck eigens gekennzeichnet.<br />
Ob man freilich mit einem Lexikon einen<br />
Überblick über die Reformationszeit erhält, vor<br />
allem über die Voraussetzungen und die Strömungen,<br />
die dahin führten, aber auch über die großen<br />
Entwicklungen <strong>de</strong>r Konsolidierung und Neuausprägung<br />
konfessioneller Großgruppen, darf nach<br />
<strong>de</strong>r Lektüre durchaus bezweifelt wer<strong>de</strong>n. Aufgenommen<br />
wur<strong>de</strong>n nur die Artikel, die sich ausdrücklich<br />
mit <strong>de</strong>r Reformationszeit beschäftigen.<br />
Dadurch fielen beispielsweise wichtige Informationen<br />
zur Vorreformationszeit unter <strong>de</strong>n Tisch;<br />
Stichworte wie „Volksfrömmigkeit“ o<strong>de</strong>r „Wallfahrt(en)“<br />
sucht man vergebens. Dabei hebt gera<strong>de</strong><br />
die neuere (auch evangelische) Forschung zur<br />
Reformation hervor, dass das „Ereignis Martin<br />
Luther“ auf <strong>de</strong>m Hintergrund einer reichhaltigen,<br />
keineswegs <strong>de</strong>generierten, son<strong>de</strong>rn erneuerten<br />
spätmittelalterlichen Frömmigkeit neu ge<strong>de</strong>utet<br />
wer<strong>de</strong>n muss. Die spätmittelalterlichen Voraussetzungen<br />
für die Reformation sind eben nicht nur<br />
<strong>de</strong>r „Humanismus“ o<strong>de</strong>r die unter „Kunst und Reformation“<br />
abgehan<strong>de</strong>lte Bil<strong>de</strong>rverehrung und<br />
Bil<strong>de</strong>rkritik, son<strong>de</strong>rn spiegeln sich in <strong>de</strong>n massenhaften<br />
Wallfahrten zur „Schönen Maria“ in Regensburg,<br />
<strong>de</strong>n Altarstiftungen <strong>de</strong>s Bürgertums<br />
o<strong>de</strong>r einer von Berndt Hamm durchaus positiv<br />
apostrophierten „Frömmigkeitstheologie“ wi<strong>de</strong>r.<br />
Analoges ist für die Behandlung <strong>de</strong>r Nachreformationszeit,<br />
also <strong>de</strong>r protestantischen Konfessionsbildung<br />
und Katholischen Reform, zu sagen.<br />
Positiv hervorzuheben ist, dass das Deuteparadigma<br />
„Konfessionalisierung“ behan<strong>de</strong>lt wird. Dass<br />
aber ein Stichwort „Bildung“ fehlt, ist schon befremdlicher.<br />
Noch unverständlicher ist, dass keiner<br />
<strong>de</strong>r großen nachreformatorischen katholischen<br />
Or<strong>de</strong>n aufgenommen ist. Auf diese Weise<br />
fällt die Leistung <strong>de</strong>s Jesuitenor<strong>de</strong>ns für die Reform<br />
<strong>de</strong>s nachreformatorischen Katholizismus<br />
(Schulwesen, Mission, Theologie) ebenso unter<br />
<strong>de</strong>n Tisch wie die volkstümliche Prägekraft, die<br />
von <strong>de</strong>n Kapuzinern ausging. Auch wird unter<br />
<strong>de</strong>m Stichwort „Zölibat“ die konkrete, anstößige<br />
Praxis nicht erwähnt, son<strong>de</strong>rn es wer<strong>de</strong>n lediglich<br />
die rechtlichen Regelungen behan<strong>de</strong>lt. So zeigt<br />
sich in <strong>de</strong>r Zusammenstellung <strong>de</strong>s Lexikons eine<br />
Vernachlässigung mentalitätsgeschichtlicher Aspekte,<br />
<strong>de</strong>ren Be<strong>de</strong>utung für das Verständnis <strong>de</strong>s<br />
Vorgangs „Reformation“ nicht hoch genug eingeschätzt<br />
wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Vieles wäre aus <strong>de</strong>r elfbändigen Vorlage <strong>de</strong>s<br />
„Lexikon für Theologie und Kirche“ noch herauszuholen<br />
gewesen, doch haben sich die Bearbeiter<br />
auf die Personen- und wichtigsten Stichwortartikel<br />
konzentriert. Dabei ist ein Kompendium<br />
entstan<strong>de</strong>n, das einen guten Überblick bietet<br />
– vor allem, wenn man die Literaturhinweise<br />
zu lesen und zu nutzen versteht –, doch <strong>de</strong>n gegenwärtigen<br />
<strong>Stand</strong> <strong>de</strong>r Reformationsforschung<br />
nur bedingt transparent wer<strong>de</strong>n lässt.<br />
Joachim Schmiedl<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Brox, Norbert<br />
KKiirrcchheennggeesscchhiicchhttee<br />
d<strong>de</strong>ess AAlltteerrttuummss<br />
– Düsseldorf: Patmos Verlag. 6. Aufl. 1998. ppb<br />
2002. 206 S., € 9.95 (ISBN 3-491-69063-3)<br />
Der Patmos Verlag legt jetzt als Paperback-<br />
Ausgabe ohne Überarbeitung <strong>de</strong>s Textes und Ergänzungen<br />
<strong>de</strong>r Literaturangaben die bereits<br />
1983 in 1. Auflage als „Leitfa<strong>de</strong>n Theologie“,<br />
Band 8, und in 6. Auflage im Jahr 1998 erschienene<br />
„Kirchengeschichte <strong>de</strong>s Altertums“ von N.<br />
Brox vor.<br />
„Kirchengeschichtliches Wissen“ – so <strong>de</strong>r Verfasser<br />
in seinem Vorwort – „korrigiert i<strong>de</strong>alistische<br />
und i<strong>de</strong>ologische Abstraktionen in <strong>de</strong>r Theologie,<br />
vor allem aber hilft es, die biblischen und<br />
dogmatischen Aussagen über die maßgebliche Beson<strong>de</strong>rheit<br />
<strong>de</strong>s Verhältnisses von Glaube und Geschichte,<br />
Offenbarung und Historie im Christentum<br />
als Aussagen über die tatsächliche Geschichte<br />
<strong>de</strong>r Menschheit nachzuvollziehen und auszulegen“<br />
(7). Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen.<br />
Der Autor gibt <strong>de</strong>m Stoff vom Anfang <strong>de</strong>r Kirche<br />
„in <strong>de</strong>n kleinen Gruppen von Freun<strong>de</strong>n, Verwandten<br />
und Anhängern Jesu von Nazaret, die<br />
nach Jesu Tod in Galiläa und Jerusalem weiterbestan<strong>de</strong>n<br />
bzw. sich neu gebil<strong>de</strong>t haben“ (9) bis zum<br />
Konzil von Chalzedon im Jahr 451 in 8 Kapiteln<br />
Struktur. Neben <strong>de</strong>r übersichtlichen und prägnanten<br />
Glie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Buches erleichtert das Namens-<br />
und Sachregister (202-206) die Orientierung.<br />
Die Sprache <strong>de</strong>s nunmehr emeritierten Hochschullehrers<br />
für Alte Kirchengeschichte und Patrologie<br />
aus Regensburg ist konzis, klar, schnörkellos.<br />
Griechische und lateinische Fachbegriffe<br />
wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m Leser übersetzt. In <strong>de</strong>r Darstellung<br />
kommen neben <strong>de</strong>r theologischen Dimension unbedingt<br />
notwendige geographische Perspektiven<br />
<strong>de</strong>s frühen Christentums in <strong>de</strong>n Blick. Lei<strong>de</strong>r<br />
fehlt visualisieren<strong>de</strong>s Kartenmaterial.<br />
Der Leitfa<strong>de</strong>n kann als gute Vorbereitung für<br />
Examina gelten. Wesentliche Namen, Daten und<br />
Fakten <strong>de</strong>r ersten christlichen Jahrhun<strong>de</strong>rte wer<strong>de</strong>n<br />
vermittelt. Wünschenswert wäre es, wenn<br />
unabdingbar Wichtiges fett gesetzt wäre; Daten<br />
bzw. fett am Rand <strong>de</strong>s Fließtextes. Eine Zeittafel<br />
am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Buches wäre kein Überfluss.<br />
Als Religionspädagoge wünschte ich mir,<br />
dass <strong>de</strong>r Fachwissenschaftler N. Brox in wenigen<br />
pointierten Sätzen Entwicklungslinien über sein<br />
Forschungsgebiet hinaus in die Gegenwart gezogen<br />
hätte. Probleme <strong>de</strong>r Alten Kirchengeschichte<br />
müssen nicht nur für junge Leute gegenwärtig<br />
sein. So z.B. 313 das Mailän<strong>de</strong>r Protokoll <strong>de</strong>s Konstantin<br />
und <strong>de</strong>s Licinius. O<strong>de</strong>r 380 das Edikt <strong>de</strong>s<br />
Kaisers Theodosius d. Gr., das alle Reichsbewohner<br />
auf das Bekenntnis von Nizäa verpflichtete und<br />
damit die Staatskirche schuf. Vor allem gilt das<br />
Gesagte für Kapitel „4 Kirchliches Leben und<br />
Organisieren“ (83-136).<br />
Ich begrüße, dass Studieren<strong>de</strong> und etablierte<br />
Religionslehrer/-innen auf die „Kirchengeschichte<br />
<strong>de</strong>s Altertums“ von N. Brox zurückgreifen<br />
können. Bernhard Jendorff<br />
Frank, Isnard Wilhelm<br />
KKiirrcchheennggeesscchhiicchhttee<br />
d<strong>de</strong>ess MMiitttteellaalltteerrss<br />
– Düsseldorf: Patmos Verlag. 4. Aufl. 1997. ppb.<br />
2002. 212 S., € 9.95 (ISBN 3-491-69064-1)<br />
Wie die „Kirchengeschichte <strong>de</strong>s Altertums“<br />
von N. Brox so wird auch die „Kirchengeschichte<br />
<strong>de</strong>s Mittelalters“ <strong>de</strong>s ehemaligen Mainzer Kirchenhistorikers<br />
I. W. Frank aus <strong>de</strong>m Jahr 1984 (Leitfa<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Theologie, Bd.14) und 1997 anno 2002<br />
unverän<strong>de</strong>rt angeboten.<br />
Frank bewältigt didaktisch gekonnt die Fülle<br />
<strong>de</strong>s Stoffs von <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung bis zum spätmittelalterlichen<br />
Konziliarismus, in<strong>de</strong>m er fundamentale<br />
Strukturen herausarbeitet. Die Institution<br />
‘Papsttum’ eignet sich „in beson<strong>de</strong>rer Weise<br />
als Ordnungsprinzip“ (9). Hierin fand die abendländische<br />
Christenheit <strong>de</strong>s Mittelalters ihre Einheit.<br />
Frank weist im Vorwort (9) zu Recht auf die<br />
Lektüre von „1.3 Eigentümlichkeiten <strong>de</strong>r frühmittelalterlichen<br />
Frömmigkeit“ (27-32) und auf<br />
das beson<strong>de</strong>re Studium von „1.4 Umformung <strong>de</strong>r<br />
kirchlichen Verfassung durch Grundherrschaft und<br />
Feudalismus“ (33-49) hin.<br />
Nach <strong>de</strong>m hinführen<strong>de</strong>n 1. Kapitel „Aneignung<br />
und Umformung <strong>de</strong>s Christentums“ (11-<br />
49) wer<strong>de</strong>n 4 Schwerpunkte gesetzt: Kapitel „2<br />
Die früh- und hochmittelalterliche Königskirche“<br />
(50-73). Hier mache ich beson<strong>de</strong>rs auf „2.2<br />
Das Verhältnis von weltlicher und geistlicher<br />
Gewalt im frühen und hohen Mittelalter“ (66-<br />
75) aufmerksam. – In Kapitel „3 Die hochmittelalterliche<br />
Papstkirche“ (76-119) wer<strong>de</strong>n alle im<br />
Lehrplan für <strong>de</strong>n (Kirchen-)Geschichtsunterricht<br />
aufgeführten Themen fachwissenschaftlich<br />
exakt dargestellt, so z.B. die Gregorianische<br />
Reform, <strong>de</strong>r Dictatus Papae, <strong>de</strong>r Investiturstreit<br />
o<strong>de</strong>r die Zwei-Schwerter-Theorie. – Aus Kapitel<br />
„4 Das ‘negotium fi<strong>de</strong>i’ in <strong>de</strong>r hochmittelalterlichen<br />
Kirche“ empfehle ich <strong>de</strong>n Praktikern vorrangig<br />
die Lektüre von „4.1.1 Reformor<strong>de</strong>n und<br />
A<strong>de</strong>l“ (123-124). – Den Schlüssel, die Ereignisse<br />
<strong>de</strong>r Reformation in Deutschland besser verstehen<br />
zu lernen, fin<strong>de</strong> ich in Kapitel „5 Zum<br />
kirchlichen Spätmittelalter“ (166-197). Last but<br />
not least verweise ich gern die Kollegen/-innen<br />
auf die Unterkapitel zur Frömmigkeit (137-145;<br />
192-197), die fachwissenschaftlicher Ausgangspunkt<br />
für das Thema <strong>de</strong>r gymnasialen Oberstufe<br />
sein könnten.<br />
W. Frank schrieb einen fachwissenschaftlich<br />
dichten Text, <strong>de</strong>r die tragen<strong>de</strong>n I<strong>de</strong>en und gestalten<strong>de</strong>n<br />
Kräfte <strong>de</strong>s Mittelalters ver<strong>de</strong>utlicht.<br />
Der Text regt zum Detailstudium an. Die angebotenen<br />
– nicht auf <strong>de</strong>m jüngsten <strong>Stand</strong> sich befin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
– Literaturangaben sowohl zu <strong>de</strong>n<br />
einzelnen Kapiteln wie auch die angeführten<br />
Gesamtdarstellungen, Lexika, Quellensammlungen<br />
und Atlanten (198-199) führen <strong>de</strong>n RU<br />
vorbereiten<strong>de</strong>n Lehrer weiter. Ein Studium und<br />
Beruf dienen<strong>de</strong>s Buch ist anzuzeigen.<br />
Bernhard Jendorff
Winkler, Gerhard B.<br />
DDaass PPaappssttttuumm<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Amtsgewalt<br />
von <strong>de</strong>r Antike bis zur Gegenwart. – Innsbruck:<br />
Tyrolia Verlag. 2002. 151 S., € 15.90 (ISBN 3-7022-<br />
2493-9)<br />
Mit <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>r päpstlichen Gewalt beschäftigt<br />
sich das aus Vorlesungen an <strong>de</strong>r Universität<br />
Salzburg hervorgegangene Büchlein <strong>de</strong>s emeritierten<br />
Kirchenhistorikers Gerhard Winkler. Es ist<br />
klar geglie<strong>de</strong>rt, in übersichtliche Kapitel eingeteilt<br />
und bietet eine schnelle Informationsmöglichkeit<br />
über die Geschichte <strong>de</strong>s päpstlichen Primats.<br />
In seinem Durchgang durch die Papstgeschichte<br />
konzentriert sich <strong>de</strong>r Verfasser vor allem auf<br />
die Entwicklung im ersten Jahrtausend. Er beginn<br />
mit <strong>de</strong>m Be<strong>de</strong>utungszuwachs, <strong>de</strong>n die römische<br />
Kirche durch die Apostel Petrus und Paulus erfahren<br />
hat. Das Petrusamt <strong>de</strong>r Bischöfe von Rom<br />
war „ursprünglicher Bestand <strong>de</strong>r apostolischen<br />
Kirche“ (S. 23). In <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit<br />
heterodoxen Gruppierungen wuchsen Wür<strong>de</strong> und<br />
Vorrang <strong>de</strong>s römischen Bischofs. Beispiele sind<br />
<strong>de</strong>r Ketzertaufstreit und die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
um die Kirchenbuße. Bis zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s dritten<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts war <strong>de</strong>r Vorrang <strong>de</strong>r römischen Kirche<br />
unter <strong>de</strong>n drei Patriarchaten Antiochien, Rom<br />
und Alexandrien geklärt.<br />
Nach <strong>de</strong>r Konstantinischen Wen<strong>de</strong> war das<br />
Papsttum in die Reichskirche eingebun<strong>de</strong>n, musste<br />
jedoch durch <strong>de</strong>n Be<strong>de</strong>utungsverlust <strong>de</strong>s weströmischen<br />
Kaisertums zunehmend eine eigene<br />
Autorität entwickeln. Das geschah auf <strong>de</strong>m Weg<br />
über Legaten zu <strong>de</strong>n im Osten <strong>de</strong>s Reiches stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
Konzilien sowie durch die Übernahme<br />
<strong>de</strong>s kaiserlichen Dekretalienstils und an<strong>de</strong>rer weltlicher<br />
Strukturen. Die Päpste wur<strong>de</strong>n zu Schiedsrichtern<br />
in dogmatischen Streitigkeiten. Ihre Autorität<br />
stieg im Lauf <strong>de</strong>s Frühmittelalters beständig<br />
an, auch wenn unter theologischem Gesichtspunkt<br />
ein Leo <strong>de</strong>r Große einem Honorius haushoch<br />
überlegen war. Wichtige Meilensteine <strong>de</strong>r<br />
päpstlichen Amtsgewalt verbin<strong>de</strong>n sich zu<strong>de</strong>m<br />
mit <strong>de</strong>n Missionsinitiativen in England und im<br />
Frankenreich und <strong>de</strong>r Treuebindung <strong>de</strong>r dortigen<br />
Bischöfe an <strong>de</strong>n Stuhl <strong>de</strong>s Petrus.<br />
Die hervorragen<strong>de</strong> Stellung <strong>de</strong>s römischen Bischofs<br />
wur<strong>de</strong> inhaltlich begrün<strong>de</strong>t durch zwei<br />
Fälschungen, nämlich das sogenannte „Constitutum<br />
Constantini“ und die „Pseudoisidorischen Dekretalien“.<br />
Die Päpste nahmen für sich in <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Königen und<br />
römischen Kaisern Immunität in Anspruch. Den<br />
Höhepunkt erreichte dieses Papstverständnis unter<br />
Gregor VII., <strong>de</strong>r bis zur Reformation „Handlungsmaximen<br />
für die Päpste“ (S. 78) in <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>n Fürsten lieferte. Das Ringen<br />
um die Kirchenfreiheit („libertas ecclesiae“) führte<br />
schließlich zu einer ersten be<strong>de</strong>utsamen Herausbildung<br />
eines päpstlichen Primats, <strong>de</strong>r sich in<br />
Exemtionsprivilegien für Klöster und Or<strong>de</strong>n, in<br />
<strong>de</strong>r Kontrolle <strong>de</strong>s Wallfahrtswesens (bis hin zu <strong>de</strong>n<br />
Kreuzzügen) und in <strong>de</strong>r Beanspruchung <strong>de</strong>r alleinigen<br />
Kompetenz in Heiligsprechungsfragen äußerte.<br />
Innozenz III. und Bonifaz VIII. repräsentieren<br />
<strong>de</strong>n Höhepunkt dieses Anspruchs.<br />
Die Geschichte <strong>de</strong>r päpstlichen Gewalt seit <strong>de</strong>m<br />
14. Jahrhun<strong>de</strong>rt wird von Winkler <strong>de</strong>utlich knapper<br />
behan<strong>de</strong>lt als die <strong>de</strong>s ersten Jahrtausends. Im<br />
Spätmittelalter schien sich zunächst die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>s<br />
Konziliarismus durchzusetzen. Die reformatorischen<br />
Kirchen setzten an die Stelle <strong>de</strong>s Papsttums<br />
<strong>de</strong>n fürstlichen Summepiskopat. Die römische Kirche<br />
<strong>de</strong>r Neuzeit <strong>de</strong>utet Winkler im Spannungsfeld<br />
zwischen Dezentralisierung und neuen Einigungsbestrebungen.<br />
Die Erfahrungen <strong>de</strong>r Französischen<br />
Revolution führten dann zu einer Zusammenschau<br />
<strong>de</strong>s päpstlichen Primats und <strong>de</strong>r Unfehlbarkeit<br />
und bereiteten so die Beschlüsse <strong>de</strong>s Ersten<br />
Vatikanischen Konzils vor, <strong>de</strong>ssen Aussagen<br />
über die Glaubenserkenntnis und über <strong>de</strong>n Papst<br />
nach Winkler in einem inneren Zusammenhang zu<br />
sehen sind. Sie sind zu verstehen „als Abschluß eines<br />
fast 1500jährigen Ringens <strong>de</strong>s höchsten geistlichen<br />
Amtes“ (S. 110). Winkler konstatiert, „daß<br />
die Unfehlbarkeitslehre weniger mit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Kirchenstaats als solchem zu tun hatte als mit<br />
<strong>de</strong>r Glaubenskrise <strong>de</strong>s Jahrhun<strong>de</strong>rts Hegels, Feuerbachs<br />
und Darwins“ (S. 113).<br />
Winkler hat ein Buch vorgelegt, das prägnant<br />
über die Entwicklung <strong>de</strong>r päpstlichen Gewalt informiert.<br />
Die Freu<strong>de</strong> wäre allerdings ungetrübter,<br />
wenn nicht so viele computertypische Schreibfehler<br />
stehengeblieben wären. Joachim Schmiedl<br />
Ebertz, Michael N.<br />
AAuuffbbrruucchh iinn d<strong>de</strong>err<br />
KKiirrcchhee<br />
Anstöße für ein zukunftsfähiges Christentum.<br />
– Freiburg u. a.: Verlag Her<strong>de</strong>r. 2003. 128 S. kart.,<br />
€ 14.90 (ISBN 3-451-27623-1)<br />
Ein erfahrener Religionslehrer, inzwischen<br />
längst in einer kirchlichen Führungsposition, sagte<br />
mir einmal: „Das Problem ist doch, dass es für<br />
unseren Religionsunterricht keine Kirche mehr<br />
gibt.“ Mit guten Grün<strong>de</strong>n setzte er voraus, dass<br />
sich die vielen Religionslehrer/-innen kompetent<br />
bemühen, die Mitte <strong>de</strong>s christlichen Glaubens<br />
sach- und altersgerecht zu vermitteln. Aber wo – so<br />
nicht nur seine Frage damals – kann dieses Evangelium<br />
außerhalb <strong>de</strong>r Schule und <strong>de</strong>s Unterrichts<br />
konkret auch erfahren, geübt und gelernt wer<strong>de</strong>n?<br />
Wo ist in einer älter- und altwer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Frauenkirche<br />
unter Männerführung schöpferischer Lebensraum,<br />
um das im Unterricht Erlernte und das<br />
alltäglich Gelebte glaubend darzustellen, ja herzustellen?<br />
Man kann gera<strong>de</strong> dieses Buch <strong>de</strong>s inzwischen<br />
führen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Kirchensoziologen in einer<br />
doppelten Diagnose zusammenfassen – und das ist<br />
gera<strong>de</strong> für Lehren<strong>de</strong> und Lernen<strong>de</strong> von zentraler<br />
Be<strong>de</strong>utung: Es besteht in <strong>de</strong>n real existieren<strong>de</strong>n<br />
Kirchen ein massives Lernproblem, eine Sprachnot<br />
angesichts <strong>de</strong>r Herausfor<strong>de</strong>rung zum Verlernen<br />
und Umlernen. Diese (selbst-)beschränkte<br />
Lernfähigkeit ist das eine – und <strong>de</strong>shalb fühlen<br />
sich viele Religionslehrer/-innen, kirchlich gesehen,<br />
oft auf so verlorenem Posten. Das an<strong>de</strong>re: Es<br />
gibt eine Fülle von neuen Lernchancen (manche<br />
re<strong>de</strong>n <strong>de</strong>shalb gerne von „Emergenz“, vom Auf-<br />
tauchen <strong>de</strong>s Neuen im Alten), es gibt angesichts<br />
rasanter Verän<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>r Gesellschaft die<br />
spürbare Einladung zum förmlich pionierhaften,<br />
evangelisatorischen Aufbruch in Neuland. Ein typisches<br />
Beispiel für Lernverweigerung angesichts<br />
<strong>de</strong>r allseits spürbaren Pluralisierungs- und<br />
Differenzierungsvorgänge: die Fixierung auf die<br />
Ortsgemein<strong>de</strong>, mit zunehmen<strong>de</strong>m Verlust all <strong>de</strong>rer,<br />
die eben auch religiös und spirituell immer<br />
mehr chatten, surfen und wählerisch sind. Ein typisches<br />
Beispiel für Lerngewinn: die Wie<strong>de</strong>rent<strong>de</strong>ckung<br />
symbolischer Formen und Interaktionen<br />
<strong>de</strong>s Christlichen (bis hin zu Happenings und<br />
Events bei beson<strong>de</strong>ren Anlässen), die neue Fülle<br />
geistlicher Gemeinschaften und spiritueller Aufbrüche.<br />
Nicht zufällig äußert sich in einer neueren<br />
empirischen Repräsentativbefragung die Mehrzahl<br />
<strong>de</strong>r befragten Jugendlichen mit <strong>de</strong>m Satz,<br />
dass man „aus <strong>de</strong>r Kirche viel mehr machen<br />
könnte“.<br />
Ebertz glie<strong>de</strong>rt seine 50 Punkte klar und pointiert:<br />
zuerst „Umbrüche“, ablesbar in <strong>de</strong>n Megatrends<br />
<strong>de</strong>r Gegenwartsgesellschaft und ihren<br />
Chancen für Religion und Kirche, dann „Abbrüche“<br />
mit einem lebhaften Plädoyer für die<br />
Überwindung bloß ortsgemeindlicher Pastoral<br />
und Perspektive; „Aufbrüche“ schließlich mit entsprechen<strong>de</strong>n<br />
person-, projekt- und milieu-orientierten<br />
Initiativen und „Inszenierungen“ <strong>de</strong>s Christlichen.<br />
Ebertz hat die notwendigen Theoriezusammenhänge<br />
genau im Auge, hält sie im Text<br />
aber im Hintergrund; vorrangig ist die klar akzentuieren<strong>de</strong><br />
und mit vielen Beispielen treffsicher<br />
akzentuierte Analyse und Perspektive, durchaus<br />
engagiert und mit spürbarer Option; nichts von<br />
<strong>de</strong>r ansonsten weitverbreiteten (inner-) kirchlichen<br />
Larmoyanz, nichts von <strong>de</strong>m ebenfalls üblichen<br />
Klischee<strong>de</strong>nken zwischen links und rechts –<br />
statt<strong>de</strong>ssen eine Fülle von geglückten Formulierungen,<br />
die Alltagserfahrungen in und zwischen<br />
<strong>de</strong>n Kirchen auf <strong>de</strong>n Punkt bringen, und Empfehlungen<br />
wie Perspektiven, die konkret weiter helfen.<br />
Das Buch durchweht ein durch und durch<br />
hoffnungsvoller Atem, befreiend klar in Trenddiagnosen<br />
und stets in <strong>de</strong>r Überzeugung, dass das<br />
Christliche sich sehen lassen kann und etwas Beson<strong>de</strong>res<br />
zu vermitteln hat. Aber es bietet, wie<br />
könnte es auch, keine Rezepte; es sollte für Gruppen<br />
und Einzelne zum Arbeitsbuch wer<strong>de</strong>n, die<br />
Schmerzpunkte <strong>de</strong>r Gegenwartsrealität und die<br />
Zündpunkte pastoraler (wie religionspädagogischer)<br />
Kreativität zu fin<strong>de</strong>n.<br />
Aus <strong>de</strong>r Vielzahl genauer Beobachtungen und<br />
wichtiger Anregungen sei z.B. <strong>de</strong>r Hinweis hervorgehoben,<br />
dass Geschmacksfragen sozial und<br />
auch religiös an Be<strong>de</strong>utung gewinnen: Nicht mehr<br />
die Wahrheitsfrage steht im Mittelpunkt, son<strong>de</strong>rn<br />
<strong>de</strong>r Test, ob ein Gottesdienst „altmodisch“ o<strong>de</strong>r<br />
„langweilig“ ist, „bunt“ o<strong>de</strong>r „lustig“. Die Ästhetisierung<br />
<strong>de</strong>r Lebenswelt – „schön Essen gehen“<br />
– macht vor Gottesdienst und Glaubensverständnis<br />
nicht Halt. Vergleichbares gilt für die „Dispersion<br />
<strong>de</strong>s Religiösen“: Heute religiös (interessiert)<br />
sein, heißt inter-religiös (interessiert) sein! Was<br />
das für einen dann ökumenischen o<strong>de</strong>r gar interreligiösen<br />
Religionsunterricht be<strong>de</strong>uten könnte<br />
und müsste, <strong>de</strong>r das Konfessorische <strong>de</strong>s eigenen<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
199
LITERATUR & MEDIEN<br />
200<br />
Bekenntnisses nicht verriete, wäre eine <strong>de</strong>r vielen<br />
spannen<strong>de</strong>n Fragen, mit <strong>de</strong>nen man dieses empfehlenswerte<br />
Buch nach <strong>de</strong>r Lektüre aus <strong>de</strong>r<br />
Hand legt und danach, möglichst oft wie<strong>de</strong>r, in<br />
die Hand nehmen sollte. Dass <strong>de</strong>rlei Überlegungen<br />
eines, freilich theologisch promovierten,<br />
Religionssoziologen unbedingt <strong>de</strong>r Ergänzung<br />
seitens <strong>de</strong>r Theologie und Spiritualität bedürfen,<br />
die aus <strong>de</strong>m Reichtum ihrer Geschichte und Gegenwart<br />
dazu mitlernend viel zu sagen hätten,<br />
liegt auf <strong>de</strong>r Hand (und zeigt schmerzhafte Desi<strong>de</strong>rate<br />
an <strong>de</strong>ren Adresse). Gotthard Fuchs<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Scholl, Norbert<br />
DDiiee ggrrooßßeenn TThheemmeenn<br />
d<strong>de</strong>ess cchhrriissttlliicchheenn<br />
GGllaauubbeennss<br />
– Darmstadt: Primus Verlag. 2002. 360 S., € 34,90<br />
(ISBN 3-89678-445-5)<br />
Dieses Buch löst ein, was <strong>de</strong>r Titel verspricht,<br />
<strong>de</strong>nn wirklich alle großen Themen <strong>de</strong>s christlichen<br />
Glaubens wer<strong>de</strong>n in gut lesbarer Form, verständlicher<br />
Sprache und <strong>de</strong>nnoch kurz dargestellt:<br />
Das I. Kapitel „Die Welt als Schöpfung<br />
Gottes“ (13-35) bietet Überlegungen zu <strong>de</strong>n biblischen<br />
Schöpfungsberichten, zu <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
von Glaube und Naturwissenschaft und zu<br />
philosophischen Fragen nach <strong>de</strong>m Wesen <strong>de</strong>s<br />
Menschen. Das II. Kapitel „Existiert Gott?“ (36-<br />
54) gibt einen Einblick über die Entstehung von<br />
Religion, über Gottesbeweise und über Buddhismus,<br />
Hinduismus und Islam. Das III. Kapitel<br />
„,Unser Gott ist ein Noma<strong>de</strong>‘ – Gotteserfahrung im<br />
Volk Israel“ (55-66) ist <strong>de</strong>r Offenbarung Gottes<br />
an Israel gewidmet, und das IV. Kapitel „Wie<br />
glaubwürdig ist die Bibel?“ (67-87) bespricht Einleitungsfragen<br />
zum AT und NT (Aufbau, Entstehungszeit,<br />
Zwei-Quellen-Theorie bei <strong>de</strong>n synoptischen<br />
Evangelien), stellt sich <strong>de</strong>m Problem <strong>de</strong>r<br />
Inspiration (ist die Bibel Gottes- o<strong>de</strong>r Menschenwort?)<br />
und benennt verschie<strong>de</strong>ne Arten, die Bibel<br />
heute zu lesen. Das V. Kapitel „Was wir über Jesus<br />
wirklich wissen“ (88-136) behan<strong>de</strong>lt nach einem<br />
Einblick in das zeitgeschichtliche Umfeld<br />
(soziale Verhältnisse, religiöse Gruppen) ausführlich<br />
das Leben Jesu mit allen strittigen Fragen<br />
(z. B. Jungfrauengeburt? Wie sind Jesu Wun<strong>de</strong>r<br />
zu verstehen? War das Grab leer? Was geschah an<br />
Ostern?). Das VI. Kapitel „So fing es mit <strong>de</strong>r Kirche<br />
an“ (137-153) beschreibt das Leben <strong>de</strong>r jungen<br />
nachösterliche Gemein<strong>de</strong> und das VII. Kapitel<br />
„Ein Gott in drei Personen?“ (154-188) zeichnet<br />
die sich daran anschließen<strong>de</strong> Entwicklung<br />
von Christologie und Trinität nach. Das VIII. Kapitel<br />
„Kirchengeschichte: Eine ,Kriminalgeschichte‘?“<br />
(189-206) bietet einen kurzen Überblick<br />
bis zum II. Vatikanum. Im IX. Kapitel „Kirche<br />
heute – Skandal o<strong>de</strong>r Heilszeichen?“ (207-<br />
304) sind alle wichtigen Themen behan<strong>de</strong>lt, die<br />
das Thema Kirche betreffen, also <strong>de</strong>r Sinn von<br />
Kirche, ihre Struktur in <strong>de</strong>n Ämtern, Dogmen,<br />
Sakramente im Allgemeinen und im Beson<strong>de</strong>ren<br />
(Taufe, Firmung), Heilige, und wie<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n alle<br />
strittigen Fragen benannt (Die Ämterfrage in <strong>de</strong>r<br />
Ökumene, das Priestertum <strong>de</strong>r Frau, das Papsttum<br />
und die Unfehlbarkeit <strong>de</strong>s Papstes, Kleriker –<br />
Laien, <strong>de</strong>r Zölibat, Zeitgemäßheit von Dogmen,<br />
Maria usw.). Das X. Kapitel „Auf <strong>de</strong>m Weg zur<br />
Ökumene“ (305-317) beschreibt das Verhältnis<br />
<strong>de</strong>r römisch-katholischen Kirche zu an<strong>de</strong>ren christlichen<br />
Kirchen und zu an<strong>de</strong>ren Religionen und<br />
das XI. Kapitel „Wozu Theologie?“ (318-328)<br />
stellt dar, was Theologie eigentlich ist. Das XII.<br />
Kapitel „Ewiges Leben?“ (329-346) beschließt<br />
das Buch mit einem Ausblick auf das En<strong>de</strong> mit<br />
<strong>de</strong>n Themen würdiges Sterben, Nahto<strong>de</strong>rfahrungen,<br />
Auferstehung <strong>de</strong>r Toten, Fegefeuer, Gericht,<br />
Hölle, Reinkarnation und Himmel. Ein Namensregister<br />
und ein Verzeichnis <strong>de</strong>r Bibelstellen run<strong>de</strong>n<br />
das sehr ansprechend gestaltete Buch ab.<br />
Bei dieser umfassen<strong>de</strong>n, thematischen Fülle,<br />
die klar geglie<strong>de</strong>rt, systematisch aufgebaut und verständlich<br />
dargestellt wird, ist Scholl so etwas wie<br />
ein Handbuch gelungen, das einem Nichttheologen<br />
entwe<strong>de</strong>r einen vollständigen Überblick über<br />
die gesamte Theologie bietet o<strong>de</strong>r aber als Nachschlagewerk<br />
dienen kann, das ansprechen<strong>de</strong>r und<br />
ausführlicher als ein Lexikonartikel Auskunft zu<br />
<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nsten Themen gibt. Gut ist dabei,<br />
dass gera<strong>de</strong> die Themen, die in Gemein<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r<br />
Schule immer wie<strong>de</strong>r gefragt wer<strong>de</strong>n, klar zur<br />
Sprache kommen. Und weil das so verständlich<br />
geschieht, könnte man mit diesem Buch durchaus<br />
auch in <strong>de</strong>r gymnasialen Oberstufe im Unterricht<br />
arbeiten. Die Antworten, die Scholl auf diese Fragen<br />
gibt, sind mo<strong>de</strong>rn, wie ja das ganze Buch als<br />
Versuch eingeführt wird, „das mächtige Gebäu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Theologie“, in <strong>de</strong>m viele Räume verstaubt,<br />
muffig und „dringend renovierungsbedürftig<br />
sind“, zu mo<strong>de</strong>rnisieren, so dass „die Besucher<br />
… ein Haus vorfin<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>m es sich (wie<strong>de</strong>r)<br />
wohnen lässt. In <strong>de</strong>m man sich (wie<strong>de</strong>r) wohl<br />
fühlen kann“ (11). Das ist berechtigt. Dennoch<br />
stellt sich mir die grundsätzliche Frage, ob alles<br />
Mo<strong>de</strong>rne wirklich von sich aus schon besser ist<br />
als das Alte, wie es die Einführung nahelegt, o<strong>de</strong>r<br />
ob es nicht manchmal auch notwendig wäre, das<br />
Alte besser zu verstehen und das, was es eigentlich<br />
sagen will, in unsere Sprache zu übersetzen.<br />
Das geschieht zu wenig. Damit zusammen hängt,<br />
dass mir mancher Mo<strong>de</strong>rnisierungsversuch zu einseitig<br />
ist. So wer<strong>de</strong>n etwa, um nur ein Beispiel zu<br />
nennen, die Erscheinungen <strong>de</strong>s Auferstan<strong>de</strong>nen<br />
im Sinne einer (nicht abwertend verstan<strong>de</strong>nen)<br />
Halluzination, also psychologisch, erklärt, ohne<br />
an<strong>de</strong>re Deutungen zu erwähnen, von <strong>de</strong>nen ich<br />
die freilich weniger griffige Auffassung, dass wir<br />
über das Wie <strong>de</strong>r Erscheinungen keine Aussage<br />
machen können, für viel wahrscheinlicher halte.<br />
Ebenfalls bedauernswert fin<strong>de</strong> ich, dass häufig<br />
noch aus <strong>de</strong>r älteren, zweiten Auflage <strong>de</strong>s „Lexikon<br />
für Theologie und Kirche“ zitiert wird, o<strong>de</strong>r<br />
dass am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kapitel in <strong>de</strong>n Literaturangaben<br />
Hinweise zu wichtigen Büchern fehlen,<br />
die eine ergänzen<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r abweichen<strong>de</strong> Sicht zu<br />
Scholls Darstellung vertreten: So z. B. zum ganzen<br />
Bereich <strong>de</strong>r Auferstehung Jesu das Buch von<br />
H. Kessler, Sucht <strong>de</strong>n Leben<strong>de</strong>n nicht bei <strong>de</strong>n Toten.<br />
Die Auferstehung Jesu Christi, Topos 2002,<br />
o<strong>de</strong>r zur Thematik <strong>de</strong>r Dreifaltigkeit das Buch von<br />
G. Greshake, An <strong>de</strong>n drei-einen Gott glauben. Ein<br />
Schlüssel zum Verstehen, Her<strong>de</strong>r, 2 1999. Diese<br />
Schlagseite schmälert <strong>de</strong>n Wert dieses Handbuches,<br />
<strong>de</strong>nn gera<strong>de</strong> bei Nichttheologen wären<br />
Hinweise auf an<strong>de</strong>re Meinungen ehrlicher gewesen,<br />
da Scholl in ihm nicht nur seine Meinung äußern<br />
will, son<strong>de</strong>rn beschreiben möchte, wie die<br />
Theologie „sich zu Beginn <strong>de</strong>s dritten Jahrtausends<br />
darstellt“ (11). Sebastian Schnei<strong>de</strong>r<br />
Fischer, Michael<br />
GGeemmeeiinnd<strong>de</strong>eeennttwwiicckk-lluunngg<br />
kkoonnkkrreett<br />
Ein Arbeitsbuch. – München: Kösel-Verlag. 2002,<br />
128 S., € 12,95 (ISBN 3-466-36585-6)<br />
Wie geht es weiter mit unseren Pfarrgemein<strong>de</strong>n<br />
angesichts <strong>de</strong>s eklatanten Pfarrermangels? –<br />
Vor <strong>de</strong>m Hintergrund dieser Ausgangsfrage ermutigt<br />
Michael Fischer dazu, es nicht bei <strong>de</strong>r Bildung<br />
von Seelsorgeeinheiten bewen<strong>de</strong>n zu lassen,<br />
son<strong>de</strong>rn mit <strong>de</strong>m „Handwerkszeug“ <strong>de</strong>r Organisationsberatung<br />
Gemein<strong>de</strong>entwicklung zu betreiben.<br />
Der Vf. arbeitet als Organisationsberater für<br />
kirchliche Krankenhäuser und besitzt als Gemein<strong>de</strong>berater<br />
mehrjährige Erfahrungen in <strong>de</strong>r Begleitung<br />
von Prozessen <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>entwicklung.<br />
Mit diesem Lese- und Arbeitsbuch ermutigt<br />
Fischer zu einer konstruktiven und kreativen Weiterentwicklung<br />
<strong>de</strong>r Pfarrgemein<strong>de</strong>n im Kontext<br />
einer Kooperativen Pastoral. Dazu glie<strong>de</strong>rt sich<br />
das Buch in drei Teile: Der erste Teil „Die Zumutungen<br />
Gottes an seine ‚Kirche’“ (13-32) lädt<br />
dazu ein, auf die Situation zu schauen, in <strong>de</strong>r das<br />
Han<strong>de</strong>ln unserer Kirche sich ereignet. Dieser Abschnitt<br />
zeichnet drei Entwicklungslinien einer<br />
Kirche im Wan<strong>de</strong>l, die mit <strong>de</strong>n Schlüsselworten<br />
Volkskirche, Angebots- bzw. Veranstaltungskirche<br />
und Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Gemeinschaften charakterisiert<br />
wer<strong>de</strong>n. In Anlehnung an das Leitbild Gemein<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Gemeinschaften entfaltet Fischer in<br />
diesem ersten Abschnitt acht Thesen zur Gemein<strong>de</strong>entwicklung<br />
wie beispielsweise: „Die Gemein<strong>de</strong><br />
als Ganze ist Subjekt und Trägerin <strong>de</strong>r Seelsorge.<br />
... Dementsprechend wird die Verantwortung<br />
<strong>de</strong>zentralisiert und die Verantwortlichen wer<strong>de</strong>n<br />
vernetzt.“ (31) Zu dieser <strong>Stand</strong>ortbestimmung einer<br />
Kirche im Wan<strong>de</strong>l entfaltet Fischer im zweiten<br />
Teil vier „Perspektiven für die Gemein<strong>de</strong>pastoral“<br />
(33-80): Aus und mit <strong>de</strong>m Evangelium leben<br />
(35-47), Das ganze Volk Gottes ist zur Mitarbeit<br />
berufen (48-55), Aufbau <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> zu einem<br />
lebendigen Organismus (56-66), und Partnerschaftliche<br />
Leitungskultur (67-80). Der abschließen<strong>de</strong><br />
dritte Teil (81-126) behan<strong>de</strong>lt die Umsetzung<br />
<strong>de</strong>r <strong>Stand</strong>ortbestimmung und <strong>de</strong>r Perspektiven.<br />
Es geht hierbei um konkrete Schritte zum<br />
Han<strong>de</strong>ln. Dazu stellt Fischer das Rottenburger<br />
Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>erneuerung vor, zeigt Formen<br />
einer Gemein<strong>de</strong>analyse und gibt nach <strong>de</strong>m<br />
Motto „Aufbruchswillige brauchen Weggefährten“<br />
konkrete Anregungen wie beispielsweise für<br />
die Klausuren <strong>de</strong>s Pfarrgemein<strong>de</strong>rates. Dabei ist<br />
nicht nur dieser Abschnitt, son<strong>de</strong>rn das ganze<br />
Buch so konzipiert, dass es einen reichen Fundus<br />
enthält an Thesen, Schaubil<strong>de</strong>rn, Impulsfragen
und nicht zu letzt an Gebeten, Bibelversen und<br />
Gedichten, die in die einzelnen Abschnitte mit<br />
Bedacht eingestreut sind; dies alles lässt Gemein<strong>de</strong>entwicklung<br />
zu einem Prozess mit Tiefgang<br />
wer<strong>de</strong>n. Joachim Eckart<br />
Claret, Bernd J.<br />
HHooffffnnuunngg iinn eeiinneerr<br />
„„zzeerrbbrroocchheenneenn WWeelltt““<br />
Ein Antwortversuch auf die Sinnfrage (Topos plus<br />
TB. 429). – Kevelaer: TOPOS plus Verlagsgemeinschaft.<br />
2003. 104 S., € 7.90 (ISBN 3-7867-8429-9)<br />
Manche meinen, das gehe nicht zusammen:<br />
Die Christliche Hoffnung und „die Erfahrung einer<br />
`zerbrochenen Welt´“ (S. 23) – ein Begriff,<br />
<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Werken von Gabriel Marcel häufig auftaucht.<br />
Bernd Claret zeigt, dass es doch geht. Er<br />
nennt die Zustän<strong>de</strong> beim Namen und überzeugt,<br />
weil er <strong>de</strong>n Sinn für die Wirklichkeit schärft und<br />
<strong>de</strong>n wachen Leser reicher macht in seinem Gespür<br />
für die Möglichkeiten, die er hat. Frei von<br />
Gesinnungsprosa und erst recht von Bekenntnislyrik<br />
wird in unaufdringlicher Weise aufgezeigt,<br />
dass man Hoffnung haben kann, vielleicht nicht<br />
darauf, dass die Welt heil ist, aber darauf, dass sie<br />
schön ist und vor allem verbesserungsfähig.<br />
Der Untertitel <strong>de</strong>s Taschenbuches „Ein Antwortversuch<br />
auf die Sinnfrage“ kennzeichnet,<br />
dass das Leben <strong>de</strong>s Menschen in <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen<br />
Gesellschaft geprägt ist durch zunehmen<strong>de</strong>n Orientierungsverlust.<br />
Als Folge dieser Unsicherheiten<br />
und Zweifel hat <strong>de</strong>r Zeitgenosse erhebliche<br />
Probleme, sich auf gemeinsame Vorstellungen<br />
zum Woher und Wohin sowie zum aktuellen<br />
<strong>Stand</strong>ort <strong>de</strong>s Gemeinsinns zu verständigen.<br />
Als ersten und damit flüchtigen Oberflächenbefund<br />
lässt sich festhalten: Allen Vermittlungsinstanzen,<br />
Familie, Schule, Hochschule, Kirchen,<br />
Massenmedien, Politik wird Versagen im Blick<br />
auf die zu erbringen<strong>de</strong> Orientierungsleistung attestiert.<br />
Mit diesem <strong>de</strong>saströsen Bild gibt sich Claret<br />
nicht zufrie<strong>de</strong>n. „Obwohl die Wirklichkeit nicht<br />
kreditwürdig erscheint – so Marcel –, kann aber<br />
ein Mensch dazu bewogen wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Wirklichkeit<br />
einen Kredit einzuräumen, und zwar aufgrund<br />
<strong>de</strong>r Hoffnung, die ihm ans Herz gelegt ist,<br />
und aufgrund von Sinn-Erfahrung, welche die<br />
Hoffnung (im Sinne Marcels) beflügeln“ (S. 48).<br />
Die Frage nach <strong>de</strong>m Sinn <strong>de</strong>s Lebens ist mit<br />
neuer Dringlichkeit erwacht. Wir fin<strong>de</strong>n heute im<br />
<strong>de</strong>utschen Kulturbereich ein ansteigen<strong>de</strong>s Interesse<br />
an unerklärlichen Phänomenen. Das Christliche<br />
ist zwar zurückgetreten, das Religiöse hat<br />
sich dagegen ausgeweitet; christlicher Glaube<br />
`verdunstet´, aber „die Hoffnung ..., dass alles gut<br />
geht“ (S. 69), erfüllt unterschiedliche Bereiche <strong>de</strong>r<br />
weltlichen Wirklichkeit. Diese Ten<strong>de</strong>nz einer unverbindlichen<br />
Religiosität in „unsere(r) `zerbrochen<br />
Welt´“ (S. 110), die eine Art kollektiver<br />
Entwurzelung, einen `Heimatverlust´ anzeigt, verlangt<br />
Orientierungswissen und Glaubenseinsicht,<br />
die sich jedoch ohne Verantwortung vor Gott als<br />
zerstörerisch erweisen. Erst im „Blick auf <strong>de</strong>n<br />
Gekreuzigten“ (S. 112) vermag <strong>de</strong>r Suchen<strong>de</strong>, in<br />
<strong>de</strong>r kulturellen Vielstimmigkeit Antwort zu fin<strong>de</strong>n<br />
auf Fragen, Sehnsüchte und Wünsche, auf die<br />
Sinnfrage <strong>de</strong>s Lebens. Als wie stabil sich die eigene<br />
I<strong>de</strong>ntität dann erweist, hängt nicht allein an<br />
<strong>de</strong>r Summe <strong>de</strong>s christlichen Orientierungswissens,<br />
son<strong>de</strong>rn auch am Zeugnis <strong>de</strong>r Begleiter<br />
beim „Unterwegssein ...: `Das hellste Licht auf<br />
unserem wetterschweren Gang durch dieses Dasein<br />
bleibt die Finsternis von Golgotha´, <strong>de</strong>nn<br />
`am herrlichsten [spricht Gott] in Christus, <strong>de</strong>n zu<br />
erkennen <strong>de</strong>n Menschen ewig macht´“ (S. 113).<br />
Dietmar Höffe<br />
Marx, Reinhard/Wulsdorf, Helge<br />
CChhrriissttlliicchhee<br />
SSoozziiaalleetthhiikk<br />
Konturen – Prinzipien – Handlungsfel<strong>de</strong>r (AMA-<br />
TEKA – Lehrbücher zur katholischen Theologie;<br />
Band XXI).- Pa<strong>de</strong>rborn: Bonifatiusverlag. 2002.<br />
449 S., € 34.90 (ISBN 3-89710-203-X)<br />
AMATECA (Gesellschaft für ein Manuale <strong>de</strong>r<br />
katholischen Theologie) unter <strong>de</strong>m Präsi<strong>de</strong>nten<br />
Kardinal Schönborn gibt in unregelmäßiger Abfolge<br />
eine Reihe heraus, in <strong>de</strong>r alle theologischen<br />
Disziplinen behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n sollen. Inzwischen<br />
sind im Bonifatiusverlag in Pa<strong>de</strong>rborn 22 Bän<strong>de</strong><br />
erschienen.<br />
Die Zugehörigkeit zu einer wissenschaftlichen<br />
Reihe ist diesem Buch auch <strong>de</strong>utlich anzumerken.<br />
So behan<strong>de</strong>lt <strong>de</strong>r erste Teil <strong>de</strong>n wissenschaftstheoretischen<br />
Ansatz <strong>de</strong>r Sozialethik. Dieses<br />
Kapitel hat beson<strong>de</strong>rs für die Be<strong>de</strong>utung, die<br />
sich systematisch <strong>de</strong>m Studium <strong>de</strong>r Sozialethik<br />
widmen. Die verschie<strong>de</strong>nen Aspekt dieser Disziplin<br />
einer philosophischen, über eine glaubensbis<br />
hin zu einer handlungsorientierten Wissenschaft<br />
wer<strong>de</strong>n in einen Bogen gespannt. Christliche<br />
Sozialethik ist die Ethik <strong>de</strong>r gesellschaftlichen<br />
Belange.<br />
Im II. Teil wer<strong>de</strong>n diese Grundlagen <strong>de</strong>r christlichen<br />
Sozialethik erarbeitet. Es sind das christliche<br />
Menschenbild, anthropologische Konzepte<br />
und die Gottesebenbildlichkeit <strong>de</strong>s Menschen.<br />
Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Teiles folgt dann eine knappe<br />
Abhandlung über die Entwicklung <strong>de</strong>r kirchlichen<br />
Sozialverkündigung. Hier hätte man sich<br />
vor allem im neueren Teil etwas mehr konkretes<br />
Material gewünscht, dafür hätte <strong>de</strong>r theoretische<br />
Teil gekürzt wer<strong>de</strong> können.<br />
Die Prinzipien <strong>de</strong>r katholischen Soziallehre<br />
wer<strong>de</strong>n im III. Teil dargestellt. Dabei gewinnt das<br />
Prinzip <strong>de</strong>r Gerechtigkeit, vor allem <strong>de</strong>r sozialen<br />
Gerechtigkeit einen beson<strong>de</strong>ren Stellenwert. Natürlich<br />
wer<strong>de</strong>n auch die klassischen Prinzipien<br />
Personalität, Solidarität und Subsidiarität ergänzt<br />
um Nachhaltigkeit in einer vernunftorientierten<br />
Begründung entwickelt, aber auch theologisch<br />
vertieft, so die Gerechtigkeit in <strong>de</strong>r biblischen<br />
I<strong>de</strong>e vom Reich Gottes.<br />
Während die ersten knapp 200 Seiten <strong>de</strong>r<br />
theoretischen Grundlegung gewidmet sind, wird<br />
<strong>de</strong>r IV. Teil dann praktisch und führt in ausgewählte<br />
Fel<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r christlichen Sozialethik auf etwas<br />
250 weiteren Seiten ein. Hier wird z.B. eine<br />
politische Ethik entfaltet, Menschenechte, Demokratie,<br />
Frie<strong>de</strong>n, Familie bis hin zur Globalisierung<br />
dargestellt, Ausführlich wird eine Rechts-<br />
ethik entwickelt. Dabei wird unter <strong>de</strong>n Einzelproblemen<br />
differenziert das Asylrecht behan<strong>de</strong>lt.<br />
In <strong>de</strong>r Wirtschaftsethik geht es vor allem um<br />
einige Schlüsselbegriffe wie Arbeit, Eigentum<br />
und Verteilung. Es wird <strong>de</strong>m Sharehol<strong>de</strong>r-value-<br />
System (Ziel <strong>de</strong>r Wirtschaft <strong>de</strong>r Gewinn <strong>de</strong>r Aktionäre)<br />
das Stakehol<strong>de</strong>r-value-System (Ziel <strong>de</strong>r<br />
Wirtschaft Gewinn aller Beteiligten, <strong>de</strong>r Eigentümer,<br />
<strong>de</strong>s Managements und <strong>de</strong>r Arbeitnehmer-<br />
Innen) entgegengestellt. Alle sind am Prozess <strong>de</strong>s<br />
Wirtschaftens je auf ihre Weise zu beteiligen. Wo<br />
die Grenzen <strong>de</strong>s Sharehol<strong>de</strong>r value liegen wird ja<br />
im Globalisierungsprozess <strong>de</strong>utlich. Eine interessante<br />
Darstellung in diesem Buch, etwas kurz<br />
aber auf <strong>de</strong>m neuesten <strong>Stand</strong> abgehan<strong>de</strong>lt.<br />
Dieses Kapitel schließt ab mit <strong>de</strong>n Herausfor<strong>de</strong>rungen<br />
<strong>de</strong>r christlichen Sozialethik für das<br />
3. Jahrtausend. Die anstehen<strong>de</strong>n Fragen wer<strong>de</strong>n<br />
mehr und mehr ökumenisch bearbeitet, hier sind<br />
die konfessionellen <strong>Stand</strong>punkte fast nicht mehr<br />
zu unterschei<strong>de</strong>n, das gilt vor allem auch von<br />
Deutschland.<br />
Der wissenschaftliche Anmerkungsapparat ist<br />
ausführlich und lädt zum Weiterstudium ein, eine<br />
ausführliche Literaturliste ergänzt das Werk.<br />
Das Buch ist eine sehr gute Einführung in die<br />
Wissenschaft <strong>de</strong>r christlichen Sozialethik. Wohl<br />
<strong>de</strong>shalb hat die Theorie gegenüber <strong>de</strong>n konkreten<br />
Fragen einen gewissen Überhang, die in Auswahl<br />
und knapp dargestellt vorhan<strong>de</strong>n sind. Das liegt<br />
im Konzept <strong>de</strong>s Buches begrün<strong>de</strong>t. Die Abhandlungen<br />
stehen auf <strong>de</strong>r Höhe <strong>de</strong>r heutigen Diskussion.<br />
Ob das Buch einmal die gleiche Rolle spielen<br />
kann wie das Kompendium christliche Gesellschaftslehre<br />
von Joseph Höffner ist fraglich. Es<br />
richtet sich nicht so sehr an eine interessierte Leserschaft,<br />
son<strong>de</strong>rn an solche, die sich wissenschaftlich<br />
mit diesem Fach auseinan<strong>de</strong>rsetzen<br />
wollen. Für diese ist es ein gelungenes Kompendium,<br />
das längst fällig war. Ernst Leuninger<br />
Vollguth, Klaus (Hg.)<br />
BBuunntt wwiiee GGootttteess<br />
RReeggeennbbooggeenn<br />
Kin<strong>de</strong>rgebete aus aller Welt. Mit Illustrationen<br />
von Maike Rathert. – Kevelaer: Verlag Butzon &<br />
Bercker/Aachen u.a.: Missio. 2002. 48 S. m. 18<br />
farb. Ill., € 8.00 (ISBN 3-7666-0461-9)<br />
Dieses Bändchen bietet Kin<strong>de</strong>rn im Vor- und<br />
Grundschulalter eine inhaltsreiche Sammlung von<br />
Kin<strong>de</strong>rgebeten aus aller Welt an. Zu <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen<br />
Tageszeiten, familiären und außerfamiliären<br />
Geschehen kommen in <strong>de</strong>n kleinen Gebeten<br />
unterschiedliche Alltagserfahrungen <strong>de</strong>r<br />
Kin<strong>de</strong>r in kurzen Sätzen zur Sprache. Die farbenfrohen<br />
Illustrationen machen es ihnen leicht,<br />
sich in die Gebetstexte hineinzuversetzen. In <strong>de</strong>r<br />
Einführung weist <strong>de</strong>r Herausgeber mit Recht darauf<br />
hin, dass diese Gebete mit Bedacht gelesen<br />
und gesprochen wer<strong>de</strong>n sollten, erschließen sie<br />
doch dann erst ihren ganzen Reichtum. So können<br />
sie Anregungen wer<strong>de</strong>n zum gemeinsamen<br />
Gebet <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r im Kin<strong>de</strong>rgarten, in <strong>de</strong>r Grundschule,<br />
von Kin<strong>de</strong>rn und Erwachsenen zu Hause.<br />
Ein Büchlein, <strong>de</strong>m man viele kleine Leser<br />
wünscht. Bernhard Merten<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
LITERATUR & MEDIEN<br />
201
INFOS & AKTUELLES<br />
202<br />
Zur Person<br />
Sabine Christe, Diplom-Religionspädagogin,<br />
ist seit <strong>de</strong>m 1. April 2003<br />
Referentin für Religionspädagogik im<br />
Amt für Kath. Religionspädagogik in<br />
Frankfurt am Main. Sie löst damit Eva<br />
Toussaint ab, die in <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>dienst<br />
gewechselt ist. Zu <strong>de</strong>n Aufgabengebieten<br />
von Sabine Christe gehö-<br />
Erstmals in seiner Geschichte hat<br />
<strong>de</strong>r Deutsche Katecheten-Verein eine<br />
Vorsitzen<strong>de</strong>. Da Professor Karlheinz<br />
Schmitt nach 20-jähriger Tätigkeit als<br />
Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Deutschen Katecheten-Vereins,<br />
München, nicht mehr kandidierte,<br />
haben die Delegierten <strong>de</strong>s Vertretertages<br />
die Leiterin <strong>de</strong>s Referates<br />
Schule, Religionsunterricht und Hochschule<br />
im Erzbischöflichen Amt Kiel,<br />
Schulrätin i. K. Marion Schöber, in<br />
dieses Amt gewählt. Marion Schöber<br />
hat in Bonn und Münster die Fächer<br />
Katholische Religion und Kunst für das<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
ren u. a. die Betreuung <strong>de</strong>r Biblio- und<br />
Mediothek, die Beratung und Begleitung<br />
religionspädagogischer Arbeitsgemeinschaften<br />
sowie die Mitarbeit in<br />
<strong>de</strong>r Ausbildung. Sabine Christe absolvierte<br />
an <strong>de</strong>r Kath. Fachhochschule in<br />
Mainz ein Studium <strong>de</strong>r Religionspädagogik.<br />
Seit 1989 war sie in verschie<strong>de</strong>-<br />
Lehramt an <strong>de</strong>r Sekundarstufe I studiert.<br />
Nach ihrem Referendardienst hat<br />
sie zunächst beim Deutschen Roten<br />
Kreuz gearbeitet und war dann von<br />
1992 bis 1998 als Referentin für Religionspädagogik<br />
im <strong>Bistum</strong> Osnabrück<br />
und im Erzbistum Hamburg tätig.<br />
Während dieser Zeit hat sie Religionsunterricht<br />
an verschie<strong>de</strong>nen Grund-,<br />
Haupt-, Real- und Son<strong>de</strong>rschulen in<br />
Schleswig-Holstein erteilt, Religionslehrerinnen<br />
und Religionslehrer fortgebil<strong>de</strong>t<br />
und kirchliche Lehrkräfte für <strong>de</strong>n<br />
Religionsunterricht ausgebil<strong>de</strong>t. Seit<br />
nen Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s Mainz als<br />
Gemein<strong>de</strong>referentin tätig. Die Erteilung<br />
von Religionsunterricht in Grundschulen<br />
gehörte hier zu ihrem Hauptarbeitsfeld.<br />
In <strong>de</strong>r Ausbildung <strong>de</strong>r Grundschullehrer/-innen<br />
war sie als Mentorin<br />
tätig. M.R.<br />
Neue Vorsitzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Deutschen Katecheten-Vereins<br />
Katholiken feiern vom 12. bis 14. September<br />
in <strong>de</strong>r City ihren regionalen<br />
Katholikentag<br />
Unter <strong>de</strong>m Motto „Kirche fin<strong>de</strong>t<br />
Stadt“ feiern Katholiken <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s<br />
<strong>Limburg</strong> vom 12. bis 14. September<br />
2003 das „Kreuzfest“ in <strong>de</strong>r Frankfurter<br />
Innenstadt. Das Kreuzfest ist <strong>de</strong>r<br />
Höhepunkt <strong>de</strong>r <strong>Limburg</strong>er Kreuzwoche<br />
und wird je<strong>de</strong>s Jahr als regionaler Katholikentag<br />
in einem <strong>de</strong>r elf Bezirke <strong>de</strong>s<br />
<strong>Bistum</strong>s gefeiert.<br />
Zum Auftakt <strong>de</strong>s Kreuzfestes la<strong>de</strong>n<br />
viele katholische Gemein<strong>de</strong>n am Freitag,<br />
12. September, am Spätnachmittag<br />
und Abend zu Gottesdiensten und Begegnungen<br />
in <strong>de</strong>n Stadtteilen ein. Im Alten<br />
Hauptzollamt in <strong>de</strong>r Domstraße, <strong>de</strong>m<br />
künftigen „Haus am Dom“ wird um<br />
17.00 Uhr die Ausstellung „Lichtinsel“<br />
eröffnet, die einen emotionalen Zugang<br />
zu Fragen um die pränatale Diagnostik<br />
eröffnen will.<br />
Die offizielle Eröffnung <strong>de</strong>s Festes<br />
fin<strong>de</strong>t am Samstag, 13. September, um<br />
11.00 Uhr, auf <strong>de</strong>r Bühne am Liebfrauenberg<br />
statt, bei <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r <strong>Limburg</strong>er Bischof<br />
Franz Kamphaus und Stadt<strong>de</strong>kan Raban<br />
Tilmann sprechen. Nach <strong>de</strong>r Eröffnung<br />
präsentieren sich zwischen Zeil<br />
und Römerberg Gemein<strong>de</strong>n, Verbän<strong>de</strong><br />
und Initiativen an Stän<strong>de</strong>n beim Offenen<br />
Forum <strong>de</strong>n Besuchern <strong>de</strong>s Festes.<br />
Auf <strong>de</strong>r großen Bühne am Liebfrauenberg<br />
gibt es ein buntes Programm. In vier<br />
Schwerpunkten wollen die Katholiken<br />
aus Frankfurt und <strong>de</strong>m ganzen <strong>Bistum</strong><br />
1998 leitet sie das Referat Schule, Religionsunterricht<br />
und Hochschule im Erzbischöflichen<br />
Amt in Kiel. Im neu gegrün<strong>de</strong>ten<br />
DKV-Diözesanverband Hamburg<br />
hat sie <strong>de</strong>n Vorsitz übernommen;<br />
seit 1999 arbeitet sie auch im DKV-<br />
Bun<strong>de</strong>svorstand mit. Für Frau Schöber<br />
ist <strong>de</strong>r Münsteraner Religionspädagoge<br />
Michael Wedding in <strong>de</strong>n Bun<strong>de</strong>svorstand<br />
nachgerückt. Heike Felsner, Mag<strong>de</strong>burg,<br />
Professor Dr. Rudolf Englert, Essen,<br />
und Dr. Hans-Willi Win<strong>de</strong>n, Aachen,<br />
sind erneut in <strong>de</strong>n Bun<strong>de</strong>svorstand gewählt<br />
wor<strong>de</strong>n. D.W.<br />
Kreuzfest <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> in Frankfurt: „Kirche fin<strong>de</strong>t Stadt“<br />
<strong>de</strong>utlich machen, was sie unter <strong>de</strong>m<br />
Motto „Kirche fin<strong>de</strong>t Stadt.“ verstehen.<br />
Bei <strong>de</strong>n Veranstaltungen zu „Religion<br />
kreuzt Kulturen“ treten Christen<br />
in <strong>de</strong>n Dialog mit an<strong>de</strong>ren Kulturkreisen<br />
und Menschen an<strong>de</strong>rer Muttersprache.<br />
Beson<strong>de</strong>rs interessant sind dabei die<br />
Talkrun<strong>de</strong> „Mehrsprachige Kin<strong>de</strong>r – eine<br />
Chance für die Zukunft“ um 12.30<br />
Uhr in <strong>de</strong>n Römerhallen, die Exkursion<br />
in eine Moschee um 12.15 Uhr o<strong>de</strong>r ein<br />
Gespräch zum Thema „Das Kreuz mit<br />
<strong>de</strong>m Kreuz“, Wissenswertes über Kreuzzüge,<br />
ebenfalls in <strong>de</strong>n Römerhallen um<br />
16.30 Uhr.<br />
Bei „Sinn sucht Leben“ geht es um<br />
die Suche <strong>de</strong>r Großstädter nach <strong>de</strong>m<br />
Sinn ihres Lebens und nach Dingen, die<br />
ihnen dabei Halt geben. Zu diesem The-
ma ist die Liebfrauenkirche <strong>de</strong>n ganzen<br />
Tag geöffnet. Das interaktive Spontantheater<br />
„Subito“ nimmt sich zwischen<br />
11.00 Uhr und 17.00 Uhr <strong>de</strong>s Themas auf<br />
<strong>de</strong>r Bühne am Liebfrauenberg an und<br />
mit <strong>de</strong>r Aussage „Küssen ist Beten“<br />
wirbt <strong>de</strong>r Benediktinerpater Wunibald<br />
Müller um 15.00 Uhr in <strong>de</strong>r Liebfrauenkirche<br />
für die Sinnlichkeit und Lust<br />
am Leben. Wem <strong>de</strong>r Sinn nach „Engeln“<br />
steht, <strong>de</strong>r kann sich von Schriftstellerin<br />
Andrea Schwarz zwischen<br />
11.00 Uhr und 17.00 Uhr zwischen Zeil<br />
und Römer über die Seriösität und Echtheit<br />
von Engeln „aufklären“ lassen.<br />
Das Thema „Wirtschaft prägt<br />
Werte“ zeigt die Gegensätze <strong>de</strong>r Stadt<br />
Frankfurt: ökonomische Macht und sozialer<br />
Abstieg liegen dicht beieinan<strong>de</strong>r.<br />
Beim Forum „Bock auf Arbeit“ von<br />
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr zwischen Zeil<br />
und Römer können Jugendliche mit Paten<br />
vom Projekt „Arbeitsplätze schaffen<br />
mit Phantasie“ Kontakte für die Zukunft<br />
knüpfen. Mit <strong>de</strong>r „Linie 11“ lernen<br />
die Besucher bei einer Straßenbahn-Son<strong>de</strong>rfahrt<br />
das soziale Engagement<br />
<strong>de</strong>r Kath. Kirche zwischen<br />
Höchst und Fechenheim kennen.<br />
Am Abend wird im Historischen<br />
Garten auf <strong>de</strong>m Römerberg von 19.00<br />
Uhr bis 21.00 Uhr vom PAX-Theater und<br />
seinen Freun<strong>de</strong>n und Freundinnen „Das<br />
Frankfurter Evangelienspiel“ aufgeführt.<br />
Mitwirken<strong>de</strong> sind 90 hören<strong>de</strong> und gehörlose<br />
Spielerinnen und Spieler.<br />
Das Wesentliche fin<strong>de</strong>n<br />
Meditation – Besinnung – Exerzitien<br />
im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong><br />
Juli bis Dezember 2003<br />
Unter <strong>de</strong>m Motto „Das Wesentliche<br />
fin<strong>de</strong>n“ ist eine Übersicht <strong>de</strong>r Exerzitienangebote<br />
<strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s <strong>Limburg</strong> für<br />
die Monate Juli bis Dezember 2003 erschienen.<br />
Das Angebot reicht von Ignatianischen<br />
Exerzitien über Exerzitien in Gemeinschaft,<br />
Meditation/Besinnung, Regelmäßige<br />
Meditationsangebote, Kur-<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Tages steht ein<br />
„Abend <strong>de</strong>r Begegnungen“ an. Internationale<br />
Musik, Kabarett, Apfelwein<br />
und Hessische Spezialitäten la<strong>de</strong>n nicht<br />
nur die Kreuzfestbesucher, son<strong>de</strong>rn alle<br />
Frankfurter und Gäste <strong>de</strong>r Stadt zum<br />
Verweilen ein.<br />
Zusammen mit <strong>de</strong>m Kreuzfest wird<br />
in Frankfurt <strong>de</strong>r Diözesanjugendtag gefeiert,<br />
<strong>de</strong>n um 14.00 Uhr Bischof Franz<br />
Kamphaus und Diözesanjugenpfarrer<br />
Wolfgang Pax auf <strong>de</strong>r Bühne am Liebfrauenberg<br />
eröffnen. Jugendliche aus<br />
<strong>de</strong>m ganzen <strong>Bistum</strong> kommen, um unter<br />
<strong>de</strong>m Motto „FRAtour“ gemeinsam<br />
Frankfurt zu erleben. 18 Expeditionen<br />
stehen auf <strong>de</strong>m Programm, die die vielen<br />
Facetten <strong>de</strong>r Lebens- und Arbeitswelt<br />
in <strong>de</strong>r Mainmetroloe wi<strong>de</strong>rspiegeln.<br />
Um 19.00 Uhr beginnt im Dom ein experimenteller<br />
Wortgottesdienst unter<br />
<strong>de</strong>m Titel „Via lucis – Eine Nacht mit<br />
Klang und Gesang und Licht“. In St.<br />
Bernhard heißt es dann ab 21.00 Uhr<br />
„Irish Pub und Party“. Liturgischer Höhepunkt<br />
und Abschluss <strong>de</strong>s Kreuzfestes<br />
ist das Pontifikalamt mit Bischof Franz<br />
Kamphaus am Sonntag, 14.9.2003,um<br />
10.00 Uhr auf <strong>de</strong>m Römerberg. Im Anschluss<br />
an <strong>de</strong>n Gottesdienst gibt es auf<br />
<strong>de</strong>m Paulsplatz ein einfaches Mittagessen.<br />
Das ausführliche Programm <strong>de</strong>s<br />
Kreuzfestes fin<strong>de</strong>t sich im Internet unter<br />
<strong>de</strong>r Adresse:<br />
www.kreuzfest-frankfurt.<strong>de</strong><br />
se zum Thema „Rhythmus – Atmen –<br />
Bewegung“, Tagesveranstaltungen bis<br />
hin zu Tagen <strong>de</strong>r Vorbereitung auf Advent<br />
und Weihnachten.<br />
Falls keine beson<strong>de</strong>re Zielgruppe<br />
angegeben ist, richten sich die Angebote<br />
an alle Interessierten je<strong>de</strong>n Alters.<br />
Anmeldungen zu <strong>de</strong>n einzelnen Veranstaltungen<br />
erfolgen zumeist direkt bei<br />
<strong>de</strong>n jeweiligen Veranstaltern, bei <strong>de</strong>nen<br />
auch ausführlichere Programme erhältlich<br />
sind. Die entsprechen<strong>de</strong>n Adressen,<br />
Fon- und Fax-Nummern, z.T. auch<br />
Als Broschüre liegt es in allen katholischen<br />
Kirchen in Frankfurt sowie<br />
im Kirchenla<strong>de</strong>n „i-punkt“ in <strong>de</strong>r Neuen<br />
Kräme nahe <strong>de</strong>r Hauptwache aus.<br />
Stichwort: Kreuzfest<br />
Im Jahr 1959 wur<strong>de</strong> das Kreuzfest<br />
<strong>de</strong>r Katholiken im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong><br />
zum ersten Mal gefeiert. Von Anfang<br />
an war es mit <strong>de</strong>r vorausgehen<strong>de</strong>n<br />
Kreuzwoche (einer Veranstaltungswoche,<br />
die sich verschie<strong>de</strong>nen<br />
Zielgruppen zuwen<strong>de</strong>t und alljährlich<br />
in <strong>Limburg</strong> durchgeführt wird)<br />
als eine Art Diözesan-Katholikentag<br />
gedacht.<br />
Das Fest wird je<strong>de</strong>s Jahr in einem<br />
an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>r 11 Bezirke <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s<br />
ausgerichtet. Es setzt thematische,<br />
spirituelle und kulturelle Akzente<br />
in <strong>de</strong>r jeweiligen Region. In<br />
seinem Mittelpunkt aber steht die<br />
Kreuzfeier mit <strong>de</strong>r Verehrung <strong>de</strong>r<br />
Kreuzreliquie, die in <strong>de</strong>r kostbaren<br />
Staurothek aufbewahrt wird.<br />
Reliquie und Behälter stammen<br />
aus Konstantinopel. Sie gelangten im<br />
Rahmen <strong>de</strong>s barbarischen Kreuzzuges<br />
von 1204, bei <strong>de</strong>m die Stadt Konstantinopel,<br />
die christliche „Mutter <strong>de</strong>r<br />
Welt“, <strong>de</strong>m Erdbo<strong>de</strong>n gleichgemacht<br />
wur<strong>de</strong>, über Umwege in das <strong>Bistum</strong><br />
Trier. Seit <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s<br />
<strong>Limburg</strong> befin<strong>de</strong>t sich diese Kostbarkeit<br />
im <strong>Limburg</strong>er Domschatz.<br />
E-Mail-Anschriften sind auf einer eigenen<br />
Übersichtsseite <strong>de</strong>s Faltblattes<br />
enthalten.<br />
Das Faltblatt kann bestellt wer<strong>de</strong>n bei:<br />
Diözese <strong>Limburg</strong>, Referat Exerzitien,<br />
Roncalli-Haus<br />
Friedrichstraße 26-28<br />
65185 Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Fon: 0611/174124<br />
Fax: 0611/174122<br />
e-mail:<br />
t.schumacher@roncallihaus.<strong>de</strong><br />
INFO 32 · 3/2003<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
203
INFOS & AKTUELLES<br />
204<br />
Priesterseminar <strong>Limburg</strong> ausgezeichnet<br />
Dem Ergebnis <strong>de</strong>r Umbaumaßnahmen<br />
im Bischöflichen Priesterseminar<br />
und damit auch insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>m bislang<br />
wenig beachteten Bibliotheksflügel,<br />
in <strong>de</strong>m jetzt zusätzlich auch das Diözesanarchiv<br />
untergebracht wur<strong>de</strong>, ist<br />
eine hohe Ehre zuteil gewor<strong>de</strong>n. Ein<br />
unabhängiges Auswahlgremium von<br />
Architekten hat <strong>de</strong>n Bau Priesterseminar<br />
<strong>Limburg</strong>, Weilburger Straße 16, für<br />
<strong>de</strong>n Tag <strong>de</strong>r Architektur 2003 in beson<strong>de</strong>rer<br />
Weise ausgezeichnet: „Sie haben<br />
sich für eine Architektur entschie<strong>de</strong>n,<br />
die Maßstäbe setzt und Vorbildcharakter<br />
hat“, so <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Architekten-<br />
und Stadtplanerkammer Hessen in<br />
seiner Nominierungs- und Gratulationsmitteilung.<br />
Die Auszeichnung ehrt und<br />
würdigt das planungsbüro mehring +<br />
heuser (Darmstadt) für seine herausragen<strong>de</strong><br />
Leistung.<br />
Anlass <strong>de</strong>r umfangreichen Umbaumaßnahmen<br />
im Gebäu<strong>de</strong> war die Unterbringung<br />
<strong>de</strong>s Diözesanarchivs innerhalb<br />
<strong>de</strong>s bestehen<strong>de</strong>n Bibliotheksbaues,<br />
<strong>de</strong>r 1929 von Dominikus Böhm<br />
für die Bücherschätze <strong>de</strong>r Diözesanbibliothek<br />
errichtet wor<strong>de</strong>n war. Nach Fertigstellung<br />
<strong>de</strong>r Umbauarbeiten, die nicht<br />
nur eine neue Fassa<strong>de</strong>ngestaltung, ein<br />
durchgängiges Farb- und Materialkonzept,<br />
funktionsgemäße Lichtführungen,<br />
Bisher einmalig in ganz Deutschland:<br />
ein Kirchenführer für Muslime.<br />
Ein Pilotprojekt <strong>de</strong>s Katholischen Bildungswerkes<br />
Frankfurt und CIBEDO,<br />
erschienen in Frankfurt am Main. Am<br />
14. Mai wur<strong>de</strong> die 50-seitige Broschüre<br />
erstmals <strong>de</strong>r Presse vorgestellt.<br />
Der Führer ist eine Einladung an<br />
Menschen <strong>de</strong>s islamischen Glaubens,<br />
die sich in einer Kirche einerseits sehr<br />
fremd und an<strong>de</strong>rerseits sehr heimisch<br />
fühlen. Mit seiner Hilfe lassen sich Ähnlichkeiten<br />
und Unterschie<strong>de</strong> zwischen<br />
christlichen Kirchen und Moscheen ent-<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Kirchenführer für Muslime<br />
Fassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Diözesanbibliothek <strong>Limburg</strong> © planungsbüro mehring + heuser · Foto: Uwe Spoering<br />
Klima- und Akustikanfor<strong>de</strong>rungen zu<br />
realisieren hatte, ist auch im Bibliotheks-<br />
und Archivbereich durch das Gestaltungspotential<br />
<strong>de</strong>s kompetenten Planungsbüros<br />
eine Innenarchitektur geschaffen<br />
wor<strong>de</strong>n, die sehr beachtlich ist.<br />
In Ergänzung und notwendiger Integration<br />
<strong>de</strong>r Arbeits- und Benutzerräume<br />
von Diözesanarchiv und -bibliothek<br />
wur<strong>de</strong> eine Gestaltung gefun<strong>de</strong>n,<br />
<strong>de</strong>cken. Dabei wer<strong>de</strong>n wesentliche Elemente<br />
eines Kirchenbaus zu Elementen<br />
einer Moschee in Verbindung gesetzt, etwa<br />
Weihwasserbecken und Waschgelegenheit<br />
o<strong>de</strong>r Bibel und Koran. Das soll<br />
vor allem <strong>de</strong>m Zweck <strong>de</strong>r besseren Verständigung<br />
von Menschen dienen, die<br />
bei<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Religionen angehören,<br />
und helfen, gegenseitige Vorurteile<br />
abzubauen, sagen die Autoren.<br />
Die I<strong>de</strong>e zu <strong>de</strong>m Führer entstand im<br />
Ausschuss <strong>de</strong>s Frankfurter Stadtsynodalrats<br />
„Dialog mit <strong>de</strong>m Islam“. Die<br />
konkrete Ausgestaltung übernahmen Dr.<br />
die z.T. mit ungewöhnlichen Mitteln die<br />
vorgegebene Baugestalt respektiert und<br />
zugleich zeitgemäße Akzente setzt.<br />
Am 29. Juni, <strong>de</strong>m Tag <strong>de</strong>r Architektur<br />
2003, war von <strong>de</strong>n eingela<strong>de</strong>nen<br />
Besuchern, die das neu gestaltete Priesterseminar<br />
interessiert, kritisch und neugierig<br />
in ihren Blick nahmen, viel Lob<br />
zu hören: eine Architektur, die sich sehen<br />
lassen kann. G.H.<br />
Barbara Huber-Rudolf und Alexan<strong>de</strong>r<br />
Rudolf von CIBEDO, <strong>de</strong>r Fachstelle <strong>de</strong>r<br />
Deutschen Bischofskonferenz für <strong>de</strong>n<br />
interreligiösen Dialog mit Muslimen,<br />
mit Sitz in Frankfurt.<br />
Die Konzeption <strong>de</strong>s Pilot-Projekts ist<br />
bei christlichen Islam-Referentinnen<br />
und -Referenten in ganz Deutschland auf<br />
großes Interesse gestoßen, und auch von<br />
offizieller Seite <strong>de</strong>r katholischen Kirche<br />
wur<strong>de</strong> die Veröffentlichung begrüßt: Der<br />
Frankfurter Stadt<strong>de</strong>kan Raban Tilmann<br />
lobte das Werk als „Pioniertat im interreligiösen<br />
Dialog“.
An<strong>de</strong>re Diözesen planen nun ähnliches<br />
für ihre Gemein<strong>de</strong>n. Schulen und<br />
Kin<strong>de</strong>rgärten haben mit <strong>de</strong>m Kirchenführer<br />
unmittelbar umsetzbares Arbeitsmaterial.<br />
Mit <strong>de</strong>m gedruckten Kirchenführer<br />
für Muslime ist das Projekt aber<br />
noch nicht abgeschlossen. Kirchengemein<strong>de</strong>n<br />
haben die Möglichkeit, über<br />
die Internet-Webpage www.cibedo.<strong>de</strong><br />
interaktive Elemente zu nutzen. So steht<br />
beispielsweise ein Computerspiel zum<br />
Download bereit. Außer<strong>de</strong>m lässt sich<br />
<strong>de</strong>r Text <strong>de</strong>s Kirchenführers als pdf-Datei<br />
herunterla<strong>de</strong>n, um ihn mit lokalen Informationen<br />
aus <strong>de</strong>r eigenen Gemein<strong>de</strong><br />
zu ergänzen.<br />
Das neue Bibelmuseum in Frankfurt<br />
Rechtzeitig zum „Jahr <strong>de</strong>r Bibel<br />
2003“ wur<strong>de</strong> am 19.1. dieses Jahres in<br />
Frankfurt das „Bibelhaus am Museumsufer<br />
– Erlebnismuseum“ als Dauerausstellung<br />
eröffnet.<br />
„Wir wollten eine völlig neue Art<br />
von Ausstellung, die eigentlich kein Besucher<br />
erwartet“, meint Pfarrer Jürgen<br />
Schefzyk, <strong>de</strong>r Leiter <strong>de</strong>s neuen Projektes.<br />
Und so fin<strong>de</strong>t man in diesem Museum<br />
auch kaum Vitrinen. Vielmehr soll<br />
man ganz bewusst mit allen Sinnen einen<br />
neuen Zugang zur Bibel gewinnen.<br />
Dass die Bibel in einer ganz an<strong>de</strong>ren<br />
Welt als <strong>de</strong>r unseren entstan<strong>de</strong>n ist,<br />
wird <strong>de</strong>n Besuchern schon bald nach<br />
Betreten <strong>de</strong>s Museums <strong>de</strong>utlich. Wer<br />
will, kann sich als Noma<strong>de</strong> verklei<strong>de</strong>n<br />
und so in die frem<strong>de</strong> Welt <strong>de</strong>r Bibel eintauchen.<br />
In einem voll ausgestatteten<br />
Noma<strong>de</strong>nzelt sitzend, kann man sich<br />
dann ganz wie Abraham fühlen. „Es<br />
geht uns aber nicht darum, hier ein romantisieren<strong>de</strong>s<br />
Noma<strong>de</strong>ni<strong>de</strong>al zu vermitteln“,<br />
schränkt Jürgen Schefzyk jedoch<br />
gleich ein. „Wir wollen hier erlebbar<br />
machen, wie an<strong>de</strong>rs das Leben früher<br />
war. Dazu gehört auch, dass man<br />
hier nachfühlen kann, dass Gastfreundschaft<br />
ganz wichtig für das Überleben<br />
<strong>de</strong>r Noma<strong>de</strong>n war, und dass ihre Wertvorstellungen<br />
ganz an<strong>de</strong>rs waren als bei<br />
uns heute.“ Und so ergibt sich unter <strong>de</strong>n<br />
Besuchern, die im Zelt Platz genommen<br />
haben, auch schnell eine Diskussion<br />
über die heutigen Lebensbedingungen<br />
<strong>de</strong>r Menschen im Nahen Osten.<br />
In <strong>de</strong>r ehemaligen Kirche, die auf<br />
Grund <strong>de</strong>s Mitglie<strong>de</strong>rschwun<strong>de</strong>s aufgegeben<br />
wer<strong>de</strong>n musste, ließ sich natürlich<br />
nicht die ganze Welt <strong>de</strong>r Bibel<br />
darstellen. Die Museumsmacher haben<br />
sich daher entschlossen, einige wenige<br />
charakteristische Aspekte herauszuheben<br />
und sie entsprechend auszugestalten.<br />
Steht das Noma<strong>de</strong>nzelt für die Welt<br />
<strong>de</strong>s Alten Testaments, so soll <strong>de</strong>r Nachbau<br />
eines vor wenigen Jahren im See<br />
Genezareth gefun<strong>de</strong>nen Fischerbootes<br />
die Lebenswelt <strong>de</strong>r Jünger Jesu aufzeigen.<br />
Ein nachgebautes Schreibpult, <strong>de</strong>ssen<br />
Vorlage aus <strong>de</strong>m Skiptorium in Kloster<br />
Eberbach stammt, soll das handschriftliche<br />
Abschreiben <strong>de</strong>r Bibel illustrieren,<br />
das über Jahrhun<strong>de</strong>rte hinweg<br />
praktiziert wur<strong>de</strong>. An einem Nachbau<br />
<strong>de</strong>r Gutenbergpressen<br />
kann man sich dann<br />
selbst eine Seite ausdrucken.<br />
Da die Orgel<br />
in <strong>de</strong>r ehemaligen Kirche<br />
erhalten bleiben<br />
musste, bot es sich an,<br />
eine eigene Abteilung<br />
über die Musik in <strong>de</strong>r<br />
Bibel und ihre Weiterentwicklung<br />
in <strong>de</strong>r Kirchengeschichte<br />
zu gestalten.<br />
Teile <strong>de</strong>r Holzverkleidung<br />
<strong>de</strong>r Orgel<br />
wur<strong>de</strong>n entfernt und<br />
durch Plexiglasscheiben<br />
ersetzt, so dass man das<br />
Innenleben einer Orgel<br />
studieren kann.<br />
Im Mittelpunkt <strong>de</strong>s<br />
Museumsraums steht eine<br />
überdimensionale Bibel,<br />
in <strong>de</strong>ren Innenleben<br />
sich reichlich Technik<br />
versteckt. Wie alle Ausstellungsstücke<br />
ist natür-<br />
Nähere Infos gibt es bei:<br />
CIBEDO<br />
Balduinenstraße 62, 60599 Frankfurt<br />
Fon 0 69 / 72 64 91, Fax 0 69 / 72 30 52<br />
Dort können auch die gedruckten Kirchenführer<br />
gegen eine Schutzgebühr von<br />
3.00 € bestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
lich auch diese Bibel begehbar. „Was die<br />
Besucher im Inneren <strong>de</strong>r Bibel erwartet,<br />
wird nicht verraten. Hier soll je<strong>de</strong>r seine<br />
eigene Möglichkeit haben, <strong>de</strong>r Bibel in<br />
neuer und unerwarteter Weise zu begegnen“,<br />
sagt Jürgen Schefzyk.<br />
Wie mo<strong>de</strong>rn die Bibel sein kann,<br />
wird an <strong>de</strong>n zahlreichen Computerstationen<br />
<strong>de</strong>utlich. Hier wer<strong>de</strong>n nicht nur<br />
Inhalte durch Hör- und Bildstationen<br />
vertieft, son<strong>de</strong>rn hier kann man auch<br />
selbst Erfahrungen mit <strong>de</strong>r multimedialen<br />
Aufbereitung <strong>de</strong>r Bibel machen. Alle<br />
<strong>de</strong>rzeit in <strong>de</strong>utscher Sprache erhältlichen<br />
Computerprogramme stehen hier<br />
Begehbare Bibel © Foto: Wolfgang Zwickel<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
205
INFOS & AKTUELLES<br />
206<br />
zur Verfügung, zu<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n speziell<br />
für dieses Museum auch einige Programme<br />
neu entwickelt. Ob man diesen<br />
Bereich nun – einem aktuellen Sprachgebrauch<br />
folgend – als e-learning o<strong>de</strong>r<br />
aber nur als Spielerei bezeichnen will:<br />
Vor allem von Jugendlichen sind diese<br />
Plätze immer stark belagert.<br />
Im Vergleich zu an<strong>de</strong>ren Bibelmuseen<br />
in Deutschland wur<strong>de</strong> in diesem<br />
Museum <strong>de</strong>r Mitmach- und Erlebnischarakter<br />
beson<strong>de</strong>rs stark betont. Die starke<br />
Resonanz <strong>de</strong>r Besucher zeigt, dass sich<br />
hier ein neuer Zugang zur Bibel fin<strong>de</strong>t.<br />
Ein Zugang, <strong>de</strong>r die Bibel nicht als antiquiertes<br />
Buch darstellt, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r neue<br />
Verständnismöglichkeiten erschließt.<br />
Der Besuch dieses Museums ist<br />
beson<strong>de</strong>rs für Gruppen interessant, weil<br />
Gemäß <strong>de</strong>n „Leitlinien <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Bischofskonferenz zum Vorgehen<br />
bei sexuellem Missbrauch Min<strong>de</strong>rjähriger<br />
durch Geistliche“, die auf <strong>de</strong>r<br />
Herbstvollversammlung <strong>de</strong>r Bischöfe<br />
im September 2002 beschlossen wur<strong>de</strong>n,<br />
hat Bischof Franz Kamphaus die<br />
Pastoralpsychologin Dr. Josefine Heyer<br />
zur Bischöflichen Beauftragten bei sexuellem<br />
Missbrauch für die Diözese<br />
<strong>Limburg</strong> ernannt. Die Or<strong>de</strong>nsschwester,<br />
die <strong>de</strong>r Gemeinschaft <strong>de</strong>r Maria-<br />
Ward-Schwestern angehört, trat ihr Amt<br />
am 1. April 2003 an. Gleichzeitig trat im<br />
<strong>Bistum</strong> auch eine Verfahrensordnung<br />
zur Durchführung <strong>de</strong>r Leitlinien <strong>de</strong>r<br />
Deutschen Bischofskonferenz in Kraft.<br />
Nach<strong>de</strong>m im vergangenen Jahr im<br />
In- und Ausland durch das Bekanntwer<strong>de</strong>n<br />
von Fällen sexuellen Missbrauchs<br />
Min<strong>de</strong>rjähriger durch Geistliche<br />
eine kirchenweite Diskussion über<br />
das Thema entbrannt war, verabschie<strong>de</strong>te<br />
die Deutsche Bischofskonferenz<br />
auf ihrer turnusmäßigen Herbstvollversammlung<br />
im letzten September eine<br />
Leitlinie zum Vorgehen bei sexuellem<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
man sich gegenseitig austauschen kann<br />
und so die Erfahrungen in <strong>de</strong>m Museum<br />
sicherlich intensiver wer<strong>de</strong>n. Der<br />
Andrang von Gruppen ist jedoch so<br />
groß, dass man sich schon einige Monate<br />
vorher einen Termin in <strong>de</strong>r Geschäftsstelle<br />
reservieren lassen muss.<br />
Bibelhaus am Museumsufer –<br />
Erlebnismuseum<br />
Metzlerstraße 19<br />
60594 Frankfurt<br />
Tel.: 069/66426525<br />
Fax: 069/66426526<br />
E-mail und Internet:<br />
frankfurterbibelgesellschaft@t-online.<strong>de</strong><br />
www.frankfurter-bibelgesellschaft.<strong>de</strong><br />
Missbrauch Min<strong>de</strong>rjähriger durch Geistliche.<br />
Darin wur<strong>de</strong> ein einheitliches Vorgehen<br />
<strong>de</strong>r Bistümer bei Verdacht auf<br />
sexuellen Missbrauch festgelegt und<br />
gleichzeitig bestimmt, dass die Diözesen<br />
für ihren Bereich Bischöfliche Beauftragte<br />
benennen sollten.<br />
Schwester Dr. Josefine Heyer wird<br />
in Zukunft im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> die<br />
Anlaufstelle sein, wenn <strong>de</strong>r Verdacht<br />
sexuellen Missbrauchs auftritt. Alle<br />
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
sind durch die Leitlinien verpflichtet,<br />
Missbrauchsfälle zu mel<strong>de</strong>n.<br />
Aber auch Betroffene o<strong>de</strong>r Eltern von<br />
Opfern können sich direkt an die Beauftragte<br />
wen<strong>de</strong>n. Diese wird eine erste<br />
Untersuchung <strong>de</strong>s Verdachtes vornehmen<br />
und weitere Schritte einleiten<br />
– von einer innerkirchlichen Voruntersuchung<br />
bis zur Zusammenarbeit mit<br />
<strong>de</strong>n staatlichen Strafverfolgungsbehör<strong>de</strong>n.<br />
Ihr zur Seite steht ein Arbeitsstab sexueller<br />
Missbrauch (AsM), <strong>de</strong>r u. a. mit<br />
einem Juristen, einem Priester, einem<br />
Richter <strong>de</strong>s Diözesangerichtes und ei-<br />
Öffnungszeiten:<br />
Di: 09.00-12.00 Uhr<br />
Mi/Do: 15.00-20.00 Uhr,<br />
Fr: 15.00-18.00 Uhr<br />
Ab 1.5. Sa/So: 14.00-18.00 Uhr<br />
Eintrittspreise:<br />
Erwachsene 3,- €<br />
ermäßigt 2,- €<br />
Familien 5,- €<br />
Kin<strong>de</strong>r unter 6 Jahren frei<br />
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung<br />
<strong>de</strong>s Katholischen Bibelwerks<br />
aus „Welt und Umwelt <strong>de</strong>r Bibel“, Heft<br />
2/2003, S. 70-71<br />
Bischof ernennt Or<strong>de</strong>nsschwester zur Beauftragten<br />
bei Missbrauchsverdacht<br />
nem psychiatrischen Sachverständigen<br />
besetzt sein wird. Diesem Arbeitsstab<br />
obliegt vor allem die psychologische<br />
und seelsorgliche Betreuung und Begleitung<br />
möglicher Opfer und <strong>de</strong>r Täter<br />
sowie die Überwachung, ob in einem<br />
Verdachtsverfahren die Verfahrensordnung<br />
eingehalten wird, <strong>de</strong>r Schutz von<br />
Persönlichkeitsrechten gewahrt bleibt<br />
und eine ausreichen<strong>de</strong> Information <strong>de</strong>r<br />
Öffentlichkeit gegeben ist.<br />
Schwester Heyer ist telefonisch o<strong>de</strong>r<br />
per Fax erreichbar unter <strong>de</strong>r Nummer<br />
(0 61 72) 94 64 78. Die Ernennung von<br />
Schwester Heyer und die Verfahrensordnung<br />
sind im Amtsblatt Nr. 4/2003<br />
<strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s <strong>Limburg</strong> nachzulesen. Das<br />
Amtsblatt ist im Internet auf <strong>de</strong>r Homepage<br />
<strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s <strong>Limburg</strong> unter<br />
http://www.<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong> veröffentlicht.<br />
Die Leitlinien <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Bischofskonferenz sind ebenfalls im<br />
Internet zu fin<strong>de</strong>n unter http://dbk.<strong>de</strong>/<br />
presse/pm2002/pm2002092702.html.
I. Zielsetzung<br />
Die Stiftung DEY för<strong>de</strong>rt charakterlich<br />
geeig-nete Kin<strong>de</strong>r, Jugendliche,<br />
Auszubil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> und Stu<strong>de</strong>nten/-innen<br />
aus katholischen Familien, die eine hohe<br />
Begabung intellektueller o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rer<br />
Art besitzen, i<strong>de</strong>ell und materiell. Durch<br />
ihre För<strong>de</strong>rung will die Stiftung DEY zur<br />
Heranbildung qualifizierten katholischen<br />
Nachwuchses in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nsten<br />
Bereichen unserer Gesellschaft<br />
beitragen.<br />
II. För<strong>de</strong>rungskriterien<br />
Für eine Bewerbung müssen folgen<strong>de</strong><br />
Kriterien gleichzeitig erfüllt sein:<br />
• katholische Konfession<br />
• beson<strong>de</strong>re Begabung und fachliche<br />
Qualifikation<br />
• kirchliches Engagement<br />
• charakterliche Eignung<br />
III. För<strong>de</strong>rungsleistungen<br />
• Zuwendungen durch einmalige<br />
o<strong>de</strong>r periodische Geldleistungen<br />
•Unterstützung beim Ergreifen<br />
bestehen<strong>de</strong>r Bildungsmöglichkeiten<br />
und bei <strong>de</strong>r Erschließung neuer<br />
Bildungswege<br />
•Ermöglichung menschlicher Kontakte<br />
innerhalb <strong>de</strong>s geför<strong>de</strong>rten Kreises<br />
IV. För<strong>de</strong>rungsdauer<br />
Die För<strong>de</strong>rung wird zunächst für die<br />
Dauer eines Kalen<strong>de</strong>rjahres gewährt.<br />
Eine Verlängerung <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rung kann<br />
vom Stipendiaten, von <strong>de</strong>r Stipendatin<br />
ggf. beantragt wer<strong>de</strong>n. Vor <strong>de</strong>r Entscheidung<br />
über eine weitere För<strong>de</strong>rung<br />
wird u.a. durch eine Leistungskontrolle<br />
(Arbeitsbericht) festgestellt, ob dies<br />
gerechtfertigt ist. Eine Verlängerung wird<br />
jeweils für <strong>de</strong>n Zeitraum eines weiteren<br />
Jahres gewährt.<br />
Anträge sind zu richten an:<br />
Bischöfliches Ordinariat<br />
Kuratorium <strong>de</strong>r Stiftung DEY<br />
z. Hd. Herrn Dr. Eckhard Nordhofen<br />
Rossmarkt 12<br />
65549 <strong>Limburg</strong>/Lahn<br />
V. Bewerbungs- und<br />
Auswahlverfahren<br />
Es gilt das Prinzip <strong>de</strong>r Selbstbewerbung.<br />
Der standardisierte Bewerbungsbogen<br />
kann mit einem formlosen Schreiben<br />
bei <strong>de</strong>r Stiftung angefor<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen<br />
müssen bis spätestens 31.12. für das<br />
Folgejahr vorliegen.<br />
Die Bewerbung soll folgen<strong>de</strong> Unterlagen<br />
enthalten:<br />
• Bewerbungsbogen<br />
• ausführlicher Lebenslauf<br />
• Zusammenstellung <strong>de</strong>r bisherigen<br />
Ausbildungs- und Studienschwerpunkte<br />
• ggf. eine Darstellung <strong>de</strong>s<br />
Dissertationsvorhabens<br />
•Abschlusszeugnisse bzw. sonstige<br />
Qualifikationen und Nachweise<br />
• Referenz durch einen Priester<br />
und/o<strong>de</strong>r Pastorale Mitarbeiter/-in<br />
Bewerber/-innen, die in die engere<br />
Wahl einbezogen wer<strong>de</strong>n, bittet die<br />
Stiftung zu einem Gespräch.<br />
Die endgültige Entscheidung über einen<br />
För<strong>de</strong>rungsantrag trifft das Kuratorium.<br />
Das Bemühen um eine möglichst faire,<br />
umfassen<strong>de</strong> Beurteilung <strong>de</strong>r Persönlichkeit<br />
eines je<strong>de</strong>n Bewerbers, einer je<strong>de</strong>n<br />
Bewerberin kennzeichnet das Auswahlverfahren<br />
<strong>de</strong>r Stiftung; dazu gehört ein<br />
differenziertes Verständnis von Begabung.<br />
Auf generalisieren<strong>de</strong> Metho<strong>de</strong>n<br />
zu ihrer Bestimmung wird bewusst<br />
verzichtet. Im Vor<strong>de</strong>rgrund steht die<br />
individuelle Bewertung von Eignung,<br />
Leistungsfähigkeit und –bereitschaft mit<br />
Blick auf das jeweils angestrebte<br />
Bildungs- bzw. Ausbildungsziel.<br />
Das Kuratorium erwartet, dass <strong>de</strong>r/die<br />
Bewerber/-in darüber informiert, ob<br />
von einer an<strong>de</strong>ren Einrichtung eine<br />
För<strong>de</strong>rung beantragt wur<strong>de</strong> bzw. bereits<br />
geleistet wird.<br />
Grün<strong>de</strong> für die Aufnahme o<strong>de</strong>r die<br />
Ablehnung wer<strong>de</strong>n nicht mitgeteilt. Ein<br />
Rechtsanspruch auf Aufnahme in die<br />
För<strong>de</strong>rung besteht nicht.<br />
BISTUM LIMBURG<br />
Die unselbstständige<br />
Stiftung DEY mit <strong>de</strong>m Sitz<br />
in <strong>Limburg</strong> an <strong>de</strong>r Lahn<br />
geht zurück auf eine<br />
Schenkung <strong>de</strong>r<br />
Geschwister Dey aus <strong>de</strong>m<br />
Jahr 1987
INFO<br />
3/2003<br />
Suche<br />
mit Google ©<br />
www.ifrr.<strong>de</strong><br />
www.ifrr.<strong>de</strong><br />
Editorial<br />
Beiträge<br />
Beiträge<br />
UnterrichtspraxisUnterrichtspraxis<br />
Literatur<br />
INFOEditorial<br />
& Medien<br />
INFO online jetzt unter:<br />
www.ifrr.<strong>de</strong><br />
www.ifrr.<strong>de</strong><br />
Literatur &<br />
Medien<br />
Archiv<br />
Archiv<br />
Kontakt<br />
Kontakt<br />
Impressum<br />
Impressum<br />
Home<br />
Tag <strong>de</strong>r Religionspädagogik und Jugendarbeit 2002<br />
Ge<strong>de</strong>nken und Erinnerung<br />
„Der Bu<strong>de</strong>nzauber <strong>de</strong>r Erinnerungskultur“<br />
„Kooperation Daniel von Libeskind Staat und bebaut Kirche Ground im Bereich Zero Bildung /<br />
Joachim Jacobi August Heuser<br />
„Unterschie<strong>de</strong> erkennen und Unterschie<strong>de</strong> bejahen!” -<br />
„Erinnern<br />
Ein Gespräch<br />
und Ge<strong>de</strong>nken<br />
zwischen<br />
als<br />
Prof.<br />
Leitkategorien<br />
em. Dr. Hartmut<br />
religiösen<br />
von Hentig<br />
Lernens“<br />
Holger Dörnemann<br />
und Dr. Eckhard Nordhofen<br />
„Erinnerung (auf-)bauen“<br />
„Was Architektur ist schief <strong>de</strong>s an Ge<strong>de</strong>nkens Pisa? - Sieben in Thesen Berlin und / Thomas New Ruster York<br />
Ute Lonny-Platzbecker<br />
Sie suchen einen bestimmten Artikel,<br />
von <strong>de</strong>m Sie nicht wissen, in welcher<br />
Ausgabe er erschienen ist?<br />
Sie interessieren sich für die Themen<br />
<strong>de</strong>r aktuellen o<strong>de</strong>r einer zurückliegen<strong>de</strong>n<br />
Ausgabe?<br />
Sie möchten Ihren Religionsunterricht<br />
durch originelle unterrichtspraktische Hilfen<br />
beleben?<br />
Sie sind neugierig, wie die sog. Populär-<br />
Kultur und Ihr Religionsunterricht in einen<br />
fruchtbaren Dialog treten können?<br />
Sie suchen anregen<strong>de</strong> theologische<br />
und religionspädagogische Literatur?<br />
INFO 4/2002<br />
INFO 3/2003<br />
Was ist schief an Pisa?<br />
Zeit für die Zeit<br />
„Pascha und Eucharistie“<br />
Jüdisches und christliches Erinnern<br />
Thomas Menges<br />
PDF<br />
Sie möchten sich fortbil<strong>de</strong>n und suchen<br />
eine Veranstaltung?<br />
Sie wollen ein Themenheft bestellen<br />
o<strong>de</strong>r die Zeitschrift abonnieren?<br />
Sie wollen einfach auf <strong>de</strong>m Laufen<strong>de</strong>n<br />
bleiben, was rund um <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> passiert?<br />
Dies und vieles mehr bietet Ihnen INFO<br />
online. Unter www.ifrr.<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>n Sie im<br />
Internet die neue Online-Ausgabe <strong>de</strong>r<br />
„Informationen für Religionslehrerinnen<br />
und Religionslehrer“ im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong><br />
– Besuchen Sie uns im World Wi<strong>de</strong> Web!
Bestell-Liste<br />
Themen <strong>de</strong>r Hefte 1980 – 2003<br />
Die nachfolgen<strong>de</strong>n Hefte können, solange <strong>de</strong>r Vorrat reicht, nachbestellt wer<strong>de</strong>n:<br />
Jahrgang 1980<br />
Heft 1/2: *Audiovisuelle Medien<br />
Heft 3: * Die Bibel im Religionsunterricht<br />
Heft 4: Audiovisuelle Medien �<br />
Jahrgang 1981<br />
Heft 1/2: Beten in <strong>de</strong>r Schule �<br />
Heft 3: Im Dialog �<br />
Heft 4: * Für euch und für alle<br />
Jahrgang 1982<br />
Heft 1/2: Religiöse Erziehung in <strong>de</strong>r Eingangsstufe �<br />
Heft 3: Religionsunterricht in <strong>de</strong>r Primarstufe �<br />
Heft 4: * Religionsunterricht<br />
Jahrgang 1983<br />
Heft 1: * Katholische Soziallehre<br />
Heft 2/3:* Nehmet einan<strong>de</strong>r an ...<br />
Heft 4: * Das Reich Gottes ist nahe ... (Mk 1.15)<br />
Jahrgang 1984<br />
Heft 1/2:* Maria<br />
Heft 3: * Das Kirchenjahr<br />
Heft 4: Lebenswege – Glaubenswege �<br />
Jahrgang 1985<br />
Heft 1/2:* 750 Jahre <strong>Limburg</strong>er Dom<br />
Heft 3: * Theologie <strong>de</strong>r Befreiung<br />
Heft 4: Armuts-Bewegungen �<br />
Jahrgang 1986<br />
Heft 1/2: Kirche im Aufbruch �<br />
Heft 3: Christen und Ju<strong>de</strong>n �<br />
Heft 4: Mit Wi<strong>de</strong>rsprüchen leben �<br />
Jahrgang 1987<br />
Heft 1/2:* Christen und Muslime<br />
Heft 3: * Christen und New Age<br />
Heft 4: Christen und Schöpfung �<br />
Jahrgang 1988<br />
Heft 1: Afrika begegnen – MISEREOR ‘88 �<br />
Heft 2/3: Schule und Leben �<br />
Heft 4: * Mystik und Politik<br />
Jahrgang 1989<br />
Heft 1/2: Brennpunkt: Religionsunterricht �<br />
Heft 3: * Sakramente im Religionsunterricht<br />
Heft 4: * Der lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Mensch – Der lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Gott<br />
Jahrgang 1990<br />
Heft 1: * Paulus – Der Lehrer<br />
Heft 2/3:* Religion und Musik<br />
Heft 4: Impulse für die Kirche �<br />
Jahrgang 1991<br />
Heft 1/2: *Prophetinnen und Propheten im<br />
Religionsunterricht<br />
Heft 3: Mitwelt – Schöpfung �<br />
Heft 4: Neue Re<strong>de</strong> von Maria �<br />
Jahrgang 1992<br />
Heft 1/2:* Herausfor<strong>de</strong>rung Islam<br />
Heft 3: * Biotechnik und Ethik<br />
Jahrgang 1993<br />
Heft 1: Qumran Essener Jesus �<br />
Heft 2/3:* Sterben / Tod / Eschatologie<br />
Heft 4: Religionsunterricht und Literatur �<br />
Jahrgang 1994<br />
Heft 1: * Fundamentalismus in Gesellschaft und Kirche<br />
Heft 2: * Von Gott re<strong>de</strong>n im Religionsunterricht<br />
Heft 3: Kirchengeschichte im Religionsunterricht �<br />
Heft 4: Das Erste Tesament und die Christen �<br />
Jahrgang 1995<br />
Heft 1: „Wenn die Kirche zur Schule geht ...“ �<br />
Heft 2: „Ich wer<strong>de</strong> von meinem Geist ausgießen<br />
über alles Fleisch“ (Apg 2,17) �<br />
Heft 3: Gespeicherte Erinnerung –<br />
Das Museum als Lernort �<br />
Heft 4: „Ich war hungrig; und ihr ...“ (Mt 25,35; 42)<br />
Vom Umgang mit <strong>de</strong>r Armut �<br />
Anzahl Anzahl<br />
Jahrgang 1996<br />
Heft 1: „Ihr seid zur Freiheit berufen ...“ (Gal 5,13)<br />
Er-löst! �<br />
Heft 2: „Er stellte ein Kind in ihre Mitte ...“ (Mt 18,1) �<br />
Heft 3: „... und spielte vor ihm allezeit.“ (Spr. 8,30 b) �<br />
Heft 4: Konfessionalität <strong>de</strong>s Religionsunterrichts �<br />
Jahrgang 1997<br />
Heft 1: * „Und vergib uns unsere Schuld.“ (Mt 6,12)<br />
Heft 2: * Alternativ leben<br />
Heft 3: Mit mehr Sinn(en) leben �<br />
Heft 4: „Typisch Mädchen?“<br />
Mädchenerziehung in <strong>de</strong>r Schule �<br />
Jahrgang 1998<br />
Heft 1: „Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt!“<br />
(Ez 18,32) �<br />
Heft 2: „Vergesst mir die Berufsschüler nicht“ �<br />
Heft 3: Gemeinschaft <strong>de</strong>r Heiligen. Große Gestalten <strong>de</strong>s<br />
<strong>Bistum</strong>s und ihre Wirkung in unserer Zeit �<br />
Heft 4: * Ju<strong>de</strong>n – Muslime – Christen.<br />
Die drei Kin<strong>de</strong>r in Abrahams Schoß<br />
Jahrgang 1999<br />
Heft 1: Gottes Er<strong>de</strong> – Zum Wohnen gemacht.<br />
Unsere Verantwortung für die Schöpfung �<br />
Heft 2: En<strong>de</strong>? Apokalyptische Visionen in<br />
Vergangenheit und Gegenwart �<br />
Heft 3: Begegnungen mit <strong>de</strong>m Buddhismus �<br />
Heft 4: Jugendliche I<strong>de</strong>ntität–Christlicher Glaube �<br />
Jahrgang 2000<br />
Heft 1: * Heiliges Jahr 2000<br />
Heft 2: * RU online. Neue Medien im Religionsunterricht<br />
Heft 3: Kirchenraum als Lernort �<br />
Heft 4: „Schwarz greift ein“. Vom kritischen Verhältnis<br />
kirchlicher Religiosität zur „civil religion“<br />
Jahrgang 2001<br />
�<br />
Heft 1: Erinnerung für die Zukunft.<br />
Kirchengeschichte im Religionsunterricht �<br />
Heft 2: * Religionsunterricht – Da steckt Musik drin<br />
Heft 3: * Chancen sehen – Der Religionsunterricht <strong>de</strong>r<br />
Zukunft<br />
Heft 4: Auf <strong>de</strong>r Suche nach einer lebendigen<br />
Mystik<br />
Jahrgang 2002<br />
Heft 1: * In <strong>de</strong>r Spur <strong>de</strong>s Auferstan<strong>de</strong>nen –<br />
leiblich auferstehen<br />
�<br />
Heft 2: „Das wäre ja gelacht!“ Humor und<br />
Komik im Religionsunterricht �<br />
Heft 3: Perspektivenwechsel – Behin<strong>de</strong>rung mit<br />
an<strong>de</strong>ren Augen sehen �<br />
Heft 4: Was ist schief an PISA? �<br />
Jahrgang 2003<br />
Heft 1: * Der achte Schöpfungstag?<br />
Heft 2: „Nimm und lies!“ �<br />
Heft 3: Zeit für die Zeit �<br />
* Diese Ausgaben sind vergriffen.<br />
je Ausgabe € 1.60<br />
INFO<br />
Name<br />
Vorname<br />
Schule<br />
Straße<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon<br />
Bitte ausfüllen, kopieren<br />
und faxen an:<br />
06431/295-237<br />
o<strong>de</strong>r per Post sen<strong>de</strong>n an:<br />
Dezernat<br />
Schule und Hochschule<br />
Bischöfliches Ordinariat<br />
<strong>Limburg</strong><br />
Dipl.-Theol. Martin W. Ramb<br />
Postfach 1355<br />
65533 <strong>Limburg</strong>
INFOS & AKTUELLES<br />
210<br />
PZ 01/2003<br />
10.09.2003, 14.30 Uhr, bis 12.09.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Internet im Religionsunterricht<br />
Einführung in das Internet<br />
Andreas Greif, Fulda<br />
Religionslehrer/-innen aller Schularten<br />
– Begrenzte Teilnehmerzahl (max. 15) –<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Wissenswertes über PISA und <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
Eine Orientierungshilfe für Religionslehrerinnen und<br />
Religionslehrer<br />
Vorgelegt von <strong>de</strong>n rheinland-pfälzischen (Erz-)Diözesen:<br />
Köln, <strong>Limburg</strong>, Mainz, Speyer, Trier<br />
Erarbeitet von:<br />
Bernd Lambert, Josef Meller, Martin W. Ramb, Dr.<br />
Clauß Peter Sajak, Dieter Skala<br />
Herausgeber:<br />
Bischöfliches Ordinariat <strong>Limburg</strong><br />
Dezernat Schule und Hochschule<br />
Postfach 13 55<br />
65533 <strong>Limburg</strong>/Lahn<br />
Fon 06431/295-235<br />
Fax 06431/295-237<br />
E-Mail schule@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
www.<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
Redaktion:<br />
Martin W. Ramb<br />
Veranstaltungen<br />
PÄDAGOGISCHES<br />
<strong>de</strong>r Bistümer im Lan<strong>de</strong> Hessen<br />
Herstellung:<br />
JVA Diez, <strong>Limburg</strong>er Straße 122, 65582 Diez<br />
© Verlag <strong>de</strong>s Bischöflichen Ordinariates <strong>Limburg</strong>,<br />
<strong>Limburg</strong>/Lahn 2003<br />
1. Auflage 2003<br />
Auflage: 13.000<br />
ISBN 3-921221-14-5<br />
Die DIN A5-Broschüre ist für 1.00 € (zzgl. Versandkosten)<br />
zu beziehen über:<br />
Bischöfliches Ordinariat <strong>Limburg</strong><br />
Dezernat Schule und Hochschule<br />
Postfach 13 55<br />
65533 <strong>Limburg</strong>/Lahn<br />
Fon 06431/295-235<br />
Fax 06431/295-237<br />
E-Mail schule@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />
Versand erfolgt mit Rechnung.<br />
PZ 02/2003<br />
12.09.2003, 18.00 Uhr, bis 14.09.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Erzählwerkstatt: Bibel<br />
Spielerisch biblische Geschichten erzählen<br />
Thomas Hofmeister-Höfener, Sen<strong>de</strong>nhorst<br />
Lehrer/-innen aller Schularten, Sek I und II, Deutsch-, Ethik- und<br />
Religionslehrer/-innen<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 03/2003<br />
22.09.2003, 14.30 Uhr, bis 24.09.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Pädagogik <strong>de</strong>r Begegnung III<br />
Teamarbeit und Teamentwicklung in <strong>de</strong>r Schule unter<br />
Lehren<strong>de</strong>n und Lernen<strong>de</strong>n. Anregungen zu einer<br />
neuen Kultur <strong>de</strong>s Miteinan<strong>de</strong>r im Lehren und Lernen.<br />
Karl Wilhelm Wolf, <strong>Limburg</strong><br />
Lehrer/-innen aller Schularten und Fächer<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
Anzeige
PZ 04/2003<br />
29.09.2003, 14.30 Uhr, bis 01.10.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Mathematische Mo<strong>de</strong>lle als Spiegel<br />
<strong>de</strong>r Wirklichkeit<br />
Dr. Martin Bracke, Kaiserslautern; StD Hans-Georg Tischbein,<br />
Westerburg<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Mathematik und Naturwissenschaften<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 05/2003<br />
07.10.2003, 10.00-17.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Populäre Musik im Religionsunterricht<br />
Arthur Thömmes, Gusenburg<br />
Musik-, Religionslehrer/-innen <strong>de</strong>r Sek I und Sek II und<br />
Berufsbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Schulen<br />
Eigenkostenanteil: 6.00 €<br />
PZ 06/2003<br />
13.10.2003, 14.30 Uhr, bis 15.10.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Biblisches in <strong>de</strong>r Dichtung<br />
Beate-Irene Hämel, Frankfurt<br />
Deutsch-, Ethik- und Religionslehrer/-innen<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 07/2003<br />
15.10.2003, 14.30 Uhr, bis 17.10.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Ängstlicher Riese und mutige Maus<br />
Bil<strong>de</strong>r und Geschichten wer<strong>de</strong>n lebendig.<br />
Möglichkeiten <strong>de</strong>r szenischen Umsetzung von<br />
Bil<strong>de</strong>rn und Kin<strong>de</strong>rbüchern<br />
Elke Mai-Schrö<strong>de</strong>r, Frankfurt<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Klassen 1 bis 5<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 08/2003<br />
15.10.2003, 14.30 Uhr, bis 17.10.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Biblische Botschaft in Bil<strong>de</strong>rn ent<strong>de</strong>cken<br />
mit Originallithographien von Marc Chagall<br />
Religionspädagogische Lernchancen von Bil<strong>de</strong>rn<br />
im Religionsunterricht<br />
Sabine Tischbein, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Ethik-, Kunst-, Religionslehrer/-innen und alle Interessierten<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 09/2003<br />
04.11.2003, 10.00 Uhr, bis 05.11.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
– In Kooperation mit <strong>de</strong>m ILF Mainz –<br />
Religionspädagogik lernen ohne Religion?<br />
Mechthild Frey-Brand, Mainz; Jürgen Weiler, Mainz; u. a.<br />
Religionslehrer/-innen an Fachschulen für Sozialpädagogik<br />
Eigenkostenanteil: 12.00 €<br />
PZ 10/2003<br />
05.11.2003, 14.30 Uhr, bis 07.11.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Wahrnehmen und Bewegen als<br />
Grundlage für Lernen und Verhalten<br />
Dorothea Beigel, Wetzlar<br />
Erzieher/-innen, Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Grundschulen und <strong>de</strong>r Sekundarstufen I<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 11/2003<br />
05.11.2003, 14.30 Uhr, bis 07.11.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
„Ringen mit Jakob“ o<strong>de</strong>r:<br />
Biblische Überlieferungen ins Spiel bringen<br />
Eine Einführung in das Bibliodrama<br />
Gerhard Hielscher, <strong>Limburg</strong>; Irmgard Kaspar, Hadamar<br />
Ethik- und Religionslehrer/-innen an Grundschulen und in <strong>de</strong>n<br />
Sekundarstufen II<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 12/2003<br />
06.11.2003, 10.00-17.00 Uhr<br />
St. Angela-Schule, Königstein<br />
Zwangsarbeit in <strong>de</strong>r Kirche<br />
Besuch und Kennenlernen <strong>de</strong>r Ausstellung im<br />
Kontext Schule.<br />
Bis min<strong>de</strong>stens 2004 wird die Ausstellung an verschie<strong>de</strong>nen Orten<br />
im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong> gezeigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Regine Gabriel, Ge<strong>de</strong>nkstätte Hadamar; Barbara Wieland,<br />
Frankfurt; Joachim Rotberg, Frankfurt<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Sekundarstufen I und II mit <strong>de</strong>n Fächern: Deutsch, Ethik,<br />
Geschichte, Politik und Religion<br />
Eigenkostenanteil: 6.00 €<br />
PZ 13/2003<br />
10.11.2003, 14.30 Uhr, bis 12.11.2003, 13.00 Uhr<br />
Erbacher Hof, Mainz<br />
Vom Kurstaat zur Republik<br />
Mainz in <strong>de</strong>r Französischen Revolution<br />
– In Kooperation mit <strong>de</strong>m Geschichtslehrerverband<br />
Hessen –<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
211
INFOS & AKTUELLES<br />
212<br />
Dr. Franz Dumont, Mainz; Dr. Hans-Bernd Spies, Aschaffenburg;<br />
Ulrich Kirchen, Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Gemeinschaftskun<strong>de</strong>-, Geschichts- und Religionslehrer/-innen <strong>de</strong>r<br />
Sekundarstufen I und II<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 14/2003<br />
17.11.2003, 14.30 Uhr, bis 18.11.2003, 18.00 Uhr<br />
Erbacher Hof, Mainz<br />
Erzählen mit Leib und Seele<br />
Erzählübungen an Märchen. Gestaltungshilfen<br />
zum ‘Inwendig’-Lernen<br />
Regina Haas-Sauer, Breuberg-Wald-Amorbach<br />
Erzieher/-innen, Lehrer/-innen aller Schularten und Fächer<br />
Eigenkostenanteil: 12.00 €<br />
PZ 15/2003<br />
26.11.2003, 10.00 Uhr, bis 28.11.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
„Ach wie gut, dass niemand weiß ...“<br />
Rolle und I<strong>de</strong>ntität im Lehrer/-innen-Beruf<br />
Astrid Reinhardt, Gießen<br />
Lehrer/-innen aller Fächer und Schularten<br />
– Begrenzte Teilnehmerzahl (max. 15) –<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 16/2003<br />
28.11.2003, 15.00 Uhr, bis 29.11.2003, 18.00 Uhr<br />
Erbacher Hof, Mainz<br />
03.11. bis 07.11.2003<br />
Reinhardswaldschule, Fuldatal<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Bibel und Archäologie: Religion „ergraben“<br />
– Religionen besser verstehen<br />
Ursprung und Entwicklung <strong>de</strong>r monotheistischen<br />
Religionen<br />
Georg Philipp Melloni, Westhausen<br />
Religionslehrer/-innen<br />
Eigenkostenanteil: 12.00 €<br />
PZ 17/2003<br />
03.12.2003, 14.30 Uhr, bis 05.12.2003, 13.00 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Erzählwerkstatt: Bibel<br />
Spielerisch biblische Geschichten erzählen<br />
Thomas Hoffmeister-Höfener, Sen<strong>de</strong>nhorst<br />
Erzieher/-innen und Religionslehrer/-innen an Sozialpädagogischen<br />
Fachschulen<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
PZ 18/2003<br />
10.12.2003, 14.30 Uhr, bis 12.12.2003, 1300 Uhr<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Frauen in <strong>de</strong>r Mystik<br />
Lebenshaltung und Lebensgestaltung<br />
Dr. Isol<strong>de</strong> Macho-Wagner, Idstein<br />
Religionslehrer/-innen und alle interessierten Kolleginnen<br />
Eigenkostenanteil: 18.00 €<br />
Weitere IInnffoorrmmaattiioonneenn zu <strong>de</strong>n KKuurrsseenn fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r Homepage <strong>de</strong>s Pädagogischen Zentrums: wwwwww..ppzz--hheesssseenn..d<strong>de</strong>e ab ca. 2 Monate<br />
vor Kursbeginn. SScchhrriiffttlliicchhee AAnnmmeelldduunnggeenn wer<strong>de</strong>n umgehend erbeten, spätestens jedoch bis vier Wochen vor Lehrgangsbeginn an:<br />
PPääddaaggooggiisscchheess ZZeennttrruumm d<strong>de</strong>err BBiissttüümmeerr iimm LLaannd<strong>de</strong>e HHeesssseenn,, WWiillhheellmm--KKeemmppff--HHaauuss,, 6655220077 WWiieessbbaad<strong>de</strong>enn--NNaauurroodd.<br />
Fon: 06127/77285; Fax: 06127/77246; E-Mail: pz.hessen@t-online.<strong>de</strong>; Homepage: www.pz-hessen.<strong>de</strong><br />
Die Lehrgänge sind gemäß Erlass <strong>de</strong>s Hessischen Kultusministeriums vom 01.07.1997 – Nr. V B 3.1-960/5000-2000 – in Verbindung mit<br />
Erlass vom 17.07.2003 Nr. VII-7-095.b.03-02 als Fortbildungsveranstaltungen anerkannt.<br />
Die Unterrichtsbefreiung für die Teilnahme an <strong>de</strong>n Lehrgängen erfolgt bei 1-3tägigen Veranstaltungen durch die Schulleitung, bei 4und<br />
mehrtägigen Veranstaltungen durch das Staatliche Schulamt (vgl. Erlass <strong>de</strong>s HKM vom 01. Juli 1997 – B V 3.1-960-5000/2000).<br />
Hessisches Lan<strong>de</strong>sinstitut für<br />
Pädagogik (HeLP),<br />
Fachbereich Kath. Religionslehre<br />
Berufsschullehrerwoche<br />
Internet und Religion<br />
Das Seminar soll vor allem didaktischen Überlegungen<br />
nachgehen.<br />
Willi Platzer, Darmstadt<br />
Religionslehrer/-innen an Berufsschulen<br />
15.11.2003<br />
Vincenzstift, Rü<strong>de</strong>sheim-Aulhausen<br />
Son<strong>de</strong>rschultagung
Spiritualität <strong>de</strong>r Lehren<strong>de</strong>n an Son<strong>de</strong>rschulen<br />
Dr. Christoph Beuers, Siegfried Fuchs, Dieter Laquai<br />
Religionslehrer/-innen an Son<strong>de</strong>rschulen<br />
17.11. bis 19.11.2003<br />
Karlsheim, Kirchähr<br />
Kontaktstudium <strong>de</strong>s Fachbereichs Katholische Theologie<br />
an <strong>de</strong>r Johann Wolfgang Goethe-Universität,<br />
Frankfurt am Main<br />
Meditation – meditieren lernen und lehren<br />
Prof. Dr. Francis D’Sa SJ, Indien; Prof. Dr. Thomas Schreijäck,<br />
Frankfurt<br />
Religionslehrer/-innen aller Schulen und Stufen<br />
AAnnmmeelldduunnggeenn aann:: HHeessssiisscchheess LLaannd<strong>de</strong>essiinnssttiittuutt ffüürr PPääddaaggooggiikk ((HHeeLLPP)),, RReeiinnhhaarrddsswwaallddsscchhuullee,, RRootthhwweesstteenneerr SSttrr.. 22--1144,, 3344223333 FFuullddaattaall..<br />
Zur Anmeldung benutzen Sie bitte die im offiziellen Programm <strong>de</strong>s HeLP eingehefteten Anmel<strong>de</strong>karten (in je<strong>de</strong>r Schule vorhan<strong>de</strong>n!). Bitte<br />
mel<strong>de</strong>n Sie sich unbedingt rechtzeitig an, am besten sofort bei Beginn <strong>de</strong>s Schulhalbjahres, da je<strong>de</strong>smal erhebliche Schwierigkeiten<br />
auftreten, wenn 6 Wochen vor Lehrgangsbeginn noch nicht genügend Anmeldungen vorliegen. Im übrigen ist es auch für die Planungen<br />
<strong>de</strong>r Schulleitungen einfacher, bereits am Beginn <strong>de</strong>s Schulhalbjahres Genehmigungen zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen<br />
erteilen zu können.<br />
Katholische Aka<strong>de</strong>mie<br />
Rabanus Maurus,<br />
Frankfurt am Main<br />
– Öffentliche Tagungen – Auswahl –<br />
Tagung Nr. 2351<br />
8.10.2003, 17.00-22.00 Uhr<br />
Karmeliterkloster, Münzgasse 9, Frankfurt am Main<br />
(Institut für Stadtgeschichte)<br />
Russland: Zwischen I<strong>de</strong>ntität und Umbruch<br />
Soiree aus Anlass <strong>de</strong>r internationalen Frankfurter<br />
Buchmesse (mit Vespergottesdienst)<br />
Referenten aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Kirchen, <strong>de</strong>r Kultur und Politik<br />
Kosten: 15.00 €, ermäßigt 10.00 €<br />
Tagung 2353<br />
16.10.2003, 17.15-21.30 Uhr<br />
Karmeliterkloster, Münzgasse 9, Frankfurt am Main<br />
(Institut für Stadtgeschichte)<br />
Kirche im Nationalsozialismus<br />
Erkenntnisse und Konsequenzen<br />
Aka<strong>de</strong>mieabend in Kooperation mit <strong>de</strong>m Institut für<br />
Stadtgeschichte aus Anlass <strong>de</strong>r Ausstellung „Zwangsarbeit<br />
in <strong>de</strong>r Kirche“ vom 22.09. bis 02.11.2003<br />
Dr. Antonia Leugers, Univ. Münster; Dr. Karl Josef Hummel,<br />
Institut für Zeitgeschichte; Dr. Rainer Ben<strong>de</strong>l und<br />
Prof. Dr. Ottmar Fuchs, Univ. Tübingen<br />
Kosten: 10.00 €<br />
Tagung Nr. 2360<br />
1.: 5.11.2003; 2.: 12.11.2003; 3.: 19.11.2003; 4.: 26.11.2003,<br />
jeweils 18.30-20.00 Uhr<br />
Vortragssaal <strong>de</strong>s Museums für Mo<strong>de</strong>rne Kunst,<br />
Domstraße 16, Frankfurt am Main<br />
Andy Warhol: Time Capsules<br />
Vortragsreihe zur Ausstellung<br />
Prof. Dr. Arnold Angenendt, Münster; Dr. Andreas Bee, MMK,<br />
Frankfurt am Main; Klaus Görner, MMK, Frankfurt am Main;<br />
Dr. Stefan Scholz, Kath. Aka<strong>de</strong>mie Rabanus Maurus<br />
Kosten: keine<br />
Tagung Nr. 2301<br />
03.09.2003 (Liebieghaus); 01.10.2003 (Stä<strong>de</strong>l); 05.11.2003<br />
(Liebieghaus); 03.12.2003 (Stä<strong>de</strong>l), jeweils 19.00 Uhr;<br />
21.12.2003, 15.00 Uhr (Stä<strong>de</strong>l)<br />
Stä<strong>de</strong>l’sches Kunstinstitut und Städtische Galerie,<br />
Schaumainkai 63, Frankfurt am Main o<strong>de</strong>r:<br />
Liebieghaus, Museum alter Plastik, Schaumainkai 71,<br />
Frankfurt am Main<br />
Kunst und Religion<br />
Bil<strong>de</strong>r und Skulpturen aus Stä<strong>de</strong>l und Liebieghaus<br />
kunstgeschichtlich erschlossen, philosophisch befragt<br />
und theologisch ge<strong>de</strong>utet.<br />
Pfr. Andreas Hoffmann, Evang. Stadtkirchenarbeit;<br />
Dr. Stefan Scholz, Kath. Aka<strong>de</strong>mie Rabanus Maurus<br />
Kosten: Liebieghaus: keine; Stä<strong>de</strong>l: 6.00 €<br />
Tagung Nr. 2302<br />
03.09.2003; 15.10.2003; 19.11.2003; 17.12.2003,<br />
jeweils 19.00-20.00 Uhr<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
213
INFOS & AKTUELLES<br />
214<br />
Ikonen-Museum <strong>de</strong>r Stadt Frankfurt,<br />
Brückenstraße 3-7, Frankfurt am Main<br />
Ikonenbegegnungen<br />
Bil<strong>de</strong>r vom Sinn <strong>de</strong>s Lebens<br />
Pfr. Andreas Hoffmann, Evang. Stadtkirchenarbeit;<br />
Dr. Stefan Scholz, Kath. Aka<strong>de</strong>mie Rabanus Maurus;<br />
Dr. Richard Zacharuk, Ikonen-Museum<br />
Tagung 2355<br />
24.-26.10.2003<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Bibel und Kriminalroman – eine Wahlverwandtschaft?<br />
Kosten: 95.00 € incl. Übernachtung und Mahlzeiten;<br />
ermäßigt: 70.00 €; 75.00 € ohne Übernachtung;<br />
ermäßigt: 50.00 €<br />
Tagung Nr. 2362<br />
14.11.2003, 15.00 Uhr, bis 15.11.2003, 18.00 Uhr<br />
Spener Haus, Dominikanergasse 5, Frankfurt am<br />
Main<br />
„Und das Wort ist Schrift gewor<strong>de</strong>n“<br />
Gemeinsamer Studientag mit <strong>de</strong>r Evang. Stadtaka<strong>de</strong>mie<br />
Frankfurt am Main<br />
Eine Bibel-Ausstellung (04.-16.11.2003) ergänzt die<br />
Tagung<br />
Kosten erfragen bei: Kath. Aka<strong>de</strong>mie Rabanus Maurus<br />
Bibelschule Königstein<br />
Programm 2003/04<br />
Ursulinenkloster St. Angela<br />
Gerichtstr. 19, 61462 Königstein/Taunus<br />
1. o<strong>de</strong>r 2.12.2003<br />
Johannes im Kirchenjahr<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Tagung Nr. 2364<br />
29.09.2003, 19.30-21.30 Uhr<br />
Pfarrzentrum St. Josef, Romero-Saal, Eichwaldstraße<br />
41, Frankfurt am Main (Bornheim)<br />
Islam und Frie<strong>de</strong>n<br />
Frie<strong>de</strong>nserziehung in <strong>de</strong>r Moschee<br />
Vortrags- und Gesprächsabend veranstaltet von <strong>de</strong>r<br />
Philosophisch-Theologischen Hochschule St.<br />
Georgen, CIBEDO und <strong>de</strong>r George-Anawati-Stiftung<br />
Prof. Dr. Cemal Tosun, Univ. Ankara<br />
Kosten: 3.00 €<br />
Tagung 2341<br />
17.09.2003 und 15.10.2003, jeweils 19.30 Uhr<br />
Zentrale Erwachsenenbibliothek, Zeil 17-21, Frankfurt<br />
am Main<br />
Heilige Texte<br />
Lese- und Gesprächsaben<strong>de</strong> in Zusammenarbeit <strong>de</strong>r<br />
Evang. Stadtaka<strong>de</strong>mie und <strong>de</strong>r Katholischen Erwachsenenarbeit<br />
– Bildungswerk Frankfurt am Main<br />
17.09.2003, 19.30 Uhr<br />
Thema: „Barmherzigkeit“<br />
Mit Ansgar Koschel, Juval Lapi<strong>de</strong>, Achmed Ajaou<br />
15.10.2003, 19.30 Uhr<br />
Thema: „Ewiges Leben“<br />
Mit Christian Schwindt, Ester Ellrodt, Gülbar Er<strong>de</strong>m<br />
Kosten: keine<br />
Zu je<strong>de</strong>r Veranstaltung gibt die Aka<strong>de</strong>mie einen eigenen Tagungsprospekt heraus, aus <strong>de</strong>m Interessenten das <strong>de</strong>tailierte Programm, <strong>de</strong>n Ort<br />
und die Kosten <strong>de</strong>r jeweiligen Veranstaltung ersehen können. Diese, das Gesamtprogramm und weitere Informationen erhalten Sie bei:<br />
KKaatthhoolliisscchhee AAkkaad<strong>de</strong>emmiiee RRaabbaannuuss MMaauurruuss,, Eschenheimer Anlage 21, 60318 Frankfurt am Main.<br />
Fon: 0 69 / 15 01-3 00; Fax: 0 69 / 29 80 28 65; E-Mail: info@KARM.<strong>de</strong>; Internet: www.KARM.<strong>de</strong><br />
(nicht nur) für Pfarrer und Pastorale Mitarbeiter/-innen<br />
Teilnehmergebühr: 20.00 €<br />
Über die Kurse:<br />
Aufbaukurs Neues Testament 2003/2004<br />
und<br />
Grundkurs Altes Testament 2003/2004<br />
erteilt Interessenten die Bibelschule Königstein<br />
(Anschrift s. u.) nähere Auskünfte.<br />
AAuusskküünnffttee erteilt: BBiibbeellsscchhuullee KKöönniiggsstteeiinn ee..VV..,, UUrrssuulliinneennkklloosstteerr SStt.. AAnnggeellaa,, GGeerriicchhttssttrr.. 1199,, 6611446622 KKöönniiggsstteeiinn..<br />
Fon: 06174/9381-0; Fax: 06174/9381-55; E-Mail: Bibelschule.Koenigstein@gmx.<strong>de</strong>
RHEINLAND - PFALZ<br />
ILF<br />
M A I N Z<br />
ILF-Nr.: 22.100<br />
24.-26.09.2003<br />
Forum Vincenz Pallotti, Vallendar<br />
Die Bibel – (k)ein Buch mit sieben Siegeln<br />
FL Norbert Wolf, Mainz<br />
Religionslehrer/-innen an Grundschulen<br />
ILF-Nr.: 22.170<br />
13.-15.10.2003<br />
Haus Maria Rosenberg, Waldfischbach<br />
Klöster, Kreuzzüge, Kirchenkämpfe<br />
Marksteine <strong>de</strong>r Kirchengeschichte in Werken <strong>de</strong>r<br />
Jugendliteratur<br />
Birgit Menzel, Offenbach<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Fächer Religion, Deutsch und Geschichte<br />
ILF-Nr.: 22.190<br />
25.10.-01.11.2003<br />
Priesterhaus Berg Moriah, Simmern<br />
Gewinn durch Verzicht<br />
Heilfasten mit spiritueller Begleitung<br />
Anne Wahle, Gesundheitstrainerin und Fastenleiterin, Honigsessen;<br />
Anneli Baum-Resch, ILF Mainz; Dipl.-Päd.’ Mechtild<br />
Frey-Brandt, ILF Mainz<br />
Lehrer/-innen und Erzieher/-innen<br />
Institut für Lehrerfortund<br />
-weiterbildung (ILF),<br />
Mainz<br />
ÜÜbbeerrrreeggiioonnaallee<br />
VVeerraannssttaallttuunnggeenn<br />
ILF-Nr.: 22.293<br />
27.-28.10.2003<br />
Herz-Jesu-Kloster, Neustadt<br />
Rituale <strong>de</strong>s Erwachsenwer<strong>de</strong>ns<br />
Dr. <strong>de</strong>s Frauke Volkland, Neustadt<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Fächer Geschichte, Religion und Biologie<br />
ILF-Nr.: 22.150<br />
04.-05.11.2003<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
– In Kooperation mit <strong>de</strong>m PZ-Hessen –<br />
Religionspädagogik lernen ohne Religion?<br />
Dipl.-Päd.’ Mechtild Frey-Brand, ILF Mainz; Jürgen Weiler,<br />
BO Mainz; N. N. Kollegen/-innen aus <strong>de</strong>r Praxis<br />
Lehrkräfte für Religionspädagigik/Religion an Fachschulen für Sozialpädagogik/Sozialwissen,<br />
Bildungsgang Erzieherinnen in Rheinland-Pfalz<br />
und Hessen<br />
ILF-Nr.: 22.151<br />
12.-14.11.2003<br />
Johann-Sebastian-Bach-Haus, Keysermühle<br />
Kin<strong>de</strong>rbibeln – Hauptsache bunt?<br />
Anneli Baum-Resch, ILF Mainz<br />
Grundschullehrer/-innen und Erzieher/-innen, Lehrer/-innen an<br />
Fachhochschulen für Sozialpädagogik/Sozialwesen<br />
ILF-Nr.: 22.191<br />
20.-22.11.2003<br />
Hedwig-Dransfeld-Haus, Bendorf<br />
Lebendig Lehren und Lernen – im Religionsunterricht<br />
und in <strong>de</strong>r religionspädagogischen<br />
Fortbildung<br />
OR Hubert Ries, Trier<br />
Religionslehrer/-innen aller Schularten und religionspädagogische<br />
Multiplikator/-inn/-en<br />
ILF-Nr.: 22.120<br />
24.-26.11.2003<br />
Zentrale Aus- und Fortbildungsstätte <strong>de</strong>r<br />
Evang. Kirche <strong>de</strong>r Pfalz, Landau<br />
– In Kooperation mit <strong>de</strong>m EFWI –<br />
Christ sein: katholisch / evangelisch<br />
Pfarrer Horst Hutter, EFWI Landau; Anneli Baum-Resch, ILF Mainz<br />
Katholische und evangelische Religionslehrer/-innen aller Schularten<br />
ILF-Nr.: 22.121<br />
03.-05.12.2003<br />
<strong>Bistum</strong>shaus St. Ludwig, Speyer<br />
„Memento“ – Das Thema „Erinnerung“ in<br />
Spielfilmen für <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
Franz Günther Weyrich, Wetzlar<br />
Religionslehrer/-innen <strong>de</strong>r Sek I (ab <strong>de</strong>r 8. Klasse) und Sek II<br />
ILF-Nr.: 22.202<br />
15.-17.12.2003<br />
Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesba<strong>de</strong>n-Naurod<br />
Zeitgeschichte im Internet und auf<br />
CD-ROM<br />
Dr. Klaus Fieberg, Leverkusen<br />
Lehrer/-innen <strong>de</strong>r Sekundarstufen I und II <strong>de</strong>r Fächer Geschichte,<br />
Sozialkun<strong>de</strong>, Religion und Ethik<br />
AAnnmmeelldduunnggeenn erfolgen sscchhrriiffttlliicchh – d. h. bis spätestens 3 Wochen vor Kursbeginn – mit <strong>de</strong>r ggeellbbeenn AAnnmmeelld<strong>de</strong>ekkaarrttee (erhältlich beim<br />
Schulleiter o<strong>de</strong>r beim ILF Mainz) üübbeerr ddiiee SScchhuulllleeiittuunngg an das ILF.<br />
AAnnsscchhrriifftt:: ILF Mainz, Postfach 24 50, 55014 Mainz; Fon: 0 61 31 / 28 45 - 0; Fax: 0 61 31 / 28 45 25); http://www.ilf.bildung-rp.<strong>de</strong><br />
INFO 32 · 3/2003<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
215
INFOS & AKTUELLES<br />
216<br />
Überregional interessieren<strong>de</strong><br />
Veranstaltungen <strong>de</strong>r Ämter für<br />
Katholische Religionspädagogik<br />
in <strong>de</strong>n Bezirken<br />
Frankfurt am Main<br />
07.10.2003, 08.30-16.00 Uhr<br />
Religionspädagogisches Amt <strong>de</strong>r EKHN<br />
Rechneigrabenstraße 10, Frankfurt am Main<br />
Studientag<br />
Religion und Gewalt<br />
Prof. Dr. Martin Stöhr; Dr. Ansgar Koschel; N. N.<br />
Anmeldung bis 30.09.2003<br />
14.10.2003, 08.30-13.00 Uhr<br />
Gemein<strong>de</strong>haus St. Josef, Rhaban-Fröhlich-Straße 18,<br />
Frankfurt-Eschersheim<br />
„In mir ist Licht und Schatten“<br />
Vom Umgang mit Gefühlen im Religionsunterricht<br />
Sabine Schumacher, Darmstadt<br />
AG Nord<br />
Anmeldung bis 10.10.2003<br />
17.11.2003, 08.30-13.00 Uhr<br />
Gemein<strong>de</strong>haus St. Wen<strong>de</strong>l, Altes Schützenhüttengässchen<br />
6, Frankfurt-Sachsenhausen<br />
Mit einer Verheißung unterwegs<br />
Gesten, Gebär<strong>de</strong>n, einfache Tänze für <strong>de</strong>n Religionsunterricht<br />
Beate Ben<strong>de</strong>l, Lie<strong>de</strong>rbach<br />
AG Süd und Ost<br />
Anmeldung bis 30.10.2003<br />
18.11.2003, 08.30-16.00 Uhr<br />
Winfriedhaus, Am Brunnengarten 9, Frankfurt-Kalbach<br />
Fortbildungstagung <strong>de</strong>r Religionslehrer/-innen an<br />
Son<strong>de</strong>rschulen im <strong>Bistum</strong> <strong>Limburg</strong><br />
Symbole erleben<br />
Glauben erfahren mit Hand, Kopf und Herz<br />
Prof. Dr. Klaus Schilling, Freiburg<br />
AG Son<strong>de</strong>rschule / Son<strong>de</strong>rschullehrer/-innen in <strong>de</strong>r Diözese <strong>Limburg</strong><br />
Anmeldung bis 07.11.2003<br />
18.11.2003, 08.30-13.00 Uhr<br />
Minna-Specht-Schule, Hans-Pfitzner-Straße 18, Frankfurt-Schwanheim<br />
„Die Sterntaler“ <strong>de</strong>r Brü<strong>de</strong>r Grimm – eine<br />
Nachfolgegeschichte<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
Wir vertonen ein Märchen mit einfachen Mitteln<br />
Musiklehrerin Ilse Best<br />
AG Höchst und West<br />
Anmeldung bis 14.11.2003<br />
Hochtaunus<br />
Religionspädagogische AG Bad Homburg<br />
Bischof-Ketteler-Haus, Dorotheenstraße 9, Bad Homburg<br />
jeweils Dienstag, 15.00-17.00 Uhr<br />
Im Spannungsfeld zwischen Macht und<br />
Ohnmacht – Facetten christlicher Ethik<br />
1. Termin: 23.09.2003<br />
Schwer verständliche Jesusworte: „Meint<br />
ihr, ich sei gekommen, um Frie<strong>de</strong>n auf die<br />
Er<strong>de</strong> zu bringen? Nein, sage ich, nicht Frie<strong>de</strong>n,<br />
son<strong>de</strong>rn Spaltung.“ (Lk 12.51)<br />
Dr. Sebastian Schnei<strong>de</strong>r<br />
2. Termin: 14.10.2003<br />
Religionslehrer/-in sein zwischen <strong>de</strong>n<br />
Stühlen: Christliche Frie<strong>de</strong>nsethik und<br />
schulisches Machtsystem<br />
Gerhard Hielscher<br />
3. Termin: 18.11.2003<br />
„Frie<strong>de</strong>n ist geil?!“ Christliche Frie<strong>de</strong>nsethik<br />
im Religionsunterricht – so aktuell<br />
wie nie!<br />
Christoph Diringer<br />
Religionslehrer/-innen aller Schulformen und Stufen<br />
Leitung: Christa Kuch / Birgit Wehner<br />
LAHN-DILL-EDER<br />
Ökumenischer Tag <strong>de</strong>r Religionspädagogik<br />
24.09.2003, 08.30-13.00 Uhr<br />
Konferenzhalle Kaiserstraße, Herborn<br />
Kin<strong>de</strong>rn das Wort geben<br />
Dozent: Rainer Oberthür, Katechetisches Institut Aachen
Rhein-Lahn / Westerwald<br />
(Rheinland-pfälzischer Bereich <strong>de</strong>s <strong>Bistum</strong>s <strong>Limburg</strong>)<br />
ILF-Nr. 22.708<br />
Ökumenischer Religionslehrertag<br />
10.09.2003, 09.30-16.00 Uhr<br />
Heime Scheuern, Nassau<br />
Das Entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ist unsichtbar<br />
Wie Kin<strong>de</strong>r und Jugendliche Religion verstehen.<br />
Prof. Dr. Lothar Kuld, Karlsruhe<br />
Religionslehrer/-innen aus Primarstufe und Sekundarstufe I<br />
(In Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>m Religionspädagogischen<br />
Amt <strong>de</strong>r EKHN, Nassau)<br />
ILF-Nr. 22.701<br />
Priesterhaus Berg Moriah, Simmern<br />
30.09.2003, 09.00-16.00 Uhr<br />
Herbst – Wer<strong>de</strong>n und Vergehen<br />
Einführung in das religionspädagogische Arbeiten<br />
nach „Klett-Kaufmann“ (Religionspädagogische<br />
Praxis)<br />
Elisabeth Kessels, Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Religionslehrer/-innen an Grund- und Son<strong>de</strong>rschulen<br />
Anmel<strong>de</strong>schluss: 19.09.2003<br />
ILF-Nr. 22.702<br />
07.10.2003<br />
Exkursion: Darmstadt<br />
Religionspädagogisches Forum<br />
Diverse Veranstaltungen mit Rainer Oberthür,<br />
Elisabeth Buk u. a.<br />
Details entnehmen Sie bitte einer geson<strong>de</strong>rten<br />
Einladung<br />
Religionslehrer/-innen aller Schularten und -stufen<br />
Anmel<strong>de</strong>schuss: 25.09.2003<br />
NNäähheerree AAuusskküünnffttee bei <strong>de</strong>n angegebenen ÄÄmmtteerrnn.. – AAnn-sscchhrriifftteenn<br />
uunndd TTeelleeffoonnnnuummmmeerrnn ssiieehhee aabb SSeeiittee 221188..<br />
Unsere Autorinnen und Autoren:<br />
Dr. Holger Dörnemann<br />
Rheinaustr. 239. 1, 53225 Bonn<br />
Museumsdirektor Dr. August Heuser<br />
Rauenthaler Weg 1, 60529 Frankfurt am Main<br />
StR’ Ute Lonny-Platzbecker<br />
Grebertstraße 2 b, 65307 Bad Schwalbach<br />
Dozent Thomas Menges<br />
Schwester-Zita-Weg 6, 52080 Aachen<br />
Franz-Günther Weyrich<br />
<strong>Limburg</strong>er Str. 52, 65555 <strong>Limburg</strong><br />
Unsere Rezensentinnen und Rezensenten:<br />
OStR. Helmut Bahr<br />
Auf <strong>de</strong>r Au 22, 56132 Dausenau<br />
Prof. Dr. Joachim Eckert<br />
Rotkehlchenweg 28, 67346 Speyer<br />
OR Dr. Gotthard Fuchs<br />
Steubenstr. 17, 65189 Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Lehrerin Gabriele Hastrich<br />
Kantstr. 6, 57627 Hachenburg<br />
Prof. Dr. Dietmar Höffe<br />
Moselweißer Straße 122-128, 56073 Koblenz<br />
Prof. Dr. Bernhard Jendorff<br />
Sandfeld 18 C, 35396 Gießen<br />
Dipl.-Theol. Dipl.-Religionspäd Rainer Jungnitsch<br />
Eichenweg 3, 64839 Münster<br />
Dipl.-Theol. Julia Knop<br />
Rölsdorfstr. 23, 53225 Bonn<br />
Prof. Dr. Ernst Leuninger<br />
Hubertusstr. 21, 65549 <strong>Limburg</strong><br />
StL i. K. Bernhard Merten<br />
Altheimstr. 18, 60431 Frankfurt am Main<br />
Prof. Dr. Joachim Schmiedl<br />
Berg Sion 1, 56179 Vallendar<br />
Dr. Sebastian S. Schnei<strong>de</strong>r<br />
Lin<strong>de</strong>nweg 4, 65817 Eppstein-Vockenhausen<br />
INFO 32 · 3/2003<br />
INFOS & AKTUELLES<br />
217
SONSTIGES<br />
218<br />
Dezernat Schule und Hochschule<br />
im Bischöflichen Ordinariat <strong>Limburg</strong> (<strong>Stand</strong>: <strong>01.09.2003</strong>)<br />
Roßmarkt 12 · 65549 <strong>Limburg</strong> · Postfach 1355 · Fon: 06431/295-235 · Fax: 06431/295-237<br />
E-Mail: schule@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong> · Internet: www.schule-und-hochschule.<strong>de</strong><br />
Abteilung I<br />
Leiter Dr. Eckhard Nordhofen (-234)<br />
Referat Grund-, Haupt- und Realschule Dipl.-Theol. Katharina Sauer (-360)<br />
Referat Religionspädagogische Aus- und Weiterbildung<br />
pastoraler MitarbeiterInnen und Geistlicher Burghard Förster (-438)<br />
Referat Grundsatzfragen Religionsunterricht Dipl.-Theol. Martin W. Ramb (-434)<br />
Referat Schriftleitung <strong>de</strong>r INFO für Religionslehrerinnen und Religionslehrer Dipl.-Theol. Martin W. Ramb (-434)<br />
Referat Hochschulen Dipl.-Theol. Martin W. Ramb (-434)<br />
Referat Stiftung Dey Dipl.-Theol. Martin W. Ramb (-434)<br />
Referat Son<strong>de</strong>rschulen Dipl.-Theol. Katharina Sauer (-360)<br />
Referat Schulpastoral Burghard Förster (-438)<br />
Sekretariat Sabrina Gilles (-424), Marianne Roos (-460), Jutta Stähler (-235)<br />
Abteilung II<br />
Leiter Dipl.-Theol. Andreas von Erdmann (-431)<br />
Referat Berufliche Schulen Dipl.-Theol. Andreas von Erdmann (-431)<br />
Referat Gestellungsverträge, Personal- und Haushaltsfragen Dipl.-Theol. Andreas von Erdmann (-431)<br />
Referat Katholische Schulen Dipl.-Theol. Andreas von Erdmann (-431)<br />
Abteilung III<br />
Leiter Studiendirektor i. K. Gerhard Hielscher (-430)<br />
Ämter für Katholische Religionspädagogik in Hessen und Rheinland-Pfalz,<br />
Referat Gymnasien, Gesamtschulen Studiendirektor i. K. Gerhard Hielscher (-430)<br />
Referat Schulelternarbeit Studiendirektor i. K. Gerhard Hielscher (-430)<br />
Referat Religionspädagogische Biblio- und Mediothek <strong>de</strong>s Dezernats Rosemarie Hansel (-435)<br />
Referat Diözesanbibliothek vakant<br />
Referat Verlag Birgit Höhler (-393)<br />
Referat <strong>Bistum</strong>sbibliothek vakant<br />
Sekretariat <strong>Bistum</strong>sbibliothek Gabi Gabb (-393)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Montag bbiiss Donnerstag 10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr. In <strong>de</strong>n FFeerriieenn nach AAbbsspprraacchhee..<br />
Ämter für Katholische Religionspädagogik<br />
in <strong>de</strong>n Bezirken (<strong>Stand</strong>: <strong>01.09.2003</strong>)<br />
Bezirk Frankfurt am Main<br />
Eschenheimer Anlage 20 (Dienstgebäu<strong>de</strong>)<br />
Eschenheimer Anlage 21<br />
60318 Frankfurt am Main (Postanschrift)<br />
Fon: 069/15011-79; Fax: 069/5975503<br />
E-Mail: relpaed.ffm@gmx.<strong>de</strong> Internet:<br />
www.kath.<strong>de</strong>/bistum/limburg/kma/hdv/rpa/in<strong>de</strong>x.htm<br />
Leiter: Schulamtsdirektor i. K. Peter Eberhardt (-78)<br />
Geschäftsführerin/Referentin für Religionspädagogik:<br />
Gemein<strong>de</strong>referentin Sabine Christe (-77)<br />
Gemein<strong>de</strong>referentin Ute Schüßler (-77)<br />
Leiter <strong>de</strong>r AG Berufsschulen:<br />
INFO 32 • 3/2003<br />
Berufsschullehrer Harald Sturm<br />
Sekretariat: Rita Merkel, Waltraud Schäfer (-79)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
In <strong>de</strong>r Schulzeit: Mo 14.00-18.00 Uhr; Di 12.30-16.30<br />
Uhr; Mi 16.00-18.00 Uhr; Do 9.00-12.00 Uhr und<br />
12.30-16.30 Uhr; Fr 9.00-12.00 Uhr;<br />
In <strong>de</strong>n Ferien auf Anfrage.<br />
Bezirk Hochtaunus<br />
Bischof-Ketteler-Haus<br />
Dorotheenstr. 9-11, 61348 Bad Homburg<br />
Fon: 06172/6733-0; Fax: 06172/20519
(Kath. Bezirksamt)<br />
Internet: www.kath-bezirksamt-hochtaunus.<strong>de</strong><br />
E-mail: kuch@kath-bezirksamt-hochtaunus.<strong>de</strong><br />
Leiterin: Dipl.-Päd. Christa E. Kuch (-22)<br />
Sekretariat: Hei<strong>de</strong>marie Behrens (-21)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Di - Do 12.30-16.00 Uhr und nach Vereinbarung,<br />
außer in <strong>de</strong>n Ferien<br />
Bezirk Lahn-Dill-E<strong>de</strong>r<br />
Bismarckstr. 13, 35683 Dillenburg<br />
Fon: 02771/80 08-0; Fax: 02771/80 08-17<br />
(Kath. Bezirksamt)<br />
E-Mail: relpaed.LDE@bistum-limburg.<strong>de</strong><br />
Leiterin: Dipl.-Theol. Beate Mayerle-Jarmer (-11)<br />
Sekretariat: Elvira Heinrich (-0)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Mo und Mi 8.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr<br />
Di und Do 8.00-12.00 Uhr; Freitag 8.00-11.00 Uhr<br />
Bezirk <strong>Limburg</strong><br />
Franziskanerplatz 3, 65589 Hadamar<br />
Fon: 06433/88 1-0 / 88 1-45; Fax: 06433/88 1-46<br />
E-Mail: relpaed.lm@bistum-limburg.<strong>de</strong><br />
Leiter: Rektor i.K. Franz-Josef Arthen (-44)<br />
Sekretariat: Gabi Heun (-45)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Mo und Mi 9.30-11.30 Uhr; Di und Do 13.30-16.30 Uhr<br />
Bezirk Main-Taunus<br />
Vincenzstr. 29, 65719 Hofheim<br />
Fon: 06192/2903-10; Fax: 06192/2903-26<br />
(Kath. Bezirksamt)<br />
E-Mail: relpaed.mt@bistum-limburg.<strong>de</strong><br />
Internet: www.kbzamt-mt.<strong>de</strong><br />
Leiter: Dipl.-Theol. Wolfgang Bentrup (-15)<br />
Christiane Krüger-Blum (-18)<br />
Sekretariat: Heidrun Garkisch (-16)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Zu <strong>de</strong>n Bürozeiten <strong>de</strong>s Bezirksamtes<br />
Mo - Do 9.00-16.00 Uhr; Freitag 9.00-13.00 Uhr<br />
In <strong>de</strong>n Ferien können die Öffnungszeiten nicht<br />
garantiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Bezirk Rheingau<br />
Zollstr. 8/1, 65366 Geisenheim<br />
Fon: 0 6722/5038-0; Fax: 06722/5038-18<br />
(Kath. Bezirksamt)<br />
E-Mail: rpa@kirche-rheingau.<strong>de</strong><br />
Leiter: Martin E. Musch-Himmerich (-23)<br />
Sekretariat: Marga Heine (-17)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Mo - Do 9.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr<br />
Bezirk Rhein-Lahn<br />
Gutenbergstr. 8, 56112 Lahnstein<br />
Fon: 02621/9406-40; Fax: 02621/9406-49<br />
(Kath. Bezirksamt)<br />
E-Mail: KBezirks@RZ-online.<strong>de</strong><br />
Leiter: Andreas Kollas ( - 40)<br />
Sekretariat: Eva-Margaret Kern ( - 13)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Mo - Fr 9.00-12.00 Uhr; Di 14.00-16.00 Uhr<br />
und nach telefonischer Vereinbarung<br />
Bezirk Untertaunus<br />
Mainzer Allee 38, 65232 Taunusstein<br />
Fon: 06128/9825-0; Fax: 06128/9825-86<br />
(Kath. Bezirksamt)<br />
E-Mail: bza-ut@gmx.<strong>de</strong> und rp-ut@gmx.<strong>de</strong><br />
Leiter: Martin E. Musch-Himmerich (- 80)<br />
Sekretariat: Helga Hornig (- 0)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Mo - Fr 8.30-11.30 Uhr; Di und Mi 14.30-16.30 Uhr<br />
und nach Vereinbarung<br />
Bezirk Westerwald<br />
Auf <strong>de</strong>m Kalk 11, 56410 Montabaur<br />
Fon: 02602/6802-0; Fax: 02602/6802-25<br />
(Kath. Bezirksamt)<br />
E-Mail: relpaed.ww@bistum-limburg.<strong>de</strong><br />
Leiter: Rektor i.K. Josef Weingarten ( - 23)<br />
Sekretariat: Gisela Roos ( - 22)<br />
Bibliothek: Rita Kurtenacker ( - 27)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Mo - Fr 10.00-12.00 Uhr; Mo und Do 14.30-16.30 Uhr<br />
In <strong>de</strong>n Ferien geschlossen<br />
Bezirk Wetzlar<br />
Kirchgasse 4, 35578 Wetzlar<br />
Fon: 06441/4 47 79-18; Fax: 06441/4 47 79-50<br />
(Kath. Bezirksamt)<br />
E-Mail: relpaed.wz@bistum-limburg.<strong>de</strong><br />
Internet: www.kath-bezirksamt-wetzlar.<strong>de</strong><br />
Leiter: Franz Günther Weyrich (-20)<br />
Sekretariat: Grazyna Andrzejewski (-18)<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Mo und Fr 8.30-12.00 Uhr; Di, Mi und Do 13.00-17.00 Uhr<br />
und nach Vereinbarung<br />
Bezirk Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Roncalli-Haus, Friedrichstr. 26-28, 65185 Wiesba<strong>de</strong>n<br />
Fon: 0611/174-0; Fax: 0611/174-122<br />
(Stadtsynodalamt)<br />
E-Mail: rpa@roncallihaus.<strong>de</strong><br />
Leiter: Dipl.-Theol. Stefan Herok (-112)<br />
Berufsschulseelsorge:<br />
Dipl.-Theol. Silvia Althofen-Dülz (-115)<br />
Sekretariat: Gisela Meffert (-113)<br />
Das Sekretariat ist Di - Fr von 10.00-12.00 Uhr besetzt.<br />
Öffnungszeiten <strong>de</strong>r Bibliothek und Mediothek:<br />
Mo 14.00-18.00 Uhr; Di und Fr 10.00-12.00 Uhr<br />
Mi 10.00-12.00 Uhr; 14.00-16.00 Uhr<br />
Do 10.00-12.00; 14.00-19.00 Uhr<br />
INFO 32 • 3/2003<br />
SONSTIGES<br />
219
„Die Präsenz ist <strong>de</strong>r Augenblick,<br />
<strong>de</strong>r das Chaos <strong>de</strong>r Geschichte<br />
unterbricht und<br />
daran erinnert o<strong>de</strong>r nur appelliert,<br />
dass ‘etwas da ist’,<br />
bevor das, was da ist, irgen<strong>de</strong>ine<br />
Be<strong>de</strong>utung hat.<br />
Das ist eine Vorstellung, die<br />
man mystische nennen<br />
kann.“<br />
ISSN 0937-8162<br />
Jean-François Lyotard<br />
INFO