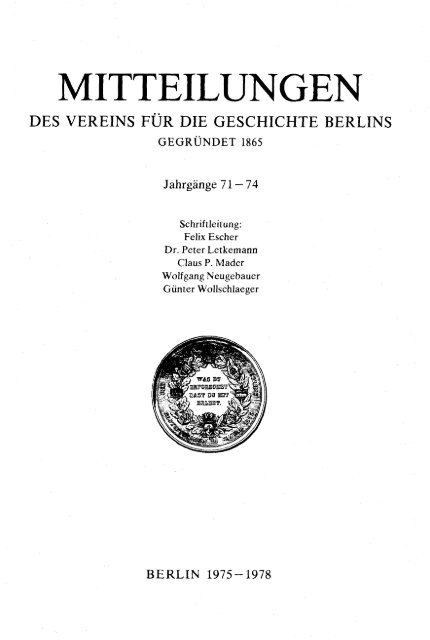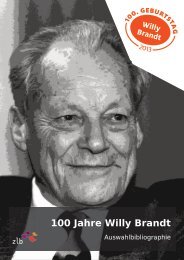Similar
Similar
Similar
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
Jahrgänge 71 — 74<br />
Schriftleitung:<br />
Felix Escher<br />
Dr. Peter Letkemann<br />
Claus P. Mader<br />
Wolfgang Neugebauer<br />
Günter Wollschlaeger<br />
BERLIN 1975-1978
Inhaltsverzeichnis<br />
I. Aufsätze<br />
Arendt, Max (t)<br />
Der Magistrats-Exekutor bei Bismarck<br />
Eine berlinische Episode (2 Abb.) 1<br />
Bader, Frido J. Walter<br />
150 Jahre Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin<br />
(2 Abb.) 480<br />
Bollert, Werner<br />
Tschaikowsky in Berlin<br />
(1 Abb.) 484<br />
Cornwall, James E.<br />
Die Geschichte der Photographie in Berlin<br />
Teil I: 1839-1900 (10 Abb.) 113<br />
Eckelt, Klaus<br />
Aus der Geschichte der Charlottenburger Luisenkirche und ihrer Gemeinde<br />
(4 Abb.) 281<br />
Erbe, Michael<br />
Ein Berliner Napoleon-Forscher: Friedrich M. Kircheisen (1877— 1933)<br />
(1 Abb.) 353<br />
Gustav Stresemann 1878-1929<br />
Zum Gedenken an seinen hundertsten Geburtstag am 10. Mai 1978 (2 Abb.) 401<br />
Funk-Bonardel, Käte<br />
Zum Gedenken an die Berliner Schauspielerin Jeannette Bethge<br />
(1875-1943)<br />
(1 Abb.) 96<br />
Gnewuch, Gerd<br />
Es begann in Berlin: Hundert Jahre Fernsprecher (1877— 1977)<br />
(5 Abb.) 333<br />
Grothe, Jürgen<br />
Am Beispiel Spandaus<br />
Der Versuch einer Gegenüberstellung 1975 (9 Abb.) 41<br />
Die Geschichte des alten Spandauer Nikolaikirchhofes<br />
(3 Abb.) 120<br />
Der jüdische Friedhof in Spandau im 19. und 20. Jahrhundert<br />
(2 Abb.) 185<br />
V
Grothe, Jürgen (Forts.)<br />
Zum Abriß des ehemaligen Garnison-Lazaretts in Spandau<br />
(2 Abb.) 314<br />
Bauliche Veränderungen an der Spandauer Zitadelle<br />
Zur Zerstörung von Teilen der historischen Bausubstanz<br />
(3 Abb.) 387<br />
Henning, Eckart<br />
Briefe und Tagebücher der Königin Luise<br />
im Brandenburg-Preußischen Hausarchiv<br />
Zur 200. Wiederkehr ihres Geburtstages am 10. März 1976 (4 Abb.) 141<br />
Hengsbach, Arne<br />
Wann fuhr der erste Omnibus in Berlin?<br />
Eine verkehrsgeschichtliche Studie (1 Abb.) 90<br />
Gewehrfabrik — Kirchenmeierei — Salzhof<br />
Ein altes Industriegebiet an der Havel (4 Abb.) 157<br />
Die Hauptstadt und die Havelstadt<br />
Berlin und Spandau in ihren wechselseitigen Beziehungen (4 Abb.) 375, 440<br />
Holzhausen, Hans-Dieter<br />
Gottlieb Fritz und die städtischen Bibliotheken Berlins<br />
(2 Abb.) 63<br />
Jessen, Hans B.<br />
Gerhart Rodenwaldt<br />
Archäolog und Berliner (1886-1945) (1 Abb.) 151<br />
Kliinner, Hans-Werner<br />
Ein hundertjähriges Buch und seine Vettern<br />
Zu Robert Springers „Berlin - die deutsche Kaiserstadt" (4 Abb.) 433<br />
Letkemann, Peter<br />
Kunstführer — Baubeschreibung — Inventarisation<br />
Zur Entwicklung der kunst- und architekturgeschichtlichen Bestandsaufnahme<br />
im Berliner Raum 235<br />
I.(i«enthat. Ernst G.<br />
Adolph Donath in Berlin<br />
Zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages (1 Abb.) 207<br />
Geschehen vor 40 Jahren<br />
Die Beschlagnahme des Logenhauses in der Kleiststraße 317<br />
Mader. Claus P.<br />
Theodor Hosemann zum Gedenken<br />
(4 Abb.) 81<br />
VI
Mader, Claus P. (Forts.)<br />
Adolph Glassbrenner (1810-1876)<br />
Zum Gedenken an seinen hundertsten Todestag (5 Abb.) 177<br />
In memoriam E.T. A. Hoffmann 214<br />
Meinik. Hans Jürgen<br />
Alfred Döblins Versuch der literarischen Verarbeitung<br />
eines Giftmordprozesses in Berlin 1923<br />
(4 Abb.) 465<br />
Mey, Hans Joachim<br />
Herman Grimm zum 150. Geburtstag<br />
6. Januar 1828 bis 16. Juni 1901 (1 Abb.) 407<br />
Mielke, Friedrich<br />
König Friedrich II. und seine Skizzen zum Schloß Sanssouci<br />
(4 Abb.) 127<br />
Oschilewski, Walther G.<br />
„Wahrheit und Freyheit"<br />
Die „Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen",<br />
1740 bis 1874 (1 Abb.) 24<br />
Zwischen Rokoko und Romantik<br />
Zum 250. Geburtstag von Daniel Chodowiecki (3 Abb.) 201<br />
Pierson, Kurt<br />
Louis Schwartzkopff zum 150. Geburtstag<br />
(2 Abb.) 70<br />
Hundert Jahre Orenstein & Koppel 1876— 1976<br />
(5 Abb.) 229<br />
Ein vergessenes Museum<br />
(3 Abb.) 348<br />
Richartz, Heinrich<br />
Die Geschichte der Vorinventarisation in Berlin<br />
und der „Beschreibung der Bau- und Kunstdenkmäler der Reichshauptstadt"<br />
in den dreißiger Jahren 240<br />
Rümmler, Gerhard<br />
Neugestaltung des U-Bahnhofs Richard-Wagner-Platz<br />
(11 Abb.) 412<br />
Schütze, Karl-Robert<br />
Charlotte Bara<br />
(2 Abb.) 320<br />
Vll
Sohnsdorf, Hartmut<br />
Künstlerische Objekte in den öffentlichen Grünanlagen Berlins<br />
Die „Denkmalkartei Berlin (West)" (2 Abb.) 244<br />
Stolzenberg, Ingeborg<br />
Heinrich von Kleist zum 200. Geburtstag<br />
Ein Ausstellungsbericht (1 Abb.) 369<br />
Theobald, Rainer<br />
„Melpomenens und Thaliens Günstling"<br />
Zum 200. Todestag des Schauspieldirektors H. G. Koch (4 Abb.) 17, 49<br />
Weiher, Sigfrid v.<br />
70 Jahre Siemens-Archiv Berlin-München<br />
(3 Abb.) 341<br />
Wentzel, Friedrich-Wilhelm<br />
„Ein ganz widerwärtiger Ort"<br />
Jacob Burckhardt (1818 bis 1897) über Berlin (2 Abb.) 449<br />
Wetzel, Jürgen<br />
Die Weingroßhändler-Familie Dalchow in Charlottenburg<br />
(3 Abb.) 28<br />
Das Landesarchiv Berlin<br />
(3 Abb.) 301<br />
Winter, Georg (t)<br />
Die Leitung der Preußischen Archivverwaltung<br />
Herausgegeben und ergänzt von Eckart Henning (9 Abb.) 308<br />
Wollschlaeger, Günter<br />
Karl Schmidt-Rottluff<br />
Zum Tode des großen Künstlers, Mäzens und Berliner Ehrenbürgers (1 Abb.) 209<br />
Zur Entwicklung Friedenaus<br />
(7 Abb.) 265<br />
II. Kleine Beiträge, Notizen,<br />
Berichte, Exkursionen<br />
250 Jahre Militärwaisenhaus zu Potsdam . 8 Stadtbezirksarchiv Pankow 167<br />
Vertrauenswerbung für Berlin 35 Franz-Neumann-Archiv 167<br />
Zehn Jahre „Mitteilungen" - Neue Folge 73 Berlin-Brunnen in München 167<br />
Die Porzellan-Plaketten der KPM Gymnasiast als Berlin-Botschafter 168<br />
1975'76 132 Themenheft „Städte + Landschaften" ... 188<br />
Die Dressel'sche Chronik von Charlotten- Ein Bachfest in Berlin 189<br />
bürg 166 Wiederaufbau am Gendarmenmarkt .... 189<br />
VIII
Um die Denkmalpflege in Ost-Berlin .... 190<br />
Der 21. Stadtbezirk Berlins<br />
Zur Denkmalspflege und Stadtplanung in<br />
218<br />
Ost-Berlin<br />
Das „Königin-Luise-Jahr'* 1976 im Rück<br />
256<br />
blick 257<br />
Autographen berühmter Berliner Autoren 258<br />
Der „Bär von Berlin", Band 25 258<br />
Landesarchiv Berlin in neuem Domizil . . . 259<br />
Die Visitenkarte der Post - 160 Jahre<br />
Poststempel in Preußen 291<br />
Umweltprobleme und Heimatschutz ....<br />
Schadow-Statue Friedrichs des Großen für<br />
292<br />
das Charlottenburger Schloß<br />
Historisches Archiv der Technischen<br />
324<br />
Fachhochschule Berlin<br />
Restaurierungsarbeiten an historischen<br />
324<br />
Bauten in Potsdam<br />
Denkmalschutz für das Holländische<br />
325<br />
Viertel in Potsdam 325<br />
Stadtteilschreiber in Hamburg 360<br />
Nachlese zur 15. Europäischen Kunstausstellung<br />
1977 „Tendenzen der zwanziger<br />
Jahre" 389<br />
Rund um den Tiergarten<br />
Edvard Munch - Der Lebensfries in Max<br />
418<br />
Reinhardts Kammerspielen<br />
Bismarek - Autographen im Geheimen<br />
418<br />
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz . . .<br />
Das Kaufhaus des Westens - ein Stück<br />
453<br />
Berliner Geschichte 455<br />
Zehn Jahre Humboldt-Zentrum Berlin . .<br />
Arbeiten zur Geschichte Berlins in Ost-<br />
456<br />
Berlin 457<br />
Spittel-Kolonnaden entstehen neu 457<br />
Europa Nostra 457<br />
Um den Döblin-Platz 487<br />
70 Jahre Märkisches Museum<br />
Dorfanger Friedrichsfeldc unter Denkmal<br />
488<br />
schutz 488<br />
110. Stiftungsfest des Vereins 34<br />
Studienfahrt 1974 nach Celle (Bericht) . . 7<br />
Studienfahrt 1975 nach Hann. Münden<br />
(Programm) 78<br />
(Bericht)<br />
Studienfahrt 1976 nach Duderstadt<br />
99<br />
(Programm) 199<br />
(Bericht)<br />
Studienfahrt 1977 ins Wendland<br />
217<br />
(Programm) 331<br />
(Bericht)<br />
Studienfahrt 1978 nach Goslar<br />
393<br />
(Programm)<br />
462<br />
(Bericht)<br />
Mitglieder-Jahreshauptversammlungen<br />
488<br />
(1975)73, (1976)188, (1977)323, (1978) 458<br />
III. Hinweise und Informationen<br />
Kleinere Mitteilungen:<br />
8, 35, 75, 100, 134, 168, 188, 189, 219,<br />
324,360, 393, 394, 398,419,454,457<br />
259.<br />
Veranstaitungskalender:<br />
16, 40, 80, 112, 140, 176, 200, 228, 264, 300,<br />
332, 368,400,432,464, 500<br />
Literaturhinweise:<br />
14, 15, 110, 111, 198, 226, 227, 367, 399,<br />
427,428,431,462,498,499<br />
IV. Personalien<br />
Würdigungen:<br />
Erich Borkenhagen 422<br />
Karl Bullemer 134<br />
Gertrud Doht 359<br />
Käte Haack 359<br />
Walter Hoffmann-Axthelm 421<br />
Walter Mügel 169<br />
Walther G. Oschilewski 325, 459<br />
Kurt Pomplun 74, 168<br />
Nachrufe:<br />
Alfred Braun 420<br />
Walter Jarchow 219<br />
Kurt Pomplun 357<br />
Walter Rieck 9<br />
Walter Schneider-Römheld 395<br />
Johannes Schultze 254<br />
P. F.-C. Wille 35<br />
Kurzmitteilungen:<br />
9, 36, 75, 100, 134, 135, 169, 190, 219, 220,<br />
259, 294,325, 360, 395,423,460,489,490<br />
Neue Mitglieder:<br />
15, 39, 79, 80, 111, 139, 175, 198, 227, 263,<br />
299,330, 366, 398,429,462,498<br />
IX
V. Buchbesprechungen<br />
Artelt/Heischkel-Artelt: Christian Mentzel<br />
u. der Hof des Großen Kurfürsten als<br />
Mittelpunkt weltweiter Forschung, 1976<br />
(Hoffmann-Axthelm) 396<br />
Atterbom: Reisebilder aus dem romantischen<br />
Deutschland, 1970 (Schultze-<br />
Berndt) 225<br />
Aust: Stadtgeographie ausgewählter Sekundärzentren<br />
in Berlin (West), 1970<br />
(Escher) 13<br />
Baar: Die Berliner Industrie in der industriellen<br />
Revolution, 1966/74 (Escher) .. 223<br />
Baedeker: Berlin-Spandau, 1977 (Escher) 494<br />
Bahnsen/O'Donnell: Die Katakombe,<br />
1975 (Escher) 193<br />
Bandel/Machule (Hrsg.): Die Gropiusstadt,<br />
1974 (Escher) 426<br />
Berlin - Chronik der Jahre 1957-1958,<br />
1974 (Letkemann) 36<br />
Berlin - Chronik der Jahre 1959- 1960,<br />
1978 (Letkemann) 490<br />
Berlin 1974 - Das Jahr im Rückspiegel,<br />
1974 (Letkemann) 101<br />
Berlin und seine Bauten, IV: Wohnungsbau,<br />
Bd. B u. C, 1974-75 (Wollschlaeger)<br />
102<br />
Berlin vor hundert Jahren, 1975 (Letkemann)<br />
197<br />
Berlin wie es lacht, 1971 (Schultze-<br />
Berndt) 174<br />
Berlin-Fibel, 1975 (Letkemann/Mader) . . 262<br />
Berlin-Literatur, 1976 (Letkemann) 220<br />
Berliner Abendblätter, 1973 (Nachdr.<br />
1810-1811/1925) (Mey) 171<br />
Berliner Malerpoeten, 1974 (Mader) .... 14<br />
Berliner Wände, 1976 (Schultze-Berndt) 329<br />
Berndal: Berliner Balladen, o.J.(Schultze-<br />
Berndt) 427<br />
Bethsold: Schöneberg - eine Gegend in<br />
Berlin, 1977 (Schultze-Berndt) 497<br />
Boeckh: Alt-Berliner Kirchen, 1975<br />
(Drese) 101<br />
Börsch-Supan: Marmorsaal und Blaues<br />
Zimmer, 1976 (Mader) 222<br />
Börsch-Supan/Kühne/Reelfs: Berlin -<br />
Kunstdenkmäler und Museen, 1977<br />
(Mader) 495<br />
Brandt: Begegnungen und Einsichten,<br />
1976 (Oschilewski) 326<br />
Braulich: Max Reinhardt, 1969 (Theobald)<br />
172<br />
Breitenborn: Berliner Wasserspiele, 1974<br />
(Schultze-Berndt) 77<br />
X<br />
Brinitzer: Die Geschichte des Daniel Ch.,<br />
1973 (Gießler) 361<br />
Brink: Es geschah in Berlin, 1970 (Mader) 78<br />
Carle: Das hat Berlin schon mal gesehn,<br />
1975 (Letkemann) 298<br />
Cauer: Oberhofbankier und Hofbaurat,<br />
1973 (Escher) 103<br />
Cornelsen: Gebaut in 25 Jahren - Berlin<br />
(West), 1973 (Schultze-Berndt) 107<br />
Das Wohnen und die Kirche, 1977<br />
(Escher) 364<br />
Dehnert: Daniel Chodowiecki, 1977<br />
(Letkemann) 493<br />
Denkler/Kittsteiner u. a.: Berliner Straßenecken-Literatur<br />
1848/49. 1977 (Escher) 425<br />
Deutscher Evangelischer Kirchentag Berlin<br />
1977 - Dokumente, 1977 (Krauß) ... 426<br />
Deutscher Planungsatlas, Bd. 9: Berlin<br />
(West), Lief. 1, 1975 (Escher) 328<br />
Döblin: Die Geschichte vom Franz Biberkopf,<br />
1976 - Ein Kerl muß eine Meinung<br />
haben, 1977 (Meinik) 492<br />
Döblin: Griffe ins Leben, 1974 (Meinik) 193<br />
Dörrier: Pankow, 1971 (Escher) 12<br />
Dronke: Berlin, 1974 (Mey) 136<br />
Duntze: Der Geist, der Städte baut, 1972<br />
(Escher) 364<br />
Enders: Historisches ürtslexikon f. Brandenburg,<br />
III, 1972 (Escher) 11<br />
Enders/Beck: Desgl., IV, 1976 (Escher) 295<br />
Engelmann: Heinrich Berghaus, 1977<br />
(Escher) 424<br />
Eschenburg/Frank-Planitz: Gustav Stresemann,<br />
1978 (Erbe) 494<br />
Fischer: Brandenburgisches Namenbuch,<br />
T. 4, 1976 (Escher) 295<br />
Fontane: Briefe aus den Jahren 1856 —<br />
1898, 1975 (Mader) 226<br />
Fontane: Reisebriefe vom Kriegsschauplatz<br />
Böhmen 1866, 1975 (Fricke) 75<br />
Friedrich: Weltstadt Berlin, 1973 (Letkemann)<br />
9<br />
Frommhold: Otto Nagel, 1974 (Schultze-<br />
Berndt) 224<br />
50 Jahre Wintergarten, 1975 (Nachdr.<br />
1938) (Mader) 106
Gelandet in Berlin, 1974 (Escher) 138<br />
Geschichte der Naturwissenschaften und<br />
der Technik im 19. Jh., 1970 (Escher) ... 173<br />
Gilbert (Hrsg.): Bankiers, Künstler und<br />
Gelehrte, 1975 (Lowenthal) 171<br />
Glaßbrenner: Altes gemütliches Berlin. -<br />
Wie war Berlin vergnügt, 1977 (Schultze-<br />
Berndt) 461<br />
Glaßbrenner: . . . ne scheene Jejend is det<br />
hier!, 1977 (Mader) 260<br />
Gottwaldt: Eisenbahn-Brennpunkt Berlin,<br />
1976 (Schiller) 196<br />
Grieben-Reiseführer Deutschland, Bd. 6:<br />
Berlin, 1973 (Escher) 104<br />
Groehler: Das Ende der Reichskanzlei,<br />
1976 (Schultze-Berndt) 329<br />
Grote: Berlin im Blickfeld der Philatelie,<br />
1975 (Schultze-Berndt) 197<br />
Grunewald-Chronik, 1974 (Lctkcmann) 78<br />
Hengsbach: Die Siemensstadt im Grünen,<br />
1974 (Escher) 108<br />
Herking: Das Beste aus meiner berlinerischen<br />
Witze- und Anekdotensammlung.<br />
1975 (Schultze-Berndt) 225<br />
Hermann: Kubinke, 1974 (Mey) 173<br />
Heym: 5 Tage im Juni, 1974 (Mader) ... 192<br />
Hilkenbach/Kramer/Jeanmaire: Berliner<br />
Straßenbahnen, 1973 (Schiller) 38<br />
Hilkenbach/Kramer/Jeanmaire: Berliner<br />
Straßenbahngeschichte II, 1977 (Schiller) 423<br />
Hitzig: Gelehrtes Berlin im Jahre 1825 /<br />
Büchner: Biographische und literarische<br />
Nachrichten . . ., 1973 (Nachdr. 1826/<br />
1834) (Escher) 365<br />
E. T. A. Hoffmann. Hrsg. von F. Schnapp,<br />
1974 (Mader) 261<br />
Hoff mann-Axthelm: Das abreißbare Klassenbewußtsein,<br />
1975 (Posener) 363<br />
Hofmeister: Berlin. Eine geographische<br />
Strukturanalyse, 1975 (Escher) 259<br />
Industrialisierung und Gewerbe im Raum<br />
Berlin-Brandenburg, Bd. 2. 1977 (Escher) 362<br />
Jaeger: Das Mittelrad-Damplschiff „Prinzessin<br />
Charlotte von Preußen" 1816,<br />
1977 (Schiller) 364<br />
Jaene: Kreuzpunkt Berlin, 1974<br />
(Mader) 77<br />
Jungmann (Hrsg.): Berliner Gassenhauer-<br />
Büchlein, 1977 (Schultze-Berndt) 497<br />
Kasmalski: Ein Berlin-Plan, 1973 (Wetzel) 135<br />
Kehrl: Berliner Kind, 1972 (Escher) 223<br />
Kladderadatsch, 1970 (Faks.-Nachdr.<br />
1848) (Mader) 104<br />
Kleberger: Berlin unterm Hörrohr, 1976<br />
(Hoffmann-Axthelm) 298<br />
Klünner: Potsdam - so wie es war, 1975<br />
(Escher) 260<br />
König: Mit Pille, Spritze und Skalpell,<br />
1975 (Hoffmann-Axthelm) 172<br />
Koner: Gelehrtes Berlin im Jahre 1845,<br />
1973 (Nachdr. 1846) (Escher) 365<br />
Kraus: Berlin zu Fuß, 1973 (Escher) 104<br />
Kuhn: Märkische Sagen und Märchen,<br />
1974 (Nachdr. 1843) (Mader) 105<br />
Lange: Berlin zur Zeit Bebeis und<br />
Bismarcks, 1972 (Escher) 298<br />
Lange: Das Wilhelminische Berlin, 1967<br />
(Escher) 298<br />
Lazarus/Steinthal - Die Begründer der<br />
Völkerpsychologie in ihren Briefen, 1971<br />
(Lowenthal) 109<br />
Lehnartz: Bilder aus der Mark Brandenburg,<br />
1975 (Escher) 296<br />
Liang: Die Berliner Polizei in der Weimarer<br />
Republik, 1977 (Escher) 361<br />
Löschburg: Ohne Glanz und Gloria, 1978<br />
(Schlenk) 496<br />
Ludwig Lewin und die Lessing-Hochschule,<br />
1975 (Lowenthal) 260<br />
Lundgreen: Techniker in Preußen während<br />
der frühen Industrialisierung, 1975<br />
(Escher) 137<br />
Machalet: Die Berliner Bezirksverwaltung,<br />
1973 (Wetzel) 10<br />
Märkisches Viertel Berlin - Plandokumentation,<br />
1972 (Escher) 426<br />
Mahncke: Berlin im geteilten Deutschland,<br />
1973 (Wetzel) ..". 135<br />
March - Ein schöpferischer Berliner<br />
Architekt an der Jahrhundertwende. 1972<br />
(Wollschlaeger) 137<br />
Mechow: Berliner Studenten. 1975<br />
(Escher) 195<br />
Mechow>: Die Ost- und Westpreußen in<br />
Berlin, 1975 (Letkemann) 326<br />
Mechow: Frohnau - die Berliner Gartenstadt,<br />
1977 (Schultze-Berndt) 424<br />
Melms: Chronik von Dahlem, 1978<br />
(Escher) 461<br />
Mendelssohn: Neuerschlossene Briefe an<br />
Friedrich Nicolai, 1973 (Stolzenberg) 105<br />
Mendelssohn-Studien, Bd. 2, 1975" (Stolzenberg)<br />
175<br />
Mühlenhaupt: Haus Blücherstraße 13.<br />
1976 (Schachinger) 261<br />
Mühlenhaupt: Ringelblumen, 1974 (Schachinger)<br />
107<br />
XI
Mühlenhaupt/Zerna: Inmitten von Berlin,<br />
1973 (Schachinger) 107<br />
Müller: Kampftage in Berlin, 1973<br />
(Meinik) 13<br />
Nagel: Die Gemälde und Pastelle. 1974<br />
(Schultze-Berndt) 224<br />
Neumann: Schwarzer Jahrmarkt. 1975<br />
(Oschilewski) 106<br />
Nicolas: Berlin zwischen gestern und<br />
heute, 1976 (Letkemann) 495<br />
Obst: Der Berliner Beichtstuhlstreit, 1972<br />
(Weichen) 297<br />
Oehlmann: Das Berliner Philharmonische<br />
Orchester, 1974 (Streu) 170<br />
Oschilewski: Ein Mann im Strom der Zeit<br />
- R. Timm, 1975 (Escher) 192<br />
Oschilewski: Zeitungen in Berlin, 1975<br />
(Mader) 220<br />
Pfankuch (Hrsg.): Hans Scharoun - Bauten.<br />
Entwürfe, Texte, 1974 (Wollschlaeger)<br />
39<br />
Pierson: Lokomotiven aus Berlin, 1977<br />
(Schiller) 295<br />
Polewoi: Berlin 896 km, 1975 (Escher) . . 193<br />
Polyglott-Reiseführer DDR, 1976<br />
(Schultze-Berndt) 261<br />
Reich (Hrsg.): Berlin, 1974 (Schultze-<br />
Berndt) 103<br />
Reinhardt: Schriften, 1974 (Theobald) . . 195<br />
Ribbe: Die Aufzeichnungen des Engelbert<br />
Wusterwitz, 1973 (Escher) 37<br />
Riha: Die Beschreibung der „Großen<br />
Stadt", 1970 (Meinik) 14<br />
Robinson: Berlin wie ich es liebe, 1976<br />
(Schultze-Berndt) 496<br />
Rohrlach: Historisches Ortslexikon für<br />
Brandenburg, V, 1977 (Escher) 423<br />
Ruland: Das war Berlin, 1972 (Letkemann)<br />
9<br />
Ryan: Der letzte Kampf. 1975 (Schultze-<br />
Berndt) 194<br />
Schattenriß von Berlin, 2 Teile 1974/75<br />
(Nachdr. 1788) (Mader) ;<br />
138<br />
Scherff: Luftbrücke Berlin, 1976 (Escher) 197<br />
Schinkel: Berlin-Bauten und Entwürfe,<br />
1973 (Escher) 495<br />
Schmädeke: Das Fernsehzentrum des<br />
SFB, 1973 (Escher)<br />
Schmidt/Mehring: Neuestes gelehrtes<br />
139<br />
Berlin, 1973 (Nachdr. 1795) (Escher) ... 365<br />
XII<br />
Schneidereit: Paul Lincke und die Entstehung<br />
der Berliner Operette, 1974<br />
(Streu) 37<br />
Schreckenbach: Bibliographie zur Geschichte<br />
der Mark Brandenburg, III und<br />
IV, 1972/74 (Escher) 170<br />
Schröter: Alfred Döblin, 1978 (Meinik) . . 492<br />
Schulze: Otto Braun oder Preußens demokratische<br />
Sendung. 1977 (Neugebauer) 491<br />
Scurla: Begegnungen mit Rahel, 1971<br />
(Mey) '. 13<br />
Sichelschmidt: Berliner Originale, 1974<br />
(Wirsig) 77<br />
Sichelschmidt (Hrsg.): Berlin 1900, 1977<br />
(Escher) 397<br />
Sichelschmidt: Berlin in alten Ansichtskarten,<br />
1975 (Schultze-Berndt) 327<br />
Sichelschmidt: Berühmte Berliner, 1973<br />
(Wirsig) 12<br />
So schön ist Berlin: Aus der Luft . . .,<br />
o.J. (Schultze-Berndt) 427<br />
Sperlich/Börsch-Supan: Schloß Charlottenburg<br />
- Berlin - Preußen, Festschrift<br />
für M. Kühn. 1975 (Wollschlaeger) 191<br />
Springer: Berlin, 1976 (Nachdr. 1861)<br />
(Letkemann) 396<br />
Stahl/Wien: Berlin von 7 bis 7, 1974/75<br />
(Schultze-Berndt) 38<br />
Sticker: Agnes Karll, 1977 (Stürzbecher) 297<br />
Stresemann: Schriften, 1976 (Erbe) .... 494<br />
Stützle: Kennedy und Adenauer in der<br />
Berlin-Krise 1961-62, 1973 (Wetzel) ... 135<br />
Tümmers (Bearb.): Kataloge und Führer<br />
der Berliner Museen, 1975 (Mader) .... 174<br />
Volk: Berlin [Ost] . . ., Historische Straßen<br />
und Plätze heute, 1973 (Letkemann) 11<br />
Weber: Die jungen Götter, 1974 (Mader) 174<br />
v. Weiher: Berlins Weg zur Elektropolis,<br />
1974 (Escher) 108<br />
Werner: Stadtplanung Berlin. T. I, 1976<br />
(Escher) 221<br />
Wille: Berliner Landseen, 1974 (Escher) 76<br />
Wolf: Unter den Linden, 1974 (Mader) . . 76<br />
Zimelien. Abendländische Handschriften<br />
(Katalog). 1975 (Letkemann) 222<br />
Zisterzienser-Studien, Bd. I, 1975 (Wollschlaeger)<br />
328<br />
Zivier: Der Rechtsstatus des Landes<br />
Berlin, 1974 (Wetzel) 135<br />
Zuckerrohr, Über das - und seine Verarbeitung,<br />
1977 (Nachdr. 1720) (Schultze-<br />
Berndt) 425
•<br />
A 20 377 F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
71.Jahrgang Heft 1 Januar 1975<br />
Wilhelmstraße 76, ein Teil des Auswärtigen Amtes<br />
1862 bis 1875 Bismarcks Amtswohnung (Foto: Hürlimann)
Der Magistrats-Exekutor bei Bismarck<br />
Eine berlinische Episode<br />
Von Dr. Max Arendt f<br />
Vorbemerkung: Der Text dieses Artikels stammt aus dem Nachlaß des 1971 verstorbenen<br />
früheren Direktors der Berliner Ratsbibliothek. Im Jahre 1942 erfolgte ein Abdruck<br />
in der „Frontzeitung der Reichshauptstadt Berlin", Hauptverwaltung, Nr. 3. Da diese<br />
Veröffentlichung kaum noch zugänglich oder auch bekannt sein dürfte, erscheint eine<br />
Wiedergabe gerechtfertigt. Neben geringfügigen Korrekturen wurden in den Anmerkungen<br />
zusätzliche Erläuterungen gegeben. Die Schriftleitung<br />
Daß Otto von Bismarck im Bundeskanzlerpalais - Wilhelmstraße 76 - keineswegs nur<br />
frohe, sorgenfreie Tage verlebt hat, ist hinlänglich bekannt. Viele Gegner haben sich nach<br />
Kräften bemüht, ihm das amtliche Leben schwer zu machen. Selten mit Erfolg, denn der<br />
Angegriffene wußte das Florett oder, wenn es sein mußte, auch den Pallasch meisterhaft<br />
zu führen und mit der Abwehr den Angriff zu verbinden.<br />
Auch der Berliner Magistrat, vielmehr seine „Servis- und Einquartierungsdeputation",<br />
hat Bismarck einmal Fehde angesagt. Diese Feststellung ergibt sich aus einem Aktenheft,<br />
das nach langen Jahren kürzlich im Antiquariatshandel aufgetaucht und als Geschenk<br />
des Ratsherrn Justizrat Dr. Reinhard Neubert an seinen Ursprungsort, das „Berlinische<br />
Rathaus", zurückgekehrt ist.<br />
Das Studium dieser Akten, die mehrere Schreiben mit Bismarcks eigenhändiger Unterschrift<br />
enthalten, ist ebenso interessant wie lehrreich, vor allem unter dem Gesichtswinkel:<br />
wie man es nicht machen soll.<br />
Das Konvolut - bei der Makulierung anscheinend aus dem Aktenbande entnommen, so<br />
daß die berühmten „Vorgänge" schmerzlich entbehrt werden müssen -, beginnt mit<br />
einer Eingabe des Legationsrats von Bismarck-Bohlen* vom August 1869 an die erwähnte<br />
Deputation und enthält eine Beschwerde über unrichtige Einstufung des Ministerpräsidenten<br />
zur Gemeindeeinkommensteuer; Graf Bismarck sei in die 30. Stufe eingeschätzt,<br />
sein Einkommen rechtfertige aber nur die Einstufung in die 28. Stufe. Sein Gehalt bestehe<br />
aus 12 000 Talern für Preußen, 4000 für Lauenburg, 2000 für die Dienstwohnung, in<br />
Summa 18 000 Talern, wovon noch Stempelgebühren in Höhe von 15 Talern in Abzug<br />
zu bringen seien. Das Privatvermögen des Bundeskanzlers entziehe sich der Berliner<br />
Besteuerung, weil es als Betriebskapital für die Bewirtschaftung der Güter diene und<br />
seiner Natur nach so wechselnd sei, daß sein Betrag mit einiger Sicherheit nicht angegeben<br />
werden könne. Im Auftrag des Ministerpräsidenten beantragte der Legationsrat die<br />
Berichtigung der Einstufung und die Zurückerstattung der zuviel gezahlten Beträge.<br />
1 Karl Graf von Bismardc-Bohlen (1832-1878), der Sohn eines Vetters von Otto v. Bismarck.<br />
Abb. S. 3 Einkommensteuerbesdieid für Bismardt auf das Jahr 1866<br />
(Geh. Staatsarchiv Berlin, Rep. 94 Nr. 331)<br />
2
.,V . tftfVC beg aotaftcrä.<br />
ICiefe stummw ift in «Ben
Im Rathause fragte man beim staatlichen Einkommensteuerbüro an und erhielt die Auskunft,<br />
Graf von Bismarck sei mit einem Einkommen von 12 000 Talern zur 18. Staatseinkommensteuerstufe<br />
veranlagt. Auch über seine Güter und ihren Ertrag wußte das<br />
Büro genauestens Bescheid. Graf Bismarck besäße im Kreise Naugard das Rittergut<br />
Kniephof mit 2161 Morgen, im Kreise Jerichow das Gut Schönhausen mit 1361 Morgen,<br />
im Kreise Schlawe das Rittergut Varzin mit 9204 Morgen sowie die Güter Wussow mit<br />
3441 und Wendisch-Puddigen mit 9460 Morgen; der Ertrag der Güter wurde mit 14 20C<br />
Talern, die Hypothekenschulden mit 149 200 Talern zu 5 v. H., 22 625 Talern zu 4<br />
v. H. angegeben.<br />
Daraufhin wurde im Rathause ein Antwortschreiben aufgesetzt, das zunächst die fehlende<br />
Vollmacht des Herrn Legationsrats höflich bemängelte und dann genauestens nachwies,<br />
daß von einer Zurückzahlung zuviel gezahlter Beträge keine Rede sein könne, Graf<br />
Bismarck vielmehr pro Vierteljahr 48 Taler nachzuzahlen habe, was zu veranlassen Seine<br />
Exzellenz ergebenst ersucht wurde. Nun griff der Ministerpräsident selbst in die Debatte<br />
ein. Das seine Unterschrift tragende Schreiben vom 28. September 1869 bestreitet die<br />
rathäusliche Auffassung der Sachlage und weist seinerseits nach, daß 42 Taler Steuern<br />
überzahlt seien, da man im Rathause die Bestimmung nicht beachtet hätte, daß Beamte<br />
- zu ihnen rechne auch der Ministerpräsident - nur die Hälfte des ermittelten Steuerbetrages<br />
zu zahlen verpflichtet seien. Die Einstufung zur Staatseinkommensteuer sei 1868<br />
ungefähr richtig gewesen, aber heute nicht mehr. „Ich habe", so lautet der Schlußabsatz<br />
des Schreibens, „seitdem das verpachtet gewesene Gut Kniephof verkauft und für den<br />
Ertrag, mit Einschluß meines früheren Kapitalvermögens, das größere, bisher aber ertraglose<br />
Gut Seelitz und mehrere kleinere Besitzungen angekauft, auch das frühere Pachtgut<br />
Misdrow mit einem Aufwände von 20 000 Talern in eigene Administration nehmen<br />
müssen. Diese Erwerbungen haben mein Kapitalsvermögen absorbiert, und kosten zur<br />
Zeit mehr als sie einbringen. Für 1870 werde ich daher auch hinsichtlich der Staatssteuer<br />
eine geringerte Einschätzung beantragen."<br />
Man kann sich unter dem Eindruck dieser Ausführungen des beklemmenden Eindrucks<br />
nicht erwehren, daß Bismarck im Herbst 1869 schon seine privaten Sorgen gehabt haben<br />
muß; mit restlos „absorbiertem" Privatvermögen Besitzer oder Pächter von Gütern, die<br />
nichts einbrachten, sondern nur kosteten, und dann noch die hohen Gemeindesteuern, auf<br />
deren pünktlicher Zahlung das Rathaus unerbittlich bestand!<br />
Ob für 1870 der beabsichtigte Antrag auf Herabsetzung der Staatseinkommensteuer gestellt<br />
worden ist, geht aus dem Aktenheft nicht hervor. Aus dem Jahre 1869 datiert noch<br />
ein Schreiben der Servisdeputation, das in der Wilhelmstraße sicher Überraschung ausgelöst<br />
hat: es waren tatsächlich 24 Taler Gemeindeeinkommensteuer überzahlt, deren<br />
Abhebung zu veranlassen Seiner Exzellenz ergebenst anheimgestellt wurde. Aber dann!<br />
Vermutlich hat Bismarck über die Ereignisse des Sommers 1870 den ganzen verwickelten<br />
Steuerkomplex vergessen. Im Schlachtendonner von Sedan war die französische Kaiserkrone<br />
zerbrochen, Bismarck hatte bei Donchery die bekannte Unterredung mit Napoleon<br />
gehabt. Am 10. September 1870 befand er sich in Reims und hatte die Nachricht<br />
erhalten, daß in Paris die Republik ausgerufen worden sei. In Berlin aber hatte am Vormittag<br />
dieses Tages der Exekutor Schmidt in der Wilhelmstraße 76 10 Taler rückständige<br />
Mietssteuer einkassieren wollen, hatte jedoch die Zahlungsaufforderung nicht „präsentieren"<br />
können, „weil", wie sein Aktenvermerk lautet, „der Herr Graf mit ins Feld gerückt<br />
ist und die Frau Gräfin nach Nauheim zur Pflege Ihres Sohnes abgereist ist (Graf Her-<br />
4
ert Bismarck war bei Mars la Tour verwundet worden und lag nun in Nauheim). 2 Laut<br />
Aussage des Portiers ist Niemand beauftragt, die Miethssteuer zu entrichten".<br />
Es wird ewig zu bedauern sein, daß der Wortlaut dieser Unterredung zwischen dem<br />
Exekutor Schmidt und dem bestallten Hüter des Hauses Wilhelmstraße 76 nicht der<br />
Nachwelt überliefert worden ist! Die Servis- und Einquartierungsdeputation aber war<br />
nun vor die schwierige Frage gestellt, wie und von wem die 10 Taler Mietssteuer einzuziehen<br />
seien. Es fand sich der Ausweg, der sich dem Vernehmen nach früher in Amtsstuben<br />
in schwierigen Situationen bestens bewährt haben soll, ein Verfahren, das auch<br />
Bismarck selbst nicht unbekannt gewesen und von ihm als „dilatorisch" bezeichnet worden<br />
ist: man legte die Sache auf Termin, „Wiedervorlage nach sechs Wochen". Dieses<br />
nützliche Verfahren hat noch einige Male wiederholt werden müssen, bis am 5. Mai 1871,<br />
nach Eingang der Zahlung, die Unterschrift des Dezernenten unter die ad-acta-Verfügung<br />
gesetzt werden konnte.<br />
Inzwischen war Bismarck Fürst, Kanzler des von ihm geschaffenen deutschen Kaiserreiches<br />
und, am 16. März 1871, Ehrenbürger der jungen Reichshauptstadt geworden.<br />
Aber mit der pünktlichen Zahlung seiner Mietssteuer hat es auch weiterhin gehapert. Am<br />
1. August 1871 war wieder der Exekutor Schmidt aus der Scharrenstraße 12 in der Wilhelmstraße<br />
76 mit einer Mahnung über 10 Taler rückständiger Mietssteuer zuzüglich<br />
4 Silbergroschen Mahngebühren erschienen. Der Mahnzettel - Fol. 53 Nr. 105 - enthielt<br />
die Aufforderung, „den Rückstand binnen 8 Tagen in den Vormittagsstunden von 9 bis<br />
IV2 Uhr an die Restbuchhalterei im Berlinischen Rathaus, Parterre, Zimmer Nr. 5 und 6,<br />
bei Vermeidung der Pfändung und der sonst zulässigen Zwangsmittel zu zahlen". Auch<br />
diese Mahnung ist an dem Portier des Reichskanzlerpalais abgeprallt, sie ist nicht zu<br />
„präsentieren" gewesen, wie Exekutor Schmidts Aktenvermerk lautet, da „derselbe<br />
(= Seine Durchlaucht) sich außerhalb Berlins befindet und für denselben keiner beauftragt<br />
ist, die Zahlung zu leisten". Wieder mußte das dilatorische Verfahren angewendet<br />
werden, ohne daß aus den Akten zu erkennen wäre, ob es zum Erfolg geführt hat.<br />
„Derselbe", nämlich Fürst und Ehrenbürger Bismarck, war inzwischen selbst im Rathause<br />
erschienen, zwar nicht im Parterre, Restbuchhalterei, Zimmer 5 und 6, sondern in<br />
den Repräsentationsräumen des soeben fertiggestellten neuen städtischen Prachtbaus. Am<br />
17. April 1871 hatten die städtischen Körperschaften im Rathaus den Mitgliedern des<br />
jungen deutschen Reichstages einen festlichen Empfang gegeben, zu dem mit dem Kaiserhause<br />
alles erschienen war, was in Berlin Rang und Namen hatte, alle überragend Fürst<br />
Bismarck in seiner Kürassieruniform. Kochhann, der damalige Stadtverordnetenvorsteher<br />
und spätere Ehrenbürger Berlins, beschrieb in seinen Erinnerungen dieses Fest ausführlich<br />
und fügte zum Schluß hinzu, Fürst Bismarck habe seine Vorliebe für gutes bayerisches<br />
Bier offensichtlich zu erkennen gegeben und selbst die feinsten Weine verschmäht. 3<br />
Bei dem guten bayerischen Trunk im strahlend erleuchteten Festsaal dachte der Ehrenbürger<br />
Berlins vermutlich nicht mehr an sein offenes Konto in Zimmer 5 und 6 des Erdgeschosses.<br />
Aber die Steuer- und Einquartierungsdeputation war sich der Tatsache völlig<br />
bewußt, daß Ehrenbürger nach der Städteordnung von 1853 keineswegs ihrer Steuer-<br />
2 Es ist nicht ersichtlich, ob diese Beifügung in Klammern so im Aktenvermerk enthalten war<br />
oder vom Verfasser eingesetzt worden ist.<br />
3 Heinrich Eduard Kochhann, Aus den Tagebüchern, hrsg. von Albert Kochhann, Teil 5:<br />
„Aus der großen Zeit 1862-1874", Berlin 1908, S. 66 ff. Siehe auch J. J. Hässlin, Berlin.<br />
5. Aufl. München 1971, S. 46 f.<br />
5
pflichten ledig waren, und bearbeitete das Konto ,14 110 Bi' unbeirrt weiter. Man hatte<br />
nach vielem Hin und Her zwischen den einzelnen Steuerbüros den Fürsten doch in der<br />
28. Stufe der Gemeindeeinkommensteuer belassen und sah nun, wie das Schreiben vom<br />
18. Dezember 1871 lautet, einer Restzahlung von 30 Talern für 1871 entgegen. Fürst<br />
Bismarck war keineswegs gesonnen, dieser im Rathaus gehegten Erwartung zu entsprechen.<br />
In einem längeren, sechs Folioseiten umfassenden Schreiben vom 2. Weihnachtsfeiertage<br />
1871 bestritt er die Veranlagung in die 28. Stufe als den Gesetzen widersprechend.<br />
Sein steuerbares Diensteinkommen bestehe aus 12 000 Talern Gehalt und 2000<br />
Talern Mietwert der Amtswohnung; die Gesamtsumme von 14 000 Talern gehört in<br />
Steuerstufe 27. Außerdem sei das Gesetz vom 11. Juli 1822 nicht beachtet worden; es<br />
bestimme, daß das Diensteinkommen der Staatsdiener bei einer Gemeindeeinkommensteuer<br />
nur mit der Hälfte zur Quotisierung gebracht werden sollte. „Ich bin jetzt noch<br />
Preußischer Minister-Präsident und Preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten,<br />
und in meinem Gehalt als Reichskanzler, welches um nichts höher ist als das<br />
Diensteinkommen, welches ich vor Errichtung des Norddeutschen Bundes resp. des Deutschen<br />
Reiches bezog, ist für die verschiedenen Functionen, welche ich zu erfüllen habe,<br />
keine Unterscheidung oder Sonderung möglich." Bismarck schloß mit einer Aufstellung,<br />
nach der 145 Taler Gemeindeeinkommensteuer von ihm überzahlt worden seien.<br />
Da die Steuerdeputation auf ihrem ablehnenden Standpunkte verblieb, beantragte Bismarck<br />
am 3. Februar 1872, seine Reklamation vom 26. Dezember der Regierung in Potsdam<br />
zur Entscheidung zu übersenden. Er fügte hinzu, daß er seit dem 1. Januar als<br />
Minister für Lauenburg kein Gehalt mehr beziehe und sein Vorgehen alle in gleicher<br />
Lage befindlichen Beamten des Auswärtigen Amtes umfasse.<br />
Das Verhalten der Steuerdeputation in dieser Streitsache ist nicht recht verständlich.<br />
Sie befleißigte sich in ihren Entgegnungen zwar eines sehr höflichen Tones, lehnte aber<br />
ein Eingehen auf die Darlegungen des Fürsten mit Hinweisen auf Bestimmungen und<br />
Regulative ab, die ihren Standpunkt zu stützen schienen; dem Antrag des Fürsten, seine<br />
Reklamation vom 26. Dezember der Potsdamer Regierung zur Entscheidung weiterzuleiten,<br />
wurde nicht stattgegeben, da eine nicht fristgemäß im Rathause eingegangene<br />
Reklamation nicht als solche, sondern nur als „Remonstration" betrachtet werden könnte.<br />
Dies Verhalten führte jedoch in die Sackgasse. Eine - nicht in den Akten erhaltene -<br />
Entscheidung des Ministers des Innern bestätigte die Anschauung Bismarcks, daß für die<br />
Besteuerung der Staatsdiener das Gesetz vom 11. Juli 1822 bindende Kraft hätte. Daraufhin<br />
erfolgte eine Einstufung Bismarcks in die Steuerstufe 27 und die Rückzahlung der<br />
überhobenen Beträge an Gemeinde- und Mietssteuern von zusammen 130 Talern.<br />
Damit endete der Schriftwechsel zwischen Bismarck und den städtischen Steuerdeputationen.<br />
Mit einer Anfrage bei der Staatlichen Steuer-Einschätzungskommission nach den<br />
Kriterien, nach denen die Heranziehung des Fürsten zur Staatseinkommensteuer 1873<br />
erfolgen würde, schließt der erhaltene Aktenfaszikel.<br />
Das Intermezzo mit den Steuerdeputationen hat Bismarcks Verhältnis zu Berlin nicht<br />
getrübt. Nach dem Ausscheiden aus seinen Ämtern hat der Altreichskanzler auf der<br />
Durchreise durch Berlin Studenten, die ihm huldigend zujubelten, geschildert, was Berlin<br />
ihm in seinem Leben bedeutet habe, und hat seine kurze Ansprache mit den Worten beendet:<br />
„Berlin ist mir jetzt über den Kopf gewachsen, wirtschaftlich und politisch. Politisch<br />
bin ich ja vielleicht in manchen Beziehungen mit der Mehrheit der Berliner auseinandergekommen,<br />
aber mein Heimatgefühl für Berlin und seine Umgebung ist immer<br />
6
dasselbe geblieben. Ich bin ein alter Kurbrandenburger. Und unsere Stadt Berlin, der<br />
ich den größten Teil meines Lebens als Bürger angehörte, sie mag werden, wie sie will -<br />
ich wünsche ihr Gedeihen und Wohlergehen. Sie lebe hoch!" 4<br />
4 Vollständiger Text u.a. in: Die politischen Reden des Fürsten Bismarck, hrsg. von Horst<br />
Kohl, Bd. 13, Stuttgart/Berlin 1905, S. 265 f.<br />
Nachrichten<br />
Studienfahrt nach Celle<br />
Es war ein Doppeldecker-Reiseomnibus, der dazu noch ein Dortmunder Kennzeichen hatte und<br />
vor der falschen Bank parkte, der die mehr als 70 Teilnehmer an der Studienfahrt 1974 unseres<br />
Vereins am Freitag, 6. September 1974, einlud. Zwar machte sich bei der Ankunft in Celle die<br />
Enge der mittelalterlichen Stadt mit ihren heutigen Verkehrsproblemen bei der Aufteilung der<br />
Gäste auf die vier Hotels bemerkbar, doch fanden sich alle pünktlich zur Besichtigung des<br />
Bomann-Museums ein. Frau Dr. Ingeborg Wittichcn war eine ebenso sachkundige wie aufgeschlossene<br />
Führerin durch die Schätze ihres Museums, wobei sie von Oberaufseher Meier<br />
assistiert wurde. Hatte man auf diese Weise mit der Vergangenheit Celles und seines Umlandes<br />
Fühlung aufgenommen und Historie, Heimatkunde, Volkskunde, aber auch Militärgeschichte<br />
kennengelernt, so führten die Besuche im Gartenbaubetrieb H. Wichmann, dem größten Orchideen-Züchter<br />
Europas, und im Niedersächsischen Landgestüt in die Bereiche der belebten Natur.<br />
Niemand ließ aber die abendliche Aufführung der Komödie „Was ihr wollt" von William<br />
Shakespeare im traditionsreichen Schloßtheater Celle aus, die sich als ein sehr munteres Spiel<br />
offenbarte, bei dem die Heiterkeit auch freundliche Pannen einbezog (ein gezogener Degen, bei<br />
dem die Klinge in der Scheide steckenblieb).<br />
Am nächsten Tage war es Museumsdirektor Dr. Dieter-Jürgen Leister einer Erkrankung wegen<br />
leider nicht möglich, die Führung durch das Schloß Celle selbst zu übernehmen. Die beiden<br />
Schloßführer entledigten sich ihrer Aufgabe aber kenntnisreich und ohne jeden Anflug von<br />
Routine. Zur Exkursion zu den Klöstern Wienhausen und Isenhagen und zur Fahrt in das<br />
Niederungsgebiet der Oberaller stieg Stadtarchivar a. D. Dr. Jürgen Ricklefs in das doppelstöckige<br />
Gefährt. In Wienhausen feierten manche Reisende Wiedersehen mit diesem mittelalterlichen<br />
Kleinod, andere zeigten sich beim ersten Besuch nicht minder begeistert. Es lag nicht am<br />
Mittagessen, sondern an der mangelnden Tragfähigkeit einer Brücke, wenn die Teilnehmer vor<br />
der Weiterfahrt nach Hankensbüttel noch einmal den Omnibus verlassen mußten. Das viel zu<br />
wenig bekannte Kloster Isenhagen, unter der jungen Äbtissin von Oertzen jetzt aus einer Art<br />
Dornröschenschlaf erwacht, braucht sich hinter der vornehmeren Schwester Wienhausen nicht zu<br />
verstecken, was die Freundlichkeit und Ausführlichkeit anbelangte, mit der die Stiftsdamen<br />
ihren Lebensbereich vorführten. Eine Kaffeetafel in Hankensbüttel, ein Besuch der dortigen<br />
Kirche sowie schließlich noch eine abendliche Besichtigung der Dorfkirche zu Eidingen beschlossen<br />
diesen erlebnisreichen Tag. Pfarrer Opitz verstand es, seine Gäste so von seinem Gotteshaus<br />
einzunehmen, daß Mitreisende nach dem Abschied spontan den Wunsch äußerten: „Hier hätten<br />
wir eine Andacht halten sollen!" Wenn uns in Celle auch niedersächsischer Landregen empfing,<br />
so beeinträchtigte dies die Stimmung des großen runden Tisches keineswegs, der sich im Ratskeller<br />
zusammengesetzt hatte.<br />
Am Sonntagmorgen führte ein Lichtbildervortrag des jungen Architekten Hild vom Planungsamt<br />
der Stadt Celle in die Probleme ein, deren sich ein vitales Gemeinwesen gegenübersieht,<br />
wenn es dem Menschen dienen, Vergängliches bewahren und Künftiges vorbereiten will. Gerade<br />
am Beispiel einer solchen übersehbaren Stadt, die das Geschehen des letzten Weltkrieges überlebt<br />
hat, vermochte man Aufgaben der Stadtplanung und -Sanierung zu erkennen und zu würdigen.<br />
Der ansdiließende Stadtrundgang litt etwas unter der großen Zahl der Mitreisenden und dem<br />
unterschiedlichen Schrittmaß, doch fanden sie sich in der erst vor wenigen Monaten neu geweihten<br />
Synagoge an versteckter Stelle wieder ein, um sich vom amtierenden Rabbiner in die Ge-<br />
7
schichte des Hauses und in den Kult einweisen zu lassen. In der Stadtkirche Celle konnte man<br />
Superintendent Manzke zu diesem Gotteshaus und seiner baulichen Neugestaltung nur gratulieren!<br />
Wenn man überdies wie schon in Eidingen von Zahl und Leben der Gemeinde erfuhr,<br />
so kam ein weiteres Moment der Hochachtung hinzu. Auch der Weifengruft galt ein Besuch.<br />
Das Mittagessen wurde noch in Celle eingenommen, Wolfsburg mußte als Rastplatz für die<br />
Kaffeepause herhalten, und nach langer Heimfahrt wurden die Gäste wieder in der Hardenbergstraße<br />
abgesetzt. Dank sei allen Gastgebern gesagt, unter denen die hohe Zahl von Ostpreußen,<br />
Pommern und Brandenburgern auffiel (es gibt aber auch eingeborene Celler), nicht<br />
minder aber auch den Mitgliedern, die sich während der Fahrt und bei der Bewältigung des<br />
zeitlich genau eingeteilten Programms als überaus verständnisvoll und diszipliniert erwiesen.<br />
Die nächste Studienfahrt wirft ihre Schatten schon voraus: Hannoversch-Münden soll das Reiseziel<br />
sein, nicht nur deshalb, weil der dort beerdigte Dr. Eisenbart und unser Vorsitzender dieselbe<br />
Facultas haben. H. G. Schultze-Bcrndt<br />
250 Jahre Militärwaisenhaus zu Potsdam<br />
Am 1. November 1724 wurde mit dem Erlaß eines General-Reglements das „Königliche Große<br />
Militair-Waisenhaus zu Potsdam" eröffnet. Die Anregung zum Bau dieser Anstalt hatte König<br />
Friedrich Wilhelm I. bei August Hermann Franckc in Halle und den dortigen caritativen Einrichtungen<br />
empfangen. Das Potsdamer Waisenhaus war eine öffentliche Anstalt unter der Schirmherrschaft<br />
des preußischen Königs und nahm nur Waisen auf, deren Väter Soldaten oder Kriegsteilnehmer<br />
gewesen waren. Auch nach dem Ende der Hohenzollernmonarchie bestand das Militärwaisenhaus<br />
fort und wurde erst 1945 aufgelöst.<br />
Das Geheime Staatsarchiv in Berlin-Dahlem zeigt gegenwärtig (bis Ende Januar 1975) in einer<br />
kleinen Schau Bilder, Dokumente, Zeugnisse und sonstige Erinnerungsstücke aus der Anstalt, die<br />
vorwiegend aus dem Besitz von Herrn Ewald Mertins, einem ehemaligen Schüler des Waisenhauses,<br />
stammen.<br />
Das III. Fernsehen des SFB beginnt am 10. Januar 1975 um 19.15 Uhr mit der Ausstrahlung<br />
einer 13teiligen Serie unter dem Titel: „Wie die ersten Menschen . . .". Die Fortsetzungen werden<br />
jeweils freitags zum gleichen Zeitpunkt gesendet. In dem Film, der unter der Leitung von Prof.<br />
Dr. Adriaan von Müller gedreht wurde, werden weitgehend die neueren Berliner archäologischen<br />
Ausgrabungen dargestellt.<br />
In Berlin starb vor hundertfünfundzwanzig Jahren Johann Gottfried Schadow am 27. Januar<br />
1850. Hier war er am 20. Mai 1764 geboren worden. Erinnert sei an seine Hauptwerke in der<br />
Nationalgalerie auf der Museumsinsel, an das Grabmal für den Grafen von der Mark, an die<br />
Marmorgruppe der Prinzessinnen Luise und Friederike sowie an die Quadriga mit der Viktoria<br />
auf dem Brandenburger Tor.<br />
Am 20. Dezember 1974 eröffnete die Gruppe der Berliner Architektur-Maler ihre diesjährige<br />
Weihnachtsausstellung in der Kongreßhalle unter dem Thema „Ausflugsziele der Berliner". Die<br />
Ausstellung ist vorerst bis zum 12. Januar 1975 zu besichtigen.<br />
8
Von unseren Mitgliedern<br />
Walter Rieck f<br />
Wer den Mitgliederversammlungen unseres Vereins beiwohnte, wird sich des Alterspräsidenten<br />
Walter Rieck wohl zu erinnern wissen, der mit seiner charakteristischen Stimme um Entlastung<br />
für den Vorstand nachsuchte, auch Worte der Anerkennung und der Kritik fand, und dann<br />
würdevoll die Wahlhandlung für den neuen Vorstand leitete. Jetzt müssen wir von unserem<br />
Nestor Walter Rieck, Rektor, Stadtrat, Bezirksbürgermeister und Senatsrat a. D., Abschied nehmen.<br />
Im neunzigsten Jahr seines Lebens ist er am 15. November 1974 in seiner Vaterstadt Berlin<br />
gestorben, in der er am 28. Oktober 1885 das Licht der Welt erblickt hatte. Zehn Jahre lang übte<br />
Walter Rieck, von Hause aus Volksschullehrer, von 1923 an das Amt eines Rektors und zugleich<br />
ehrenamtlichen Stadtrats auf dem Wedding aus. Der dienstentlassene Sozialdemokrat mußte sich<br />
von 1933 bis 1945 als Hausverwalter und Gesdiäftsführer eines Lichtspieltheaters durchschlagen<br />
und mehrere Verfahren vor der Gestapo über sich ergehen lassen. Seine Hilfe, die er in dieser<br />
Zeit immer wieder Juden zuteil werden ließ, die er vielfach auch versteckte, wurde nach 1945<br />
von der Jüdischen Gemeinde in der Weise gewürdigt, daß sie ihn als „Gerechten" ehrte.<br />
Walter Rieck, der vor 1933 Vorsitzender der Lehrer an den weltlichen Schulen Berlins war,<br />
wirkte sehr aktiv im Bund der freien Schulreformer, in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer<br />
Lehrer und im Bund der freien Schulgesellschaften mit. Nach Kriegsende wurde er Rektor<br />
in Lankwitz und von 1946 bis zum 30. Mai 1950 Bürgermeister des Bezirks Wilmersdorf. 1947<br />
gehörte er bei der Wiedergründung der Freien Volksbühne dem Gründungsausschuß an und war<br />
Vorstandsmitglied der Freien Volksbühne für den britischen Sektor. Nach der Spaltung Berlins<br />
amtierte er auch als Vorstandsmitglied der Freien Volksbühne Berlins.<br />
Walter Rieck, ein vielseitig gebildeter Mensch mit verhaltenem Charme und ein aufrechter Verfechter<br />
seiner Meinung, die ihn sogar einen Bruch mit seiner Partei nicht scheuen ließ, verkörperte<br />
in seinem Leben ein Stück Berliner und deutscher Geschichte. Zu seinem neunzigsten Geburtstag<br />
wollten wir ihn auch im Verein für die Geschichte Berlins ehren. Er wird uns fehlen.<br />
H. G. Scbultze-Berndi<br />
*<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Herrn Hans Schiller, Herrn Max Göhler, Frau Gertrud Schroth, Frau Gertrud<br />
Kahl, Herrn Albert Brauer, Herrn Dr. Hans Beerbohm, Herrn Paul Weihe; zum 75. Geburtstag<br />
Frau Erna von Wolff, Herrn Dr. Karl BergerhofF, Frau Magdalena Bellee, Herrn Dr.<br />
Albert Brandes, Frau Gertrud Warzccha, Frau Gertrud Hartmann, Herrn Erich Kemnitz; zum<br />
80. Geburtstag Herrn Karl Lortzing, Herrn Dr. Hermann Fricke.<br />
Buchbesprechungen<br />
Otto Friedrich: Weltstadt Berlin. Größe und Untergang 1918-1933. München: Des* 1973.<br />
328 S. m. Abb., Leinen, 29,80 DM.<br />
Bernd Ruland: Das war Berlin. Erinnerungen an die Reichshauptstadt. Bayreuth: Hestia 1972.<br />
317 S. m. 86 Abb., brosch., 28 DM.<br />
Kaum eine andere Epoche der Berliner Geschichte ruft in der Beurteilung einen größeren Zwiespalt<br />
der Meinungen hervor als die der zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts. Ein einhelliges<br />
Urteil über sie fällt schwer, kommt wohl nicht ohne Differenzierungen aus, und zwar nicht nur<br />
wegen ihrer relativen Nähe zur Gegenwart: Vielen unserer Zeitgenossen sind diese Jahre noch in<br />
Erinnerung, und der Blickpunkt des Betrachters setzt die Akzente. Begeisterung und Verdammnis,<br />
Schrecken und Bewunderung treffen gleichermaßen zu. Bringt man noch die Kausalitäten mit<br />
hinein - die 20er Jahre etwa als permanenter Befreiungsakt vom geistig-kulturellen Getto des<br />
Kaiserreichs oder als Trittbrett für den „Anfang vom Ende" 1933 - so gesellen sich zu den bekannten<br />
Schlagworten noch jene Pauschalurteile hinzu, die den Blick auf die tatsächlichen<br />
Gegebenheiten schon ordentlich trüben können. Fest steht, daß in der Politik nach 1918, und<br />
zwar nicht nur auf deutscher Seite, schwere Fehler gemacht wurden; fest steht auch, daß anderer-<br />
9
seits Berlin in jenen Jahren auf den Gebieten der Wissenschaften, Technik und Künste eine einzigartige<br />
Stellung einnahm. Dazwischen lag das ganze Spektrum der Erscheinungsformen einer<br />
pulsierenden Weltstadt als ein immerwährender Anreiz zu literarischer Behandlung.<br />
Der deutschstämmige Amerikaner Otto Friedrich, Jahrgang 1929, Historiker an der Harvard-<br />
Universität, liefert denn auch ein solches Kolossalgemälde, eine Art Kulturgeschichte der Weimarer<br />
Republik unter dem Berliner Aspekt, dabei oft weit über die Stadt hinausgehend. Er berichtet<br />
das, was an anderer Stelle auch schon steht, hat es aber komprimiert und, einem modischen<br />
Trend folgend, etwas feuilletonistisch aufgeputzt, indem er private Erinnerungen und<br />
Urteile von Augenzeugen hineinbringt und dadurch den strengen Reportagestil auflockert. Das<br />
liest sich ohne Zweifel gut und flüssig, und für viele Informationen wird der unbefangene Leser<br />
dankbar sein. Doch spätestens am Ende der Einleitung, wo z. B. der Pianist Abram Chasins „mit<br />
auffallend großen Ohren" vorgestellt wird und einige läppische Bemerkungen über das damalige<br />
Berlin macht, fragt man nach dem Wert solcher „historischen" Beweisaufnahmen, die sich über<br />
das ganze Buch verteilen. In diesen eingeschobenen Erinnerungs- und Gesprächsfetzen, die fortwährend<br />
die aktuelle politische Berichterstattung unterbrechen, häufen sich die banalen Äußerungen,<br />
manchmal in schicksalsschwere Sätze gekleidet, gelegentlich auch nach Klatsch riechend.<br />
Blättert man im Quellenverzeichnis, so entdeckt man eine große Zahl von hierzulande völlig<br />
unbekannten Memoirentiteln, vermißt jedoch zugleich viele grundlegende Werke über jene Epoche.<br />
Hier spürt man den amerikanischen Zuschnitt, mehr aber noch die Ferne vom Ort des Geschehens<br />
- zahlreiche Fehler und Ungenauigkeiten sind die Folge. Auch bei der Beurteilung der<br />
kultur- und geistesgeschichtlichen Tendenzen wird man dem Autor nicht uneingeschränkt folgen<br />
können; so waren z. B. Brecht und George Grosz keineswegs die zentralen Figuren, als die sie<br />
hier erscheinen. Man liest in diesem Buch vieles mit Gewinn (wenngleich nicht nur über Berlin),<br />
muß dabei aber viel Nebensächliches und manches verwirrende Urteil in Kauf nehmen.<br />
Ist in dem Buch Friedrichs von den „goldenen Zwanzigern" nur sehr bedingt die Rede, so verlegt<br />
sich der altgediente Journalist Bernd Ruland in seinen Berlin-Erinnerungen ganz auf die Rolle<br />
der Märchenfee, die von einem fernen Paradies erzählt. „Es war einmal ..." - so beginnt dieses<br />
freundliche Buch über die Jahre 1919 bis 1939, in denen Glanz und Elend so nahe beieinander<br />
lagen und doch nur dem Glanz in der verklärenden Rückschau ein Denkmal gesetzt wird. Die einzelnen<br />
Kapitel handeln denn auch weniger von Politik als von Kunst, Gesellschaft und Sport;<br />
Hunderte von Namen passieren Revue, und die Spitzenleistungen in den Wissenschaftsinstituten<br />
oder Konzertsälen, im Sportpalast oder in den Filmateliers rechtfertigen den Ruf der Reichshauptstadt<br />
als Metropole der Superlative. Abgesehen von dem euphorischen Grundton ist das<br />
Buch mit seiner Fülle von Daten und Fakten akkurat geschrieben; im direkten Vergleich zu<br />
Friedrichs Werk ist Ruland bei der Schilderung vieler Vorgänge, derer sich beide Autoren annehmen,<br />
wesentlich präziser. Beide Bücher verfügen über Namensregister und einen ausgezeichneten<br />
Abbildungsteil. Peter Letkemann<br />
Eberhard Machalet: Die Berliner Bezirksverwaltung. Stuttgart: Kohlhammer 1973. 227 S.,<br />
brosch., 34 DM. (Schriftenreihe d. Vereins f. Kommunalwissenschaften e. V./Deutsches Institut<br />
f. Urbanistik, Bd. 39.)<br />
Die Berliner Bezirke lassen sich nur schwer in das übliche Begriffssystem juristischer Organisationsformen<br />
einordnen und sind wegen ihrer besonderen Ausgestaltung mit anderen großstädtischen<br />
Untergliederungen kaum zu vergleichen. Da sich die in Berlin gewählte Form der bezirklichen<br />
Selbstverwaltung jedoch bewährt hat, kann sie als Modell für andere aufzugliedernde Millionenstädte<br />
herangezogen werden. Zu diesem Ergebnis kommt Eberhard Machalet in seiner Untersuchung<br />
über die Berliner Bezirksverwaltung.<br />
Im ersten Teil behandelt er die Grundlagen der Bezirksverwaltung, die geschichtliche Entwicklung<br />
und die Organisationsprinzipien. Der Verfasser hebt hervor, daß die verfassunggebende<br />
Preußische Landesversammlung gut beraten gewesen sei, als sie 1920 Berlin in nichtrechtsfähige<br />
Verwaltungseinheiten aufgegliedert und das verwaltungsorganisatorische Prinzip der Dezentralisation<br />
mit dem verwaltungspolitischen Gedanken bürgerschaftlicher Mitwirkung verbunden habe.<br />
Dadurch sei auch in der Großstadt eine gewisse Transparenz kommunaler EntScheidungsprozesse<br />
erhalten geblieben und ein wichtiges Postulat der Demokratie verwirklicht worden. Im zweiten<br />
Teil untersucht Machalet die Beteiligung der Bezirke an der Verwaltung Berlins. Ausführlich beschäftigt<br />
er sich zunächst mit dem Begriff der Selbstverwaltung, untersucht dann die Rechtsstellung<br />
der Bezirke und arbeitet schließlich die Unterschiede zwischen den Berliner Bezirken und<br />
den selbständigen Gemeinden heraus. Er kommt dabei zu dem Schluß, daß die Bezirke trotz des<br />
Fehlens dreier Wesensmerkmale kommunaler Selbstverwaltung - Rechtsfähigkeit, Autonomie und<br />
Finanzhoheit - durch einen umfangreichen Aufgabenkreis, durch ihre Universalität, Personalhoheit<br />
und die Befugnis zur Bestellung eigener Organe in erheblichem Maße eigenverantwortlich<br />
an der Verwaltung Berlins beteiligt sind. Im dritten Teil der Untersuchung wird schließlich die<br />
innere Verfassung der Bezirke, die Funktionen der bezirklichen Organe und ihr Zusammenwir-<br />
10
ken behandelt. Die grundsätzlichen Fragen der inneren Bezirksorganisation haben in einem ständigen<br />
politischen und verfassungsrechtlichen Streit gestanden, der weitgehende Reformbestrebungen<br />
ausgelöst hat. Die vorläufig letzte Veränderung ist 1971 durch die Umstellung vom Dreiorgan-<br />
(BA, BVV, Deput.) zum Zweiorgan-System (BA, BVV) erfolgt. In dieser ständigen Umgestaltung<br />
der Bezirksverfassung sieht der Verfasser ein Streben nach Anpassung an die im<br />
Laufe der Zeit mit der Bezirksverwaltung gewonnenen praktischen Erfahrungen.<br />
Es ist zu begrüßen, daß nach mehr als zwanzig Jahren wieder eine umfangreiche Untersuchung<br />
über die Berliner Bezirksverwaltung erschienen ist, zumal - wie Machalet überzeugend dargelegt<br />
hat - das Berliner Organisationsmodell immer stärker in den Blickpunkt rücken wird, je mehr<br />
Stadtlandschaft und Ballungsgebiete unsere zukünftigen Siedlungseinheiten sein werden.<br />
Jürgen Wctzcl<br />
Waltraut Volk: Berlin, Hauptstadt der DDR - Historische Straßen und Plätze heute. 2. Aufl.<br />
(Ost-)Berlin: VEB Verlag f. Bauwesen 1973. 256 S. m. Abb., 3 Skizzenbeilagen, Leinen, 38 M.<br />
Dieses Buch ist aus einer Fotoausstellung des Instituts für Städtebau und Architektur an der Ost-<br />
Berliner Bauakademie hervorgegangen. Das Interesse, das die Gegenüberstellung alter und neuer<br />
Bausubstanz im alten Stadtzentrum allenthalben hervorrief, bewog die Aussteller schließlich zu<br />
einer Veröffentlichung des Bildmaterials, wobei die große Materialfülle eine Themenbeschränkung<br />
erforderlich machte. Der Band hat daher nur die drei Baukomplexe Unter den Linden, Breite<br />
Straße/Fischerkietz und Alexanderplatz zum Gegenstand, die zugleich drei wichtige städtebauliche<br />
Epochen Berlins repräsentieren.<br />
Auf die architekturgeschichtliche Einleitung, die jeden Gebäudeabschnitt einzeln beschreibt, folgt<br />
ein ausgedehnter Bildteil - rund 400 Abbildungen insgesamt, mit teilweise seltenen Aufnahmen,<br />
alten Grafiken und Entwurfskizzen aus den modernen Wettbewerben. Auch Details wie Türen,<br />
Friese, Treppenhäuser und dekorative Interieurs werden gezeigt. Der bereits genannte Reiz der<br />
Konfrontation von alt und neu, von mittelalterlicher Beschaulichkeit und friderizianischer<br />
Strenge, wilhelminischem Pomp und moderner Glätte kann ihre Wirkung nicht verfehlen. Mehr<br />
noch als der Text, der betont sachlich ist, reflektieren die Bilder das Schicksal von Häusern einer<br />
Stadt, die vielleicht mehr als andere die Etappen der herrschenden Gesinnungen in ihren Fassaden<br />
zum Ausdruck brachte. Die Vielfalt der einst vorhandenen Baustile zeugte indes auch von<br />
dem steten Wandel, der sich auf geistigem oder künstlerischem Gebiet vollzog und der auch nicht<br />
ausschloß, die Stilelemente verschiedener Epochen nebeneinander stehen zu lassen. Die eigentliche<br />
Konfrontation, den radikalen Bruch mit der bisherigen architektonischen Überlieferung ergab erst<br />
das Jahr 1945. Da die alter Berliner Innenstadt fast ein einziges Trümmerfeld war, konnten sich<br />
hier die „Grundsätze sozialistischen Städtebaus" voll entfalten - besonders sichtbar in Alt-Kölln,<br />
wo außer einigen Relikten in der Breitestraße und an der Friedrichsgracht nichts von der alten<br />
Bebauung übrig blieb. Es muß dem Betrachter überlassen bleiben, ob er in den neuen Straßenzügen<br />
so etwas wie ein „Antlitz" dieser Stadt erkennen kann, und wenn ja, welches.<br />
Die vorzügliche Bildausstattung des Buches wird leider durch die verworrene grafische Gestaltung<br />
und die mißverständlich plazierten Bilderläuterungen beeinträchtigt. Peter Letkemann<br />
Lieselott Enders (Bearb.): Historisches Ortslexikon für Brandenburg, Teil III: Havelland.<br />
Weimar: Böhlau 1972. 472 S., 1 Karte, Leinen, 32 M. (Veröff. d. Staatsarchivs Potsdam,<br />
Bd. 11.)<br />
Der 3. Teil des im Staatsarchiv Potsdam bearbeiteten Historischen Ortslexikons für Brandenburg<br />
umfaßt das Gebiet der ehem. Landkreise West- und Osthavelland sowie der ehem. Stadtkreise<br />
Brandenburg, Potsdam und Spandau. Zugrundegelegt werden - wie in den bereits zuvor erschienenen<br />
Teilen I: Prignitz und II: Ruppin - die Kreisgrenzen im Jahre 1900; mitbehandelt<br />
sind also auch die Gebiete, die seit 1920 den Bezirk Spandau von Groß-Berlin bilden.<br />
Im Gegensatz zu dem jüngst erschienenen Handbuch der historischen Stätten Deutschlands,<br />
Bd. 10 Berlin und Brandenburg (vgl. Besprechung in den „Mitteilungen" Jg. 70/1974, Nr. 14,<br />
S. 434 f.) sind die Bände des Historischen Ortslexikons statistisch-topographisch aufgebaut. Beide<br />
Nachschlagewerke ergänzen sich also. Unter den Stichworten „Art und Verfassung der Siedlung",<br />
„Gemarkungsgröße", „Siedlungsform", „erste schriftl. Erwähnung", „Gerichtszugehörigkeit",<br />
„Herrschaftszugehörigkeit", „Wirtschafts- und Sozialstruktur", „kirchliche Verfassung",<br />
„Baudenkmale" und „Bevölkerungsziffern" werden Angaben zu bestimmten Stichjahren, nicht<br />
nur für jede Gemeinde, sondern auch für alle anderen Wohnplätze gemacht. Besonderer Wert<br />
wird auf den Stichpunkt „Wirtschafts- und Sozialstruktur" gelegt; hierunter fallen z. B. die Besitzverhältnisse<br />
im ländlichen Raum sowie die Industrie- und Berufsverhältnisse. Als letztes<br />
Stichjahr ist - außer für den Bereich Berlin (West) - 1968 angegeben. Auch die abgegangenen<br />
Siedlungen (Wüstungen) werden mitbehandelt und noch einmal in einem Register gesondert<br />
aufgeführt.<br />
11
Die in den Ortsstichworten gemachten Angaben beruhen weitgehend auf archivalischem Material,<br />
vor allem des Staatsarchivs Potsdam. So bildet das „Ortslexikon" eine vorzügliche Hilfe für<br />
jeden, der sich mit brandenburgischer Geschichte befaßt. Doch gibt es einige Einschränkungen:<br />
In den sonst sehr gründlichen Artikeln zu den heute zu Berlin-Spandau gehörenden Wohnplätzen<br />
fehlt jeder Hinweis auf Industriebetriebe neben den ehem. Rüstungsbetrieben und den Siemenswerken.<br />
Der Artikel „Berlin-Siemensstadt" (das Gebiet gehörte zum Kreis Niederbarnim) ist<br />
ebenfalls außerordentlich dürftig. Der seit 1920 zum Verwaltungsbezirk Spandau gehörige ehem.<br />
Gutsbezirk Ruhleben hätte ebenfalls einen eigenen Artikel verdient. Jedoch kann dies im -<br />
hoffentlich bald erscheinenden - Teil „Teltow" erfolgen. Felix Escher<br />
Gustav Sichelschmidt: Berühmte Berliner. Biographische Miniaturen. Berlin: Rembrandt-Verlag<br />
1973. 115 S., 12 Abb., Leinen, 12,80 DM.<br />
Dem 1972 erschienenen Büchlein „Große Berlinerinnen" (vgl. „Mitteilungen" Jg. 69/1973, H. 11,<br />
S. 331) ließ Sichelschmidt nun eine Sammlung von Kurzbiographien männlicher Vertreter des<br />
„Urbcrlinertums" folgen: In chronologischer Reihung skizziert er die Lebensgeschichten von Paul<br />
Gerhardt, Andreas Schlüter, Friedrich Nicolai, Ernst Ludwig Heim, Karl Friedrich Zelter, Alexander<br />
von Humboldt, Achim von Arnim, Ludwig Devrient, Albert Lortzing, August Borsig,<br />
Theodor Fontane und Otto Lilienthal. Das Interesse gilt also Personen aus gehobenem Bürgertum<br />
und Adel des 17. bis 19. Jahrhunderts, die sich auf dem Gebiet der Literatur und Musik, der<br />
Naturwissenschaften und Technik hervorgetan haben. Bildhauerei und Schauspiel dagegen wurden<br />
in die Randposition verwiesen; Maler oder auch Geisteswissenschaftler - bedeutende Historiker<br />
etwa oder der für Berlin so wichtige Wilhelm von Humboldt - fehlen ganz. Bei dieser<br />
Auswahl ist die Vorliebe für Willens-, Tat- und Erfolgsmenschen auffällig. Allenfalls große<br />
Künstler dürfen sich Extravaganzen leisten. Eine recht populäre Auffassung von „Urberlinertum"<br />
mit den Attributen „Arbeit, Kritik und Wirklichkeitssinn" (S. 29) sowie Goethes Ansicht<br />
über die Berliner (S. 44) stecken den Rahmen ab für die Charakterbilder. Im einzelnen werden<br />
Zielbewußtsein, Eigenständigkeit, Freimut, praktische Veranlagung, Entschlossenheit sowie Mangel<br />
an Sentimentalität als die hinlänglich bekannten Tugenden gerühmt - neue Aspekte bieten<br />
sich dem Leser kaum.<br />
Über die Sprachgebung und den Stil etwas sagen hieße das über die „großen Berlinerinnen" gefällte<br />
Urteil wiederholen. Besonders im ersten und zweiten Kapitel ist die Neigung zu Phrasen<br />
wieder recht störend, und nicht immer ist das Deutsch einwandfrei: Ober die Wittenberger Jahre<br />
Paul Gerhardts z. B. liegt Dunkel, auch die Schatten über seine Mittenwalder Jahre weichen<br />
nicht (S. 9, S. 11); Schlüter hängte gar die Köpfe seiner sterbenden Krieger an Schilden, und<br />
Borsig schließlich residiert wie ein König über ein unübersehbares Heer von Mitarbeitern (S. 16,<br />
S. 95). Wie die Zitate aus ,Eckermann' beweisen, kennt der Autor zwar seinen Goethe gut, doch<br />
verwirrt ihm die Emphase die Grammatik auf recht berlinische Weise. Zudem hätte man gern<br />
statt manchen Goetheworts Auszüge aus den gelegentlich erwähnten eigenhändigen Lebensberichten<br />
Nicolais oder Zelters gelesen. Eva Wirsig<br />
Rudolf Dörrier u.a.: Pankow. Chronik eines Berliner Stadtbezirkes. Herausgegeben vom Rat<br />
des Stadtbezirkes Berlin-Pankow 1971. VIII, 326 S. m. Abb. u. Plänen.<br />
Diese in einer vorzüglichen Ausstattung erschienene Geschichte des Stadtbezirkes Berlin-Pankow<br />
wendet sich an einen breiten Leserkreis. Sie gliedert sich in zwei Teile: Im ersten gibt der Verfasser<br />
einen chronologischen Abriß der Geschichte des Dorfes Pankow sowie der anderen, 1920<br />
zum Bezirk Berlin-Pankow zusammengefaßten Ortsteile von der Vorzeit bis zum Jahre 1948.<br />
Der zweite, umfangreichere Teil ist nach Sachgruppen geordnet. Die Entwicklung 1948 bis 1968<br />
von Dienstleistungen und Handwerk, der Land- und Gartenwirtschaft, der Industrie, des Bau-,<br />
Verkehrs- und Gesundheitswesens, der Volksbildung, der Kulturarbeit und der staatlichen und<br />
gesellschaftlichen Institutionen wird hier vorgestellt.<br />
Besonderes Gewicht wird im ersten Teil auf die Entwicklung der Pankower Ortsteile im späten<br />
19. und dem 20. Jh. gelegt. Ausführlich geht der Autor auf den Gang der Bebauung, die Industrie-<br />
und Verkehrsentwicklung des Gebietes, die Anfänge der Arbeiterbewegung, die Novemberrevolution,<br />
den Widerstand gegen den Fasdiismus und die Zeit während des Zweiten Weltkrieges<br />
ein. Auch der Stellung Pankows in Literatur und Kunst wird breiter Raum gegeben: in Niederschönhausen<br />
wohnte u. a. zeitweilig Arno Holz.<br />
Die unter Mitarbeit von Fachleuten des jeweiligen Gebietes entstandenen Abschnitte des zweiten<br />
Teils geben einen sachlichen Überblick über die Entwicklung der kommunalen und gesellschaftlichen<br />
Einrichtungen des Stadtbezirkes bis 1968. In einem Nachtrag werden die Veränderungen<br />
1968 bis 1970 zusammengefaßt. - Diese Geschichte Pankows ist mit viel Liebe zum heimatkundlichen<br />
Detail geschrieben. Es bleibt zu hoffen, daß auch andere Ostberliner Bezirke eine Chronik<br />
in ähnlicher Form herausbringen. Felix Escher<br />
12
Bruno Aust: Stadtgeographie ausgewählter Sekundärzentren in Berlin (West). Berlin: Reimer<br />
1970. 151 S., 32 Abb., 7 Ktn., brosch., 19 DM.<br />
Eine der vielen Besonderheiten des von dem historischen Zentrum der Gesamtstadt abgeschnittenen<br />
West-Berlin ist die Entwicklung neuer zentraler Bereiche. Neben den politisch-administrativen<br />
Zentren in Schöneberg und um den Fehrbelliner Platz konnte am ehesten das Zooviertel<br />
mit einem vielseitigen Angebot an zentralen Dienstleistungen, Vergnügungs- und Kulturstätten,<br />
an Geschäften für den Luxusbedarf sowie als Zentrum der Berliner Konfektionsindustrie Teilfunktionen<br />
der alten City übernehmen. Jedoch nicht in allen Bereichen konnte das Zooviertel<br />
eine Vorrangstellung erringen. Namentlich für den Dienstleistungs- und Einzelhandlungsbereich<br />
entstanden in verschiedenen Stadtteilen weitere Zentren. Der Untersuchung dieser, in anderen<br />
Arbeiten „Nebencities", im vorliegenden Falle zur Unterscheidung vom „Primärzentrum", dem<br />
Zooviertel, „Sekundärzentren" genannten Gebiete ist diese Arbeit gewidmet.<br />
Detailliert werden die drei „Sekundärzentren" Steglitz-Schloßstraße, Charlottenburg-Wilmersdorfer<br />
Straße und Tegel-Berliner Straße behandelt. So werden u. a. Baustruktur, Gebäudenutzung,<br />
Arbeits- und Wohnverhältnisse, Mietpreise und Passantenströme der genannten Bereiche,<br />
insbesondere der Wilmersdorfer Straße, untersucht. Mit Hilfe einer Repräsentativumfrage<br />
ist der Versuch unternommen worden, eine Gliederung von Berlin (West) in Raumeinheiten<br />
nach der Zuordnung zu einzelnen Zentren zu erstellen. Das Ergebnis dieses Versuchs ist eine<br />
Karte der Raumeinheiten. Innerhalb der Einheiten zeigen sich zu einzelnen Angeboten (Warenhaus,<br />
Bekleidungsgeschäft und Luxusgeschäft) weitere Differenzierungen zwischen den insgesamt<br />
11 Sekundärzentren. Es wird so möglich, eine „Hierarchie" der Sekundärzentren aufzustellen. -<br />
Interessant wäre obendrein der Versuch, die Verkehrsverhältnisse der Sekundärzentren mit den<br />
Ergebnissen dieser Arbeit in Beziehung zu setzen. Felix Esdier<br />
Heinz Müller: Kampftage in Berlin. Ein deutscher Antifaschist und Internationalist berichtet.<br />
(Ost-)Berlin: Dietz 1973. 174 S., 11 Abb., Leinen, 6 M.<br />
Der Untertitel des Buches führt mitten in die Problematik hinein. Der junge Luftwaffenoffizier<br />
Müller berichtet aus eigenem Erleben über seinen und seiner Genossen antifaschistischen Kampf<br />
während des 2. Weltkrieges. Der Bericht beginnt mit Müllers abenteuerlicher Flucht in einem<br />
gekaperten Flugzeug nach Rußland im Januar 1944.<br />
Über die antifaschistische Frontschule der 4. Ukrainischen Front gelangte Müller schließlich<br />
nach Moskau und Ende Februar 1944 nach Krasnogorsk. Hier traf er mit Walter Ulbricht<br />
zusammen, der ihn aufforderte, der Bewegung „Freies Deutschland" beizutreten (S. 31). Es galt<br />
vor allem die Propagandaarbeit gegen Hitler unter den Soldaten und Offizieren des deutschen<br />
Heeres aufzunehmen. Müller wurde für diese Arbeit in eigens dafür eingerichteten Instituten<br />
geschult. Ende September 1944 erhielt Müller zusammen mit einigen anderen Antifaschisten den<br />
Auftrag, nach Deutschland zurückzukehren, um „den Stab einer bestimmten faschistischen Dienststelle<br />
ausfindig zu machen und entsprechende Informationen darüber zu geben" (S. 38). Im<br />
Anschluß daran sollten in Berlin Kampfmaßnahmen gegen die Herrschaft Hitlers ergriffen<br />
werden. Hierzu gehörte auch die „Aktion Avus", in deren Verlauf drei SS-Leute den Tod<br />
fanden (vgl. den Abdruck der Dokumente zwischen S. 96 und S. 97).<br />
Charakteristisch für den antifaschistischen Widerstandskampf war die permanente Gefahrensituation,<br />
in der die daran Beteiligten standen. Heinz Müllers Erlebnisbericht schildert dies an<br />
vielen Einzelbeispielen mit großer Eindringlichkeit. Hans Jürgen Meinik<br />
Herbert Scurla: Begegnungen mit Rahel. Der Salon der Rahel Levin. 5. Aufl. (Ost-)Berlin:<br />
Verlag der Nation 1971. 527 S. mit Abb., Leinen, 12,80 M.<br />
Wie kaum anders zu erwarten, ist dem profunden Kenner der Berliner Klassik und Romantik -<br />
erinnert sei an seine umfassende Darstellung der historischen und geistigen Welt Wilhelm von<br />
Humboldts - in seinem Rahel-Werk ein außerordentlich getreues, den politischen, gesellchaftlichen<br />
und künstlerischen Kräften der Epoche zwischen 1780 und 1830 nachspürendes Zeitgemälde<br />
gelungen. Wir werden nicht nur mit einem anschaulichen, die sozialen Verhältnisse zu Ende des<br />
18. Jahrhunderts farbig widerspiegelnden „Mosaik" Berlins beschenkt, vielmehr auch mit liebevoller<br />
Umsicht in die vielfältigen Beziehungen eingeführt, in die das Leben Raheis und ihres<br />
Mannes eingefügt war: Ob es sich um die diplomatischen Vorbereitungen der deutschen Erhebung<br />
und den endlichen Fall. Napoleons, um die Verbindungen zur damaligen eben gegründeten<br />
Universität mit ihren geistigen Repräsentanten Fichte, Schleiermacher, Hegel handelt, oder um<br />
die der älteren und jungen Romantik von den Brüdern Schlegel bis zu den „Liederbrüdern"<br />
Clemens Brentano und Achim von Arnim. Daß neben Berlin auch Weimar mit seinen weit in das<br />
damalige geistige Europa hinausreichenden Fäden in dieser Darstellung seinen gebührenden<br />
Platz findet, bedarf kaum einer Betonung. Summa summarum: Ein dankenswertes Werk, das<br />
den Leser mit einem reichen Schatz an Informationen und vielfältigen Anregungen für eine<br />
weitere Beschäftigung mit dieser Epoche entläßt. Hans Joachim Mey<br />
13
Karl Kiha: Die Beschreibung der „Großen Stadt". Zur Entstehung des Großstadtmotivs in der<br />
deutschen Literatur (ca. 1750 - ca. 1850). Bad Homburg v. d. H./Berlin/Zürich: Gehlen 1970.<br />
182 S., Leinen, 28 DM. (Frankfurter Beiträge zur Germanistik, Bd. 11.)<br />
Riha bietet in dieser Studie zunächst einen detaillierten Überblick zum Stand der Stadt-<br />
Forschung in der Literatur (S. 7-19, 20-38). Über die bisherigen Forschungsansätze zu dieser<br />
Thematik geht er dann hinaus, indem er das „Beobachtungsfeld" erweitert und „bewußt solche<br />
außerliterarischen Texte, eine scheinbar abseitige, auch unterströmige Literatur" in den Rahmen<br />
seiner Untersuchungen mit einbezieht (S. 18). Zum Komplex des „Stadt-Erlebnisses" heißt es<br />
eigens (S. 40): „Unser besonderes Interesse gilt den außer- und vorliterarischen Formen, in die<br />
diese Erlebnisse gefaßt sind, und dem Weg, auf dem sie in die Literatur kommen."<br />
Zur Zeit der Drucklegung dieser Arbeit erschien allerdings gerade die bedeutsame Arbeit von<br />
Volker Klotz: Die erzählte Stadt. Ein Sujet als Herausforderung des Romans von Lesage bis<br />
Döblin, München 1969. Riha hofft indessen, daß sich „dem großen europäischen Rahmen bei<br />
Klotz" die eigene Arbeit „im engeren motivischen Bereich der deutschen Literatur als konkretisiertes<br />
Detail" einfügt (S. 19, Anm. 59). In der Tat breitet Rihas Studie eine Fülle von Details<br />
zum Motiv- und Stoffkomplex der „Großen Stadt" aus. Bei der Rubrizierung der verschiedenen<br />
Romane zum Thema der Stadt ergeben sich allerdings einige methodische Schwierigkeiten<br />
(S. 29 f). Dies wird deutlich bei dem Vergleich beispielsweise so grundverschiedener Werke wie<br />
Fontanes Berliner Romane und etwa Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz". Im letztgenannten<br />
Roman wird die Stadt selbst zum erzählten Subjekt. Berlin erscheint als „Moloch", der das<br />
Schicksal der Menschen beeinflußt und ihre Lebenssphäre prägt.<br />
Interessante Aspekte - auch im Hinblick auf soziale Themenbereiche - werden bei der Behandlung<br />
anderer großer Städte (bes. Paris und London) offengelegt (S. 40 ff,). Bei der Auseinandersetzung<br />
mit den Einzel werken geht es vornehmlich um Adalbert Stifters „Wien und die Wiener",<br />
Friedrich Nicolais „Sebaldus Nothanker", Ludwig Tiecks „William Lovell", E. T. A. Hoffmanns<br />
„Des Vetters Eckfenster", Franz Grillparzers „Der arme Spielmann" und Gottfried Kellers „Der<br />
grüne Heinrich". Hierbei ist es Riha um „Modellanalysen" zu tun, die seine These, „daß die<br />
dichterische Gestaltung des Großstadtstoffes in engem Zusammenhang mit einer allgemeinen<br />
Entwicklung des Stoffes gesehen werden müsse", unterstützen sollen. Hans Jürgen Meinik<br />
Berliner Malerpoeten. Eine Anthologie. Hrsg. v. Aldona Gustas, mit einer Einleitung v. Karl<br />
Krolow. Herford: Nicolaische Verlagsbuchhandlung 1974. 148 S., 54 z.T. färb. Abb., lam.<br />
Pappbd., 39,50 DM.<br />
Die hier vorliegende Publikation soll beweisen, so wollen es die Editoren, daß z. Z. mehrere<br />
Künstler in West-Berlin leben, denen sowohl die Prosa und Lyrik wie auch die Malerei und<br />
Plastik die Möglichkeit zu künstlerischer Ausdrucksform bietet. Von Günter Bruno Fuchs, Günter<br />
Grass, Aldona Gustas und Roger Loewig über Märchen, Christoph Meckel, Curt Mühlenhaupt<br />
und Karl Oppermann bis Robert Wolfgang Schnell, Wolfdietrich Schurre, Friedrich Schröder-<br />
Sonnenstern, Joachim Uhlmann und Hans-Joachim Zeidler werden dem Leser diese „Doppelbegabungen"<br />
mit ihren Texten und Bildern vorgestellt. Arrivierte stehen neben jenen, die bislang<br />
überwiegend auf der lokalen Kunstszenerie Beachtung fanden. Leider kann dieser Dokumentation<br />
lediglich ein bedingter Erfolg zugestanden werden. Das liegt einmal an der nur sehen vorhandenen<br />
Spontaneität. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, es hier mit einem „gewollten"<br />
Buch zu tun zu haben; mit einer gewissen Sterilität als Ergebnis, die z. B. die Bücher der Rabenund<br />
Eremiten-Presse nicht aufweisen.<br />
Sind die Grafiken und Bilder z. T. noch recht amüsant und die Prosatexte - Grass „blechtrommelt"<br />
wieder Sozialkritisches - noch verständlich, so befällt einem bei der modernen Lyrik das<br />
Gefühl, inhaltslosen „Sprachübungen" beizuwohnen. Auch der Vergleich zu E. T. A. Hoffmann,<br />
Goethe, Wilhelm Busch und Alfred Kubin wirkt voreilig, ja überheblich, da hiermit Quantität<br />
gegen Qualität gesetzt wird. Selbst der bis zum Jahresende 1974 gültige Vorzugspreis von 35 DM<br />
dürfte unter diesen Aspekten von den Interessenten als zu hoch empfunden werden.<br />
Klaus P. Madei<br />
Eingegangene Bücher<br />
(Besprechung vorbehalten)<br />
Theodor Fontane. Hrsg. von Richard Brinkmann in Zusammenarbeit mit Waltraut Wiethölter.<br />
München: Heimeran 1973. 2 Bände, 842 u. 873 S. (Dichter über ihre Dichtungen, Bd. 12/1<br />
u. IL)<br />
Kmiecik, Edward: Berliner Victoria. 24. IV.-2. V. 1945. Polnische Soldaten am Brandenburger<br />
Tor. Warschau: Ruch 1972. 69 S. m. Abb.<br />
14
Kupjerberg, Herbert: Die Mendelssohns. Tübingen/Stuttgart: Wunderlich 1972. 304 S. mit Abb.<br />
Das Märkische Museum und seine Sammlungen. Festgabe zum 100jährigen Bestehen des kulturhistorischen<br />
Museums ... im Jahre 1974. (Ost-)Berlin: Mark. Museum 1974. 195 S. m. Abb.<br />
Ribbe, Wolfgang: Die Aufzeichnungen des Engelbert Wusterwitz. Berlin: Colloquium 1973.<br />
264 S. (Einzelveröff. d. Histor. Kommission zu Berlin, Bd. 12)<br />
Schellenberg, Carl (Hrsg.): Alfred Lichtwark - Briefe an seine Familie 1875-1913. Hamburg:<br />
Christians 1972. 777 S.<br />
Schmidt, Paul: So gingen sie dahin . . . Die Chronik der Familie Kleinschmidt (1876-1946).<br />
Ulm: Hess 1969. 619 S.<br />
Schmidt, Valentin Heinrich, u. Daniel Gottlieb Gebhard Mehring: Neuestes gelehrtes Berlin oder<br />
literarische Nachrichten von jetztlebenden Berlinischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen.<br />
2 Bde. Nachdr. d. Ausg. Berlin 1795. Leipzig: Zentralantiquariat der DDR 1973. 294 u.<br />
308 S.<br />
Schneidereit, Otto: Paul Lincke und die Entstehung der Berliner Operette. (Ost-)Berlin:<br />
Henschelverlag 1974. 148 S. m. Abb.<br />
Schönstedt, Walter: Kämpfende Jugend. Roman der arbeitenden Jugend. 2. Aufl. Berlin: Oberbaumverlag<br />
1972. 204 S.<br />
Schreckenbach, Hans-Joachim: Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg. Teil III<br />
(Orte u. Ortsteile, 1). Weimar: Böhlau 1972. 584 S.<br />
v. Weiher, Siegfried: Berlins Weg zur Elektropolis. Berlin: Stapp/Berlin u. München: Siemens AG<br />
1974. 206 S. m. Abb.<br />
Weißhuhn, Gernot: Alternativprojektionen des wirtschaftlichen Wachstums in West-Berlin bis<br />
zum Jahre 1980. Berlin: Duncker & Humblot 1972. 63 S. (DIW-Beiträge zur Strukturforschung,<br />
H. 23.)<br />
Wiebach, Ursula: Hotelpension Mailion. (Ost-)Berlin: Militärverlag der DDR 1973. 224 S.<br />
Zerna, Herta, u. Kurt Mühlenhaupt: Inmitten von Berlin. Düsseldorf/Hamburg: M. v. Schröder<br />
1973. 80 S., 30 Abb.<br />
'Zivier, Ernst R.: Der Rechtsstatus des Landes Berlin. Eine Untersuchung nach dem Viermächte-<br />
Abkommen vom 3. Sept. 1971. Berlin: Berlin Verlag 1973. 263 S.<br />
Im IV. Vierteljahr 1974<br />
haben sich folgende Damen und Herren<br />
Torsten R. Birlem, Dipl.-Soz.<br />
1 Berlin 30, Fuggerstraße 24<br />
Tel. 2 11 77 45 (Schriftführer)<br />
Wilfried Göpel, Journalist<br />
1 Berlin 30,<br />
Prinz Friedr.-Leopold-Straße 34<br />
(Dr. Letkemann)<br />
Edith Hobbing, Beamtin<br />
1 Berlin 62, Meininger Straße 7<br />
Tel. 7 84 74 07 (M. Thiemicke)<br />
Helene Kalbhenn, Kauffrau<br />
1 Berlin 20, Jägerstraße 25<br />
Tel. 3 61 90 48 (R. Koepke)<br />
Elisabeth Knispel, Verw.-Angest.<br />
1 Berlin 19, Wundtstraße 40-44<br />
Tel. 3 06 82 45 (R. Sylvester)<br />
Günther König, Amtsleiter<br />
1 Berlin 61, Tempelhofer Ufer 12<br />
Tel. 2 51 93 38 (R. Koepke)<br />
Edith Lemme, Sozialarbeiterin<br />
1 Berlin 31, Brabanter Straße 16<br />
Tel. 8 22 89 84 (R. Sylvester)<br />
Eva Maria Lüdeke, Oberstud.-Rätin a. D.<br />
1 Berlin 45, Margaretenstraße 36<br />
Tel. 8 32 49 86 (A. Hamecher)<br />
zur Aufnahme gemeldet:<br />
Hildegard Mattusch, Verw.-Angest.<br />
4 Düsseldorf, Karolingerstraße 18<br />
Tel. 34 02 94 (Dr. Leichter)<br />
Johannes Posth, Bankdir. i. R.<br />
Istanbul-Tophane/Türkei, Cli Apt. 5<br />
Izzetpasa so.<br />
Tel. 44 13 39 (Dr. J. Posth)<br />
Margarete Rettig<br />
1 Berlin 22, Niendorfweg 6<br />
Tel. 3 53 49 40 (A. Behrbohm)<br />
Hilde Ribbe, Oberstudiendirektorin<br />
1 Berlin 33, Koenigsallee 34<br />
Tel. 8 26 40 79 (R. Koepke)<br />
Frieda Senger, Reg.-Ob.-Sekr. a. D.<br />
1 Berlin 61, Fürbringerstraße 3<br />
Tel. 6 92 65 10 (K. R. Schütze)<br />
Kurt Smolka, Ing.<br />
1 Berlin 28, Nimrodstraße 20<br />
Tel. 4 11 16 00 (Schriftführer)<br />
Clara-Sybilla Wiegmann, Wirtschaftsleiterin<br />
1 Berlin 33, Nikischstraße 2<br />
Tel. 8 26 20 66 (I. Köhler)<br />
Dr. Heinz Wiegmann, Arzt<br />
1 Berlin 33, Nikischstraße 2<br />
Tel. 8 26 20 66 (I. Köhler)<br />
15
Veranstaltungen im I. Quartal 1975<br />
1. Sonnabend, 11. Januar, 10 Uhr: Besichtigung der Ausstellung „Von Schinkel bis<br />
Mies van der Rohe" in der Sonderausstellungshalle des Museums Dahlem, Eingang<br />
Lansstraße (U-Bahnhof Dahlem-Dorf).<br />
Es führt der Direktor der Kunstbibliothek Berlin, Prof. Dr. Ernst Berckenhagen.<br />
2. Dienstag, 21. Januar, 19.30 Uhr: Gemeinschaftsveranstaltung mit der Gesellschaft<br />
für deutsche Postgeschichte, Bezirksgruppe Berlin: Lichtbildervortrag von Herrn<br />
Gerd Gnewuch, „Aus 125 Jahren Berliner Postgeschichte".<br />
Bürgersaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
3. Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr: Eisbeinessen anläßlich des 110. Jahrestages der Gründung<br />
unseres Vereins im Großen Saal der Hochschul-Brauerei, Amrumer Straße 31<br />
(Ecke Seestraße; U-Bahnhof Amrumer Straße, Busse 16, 64, 65, 89). Es spridit<br />
Alfred Braun.<br />
Anmeldung an Frau Ruth Koepke bis zum 22. Januar (mit evtl. Diätwünschen).<br />
Endpreis pro Gedeck 9 DM.<br />
4. Dienstag, 11. Februar, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Egon Fouquet:<br />
„Die Hugenotten, 2. Teil: Berlin-Brandenburg".<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
5. Sonnabend, 22. Februar, 10 Uhr: „Die Bronzezeit und ihre Spuren im Berlin-Brandenburger<br />
Raum". Direktor Prof. Dr. Adriaan v. Müller führt durch das Museum<br />
für Vor- und Frühgeschichte, Schloß Charlottenburg, Langhans-Flügel.<br />
6. Dienstag, 11. März, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Frau Dr. Ilse Reicke:<br />
„Berlins berühmte Malerinnen und die von ihnen Porträtierten".<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
7. Sonnabend, 22. März, 10 Uhr: Herr Karlheinz Gravc führt durch das Berliner<br />
Post- und Fernmeldemuseum (im Gebäude der Urania).<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek<br />
ist zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen<br />
geselliges Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 24. Januar, 21. Februar und 21. März, zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
ab 17 Uhr.<br />
Wir weisen darauf hin, daß der Mindest-Jahresbeitrag 36 DM beträgt und bitten um umgehende<br />
Überweisung noch ausstehender Beiträge für das Jahr 1974.<br />
Mit dem vorliegenden Heft beginnt eine neue Zählung der Hefte und Seiten. Das Gesamtinhaltsverzeichnis<br />
und das Namensregister für die Jahrgänge 1971 bis 1974 der „Mitteilungen"<br />
wird mit Nr. 2 ausgeliefert.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Ruth Koepke, 1 Berlin 61,<br />
Mehringdamm 89, Ruf 6 93 67 91. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 4 65 90 11. Schatzmeister: Landgerichtsrat a.D. D. Franz, 1 Berlin 41, Grunewaldstraße<br />
5, Ruf 7 91 57 41. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1 Berlin 21.<br />
Bibliothek: 1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus). Geöffnet: freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Klaus P.<br />
Mader; Günter Wollschlaeger. Bezugspreis für Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
16
- A 20 377 F<br />
J"$$$9^i. d$T u~. ürj^r ^faviibibiiothek<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
71. Jahrgang Heft 2 April 1975<br />
17
„Melpomenens und Thaliens Günstling"<br />
Zum 200. Todestag des Schauspieldirektors H. G. Koch<br />
Von Rainer Theobald<br />
Betrachtet man einerseits die „Kränze", die heute etwa einem vor zwei Jahrhunderten<br />
geborenen Maler der Romantik „geflochten" werden, und sucht andererseits vergebens<br />
nach der bescheidensten Zeitungsnotiz, die an den 200. Todestag eines Bühnenkünstlers<br />
erinnern könnte, so erweist das einst arg strapazierte Schillerwort vom „Mimen" noch<br />
immer seine Gültigkeit. Das Kunstwerk des Schauspiels ist erst in unserem Jahrhundert<br />
konservierbar geworden; was weiter zurückliegt, kann nur aus Spielvorlagen, Bildern<br />
und Berichten höchst unzulänglich vor unserem geistigen Auge wiedererstehen. Vollständig<br />
rekonstruierbar ist es auch mit theaterwissenschaftlicher Methodik nicht, weil das<br />
Element „Publikum", dessen unwägbare Rückwirkung auf das künstlerische Produkt<br />
beim Theater viel größer ist als bei der Rezeption anderer Künste, sich solcher Rekonstruktion<br />
entzieht.<br />
Es nützte Heinrich Gottfried Koch 1 nichts, daß er den prominentesten Theaterkritiker<br />
seines Jahrhunderts, der als erster das Problem der Vergänglichkeit der Schauspielkunst,<br />
der „transitonschen Malerei", systematisch untersuchte, daß er Gotthold Ephraim Lessing<br />
zu seinen vielen Freunden und Verehrern zählen konnte. Als der Direktor der „Kochischen<br />
Gesellschaft Deutscher Schauspieler" am 3. Januar 1775 in Berlin gestorben war,<br />
blieb die Leistung seines Lebens noch im Bewußtsein einer Generation erhalten; im<br />
19. Jahrhundert war Heinrich Gottfried Koch nur noch ein Name, der in literaturwissenschaftlichen<br />
Abhandlungen immer wieder erwähnt werden mußte, wenn von literarischen<br />
Größen der Aufklärung die Rede war. 25 Jahre lang hatte er mit fast allen namhaften<br />
Bühnenschriftstellern seiner Zeit Hand in Hand gearbeitet; deren Werke können wir<br />
heute noch lesen, angemessen beurteilen können wir sie jedoch nur, wenn wir die Wirkung<br />
in ihrer Zeit betrachten, wenn wir uns die Existenz- und Produktionsbedingungen<br />
der deutschen Wanderbühnen des 18. Jahrhunderts vor Augen führen, die Heinrich Gottfried<br />
Koch einen lange zu wenig beachteten, aber in vieler Hinsicht bedeutsamen Fortschritt<br />
zu verdanken hatten.<br />
1 So lautet die Reihenfolge der Namen korrekt, nicht „Gottfried Heinrich", wie oft zu lesen<br />
ist. - Über Kodi existiert eine unübersehbare Literatur, jedoch, im Gegensatz zu den anderen<br />
bedeutenden Prinzipalen seiner Zeit, keine wissensdiaftliche Gesamtwürdigung. Paul Legband<br />
(vgl. Anmerkung 23) kündigte bereits 1902 eine „auf archivalisches Material sidi stützende<br />
Darstellung" an, die aber nie erschienen ist. Über Kochs Tätigkeit in Leipzig, Hamburg und<br />
Berlin unterrichten die frühen lokalen Theatergesdiichten von H. Blümner (Leipzig 1818),<br />
J. F. Schütze (Hamburg 1794) und C. M. Plümicke (Berlin 1781). Wichtiges Archivmaterial<br />
ist bei Reden-Esbeck („Caroline Neuber und ihre Zeitgenossen", Leipzig 1881) und vor allem<br />
bei M. Fürstenau („Der Prinzipal Johann Gottfried Heinrich Koch in Dresden 1764 und<br />
1765". In: Almanach d. Genossenschaft dt. Bühnen-Angehöriger, 1875, S. 17-30) abgedruckt.<br />
Einige der zeitgenössischen Quellensdiriften sind in den Anmerkungen 22, 23 und 25 genannt.<br />
Die maschinenschriftliche Dissertation von Elisabeth Prick („Heinrich Gottfried Koch und<br />
seine Schauspielergesellschaft bis zum Bruch mit Gottsched", Frankfurt 1925), die nur die erste<br />
Hälfte seiner Wirkungszeit behandelt, konnte für den vorliegenden Aufsatz nicht benutzt<br />
werden.<br />
IS
Der Begriff der „Wandertruppe" als einer für das deutsche Theater zweier Jahrhunderte<br />
typischen Erscheinung erweckt für den Laien häufig noch die unrichtige Vorstellung von<br />
minderwertigen „Schmierenkomödianten". Die Truppen des deutschsprachigen Berufstheaters<br />
zwischen 1650 und 1800 waren aber weniger aus Mangel an Qualität zum Wandern<br />
gezwungen als aus Mangel an Publikum. Die Gesellschaftsschicht, die genügend Geld<br />
und Zeit zum Theaterbesuch besaß, war der Adel, der sich jedoch fast völlig an französischer<br />
und italienischer Kultur orientierte, oft überhaupt nur mangelhaft deutsch sprach.<br />
Die meisten Höfe hielten sich italienische Opern- und französische Schauspieltruppen; die<br />
Akteure des deutschen Sprechtheaters waren vorwiegend auf ein wohlhabendes bürgerliches<br />
Publikum angewiesen, das aber selbst in den größeren Städten nicht zahlreich und<br />
gebildet genug war, um die Existenz einer stehenden Bühne zu ermöglichen. Durch einen<br />
Teufelskreis von Barrieren wurde das deutsche Theater mit seinen Künstlern bis weit in<br />
das 18. Jahrhundert hinein am Rande der Gesellschaft und der kulturellen Entwicklung<br />
gehalten: Von der Kirche als „weltliches Laster" erbittert bekämpft, durch Feiertage und<br />
-fristen wie Advent- und Fastenzeit oder Landestrauer in den Spielzeiten stark eingeschränkt,<br />
erhielten die Wanderbühnen durch die Räte der Städte, wenn überhaupt,<br />
jeweils nur kurze Aufenthalte bewilligt, die mit Abgaben und Auflagen verschiedenster<br />
Art verbunden waren. Da auch die Eintrittspreise meist durch die Stadtväter festgesetzt<br />
oder zumindest limitiert wurden, war die Truppe, die im Durchschnitt aus 20 bis 25 Personen<br />
bestand, auf äußerste Sparsamkeit angewiesen: Das Theater, ein gemieteter Saal<br />
oder ein eigens errichteter Holzbau, mußte primitiv bleiben, die Dekorationen und<br />
Kostüme, die ohnehin durch den ständigen Transport litten, mußten ärmlich bleiben. Die<br />
Aufführungen mußten, um den kleinen Kreis des Publikums zu unterhalten, in täglichem<br />
Wechsel das bringen, was „ankam": Sensationen und Zoten. Um den Schauspielern das<br />
Existenzminimum zu sichern, blieb das Theater das „Vergnügen des Pöbels", ohne seinem<br />
Inhalt nach wirklich volkstümlich zu sein. Anders als in Frankreich und England hatte<br />
sich aber auch die Literatur weit vom Theater entfernt. Die Truppen mußten sich ihr<br />
Repertoire mühsam aus Übersetzungen zusammenstoppeln, die durch die Einfügung der<br />
„lustigen Person", des Harlekin oder Hanswurst, publikumswirksam zugestutzt wurden.<br />
Das Sprechtheater konnte also von sich aus nicht salonfähig werden und zog sich dadurch<br />
wieder die Verachtung der Reichen, Mächtigen und Gebildeten zu, die in dieser frühbürgerlichen<br />
Phase allein imstande gewesen wären, es zu dem kulturellen Faktor zu erheben,<br />
den es im Ausland darstellte. Erst die Bemühungen des einflußreichen Leipziger<br />
Universitätsprofessors Gottsched, Theater und Literatur zu vereinen, indem er die beste<br />
Schauspieltruppe seiner Zeit dazu bewog, die hanswurstgespickten „Haupt- und Staatsaktionen"<br />
durch „regelmäßige" Stücke nach französischem Vorbild zu ersetzen, leiteten<br />
die Entwicklung ein, die vor allem durch vier hervorragende Theaterpersönlichkeiten,<br />
Friederike Caroline Neuher, Johann Friedrich Schönemann, Konrad Ernst Ackermann<br />
und Heinrich Gottfried Koch, eine stetige ästhetische und gesellschaftliche Aufwertung<br />
der Schauspielkunst bewirkte, bis mit der Gründung der ersten „Nationaltheater" und<br />
dem Beginn der „klassischen" Epoche der Literatur auch das deutschsprachige Theater<br />
seine volle Emanzipation erreicht hatte.<br />
„Die Nachricht von Koch, daß er nach Berlin gehen werde, habe ich der Herzogin von<br />
Weimar gesagt, die sie aber nicht glauben will. Sie versicherte, daß er sich anheischig gemacht,<br />
diesen Sommer wieder nach Weimar zu kommen", schreibt Lessing am 26. Mai<br />
1771 an seinen Bruder Karl nach Berlin. Die Herzogin wurde enttäuscht: Durch den<br />
19
Tod des jüngeren Schuck- wurde das „preußische Privilegium" (d. h. die königliche Spiel-<br />
Konzession für Preußen) frei, und Koch nutzte schnell entschlossen die Möglichkeit, in<br />
einer Berufswelt ruhelosen Existenzkampfes zum vierten Mal eine solide Basis zu errichten,<br />
womöglich hier in stabilen Verhältnissen seine endgültige Wirkungsstätte zu finden,<br />
obwohl gerade Berlin zu den wenigen großen Städten gehörte, deren Publikum er noch<br />
nicht kennengelernt hatte.<br />
1703 in Gera als Sohn eines Kaufmanns geboren, hatte er an der Leipziger Universität<br />
Jura studiert, ehe er, wie so viele Studenten seiner Zeit 3 , in materieller Not über die<br />
gesellschaftlichen Schranken zum Theater wechselte. Anlaß dazu gab das Auftreten der<br />
1727 gegründeten Neuberschen Schauspieltruppe, bei der wir Koch ein Jahr später finden.<br />
Seine Bildung und die vorzügliche Schule der „Neuberin" verhalfen seiner Begabung<br />
zu rascher Entfaltung: Er betätigte sich nicht nur als Schauspieler, sondern auch als<br />
Autor und Übersetzer 4 ; sogar als Dekorationsmaler leistete er Beachtliches 5 . Durch zwei<br />
Dezennien nahm er, zunächst in tragischen, später in komischen Rollen exzellierend, an<br />
den Wanderungen der Neuberschen Truppe, an den Erfolgen und Rückschlägen ihrer<br />
Theaterreform teil. 1737 vermählte er sich mit einem Mitglied ihrer Gesellschaft, einer<br />
Schwägerin des Kupferstechers Bernigeroth, von dem uns Bildnisse Kochs und seiner<br />
zweiten Frau bekannt sind". Der allmähliche wirtschaftliche und künstlerische Niedergang<br />
des Ensembles der berühmten Prinzipalin, die, bei aller bewundernswerten Tatkraft und<br />
von hohem Ethos getragenen Auffassung ihres Berufes in einer feindseligen Umwelt,<br />
nach ihrer Rückkehr aus Rußland und dem Bruch mit Gottsched nicht mehr die Beziehungen,<br />
die Beweglichkeit und Geschäftstüchtigkeit besaß, um veränderten Ansprüchen<br />
und neuen Konkurrenten zu begegnen, veranlaßte Koch 1743, sein Glück bei anderen<br />
renommierten Schauspielgesellschaften in Hamburg 7 und Prag 8 zu versuchen. Doch kehrte<br />
er noch einmal für vier Jahre zur Neuberin zurück, bis er 1748 endgültig die vor dem<br />
Ruin stehende Truppe verließ und sich nach Wien wandte, wo er in Selliers „Entreprise"<br />
den Kampf um das regelmäßige Schauspiel fortsetzte. Da seine erste Frau schon 1741<br />
gestorben war, vermählte er sich in Wien mit der Schauspielerin Christiane Henriette<br />
Merleck, deren Schönheit von den Zeitgenossen enthusiastisch gepriesen wird 9 . 1749 nach<br />
2 Franz Schuch d. J. (1741-1771) übernahm 1764 nadi dem Tode seines Vaters, der als „Hanswurst"<br />
berühmt war, in Breslau das preußische Privileg, kam nach Berlin und errichtete hier<br />
ein massives Theater in der Behrenstraße.<br />
3 Vgl. Karl Konrad: Die deutsche Studentenschaft in ihrem Verhältnis zu Bühne und Drama,<br />
Berlin 1912, S. 96 ff.<br />
4 Er schrieb u. a. die (ungedrudtten) Dramen „Sancio und Sinilde", „Titus Manlius oder Der<br />
Edelmann in der Stadt"; „Der Philosoph auf dem Lande", „Der Tod Cäsar's", „Pigmalion",<br />
„Das Schicksal des Damot", die alle unter Aufsicht Gottscheds entstanden. Viel gespielt<br />
wurde auch Kochs Obersetzung von Voltaires „Verschwenderischem Sohn".<br />
5 Vgl. die Briefe Johann Neubers an Gottsched vom 17. 9. 1730 und vom 21. 7. 1731 (Reden-<br />
Esbeck, S. 97 u. 102).<br />
• 1760 und 1761 nach den Gemälden von E. G. Hausmann. Abbildungen u. a. bei Gerhard<br />
Wahnrau: Berlin, Stadt der Theater (Berlin 1957), S. 117, und in „Spemanns Goldenem Buch<br />
des Theaters" (Stuttgart 1912), S. 113.<br />
7 Bei der Truppe von Sophie Schröder (1714-1793), der späteren Gattin Konrad Ackermanns.<br />
• Bei Joseph Felix Kurz dem Älteren (geb. 1690).<br />
• Vgl. Fürstenau (s. Anm. 1), S. 27 f.; ferner die brieflichen Berichte Karl Lessings über ihr<br />
Berliner Auftreten.<br />
20
Leipzig zurückgekehrt, gelang es ihm mit Hilfe einflußreidier Gönner 10 , vom König die<br />
Ernennung zum „Hof-Comoedianten" mit einem kursächsischen Privilegium 11 neben der<br />
Neuberin zu erwirken.<br />
Er stellte sich nun eine eigene Truppe zusammen und begann am 6. Juli 1750 seine Vorstellungen.<br />
Leipzig bot zu dieser Zeit wohl im gesamten deutschen Sprachraum die günstigsten<br />
Bedingungen für ein regelmäßiges Schauspiel, und die Wandertruppen, von<br />
denen oft zwei gleichzeitig in und vor der Stadt auftraten, kämpften verbissen um jede<br />
Spielmöglichkeit. Drei Messen im Jahr sorgten für Publikum, die Universität und ein<br />
reger Buchhandel hatten bewirkt, daß Leipzig um die Mitte des Jahrhunderts die Hochburg<br />
des literarischen Lebens in Deutschland geworden war. Von den theaterfreundlichen<br />
Universitätsprofessoren seien nur Gottsched, Geliert und Clodius genannt. Aus der Vielzahl<br />
aufstrebender und etablierter Literaten, die dem Theater nahestanden, ragten der<br />
junge Lessing und sein Studienfreund Christian Felix Weiße hervor. Während Lessing<br />
sich zunächst darauf beschränkte, das Theater zu frequentieren und mit den Mitgliedern<br />
der Kochschen Truppe umzugehen, begannen Weiße und Koch eine Zusammenarbeit, die<br />
Kochs Truppe für die nächsten Jahrzehnte ihr besonderes Gepräge verlieh und Weiße<br />
zum beliebtesten deutschen Bühnenautor im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts erhob.<br />
Die Begründung und Verbreitung des deutschen Singspiels ist wohl die bekannteste der<br />
Pioniertaten Kochs, die in die Leipziger Blütezeit seines Wirkens fallen. Er hatte schon<br />
früh den Erfolg bemerkt, mit dem musikalische Intermezzi die ehemalige Funktion des<br />
Harlekin übernommen hatten, das langatmige Pathos der Alexandriner-Tragödien dem<br />
Publikum erträglich zu machen. Zudem war die Oper die angesehenste und am besten<br />
besuchte theatralische Gattung. Koch erkannte eine „Marktlücke" und beschloß, mit seinem<br />
Schauspielensemble Musiktheater zu bieten, das nicht den Aufwand und die Virtuosität<br />
der Oper erforderte, aber neben den ohnehin schon üblichen Balletten nun Gesangspartien,<br />
Lieder von eingängiger Melodik und frischer Natürlichkeit in einem heiteren,<br />
einfachen Handlungsablauf präsentierte, der seine Anziehungskraft teilweise durch sozialkritische<br />
Tendenz des - meist französischen - Stoffes noch erhöhte.<br />
Die derbe ,ballad opera' „The devil to pay", die der Ire Charles Coffey in der Nachfolge<br />
von Gays „Beggar's Opera" verfaßt hatte, war schon von der Schönemannschen<br />
Truppe 1743 in der Übersetzung Borcks 12 und mit der Originalmusik in Berlin gespielt<br />
worden. Da Schönemann Text und Noten seines Erfolgsstücks auch 1750 in Leipzig unter<br />
Verschluß hielt, veranlaßte Koch seinen Freund Weiße zu einer Neubearbeitung des Originals,<br />
die der Korrepetitor der Kochschen Truppe, Johann Georg Standfuß, mit neuen<br />
Melodien versah. Am 6. Oktober 1752 wurde ihre Fassung unter dem Titel „Der Teufel<br />
ist los oder Die verwandelten Weiber" mit durchschlagendem Erfolg zum ersten Mal aufgeführt;<br />
ein Datum, das als Geburtsstunde des deutschen Singspiels gilt. Gottscheds Abneigung<br />
gegen das Stück und der enorme Zulauf des Publikums hatten einen Theater-<br />
10 Vor allem der wohlhabende Magister Steinel, der Koch auch Prologe und Übersetzungen<br />
lieferte, setzte sich für ihn ein.<br />
11 Abgedruckt bei Reden-Esbeck (s. Anm. 1), S. 328.<br />
12 Caspar Wilhelm v. Borck, preußischer Gesandter in London, ist vornehmlich durch seine<br />
Alexandriner-Übersetzung von Shakespeares „Julius Caesar" bekannt geworden, die 1741 in<br />
Berlin bei Ambrosius Haude erschien.<br />
21
krieg zur Folge, der sich in diversen Flugschriften 13 austobte und Gottscheds ohnehin<br />
gesunkenes Ansehen ruinierte, so daß er sich von seiner langjährigen Einwirkung auf die<br />
Bühne gänzlich zurückzog. Nachdem auch für die Fortsetzung des „Devil to pay" Weiße<br />
und Standfuß gewonnen worden waren, wurde die „Operette" zur Spezialität der Kochschen<br />
Truppe, allerdings erst im neuen Theater auf der Rannstädter Bastei und durch<br />
das Schaffen Johann Adam Hillers u , der nach Standfuß' Tod die Kompositionen zu den<br />
Singspielen Weißes lieferte. Insgesamt 9 Operetten entstanden in Zusammenarbeit Weißes<br />
mit Standfuß und Hiller, die alle ihre Uraufführung auf der Kochschen Bühne erlebten:<br />
„Der Teufel ist los" (6. 10. 1752), „Der lustige Schuster" (18. 1. 1759), „Lottchen<br />
am Hofe" (24. 4. 1767), „Die Liebe auf dem Lande" (18. 5. 1768), „Die Jagd" (29. 1.<br />
1770), „Der Aerndtekranz" (1771), „Der Dorfbaibier" (1. 8. 1771), „Der Krieg" (17. 10.<br />
1772) und „Die Jubelhochzeit" (5. 4. 1773).<br />
Hatte schon 1749 die Erteilung des Privilegs, ohne daß Koch eine Truppe besaß, die ungewöhnliche<br />
Achtung bezeugt, die er am sächsischen Hof genoß (der ihn 1764 auch nach<br />
Dresden berief), so spricht in den folgenden Jahrzehnten die Bereitwilligkeit zahlreicher<br />
Schriftsteller und Künstler, für Kochs Bühne zu arbeiten 15 , für das hohe Ansehen, das<br />
sich der Prinzipal durch seine Persönlichkeit und seine Theaterleitung erworben hatte.<br />
1766 war die Eröffnung seines Schauspielhauses auf der Rannstädter Bastei in Leipzig 10 ,<br />
an dessen Einrichtung neben dem Architekten Georg Rudolf Fäsch und Koch auch der<br />
Direktor der Leipziger Akademie, Adam Friedrich Oeser, wesentlichen Anteil hatte, ein<br />
Ereignis ersten Ranges. Goethe, der wie vor ihm /. E. Schlegel, Klopstock und Lessing<br />
als Student Kochs Auftreten in Leipzig erlebte, beschreibt den von Oeser gemalten Vorhang,<br />
der eine erstaunlich frühe Shakespeare-Apotheose enthielt, im 8. Buch des 2. Teils<br />
von „Dichtung und Wahrheit". Oeser schuf auch eine Reihe von Dekorationen für Kochs<br />
Theater 17 ; daß ein bedeutender Maler in solcher Stellung für eine private deutsche Schauspielbühne<br />
arbeitete, war ein Symptom der Aufwertung des Theaters zu einer bürgerlichen<br />
Bildungsstätte. Ferner porträtierte Oeser die umschwärmte jugendliche Liebhaberin<br />
der Kochschen Truppe, die von Goethe sehr geschätzte Karoline Schulze 18 , nachdem schon<br />
der berühmte Bildnismaler Anton Graff Madame Koch als „Pelopia" in Weißes Trauerspiel<br />
„Atreus und Thyest" verewigt hatte. Graffs Gemälde wurde durch Johann Fried-<br />
1:1 Der größte Teil von ihnen ist besprochen auf S. 375-397 der noch heute maßgebenden Weiße-<br />
Monographie von Jakob Minor: Christian Felix Weiße und seine Beziehungen zur deutsdien<br />
Literatur des achtzehnten Jahrhunderts, Innsbrudt 1880. Vgl. ferner Wilhelm Härtung: Zum<br />
„komischen Krieg" Gottscheds und seiner Anhänger mit dem Schauspieldirektor Kodi (In:<br />
Euphorion 19, S. 792-794).<br />
14 Vgl. Georgy Calmus: Die ersten deutschen Singspiele von Standfuß und Hiller, Leipzig 1908.<br />
15 Zu Weißes beherrschender Stellung in der dramatischen Literatur der „Empfindsamkeit" trug<br />
nicht wenig die Kochsche Truppe bei, die fast alle der mehr als 30 Studie Weißes zur<br />
Uraufführung brachte. Weiße wirkte somit gleichsam als unbestallter „Theaterdichter" Kochs,<br />
eine Funktion, die eine Zeitlang auch Daniel Schiebeier und Karl Franz Romanus ausübten.<br />
Als häufigste Prologschreiber für Kodis Bühne betätigten sich die Professoren Clodius, Engel<br />
und Ramler, in Hamburg auch die Literaten Bode und Dreyer.<br />
'• Vgl. Gertrud Rudloff-Hille: Das Leipziger Theater von 1766 (In: Maske und Kothurn, 1968,<br />
S. 217-238).<br />
17 „26. 9. 1770: Eine sehr schöne Dekoration vom Herrn Professor Oeser ward denselben Abend<br />
zum erstenmal aufgestellt; eine neue Bereicherung des auch im Äußerlichen brillanten<br />
Kochischen Theaters!" (C. H. Schmid: Das Parterr, 1771, S. 264).<br />
1S Vgl. die wertvollen „Lebenserinnerungen der Karoline Schulze-Kummerfeld", hrsg. v. Emil<br />
Beneze. 2 Bde, Berlin 1915.<br />
11
ieh Bauses Kupferstich 19 bekannt und gilt als das erste künstlerisch bedeutende Rolltnbild<br />
der deutschen Theatergeschichte.<br />
Auch in Hamburg, wohin er sich nach Ausbruch des Siebenjährigen Krieges flüchtete,<br />
„interessierten sich einheimische Gelehrte und witzige Köpfe für Kochs Theater", wie<br />
Schütze, der zeitgenössische Hamburger Theaterhistoriker schreibt. „Bode, Lessing und<br />
mehrere gute Köpfe hielten mit Koch und einigen seiner Schauspieler Abendzirkel, in<br />
welchen über Sachen der Kunst und Bühne gesprochen ward. Manches Gute und Bessere<br />
ging aus diesen freundschaftlichen Unterhaltungen auf die Bühne und in das große Publikum<br />
über." 20<br />
In Hamburg erreichte Koch ebenfalls die Kontinuierlichkeit des Theaterbetriebs, der er<br />
in Leipzig ein so hohes Niveau verdankt hatte. Hier wie in Leipzig betonen die Chronisten,<br />
daß sich vor ihm kein Bühnenleiter über einen so langen Zeitraum am Ort habe<br />
halten können 21 . Hier wie dort verschaffte er der Einwohnerschaft durch geschickte, ökonomische<br />
Verwaltung, durch vielseitigen Spielplan und, wenn es nötig war, Abstecher in<br />
die Umgebung den Genuß eines stehenden Repertoiretheaters, obwohl er ohne jeden Zuschuß,<br />
nach rein privatunternehmerischen Prinzipien arbeiten mußte.<br />
Wenn eine Biographie Kochs hervorhebt, ihm sei die Entstehung der Theaterkritik im<br />
heutigen Sinne zu verdanken, so dürfen wir doch den Wert jener ersten Aufführungsberichte<br />
nicht zu hoch veranschlagen. Die „Schildereyen", „Vergleichungen", „Sendschreiben"<br />
und „Beantwortungen", die teils selbständig, teils in Zeitschriften erschienen,<br />
waren zum großen Teil Pamphlete, deren meist anonyme Verfasser sich mit oft sehr geringer<br />
Qualifikation selbstherrlich in dem neuen Beruf des „Kunstrichters" tummelten,<br />
dem Schauspieler in apodiktischem Ton seine „Fehler" vorrechneten und den Vorwurf<br />
der „Partheylichkeit", den der jeweils gegnerische Rezensent automatisch erhob, entrüstet<br />
von sich wiesen, obwohl der Parteigeist, der das Publikum dieser Epoche kennzeichnet,<br />
aus jeder Zeile sprach. Kochs Bühne stand insbesondere im Mittelpunkt der<br />
Fehden dreier Kritiker, deren Schriften 22 , mit Vorsicht benutzt, uns doch einigen Aufschluß<br />
über die Leistungen seiner Akteure geben können: der Erfurter, dann Gießener<br />
Professor Christian Heinrich Schmid, dessen Verdienste als Theaterhistoriker lange durch<br />
seine zwielichtige Rolle in der Literatur verdunkelt waren 23 , sowie der Berliner Christian<br />
August Bertram 2 * und der Hallenser Johann Jost Anton vom Hagen 25 , beide Gegner<br />
** Sehr häufig abgebildet, u. a. bei Wahnrau (s. Anm. 6), S. 117.<br />
20 Joh. Fr. Schütze: Hamburgische Theatergeschichte, Hamburg 1794, S. 310.<br />
21 „Keine Gesellschaft hatte vorher so lange zu Hamburg ausgedauert, keine so viel Beifall eingeärndtet,<br />
keine so viel Ehre genossen, und keine ist so sehr vermißt worden, als sie." (Chronologie<br />
des deutschen Theaters, 1775, S. 129; s. Anm. 23).<br />
22 Eine Zusammenstellung aller z. Z. bekannten zeitgenössischen Flugschriften und sonstigen Broschüren<br />
über Koch und seine Truppe folgt im 2. Teil des Aufsatzes.<br />
23 Vgl. Christian Heinrich Schmid: Chronologie des deutschen Theaters (1775), neu hrsg. v. Paul<br />
Legband, Berlin 1902; eine der wichtigsten theaterhistorischen Quellen, audi zur Kenntnis<br />
der Kochschen Truppe. Schmids Sdirift „Das Parterr", Erfurt 1771, enthält auf S. 255-324<br />
ausführliche Besprechungen der Leipziger Aufführungen Kochs.<br />
24 Herausgeber mehrerer wertvoller Theaterzeitschriften in Berlin. Vgl. über ihn Wilhelm Hill:<br />
Die deutschen Theaterzeitschriften des achtzehnten Jahrhunderts, Weimar 1915, S. 62-72.<br />
25 Vgl. über ihn Hill (s. Anm. 24) S. 38 ff. Sein „Magazin zur Geschichte des deutschen Theaters",<br />
Halle 1773, von dem nur 1 Stück erschien, enthält eine ausführliche, sehr abfällige<br />
Charakteristik der Kochschen Truppe und ihrer „Emilia-Galotti"-Aufführung in Berlin. Hagen<br />
23
Kochs und erbitterte Feinde Schmids. So einseitig und unmaßgeblich ihre Urteile oft sind,<br />
so enthalten sie doch manchen Hinweis auf die Darstellungsweise der Schauspieler, die<br />
uns nun in Kochs Berliner Theater begegnen.<br />
(Der zweite Teil folgt im nächsten Heft)<br />
ist wahrscheinlich der Herausgeber der 1783 erschienenen „Gallerie von teutschen Schauspielern"<br />
(neu hrsg. v. R. M. Werner, Berlin 1910), die ich im folgenden ebenfalls unter<br />
„Hagen" zitiere, obwohl darin meist fremde Kritiken übernommen sind.<br />
„Wahrheit und Freyheit"<br />
Die „Berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen", 1740 bis 1874<br />
Von Walther G. Oschilewski<br />
Am 5. Oktober 1723 wurde Ambrosius Haude das königliche Privileg erteilt, die 1614<br />
von den Brüdern Hans und Samuel Kaue gegründete und zuletzt von Johann Christoph<br />
Papen geleitete Buchhandlung in der Straße An der Stechbahn in unmittelbarer Nähe<br />
des Stadtschlosses fortzuführen.<br />
Ambrosius Haude (1690-1748) war ein wohlhabender, tatkräftiger und hochgebildeter<br />
Mann, der unter anderen die lateinische und französische Sprache beherrschte. Zu dem<br />
jungen, literarisch interessierten Kronprinzen, dem späteren König Friedrich //., unterhielt<br />
er enge Beziehungen, die dessen Lehrer, Duhan de Jandin, vermittelt hatte. Der<br />
hartherzige Vater, Friedrich Wilhelm I., hatte dem Kronprinzen nicht nur das Flötenspiel,<br />
sondern auch den Besitz zahlreicher, nach seiner Meinung „verbotener" Bücher untersagt.<br />
Er ließ diese Bücher an Haude verkaufen, der sie aber später dem Kronprinzen<br />
einzeln zurückgab. Als der König die einige tausend Bände umfassende Privatbibliothek<br />
des Kronprinzen, die in einem Hinterzimmer des Haudeschen Ladengeschäftes bewahrt<br />
und von ihm häufig benutzt wurde, entdeckte, ließ er sie in Amsterdam versteigern.<br />
Der junge Friedrich, 1740 nunmehr König, hat Haudes wagemutiger Hilfe auf verschiedene<br />
Art und Weise gedankt. Der Verlagsbuchhändler, der schon seit 1735 den „Potsdamischen<br />
Staats- und Gelehrten Merkurius" herausbrachte, erhielt nun auch den Freibrief<br />
für die Herausgabe einer zweiten Berliner Zeitung, den ihm Friedrich Wilhelm 1.<br />
verweigert hatte. Haude nannte das Blatt „Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten<br />
Sachen"; die erste Ausgabe erschien am 30. Juni 1740 und wurde zunächst dienstags,<br />
donnerstags und sonnabends im Haudeschen Domizil an der Schloßfreiheit gegenüber<br />
dem Schloßportal und auf dem Königlichen Hof-Post-Amt für 6 Pfennige ausgegeben.<br />
Um die gleiche Zeit, nur einige Tage später, erschien auf Veranlassung des Königs<br />
im Haudeschen Verlag auch eine literarisch-politische Zeitschrift in französischer Sprache:<br />
„Journal de Berlin" (2. Juli 1740), das der Prediger und Gymnasialprofessor Jean Henry<br />
Formey leitete.<br />
24
Ao. 1740.<br />
$omtev|!ög,<br />
a&eriinifc&e 9?acf)ri$teit<br />
Ml<br />
€?Uat$* mtt> $elefovtctt
und, mit einem Strohhute auf dem Kopfe gezieret, verkehrt auf einen Esel gesetzt, so,<br />
daß sie ihr Gesichte nach der Extremität des Esels wendete. An ihrem Strohhute las man<br />
vorn und hinten die Worte: Oeffentliche Kupplerin! Der Scharfrichter gab ihr, nach<br />
geschehener Brandmarckung, mit vieler Geschicklichkeit einen tüchtigen Staupbesen, und<br />
alsdenn brachte man sie zur Arbeit in eine Salpeter-Grube. Um nun das Schauspiel desto<br />
beträchtlicher zu machen, mußten 2 junge Opfer-Mägde der Venus und bisherige Brodterwerberinnen<br />
der alten Gelegenheitsmacherin, mit dergleichen Strohhüten geschmückt,<br />
neben dem Esel hergehen, und Trabanten-Dienste tun. Vermutlich werden auch diese<br />
letztern ihren Vorwitz in Salpetergruben beseufzen müssen. Man glaubt hier, daß man<br />
diese besondere und sehr nützliche Art von Schauspielen künftig auch in anderen Ländern<br />
nachmachen möchte" („Berlinische Nachrichten", Nr. 17, 1749).<br />
Erst während des Siebenjährigen Krieges unter der Redaktion von Johann Gottlieb<br />
Krause gewannen die „Berlinischen Nachrichten" an Profil. Krause hatte schon früher<br />
die „gelehrten Artikel" bearbeitet. Bei diesem Teil des Blattes handelte es sich nicht um<br />
literarische Abhandlungen. Er und seine Nachfolger bevorzugten eine bunte Mischung<br />
von Nachrichten und Darstellungen der verschiedenstens Wissens- und Lebensgebiete.<br />
Von den Kriegsereignissen blieben auch die Zeitungen nicht verschont. Die „Berlinischen<br />
Nachrichten" hatten den deutschstämmigen Kommandeur der russischen Truppen, General<br />
Graf Tottieben, einen „Aventurier" [ = Abenteurer im üblen Sinne, Glücksritter] genannt.<br />
Als die fremden Truppen Berlin besetzt hatten, wurde Krause verhaftet und zur<br />
Prozedur eines öffentlichen Spießrutenlaufens auf dem Neuen Markt verurteilt, jedoch<br />
im letzten Augenblick mit einem Verweis begnadigt.<br />
Ambrosius Haude starb 1748 im Alter von 58 Jahren. Buchhandel, Verlag und die Zeitung<br />
kamen in den Besitz der Witwe Susanne Haude und ihres Bruders, des seit 1739<br />
privilegierten Buchhändlers Johann Carl Spener d. Ä., den Haude noch kurz vor seinem<br />
Tode als Teilhaber in das Unternehmen aufgenommen hatte. Die Firma hieß von nun an<br />
„Haude und Spener", als Buchverlag blieb es so bis auf den heutigen Tag.<br />
Auch Spener verstarb bald (1756). Die beiden Witwen Haude und Spener führten zunächst<br />
das Geschäft allein weiter. 1772 übernahm es Speners zweiundzwanzigjähriger<br />
Sohn, Johann Carl Philipp Spener d. ]., und er war damit auch Herausgeber der „Berlinischen<br />
Nachrichten", die er bis 1827 mit Geschick und Niveau redigierte. Er war ein<br />
weitgereister Mann von profunder Bildung, der enge Beziehungen zu bedeutenden Männern<br />
seiner Zeit unterhielt. Ihm ist die Einführung der ständigen Theaterkritik und eines<br />
regelrechten Feuilletons zu verdanken. Spener war aber auch der erste deutsche Verleger<br />
auf dem europäischen Festland, der seine Zeitung seit dem 25. Januar 1823 auf<br />
der von Friedrich König konstruierten Zylinder-Schnellpresse druckte.<br />
Das allgemeine Bild der Berliner Zeitungen bis zur Märzrevolution 1848 ist nicht gerade<br />
imponierend, wenn es auch hier und dort winzige Glanzpunkte aufweist. Der publizistischen<br />
Wirksamkeit der beiden privilegierten Zeitungen waren enge Grenzen gesetzt. Die<br />
noch neben dem „Berliner Intelligenz-Blatt" kurzzeitig bestehenden Blättchen wie „Mercure",<br />
„Spectateur", „Gazette de Berlin", „Berlinische Damen-Zeitung" und die von<br />
dem Prediger an der Dreifaltigkeitskirche und Pädagogen Johann-Julius Hecker gegründete<br />
„Gelehrte und Politische Zeitung" vegetierten dahin. Der Zensor stand immer wieder<br />
ins Haus. Zu den ärgsten Widersachern des geringen Freiheitsraumes der damaligen<br />
Presse gehörte der Justizminister und Chef des geistlichen Departements, der Rosenkreuzler<br />
Johann Christoph von Wöllner, ein eifernder Gegner der von Frankreich aus-<br />
26
gehenden und gegen Ende des 18. Jahrhunderts sich auch in Deutschland ausbreitenden<br />
Aufklärung. Wöllner war der Initiator des „Erneuerten Censur-Edicts für die Preußischen<br />
Staaten exklusive Schlesien" vom 19. Dezember 1788, mit dem eine Kabinettsordre<br />
an den Großkanzler von Carmer einherging, in der Friedrich Wilhelm I. glaubte<br />
feststellen zu müssen, „daß die Pressefreiheit in Pressefrechheit ausartet". Dieses „Censur-<br />
Edict" hat entscheidend dazu beigetragen, daß sich die Berliner Zeitungen mit ihrer an<br />
sich schon trostlosen Rolle gezwungenermaßen für lange Jahre abfinden mußten. Das<br />
fortschrittliche Element der Publizistik verlagerte sich auf die in Berlin zahlreich erscheinenden<br />
gelehrten, literarischen und unterhaltenden Zeitschriften, von denen die von<br />
Friedrich Gedike und Johann Erich Biester herausgegebene „Berlinische Monatsschrift"<br />
(1783-1796) und das „Athenäum" (1798-1800) der Brüder August Wilhelm und Friedrich<br />
Schlegel die bedeutendsten waren.<br />
Johann Carl Philipp Spener überantwortete im Januar 1827 nach dem frühen Tod seines<br />
Sohnes und wenige Wochen vor seinem eigenen den Verlag seinem langjährigen Gehilfen<br />
Joseephy; Druckerei und Zeitung gingen in den Besitz des Kgl. Bibliothekars<br />
Samuel Heinrich Spiker über, der den „Berlinischen Nachrichten" lange Zeit ein umsichtiger<br />
Redakteur war. Die Zeitung behielt vorerst ihren alten Namen und wurde<br />
nicht in „Spenersche Zeitung" umbenannt, als sie von Spiker erworben und redigiert<br />
wurde, wie aus den Ausgaben vom Ende der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts ersichtlich<br />
ist. Man hatte sich aber im Laufe der Zeit daran gewöhnt, jedes der beiden Berliner<br />
Blätter nach ihrem Besitzer zu nennen, also „Vossische Zeitung" und „Spenersche<br />
Zeitung", obwohl beide ihre traditionellen Titel über anderthalb Jahrhunderte beibehielten.<br />
Der Volksmund sprach seit dem Revolutionsjahr 1848 nur noch von der „Tante<br />
Voss" und dem „Onkel Spener"; die eine Zeitung war populär und auflagenstark, die<br />
andere (Spener) stützte sich vornehmlich auf das mehr konservative Besitz- und Bildungsbürgertum.<br />
Spiker starb 1858, die „Spenersche Zeitung" wurde zunächst von seinen Erben fortgeführt.<br />
Nach der Reichsgründung, im ständigen Konkurrenzkampf auch mit den inzwischen<br />
neu erstandenen Blättern („Berliner Börsen-Zeitung", 1855; „Berliner Börsen-<br />
Courier", 1868; „Berliner Tageblatt", 1871; „Germania", 1870) konnte sie sich kaum<br />
noch am Leben erhalten. Obwohl die „Spenersche Zeitung" einen gar nicht so schlechten<br />
Ruf über Berlin hinaus hatte, machte es sich doch bemerkbar, daß ihr die richtige Führung<br />
fehlte, um Wirtschaftlichkeit und publizistischen Auftrag in Balance zu halten. Da<br />
konnten ihr die offiziösen „Hilfestellungen", die ihr - nach Moritz Busch, dem damaligen<br />
Pressereferenten des Auswärtigen Amtes - durch gelegentliches Zuspielen der politischen<br />
Intentionen Bismarcks zuteil wurden, auch nicht viel helfen. Das Blatt wurde<br />
mehrmals von pressefremden Interessen- und Finanzgruppen übernommen, bis es schließlich<br />
im Herbst 1874 in die nationalliberale „National-Zeitung" aufging. Als letzten<br />
Fortsetzungsroman brachte die „Spenersche Zeitung" Paul Heyses „Die Kinder der<br />
Welt", die im Gegensatz zu den bürgerlich-christlichen „Kindern des Himmels" stehen<br />
und in dem zumindest ansatzmäßig versucht wird, sich trotz individualistischer Einstimmung<br />
wohlwollend mit der Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung auseinanderzusetzen.<br />
Es gehörte Mut dazu, diesen diesseitigen Roman den konservativen Lesern darzubieten.<br />
Der Abdruck soll dem Vernehmen nach das Ende der „Spenerschen Zeitung"<br />
beschleunigt haben.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 37, Am Fischtal 19<br />
27
Die Weingroßhändler-Familie Dalchow in Charlottenburg<br />
Von Dr. Jürgen Wetzel<br />
Vor einiger Zeit gelang es dem Landesarchiv Berlin, die „Erinnerungsblätter" der Charlottenburger<br />
Weingroßhändler-Familie Dalchow zu erwerben. Diese Archivalien bilden<br />
im streng archivischen Sinne zwar keinen echten Nachlaß, bieten aber genügend Material,<br />
um die Entwicklung des Geschäfts aus kleinen Anfängen bis zu einer der größten<br />
Weinhandlungen Deutschlands verfolgen zu können.<br />
Der Firmengründer Johann Gustav Dalchow, 1825 in Zerbst als 10. Kind eines Webers<br />
geboren, kam Anfang der vierziger Jahre nach Berlin 1 . Hier begann er 1841 in<br />
der Hirschelstraße beim Materialwaren- und Weinhändler F. L. Meyer eine kaufmännische<br />
Lehre. Nach den Lehrjahren gehörte er dem Hause noch acht Jahre als „Disponent"<br />
an 2 . Aus dieser Zeit sind Briefe an seine Eltern vorhanden, in denen der junge<br />
Dalchow die dramatischen Ereignisse der Märztage des Jahres 1848 schildert. Trotz vieler<br />
Veröffentlichungen ist es sicher nicht uninteressant, die Vorgänge noch einmal aus der<br />
Sicht eines jungen Augenzeugen zu betrachten. Am 15. März schreibt Dalchow nach<br />
Zerbst: „Berlin ist jetzt sehr aufgeregt, obgleich Zusammenrottungen und Versammlungen<br />
ähnlicher Art nur aus dem Pöbel und verdorbenen Litteraten bestanden; die Bürger<br />
sind zu einsichtsvoll, als daß sie es sollten machen wie in Paris". Nach Ausschreitungen<br />
„in den Zelten" und in der Stadt spitzte sich aber die „kriegerische Lage" zu, und er<br />
befürchtete, zum Militär einberufen zu werden. Das „lustige Leben" sei nun wohl für<br />
ihn zu Ende, fügte er bedauernd hinzu 3 .<br />
Vom Geschehen überwältigt, schreibt Gustav Dalchow vier Tage später aus der „Stadt<br />
der Schrecken": „Ich bin noch am Leben, Tausende und aber Tausende sowohl Militär<br />
als auch Bürger haben ihr Leben geopfert 4 . Die Revolution ist seit gestern Mittag ausgebrochen."<br />
5 Es folgt die lebhafte Schilderung des Ablaufs der Ereignisse. Auf dem<br />
Höhepunkt der Krise hatte König Friedrich Wilhelm IV. am 18. März „vom Schloß<br />
aus alles frei" gegeben; er hatte in einem königlichen Patent Pressefreiheit, die Einberufung<br />
des Landtags und weitere Reformen in Aussicht gestellt 6 . Am Abend sollte „ganz<br />
Berlin illuminirt werden vor Freude. (Die Zettel waren schon angeklebt und ausgegeben.)<br />
Um 2 Uhr brachte ein Deputation Bürger von Berlin dem König ein Lebehoch.<br />
Das Schloß ist umzingelt von Militär und Volk; es fallen einige Schüsse auf die Bürger<br />
. . . Jetzt schrie das Volk: Verrath, Verrath, zu den Waffen, man will uns morden<br />
.. . Alle Straßen wurden verbarrikadirt, die Kutschen und Wagen wurden umgeworfen,<br />
Plumpen und Brücken, alles was sich auf den Straßen befand wurde demolirt,<br />
1 Alle im folgenden gemachten Angaben stammen, falls nicht anders vermerkt, aus: Landesarchiv<br />
Berlin, Rep. 200, Acc. 2036. Die Fundstellen sind bei den Belegen jeweils in Klammern<br />
angegeben.<br />
- Persönliche Daten in der „Jubel-Zeitung", Privatdruck Charlottenburg 1878 (Nr. 139).<br />
• Brief vom 15. 3. 1848 (Nr. 199).<br />
4 Circa 240 Menschen sind während der Kämpfe umgekommen. Vgl. K. Kettig, Berlin im 19. u.<br />
20. Jahrhundert 1806-1945, in: Heimatchronik Berlin, Köln 1962, S. 395.<br />
' Brief vom 19. 3. 1848 (Nr. 200).<br />
6 Vgl. Kettig, S. 394.<br />
28
I. 0. DAL€HOW,<br />
Hoflieferant Ihrer Majestät der Königin Elisabeth von Preussen,<br />
Charlottenburg, Berliner-Strasse No. 63.<br />
(Stammhaus der Firma nach der ersten Erweiterung, um 1860)<br />
das Pflaster aufgerissen und nach den Dächern geschleppt, auf freier Straße wurden<br />
Kugeln gegossen, die Gewehrläden gestürmt, alles schwebt in Todesgefahr." Militär<br />
ströme durch alle Tore in die Stadt. Das Volk decke die Dächer ab und bombardiere<br />
die Soldaten mit Ziegeln und Möbeln. Von allen Seiten hört man Kanonendonner und<br />
Geschrei. „Überall schlagen die Flammen empor . . . wer Berlin früher gesehen hat, kennt<br />
es bald nicht mehr wieder, die Straßen schwimmen von Blut." 7<br />
Inzwischen hatte Dalchow Nachrichten über Unruhen in seiner Heimatstadt erhalten.<br />
Verwundert schreibt er seinen Eltern: „Daß auch die sonst so friedliche Stadt Zerbst<br />
von dem wilden Geiste der jetzigen Zeit nicht verschont geblieben ist, will mir gar<br />
nicht einleuchten . . . Wenn es nun auch wohl schlimm hergegangen ist, so wird es wohl<br />
Wie Anm. 5.<br />
29
nie in Vergleich zu der Berliner Revolution kommen können ..." Er sei von dem Geschehen<br />
so ergriffen, daß ihm noch mehrere Tage hindurch „das Glockengeläute und<br />
der Kanonendonner durch die Ohren" surrten, „und doch schien mir dies schreckliche<br />
Ereigniß nur ein Traum zu seyn" 8 .<br />
Nach Wiederherstellung der Ruhe durch das Militär normalisierte sich das Leben. Zwar<br />
nahm Dalchow weiterhin lebhaften Anteil an der politischen Entwicklung, doch im<br />
Vordergrund seines Interesses stand das berufliche Fortkommen.<br />
Im Sommer 1849 übernahm Gustav Dalchow die Leitung einer Charlottenburger Filiale<br />
der Firma Meyer. Dort erwarb er sich durch Fleiß und Umsicht die nötigen Kenntnisse<br />
zur selbständigen Führung eines Geschäfts. Nach vier Jahren hatte er genügend Kapital<br />
angesammelt, um vom Ratsmaurermeister Irmisch in der Berliner Straße 63 ein Haus<br />
mieten zu können 9 . Hier eröffnete er am 25. Oktober 1853 ein „Colonial-Wein-Italienerwaaren-<br />
und Butter-Geschäft" 10 . Handschriftlich zeigte er seinen Kunden die Eröffnung<br />
an: „Das seit mehreren Jahren genossene Vertrauen hiesiger Stadt, als auch<br />
genaue Kenntniß des Geschäfts und hinreichende Mittel, erlauben mir, Sie zu bitten,<br />
bei vorkommenden Bedarf in diesen Artikeln, mich mit Ihren schätzbaren Aufträgen zu<br />
beehren, indem es mein eifrigstes Bestreben sein wird, mir Ihre vollkommenste Zufriedenheit<br />
durch sorgfältige Bedienung, gute Waaren und solide Preise zu erwerben." 10 Eine<br />
der Anzeige beigefügte Preisliste zeigt, daß es Gustav Dalchow mit diesen Grundsätzen<br />
Ernst war. Eine Flasche Piesporter offerierte er für 10, eine Flasche Alten Madeira für<br />
20 und eine Flasche Chäteau Larose für 30 Silbergroschen 11 . Der zuvorkommenden Bedienung,<br />
den guten Waren und den soliden Preisen war es zu verdanken, daß das Geschäft<br />
in wenigen Jahren einen erstaunlichen Aufschwung nahm. Bald war Dalchows<br />
geschäftliche Position so gefestigt, daß er eine Familie gründen konnte. 1857 heiratete<br />
er Clara Hartwich, die Tochter eines Charlottenburger Kaufmanns 12 . Da seine Frau<br />
aus dem gleichen Berufsstand kam, war sie ihm eine verständnisvolle und kenntnisreiche<br />
Partnerin. Sie hat es vor allem verstanden, dem Aufschwung des Geschäfts durch gesellschaftliche<br />
Repräsentation auch äußerlich Ausdruck zu verleihen. In den Jahren 1859 bis<br />
1865 wurden dem Ehepaar drei Söhne und eine Tochter geboren.<br />
Eine Liebhaberei, das Reisen, führte Johann Gustav Dalchow durch ganz Europa, von<br />
Kopenhagen bis Bukarest, von Biarritz bis Petersburg. Eine aus dem Jahre 1878 erhaltene<br />
Liste der besuchten Städte enthält mehr als dreihundert Ortsnamen 13 . Auf seinen<br />
Reisen verstand er es, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Er lernte die<br />
Lieferanten und Bezugsquellen seiner vielen Artikel persönlich kennen und war so stets<br />
in der Lage, die billigsten und besten Waren aus allen Teilen Europas zu liefern. Den<br />
Wein, schreibt er seinen Kunden, beziehe er direkt „von den ersten Häusern in Bordeaux,<br />
Reims, Tokaj, London, am Rhein und an der Mosel" 14 . Auf einer dieser Reisen<br />
zu seinen Siebenbürger Verwandten wurde er dazu angeregt, Ungarnweine im großen<br />
* Brief vom 27. 3. 1848 (Nr. 201).<br />
* „Jubel-Zeitung" 1878 (Nr. 139) sowie verschiedene Ansichten des Hauses (Nr. 45, 129, 224).<br />
10 Handschriftl. Geschäftsanzeige Oktober 1853 (Nr. 127).<br />
11 (Nr. 128,129).<br />
12 „Jubel-Zeitung" 1878 (Nr. 139, auch zum folgenden), Verlobungsanzeige (Nr. 45) und Familienfoto<br />
(Nr. 225).<br />
u (Nr. 137).<br />
11 Preisliste (Nr. 129).<br />
30
Johann Gustav Dalchow<br />
(1825-1889)<br />
Stil nach Deutschland einzuführen. Um die große Nachfrage befriedigen zu können,<br />
verband er sich 1871 mit Samuel Löwy zum „Vertrieb des Ungarwein Engros-Geschäfts"<br />
15 .<br />
Längst war die Weingroßhandlung dem engen Charlottenburger Rahmen entwachsen<br />
und weit über die Grenzen Preußens ein Begriff geworden. Das Kolonialwarengeschäft<br />
wurde nur noch nebenbei weiter betrieben, 1882 schließlich an den Kaufmann Magnus<br />
Rücken verkauft 16 . Das von Dalchow 1861 käuflich erworbene Haus in der Berliner<br />
Straße 63 hat er - den gehobenen Ansprüchen Rechnung tragend - zu einem repräsentativen<br />
Palais ausbauen lassen 17 . Krönender Abschluß der ersten Phase des Geschäftsaufbaus<br />
war die Ernennung Dalchows zum Hoflieferanten der Königin Elisabeth und<br />
des Prinzen Friedrich Carl von Preußen 18 . Johann Gustav Dalchow, der 1853 nur eine<br />
bedingte Aufenthaltsgenehmigung erhalten 19 und erst 1855 das Charlottenburger Bürgerrecht<br />
erworben hatte 20 , gehörte nun zu den Honoratioren der Stadt. Er wurde Abgeordneter<br />
im Stadtparlament, und zahlreiche Vereine rechneten es sich zur Ehre an, ihn<br />
in ihrer Mitte zu haben 21 .<br />
Dieser rasche Aufstieg war typisch für die beiden Jahrzehnte vor der Reichsgründung.<br />
Viele Liberale hatten sich aus Enttäuschung über den Ausgang der Revolution von 1848<br />
ausschließlich wirtschaftlichen Interessen zugewandt. In ganz Deutschland nahmen in<br />
15 „Gründungsanzeige", Januar 1871 (Nr. 131).<br />
16 Geschäftsanzeige (Nr. 145).<br />
17 Foto-Abb. (Nr. 17 u. 230, letztere hier beigefügt).<br />
18 (Nr. 129, 135, 136 u. 144).<br />
19 Naturalisations-Urkunde der Regierung Potsdam vom 22. 9. 1853 (Nr. 2).<br />
20 Bürgerbrief vom 22. 3. 1855 (Nr. 3).<br />
21 Diverse Presseberichte (Nr. 5-9).<br />
31
Stammhaus<br />
der Firma Dalchow<br />
um 1900<br />
IIWIIIMI<br />
jenen Jahren Handel und Industrie einen außerordentlichen Aufschwung. Besonders<br />
aber nach der Reichsgründung, nach dem schnellen Sieg über Frankreich und dem Einströmen<br />
der Kriegsmilliarden geriet die wirtschaftliche Entwicklung in eine hektische<br />
Phase, die das kleine und mittlere Bürgertum in einen Rausch versetzte. „Jeder, der es<br />
sich nur irgendwie leisten konnte, wollte plötzlich mitgründen, mitgewinnen, mitaufsteigen."--<br />
Börsenspekulation und Strebertum, Prunksucht und ungehemmter „Ellbogendarwinismus"<br />
breiteten sich wie eine Seuche aus. Ohne soziales Empfinden gegenüber den<br />
wirtschaftlich Schwächeren glaubte das Bürgertum an einen permanenten wirtschaftlichtechnischen<br />
Aufschwung und ahnte nicht, daß es sich mit diesem blinden Fortschrittsglauben<br />
selbst betrog. „Wir leben in einer neuen, einer großen Zeit des Fortschritts, der<br />
Entwicklung auf allen Gebieten des Handels und der Industrie", heißt es in einem Zei-<br />
22 J. Hermand, Der gründerzeitlidie Parvenü,<br />
der Akademie der Künste, 1974, S. 7.<br />
32<br />
In: Aspekte der Gründerzeit. Ausstellungskatalog
tungsartikel, der sich mit dem Aufstieg der Firma Dalchow beschäftigt. „Zeit und Entfernungen<br />
sind überwunden. Keine Schranke hemmt mehr den Blick - Electricität und<br />
Dampf verbinden die Pole und halten in steter, unmittelbarer Wechselwirkung alle<br />
Theile der alten und der neuen Welt, und was der menschliche Geist erdacht, erschaffen,<br />
gewonnen - rasch wird es zum Gemeingut aller .. ." 2S Die Entwicklung des Hauses Dalchow<br />
veranschauliche, welche Ausdehnung der Handel genommen habe, der auch Charlottenburg<br />
an den weltweiten Beziehungen teilhaben läßt. Zwar gehörte Johann Gustav<br />
Dalchow nicht zu den rigorosen Glücksrittern, doch verkörperte er in einigen seiner<br />
Eigenschaften den Typ des zu schnellem Reichtum gelangten „Kommerzienrates", wie er<br />
uns in der Literatur bei Theodor Fontane und Gustav Freytag begegnet. 1878 stand<br />
Gustav Dalchow auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Mit einem aufwendigen Fest „wie<br />
Charlottenburg wohl nie zuvor ein ähnliches gesehen" 24 , feierte er im Kreise zahlreicher<br />
Geschäftspartner das 25jährige Firmenjubiläum. Seitenlang berichteten die Zeitungen<br />
über den Ablauf der Festlichkeiten, über die Ansprachen, die Speisen, die Toiletten der<br />
Damen und die Geschenke 25 . Auf dieser Feier wurde ein Prunk entfaltet, der dann um<br />
die Jahrhundertwende in Protzerei und Geschmacklosigkeit ausartete.<br />
Nach dem Tod Gustav Dalchows 1889 übernahmen seine beiden ältesten Söhne Alfred<br />
und Willy das Geschäft unter dem Namen /. G. Dalchow u. Söhne 26 . Hatte der Firmengründer<br />
durch seinen persönlichen Einsatz aus dem Nichts ein bedeutendes Unternehmen<br />
aufgebaut, so wuchsen seine Söhne in gesicherten Verhältnissen auf und genossen<br />
eine vorzügliche Erziehung. Nach dem Besuch des Charlottenburger Kaiserin-Augusta-<br />
Gymnasiums absolvierten beide eine kaufmännische Lehre. Da sein Bruder Alfred häufig<br />
krank war, wurde Willy Dalchow der eigentliche Chef des Unternehmens. Wie sein<br />
Vater erwarb er sich während der Lehre bei dem „Banquier" Aron Meyer in der Berliner<br />
Mohrenstraße gründliche kaufmännische Kenntnisse. Nachdem er ausgelernt hatte,<br />
gehörte er der Bank von 1884 bis 1887 als „Commis" an 27 . Nur kurze Zeit war er<br />
noch im väterlichen Geschäft tätig, bis er selbst die Weingroßhandlung übernahm. Kurz<br />
vor dem Tode seines Vaters heiratete er Olga Zimmermann, die Tochter eines Spandauer<br />
Bäckermeisters 28 . Seine Frau paßte sich sehr schnell den großzügigen Verhältnissen<br />
der Familie Dalchow an und hat es wie ihre Schwiegermutter verstanden, das Haus nach<br />
außen zu repräsentieren. 1890 und 1891 wurden dem Ehepaar die Söhne Georg und<br />
Gustav geboren 29 . Gustav starb jedoch schon nach zwei Jahren.<br />
Willy Dalchow hat die Weingroßhandlung wesentlich erweitert. Er eröffnete in Berlin<br />
und in den westlichen Vororten mehrere Filialen. In der Berliner Filiale Alexanderstraße<br />
42 - vis-a-vis dem königlichen Polizeipräsidium - richtete er außerdem ein Weinrestaurant<br />
ein, das sich großer Beliebtheit erfreute 30 . Die Dalchows besaßen inzwischen<br />
eigene Weinberge, eigene Weinkellereien und in allen weinproduzierenden europäischen<br />
23 „Neue Zeit" (Charlottenburg), 18. 11. 1871 (Nr. 133).<br />
24 „Deutsche Handelszeitung", 31. 10. 1878 (Nr. 143).<br />
25 „Jubel-Zeitung" 1878; „Neue Zeit", 29.10.1878; „Deutsche Handelszeitung", 31.10.1878<br />
(Nr. 139, 140, 142).<br />
26 Diverse Familien- und Geschäftsanzeigen (Nr. 18, 20-40, 154, 155).<br />
"' Zeugnis des Bankhauses, 31. 3. 1887 (Nr. 58).<br />
28 Heiratsanzeige (Nr. 72).<br />
2 * Privatanzeigen (Nr. 73, 79).<br />
30 „National-Zeitung", 23. 10. 1891 (Nr. 168).<br />
33
Ländern eigene Agenturen. Das Renommee der Firma war inzwischen in ganz Deutschland<br />
so groß, daß Willy Dalchow zum Hoflieferanten des Prinz-Regenten Luitpold von<br />
Bayern, des Großherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach und des Prinzen Heinrieb von<br />
Hessen-Darmstadt ernannt wurde 31 . Nach dem Tode seines Bruders Alfred und seines<br />
Teilhabers im Ungarnwein-Großhandel Samuel Löwy war Willy Dalchow seit 1905<br />
Alleininhaber des gesamten Unternehmens 32 . In diesen Jahren erreichte die Weingroßhandlung<br />
den Gipfel des Erfolges.<br />
Dem Stile der Zeit entsprechend wurde dieser geschäftliche Erfolg bei jeder sich bietenden<br />
Gelegenheit durch prunkvolle Feste zur Schau gestellt. In aufwendig dekorierten<br />
Sälen versammelte sich eine illustre Gesellschaft aus Geschäftsleuten, Militärs und Künstlern.<br />
Die Herren erhielten häufig in extra angefertigten Taschen mit der Photographie<br />
des Stammhauses teure Havannas, die Damen Erinnerungstücher als Gastgeschenke.<br />
Seidenbespannte Speisekarten kündigten Menüs bis zu zwölf Gängen mit erlesenem<br />
Wein und Champagner an. Die Diners wurden durch „künstlerische Darbietungen",<br />
durch Tafellieder, Couplets und Orchestermusik begleitet. Neben Walzern und Märschen<br />
erfreuten sich vor allem Stücke aus Wagner-Opern großer Beliebtheit 33 . Auf solchen<br />
Festen der Familie Dalchow, die typisch für die wilhelminische Ära waren, wurden<br />
patriotische Ansprachen gehalten, wurde gespielt, getanzt und en passant manches lukrative<br />
Geschäft abgeschlossen.<br />
Leider sind keine Quellen vorhanden, die Auskunft über das weitere Schicksal der Weingroßhändler-Familie<br />
geben könnten. Den Adreßbüchern ist zu entnehmen, daß die Firma<br />
1909 zum Kaiserdamm 96 verlegt und 1915 in eine GmbH umgewandelt wurde. Geschäftsführer<br />
blieb Willy Dalchow. Seit 1920 war auch sein Sohn Georg an der Firma<br />
beteiligt. Die durch den Weltkrieg hervorgerufenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten führten<br />
bis auf die Filialen in der Chaussee- und Berliner Straße zur Schließung aller anderen<br />
Zweigstellen. Die beiden letzten Filialen scheinen dann der Inflation zum Opfer<br />
gefallen zu sein. Die Weingroßhandlung /. G. Dalchow u. Söhne G.m.b.H. hat noch bis<br />
1927 bestanden, bis 1930 taucht der Name Willy Dalchow in den Adreßbüchern auf.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 47, Grüner Weg 77<br />
31 (Nr. 161, 162, 170, 171).<br />
3S Geschäftsanzeige, November 1905 (Nr. 187).<br />
33 (Nr. 11, 12, 14, 16, 17, 62, 63, 65-71, 75, 76, 82, 84, 98, 140-143, 177-183).<br />
Nachrichten<br />
110. Stiftungsfest<br />
Das Restaurant „Hochschul-Brauerei" bot am 28. Januar 1975 einen freundlichen Anblick, als<br />
sich eine große Zahl von Mitgliedern zu einem Eisbeinessen aus Anlaß der 110. Wiederkehr der<br />
Vereinsgründung eingefunden hatte. Der Vorsitzende Professor Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm<br />
ließ keine Zweifel aufkommen, daß dies ein freudiges Ereignis sei, das man auch mit entsprechend<br />
fröhlichen Gesichtern zu begehen habe. Er erteilte dem verehrten Mitglied Alfred<br />
34
Braun das Wort zu einem freien Vortrag von 30 Minuten Dauer, der von der Etymologie des<br />
Eisbeins ausging, den Verein und seinen einstigen „Hort", den Deutschen Dom am Gendarmenmarkt,<br />
würdigte und das Wirken des Vereins und das Aufragen des Turmes mit der Gestalt<br />
des Lynkeus in Verbindung brachte. Hier war die Frage zu stellen, was man mehr bewundern<br />
sollte: das phänomenale Gedächtnis Alfred Brauns, die meisterliche Vortragskunst, die 174.<br />
Volksschule, die einst das Fundament der Bildung gelegt hatte, oder die Begnadung, die es<br />
Alfred Braun möglich macht, bis in das 87. Lebensjahr hinein derart lebendig und fesselnd vorzutragen.<br />
Nicht minder herzlicher Beifall galt dem lieben Mitglied Frau Käte Haack, die sich eine Reihe<br />
von Gedichten ihr nahestehender Poeten ausgewählt hatte. Sie wußte die Hörer mit ihrem<br />
Charme und der feinen Art ihrer Rezitation in den Bann zu schlagen. Ein herzlicher Dank gilt<br />
beiden Vortragenden, die dem ach so profanen und nahrhaften Eisbeinessen einen künstlerischen<br />
Akzent zu geben vermochten. H. G. Schultze-Berndt<br />
Vertrauenswerbung für Berlin<br />
Mehr als 13 Millionen DM sind vom Senat von Berlin für Berlin-Werbung und Berlin-Information<br />
in den Haushalt 1975 eingestellt worden. Von den 9,6 Millionen DM, über die dabei die<br />
Senatskanzlei verfügen kann, entfallen rund 4,2 Millionen DM auf die sogenannte Vertrauenswerbung,<br />
u. a. in Gestalt von Anzeigen in Presseorganen. 1,15 Millionen DM sind für Berlin-<br />
Werbung im Ausland vorgesehen, 280 000 DM für Meinungsumfragen und etwa 366 000 DM<br />
für Informationen der Bezirksverwaltungen über Berlin.<br />
Es ist zu hoffen, daß auch unser Jahrbuch „Der Bär von Berlin" in diesem Sinne um Vertrauen<br />
zu Berlin wirbt und die Verhandlungen um eine Weiterführung des bescheidenen Zuschusses zu<br />
diesem Jahrbuch von Erfolg gekrönt sind.<br />
Nach ihrer Weihnachtsausstellung in der Kongreßhalle, die auch bei unseren Mitgliedern großen<br />
Anklang gefunden hat, tritt die Arbeitsgruppe Berliner Architekturmaler mit „Bauten der Kaiserzeit<br />
im heutigen Berlin" wieder an die Öffentlichkeit. Vom 30. Mai bis zum 16. Juni zeigt sie<br />
Gebäude, Brücken und Denkmäler im Hotel Esplanade in der Bellevuestraße 6—10.<br />
Dr. med. P. F.-C. Wille f<br />
Am 7. Februar 1975 starb in Hannover eines unserer treuesten Mitglieder, der Frauenarzt Paul<br />
Friedrich-Carl Wille. Geboren am 20. Mai 1891 in Berlin, wurde Wille Zögling des ehrwürdigen<br />
Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster, sodann entschied er sich durch Studium an der<br />
Kaiser-Wilhelm-Akademie für die militärärztliche Laufbahn. Am 1. Weltkrieg nahm er als Arzt<br />
im Felde teil und promovierte 1930 mit einer grundlegenden, noch heute oft zitierten Dissertation<br />
über „Die Geschichte der Berliner Hospitäler und Krankenhäuser bis zum Jahre 1800". Neben<br />
einer ausgedehnten ärztlichen Tätigkeit blieb Wille weiterhin der Geschichte der Medizin und der<br />
Geschichte der Stadt Berlin treu, was sich in zahlreichen Veröffentlichungen und einer ebenso umfassenden<br />
wie kostbaren Bibliothek der Berliner Medizin niederschlug. Aufgrund seiner besonderen<br />
Leistungen wurde er zum Kustos der Staatlichen Sammlung im Kaiser-Friedrich-Haus in<br />
Berlin gewählt, und er hat es, wie ich glaube, nie ganz verwunden, daß diese größte medizinhistorische<br />
Sammlung Deutschlands in den Wirren der Nachkriegszeit untergegangen ist, obwohl<br />
sie und das sie beherbergende Gebäude, jetzt Akademie der Künste (Ost) am Robert-Koch-Platz,<br />
von den Bomben des 2. Weltkrieges verschont geblieben sind.<br />
Nach dem Zusammenbruch verschlug ihn das Schicksal nach Hannover, wo er bis in seine letzten<br />
Tage eine umfangreiche gynäkologische Praxis ausübte, und noch im Oktober vorigen Jahres veröffentlichte<br />
er eine medizinhistorische Arbeit über den Krankentransport, in welcher ein Stich<br />
des Krankenhauses Bethanien eine Schlüsselrolle spielt. 1966 veröffentlichte er in unseren „Mitteilungen"<br />
einen hochinteressanten Beitrag mit einmaligen Abbildungen des alten Berliner Rathauses.<br />
Gemeinsame Interessen führten ihn zu treuer Freundschaft mit meinem unvergessenen<br />
Vorgänger im Vorsitz, Professor Harms, zusammen, und eine besondere Freude bedeutete es für<br />
35
die Teilnehmer unserer Exkursion im Jahre 1970, als sie den rüstigen, uns alle überragenden<br />
Dr. Wille ganz überraschend in Hameln begrüßen konnten.<br />
Nun ist auch er von uns gegangen. Diese Zeilen aber sollen erinnern an ein Mitglied unseres<br />
Vereins, das diesem fast ein halbes Jahrhundert die Treue gehalten hat.<br />
Walter Hoffmann-Axthelm<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Frau Frieda Senger, Frau Katharina Knirsch; zum 75. Geburtstag Frau Eva<br />
Paproth, Frau Elisabeth Rossberg, Frau Margarete Rettig, Herrn Dr. Dr. Waldemar Heinrich;<br />
zum 80. Geburtstag Frau Lucie Schulze, Frau Toni Gundermann.<br />
Buchbesprechungen<br />
Berlin - Chronik der Jahre 1957-1958. Hrsg. im Auftrag des Senats von Berlin. Bearb. durch<br />
Hans J. Reichardt, Joachim Drogmann, Hanns U. Treutier (Landesarchiv Berlin - Abt. Zeitgeschichte).<br />
Berlin: Heinz Spitzing Verlag 1974. 901 S., Leinen, 52,30 DM. (Schriftenreihe zur<br />
Berliner Zeitgeschichte, Bd. 8.)<br />
Nach einer Unterbrechung von rund drei Jahren, während der 1972 die chronikalische Übersicht<br />
„25 Jahre Theater in Berlin - Premieren 1945-70" eingeschoben worden war, wird mit dem<br />
neuesten Band die Chronik des aktuell-politischen Tagesgeschehens in Berlin fortgesetzt. Genau<br />
wie bei den vorhergegangenen 5 Bänden für die Zeit von 1945-1956 (vgl. Bespr. in den „Mitteilungen"<br />
H. 21/1970 und 4/1971) ist der Geschehensablauf wiederum in detaillierte „Tagesmeldungen"<br />
aufgelöst, die in erster Linie von den politisch-parlamentarischen Ereignissen gespeist<br />
werden. West- und Ost-Berlin finden dabei gleichermaßen Berücksichtigung. Darüber hinaus sind<br />
auch zahlreiche weltpolitische Nachrichten, sofern sie das allgemeine Ost-West-Verhältnis und die<br />
Deutschlandsituation im besonderen betrafen, aufgenommen worden. Meldungen über herausragende<br />
kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Vorkommnisse runden die Informationen ab.<br />
Die beiden hier behandelten Jahre sind durch eine zunehmende wirtschaftliche und soziale Konsolidierung<br />
gekennzeichnet. Der Wiederaufbau der Stadt schreitet voran, neue Objekte - wie z. B.<br />
die Stadtautobahn, die Kongreßhalle, die Universitätsbauten - gewinnen Gestalt, wobei die<br />
„Interbau" 1957 mit der Verwirklichung neuer planerischer Grundsätze weltweite Bedeutung<br />
erlangt. Demgegenüber verschlechtert sich das politische Klima zusehends: Obwohl ein Meinungsaustausch<br />
über die Sektorengrenze hinweg noch stattfindet und das Wort „Wiedervereinigung"<br />
immer wieder gebraucht wird, verhärten sich die Fronten. 1957 stirbt Otto Suhr, neuer Bürgermeister<br />
wird Willy Brandt, unter dessen Führung die Stadt im folgenden Jahr durch das sog.<br />
Chruschtschow-Ultimatum einer schweren Belastungsprobe entgegengeht. Bei den Abgeordnetenhauswahlen<br />
am 7. 12. 1958 legt dann die Berliner Bevölkerung erneut ein eindeutiges Vertrauensbekenntnis<br />
zu ihrer demokratischen Führung ab.<br />
Jeder Vorgang in der Chronik ist quellenmäßig belegt, in der Regel durch die Berliner Tageszeitungen,<br />
aber auch in zunehmendem Maße durch andere zeitgeschichtliche Dokumentär- und<br />
Memoirenwerke sowie Film- und Tonaufnahmen. Diese Verdichtung der Quellen, durch den<br />
wachsenden zeitlichen Abstand bedingt, führt sowohl zu einer Vermehrung des Informationsgehaltes<br />
wie auch zu einer verstärkten Kommentierung der gelieferten Nachrichten. Sie bringt<br />
indessen auch manche Weitschweifigkeit mit sich, die den eigentlichen Kern des Vorgangs zu überlagern<br />
droht. Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung, die Berlin im damaligen politischen<br />
Kräftespiel einnahm, mag es jedoch angebracht erscheinen, tiefer in die Abfolge des Geschehens<br />
einzudringen und die große Materialfülle, die in den Quellen geboten wird, auch auszuwerten.<br />
Das Problem, wie die Auswahl zu treffen sei, ist fast so alt wie die Geschichtsschreibung selbst.<br />
Die Entscheidung für eine extensive Anwendung des Auswahlprinzips wird gerechtfertigt durch<br />
die Einmaligkeit dieses Werkes, auf das auch spätere Historikergenerationen nicht werden verzichten<br />
können. Die Quellen- und Literaturverzeichnisse sowie Namen- und Sachregister erschließen<br />
den Band wiederum auf vorbildliche Weise. Peter Letkemann<br />
36
Wolfgang Ribbe: Die Aufzeichnungen des Engelbert Wusterwitz. Überlieferung, Edition und<br />
Interpretation einer spätmittelalterlichen Quelle zur Geschichte der Mark Brandenburg. Berlin:<br />
Colloquium Verlag 1973. XII, 245 S., Leinen, 78 DM. (Einzelveröff. d. Histor. Kommission zu<br />
Berlin, Bd. 12.)<br />
Die Mark Brandenburg gehört zu den deutschen Gebieten, in denen sich im Mittelalter keine<br />
große Geschichtsschreibung entwickelte. Mit den wenigen historischen Aufzeichnungen, die<br />
trotzdem im Lande entstanden, ist die Nachwelt recht achtlos umgegangen, so daß von den<br />
meisten derartigen Arbeiten nur noch Bruchstücke überliefert sind. Einen besonderen Rang<br />
unter den wenigen brandenburgischen Historiographen nahm seit jeher der gelehrte Jurist<br />
und Stadtsyndikus der Neustadt Brandenburg in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts,<br />
Engelbert Wusterwitz, ein.<br />
Das Original der Berichte Engelberts, die wichtigste Quelle zum Ende der luxemburgischen<br />
und Beginn der Hohenzollernherrschaft in der Mark, ist verloren, ebenso sämtliche Abschriften.<br />
Teile der Berichte sind in die nachmittelalterliche brandenburgische Historiographie,<br />
insbesondere in das Werk des um 1600 gestorbenen Peter Hafftitz, übernommen. Der Herausgeber<br />
unternahm es, den Text des Engelbert zu rekonstruieren. Dies erforderte die Anwendung<br />
besonderer Methoden, die über diejenigen einer bloßen kritischen Textausgabe hinausgehen.<br />
Der gesamte erste Teil der dreiteiligen Arbeit ist deshalb dem Überlieferungsproblem<br />
und den editorischen Vorarbeiten gewidmet. Der zweite Teil enthält den eigentlichen Quellentext<br />
mit dem dazugehörenden Variantenapparat und den Anmerkungen. Der Text reicht vom<br />
Jahre 1391 bis 1421. Von besonderem Interesse für die Berliner Geschichte ist u. a. der<br />
Bericht über die Fehde des Dietrich von Quitzow mit der Stadt Berlin von 1410 - einer Fehde,<br />
die für die Stadt recht ungünstig ausging. - Im dritten Teil unternimmt der Autor den Versuch<br />
einer Interpretation der Aufzeichnungen. Die Zeitverhältnisse und in diesem Zusammennang<br />
auch die Position des Engelbert Wusterwitz werden hier behandelt. Die Übernahme<br />
Brandenburgs durch die Hohenzollern brachte nicht - wie Wusterwitz wohl gehofft haben<br />
mag - ein rasches Ende der anarchischen Zustände in der Mark. Die von ihm so leidenschaftlich<br />
bekämpfte Adelsherrschaft war auch unter Friedrich I. noch nicht gebrochen. Mit dem<br />
Scheitern der Hoffnungen des brandenburgischen Stadtsyndikus dürfte, wie Ribbe zeigt,<br />
auch sein Verzicht auf eine breitere Darstellung der Zustände unter Friedrich I. zusammenhängen.<br />
Die zahlreichen erklärenden Anmerkungen sowie das ausführliche Register machen dieses<br />
Werk auch für den interessierten Laien benutzbar. Dem Herausgeber gebührt das Lob, daß er<br />
sich eines der schwierigsten Kapitel der wahrlich nicht problemlosen brandenburgischen Historiographie<br />
angenommen hat. Felix Escher<br />
Otto Schneidereit: Paul Lincke und die Entstehung der Berliner Operette. (Ost-)Berlin:<br />
Henschelverlag 1974. 144 S. m. 44 Abb., Pappbd., 8 M.<br />
Der Titel deutet schon auf Paul Lincke als den eigentlichen Vater der Berliner Operette hin.<br />
Die Schaffenszeit des Künstlers war auch die Zeit des Aufstiegs Berlins zur Groß- und Weltstadt,<br />
der Paul Lincke ihre Melodie gab. Eine typisch berlinische Operette gab es zuvor nicht.<br />
Ihre Entstehung kann man mit dem Erscheinen der „Frau Luna" ansetzen, einer äußerst erfolgreichen<br />
Operette, die auch heute noch ihre Daseinsberechtigung hat und sich großer Beliebtheit<br />
erfreut. Der Verfasser begleitet Paul Lincke auf seinem Lebens- und Schaffensweg, versäumt<br />
es aber auch nicht, den populären Künstler kritisch zu zeichnen. Die kritischen Töne wirken<br />
aber niemals verletzend.<br />
Lincke, aufgewachsen in den häßlichen Vierteln Berlins der Gründerjahre und mit Geld nicht<br />
gesegnet, verstand es, seinen Willen, das „Musikerhandwerk" zu erlernen, durchzusetzen, nachdem<br />
sich schon frühzeitig herausgestellt hatte, daß er eine seltene Gabe besaß: das absolute<br />
Gehör. Der Musikerberuf wurde ihm - zu einem regulären Studium fehlten die Mittel - in<br />
dreijähriger Lehrzeit in der Stadtpfeiferei zu Wittenberge beigebracht. Lincke hat sich später<br />
lobend über die Lehrjahre in Wittenberge geäußert und seinem Lehrherrn ein gutes Zeugnis<br />
ausgestellt. Erste Engagements als Orchestermusiker führen ihn über verschiedene Theater zur<br />
Tätigkeit eines Korrepetitors, zweiten Kapellmeisters und schließlich ersten Kapellmeisters an<br />
das Königstädtische Theater am Alexanderplatz. Zum Schluß seiner Kapellmeister-Laufbahn<br />
finden wir Lincke an den Folies-Bergere in Paris, dem damaligen Zentrum europäischen Vergnügungslebens.<br />
Im Februar 1899 holte man ihn nach Berlin an das neueröffnete Apollo-Theater<br />
zurück, wo er zu einem Text von Bolten-Baeckers bis zum 1. Mai 1899 eine Operette komponieren<br />
und einstudieren mußte. Es war die „Frau Luna", die am 1. Mai 1899 eine glanzvolle<br />
Uraufführung erlebte. Bereits am 18. Dezember 1899 folgte die Operette „Im Reiche des Indra".<br />
An heute noch bekannten Kompositionen folgen in den Jahren bis zum 1. Weltkrieg noch „Lysi-<br />
37
strata" mit dem Glühwürmchenidyll, die Ausstattungs-Burleske „Berliner Luft", die „Champagner-Visionen",<br />
ein Ballett und die Operette „Casanova". Neben diesen Bühnenwerken komponierte<br />
er weiterhin eine große Zahl noch heute populärer Lieder. Der 1. Weltkrieg beendete die<br />
Laufbahn Linckes als Komponist. Foxtrott, Tango und Jazz der „Goldenen Zwanziger Jahre"<br />
waren nicht sein Metier. Der Beginn der großen Zeit des Rundfunks sorgte aber dafür, daß es<br />
um Lincke nicht still wurde. Viele seiner Melodien wurden über die Ätherwellen erst recht<br />
populär. 1943 verließ er seine geliebte Heimatstadt, um über Marienbad und Bayern schließlich<br />
1946 nach Hahnenklee im Harz zu gelangen, wo er am 3. September 1946 verstarb.<br />
Klaus Streu<br />
Sigurd Hilkenbach. Wolf gang Kramer, Claude Jeanmaire: Berliner Straßenbahnen. Die Geschichte<br />
der Berliner Straßenbahn-Gesellschaften seit 1865. Gut Vorhard, Villigen /Schweiz:<br />
Verlag Eisenbahn 1973. 240 S. m. 379 Abb., Leinen, 39 DM.<br />
Eine lückenlose Chronik der Geschichte der Berliner Straßenbahnen existiert noch nicht. Sie<br />
würde mehrere dickleibige Bände füllen, sollte der gesamte Entwicklungskomplex, d. h. das<br />
Vertragswerk der zahlreichen Bahnunternehmungen mit den einzelnen Stadtgemeinden, die<br />
Entstehung und Entwicklung der oft umfangreichen Liniennetze im einzelnen und die Inbetriebnahme,<br />
Bewährung, Verwendung und der Verbleib der zahllosen Wagentypen technisch detailliert<br />
behandelt werden.<br />
Einen großen Schritt auf dieses Fernziel hin bedeutet jedoch die Herausgabe dieses Werkes<br />
über die Berliner Straßenbahnen. Auf 240 Seiten wird dem Leser - und nicht nur dem Verkehrsamateur<br />
- mittels einer langen Reihe guter und teilweise seltener Abbildungen ein mehr als<br />
hundertjähriger Zeitraum des Nahverkehrsablaufes in Berlin vorgeführt, der von den fernen<br />
Zeiten des Pferdebetriebes bei der Straßenbahn bis in unsere Tage reicht. Da die Autoren von<br />
dem Gedanken ausgegangen sind, die Epoche des Berliner Straßenbahnzeitalters vorwiegend<br />
durch fotografisches Bildmaterial aufzuzeigen, liegt der Schwerpunkt der Darstellung in der<br />
Entwicklung des Wagenparkes und nicht der Liniennetze der einzelnen Gesellschaften. Eine<br />
Fülle von Reproduktionen und Ansichten von Verkehrsszenen auf Straßen und Plätzen läßt die<br />
Schrift zu einer lebendigen Dokumentation der Entwicklung des dermaleinst wesentlichen Berliner<br />
Nahverkehrsträgers werden.<br />
Die Abhandlung ist in übersichtlicher Weise aufgebaut, enthält klare technische Aufrisse besonders<br />
interessanter Fahrzeugmodelle, Reproduktionen von Originalen fast hundert Jahre alter<br />
Fahrpläne, Abbildungen von Fahrscheinen, Streckennetzen, Werkfotos, Verkehrszeichen und<br />
Haltestellensäulen. Die zahlreichen Zeitgenossen, deren vordergründiges Interesse dem Wagenpark<br />
der Berliner Straßenbahnen gilt, werden die genauen Hinweise auf die kontinuierlich<br />
fortschreitenden Umnumerierungen der einzelnen Fahrzeuge freudig begrüßen, denen die Autoren<br />
größte Aufmerksamkeit gewidmet haben.<br />
Besonderer Erwähnung bedürfen die erläuternden Texte, die in knapper, aber aufschlußreicher<br />
Form die Bildreportagen des Werkes von der ersten bis zur letzten Seite begleiten. Durch sie<br />
wird dem Leser eine Fülle von speziellem Wissen vermittelt, dessen Quellen dem interessierten<br />
Einzelgänger ansonsten nur schwer zugänglich sind.<br />
Die Zusammenstellung der Materie kann als einschlägiges Standardwerk bezeichnet werden.<br />
Geringfügige Meinungsverschiedenheiten von Verkehrsexperten betreffend den Einsatz einiger<br />
weniger Fahrzeugtypen in bestimmten Streckenbereichen können und sollen nicht als „falsche<br />
Angaben" betrachtet werden. Dem Werk ist weiteste Verbreitung unter der großen Gilde junger<br />
und alter Freunde des Berliner Straßenbahnwesens zu wünschen. Hans Schiller<br />
Walter Stahl und Dieter Wien: Berlin von 7 bis 7. Ein ungewöhnlicher Führer durch eine<br />
außergewöhnliche Stadt. Mitautorin: Monika Bader. 5., verbesserte Aufl. Hamburg/Berlin: Falk-<br />
Verlag 1974/75. 404 S. mit zahlr. Zeichnungen, Linson, 18,60 DM.<br />
Die vom Verlag „Bestseller-Serie" genannte Reihe „. . . von 7 bis 7" bemächtigt sich nun schon<br />
zum fünften Male der beiden Hälften unserer Stadt, die als außergewöhnlich bezeichnet wird,<br />
wohingegen Hamburg das Prädikat „ungewöhnlich" und Wien „weltberühmt" erhalten hat (und<br />
Sylt „einzigartig"). Der dem Buch vorangestellte Berliner Volksmund „Wat denn, wat denn, -<br />
Berlin is doch keen Dorf" bestätigt sich wieder am Umfang und im Gehalt der Angaben über<br />
das kulturelle Leben, die Restaurants, Abendlokale und Nightclubs. Auf Sportmöglichkeiten,<br />
Sehenswürdigkeiten und Dienstleistungen wird hingewiesen, wissenswerte Angaben über „Deutschlands<br />
Metropole" fehlen nicht, und eine geraffte Übersicht sowie ein alphabetisches Gesamtverzeichnis<br />
erweisen sich als überaus nützlich. Gegenüber der letzten Auflage wurden 85 Gaststätten<br />
usw. weggelassen und 114 neu aufgenommen. Ein Stern-System verweist auf besonders empfehlenswerte<br />
gastronomische Betriebe. Die Preisangaben stammen aus dem Herbst 1973. Als besonders<br />
lobend muß hervorgehoben werden, daß der Ost-Berliner Teil nahtlos in dieses Gesamt-<br />
38
erliner Nachschlagewerk eingefügt ist und die Theater, Weinstuben usw. der östlichen Stadthälfte<br />
nur durch ein Symbol kenntlich gemacht worden sind.<br />
Einige Anmerkungen seien erlaubt, da sie vermeidbare Fehler betreffen. In der Deutschen Oper<br />
Berlin ist Gustav Rudolf Seilner schon seit 1972 nicht mehr Generalintendant (jetzt Egon Seefehlner),<br />
ähnliches gilt für Frank Lothar und die „Tribüne". Das Haus der Ostdeutschen Heimat<br />
trägt jetzt einen geographisch umfassenderen Namen. Der Zoologische Garten mit Aquarium<br />
hat auf Seite 313 unter der Rubrik „Unter den Linden" nichts zu suchen. Das Rote Haus (S. 325)<br />
heißt in Wirklichkeit Rotes Rathaus, und von den Druckfehlern sei nur der des Bekleidungshauses<br />
Laden-(statt Loden-)Frey erwähnt.<br />
Das handliche Buch, zum Gegenwert eines normalen innerstädtischen Abendessens geboten, kann<br />
sich als preiswürdig erweisen, wenn man mit seiner Hilfe den richtigen oder einen neuen Weg<br />
findet. H. G. Schultze-Berndt<br />
Peter Pfankuch (Hrsg.): Hans Scharoun - Bauten, Entwürfe, Texte. Berlin: Gebr. Mann Verlag<br />
1974. 408 S. mit 447 Abb. u. Plänen, Linson, 59 DM. (Schriftenreihe d. Akademie d. Künste<br />
Berlin, Bd. 10.)<br />
Hier liegt die erste umfassende Publikation über das Gesamtwerk Hans Scharouns vor. Peter<br />
Pfankuch, viele Jahre dessen Mitarbeiter und jetzt Sekretär der Abteilung Baukunst der Akademie,<br />
gab sie heraus. Der Leser erlebt den Architekten, Künstler und Menschen Hans Scharoun,<br />
der als Stadtbaurat nach 1945 und als Präsident der Akademie der Künste auch für Berlin von<br />
Bedeutung war. Dessen Entwürfe, Notizen und Manuskripte, ergänzt durch zeitgenössische Dokumente<br />
und Daten des Herausgebers, spiegeln ebenfalls den großen Aufbruch nach dem ersten<br />
Weltkrieg wider, den eine junge, von neuem Bauwollen beseelte Architektengeneration in der<br />
Planung aufstrebender, moderner Städte wagte. Das moralische Element der Stadtlandschaft als<br />
private und berufliche Umwelt ging einher mit der technischen Expansion. Die „menschenbildende<br />
Aufgabe" der Architektur fand ihren Niederschlag in der Nachbarschaftsidee; Scharoun<br />
war einer ihrer Verfechter.<br />
So wird diese Veröffentlichung, die detailliert das Leben und die schöpferische Entwicklung des<br />
Architekten darlegt, fast zu einem Handbuch der gegenwärtigen Baukunst. Günter Wolbchlaeger<br />
Im I. Vierteljahr 1975<br />
haben sich folgende Damen und Herren<br />
Waltraut Adomat, Verw.-Angest.<br />
2116 Hanstedt, Rübenkamp 6<br />
Tel. (0 41 84) 4 21 (Nawrocki)<br />
Hans Axthelm, Techn. Angest.<br />
1 Berlin 47, Britzer Damm 23<br />
Tel. 6 25 31 34 (Vorsitzender)<br />
Carl-Ulrich Blecher, Zahnarzt u. Schriftsteller<br />
1 Berlin 19, Württembergallee 8<br />
Tel. 3 04 30 38 (Vorsitzender)<br />
Dagmar Blecher<br />
1 Berlin 19, Württembergallee 8<br />
Tel. 3 04 30 38 (Vorsitzender)<br />
Dr. Jürgen Boeckh, Pfarrer<br />
1 Berlin 62, Hauptstraße 47<br />
Tel. 7 81 57 84 (Vorsitzender)<br />
Renate Hörn, Assessorin d. Lehramtes<br />
53 Bonn, Im Kirchenbenden 18<br />
Tel. 23 48 20 (Vorsitzender)<br />
Wilhelm Kielhorn, Abt.-Leit. i. R.<br />
1 Berlin 33, Spessartstraße 9 b<br />
Tel. 8 22 51 49 (Rüsch)<br />
Dr. Georg Kraffel, Augenarzt<br />
1 Berlin 27, Gabrielenstraße 34-36<br />
Tel. 4 33 88 04 (Vorsitzender)<br />
zur Aufnahme gemeldet:<br />
Jürgen Manthey, Dipl.-Ing., Architekt<br />
1 Berlin 42, Totilastraße 10<br />
Tel. 7 52 53 00 (Schriftführer)<br />
Werner Nawrocki, Student<br />
1 Berlin 65, Drontheimer Straße 20<br />
Tel. 4 93 11 86 (Schriftführer)<br />
Aenne Otterstedt, Katechetin, Kirchenmusikerin<br />
1 Berlin 41, Südwestkorso 6<br />
Tel. 8 52 42 16 (Vorsitzender)<br />
Anneliese Richter<br />
1 Berlin 46, Mozartstraße 29 b<br />
Tel. 7 71 85 90 (E. Guth)<br />
Charlotte Rieck<br />
1 Berlin 30, Weiserstraße 10<br />
Tel. 2 1129 32<br />
Hildegard Rüsch, MTA i. R.<br />
1 Berlin 51, Amendestr. 66<br />
Tel. 4 91 32 05 (Schriftführer)<br />
Martin Schröder, Studienreferendar<br />
1 Berlin 42, Mussehlstraße 23<br />
Tel. 7 85 19 17 (Schriftführer)<br />
Irma Wullkopf<br />
1 Berlin 21, Bundesratufer 10<br />
Tel. 3 91 63 52 (Koch)<br />
39
Veranstaltungen im IL Quartal 1975<br />
1. Dienstag, 15. April, 19.30 Uhr, Filmsaal des Rathauses Charlottenburg: Vorführung<br />
des Films „Robert Koch" mit Emil Jannings und Werner Krauß.<br />
Einführende Worte: Professor Dr. Dr. Walter Hoffmann-Axthelm.<br />
2. Dienstag, 22. April, 19.30 Uhr: Ordentliche Mitgliederversammlung im Bürgersaal<br />
des Rathauses Charlottenburg.<br />
Tagesordnung:<br />
1. Entgegennahme des Tätigkeits-, des Kassen- und des Bibliotheksberichtes.<br />
2. Bericht der Kassenprüfer und der Bibliotheksprüfer. 3. Aussprache. 4. Entlastung<br />
des Vorstandes. 5. Wahl des Vorstandes. 6. Wahl von zwei Kassenprüfern<br />
und von zwei Bibliotheksprüfern. 7. Verschiedenes.<br />
Die Wahlen bestimmen für die Dauer der nächsten beiden Jahre die Zusammensetzung<br />
des Vorstands und damit auch die Geschicke des Vereins. Anträge sind<br />
bis spätestens 12. April der Geschäftsstelle einzureichen.<br />
3. Mittwoch, 7. Mai, 15.00 Uhr: Führung durch das Robert-Koch-Institut durch<br />
den leitenden Direktor Prof. Dr. med. Karl-Ernst Gillert. Berlin-Wedding,<br />
Nordufer 20. U-Bahnhof Putlitzstraße, Nordausgang; Omnibus 16, 64.<br />
4. Dienstag, 27. Mai, 19.30 Uhr, Filmsaal des Rathauses Charlottenburg: Lichtbildervortrag<br />
von Felix Escher „Jerichow, Stendal, Tangermünde — drei Phasen<br />
mittelalterlicher Geschichte im brandenburgischen Raum".<br />
5. Sonnabend, 7. Juni, Exkursion nach Jerichow, Stendal und Tangermünde unter<br />
der Leitung von Joachim Schlenk. Die Teilnahme an der Veranstaltung am<br />
27. Mai ist für alle Interessenten verbindlich.<br />
6. Dienstag, 24. Juni, 19.30 Uhr, Filmsaal des Rathauses Charlottenburg: Lichtbildervortrag<br />
von Egon Fouquet „Die Hugenotten, 2. Teil: Berlin-Brandenburg".<br />
(Wegen Erkrankung des Vortragenden mußte dieses Referat am 11. Januar durch<br />
einen Vortrag des Vorsitzenden ersetzt werden.)<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenbuf^ sind Gäste willkommen. Die Bibliothek<br />
ist zuvor jeweils eine halbe Stunde geöffnet. Nach den Vorträgen geselliges<br />
Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 25. April, 30. Mai und 27. Juni, von 17.00 Uhr an zwangloses Treffen<br />
in der Vereinsbibliothek.<br />
Unsere diesjährige Studienfahrt wird uns vom 5. bis 7. September nach Hannoversdi-<br />
Münden führen.<br />
Beilagenhinweis: Diesem Heft liegen das Gesamtinhaltsverzeichnis und das Namensregister für<br />
die Jahrgänge 1971-1974 der „Mitteilungen" bei.<br />
Unser Jahrbuch „Der Bär von Berlin", Band 24 (1975), wird - ähnlich wie im Vorjahr - im<br />
Sommer dieses Jahres erscheinen.<br />
Wir weisen darauf hin, daß der Mindest-Jahresbeitrag 36 DM beträgt und bitten um umgehende<br />
Überweisung noch ausstehender Beiträge für das Jahr 1974.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Ruth Koepke, 1 Berlin 61,<br />
Mehringdamm 89, Ruf 6 93 67 91. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 4 65 90 11. Schatzmeister: Landgerichtsrat a.D. D.Franz, 1 Berlin 41, Grunewaldstraße<br />
5, Ruf 7 91 57 41. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1 Berlin 21.<br />
Bibliothek: 1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus). Geöffnet: freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Klaus P.<br />
Mader; Günter Wollschlaeger. Bezugspreis für Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
«0
iäöi - A 20 377 F<br />
ieriiner Stach<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
71.Jahrgang Heft 3 Juli 1975<br />
Foto: Landesbildstelle Berlin<br />
41
Am Beispiel Spandaus<br />
Der Versuch einer Gegenüberstellung 1975<br />
Von Jürgen Grothe<br />
Im Jahr des „Europäischen Denkmalschutzes" wird die Erhaltung historischer Stadtteile,<br />
Gebäude oder Fassaden lebhaft diskutiert. So erhebt sich in Berlin die Frage, wie es mit<br />
der Erhaltung der Spandauer Altstadt aussieht, die ja immerhin die einzige mittelalterliche<br />
Stadt innerhalb des Stadtgefüges von West-Berlin ist. Seit Jahren wird von der<br />
„Altstadtplanung" in Presse und Rundfunk berichtet. Bisher wurde jedoch ausschließlich<br />
von Neuplanungen gesprochen. Ein Katalog der zu erhaltenden, zu restaurierenden oder<br />
zu sanierenden Gebäude ist bis heute nicht erstellt. Tatsache ist, daß in den letzten Jahren<br />
mehrere erhaltenswerte Gebäude abgerissen wurden.<br />
Die Spandauer Altstadt besaß von jeher eine sehr prägnante Stadtsilhouette. Die Dominante<br />
dieser Silhouette bestimmte bis zum Bau des Rathauses die St.-Nikolai-Kirche<br />
(siehe Titelbild). Die übrige Bebauung war niedrig, d. h. ein- bis zweistöckig gehalten<br />
und besaß außer den Türmen der Stadtmauer keine aufragenden Gebäude. Außerhalb<br />
der Altstadt bildete der Juliusturm einen Gegenpol zum Kirchturm.<br />
Die Nikolaikirche ist das typische Beispiel einer märkischen Stadtpfarrkirche. Sie ist mit<br />
ihrer Ost-West-Lage unregelmäßig in das Stadtgebilde eingefügt. Ihre Turmarchitektur<br />
beherrschte nicht nur das gesamte Stadtbild, sondern auch, da der Turm in die Carl-<br />
Schurz-Straße eingerückt ist, diesen Straßenzug in seiner vollen Länge. Am 6. Oktober<br />
1944 brannte der Turm während eines schweren Luftangriffes auf die Spandauer Altstadt<br />
aus. Die welsche Haube, der achteckige Laternenaufbau und die zweifach geschweifte<br />
Haube gingen verloren. Im Baubeschluß zur Wiederherstellung der Kirche nach dem<br />
Kriege heißt es, daß die heutige Gestaltung des Turmdaches nur als Provisorium zu betrachten<br />
sei. Bis heute, 30 Jahre später, ist dieses Provisorium, ein Pyramidaldach, das in<br />
keiner Weise zum Bau und zum Kirchendach paßt, beibehalten worden. Es ist an der<br />
Zeit, daß Kirche, Landeskonservator, Bezirksamt Spandau und der Senat von Berlin<br />
gemeinsam Geldmittel zur Verfügung stellen, um den alten Turmaufbau trotz der enormen<br />
Kosten wieder herzustellen.<br />
Die Umbauung des Reformationsplatzes, auf dem die Nikolaikirche steht, wird immer<br />
wieder als historisch bezeichnet. Sie stammt fast ausschließlich aus dem 19. Jahrhundert.<br />
Pietätlosigkeit der Stadt und privater Bauherren hat hier Gebäude entstehen lassen, die<br />
in ihren Proportionen keinerlei Rücksicht auf den Bau der Nikolaikirche nehmen. Eine<br />
Stadtpfarrkirche steht stets im engsten künstlerischen und baulichen Zusammenhang mit<br />
ihrer Umgebung, die sich ihr entweder unterordnet oder sie ergänzt. Das Spandauer Beispiel<br />
zeigt, daß eine falsche Umbauung dem Baudenkmal viel von seiner Wirkung nimmt.<br />
Durch den fehlenden Turmabschluß wird der Höhenfluß des Bauwerkes außerdem noch<br />
stark reduziert.<br />
Direkt gegenüber der Nikolaikirche, an der Westseite der heutigen Carl-Schurz-Straße,<br />
befindet sich die erste „Bausünde" der Altstadt (Bild 1 b). Bis 1950 war die Umbauung<br />
des Reformationsplatzes, trotz der Ruinen an der Westseite der Carl-Schurz-Straße, geschlossen.<br />
1950 erfolgte der Abriß der Ruine des ehem. Amtsgerichtes. Das Gebäude des<br />
„Königlichen Amtsgerichtes" war 1854 durch einen Umbau entstanden (Bild 1 a). Bereits<br />
1439 wird an dieser Stelle „dat Radhüsiken up dem Kerkhof" genannt. Ab 1677 war es<br />
42
-v- V t<br />
f<br />
/ /<br />
TT<br />
BK • Bn* •<br />
^ ^ ^ i " -••--•****"'"*il.;Z?<br />
Bild 1 a (Aufnahme um 1910) Foto vom Verfasser<br />
Bild 1 b (Aufnahme April 1975) Foto vom Verfasser<br />
43
Bild 2 a (Aufnahme 1965)<br />
Bild 2 b (Aufnahme April 197<br />
A4<br />
Foto vom Verfasser<br />
Foto vom Verfasser
Wohnhaus der Spandauer Bürgermeisterfamilie Neumeister, bis es 1697 von der Stadt<br />
erworben wurde. Fortan diente es als Quartier der Spandauer Regimentschefs. 1769 übernahm<br />
Prinz Heinrich v. Preußen, der Bruder Friedrichs IL, das Spandauer Regiment.<br />
Das Haus wurde umgebaut und erhielt den Namen „Prinz-Heinrich-Palais". Aus diesem<br />
Barockbau entstand durch einen erneuten Umbau das Amtsgericht. Obwohl die romantische,<br />
burgähnliche Fassade nicht in das Spandauer Stadtbild paßte, ordnete sich der Bau<br />
in seinen Maßen in die vorhandene Bebauung ein.<br />
Einen Fremdkörper bildet das heute an dieser Stelle vorhandene Gebäude. In keiner<br />
Weise ist Rücksicht auf die Umbauung des Reformationsplatzes genommen worden.<br />
Durch die Zurückziehung des Gebäudes wurde die Einheitlichkeit der Häuserflucht unterbrochen.<br />
Am 10. August 1956 zeigte das „Forum-Filmtheater" in dem Neubau seinen<br />
ersten Film. Nach 12 Jahren schloß das modernste Kino der Spandauer Altstadt am<br />
6. Oktober 1968 wieder seine Pforten. Eine innere und äußere Umgestaltung verstärkte<br />
die Disharmonie innerhalb des Ensembles Reformationsplatz. Am 7. Dezember 1968 eröffnete<br />
ein Discount-Unternehmen in dem ehemaligen Kino eine Filiale.<br />
Als nach dem Dreißigjährigen Krieg stehende Heere aufgestellt wurden, zeigte sich die<br />
Notwendigkeit, spezielle Gebäude für die Unterkunft der Soldaten zu errichten. Gleichzeitig<br />
konnte die Desertation erschwert werden. Nachdem in Berlin die ersten Kasernen<br />
entstanden waren, erhielt der Spandauer Oberstleutnant von Kleist am 14. September<br />
1766 die Order, in Spandau Kasernen erbauen zu lassen. Als Bauplatz entschied man<br />
sich für einen Teil des Moritzkirchhofes und des Stadthofes am Südende der heutigen<br />
Kinkelstraße. Der Entwurf stammte von dem Spandauer Bauinspektor Lehmann. Der<br />
Bau war ein typisches Beispiel der preußischen Zweckarchitektur (Bild 2 a). Das 18 Fensterachsen<br />
lange und 3 Fensterachsen breite Gebäude war nur durch ein einfaches Gesims,<br />
das das Erdgeschoß von den oberen Stockwerken trennte, und 2 Korbbogenportalen gegliedert.<br />
1920 baute es der Spandauer Stadtbaurat Karl Elkart für Wohnzwecke um. Er<br />
integrierte den Bau in seine zur Linderung der Wohnungsnot zwischen Kinkelstraße und<br />
Viktoria-Ufer entstandene Wohnsiedlung. 21 Familien fanden in den beiden oberen<br />
Stockwerken eine Unterkunft. 1964 war das Gebäude plötzlich baufällig. Kleinere Renovierungen<br />
hatte das Bezirksamt nach Kriegsende bereits durchführen lassen. Eine völlige<br />
Instandsetzung hätte eine Million DM gekostet. 850 000 DM hatte das Bauamt bereits<br />
veranschlagt, so daß ein Differenzbetrag von 150 000 DM bei einem damals in die Milliarden<br />
gehenden Etat keine große Rolle hätte spielen dürfen. Immerhin hätte es sich ja<br />
nicht um reine Restaurierungskosten gehandelt. Es wären ca. 30 Wohnungen geschaffen<br />
worden. Aber der Grund des Abrisses lag auf einem anderen Gebiet. Das Gebäude, das<br />
in die Kinkelstraße eingerückt war, störte die Stadtplaner: Es galt als Verkehrshindernis<br />
und war demnach - zum Abriß verurteilt. So wurde die friderizianische Kaserne im<br />
Sommer 1965 abgebrochen, obwohl der Bau unter Denkmalschutz stand und der letzte<br />
seiner Art in Berlin war. Im selben Jahr noch wurde hier ein Parkplatz für 30 Kraftfahrzeuge<br />
geschaffen (Bild 2 b).<br />
Breite Straße und Carl-Schurz-Straße galten seit je als die Hauptstraßen Spandaus; sie<br />
waren Einfall-, Ausfall- und Geschäftsstraßen. Mit dem Zuzug großer Bevölkerungsteile<br />
um 1880 änderten auch diese beiden Straßen ihr architektonisches Bild; Geschäftshäuser<br />
und Hotels entstanden. Im südlichen Teil der Carl-Schurz-Straße (ehemalige Klosterstraße,<br />
Potsdamer Straße) dominierte das im Stil der Nachgründerzeit erbaute Gebäude<br />
des Hotels „Roter Adler" (Bild 3 a). In seinem großen Festsaal fanden Konzerte, Thea-<br />
45
Bild 3 a (Aufnahme um 1890)<br />
Bild 3 b (Aufnahme 1974)<br />
46<br />
\<br />
Foto vom Verfasser<br />
Foto vom Verfasser
Bild 4 b (Aufnahme 1975)
teraufführungen und Tanzveranstaltungen statt. Teilzerstörungen der Carl-Schurz-Straße<br />
während des Zweiten Weltkrieges an der Charlottenstraße bildeten die Voraussetzung<br />
zur Errichtung eines Kaufhauses, das der Hertie-Konzern 1963/64 errichten ließ. Bald<br />
genügte dieser Bau nicht mehr den Ansprüchen. So erfolgte 1971 eine Erweiterung<br />
(Bild 3 b). Der Hertie-Bau, von einem konzerneigenen Architektenteam entworfen, beherrscht<br />
heute die Carl-Schurz-Straße zwischen Charlotten- und Mauerstraße. Eine organische<br />
Einfügung in die Altstadtbebauung erfolgte nicht. Die bisherigen Maßstäbe wurden<br />
gesprengt: Ohne Rücksicht auf das Stadtbild hat man das Kaufhaus zwischen die<br />
alten Häuser gesetzt.<br />
Heute muß ein Kaufhaus in größerer Zahl Parkplätze für seine Kunden zur Verfügung<br />
stellen. Aus diesem Grunde wurde teilweise die aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammende<br />
Bebauung der Mauer- und Breite Straße abgerissen (Bild 4 a). 1971 entstand an<br />
dieser Stelle ein Parkhaus mit 400 Einsteilplätzen (Bild 4 b).<br />
Es bleibt festzustellen, daß die Gegend zwischen Carl-Schurz-Straße, Mauer-, Breite und<br />
Charlottenstraße durch den Hertie-Bau und das Parkhaus negativ beherrscht wird und<br />
die Funktion einer Altstadt verlorenging. Atmosphäre ist durch öde und ausdruckslose<br />
Fassaden ersetzt worden. Kaufhäuser sollen das Leben einer Stadt bereichern, Einzelhandelsgeschäfte<br />
nach sich ziehen, Spaziergänger zum Betrachten der Auslagen oder zum<br />
Besuch von Restaurants und Cafes anregen. Das ist in Spandau nicht der Fall. Nach<br />
Geschäftsschluß herrscht in der Altstadt gähnende Leere. Die Stadtplaner taten noch ein<br />
Weiteres: Das alte Pflaster wurde mit einer Asphaltdecke versehen, und die Laternen aus<br />
dem 19. Jh. mußten modernen Peitschenmasten weichen. Hat man nie gemerkt, daß die<br />
Straßen der Altstadt durch die Schaufensterbeleuchtungen ausreichend erhellt waren?<br />
Eine starke Veränderung des mittelalterlichen Stadtgrundrisses ergab 1960 der Abriß der<br />
Häuser an der Nordseite der Havelstraße. Ein Parkplatz für 135 Wagen wurde geschaffen.<br />
Betont wird dieser Eingriff zusätzlich durch die Anlage der Straße Am Juliusturm.<br />
Behnitz und Kolk wurden so von der Altstadt abgetrennt.<br />
Die Spandauer Altstadt kann moderne Funktionen aufnehmen, auch im Rahmen ihrer<br />
Altbebauung. Allerdings muß das Unverständnis alten Gebäuden gegenüber abgelegt und<br />
Profitstreben zurückgestellt werden. Jahrzehntelang versäumte Restaurierungen rächen<br />
sich, in vielen Fällen kommt eine Sanierung zu spät. Sanieren muß nicht Abriß heißen,<br />
wie Beispiele am Kolk und Behnitz zeigen. Die Stadt sollte, wenn auch noch so teuer,<br />
Häuser aufkaufen und erhalten. Nur so ist der Spekulation mit Grundstücken in der Altstadt<br />
Einhalt zu gebieten. Zu lange haben Denkmalpfleger nur einzelne Gebäude geschützt,<br />
in Spandau auch das noch nicht einmal mit Erfolg. Ganze Straßenzüge, wie Teile<br />
der Ritterstraße, des Hohen Steinwegs, von Kolk und Behnitz sowie des Möllentordamms<br />
sollten unter Denkmalschutz gestellt werden. Letztlich kommt es auf die Geschlossenheit<br />
des Stadtbildes an.<br />
Straßenzüge zum „baugeschützten Bereich" zu erklären ist zwecklos, wie zahlreiche Abrisse<br />
in der Ritter- und Kinkelstraße zeigen. Noch ist eine Restaurierung der Altstadt<br />
teilweise möglich. Allerdings muß eine weitere Verödung des Stadtbildes vermieden werden.<br />
Zahlreiche Gebäude sollen in nächster Zeit abgebrochen werden. Dies zu verhindern,<br />
sollte Aufgabe des Bezirksamtes, des Landeskonservators, der Berliner Geschichtsvereine,<br />
der Hausbesitzer und letzten Endes auch der Bevölkerung sein.<br />
Warum gehen Sonntagsspaziergänger nicht durch moderne Wohnsiedlungen, sondern<br />
durch Altstädte? Weil sie in technoider, steriler Architektur keine geistigen Orientierungs-<br />
48
hilfen finden. Durch eine rigorose Bauordnung ist die Altstadt von Bern gerettet worden.<br />
Danzig und Warschau waren bis zu 90 °/o zerstört, beide Städte sind wiedererstanden.<br />
Auch die Spandauer Altstadt braucht nicht „wegsaniert" zu werden - ihr Reiz kann<br />
erhalten bleiben, wenn die Bürger es wollen.<br />
„Melpomenens und Thaliens Günstling"<br />
Zum 200. Todestag des Schauspieldirektors H. G. Koch<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 20, Kellerwaldweg 9<br />
Von Rainer Theobald (Fortsetzung von Heft 2)<br />
Schon 1767 hatte Koch versucht, während der Abwesenheit Schucks in Berlin Fuß zu<br />
fassen, doch war ihm Carl Theophil Döbbelin M zuvorgekommen. Als ein Jahr später in<br />
Leipzig seine Existenz dadurch gefährdet wurde, daß ihm auf Betreiben von Kirche und<br />
Universität nur noch zwei Spieltage wöchentlich zugestanden wurden, folgte er einem<br />
Ruf der kunstliebenden Herzogin Anna Amalia nach Weimar und kehrte nur zu den<br />
Meßzeiten, in denen täglich gespielt werden durfte, nach Leipzig zurück. Von dort kommend,<br />
traf die Truppe Ende Mai 1771 in Berlin ein, nachdem ihrem Prinzipal schon am<br />
13. März das preußische Privilegium ausgefertigt worden war. Er hatte sich verpflichten<br />
müssen, Schucks Theater in der Behrenstraße käuflich zu erwerben und die hohen Schulden,<br />
die jener hinterlassen hatte, mit zu übernehmen.<br />
Der Antritt vor dem Berliner Publikum war für beide Seiten mit großen Hoffnungen<br />
verbunden, bedeutete für Koch aber einen Schritt ins Ungewisse, über dessen Risiko er<br />
sich durchaus im klaren war. Er hatte bereits das für damalige Verhältnisse recht hohe<br />
Alter von 68 Jahren erreicht. Er hatte 32 künstlerisch,Beschäftigte 27 zu versorgen, von<br />
denen einige schon Jahrzehnte bei ihm dienten, also aus moralischen und sozialen Gründen<br />
„unkündbar" waren; ein Drittel seiner Truppe war noch nie in Berlin aufgetreten,<br />
ein Teil bestand aus Anfängern - überall Unsicherheitsfaktoren. Wie es bei allzu langen<br />
Direktionsperioden vorkommt, war ein gewisser Schlendrian eingerissen, der sich in Vernachlässigung<br />
von Proben und Ausstattung bemerkbar machte. Auch war der Darstellungsstil<br />
des Ensembles uneinheitlich. Koch hatte das steife Emportement der regulierten<br />
Gestik beibehalten, die die Neubersdie Truppe nach französischem Muster kultiviert<br />
hatte. Ein Teil seiner Schauspieler folgte ihm noch darin, ein Teil war schon bei anderen<br />
Gesellschaften von den Bestrebungen beeinflußt worden, die „Nachahmung der Natur"<br />
vom Darsteller forderten (auch wenn darunter noch nicht „Natürlichkeit" verstanden<br />
2C C. T. Döbbelin (1727-1793) hatte 1756 in Leipzig erstmals eine eigene Truppe gegründet, angeblich<br />
auf Betreiben Gottscheds, um Koch auszustechen. Er hielt sich dann teils mit, teils neben<br />
Schuch in Berlin, den preußischen Provinzen, in Sachsen und Weimar auf. 1786 wurde er in<br />
Berlin zum Direktor des neugegründeten „Königlichen Nationaltheaters" ernannt, aber schon<br />
nach drei Jahren pensioniert.<br />
27 D. h. Schauspieler und Tänzer; dazu kamen noch Musiker und technisches Personal. Eine namentliche<br />
Aufzählung der Darsteller gibt A. E. Brachvogel: Das alte Berliner Theaterwesen bis<br />
zur ersten Blüthe des deutschen Dramas. Berlin 1877, S. 226 f.<br />
49
wurde). Was Kochs Repertoire betrifft, so wurde ihm hier oft vorgeworfen, er benutze<br />
veraltete Übersetzungen. Daran waren jedoch auch die Schauspieler schuld, die sich weigerten,<br />
eine einmal „sitzende" Rolle umzulernen 28 . Allerdings konnte Koch schon 1764<br />
in Dresden ein Repertoire von mehr als 100 Titeln vorweisen 29 , das nunmehr, da die<br />
Stücke nur langsam veralteten, gewaltig angewachsen war und von den Darstellern erhebliche<br />
Gedächtnisleistungen verlangte. Auch die Struktur des Repertoires bot Grund<br />
zur Sorge: Während Döbbelin einen ausgewogenen Spielplan mit einem gewichtigen Anteil<br />
an ernster Dramatik vorgeführt hatte, brachte Koch ein Operetten- und Lustspielensemble<br />
nach Berlin, das fürchten mußte, bei der nunmehr notwendigen Fächerung des<br />
Spielplans dem Vergleich mit Döbbelin nicht standzuhalten. Ein weiteres Handicap<br />
waren die übertriebenen Erwartungen, die man an das Niveau der Kocbsdien Truppe<br />
knüpfte. Schon die beiden Schuck hatten schauspielerisch Vorzügliches in Berlin geboten,<br />
und Döbbelin besaß hier eine starke „Partei". Koch aber genoß von allen lebenden Prinzipalen<br />
den größten, einen fast legendären Ruf, den er nun zu rechtfertigen hatte. Dazu<br />
kamen die hohen finanziellen Investitionen, die er schon vor der ersten Einnahme aufbringen<br />
mußte. Die Übernahme der Schulden Schucks zeugen nicht nur von dem Wert,<br />
den Koch dem preußischen Privilegium beimaß, sondern auch von seiner weitsichtigen<br />
Geschäftsführung, indem er stets für einen Fonds sorgte, der die finanzielle Sicherheit des<br />
Unternehmens und der von ihm Abhängigen garantierte. Wie hoch diese Rücklage war,<br />
zeigte sich, als er eine weitere Belastung auf sich nahm, bevor er seine Bühne eröffnen<br />
konnte: Die trotz königlichen Zuschusses in der Auflösung befindliche französische<br />
Truppe des Fierville hatte, kaum daß sie von Kochs Anrücken hörte, das Theater mit<br />
Beschlag belegt. Um sein teuer erkauftes Haus benutzen zu können, mußte Koch das<br />
Kammergericht anrufen. Die Entscheidung lautete zwar, daß Fierville das Gebäude innerhalb<br />
von drei Tagen zu räumen habe, aber Koch wollte nicht in einer Atmosphäre<br />
der Feindseligkeit beginnen. Er kaufte also Fierville noch seine schäbigen Dekorationen<br />
für 1500 Taler ab, und der Streit war beigelegt. Das Schuchsche Theater, das nicht direkt<br />
an der Straße, sondern auf einem Hof lag 30 , war übrigens wesentlich bescheidener als<br />
Kochs Leipziger Schauspielhaus und faßte nur maximal 800 Zuschauer.<br />
Am 10. Juni 1771 eröffnete Koch sein Theater mit Lessings bürgerlichem Trauerspiel<br />
„Miß Sara Sampson" und einem pantomimischen Ballett, benannt „Die Abendstunde".<br />
Vorangegangen war ein Prolog Karl Wilhelm Ramlers, des Berliner Poeten und Professors<br />
der Logik und der Schönen Wissenschaften. Plümicke, der erste Historiograph des<br />
Berliner Theaters, berichtet: „Der Beifall war so gros, daß in den ersten sechs oder acht<br />
Vorstellungen das Theater nicht allein gepfropft voll war, sondern wol eben so viel Zuschauer<br />
wieder weggehen musten, als es schon wirklich enthielt; welches auch nachher<br />
noch zum öftern geschehen." 31 Ramlers Prolog, gesprochen von Madame Koch 32 , appellierte<br />
kräftig an das Nationalgefühl, den „Deutschen Musentempel" nicht zu mißachten,<br />
sondern gegen die Übermacht der italienischen Oper und des französischen Schauspiels zu<br />
unterstützen:<br />
28 Vgl. C. A. Bertram: An den Herrn Schmid zu Giessen. Frankfurt, Leipzig 1773, S. 29.<br />
29 Fürstenau (s. Anm. 1 in Teil 1), S. 20.<br />
30 Situationsplan bei Brachvogel (s. Anm. 27), S. 187.<br />
31 C. M. Plümicke: Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin. Berlin, Stettin 1781, S. 269.<br />
32 Die Bezeichnungen „Madame" und „Demoiselle" für weibliche Bühnenangehörige wurden in<br />
Berlin erst infolge der Revolution von 1848 durch „Frau" und „Fräulein" ersetzt.<br />
50
„Wenn Ihr den Künstlern fremder Nationen<br />
So viel vergeben habt, und noch vergebt:<br />
Wie? wolltet Ihr nicht gern des eignen Volkes schonen?<br />
O beste königliche Stadt,<br />
Die nicht den kleinern Ehrgeitz hat,<br />
Das andere Paris zu werden;<br />
Die stets nach einem höhern Ziele stand:<br />
Die erste Stadt des ersten Volks zu werden . . ." 33<br />
Mit solchen Worten war das Publikum schon gewonnen, und die Vorstellung von Lessings<br />
Trauerspiel, das in Kochs Leipziger Erstaufführung seinen eigentlichen Siegeszug<br />
angetreten hatte 34 , in Berlin jetzt aber lange nicht gegeben worden war, erwies sich als<br />
geeignetes Debüt der Truppe. Karl Lessing berichtet am 22. Juni an seinen Bruder:<br />
„Koch ist mit seiner Truppe hier, und spielt schon seit neun Tagen. Er hat großen Beyfall,<br />
und ich glaube, nicht unverdienter Weise. Seine Leute sind eben keine großen Meister,<br />
doch erträglich. Ihre Vorstellungen fallen im Ganzen immer besser aus, als die Döbbelinischen:<br />
ungeachtet ich einzelne Rollen oft lieber von einem Döbbelinischen Acteur sehen<br />
möchte, als von einem Kochischen. . . . Brückner als Meilefont hat mich . . . nicht sehr<br />
erbauet. Empfindungen anzudeuten, scheint gar nicht seine Sache. Sein Schreyen wollte ich<br />
ihm verzeihen: er ist ein Sachse, und hat bisher auf einem großen Theater gespielt. . . .<br />
Geht er in das Großmüthige über, so hat er so etwas Bramarbasisches oder Döbbelinisches,<br />
daß er ohne seinen guten Anstand 35 und seine feine Figur unausstehlich sein würde.<br />
Madame Koch hat die Marwood sehr gut gespielt, viel natürlicher als die Schulzin 38 . . . .<br />
Wenn sie in allen Rollen so wäre, müßte sie auch der Neid für eine unserer besten<br />
Schauspielerinnen halten. . . . Meynst Du aber, daß hier wohl eine . . . Ursache wirken<br />
könne: ihre Schönheit; so erlaube mir, Dich zu erinnern, daß Du sie schon vor zwanzig<br />
Jahren gesehen hast, und Theaterdamen an die Fünfzig, und so dick als groß, meine<br />
Augen und Ohren wohl vor einem unrechten Eindrucke bewahren. Madame Starkin<br />
machte die Miß Sara. Ihr Äußeres steht zwar ihrem inneren Werthe nach; aber wahrhaftig,<br />
ich sehe lieber die schlechteste Rolle von ihr, als die beste von der schönen<br />
Döbbelin. Den Waitwell spielte Schubert. Vortrefflich, sage ich Dir. Diese Rolle hat<br />
mir immer etwas matt und langweilig geschienen, welches ich zum Theil dem Verfasser<br />
zugeschrieben habe; allein Schubert hat mich auf andere Gedanken gebracht, und nun<br />
scheint mir Waitwell eine von den wichtigsten und rührendsten Personen des Stückes<br />
zu seyn. Sampson war kalt: denn es war Schmelz; und Betty eine schöne artig gekleidete<br />
sächsische Kammerjungfer: es war die älteste Schickinn, die mit ihrer Schwester und der<br />
Mademoiselle Huber recht artige Mädchen sind." 37<br />
33 C. A. Bertram: Ueber die Kochische Schauspielergesellschaft. Aus Berlin an einen Freund. Berlin,<br />
Leipzig 1772, S. 16.<br />
54 Die Uraufführung fand nicht, wie z.B. Kürschner (Allgem. Deutsche Biographie, Bd. 16/1882,<br />
S. 381) noch annahm, in Leipzig statt, sondern am 10. 7. 1755 durch die Ackermannsche Truppe<br />
in Frankfurt a. d. Oder. Sie wurde jedoch noch längst nicht so beachtet wie Kochs Aufführung<br />
im April 1756 in Leipzig.<br />
35 „Anstand" bedeutete in der Schauspieltheorie der Zeit soviel wie würdiges oder gewandtes<br />
Auftreten und Benehmen, im Charakter der Rolle, aber unter Beherrsdiung und Beachtung der<br />
Gesetze der Ästhetik und der Etikette.<br />
36 Karoline Schulze-Kummerfeld (vgl. Teil 1, S. 22).<br />
** Dieses wie alle folgenden Briefzitate sind den Bänden 17-20 der historisch-kritischen Lessing-<br />
Ausgabe von K. Lachmann und F. Muncker (Stuttgart, Leipzig 1886 ff.) entnommen, die im<br />
übrigen als Quelle zur Theatergeschichte Berlins noch viel zu wenig ausgewertet worden ist.<br />
51
C. A. Bertram, der im übrigen vermutet, daß das Stück stark gekürzt wurde, stimmt in<br />
vielem mit Karl Lessings Urteil überein: „Hr. Brückner spielte den Mellefont vortrefflich,<br />
nur gegen seine Sara war er fast immer zu stürmisch. . . . Mad. Kochinn machte die<br />
Marwood als eine Meisterin. Ihr öfteres heftiges Schlagen mit der Hand auf dem Busen,<br />
wäre etwan das Einzige, was man an ihr rügen könnte. ... Madam Starckinn schien<br />
ihrer Jahre wegen in der Rolle einer feurigen, unschuldigen und affektvollen Liebhaberin<br />
nicht an ihrer rechten Stelle zu seyn, . . . hier hätte ich mir wohl eine Döbbelinin zu sehen<br />
gewünscht. . . . Von Hrn. Schmelz als Sir Sampson hätte ich mehr vermutet. . . . Sollte<br />
der nicht Kummer, Affect, Hitze, ja sogar Verzweifelung zeigen? Aber Herr Schmelz that<br />
nichts als Weinen." Schuberth als Waitwell fand Bertram „sehr natürlich", Herlitz als<br />
Norton und die ältere Schick als Betty „leidlich", Madame Steinbrecher „als Hannah,<br />
schlecht; es war bei ihr gar keine Aktion, und es müssen ihr viele Zähne fehlen, denn sie<br />
redete sehr unangenehm und undeutlich". Das abschließende Ballett „nahm sich, weil das<br />
Theater für die vielen Personen, die darinn vorkamen, beinahe zu klein war, nicht sehr<br />
gut aus". 38<br />
Mit der ersten Vorstellung hatte Koch die wichtigsten Inhaber der tragischen Rollenfächer<br />
präsentiert. Johann Gottfried Brückner (1730-1786) war der Heldenspieler und<br />
„Star" des Ensembles. Ein kultivierter, sehr temperamentvoller Schauspieler, war er<br />
schon 1753 zu Koch gekommen und schnell in komischen Rollen groß geworden. Er<br />
wechselte dann ins Fach der „Chevaliers" und wurde schließlich in Tyrannenrollen<br />
berühmt. Ein gewisser Mangel an Wärme blieb seinem Spiel immer eigen, den er in<br />
Szenen der Leidenschaft durch Heftigkeit und Lautstärke zu überdecken suchte. Schmid<br />
rühmt seine „geläufige Sprache, gute Modulation der Stimme, mannichfaltige Pantomime",<br />
wirft ihm aber z. B. vor, daß er als Meilefont „zu kalt" sterbe. Er galt in seinen<br />
Fächern neben Konrad Ekhof als der größte Schauspieler der Epoche. 39<br />
Christiane Henriette Koch (1731-1804) begann als Soubrette, exzellierte in komischen,<br />
dann aber auch in tragischen Rollen, vor allem in Weißes Trauerspielen. Ihre Spezialität<br />
waren Hosenrollen, die sie auch jetzt noch spielte, was angesichts ihrer Leibesfülle von<br />
der Kritik als unpassend bezeichnet wurde. 40 Hagen bemerkt boshaft, sie habe „noch<br />
jetzt ein ziemlich reizendes Gesicht aufzuweisen, besonders für die Liebhaber von Rubens'<br />
Geschmack". Bezüglich ihres „Portebras" tadelt er ihre einförmig-manierierte Gestik:<br />
„Sie sucht eine Schönheit darin, mit ihren Armen in unaufhörlicher Bewegung zu<br />
sein. Sobald der eine Arm niedersinkt, hebt sich der andere, und dieses dauert so lange,<br />
als sie etwas zu sagen hat. Ihre ganze Modulation der Bewegung besteht darin, daß sie<br />
entweder mit dem Daumen und Zeigefinger ihrer rechten Hand an die Stirne greift, oder<br />
die Hand in einer geringen Entfernung vom Munde hält." 41 Schmid lobt dagegen eine<br />
Begabung, „die sie nur mit wenigen gemein hat: den Anstand, womit sie haranquiren<br />
kann, ein nützliches Talent für eine Prinzipalin, welche oft Prologe herzusagen hat". 42<br />
Johanna Christiana Starke (1732-1809) erlangte laut Hagen in der Kunst zu deklamieren<br />
„in der bürgerlichen Tragödie und rührenden Komödie große Vollkommenheiten. Voll<br />
38 Bertram (s. Anm. 33), S. 18 f.<br />
39 Lessing stellte ihn als „Teilheim "über Ekhof (Brief v. 9. 6. 1768). Schmid fand ihn als „Richard<br />
III." (Weiße) Ekhof ebenbürtig („Das Parterr", 1771, S. 296).<br />
40 J. J. A. v. Hagen: Magazin zur Geschichte des Deutschen Theaters. Halle 1773, S. 80.<br />
11 Hagen (s. Anm. 40), S. 77 f.<br />
innigster Empfindung in zärtlichen, voller Naivität in unschuldigen Rollen hat sie frühzeitig<br />
gerührt und entzückt". Scbmid urteilt 1770: „Die größte deutsche Schauspielerin<br />
in der Empfindung ist unstreitig Madam Starke." Sie war die begabteste Charakterdarstellerin<br />
der Truppe, die ideale Partnerin für Brückner.<br />
Simon Schmelz (1735-1785), der mit seiner Frau bei der „Hamburgischen Entreprise" 43<br />
mitgewirkt hatte, begann erfolglos in Liebhaberrollen und brachte es allmählich in „ernsthaften<br />
und melancholischen Charakteren" zu einiger Bedeutung. Der „Teilheim" wurde<br />
seine Forcerolle.<br />
Johann Gottlieb Schuberths (1717-1772) eigentliche Sphäre waren „die echten teutschen<br />
Bürger, die treuherzigen und zänkischen Alten und Gecken". Er starb schon am 2. 8. 1772<br />
am Herzschlag auf einer Spazierfahrt in Charlottenburg.<br />
Herlitz (ca. 1748-1776), der ursprünglich Tänzer gewesen war, spielte „lüderliche<br />
Karaktere, feine Betrüger und einige lebhafte Liebhaber", litt jedoch unter einer heiseren<br />
Stimme.<br />
Anna Christine Schick (1753-1827), deren jüngere Schwester ebenfalls zu Kochs Truppe<br />
gehörte, wurde später „unstreitig eine der ersten teutschen Soubretten", von der Hagen<br />
meinte, „man wird wenig Schauspielerinnen finden, die einen solchen Reidithum an<br />
nekkischer Pantomime haben, deren Auge so viel schalkhaften Spott, und wenn's sein<br />
muß, Naivität äußert".<br />
Die alte Steinbrecher, die bei der Neuberin „kokette Mütter" gespielt hatte, wurde<br />
nicht so bekannt wie ihre Tochter Karoline Elisabeth (geb. 1733), die als hervorragende<br />
Soubrette eine Hauptstütze des Kochsdien Operettenrepertoires war.<br />
43 Zeitgenössische Bezeichnung für das Hamburger Nationaltheater (1767-69), das Lessings „Hamburgische<br />
Dramaturgie" veranlaßte.<br />
53
In den nächsten Monaten stellte Koch nun seine Vielseitigkeit unter Beweis und brachte<br />
fast täglich eine Novität. Das hatte Klagen der Kritiker über mangelndes Memorieren<br />
der Schauspieler, unpassende Kostüme und schlechte Dekorationen zur Folge 44 . Da noch<br />
keine Tageskritiken erschienen, merkte Koch von solchem Mißfallen wenig, denn der<br />
Andrang des Publikums blieb unvermindert. Am 12. Juni begann der langerwartete<br />
Reigen der Operetten mit „Lottchen am Hofe" (bis zum 30. 3. 1775 20mal gespielt),<br />
dem am 18. „Die Jagd" folgte. In diesem Singspiel, das unter Koch in Berlin<br />
„einige vierzig Mal" (Plümicke) gegeben wurde, stellte sich fast das gesamte Komikerpersonal<br />
der Truppe vor: Karoline Steinbrecher, das Ehepaar Löwe, die Herren<br />
Witthöfl, Martini, Henke, Hübler und Klotzsch. Vor allem Karl Wilhelm Witthöft<br />
(1728-1798) und Christian Leberecht Martini (1728-1801) wurden in fein- wie in derbkomischen<br />
Rollen fast immer gelobt. Schmid gesteht mehrmals: „Bei beiden kann man<br />
vor Lachen nicht zu sich selbst kommen." Witthöfl, der wie Schmelz bei der „Hamburgischen<br />
Entreprise" mitgewirkt hatte, gehörte zu den Komikern, die durch ihr bloßes<br />
Auftreten Lachstürme hervorrufen, konnte aber auch Intriganten glaubhaft verkörpern.<br />
Martini war Kochs Bühne auch als Lustspieldichter von Nutzen.<br />
Am 1. Juli trat der Prinzipal selbst zum ersten Mal in einer größeren Rolle vor das<br />
Publikum. Es wurde „Der Kranke in der Einbildung" nach Moliere gegeben, mit einem<br />
Nachspiel: „Die Doktorpromotion des Argan." Bertram berichtet, daß alle Rollen sehr<br />
gut besetzt waren und das Stück „mit Applaudissement" aufgenommen wurde. Der<br />
„Argan" gehörte zu dem Rollenfach, das Koch meisterhaft beherrschte. „Sein größtes<br />
Verdienst als Schauspieler bestand in Moliereschen Alten, die vor ihm noch keiner den<br />
Franzosen abgelernt und worin er nur einen einzigen, aber gefährlichen Nebenbuhler<br />
an Herrn Ackermann hatte. Er that dies so glücklich, daß durch ihn die Molieresche,<br />
das ist die wahre Komödie, zuerst Leben und Wahrheit erhielt." 45 Hagen beschreibt Koch<br />
im Jahre 1773 als einen Mann von „mittler Statur, und noch jetzt von einer vortheilhaften<br />
und einnehmenden Bildung. Seine Miene ist voll Ausdruck, seine Augen voller<br />
Beredsamkeit, seine Sprache sanft, doch durch sein hohes Alter nunmehro etwas unverständlich.<br />
Er war ehedem einer der besten deutschen Schauspieler; noch jetzt findet man<br />
in seinem Spiele die deutlichsten Spuren davon. ... In Molierens eingebildetem Kranken<br />
zeigte er sich in der Hauptrolle zuerst in Berlin. Man hatte hier in eben dieser Rolle<br />
einen Stenzel 46 gesehen, der sie vortrefflich spielte; das noch zu lebhafte Andenken<br />
davon mochte bey dem Zuschauer wohl Schuld daran seyn, daß Hr. Koch den Grad<br />
des Beyfalls nicht erhielt, den er sich vielleicht versprochen hatte; wenigstens hat er<br />
sich weder in dieser, noch in einer andern Hauptrolle aus Molierens Lustspielen hier<br />
wieder sehen lassen, so sehr man auch wenigstens den Geitzigen von ihm zu sehen<br />
wünschte, den er in vorigen Zeiten ausnehmend gut gespielt haben soll." 47<br />
Bauses 1783 erschienener Kupferstich, der Koch als „Argan" mit einer turbanartigen<br />
Kopfbedeckung zeigt, trägt die Unterschrift „Melpomenens und Thaliens Günstling".<br />
Das kann bedeuten, daß man sich auch des Tragöden Koch noch dankbar erinnerte,<br />
44 Hagen (s. Anm. 40), S. 71-73.<br />
45 Hagen: Gallerie (s. Anm. 25 in Teil 1), S. 78 f.<br />
18 Johann Anton Stenzel (1705-1781), ein gebildeter, vielseitiger Charakterdarsteller, war seit<br />
1740 bei Schudi engagiert.<br />
47 Hagen (s. Anm. 40), S. 69 f. - Hagens Schrift erschien 1773, konnte also von Kochs späteren<br />
Moliere-Rollen noch nichts wissen.<br />
§4
obwohl er im letzten Jahrzehnt seines Lebens wohl nur in Komödien auftrat. Vielleicht<br />
war aber dieses Prädikat auch lediglich eine bei solchem Anlaß beliebte Floskel, denn<br />
auch Lessing wurde 1771 so tituliert.<br />
Im Januar 1772 versuchte Koch, durch die anhaltenden Erfolge ermutigt, seiner Truppe<br />
den Charakter von „Hofschauspielern" zu verschaffen, schon um wenigstens teilweise<br />
von den drückenden Abgaben an die Stadt befreit zu werden. Karl Lessing, der von<br />
diesem Bemühen später mündlich erfuhr, schildert den Fall in einem Brief an seinen<br />
Bruder: „Jedermann ist diesem Biedermanne gut, und letzthin soll ihm ein Minister den<br />
Anschlag gegeben haben, sich den Titel als Hof Schauspieler bey dem König auszubitten;<br />
dann könnte er ihm einige Abgaben erlassen, die doch jährlich an 1500 Thaler betragen.<br />
Koch thut es. Als der König seine Supplik erbricht, sagt er zu seinem Cabinetsrathe:<br />
,Höre Er, dem alten Koch möcht ich wohl einen Titel geben; schreibe Er ihm nur, ob<br />
er will Commercienrath, Hofrath, Kriegesrath, und so was werden; ich will es ihm<br />
gern accordiren.' Als der arme Koch das allergnädigste Handschreiben erbricht, fängt<br />
er bitterlich an zu weinen, und seufzet: ,Ach, der König glaubt gar, ich bin nicht klug!'<br />
Man hatte Mühe, es ihm auszureden und ihm zu bedeuten, daß der König ihn nur zu<br />
wohl verstanden und mit Döbbelin gewiß den Spaß nicht gemacht haben würde. Aber<br />
aus diesem Spaße erkennt nun Jedermann die Gesinnung des Königs für das deutsche<br />
Theater."<br />
Sachlicher ist die Angelegenheit bei Piümicke dargestellt, der auch die Kabinettsorder<br />
Friedrichs des Großen im Auszug mitteilt. Sie besagte, „daß obgleich S. K. M. Bedenken<br />
trage, der Kochschen Truppe den nachgesuchten Charakter beizulegen, dennoch in Ansehung<br />
ihrer vorzüglichen Talente zum Theater und des bei Kennern dadurch erworbenen<br />
großen Beifalls, wodurch dieselbe wol einige Distinktion verdienet, Sr. K. Maj. höchste<br />
Willensmeinung dahin gehe, daß man für selbige einen andern schicklichen Charakter<br />
aussinnen und in Vorschlag bringen solle, welcher derselben nicht allein zur Distinktion<br />
von andern gemeinen Comödianten, sondern zugleich zur Aufmunterung dienen könne,<br />
ihre Talente noch immer mehr zu excoliren und dem deutschen Theater Ehre zu machen".<br />
Piümicke bemerkt dazu: „Der weitere Erfolg war, daß zwar der seel. Minister von<br />
Massow verschiedene Titel in Vorschlag brachte, daß aber Koch alle Titel verbat, welche<br />
nicht zugleich auf seine Schauspielergesellschaft mit Beziehung hatten."<br />
Blieb also von außen der Beitrag zur materiellen Sicherung der Schauspieler versagt,<br />
so führte Koch selbst eine Neuerung ein, die ihm von verschiedenen Kritikern verübelt<br />
wurde, aber einen wichtigen finanziellen Fortschritt in der Sozialgeschichte des Schauspielers<br />
darstellt: das Spielhonorar für Gesangsrollen, also für außer der Norm erbrachte<br />
Sonderleistungen. Piümicke berichtet: „Der schöne Gesang der Hillerschen Operetten<br />
war beim Berlinischen Publikum, in welchem sich viele Kenner der Musik befinden,<br />
und das an Grauns edlen Gesang gewohnt war, eigentlich die Ursach, daß die musikalischen<br />
Schauspiele in kurzem so großen Beifall fanden. Koch aber war, durch eigene<br />
Unvorsichtigkeit, Schuld, daß die Operetten (sehr wider seinen Willen) mehr gefordert<br />
wurden, als ihm lieb war. Er hatte eingeführt, daß diejenigen Schauspieler, welche die<br />
Hauptrollen sangen, bei der ersten Vorstellung einen Louisd'or, bei der zweiten einen<br />
Dukaten, und bei jeder der nachfolgenden Vorstellungen zwei Gulden erhielten; wie auch<br />
den geringem Akteurs, sobald sie sangen, für die erste Vorstellung wenigstens ein Dukaten,<br />
bei der zweiten ein Thaler, und hierauf bei jeder nachfolgenden Vorstellung ein<br />
Gulden gereicht werden mußte. Dieses bewog die Schauspieler, die singen konnten, alles<br />
55
mögliche anzuwenden, um die Singspiele emporzuheben, ... so daß zuletzt weit mehr<br />
als die Hälfte der Schauspiele singend war; wodurch denn die Schauspieler, welche<br />
singen konnten, von den nur bemeldeten Singegeldern sich eine stärkere Einnahme zu<br />
verschaffen wußten, als ihr eigentliches Gehalt war."<br />
Am 6. April 1772 fand eine denkwürdige Premiere statt. Gotthold Ephraim Lessing,<br />
der zurückgezogen in Wolfenbüttel lebte, hatte schon im Juli 1771 eine scherzhafte<br />
Mahnung seines Bruders aus Berlin erhalten, der regen Umgang mit Kochs Truppe<br />
pflegte: „Manuscript, lieber Bruder! Oder eine Tragödie oder Komödie! Dem armen<br />
Koch käme sie zustatten!"<br />
Ein halbes Jahr später war „Emilia Galotti" im Entstehen, und Lessing schrieb am<br />
24. Dezember an seinen Verleger Voß in Berlin: „Mit meinem neuen Stücke hätte ich<br />
vor, es auf den Geburthstag unsrer Herzogin, welches der lOte März ist, von Döbblinen<br />
hier zum erstenmale aufführen zu lassen. Nicht Döbblinen zu Gefallen, wie Sie wohl<br />
denken können: sondern der Herzogin, die mich, so oft sie mich noch gesehen, um<br />
eine neue Tragödie gequält hat. In diesem Falle müßte ich Sie aber bitten, es zu<br />
verhindern, daß Koch sie nicht etwa vor besagten lOtn März spielte. Denn sonst würde<br />
das Kompliment allen seinen Werth verlieren."<br />
Am 11. Januar 1772 fragte Karl Lessing an: „Du bist doch nicht böse, wenn Deine<br />
Tragödie hier von Koch gespielt wird? Es versteht sich, nicht eher als Du es haben<br />
willst."<br />
Aus einem Brief vom 15. Februar geht hervor, daß Karl Lessing direkten Einfluß auf<br />
die Inszenierung nahm: „Nun ein Wort von der Vorstellung! Ich fürchte, sie wird<br />
dem Innern [der Dichtung] nicht entsprechen. In welcher Tragödie ist der Ton, den<br />
Du angenommen? Unsere Paar guten Schauspieler können rasen, wüthen, toben; aber<br />
Marinelliren wahrhaftig nicht. . . . Vielleicht greifen sich hier unsere Schauspieler<br />
aus Eifersucht gegen Döbbelin mehr an. Schicke nur bald das Ende Deiner Tragödie;<br />
ich will Dir ein Langes und Breites darüber fragen, damit ich sie durch Dich unterrichten<br />
kann."<br />
Bezüglich der Besetzung hatte auch der Dichter Bedenken: „Wenn Koch die Emilia<br />
spielt, so ist mir bange, daß die Steinbrecherin die Emilia wird machen sollen. - Das<br />
wäre aber eine Rolle, um die älteste Schickin damit in Arbeit zu setzen. Man vergiebt<br />
dem jungen Mädchen immer mehr, als der alten Actrice. Und sie müßte ja wohl<br />
abzurichten seyn."<br />
Drei Wochen nach der erfolgreichen Braunschweiger Uraufführung ging das Werk<br />
auch in Berlin in Szene. Friedrich Nicolai berichtet am nächsten Tag an Lessing:<br />
„Ich muß Ihnen sagen, daß die Aufführung wider mein Erwarten ausgefallen ist; denn<br />
ich zitterte (dies unter uns), daß es diese Truppe ganz verderben möchte. Ich befürchtete,<br />
daß die Spieler, zumal in der Eil, in der sie die Rollen haben lernen müssen,<br />
noch weit weniger von ihren Rollen verstehen würden, als sie wirklich verstanden<br />
haben. Zuerst, versichere ich Sie, daß die Starkin die Claudia meisterhaft spielte. . . .<br />
Dies ist nicht allein mein Urtheil, sondern auch das aller derer, auf deren Urtheil (in<br />
Berlin) Sie einiges Gewicht legen, besonders Moses 48 Urtheil. Die Steinbrecherin jun. hat<br />
die Emilia besser gespielt, als man vermuthen konnte. Sie hat freylich nicht das jugendliche<br />
Ansehen, das ihr zu dieser Rolle zu wünschen wäre. .. . Aber sie hat nicht allein<br />
48 Der mit Lessing befreundete Philosoph Moses Mendelssohn.<br />
56
alles, was ans Naive gränzt, sehr gut gemacht, sondern auch, was das meiste ist, ihre<br />
ganze Rolle, bis auf einige Kleinigkeiten, verstanden. . . . Die Orsina hat die Kochin<br />
doch noch besser gespielt, als ich mich zu erwarten getrauete. Was sie verstanden hat,<br />
daß heißt ein starkes Drittel der Rolle, ist ganz gut gewesen. .. . Brückner ist, wie Sie<br />
wissen, in seinem Spiele ziemlich auf Draht gezogen; dies hat er auch in seinem Marinelli<br />
gestern nicht verläugnet. . . . Aber dennoch war Vieles ganz gut, sonderlich für das<br />
allgemeine Publicum. ... Ich glaube auch, aus einigen Excursen gestern Abend, daß er<br />
einige Stellen künftig noch feiner machen wird. ... Es ist ein großer Fehler, daß der<br />
Odoardo Schuberten, und nicht Schmelzen gegeben worden, der den Mahler macht. Dies<br />
kommt daher, daß die Rollen ausgetheilt und auch zu lernen angefangen wurden, als<br />
erst drey Acte hier waren. Man hatte nicht daran gedacht, daß der Vater im vierten<br />
und fünften Act solche wichtige Scenen haben könnte. ... So manche Vollkommenheit<br />
auch den Schauspielern fehlt, so muß man doch mit ihnen zufrieden seyn, daß sie<br />
durch die Aufführung viele Schönheiten des Stücks den Zuschauern im Ganzen lebhafter<br />
vor Augen gebracht haben, als durch das bloße Lesen geschehen. Der Beyfall<br />
war allgemein."<br />
Das Werk erlebte 9 Wiederholungen; keine große Zahl, doch zweifellos für ein Trauerspiel<br />
ein Zeichen stärkeren Interesses.<br />
Im August enthält ein Brief Karl Lessings eine Bemerkung, die aufschlußreich für die<br />
moralische Haltung und den gesellschaftlichen Status der Kochsdien Truppe ist: „Man<br />
schätzt sie mehr um ihres stillen und ordentlichen Lebens, als um ihrer Vorstellungen<br />
willen." Auch hierin ging Koch mit seiner Bühnenleitung den anderen Truppen voran.<br />
Der erste Eindruck Karoline Schuhes, die vorher bei Ackermann gespielt hatte, war<br />
eine ungewohnte „Bürgerlichkeit" ihrer Kollegen: „Mir war, als ob ich in eine neue<br />
Welt versetzt worden. Es herrschte die größte Ordnung. Die Schauspieler begegneten<br />
einer dem andern höflich, gefällig, freundlich. Brüderschaften, daß alles sich Du und Du<br />
nannte, war ebensowenig der Ton wie bei Ackermann. Aber da war kein Gezanke.<br />
Jedes lebte für sich. Man besuchte sich auch. Aber wie es Bürger in Städten machen,<br />
die ihre Freunde, wenn es Zeit und Geschäfte erlauben, gegenseitig mit ihren Besuchen<br />
ehren. . . . Der alte Koch und seine Frau waren die rechtschaffensten Leute, und dabei<br />
überaus billig und wohlwollend und schätzbare Künstler. Sie duldeten auf ihrer Bühne<br />
keine Klatschereien und hielten streng auf Anstand und gute Sitte. Deshalb waren<br />
Kochs und ihre Schauspieler in den besten Gesellschaften gern gesehen und selbst in<br />
Familien, die es sehr genau mit der Schicklichkeit nahmen, einheimisch." 49<br />
Am 13. September reiste die Truppe noch einmal für eine Saison nach Leipzig; im<br />
März 1773 kehrte sie zurück und blieb fortan dauernd in Berlin. Seit dem 30. März<br />
1773 existiert eine stehende Bühne in unserer Stadt: auch diese Kontinuität durchzusetzen,<br />
blieb der Energie und Umsicht Heinrich Gottfried Kochs vorbehalten.<br />
Trotz seiner hohen Jahre erschien der Prinzipal noch von Zeit zu Zeit auf der Bühne.<br />
Seit dem 6. August spielte er Molieres „bürgerlichen Edelmann" und hatte, wie Karl<br />
Lessing bezeugt, „sein Haus alle Tage voll. Auf solche Stücke schimpft man, wie gewöhnlich;<br />
aber ihm konnte man, ungeachtet seines Alters, den Beyfall nicht versagen."<br />
Das spektakulärste Ereignis seines Berliner Wirkens war dann die Uraufführung des<br />
„Götz von Berlichingen", die dem bis dahin unbekannten fünfundzwanzigjährigen Ver-<br />
49 Karoline Sdiulze-Kummerfeld: Erinnerungen (s. Anm. 18 in Teil 1), S. 211 f.<br />
57
fasser den Vergleich mit Shakespeare eintrug und auch Kochs Namen „Unsterblichkeit"<br />
sicherte, obwohl er solche gewiß nicht seinem literarischen Weitblick zu verdanken hatte.<br />
Karl Lessing stellt die Vorgeschichte der Aufführung in einem Brief an seinen Bruder<br />
so dar:<br />
„In der Braunschweigischen Zeitung las ich bey der Anzeige dieses Götz ein kritisches<br />
Verbot, ihn nicht aufzuführen; und doch wird Koch es thun: ich läugne nicht, auf mein<br />
Zureden, das viele Andere unterstützt und am meisten gewisse Umstände gültig gemacht<br />
haben. Hier will es nicht mehr mit den Wiener Stücken fort, und Koch steht dazu im<br />
allgemeinen Rufe, daß er der erbärmlichste Kenner von theatralischen Sachen sey 50 .<br />
Seine Freunde und Rathgeber müssen zwar von dieser Beschuldigung auch einen großen<br />
Theil mit tragen; allein ich weiß am besten, daß er zu alt und im Geschmack zu weit<br />
zurück ist, um die kleinen und großen Einsichten seiner Freunde wie ein Director zu<br />
nutzen. . . . Da Alle, die den Götz gelesen, ihn ganz vortrefflich finden, auch daher<br />
schon voraussetzen, Koch werde ihn nicht aufführen: so muß er wohl das Gegen -<br />
theil thun, so ungern er auch in seinem Herzen daran geht."<br />
Diese Vorwürfe sind einigermaßen ungerecht. Koch war ein erfahrener Praktiker, der<br />
die Darstellbarkeit eines Stückes durch sein Personal sehr gut beurteilen konnte. Er<br />
mußte bei der Annahme von Dramen in erster Linie deren Bühnenwirkung im Auge<br />
haben und konnte nicht leichtfertig sein Unternehmen dadurch gefährden, daß er allen<br />
literarischen Neigungen seiner „Freunde" folgte. Die Wiener Lustspiele der Gebrüder<br />
Stephanie, die Koch bevorzugte, stellten effektvolle, erprobte Theaterware dar, deren<br />
Aufführung ihm nur laienhafte Besserwisser verübeln konnten.<br />
Der „Götz von Berlichingen" mit seiner großen Personenzahl und dem häufigen Szenenwechsel<br />
galt allgemein als unaufführbar. Koch wird sich wohl nicht nur auf Karl Lessings<br />
Zureden entschlossen haben, den Versuch zu wagen. Vielmehr erkannte er die Neuheit<br />
des Stoffes und des Genres, die auf jeden Fall Interesse finden würde, zumal das Buch<br />
bereits überall im Gespräch war. Was ihn bedenklich stimmte, waren die szenischen<br />
Anforderungen, die seine „Ratgeber" wenig kümmerten. Daß und wie er sich dennoch<br />
ans Werk machte, beweist Mut, geistige Beweglichkeit und sicheren Blick für dem Werk<br />
innewohnende Problematik und sich daraus ergebende Notwendigkeiten. Koch gelang<br />
es nämlich wie in Leipzig, einen der prominentesten Künstler der Stadt für die Mitarbeit<br />
zu gewinnen: Johann Wilhelm Meil.<br />
Kochs Garderobe war stets als „reichhaltig" und „prächtig", wenn auch als gelegentlich<br />
falsch angewandt bezeichnet worden. Trotzdem erkannte er, daß er bei dieser neuen<br />
theatralischen Gattung, dem „Ritterdrama", nicht auf seinen Fundus zurückgreifen<br />
durfte, sondern um ein historisch getreues Kostüm bemüht sein mußte. Eine ähnliche<br />
Situation war schon 1766 eingetreten, als Koch das Leipziger Schauspielhaus mit Schlegels<br />
„Hermann" eröffnete und die antikischen Gewänder der Darsteller Aufsehen erregten,<br />
weil das Publikum gewohnt war, die römischen Helden im Rokoko-Habit zu sehen. Die<br />
ersten deutschen Versuche, Korrektheit im historischen Kostüm zu erreichen, sind also<br />
mit Kochs Namen verbunden. „Mit dem ,Götz' hatte die Bühne ein neues, nie gesehenes<br />
Milieu von unumgänglicher dramaturgischer Wichtigkeit darzustellen", schreibt Winfried<br />
SS<br />
Gemeint ist: von dramatischer Literatur, die er allerdings anders beurteilte als bühnenfremde<br />
Intellektuelle. Ein typisches Beispiel bringt Benram (s. Anm. 28), S. 65.
flk-r<br />
V- -4.<br />
$f-¥<br />
M B B H H |<br />
\i0-<br />
,7.<br />
"Ä"<br />
^'*^<br />
J.W. Meil:<br />
Kostüm der<br />
Elisabeth in<br />
„Götz von Berlichingen<br />
Berlin 1774<br />
Klara 51 , „und es spricht für Kochs sicheren Instinkt, daß er den kostümhistorisch erfahrenen<br />
Maler herbeiruft und durch seine Mitwirkung die Aufführung zur einer weithin<br />
wirkenden Sensation macht."<br />
Karl Lessing meldet seinem Bruder am 14. Februar 1774: „Meil hat Zeichnungen zu<br />
dem Götz von Berlichingen gemacht; es kömmt nun auf Kochs Schneider an, was daraus<br />
werden wird."<br />
Der Theaterzettel der Premiere am 12. April 1774 enthielt folgende Erläuterung: „Ein<br />
ganz neues Schauspiel von fünf Ackten, Welches nach einer ganz besondern, und jetzo<br />
51 W.Klara: Schauspielkostüm und Schauspieldarstellung. Entwicklungsfragen des deutschen Theaters<br />
im 18. Jahrhundert. Berlin 1931, S. 37.<br />
59
ganz ungewöhnlichen Einrichtung von einen gelehrten und scharfsinnigen Verfasser mit<br />
Fleiß verfertiget worden. Es soll, wie man sagt, nach Schakespearschen Geschmack abgefaßt<br />
sein. Man hätte vielleicht Bedenken getragen, solches auf die Schaubühne zu bringen,<br />
aber man hat dem Verlangen vieler Freunde nachgegeben, und so viel, als Zeit und Platz<br />
erlauben wollen, Anstalt gemacht, es aufzuführen. Auch hat man, sich dem geehrtesten<br />
Publico gefällig zu machen, alle erforderliche Kosten auf die nöthigen Decorationen und<br />
neuen Kleider gewand, die in damaligen Zeiten üblich waren." 52 Der Autor wurde erst<br />
auf dem Zettel vom 28. April genannt: „. .. vom Herrn D.[oktor] Göde in Franckfurth<br />
am Mayn."<br />
Die Aufführung war ein glänzender Erfolg; das Stück wurde sechs Tage en suite gespielt<br />
und erlebte 18 Wiederholungen durch die Kochsdie Truppe. Die Vossische Zeitung, die<br />
zum ersten Mal einen ausführlichen Theaterbericht brachte, vertrat die Ansicht, „daß<br />
ein solches Stück, dessen Aufführung vielen Schwierigkeiten unterworfen, im Ganzen<br />
genommen, nach der Beschaffenheit des deutschen Theaters wohl von keiner Gesellschaft<br />
besser vorgestellt werden kann". Ein anderer Kritiker 53 ärgerte sich zunächst „von<br />
ganzem Herzen darüber, daß man auf solch einem Theater, das nur für Nachspiele<br />
scheint gebaut zu seyn, einen Goez spielen wollte". Dann wurde er günstiger gestimmt:<br />
„Brückner riß mich bisweilen ganz mit sich fort, aber er hatte seine Rolle nicht ganz<br />
studirt. Den guten ehrlichen Goez machte er sehr mittelmäßig. . . . Aber wo er<br />
den ungestümen, hartnäckigen Goez machte, da war er Meister. Ihn vor<br />
dem Gerichte der kaiserlichen Räthe zu sehn, hätt einen allein schon mit der ganzen<br />
Vorstellung wieder aussöhnen können." Er gelangt jedoch zu dem Schluß: „Überhaupt<br />
aber muß ich Ihnen gestehen, daß die kochische Gesellschaft im Ganzen nicht so gut<br />
mehr zu Berlin ist, als ich sie zu Leipzig gesehen habe."<br />
Das Rollenbild Brückners aus dem Jahre 1779 zeigt ihn als einen recht jung wirkenden<br />
Götz, einen schneidigen Edelmann mit Lippenbärtchen, mit geschlitztem Wams, Halskrause<br />
und Federbarett. Ob hier noch Meils Kostüm dargestellt ist, wissen wir nicht 54 .<br />
Trotz dramaturgischer Striche hatte Kochs Personal übrigens nicht ausgereicht, so daß<br />
von den 21 auf dem Zettel genannten Darstellern 6 eine Doppelrolle übernehmen<br />
mußten. Insgesamt war jedoch die Wirkung sehr positiv; die Aufführbarkeit des Werkes<br />
war erwiesen, und bald folgten andere Bühnen.<br />
Noch einmal sorgte Koch in diesem letzten Jahr seines Lebens für ein literarisches<br />
Ereignis: Am 3. November wurde Goethes „Clavigo" aufgeführt. Zwei Monate später,<br />
am 3. Januar 1775 starb mit Heinrich Gottfried Koch der letzte aktive Prinzipal aus<br />
der Kampfzeit der Gottsched-'Ara. Bis zum 15. April führte seine Frau noch die<br />
Geschäfte seiner Bühne, dann nahm Carl Theophil Döbbelin den langersehnten Direktionsplatz<br />
ein.<br />
Plümicke schildert die Tränen des Publikums, als Madame Koch sich in tiefer Trauer<br />
mit einem Epilog Ramlers verabschiedete, in dem es hieß:<br />
52 Der oft ungenau zitierte Zettel ist originalgetreu wiedergegeben bei C. L. Barth: Zur hundertjährigen<br />
Jubel-Feier des Schauspiels Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand von<br />
J. W. von Goethe. Berlin 1874.<br />
53 In der „Gelehrten Zeitung für das Frauenzimmer". Vgl. R.M.Werner: Die erste Aufführung<br />
des Götz von Berlichingen, in: Goethe-Jahrbuch, Bd. 2, S. 87-100.<br />
54 Vgl. Klara (s. Anm. 51), S. 43.<br />
60
„Laßt seinen Namen nicht ersterben! zählet ihr<br />
Die Roscier der Neuern, rühmet ihr die Kunst<br />
der Gallier und Britten: o! so schämet euch<br />
Des deutschen Künstlers nicht! Nennt noch den guten Greis,<br />
Der mit dem wachsenden Geschmack der Deutschen wuchs. . . .<br />
Der, ohne Lust, sich zu bereichern, ohne Hang<br />
Zur weichen Üppigkeit, zur stolzen Modepracht,<br />
Mit Freuden alles seiner Bühne opferte,<br />
Gesundheit, Leben, alles. Nichts bleibt ihm forthin,<br />
Als noch der Name, den ihr selbst ihm gönnen wollt,<br />
Und eine, die um ihn bis an ihr Ende weint -"<br />
Kochs Berliner Spielplan umfaßte 16 Trauerspiele und 15 Schauspiele gegenüber 116<br />
Lustspielen und 34 Singspielen, wobei man noch die wesentlich höheren Aufführungsziffern<br />
der Komödien und Operetten berücksichtigen muß. Im Trauer- wie im Singspiel<br />
dominierte Weiße mit insgesamt 12 Stücken. Im Lustspiel steht Goldoni mit 9 Titeln<br />
(dazu 2 Singspiele) an erster Stelle; eine beachtliche GoWom-Pflege, die von der Kritik<br />
ebenso getadelt wurde wie die Vorliebe für Wiener Autoren, von denen Stephanie der<br />
Jüngere mit 7 Stücken den ersten Platz einnimmt. Unter den Franzosen, die insgesamt<br />
den größten Anteil aller Aufführungen bestritten, ist Destouches 7mal vertreten.<br />
Berücksichtigt man das gesamte Bühnenrepertoire des deutschen Theaters, die spezifische<br />
Struktur der Kochsdien Truppe und den von Friedrich II. ausgehenden starken<br />
französischen Einfluß in Berlin, so muß man Kochs Spielplan als vielseitig und vollkommen<br />
angemessen bezeichnen. Daß in dem kurzen Zeitraum 3 Trauer- und 2 Lustspiele<br />
von Lessing, sowie ein Trauer- und ein Schauspiel von Goethe aufgeführt wurden,<br />
daß beim Lustspiel neben Goldoni auch Moliere und Voltaire gut vertreten waren, ist<br />
nicht selbstverständlich und zeugt von Kochs Bestreben, innerhalb seiner Möglichkeiten<br />
das Neueste und Beste an dramatischer „Weltliteratur" vorzuführen.<br />
Zieht man das Fazit seiner Bemühungen als Bühnenleiter, so läßt sich wohl mit Bestimmtheit<br />
sagen, daß Koch in fünffacher Hinsicht verdienstvoll gewirkt hat: Mit sicherem<br />
Instinkt für den Theaterwert neuer Entwicklungen hat er die Rezeption von drei<br />
epochalen Gattungen des deutschen Dramas eingeleitet. Das bürgerliche Trauerspiel<br />
wurde durch die Leipziger Aufführung der „Miß Sara Sampson" zu einem Begriff für<br />
das breite Publikum. Im Singspiel schuf er in Zusammenarbeit mit Weiße, Standfuß und<br />
Hiller die erste künstlerische Form volkstümlichen Musiktheaters in deutscher Sprache.<br />
Mit der ersten und sorgfältigen Aufführung eines Dramas von Goethe leitete er auf<br />
der Bühne die Periode der „Geniezeit" und des „Ritterdramas" ein und machte Goethe<br />
als gleichsam revolutionären Dramatiker schlagartig bekannt.<br />
Der vierte wichtige Aspekt der Theaterleitung Kochs ist die Konsolidierung des Theaters<br />
von innen durch untadelige Lebensführung und geregelte Verhältnisse in der Organisation<br />
der Truppe. Die Einführung des Spielhonorars neben der festen Gage, die von den<br />
Zeitgenossen getadelt und für eine einseitige Spielplan- und ungerechtfertigte Gagenentwicklung<br />
verantwortlich gemacht wurde, entsprang Kochs sozialem Prinzip, den Gewinn<br />
in Form von Leistungsprämien gerecht wieder auszuschütten.<br />
Im Zusammenhang mit der inneren Stabilisierung steht der fünfte Ertrag seines Lebenswerks:<br />
die Emanzipation des Theaters nach außen. Durch Gewinnung hervorragender,<br />
61
angesehener Künstler und Autoren zur Mitarbeit, durch Verzicht auf unseriöse Effekte,<br />
durch Zuverlässigkeit und Kontinuität seines Theaterbetriebs war es ihm gelungen, aus<br />
einer Kunstform, der dreißig Jahre früher noch weithin mit Mißtrauen und Verachtung<br />
begegnet worden war, eine Institution bürgerlichen Geistes- und Kulturlebens zu schaffen,<br />
die man nicht nur in den Städten zu halten, sondern bald auch mit öffentlichen<br />
Mitteln zu unterhalten suchte. Zu dieser Entwicklung leisteten auch andere Truppen<br />
ihren Beitrag; doch hatte Berlin das Glück, daß ihm mit Kochs Theater gleichsam<br />
die Summe all jener Bemühungen auf einmal zugute kam. Vergleicht man die vielen<br />
Stimmen, die Kochs Wirken in Berlin beurteilt haben, so scheint aus dem Nachruf<br />
Gottlob Wilhelm Burmanns in der Haude- und Spenerschen Zeitung ehrliche Überzeugung<br />
zu klingen, wenn er sagt:<br />
„Koch's Bühne war aus mehr als einem Betracht eine der schönsten und auserlesensten<br />
in Deutschland. Nie hat sich wol ein Theater den Beifall Berlins allgemeiner erworben<br />
als dieses. Verschiedene Jahre hindurch hat er mit ununterbrochenem Beifall eine Stadt<br />
lehrreich und angenehm unterhalten, welche den guten Geschmack erblich zu haben<br />
scheint."<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 28, Oppenheimer Weg 6 a<br />
Für die sehr wünschenswerte nähere Beschäftigung der Theaterforschung mit Koch gebe ich<br />
hier eine Zusammenstellung aller mir bekannt gewordenen Broschüren, die sich zu Kochs<br />
Lebzeiten speziell mit seiner Truppe beschäftigt haben:<br />
1. »Schildereyen der Kochischen Schaubühne in Leipzig", Leipzig 1755. - 2. „Fernere Ausarbeitung<br />
derer Schildereyen der Kochischen Schaubühne in Leipzig", o. O. 1755. - 3. „Gegenschilderungen<br />
der Kochischen Schaubühne in einem Schreiben an den Parterre-König", o. O.<br />
1755. - 4. „Vernünftige Gedanken über den Zustand der Kochischen Bühne", Leipzig 1755.<br />
- 5. „Einige Briefe, die Kochische Schaubühne betreffend", Leipzig 1755. - 6. „Unvorgreifliche<br />
Gedancken zu einem dauerhaften Frieden, zwischen dem Parterrekönig und dem Theatercommandanten<br />
der Kochischen Schaubühne zu Leipzig", Halle 1755. - 7. (Mauvillon, Jakob:)<br />
„Freundschaftliche Erinnerungen an die Kochsche Schauspieler-Gesellschaft, bey Gelegenheit<br />
des Hausvaters des Herrn Diderots", Frankfurt und Leipzig 1766. - 8. „Vergleidiung der<br />
Ackermann- und Kochischen Schauspielergesellschaften, nebst einigen Zusätzen", Hamburg und<br />
Leipzig 1769. - 9. „Ueber die Leipziger Bühne an Herrn Johann Friedrich Löwen zu<br />
Rostodi", „Erstes" und „Zweetes Schreiben", Dresden 1770. (Der Pseudonyme Verfasser „von<br />
Schweigerhausen" ist Chr. H. Schmid.) - 10. (Bertram, CA.:) „Ueber die Kochische Schauspielergesellschaft.<br />
Aus Berlin an einen Freund", Berlin und Leipzig 1771 und 1772. - 11.<br />
„Beantwortung des Schreibens über die Kochsche Schauspieler-Gesellschaft, von einem Freund<br />
aus Halle an der Saale", o. O. 1771. - 12. „Nachricht von der Kochschen Gesellschaft deutscher<br />
Schauspieler seit ihrer Ankunft von Leipzig in Berlin im Jahre 1771".<br />
Zusammenstellung von Prologen und Repertorien s. bei Legband (s. Anm. 23), S. 269-272.<br />
Zu den Abbildungen:<br />
Das seltene Porträt Kochs, das hier wohl zum ersten Mal reproduziert wird, befindet sich im<br />
18. Band (1775) der von C. F. Weiße herausgegebenen „Neuen Bibliothek der schönen Wissensdiaften<br />
und der freyen Künste".<br />
Die Porträts Witthoefts und Brückners, gestochen von bzw. nach Rosenberg, entstammen Reidiards<br />
Gothaer Theaterkalender.<br />
Meils Kostümzeichnung zum „Götz v. Berlichingen", anscheinend die einzige, die sich erhalten<br />
hatte, befand sich bis 1945 unter den Schätzen der nach Kriegsende in Ost-Berlin verschollenen<br />
riesenhaften „Theatersammlung Louis Schneider" im Museum der Preußischen Staatstheater. Unsere<br />
Abbildung nach W. Klara (s. Anm. 51).<br />
Berichtigung: Heft 2, S. 22, Z. 11 muß es richtig heißen: „Der Krieg" (17. 8. 1772).<br />
S2
Gottlieb Fritz und die städtischen Bibliotheken Berlins<br />
Von Hans-Dieter Holzhausen<br />
Die Berliner Stadtbüchereien, bis in die zwanziger Jahre auch Volksbibliotheken, Bücheroder<br />
Lesehallen genannt, können in diesem Jahr auf eine 125jährige Geschichte zurückblicken.<br />
Am 1. August 1850 gelang es dem Historiker Friedrich von Raumer mit Hilfe<br />
des von ihm gegründeten Vereins für wissenschaftliche Vorträge nach mehrjährigen mühsamen<br />
Verhandlungen mit den städtischen und staatlichen Behörden die ersten vier<br />
Volksbibliotheken in dem damaligen Stadtgebiet von Berlin zu eröffnen. Entscheidend<br />
war dabei, daß erstmalig eine der größten deutschen Städte als Gründerin und Trägerin<br />
dieser für die Volksbildung so wichtigen Einrichtung auftrat.<br />
Nun ist über die Anfänge und über Teilaspekte der Entwicklung an anderer Stelle und<br />
auch in dieser Zeitschrift einiges geschrieben und veröffentlicht worden 1 , aber viele Ereignisse,<br />
ganze Phasen der Entwicklung und vor allem eine Gesamtdarstellung warten noch<br />
auf eine Bearbeitung. Hierzu gehören nicht zuletzt Darstellung und Würdigung der<br />
Verdienste von Gottlieb Fritz, dem Leiter der Städtischen Volksbibliothek in Charlottenburg<br />
von 1900-1923 und Direktor der Berliner Stadtbibliothek von 1924-1934, den<br />
Fachleuten als einer der Pioniere der Bücherhallenbewegung weit über die Grenzen<br />
Berlins hinaus bekannt. Eine Skizze seines Berliner Wirkens soll im folgenden versucht<br />
werden.<br />
Herkunft und Bildungsweg<br />
Gottlieb Fritz wurde am 16. November 1873 in Harlingerode am Harz im damaligen<br />
Herzogtum Braunschweig geboren. Sein Vater, Arnold Fritz, war in dem 1300 Einwohner<br />
zählenden Dorf als ev.-luth. Pfarrer tätig. Seine Mutter, Charlotte F., entstammte<br />
einer deutschen Adelsfamilie aus Livland und war eine geborene von Wolff zu Lysohn.<br />
Lutherisches Pfarramt und baltischer Adel prägten also Kindheit und Jugend. Dazu<br />
kam die klassische humanistische Ausbildung an der Großen Schule zu Wolfenbüttel,<br />
die er als Primus omnium 1893 mit dem Zeugnis der Reife verließ 2 .<br />
Bald nach Beendigung der Schulzeit begann er deutsche und klassische Philologie,<br />
Geschichte und Philosophie zu studieren. Zürich, Leipzig und Berlin waren von 1893-96<br />
seine Studienorte. Der Philosoph Richard Avenarius, der Psychologe Wilhelm Wundt,<br />
die Historiker Delbrück, Treitschke, Lenz und schließlich die Germanisten Erich Schmidt<br />
und Karl W'einhold gehörten zu seinen Lehrern. Am 9. 12. 1896 wurde er mit einer<br />
Arbeit über das Thema „Der Spieler im Drama des achtzehnten Jahrhunderts" zum<br />
Dr. phil. promoviert. Sie zeigt bereits den konzentrierten, nüchternen und auf das<br />
Wesentliche gerichteten Stil von Fritz.<br />
1 Buchholtz, Arend: Die Volksbibliotheken und Lesehallen der Stadt Berlin 1850-1900. Festschrift<br />
der Stadt Berlin, Berlin 1900. - Schuster, Wilhelm: Zur Geschidite des Berliner städtischen<br />
Büdiereiwesens. In: Zeitsdir. des Vereins f. d. Geschidite Berlins, Jg. 51 (1934), S. 96-100.<br />
- Festsdirift der Stadt Berlin zum hundertjährigen Bestehen der Volksbüchereien, hrsg. vom<br />
Magistrat von Groß-Berlin. Berlin 1950. (Mit reichen Literaturangaben.)<br />
2 Diese und die folgenden Angaben verdanke ich der Tochter von Gottlieb Fritz, Frau Roswitha<br />
Kohler, die mir großzügigerweise den Nadilaß ihres Vaters zur Verfügung gestellt hat.<br />
63
In Berlin lernte er Rudolf Kassner kennen, mit dem ihn eine lange Freundschaft verbinden<br />
sollte 3 . Was beide zusammengeführt hat, ist heute nur noch schwer festzustellen.<br />
Ein gemeinsam herausgegebener Musenalmanach 4 zeigt eine Sammlung mehr oder weniger<br />
sentimentaler Gedichte: „Sonnengnade" von Kassner, „Heimkehr" und „Am<br />
Feuer" von Fritz. Immerhin ist das Bändchen „Theodor Fontane und Gerhart Hauptmann,<br />
unserm alten und unserm jungen Meister" gewidmet, was beweist, daß man sich<br />
mit zeitgenössischer Dichtung auseinandersetzte. Aufgeschlossenheit für die Probleme<br />
der Zeit, dem ,fin de siecle', wird man dem Kreis um Kassner und Fritz nicht absprechen<br />
können. Kassner war einige Jahre später in Fritz' Elternhaus in Westerlinde zu Gast<br />
' Rudolf Kassner (1873-1959), bedeutender philos. Schriftsteller und Essayist, hat sein Buch „Der<br />
Tod und die Maske", Gleichnisse, 1902, G. Fritz gewidmet.<br />
4 Musenalmanach Berliner Studenten. Hrsg. von Gottlieb Fritz, Rudolf Kassner und Emil Schering.<br />
Berlin 1896.<br />
6-4
(1899), wo er durch einen Vikar auf Sören Kierkegaard hingewiesen wurde, eine für<br />
Kassner und die moderne Philosophie folgenreiche Entdeckung 5 . Die Briefe von Kassner<br />
an Fritz beabsichtigt der Herausgeber der Werke von Kassner, Ernst Zinn, zu veröffentlichen.<br />
Leider sind die Briefe von Fritz an Kassner verloren gegangen*.<br />
Bibliothek und Volksbildung<br />
Kassner ging den Weg der Deutung und Gestaltanalyse unseres Seins, wie er sich in<br />
seinen vielen Aufsätzen und Büchern zeigt, mit Erfolg weiter. Fritz zog es aufgrund<br />
seiner mehr didaktischen und organisatorischen Befähigungen zur aktiven Mitarbeit bei<br />
der Vermittlung der Bildungsgüter. Hier boten sich Schule oder Bibliothek an. Zwar<br />
hat er die entsprechende Prüfung für das höhere Lehramt abgelegt (1S98), aber durch<br />
einen älteren Wolfenbütteler Mitschüler, Ernst Jeep 7 , wurde er auf Reformbestrebungen<br />
im Volksbibliothekswesen aufmerksam gemacht. Schon als Student (1895) hatte er mit<br />
Jeep die erste Lesehalle der deutschen Gesellschaft für ethische Kultur in Berlin in der<br />
Neuen Schönhauser Straße eingerichtet und bald nach seinem Studium die im Sinne der<br />
Bücherhallenbewegung erneuerte Charlottenburger Volksbibliothek ebenfalls gemeinsam<br />
mit Jeep aufgebaut (1897/98).<br />
Die Bücherhallenbewegung wollte nach amerikanischem und englischem Vorbild die<br />
deutschen Volksbibliotheken erneuern, sie für alle Bevölkerungsschichten, nicht nur für<br />
die unteren, attraktiv gestalten und ihnen vor allem Lesehallen mit ausgebauten Informations-<br />
und Zeitschriftenbeständen angliedern. Hier fand Fritz ein seinen Neigungen<br />
entsprechendes Betätigungsfeld. Eines der Schlagwörter der Bücherhallenbewegung, das<br />
Fritz in seinen Schriften immer wieder verwendet und das ihn besonders beeindruckt<br />
haben muß, war das der sozialpädagogischen Aufgabe der Volksbibliothek. Sozialpädagogik<br />
hieß damals, Sozialpolitik durch Anhebung der Bildung zu betreiben. Hierzu<br />
sollten Bibliotheken, die in ihrem Bücherangebot und ihren Organisationsformen den<br />
verschiedenen Bildungsbedürfnissen der Bevölkerung entgegenkamen, entscheidend<br />
helfen.<br />
Eine führende Rolle in der Propagierung dieser neuen Bücher- und Lesehallen, wie ihr<br />
Begründer Constantin Nörrenberg s sie genannt hat, spielte die Comenius-Gesellschaft,<br />
eine typische Bildungsgesellschaft jener Zeit, deren Ziel es war, im Geiste des großen<br />
Pädagogen Comenius (1592-1670) Volkserziehung zu betreiben. Ihr Generalsekretär<br />
war Fritz von 1898-99, sehr bald stand er also mitten in der sozialpädagogischen Arbeit.<br />
Dadurch bekannt geworden, holte den damals gerade 25jährigen der schon genannte Constantin<br />
Nörrenberg 1899 nach Hamburg zur Leitung der dort kurz vorher gegründeten<br />
Bücherhalle. Fritz brach daher ein wenige Monate vorher begonnenes Volontariat an der<br />
Königlichen Bibliothek Berlin ab und hat auch später die Ausbildung zum wissenschaftlichen<br />
Bibliothekar nicht fortgesetzt; die neue Bücher- und Lesehallenbewegung mit ihrer<br />
sozialpädagogischen Komponente zog ihn mehr an.<br />
5 R. Kassner in: Basler Nachriditen. Sonntagsblatt, Nr. 45 vom 13. 11. 1955.<br />
c Vgl. R. Kassner, Sämtliche Werke, hrsg. von Ernst Zinn. Pfullingen 1970 ff. (Bisher 2 Bde.)<br />
7 Ernst Jeep, geb. 1867, Bibliothekar an der Königl. Bibliothek Berlin, hat sich besonders um die<br />
Einriditung von Lesehallen in Berlin und Umgebung verdient gemadit.<br />
8 Constantin Nörrenberg (1862-1937), Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Kiel, Begründer<br />
und Hauptpropagandist der Büdierhallenbewegung.<br />
tö
Stadtbibliothekar in Charlottenburg<br />
Hamburg blieb nur ein Zwischenspiel. Schon im Juli 1900 folgte er einem Ruf nach<br />
Charlottenburg als Leiter der Städtischen Volksbibliothek, die er ja von der Mithilfe<br />
bei den Einrichtungsarbeiten her gut kannte. Charlottenburg war dabei, seine Volksbibliothek<br />
erneut zu erweitern und ihr ein eigenes Gebäude zu errichten, das nach den<br />
neuesten Vorstellungen der Bücherhallenbewegung ausgestattet werden sollte. Dazu war<br />
Fritz der rechte Mann.<br />
Die Geschichte dieser Volksbibliothek ist ein Stück Demokratie-Geschichte von Charlottenburg<br />
9 . Ursprünglich klein und unansehnlich in einer Schule in der Oranienstraße<br />
(heute: Nithackstraße) gegründet, war sie 1898 in die Kirchstraße 4/5 (heute: Gierkezeile)<br />
umgezogen und hatte dort bereits einen größeren Leseraum erhalten. Dies war vor<br />
allem das Verdienst eines Bürger-Comites, das unter der Beratung von Ernst Jeep sich<br />
aktiv für eine Erneuerung der Volksbibliothek eingesetzt hatte. Stimulierend hatte dabei<br />
die Stiftung des Verlagskunsthändlers Emil Werckmeister aus Westend gewirkt, der<br />
23 000 Mark für die Anschaffung von Büchern gespendet hatte. Der Magistrat war nur<br />
halben Herzens an die Sache herangegangen, als er aber sah, wie die Bibliothek Anklang<br />
in der Bevölkerung fand, war auch er bald bereit, ein noch größeres Gebäude zur Verfügung<br />
zu stellen. Dies wurde im Zusammenhang mit einer neuen Fortbildungsschule<br />
in der Wilmersdorfer Straße 166/167 (heute: Eosanderstraße 1) erbaut und konnte im<br />
September 1901 eingeweiht werden. An der Straßenfront, die sich bis zur Brauhofstraße<br />
4 hinzog, befand sich die Fortbildungsschule, im Quergebäude im Erdgeschoß eine<br />
Turnhalle und in den drei Obergeschossen die Volksbibliothek. Mittelpunkt der Bibliothek<br />
war ein repräsentativer Lesesaal, der durch alle drei Stockwerke ging und von zwei<br />
übereinander liegenden Galerien umzogen war. Er umfaßte 284 qm Bodenfläche und<br />
wies zunächst für 90 Leser Sitzplätze auf, die später auf 150 erhöht wurden. Er muß<br />
nach fast einstimmigem Zeugnis der Zeit einen schönen und hellen Eindruck gemacht<br />
haben. Aber lassen wir Gottlieb Fritz selbst berichten: „Die Ausstattung des Lesesaals<br />
wie der übrigen Räume ist vornehm geschmackvoll und in einer dem Auge besonders<br />
wohltuenden Farbabstimmung gehalten. Als Bodenbelag ist rotbraunes Linoleum verwendet<br />
worden, das mit dem in ähnlichem Tone matt schimmernden Holzwerk vortrefflich<br />
harmoniert, während die Tische mit grünem, der Farbe der Eisenkonstruktion<br />
entsprechenden Linoleum überzogen sind." 10 Dazu kamen für damalige Zeiten technische<br />
Neuerungen, wie Zentralheizung und elektrisches Licht.<br />
In dem Lesesaal hatte Fritz eine breit gefächerte Handbibliothek von fast 2700 Bänden<br />
aufgestellt. Hier konnte der Leser die großen Nachschlagewerke von Brockhaus und<br />
Meyer, Speziallexika wie Kürschner, Minerva oder den Hofkalender finden. Dazu kamen<br />
fast 100 verschiedene Zeitschriften; von „Daheim", „Deutscher Rundschau", „Leipziger<br />
Illustrirte" über Fachzeitschriften für Handwerk und Handel, populären naturwissenschaftlichen<br />
Blättern bis hin zu den „Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins"<br />
• Vgl. die gedruduen Beridite der Stadtverwaltung, die Vorlagen für die Stadtverordnetenversammlung<br />
und die Berichte über die Verhandlungen derselben. Leider gibt es bis auf die Bauakten<br />
kaum braudibare Arduvalien über diesen Komplex. Zur Gesdiidwe der Charlottenburger<br />
Volksbibliothek vgl. auch Wilhelm Gundlach, Geschichte der Stadt Charlottenburg. Berlin 1905.<br />
Bd. 2, S. 658-662.<br />
10 Bericht in: Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen, Jg. 2 (1901), S. 181.<br />
66
Lesesaal der städtischen Volksbibliothek in Charlottenburg (1901-1944)<br />
Foto aus: Eduard Reyer, Fortschritte der Volkstümlichen Bibliotheken, Leipzig 1903.<br />
und dem Reichsgesetzblatt war es eine reiche Palette. Nur politische Zeitungen durften<br />
nicht ausgelegt werden. Der Magistrat war der Meinung, daß es grundsätzlich nicht<br />
Sache der Gemeindeverwaltung sei, das parteipolitische Lesebedürfnis der Einwohner der<br />
Stadt zu befriedigen 11 . Hiergegen hat es im Laufe der Zeit manche Eingaben, vor allem<br />
von sozialdemokratischen Stadtverordneten gegeben. Aber jedesmal wies der Magistrat<br />
unter Hinweis auf die Raumsituation oder Finanzlage diese Forderungen ab.<br />
Auf den Galerien befand sich die Ausleihbibliothek mit zunächst 17 000 Bänden,<br />
1914 waren es 55 000. Die Verbindung zum Ausgaberaum stellte ein Fahrstuhl her -<br />
auch das eine technische Neuerung. Das Publikum honorierte die bibliothekarischen und<br />
kommunalen Investitionen auf das Beste. 1902 besuchten 92 000 Personen den Lesesaal,<br />
1914 war die Zahl auf über 200 000 angestiegen. Unter den Lesern befanden sich, wie<br />
heute, überwiegend Schüler und Studenten, gefolgt von Angehörigen der kaufmännischen<br />
Berufe; Handwerker und Arbeiter bildeten etwa 20 °/o der Leserschaft 1 -. In der Ausleihbibliothek<br />
überwog zwar die Nachfrage nach belletristischer Literatur (75 °/o), aber die<br />
Sachliteratur (Ausleihanteil 25 °/o) wurde ständig gefördert, nicht zuletzt durch gedruckte<br />
Kataloge, die man für 30 Pfennige erwerben konnte. Mit Stolz konnte Fritz immer<br />
wieder berichten, daß die Charlottenburger Volksbibliothek unter den deutschen Bildungsbibliotheken<br />
an erster Stelle stünde 13 .<br />
11 Vgl. Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 20. 1. 1897.<br />
12 Das Statistische Büro der Stadt Ch. veröffentlichte für das Jahr 1908 eine umfangreiche Repräsentativstatistik.<br />
13 Z. B. in „Das moderne Volksbildungswesen", Leipzig 1909, 2. Aufl. 1920.<br />
6?
Doch die Entwicklung der Großstadt vor den Toren Berlins ging rasch weiter. Waren<br />
es 1895 noch 100 000 Einwohner, so 1902 schon 200 000 und 1910 bereits 300 000.<br />
Eduard Spranger hat in seinem Aufsatzband „Berliner Geist" (1966) die Dynamik und<br />
die kulturelle Atmosphäre jener Jahre fast unüberbietbar geschildert. Alles drängte<br />
nach Erweiterung. Auch die so großzügig angelegte Volksbibliothek war nach wenigen<br />
Jahren räumlich den ständig steigenden Anforderungen nicht mehr gewachsen.<br />
Durch Besuche in England und Dänemark angeregt, hatte Fritz einen Plan für ein großstädtisches<br />
Büchereisystem entworfen. Die Bibliothek in der Wilmersdorfer Straße sollte<br />
zu einer Hauptbibliothek mit vorwiegend universalem und wissenschaftlichem Schrifttum<br />
ausgebaut werden, daneben sollte es Zweigbibliotheken geben, die mehr die sozialpädagogische<br />
Funktion der Volksbibliothek zu erfüllen hatten. So wurden in den einzelnen<br />
Stadtteilen Filialbibliotheken eingerichtet: 1904 in der Wormser Straße 6 a (Nähe<br />
des Wittenbergplatzes) für den Ostteil der Stadt, 1908 in der Danckelmannstraße 47<br />
für den Westteil, 1912 am Savignyplatz 1 für den Südteil, verbunden mit einer Musikalienbibliothek,<br />
und im selben Jahr in der Kaiserin-Augusta-Allee 80 für den Nordteil.<br />
Außerdem plante man einen Neubau für die Hauptblibliothek am Spreebord, ein 2,5-<br />
Millionen-Projekt, das aber der erste Weltkrieg zunichte machte.<br />
Die Bibliothek in der Wilmersdorfer Straße hat noch bis in den zweiten Weltkrieg der<br />
Charlottenburger Bevölkerung gedient. 1943 wurde sie zerstört. Die heutige Hauptstelle<br />
wurde im April 1949 im Rathaus eröffnet und hat bis heute noch kein eigenes<br />
Gebäude erhalten.<br />
Gottlieb Fritz als Volksbüchereidirektor von Berlin und<br />
Direktor der Stadtbibliothek<br />
1914 würdigte die preußische Regierung die Verdienste von Gottlieb Fritz öffentlich<br />
durch die Verleihung des Professorentitels - eine bis dahin keinem Volksbibliothekar<br />
widerfahrene Ehre. Sie galt einem Mann, der inzwischen weit über die Grenzen Charlottenburgs<br />
nicht nur in Fachkreisen bekannt geworden war. Eine reiche Korrespondenz<br />
in seinem Nachlaß beweist Freundschaften und Kontakte zu Dichtern, Wissenschaftlern,<br />
Pädagogen, Künstlern und Politikern. So war es nicht weiter befremdlich, daß die 1920<br />
gegründete neue Stadtgemeinde Berlin zur Neuordnung ihres großen, aber qualitativ<br />
recht ungleichen Büchereiwesens ihn zum Leiter aller Volksbibliotheken Berlins berief,<br />
indem sie ihn 1922 zum Volksbüchereidirektor wählte. 1924 übernahm er auch das<br />
Direktorat der Stadtbibliothek.<br />
Was er vorfand, waren neben der 1907 eröffneten Stadtbibliothek 31 Volksbibliotheken,<br />
12 Lesehallen, 6 Kinder-Lesehallen in Alt-Berlin, 5 Büchereien unter wissenschaftlichbibliothekarischer<br />
Leitung in den hinzugekommenen Gemeinden Neukölln, Schöneberg,<br />
Wilmersdorf, Steglitz und Charlottenburg sowie 50 Volksbibliotheken in den übrigen<br />
Vororten. Auch hier versuchte Fritz seine Grundidee eines großstädtischen Systems mit<br />
einer wissenschaftlichen Zentralbibliothek als Oberbau und Volksbibliotheken als<br />
Zweigstellen zu verwirklichen. Nicht mehr leistungsfähige Bibliotheken wurden geschlossen<br />
oder mit anderen zusammengelegt. Eine Büchersammlung von einigen hundert<br />
zerlesenen Büchern, aufbewahrt im Spind einer Gemeindeschule, konnte nicht mehr<br />
gut als kommunale Bibliothek einer Weltstadt anerkannt werden. Hier mußten eine<br />
einheitliche Verwaltung und ein einheitlicher Standard hergestellt werden. Doch der<br />
68
Wunsch der Bezirke, wenigstens auf einigen Gebieten ihre bisherige Autonomie zu wahren,<br />
erschwerte eine einheitliche Gestaltung und machte sie so, wie Fritz sie sich vorgestellt<br />
hatte, schließlich unmöglich. Die Bezirke, zuletzt die sechs Innenstadtbezirke<br />
(1926), gingen dazu über, eigene Stadtbüchereien als Zentralen eines eigenen bezirklichen<br />
Büchereisystems aufzubauen 14 .<br />
So konzentrierte sich Fritz schließlich ganz auf den Ausbau der Stadtbibliothek,<br />
die er zu einer angesehenen, wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek umschuf. Zwar<br />
blieben der Stadtbibliothek noch einige Aufgaben der Koordination, wie Beratung bei<br />
Neugründung und Aufbau von Büchereien, Aufstellung von empfehlenden Literaturlisten,<br />
Regelung des innerstädtischen Leihverkehrs mit wissenschaftlichen Werken, Fortbildung<br />
der Bibliothekare und seit 1925 die Abhaltung von Kursen für werdende Bibliothekare,<br />
die 1930 zur Berliner Bibliotheksschule ausgebaut wurden. Grundsätzlich gingen<br />
aber Stadtbibliothek und Bezirksbüchereien getrennte Wege.<br />
Besondere Schwierigkeiten bereitete Fritz die Raumfrage der Stadtbibliothek. Diese war<br />
zwar 1921 in den ehemaligen Marstall am Schloß gekommen und damit großzügiger<br />
untergebracht als vorher in der Zimmerstraße 90/91, einem ehemaligen Markthallengebäude;<br />
doch auch der Marstall konnte nur ein Provisorium sein. Über Pläne und<br />
Projekte ist man jedoch nicht hinausgekommen, die Zeitereignisse zerschlugen jeweils<br />
alle verheißungsvollen Vorhaben. Erst heute scheint diese Frage durch den Neubau<br />
in der Breiten Straße gelöst zu sein (1966).<br />
Über seine Berliner Verpflichtungen hinaus widmete sich Fritz weiterhin überregionalen<br />
Aufgaben. Diese erstreckten sich vornehmlich auf das Ausbildungswesen, den Zusammenschluß<br />
der Volksbibliothekare zu einer eigenen berufsständischen Organisation, dem<br />
Verband Deutscher Volksbibliothekare, deren erster Vorsitzender er wurde, und der<br />
Herausgabe und Mitarbeit an der Fachzeitschrift „Bücherei und Bildungspflege".<br />
Seine vermittelnde und anregende und auf das Wesentliche von Theorie und Praxis<br />
gerichtete Art machten ihn zum gesuchten, wenn auch selbst nicht gewollten Mittelpunkt<br />
des Büchereiwesens für viele. Wirtschaftskrise und der politische Umbruch 1933 legten<br />
auch einem aktiven und ständig um die Volksbildung bemühten Manne, wie Gottlieb<br />
Fritz, Fesseln an.<br />
Im Januar 1934 mußte er aus dem Dienst scheiden und starb am 22. 7. 1934 an den<br />
Folgen einer schweren Krankheit.<br />
Die Stadt Berlin hatte in ihm viel zu früh einen ihrer bedeutendsten Bibliothekare<br />
verloren.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 33, Breitenbachplatz 12<br />
14 G.Fritz: Der Berliner und sein Buch. In: Probleme der neuen Stadt Berlin. Berlin 1926, S. 183<br />
bis 189.<br />
69
Louis Schwartzkopff zum 150. Geburtstag<br />
Von Kurt Pierson<br />
Schon zu Beginn des Eisenbahnzeitalters in Preußen bestand die Möglichkeit, von<br />
Berlin aus auf der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn über Frankfurt-Sommerfeld-<br />
Kohlfurt-Görlitz und von dort über die Sächsisch-Schlesische Eisenbahn nach Dresden<br />
zu gelangen - ein umständlicher Weg von 354 Kilometern. Etwas später bot die Berlin-<br />
Anhaltische Eisenbahn nach Fertigstellung ihres Streckenabschnitts Herzberg-Riesa einen<br />
wesentlich kürzeren Schienenweg über Jüterbog von nur 191 km an, der fünfundzwanzig<br />
Jahre hindurch den Verkehr zwischen der preußischen und der sächsischen Hauptstadt<br />
bewältigte.<br />
Nach dem Kriege 1870/71 wurde die Forderung in der Öffentlichkeit immer dringender,<br />
die junge Reichshauptstadt auf direktem Wege mit der sächsischen Metropole zu verbinden.<br />
Es kam zur Gründung der Berlin-Dresdener Eisenbahngesellschaft, die sich bei<br />
Konzessionsverhandlungen verpflichten mußte, den Bahnkörper zwischen Berlin und<br />
Zossen von vornherein so breit auszubauen, daß auf ihm ein drittes Gleis für die vom<br />
Chef des preußischen Generalstabes, Graf v, Moltke, geplante Militäreisenbahn verlegt<br />
werden konnte, die von Schöneberg über Zossen und dem Schießplatz Kummersdorf<br />
zum Truppenübungsplatz Jüterbog führen sollte.<br />
Vor genau hundert Jahren, am 17. Juli 1875, konnte der Betrieb auf der 180 km langen<br />
Strecke Berlin-Elsterwerda-Dresden aufgenommen werden. Hierfür hatte der Fabrikbesitzer<br />
und Kommerzienrat Louis Schwartzkopff in Berlin vierzehn dreiachsige Personenzuglokomotiven<br />
geliefert und weitere zwei gleichartige an die im selben Jahr<br />
eröffnete Militäreisenbahn, die den Namen „Moltke" bzw. den des damaligen Kriegsministers<br />
„Kameke" trugen und von denen die letztere im Bilde dargestellt ist.<br />
Dieser Louis Schwartzkopff war einer der „drei Großen" vor dem Oranienburger Tor,<br />
die in der Chausseestraße Lokomotiven bauten und er war, wie August Borsig und<br />
Friedrich Wöhlert, ebenfalls kein Berliner. Er wurde vielmehr vor nunmehr 150 Jahren<br />
in Magdeburg im väterlichen Gasthof „Zum Goldenen Schiff" geboren und hatte dort<br />
das Gymnasium sowie die Gewerbeschule besucht. Gemeinsam mit seinem Freund Wilhelm<br />
Siemens nahm er bei dessen Bruder, dem Artillerieoffizier Werner Siemens,<br />
morgens von fünf bis sieben Uhr Mathematikunterricht. Mit siebzehn Jahren ging<br />
Louis Schwartzkopff nach Berlin, um an dem von Beutb ins Leben gerufenen Gewerbeinstitut<br />
sein Studium aufzunehmen. Im Anschluß daran erfolgte seine praktische Ausbildung<br />
bei Borsig, die mit einer sechsmonatigen Tätigkeit als Lokomotivführer bei der<br />
Berlin-Hamburger Eisenbahn endete.<br />
Inzwischen war seine Heimatstadt Magdeburg zu einem Eisenbahnknotenpunkt geworden.<br />
Eine der von dort ausgehenden Bahnlinien war die Magdeburg-Wittenbergische<br />
Eisenbahn, die dem aus der Geschichte bekannten freisinnigen Regierungsrat Victor<br />
v. Unruh unterstand. Dieser suchte einen tüchtigen Maschinenmeister und fand ihn in<br />
Schwartzkopff, den er durch Borsig kennengelernt hatte. Der Bau einer Eisenbahnbrücke<br />
großer Spannweite bei Wittenberge über die Elbe machte im Jahre 1848 eine<br />
Studienreise nach England erforderlich, zu der v. Unruh seinen neuen Maschinenmeister,<br />
den Brückenbauspezialisten Benda und den Hersteller der Brückenbauteile, August Borsig,<br />
mitnahm. Drei Jahre später trat Schwartzkopff allein eine zweite Englandreise zur<br />
70
Geh. Kommerzienrat Louis Schwartzkopff<br />
(1825-1892)<br />
Foto: Archiv Pierson<br />
Londoner Weltausstellung an. Nach seiner Rückkehr verließ er den Eisenbahndienst und<br />
kaufte 1851 mit Unterstützung durch seine Familie in der Chausseestraße zu Berlin<br />
das Grundstück Nr. 20, das nach Süden zu an die Invalidenstraße und nach Osten an<br />
die Berlin-Stettiner Eisenbahn grenzte.<br />
Schwartzkopff hatte sich einen der damals tüchtigsten Berliner Gießereimeister, Nitsche,<br />
als Teilhaber genommen, mit dem zusammen er am 3. Oktober 1852 die „Eisengießerei<br />
und Maschinenfabrik Schwartzkopff und Nitsche" gründete, den Firmennamen jedoch<br />
bald auf seinen Namen allein ändern ließ. Um die Jahreswende 1852/53 floß zum ersten<br />
Mal das glühende Eisen in die Pfannen. Aufträge lagen zur Genüge vor: Siemens<br />
& Halske überzogen gerade Rußland mit einem Netz von Telegraphenlinien und<br />
ließen die eisernen Isolatorenstützen bei Schwartzkopff gießen; die damals größte<br />
Eisenbahnwaggonfabrik in Deutschland, F. A. Pflug in der Chausseestraße 8, benötigte<br />
ständig Achslager und Puffer. Der Kunstguß, von dem Nitsche hergekommen war,<br />
bedeutete zu jener Zeit einen Schwerpunkt für jede Gießerei.<br />
Doch gerade hier schieden sich die Geister. Schwartzkopff zahlte seinen Teilhaber aus<br />
und wandte sich vor allem dem Maschinenbau zu. Neben Dampfsägen, Holzbearbeitungsmaschinen<br />
und Kreiselpumpen wurde der Bau von Dampfhämmern, Bergwerksund<br />
Walzmaschinen aufgenommen. Als der Absatz in diesen Bereichen nachließ, begann<br />
die Fabrik um 1860 mit der Fertigung spezieller Werkzeugmaschinen für den Heeresbedarf<br />
sowie aller Art von Eisenbahnmaterial für den Strecken- und Bahnhofsbau.<br />
In diesem Zusammenhang half Louis Schwartzkopff der Berlin-Stettiner Eisenbahn in<br />
besonders schwierigen Fällen beim Brückenbau über die Oder. Der Dank hierfür wurde<br />
ihm von der Bahnverwaltung in großherziger Weise abgestattet, als die Schwartz-<br />
71
Schwartzkopff-Lokomotive der Kgl. Militäreisenbahn bei einer Brückenbauübung<br />
Foto: Archiv Pierson<br />
kopffsche Fabrik 1860 durch einen Großbrand auf dem entlang dem Bahngelände<br />
gelegenen Teil zerstört wurde. Durch einen umfangreichen Auftrag für den Bau der<br />
Vorpommerschen Eisenbahn gelang es, über die ersten Schwierigkeiten hinwegzukommen.<br />
Die Leistungen des Unternehmens waren höheren Orts nicht unbemerkt geblieben.<br />
Der preußische König Wilhelm I. verlieh dem Fabrikherrn persönlich den Titel „Kommerzienrat";<br />
der preußische Handelsminister, Graf v. Itzenplitz, ermunterte ihn zum<br />
Bau von Lokomotiven. Im Jahre 1867 verließen die ersten zwölf Güterzuglokomotiven<br />
das Werk, die für die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn bestimmt waren.<br />
Es lag auf der Hand, daß ein sich von nun an immer mehr ausweitender Fabrikationszweig<br />
die engen Räumlichkeiten zu sprengen drohte. Louis Schwartzkopff hatte rechtzeitig<br />
ein genügend großes Gelände in der Ackerstraße erworben und auf ihm ein neues,<br />
modernes Werk errichtet, das vornehmlich dem allgemeinen Maschinenbau dienen sollte.<br />
Dieses Werk, im letzten Krieg zerstört, wurde 1952 erneuert und birgt in seinem<br />
Grundstein die Gründungsurkunde sowie Lokomotivzeichnungen und -Lieferlisten aus<br />
der alten und Dokumente aus neuerer Zeit.<br />
Die inzwischen in „Berliner Maschinenbau AG vorm. L. Schwartzkopff" umgewandelte<br />
Firma hatte das Stammwerk in der Chausseestraße durch schrittweisen Zukauf der<br />
Grundstücke 19 und 23 zu einer allen Ansprüchen genügenden Lokomotivfabrik erweitert.<br />
Louis Schwartzkopff war es vergönnt, noch zwei Jahrzehnte lang Generaldirektor des<br />
von ihm geschaffenen Werkes zu sein. Die preußische Regierung berief ihn in den Staatsrat<br />
und würdigte damit das vielseitige Wirken dieses Mannes, der bis zu seinem Tode<br />
am 7. März 1892 seinem einstigen Lehrherrn August Borsig ein dankbares Andenken<br />
72
ewahrt und ihm zu Ehren unter dem Fenster seines Arbeitszimmers ein Relief mit dem<br />
Porträt des „Lokomotivkönigs" hatte anbringen lassen.<br />
Als das Stammwerk im Jahre 1900 seine Pforten schloß und fünf Jahre später der Abbruch<br />
dieser historischen Fabrik erfolgte, fiel auch das alte, abseits der Straße gelegene<br />
Verwaltungsgebäude, in dem Louis Schwartzkopff vierzig Jahre seines Lebens verbracht<br />
hatte, der Spitzhacke zum Opfer. Nur eine kleine Seitenstraße der nördlichen Berliner<br />
Industriemagistrale erinnerte noch an den letzten Lokomotivbauer vor dem Oranienburger<br />
Tor.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 15, Meierottostraße 4<br />
Nachrichten<br />
Mitgliederversammlung 1975<br />
Der Bürgersaal im Rathaus Charlottenburg sah am 22. April 1975 die ordentliche Mitgliederversammlung<br />
des Vereins, die vom Vorsitzenden Professor Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm mit<br />
der Totenehrung eingeleitet wurde. Mit schweigendem Gedenken würdigte die Versammlung die<br />
seit der letzten Hauptversammlung verstorbenen Mitglieder: Erich Tauer, Charlotte Hering,<br />
Arthur Lessing (Ehrenmitglied), Hanna Reuter, Ida Bohnert, Edzard Hohbing, Lothar Loeff,<br />
Hans-Georg Scharsich, Walter Seifert, Otto Gutz, Walter Rieck, Max Backe, Ernst Köhler,<br />
Ewald Heinze, Lucia Winter, Oskar Matthes, Ella Frank, Elisabeth Donath, Walter Marzillier,<br />
Dr. Paul Friedrich Carl Wille, Wilhelm Biermann, Siegfried Winke, Herbert Bantelmann, Ernst<br />
Hartmann, Ursula Brunsing, Werner Pasewaldt, Hellmuth-Charles Mathieu und Rhoda Kraus.<br />
Der Versammlung lagen der zum Abdruck im Jahrbuch 1975 „Der Bär von Berlin" bestimmte<br />
Tätigkeitsbericht und der vom kommissarischen Schatzmeister Frau L. Franz ausgearbeitete<br />
Kassenbericht vor. Dem vom Betreuer der Bibliothek K. Grave erstatteten Bibliotheksbericht<br />
schlössen sich der Bericht der Kassenprüfer Alulack und Kretschmer (vom Vorstand anstelle des<br />
kommissarisch tätigen stellvertretenden Schatzmeisters Brauer in dieses Amt berufen) und der<br />
Bericht der Bibliotheksprüfer Schlenk und Kemnitz an. In der Aussprache wurden Fragen der<br />
Ausstattung des Jahrbuchs, einer Bürgerinitiative zur Erhaltung von Denkmälern und der<br />
Aktivierung der Bibliotheksabende vorgetragen. Ehrenmitglied Mügel beantragt die Entlastung,<br />
die einmütig ausgesprochen wurde. Mit Worten des Dankes verabschiedete der Vorsitzende die<br />
aus dem Vorstand scheidenden bewährten älteren Kollegen Kurt Pomplun und Dr. Hans Leichter.<br />
Ehrenmitglied Mügel wirkte auch als Wahlvorstand. Die Mitglieder des geschäftsführenden<br />
Vorstandes wurden jeweils einstimmig gewählt, die Beisitzer en bloc bei vier Stimmenthaltungen.<br />
Der neue Vorstand wird in den kommenden zwei Jahren in der folgenden Zusammensetzung<br />
wirken: Vorsitzender: Professor Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm, 1. stellv. Vorsitzender:<br />
Dr. Gerhard Kutzsch, 2. stellv. Vorsitzender: Jürgen Grothe, Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-<br />
Berndt, stellv. Schriftführer: Albert Brauer, Schatzmeister: Frau Ruth Koepke, stellv. Schatzmeister:<br />
Frau Leonore Franz, Beisitzer: Dr. H. Engel, Professor Dr. K. Kettig, Dr. P. Letkemann,<br />
K. P. Mader, W. G. Oscbilewski, ]. Schlenk, Professor Dr. M. Sperlich, G. Wollschlaeger.<br />
Die Wiederwahl der Kassenprüfer Kretschmer und Mulack wie auch der Bibliotheksprüfer<br />
Kemnitz und Schlenk erfolgte einmütig. Als Bildarchivar wird künftig das Mitglied Mücke<br />
tätig sein.<br />
Hinsichtlich des Mitgliedsbeitrages (36 DM jährlich) ergeben sich keine Änderungen. Zum Zeitpunkt<br />
der Jahreshauptversammlung hat der Verein 823 Mitglieder. Der Vorsitzende verlas eine<br />
statistische Ausarbeitung von Frau Koepke über die Zusammensetzung nach Einzelmitgliedern<br />
und Institutionen bzw. nach Geschlecht und Altersgruppen. Eine Reihe von Problemen kam<br />
unter Punkt „Verschiedenes" zur Diskussion, in deren Verlauf der Schriftführer die Grüße des<br />
nunmehrigen Alterspräsidenten und Ehrenmitglieds Bullemer ausrichtete.<br />
H. G. Schultze-Berndt<br />
Zehn Jahre „Mitteilungen" - Neue Folge<br />
Nach der kriegs- und nachkriegsbedingten Unterbrechung von 22 Jahren erschienen im Juli 1965<br />
die „Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins" in neuer Folge. Nach den Einführungsworten<br />
des damaligen Vorstandes sollten sie sowohl die wissenschaftlichen Leistungen<br />
73
wie auch die praktische Arbeit des Berliner Geschichtsvereins widerspiegeln, das Band zwischen<br />
Verein, Mitgliedern und Interessenten fester knüpfen und somit nahtlos die Tradition der<br />
alten „Mitteilungen" von 1884 bis 1943 fortsetzen.<br />
Dieses Programm gilt auch nach zehn Jahren unverändert. Im Rückblick auf diese Dekade<br />
läßt sich ohne Mühe eine „Planerfüllung" feststellen, die neben dem berechtigten Stolz auf<br />
das bisher Geleistete auch für die Zukunft Maßstäbe setzen kann und soll. Dabei hat für den<br />
verantwortlichen Schriftleiter das Letztere verständlicherweise mehr Gewicht als jegliches Ausruhen<br />
auf verwelkendem Lorbeer. Da Lob oder Kritik immer erst auftreten, wenn die ausgedruckten<br />
Hefte auf dem Tisch liegen, ist die Planung immer ein Schritt ins Ungewisse, die<br />
Gestaltung mit Risiken verbunden, vor allem dann, wenn das eingefahrene Gleis einmal<br />
verlassen werden soll. Dabei treten die Schwierigkeiten z. Z. weniger im organisatorischen<br />
als vielmehr im fachlichen Bereich auf: Die Zahl der qualifizierten (und speziellen) Berlinhistoriker<br />
ist spürbar zurückgegangen und damit auch die Auswahl an Themen und Stoffen.<br />
Hinzu kommt die Unzugänglichkeit der wichtigsten Quellen durch die politische Teilung unserer<br />
Stadt. Die Forderung nach Wissenschaftlichkeit auf der einen und vereinsintern-populärer<br />
Information auf der anderen Seite stellt sich als weiteres Problem dar, dem freilich viele<br />
vergleichbare Zeitschriften andernorts auch unterliegen. Dieses doppelte Gesicht gereicht den<br />
Heften nicht unbedingt zum Vorteil, da wissenschaftlicher Anspruch und innerbetriebliches<br />
Feuilleton ganz unterschiedliche Leserkreise ansprechen. Doch weil die „Mitteilungen" für<br />
alle Mitglieder gemacht werden müssen, wird das Auspendeln der Gewichte die vornehmste<br />
Aufgabe der Redaktion bleiben. Bereits 1893 war in einer Rezension den „Mitteilungen" bescheinigt<br />
worden, in ihnen sei „das Verhältnis des Wichtigeren zum Bedeutungslosen zum<br />
Vorteil des ersteren gestiegen".<br />
Nach diesen Reflexionen noch etwas für die Statistik: In den 10 Jahren erschienen (ausschließlich<br />
des vorliegenden) 40 Hefte mit insgesamt 912 Seiten, dazu je 2 Inhaltsverzeichnisse und<br />
Personenregister mit weiteren 36 Seiten. 47 Autoren lieferten zusammen 91 Artikel, die<br />
kleineren Beiträge nicht mitgerechnet. Hinzu kamen 440 Buchbesprechungen, an denen 59 Rezensenten<br />
beteiligt waren. In den beiden Personenregistern 1965 bis 1970 und 1971 bis 1974<br />
sind rund 2250 Namen verzeichnet.<br />
Mit dem aufrichtigen und herzlichen Dank an alle Mitarbeiter und Förderer, die sich unermüdlich<br />
und nicht ohne persönliche Opfer in den Dienst dieser Zeitschrift gestellt haben, verbindet<br />
die Schriftleitung den ebenso herzlichen Wunsch, auch in Zukunft unsere gemeinsame Arbeit<br />
im Sinne der verpflichtenden Tradition berlinischer Geschichtsschreibung mit Tatkraft und<br />
Wohlwollen zu unterstützen. Peter Letkemann<br />
Kurt Pomplun, 65jährig, verabschiedet<br />
Wüßte man nicht selbst, daß unser langjähriger stellvertretender Vorsitzender, als „Kutte"<br />
weit über seinen Kietz hinaus bekannt, die Vollendung des 65. Lebensjahres als den Zeitpunkt<br />
seiner offiziellen Pensionierung herbeigesehnt hätte, um von nun an noch mehr arbeiten<br />
zu können, man würde sich scheuen, dieses Ruhestandsalter mit der Person, dem Wirken<br />
und der Aktivität des Jubilars in Verbindung zu bringen. Dennoch sei es gewagt, die<br />
Lebensdaten Pompluns aufzuzählen und damit mehr für die Nachwelt festzuhalten als das,<br />
was sie über ihn ohnehin schon weiß: Daß sich bei ihm immenser Fleiß und profunde Kenntnisse<br />
die Waage halten, daß er mitnichten auf den Mund gefallen ist, daß er seinen Geburtsort<br />
Berlin weder verleugnen kann noch will, daß er zur Berliner Prominenz zählt und haarscharf<br />
schon die Gloriole eines „Originals" für sich beanspruchen kann, daß er gerne Bier trinkt und<br />
daß unsere Berliner Landschaft eintöniger und ärmer wäre, wüßte er sie nicht mit seinem<br />
Füllhorn von Zeitschriftenaufsätzen, Büchern, Vorträgen, Führungen und Interviews zu beleben<br />
und die trockenen Fakten der Historie in fesselnde Beiträge umzumünzen. Hier das<br />
geleistet zu haben, was man unter einem anderen Vorzeichen „Breitenarbeit" nennen würde,<br />
nämlich so vielen Lesern und Hörern erst bewußt gemacht zu haben, auf was für einen Flecken<br />
Erde sie leben, kann er sich heute schon als bleibendes Verdienst anrechnen.<br />
Das Curriculum vitae ist schnell abgehandelt: Kurt Pomplun wurde am 29. Juli 1910 geboren.<br />
Er besuchte die Höhere Staatslehranstalt für Vermessungswesen Berlin, auf der er seine Ausbildung<br />
zum Vermessungsingenieur erfuhr, und kann jetzt die Berufsbezeichnung „Amtsrat<br />
a. D., Schriftsteller" führen, nachdem er zuletzt von 1965 bis zur Jahresmitte 1972 dem<br />
Landeskonservator seine Dienste lieh. Seine Buchveröffentlichungen über Berlin seien hier<br />
lediglich der Vollständigkeit halber aufgeführt, weil sie als bekannt vorausgesetzt werden<br />
können: Berlins alte Dorfkirchen (3. Aufl. 1967), Berlins alte Sagen (3. Aufl. 1967), Kutte kennt<br />
sich aus (1970), Berliner Häuser (1971) und Von Häusern und Menschen (1972). Daß er auch<br />
74
Baedekers Reisehandbuch Berlin (24. Aufl. 1966 und weitere) verfaßt hat, nimmt nicht wunder.<br />
Größeres Erstaunen dürfte es aber hervorrufen, daß er aus der beliebten und zuverlässigen<br />
Reihe von Baedeker auch für die folgenden Bände verantwortlich ist: Salzburg (1964),<br />
Nürnberg (1966), Würzburg (1966), Regensburg (1967), Augsburg (1968), Bamberg (2. Auflage<br />
1969), Braunschweig (1969) und Innsbruck (1969). Auch Eingeweihte fragen sich, wie er dies<br />
Pensum überhaupt schafft, zumal er gar nicht den Eindruck eines Schreibtischhockers macht.<br />
Lassen wir ihm dieses Geheimnis, gönnen wir ihm Vitalität und Lebensfreude, verargen wir es<br />
nicht, daß er sich auf der Jahreshauptversammlung 1975 nicht wieder als stellvertretender Vorsitzender<br />
hat wählen lassen, und schätzen wir uns glücklich, daß er noch so viel vorhat —<br />
unser manchmal etwas raunziger und bärbeißiger, aber doch herzensguter und lieber „Kutte".<br />
H. G. Schultze-Berndt<br />
*<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Frau Dorothea Macholz, Frau Käthe Pierson, Frau Hilde Krauss, Herrn<br />
Prof. Dr. Volkmar Denckmann, Herrn Willy Born, Frau Anni Ihlenfeld, Herrn Alfred Hardow,<br />
Herrn Günther Rühl; zum 75. Geburtstag Frau Karoline Cauer, Herrn Werner Obigt, Frau<br />
Grete Paesler, Frau Christa Ohle; zum 80. Geburtstag Herrn Ernst Müller, Herrn Richard<br />
Deicke, Herrn Hans Zopf; zum 85. Geburtstag Herrn Hans Atzrott.<br />
*<br />
Der Beitrag „Fontanes Umgang mit Bismarck" unseres verstorbenen Mitgliedes Kurt Ihlenfeld,<br />
veröffentlicht im „Bär von Berlin" 1973, wurde mit Unterstützung von Frau Ihlenfeld in<br />
kleiner Auflage als Sonderheft herausgebracht. Er kann zum Preis von 3 DM zuzüglich Portokosten<br />
bei der Geschäftsstelle bestellt werden.<br />
Dem Heft 2/1975 der MITTEILUNGEN lag das Inhaltsverzeichnis für die Jahrgänge 67 bis 70<br />
(1971 bis 1974) bei. Aufgrund der Nachfrage hat unser Buchbinder für die Bibliothek den<br />
Mitgliedern des Vereins einen Sonderpreis für das Einbinden obiger Jahrgänge von 19 DM eingeräumt.<br />
Interessenten mögen die Hefte mit Inhaltsverzeichnis bis spätestens Ende Juli in der<br />
Bibliothek während der Öffnungszeiten abgeben. Die Bibliothek ist auch während der Ferienzeit<br />
geöffnet.<br />
Buchbesprechungen<br />
Theodor Fontane: Reisebriefe vom Kriegsschauplatz Böhmen 1866. Hrsg. von Christian<br />
Andree, Frankfurt a. M./Berlin: 1975. 112 S., brosch., 3,80 DM. (Ullsteinbuch Nr. 4600.)<br />
Der deutsche Krieg von 1866, den Fontane in dem zweiten Werk seiner fünfzehnjährigen<br />
kriegshistorischen Tätigkeit ausführlich dargestellt hat, war am 26. Juli durch den Präliminar-<br />
Friedensvertrag von Nicolsburg zu Ende gegangen. Im Auftrag des Königlich Geheimen Ober-<br />
Hofbuchdruckers R. v. Decker in Berlin bereiste Fontane vom 18. bis 31. August den von der<br />
Cholera durchseuchten böhmischen Kriegsschauplatz und berichtete darüber in dem von Decker<br />
herausgegebenen „Fremdenblatt", das damals einen offiziösen Charakter trug, deshalb u.a. in<br />
Wien sorgsam aufgesammelt wurde. Fontane hat diese Berichte selbst in zwei Heften aufgeklebt,<br />
das eine Exemplar seiner Gattin Emilie zum 42. Geburtstag geschenkt, das andere Exemplar<br />
war bis zu dessen Heimgang im Besitz seines jüngsten Sohnes Friedrich. Es entbehrt nicht eines<br />
grotesken Interesses, daß Friedrich Fontane in der gewiß nicht militärfeindlichen Zeit nach 1933<br />
den Neudruck dieser Berichte jahrelang Verlegern in Nord- und Süddeutschland vergeblich<br />
angeboten hat. In der Zeit der Großdeutschland-Euphorie war die Publikation unerwünscht.<br />
So war es ein besonderes Verdienst unseres Vereinsmitgliedes Christian Andree, offenbar aufgrund<br />
dieses Exemplars die Berichte, versehen mit einer vorzüglichen Einleitung und 14 S.<br />
militärhistorischen Erläuterungen, dem Kreis der Fontanefreunde neu zugänglich gemacht zu<br />
haben (Propyläen Verlag 1973). Ein seitengetreuer Nachdruck ist nunmehr in der Reihe der<br />
preiswerten Ullsteinbücher erschienen und wird allen Fontanefreunden sehr willkommen sein,<br />
da mehr als aus Fontanes ganzer Kriegshistorik hier der Mensch und Schriftsteller sichtbar<br />
wird. Andrees Einleitung ordnet die Berichte vom böhmischen Kriegsschauplatz exakt in das<br />
75
Gesamtwerk des Dichters ein. Sie sind aber auch ein ganz besonderes Dokument hinsichtlich<br />
der sozialpolitischen Bedeutung innerhalb der breiten, aber so seichten Ströme der Kriegsberichterei<br />
jener Zeit und nicht weniger eine stille Kritik an der von Moltkes Generalstab<br />
geübten Vorbehalte der militärischen Historik. Diesem Thema sind die Berichte wichtig, und<br />
es steht zu erwarten, daß die sozialpolitischen Probleme der Fontaneschen Kriegshistorik in<br />
der in Arbeit befindlichen Dissertation eines Urenkels des Dichters, Jörg von Forster, einer<br />
Klärung zugeführt werden. Hermann Fricke<br />
Christa Wolf: Unter den Linden. Drei unwahrscheinliche Geschichten. (Ost-)Berlin: Aufbau-<br />
Verlag 1974. Lizenzausgabe Darmstadt: Luchterhand 1974. 169 S., Leinen, 22 DM.<br />
Christa Wolf, profilierte Schriftstellerin der DDR und wohnhaft in Kleinmachnow bei Berlin,<br />
stellte sich auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse mit ihrem neuesten Buch dem hiesigen<br />
Publikum vor. Nach „Der geteilte Himmel" und „Nachdenken über Christa T." legt die Trägerin<br />
des Heinrich-Mann-Preises und des Nationalpreises der DDR neben der fast traumatischen<br />
Titelgeschichte mit „Neue Lebensansichten eines Katers" und „Selbstversuch" erstmalig Satiren<br />
vor. Der Inhalt dieser drei Texte ist transparent und daher gut verständlich. Eine Frau - autobiografische<br />
Züge scheinen sichtbar - begegnet im Traum auf Berlins berühmtester Straße einem<br />
alten Freund, trifft einen ungenannten Mann und fühlt sich ständig von einem Mädchen beobachtet;<br />
ein stets im Dunkeln verbleibendes Moment.<br />
Absurd ist des Katers Bericht über seinen Professor, dessen Versuch, den Menschen mit all seinen<br />
Lebensgewohnheiten zu katalogisieren, an E. T. A. Hoffmanns Geschichte vom „Kater Murr"<br />
erinnert.<br />
Das irreale Experiment, welchem sich eine junge Wissenschaftlerin unterzieht, um als „Mann auf<br />
Zeit" den psychischen Unterschied der Geschlechter zu analysieren, ist Thema der zweiten Satire.<br />
So phantastisch diese drei Inhalte sind, so ernsthaft setzen sie sich doch mit dem Erscheinungsbild<br />
unserer Zeit und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für den einzelnen Menschen auseinander.<br />
Ergänzend sei vermerkt, daß die Ausgabe des Aufbau-Verlages drei Farbillustrationen<br />
von Harald Metzkes enthält. Klaus P. Madet<br />
Klaus-Dieter Wille: Berliner Landseen. Bd. I: Vom Haiensee zu den Rudower Pfuhlen.<br />
Bd. II: Vom Heiligensee zur Krummen Laake. Berlin: Haude & Spener/Hessling 1974. 90 und<br />
88 S. mit Abb., brosch., je 14,80 DM. (Berlinische Reminiszenzen Bd. 40 und 41.)<br />
Ein Charakteristikum der Berliner Landschaft sind - neben den seenartig ausgeweiteten Flußgebieten<br />
der Spree im Osten und der Havel im Westen - die recht zahlreichen, über das<br />
gesamte Stadtgebiet verteilten kleinen Seen und Teiche. Der Verfasser hat sich in den vorliegenden<br />
beiden schmalen Bändchen die Aufgabe gestellt, die große Bedeutung dieser oft unscheinbaren<br />
Wasserflächen für unsere Umwelt in Vergangenheit und Gegenwart herauszuarbeiten.<br />
Die Darstellungen der einzelnen Seen, die hier nach geographischen Gesichtspunkten<br />
geordnet sind, enthalten neben geologischen, botanischen und wasser- und forstwirtschaftlichen<br />
auch historische Themen. Erfreulich ist, daß beide Teile der Stadt in gleicher Weise vertreten<br />
sind. Nicht alle Landseen konnten berücksichtigt werden, die Auswahlprinzipien bleiben<br />
oft unklar. Im Süden hätten die zahlreichen Teiche zwischen Steglitz und Tempelhof, etwa<br />
der Kelchpfuhl und die Blanke Helle, durchaus Erwähnung finden können.<br />
Während einzelne Aspekte, etwa der Umfang der zivilisatorischen Schäden, insbesondere aus<br />
den letzten Jahren, erschreckend deutlich gemacht werden konnten, bleiben die historischen<br />
Anmerkungen sehr fragwürdig. So ist z. B. das Dorf Stolpe am Rande des Stölpchensees (Bd. I<br />
S. 53 ff.) noch nicht 1197 genannt worden. Das in einer Dotationsurkunde 1197 (Riedel, Codex<br />
Diplom. Brandenb. A 7, S. 469) genannte „Stülp" lag bei Paretz im Havelland. An den wüstgefallenen<br />
Ort erinnerten noch im 16. Jh. die „Stolpischen Hufen" in der Feldmark Paretz<br />
(Riedel, CDB A 7, S. 488). Auch die für 1624 genannte Bevölkerungszahl ist unrichtig. Der<br />
geschraubte Stil führt überdies zu offensichtlich falschen Aussagen (S. 53 unten). Bei der Beschreibung<br />
des weiter südlich gelegenen Griebnitzsees (Bd. I S. 56 ff.) fehlt die in der Literatur<br />
längst diskutierte glazialmorphologische Deutung der für große Teile der Mark typischen<br />
Oberflächenform des Sees. Die Liste der Monita kann beliebig fortgesetzt werden. Auch das<br />
Literaturverzeichnis vermag nicht zu befriedigen.<br />
Positiv hingegen sind die gute Bebilderung und die Tabellen mit den wichtigsten Daten zu<br />
den besprochenen Seen hervorzuheben. Es bleibt im Interesse an der Sache zu hoffen, daß<br />
die Bändchen, trotz aller Mängel, ihre Aufgabe erfüllen und ein größeres Interesse an der<br />
Erhaltung und Pflege der immer stärker bedrohten Wasserflächen wecken können.<br />
Felix Escher<br />
76
Gustav Sichelschmidt: Berliner Originale. Ein Dutzend berlinischer Porträts. - Berlin: Rembrandt-Verlag<br />
1974. 121 S., 12 Abb., Leinen, 14,80 DM.<br />
Es scheint, als hätten ein etwas verschwommener Originalbegriff und ein Überschuß an Kurzbiographien<br />
„berühmter Berliner", die möglicherweise aus Platzgründen im zweiten Bändchen<br />
der Reihe nicht unterzubringen waren, bei der Entstehung dieses neuen Opus zusammengewirkt.<br />
Ein Übriges mag die Spekulation auf das Komplettierbedürfnis von Sammlernaturen<br />
beigetragen haben. Und so werden unverdrossen bekannte Maler und Bildhauer (Chodowiecki,<br />
Schadow, Liebermann, Zille), Schriftsteller (Glaßbrenner, Kaiisch, Heinrich Seidel), Musiker<br />
(Paul Lincke) und Kabarettisten (Otto Reutter) zusammen mit dem Grafen Wrangel, dem<br />
Bankier Fürstenberg und dem Chirurgen Sauerbruch diesmal als „Berliner Originale" verkauft.<br />
Ohne nennenswerten Zuwachs an Qualität und mit wechselndem Titel kann in gleicher Art<br />
noch viel Unterhaltsames geschrieben werden. Das Berlinische, das Berlinertum und die Berliner<br />
Volksmentalität werden oft beschworen, geistig zwar nicht stärker durchdrungen als in<br />
dem vorangegangen Büchlein, aber Lokalpatrioten werden weiter ihre Freude daran finden.<br />
Eva Wirsig<br />
Hans Dieter Jaene: Kreuzpunkt Berlin. Bilder aus der Mitte Europas. Berlin/Westhof en: Anke<br />
Starmann Verlag 1974. 234 S. m. 135 Abb., Leinen, 54,85 DM.<br />
Liest man als unvoreingenommener Leser zunächst das Impressum, die Einleitung und die<br />
zwei Vorworte, so entsteht der Eindruck, hier mit einer Publikation über Berlin überrascht<br />
zu werden, deren Gesamtkonzeption - sowohl vom Material als solchem und dessen Auswertung,<br />
wie auch von der typographischen Gestaltung und der technischen Ausführung her -<br />
sich dem Stil der heutigen Tage anpaßt und sich damit positiv aus dem Gros früherer einschlägiger<br />
Veröffentlichungen heraushebt.<br />
Die Farbfotos stammen von Klaus Lehnartz, das weitere Bild- und Kartenmaterial u. a. von<br />
der Landesbildstelle Berlin, dem Museum für Vor- und Frühgeschichte, dem Werner-von-<br />
Siemens-Institut, der Deutschen Presse-Agentur und dem Fackelträger-Verlag, der die Einwilligung<br />
für die Veröffentlichung der Zille-Zeichnungen und Texte gab. Die Vorworte sind von<br />
Wilhelm Wolfgang Schütz vom Kuratorium Unteilbares Deutschland, dem auch der Reinerlös<br />
aus dem Verkauf des Buches zufließt, sowie vom Regierenden Bürgermeister Klaus Schütz.<br />
Wenden wir uns nun dem eigentlichen Inhalt zu. Das dargebotene Material ist recht übersichtlich<br />
in sieben Kapitel aufgeteilt, wenngleich sich auch hier gewisse Überschneidungen nicht<br />
vermeiden ließen. Sechs Kapitel zeigen die Geschichte und das Schicksal dieser Stadt und ihrer<br />
Bewohner aus überwiegend wirtschaftlichen Blickwinkel, während eines „Zwangslose Geschichten<br />
und Bilder von Heinrich Zille" zum Inhalt hat. Hans Dieter Jaene, der als freier Journalist<br />
und Publizist heute in Berlin lebt, hat aus der Fülle des Vorhandenen das Buch zusammengestellt<br />
und die kurzen anschaulichen und gut verständlichen Texte dazu geschrieben. Und<br />
hier kann eine gewisse Kritik nicht ausbleiben. Einmal sind es die Abbildungen im Kapitel 7,<br />
das „Berlin (West) - Berlin (Ost) oder Eine Stadt geht zwei Wege" überschrieben ist. Ein Teil<br />
der hier gezeigten Fotos ist nur von geringer Aussagekraft, wobei sicher in vielen Archiven<br />
bessere Aufnahmen zu finden sind. Vielleicht hätte sich auch hier oder da ein anderer Bildausschnitt<br />
angeboten. Doch leider auch der Text dieses Kapitels fällt von dem der anderen<br />
Kapitel ab und ergeht sich in Floskeln und Banalitäten, die in diesen Heften schon früher<br />
Mißfallen erregten. Noch ein Wort zur technischen Ausführung. Sie ist, sieht man von der<br />
schlechten Wiedergabe einzelner Vorlagen ab, guter Durchschnitt, wobei man über das überproportionierte<br />
Querformat und die angeschnittenen Bildseiten geteilter Meinung sein kann.<br />
So bleibt als Fazit und Entgegnung auf den Satz im Vorwort von Klaus Schütz „. .. zum<br />
kompletten Berlin-Buch der siebziger Jahre": leider nicht ganz das Ziel erreicht!<br />
Klaus P. Mader<br />
Dieter Breitenborn: Berliner Wasserspiele. (Ost-)Berlin: VEB Verlag für Bauwesen 1974. 80 S.<br />
m. 112 Abb., Pappbd., 13 M.<br />
Rom wird man für eine Stadt der Brunnen halten, auch München, und man zögert eigentlich, ob<br />
man die sonst zu beobachtende Liebe des Berliners zum Wasser auch auf Zahl, Popularität und<br />
Geltung öffentlicher Brunnenanlagen übertragen kann (die Renommier-Wasserspiele am alten<br />
Knie, vom Volksmund „Ernst-Reuter-Sprudel" getauft, sind wohl eher eine Ausnahme). Dies<br />
war schon seit jeher so, denn in dem vom Architektenverein zu Berlin 1877 herausgegebenen<br />
Band „Berlin und seine Bauten" wird die Armut vor allem an monumentalen Wasserspielen<br />
beklagt und ausgeführt, „größere Anlagen sind bisher immer Projekt geblieben". Nicht zu verwechseln<br />
mit den öffentlichen Wasserspielen sind jene Pumpen, die noch heute das Stadtbild<br />
Berlins beleben (vor allem durch die zahlreichen Autowäscher), selbst wenn ihre nüchterne Form<br />
den Vergleich mit den altväterlichen Vorgängern nicht aushält. 1856 gab es in Berlin neben 9000<br />
77
Hofbrunnen noch 900 öffentliche Brunnen, deren Pumpenschwengel bei starkem Frost von den<br />
damals 30 Nachtwächtern der Stadt regelmäßig betätigt werden mußten, um ein Einfrieren zu<br />
verhindern.<br />
Das hier vorliegende Buch beschränkt sich in seiner Betrachtung trotz seines nicht abgrenzenden<br />
Titels auf die rund 60 Brunnen im Ostteil der Stadt, von denen rund ein halbes Hundert abgebildet<br />
und beschrieben werden. Darunter sind vertraute Wasserspiele wie der Märchenbrunnen im<br />
Friedrichshain, aber auch weniger bekannte wie der Eulenspiegel-Brunnen im Kulturpark Treptow.<br />
Ebenso erscheinen Anlagen wie z. B. die Kaskaden am Fernsehturm, deren Reiz auf technischen<br />
Effekten beruht. In kurzen Zeilen wird ihrer Herkunft nachgegangen und der Standort<br />
beschrieben, häufig mit dem Hinweis, technische Mängel oder Bubenhände hätten die Wassertechnik<br />
zum Erliegen gebracht. Daß in einem historischen Rückblick an jenem Streifen haltgemacht<br />
wird, der heute nur von Bewaffneten und Hunden bevölkert wird, ist eigentlich unverständlich,<br />
werden doch auch Werke wie Müller-Bohns „Die Denkmäler Berlins in Wort und Bild"<br />
aus dem Jahre 1905 zu Rate gezogen, als noch nicht ein Drittel einer Weltstadt behauptete, das<br />
Ganze oder gar Hauptstadt zu sein. H. G. Schultze-Berndt<br />
Grunewald-Chronik. Hrsg. von der Grunewald-Grundschule anläßlich des 75jährigen Jubiläums<br />
1974. Redaktion: Eberhard Welz. 160 S. mit Abb., 10 DM.<br />
Diese nicht im Buchhandel erhältliche Materialsammlung wurde zur Gestaltung einer historischen<br />
Ausstellung anläßlich der 75-Jahr-Feier der Kolonie Grunewald und ihrer Grundschule in der<br />
Delbrückstraße 20 a zusammengetragen. Aus privaten Erinnerungsblättern und Fotos, aus Zeitungen,<br />
amtlichen Schriften und Geschichtswerken entstand eine - wenn auch bunt zusammengewürfelte<br />
- Chronik, die eine Fundgrube für jeden lokalhistorisch Interessierten darstellt.<br />
Die Anfänge der am 1. April 1899 gegründeten Landgemeinde mit ihrem bereits damals erkennbaren<br />
Hauch von Exklusivität sind schon von den Zeitgenossen ausgiebig beschrieben worden;<br />
ihre weitere Geschichte erfährt z. B. durch viele Villenbewohner mit illustren Namen noch<br />
zusätzliche Verklärung. Neben der Wiedergabe älterer Berichte über die Bau- und Verkehrsverhältnisse,<br />
die Bildungseinrichtungen und auch die „kriminelle Beziehung" der Kolonie<br />
Grunewald finden die schulischen Belange gebührende Berücksichtigung. Die noch erkennbaren<br />
Lücken, vom Hrsg. selber beklagt, sollen durch Fortsetzung der Sammeltätigkeit in Zukunft<br />
geschlossen werden. Peter Letkemann<br />
Werner Brink: Es geschah in Berlin. Bayreuth: Hestia 1970. 318 S., Leinen, 18,50 DM.<br />
In weit über fünfhundert Hörspielfolgen hat der Autor in Zusammenarbeit mit der hiesigen<br />
Kriminalpolizei Fälle von Rechtsvergehen aus dem Berlin der Nachkriegszeit zusammengestellt.<br />
Diese wöchentlich ausgestrahlte Sendefolge erfreute sich stets großer Beliebtheit. Nun sind in<br />
diesem Band sieben Fälle aufgezeichnet, von denen angenommen wird, daß sie zu den interessantesten<br />
der Reihe gehören. Hinzu kommt, daß es sich hier um jene Fälle handelt, die erst<br />
durch eingehende Analyse der Hintergründe durchschaubar werden - ein Vorteil des Buches<br />
gegenüber einer begrenzten Sendezeit. Dank dieser breit angelegten Schilderungen - gut und<br />
spannend geschrieben - ist hier eine Urlaubslektüre zu empfehlen. Klaus P. Mader<br />
Studienfahrt nach Hann. Münden<br />
Die diesjährige Exkursion führt vom 5. bis 7. September 1975 nach Hannoversch Münden.<br />
Auch in diesem Jahr werden keine gesonderten Einladungen verschickt, alle Interessenten aber<br />
weiter schriftlich unterrichtet.<br />
Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 64 DM je Person und schließt die Omnibusfahrt, Eintrittsgelder<br />
und Honorare für Besichtigungen und Führungen ein. Der Verkehrsverein Naturpark<br />
Münden e. V. hat vorsorglich mehr als 60 Betten in der Preislage 23 DM bis 28 DM (Endpreis<br />
einschl. Frühstück) für uns reserviert. Sollten die Übernachtungsmöglichkeiten nicht mit unseren<br />
Wünschen in Einklang zu bringen sein, wäre hinsichtlich einer Begrenzung die Reihenfolge<br />
der Anmeldungen für die Teilnahme ausschlaggebend. Außer den Hotelkosten erwachsen den<br />
Mitreisenden aus den gemeinsamen Veranstaltungen folgende Ausgaben: Kaffeetafel in Schloß<br />
Berlepsch 5,50 DM (Kännchen Kaffee und ein Stück Torte mit Sahne), Mittagessen im Burghotel<br />
Trendelburg 15 DM (Gespickter Rindersaftbraten in Burgundersauce, frischer Wirsing<br />
n
und Butterkartoffeln) und Mittagessen im Hotel „Schmucker Jäger" 8,60 DM (Schweineschnitzel<br />
paniert, gem. Salat, Salzkartoffeln).<br />
Richten Sie ihre Anmeldungen bitte formlos bis zum 18. Juli 1975 an Herrn Dr. H. G. Schultze-<br />
Berndt, 1 Berlin 65, Seestraße 13, Tel. 4 65 90 11, App. 91, wegen des dann beginnenden<br />
Urlaubs unseres Schriftführers auf keinen Fall später! In einem späteren Rundschreiben<br />
erfahren Sie dann Einzelheiten einschließlich der Kontonummer für die Überweisung des<br />
Kostenbeitrags.<br />
Programm<br />
Freitag, 5. September 1975<br />
6.30 Uhr Abfahrt von der Hardenbergstraße 32 (Berliner Bank)<br />
13.30 Uhr Eintreffen in der Städtischen Brauerei zu Göttingen AG, Imbiß, Führung durch<br />
Dipl.-Braumeister Robert Stolle und Vortrag Dr. H. G. Schultze-Berndt „Zur<br />
Geschichte des Brauwesens in Göttingen"<br />
19.00 Uhr Ankunft in den Hotels in Hann. Münden<br />
Sonnabend, 6. September 1975<br />
9.00 Uhr Vorträge im Hotel Kerksiek<br />
1. Ortsheimatpfleger Dr. Karl Brethauer: „Ein Gang durch Münden und seine<br />
Geschichte"<br />
2. Ortsheimatpfleger Heinz Härtung: „Münden als Fachwerkstadt mit dem Problem<br />
der Sanierung"<br />
Anschließend Rundgang mit Empfang durch Bürgermeister Gustav Henkelmann<br />
im Rathaus und Besichtigung der Ausgrabungen in der Kirche St. Blasii; Abschluß<br />
im Schloß (Fresken). Der Besuch der Heimatkundlichen Abteilung des Museums mit<br />
bemerkenswerter Darstellung der Geschichte des Fachwerkbaus wird freigestellt.<br />
13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Hotel „Schmucker Jäger"<br />
14.30 Uhr Ausflug zum Kloster Bursfelde und zur Klosterkirche Lippoldsberg unter Führung<br />
von Dr. K. Brethauer<br />
19.00 Uhr Zwangloses geselliges Beisammensein<br />
Sonntag, 7. September 1975<br />
10.00 Uhr Exkursion in den Reinhardswald mit Besuch der Sababurg und der Krukenburg<br />
12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen im Burghotel Trendelburg<br />
14.30 Uhr Besichtigung des Europäischen Brotmuseums Mollenfelde mit Vortrag und Führung<br />
des Gründers und Direktors Otto A. Kunkel<br />
15.30 Uhr Kaffeetafel im Schloß Berlepsch mit Vortrag von Edmund Littau über die Geschichte<br />
der „Berlepsch"<br />
22.30 Uhr Ankunft in Berlin<br />
Im II. Vierteljahr 1975<br />
haben sich folgende Damen, Herren und Institutionen zur Aufnahme gemeldet:<br />
Martha Anklamm, Kauffrau Max Bolstorff, Bankkaufmann<br />
1 Berlin 37, Süntelsteig 12 1 Berlin 33, Hüninger Straße 3<br />
Tel. 8 13 50 07 (Schriftführer) Tel. 8 3132 03 (Schriftführer)<br />
Eike-Eckehard Baring, Richter am Verw.-Ger. Hartmut Dimke, Verwaltungsangestellter<br />
1 Berlin 31, Halberstädter Straße 2 1 Berlin 26, Quickborner Straße 91<br />
Tel. 8 85 75 45 (Schriftführer) Tel. 4 16 49 66 (Erwin Dimke)<br />
Nanni-Erna Becker Christel Hartwig, Sekretärin<br />
1 Berlin 62, Badensche Straße 3 1 Berlin 30, Eisenacher Straße 12<br />
Tel. 7 8179 12 (Vorsitzender) Tel. 2 1184 24 (Schriftführer)<br />
79
Interessengemeinschaft der Eigenheimsiedlung<br />
Ruhleben e. V.<br />
Herbert Niebel, Baukaufmann<br />
1 Berlin 19, An der Fließwiese 33<br />
Tel. 3 04 39 09 (Vorsitzender)<br />
Dr. Stefan Massante, Diplomgärtner<br />
62 Wiesbaden, Leibnizstraße 16 a<br />
Tel. 56 33 12 (Dr. Leichter)<br />
Veranstaltungen im III. Quartal 1975<br />
1. Sonnabend, 5. Juli, 15 Uhr: Sommerausflug zum Jagdschloß Grunewald mit<br />
Besichtigung der freigelegten Renaissance-Architekturen. Führung durch Prof. Dr.<br />
Martin Sperlich. Anschließend Ausklang im Gasthaus Paulsborn.<br />
2. Mittwoch, 9. Juli, 18 Uhr: Besichtigung der Ausstellung „Historische Stadtgestalt<br />
und Stadterneuerung in Berlin" im Berlin-Pavillon an der Straße des 17. Juni<br />
(S-Bahnhof Tiergarten) anläßlich des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975.<br />
Führung durch Landeskonservator Dr. Helmut Engel. Fahrverbindungen: U-Bhf.<br />
Hansaplatz; Autobus 23.<br />
Im Monat August finden keine Vorträge und Führungen statt. Die Bibliothek ist zu<br />
den üblichen Zeiten geöffnet.<br />
3. 5. bis 7. September: Studienfahrt nach Hann. Münden. Ausführliches Programm<br />
auf der vorhergehenden Seite!<br />
4. Sonnabend, 13. September, 10 Uhr: Rundgang durch Heiligensee, Führung durch<br />
Kurt Pomplun. Treffpunkt an der Dorfkirche. Fahrverbindungen: Autobus 13<br />
oder 14.<br />
Freitag, 25. Juli, 29. August und 26. September," zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
ab 17 Uhr.<br />
Wir weisen darauf hin, daß der Mindest-Jahresbeitrag 36 DM beträgt und bitten um umgehende<br />
Überweisung noch ausstehender Beiträge für das Jahr 1974 und 1975. Auf Wunsch kann<br />
eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 4 65 90 11. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1 Berlin 21.<br />
Bibliothek: 1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus). Geöffnet: freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Klaus P.<br />
Mader; Günter Wollschlaeger. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt,<br />
Bezugspreis für Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
SO<br />
Manfred Pix, stellv. Vorsitzender des Vorstands<br />
der Sparkasse im Landkreis Neustadt<br />
- Bad Windsheim und Dir. der Sparkasse<br />
8530 Neustadt a. d. Aisch, Hartschmiedenweg<br />
1<br />
Tel. 34 29 bzw. 91 - 2 20 (Schriftführer)<br />
Gerda Schuck, Sekretärin<br />
1 Berlin 41, Grazer Damm 146<br />
Tel. 8 55 14 68 (Schriftführer)
A 20 377 F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
71. Jahrgang Heft 4 Oktober 1975<br />
•V<br />
4MM<br />
Theodor Hosemann<br />
Kl
Theodor Hosemann zum Gedenken<br />
Von Claus P. Mader<br />
Am 15. Oktober 1975 jährt sich der Todestag Theodor Hosemanns zum hundertsten<br />
Mal. Das sollte ein Anlaß sein, mit einigen Sätzen auf Leben und Wirken eines Mannes<br />
einzugehen, der fast ein halbes Jahrhundert in Berlin gelebt hat und der für uns heute<br />
der Schilderer des vor- und nachmärzlichen Berliner Bürgertums bis zur Reichsgründung<br />
ist. Mit seinen kleinen Genreszenen und ihren kleinbürgerlichen Gestalten läßt<br />
er uns noch heute in humorvoller Weise ein Stück hiesiger Vergangenheit erleben.<br />
Leider muß man mit einer gewissen Resignation feststellen, daß zwar eine annehmbare<br />
Biografie vorliegt, daß aber eine abschließende kunsthistorische Wertung oder gar ein<br />
Oeuvrekatalog fehlen. Nach wie vor ist man in der Hauptsache auf Schrifttum angewiesen,<br />
dessen Veröffentlichung bereits über vierzig Jahre zurückliegt. Auch jetzt noch gilt<br />
Lothar Briegers Werk über den „Altmeister Berliner Malerei" als bisher bestes Standardwerk,<br />
obwohl Autor und Verlag sich aus finanziellen Gründen mit einer Auslese des damals<br />
vorhandenen Materials begnügen mußten. Doch sind in einem Literaturverzeichnis<br />
die wichtigsten Quellen angegeben. Der von Karl Hobrecker bearbeitete Katalog der<br />
grafischen Werke umfaßt nur 584 Titel, d. h. ca. zehn Prozent aller Arbeiten; sicher keine<br />
ausreichende Grundlage. Als zweite wichtige Arbeit zum Thema ist die kunstgeschichtliche<br />
Studie von Franz Weinitz einzustufen, die bereits 1897 in den Schriften unseres<br />
Vereins erschienen ist. Nimmt man noch die wenigen Artikel aus Lexika, Kunstbüchern<br />
und Zeitschriften sowie die Beiträge aus Berlin-Büchern kulturhistorischen Inhalts hinzu,<br />
so ist damit die beweiskräftige Hosemann-Literatur erschöpfend ausgelotet. Neuere Veröffentlichungen<br />
wie z. B. die des Berlin-Museums oder die von Hans Ludwig im Verlag<br />
Rogner & Bernhard greifen alle auf die zuvor genannten Publikationen zurück und bringen<br />
kaum bislang Unbekanntes.<br />
So kann und soll dieser Beitrag auch nur eine kleine Zusammenstellung und Wertung<br />
bisher veröffentlichter Daten sein. Die Literaturhinweise bieten darüber hinaus dem an<br />
diesem Thema Interessierten die Möglichkeit zu weiteren Studien.<br />
Vergegenwärtigen wir uns zunächst die vita des Künstlers.<br />
Wie so viele von denen, die diese Stadt für ihre Kunst entdeckten - es seien hier nur<br />
Chodowiecki aus Danzig, Dörbeck aus Livland, Menzel und Baluschek aus Breslau und<br />
Zille aus Radeburg bei Dresden angeführt -, war auch Hosemann kein „echter" Berliner.<br />
Er kam aus Brandenburg, welches in jenen Tagen noch zwei Tagereisen von Berlin entfernt<br />
lag. Hier wurde Friedrich Wilhelm Heinrich Theodor Hosemann am 24. September<br />
1807 als Sohn eines preußischen Offiziers geboren. Die unruhige Zeit der Napoleonischen<br />
Kriege brachte es mit sich, daß der Vater von der Familie über Jahre getrennt lebte und<br />
diese aus finanzieller Not bei Verwandten Unterkunft suchen mußte. So wohnte die<br />
Mutter mit dem kleinen Theodor und dessen älterer Schwester erst in Oggersheim, danach<br />
in Heidelberg und Mannheim. Diese stete Wanderschaft der Familie in den Jahren<br />
1811 bis 1816, als sie sich endgültig in Düsseldorf niederließ, war auch der Grund dafür,<br />
daß der Sohn seinen Vater erst 1815 kennenlernte. Die Not und bittere Armut, in der<br />
sich nach dessen Pensionierung die Familie befand, zwangen den Zwölfjährigen, sich nach<br />
82
einem Beruf umzusehen, der ihm schnell eine Verdienstmöglichkeit bot. Beides fand er<br />
1819 in der Lithografischen Anstalt von Arnz & Winckelmann. Hier begann er seine<br />
Lehre als Lithograf, mit der er einen Weg betrat, den zehn Jahre später auch Adolph<br />
Menzel durchlaufen mußte.<br />
Da damals noch keine Farblithografien von mehreren Steinen gedruckt werden konnten,<br />
bestand eine Hauptaufgabe zunächst im Kolorieren der Abdrucke. Beglaubigte Arbeiten<br />
aus dieser Zeit liegen nicht mehr vor, doch muß sein Lehrherr Arnz zufrieden gewesen<br />
sein. Er ließ ihn erst die Elementarklasse für Zeichnen besuchen, welche Lambert von<br />
Cornelius leitete, um ihm danach den Besuch der dortigen Kunstakademie zu ermöglichen,<br />
wo Peter von Cornelius, der Bruder Lamberts, Direktor und sein Lehrer war.<br />
Zwar konnte dieser keinen entscheidenden Einfluß auf Hosemann und dessen künstlerische<br />
Entwicklung ausüben, erkannte jedoch immerhin die Leistungen seines Schülers an,<br />
was sehr viel bedeutete. Auch sein weiterer Lehrer Adolf Schrödter war von den Leistungen<br />
Hosemanns angetan.<br />
Das Jahr 1828 wurde für den jungen Lithografen bedeutungsvoll. Johann Christian<br />
Winckelmann trennte sich von seinem Teilhaber, um nach Berlin zu gehen und sich selbständig<br />
zu machen. Er gründete noch im selben Jahr das Lithografische Institut<br />
Winckelmann & Söhne. Mit ihm kam auch Theodor Hosemann nach Berlin, nachdem<br />
ein jährliches Gehalt von 400 Talern festgelegt worden war. Hier erschloß sich ihm eine<br />
neue Welt mit interessanten Aufgaben.<br />
Bis in das ausgehende 18. Jahrhundert hinein hatte es die überlieferte Verbindung von<br />
Architektur, Plastik und Malerei gegeben. Nach Auflösung der alten kirchlichen und<br />
weltlich-ständischen Ordnungen wurden im 19. Jahrhundert Staat, Stadt, Verwaltung,<br />
Gemeinde und später auch die Industrie die Auftraggeber der bildenden Künste unter<br />
der Zwangsvorstellung, Architektur hätte Kunst zu sein. Die Plastik, die schon im<br />
18. Jahrhundert die Funktion der Repräsentation besessen hatte, erhielt im 19. zumeist<br />
Aufträge öffentlicher Natur. Die Künstler, die dem Publikumsgeschmack am weitesten<br />
entgegenkamen und zum Beispiel Pathos, Realismus oder Ähnliches am stärksten in<br />
ihren Werken zum Ausdruck brachten, erhielten größtenteils die Aufträge.<br />
Dagegen war die Malerei frei geblieben. Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, Karlsruhe<br />
und andere ehemalige Residenzen bildeten Kunstzentren, die in ausgesprochen<br />
krassem Gegensatz zu der geschlossenen Schule in Frankreich standen.<br />
In den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts setzte die Wirkung des Biedermeier ein,<br />
dessen Werden das Aussterben der Romantik bedeutete. Zu dieser Zeit hatten sich die<br />
Maler größtenteils in Kunstvereinen organisiert, denen gemischte Gremien aus Bürgerund<br />
Künstlerschaft vorstanden. Der erste war 1824 in München gegründet worden. Ihre<br />
Blütezeit lag zwischen 1830 und 1860. Danach verloren sie an Gewicht, denn in den<br />
Gründerjahren nach 1870 ahmte das Großbürgertum die offizielle Führungsschicht nach.<br />
Sie veranstalteten Ausstellungen und Verlosungen für ihre Mitglieder, bei denen von<br />
den Vereinen vorher angekaufte Bilder gewonnen werden konnten.<br />
Die Biedermeier-Kunst erzählt typische Genre-Motive, oft in großer malerischer Qualität<br />
und von außerordentlich farblichem Reiz. Der Maler dieser Zeit ist der behagliche,<br />
gemütvolle Schilderer des täglichen Lebens, das er liebevoll, aber oft nicht ohne Ironie<br />
sieht. Es gab Künstler, die durchaus nicht im Erzählen von Anekdoten steckenblieben.<br />
83
Etwa um 1830 trat überall in Europa die Historienmalerei hervor, die den Vorrang<br />
Frankreichs in diesem Genre ablöste. Die Mehrzahl der Künstler verfolgte den einfachen<br />
Weg, realistisch darzustellen; die überwiegende Mehrheit der Maler ging darauf aus, dem<br />
Publikum zu gefallen. Reportagen sind das Ergebnis dieser Produktion. So konnte es<br />
schließlich zur Existenz zweier Funktionen der Malerei kommen, einmal der realistischen<br />
Berichterstattung für die Menge, zum anderen der Malerei für den Geistig-Anspruchsvollen,<br />
der Kunst des Individuums für das Individuum.<br />
In dieser Gesamtsituation bildete auch Berlin keine Ausnahme. Als Sitz des Hofes und<br />
der Staatsbehörden, als Universitätsstadt, als eine Stadt von über 200 000 Einwohnern,<br />
voller Regsamkeit und künstlerischer Initiative, die bereits Persönlichkeiten von europäischem<br />
Rang auf allen Geistesgebieten zu ihren Bürgern zählte, boten sich künstlerischen<br />
Naturen, auch wenn sie zunächst nur handwerklich vorgebildet waren, hinreichende<br />
Entfaltungsmöglichkeiten.<br />
Zu ihnen gehörte auch der junge Theodor Hosemann.<br />
Die Art der Tätigkeit des Neuberliners Hosemann unterschied sich zunächst kaum von<br />
derjenigen seiner Düsseldorfer Zeit: lithografische Arbeiten und das Kolorieren von<br />
Druckbogen. Doch noch - oder schon - im Jahre 1828 erschien bei Winckelmann & Söhne<br />
„Das allergrößte Bilder-ABC", ein Werk von 22 Druckbogen mit je 3 bis 6 Abbildungen,<br />
die uns zum ersten Mal selbständige Illustrationen Hosemanns zeigen. Mit dieser Arbeit<br />
gelang ihm sofort der Beweis, nicht nur ein guter „Handwerker", sondern ein ebenso<br />
guter Künstler zu sein. Schon im folgenden Jahr (1829) wurde er als Lithograf für das<br />
„Fest der weißen Rose", eine Beschreibung des Festes in Potsdam am 13. Juli zum Geburtstag<br />
der Kaiserin von Rußland, genannt. Diese Schrift erschien bei Gropius in Berlin.<br />
Seine sehr guten Aquarellierungen führten zur Bekanntschaft mit dem Intendanten der<br />
Kgl. Schauspiele, dem Grafen Brühl. Hieraus entwickelte sich eine Reihe wichtiger Verbindungen,<br />
so daß er schon bald zum beliebtesten Mal- und Zeichenlehrer der Berliner<br />
Adelskreise wurde, die später zu den besten Käufern seiner Bilder gehörten. Sein Fleiß<br />
brachte ihm zwar schon bald die finanzielle Unabhängigkeit, erwies sich jedoch leider<br />
auch als Hemmschuh für seine weitere künstlerische Entfaltung. Er, der aus einfachen<br />
und bescheidenen Verhältnissen stammte, mußte sich in den gehobenen Kreisen in gewissem<br />
Sinne deplaciert vorkommen. So führte er auch die ihm hier aufgetragenen Arbeiten<br />
in dem offensichtlichen Bemühen aus, ohne innere Anteilnahme das Beste zu schaffen.<br />
Gerade jene lassen seine ausgereifte Technik erkennen, wirken jedoch meist steif und<br />
manieriert. Hosemann war mit dem Gefühl für das Bürgerliche ein Schilderer der täglichen<br />
Situationen. Und aus eben jenem Gefühl heraus schuf er seine eindrucksvollen<br />
Arbeiten, mit denen er sich bis in unsere Zeit ein Denkmal als Volkskünstler des Berliner<br />
Biedermeier setzen konnte.<br />
Hosemann, der im Zentrum Berlins in der Dorotheenstadt wohnte, fand schnell Anschluß<br />
an die hiesige Künstlerschaft. So trat er dem „Jüngeren Künstlerverein" bei. Dieser<br />
hatte sich neben einem älteren Verein, dessen Gründer Gottfried Schadow war, zusammengefunden.<br />
Für diesen, dem die jüngeren Vertreter der Kunst und wohlhabende<br />
Kunstfreunde angehörten, die sich zu gemeinsamen Studien und geselligen Festen trafen,<br />
schuf Hosemann seine geist- und humorvollen Einladungs- und Tischkarten. Diese Karten,<br />
als deren Erfinder und Schöpfer er gilt, durften bald bei keinem heiteren Festessen<br />
S4
^S@SHPHHH<br />
•nHuaun<br />
flimll MI BUK jn Ol W*» «OS m *# •" fcWg, WWW M »mWjl»<br />
Großes Lentzturnier auf dem Kreutzberge zum 23. Mai 1850 von einer ehrsamen Künstl<br />
Festkarte des Jüngeren Künstlervereins (Federlithographie 52,4 X 43 cm).<br />
Kupferstichkabinett Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz.
fehlen. Bis zu seinem Tode sind sie - auch als Speisekarten - für die verschiedensten<br />
Gesellschaften von ihm immer wieder entworfen worden.<br />
Neben sehr großem Fleiß war es vor allem seine Zuverlässigkeit, die ihm immer neue<br />
Aufträge einbrachte. So war es nicht nur der Verlag von Winckelmann, für den er u. a.<br />
neben vielen Einzelblättern die Illustrationen zu den Jugendschriften des Berliner Schuldirektors<br />
Theodor Dielitz und zu dem „Berliner Bilder-ABC" sowie für „Die kleine<br />
Hausfrau" (erschienen erst 1877) schuf, sondern auch der Verlag von Georg Gropius<br />
schätzte Hosemanns Mitarbeit. Gropius brachte ab 1830 eine Reihe bunter Hefte heraus:<br />
„Berliner Redensarten", „Berliner Parodien", „Berliner Witz und Anekdoten" und<br />
„Tagesbegebenheiten". Als Mitarbeiter für diese Hefte hatte der Verlagsbuchhändler<br />
bereits Johann Gottfried Schadow und Franz Burchard Dörbeck unter Vertrag. Letzterer<br />
schied jedoch schon wenig später aus, so daß der junge Hosemann dessen Platz einnehmen<br />
konnte. Er kopierte, einer Bitte des Verlegers nachkommend, in der Anfangszeit den<br />
wesentlich gröberen Stil Dörbecks. Auch als der Historiker Franz Kugler seine Geschichte<br />
Friedrichs II. illustrieren lassen wollte, dachte er zunächst an Hosemann, ehe der jüngere<br />
Adolph Menzel den Auftrag erhielt. Beide Künstler arbeiteten lithografisch um 1834 zusammen,<br />
wovon z. B. Festkarten des Vereins Berliner Künstler Zeugnis sind. Beide waren<br />
auch Mitglieder des Berliner Sonntagsvereins „Der Tunnel über der Spree". Gemäß der<br />
Satzung, daß dort kein Mitglied unter seinem bürgerlichen Namen auftreten durfte,<br />
führte Menzel das Pseudonym „Rubens", während Hosemann den Namen des englischen<br />
satirischen Zeichners „Hogarth" trug. Obwohl beide, sowohl Hogarth wie auch Hosemann,<br />
das gleiche Grundthema in ihren Arbeiten hatten, etwa: „Der Mensch auf der<br />
Straße und in den Wirtshäusern", ist das Pseudonym für den Deutschen nur bedingt<br />
richtig. Denn: Hosemann war kein Satiriker.<br />
Mögen alle bisherigen Bekanntschaften und Verbindungen positiven Einfluß gehabt<br />
haben, zur wichtigsten Begegnung sollte die mit dem Schriftsteller Adolf Glaßbrenner<br />
werden. Glaßbrenner, 1810 in Berlin geboren, war nach abgebrochener Kaufmannslehre<br />
und frühen schriftstellerischen Arbeiten 1832 Redakteur des Berliner Sonntagsblattes.<br />
Nachdem sein „Don Quijote" von der Regierung verboten worden war, setzte er seine<br />
Plänkeleien gegen diese unter dem Pseudonym „Brennglas" fort. 1830 erschien das erste<br />
einer Reihe von 30 Heften, die er „Berlin, wie es ist und - trinkt" nannte und die bei<br />
Vetter & Rostosky, später bei Ignaz Jackowitz, beide in Leipzig, erschienen. Jedes dieser<br />
Hefte war mit einem, auf Inhalt und Atmosphäre der Texte eingehenden, handkolorierten<br />
Titelbild versehen, von denen auch Hosemann eine Anzahl schuf, so z.B. 1834 für<br />
Heft 6 den „Guckkästner", für Heft 17 von 1847, Heft 29 von 1848 und für das 30.<br />
Heft „1849 im Berliner Guckkasten". Diese Hefte, von denen viele Nachauflagen brachten,<br />
führten die untersten Schichten des Volkes und den Berliner Dialekt in die Literatur<br />
ein. Die Leser waren zunächst Dienstmädchen, Arbeiter und Handwerker - eben die<br />
„kleinen Leute". Hiermit begann sowohl für Hosemann als auch für Glaßbrenner eine<br />
über zwei Jahrzehnte dauernde fruchtbare Zusammenarbeit. So enthielten die 14 Hefte<br />
der Serie „Buntes Berlin" (1837-1852) je zwei Federzeichnungen. „Deutsche Lieder" und<br />
„Deutsches Liederbuch" (beide 1837), „Berliner Erzählungen und Lebensbilder" (1838),<br />
die dreibändige Ausgabe „Berliner Volksleben" (1847-1851), der „Komische Volkskalender"<br />
(1849-1892), ferner zwei Kinderbücher und die „Freien Blätter", von denen 1848,<br />
dem Revolutionsjahr, 56 Nummern herausgegeben wurden, sehen Hosemann ebenfalls<br />
als Mitarbeiter.<br />
86
Theodor Hosemann<br />
Friedrich Wilhelm IV.<br />
in der Theaterloge<br />
Kol. Lithografie<br />
25 X 20 cm<br />
Verwaltung<br />
der Staatlichen<br />
Schlösser und<br />
Gärten, Berlin<br />
Foto: Ellen Brast<br />
Neben den bereits aufgeführten Arbeiten zu den Texten von Glaßhrenner entstand in<br />
den Jahren von 1830 bis ca. 1850 - sie werden als die besten seines Schaffens angesehen<br />
- eine große Zahl von Einzelstücken als Lithografien und auch als Ölbilder, welche uns<br />
eine vortreffliche Chronik des kleinbürgerlich-gemütlichen Berlins des Biedermeier bieten.<br />
Hier seien nur einige Titel aufgeführt: „Der Stralauer Fischzug", „Lumpen-Musikanten",<br />
„Die beiden Maurer", „Die Lumpensammler" und neben vielen anderen auch „Die drei<br />
Sonntagsreiter". Dieses Bild wurde von Hosemann - wie eine größere Anzahl seiner<br />
Arbeiten - in verschiedenen Techniken ausgeführt: in öl auf Leinwand, als Aquarell und<br />
1842 als farbige Lithografie. Es zeigt David Kaiisch, beliebtester Possendichter des<br />
damaligen Berlin, den „langen" Wilhelm Scholz - Zeichner des „Kladderadatsch" - und<br />
den Künstler selbst. Alle drei verband neben einer langjährigen soliden Freundschaft<br />
die gleichgeartete Tätigkeit, obwohl Hosemann nie Illustrationen für diese Zeitschrift<br />
lieferte.<br />
Dank seines großen Einfühlungsvermögens in die zu bebildernden Texte - das Aufspüren<br />
von Charakteristika und anschließende Umsetzen ins Optische - galt er bald als einer<br />
der besten Buchillustratoren. Soll man aus der Vielzahl der Bücher seine wohl reifste<br />
Leistung auswählen, so müssen die 1844 geschaffenen Federzeichnungen zu E.T.A. Hoffmanns<br />
„Gesammelten Schriften" genannt werden. Mit je zwei Federzeichnungen wurde<br />
S7
die zwölfbändige Ausgabe von C. Reimer in Berlin verlegt. Um diese als kongenial empfundenen<br />
kleinen Meisterwerke gruppieren sich - um nur einige zu nennen - die Folgen<br />
zu /. F. W. Zacbariäs „Der Renommist", Münchhausen, Musäus' Volksmärchen, Andersens<br />
Volksmärchen, Immermanns „Das Tulifäntchen" und die 1849 geschaffene Serie zu<br />
dem Erfolgsroman der damaligen Zeit von Eugene Sue „Die Geheimnisse von Paris".<br />
Dieser Text wäre, wie so viele aus jenen Tagen, längst in Vergessenheit geraten, die<br />
Illustrationen Hosemanns verhinderten das.<br />
Schon aus der Zusammenarbeit mit Glaßbrenner ergab sich die Notwendigkeit, zu den<br />
politischen Ereignissen des Jahres 1848 Stellung zu nehmen. Wie viele andere auch stand<br />
er jenen Vorkommnissen positiv gegenüber, ohne sich indessen mit ihnen zu identifizieren.<br />
So fertigte er neben den bereits aufgeführten Arbeiten für die Hefte Glaßbrenners<br />
u. a. noch Federzeichnungen für die „Amtlichen Berichte über die Barrikadenkämpfe",<br />
„Die deutschen Bewegungen im Jahre 1848", sechsunddreißig Holzschnitte und mehrere<br />
Steindruckbeilagen, die in den Düsseldorfer Monatsheften bei Arnz & Co. erschienen,<br />
acht weitere Federzeichnungen für die Serie „Herr Fischer . . .", eine Beilage „Das Heer<br />
der Reaktion" sowie eine Reihe Einzelblätter an.<br />
Aus dieser Aufstellung geht auch hervor, daß Hosemann sich zeit seines Lebens dem<br />
Düsseldorfer Kunstgeschehen als zugehörig betrachtete. Arbeiten, die sonst nur von dort<br />
lebenden Künstlern ausgeführt wurden, beweisen das zumindest bis zum Jahre 1859.<br />
Nach den Begebenheiten des Jahres 1848 und dem Sieg der Reaktion verließ Glaßbrenner<br />
Berlin und ging nach Hamburg. Es scheint heute, als ob mit dem Fortgang des<br />
Freundes auch der progressive Elan Hosemanns versiegte.<br />
Darüber hinaus hat sich Hosemann seine sozial-kritische Einstellung auch im Alter bewahrt,<br />
doch besaß diese von Anfang an eher freundliche und rührend-menschliche<br />
Züge. Im Gegensatz zu seinem späteren Schüler Heinrich Zille, der stets zu den Menschen<br />
seines „Milljöhs" gehörte und auch im Alter nicht der bürgerlichen Gefälligkeit<br />
erlag - ja, noch kompromißloser anklagte - stand Hosemann neben dem Volk, zeigte er<br />
sich duldsamer und konzilianter.<br />
Im Lauf der Jahre kamen auch die Ehrungen.<br />
Eine Anekdote weiß folgendes zu berichten: Hosemann gab 1857 dem Prinzen Georg<br />
von Preußen Zeichenunterricht und wurde von diesem stets mit „Herr Professor" tituliert.<br />
Als der Künstler auf den Irrtum aufmerksam machte, entgegnete der Prinz, daß<br />
das ein Fehler sei, der korrigiert werden müsse. Bald danach erhielt Hosemann eine<br />
Professur, die ihm noch jährlich 500 Taler einbrachte. 1860 wurde er zum Mitglied der<br />
Akademie der Künste ernannt und erhielt sechs Jahre später die Stelle eines Zeichenlehrers<br />
an der zur Akademie gehörenden allgemeinen Zeichenschule. Ruhe, Bescheidenheit<br />
und Geduld verhalfen ihm zu großer Beliebtheit bei seinen Schülern. Zu ihnen gehörte<br />
dann ab 1874 auch der junge Heinrich Zille, dessen Fähigkeiten Hosemann schnell<br />
erkannte und förderte.<br />
Schon in seinen letzten Lebensjahren war Hosemann gleich anderen Künstlern dieses<br />
Genres in Vergessenheit geraten.<br />
Sein Tod fand in der zeitgenössischen Presse nur teilweise kurze Erwähnung. Er ruht<br />
neben seiner zweiten Frau Bertha Heimbs auf dem Sophienfriedhof an der Bergstraße.<br />
Sein Andenken ehrt die Hosemannstraße im Bezirk Prenzlauer Berg. Nicht nur von<br />
Kennern dieser Art von „Kleinkunst" geschätzt, erfreut sich das Werk dieses hervorragenden<br />
Illustrators der B
Theodor Hosemann<br />
Die Pfaueninsel<br />
bei Sacrow<br />
(1869)<br />
Aquarell, 22,5 X 15 cm<br />
Verwaltung<br />
der Staatlichen<br />
Schlösser und<br />
Gärten, Berlin<br />
Foto: Ellen Brast<br />
Zur Zeit findet im Haus am Lützowplatz mit Unterstützung des Senators für Wissenschaft<br />
und Kunst die Ausstellung „Druckgraphische Arbeiten von Theodor Hosemann"<br />
statt, die noch bis zum 19. Oktober besucht werden kann. Die zahlreichen Exponate, die<br />
von Museen, Vereinen - auch unser Verein ist vertreten - und privaten Sammlern als<br />
Leihgaben zur Verfügung gestellt wurden, vermitteln dem Besucher eine recht umfassende<br />
Übersicht vom Schaffen des Künstlers. Der großformatige Katalog (18 DM) ist<br />
reich bebildert. In ihm wird auch die Vorbereitung eines ausführlichen Werkverzeichnisses<br />
angezeigt.<br />
Eine Nachfrage beim Märkischen Museum, ob und wann eine Hosemann-Ausstellung geplant<br />
sei, und ob im Zusammenhang mit einer eventuellen Ausstellung ein Katalog herausgegeben<br />
wird, ergab keine definitive Antwort.<br />
89
Literaturhinweise<br />
Hans Weinitz: Theodor Hosemann. Berlin: Sdiriften des Vereins für die Gesdiichte Berlins 1897,<br />
Heft XXXIX.<br />
Lothar Brieger: Theodor Hosemann. Mit einem Katalog der graph. Werke von Karl Hobrecker.<br />
München: Delphin-Verlag 1920.<br />
Lothar Brieger: Theodor Hosemann. Der Maler des Berliner Volkes. München o. J., Delphin-<br />
Verlag. (Kleine Delphin Kunstbücher, Bd. 18.)<br />
Paul Hörn: Düsseldorfer Graphik in alter und neuer Zeit. Düsseldorf 1928. Verlag des Kunstvereins<br />
für die Rheinlande und Westfalen. (Schriften des Städtischen Kunstmuseums Düsseldorf,<br />
Bd. II.)<br />
Paul Weiglin: Berliner Biedermeier. Bielefeld u. Leipzig: Velhagen und Klasing 1942.<br />
Hans Ostwald: Kultur- und Sittengeschichte Berlins. Berlin o. J. Verlagsanstalt Hermann<br />
Klemm KG.<br />
Ernst Heilborn: Zwischen zwei Revolutionen. Berlin: Wegweiser Verlag 1927.<br />
Ernst Dronke: Berlin. Hrsg. v. Rainer Nitsche. Darmstadt/Neuwied: Luchterhand 1974. (Samml.<br />
Luchterhand, 156.)<br />
Georg Hermann: Theodor Hosemann. Braunschweig: Verlag Westermann 1909. (Westermanns<br />
Monatshefte 53. Jahrgang, Bd. 105, II, Heft 628.)<br />
Horst Kunze: Schatzbehalter. Vom Besten aus der älteren deutschen Kinderliteratur. Berlin(Ost):<br />
Kinderbuchverlag 1969.<br />
Gerhard Kapitän: Die Politische Graphik Theodor Hosemanns. Dresden: VEB Verlag der Kunst<br />
1955. (Das kleine Kunstheft.)<br />
Irmgard Wirth: Theodor Hosemann. Maler und Illustrator im alten Berlin (Ausstellungskatalog).<br />
Berlin 1967. 7. Veröffentlichung des Berlin-Museums. [Anmerkungen über diese Ausstellung<br />
in: Mitteilungen d. Vereins f. d. Gesch. Berlins, 64. Jahrgang, 1968, Nr. 11, S. 140 ff.]<br />
Hans Ludwig: Theodor Hosemann. München: Rogner u. Bernhard 1974. (Klassiker der Karikatur,<br />
Bd. 9.)<br />
Ulrich Thieme, Felix Becker: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Bd. 17. Hrsg. v. Hans<br />
Vollmer. Leipzig: Verlag E.A.Seemann 1924.<br />
Wann fuhr der erste Omnibus in Berlin?<br />
Eine verkehrsgeschichtliche Studie<br />
Von Arne Hengsbach<br />
In allen Veröffentlichungen, die sich mit der Entstehung und Entwicklung der Berliner<br />
Nahverkehrsmittel beschäftigen, wird angegeben, der Omnibusverkehr sei hier im Jahre<br />
1846 mit 5 Linien aufgenommen worden. Auch die sonst außerordentlich gewissenhafte<br />
und umfassende Arbeit Carl Dietericis „Geschichtliche und statistische Mitteilungen über<br />
das öffentliche Fuhrwesen in Berlin", 1865 in der „Zeitschrift des Königl. Preußischen<br />
Statistischen Bureaus" erschienen, die die Akten des seinerzeit für die Bearbeitung von<br />
Verkehrsangelegenheiten allein zuständigen Polizeipräsidiums auswertete und noch heute<br />
die einzige zuverlässige Quelle für die Vor- und Frühgeschichte des Berliner öffentlichen<br />
Nahverkehrs darstellt, bemerkt: „Das Unternehmen wurde mit 20 Wagen und 120<br />
Pferden noch 1846 eröffnet." Die „ABOAG"-Festschrift von 1928, die maßgebliche<br />
Omnibuschronik Berlins, berichtet ebenfalls, der Betrieb sei Ende des Jahres 1846 eröffnet<br />
worden.<br />
Tatsächlich hat aber die Anfangszeit des Berliner Omnibuswesens später begonnen. Die<br />
wenigen Berichte und Anzeigen, die in der „Vossischen Zeitung" Ende 1846 und im<br />
90
donc. ^Berliner Dmnibu^dom^).<br />
SßCHTt 1. Oktober C. üb, werben unfere 53agcn nie folgt<br />
ceurftrrn.<br />
Die ©tftC (grütic) 2t«ic lüirt ftatt beim -^) of i5
Von beiden Endpunkten, welche später noch weiterhin ausgedehnt werden sollen, wird<br />
präcise jede V4 Stunde ein Omnibus abfahren - im Winter von 8 Uhr Morgens an bis<br />
9 Uhr Abends zuletzt, im Sommer von 7 Uhr Morgens an bis 9 l fa Uhr Abends zuletzt.<br />
Jeder Wagen wird Abends gut erleuchtet sein. Jeder anständig und reinlich Gekleidete,<br />
welcher irgendwo auf der ganzen Tour einzusteigen wünscht, braucht nur dem Condukteur,<br />
welcher hinten auf dem Wagen steht, oder dem Kutscher ein Zeichen zu geben, um<br />
den Wagen halten zu lassen und aufgenommen zu werden. Ist der Wagen im Innern<br />
vollständig besetzt, so wird dies durch Aufsteckung einer Fahne hinten am Wagen angezeigt.<br />
Ebenso kann jeder Fahrgast, der auszusteigen wünscht, halten lassen, wann und<br />
wo er es verlangt. Jedoch sind die Condukteure angewiesen, keinen Betrunkenen, keinen<br />
unreinlich Gekleideten, welcher die übrigen Fahrgäste belästigen würde, keinen Fahrgast<br />
mit größeren Packeten, welche andere genieren würden, einzunehmen. Ebenso wenig<br />
dürfen sie leiden, daß im Innern des Wagens geraucht und laut gesungen werde, auch<br />
dürfen keine Hunde mit in den Wagen gebracht werden. Der Preis ist für die Person auf<br />
2 Silbergroschen pro Fahrt angesetzt, mag man nun die ganze Tour oder nur einen Theil<br />
derselben fahren. Kinder unter 4 Jahren, welche keinen besonderen Platz einnehmen,<br />
sondern auf dem Schöße Erwachsener sitzen, sind frei. Gegenstände, welche in dem<br />
Wagen liegen geblieben sind, können im Laufe des Tages bei den Inspektoren auf dem<br />
Bureau an den resp. Endpunkten jeder Linie reklamiert werden. Später bitten wir diese<br />
Gegenstände im Haupt-Büreau, Dorotheenstraße No. 12 parterre, wo überhaupt jede<br />
gewünschte Auskunft ertheilt wird, oder bei dem Herrn Polizei-Commissarius Aschoff<br />
abzufordern . . . Dagegen werden wir Alles aufbieten, dem hochgeehrten Publikum eine<br />
recht anständige, bequeme und häufige Fahrgelegenheit zu verschaffen und bitten zu<br />
berücksichtigen, daß bei der kurz zugemessenen Zeit - wir erhielten die Concession erst<br />
vor 2 Monaten - es nicht möglich war, alle Linien auf einmal in Gang zu bringen. Es<br />
wird aber thätig daran gearbeitet, dies in kürzester Frist zu bewerkstelligen, und sobald<br />
sämmtliche Linien aufgestellt sind, sollen Correspondenzfahrten zu noch größerer Bequemlichkeit<br />
des Publikums eingerichtet werden. - Die Wagen dieser ersten Linie werden<br />
grüne Farbe erhalten und so wird jede Linie ihre besondere Farbe haben. - Unsere Leute<br />
sind strenge angewiesen, sich stets höflich und zuvorkommend gegen Jedermann zu betragen.<br />
- Allen und besonders Damen, Kindern und ältlichen Leuten beim Ein- und<br />
Aussteigen behülflich zu sein. Etwaige Contraventionen derselben oder sotistige Beschwerden<br />
bitten wir mit der Adresse des Beschwerdeführers in das zu diesem Zwecke<br />
bei den Inspektoren an den resp. Endpunkten jeder Linie niedergelegte Buch einzutragen,<br />
worauf erforderlichen Falls sogleich Genugthuung erfolgen wird."<br />
In ihrer Ausführlichkeit bietet diese Anzeige eine anschauliche Darstellung des frühen<br />
Berliner Omnibuswesens. Zur Erläuterung sei hinzugefügt, daß der „Condukteur" unserem<br />
heutigen „Schaffner" entsprach. Unter den in Aussicht gestellten „Correspondenzfahrten"<br />
verstand man damals Fahrten, bei denen man mit einem Umsteigefahrschein<br />
vom Wagen der einen auf den einer anderen übergehen konnte. Dergleichen „Correspondenzeinrichtungen",<br />
wie sie hier angedeutet wurden, wurden des öfteren erörtert,<br />
aber erst in den Jahren 1865-67 vorübergehend eingeführt und dann wieder aufgegeben.<br />
Die Kennzeichnung der einzelnen Linien durch verschiedenfarbige Schilder und farbige<br />
Gläser vor den Laternen in den Abendstunden waren bei den Pferdeomnibussen Berlins<br />
wenigstens seit 1866 üblich, und auch die Pferdebahnen haben später dieses Orientierungssystem<br />
farbiger Schilder und Lampen übernommen. Die Kenntlichmachung einer<br />
42
Linie durch einheitlichen Anstrich der auf ihr eingesetzten Fahrzeuge ist eine frühe<br />
Variante, die in einigen anderen Städten Parallelen hatte.<br />
Das Endziel der Linie, das „Odeum", war eines der besuchtesten Ausflugs- und Vergnügungslokale<br />
am Südrande des Tiergartens, das sich von der Tiergartenstraße bis<br />
zum Schaf- oder Landwehrgraben, aus dem bald der Landwehrkanal hervorgehen sollte,<br />
erstreckte. Es hatte ein eigenes „Gashaus", dessen Einrichtung 200 „Flammen" versorgte,<br />
und lag zwischen der nachmaligen Hildebrand- und Graf-Spee-Straße. Im Laufe des<br />
Frühjahres 1847 wurde die Linie um etwa 500 Meter bis zum „Hofjäger"-Etablissement,<br />
einem ebenfalls stark besuchten Ausflugs- und Konzertlokal, verlängert, das an<br />
der Ecke Klingelhöfer- und Tiergartenstraße gestanden hat. Mit dieser Tiergartenlinie,<br />
die den Ausflugsverkehr zu den zahlreichen Ausflugs- und Tanzlokalen am Rande des<br />
Tiergartens erleichterte, wurde auch der 1844 neu angelegte Zoologische Garten, dessen<br />
Eingang sich damals südlich der früheren Lichtensteinbrücke befand, einigermaßen verkehrsgünstig<br />
erschlossen. Vom „Hof jäger" bis zum Zoo-Eingang hatten die Besucher nun<br />
nur noch etwa 800 m Fußweg zurückzulegen, und der Vorstand des Zoologischen Gartens<br />
bemerkt denn auch in einer am 3. Mai 1847 veröffentlichten Anzeige: „Der Besuch des<br />
Gartens hat durch neue Mittel des Verkehrs mancherlei Erleichterungen erfahren."<br />
Wie sehr die Frequenz der Linie vom Ausflugsverkehr zum Tiergarten abhängig war,<br />
beweist auch, daß mit Eintritt der kälteren Jahreszeit der Endpunkt wieder zum<br />
„Odeum" zurückgenommen wurde. Aber auch im Winter wurde der Omnibus zum<br />
Zwecke der Erholung und des „Vergnügens", wie man damals sagte, benutzt, und so<br />
teilte die „Vossische Zeitung" am 25. Januar 1847 mit, daß zu den Eisbahnen auf den<br />
Teichen im Zoo und auf dem Landwehrgraben die Omnibusse „bequeme Communicationsmittel"<br />
bildeten.<br />
Am 27. März 1847 brachte die Zeitung folgende Notiz:<br />
„Mit dem 1. April c. wird nunmehr die zweite Fahrlinie für die Omnibus eröffnet<br />
werden. Dieselbe wird von der Brückenstraße ausgehen, die Stralauer, Gertrauten und<br />
Leipziger Straße berühren und am Bahnhof der Berlin-Magdeburger Eisenbahn enden."<br />
Von dieser Linie, die in ihrer Führung zum großen Teil der einer 1846 geplanten entsprach,<br />
ist dann nicht mehr die Rede; am 22. Mai veröffentlichte die „Concessionirte<br />
Berliner Omnibus-Compagnie" nachstehende Anzeige:<br />
„Mit Bewilligung der Behörde wird unsere zweite Omnibus-Linie vom 22. d. Mts. an in<br />
Alt-Schöneberg bei Herrn Hunkel im Gasthof zum Schwarzen Adler beginnen und am<br />
Spittelmarkt endigen, von welcher Änderung wir das geehrte Publikum in Kenntnis<br />
setzen."<br />
Vom 24. Juni an fuhren die Wagen dieser „zweiten Linie" vom Molkenmarkt ab nach<br />
Schöneberg, aber diese Erweiterung mag nicht lange bestanden haben, da Ende September<br />
als Endpunkt wieder der Spittelmarkt genannt wird. Zusammenhänge zu konstruieren,<br />
wo die Beweislage dürftig bleibt, ist immer mißlich, aber auffällig wirkt doch, daß<br />
die Linie nur wenige Tage nach der Eröffnung des neuerbauten Schöneberger Sommertheaters<br />
im „Schwarzen Adler" nach Schöneberg verlegt wurde. Schöneberg war zu<br />
jener Zeit noch Sommerfrische für die Berliner Familien, die hier „Sommerwohnungen"<br />
mieteten. Die Frequenz des sommerlichen Ausflugs- und Erholungsverkehrs konnte<br />
durchaus Verstärkung finden durch die Besucher des Schöneberger Sommertheaters, das<br />
Lustspiele, Possen, Schwanke, Vaudeville-Szenen usw. bot. Auch diese Linie wurde am<br />
1. Oktober verkürzt, sie verkehrte nun nur noch zwischen Spittelmarkt und dem Karls-<br />
n
ad Ecke Potsdamer Straße. Da diese Linie einmal als die „rote" bezeichnet wird, darf<br />
man annehmen, daß die auf ihr fahrenden Wagen roten Anstrich hatten. Die Fahrabstände<br />
auf den beiden hier genannte Linien müssen übrigens Änderungen erlitten<br />
haben, denn die „Omnibus-Compagnie" machte am 1. September dem „verehrlichen<br />
Publikum die ergebene Anzeige, daß . .. unsere Wagen nach dem Hofjäger und nach<br />
Schöneberg wieder alle 15 Minuten von einem Endpunkt zum andern abgehen werden".<br />
Die dritte Linie, Unter den Linden, Akademie-Gebäude—Charlottenburg wurde am<br />
1. Mai 1847 in Betrieb genommen. Die Fuhrherren, die Jahrzehnte hindurch unangefochten<br />
den nicht unbeträchtlichen Ausflugs- und Vergnügungsverkehr zwischen Berlin<br />
und Charlottenburg mit ihren am Brandenburger Tor aufgestellten Torwagen und<br />
Kremsern bedient hatten, erblickten in dem neu hinzukommenden Omnibus eine unliebsame<br />
Konkurrenz und führten beim Ministerium Beschwerde über den unangenehmen<br />
Wettbewerber. Das Polizei-Präsidium mußte daraufhin „den öffentlichen Thorfuhrwerken<br />
und Kremserwagen" am 31. Juli gestatten, so wie die Omnibusse unterwegs anzuhalten,<br />
um „Personen, welche die Mitfahrt begehren, gegen das tarifmäßige Fahrgeld<br />
aufzunehmen, sofern das Fuhrwerk noch nicht mit der vorgeschriebenen Personenzahl<br />
besetzt ist". Nach einer Anzeige der „Omnibus-Compagnie" vom 20. September 1847<br />
betrug der Fahrpreis für die Charlottenburger Linie „unverändert 3 Silbergroschen",<br />
die Linie endete in Charlottenburg zu diesem Zeitpunkt „beim Enkesdien Cafe-Hause".<br />
Eine besondere Farbe wird für diese Linie nicht mehr erwähnt, genausowenig für die<br />
vierte, am 9. Oktober eröffnete Linie. Die „Omnibus-Compagnie" benachrichtigte das<br />
Publikum,<br />
„daß die vierte Omnibus-Linie zwischen dem Halleschen Thor und der Chausseestraße<br />
bis zum Liesenschen Etablissement am künftigen Sonnabend Morgens 8 Uhr eröffnet<br />
und viertelstündlich bis Abends 9 Uhr befahren wird. Der Preis beträgt für die Person<br />
und den Cours 2 Sgr."<br />
Diese Linie, die im Zuge der Friedrich- und Chausseestraße Berlin von Süden nach Norden<br />
durchschnitt, hat, mit zeitweiligen Verlängerungen bis zum Kreuzberg und bis zum<br />
Wedding hin und späteren Verkürzungen wieder zu den alten Endpunkten, Jahrzehnte<br />
hindurch bestanden. Auch in ihrem Bereich lagen viel besuchte Gartenlokale, so im Norden<br />
das Liesensche, an dessen einstige Lage die Liesenstraße erinnert, während südlich<br />
des Halleschen Tores am Kreuzberg das berühmte „Tivoli" mit seiner Rutschbahn und<br />
den großen Feuerwerken Hauptanziehungspunkt war. Auf der Linie Hallesches Tor-<br />
Chausseestraße Ecke Liesenstraße wurden übrigens am 19. November 1905 die ersten<br />
Autobusse eingesetzt.<br />
Von einer fünften Linie, die das Polizeipräsidium 1846 Dr. Freyberg konzessioniert<br />
hatte und die vom Anhalter Bahnhof über den Hackeschen Markt nach dem Schönhauser<br />
Tor führen sollte, verlautet nichts in der Zeitung. In den Statistiken, die Dieterici mitteilt,<br />
ist allerdings in den Jahren 1848 und 1849 die Zahl von 5 Linien aufgeführt. Erst<br />
im Jahre 1850 ist diese Linie belegt, sie sollte vom 1. Mai ab vom Anhalter Tor über<br />
den Schloßplatz und durch die Schönhauser Allee bis nach Pankow geführt werden. In<br />
dem Löwenbergsdien Führer „Der Fremde in Berlin und Potsdam" vom gleichen Jahre<br />
endete die Linie allerdings bereits am Oest'sdien Lokal in der Sdiönhauser Allee, das<br />
in der Gegend südlich des heutigen Ringbahnhofes gelegen hat. Auch diese Linie brachte<br />
einige größere, beliebte volkstümliche Garten- und Tanzlokale den Berliner Besuchern<br />
näher.<br />
44
Die Vossische Zeitung bringt dann noch einige Nachrichten über den Gründer der „Concessionirten<br />
Berliner Omnibus-Compagnie", Dr. phil. Eduard Freyberg; Ende 1847 hatte<br />
sich dieser in das Ausland abgesetzt, es wurde nach ihm gefahndet; die Zeitung vermutete,<br />
daß sich die Anschuldigungen gegen Freyberg „auf die finanziellen Verhältnisse des<br />
Omnibus-Fuhrwesens" bezögen. Tatsächlich teilten zwei Condukteure in einer längeren<br />
Anzeige vom 29. Januar 1848 dem Polizeipräsidium mit, daß nach Angaben des Mitgesellschafters<br />
Elwanger Dr. Freyberg ihre Kautionen aus der Geschäftskasse entnommen<br />
und nicht wieder zurückgegeben habe. In damaliger Zeit mußten die Schaffner beim<br />
Dienstantritt dem Unternehmer eine Kaution hinterlegen, aus der dieser sich befriedigen<br />
konnte, wenn der Schaffner bei Fahrgeldunterschlagungen, die bei dem Fehlen von Kontrollmöglichkeiten<br />
- es wurden z. B. keine Fahrscheine ausgegeben - immerhin möglich<br />
waren, ertappt wurde. Im Februar 1848 kehrte Freyberg nach Berlin zurück und stellte<br />
sich dem Polizeipräsidenten, er wurde Anfang März aber aus der Hausvogtei entlassen,<br />
da sich die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen als unbegründet erwiesen hätten.<br />
Wenige Tage später begann die Revolution in Berlin; in diesen erregten, die Bevölkerung<br />
aufwühlenden Zeiten mit ihren Straßenkämpfen, Demonstrationen, Versammlungen<br />
usw. hatten die Zeitungen wahrlich über andere Themen als über Omnibuslinien zu<br />
berichten. Aus anderen Quellen wissen wir, daß damals Omnibuswagen umgestürzt und<br />
mit zum Bau von Barrikaden verwendet wurden. Die ideologischen Auseinandersetzungen<br />
von einer zuvor nie gekannten Schärfe und Aggressivität waren der wirtschaftlichen<br />
Entwicklung eines Verkehrsinstituts, das seine Haupteinkünfte dem Ausflugs- und Vergnügungsverkehr<br />
zu Gartenrestaurants in der Umgebung und die übrigen Einnahmen<br />
einem bescheidenen Besorgungs- und Besuchsverkehr verdankte, nicht gerade günstig.<br />
Erschwerend kamen hinzu die Beschädigung oder Zerstörung eines Teils der Betriebsmittel<br />
und die wohl doch unzulängliche Geschäftsführung Freybergs. Seine Gründung ging<br />
unter. Nach Dieterici „wurde das vorhandene Inventar von einem der früheren Gesellschafter,<br />
auf den die Concession sich mit bezog, aus der Concursmasse erworben". Der<br />
Erwerber war der „Amtmann" C. L. Elwanger (diese Berufsbezeichnung hatten Landwirte,<br />
die größere Flächen, meist pachtweise, bewirtschafteten), der zum ersten Male in<br />
einer Anzeige vom Oktober 1847 als Mitgesellschafter der Freybergschen „Omnibus-<br />
Compagnie" in Erscheinung trat.<br />
Nach dem „Wohnungsanzeiger für Berlin" von 1850 war Elwanger am 1. April nach<br />
dem Hause Dorotheenstraße 12, in dem sich auch das Büro der „Berliner Omnibus-<br />
Compagnie" befunden hatte, gezogen. In den Wohnungsanzeigern für die Jahre 1850<br />
und 1851 ist die „Omnibus-Compagnie" unter ihrer alten Adresse noch angeführt, danach<br />
wird sie nicht mehr erwähnt. Elwanger wird seit dem Wohnungsanzeiger für 1851<br />
als „Amtmann und Omnibusbesitzer" aufgeführt; im Branchenteil dieses Adreßbuches ist<br />
er später auch unter den Fuhrunternehmern mit dem Zusatz „(Omnibus)" verzeichnet.<br />
Die Stallungen des verunglückten Freybergschen Unternehmens hatten sich von dem<br />
Grundstück Dorotheenstraße 12, das auf deren Nordseite gegenüber der Einmündung<br />
der Charlottenstraße lag, bis zur Georgenstraße 32 hin erstreckt. Dieses nunmehr Elwangersche<br />
Omnibusdepot wurde noch von der 1865 begründeten „Berliner Omnibus-<br />
Gesellschaft, Kommandit-Gesellschaft auf Aktien G. Busch und S. Rosenberg" für ihren<br />
Verkehr benutzt.<br />
In welchem Umfange Elwanger 1848/49 den Betrieb durchzuführen in der Lage war,<br />
ist nicht bekannt; nach der Statistik war die Zahl der Fahrzeuge, die ursprünglich 20<br />
n
etragen hatte, 1849 auf 14 zurückgegangen. Daß das Elwangersche Unternehmen nur<br />
in einem beschränkten Umfange weitergeführt werden konnte, ergibt sich u. a. aus<br />
einer Anzeige vom 9. Januar 1850:<br />
„Omnibusfahrten, Oranienburger - Hallesches Thor (Friedrichstraße). Vom 14. d. M.<br />
von Morgens 9 Uhr bis Abends 8 Uhr stündlich. Abfahrt Unter den Linden C?VL> Morgens,<br />
Ende 8 , /2 Uhr Abends."<br />
Mit der Beruhigung des politischen Lebens und der Rückkehr geordneter Verhältnisse<br />
erholte sich auch das Berliner Omnibuswesen wieder. Auf der Omnibuslinie vom Oranienburger<br />
zum Halleschen Tor wurde der Verkehr vom 1. März 1850 ab im 30-Minuten-Abstand<br />
und, wie es scheint, auf der erweiterten Strecke von Liesens Lokal an der<br />
Chausseestraße bis zum „Düsteren Keller" an der Bergmannstraße aufgenommen. Im<br />
Laufe des Jahres kamen dann wieder alle bereits von Freyberg betriebenen Linien sowie<br />
die erwähnte fünfte vom Anhalter Tor bis zur Schönhauser Allee in Gang; dazu trat im<br />
Mai noch eine sechste vom Lustgarten über das Neue Tor nach Moabit. Von nun an<br />
setzte zwar langsam, aber doch stetig eine gedeihlichere Entwicklung im Berliner Omnibusverkehr<br />
ein; die Zahl der Unternehmen, der Linien und der Fahrzeuge nahm allmählich<br />
zu.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 31, Joachim-Friedrich-Straße 2<br />
Zum Gedenken an die Berliner Schauspielerin Jeannette Bethge<br />
(1875-1943)<br />
Von Käte Funk-Bonardel<br />
Aimee Jeannette Bethge entstammte mütterlicherseits einer alten Berliner Theaterfamilie.<br />
Ihre Großmutter Henriette Lachmann, aus Bromberg gebürtig, war Sängerin und Schauspielerin;<br />
im Jahre 1837 heiratete sie während einer Tournee in Posen den Berliner<br />
Schauspieler Adolph Bethge (* 1810), dessen Vater auch schon 36 Jahre lang Theater gespielt<br />
hatte.<br />
Das erste Kind aus dieser Ehe war Jeannette Bertha, die Mutter Aimee Jeannettes. Sie<br />
wurde durch Vater Adolph schon als Kind ausgebildet und auf die Bühne der „Königlichen<br />
Schauspiele" gestellt - was den Intendanten Graf von Hülsen nachhaltig verdroß,<br />
denn nach ihr erklommen noch weitere drei kindliche Geschwister Bethge, von Adolph<br />
gestützt und geschoben, die geheiligten Bretter.<br />
Aimee Jeannette wurde am 24. April 1875 als drittes und letztes Kind der seit vier<br />
Jahren verwitweten Jeannette Bertha geboren. Diese war mit dem Hugenottenenkel<br />
Carl Eduard Bonardel (1807-1871) verheiratet gewesen, der sich, als Sohn eines Drechslermeisters,<br />
vom Uhrmacherlehrling zum Fabrikbesitzer emporgearbeitet hatte. Nach<br />
seinem Tode war sie eng befreundet mit dem Rittergutsbesitzer und vereideten Fondsmakler<br />
Jean Guillaume Bertrand (* 1836), der Jeannettes Vater wurde. Auch Bertrand<br />
gehörte der Berliner französischen Kolonie an; seine Vorfahren, überwiegend Kaufleute,<br />
zählten zu den Honoratioren in der preußischen Metropole und seinen Großvater Jean<br />
U
Jeannette Bethge<br />
(1754-1822) finden wir sogar als Direktor des französischen Waisenhauses in der Charlotten-,<br />
Ecke Jägerstraße. Bertrand blieb Jeannettes Vormund, bis sie, fünfzehnjährig,<br />
von ihrem Onkel, dem Königlichen Garten-Intendantur-Sekretär Alexander Bethge in<br />
Sanssouci adoptiert wurde.<br />
Wahrscheinlich entdeckte man um diese Zeit ihre Begabung und wollte dem alten Theaternamen<br />
Bethge zu frischem Glanz verhelfen. Dies gelang über Erwarten gut. In jungen<br />
Jahren spielte Jeannette in jenen Gegenden und Städten, die man als „Provinz" zu bezeichnen<br />
pflegt. Sie war in Bremen, Breslau, Görlitz, Bromberg, Hannover und Wiesbaden<br />
engagiert. Seit 1911 lebte sie in Berlin-Steglitz. Mit nur kurzen Unterbrechungen<br />
war sie daraufhin an verschiedenen Berliner Theatern beschäftigt; dazu gehörten in<br />
erster Linie Schiller- und Schloßpark-Theater, Deutsches Theater, Volksbühne, Central-<br />
Theater, Theater in der Klosterstraße, Thalia-Theater, Wallner-Theater, Renaissance-<br />
Theater, die Kammerspiele des Deutschen Theaters und gelegentlich die Freie Volksbühne<br />
in Oranienburg.<br />
Sie hatte Engagements bei Max Reinhardt und Heinz Hilpert und lernte zum Schluß<br />
auch den damals jungen Boleslaw Barlog kennen, der sich noch „liebevoll an sein Jeannettchen"<br />
erinnert. Zur Weihnachtszeit wurde sie begeistert als „Märchentante" begrüßt<br />
von einem Haus voll kleiner und großer Kinder, und schließlich war sie eine erfolgreiche<br />
„komische Alte" in vielen Variationen. Sie schien auf dieses Rollenfach festgelegt, profitierte<br />
aber auch gleichzeitig von dieser Art Monopolstellung, denn irgendeine Inszenierung<br />
an einer der vielen Bühnen Berlins verlangte bestimmt jederzeit nach ihrem Typ.<br />
Nur so ist ihr häufiger Engagementswechsel von Spielzeit zu Spielzeit zu erklären, der<br />
97
gewiß nichts mit Unstetigkeit zu tun hat. Ober ihre Leistungen, ihre Qualitäten wissen<br />
wir leider nichts Näheres, daß sie aber - auf ihre Weise - Erfolg hatte, ist anzunehmen,<br />
wenngleich sie keine „große" Schauspielerin im herkömmlichen Sinn war.<br />
Persönliche Erinnerungen sowie die zielsichere Überlieferung der Episoden lassen uns<br />
jedoch das Bild plastischer erscheinen. So gehörte Jeannette unter anderem auch zum Ensemble<br />
der Agnes Straub, das mit dem äußerst zugkräftigen Stück „Die Schauspielerin"<br />
auf Tournee ging. Die Straub - enorm kurzsichtig - fuhr, um einem Lastwagen auszuweichen,<br />
direkt in ein Scheunentor hinein. (Wenn ich mich richtig erinnere, stand sie<br />
später mit einem eingegipsten Arm wieder in Berlin auf der Bühne.) Kurt von Ruffin,<br />
damals einer von Jeannettes jüngsten Kollegen, erzählte mir sehr anschaulich, wie Jeannette<br />
gefaßt und kaltblütig - ihr war nichts passiert - sofort ausstieg und die Leichtverletzten<br />
umhertrieb, damit sie durch Bewegung den Schock überwänden; auch labte sie<br />
alle Betroffenen mit Cognac, „um die Wunden zu spülen".<br />
Auch Film und Tonfilm holten sich Jeannette Bethge; sie spielte in „Sophienlund", in<br />
„Das Mädchen vom Moorhof", in „Johannisfeuer" (nach Hermann Sudermann) als „betuliche<br />
Mamsell" und im „Veilchen vom Potsdamer Platz" mit Rotraut Richter in der<br />
Hauptrolle. Die so jung Verstorbene wohnte Jeannette gegenüber in der damaligen Lindenstraße<br />
(heute Leydenallee) in Steglitz und kam manchmal zu einer Plauder- oder<br />
Unterrichtsstunde.<br />
Privat war Jeannette Bethge eine herzensgute, mütterliche und humorvolle Frau, bescheiden<br />
und resolut zugleich, die unverheiratet blieb. Sie teilte ihr ganzes Leben (soweit<br />
es nicht vom Theater beherrscht wurde), ihre Wohnung und auch ihre Gagen mit zahlreichen<br />
Verwandten und wurde von der ganzen Familie geliebt und bewundert. Sie<br />
machte jeden Jux mit und ließ uns freigebig in ihrem „Schrankzimmer" wühlen, wenn<br />
wir für unsere Theaterspielereien Garderobe brauchten. Zu Familienfesten, Hochzeiten<br />
usw. studierte sie mit uns kleine Sketches und Szenen und machte das so temperamentvoll,<br />
daß ein Besucher schon auf dem ziegelgepflasterten Hofgang mit den Quittenbäumen<br />
auf den Zehenspitzen umkehrte ohne zu klingeln, um dem vermeintlichen Familienkrach<br />
auszuweichen.<br />
Solches widerfuhr zweifellos einem unangemeldeten Besuch, denn während ihrer offiziellen<br />
Kaffeegesellschaften fanden keine Familien-Theaterproben statt. An diesen gemütlichen<br />
Nachmittagen saßen mehr oder minder illustre Gäste am schöngedeckten Tisch:<br />
adlige Kolleginnen - vermutlich Außenseiter ihrer Familien - mit rollendem Zungen-R<br />
und Königin-Mutter-Allüren, alte Theaterhasen, die ihr mit pathetischer Grandezza die<br />
Hand küßten, sowie alle möglichen Leute, die nicht mehr oder noch nicht ganz dazugehörten.<br />
Während der ersten Hitlerjahre wurden an „Muhmes" Kaffeetafel neben Bühnenanekdoten<br />
auch jüdische Witze zum besten gegeben; dann wurden einige der Kollegen stiller<br />
und kamen seltener, und wenn es ihnen nicht gelang, nichtarische Ahnen unter den Tisch<br />
fallen zu lassen, hörte man eines Tages nichts mehr von ihnen. Jeannette brauchte nur<br />
ihre Großmutter Lachmann zu verschweigen. Sie erboste sich über das Regime und war<br />
tief bekümmert über das vielfältige Leid ihrer Freunde und Kollegen. Sie half mit Rat<br />
und Tat, wo sie nur konnte.<br />
So gewissenhaft und zuverlässig Jeannette ihre kleinen und größeren Rollen mit ihrer<br />
Persönlichkeit füllte, so charmant und liebenswürdig sie bei Tisch präsidierte, so unpraktisch<br />
und nervös war sie bei alltäglichen Verrichtungen, obwohl sie wunderbar zu kochen<br />
9(8
und zu backen verstand. Was für ein Durcheinander noch eine halbe Stunde vor der<br />
Ankunft von Gästen im Hause Bethge geherrscht hatte, ahnte keiner von ihnen; die<br />
jährliche Steuererklärung oder der Abschluß einer Lebensversicherung versetzten sie in<br />
Panik. Solange er lebte, erledigte ihr Bruder Fritz Bonardel die geschäftlichen Dinge, und<br />
die Aufräumungsarbeiten wurden von den Nichten übernommen.<br />
Daß ihr Heim mit all den schönen Erbstücken einer Brandbombe zum Opfer fiel, hat sie<br />
nicht mehr erlebt. Um ihre beruflichen Pflichten erfüllen zu können, vernachlässigte und<br />
verschwieg sie ein inneres Leiden. Sie starb nach einer Operation am 19. Februar 1943.<br />
Bei der Trauerfeier sprach Ernst Karchow vom Deutschen Theater, schmerzlich erschüttert<br />
wie wir alle, während seiner Rede die Worte: „Ganz gleich, ob man Dir eine große<br />
oder kleinere Aufgabe anvertraute, immer fülltest Du den Platz, auf den man Dich<br />
stellte, mit all Deinem Können und mit größter Gewissenhaftigkeit restlos aus. Du warst<br />
ein Mensch, auf den man sich immer verlassen konnte."<br />
Etwas Schöneres kann auch ich im 100. Geburtsjahr meiner Tante Jeannette Bethge nicht<br />
zu ihrem Gedenken sagen.<br />
Quellenhinweise:<br />
Neben privaten Unterlagen der Familien Bonardel und Bethge wurden herangezogen: Nachrichten<br />
des Familienverbandes der Betge-Betke, hrsg. im Auftrage des Familienverbandes von Christian<br />
Bethge, Berlin 1938-1942; Edouard Muret, Geschichte der Französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen,<br />
Berlin 1885; Richard Beringuier, Die Stammbäume der Mitglieder der Französischen<br />
Colonie in Berlin, Berlin 1887; Deutsches Bühnen-Jahrbuch, Jg. 1902-1943. Bei der Auswertung<br />
der Quellen und mit Hinweisen waren mir die Herren Dr. Peter Letkemann und Rainer<br />
Theobald behilflich.<br />
Nachrichten<br />
Studienfahrt nach Hann. Münden<br />
Anschrift der Verfasserin: 78 Freiburg, Beichenstraße 34<br />
Wieder war es ein zweistöckiger Omnibus, der am frühen Morgen des 5. September 1975 rund<br />
70 Reisende zur Exkursion nach Hann. Münden aufnehmen mußte. Erste Station war das<br />
Göttinger Brauhaus, in dem Dipl.-Braumeister Robert Stolle die interessierten Teilnehmer mit<br />
den Einrichtungen des Betriebes und mit der Bierbereitung vertraut machte. Ein anschließender<br />
Imbiß zum vortrefflichen Göttinger Bier im „Deutschen Garten" wurde von Dr. H. G. Schultze-<br />
Berndt mit Ausführungen zur Geschichte dieser von der Rechtsform her einzigartigen früher<br />
Städtischen Brauerei zu Göttingen gewürzt.<br />
Am Sonnabend, 6. September 1975, hielt zunächst Ortsheimatpfleger Dr. Karl Brethauer einen<br />
einführenden Vortrag in die wechselvolle Geschichte Mündens, die durch die Ergebnisse der<br />
neueren Grabungen in St. Blasii an Alter und Bedeutung gewonnen hat. Ihm folgte Stadtbildpfleger<br />
Heinz Härtung, der die Fachwerkstadt Münden und das Problem der Sanierung in den<br />
Vordergrund seiner Betrachtungen stellte. Mit vielen gutgewählten Diapositiven vermochte er<br />
aufzuzeigen, wie Münden aus dem Aschenputteldasein einer grauen Kleinstadt zu neuem Leben<br />
seiner mehr als 400 Fachwerkbauten erwacht ist, von denen rund 200 sich schon in alter Pracht<br />
offenbaren. Auch der anschließende Rundgang mit den beiden kundigen Herren verstärkte den<br />
Eindruck, als handle es sich bei Hann. Münden nicht nur um den Glücksfall einer landschaftlidi<br />
überaus bevorzugt gelegenen Stadt, die überdies noch weitgehend vom Zweiten Weltkrieg verschont<br />
geblieben ist, sondern auch um ein Exempel von Bürgersinn und Bürgermut, den man<br />
manch anderer Stadt gern wünschte. Nachdem Bürgermeister Gustav Henkelmann im Rathaus<br />
noch freundliche Worte der Begrüßung an seine Berliner Gäste gerichtet und im „Schmucken<br />
Jäger" das gemeinsame Mittagessen die Glieder gestärkt hatte, war Dr. K. Brethauer auch<br />
liebenswürdiger Cicerone beim anschließenden Besuch des Klosters Bursfelde und der romanischen<br />
Klosterkirche Lippoldsberg. Galt dabei in Bursfelde das Interesse der kirchenpolitischen Bedeutung<br />
des Klosters, wie sie in der Bursfelder Kongregation heute noch zum Ausdruck kommt,<br />
99
so berührte der Besuch Lippoldsbergs und seiner stilrein erhaltenen romanischen Kirche auch<br />
die literarisch kundigen Reisegefährten (Hans Grimm).<br />
Am Sonntag, 7. September 1975, bot die Sababurg, das Dornröschenschloß der Brüder Grimm<br />
bei freundlichstem Wetter einen angenehmen Anblick und Ausblick. Ein Spaziergang führte<br />
durch den eigenartigen Urwaldteil des Reinhardswaldes, bevor im Burghotel Trendelburg in<br />
gepflegter Atmosphäre das Mittagessen eingenommen wurde. Baron von Stockhausen, Burgherr<br />
und Leiter der Arbeitsgemeinschaft „Gast im Schloß", steuerte interessante Beiträge zur Historie<br />
seines Hauses und der Trendelburg bei und vermochte auch für die Probleme zu erwärmen, die<br />
der Besitz eines solchen Erbes mit sich bringt. Daß er auf die den privaten Eigentümern zugewandte<br />
Denkmalpflege des Landes Hessen ebenso wie später Graf Berlepsch nicht gut zu<br />
sprechen war, sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Im Europäischen Brotmuseum in Mollenfelde<br />
erwartete dessen Gründer und Direktor Otto A. Kunkel seine Berliner Landsleute. 1928<br />
hatte der Bäckerlehrling Kunkel in Berlin mit dem Sammeln begonnen, 40 Jahre später mußte<br />
der Bäckermeister Kunkel mit mehr als 1600 Stücken seine Heimatstadt verlassen, weil sie ihm<br />
kein geeignetes Domizil bieten konnte. In ein ausgedientes Forsthaus hat er nun seine Sammlung<br />
eingebracht und sein Vermögen dafür geopfert. Der Besuch zeigte den Gästen, wie vielfältig das<br />
Brot das Leben des Menschen bestimmt und wie es im Brauchtum und Kunst seine Spuren hinterlassen<br />
hat. Abschluß der Studienfahrt war eine gemeinsame Kaffeetafel auf Schloß Berlepsch,<br />
in deren Verlauf Hubertus Graf Berlepsch seine geistreichen und vielfach selbstironischen Betrachtungen<br />
über das Geschlecht und das Schloß Berlepsch stellte. Der Schlußpunkt geriet auf diese<br />
Weise unverhofft zum Höhepunkt der Exkursion, und in Dankbarkeit und mit reichem Gewinn<br />
schieden die Reisenden aus dem gastlichen Land.<br />
Für 1976 ist der westliche Teil des Eichsfeldes mit Duderstadt als Reiseziel vorgesehen.<br />
H. G. Schultze-Berndt<br />
*<br />
Die Arbeitsgruppe Berliner Architekturmaler stellt ab 17. Oktober „Skizzen aus dem Berliner<br />
Straßenbild" aus und wird Weihnachten wieder im Schloß Glienicke vertreten sein. Zu dieser<br />
Zeit gibt sie die erste von Günter Wollschlaegcr kunst- und kulturgeschichtlich erläuterte Mappe<br />
„Schlösser und Gärten in West-Berlin" ihres großen Berlin-Werkes heraus.<br />
Von unseren Mitgliedern<br />
Der niedersächsische Ministerpräsident Alfred Kübel hat in seiner Eigenschaft als Bundesratspräsident<br />
in Vertretung des Bundespräsidenten unserem Mitglied Klaus Schütz, Regierender<br />
Bürgermeister von Berlin, am 26. August 1975 das Große Verdienstkreuz des Bundesverdienstordens<br />
mit Stern und Schulterband überreicht.<br />
*<br />
Unser Mitglied Franz Berndal, der schon im vorigen Jahr beim Senioren-Wettbewerb des Bezirksamtes<br />
Wilmersdorf für Lyrik - Geschichten - Fotos den zweiten Preis für ein humoristisches<br />
Gedicht erhalten hatte, wurde am 27. Juni von Stadtrat Wuttke in Gestalt einer Urkunde<br />
mit dem ersten Preis für das beste eingesandte Gedicht ausgezeichnet. Eine Kurzreise nach<br />
freier Wahl war der Lohn für das Schaffen Berndais.<br />
*<br />
Vorstandsmitglied Landeskonservator Dr. Helmut Engel wurde vom Fachbereich 02 der Technischen<br />
Universität Berlin (Gesellschafts- und Planungswissenschaften) zum Honorarprofessor<br />
ernannt.<br />
*<br />
Der Freie Deutsche Autorenverband wählte unser Mitglied Dr. med. Klaus-Peter Schulz, MdB,<br />
zum 1. Vorsitzenden ihrer Berliner Sektion.<br />
*<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Herrn Alfred Klatt, Herrn Johannes Mathes, Frau Ursula Winther; zum<br />
75. Geburtstag Frau Frieda Heyn, Herrn Fritz Max Tühke; zum 85. Geburtstag Herrn Alexander<br />
Fiedler.<br />
100
Buchbesprechungen<br />
Berlin 1974. Das Jahr im Rückspiegel. Redaktion: Rainer Wagner u.a. Berlin: Ullstein 1974.<br />
224 S. mit Abb. u. Zeichn., lamin. Pappbd. 15,80 DM.<br />
Die Palette der bunten Berlin-Bücher, bisher an Farbenreichtum nicht mangelnd, ist um eine<br />
Nuance reicher geworden. „Das Jahr im Rückspiegel" ist eine verfeinerte Ausgabe jener illustrierten<br />
Retrospektiven, die am Jahresende den Zeitungen beigelegt und mit diesen zusammen nach<br />
der Lektüre sehr rasch den Weg alles Irdischen gehen - denn nichts ist bekanntlich so alt wie die<br />
Zeitung von gestern. Ohne sich deshalb die Frage vorzulegen, ob überhaupt ein Bedürfnis nach<br />
einer solchen Veröffentlichung bestand, hat sich ein vierköpfiges Redaktionskollegium des Ullstein-Verlages<br />
unter Zuarbeit von 34 Autoren daran gemacht, diesem Jahresüberblick eine äußerlich<br />
dauerhafte Form zu geben, ohne freilich mehr zu bringen als einen konventionellen Streifzug<br />
durch die Berliner Schlagzeilen vom November 1973 bis Oktober 1974.<br />
Sie kommentieren die großen und kleinen Vorkommnisse, die sich zwischen den beiden „globalen"<br />
Sensationen von 1974, der Energiekrise und der Fußballweltmeisterschaft, auf unserem Terrain<br />
zugetragen haben. Da werden Routineveranstaltungen - etwa die Messen, Ausstellungen, Karneval,<br />
Sport - mit ihren Neuheiten vorgestellt oder besondere Aktualitäten dieses Jahres, wie der<br />
Gebietsaustausch mit Ost-Berlin, der ÖTV-Streik, die Fertigstellung des Flughafens Tegel, angesprochen.<br />
Der Gang über die Trödelmärkte fehlt ebensowenig wie ein Besuch beim Bundeskartellamt<br />
oder beim Schöneberger Rathaus-Geburtstag. Die „Affären" des Jahres '74 - Steglitzer<br />
Kreisel, Kongreßzentrum - müssen sich scharfzüngige Kommentare gefallen lassen, ebenso wie<br />
der völlig verregnete Sommer: die Gewichte werden gleichmäßig verteilt. Die Geschichte des<br />
Bildes vom Kriegsausbruch 1914, das damals als Dokument der deutschen Kriegsbegeisterung in<br />
die Welt ging, ist dagegen ein Treffer, den man in diesem Buch nicht vermutet.<br />
Das Ganze wird in lockerer, journalistischer Manier dargeboten, manchmal etwas zu lässig und<br />
von stilistischer Sorglosigkeit. Die Bearbeiter gingen wohl davon aus, daß es für Bücher dieser<br />
Art kein Muster und kein verpflichtendes Schema gebe, daß man also zunächst munter drauflos<br />
schreiben könne. Das geht auch in Ordnung, solange es nicht zu sprachlichem Wildwuchs (wie an<br />
einigen Stellen zu bemerken) oder zu recht nichtssagenden Passagen, wie z.B. den „Jugend"-<br />
Abschnitt S. 88 ff., führt. Manches aus den Texten sollte dort bleiben, wo es auch in der aktuellen<br />
Presse zu finden ist: unterm Strich. Die Abbildungen fügen sich nahtlos in die Beiträge ein;<br />
ihr dokumentarischer Wert ist je nach der Thematik des begleitenden Textes unterschiedlich. Hier<br />
wird offenkundig, wie schwer die Mitte zwischen Sachbuch und buntem Bilderbogen zu finden ist<br />
und daß dieses Buch hierbei auch nur einen Kompromiß darstellt. Es bleibt abzuwarten, ob dieser<br />
„Rückspiegel" auch in die Zukunft blicken kann. Peter Letkemann<br />
Jürgen Boeckh: Alt-Berliner Kirchen. Von St. Nicolai bis „Jerusalem". Berlin: Haude & Spener<br />
1975, 125 S., 13 Abb., brosch., 14,80 DM. (Berlinische Reminiszenzen Bd. 43.)<br />
Vom Titel her könnte der interessierte Leser vermuten, mit dem Büchlein eine spezifisch bau- und<br />
kunstgeschichtliche Untersuchung über den Sakralbau in den mittelalterlichen Nachbarstädten<br />
Berlin und Colin in die Hand zu bekommen. Der Verfasser läßt jedoch bereits in seinem Vorwort<br />
erkennen, daß ihn vielmehr sein besonderes Interesse an der Geschichte Berlins und der<br />
Kirche zu dieser Veröffentlichung angeregt hat. Folgerichtig behandelt er die Geschichte der 9<br />
vorreformatorischen Kirchen und Kapellen Alt-Berlins aus dem Blickwinkel ihrer Gemeinden.<br />
Boeckhs Bericht über das kirchliche Leben in den Gemeinden, ihr Verhältnis zur Obrigkeit, über<br />
die Frömmigkeit und Bekenntnistreue im alten Berlin sowie über die Persönlichkeiten, die hier<br />
gewirkt und die Geschichte dieser Stadt und darüber hinaus mitgeprägt haben, ist geeignet, einen<br />
großen Leserkreis anzusprechen. Das Bändchen ist daher - trotz einiger bedauerlicher Druckfehler<br />
- dennoch ganz besonders als Lektüre für den Geschichts- und Religionsunterricht in den<br />
Berliner Schulen zu empfehlen.<br />
Im Gegensatz zu den zahlreichen alten Dorfkirchen des heutigen Berlin, die nahezu vollständig<br />
die Kriegszeiten überdauert haben oder wiederaufgebaut worden sind, traf die mittelalterlichen<br />
Kirchen der Berliner Altstadt ein beklagenswertes, trauriges Schicksal, denn von ihnen ist nur<br />
die Marienkirche als Bauwerk und Gotteshaus bis heute erhalten geblieben. Die wachsende Bedeutung<br />
dieser Predigtstätte nach den Jahren der Zerstörung gibt dem Verfasser Gelegenheit, die<br />
Geschichte der geteilten Stadt und ihrer in geistlicher Gemeinschaft fortlebenden Kirche bis in<br />
unsere Zeit zu verfolgen.<br />
101
Im Nachwort weist Jürgen Boeckh darauf hin, daß die Reihe der vorreformatorischen Kirchenbauten<br />
nach einer Unterbrechung von 200 Jahren erst im Jahre 1687 mit der Einweihung der<br />
Dorotheenstädtischen Kirche als erstem von vornherein protestantischen Kirchenbau ihre Fortsetzung<br />
findet. Es schließen sich bald darauf im 18. Jh. in kurzer Folge weitere Sakralbauten<br />
an, die ebenfalls noch zu den Alt-Berliner Kirchen gerechnet werden müssen und deren Darstellung<br />
der Verfasser einem besonderen, zweiten Band vorbehalten hat. Auf ihn kann man nach<br />
der gelungenen Konzeption des 1. Teiles nur gespannt sein. Volkmar Dresc<br />
Berlin und seine Bauten. Hrsg. vom Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin. Berlin/München/Düsseldorf:<br />
Verlag W. Ernst & Sohn. Teil IV Wohnungsbau - Bd. B: Die Mehrfamilienhäuser.<br />
(1974.) 867 S. m. 116 Abb., 668 Objekte m. 738 Abb. sowie Plänen, Zeichn. u. Ktn.,<br />
Leinen, 140 DM. - Bd. C: Die Wohngebäude - Einfamilienhäuser. Individuell geplante Einfamilienhäuser.<br />
Die Hausgärten. (1975.) 421 S. m. 236 Abb., 833 Objekte m. Abb. sowie Plänen,<br />
Zeichn. u. Ktn., Leinen, 72 DM.<br />
In erfreulich rascher Folge setzt der Berliner Architekten- und Ingenieur-Verein seine vorzüglich<br />
ausgestattete Inventarreihe über die Berliner Bauten fort. Der erste der hier anzuzeigenden<br />
Bände mit den Registern der mehrgeschossigen Wohnhäuser, 1972 abgeschlossen, folgt dem die<br />
Entwicklung der Wohngebiete bis 1970 behandelnden Teil IV-A. Systematischen Beiträgen von<br />
Alfred Schinz - diese Arbeit ist umfassend angelegt -, Ernst Heinrich, Dittmar Machule und<br />
Klaus Müller-Rehm folgen die von Hans-Henning Joeres, Dittmar Machule, Wilfried Pape,<br />
Dieter Rentschier und Barbara Schulz zusammengestellten Listen der Häuser. Ihr Aufbau ist<br />
besonders hervorzuheben. Stellen sie doch durch Gliederung in die Zeitabschnitte von 1896 bis<br />
1918, 1918 bis 1945, nach 1945 und durch Unterteilung in Bezirke mit Beschreibung, Daten und<br />
Quellennachweisen ein hervorragendes Arbeitsmittel dar. Das Manko sei gleich genannt: Die<br />
Entwicklung des Wohnbaus seit 1945 im anderen Teil unserer Stadt fehlt. Vergleiche wären<br />
sicher sehr interessant gewesen, zumal dieser nach Überwinden von Planung und Formenausdruck<br />
der fünfziger Jahre gerade im Stadtzentrum auch durchaus akzeptable Lösungen bietet.<br />
Sattsam bekannte Umstände dürften die Aufnahme verhindert haben.<br />
Aus der Zeit, die vor der führenden Bedeutung des Berliner Wohnbaus in den Jahren zwischen<br />
Inflation und Beginn der NS-Herrschaft liegt, werden nicht nur die Renommierbeispiele des<br />
gemeinnützigen und genossenschaftlichen Wohnungsbaus erwähnt, sondern auch die individuellen<br />
Versuche, den unfruchtbaren Historismus hinter sich zu lassen, gewürdigt. Anspruch auf Vollständigkeit<br />
wird immer Utopie bleiben. Auch eine Publikation dieser Zielsetzung und dieses<br />
Umfanges will sie nicht erreichen. So müssen hier leider bestimmende Charakteristika ihrer Zeit<br />
ungenannt bleiben.<br />
Der folgende Band IV-C ist dem individuellen Wohntypus - in der Regel außerhalb der städtischen<br />
Kernbebauung - gewidmet. Die Berliner hat es schon immer in die unmittelbare Umgebung<br />
ihrer Stadt getrieben. So sind auch die Berliner Vororte ein Einzelfall im europäischen<br />
Bereich. Großzügig durchzogen sie Grün-, Park- und Waldanlagen. Ihre Weiträumigkeit, durch<br />
die man spazierenging, ohne sich große Gedanken darüber zu machen, spürt man eigentlich erst,<br />
seit wilde Bodenspekulation statt maßvoller Planung zum „Villensterben" führt. Diese Randzonen<br />
und Gartenstadtsiedlungen besitzen ihren Ursprung in jenen Villenkolonien, die vor rund<br />
hundert Jahren entstanden und mit Namen wie Quistorp (Westend) und Carstenn (Lichterfelde,<br />
Wilmersdorf, Friedenau und Haiensee) verbunden sind, wenn auch Friedenau und Wilmersdorf<br />
durch das persönliche Schicksal Carstenns den Charakter als Villenkolonie schon frühzeitig verloren<br />
haben.<br />
In diesen Wohngebieten haben viele namhafte Architekten gebaut, unter ihnen Hermann Muthesius,<br />
Paul Mebes, Alfred Messel und Peter Behrens, in ihrer Bedeutung weit über lokale Grenzen<br />
hinausragend.<br />
Die Häuser nach dem ersten Weltkrieg wurden bescheidener. Von ihren Baumeistern mögen<br />
Erich Mendelsohn, Richard Neutra, Hans Poelzig, Hans und Wassili Luckhardt, Alfons Anker,<br />
Walter Gropius, Arthur Korn, Siegfried Weitzmann, Heinrich Tessenow und Heinrich Schweitzer<br />
auch für die anderen genannt sein, die damals das moderne Berlin planten und bauten. Egon<br />
Eiermann, Werner Harting, Hans Scharoun und anfangs auch noch Ludwig Hilberseimer konnten<br />
sich ohne Konzessionen durch die dreißiger Jahre „mogeln", was neben ihnen nur wenigen<br />
vergönnt war. Nach dem zweiten Weltkrieg entstanden erst zwölf bis fünfzehn Jahre später<br />
wieder bedeutendere Einfamilienhäuser. Heinz Schudnagies aus der Gruppe um Scharoun sei<br />
für ihre Architekten genannt.<br />
Diesen Band - Autoren Julius Posener und Burkhard Bergius - ergänzt Herta Hammerbachers<br />
Beitrag über die Hausgärten ausgezeichnet. Ohne Bedeutungsschmälerung des Architekturgartens<br />
wird ihre Vorliebe für den Landschaftsgarten deutlich spürbar.<br />
102
Der wichtigste Teil auch hier wieder die von Julius Posener und Burkhard Bergius unter Mitarbeit<br />
von Dirk Förster und Dieter Rentschier zusammengestellten Listen von 564 Häusern<br />
(1896-1968) mit Fotos, Plänen oder Quellenangaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Vorzüglich.<br />
Ein Buch, mit dem man die Vororte Berlins entdecken möchte, auch wenn die östlichen<br />
Bezirke fehlen. Günter Wollscblaeger<br />
Berlin. Herausgegeben von Hanns Reich. Einleitung von Sybille Schall. Fotos von Liselotte<br />
und Armin Orgel-Köhne u. a. 7., völlig neu bearb. Aufl. Düsseldorf: Hanns Reich Verlag<br />
1974. Halbleinen, 96 S., 24 DM.<br />
Klaus Schütz, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, ist völlig beizupflichten, wenn er<br />
als Vorwort schreibt: „Berlin als .terra magica' zu verkaufen, hat sich bezahlt gemacht -<br />
nicht nur für den Verlag, sondern auch für den Leser und Betrachter dieses Bildbandes. Die<br />
vielen Auflagen, die seit 1959 notwendig wurden, beweisen auch äußerlich die Schnellebigkeit<br />
der Stadt samt ihrer Politik und ihrer Historie und der Weltgeschichte schlechthin. So gesehen<br />
ist ein Bildband über Berlin mehr als nur eine Zusammenstellung schöner Fotos. In einer<br />
Zeit, wo niemand Zeit hat, kann er Geschichtsunterricht ersetzen. Und das ist besser als gar<br />
keine Beschäftigung mit der Geschichte und in diesem speziellen Fall mit Berlin." In der Tat<br />
ist der vorliegende Band eines der gängigsten Werke über Berlin, wobei „gängig" nicht mit<br />
konventionell oder abgeklappert zu verwechseln ist. Die Fotografien zeigen vielmehr zum<br />
Teil mutige Blickwinkel. Der Text von Sybille Schall hält die Waage zwischen gediegener<br />
Information und schnodderiger Plauderei und könnte auch von anderen Vorwortschreiberinnen<br />
stammen. Daß allerdings 1830 eine „leidenschaftliche Begeisterung" die Franzosen aus<br />
dem Lande gewiesen hätte, ist neu (1813?). Auch heißt das „letzte alte Dorf Berlins" Lübars<br />
(und nicht Lybars). Im übrigen spricht die hohe Auflage für sich selbst.<br />
H. G. Schultze-Bcrndt<br />
Karoline Cauer: Oberhofbankier und Hofbaurat. Aus der Berliner Bankgeschichte des XVIII.<br />
Jahrhunderts. Frankfurt a. M.: Institut für Bankhistorische Forschung e.V. [1973]. 108 S. m.<br />
Abb., brosch., 15 DM.<br />
Mit bewundernswertem Fleiß und großem persönlichen Einsatz - u. a. wurden Archive in Paris,<br />
Merseburg und Marburg besucht - hat die Autorin versucht, ein Bild des Bankiers König Friedrich<br />
Wilhelms II. und preußischen Hofbaurats Isaac Daniel Itzig nach den Quellen zu zeichnen.<br />
Anlaß und Ausgangspunkt war ein wohl größerer Bestand Itzigscher Papiere aus dessen Nachlaß<br />
im Familienbesitz der Verfasserin.<br />
Die Darstellung von Aufstieg und Fall des Finanziers bringt eine Fülle von Informationen, die<br />
weit über das ausschließlich Biographische hinausgehen. Die Finanzbeziehungen zu deutschen<br />
Duodezfürsten und dem preußischen Adel in den letzten Jahrzehnten des 18. Jhs. werden ebenso<br />
dargestellt wie der Handel mit der jungen Französischen Republik. Auch die von Itzig maßgeblich<br />
geförderten Emanzipationsbestrebungen der preußischen Juden, der Freimaurerei und die<br />
Beteiligung an der Gründung einer jüdischen Freischule behandelt die Vf.in gebührend. Von besonderem<br />
Interesse für den Lokalhistoriker ist die Darstellung des Beginns des preußischen<br />
Chausseebaus, die Finanzierung und Durchführung der Arbeiten an der Berlin-Potsdamer Chaussee<br />
unter der Mitwirkung des dafür zum Hofbaurat ernannten Itzig. Durch den Ankauf des<br />
Schöneberger Freiguts, des Kruges und eines weiteren Kossätenhofes hatte er bereits umfangreichen<br />
Besitz im Berliner Umland erworben - ein Besitz, dessen Wert durch die Anlagen der<br />
Chaussee nur noch gesteigert werden konnte. Später kamen noch der Erwerb der Ellerschen<br />
Meierei in der Köpenicker Straße sowie der Bartoldyschen Meierei vor dem Schlesischen Tor<br />
dazu. Itzigs Pläne, ein preußisches Chausseebaumonopol zu erreichen, haben sich jedoch nicht<br />
realisiert. Das bereits organisierte Fuhrwesen konnte dafür nicht mehr eingesetzt werden. Die<br />
hier im Zusammenhang mit Spanndiensten genannte „Domäne" Wilmersdorf (S. 43) gab es allerdings<br />
nie.<br />
Der Konkurs der Firma Itzig u. Co. im Jahre 1796 war unausweichlich geworden, als die von<br />
der französischen Regierung als Bezahlung für bedeutende Armeelieferungen gegebenen Wechsel<br />
nicht eingelöst wurden. Erörterung des Testaments und eine Übersicht über die weiteren Tätigkeiten<br />
Itzigs bis zu seinem Tode 1806 schließen die Studie ab.<br />
Leider ist von dieser in schöner Ausstattung erschienenen und mit einer einleitenden Übersicht<br />
über „Das Bankwesen Berlins im 18. Jahrhundert" von Erich Achterberg versehenen Arbeit nicht<br />
nur Positives zu sagen. Der Nachlaß Itzig, die Hauptquelle der Ausführungen, wird nur pauschal<br />
zitiert. Die im Anhang daraus beigegebenen Dokumente sind nicht immer einwandfrei ediert.<br />
103
Die bei Dokument 5, S. 94, im Text gemachte Angabe „Drey Thaler" bezieht sich wohl auf die<br />
in Preußen übliche Steuer auf derartige Patente. Die in den Anmerkungen und dem Literaturverzeichnis<br />
genannten Titel lassen eine recht eigenwillige Zitierweise erkennen. Eindeutig falsch<br />
zitiert sind zwei Aufsätze Johannes Schultzes (S. 108, Nr. 50 c u. d). Sie sind nicht in den Veröffentlichungen<br />
der Historischen Kommission zu Berlin, sondern im „Jahrbuch für die Geschichte<br />
Mittel- und Ostdeutschlands" erschienen. Zahlreiche weitere Fehler geben Anlaß zum Verdacht,<br />
daß sich auch in den nicht nachprüfbaren Angaben Unkorrektheiten eingeschlichen haben könnten.<br />
So ist bei aller Hochachtung vor der großen Leistung der Vf.in der Eindruck dieser Arbeit durch<br />
technische Mängel etwas getrübt. Felix Escher<br />
Rhoda Kraus: Berlin zu Fuß. 13 Wanderungen in West- und Ost-Berlin. Berlin: Stapp-Verlag<br />
1973. 152 S. m. Abb. u. Kartenskizzen, Linson, 12,80 DM.<br />
Grieben-Reiseführer Deutschland. Band 6: Berlin. München: Thiemig 1973 (verbess. Nachdr. v.<br />
1967). 221 S., 1 Faltplan, brosch., 8,80 DM.<br />
Im Zuge der „Trimm-Dicb-Bewegung" sind auch Spaziergänge wieder modern geworden. In<br />
ihrem Büchlein „Berlin zu Fuß" bietet Rhoda Kraus 13 Stadtspaziergänge - die Vf.in nennt sie<br />
Wanderungen - im West- und Ostteil der Stadt an. Tiergarten (2X), Zoo und Hansaviertel,<br />
Kreuzberg und Dahlem (2X), Schloß Charlottenburg und Pfaueninsel, Kurfürstendamm und<br />
Funkturm sind die wenig originellen Ziele im Westteil; im Ostteil ist es noch magerer: der<br />
Alexanderplatz und „Unter den Linden" sind hier die einzigen Plätze, die Frau Kraus vorschlägt.<br />
Der langatmige Text ist zudem nicht geeignet, Begeisterung für die „Wanderungen" zu wecken.<br />
Im Gegensatz dazu bietet der Berlin-Band des Grieben-Reiseführers Deutschland allein 34 Vorschläge<br />
für Spaziergänge in Berlin (West). Die einzelnen Objekte werden knapp erläutert. Den<br />
weitaus größten Raum nimmt das Stadtlexikon ein. Von „Akademie" bis „Zoologischer Garten"<br />
werden auf 200 Seiten lexikonartig „Berlin-Begriffe" abgehandelt. Leider gelang es hier ebensowenig<br />
wie in den „Spaziergängen und Ausflügen" Wesentliches oder für Berlin Charakteristisches<br />
von einer Flut nebensächlicher Informationen zu trennen. So sind die für Berlin typischen Großsiedlungen<br />
der 20er Jahre, die international Anerkennung gefunden haben, nur im Zusammenhang<br />
mit den Siedlungsanlagen der 50er und 60er Jahre - von denen man Gleiches wirklich<br />
nicht behaupten kann (z. B. Georg-Ramin-Siedlung in Spandau) - genannt (S. 173). Dies ist um<br />
so bedauerlicher, da der Reiseführer gerade für den eiligen Touristen gedacht ist. Nicht zu empfehlen<br />
ist die dem Band beigegebene Übersichtskarte, die den Stand des U-Bahn-Netzes von<br />
1969 wiedergibt. Bei der S-Bahn ist die Netztrennung nur sehr unvollkommen angedeutet.<br />
Felix Escher<br />
Kladderadatsch. Faksimile-Nachdruck des 1. Jahrgangs 1848. Hildesheim: Olms Presse 1970.<br />
136 S. m. zahlr. Abb., brosch. 28 DM.<br />
Schon seit Jahrzehnten sind die Originalausgaben, insbesondere die der ersten Jahrgänge, zu<br />
großen Raritäten auf dem Antiquariatsmarkt geworden. So ist es begrüßenswert, daß dieser<br />
Verlag in seiner Reihe „Quellen zur Trivialliteratur" den 1. Jahrgang dieser Wochenschrift<br />
faksimiliert hat.<br />
Im Jahre 1848, in dem am 1. 4. die liberale „Nationalzeitung" und am 16. 6. die konservative<br />
„Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung" erschienen, wurde der „Kladderadatsch" als erste<br />
politisch-satirisch-witzige Wochenschrift in Berlin von David Kaiisch und dem Verlagsbuchhändler<br />
Albert Hofmann gegründet. Die erste Nummer kam am 7. Mai heraus. In den ersten<br />
Jahren zeichneten Rudolf Löwenstein und Ernst Dohm für die Redaktion verantwortlich,<br />
während David Kaiisch, Johannes Trojan und der Satiriker Julius Stettenheim die Mehrzahl<br />
der Texte verfaßten. Wilhelm Scholz zeichnete über 40 Jahre lang fast alle Illustrationen in<br />
diesem „Organ für und von Bummler". Gleich den anderen Zeitungen und Zeitschriften<br />
wurde auch der „Kladderadatsch" in jenen Tagen nach der März-Revolution mehrmals verboten<br />
und beschlagnahmt. Mit sehr viel Humor, noch mehr beißendem Spott und bissiger<br />
Satire hielt er der Gesellschaft seiner Zeit stets ein blinkendes Spiegelbild vor, was ihr meist<br />
durchaus nicht zum Ruhme gereichte. Und dennoch: trotz aller Anfechtungen erwarben sich<br />
die Zeitungen Berlins - und mit ihnen auch der „Kladderadatsch" - im Jahre 1848 ein politisches<br />
Bewußtsein und einen politischen Charakter. Das berühmte Berliner Witzblatt wurde<br />
fast hundert Jahre alt und „starb" erst 1944 in den Wirren der Kriegstage.<br />
Dem vorliegenden Reprint fehlt ein kurzer einführender Text, was als Manko angesehen<br />
werden kann. Doch sicher wird dieser Nachdruck auch so viele Interessenten finden, zumal die<br />
Qualität der Ausführung und der dafür geforderte Preis übereinstimmen.<br />
Claus P. Mader<br />
104
Moses Mendelssohn: Neuerschlossene Briefe an Friedrich Nicolai. In Gemeinschaft mit Werner<br />
Vogel hrsg. von Alexander Altmann. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1973. XI,<br />
122 S., brosch., 26 DM.<br />
Als Preprint und Kostprobe der geplanten Briefbände der Jubiläumsausgabe von Moses Mendelssohns<br />
Gesammelten Schriften (Berlin 1929-1938 und Stuttgart 1971 ff.) ließ der Verleger<br />
Günther Holzboog kürzlich die „Neuerschlossenen Briefe Moses Mendelssohns an Friedrich<br />
Nicolai" in einer einfachen Offsetpublikation erscheinen. Inzwischen sind diese Briefe mit Ausnahme<br />
der rein geschäftlichen Schreiben und zum Teil um die wirtschaftlichen Passagen gekürzt<br />
auch in das von der American Lessing Society herausgegebene Lessing Yearbook 5, 1973,<br />
S. 13-60, eingegangen, so daß sie in der Mehrzahl nun ebenfalls in einer typographisch befriedigenden<br />
Form vorliegen. Der beste Kenner des Philosophen Moses Mendelssohn und berufene<br />
Fortsetzer von dessen Gesamtausgabe, Alexander Altmann, Professor für Jüdische Philosophie<br />
an der Brandeis-Universität in Waltham, Mass., USA, macht damit eine Brieffolge bekannt, die<br />
erst ca. 1937/38, nach Erscheinen des ersten Briefbandes der Jubiläumsausgabe (mit der Korrespondenz<br />
von 1754-1762, darunter auch Briefen an Nicolai) von Richard Wolff aufgefunden<br />
wurde und infolge der damaligen Ereignisse im nationalsozialistischen Deutschland nicht veröffentlicht<br />
werden konnte. Die jetzige Ausgabe beruht allerdings nur in ihrem zweiten Teil<br />
auf den Originalbriefen, die Altmann allein für seine Nummern 26-34 und 36-55 aus dem<br />
Mendelssohn-Depositum des Landes Berlin im Mendelssohn-Archiv der Staatsbibliothek Preußischer<br />
Kulturbesitz zur Verfügung standen. Die Nummern 1-25 und 35 sind nach einer vollständigen<br />
Abschrift (in der nur Altmanns Nr. 42 fehlt) aus ehemaligem Marburger Privatbesitz,<br />
jetzt in dem der Mendelssohn-Gesellschaft e. V. in Berlin wiedergegeben. Auf diese Quellenlage<br />
und die Vorgeschichte seiner Ausgabe weist der Hrsg. in seinem Vorwort hin, in dem man<br />
jedoch eine Äußerung über den Wert und die Zuverlässigkeit der benutzten Abschrift vermißt.<br />
In verschiedenen Briefen weisen gelegentlich Pünktchen darauf hin, daß der Abschreiber einzelne<br />
Wörter, vor allem Eigennamen und Währungsbegriffe, nicht lesen konnte. Auch eine<br />
Konkordanz von Altmanns chronologisch vergebenen Nummern, denen der sogenannten Marburg-Mappe<br />
und denen des Mendelssohn-Depositums würde sich als nützlich erweisen.<br />
Die Briefe erstrecken sich von 1757 bis 1785, wenige Monate vor Mendelssohns Tod im Januar<br />
1786. Sie bezeugen gerade auch in ihrer überwiegenden Kürze und Knappheit die engen<br />
freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen den Korrespondenzpartnern bestanden. Inhaltlich<br />
nehmen literarische und buchhändlerischc Themen einen bedeutenden Platz ein: so erfährt man<br />
einiges von Mendelssohns eigenen Werken und Arbeiten, von seiner Lektüre und den entsprechenden<br />
Buchbestellungen bei seinem Buchhändlerfreund sowie von seinem persönlichen Umgang<br />
mit Schriftstellern und Gelehrten. Nicht minder umfangreich sind die finanziellen Erörterungen.<br />
Mendelssohn avancierte offenbar bald zu Nicolais Hauptberater in Geldgeschäften.<br />
Dabei stellen wir fest, daß Nicolai nicht nur Mendelssohns Schuldner, sondern zeitweilig auch<br />
sein Gläubiger war.<br />
Die Briefe sind kenntnisreich kommentiert. Den finanziellen Abschnitten wurden grundlegende<br />
Erläuterungen von Werner Vogel beigegeben. Wir möchten, hoffen, daß dieser Vorpublikation<br />
bald die Briefbände der Jubiläumsausgabe folgen, in die dann zum Beispiel auch die an anderer<br />
Stelle überlieferten Briefe Mendelssohns an Nicolai (etwa aus dem Nicolai-Nachlaß der Staatsbibliothek<br />
Preuß. Kulturbesitz, betreffend die Allgemeine Deutsche Bibliothek) eingehen werden.<br />
Ingeborg Stoltenberg<br />
Adalbert Kuhn: Märkische Sagen und Märchen nebst einem Anhange von Gebräuchen und<br />
Aberglauben. Nachdruck der Ausgabe Berlin 1843. Hildesheim: Olms Verlag 1974. XVI/388/<br />
XXVI S., Leinen, 41,80 DM. (Volkstümliche Quellen IV, Sage, Hrsg. Will-Erich Peuckert.)<br />
Der bislang einzige lizenzierte Nachdruck dieses Standardwerkes, welches seit Jahrzehnten nicht<br />
mehr in Antiquariatslisten auftauchte, erfolgte bei F. A. Herbig in Berlin 1937. Da auch dieser<br />
Nachdruck schon zur Rarität geworden ist, kann man jetzt dem Olms Verlag für den neuen<br />
Reprint der Erstausgabe dankbar sein. Diese Veröffentlichung und jene von Wilhelm Schwartz,<br />
dem Schwager Kuhns, über die „Sagen und alten Geschichten der Mark Brandenburg für jung<br />
und alt" gelten seit jeher als wichtigste Quellen für alle nachfolgenden Publikationen. So nennen<br />
auch die Herausgeber jener zwei Bändchen, die vor einigen Jahren von zwei Berliner<br />
Verlagen angeboten wurden, Kuhn und Schwartz als Hauptquellen.<br />
Bereits in den Jahren 1816 bis 1820 veröffentlichten die Brüder Grimm ihre Bücher über<br />
„Kinder- und Hausmärchen" und „Die Deutschen Sagen", in denen auch berlinische und<br />
märkische Sagen enthalten sind. Doch erst um 1840 befaßten sich Heimatkundige intensiv<br />
mit dem Sammeln jenes Volksgutes. Zu ihnen gehörten auch Adalbert Kuhn, späterer Direktor<br />
des Köllnischen Gymnasiums und 1872 in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen, sowie<br />
Wilhelm Schwartz, zu dieser Zeit noch Gymnasiast. Auf der Suche nach mündlichen Volksüberlieferungen<br />
durchstreiften sie von Berlin aus die nähere Umgebung und später auch große Teile<br />
105
Nord- und Westdeutschlands. Dabei entstand in den Jahren von 1837 bis 1849 eine wissenschaftlich<br />
geordnete Sammlung - eine Fundgrube für weitere ernsthafte Kulturarbeit.<br />
Obwohl der hier vorliegenden Neuauflage, vom bescheidenen Klappentext abgesehen, keine<br />
weiterführenden Erläuterungen beigegeben sind, werden Volkskundler sowie Märchen- und<br />
Sagenliebhaber sicher nicht auf diesen Band verzichten können und wollen. Claus P. Mader<br />
50 Jahre Wintergarten 1888-1938. Nachdruck der Festschrift Berlin 1938. Hildesheim: Olms<br />
Presse 1975. FW 104 S. m. zahlr. Abb. u. 1 färb. Beihefter, brosch., 19,80 DM.<br />
„Spezialitätentheater", ein Berliner Begriff für Varietes, gab es schon seit der Mitte des vorigen<br />
Jahrhunderts in großer Anzahl und jeder Preisklasse. Doch war der Wintergarten das vornehmste.<br />
Er befand sich im Central-Hotel am Bahnhof Friedrichstraße und bot ein Programm<br />
aus einer Mischung von Kabarett und Zirkus. Hier zeigte auch Max Skladanowski 1895 das<br />
von ihm erfundene Bioskop in einer öffentlichen Vorführung. Es war die erste Veranstaltung<br />
auf kinematographischem Gebiet überhaupt in unserer Stadt. Erinnern wir uns aber auch<br />
noch einmal der Stars und Sternchen des damaligen „Schaugeschäfts". Ohne in der Nennung<br />
und der Reihenfolge eine Wertung zu sehen, waren es u. a. die Tänzerinnen „La belle Otero",<br />
Rosario Guerrero, „Miss Saharet", Marika Rökk; die Jongleure Bellini, Paul Conchas, Rastelli,<br />
die Diseusen Yvette Guilbert, Margarete Slezak, Tola Mankiewicz, Marita Farell, Edith Schollwer,<br />
Grethe Weiser, Loni Heuser sowie die Artisten „Die 3 Codonas", „Die 4 Berosini" und<br />
„Die 4 Wallendas", Alfred Court mit seiner Raubtiergruppe; die Reiterinnen May Wirth und<br />
Micaela Busch. Für den Ulk und den Humor sorgten die Clowns Charly Rivel, Antonet und<br />
Grock, „Die Barracetas" und Guido Thielscher, der jahrelang im Wintergarten auftrat. Viele<br />
von den Genannten und noch mehr von den hier nicht Erwähnten sind heute in Vergessenheit<br />
geraten. Einer soll jedoch noch besonders hervorgehoben werden: Otto Reutter. Fast<br />
31 Jahre trat er immer wieder im Wintergarten auf. Bald sang ganz Berlin den Refrain seines<br />
Couplets „In fünfzig Jahren ist alles vorbei". Nun, es dauerte auch nicht viel länger, bis im<br />
Jahre 1944 dieses Haus und mit ihm Tradition und große Leistung in Schutt und Asche fielen.<br />
So wird diese kleine Schrift vielen Berlinern (und nicht nur ihnen) wehmütige Erinnerungen<br />
hervorrufen an eine Zeit, da Artistik, Clownerie und „Show" noch nicht durch bloßen Knopfdruck<br />
in alle Wohnstuben gelangten.<br />
Allerdings muß noch eine kritische Bemerkung folgen. Zu einem Nachdruck gehören „alle"<br />
Seiten, also auch jene Seiten 11-16, auf die der Verlag in dem Reprint verzichtet. Warum?<br />
Sollten hier falsche Scham und Fehleinschätzung des Lesers das Motiv sein? Dies müßte dann<br />
verworfen werden, zumal der „Führer" mehrmals in vollem Ornat auf mehreren Seiten zu<br />
sehen ist. Dennoch: diese Schrift wird viele Freunde finden, da das Original durch Kriegseinwirkungen<br />
sehr selten geworden und der für diesen Nachdruck geforderte Preis akzeptabel ist.<br />
Claus P. Mader<br />
Günter Neumann: Schwarzer Jahrmarkt. Eine Revue der Stunde Null. Berlin: Blanvalet 1975.<br />
192 S. m. 45 Zeichn., 16 Abb.-Taf., lamin. Pappbd., 29,80 DM.<br />
Viele Zeitgenossen, die das Inferno des Hitlerkrieges überstanden hatten, sahen damals, 1947,<br />
Günter Neumanns knackfrischen „Schwarzen Jahrmarkt" im kurz zuvor von ihm eröffneten<br />
Cabaret „Ulenspiegel" in der Nürnberger Straße. Dies zu einer Zeit, die man noch der „Stunde<br />
Null" zurechnet, in der die abgerissenen und ausgehungerten Berliner nach einer theatralischen<br />
Kost verlangten, die sie ganz schlicht und doch ergreifend wieder einmal lachen ließ. Es war<br />
beinahe ein Wunder, daß sich, als noch die Trümmer rauchten, die Theater, die Künstler, die<br />
Schriftsteller als erste regten, um den Unrat einer „heroischen Epoche" hinwegzuräumen. Im Umkreis<br />
der „Kleinkunst", die, wenn gekonnt, Größeres auf die Beine stellte als manche schwergewichtige<br />
Tragödien, war Günter Neumann (1913-1972) ein gestandener Mann. Mit leichter<br />
fixer Hand meisterte er Wort und Musik, ohne trivial zu werden. Von nobler Gesinnung, die<br />
sich als pazifistisch einstufen läßt, brachte er das Ernste amüsant und lustig. So eben auch in<br />
seiner musikalisch-satirischen Zeit-Revue, einem Spektakulum praller Aktualität. Dazu gehörte<br />
übrigens auch Zivilcourage, denn die Neumann-Texte schonten auch die vier Alliierten nicht,<br />
von uns Normaldeutschen gar nicht zu reden. Natürlich war Günter Neumann als Texter kein<br />
Kurt Tucholsky, kein Walter Mehring oder Erich Kästner, aber er hatte einen genialischen Zug,<br />
das Wort zugleich musikalisch und szenisch attraktiv wirksam zu machen.<br />
Daß der „Schwarze Jahrmarkt" sich seine zeitdokumentarische Beständigkeit erhalten hat, beweist<br />
das derzeitige theatralische Comeback im Hebbel-Theater. Tatjana Sais und Karl Vibach<br />
haben die Revue neu eingerichtet. Der immer wieder mobile Verleger Lothar Blanvalet hat jetzt<br />
die z. T. umwerfenden Texte herausgebracht, von Erich Rauschenbach kongeniale Zeichnungen<br />
dazu machen lassen und Szenenbilder der Aufführung von 1947 und die der jetzigen Inszenierung<br />
im Hebbel-Theater dazugenommen. Zum Ganzen schrieb Friedrich Luft ein brillantes Vorwort.<br />
Es ist gut, das alles beisammen zu haben. Walther G. Oschilewski<br />
106
Horst Cornelsen: Gebaut in 25 Jahren - Berlin (West). Hamburg: Harry v. Hof mann Verlag<br />
1973. 128 S. m. 275 Abb., Linson, 48 DM.<br />
Der Rez., der von 1964 an acht Jahre im Märkischen Viertel gewohnt hat, könnte geneigt sein,<br />
der Besprechung eigene Erfahrungen in einem Stadtteil zugrunde zu legen, der an den Menschen<br />
vorbeigeplant worden ist. Hier hilft kein Hinweis, daß man „grüne Slums" beseitigt<br />
und preiswerte Wohnungen mit gutem Schnitt geschaffen hat, wenn die Infrastruktur so vernachlässigt<br />
wurde, daß man die vielgescholtenen Bauspekulanten der Gründerzeit (etwa Carstenn)<br />
neben diesen gemeinnützigen Wohnmaschinenfabrikanten geradezu als Wohltäter der Menschheit<br />
bezeichnen muß. Aber es geht hier, wie es heißt, um den „Versuch eines engagierten Journalisten",<br />
der „keine Dokumentation und keine Architekturkritik" vorlegen will, sondern den „Bericht<br />
eines Berliners über seine Stadt". In dem Bestreben, sich von der modischen Kritik fernzuhalten,<br />
die Berlin als „Bauplatz des Grauens" darstellt, schwankt der Verfasser zwischen Bescheidenheit<br />
(„wer vieles anpackt, wird auch Fehlentscheidungen treffen") und Euphorie, die sich aus dem<br />
Vier-Mächte-Abkommen über Berlin herleitet.<br />
Zur Ausstellung „Berlin plant - Erster Bericht", die am 20. August 1946 im Weißen Saal des<br />
Berliner Stadtschlosses eröffnet wurde, äußerte sich der damalige Baustadtrat Hans Scharoun:<br />
„Bei der Erarbeitung der neuen Stadt ist die geistige Voraussetzung mindestens so wichtig wie die<br />
Anwendung der technischen Mittel." Immerhin waren im Mai 1945 rund 500 000 Wohnungen zerstört<br />
und bedeckten 80 Millionen Kubikmeter Trümmer die Stadt. Auf den Zeitraum der Reparaturen<br />
folgte „der große Abschnitt der Nachkriegsgeschichte", der mit einem kleinen Studentenklubhaus<br />
(1950), dem Luftbrückendenkmal (1951) und der Mensa der Freien Universität (1952)<br />
eingeleitet wurde. Die damals entstandenen Wohnungen sind, wie es heißt, auch heute noch in<br />
Komfort und Miethöhe vorbildlich, städtebaulich aber nicht immer Schmuckstücke. Einen deutlichen<br />
Höhepunkt markiert die 1957 eröffnete „Interbau" (und man hätte hier ruhig erwähnen<br />
können, daß sie um ein Jahr verschoben werden mußte). Rund zehn Jahre später stehen die<br />
Gropiusstadt, für die sogar der Name „Brandenburgisches Viertel" sinnigerweise prämiiert worden<br />
war, und das Märkische Viertel im Mittelpunkt des Interesses, aber auch der Kritik. Dort<br />
kommt zwar auf jede Wohnung ein Baum (mehr als 14 000 sind es), und auch der Nachholbedarf<br />
an Schulen, Kindergärten, Kirchen und Läden konnte einigermaßen gedeckt werden, so daß zu<br />
einer richtigen Wohnstadt - und nicht nur „Schlafstadt" - eigentlich nur das sehr menschliche<br />
Angebot an anheimelnden Eckkneipen, von Krankenhaus und Friedhof fehlt.<br />
Wie schnellebig unsere Zeit ist, mag daraus abgelesen werden, daß der Plan von Heinz Mosch<br />
zur Oberbauung der Autobahn als ein Projekt, das völliges Neuland betritt, noch bejubelt wird,<br />
zwei Jahre später aber bereits der Konkurs der westdeutschen Mosch-Unternehmen mit ihren<br />
Auswirkungen auch auf Berlin beklagt werden muß.<br />
In jedem Fall sind die Fotografien, gelegentlich nur in Briefmarkengröße wiedergegeben, ein<br />
Stück Zeitgeschichte. Aus dem Vorwort sei zitiert: „Diese Stadt, die in ihrer kurzen Geschichte<br />
wahrlich arm an architektonischen Glanzstücken geblieben ist, hat aufgeholt und besitzt nunmehr<br />
Bauten von internationalem Niveau. So wollen wir die vielseitigen Bemühungen darstellen, diese<br />
Stadt neu erstehen zu lassen. Dem Betrachter bleibt es überlassen, zu entscheiden, was ihm gefällt"<br />
- und ob er dieses Urteil teilt. H. G. Schultze-Bcrndt<br />
Inmitten von Berlin. Zeichnungen von Kurt Mühlenhaupt zu Gedichten und Texten von<br />
Herta Zerna. Hamburg/Düsseldorf: Marion v. Schröder-Verlag 1973. 80 S., Pappbd., 22 DM.<br />
Curt Mühlenhaupt: Ringelblumen. Kindheit im Berliner Milljöh: goldene Jahre und „braune<br />
Motten". Bayreuth: Loewes-Verlag 1974. 127 S. m. Abb., lamin. Pappbd., 12,80 DM.<br />
Unter dem erstgenannten Titel sind 47 Gedichte und Texte von Herta Zerna mit 24 ganzseitigen<br />
Lithographien und Zeichnungen von Kurt Mühlenhaupt zusammengestellt. Beiden<br />
Autoren ist die Liebe zu Berlin gemeinsam, aus der heraus sie die Erlebnisse in dieser Stadt<br />
mit der Feder oder mit dem Griffel beschreiben.<br />
Herta Zernas Themen - eingebunden in den Ablauf der Jahreszeiten - befassen sich mit den<br />
Erlebnissen und Erfahrungen der Berliner einst und jetzt, in Ost und West (z. B. „Rheinsberg<br />
1912-1972"; „Weihnachtsmarkt drüben"). Die meisten Themen beziehen sich auf den West-<br />
Berliner Alltag, dessen Probleme sie mit Liebenswürdigkeit anspricht: Spießbürgerlichkeit, Bau-<br />
Boom und Verkehrsfluß, Abfall und Luftverpestung, ja sogar ein Ladendiebstahl werden -<br />
teils in Gedichten, teils in Prosa - behandelt. Es wäre aber verfehlt, anzunehmen, daß Herta<br />
Zerna nur amüsante Plauderei bietet. Sie möchte den Leser anregen, über die Probleme nachzudenken,<br />
die sie scheinbar mit leichter Hand anspricht. Als Beispiel sei das „Lied vom<br />
Weihnachtsmann" (S. 76) von 1932 genannt, das mich in dieser Hinsicht am stärksten beeindruckt<br />
hat.<br />
Die 24 ganzseitigen Abbildungen von Kurt Mühlenhaupt sind zum größten Teil seiner Graphikmappe<br />
„Blücherstraße 13" und der losen Folge seiner „Berliner Blätter" entnommen.<br />
107
Obwohl diese Abbildungen gegenüber den Originalgraphiken ein verkleinertes Format haben,<br />
haben sie nichts von ihrer Kraft eingebüßt. Gelegentlich eingestreute figürliche Darstellungen<br />
im Text und die Zeichnungen auf S. 57, 69 und 73 hat Mühlenhaupt eigens für dieses Buch<br />
gemacht (Maßstab 1 : 1). Wie kein anderer lebender Maler versteht er das oft zitierte Milieu<br />
der kleinen Leute in Berlin darzustellen: Szenen auf der Straße oder dem Hinterhof, vor der<br />
Haustür oder der Markthalle, in der Kneipe oder am Landwehrkanal geben ein beredtes Zeugnis<br />
davon. Mit diesen Darstellungen verbindet der Maler und Graphiker keine Sozialkritik im<br />
Sinne einer Anklage. Er möchte uns über Witz und Ironie hinweg, die auch aus diesen<br />
Abbildungen sprechen, zu einer Sicht der Mitmenschen führen, aus der heraus wir über sie<br />
lächeln, aber nicht lachen oder gar spotten können. Lächeln im Sinne von Aggressionsabbau,<br />
lächeln in dem Sinne: Hier erkenne ich mich selbst wieder. Lächeln als kleiner Schritt hin<br />
zu einem liebevollen Verständnis des anderen. In der in dem vorliegenden Band gebotenen<br />
Auswahl zeigt sich dieses Bemühen des Künstlers für mich am stärksten auf den Seiten 41<br />
und 77.<br />
Wenn man Texte und Bilder genau vergleicht, erkennt man, daß sie nachträglich zusammengestellt<br />
wurden, was keiner Kritik bedarf, würde nicht der Herausgeber auf der Rückseite<br />
des Einbandes behaupten, Kurt Mühlenhaupt illustriere mit diesen Abbildungen die Gedichte<br />
von Herta Zerna. Dies stimmt einfach nicht. Bekanntlich hat Mühlenhaupt die Graphikmappe<br />
„Blücherstraße 13" mit einem eigenen Text versehen und gelegentlich auch die „Berliner<br />
Blätter". Der künstlerische Zusammenhang von Text und Bild wird durch die hier vorliegende<br />
Auswahl und Zusammenstellung „Inmitten von Berlin" auseinandergerissen. Dies fällt<br />
besonders kraß auf den Seiten 78 und 79 auf: Dem Gedicht „Weihnachtsmarkt drüben" von<br />
Herta Zerna wird die Darstellung der Heilig-Kreuz-Kirche in der Blücherstraße gegenübergestellt.<br />
Dagegen ergibt sich in dem Buch „Ringelblumen" von Kurt Mühlenhaupt wieder eine Einheit<br />
von Bild und Text, da hier der Künstler beides selbst verfaßt hat. Mühlenhaupt erzählt in<br />
diesem Band die Geschichte seiner Kindheit und Jugend in einer losen Folge von Kurzgeschichten,<br />
die durch Zeichnungen anschaulich illustriert werden. Wie er selbst sagte, wußte er<br />
während der Arbeit an diesem Buch oftmals nicht, ob er lieber zeichnen oder schreiben sollte:<br />
Wort und Bild gehen ineinander über.<br />
Der Verfasser, der nicht nur als Maler, sondern auch als Kinderbuchautor bekannt ist, wendet<br />
sich mit diesem Band an Kleine und Große. Der Text ist bewußt einfach gehalten, ohne vordergründig<br />
naiv zu sein. Wir erfahren u. a. die kindliche Verbundenheit mit der Natur in<br />
der Laubenkolonie, die verwirrende Welt des Wochenmarktes, jugendliche Streiche durch Mottenkugeln<br />
und Juckpulver. Dabei sind Mühlenhaupts Erzählungen durchaus geprägt von der<br />
Zeitgeschichte, wie der Untertitel des Buches bereits andeutet. So begegnen dem kleinen Kurt<br />
die Folgen des ersten Weltkrieges beim Spielen in den Sandkuten und die sozialen Unterschiede<br />
der Weimarer Zeit schon deutlich in den ersten Schultagen. Später wird der heranwachsende<br />
Mühlenhaupt mit Politik konfrontiert, und er versucht auf seine Weise, mit seinen Spielkameraden<br />
die „braunen Motten", die Nazis, zu bekämpfen. Der Verfasser will aber nicht<br />
nur unterhalten, er verfolgt auch eine pädagogische Absicht. Am deutlichsten wird dies im<br />
zweiten Teil des Buches mit den Geschichten vom Ladendiebstahl, von der Liebe zwischen<br />
Mann und Frau und von der Schularbeit, die plötzlich sogar Spaß machen kann. Im Deutschund<br />
Religionsunterricht in Grundschulen haben sich diese Geschichten bereits bewährt. Die<br />
Schüler können sich mit dem kleinen Kurt identifizieren und fühlen sich direkt angesprochen.<br />
Die Volkstümlichkeit des Verfassers erweist sich mit diesem Buch von neuem: So schlicht<br />
und direkt den kleinen wie den großen Leser ansprechen kann nur der, der unverbildet und<br />
unverkrümmt den Zugang zu dem einfachen Volk nicht verloren hat, aus dem er selbst<br />
stammt. Dies trifft bei Kurt Mühlenhaupt zu, und deshalb macht es auch so großen Spaß,<br />
dieses Buch zu lesen. Erika Schachinger<br />
Sigfrid v. Weiher: Berlins Weg zur Elektropolis. Technik- und Industriegeschichte an der Spree.<br />
Berlin: Stapp-Verlag u. Siemens AG 1974. 206 S., 53 Abb., Leinen, 24 DM.<br />
Arne Hengsbach: Die Siemensstadt im Grünen. Zwischen Spree und Jungfernheide 1899-1974.<br />
Berlin 1974 (Vertrieb: Stapp-Verlag u. Bücherstube Siemensstadt). 73 S. m. Abb. u. Plänen,<br />
brosch., 5,80 DM.<br />
In gedrängter Form liefert Sigfrid von Weiher einen Abriß der Technik- und Industriegeschichte<br />
Berlins bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Vom Beginn der Berliner industriellen<br />
Entwicklung im 18. Jh. über das Entstehen einer leistungsfähigen Berliner Maschinenbauindustrie<br />
im frühen 19. Jh. bis zu den Anfängen und zur Blüte der Berliner Elektroindustrie<br />
im späten 19. und frühen 20. Jh. und den Rückschlägen durch die beiden Weltkriege reicht der<br />
vom Vf. gespannte Bogen. Technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen wird gleichermaßen<br />
10S
Rechnung getragen. Eine umfassende Quellen- und Literaturkenntnis - der Vf. ist Archivar<br />
der Siemens AG - kommt dem Werk zugute. Die Anmerkungen geben eine Fülle von Informationen<br />
zur Weiterarbeit. Die Entwicklung der Berliner Elektroindustrie nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg wird in einer Art Epilog von Gottfried Vetter geschildert. Steht auch die Elektroindustrie<br />
- einst in der Welt führend - im Mittelpunkt des Buches, so werden auch die wirtschaftlichen<br />
Voraussetzungen, z. B. die Verkehrsverhältnisse, nicht nur der Frühzeit, sondern<br />
auch der Zeit des Kaiserreiches berücksichtigt (S. 72). Hier haben sich dann allerdings kleinere<br />
Fehler eingeschlichen. So ist die Ringbahn - bis auf ein fehlendes westliches Verbindungsstück -<br />
bereits 1871 dem Verkehr übergeben worden, d.h. vor Eröffnung der Stadtbahn, deren östlicher<br />
und westlicher Endpunkt erst seit der Weimarer Zeit die Namen „Ostkreuz" und „Westkreuz"<br />
tragen.<br />
Mit dem vorliegenden Buch besitzen wir jetzt eine in ihrer Knappheit prägnante Darstellung<br />
der einzigartigen Entwicklung, die die Berliner Elektroindustrie in ihrer mehr als hundertjährigen<br />
Geschichte genommen hat.<br />
Einer „Elektropolis" im engeren Sinne ist das von Arne Hengsbach verfaßte Heft „Die Siemensstadt<br />
im Grünen" gewidmet. Anlaß war das 75jährige Jubiläum der Verlegung der ersten<br />
Siemens-Fertigungsstelle, des Kabelwerkes, in die damaligen Nonnendammwiesen, eine Spandauer<br />
Exklave am Rande des ehemaligen Stadtteils Charlottenburg. In rascher Folge wurden<br />
weitere Siemensbetriebe in das bisherige Wiesen- und Waldgelände nördlich der Spree verlegt.<br />
Erste Wohnviertel - zunächst südlich der Nonnendammallee - wurden errichtet. 1914, als der<br />
Stadtteil offiziell den Namen Siemensstadt erhielt, befand sich dort bereits der Schwerpunkt<br />
des weltweit operierenden Berliner Konzerns. Auch die Zwischenkriegszeit bedeutete für die<br />
Siemensstadt eine Zeit reger Bautätigkeit. Es entstanden die Industrie- und Wohnsiedlungen<br />
des Chefarchitekten des Hauses Siemens, Hans Hertlein, die Großsiedlung Siemensstadt, an<br />
der u. a. Scharoun, Gropius und Bartning entscheidend mitgewirkt haben. Die Bauten zeugen<br />
noch heute vom hohen Rang des damaligen Städtebaus. Auch nach 1945 und nach der Verlegung<br />
des Siemens-Hauptfirmensitzes nach Westdeutschland ging die Entwicklung des Stadtteils<br />
weiter. Neue Wohnsiedlungen entstanden, und auch die Industrie ist heute nicht nur auf<br />
den einen Großbetrieb beschränkt.<br />
Auf die anderen in dem Buch ausführlich abgehandelten Themen, wie die Verkehrserschließung,<br />
das Verhältnis der bis 1920 selbständigen Städte Charlottenburg und Spandau zueinander, die<br />
Entwicklung der Infrastruktur des Ortsteiles, soll hier nicht eingegangen werden. Unbedingt<br />
aber muß die reiche, in ihrer Auswahl vorzügliche Bebilderung hervorgehoben werden. Leider<br />
- dies ist der einzige zu bemängelnde Punkt - fehlt ein Quellen- und Literaturverzeichnis.<br />
Felix Escher<br />
Moritz Lazarus und Heymann Steinthal. Die Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen.<br />
Mit einer Einleitung hrsg. von Ingrid Belke. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1971.<br />
CXLII, 421 S., 5 Abb., Leinen, 98 DM. (Schriftenreihe wiss. Abhandlungen d. Leo-Baeck-Instituts,<br />
Bd. 21.)<br />
Lazarus und Steinthal figurieren prominent in der deutsch-jüdischen Geschichte des ausgehenden<br />
19. Jahrhunderts, namentlich in Berlin. Lazarus (* 1824 Filehne/Posen - f 1903 Meran), jüdisch<br />
wie allgemein gründlich ausgebildet, war als Philosoph und Psychologe zunächst Professor in<br />
Bern. Von 1868 bis 1872 lehrte er an der preußischen Kriegsakademie in Berlin, und erst danach<br />
erhielt er eine Honorarprofessur an der Berliner Universität; als Jude konnte er damals in<br />
Deutschland nicht Ordinarius werden. 1872 gehörte er zu den Gründern der Lehranstalt (Hochschule)<br />
für die Wissenschaft des Judentums in der Reichshauptstadt. Bei der Bekämpfung des<br />
Antisemitismus eines Stöcker und Treitschke stand er in vorderer Linie. Steinthal, 1823 in Gröbzig/Anhalt<br />
geboren und 1899 in Berlin gestorben, studierte Sprachwissenschaften und Philosophie,<br />
habilitierte sich 1850 an der Berliner Universität, verbrachte mehrere Jahre studienhalber<br />
in Paris und erhielt 1855 eine außerordentliche Professur in Berlin. 1872 war er Mitglied des<br />
ersten Dozentenkollegiums der vorgenannten jüdischen Hochschule, an der er Bibelwissenschaft<br />
und Religionsphilosophie lehrte.<br />
Die beiden hatten sich in Berlin kennengelernt, wo sie bei dem Sprachwissenschaftler Prof. Carl<br />
W. L. Heyse eifrig hörten, schlössen enge Freundschaft und wurden später Schwäger. So verschieden<br />
sie in ihrem Wesen waren - in ihren Interessen und Ideen begegneten sie einander und ergänzten<br />
sich. Gemeinsam schufen sie den Begriff der Völkerpsychologie, und gemeinsam gründeten<br />
sie 1860 die Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft.<br />
Die vorliegende Briefedition hat eine längere Vorgeschichte, weil mehrere Bearbeiter vorzeitig<br />
starben. Gegen Ende der 50er Jahre gelangte dann das Briefmaterial in die Hände des Leo-<br />
Baeck-Instituts in New York, das der Erforschung und Darstellung der neuzeitlichen Geschichte<br />
des deutschen Judentums dient, und von diesem wurde schließlich die jetzt in Basel ansässige<br />
Germanistin und Historikerin Ingrid Belke mit der endgültigen Herausgabe der Briefe betraut.<br />
109
Die Publikation zerfällt in drei ungleich große Teile. Zwei Drittel enthalten rund 150 ausgewählte<br />
Briefe, die Lazarus zwischen 1845 und 1903 an mehr als 50 verschiedene und verschiedenartige<br />
Zeitgenossen gerichtet hat. Abgesehen von Steinthal und Paul Heyse (1830-1914), dem<br />
Sohn des Professors und nachmaligen Literaturnobelpreisträgers, handelt es sich um Verwandte,<br />
um jüdische wie nichtjüdische Gelehrte (Philosophen, Theologen, Literaturhistoriker) und Schriftsteller,<br />
auch um Rabbiner, Pädagogen, Politiker. Moritz Lazarus hatte einen großen Kreis, er<br />
pflegte die Beziehungen zu Menschen und liebte Geselligkeit. Ihm lag viel an Gedankenaustausch<br />
und geistiger Auseinandersetzung. Diesem seinem Bild entspricht der Stil seiner Briefe; sie klingen<br />
höflich geschäftlich-sachlich, in ihrer Form sind sie oft elegant, weltmännisch. Ganz anders<br />
Steinthal. Von ihm sind etwa 40 Briefe (ausschließlich an Lazarus) aus den 50er und 60er Jahren<br />
des vorigen Jh.s abgedruckt. Obwohl er aus einem ähnlichen kleinstädtischen Milieu kam wie<br />
Lazarus, wirkt er wie aus anderem Holz geschnitzt: seine Briefe sind schlichter, inniger, für die<br />
Familie bestimmte, zuweilen tagebuchartige Stimmungsberichte. Oft enthalten sie persönliche Mitteilungen<br />
mit selbstironischem Unterton. Gleichzeitig vermitteln sie zuweilen Gedanken wissenschaftlicher<br />
Natur, wie sie etwas weltfremde, grübelnde Forscher äußern. Die Herausgeberin hat<br />
ihren Auftrag nicht eng aufgefaßt: Zu der eigentlichen Edition hat sie eine den beiden Gelehrten<br />
zu gleichen Teilen gewidmete, sorgfältige Lebens- und Werksbeschreibung verfaßt und in diese<br />
einige wichtige Exkurse, z. B. über Völkerpsychologie, über den Antisemitismusstreit, eingeflochten.<br />
Zusammengenommen ist dieser lehrreiche und lesenswerte, zudem hervorragend lesbare „Vorspann"<br />
zu einem wesentlichen Bestandteil des ganzen Werks geworden. Ein zweiter Briefband<br />
Lazarus-Steinthal ist in Aussicht genommen. Ernst G. Lowenthal<br />
Eingegangene Bücher<br />
(Besprechung vorbehalten)<br />
Arendt, Hannah: Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik.<br />
Frankfurt/Berlin/Wien: Ullstein 1974. 300 S. (Ullstein-Buch Nr. 3091).<br />
Bauordnung für Berlin in der Fassung vom 13. Februar 1971. Kommentar mit Rechtsverordnungen<br />
und Ausführungsvorschriften. Gütersloh: Bertelsmann Fachverlag 1972. 516 S.<br />
Berliner Handelsregister-Verzeichnis. Leitende Personen der Berliner Wirtschaft. Bearb. durch<br />
Kurt Röder. Berlin: Adreßbuch-Gesellschaft 1974. 798 S.<br />
Berliner Stadt-Adreßbuch. Bd. II: Branchen-Adreßbuch für Berlin (West). Berlin: Adreßbuch-<br />
Gesellschaft 1975.<br />
Botting, Douglas: Alexander von Humboldt. Biographie eines großen Forschungsreisenden. München:<br />
Prestel 1974. 402 S. m. Abb.<br />
Braulieb, Heinrich: Max Reinhardt. Theater zwischen Traum und Wirklichkeit. (Ost-)Berlin:<br />
Henschelverlag 1969. 320 S. m. Abb.<br />
600 Jahre Britz 1375-1975. Festschrift. (Text: Herbert Fätkenheuer.) 56 S. m. Abb.<br />
Bruno Paul. Hrsg. von Lothar Lang. München: Rogner & Bernhard 1974. 112 S. m. Abb. (Klassiker<br />
der Karikatur. 11).<br />
Das Berliner Taxigewerbe - Sonderausgabe 1900-1975. Hrsg. zum 75jährigen Bestehen der Innung<br />
des Berliner Taxigewerbes. Berlin: Selbstverl. 1975. 88 S. m. 111.<br />
Döblin, Alfred: Griffe ins Leben. Berliner Theaterberichte 1921-1924. Hrsg. u. eingel. von Manfred<br />
Beyer. (Ost-)Berlin: Henschelverlag 1974. 288 S.<br />
Drewitz, Ingeborg: Wer verteidigt Katrin Lambert? Roman. Stuttgart: Gebühr 1974. 175 S.<br />
Edel, Peter: Die Bilder des Zeugen Schattmann. Ein Roman über deutsche Vergangenheit und<br />
Gegenwart. Frankfurt a. M.: Röderberg-Verl. 1973. 560 S.<br />
Fischer-Fabian, Siegfried: Berlin-Evergreen. Bild einer Stadt in sechzehn Porträts. Frankfurt/<br />
Berlin/Wien: Ullstein o. J. 188 S. (Ullstein-Buch Nr. 3005).<br />
Fragen an die deutsche Geschichte. Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart.<br />
Katalog zur Historischen Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin. Bearb. von Lothar<br />
Gall. Stuttgart: Kohlhammer 1974. 224 S. Text m. Abb. und 316 Abb. auf Taf.<br />
Franke, Wilhelm: So red't der Berliner. Ein lustiger Sprachführer. 11. Aufl. Berlin: arani 1975,<br />
61 S. m. 111.<br />
Gelandet in Berlin. Zur Geschichte der Berliner Flughäfen. Hrsg.: Berliner Flughafengesellschaft<br />
mbH (1974). 355 S. m. Abb.<br />
Granach, Alexander: Da geht ein Mensch. Der Lebensroman eines Schauspielers. München: Herbig<br />
1973. 304 S.<br />
Hofmeister, Burkhard: Berlin. Eine geographische Strukturanalyse der zwölf westlichen Bezirke.<br />
Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1975. 468 S. m. Karten u. Schaubildern, 25 Abb. auf Taf.<br />
(Wiss. Länderkunden, Bd. 8/1).<br />
110
König, Rolf: Mit Pille, Spritze und Skalpell. Anekdoten um Berliner Ärzte und ihre Patienten.<br />
Berlin: Rembrandt 1975. 140 S. m. 111.<br />
Lemmer, Konrad (Hrsg.): Berliner Anekdoten und Geschichten. Berlin: Rembrandt 1974. 136 S.<br />
m. 111.<br />
Lundgreen, Peter: Techniker in Preußen während der frühen Industrialisierung. Berlin: Colloquium<br />
1975. 307 S. (Einzelveröff. d. Histor. Kommission zu Berlin, Bd. 16).<br />
Mahncke, Dieter: Berlin im geteilten Deutschland. München/Wien: Oldenbourg 1973. 325 S.<br />
(Schriften d. Forschungsinstituts der Dt. Gesellsch. f. Auswärtige Politik e. V., Bd. 34).<br />
Max Reinhardt - Schriften, Briefe, Reden, Aufsätze, Interviews, Gespräche, Auszüge aus Regiebüchern.<br />
Hrsg. von Hugo Fetting. (Ost-)Berlin: Henschelverlag 1974. 528 S. m. Abb.<br />
Oehlmann, Werner: Das Berliner Philharmonische Orchester. Kassel: Bärenreiter 1974. 199 S.<br />
m. Abb.<br />
Paul, Wolfgang: Einladung ins andere Deutschland. Hundert Städte und Landschaften zwischen<br />
Rügen und dem Erzgebirge. Frankfurt a. M.: Weidlich 1967. 320 S., 20 Abb.<br />
Reichardt, Hans D.: Berliner S-Bahn. 50 Jahre elektrischer Stadtschnellverkehr. - Ders.: Berliner<br />
U-Bahn. - Ders.: Die Straßenbahnen Berlins. Eine Geschichte der BVG und ihrer Straßenbahnen.<br />
Düsseldorf: Alba Buchverlag 1974. 144, 112 u. 96 S., jeweils mit Abb. u. Zeichn.<br />
Reuter, Ernst: Schriften - Reden. Hrsg. von Hans E. Hirschfeld (f) und Hans J. Reichhardt.<br />
Bd. 3: 1946-1949. Berlin: Propyläen 1974. 944 S.<br />
Schmädeke, Jürgen: Das Fernsehzentrum des Senders Freies Berlin. Berlin: Haude & Spener<br />
1973. 75 S. Text, 50 Tafel-Abb. (Buchreihe des SFB, 13).<br />
Scholz, Hans: Wanderungen und Fahrten in der Mark Brandenburg. Bd. 1-3. Berlin: Stapp<br />
1973-75. 156, 179 und 188 S., jeweils mit Abb. u. Km.<br />
Schramm, Adalbert Georg: Heiteres vom dritten Hof. Ein Blick in das Herz des Berliners.<br />
Berlin: Rembrandt 1974. 80 S. m. 111.<br />
Schreiber, Georg: Husaren vor Berlin. Wien/München: Jugend und Volk Verlagsgesellsch. 1974.<br />
221 S.<br />
Scbrißsteller in Berlin. Einzelheft der Zeitschrift „europäische ideen", Hrsg.: Andreas W. Mytze.<br />
Heft 7, Berlin 1974, 45 S.<br />
Steineckert, Gisela, u. Joachim Walther: Neun-Tage-Buch. Die X. Weltfestspiele in Berlin - Erlebnisse,<br />
Berichte, Dokumente. (Ost-)Berlin: Verl. Neues Leben, u. Dortmund: Weltkreis-<br />
Verlags-GmbH 1974. 267 S. m. Abb.<br />
Stützle, Walther: Kennedy und Adenauer in der Berlin-Krise 1961-1962. Bonn-Bad Godesberg:<br />
Verl. Neue Gesellschaft 1973. 253 S. (Schriftenreihe d. Forschungsinstituts d. Friedr.-Ebert-<br />
Stiftung, Bd. 96).<br />
Wendland, Victor: Die Wirbeltiere Westberlins. Berlin: Duncker & Humblot 1971. 128 S. m. Abb.<br />
Wladimir Iljitsch Lenin in Berlin und als Leser der Königl. Bibliothek, der heutigen Deutschen<br />
Staatsbibliothek. (Ost-)Berlin: Dt. Staatsbibliothek 1970. 40 S. m. Abb.<br />
Zivier, Georg, Hellmut Kotschenreuther u. Volker Ludwig: Kabarett mit K. Fünfzig Jahre große<br />
Kleinkunst. Berlin: Berlin-Verlag 1974. 156 S. m. Abb.<br />
Im III. Vierteljahr 1975<br />
haben sich folgende Damen, Herren und<br />
Berliner Baugenossenschaft e. G.<br />
1 Berlin 41, Brentanostraße 19<br />
Tel. 8 21 10 95 (Harry Richter)<br />
Heinrich Buecheler, Soldat<br />
5308 Rheinbach, Lilienweg 21<br />
Tel. (0 22 26) 52 83 (W. G. Oschilewski)<br />
Wilhelm Bratspis, Verwaltungsbeamter a. D.<br />
1 Berlin 42, Adolf-Scheidt-Platz 3<br />
Tel. 7 86 69 91 (Schriftführer)<br />
Heinz Hoffmann, Leiter der Filiale des<br />
Westermann-Verlages<br />
1 Berlin 31, Kaubstraße 7 a<br />
Tel. 87 75 12<br />
Institutionen zur Aufnahme gemeldet:<br />
Prof. Hans-Dieter Holzhausen, Hochschullehrer<br />
1 Berlin 33, Breitenbachplatz 12<br />
Tel. 8 241528 (Eva-Maria Holzhausen)<br />
Dr. Albert Lindemann, HNO-Facharzt<br />
1 Berlin 27, Lachtaubenweg 8 a<br />
Tel. 4 31 21 44 (Schriftführer)<br />
Rosemarie Richter, techn. Angestellte<br />
1 Berlin 37, Mühlenstraße 3<br />
Tel. 8 15 30 23 (Schriftführer)<br />
Alexander von Stahl, Senatsdirektor<br />
1 Berlin 21, Solinger Straße 4<br />
Tel. 3 91 81 18 (K. Pomplun)<br />
111
Veranstaltungen im IV. Quartal 1975<br />
1. Mittwoch, 8. Oktober 1975, 18 Uhr: Besichtigung der Ausstellung „Berlin vor<br />
30 Jahren" in der Ausstellungshalle des Neubaues der Landesbildstelle Berlin,<br />
Berlin 21, Wikingerufer 7 (Busse 23 und 90). Führung: Herr Dr. Friedrich Terveen.<br />
2. Dienstag, 28. Oktober 1975, 18 Uhr: Besichtigung der Ausstellung „Helmuth von<br />
Moltke - 1800-1891. Zum 175. Geburtstag des Generalfeldmarschalls" im Geheimen<br />
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, Archivstraße 12-14<br />
(Busse 1, 68, U-Bahn Podbielski-Allee). Führung: Frau Dr. Cecile Lowenthal-<br />
Hensel.<br />
3. Dienstag, 11. November 1975, 19.30 Uhr: Filmvortrag „Berlin 1927", ein Dokumentarfilm<br />
über Stadt und Menschen. Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
Leitung: Herr Wolf Rothe.<br />
4. Dienstag, 25. November 1975, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Michael<br />
Engel: „Grabstätten auf Berliner Friedhöfen." Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
5. Dienstag, 9. Dezember 1975, 19.30: Lichtbildervortrag von Herrn Prof. Dr. Julius<br />
Posener: „Was bedeutet uns das bauliche Erbe Berlins?" Filmsaal des Rathauses<br />
Charlottenburg.<br />
6. Sonnabend, 20. Dezember 1975, 16 Uhr: Vorweihnachtliches Beisammensein mit<br />
Lichtbildervortrag von Herrn Hans Werner Klünner: „Weihnachtszeit im Alten<br />
Berlin." Ratskeller Schöneberg, Berlin 62, John-F.-Kennedy-Platz.<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek<br />
ist zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen<br />
geselliges Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 24. Oktober, 21. November und 12. Dezember, zwangsloses Treffen in der<br />
Vereinsbibliothek ab 17 Uhr.<br />
Wir weisen darauf hin, daß der Mindest-Jahresbeitrag 36 DM beträgt und bitten um umgehende<br />
Überweisung noch ausstehender Beiträge für das Jahr 1974 und 1975. Auf Wunsch kann<br />
eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 4 65 90 11. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1 Berlin 21.<br />
Bibliothek: 1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus). Geöffnet: freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Claus P.<br />
Mader; Günter Wollschlaeger. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt,<br />
Bezugspreis für Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
112
J<br />
A 20 377 F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
72. Jahrgang Heftl Januar 1976<br />
Optische Anstalt<br />
C.P.Croerz,<br />
Berlin-Friedenau VSf^<br />
lUW-Vorit: 52 Käst Union Square- Pari*: 22 medel'Emrepöt. Cettfott: 4 u. sHolborn-Circus. EC.<br />
Fabrik photographischer Apparate.<br />
Goerz-Änschütz 1<br />
Moraent-<br />
Klapp-Apparat.<br />
Vorzügl. Taschenapparat, für schnellste Momentaufnahmen bis ZU > um, Sek eingerichtet<br />
VorzüRe: Geringer Umfang, Doppel-Anasügniat, Schlit^verschiuss, umklappbare* Visir.<br />
Formate: 6'„x9, 9x12, 12X16C ,)i 13X18 cm und Stereoskop.<br />
Goerz AnscMtz' Schlitz Verschluss<br />
mit verstellbarem Schlitz<br />
gestattet bei rfoBer Ausnutzung der Lichtstärke des<br />
Obiectivs Belichtungen bis herab zu tf%m Sekunde.<br />
Kanu für jede Camera angefertigt vurden, welche<br />
mit umseuharem. Hinterrahmen oder mit Falz für Capsetten<br />
versehen ist Einsendung der Camera zum Hinpassen<br />
tsjt durchaus nothwendig.<br />
Für Formate von 6X 9 *« s 30V 40 C,H und Stereoskop.<br />
Goerz'<br />
Sectoren-Yerschluss<br />
für Zeit- u. Moment-Auinahmen.<br />
Besondere Vorzüge:<br />
Einfacher, vollständig geschützter Mechanismus,<br />
geringes Gewicht, geringer Umfang,<br />
sichere Verstell bar keit der Schnelligkeit und<br />
der Blendenöffnung in den Grenzen von '/,,„,<br />
bis i Sekunde Rapides Oeffnen und Seh.lie.ssen,<br />
daher kern Liehtverhist G!et< hmäs-ige Lichtvenheilung<br />
über das Bild Oeffnet und sddiesst sich völlig geräuschlos, bleibt beim Spannen<br />
geschlossen<br />
Hauptpreisliste über photographische Objecüve (Goerz;" Poppei - Anastigmate, Lynkeioskope etc.)<br />
und photographische Apparate auf Wunsch kostenfrei<br />
113
Die Geschichte der Photographie in Berlin<br />
Teil I: 1839-1900<br />
Von James E. Cornwall<br />
„Man ist hier noch immer nicht genug gegen französische Windbeuteleien verwahrt",<br />
kommentierte die Vossische Zeitung vom 28. August 1839 die Erfindung der Photographie.<br />
In Paris wurde nämlich 9 Tage zuvor während einer Sitzung der Akademie der<br />
Wissenschaften, durch Francois Arago, die genaue Beschreibung der photographischen<br />
Prozesse von Nicephore Niepce und Louis Jacques Mande Daguerre bekanntgegeben.<br />
Das Verfahren bestand darin, daß man eine versilberte Metallplatte Joddämpfen aussetzte<br />
und die Platte danach in einer Kamera belichtete. Im Anschluß daran wurde die<br />
belichtete Metallplatte durch Quecksilberdämpfe entwickelt. Das ergab auf der spiegelnden<br />
Platte ein positiv erscheinendes Bild (Daguerreotypie genannt).<br />
Die Einführung der Daguerreotypie in Berlin verdanken wir dem Kunsthändler Louis<br />
Friedrich Sachse (12. 7. 1798-29. 10. 1877), Besitzer einer lithographischen Anstalt in<br />
Berlin, Jägerstraße 30. Sachse war mit Daguerre persönlich befreundet und wurde bereits<br />
im April 1839 in sein Geheimnis eingeweiht. Die Kamera, die Daguerre zur Herstellung<br />
seiner Bilder benutzte, ließ er bei der Firma Giroux & Co. in Paris bauen. Sachse traf<br />
mit dieser Firma schon im Juli 1839 ein Abkommen wegen der Einführung der ersten<br />
Daguerre'schen Apparate in Deutschland. Am 6. September erhielt Sachse aus Paris die<br />
ersten sechs Apparate zum Preis von je 465 Francs, nebst dem nötigen Zubehör von<br />
Kupferplatten, Gläsern und Chemikalien. Infolge unzureichender Verpackung brachen<br />
sämtliche Flaschen sowie die Kameras und man kann sich vorstellen, welche Wirkung<br />
die Chemikalien auf das Holz hatten. Sachse ließ die Kameras reparieren und begann<br />
endlich am 20. September 1839 mit Erfolg zu arbeiten.<br />
Während Sachse der erste war, der in Berlin die ersten Originalkameras aus Paris einführte,<br />
kann der Berliner Optiker Carl Theodor Dörffel (1810-1878) das Verdienst für<br />
sich in Anspruch nehmen, als erster deutsche Apparate gefertigt zu haben. So stellte er<br />
bereits am 16. September 1839 einen Probeapparat in seinem Laden, Unter den Linden 46,<br />
zur Ansicht aus und nahm dort auch gleich Bestellungen entgegen. Die Silberplatten für<br />
das Verfahren lieferte Johann George Hossauer (5. 10. 1794-14. 1. 1874), der Hofgoldschmied<br />
Friedrich Wilhelms III.<br />
Das Daguerreotypieren, welches zumeist sonntags betrieben wurde, war für die Beteiligten<br />
ein Nebengeschäft. Die anfänglichen Belichtungszeiten bei Sonnenschein betrugen immerhin<br />
15-30 Minuten. Unsere Urgroßväter hatten daher manchmal beim Photographen<br />
folgendes gehört: „Gut so, sitzen Sie still. Ich werde die Klappe abnehmen und dann<br />
Mittag essen. Wenn ich wiederkomme, werde ich die Sitzung schließen."<br />
Im Laufe der nächsten zwei Jahre konnte jedoch durch Entwicklung lichtstärkerer Objektive<br />
die Belichtungszeit auf 1 Minute reduziert werden. Die „kurze" Belichtungszeit<br />
erleichterte das Photographieren von Personen und ebnete somit den Weg für die Berufsphotographie.<br />
Der erste Berliner Berufsphotograph war Johann Carl Conrad Schall (3.4.1805-2.3.<br />
1885), Sohn des Porzellanmalers Johann Friedrich Schall. Er eröffnete im Mai 1842 ein<br />
„öffentliches Conterfei-Atelier", Zimmerstraße 41. Geworben hatte er mit folgendem<br />
114
Abb. la-c<br />
Text: „Lichtbilder-Portraits mit dem Daguerreotyp in einer Minute gefertigt, werden in<br />
beliebiger Größe täglich von 9-3 Uhr gemacht".<br />
Die Daguerreotypisten (so wurden die ersten Photographen genannt) kamen überwiegend<br />
aus artverwandten Berufen, wie z. B. Portraitmaler, Kupferstecher, Zeichenlehrer<br />
und Optiker. Aber auch „Umschüler" waren dabei, wie der Juwelier Altmann, der Tapezierer<br />
Bodinus, der Nadler Siebert und, nicht zu vergessen, der Hühneraugenoperateur<br />
Cusany. Offenbar hatte jedoch August Friedrich Cusany beim Entfernen von Hühneraugen<br />
mehr Erfolg als beim Photographieren, denn er hängte den Beruf als Daguerreotypist<br />
schon nach einem Jahr wieder an den „Nagel".<br />
Bereits im Jahre 1846 gab es 18 photographische Ateliers in Berlin. Bis zum Jahre 1850<br />
blieb die Zahl der Ateliers ungefähr konstant und stieg dann aber bis 1853 sprunghaft<br />
auf eine Zahl von 46 an. Diese Tendenz setzte sich weiter fort, woraufhin man im Jahre<br />
1860 bereits 94 Photographen in der Stadt verzeichnen konnte. Aus der „Grünen<br />
Apotheke" von Schering, Chausseestraße 21, wurden die Photographen ab 1854 mit<br />
entsprechenden Chemikalien, die sie für ihre Arbeit benötigten, versorgt.<br />
Unabhängig von der Erfindung Daguerres war es einem Engländer gelungen, Photographien<br />
auf Papierunterlagen herzustellen. Die Möglichkeit, beliebig viele positive<br />
Abzüge herstellen zu können, schaltete in steigendem Maße die Daguerreotypie aus. Die<br />
letzten Daguerreotypien wurden um 1860 hier in Berlin angefertigt.<br />
Bisher war die Photographie den Berufsphotographen und einigen wohlhabenden<br />
Amateuren vorbehalten. In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts erschien dann die<br />
„Reise"-Kamera. Sie war zusammenlegbar, wesentlich leichter und eroberte sich schnell<br />
die Sympathie der Amateure, die von nun an in steigendem Maße selbst zu photographieren<br />
begannen.<br />
115
Den Bedarf an Kameras, der dadurch zwangsläufig entstand, deckten in erster Linie<br />
Berliner Möbeltischler, die sich davon eine lukrative, zusätzliche Einnahmequelle versprachen.<br />
Diese Vermutung bestätigte sich dann auch, denn viele Möbeltischler fertigten<br />
nach ein paar Jahren nur noch Holzkameras. Kameratischler siedelten sich in der Reichenberger-,<br />
Prinzen- und Oranienstraße an und waren bald danach auch über Berlins Grenzen<br />
hinaus für ihre präzise und solide Arbeit bekannt. Namen wie Stegemann, Heßler<br />
und Gareis waren auch nach der Jahrhundertwende dominierend auf dem Gebiet des<br />
Kamerabaus in Berlin.<br />
Als 1854 das „Visitbild" erschien (siehe Abb. 1 a-c) und die Preise für das kleine Format<br />
erheblich sanken, hatten die Photographen einen solchen Zustrom, daß man nur nach<br />
Anmeldung und wochenlanger Wartezeit photographiert werden konnte. Wenn auch<br />
gerade damals die Einführung der „Visitbilder", die im Dutzend gekauft werden mußten,<br />
neues Leben ins Geschäft gebracht hatte, so zeigten sich auch schon die Verfallserscheinungen<br />
der Portrait-Photographie in Form von Preisdrückereien. Diejenigen unter den<br />
Photographen, die sich Gedanken um die Zukunft machten, sahen allmählich ein, daß<br />
der drohenden Übersättigung des Publikums nur eine Hebung der Qualität helfen<br />
konnte. Dies diskutierten sie auch in Gemeinschaft Gleichgesinnter und es kristallisierte<br />
sich der Wunsch heraus, eine fachliche Interessengemeinschaft zu gründen. Am 20. November<br />
1863 wurde der „Photographische Verein zu Berlin" von seinem Gründer Dr. Hermann<br />
Wilhelm Vogel (26. 3. 1834-17. 12.1898) aus der Taufe gehoben.<br />
In der Gründungssitzung des Vereins hatte Dr. Vogel unter den künftigen Aufgaben des<br />
Vereins auch die Veranstaltung photographischer Ausstellungen genannt. Dieser Punkt<br />
lag Vogel besonders am Herzen. Er erstrebte eine Ausstellung aus mehreren Gründen.<br />
Unter anderem sollte dem Publikum, das unter Photographie zumeist nur eine billige<br />
Portraitierkunst verstand, die vielseitige Leistungsfähigkeit der Photographie in Wissenschaft,<br />
Kunst und Technik gezeigt werden.<br />
Zwei Jahre später war es dann soweit. Man kündigte Medaillen für die besten Aussteller<br />
an. Und das wirkte Wunder. Vier Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses war die<br />
Zahl der Aussteller schon auf fast 300 angewachsen. In der Ausstellerliste fand man alle<br />
photographischen Größen jener Zeit vertreten. Die Aussteller und die Mitglieder des<br />
Vereins hatten freien Eintritt. Um die beliebte Weitergabe der für diese Personen<br />
bestimmten Ausweise zu unterbinden, führte Vogel eine Neuheit ein: Als Ausweis diente<br />
das mit dem Ausstellungsstempel versehene Visit-Portrait des Betreffenden. Mit dieser<br />
Maßnahme hatte Vogel das photographische Bildnis als Grundlage eines Personalausweises<br />
zwar nicht erfunden, aber wohl als erster in die Praxis eingeführt.<br />
Hermann Wilhelm Vogel, bekannt geworden durch seine zahlreichen Veröffentlichungen<br />
auf dem Gebiet der Photochemie, wurde später zum Leiter der Abteilung für Chemie<br />
an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg ernannt.<br />
Doch wenden wir uns einmal der Berliner Wirtschaft in dieser Zeit zu.<br />
Noch heute bestehen Firmen auf optischem und photographischem Sektor in Berlin, die<br />
im vorigen Jahrhundert gegründet wurden. Hierzu zählen u. a. Firma Kindermann &<br />
Co. (gegr. 1861) und Firma Schmidt & Haensch (gegr. 1864). Auch die Firma Agfa<br />
hatte ihren Beginn 1867 in Berlin.<br />
In der Zimmerstraße 23 gründete im Jahr 1886 der damals noch unbekannte Carl Paul<br />
Goerz (21. 7. 1854-14. 1. 1923, Abb. 2) ein Versandhaus für mathematische Instrumente.<br />
Zwei Jahre später erwarb er eine mechanische Werkstatt, um selbst photographische<br />
116
Abb. 2 Abb. 3<br />
Apparate und Objektive herstellen zu können. Das Schleif- und Poliermaterial mußte<br />
von einem Arbeiter selbst eingekauft werden, und er erhielt zu diesem Zweck vom Mechanikermeister<br />
8 Groschen ausgehändigt mit den Worten: „Daß Sie mir aber oben auf dem<br />
Omnibus fahren, da kostet's bloß einen Sechser!" - Für 35 Pfennig pro Stunde arbeiteten<br />
die Arbeiter 10 Stunden am Tage.<br />
Am 29. und 30. März 1898 fand der vierte Umzug seit Bestehen der Firma statt; dieses<br />
Mal zog man nach Friedenau, Rheinstraße 45-46. An der Ortsgrenze zwischen Friedenau<br />
und Schöneberg wurde die Belegschaft von einer Musikkapelle empfangen, und so zogen,<br />
die Musik voran, die Arbeiter und Möbelwagen unter Freudenklängen die Rheinstraße<br />
hinunter zu der neuen Arbeitsstätte. Die Polizei von Friedenau hatte für dieses „Vergnügen"<br />
kein Verständnis, denn es folgte ein Strafmandat über 12 Mark wegen polizeilich<br />
nicht gemeldeten Aufzuges.<br />
Wir lesen in „Das gewerbliche Leben im Kreise Teltow" von 1900: „... daß ein Teil der<br />
in Friedenau und Steglitz befindlichen optischen Anstalten früher schon in Berlin bestanden<br />
hat, dort aber nicht bleiben konnte, weil für die sorgfältige Prüfung der äußerst<br />
empfindlichen Apparate nicht die erforderliche Ruhe vorhanden war."<br />
Aber betrachten wir die letzten zehn Jahre von der Jahrhundertwende noch einmal<br />
genauer.<br />
117
Sicher werden sich viele Leser dieser Zeitschrift an das photographische Atelier Emilie<br />
Bieber in der Leipziger Straße erinnern. Das Atelier wurde ursprünglich in Hamburg<br />
gegründet. Professor Leonard Berlin, der Neffe von E. Bieber, wurde mit Vorliebe von<br />
Kaiser Wilhelm IL nach Berlin geholt, um Portraits anzufertigen. Auch im Jahre 1892<br />
hatte der Kaiser ihn nach Berlin bestellt. Als der Photograph im Zuge saß, hörte er, daß<br />
Hamburg wegen der Cholera-Epidemie zur gesperrten Stadt erklärt worden war. Da er<br />
also vorerst nicht nach Hamburg zurück konnte, ließ er sogleich seine Familie nachkommen<br />
und gründete in Berlin eine Filiale, die sich zunächst in der Friedrichstraße und<br />
später in der Leipziger Straße befand.<br />
Prof. Leonard Berlin behielt die Leitung des Berliner Hauses bis zum 1. Weltkrieg,<br />
dann verkaufte er das Geschäft und zog sich ins Privatleben zurück. Er starb 1931 in<br />
Hamburg.<br />
Erwähnen muß man noch einen Mann, der bis jetzt in Berlin fast unbekannt geblieben<br />
ist - ein Mann, dem wir zu verdanken haben, daß die Flugversuche von Orro Lilienthal<br />
im Bilde festgehalten wurden. Dr. Richard Neuhauss (17.10.1855-9.2.1915, Abb. 3)<br />
war seit 1886 als praktischer Arzt in Berlin tätig. Als begeisterter Amateurphotograph<br />
machte er zwischen 1894 und 1896 unzählige Aufnahmen der Flugversuche Lilienthals an<br />
dem berühmten „Berg" in Lichterfelde. Einige Bilder erschienen als Serie im Postkartenformat.<br />
Berlin kann auch stolz sein, Erfindertalente auf dem Gebiet der Photographie und Optik<br />
gehabt zu haben. Drei hervorragende Männer sollen hier vorgestellt werden. Sehr große<br />
Verdienste um den Fortschritt der Serienphotographie erwarb sich Ottomar Anschütz<br />
(16.5.1846-30.5.1907). Anschütz befaßte sich 1882 mit Einzelmomentaufnahmen und<br />
erregte 1884 großes Aufsehen mit seinen Momentbildern von fliegenden Tauben und<br />
Störchen, welche eine damals unerreichte Deutlichkeit und ansehnliche Größe besaßen.<br />
Die optische Vereinigung dieser Serienphotographien zu „lebenden" Bewegungsbildern<br />
gelang Anschütz weitaus vollkommener und präziser als allen seinen Vorgängern durch<br />
seinen „Schnellseher". In diesem elektrischen „Schnellseher" konnte er bereits viele dieser<br />
Bildserien (er hatte davon etwa 200!) vorführen. Das photographische Wochenblatt 1887<br />
schrieb: „Anschütz' elektrischer ,Schnellseher' ist der erste Apparat, der in einwandfreier<br />
Weise eine schöne Darstellung photographisch gewonnener lebender Bilder gab, wenn<br />
auch in kleinem Maßstab, so doch für einen kleinen Kreis von Beschauern gleichzeitig<br />
sichtbar." Aufgrund dieses Ergebnisses wurde ihm sogar von Kultusminister von Goßler<br />
ein Zuschuß zum Ausbauen seiner Apparate zugebilligt. Die Bilder wurden auf einer<br />
großen Metallscheibe angeordnet und in stetiger Bewegung an einem Guckloch vorbeigeführt<br />
(siehe Abb. 4). Die Firma Siemens & Halske hatte für Anschütz eine Serie von<br />
„Schnellsehern" angefertigt, die auf Ausstellungen 1891 in Deutschland, 1892 in Wien<br />
und London und 1893 auf der Weltausstellung in Chicago ein Massenpublikum anzogen.<br />
Ebenso bedeutend für die Geschichte der Kinematographie war der Berliner Max Skladanowsky<br />
(30. 4.1863-30.11.1939). Am 1. November 1895 führte Max Skladanowsky in<br />
Berlins berühmtem Variete „Wintergarten" erstmals Filme öffentlich vor. Er benutzte<br />
hierzu den von ihm konstruierten Projektor, „Bioscop" (siehe Abb. 5) genannt. Für diese<br />
Sensation ersten Ranges hatten Max Skladanowsky und sein Bruder Eugen 9 Filme mit<br />
Zwischentiteln gedreht. Die ersten Schauspieler dieser interessanten Erfindung der Neuzeit<br />
waren Emil und Eugen Skladanowsky. Max Skladanowsky gehörte zu den Erfindern,<br />
denen es gelang, die Kinematographie zu verwirklichen.<br />
118
Abb. 4 Abb. 5<br />
Der dritte der erfolgreichen Erfinder war Oskar Meßter (21. 11. 1866-7. 12. 1943). Er<br />
war der einzige der technischen Pioniere und Erfinder, der selbst noch viele Jahre lang<br />
führend auf seinem Gebiet war. Bekannt wurde er durch die Entwicklung des „Deutschen<br />
Getriebes" (Malteserkreuz genannt), einem Getriebe für Projektoren. Er war auch als<br />
Produzent ein Pionier des deutschen Films und blieb es viele Jahre lang, in denen er<br />
seine eigenen Filme herstellte.<br />
Im Dachgeschoß des Hauses Friedrichstraße 94 a eröffnete Meßter 1896 das erste Berliner<br />
Filmatelier, das zugleich mit Kunstlicht betrieben wurde. Im Januar 1897 drehte er erstmals<br />
Filmaufnahmen vom Berliner Presseball. Gleichzeitig begann er seine ersten Filme<br />
zu drehen und, wie damals üblich, war er sein eigener Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann,<br />
Entwickler, Kopierer und Vorführer. Auch die ersten Filmaufnahmen aus einem<br />
Freiballon drehte er 1900 selbst.<br />
Inzwischen wurde das erste Berliner Kinotheater eröffnet. Es befand sich in einem Raum<br />
des Restaurants „Wilhelmshallen", Unter den Linden 21. Kurz danach öffnete in der<br />
Friedrichstraße ein zweites Berliner Kino unter dem Namen „Edison-Theater". Neben<br />
Filmen über aktuelle Ereignisse, wie die „Kaiser-Flottenparade von Helgoland", sah man<br />
kurze, wenn auch reichlich primitive Spielfilme. Kassenmagnet wurde „Der Raubmord<br />
am Spandauer Schiffahrtskanal bei Berlin oder Überfall eines Bierkutschers auf einsamer<br />
Landstraße". Aber auch Filme wie „Hochfliegende Pläne des Prof. Luftikus" begeisterten<br />
119
die Berliner. Titel wie „Die Hochzeitsnacht" oder „Im Separee" versprachen freilich<br />
mehr, als sie hielten.<br />
Ob Klamauk im ,Kintopp' oder der Photograph im Glasatelier - lassen wir zum Schluß<br />
Wilhelm Busch zu Worte kommen:<br />
Wie standen ehedem die Sachen<br />
So neckisch da in ihrem Raum,<br />
Schwer war's, ein Bild davon zu machen,<br />
Und selbst der Beste könnt' es kaum.<br />
Jetzt ohne sich zu überhasten,<br />
Stellt man die Guckmaschine fest<br />
Und zieht die Bilder aus dem Kasten<br />
Wie junge Spatzen aus dem Nest.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 15, Uhlandstr. 45<br />
b. Hildebrandt<br />
Sämtliche Bildvorlagen stammen aus dem Archiv des Verfassers.<br />
Die Geschichte des alten Spandauer Nikolaikirchhofes<br />
Von Jürgen Grothe<br />
Wie archäologische Untersuchungen der letzten Jahre auf dem Spandauer Burgwall<br />
bewiesen, befand sich der erste christliche Begräbnisplatz auf Spandauer Gebiet nicht in<br />
der heutigen Altstadt, sondern an der Krowelstraße 1 . Er gehörte zur Burg 8 und somit<br />
gleichzeitig zur ersten frühdeutschen Siedlung auf dem Gelände des Burgwalls. Den<br />
Funden nach wird dieser Begräbnisplatz in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts<br />
1 von Müller, Adriaan: Wo lag Alt-Spandau? Hrsg. vom Förderkreis des Heimatmuseums<br />
Spandau. Berlin 1975.<br />
120
Abb. 1:<br />
Ausschnitt aus dem<br />
„Plan der Stadt Spandau<br />
Intra Moenia"<br />
von Haestkau, 1724<br />
datiert. Die Toten waren in Holzsärgen, auf Totenbrettern oder ohne jede Ummantelung<br />
beigesetzt.<br />
Noch im 12. Jahrhundert wird die Siedlung auf dem Burgwall aufgegeben und an die<br />
Stelle der heutigen Spandauer Altstadt verlegt. 1972-73 gelang den Archäologen die<br />
bisher älteste Siedlungsschicht in der Altstadt, südlich der Mönchstraße, anzuschneiden 2 .<br />
Häuser mit senkrecht stehenden Holzplankenwänden, aus der zweiten Hälfte des<br />
12. Jahrhunderts, konnten 3 Meter unter dem heutigen Straßenniveau freigelegt werden.<br />
Die Frage, wann die erste Nikolaikirche errichtet worden ist, ist bis heute nicht zu<br />
beantworten. Grabungen von Albert Ludewig, die unzureichend publiziert sind, lassen<br />
ein Gotteshaus um 1200 vermuten 3 . Dieses Gotteshaus und die Kaufmannssiedlung auf<br />
der Altstadtinsel fielen zwischen 1230 und 1240 einem Schadenfeuer zum Opfer. Die<br />
Brandschicht wird bei archäologischen Untersuchungen immer wieder angeschnitten.<br />
Scherbenfunde an der Mönchstraße zeigten, daß die Bewohner deutscher Herkunft waren.<br />
2 Wie Anmerkung 1.<br />
3 Ludewig, Albert: Die Kirchen um St. Nikolai. In: Spandauer Volksblatt Nr. 79 vom 3. 3. 1947.<br />
121
Somit dürfte auch das erste Gotteshaus dem Hl. Nikolaus von Myra, dem Schutzpatron<br />
der Kaufleute und Fischer, geweiht gewesen sein.<br />
Die Frage, wann der Begräbnisplatz an der Nikolaikirche angelegt wurde, ist gleichfalls<br />
noch ungeklärt. Archäologische Untersuchungen auf dem Gelände des heutigen Reformationsplatzes<br />
stehen noch aus. Diese Ausgrabungen sind für die mittelalterliche Geschichte<br />
Spandaus von äußerster Wichtigkeit. Sie könnten Antwort auf folgende Fragen geben:<br />
1. Wann wurde das erste Gotteshaus erbaut?<br />
2. Wann wurde der erste Friedhof angelegt?<br />
3. Befand sich ursprünglich an dieser Stelle ein Handelsplatz, wie Albert Ludewig<br />
vermutet? 4<br />
4. Lag das Gotteshaus, wie A. v. Müller annimmt, außerhalb der Stadtmauer? 5<br />
Im 13. Jahrhundert wird die Nikolaikirche zum erstenmal genannt. 1239 war das<br />
Benediktinerinnen-Kloster St. Marien durch die Markgrafen Johann und Otto vor den<br />
Toren der Stadt gegründet worden. Gleichzeitig wurde ihm das Patronat über die Pfarrkirche<br />
übertragen. Ein Jahr später, am 29. 7. 1240, übertrugen dieselben Markgrafen das<br />
Patronat den Bürgern Spandaus. Das Gotteshaus wird als „ecclesia forensis", Marktkirche,<br />
urkundlich erwähnt 6 .<br />
Nachrichten über die Frühzeit des Kirchhofes fließen spärlich. In einer Urkunde vom<br />
10. 9. 1424, in der Peter Kletzke bekundet, unter welchen Bedingungen der Pfarrer von<br />
Seegefeld dem Spandauer Kloster den Zehnt von 10 Hufen überlassen habe, wird zum<br />
erstenmal ein Begräbnisplatz an der Parochialkirche in Spandau genannt 7 . Die nächste<br />
Nachricht stammt aus dem Jahr 1431. Der Bischof von Brandenburg weihte einen<br />
„Kerkhof" in Spandau. Ohne diese Weihe der Erde durch einen Bischof konnte ein<br />
Begräbnisplatz nicht seiner Bestimmung übergeben werden. Es war eine teure Angelegenheit<br />
für die Spandauer, denn der Bischof erhielt 5 Schock, 6 Gr. und 3 Pfg. Außerdem<br />
benötigte man Wein und 3 Stübchen Bier (Stübchen = altes Flüssigkeitsmaß, ca.<br />
3,5 1) für 5 Gr. 2 Pfg, und weitere 21 Gr. kostete ein Faß Bier, das der Bischof als<br />
Geschenk bekam.<br />
In dieser Zeit erfolgte der Neubau der Nikolaikirche. Da es keine zeitgenössische Baunachricht<br />
gibt, ist die Weihe des Kirchhofes ein Beleg dafür, daß der Neubau zumindest<br />
im Rohbau vollendet war. Sonst wäre eine Weihe des Kirchhofes nicht möglich gewesen.<br />
Auch die Formen des Gotteshauses als Hallenbau der Spätgotik, mit der Weiträumigkeit<br />
des Innenraumes und den breitgelagerten Jochen sprechen für diese Zeit. Ob es sich bei<br />
der Kirchhofsweihe von 1431 um eine Erweiterung oder Neu weihe handelt, ist nicht zu<br />
sagen. Folgt man der These Albert Ludewigs, so muß in dieser Zeit die Umsiedlung des<br />
Marktes von der Nikolaikirche an den heutigen Ort erfolgt sein. Dort wurde 1434-37 8<br />
das „Kophus" zum Rathaus umgebaut. 1439 wird zwar noch „dat Rat Hüsiken up dem<br />
Kerkhof" genannt 9 , das der Nikolaikirche gegenüber an der Westseite der heutigen<br />
4 Ludewig, Albert: Dat Rathüsiken up dem Kerkhof zu Spandau. In: Märkisdier Wandergruß<br />
1951, S. 19.<br />
5 Wie Anmerkung 1.<br />
6 Riedel, Adolph Friedridi: Codex diplomaticus Brandenburgensis, Teil I, Bd. 11 (Berlin 1856),<br />
Nr. 17,2.<br />
7 Riedel, ebenda Nr. 17,114.<br />
8 Sdiulze, Daniel Friedrich: Zur Beschreibung und Geschichte von Spandow. Gesammelte Materialien,<br />
hrsg. von Otto Recke. Spandau 1913, Bd. 2, S. 16.<br />
9 Sdiulze, ebenda S. 22.<br />
122
Carl-Schurz-Straße lag. Diese Bezeichnung wird das Gebäude am Kirchhof noch längere<br />
Zeit besessen haben, obwohl die Verwaltung längst in den Neubau am heutigen Markt<br />
umgezogen war. Als Beispiel sei eben dieses Rathaus am Markt genannt, das man bis<br />
zum Abriß 1929 Rathaus nannte, obwohl bereits 1913 der Neubau an der Carl-Schurz-<br />
Straße 2-6 die Verwaltung aufgenommen hatte.<br />
1493 wird der Friedhof im Zusammenhang mit der Franziskaner-Terminei genannt. Ihr<br />
Platz sei bei dem Kirchhof gegen Abend (Westen). Diese Terminei lag an einem „Kirchgasse"<br />
genannten Gang, der die Carl-Schurz-Straße mit der Kinkelstraße verband. Neben<br />
dem Kirchhof war der Innenraum der Nikolaikirche bevorzugte Begräbnisstätte. In ihr<br />
wurde jedoch nur begraben, wer vornehm oder wenigstens begütert war. Einige Grabsteine<br />
und Erbbegräbnisse zeugen noch heute davon.<br />
Als 1612 in Spandau 927 Menschen an der Pest starben, reichte der Nikolaikirchhof<br />
nicht mehr aus. Am 24. August desselben Jahres begann der Totengräber mit den Beerdigungen<br />
auf dem Moritzkirchhof, der zwischen der Stadtmauer und der Jüdenstraße (seit<br />
1938 Kinkelstraße) lag und den Namen „Neuer Friedhof" erhielt 10 . Die Anlage eines<br />
Pestfriedhofes innerhalb der Stadtmauern kann als Beweis dafür gedeutet werden, daß<br />
zu dieser Zeit bereits Pläne bestanden, die Stadt mit Wallanlagen zu umgeben. Das<br />
Risiko, einen gerade vor den Toren der Stadt angelegten Friedhof deshalb wieder aufzulassen,<br />
ging man nicht ein.<br />
Außer den Erb- und Familienbegräbnissteilen innerhalb des Gotteshauses gab es auch<br />
auf dem Kirchhof Erbbegräbnisstellen. 1670 kaufte Bürgermeister David Dilschmann<br />
vom Rat, Ministerium und den Kirchenvorstehern einen Platz für seine Eltern, seine<br />
Frau, seine Kinder, Kindes-Kinder und sich für 15 Taler 11 . Gleichzeitig gab er seine<br />
Grabstelle in der Nikolaikirche, die ihm als Bürgermeister zustand und 10 Taler wert<br />
war, zurück. Als der Erbe des Bürgermeisters, der Konrektor Dilschmann, das Erbbegräbnis<br />
an die Nikolaikirche zurückgeben wollte, ging das nicht ohne weiteres. Mitglieder<br />
der weitverzweigten Familie hätten Ansprüche auf eine Beisetzung in dem Erbbegräbnis<br />
stellen können. So mußte die Obereignung an die Kirche erst im „Intelligenz-Blatt" und<br />
in den Zeitungen bekanntgegeben werden.<br />
1722-24 wurde die Nikolaikirche renoviert. Am 27. März 1723 genehmigte das Konsistorium,<br />
unleserlich gewordene Grabsteine und Steine ausgestorbener Familien zur Pflasterung<br />
des Mittelganges des Gotteshauses zu verwenden.<br />
Eine Mauer grenzte den Kirchhof zur Klosterstraße, der heutigen Carl-Schurz-Straße,<br />
ab. 2 Tore dienten als Zugang (siehe Abb. 1). Weitere Eingänge befanden sich an der<br />
Mönchstraße, Schulgasse und Havelstraße. 1680 wurde die Umfassungsmauer ausgebessert.<br />
Der Gouverneur, General von Schoening, stellte dafür von der Festung 16 Fuhren<br />
Mauersteine zur Verfügung. 1739 mußte sie jedoch auf Anordnung des Generals von<br />
Derschau auf der Südseite abgerissen werden: „Damit die Soldaten desto mehr Raum<br />
hätten, sich zu stellen, wenn sie auf die Wache ziehen, auch auf der Seite nach den<br />
Offiziantenhäusern und der Schule exerzieren könnten." Der Platz vor dem „Heimhaus"<br />
und der Schule sollte, wie ab 1713 der Lustgarten in Berlin, als Exerzierplatz und zum<br />
Aufstellen der Wache genutzt werden. Alle Proteste des Magistrats und der Kirchenverwaltung<br />
gegen den Abriß halfen nichts. Sie mußten sogar noch die Kosten über-<br />
10 Schulze, ebenda S. 142.<br />
11 Schulze, ebenda Bd. 1, S. 117.<br />
123
nehmen. Die Kämmerei zahlte 2 Taler 7 Gr. 12 Jahre später, im März 1750, ließ Major<br />
Stranz auf Befehl des Prinzen August Wilhelm von Preußen die restliche Mauer abreißen.<br />
Als auf seinen Befehl hin nichts geschah, begann er selbst Teile der Mauer einzureißen.<br />
Das sahen die Spandauer Jungen, die ihm nun mit Freude halfen. Der Maurermeister<br />
Vogt brauchte nur noch den Rest zu entfernen und die Steine im Kirchturm aufzustellen.<br />
Er erhielt eine Entlohnung von 11 Talern 20 Gr. Die Grabsteine wurden abgebrochen<br />
und von Angehörigen der Verstorbenen teils in die Wohnhäuser geholt, teils in der<br />
Kirche befestigt, der Platz planiert und mit Rasen besät. Aber er eignete sich schlecht als<br />
Exerzierplatz, denn durch das Absinken der Grabstellen wurde das Gelände uneben.<br />
Nach 1750 fanden Beerdigungen nur noch hinter den Gittern, die die Kirche umgaben,<br />
statt. Die Grabstelle für einen Erwachsenen kostete 3 Taler und für ein Kind 1 Taler<br />
12 Gr.<br />
Bis zur Eröffnung des neuen Nikolaifriedhofes in der Oranienburger Vorstadt, der<br />
heutigen Neustadt, wurden Mitglieder der Nikolaikirchengemeinde auf dem Moritz- und<br />
Reformiertenkirchhof beerdigt. Da sie lutherisch waren, gab es bei Beerdigungen auf<br />
dem Reformiertenkirchhof, der sich an der Stelle des Schulhofes des heutigen Kantgymnasiums<br />
befand, mitunter Schwierigkeiten, die aber in den meisten Fällen finanziell<br />
geregelt werden konnten.<br />
1752 fertigte der Ingenieur Rhode Pläne des alten und neuen Kirchhofes an. Im selben<br />
Jahr wurde der neue Nikolaifriedhof auf einem 18 Morgen großen Gelände der ehemaligen<br />
Kirchenmeierei zwischen der heutigen Schönwalder-, Kirchhofstraße und Straße<br />
Am Koeltzepark eröffnet.<br />
1777 ließ der Kommandeur des Regiments Prinz Heinrich, Oberst von Kalckstein, einen<br />
Teil des Geländes des ehemaligen Kirchhofes an der Nikolaikirche erneut planieren und<br />
mit Rasen belegen. 1780 erweiterte dessen Nachfolger, Oberst von Stwolinsky, die<br />
Rasenfläche und ließ den Platz mit Walnußbäumen und Birken bepflanzen und mit<br />
einem Holzzaun umgeben. Die Einschränkung stieß auf heftige Kritik der Kirchenverwaltung<br />
unter der Leitung des Spandauer Chronisten Daniel Friedrich Schulze, der zu<br />
dieser Zeit Inspektor an St. Nikolai war. Aber erst 1792 wurde der Zaun durch den<br />
Kommandeur Graf von Wartensieben entfernt und die Rasenfläche durch Schmuckanlagen<br />
im englischen Stil umgestaltet. Im 19. Jahrhundert erhielt der Platz nördlich der Nikolaikirche<br />
den Namen Heinrichsplatz (nach dem Bruder König Friedrichs II.) und der südliche<br />
Teil den Namen Joachimsplatz nach Kurfürst Joachim IL, der am 1.11. 1539 in der<br />
Nikolaikirche zum protestantischen Glauben übergetreten sein soll. Da es an ausreichenden<br />
Überlieferungen fehlt, gibt es über den Ort der Handlung, ob Berlin oder Spandau,<br />
in der Geschichtsforschung einen Jahre währenden Streit. Joachim II. zu Ehren wurde<br />
am 1. November 1889 ein von dem Bildhauer Erdmann Encke geschaffenes Standbild<br />
errichtet. Das Denkmal steht auf einem idealen Platz im Zentrum der Altstadt, mitten<br />
im Verkehr, ohne diesen zu behindern, für jeden sichtbar, in der Hauptachse der Nikolaikirche<br />
vor deren Hauptportal, aber soweit von diesem abgerückt, daß ein Wagen<br />
bequem vor dem Gotteshaus vorfahren kann. 1939 erhielt der gesamte das Gotteshaus<br />
umgebende Platz den Namen Reformationsplatz.<br />
Auf dem ehemaligen Kirchhof, nördlich der Nikolaikirche, steht Spandaus ältestes Denkmal.<br />
Es erinnert an die während der Freiheitskriege 1813-1815 gefallenen Spandauer<br />
124
Abb. 2:<br />
Ehrenwache am Denkmal<br />
für die Gefallenen der Befreiungskriege<br />
auf dem ehem.<br />
Nikolaikirchhof anläßlich<br />
der Gedenkfeier am 20. 4. 1913<br />
Bürger und an die beim Sturm auf die Zitadelle am 20. April 1813 Gefallenen. Es<br />
wurde nach Entwürfen Karl Friedrich Schinkels geschaffen und am 27. April 1816 feierlich<br />
eingeweiht. Das Denkmal ist ein typisches Zeugnis der deutschen Romantik. Durch<br />
Lanzen und Ritterhelme sollte an Spandaus mittelalterliche Vergangenheit und durch<br />
die bekrönende, flammende Bombe an den gerade beendeten Krieg erinnert werden. Das<br />
Denkmal steht auf einem dreistufigen Sockel aus Sandstein. Nach 1900 wurde es durch<br />
eine Untermauerung aus Ziegelsteinen im sogenannten Klosterformat, die von der<br />
Spandauer Stadtmauer stammten, gehoben. Unaufdringlich hat Schinkel das Denkmal in<br />
die Stadtlandschaft, unter Berücksichtigung der Architektur der Nikolaikirche und der<br />
Umbauung des damaligen Heinrichsplatzes, eingefügt. Die Idee zu einem Denkmal für<br />
die Gefallenen entstand bereits 1813. Im Herst 1815 wurden auf dem Heinrichsplatz<br />
3 Eichen und mehrere Linden gepflanzt. Hieraus entwickelte sich der Gedanke, ein<br />
würdiges Denkmal zu errichten. Wie das Spandauer Gartenbauamt 1961 durch Bohrungen<br />
feststellte, stammen heute noch 2 Eichen und mehrere Linden aus dieser Zeit 12 .<br />
Von 1876 bis 1879 entstand die neue Enteeinte (Umwallung) um die Neustadt, so daß in<br />
diesem Stadtteil die Baubeschränkungen entfielen. Als eine intensivere Bebauung ein-<br />
12 Freundliche Auskunft von Herrn Kirchenbuchführer und Archivar Werner Rachais, Spandau.<br />
125
Abb. 3: Gruft an der Südseite der Nikolaikirche: Nordwand der westlichen Gruft mit Strebepfeilerfundament<br />
(1972)<br />
setzte, wurden die Friedhöfe zwischen Neuendorfer- und Schönwalder Straße als störend<br />
empfunden. So wurde der Nikolaifriedhof am 15. 11. 1886 bereits wieder geschlossen<br />
und am 17. 11. desselben Jahres der konfessionslose Friedhof an der Pionierstraße<br />
eröffnet. Das Gelände des Friedhofes und das des benachbarten gemeinsamen Johannisund<br />
Garnisonsfriedhofes wurden 1933 in eine Parkanlage umgestaltet, die 1934 den<br />
Namen Koeltzepark zu Ehren des langjährigen Spandauer Oberbürgermeisters Friedrich<br />
Koeltze erhielt.<br />
Am 21. September 1972 wurde durch Handwerker eine Gruft an der Südseite der<br />
Nikolaikirche, direkt westlich an die Südkapelle (heute Sakristei) anschließend, angeschnitten<br />
13 . Wie die Untersuchungen ergaben, handelte es sich um 2 nebeneinander liegende,<br />
durch einen Gang verbundene Gewölbe. Übereinandergestellte Särge waren zusammengesunken,<br />
dennoch waren 15 Schädel erhalten. Auf einem Sargdeckelrest konnte entziffert<br />
werden: „Eva Geborene von Wreechen Gestorben in Berlin April 1705". Es<br />
handelte sich hierbei um die Frau des Generalleutnants der Kavallerie, Gouverneurs und<br />
Oberhauptmanns von Spandau (1705-13), Johann Georg von Tettau. Eva von Tettau<br />
wurde am 2. Juli 1705 als erste in dem Erbbegräbnis beigesetzt. Ferner wurden Zinnbeschläge<br />
des Sarges Friedrich Christoph von Salderns geborgen, der als letzter, 1785, in<br />
der Tettauschen Gruft beigesetzt wurde.<br />
" Kernd'l, Alfred: Untersuchung einer Gruft an der Südmauer der Spandauer Nikolai-Kirche.<br />
In: Ausgrabungen in Berlin, Nr. 3/1972, S. 177-183.<br />
126
Reste eines versilberten Kupferbleches wiesen auf den 1719 verstorbenen Oberst von<br />
Below hin. Von Below war im oberen Gewölbe des Neumeisterschen Erbbegräbnisses<br />
beigesetzt. Ebenfalls wurde ein versilbertes Wappenschild „Der von Zitzewitz" geborgen.<br />
Die von Zitzewitz hatten in St. Nikolai kein Erbbegräbnis. Auch die Sterbebücher<br />
dieser Gemeinde nennen die Familie nicht. Die Särge müssen 1838 bei der Restaurierung<br />
der Nikolaikirche in die Grüfte gekommen sein, die nach dem „Journal über die Führung<br />
des Baues der Nikolaikirche in Spandow 1838" vertieft und erweitert wurden, um<br />
17 neue Särge aufnehmen zu können.<br />
Zweckentfremdet wird der Reformationsplatz seit einigen Jahren an der Südseite als<br />
Parkplatz genutzt. Im Zuge der Neugestaltung der Altstadt wurde im November 1975<br />
mit dem Bau einer Treppe von der Mönchstraße zum ehemaligen Kirchhof begonnen.<br />
Eine bessere Verbindung vom Markt zur Nikolaikirche soll hergestellt werden. Die<br />
Treppenanlage wurde nötig, da der Kirchhof im Laufe der Jahrhunderte um ca. 90 cm<br />
hochgewachsen ist.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 20, Kellerwaldweg 9<br />
Abbildungsnachweis:<br />
Nr. 1 Geh. Staatsarchiv Berlin, Plankammer Potsdam; Nr. 2 Landesbildstelle Berlin; Nr. 3 vom<br />
Verfasser.<br />
König Friedrich II. und seine Skizzen zum Schloß Sanssouci<br />
Von Prof. Dr.-Ing. Friedrich Mielke<br />
Wir kennen zwei eigenhändige Skizzen Friedrichs IL, die den Grundriß des Schlosses<br />
Sanssouci zeigen. Sie werden in der einschlägigen Fachliteratur als Entwürfe des Königs<br />
bezeichnet, also als Darstellungen eines Zustandes, der noch nicht ausgeführt worden ist 1 .<br />
Diese Annahme kann sich auf Indizien stützen:<br />
a) Wie uns Heinrich Ludewig Manger-, d'Alemberfi und der Berliner Gelehrte Anton<br />
Friedrich Büsching* überzeugend berichten, hat der König vielfach Skizzen angefertigt<br />
und seinen Architekten befohlen, danach zu bauen.<br />
1 Vgl. Eckardt, Götz: Die ersten Entwürfe zur Terrassenanlage und zum Schloß Sanssouci. Ein<br />
Beitrag zu Knobelsdorffs Anteil. In: Anschauung und Deutung - Willy Kurth zum 80. Geburtstag.<br />
Berlin (Ost) 1964, S. 155-169. - Kania, Hans: Potsdamer Baukunst. Eine Darstellung ihrer<br />
geschichtlichen Entwicklung. Berlin 1926, S. 30. - Kurth, Willy: Sanssouci. Ein Beitrag zur<br />
Kunst des deutschen Rokoko. Berlin (Ost) 1962, S. 16f. - Seidel, Paul: Friedrich der Große<br />
und die Bildende Kunst. 2. Aufl. Leipzig/Berlin 1924, S. 95 f. - Streichhan, Annelise: Knobelsdorff<br />
und das friderizianische Rokoko. Diss. Rostock 1931, Burg b. Magdeburg 1932, S. 51.<br />
2 Manger, Heinrich Ludewig: Baugeschichte von Potsdam, besonders unter der Regierung König<br />
Friedrichs des Zweiten. Bd. 3, Berlin/Stettin 1790, S. 542.<br />
3 Maugras, Gaston (Hrsg.): Trois mois a la cour de Frederic. Lettres inedites de d'Alembert.<br />
Paris 1886, S. 44.<br />
4 Büsching, Anton Friedrich: Character Friederichs des zweyten, Königs von Preußen. 2. Ausg.<br />
Halle 1788, S. 284.<br />
127
: alHf<br />
1/17/<br />
Abb. 1:<br />
Sdiloß Sanssouci mit Terrassen,<br />
Skizze König Friedridis II.<br />
b) Nach den Beischriften und der Strichführung zu urteilen, sind die Skizzen von der<br />
Hand des Königs.<br />
c) Die Beischriften scheinen darauf hinzudeuten, daß sie Anweisungen zur Ausführung<br />
seien.<br />
d) Die Unterschiede zwischen den skizzierten Details (z. B. Zahl der Terrassen und<br />
Stufen) und dem ausgeführten Bauzustand gelten als Beweise dafür, daß die Skizzen<br />
nur eine Idee andeuten, die später bei der Transponierung in die Realität des Baues und<br />
des Geländes durch den Architekten (v. Knobelsdorjf) modifiziert werden mußte.<br />
Der Gedankengang scheint einleuchtend, berücksichtigt jedoch nicht, daß er umkehrbar<br />
ist, wenn man die Eigenarten des Königs in Rechnung setzt. Auch eine nachträglich<br />
angefertigte Skizze kann von der Wirklichkeit abweichen, zumal wenn der Autor<br />
ungeübt und im Bereich der Architektur ein Dilettant ist. Es ist nachzuweisen, daß<br />
Friedrich II. auch von bereits bestehenden Bauten, speziell vom Schloß Sanssouci, Skizzen<br />
angefertigt hat.<br />
Diesen Beweis liefert uns Henri de Catt, der von 1757 bis 1780 Vorleser des Königs<br />
gewesen ist und diesen in das Feldlager des Siebenjährigen Krieges begleitete. Wenn wir<br />
auch wissen, daß de Catt in der Angabe des Datums bei seinen Berichten nicht sehr<br />
korrekt verfuhr und zeitlich auseinanderliegende Vorgänge zu einem Bericht zusammengefaßt<br />
hat, so ist doch an der historischen Existenz des jeweiligen Ereignisses an sich nicht<br />
zu zweifeln. Unter dem Datum vom 27. 4. 1758 berichtet de Catt, Friedrich II. habe zu<br />
ihm gesagt: „... ich möchte Ihnen eine Vorstellung von meinem Sanssouci vermitteln und<br />
will es Ihnen skizzieren. Sie können sich die Zeichnung, die ich Ihnen entwerfe, aufheben<br />
und wenn Sie es nach dem Kriege sehen, so werden Sie mir frei und offen sagen,<br />
ob meine Zeichnung richtig gewesen ist.. ." 5 .<br />
128
Abb. 2: Schloß Sanssouci, Grundriß. Skizze König Friedrichs II.<br />
Wenige Wochen danach, am 10. 6. 1758, erwähnt de Catt erneut, daß er den König damit<br />
beschäftigt fand, „das Schloß Sanssouci, die Gärten, den Säulengang, das chinesische<br />
Schlößchen auf Papier zu zeichnen, wovon er mir schon einmal eine Skizze entworfen<br />
hatte . . ." 6 .<br />
Es sei dahingestellt, ob die von de Catt erwähnten Skizzen jene beiden sind, die sich<br />
erhalten haben und als Entwürfe zum Schloß Sanssouci angesehen werden. Fest steht<br />
jedoch, daß der König nicht nur Entwürfe lieferte, sondern es auch liebte, sich eine<br />
bereits fertige Situation zeichnerisch zu vergegenwärtigen. Damit ist die Gewißheit, daß<br />
jene beiden Skizzen vor der Erbauung des Schlosses Sanssouci, also in den Jahren<br />
vor 1745, entstanden sein müssen, fragwürdig geworden. Es käme auch ein späteres<br />
Datum, vielleicht sogar das Jahr 1758, in Frage.<br />
Betrachten wir die beiden Skizzen unter dem Gesichtspunkt der Berichte von de Catt, so<br />
erhalten die Anmerkungen des Königs eine neue Bedeutung: sie sind nicht für den ausführenden<br />
Architekten bestimmt, sondern für eine Person, der das Schloß Sanssouci noch<br />
nicht bekannt war.<br />
Wie aber steht es mit den Abweichungen auf den Skizzen von dem gebauten Grundriß,<br />
die so sehr darauf hinzudeuten scheinen, daß die Skizzen vor dem Schloßbau angefertigt<br />
wurden? Wenn die Blätter erst 1758 oder in einem ähnlich späten Jahr entstanden sind,<br />
so sollte man annehmen können, daß der König den von ihm selbst inspirierten 7 und in<br />
den Jahren von 1745 bis 1748 geschaffenen Zustand so genau kennen müßte, daß er ihn<br />
annähernd exakt wiedergeben könnte.<br />
5 Friedrich der Große - Gespräche mit Catt. Vollst. Ausg. Hrsg. von Willi Schüssler, Leipzig<br />
1940, S. 54.<br />
c Ebenda, S. 133.<br />
7 Manger, a.a.O. Bd. 1 (1789), S. 50 schreibt, „daß die erste Idee dazu der König selbst dem<br />
Freyherrn von Knobelsdorff gegeben habe".<br />
129
— -1 _ J, "4<br />
-4 — ,4_,i<br />
54 *> J u<br />
Abb. 3:<br />
Schloß Sanssouci, Grundriß.<br />
Entwurfsskizze von<br />
G. W. v. KnobelsdorfF<br />
Diese Voraussetzung bedarf der Einschränkung durch die in der menschlichen Natur<br />
liegenden Fehlerquellen. Es ist nahezu die Regel, daß im täglichen Umgang vertraut<br />
gewordene Gegenstände nicht präzise beschrieben werden können. Wer hat sich schon die<br />
Zahl der Eingangsstufen zur eigenen Wohnung gemerkt? Und überdies genügt es völlig,<br />
statt der vorhandenen sechs Terrassen nur drei darzustellen, wenn das Prinzip der Lage<br />
des Schlosses erläutert werden soll.<br />
Auffallender und wichtiger als die Zahl der Stufen und Terrassen scheinen mir andere<br />
Details zu sein, die bisher wenig oder keine Beachtung fanden:<br />
A. Die beiden flankierenden Rundräume (Bibliothek und Rothenburgzimmer).<br />
B. Der Zugang zur Bibliothek.<br />
ZuA: Daß für den Grundriß des Schlosses Sanssouci Friedrichs Kronprinzenschloß in<br />
Rheinsberg Pate gestanden hat, ist bekannt. Die dort dreiflügelige Anlage wurde im<br />
Sinne eines maison de plaisance auf einen einflügeligen gestreckten Baukörper reduziert.<br />
Die beiden Rheinsberger Türme wandelten sich zu kreisrunden Pavillonbauten.<br />
Soweit ich weiß, blieb unbekannt, daß der „Grundriß eines Landhauses wie solches ein<br />
vornehmer Herr auf dem Lande anlegen könnte", den Paulus Decker 1711 publiziert<br />
hat, mit dem Grundriß des Schlosses Sanssouci eine prinzipielle Ähnlichkeit besitzt. Bei<br />
Decker finden wir auch die Darstellung eines Schlosses mit zwei flankierenden Kavalierhäusern<br />
in hügeligem Gelände 8 , die sehr weitgehend der Situation des Schlosses<br />
Sanssouci mit den Neuen Kammern und der Bildergalerie entspricht. Ferner sind Anregungen<br />
zum Neuen Palais in Potsdam und zum sog. Pal. Barberini (Potsdam, Humboldtstraße<br />
5-6, 1771/72) bei Decker nachzuweisen 9 . Es ist deshalb nicht abwegig, den Grundriß<br />
des Schlosses Sanssouci als u. a. auch von Decker inspiriert anzusehen. Dabei ist zunächst<br />
gleichgültig, ob die Anregungen vom König selbst oder von seinem Architekten<br />
aufgegriffen wurden. Auffallend ist jedoch, daß der König das Prinzip des Grundrisses,<br />
oblonger Bau mit je einem kreisrunden Raum am Ende, in seinen Skizzen nicht auszu-<br />
• Decker, Paul: Der Fürstliche Baumeister oder Architectura Civilis. Augsburg 1711, Tafel 6<br />
„Prospect des Fürstlichen Lustgartens hinter dem Pallast".<br />
9 Mielke, Friedrich: Friedrich IL, das Neue Palais in Potsdam und Paul Deckers „Fürstlicher<br />
Baumeister". In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- u. Ostdeutschlands, Bd. 18, Berlin 1969,<br />
S. 319-322.<br />
130
drücken vermochte. In beiden Skizzen deutet er den Rundraum nur dort an, wo er ihn -<br />
analog zu Rheinsberg - selbst erlebt hat, nämlich in seiner Bibliothek. Die architektonische<br />
Konzeption des Pendants, des sog. Rothenburg-Zimmers, ist ihm offenbar fremd geblieben.<br />
Der Grundriß dieses Raumes ist auf Friedrichs Skizzen einer Kreisform weitaus<br />
unähnlicher als der Grundriß der Bibliothek. Jeder Autor, sei er Laie oder Fachmann,<br />
wird die von ihm selbst entwickelte Konzeption eines Baues in entsprechender Weise, in<br />
diesem Falle mit Kreisen, auszudrücken versuchen. Da der König sich aber nur bei einem<br />
der beiden Rundräume, dem von ihm bewohnten, um die Kreisform mühte, den anderen<br />
gleichartigen aber offenkundig vernachlässigte, ist daraus zu schließen, daß er das<br />
geometrische Prinzip der Anlage nicht verstanden hat. Diese Erkenntnis läßt zwei<br />
Schlüsse zu:<br />
1. Der Entwurf des Grundrisses kann nicht vom König stammen, und<br />
2. die beiden zur Diskussion stehenden Skizzen sind keine Entwurfszeichnungen, sondern<br />
Reproduktionen eines bereits bekannten Zustandes.<br />
ZuB: Die Beweisführung anhand nur eines Grundrißdetails ist zweifellos ungenügend.<br />
Deshalb wollen wir einen zweiten Beweis führen, indem wir den Zugang vom königlichen<br />
Arbeitszimmer zur Bibliothek untersuchen. Dieser Zugang stellt zugleich die Verbindung<br />
zu den Zimmern der Sekretäre und Diener her. Die Grundrißlösung ist an<br />
dieser Stelle ungewöhnlich, um nicht zu sagen: kompliziert. Selbst Knobelsdorff, der sich<br />
- wie sein Skizzenbuch ausweist - vielfach mit Grundrißlösungen beschäftigte, hatte<br />
offensichtlich Schwierigkeiten, die drei Zugänge einwandfrei zu ordnen (Abb. 3).<br />
Folgen wir der landläufigen Auffassung, nach der Friedrich II, als erster den Grundriß<br />
konzipiert habe und seine Skizzen Knobelsdorff zur Ausführung übergab, dann müssen<br />
die Skizzen des Königs (nennen wir sie der Einfachheit halber A 1 und A 2 = A) entweder<br />
ein Vorstadium des knobelsdorffschen Entwurfes (den wir als B bezeichnen<br />
wollen) darstellen oder aber mit diesem übereinstimmen, d. h. es muß die Entwicklung<br />
vom Stadium der Skizzen A über Skizze B bis zu der ausgeführten Version (die C heißen<br />
soll) erkennbar sein. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Skizzen A 1 und A 2 entsprechen<br />
in dem zu untersuchenden Detail genau dem Zustand C (Abb. 4).<br />
Abb. 4: Schloß Sanssouci, ursprünglicher Grundriß vor dem Umbau durch Ludwig Persius<br />
131
Von Manger wissen wir, daß nach dem Beginn der Arbeiten am Schloß Sanssouci, als<br />
der König im Dezember 1745 aus dem Schlesischen Krieg nach Potsdam zurückgekehrt<br />
war, „verschiedenes wieder abgebrochen, und weiter heraus gerückt, oder<br />
sonst verändert werden" mußte 10 . Es kann also der Zustand A nicht mit C identisch<br />
sein, wenn A als Entwurf anzusehen ist und wenn B zu C verändert wurde. Es bleibt<br />
deshalb nur zu folgern, daß die Skizzen A nicht vor B und C entstanden sein können,<br />
sondern erst nach C, d. h. nach Fertigstellung des Baues.<br />
Quod erat demonstrandum.<br />
10 Manger, a.a.O. Bd. 1, S. 50.<br />
Abbildungsnachweis:<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 37, Oertzenweg 17 B<br />
Nr. 1 und 2 aus G. Eckardt (siehe Anm. 1); Nr. 3 aus dem sog. Skizzenbuch v. Knobelsdorffs,<br />
Besitz der Verwaltung der Staatl. Schlösser und Gärten Berlin, Schloß Charlottenburg, Plankammer;<br />
Nr. 4 aus Max Baur/Friedrich Mielke, Potsdam wie es war, Berlin 1963, S. 25.<br />
Die Porzellan-Plaketten der KPM 1975/76<br />
Schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde von der damals Königlichen Porzellan-Manufaktur<br />
Berlin eine eindrucksvolle Reihe von Plaketten mit Bildnissen namhafter Persönlichkeiten<br />
der Zeit geschaffen. Zu den ersten dieser Porträtierten gehörten Kurfürst Karl Theodor von der<br />
Pfalz (um 1780) und König Friedrich der Große (1785); in der Folgezeit schlössen sich viele<br />
Mitglieder des preußischen Herrscherhauses und des Militärs (Befreiungskriege!) dieser Reihe an.<br />
Die in Biskuit-Porzellan ausgeführten Plaketten gehören zu jenen Kleinkunstwerken, für deren<br />
intimen Reiz man seit dem Rokoko bis hin zur Biedermeierzeit ein sehr feines Gespür besaß.<br />
Miniaturen wie Silhouetten, Gemmenschnitte, Medaillen und eben solche Porzellanplaketten<br />
erfreuten sich allgemeiner Beliebtheit, wurden von Sammlern begehrt und stellten gern gesehene<br />
Gelegenheitspräsente dar.<br />
Die schönsten und berühmtesten Medaillen hat der aus Österreich zugewanderte Bildhauer und<br />
Modelleur Leonhard Posch (1750-1831) geschaffen, der 1804 zur Königlichen Eisengießerei nach<br />
Berlin kam und hier die Porträtkunst, vor allem feinste Eisengußarbeiten im Plaketten- und<br />
132
Medaillonstil, zu hoher Blüte brachte. So gehörte beispielsweise Gottfried Scbadow zu den<br />
uneingeschränkten Bewunderern dieses auf seinem Gebiet einmaligen Berliner Künstlers. Posch-<br />
Medaillen fanden, bedingt durch die Besatzungen während der napoleonischen Kriege, in<br />
Deutschland und Westeuropa rasch Verbreitung und wurden zu einem festen Begriff künstlerischer<br />
Wertschätzung.<br />
Das ist bis heute so geblieben. Unter den aus den Trümmern des 2. Weltkrieges geborgenen und<br />
wiederhergestellten Plaketten der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Berlin befindet sich rund<br />
ein halbes Hundert von der Hand Poschs. Diese Porträtmedaillons wurden von den Formgestaltern<br />
der Manufaktur Siegmund Schütz und Johannes Henke restauriert, wovon einige<br />
heute - neben zahlreichen anderen verschiedener Künstler des 18. bis 20. Jahrhunderts - zu<br />
Nachformungen verwendet wurden und käuflich zu erwerben sind (17 DM, Größe 8 cm).<br />
Daneben führt die KPM die Tradition der Gestaltung von Bildnisplaketten unverändert fort.<br />
In der Regel erscheinen sie zu den Gedenktagen der Porträtierten, zu sonstigen öffentlichen<br />
Anlässen, teilweise auch nach Aufträgen durch öffentliche Institutionen oder nach Wettbewerben.<br />
Ihre Herstellung geschieht im Handprägeverfahren, wobei das Abbild im sog. Negativschnitt<br />
geformt wird, und auch alle weiteren Arbeitsvorgänge erfolgen ausschließlich von Hand.<br />
Auch die jüngsten von der Berliner Manufaktur herausgebrachten Porträtplaketten stehen ganz,<br />
in dieser Tradition. Straffe, doch präzise Formen und ein zeitloses Stilempfinden verleihen den<br />
Medaillen eine natürliche Klassizität, die durch den ästhetischen Reiz des weißen Biskuitporzellans<br />
noch betont wird. Johannes Henke hat für seine Porträts im Jahre 1975 folgende Persönlichkeiten<br />
ausgewählt:<br />
1. Johann Ernst Gotzkowsky. Der Berliner „patriotische Kaufmann", 1710 in Konitz (Westpreußen)<br />
geboren, übernahm im Jahr 1761 die hiesige Manufaktur und erreichte in kürzester<br />
Zeit eine künstlerisch hochwertige Produktion, die auch nach dem Übergang des Betriebes an<br />
König Friedrich II. (1763) beibehalten werden konnte. Nach vielfältigen wirtschaftlichen Mißerfolgen<br />
starb Gotzkowsky vor 200 Jahren am 9. August 1775 in Berlin.<br />
2. Albert Schweitzer (1875-1965). - 3. Thomas Mann (1875-1955). - 4. Heinrich Mann (1871<br />
bis 1950). Diese drei Plaketten erschienen jeweils zum 100. Geburtstag bzw. zum 25. Todestag<br />
der genannten Persönlichkeiten. Ihre Größe beträgt gleichfalls 8 cm, ihr Preis 17 DM.<br />
Für 1976 schuf Siegmund Schütz (in gleicher Ausstattung) zwei weitere Medaillen, die bedeutenden<br />
Künstlern der Vergangenheit gewidmet sind:<br />
1. Am 24. Januar 1976 jährt sich der Geburtstag E. T. A. Hoffmanns zum 200. Mal. Wir haben<br />
vor einigen Jahren das Leben und das (Berliner) Wirken des Dichters an dieser Stelle ausführlich<br />
gewürdigt. - 2. Carl Maria von Weber, der Tondichter der Romantik, geb. 1786, starb vor<br />
150 Jahren am 5. Juni 1826 in London. Seine epochemachende Oper „Der Freischütz" erlebte<br />
1821 in Berlin ihre Uraufführung. - Insgesamt vier der oben Genannten zeigen die Plaketten<br />
in den beigefügten Abbildungen. Die Vorlagen hierzu wie auch weiterführende Informationen<br />
stellte die Staatliche Porzellan-Manufaktur zur Verfügung, wofür ihr herzlich gedankt sei.<br />
Peter Letkemann<br />
133
Im Schloß Glienicke stellen bis zum 18. Januar 1976 Walter Bewersdorf, Alfred Karl Dietmann,<br />
Ruth Rieger und Harry Woehleke von der Arbeitsgruppe Berliner Architekturmaler sowie als<br />
Gast Jean-Jaques Brombourgh aus Straßburg zum Thema „Wasser in und um Berlin" aus. Wie<br />
stets umfassen die Bilder auch den anderen Teil unserer Stadt. Zur Zeit liefert die Gruppe die<br />
erste Mappe „Schlösser in West-Berlin" ihres großen Berlin-Mappenwerkes aus. Für die zweite<br />
unter dem Titel „Dorfkirchen in West-Berlin" sind Interessenteneintragungen jetzt möglich.<br />
Im Rahmen dieser Ausstellung spricht Günter Wollschlaeger am 3. Januar um 16 Uhr im Schinkelsaal<br />
des Schlosses anhand von Lichtbildern über „Berliner Architektur der Romantik und des<br />
Biedermeier".<br />
Personalien<br />
Karl Bullemer 90 Jahre<br />
Cicero läßt seinen Cato einmal sagen: „Wer in sich selber nicht zum Seligleben Kraft gewonnen,<br />
dem wird jedes Alter beschwerdenreich. Wer aber aus dem eigenen Innern das Beste schöpft,<br />
dem tritt nichts als ein wirkliches Übel entgegen, auch das späte Alter nicht, das jeder erreichen<br />
möchte, aber wenn er's erreicht hat, grämlich beklagt . .." An diese Worte wird man erinnert,<br />
wenn es am 2. Januar 1976 der Vollendung des 90. Lebensjahres unseres hochgeschätzten, lieben<br />
Ehrenmitglieds Direktor i. R. Karl Bullemer zu gedenken gilt. Er ist an der Schwelle zu seinem<br />
zehnten Dezennium alles andere als grämlich, und er hat stets aus dem eigenen Innern das Beste<br />
geschöpft, nicht nur für sich, sondern für alle Organisationen und Ehrenämter, in denen er<br />
Verantwortung trug, und für den großen Kreis seiner Freunde und Mitmenschen. Sein Curriculum<br />
vitae ist schnell abgehandelt. 1909 trat er nach vorangegangener Tätigkeit im westdeutschen<br />
Braugewerbe in den Verein der Brauereien Berlins und der Umgegend ein, nahm am Ersten<br />
Weltkrieg teil und wurde 1919 zum Generalsekretär und später zum Hauptgeschäftsführer dieses<br />
Rechtsvorgängers des heutigen Wirtschaftsverbandes Berliner Brauereien e. V. bestellt. Daneben<br />
hatte er von 1926 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges die Geschäftsführung des Verbandes<br />
der Deutschen Ausfuhrbrauereien e. V. inne und wurde nach dem Kriege in den Vorstand des<br />
Deutschen Versicherungsschutzes für Brauereien V. a. G. berufen. In den schwersten Jahren des<br />
Wiederaufbaus der Berliner Brauereien und ihrer Organisationen vermochte er seine Erfahrungen<br />
und sein Geschick zum großen Nutzen der ihm anvertrauten Belange einzusetzen. 1959 ist<br />
er in den Ruhestand getreten. Äußerliches Zeichen der Anerkennung seiner Verdienste in einem<br />
halben Jahrhundert ununterbrochener Tätigkeit war die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.<br />
Wie nicht wenige Brauer vor und nach ihm (wir denken nur an Richard Knoblauch) wußte er<br />
seine Arbeit für dieses traditionsbewußte Gewerbe mit historischen Studien und mit ehrenamtlichen<br />
Diensten in Geschichtsvereinen zu verbinden. Zahlreiche Arbeiten aus seiner gewandten<br />
Feder sind etwa in den Jahrbüchern der Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des<br />
Brauwesens e. V., aber auch in den Publikationen unseres Vereins erschienen. Hier war er nach<br />
dem Kriegsende ein Mann der ersten Stunde, der sich vor allem um die Zusammenführung der<br />
beiden Geschichtsvereine von 1949 und von 1865 bleibende Verdienste erworben hat. Mit Umsicht<br />
und mit Akkuratesse versah er die Geschäfte eines Schriftführers, bis er sie 1969 in jüngere<br />
Hände legte. Die Ehrenmitgliedschaft des Vereins für die Geschichte Berlins war gerechter Lohn<br />
und bescheidener Dank für den Wahl-Berliner, der auch nach dem Tode seiner lieben Gattin der<br />
Stadt Berlin die Treue gehalten hat, mag er dem ärztlichen Rat und dem Wandertrieb folgend<br />
auch hin und wieder in die bayerischen Berge entfliehen, so auch an seinem jetzigen Ehrentag.<br />
Der Alterspräsident unseres Vereins ist eine Persönlichkeit, die Würde und menschliche Nähe in<br />
sich vereint. Wir wünschen Karl Bullemer, daß ihm noch viele gesunde Jahre zwischen Berlin<br />
und Türk-Marzoll beschert sind, daß er immer genügend Papier und Tinte hat und uns noch<br />
lange erhalten bleibt. Mit dem ihm eigenen Sinn für Humor wird er es hinnehmen, wenn wir den<br />
Vers von Börries Freiherr von Münchhausen: „Geschlechter kommen, Geschlechter gehen, hirschlederne<br />
Reithosen bleiben bestehen" auf ihn ummünzen. H. G. Schultze-Berndt<br />
*<br />
Am 7. Dezember 1975 ist unserem Mitglied Pfarrer Heinrich Albertz, Regierender Bürgermeister<br />
a. D., von der Deutschen Sektion der Internationalen Liga für Menschenrechte die Carl-von-<br />
Ossietzky-Medaille verliehen worden.<br />
Aus Anlaß der Vollendung des 75. Geburtstages ist die Schriftstellerin Anna Seghers, Präsidentin<br />
des Schriftstellerverbandes der DDR, am 19. November 1975 mit der Ehrenbürgerwürde (Ost-)<br />
Berlins ausgezeichnet worden.<br />
134
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Frau Käthe Sandeck, Herrn Fritz Votava, Herrn Gerhard Lasson, Herrn<br />
Ernst-Jürgen Otto; zum 75. Geburtstag Herrn Eugen Honnette, Herrn Friedrich Hillenherms,<br />
Frau Charlotte Hardow; zum 80. Geburtstag Frau Hilde Altmann-Reich, Frau Anne-Marie<br />
Grabow, Herrn Dr. Hans Wendorff, Frau Johanna Giesemann; zum 90. Geburtstag Herrn Karl<br />
Bullemer, Frau Annemarie Neitzel; zum 95. Geburtstag Frau Else Schoen.<br />
Buchbesprechungen<br />
Dieter Mahncke: Berlin im geteilten Deutschland. München/Wien: Oldenbourg 1973. 325 S.,<br />
geb., 42 DM. (Schriften d. Forschungsinstituts der Dt. Gesellsch. f. Auswärtige Politik e. V.<br />
Bonn, Bd. 34).<br />
Ernst R. Zivier: Der Rechtsstatus des Landes Berlin. Eine Untersuchung nach dem Viermächte-<br />
Abkommen vom 3. September 1971. 2. Aufl. Berlin: Berlin-Verlag 1974. 312 S., brosch., 28 DM.<br />
(Völkerrecht u. Politik, Bd. 8).<br />
Walther Stützle: Kennedy und Adenauer in der Berlin-Krise 1961-1962. Bonn-Bad Godesberg:<br />
Verlag Neue Gesellschaft 1973. 253 S., brosch., 32 DM. (Schriftenreihe d. Forschungsinstituts der<br />
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bd. 96).<br />
Rudolf Kasmalski: Ein Berlin-Plan. Auftrag und Aufgabe. Ziegelhausen (Neckar): Neuung-<br />
Verlag [1973]. 118 S., brosch., 8,40 DM.<br />
Berlin bleibt - trotz des Viermächte-Abkommens - eine empfindliche Stelle der Ost-West-Beziehungen.<br />
Die zurückliegenden und die gegenwärtigen Konflikte um diese Stadt beherrschen<br />
deshalb weiterhin die politische Berlin-Literatur.<br />
Dieter Mahncke hat in seinem Buch „Berlin im geteilten Deutschland" die vielfältige Berlin-<br />
Literatur zu einer Bestandsaufnahme verarbeitet. Einleitend beschäftigt er sich mit der Rolle<br />
Berlins im Wandel des Ost-West-Verhältnisses. Anschließend untersucht er die politische und<br />
rechtliche Entwicklung der Stadt von 1944 bis 1972, leitet dann zu den Interessen der Sowjetunion<br />
und der Westmächte in Berlin über und analysiert schließlich die wirtschaftliche Lage<br />
der Stadt. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die jüngsten Berlin-Vereinbarungen.<br />
Mahncke warnt vor allzu großen Erwartungen. Die Tragfähigkeit hänge von der langfristigen<br />
Praxis der Berlin-Regelung ab und von der weiteren Entwicklung der Beziehungen West-<br />
Deutschlands zur Sowjetunion und der DDR. Damit sei die Berlin-Situation eng mit der Entspannung<br />
verknüpft. Wenn der gefundene Modus vivendi aber dazu führen sollte, daß Ost-<br />
Berlin auf Dauer Teil der DDR werde, während West-Berlin als letztes aus dem Zweiten Weltkrieg<br />
entstandenes Besatzungsgebiet - vielleicht mit sowjetischem Mitspracherecht - erscheine,<br />
dann wären die Abkommen nichts wert und würden Ansatzpunkte zu neuen Konflikten liefern.<br />
Im Schlußkapitel beschäftigt sich Mahncke mit der Zukunft Berlins. Er hebt hervor, daß selbst<br />
bei einer positiven Praxis der Vereinbarungen weiterhin Probleme hinsichtlich der Insellage, der<br />
Bevölkerungsstruktur und der psychologischen Lage der Bewohner bestehen. Spannungen dagegen<br />
werden erhebliche Auswirkungen auf das Meinungsklima, auf die Wanderungsbewegung<br />
und auf die Wirtschaft haben. Da aber das wirtschaftliche und das politische Meinungsklima bestimmt<br />
werden von der Zuversicht der Bevölkerung in die politische, wirtschaftliche und kulturelle<br />
Zukunft der Stadt, muß nach Ansicht des Verfassers die Attraktivität Berlins erhalten<br />
und laufend erhöht werden. Eine ständige Berlin-Beobachtungs- und Planungs-Gruppe im<br />
Bundeskanzleramt und beim Senat sollte über die Entwicklung der Stadt wachen. Die größte<br />
Gefahr für Berlin sieht Mahncke in dem fehlenden übergeordneten Konzept des Westens. Dadurch<br />
sei die Stadt den Versuchen des Ostens, sie zu einer „besonderen politischen Einheit" zu<br />
degradieren, wehrlos ausgeliefert.<br />
Die Arbeit von Dieter Mahncke ist ausgewogen im Urteil und übersichtlich gegliedert. Handbuchartig<br />
hat er die einzelnen Themenkreise nach Sachzusammenhängen geordnet. Ein umfangreicher<br />
Dokumententeil ergänzt diese überzeugende Darstellung.<br />
Den Charakter eines Handbuches hat auch die Arbeit von Ernst R. Zivier „Der Rechtsstatus<br />
des Landes Berlin". Systematisch beleuchtet der Verfasser im 1. Teil die rechtliche Situation<br />
Berlins vom Londoner Protokoll 1944 bis zu den Viermächte-Verhandlungen 1971. Im 2. Teil<br />
beschäftigt er sich mit dem „Berlin-Status als Rechtsproblem". Zivier weist nach, daß trotz anderer<br />
Auffassungen der Sowjetunion und der DDR und trotz der seit 1948 eingetretenen Veränderungen<br />
der Viermächte-Status für ganz Berlin de jure fortbesteht. Wie in der Arbeit von<br />
Mahncke steht das Viermächte-Abkommen vom 3. September 1971 und die innerdeutschen<br />
Ausführungsverhandlungen im Mittelpunkt der Darstellung. Hat Mahncke stärker die politischen<br />
Probleme herausgearbeitet, so beschränkt sich Zivier auf die rechtlichen Aspekte. Das<br />
Viermächte-Abkommen hat, so hebt der Verfasser hervor, weder einen neuen Berlin-Status<br />
135
geschaffen noch die mit dem Berlin-Problem verbundenen Rechtsfragen umfassend geklärt. In<br />
Zukunft auftauchende Konflikte könnten deshalb nicht ausgeschlossen werden. Abschließend behandelt<br />
Zivier die rechtlichen Auswirkungen des Grundvertrages auf die Berlin-Regelung. Ein<br />
Dokumenten-Anhang mit allen für den Rechtsstatus Berlins wichtigen Texten, vom Londoner<br />
Protokoll bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Grundvertrag 1973, ergänzt auch<br />
diese Darstellung. Die Arbeit von Zivier enthält nichts Neues, bietet aber all jenen, die sich<br />
schnell über den rechtlichen Status von Berlin und die damit verbundenen Probleme orientieren<br />
wollen, eine zuverlässige Hilfe.<br />
Haben Mahncke und Zivier die politische und rechtliche Position Berlins in Vergangenheit und<br />
Gegenwart behandelt, wendet sich Walther Stützle mit seiner Arbeit „Kennedy und Adenauer<br />
in der Berlin-Krise 1961-1962" einem Teilaspekt der Zeitgeschichte zu. An Hand umfangreicher<br />
Materialien untersucht er die unterschiedlichen Auffassungen Kennedys und Adenauers<br />
in der Berlin-Frage. Während Kennedy den Status quo durch Regelungen mit dem Osten<br />
sicherer machen und durch die Anerkennung überwinden wollte, strebte Adenauer aus der<br />
Position der Stärke die Änderung des Status quo auf Kosten der Sowjetunion an. Stützle versucht<br />
nachzuweisen, daß durch den Bau der Mauer Adenauers Deutschland- und Berlin-Politik<br />
gescheitert ist. Kennedy dagegen habe sich bestätigt gesehen, daß nur auf Grundlage des Status<br />
quo die Mittel zu seiner Überwindung gefunden werden konnten. Das habe Egon Bahr später<br />
als erster Deutscher begriffen und daraus die bekannten Schlüsse gezogen.<br />
Der Zusammenhang zwischen Anerkennung der Realitäten und der Entspannungspolitik ist<br />
heute sichtbar. Hier hat Stützle mit seiner Arbeit wesentlich zum Verständnis beigetragen.<br />
Doch beurteilt er das Vorgehen Kennedys zu sehr aus dem Blickwinkel der gegenwärtigen<br />
Ostpolitik und wird dadurch der Strategie Adenauers nicht ganz gerecht. Der Verfasser sympathisiert<br />
offensichtlich mit der Politik des amerikanischen Präsidenten und wahrt nicht immer<br />
die gebotene kritische Distanz, ein Manko der Arbeit, auf das auch Gilbert Ziebura im Vorwort<br />
hinweist.<br />
Das Buch von Rudolf Kasmalski „Ein Berlin-Plan - Auftrag und Aufgabe" fällt aus dem Rahmen<br />
der bisher besprochenen Arbeiten, da es voller Ungereimtheiten steckt. Kasmalski präsentiert<br />
einen Berlin-Plan in zehn Punkten, der eine freie Stadt Groß-Berlin schaffen soll. Die DDR<br />
wird aufgefordert, den Ostteil der Stadt preiszugeben. Die Bundesrepublik soll den Reichstag<br />
(das Symbol einer verfehlten Politik) abreißen und das Gelände den Vereinten Nationen zur<br />
Verfügung stellen, die ihren Sitz von New York nach Berlin verlegen müßten. Im Berlin-Abkommen<br />
vom 3. September 1971 sieht Kasmalski die Basis für die Durchführung seines Plans,<br />
der darüber hinaus ein erster Schritt für die Errichtung eines „neuen" neutralen Deutschlands<br />
sein soll. Ist dem Verfasser im ersten Teil des Buches bei aller Skepsis gegenüber seinen<br />
utopisch erscheinenden Plänen eine gewisse logische Konsequenz nicht abzusprechen, so wirkt<br />
der zweite Teil konfus. Kasmalski präsentiert dort eine im vereinigten Deutschland einzuführende<br />
„Neue Ordnung". An Stelle der Demokratie, der Volksherrschaft, soll die Volksgemeinschaft<br />
treten, die nach seiner Ansicht alle Konflikte und Merkmale der Spaltung überwinden<br />
wird.<br />
Völlig abwegig sind dann seine Reflexionen über Pornographie, Insemination und die Wiedereinführung<br />
der Todesstrafe. Bezeichnend ist, daß Kasmalski einen eigenen Verlag gegründet<br />
hat, der seine Schriften druckt. Es dürfte schwer sein, sie an anderer Stelle unterzubringen.<br />
Jürgen Wetzet<br />
Ernst Dronke: Berlin. Hrsg. von Rainer Nitsche. Darmstadt/Neuwied: Luchterhand 1974.<br />
429 S. mit 111., brosch., 14,80 DM. (Sammlung Luchterhand, 156.)<br />
Mit dem Nachdruck der Erstausgabe dieses 1846 erschienenen Buches wird dem Leser ein höchst<br />
interessantes, lebendiges, von wacher und intelligenter Beobachtungsgabe diktiertes Bild Berlins<br />
wenige Jahre vor den Ereignissen des Jahres 1848 vermittelt. Herausgeber und Verlag sehen<br />
nicht zu unrecht in diesem Werk einen wichtigen und in seiner Authentizität nicht gering zu veranschlagenden<br />
Dokumentarbeitrag zur sozialen Situation Berlins in den Jahren des Vormärz. Die<br />
Lektüre vermittelt unzählige Details und Fakten aus den Lebensgewohnheiten und -formen des<br />
„Berliners" in seiner jeweiligen sozialen Um- und Mitwelt, dem öffentlichen und politischen<br />
Leben, in den Bereichen des Geld- und Finanzwesens, der Parteien, des Beamtentums, des Strafvollzugs<br />
und der Kulturpolitik an der Universität, in den Theatern und in der Kunst. Die Darstellung<br />
nährt sich aus dem unmittelbaren Erleben und Erfahren, das für Dronke nach dem<br />
Erscheinen dieses Berlin-Buches konsequent mit Prozeß, Verurteilung, Festungshaft und Emigration<br />
seinen durchaus „zeitgemäßen" Abschluß fand. In einem erfreulich gestrafften Nachwort<br />
bemüht sich der Herausgeber, dem Leser mit Hinweisen und einem biographischen Abriß zu<br />
Dronkes Persönlichkeit bei der historischen Einordnung des Werkes hilfreich zu sein. Ein übriges<br />
tun die zahlreichen Anmerkungen, mit denen Auskunft über die im Text erwähnten Personen<br />
gegeben wird. Hans Joachim Mey<br />
136
Otto March - Ein schöpferischer Berliner Architekt an der Jahrhundertwende. Reden und Aufsätze.<br />
Hrsg. Werner March. Tübingen: Wasmuth 1972. 104 S. m. 23 Abb., Leinen, 18 DM.<br />
Der als Schöpfer des Berliner Olympia-Stadions weithin bekanntgewordene Architekt Werner<br />
March widmet diese Publikation seinem ebenso bekannten Vater Otto March, dem Klassenkameraden<br />
Max Liebermanns, dem Schüler Stracks an der Berliner Bauakademie, Schadows an<br />
der Preußischen Akademie der Künste und nach dem Krieg von 1870 Ferstels in Wien.<br />
Seine Tätigkeit im Landhausbau, die mit der Villa Holtz in Westend begonnen hatte, wurde<br />
nach der Englandreise von 1888 vom dortigen Bauschaffen maßgeblich beeinflußt. Individuelle<br />
Grundrisse nach den Wünschen der Bauherren und die Eingliederung der Werke in deren Umgebung<br />
lassen Otto March zum gesuchten Architekten auch von Herrenhäusern und Landsitzen<br />
werden. Die hierbei gemachten schöpferischen Erfahrungen schlagen sich unter anderem in der<br />
1896/97 errichteten Landhausgruppe „Amalienpark" in Pankow nieder. Zwei- bis dreigeschossige<br />
Mietwohnhäuser sind um die als Gartenplatz mit zwei Fahrbahnen gestaltete Mitte angeordnet.<br />
Der damalige Direktor der Landhaus-Baugesellschaft Pankow gehört damit zu den Wegbereitern<br />
der nächsten Baumeister-Generation. Seine Berliner Kirchenbauten folgen neben denen<br />
von Osnabrück, Delbrück, Borkum, Oberkassel bei Bonn und Köln-Marienburg strikt der<br />
Forderung der Predigtkirche und fügen sich sowohl in der Funktion des Innenraumes als auch<br />
der städtebaulichen Eingliederung dem Gedanken der Gemeinde. March errichtet die Rennbahnen<br />
in Köln, Hamburg, Breslau, Berlin-Hoppegarten und mit der von Berlin-Grunewald<br />
das erste Stadion in Deutschland. Schon früher hatte sein „Städtisches Spiel- und Festhaus" in<br />
Worms mit der weit in den Zuschauerraum gezogenen offenen Vorderbühne das Theater reformiert.<br />
Diese vielschichtigen Aufgaben setzt er in zahlreichen Aufsätzen und Vorträgen als Architektur-<br />
Theoretiker auseinander. So erlebt der Leser eine Baumeister-Persönlichkeit, die nicht nur<br />
historisches Interesse weckt, sondern im Nachhall ihres Wirkens lebendig geblieben ist.<br />
Günter Wollschlaeger<br />
Peter Lundgreen: Techniker in Preußen während der frühen Industrialisierung. Ausbildung und<br />
Berufsfeld einer entstehenden sozialen Gruppe. Berlin: Colloquium 1975. XIV, 307 S., Leinen,<br />
68 DM (Einzelveröff. d. Histor. Kommission zu Berlin, Bd. 16 = Publikationen zur Geschichte d.<br />
Industrialisierung).<br />
Die vorliegende Schrift gehört zu der Reihe der aus dem zentralen Forschungsschwerpunkt<br />
„Frühe Industrialisierung des Raumes Berlin-Brandenburg" entstandenen Arbeiten. Nachdem<br />
nunmehr vor 10 Jahren Ilja Mieck in seiner Studie „Preußische Gewerbepolitik in Berlin 1806<br />
bis 1844. Staatshilfe und Privatinitiative zwischen Merkantilismus und Liberalismus" - erschienen<br />
in der gleichen Reihe - die Bemühungen des Beuthschen Gewerbe-Instituts und des preußischen<br />
Finanzministeriums zur Entwicklung und Verbesserung der Gewerbebetriebe dargestellt hat,<br />
wird hier einer anderen Seite der Gewerbeförderung, der Technikerausbildung und des Einsatzes<br />
der ausgebildeten Techniker in der Wirtschaft besondere Beachtung geschenkt. Als Quelle dienten<br />
vornehmlich die reichen Bestände der Archive in Potsdam und Merseburg.<br />
Der erste Hauptteil des zweiteiligen Buches ist der Technikerausbildung gewidmet. Von besonderem<br />
Gewicht sind hier die Partien über die Herausbildung des Gewerbeschultyps in Preußen<br />
aus den verschiedenen Vorformen des 18. Jh.s und die Bedeutung des französischen Vorbilds.<br />
Auch die Organisation der Provinzial-Gewerbe-Schulen und des Berliner Gewerbe-Instituts, des<br />
Vorläufers der heutigen Technischen Universität, wird eingehend besprochen. Tabellen zur Herkunft,<br />
dem Beruf des Vaters, dem Bildungsgrad und der Verweildauer der Schüler geben einen<br />
guten Einblick in die soziale Struktur der zukünftigen Techniker. Auch die materielle Seite des<br />
Studiums wird behandelt; staatliche und private Stipendien - hier wird das Seydlitz-Stipendium<br />
besonders hervorgehoben - boten begabten Studenten zusätzliche finanzielle Anreize. Aus der<br />
Wahl der Fachgebiete in chronologischer Abfolge zeigt sich deutlich das Nachlassen des Interesses<br />
an dem noch im ersten Vierteljahrhundert führenden Textilbereich zugunsten einer Ausbildung<br />
in den Metallberufen.<br />
Das „Berufsfeld" der Absolventen wird im zweiten Hauptteil behandelt. Hier stützt sich der Vf.<br />
nahezu ausschließlich auf das in den genannten Archivbeständen befindliche Material zum späteren<br />
Lebensweg der ausgebildeten Techniker. Obwohl in dem Material einige wichtige Einzelheiten<br />
zum Arbeitsplatz, der sozialen Position und zum Verdienst des Technikers um die Mitte des<br />
19. Jh.s enthalten sind, ist die Materialbasis doch zu gering, um allgemeine Schlüsse zum Berufsfeld<br />
eines jungen Berufs zu machen. Anzuregen wäre eine Bearbeitung des Verhältnisses der<br />
akademisch ausgebildeten zu den nicht ausgebildeten Technikern.<br />
Wenn auch die Schrift nur den engen Bereich der akademischen Technikerausbildung abdeckt,<br />
so wird doch dadurch ein Aspekt der Industrialisierung hervorgehoben, der auch einen wichtigen<br />
Teil der Geschichte der Bildung und Ausbildung in Berlin umfaßt. Felix Escher<br />
137
Gelandet in Berlin. Zur Geschichte der Berliner Flughäfen. Text: Helmut Conin. Berlin: Berliner<br />
Flughafen-Gesellschaft mbH 1974. 355 S. m. 303 Abb., Leinen, 39 DM.<br />
Das 50jährige Bestehen der „Berliner Flughafengesellschaft mbH" und die baldige Inbetriebnahme<br />
des neuen Flughafens Tegel boten der Flughafengesellschaft doppelten Anlaß zur Herausgabe<br />
einer Festschrift.<br />
Die Entwicklung des Luftverkehrs in und um Berlin vom Aufstieg des ersten Heißluftballons auf<br />
dem alten Exerzierplatz nordwestlich des Brandenburger Tores im Jahre 1788 bis zur Gegenwart<br />
wurde zum Thema des Buches. Besonders großer Raum ist der Zwischenkriegszeit, dem<br />
Ausbau der Berliner Flughäfen zum „Luftkreuz Europas", gewidmet. Die offenbar großen Verluste<br />
an Quellenmaterial erlauben es wohl nicht, eine chronologische Geschichte des Berliner<br />
Flugverkehrs und seiner Flughäfen zu schreiben: so wurde hier ein anderer Weg gesucht. Im<br />
Mittelpunkt steht die ausgezeichnet ausgewählte Bebilderung. Der oft etwas saloppe Text dient<br />
weitgehend nur als Ergänzung des Bildmaterials. Hier muß allerdings beklagt werden, daß mehr<br />
Anekdoten als Fakten geboten werden. Nur beiläufig wird an den verschiedensten Stellen die<br />
nicht ganz unbedeutende Flugzeugindustrie der Vorkriegszeit erwähnt.<br />
Der Ausbau des Zentralflughafens Tempelhof im Rahmen der „Speer-Planung" konnte im<br />
Zweiten Weltkrieg nicht vollendet werden. Trotz zahlreicher Schäden wurde der gewaltige<br />
Gebäudekomplex - einer der größten der Welt - bald wieder in Betrieb genommen, zunächst<br />
provisorisch für die amerikanische Besatzungsmacht.<br />
Die Nachkriegszeit brachte vollständig veränderte Voraussetzungen für den Flugverkehr, der nun<br />
in den Händen der Alliierten lag. Die Luftbrücke und das später einsetzende Ausfliegen von<br />
DDR-Flüchtlingen zeigen die neue politische Dimension des Luftweges als einzigem unkontrollierten<br />
Zugang nach West-Berlin. Auch der Reiseflugverkehr begann wieder im Zentralflughafen<br />
Tempelhof, zeitweise auch im britischen Flugplatz Gatow und dem auf ehem. Militärgelände<br />
während der Blockade angelegten Flugplatz Tegel, wo im Jahre 1960 mit dem zivilen Verkehr<br />
begonnen wurde.<br />
In der Schilderung der jüngsten Zeit ist das nur ein Jahr alte Werk bereits veraltet. Der Umzug<br />
in die modernen Abfertigungsanlagen in Tegel-Süd - die Eröffnung war hier noch für November<br />
1974 vorgesehen (S. 349) - bedeutete nicht eine Entlastung, sondern, im Zeichen der abnehmenden<br />
und erst jetzt sich wieder konsolidierenden Fluggastzahlen, den Abschied vom Zentralflughafen<br />
Berlin-Tempelhof. Felix Escher<br />
Schattenriß von Berlin. 2. Ausg. Amsterdam 1788. Hrsg. und mit kritischen Anmerkungen versehen<br />
von Uwe Otto. Teil 1: Kritische Betrachtungen über das offizielle Berlin, seiner Einwohner<br />
und andere Berliner Sachen. - Teil 2: Kritische Betrachtungen über das private Berlin . . . Berlin:<br />
Berliner Handpresse 1974 und 1975. Je 42 S. mit 17 111., Großformat, bibl. Pappbd., je 32 DM.<br />
(Berliner Handpresse, Reihe Werkdruck Nr. 2 u. 3.)<br />
Um es vorweg zu sagen: Der hier vorliegende Reprint, aus drucktechnischen Gründen in zwei<br />
Teilen, ist eine gefällige und amüsante Sache. Den Herausgebern der rührigen Berliner Handpresse<br />
kam bei diesem Unternehmen der Umstand zugute, daß der bis heute anonym gebliebene<br />
Verfasser den Text so passend in einzelne Kapitel aufgeteilt hat, daß beide Teile unabhängig<br />
voneinander gelesen werden können. Das Original erschien 1788, und als Verlagsort<br />
gilt - trotz gewisser Zweifel - Amsterdam, jene Stadt also, die wegen ihrer Zensurfreiheit im<br />
Zeitalter der Aufklärung überregionalen Ruhm erlangte.<br />
Die für damalige Verhältnisse sicher sehr mutige Kritik und Bestandsaufnahme hob sich entschieden<br />
von den geläufigen Vorstellungen ab, ließen jedoch auch die große Sorge um die weitere<br />
Entwicklung Berlins spürbar werden. Mit dieser Kritik sollten überalterte Zustände<br />
aufgezeigt und zum Wohle der Allgemeinheit, deren Entfaltung durch die große Armut beeinträchtigt<br />
wurde, verbessert werden. Betrachtet man die einzelnen Kapitel dieser Edition, so<br />
muß man unweigerlich zu dem Schluß gelangen, daß sowohl das gesamte öffentliche wie auch<br />
ein überwiegender Teil des privaten Berlins von den „Würmern" zerfressen waren. Mängel<br />
im medizinischen Bereich und Korruption in Verwaltung und Gerichtsbarkeit werden ebenso<br />
angeprangert, wie z. B. die um sich greifende Zuhälterei. Dies sind nur wenige Themen des<br />
Gesamtinhaltes.<br />
Schließlich noch ein Satz zur technischen Ausführung. Obwohl einige Textseiten - aus reprotechnischen<br />
Gründen - nur schwer lesbar sind, ist jene als annehmbar zu bezeichnen. Die jeweils<br />
17 Illustrationen von Wolf gang Jörg und Erich Schönig passen sich dem Text an. Die<br />
numerierte und signierte Auflage von 1200 Exemplaren - für einen Handpressendruck eine<br />
recht hohe Auflage - kann auch noch für Sammler von derartigen Druckerzeugnissen interessant<br />
sein. Claus P. Mader<br />
138
Jürgen Schmädeke: Das Fernsehzentrum des Senders Freies Berlin. Berlin: Haude & Spener<br />
1973. 75 S. Text, 50 Abb. auf Taf., Pappbd., 17,80 DM. (Buchreihe des SFB, Nr. 13.)<br />
Nach dem „Haus des Rundfunks" ist nun auch das „Fernsehzentrum des Senders Freies Berlin"<br />
in Buchform dokumentiert worden. Dem Vf., einem Journalisten, gelingt es, auch die komplizierte<br />
Technik des eindrucksvollen Bauwerks am Theodor-Heuss-Platz für den technischen Laien<br />
durchschaubar zu machen. Von dem Provisorium der Nachkriegszeit über den Wettbewerb, den<br />
Bauablauf bis hin zur Beschreibung der Funktion und Arbeit in dem neuen Komplex geht die<br />
durch einen umfangreichen Bildteil unterstützte Beschreibung des neuen Hauses. Dankenswerterweise<br />
werden die Probleme und Pannen, die bei einem Hochbauvorhaben dieser Größenordnung<br />
unvermeidlich auftreten, nicht verschwiegen. Freilich — auch das wird nicht verschwiegen —<br />
bedeutete die Anlage der großen, erst in ferner Zukunft völlig ausgelasteten Studios eine beträchtliche<br />
Oberkapazität an Fernsehproduktionsstätten und führte damit zu einem Abzug von Produktionen<br />
aus den Tempelhofer und Spandauer Ateliers - eine Frage, der man sich noch mehr<br />
Aufmerksamkeit gewünscht hätte. Erfreulich ist der (bei einer derartigen Schrift sonst durchaus<br />
nicht übliche) Anmerkungsapparat, der den Wert der Arbeit beträchtlich erhöht. Es fehlen<br />
allerdings Aufsätze über den Bau aus einschlägigen Fachzeitschriften, z. B. der „Bauwelt", die<br />
dem interessierten Leser sicherlich noch Anregungen zur weiteren Beschäftigung geben könnten.<br />
Felix Escher<br />
Im IV. Vierteljahr 1975<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Werner August, Rentner<br />
8263 Burghausen, Robert-Koch-Straße 17 a<br />
(Ruth Koepke)<br />
Maria Barthel, Rentnerin<br />
1 Berlin 31, Jenaer Straße 15<br />
Tel. 8 54 38 94 (Hildegard Golisch)<br />
Maria-Gabriele Bauwens, VHS-Dozentin<br />
1 Berlin 28, Bertramstraße 54<br />
Tel. 4 04 49 12 (Ruth Koepke)<br />
James E. Cornwall<br />
1 Berlin 15, Uhlandstraße 45, bei Hildebrandt<br />
Tel. 8 82 23 46 (Mücke)<br />
Horst Drescher, Verlagskaufmann<br />
1 Berlin 41, Steglitzer Damm 8<br />
Tel. 7 91 53 28 (Dr. Leichter)<br />
Irmgard Giering, Oberstudienrätin<br />
1 Berlin 31, Joachim-Friedrich-Straße 53<br />
Tel. 8 85 13 59 (Martin Schröder)<br />
Erika Goosmann, Lehrerin<br />
1 Berlin 42, Alt-Tempelhof 40<br />
Tel. 7 52 44 74 (Gertrud Hedrich)<br />
Eckhard Grothe, Fertigungsingenieur<br />
1 Berlin 41, Beymestraße 19<br />
Tel. 7 91 55 31 (Brauer)<br />
Karin Hindorf, Med. techn. Assistentin<br />
1 Berlin 37, Clayallee 339 a<br />
Tel. 8 01 79 30 (Schriftführer)<br />
Dr. Henner Hummelsiep, Arzt<br />
1 Berlin 41, Plantagenstraße 2<br />
Tel. 7 91 16 99 (Brauer)<br />
Prof. Dr. Guido Jüttner, Hochschullehrer (FU)<br />
1 Berlin 41, Niedstraße 36<br />
Tel. 8 52 29 86 (Vorsitzender)<br />
Eva Kempin<br />
1 Berlin 45, Gardeschützenweg 111<br />
Tel. 8 33 13 46 (Brauer)<br />
Elsa Klages, Soz.-Oberinspektorin i. R.<br />
1 Berlin 42, Kaiserin-Augusta-Straße 13<br />
Tel. 7 52 44 31 (Gertrud Hedrich)<br />
Peter-Jürgen Marcus, Studiendirektor<br />
34 Göttingen, Rosdorfer Weg 1<br />
Tel. (05 51) 4 69 10 (Schriftführer)<br />
Edmund Nawrocki, Pensionär<br />
1 Berlin 65, Nachtigal-Platz 5<br />
Tel. 4 51 95 60 (Werner Nawrocki)<br />
Friedburg Schreiber, Krankenschwester<br />
4504 Georgsmarienhütte, Stadtkrankenhaus<br />
Tel. (0 54 01) 20 21 (Hildegard Mattusch)<br />
Hedwig Wollstein, Rentnerin<br />
1 Berlin 37, Eisvogelweg 28<br />
Tel. 8 13 38 40 (Schriftführer)<br />
139
Veranstaltungen im I.Quartal 1976<br />
1. Dienstag, 13. Januar 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Gerhard<br />
Küchler: „Fürst Hermann von Pückler-Muskau 1785-1871. Ein märkischer Standesherr,<br />
Landschaftsgestalter und Reiseschriftsteller". Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
2. Mittwoch, 21. Januar 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Prof. Dr.<br />
Friedrich Mielke: „Palladio und Potsdam". Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
3. Mittwoch, 28. Januar 1976, 19.00 Uhr: Eisbeinessen anläßlich des 111. Jahrestages<br />
der Gründung unseres Vereins im Großen Saal der Hochschul-Brauerei, Berlin 65,<br />
Amrumer Straße 31 (Ecke Seestraße; U-Bahnhof Amrumer Straße, Busse 16, 64,<br />
65, 89). Es spricht Herr Alfred Braun.<br />
Voranmeldungen bis 21. 1. 1976 an Herrn Albert Brauer, 1 Berlin 31, Blissestraße<br />
Nr. 27.<br />
4. Dienstag, 10. Februar 1976, 19.30 Uhr: Lesung und Plauderei über „Wanderungen<br />
in der Mark Brandenburg heute" mit Herrn Hanz Scholz. Filmsaal des Rathauses<br />
Charlottenburg.<br />
5. Dienstag, 24. Februar 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Prof. Börsch-<br />
Supan: „Caspar David Friedrich und Berlin". Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
6. Dienstag, 9. März 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Günter Wollschlaeger:<br />
„Beispiele Berliner Jugendstilarchitektur". Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
7. Dienstag, 30. März 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Jürgen Grothe:<br />
„Häuser und Straßen im Alten Berlin der Vorkriegszeit". Filmsaal des Rathauses<br />
Charlottenburg.<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek<br />
ist zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen<br />
geselliges Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 23. Januar, 20. Februar und 19. März zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
ab 17 Uhr.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Sdiultze-Berndt, 1 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 4 65 90 11. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank, 1 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Claus P.<br />
Mader; Felix Escher. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitarg gedeckt, Bezugspreis für<br />
Nidvtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
140
' 3'' J A 20 377 F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
72.Jahrgang Heft 2 April 1976<br />
3fiEt<br />
fe^^^^^^fe.;- 1<br />
Bla*. ' ! ^t&$ ^_^^^<br />
(Hl m ^BL<br />
mma^ •rk ~*M<br />
PÄ^*<br />
w4£ y^K jJ^k<br />
•Hf; 1<br />
^1 V i»y • f ^1<br />
• »<br />
ffr JSVCi ^L^g^^s<br />
#%;- :v *<br />
'"W<br />
~*g;<br />
rfJ'<br />
V|M£<br />
Königin Luise von Preußen mit ihren beiden ältesten Söhnen, dem späteren Köni^<br />
Friedrich Wilhelm IV. und Kaiser Wilhelm I., in Königsberg<br />
(Gemälde von Karl Steffeck, 1886) Foto: Bildarchiv Preuß. Kulturbesitz<br />
141
Briefe und Tagebücher der Königin Luise<br />
im Brandenburg-Preußischen Hausarchiv<br />
Zur 200. Wiederkehr ihres Geburtstages am 10. März 1976<br />
Von Eckart Henning M. A.<br />
Das Brandenburg-Preußische Hausarchiv, 1848/52 errichtet, ist am 23. November 1943<br />
durch einen Bombenangriff auf sein Dienstgebäude am Luisenplatz in Berlin-Charlottenburg<br />
restlos zerstört und seine Geschäftsstelle daraufhin am 29. Dezember 1943 in das<br />
Geheime Staatsardiiv nach Berlin-Dahlem verlegt worden. Nur dreiundzwanzig Prozent<br />
der Bestände konnten durch eine rechtzeitige Verlagerung gerettet werden. Sie befinden<br />
sich heute im Zentralen Staatsarchiv der DDR in Merseburg, wo man das Hausarchiv<br />
als eigenen Archivkörper freilich aufgelöst hat und bestrebt war, seine Bestände Provenienzzusammenhängen<br />
einzugliedern, in denen sie einmal erwachsen waren 1 .<br />
Nur einige besondere Kostbarkeiten des Hausarchivs, die im Flakturm am Berliner Zoologischen<br />
Garten untergebracht waren, sind bei Kriegsende schließlich in das Geheime<br />
Staatsardiiv gelangt (weniger als drei Prozent des Gesamtbestandes). Unter ihnen befinden<br />
sich, außer den Testamenten der Hohenzollern, den Hausverträgen, der Belehnungsurkunde<br />
mit der Mark Brandenburg und weiteren Urkunden, Nadilässen u. a. Wittgensteins<br />
und Saegerts, audi eine Reihe von Briefen und Aufzeidinungen der Königin<br />
Luise aus den Jahren 1807 und 1810, die heute gut die Hälfte aller im Hausardiiv verwahrten<br />
Stücke von ihrer Hand ausmadien. Insgesamt besitzt das Brandenburg-<br />
Preußische Hausarchiv, das als eigener Archivkörper im Geheimen Staatsarchiv fortbesteht<br />
und auch weiterhin in Anlehnung an den Vertrag über die Vermögensauseinandersetzung<br />
zwisdien Preußen und dem vormals regierenden Königshaus vom 12. Oktober<br />
1925 2 betreut und in seinem Wiederaufbau gefördert wird, heute nodi siebenundachtzig<br />
Briefe der Königin, ferner ihre „Description de mon voyage en Hollande" (1798)<br />
sowie ihr „Journal depuis Königsberg jusqu'a Petersbourg" (1808/1809). Von den<br />
Briefen sind achtundvierzig Studie im ungebrodienen Besitz des Hausardiivs, während<br />
es sidi bei den übrigen ebenso wie bei den Reisebesdireibungen um neu-, mitunter audi<br />
um nadi dem zweiten Weltkrieg zurückerworbene Stücke handelt. Trotz des relativ geringen<br />
Umfanges dieses Bestandes ergeben sidi dodi deutlidie Schwerpunkte im Verlobungsjahr<br />
Luises 1793, ferner in den Jahren 1803 und besonders 1807, dem ersten Jahr<br />
nach der preußischen Niederlage gegen Napoleon bei Jena und Auerstädt, sowie im<br />
Todesjahr der Königin 1810.<br />
Eine wesentliche Ergänzung dieses Materials stellt der Nachlaß des zuletzt in Jena lehrenden,<br />
1953 verstorbenen Königin-Luise-Forsdiers Karl Griewank im Brandenburg-<br />
Preußisdien Hausardiiv dar 3 . Er besteht hauptsädilidi aus 1928 angefertigten Absdiriften<br />
und Übersetzungen der französisdi geführten Korrespondenz zwisdien der Königin und<br />
1 Vgl. meine entsprechenden Angaben über das Hausarchiv und die dort vermerkte Literatur im<br />
Führer durch das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Berlin 1974, S. 43-44.<br />
8 Otto Heinrich Meisner: Das Hausarchiv in Charlottenburg, in: Denkschrift [des Preußischen<br />
Finanzministeriums] zur Frage der Vermögensauseinandersetzung zwischen dem preußischen<br />
Staat und dem vormals regierenden Königshaus. [Berlin 1924], Sp. 184-187.<br />
* Brandenburg-Preußisches Hausarchiv (künftig zit.: Br.-Pr. Hausardiiv), Rep. 192, Nadilaß<br />
Griewank.<br />
142
Briefpapier der Königin Luise aus verschiedenen Jahren<br />
ihrem Gemahl aus den Jahren 1793-1810, die Griewank für seine Veröffentlichungen 4<br />
anfertigte. Der Umfang dieser Sammlung, die auch unveröffentlichte Briefe Luises enthält,<br />
beläuft sich auf siebzehn Mappen.<br />
Prinzessin Auguste Wilhelmine Amalie Luise von Mecklenburg-Strelitz wurde vor<br />
200 Jahren am 10. März 1776 in Hannover im „Alten Palais an der Leinestraße" geboren,<br />
wo ihr Vater, Erbprinz Karl von Mecklenburg-Strelitz (1741-1816) 5 , bis 1787<br />
Gouverneur der Stadt, als großbritannisch-hannöverscher Generalleutnant lebte; Luises<br />
Mutter Friederike, eine Tochter Landgraf Georgs von Hessen-Darmstadt, starb bereits<br />
1782. Das Leben Luises, die in Darmstadt aufwuchs (1786-93), am 24. Dezember 1793<br />
in Berlin mit dem Kronprinzen von Preußen vermählt und 1797 an der Seite ihres<br />
4 Königin Luise. Briefe und Aufzeichnungen. Hrsg. u. erl. von Karl Griewank. Leipzig 1924 (zit.<br />
Griewank I), und Briefwechsel der Königin Luise mit ihrem Gemahl Friedrich Wilhelm III.<br />
1793-1810, hrsg. von Karl Griewank. Leipzig 1930 (zit. Griewank II). - Hinweis: Deutsche<br />
Wörter innerhalb des französischen Brieftextes der Königin sind durch spitze Anführungszeichen<br />
(», «) markiert.<br />
5 Seit 1794 Herzog, nach 1815 Großherzog von Mecklenburg-Strelitz.<br />
143
Gemahls, König Friedrich Wilhelms III., preußische Königin wurde, ist so oft erzählt<br />
worden 6 , daß sich hier eine erneute Darstellung erübrigt.<br />
Ihrem Gedächtnis dienen daher wohl am besten ihre Briefe an Friedrich Wilhelm aus<br />
dem Jahre 1807, von denen wir aus Anlaß ihres Jubiläums einige in den Übersetzungen<br />
Karl Griewanks wiedergeben wollen. In ihnen kommt die Persönlichkeit der Königin,<br />
von der Theodor Fontane mit Recht bemerkt hat, daß sie „mehr als von der Verleumdung<br />
ihrer Feinde, von der Phrasenhaftigkeit ihrer Verherrlicher zu leiden gehabt" hat 7 ,<br />
am unmittelbarsten zum Ausdruck 8 . Es sind meist ernsthafte, mitunter verzweifelte,<br />
zumeist aber hoffnungsvolle und gelegentlich auch humorvolle Briefe, die immer in erster<br />
Linie von der Liebe zu ihrem Manne zeugen, dessen uneingeschränktes Vertrauen sie besaß<br />
und dessen Ohr sie auch in politischen Fragen, denen sie sich meist von der ethischen<br />
Seite her genähert hat, immer wieder suchte.<br />
Vergegenwärtigen wir uns die damalige politische Lage Preußens 9 : Der Separatfrieden<br />
Österreichs mit Napoleon in Preßburg am 26. Dezember 1805 hatte die dritte Koalition<br />
zwischen England, Rußland, Österreich und Schweden endgültig auseinandergesprengt.<br />
Sie war letztlich gescheitert, weil sich Preußen seit dem Baseler Sonderfrieden (1795)<br />
neutral verhielt. In Südwestdeutschland entstand der „Rheinbund" von Napoleons<br />
Gnaden, dem sechzehn Staaten beitraten. Ihre Mitgliedschaft setzte das Ausscheiden aus<br />
dem Reichsverband voraus, worauf Kaiser Franz II. in Wien die Krone des Heiligen<br />
Römischen Reiches Deutscher Nation niederlegte. In Berlin sah man nach Auflösung des<br />
Reiches und der Besetzung Hannovers durch Preußen, dem Pariser Vertrag vom 15. Februar<br />
1806 entsprechend, eine Chance, einen norddeutschen Bund unter preußischer Führung<br />
zu bilden, den Napoleon anfänglich zu tolerieren schien. Zur Absicherung im Osten<br />
war es Hardenberg in Verhandlungen mit Kaiser Alexander I. gerade gelungen, eine<br />
preußisch-russische Verständigung zustande zu bringen, als das preußische Ultimatum<br />
vom 26. September 1806 an Frankreich und seine Folgen allen derartigen Plänen ein<br />
jähes Ende machte. Die vernichtende Niederlage, die Napoleon Preußen bei Jena und<br />
Auerstädt am 14. Oktober bereitete und die nachfolgende Besetzung fast des ganzen<br />
Landes ließen die königliche Familie über Stettin, Graudenz, Osterode und Orteisburg<br />
nach Königsberg, im Januar 1807 schließlich in die äußerste Nordostecke Preußens, nach<br />
Memel, fliehen.<br />
So zeigt der erste der hier wiedergegebenen Briefe, vom 12. April 1807, die Königin<br />
als Flüchtling in Ostpreußen, als sie unter stärksten persönlichen Entbehrungen und Lei-<br />
* Als maßgeblich kann im ganzen immer noch die umfangreiche, aus den Quellen geschöpfte und<br />
1913 auf Vorschlag der Preußischen Akademie der Wissenschaften von Kaiser Wilhelm II. mit<br />
dem Verdun-Preis ausgezeichnete Biographie des Geheimen Archivrats Paul Bailleu gelten:<br />
Königin Luise. Ein Lebensbild. Bln./Leipzig erstmals 1908, 3. Aufl. hrsg. von Hermann Dreyhaus<br />
1926. - Aus der Vielzahl von Veröffentlichungen über die Königin seien aus neuerer Zeit<br />
außerdem genannt: Hans v. Arnim: Königin Luise. Berlin 1969 (= Berlinische Reminiszenzen,<br />
Bd. 24) und Constance Wright: Louise, Queen of Prussia. A Biography. London 1970.<br />
' Vgl. Theodor Fontane: Das Luise-Denkmal, in: Wanderungen durch die Mark Brandenburg,<br />
T. I, S. 479. München 1960 (= Sämtliche Werke [sogen. Nymphenburger Ausg.] Bd. IX, hrsg.<br />
von Edgar Groß).<br />
8 Zur Problematik von Briefen wie anderer autobiographischer Aufzeichnungen als Quellen des<br />
Historikers, vgl. Eckart Henning: Selbstzeugnisse, in: Handbuch der Genealogie, für den Herold<br />
hrsg. v. E. Henning u. W. Ribbe. Neustadt/Aisch 1972, S. 132-142 (Lit.-Ang. S. 280).<br />
* Vgl. Deutschland unter Napoleon. Augenzeugenberichte, hrsg. und eingel. von Eckart Kleßmann.<br />
Düsseldorf 1965.<br />
144
den nach der Begegnung zwischen König Friedrich Wilhelm III. mit Kaiser Alexander<br />
von Rußland in Kydullen (4.-11.4.) allein nach Königsberg zurückkehrte:<br />
„Ich benutze den Eilboten, den General Rüchel 10 Dir schickt, um Dir mitzuteilen,<br />
daß ich mehr tot als lebendig angekommen bin, infolge der schrecklichen Wege, die ich<br />
gerade bei einem Regen, Sturm und Schmutz, von denen ich bis jetzt noch keine<br />
Ahnung hatte, zurücklegen mußte. Von Sanditten bis hierher brauchte ich 8 Stunden,<br />
mitten auf dem Wege blieb ich im Schmutz stecken. Zwei Pferde sind im Kot fast<br />
umgekommen, nur mit Hilfe von Menschenkräften konnte ich mich nach einer halben<br />
Stunde Arbeit daraus befreien, 10 Männer hielten den Wagen, andere hatten Hacken,<br />
Klötze und Schaufeln, um die Räder freizumachen; Bäume und Balken wurden unter<br />
den Wagen gelegt, um vorwärtskommen zu können. Kurz, es ist die unglaublichste<br />
Reise, die ich in meinem Leben machte. Ich habe meine Frauen seit Kydullen nicht<br />
gesehen, ich zog mich an und aus, machte mein Bett, packte ganz allein ein; nein,<br />
lieber Freund, es ist stark. Ich beabsichtige sie hier zu erwarten und diese Stadt<br />
nicht eher zu verlassen, ehe ich nicht weiß, ob man die Wege bei Kranz passieren<br />
kann. Morgen werde ich Dir mehr darüber mitteilen, aber für heute bin ich tot . . ."<br />
[Königsberg, 12. 4. 1807J 11 .<br />
Alexander und Friedrich Wilhelm hatten sich von Kydullen, wo der König Hardenberg<br />
zum Kabinettsminister ernannte 12 , weiter nach Bartenstein begeben, wo sie am 23. April<br />
1807 einen neuen Vertrag schlössen, der die Zurückdrängung Frankreichs über den Rhein<br />
und die Wiederherstellung Preußens vorsah.<br />
Königin Luise hielt sich in Königsberg vom 12. April bis zum 10. Juni, dem Tag ihrer<br />
Rückkehr nach Memel, auf. Der folgende Brief an Friedrich Wilhelm III. stammt aus der<br />
„besten Zeit" Luises 13 in diesen schrecklichen Jahren, nämlich der Zeit nach der -<br />
unentschieden verlaufenen - Schlacht bei Preußisch-Eylau (7./8. 2. 1807) und der bei<br />
Friedland am 14. Juni 1807, die den militärischen Widerstand Preußens wie auch Zar<br />
Alexanders vollständig brach. — Der König hatte seine Frisur geändert - die „Zopfzeit"<br />
war vorüber:<br />
„Das Geschenk, daß Du mir gemacht hast, ist wirklich ganz neuartig und gewiß<br />
werde ich diesen Zopf mein ganzes Leben aufbewahren; er hat mich zu einer recht<br />
eigenartigen Betrachtung geführt, und das Ergebnis ist nicht angenehm. Denn vor<br />
zwei Jahren hätte man in Preußen nicht gewagt, an diese Änderung zu denken,<br />
wegen der Idee und des Wertes, die man dem alten Kostüm der preußischen Armee<br />
beimaß. Der siebenjährige Krieg hatte seine Macht bis auf die Haartracht ausgedehnt,<br />
und wer sie hätte ändern wollen, hätte ein Majestätsverbrechen begangen. Die Macht<br />
der französischen Revolution hat diese Änderung gestattet, denn, meiner Treu, niemand<br />
wird den Zopf tragen wollen, um die Erinnerung an den Tag des 14. Oktober<br />
zu verewigen, der gegen die Revolutionäre verloren ging. Jedenfalls habe ich bis zu<br />
Tränen gelacht über das »Zäpfchen«, und es soll unangetastet aufbewahrt bleiben bis<br />
an der Welt Ende . . . Ich muß Dir noch sagen, daß das Geschenk Deines Zopfes mir<br />
10 General Ernst Philipp v. Rüchel (1754-1823), seit 7. Dezember 1806 Gouverneur von Preußen.<br />
11 Br.-Pr. Hausarchiv, Rep. 49 Nr. 34; Griewank II, S. 271 f.<br />
n Der König hatte ihm zugleich die Führung der auswärtigen Politik übertragen. In Kydullen<br />
durfte Hardenberg ihm überdies, zum ersten Male in der preußischen Geschichte, ohne Vermittlung<br />
eines Kabinettsrates Vortrag halten.<br />
18 Vgl. Paul Bailleu: Königin Luise a. a. O., S. 227.<br />
145
wirklieb Vergnügen gemacht hat, denn ich wünschte diese Toilettenänderung längst,<br />
und im Kriege ist alles, was die Toilettenbedürfnisse vereinfachen kann, wirklich<br />
gut . . ." [Königsberg, 6. Mai 1807] u .<br />
Sechs Tage später nimmt Luise in einem ebenfalls noch heute im Hausarchiv aufbewahrten<br />
Brief an Friedrich Wilhelm unmittelbar zu politischen Fragen Stellung. Sie empfiehlt<br />
ihm dringend, wie so oft in diesen Tagen, sich von Generalmajor Wilhelm von Zastrow<br />
(1758-1830), seit Januar 1807 Minister des Äußern, zu trennen und legte ihm stattdessen<br />
immer wieder Hardenberg (1758-1822) und dessen politische Freunde ans Herz, von<br />
denen sie die innere Erneuerung und schließlich äußere Rettung Preußens erhoffte.<br />
Nicht minder mitteilenswert erscheint uns aber auch ein anderer Teil dieses Briefes zu<br />
sein, in dem Luise philosophierend einige Betrachtungen an das Wetter knüpft, die ihre<br />
innersten Überzeugungen berühren: sie glaubt, daß es im Grunde genommen im Leben<br />
nur darauf ankomme, sich „des Herzens Unverdorbenheit zu bewahren" (wie sie auf<br />
deutsch bekräftigend hinzufügt), ja, daß es nur einer reinen „Seele und eines einfachen<br />
Herzens" bedürfe, den Menschen wirklich glücklich zu machen und ihn an seine eigentlichen<br />
Pflichten zu erinnern. Anklänge an Schiller, den Luise den meisten anderen<br />
Dichtern ihrer Zeit vorzog 15 , werden hier spürbar.<br />
„. .. Wenn ich Dir übrigens sagen soll, was ich denke, so glaube ich, daß Du Dich<br />
des Herrn Zastrow entledigen mußt, denn ein Mann, der den Waffenstillstand aus<br />
Überzeugung unterschrieben hat, ich sage aus Überzeugung, wird Dir<br />
niemals gut dienen; »never never good*. - Die Leidenschaft mischt sich in alle seine<br />
Taten; ich muß Dir gestehen, er ist mir doppelt verdächtig, weil er Ländereien in<br />
14 Br.-Pr. Hausarchiv, Rep. 49 Nr. 46; Griewank II, S. 299 f.<br />
15 Vgl. die Ausführungen Caroline Friederikes von Berg, Luises vertrauter Freundin, in ihrem<br />
anonym erschienenen Buch: Die Königin Luise. Der preußischen Nation gewidmet. [Berlin]<br />
1814, S. 13 f. Vgl. auch Luises Schiller-Zitat im letzten wiedergegebenen Brief vom 29. Juni 1807.<br />
18 Gemeint ist der Charlottenburger Waffenstillstand vom 16. November 1806, den der König,<br />
hauptsächlich auf Betreiben Steins und Voß', abgelehnt hatte.<br />
146
Polen hat; die Ratschläge, die er seit seinem Eintritt ins Ministerium gegeben hat,<br />
schmeckten etwas nach dem Bestreben, sie sobald wie möglich wieder zu erlangen.<br />
König, Staat und Patriotismus kamen hinterher, und der Egoist zeigte sich nicht<br />
schlecht. Er bietet Dir an, Dich zu verlassen, wünsche ihm glückliche Reise . . . Alle<br />
Wohlgesinnten begrüßen, was Du zur Förderung des Guten getan hast, d. h. alles<br />
Vertrauen, das Du Hardenberg bezeigst. Er ist umgeben von den besten Köpfen des<br />
Königreichs, und die Wahl seiner Beamten und Berater wird allgemein gebilligt .. .<br />
Nach drei Gewittern haben wir hier Kälte, einen kleinen Februarwind und leuchtenden<br />
Sonnenschein, der sich nur über uns lustig macht; denn die Strahlen, mit denen er uns<br />
berührt, sehen so aus, als ob sie wärmen, und sind nur gelb gefärbt. Könnte man nicht<br />
diesen kalten schönen Sonnenschein mit einem koketten Mädchen vergleichen, wenn<br />
man nicht zuviel Philosophie in einem Briefe scheute? Wenn Reichtum der Seele und<br />
des Herzens nicht die Handlungen eines Menschen erwärmen, ist alles verführerische<br />
Äußere nichts; einen Augenblick dauert das, erfreut das; aber dann sind wir enttäuscht,<br />
denn niemals werden wir getröstet durch eine kalte Seele; wir verlassen diesen<br />
Menschen, ohne eine angenehme Erinnerung von ihm zu bewahren, da er uns<br />
nichts Tröstliches gibt; er lehrt uns nichts, er gibt uns nichts; denn er will genießen,<br />
will bedient werden. Möge Gott jedem Menschen, um ihn glücklich zu machen, eine<br />
reine Seele und ein einfaches Herz bewahren, so daß er nur einen Augenblick zu überlegen<br />
braucht, um sich seiner Pflichten zu erinnern. ]e mehr man »des Herzens Unverdorbenheiu<br />
bewahrt, um so glücklicher ist man. - Aber basta, das paßt nicht in einen<br />
Brief, denn es gleicht einer Predigt . .." [Königsberg, 12. Mai 1807J 17 .<br />
Der folgende Brief vom 24. Juni 1807, der an ihren Vater in Neustrelitz gerichtet ist,<br />
steht bereits ganz unter dem Eindruck der endgültigen Niederlage der Verbündeten bei<br />
Friedland. Das Schreiben aus Memel nimmt den philosophierenden Ton des früheren<br />
Briefes unter veränderten Bedingungen wieder auf; aus ihm spricht Luises unbeirrbare<br />
Standhaftigkeit, aber auch ihre ganze Hoffnungslosigkeit.<br />
„. . . Auf dem Wege des Rechts leben, sterben, ja wenn es sein muß, Brot und Salz<br />
essen, nie, nie werd' ich unglücklich sein. Nur hoffen kann ich nicht mehr. Wer so wie<br />
ich von seinem Himmel heruntergestürzt ist, kann nicht mehr hoffen. Kommt das<br />
Gute, o! kein Mensch ergreift, genießt, empfindet es dankbar so wie ich, aber hoffen<br />
kann ich nicht mehr. Kommt Unglück, so setzt es mich auf Augenblicke in Verwunderung,<br />
aber beugen kann es mich nie, sobald es nicht verdient ist. Nur Unrecht, nur<br />
Unzuverlässigkeit des Guten unsererseits bringt mich zu Grabe, da komm' ich nicht<br />
hin, denn wir stehen hoch. Sehen Sie, bester Vater, so kann der Feind des Menschen<br />
nichts über mich . .." [Memel, 24. Juni 1807 J ls .<br />
Am 7. und 9. Juli 1807 wurde in Tilsit der Friedensvertrag zwischen Preußen und Frankreich<br />
geschlossen, der Preußen nach Napoleons Willen auf die Gebiete östlich der Elbe<br />
beschränkte, während der westliche Teil zum Königreich Westfalen zusammengefaßt<br />
wurde. Damit zahlte Preußen, auch wenn Kaiser Alexander seine gänzliche Auflösung<br />
verhinderte, schließlich den Preis für die französisch-russische Verständigung.<br />
Am 27. Juni 1807 versuchte Luise noch, wie immer, dem niedergeschlagenen und unschlüssigen<br />
Friedrich Wilhelm brieflich beizustehen, in dem sie ihm Ratschläge, fast möchte man<br />
17 Br.-Pr. Hausarchiv, Rep. 49 Nr. 49; Griewank II, S. 310 ff.<br />
18 Br.-Pr. Hausarchiv, Rep. 49 Nr. 63; Griewank I, S. 221 f.<br />
147
sagen „Verhaltungsmaßregeln", für die politischen Gespräche in Tilsit mitzugeben versucht,<br />
Zeilen, die ihre Vertrautheit mit allen anstehenden Problemen verraten und zugleich<br />
von einem heroischen Idealismus getragen sind, der dem König Halt gab und ihm<br />
half, Mut und Selbstbewußtsein wiederzuerlangen.<br />
„... aber verstehen kann ich nicht und werde ich niemals den Aufenthalt der drei<br />
gekrönten Häupter in Tilsit . . . Aber ich beschwöre Dich, eines »zu beherzigen«:<br />
Wende bei diesem Handel alle Energie auf, deren Du fähig bist, und gib in keiner<br />
Weise irgend etwas zu, was Deine Unabhängigkeit zerstört. Das Unglück soll uns<br />
wenigstens eine große Lehre gegeben haben: wir haben so entbehren lernen, daß uns<br />
solche Art von Aufopferung, daß uns ein Opfer an Land nichts sein darf im Vergleich<br />
zu dem Opfer unserer Freiheit. Mag Napoleon Dir die Hälfte Deines bisherigen<br />
Besitzes nehmen, wenn Du das, was Dir zugebilligt wird, nur in vollem Besitz behältst,<br />
mit dem Vermögen, Gutes zu tun, die Untertanen, die Gott Dir läßt, glücklich<br />
zu machen und Dich politisch dort anzuschließen, wohin die Ehre Dich ruft und wohin<br />
Deine Neigungen Dich führen. Hardenberg darf nicht geopfert werden . . .; es wäre<br />
geradeso, wie wenn Du die Entfernung Talleyrands fordertest . . . Ich wage zum<br />
zweitenmal die Bitte, daß Du in diesem Handel alle Energie anwendest, deren Du<br />
fähig bist. Ich wiederhole: Was ist Opfer an Land im Vergleich mit dem Opfer der<br />
Freiheit des Geistes, der Freiheit zu edler Tat, kurz des eigenen Vermögens? Mit<br />
Napoleon würdest Du böse und schlecht werden, das Gelächter der Welt . . . Ich mißtraue<br />
sehr diesem Tilsiter Aufenthalt; Du und der Kaiser [Alexander], die Redlichkeit<br />
selbst, zusammen mit der Hinterlist, dem Teufel, »Doktor Faust und sein Famulus<br />
29 cela n'ira jamais, und keiner ist dieser Gewandheit gewachsen. Tant pis und<br />
gottlob!« . . ." [Memel, 27. Juni 1807p 1 .<br />
Der letzte Brief Luises, aus dem noch einige Partien wiedergegeben werden, zeigt die<br />
Königin wenige Tage vor ihrer Begegnung mit Napoleon am 6. Juli 1807 in Tilsit, wo<br />
sie vergeblich versucht hat, den Sieger milder zu stimmen und günstigere Friedensbedingungen<br />
für Preußen zu erwirken. Der Brief vom 29. Juni an Friedrich Wilhelm zeigt,<br />
wie Luise unter der „Hinterlist" Napoleons leidet und läßt leicht ermessen, welche Überwindung<br />
es sie kostete, von Memel aus nun ihren Gang nach Canossa anzutreten.<br />
„. . . Es gibt kein grausameres Los als unseres . . . Seine [Napoleons] schlechten Absichten<br />
gegen uns setzen mich nicht in Erstaunen, ich habe sie nie bezweifelt, nur Lombard<br />
iz und Haugwitz 23 zweifelten eine Zeitlang daran. Was Du mir berichtest von<br />
Hardenberg und von dem anspruchsvollen Wesen seines Feindes, bringt mich wirklich<br />
zur Verzweiflung, denn ich kenne niemand, aber auch niemand, der ihn ersetzen<br />
könnte. Da Napoleon sich anspruchsvoll nennt, erkläre Du Dich für starrköpfig wie<br />
ein Maultier, dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Ich weiß nicht, was<br />
ich von seinen Absichten denken soll, aber ich glaube, entweder will er Dich wieder<br />
einsetzen in Deine Staaten und Dich abhängig machen wie die reizenden Könige sei-<br />
18 Charles-Maurice von Taüeyrand-Perigord, Fürst von Benevent (1754-1838), französischer<br />
Minister des Auswärtigen seit 1797 bzw. 1799.<br />
*° Napoleon und Talleyrand.<br />
S1 Br.-Pr. Hausarchiv, Rep. 49 Nr. 65; Griewank I, S. 224 ff.<br />
11 Johann Wilhelm v. Lombard (1767-1812), preußischer Geheimer Kabinettsrat und Kabinettssekretär.<br />
85 Christian August Heinrich Kurt Graf v. Haugwitz und Frhr. v. Krappnitz (1752-1831).<br />
148
ner Fabrik, oder Didi ganz einfach aus Deinem Königreich verjagen und es den reizenden<br />
Murat 2i und ]erome 2!i zum Geschenk machen . .. Seine unhöflichen Manieren<br />
setzen mich nicht in Erstaunen, denn dafür gibt es zwei Gründe: Mangel an gutem<br />
Willen oder Mangel an Lebensart und an Kenntnis der höfischen Gebräuche. Denn<br />
wie sollte wohl dieses höllische Wesen, das sich »aus dem Kot emporgeschwungen*<br />
hat, wissen, was Königen zukommt? . . . Die Zeichen N. und A. am Pavillon ohne<br />
das Deine, die Einladung des Kaisers zum Essen ohne Dich, all das sind wirklich<br />
Grobheiten zu seiner Belustigung. Zunächst gehört die Memel Dir; warum läßt er<br />
denn das Zeichen dessen fort, dem das Land gehört, und warum lädt er Dich nicht<br />
auch ein, nachdem er Deine Bekanntschaft gemacht hat? »Nun, es lebt doch noch ein<br />
Gott, der wird ihm schon den Lohn geben, den er verdient.« Hat er etwa zu Dir<br />
etwas von Hardenberg gesagt? Und wem hat er seinen Plan vorgeschlagen, sich Preußen<br />
zu reservieren, um den Krieg mit Rußland zu führen? Nein, das ist wahrhaftig<br />
zu stark, und nichts, was ich noch gesehen habe, gleicht diesem würdelosen, niederträchtigen<br />
Mörder. Ich bin sicher, wenn Du es auch nicht gesagt hast, hast Du lebhaft<br />
gefühlt, was Maria Stuart beim Anblick der Elisabeth von England sagt: »In dieser<br />
Brust wohnt kein Herz!«"*« . . . [Memel, 29. Juni 1807]".<br />
Nicht allein, weil es an unmittelbaren Zeugnissen im heutigen Hausarchiv über die oft<br />
beschriebene Tilsiter Begegnung der Königin mit Napoleon mangelt, in der Luise dem<br />
Kaiser auf seine Frage: „Aber wie konnten Sie den Krieg mit mir anfangen?" die berühmt<br />
gewordene Antwort gab: „Der Ruhm Friedrichs des Großen hat uns über unsere<br />
Mittel getäuscht" 28 , sondern mehr aus Raummangel muß ein näheres Daraufeingehen<br />
unterbleiben 29 .<br />
Die vorstehend abgedruckten Briefstellen müssen dem einen als Erinnerung, dem anderen<br />
als ersten Anhaltspunkt für eine Beschäftigung mit Luise genügen, die als einzige unter<br />
allen preußischen Königinnen wirklich volkstümlich geworden und deren Name auch<br />
heute noch weiten Kreisen ein Begriff ist. Ob ihr über Berühmtheit hinaus „Größe" zugeschrieben<br />
werden kann, scheint heute zweifelhaft geworden zu sein. Während die erste<br />
Ausgabe des bekannten Sammelwerkes „Die Großen Deutschen" Karl Griewanks kompetente<br />
Würdigung der Königin, fast möchte man sagen „selbstverständlich", noch enthält<br />
30 , meinten die Herausgeber der neuen Ausgabe 31 ohne die Biographie Luises auskommen<br />
zu sollen. Auch im fünften (Nachtrags-)Band findet man sie nicht, obwohl Theodor<br />
Heuss in seiner Einleitung „Über Maßstäbe geschichtlicher Würdigung" mit Recht an-<br />
24 Joachim Murat (1771-1815), Schwager Napoleons, Großherzog von Cleve und Berg (1806 bis<br />
1808), dann König von Neapel.<br />
25 Jerome, jüngster Bruder Napoleons (1784-1860), König von Westfalen.<br />
86 Friedrich v. Schiller, Maria Stuart 111,4: „O Gott, aus diesen Zügen spricht kein Herz!"<br />
27 Br.-Pr. Hausarchiv, Rep. 49 Nr. 67; Griewank I, S. 133.<br />
28 Zit. nach v. Arnim, Königin Luise a. a. O., S. 77. Etwas abweichend vgl. H. Sandt/W. Schlegel,<br />
Königin Luise, Charlottenburg o. J., S. 52.<br />
29 Vgl. am ausführlichsten Tessa Klatt: Königin Luise von Preußen in dem Zeitalter der Napoleonischen<br />
Kriege. Berlin 1937, II. Abschnitt: Königin Luise und Napoleon, S. 130-198<br />
(= Schriften d. kriegsgeschichtlichen Abteilung des Histor. Seminars a. d. Friedrichs-Wilhelms-<br />
Universität zu Berlin, H. 20).<br />
30 Die Großen Deutschen, 4 Bde., hrsg. v. Willy Andreas und Wilhelm v. Scholz, Berlin 1935/36,<br />
Bd. II, S. 476-489.<br />
31 Die Großen Deutschen, 4 Bde., 1 Nachtrags-Bd., hrsg. v. Hermann Heimpel, Theodor Heuss<br />
und Benno Reifenberg. Berlin 1956/57.<br />
149
merkt, daß derjenige „ein Grundelement der ,Größe' verspielt", der „im Unterliegen<br />
menschlich versagt", ja „Seelengröße" als Kategorie ausdrücklich gelten läßt 32 . Mag man<br />
auch heute dazu neigen, Luises Rolle als „Schutzgeist" 33 für die Männer der Stein-Hardenbergschen<br />
Reformen stärker zu betonen als ihre eigene innere Haltung in dieser Zeit,<br />
so gehört doch in Wahrheit beides, die Seelengröße der Königin, von der schon die wenigen<br />
angeführten Briefzitate zeugen, und die Wirkungen, die von ihr auf die Zeitgenossen<br />
ausgingen, untrennbar zusammen. Zwei von ihnen, Heinrich von Kleist und Wilhelm<br />
von Humboldt, mögen hier stellvertretend für viele sprechen:<br />
Kleist schrieb am 6. Dezember 1806 an seine Schwester Ulrike:<br />
„In diesem Kriege, den sie [Luise] einen unglücklichen nennt, macht sie einen größeren<br />
Gewinn, als sie in einem ganzen Leben voll Frieden und Freuden gemacht haben<br />
würde. Man sieht sie einen wahrhaft königlichen Charakter entwickeln. Sie hat den<br />
ganzen großen Gegenstand, auf den es jetzt ankommt, umfaßt; sie, deren Seele noch<br />
vor kurzem mit nichts beschäftigt schien, als wie sie beim Tanzen, oder beim Reiten,<br />
gefalle. Sie versammelt alle unsere großen Männer, die der K[önig] vernachlässigt,<br />
und von denen uns doch nur allein Rettung kommen kann, um sich; ja, sie ist, die<br />
das, was noch nicht zusammengestürzt ist, hält" M .<br />
Humboldt äußerte sich am 31. Juli 1810 in einem Brief an seine Frau Caroline, ferner<br />
am 29. August 1810 über Königin Luise:<br />
„Ich leugne nicht, daß mich diese Tage sehr erschüttert haben. Die Königin war, auch<br />
bloß als Frau betrachtet, von einer seltenen Harmonie in ihrem ganzen Wesen; sie<br />
hatte wirkliche Größe und alle Sanftmut, die nur aus den herzlichsten häuslichen Verhältnissen<br />
hervorgehen kann; sie war dabei uns sehr gut, und wir haben unendlich<br />
viel mit ihr verloren . . , 35 Sie hatte im höchsten Grade die Gabe zu beseelen, zu ermutigen,<br />
zu beleben und wieder zu beruhigen allein schon durch ihre Gegenwart,<br />
selbst in gefahrvollen Augenblicken; sie erkannte alle Talente; sie besaß die Kunst,<br />
selbst diejenigen zu entdecken, die sich am wenigsten selbst hervortaten. Man muß ihr<br />
die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß sie mit äußerster Schlichtheit und Milde,<br />
und obwohl sie sich fast niemals in eingehender Weise mit Staatsgeschäften befaßt<br />
hat, dem Staate und den Staatsgeschäften alle Eigenschaften nützlich zu madien<br />
wußte, durch welche die vornehmsten Frauen Leben und Seele über die Gesellschaft<br />
verbreiten" si .<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 38, LückhoffStraße 33<br />
3S Ebenda Bd. I, S. 14 f.<br />
53 Ein in der Literatur gängiger Ausdruck, vgl. u. a. Paul Seidel: Die zeitgenössischen Bildnisse<br />
der Königin Luise, im Anhang zu Paul Bailleus Biographie, a. a. O., S. 359.<br />
" Heinrich v. Kleist: Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von Helmut Sembdner, Bd. II, München<br />
1961, S. 773 f.<br />
35 Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen, hrsg. von A. v. Sydow, Bd. III, Berlin<br />
1909, S. 451.<br />
30 Zit. nach H. Sandt/W. Schlegel a. a. O., S. 165 f.<br />
150
Gerhart Rodenwaldt<br />
Archäolog und Berliner (1886-1945)<br />
Von Dr. Hans B. Jessen<br />
Aber nichts ist verloren und verschwunden,<br />
"Was die geheimnisvoll waltenden Stunden<br />
In den dunkel schaffenden Schoß aufnahmen -<br />
SCHILLER: Die Braut von Messina III, 5<br />
„Die Friedrichs-Sitzung der Preußischen Akademie der Wissenschaften war in diesem<br />
Jahre" - berichtet am 30. Januar 1945 die Deutsche Allgemeine Zeitung - „ohne jeden<br />
herkömmlichen Glanz. Die Würde der Einfachheit fand gleichsam ihr Spiegelbild in dem<br />
Vortrag von Professor Rodenwaldt über Griechisches und Römisches in Berliner Bauten<br />
des Klassizismus", endend mit dem Anruf dreier Denkmale, ohne allen Prunk, nur dem<br />
Zwecke gehorchend, „schön und einfältig aufgeführt" (Winckelmann), wie kaum andere<br />
Berlins Gesicht und Berlins Geist bedeutend, in strenger Großgestalt, über alle Architektur<br />
hinaus, exempla patriae: „Aber mit Stolz sollten wir uns dessen bewußt sein, daß in<br />
Bauten wie dem Brandenburger Tor, der Neuen Wache und dem Museum aus der Begegnung<br />
preußisch-berlinischen Geistes mit der Antike, aus der Erinnerung an die Taten<br />
Friedrichs und dem Erlebnis der Notzeit und der Befreiungskriege, aus der Bewahrung<br />
guter Tradition und der Meisterung neuer Aufgaben Werke entstanden sind, die es mit<br />
demselben Recht, wie antikische Bauten der Renaissance oder Schöpungen der zeitgenössischen<br />
Literatur verdienen, nicht klassizistisch, sondern klassisch genannt zu werden."<br />
Kaum drei Monate später gibt Gerhart Rodenwaldt sich in der eingeschlossenen Stadt<br />
den Tod. Die Eroberung, die auch die Wirkensstätte seiner früheren Mannesjahre, das<br />
Deutsche Archäologische Institut, zur Ruine macht, erlebt der Achtundfünfzigjährige<br />
nicht mehr. Er geht in einem Augenblick davon, als seine Hand von allen die notwendigste,<br />
gerade für jenes Haus die rettendste werden sollte. Wie schrill, wie beklemmend<br />
der Ausgang - vermochte ein mit Berlin, mit seinen Menschen von einst und damals,<br />
seiner Wissenschaft, seinem künstlerischen Wollen auf das fühlsamste und fruchtbarste<br />
verflochtenes Gelehrtenleben wie dieses wohl würdiger, sinnhaltiger, ja trotz aller Bitternis<br />
wagen wir es: schöner zu schließen als an solchem Tage, solchem Ort, mit solchen<br />
abermals eindringsamen Bemühen um das alte, vaterstädtisch-heimatländische Thema<br />
„Preußen und die Antike"? Ob bewußt, ob vom Sprecher kaum geahnt - die Friedrichs-<br />
Rede am 25. Januar 1945 ist wie ein Scheidegruß an seine Welt, an die beiden Vaterländer,<br />
das des Geistes, das der Geburt, ist über alle fachliche Bekenntnis zu ihr, die einzig<br />
unter Deutschlands Städten auch in der Hinwendung, in dem vielfältig wiederschaffenden<br />
Bunde mit den Alten, ist eines Berliners „letztes Wort", sein heimisch-berlinisches<br />
Vermächtnis über den Tag hinaus.<br />
1922 war Rodenwaldt, am 16. April 1886 in einem Altberliner Hause geboren, nach<br />
Studium, Wanderjahren, Kriegsdienst und nur kurzer auswärtiger Lehrtätigkeit nach<br />
Berlin zurückgekehrt, als Präses des Deutschen Archäologischen Instituts, des 1829 ins<br />
Leben getretenen, weit über Deutschland hinaus wirkenden, als Gelehrten-Korporation<br />
wie überhaupt als geistesgeschichtliches Phänomen einzigartigen Zentrums zur Erkundung<br />
151
antiker Kunst. Nach Eduard Gerhard im früheren und Alexander Conze im späteren<br />
19. Jahrhundert - beide viele Jahrzehnte in Berlin amtierend - sollte Rodenwaldt dieser<br />
„Akademie über den Völkern" ein dritter Gründer werden, als deren durch mancherlei<br />
Kriegsungunst verwirrte Fäden geordnet, sie wieder strapazierbar, dichtmaschiger und<br />
damit leistungsfähiger gemacht. Dem internen Geschäftsgang, vor allem aber dem wissenschaftlichen<br />
Programm gab er Richtsätze, eröffnete zwischen Spanien und dem Iran, von<br />
Ägypten hinauf zur Germania Romana um Wesentliches, nicht bloß graduell vermehrte<br />
Möglichkeiten, verlieh zündendste Impulse, die nicht wenige Denkmäler, Denkmäler-<br />
Gruppen und damit ganze Kunst-Epochen von der Minos-Zeit bis zum heraufdämmernden<br />
Mittelalter neu und anders als bisher anschauen und deuten ließen. Solche Belebung<br />
haben selbst unruhigste Zeitläufe nicht entwertet, geschweige denn zunichte gemacht, sie<br />
in ihrer vorausschauenden Modernität und Wegweisung mehr als einmal bestätigt.<br />
Was lange vor dieser Zeit, 1889, in den „Preußischen Jahrbüchern" der Archäologe Adolf<br />
Michaelis als das „schwierigste Amt" eines Präses beschrieb, „das Ganze der Unternehmungen<br />
und der Ziele des Instituts unablässig im Auge zu haben, überall anzutreiben,<br />
auszugleichen, Hindernisse hinwegzuräumen, neue Wege zu eröffnen, neue geeignete<br />
Kräfte aufzufinden", dem ist Rodenwaldt, damals fast noch „junger Mann", ohne jede<br />
geräuschvolle Betriebsamkeit - „Wissenschaftliche Anstalten, die ihre Aufgabe ernst nehmen,<br />
pflegen ein Stilleben zu führen" (Michaelis) - mit solcher, ihrer selbst gewissen<br />
Energie, solcher diplomatischen Umsicht gerecht geworden, hat die Lenkung dieses wissenschaftlichen<br />
„Großbetriebs" (um Mommsens leidvoll nüchterne Diagnose moderner<br />
Institutionalität zu zitieren) allerwegen so souverän moderierend betrieben, daß seine<br />
Amtszeit dem ganzen Hause nachgerade ein neues Fundament, ein aus jahrhundertealter,<br />
reicher Vergangenheit ohne abrupte Zäsur behutsam fortentwickeltes Arbeitssystem eintragen<br />
mußte.<br />
Als das Institut 1929 in Berlin mit Festsitzungen im Reichstage, im ehemaligen Herrenhause<br />
und im Palais Friedrich Leopolds, nicht zuletzt mit feierlicher Einkehr vor dem<br />
(eben wiedererstellten) Pergamon-Altar als dem wohl volkstümlichsten Markstein deutschen<br />
Dienstes an der Antike und mit einer erstaunlich aspektreichen „Internationalen<br />
Tagung für Ausgrabung" seines hundertjährigen Bestehens gedachte, wurde diese aus<br />
aller Welt beschickte Aprilwoche zum Höhepunkte Rodenwaldtscher Präsidentschaft,<br />
unversehens-ungewollt zu seinem Jubiläum, feierte man gleichermaßen seine, mit so geringem<br />
bürokratischem Aufwand und wenigen Mitarbeitern erreichten Erfolge, ward<br />
ohne viel Aufheben einer Gelehrten-Fortune gratuliert, wie nicht häufig in Deutschland.<br />
Dieses letzte Fest des abendländischen Humanismus, dessen hochgestimmtes Pathos zehn<br />
Jahre später, schon auf der Schwelle des Krieges, dem Internationalen Archäologen-<br />
Kongreß in Berlin (auch er noch „Frucht seiner Saat") füglich nicht mehr zu eigen, ließ<br />
von Rodenwaldts Gestalt, seinem menschenvereinigenden Vermögen, der Unvoreingenommenheit<br />
und Intensität seiner Antikenerkenntnis, seiner phrasenlosen pietas den<br />
Alten gegenüber wie selten noch, ein Licht ausgehen, das nicht verlöschen wird, nicht<br />
erkalten, seinen sicher lenkenden Strahl nicht verlieren mag.<br />
Wenig später nach der Zentenarfeier schied Rodenwaldt, antikisch weise, aus dem Amte<br />
und auch dessen zehrenden Geschäften, widmete sich an der Berliner Universität allein<br />
der Lehre und der Forschung wie nicht zuletzt der Akademie, der er seit 1933 angehörte<br />
und der das opus ultimum geweiht, während die Bereiche des Ausgrabens und des Museums<br />
ihn eigentlich nie unmittelbar beschäftigt haben. So ist denn auch er der für Ber-<br />
152
Prof. Dr.<br />
Gerhart Rodenwaldt<br />
liner Archäologen „klassischen" Fünfzahl der Funktionen nahe gekommen: Institut, Lehrstuhl,<br />
Akademie, Archäologische Gesellschaft und Museum, welcher fast hundert Jahre<br />
zuvor, gewiß unter äußerlich reduzierteren Verhältnissen und Voraussetzungen, Eduard<br />
Gerhard vollkommen genügte. Mit rührigen Schülern von nah und oft sehr fern ward<br />
nun aufs neue die Oikumene in ihren bildnerischen Hinterlassenschaften durchgearbeitet,<br />
wobei manches „Zukunftsarchäologische" sich ankündigte: „ungeahnte Zusammenhänge"<br />
der klassischen Mittelmeerwelt mit dem, was jenseits von Tajo und Oxus, von Nil und<br />
Rhein, ja in Zentralasien, Indien, gar China sich bald zögernder, bald bestürzend schnell<br />
zu enthüllen begann. Insonderheit aber für die „klassischen" Epochen, für deren jeweils<br />
essentiell Ureigenes, für das perikleische Hellas und seine, wie auch immer „selig in sich<br />
selbst", stillen Gestalten, für das Rom der Caesaren, deren auch im Künstlerischen nicht<br />
nachlassende Welt-Unifizierung, die unmittelbare Tagesbezogenheit imperialer Bauten<br />
und Bilder erschlossen sich neue Erkenntnisschichten, präzisiertere Ansätze, fern esoterischem<br />
Ästhetisieren manche verfeinerte Einsicht in die künstlerische wie überhaupt geschichtliche<br />
Wertung und Wertigkeit jener Zeiten.<br />
Auch jetzt, wiewohl hinter Universitätsmauern tätig, entzog sich Rodenwaldt keineswegs<br />
der schon früher gerne gewahrten Verpflichtung, weiteren, gerade nicht-akademischen<br />
Kreisen Welt und Werk der Alten verstehbarer zu machen, überhaupt auf Forderungen,<br />
Stimmungen, Gebilde dieser seiner Zeit - wie war er den Malereien Noldes zugetan -<br />
sehr Acht zu geben. Dies gewiß nicht mit ideologisch mahnendem Zeigefinger, mit blasierten,<br />
gegenwartslosen Programmen, sondern das für seinen Tag und seine Umwelt ihm<br />
vonnöten Dünkende unerzwungen entwickelnd, die wenn auch wechselnde, so doch<br />
153
perennierende Präsenz der Antike von seinem Hauptgeschäft, von den Monumenten her<br />
erhärtend. Dafür gibt es, bis in die hier ausgelassene Tagespublizistik, manches markante<br />
Zeugnis: so die vier Auflagen der monumentalen „Kunst der Antike" in der alten Propyläen-Kunstgeschichte,<br />
die vielbegehrten, mit dem Meisterphotographen Walter Hege<br />
herausgegebenen Bilderbücher von der Akropolis, Olympia und griechischen Tempeln,<br />
die beiden, für sein eigenes Empfinden so vernehmlich sprechenden Essais „Kunst um<br />
Augustus" und der über Goethe in Verona, das liebevoll kongeniale Album über den<br />
Romantikermaler und „Entdecker der griechischen Landschaft", Otto Magnus v. Stackelberg<br />
(1787-1837). Nicht zu vergessen sei die zwar kaum ostensible, doch deshalb nicht<br />
weniger folgenlose Teilhabe an der unvergleichlichen Zeitschrift des Berlin zwischen den<br />
Kriegen, „Die Antike", welche, abermals bereicherten Wissens, tiefer erweckten und erweckenden<br />
Geistes, jener „urbildlichen Schöpfungen" sich nach eigener Art neu zu bemächtigen<br />
suchte. Die überlegene Führung der hiesigen Archäologischen Gesellschaft, in<br />
der sich seit mehr als einem Jahrhundert Freunde des Altertums, wer es auch sei, treffen<br />
und besprechen, stellt ein besonders rührendes, fein instrumentiertes Kapitel Rodenwaldtscher<br />
Öffentlichkeitsarbeit' dar.<br />
So seiner weiteren Mit- und Umwelt keineswegs abgewandt, ihr fördernd und mannigfach<br />
formend zugetan, war der von Natur sehr an sich haltende, gemessene Rodenwaldt<br />
doch alles andere als ein Mann des Marktes, war weder dirigierender Behördenchef gewesen<br />
noch brillierender Kathederfürst geworden, wie solche auch dem nachwilhelminischen<br />
Berlin nicht fremd. Er machte nicht „Figur", wirkte darum auf Freunde wie Fremde<br />
nur um so unangefochtener, unauslöschbar. Wo traf - und trifft noch immer - die überlegen<br />
ausgleichende, überaus durchsichtige Diktion seiner Bücher und Aufsätze nicht<br />
ins Schwarze? Wo kristallisiert sich hier nicht prägnant wie kaum sonst das, was zu<br />
Kunst und Künstler, über Wechsel und Verzweigung, über Verwandlung und zäheres,<br />
geheimes Beharren antiker Form als solcher, bis ins Methodologische, Kunstphilosophische<br />
dringend, vorgetragen ist? „Diejenige Harmonie, die unseren Geist entzücket, besteht<br />
nicht in unendlich gebrochenen, gekettelten und geschleifeten Tönen, sondern in einfachen<br />
und langanhaltenden Zügen." Nicht Weniges von diesem Winckelmannwort weht<br />
auch durch Rodenwaldts Niederschriften. Das klar Gesetzte dieses Mannes, das unprätentiös<br />
Gelassene, das nur dem Objekt als solchem Dienende, spricht und weiß von mehr,<br />
als was Thema und Titel der Schriften und Reden im Einzelnen wohl anzeigen. Dieser<br />
Archäolog ist nicht bloß Fachmann und Spezialist. Er ist Humanist schlechthin, umsichtig<br />
bedachtsamster Deuter der Bilder jenes formendsten Universums unserer Geisteswelt. Er<br />
hat das Herz des Philhellenen mit dem eines Deutsch-Römers vereint. Er hat, in der<br />
Sache nie zu bestechen und nie zu beirren, stets an sich haltend, Jedwedem das Seine<br />
gebend, „preußische Archäologie" praktiziert.<br />
Das zu Erforschende scheint der ganzen Person, dem ganzen Sensorium, einer ungeteilten<br />
Gedanklichkeit eingesenkt, Beobachtung, Betrachtung wie Diagnose aus tieferer Wurzel<br />
genährt, nicht pures, papierenes Schreibtischreservat, nicht routiniert kläubelndes Handund<br />
Stückwert zu sein. Die Gesinnung ist es, diese sehr persönliche, schwer auszumessende<br />
Symbiose von Gefühl und Gedanke, die auch dieses Auge, diese Hand führt - die<br />
sie adelt, in „lang anhaltenden Zügen" ihren Stoff, ohne ihn zu stilisieren, auf ein Ganzes<br />
stimmt. Solchermaßen muß es dem Forscher Rodenwaldt am Ende „ganz unspekulativ"<br />
zu einer „archäologisch fundierten Geistesgeschichte" (um ein Wort Schadewaldts<br />
zu variieren) gedeihen - ähnlich wie bei seinem engeren Fach- und Fakultätskollegen<br />
154
Werner Jaeger ein „historischer Humanismus" das Bemühen um die Alten krönt. Bei dem<br />
einen wie dem anderen drängt das Forschen umfassenderem Verstehen-Wollen zu, einem<br />
Wiedererkennen des Antiken im Ganzen von solcher Temperatur und Kohärenz, daß ein<br />
Weg in die „Pädagogische Provinz" sich auftun will - daß alles Erkennen, ohne jedes<br />
Schul-Erzieherische, wieder bildend werden muß. Zu höchst persönlichem Entscheid fühlt<br />
man sich gerufen, zu Konsequenzen jenseits jeder Historie. Das innere Beteiligtsein der<br />
Forschenden, Ernst und Anspannung ihres Ausgreifens, die Wucht und die Eindeutigkeit<br />
des dieserart Geförderten zieht sowohl für den Gelehrten selbst wie für den, der zuhört<br />
und zusieht, wie spielend weitere und weiteste Kreise.<br />
Es ist die neue Optik der Antike, wie sie bald nach dem Ersten Weltkriege vornehmlich<br />
in Deutschland festzustellen, die so denn auch über Rodenwaldt folgenschwer Macht<br />
gewonnen und Macht behält. Nach mehr als einem Jahrhundert extensiven Sammeins<br />
und breit schichtenden Dokumentierens beherrscht Verdichtung die Stunde, zügig sichtende<br />
Systole, erhält der gesamte Wissensbestand, von einem sehr eigenen Standpunkt<br />
erfaßt, gerafft und abermals, aber anders als ein Ganzes verstanden (und Eigenes<br />
schärft und beflügelt nur Blick wie Feder), demgemäß Form und Gesicht. Solches gewiß<br />
nicht spekulativ wie in früheren Jahrhunderten häufiger (geschweige denn normativ als<br />
nur ästhetisches Programm, als „Historische Metaphysik" ä la Winckelmann), sondern<br />
ausgesprochen pragmatisch, tatsachenfundiert, faktenbezogen, in diesem Sinne noch<br />
immer historisch, unanfechtbar „eigentliche Geschichte" (Herder). Allein, dieser „direkte",<br />
rechtverstanden voraussetzungslose, doch höchst aktiv aktualisierte Forschungsansatz,<br />
den keine Stoffmasse als solche noch eine vom Eigentlichen ablenkende Doktrin verstellt,<br />
erwirkt eine so überraschende, bis heute in vielem noch lebendige Phänomenologie der<br />
Alten, daß der Schritt nach vorne auf diesem Wege nicht zu leugnen. Unter den Vordersten<br />
aber, die hier so intransigent am Werke, die fragen und sehen, scheiden und<br />
wieder ordnen, denen eine, weit über ihr Katheder und Seminar hinausgehende Vernehmbarkeit,<br />
oft ein gläubiger Zuspruch und demzufolge eine wiedererstandene Autorität,<br />
eine nicht bezweifelte Würde von Fach und Amt zugekommen, steht, in unaufdringlich<br />
steter Disziplin zielstrebend die Bahn nehmend, neben einem Buschor und Härder,<br />
neben Kaschnitz, Reinhardt und Weber, Rodenwaldt - in allem und für alle professor<br />
antiquitatum.<br />
Vorzüglich also kraft einer ihm eigentümlichen, so konzentrierten wie konzentrierenden<br />
inneren Vitalität (welches „Gewand" sie auch trage- und es gibt mehr als ein „Gewand")<br />
eröffnete dieser Kreis, die Genannten wie mancher Ungenannte, gewissermaßen schlaglichtartig<br />
Sicht und tieferen Einstieg in die Elemente der Antike, ihre legislativen Konstanten,<br />
vermag er an das Band rühren, das alles umfaßt und hält. Ja, nicht nur das:<br />
alles erscheint von neuer, recht eigentlich „frischerer" Qualität erkannt und befunden,<br />
wie mit Naturgewalt wieder wesentlich geworden. Was Standbild und Tempel, was<br />
Theater und Triumphbogen, was Markt, Straße, Grab und Altar, was Epos und Gedicht<br />
und Drama, was Staatserlaß, Ehreninschrift oder Kaufmannstat einstens war und galt<br />
und wirkte: im Kraftfeld solcher scienza nuova - sie freilich nur, wie sie selber zu gut<br />
weiß, Erbe und Mehrer der Väter- und Vorvätergeneration - scheint jedwedes wie neu<br />
aufgeführt, wie eben geschrieben, wie heute getan, tritt das scheinbar Abgelebte in die<br />
tätigste Nachbarschaft zur Gegenwart, greift an Leben und Existenz schlechtweg.<br />
Was aber Rodenwaldts unleugbares Hauptgeschäft, das Archäologische Institut angeht,<br />
dem er wirklich Regent und Gestalter und mehr als akkurater Verwalter war, - ein<br />
155
Dezennium wie das seine von 1922 bis 1932 hat es nicht wieder gesehen. Nie seither war<br />
es sich dessen inniger und niemals so segensvoll bewußt, daß es auch ein Berliner Institut<br />
sei, daß es ein solches in mehr denn einer Hinsicht und zu mehr denn einem Ziele bleiben<br />
müsse. Präsident und Institut, Person, Dienst und Ort kamen damals zu einer Identität,<br />
deckten einander so sehr, daß kaum noch etwas zu wünschen schien, um das Singulare<br />
dieses, nach Funktion nicht wenig zentrifugalen, faktisch in Berlin gründenden, immer<br />
Berlin suchenden' Institutsverbundes (von mittlerweile zehn Häusern) verständlich zu<br />
machen. Geistiger Eigenwuchs, forscherliche Fähigkeit, schmiegsam genug arbeitende<br />
Organisation und ein Ertrag, gewonnen wie eigentlich noch nie, ward unter, ward durch<br />
diesen einen Mann nahezu ideal repräsentiert und personifiziert. Und das, kaum zufällig,<br />
an einem Orte, wo schon unter dem Großen König mehr als einer, von hier wie von<br />
außen (so 1782 Friedrich Munter aus Kopenhagen), „glaubt im alten Rom zu wandeln,<br />
unter den Säulengängen, auf den foris - lauter äußerst schöne Straßen, lauter Palläste".<br />
Die jüngst wieder betrachtete Vorgeschichte des Friedrichs-Denkmals Unter den Linden<br />
bestätigt figurenreich genug solche Rom-Neigungen.<br />
Was schon einmal, zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, einem Großen unter Deutschlands<br />
Humanisten, Christian Gottlob Heyne (1729-1812) in Göttingen, als kaum gewöhnlich<br />
nachgerühmt wurde: die einander stimulierende Verflechtung von Wissenschaft<br />
und Wissenschafts-Organisation, ein doppelgleisig-gleichgewichtiges Mühen um Forschung<br />
und „Geschäft" zugleich (was bei Mommsen, freilich in sehr andersartiger Ausprägung<br />
und Tendenz, abermals gipfelt) sollte bei Rodenwaldt, gewiß individuell nuanciert, dennoch<br />
seltsam konvergent, wiederkehren: „Es sind aber zwey Seiten, von denen er dargestellt<br />
werden muß, als Gelehrter und als Geschäftsmann. Daß die Anlagen zu beyden<br />
in einem so ausgezeichneten Grade in ihm vorhanden waren, daß man zweifeln kann,<br />
wozu ihn die Natur am meisten bestimmt hatte; daß diese Anlagen zu beyden so ausgebildet<br />
wurden, daß man zweifeln kann, ob er mehr Gelehrter oder mehr als Geschäftsmann<br />
gewirkt hat - dieß ist es, was ihn zu einem der seltensten Männer, was ihn zu<br />
dem Manne machte, .. . die richtige Ansicht der Dinge zu fassen" (A. H. L. Heeren 1813).<br />
Wieder und wieder wird das Erinnern, wird bewegtester Dank, wird ein stiller,<br />
wehmütiger Stolz nach Lichterfelde hinausgehen, wo der Präsident sein Haus hatte und<br />
nun auf dem Parkfriedhof ruht - neben seiner Frau, neben dem Stein für den Sohn,<br />
alle Opfer des Krieges. Einer seiner Nachfolger im Institut, der jüngst in Berlin dahingegangene<br />
Carl Weickert, suchte, noch in trübster Nachkriegszeit, Summe zu ziehen, die<br />
in solchem Leben, durch solche Leistung offenbarte, schlechtweg sittigende Kraft in eins<br />
zu fassen: „Wir werden nicht in Hoffnungslosigkeit versinken, wenn wir dieses Mannes<br />
gedenken." Er hat kaum Unrecht behalten seither. Er wird es auch fürderhin nicht.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 33, Peter-Lenne-Straße 28-30<br />
Literatur:<br />
Gustav Hirschfeld, Nord und Süd, Jg. 48 (1889), S. 297 ff.<br />
Ludwig Curtius, Gerhart Rodenwaldt 1886-1945, in: Forschungen und Fortschritte 21/23,<br />
Berlin 1947, S. 222.<br />
Carl Weickert, Archäologischer Anzeiger Bd. 63/64, Berlin 1948/49, S. 169 ff.<br />
Ders., Gerhart Rodenwaldt f, in: Gnomon 21, München 1949, S. 82 ff.<br />
G. Rodenwaldt, Griechisches und Römisches in Berliner Bauten des Klassizismus, Berlin 1956;<br />
ebd. S. 34 ff. Rodenwaldt-Bibliographie.<br />
Wolfgang Schadewaldt, Gedenkrede auf Werner Jaeger, Berlin 1961.<br />
156
Kurt Bauch, Das Brandenburger Tor, Berlin 1967.<br />
Hans B. Jessen, Ein archäologisches Forschungszentrum in Berlin, in: Mitt. d. Vereins f. d. Geschichte<br />
Berlins Jg. 68 (1972), H. 8, S. 211 ff.<br />
Friedrich Mielke/J. v. Simson, Das Berliner Denkmal für Friedrich IL, den Großen, Berlin 1975<br />
(Sonderdruck Propyläen).<br />
Gewehrfabrik - Kirchenmeierei - Salzhof<br />
Ein altes Industriegebiet an der Havel<br />
Von Arne Hengsbach<br />
Im Osten Spandaus, jenseits der Havel, befanden sich im Umkreis der Zitadelle einige<br />
zerstreute Ansiedlungen, an deren Stelle im Laufe der Zeit schließlich ein zusammenhängendes<br />
Industriegebiet von gut 2 km Ausdehnung längs der Oberhavel und einer Tiefe<br />
von 500 bis 1000 m trat. Nur eines der ursprünglich in dieser Gegend vorhanden gewesenen<br />
Etablissements wurde Ansatzpunkt für die Gestaltung der späteren Industrielandschaft.<br />
Es war die<br />
Gewehrfabrik auf dem Plan.<br />
Sie wurde auf Veranlassung Friedrich Wilhelms I. gegründet, der mit dieser Rüstungsfabrik<br />
unabhängig von den Waffeneinfuhren aus anderen Staaten werden und zugleich<br />
die Bewaffnung und damit die Schlagkraft seiner Armee verbessern wollte. Diese Schöpfung<br />
merkantilistischer Wirtschaftspolitik war ein halbstaatlicher Betrieb: die Leitung<br />
hatten private Unternehmer, aber der Staat beaufsichtigte die Produktion, bestimmte<br />
deren Umfang und nahm sie ab. Die erforderlichen Facharbeiter wurden zuerst in Lüttich<br />
angeworben, für sie wurde eine kleine Werksiedlung neben der Fabrik errichtet, zu der<br />
auch ein katholisches Gotteshaus gehörte. Die Lütticher Handwerker waren Katholiken,<br />
denen man die freie Ausübung ihrer Religion zugesagt hatte. Diese kleine Kapelle war<br />
eine der ältesten katholischen Kirchen der Mark Brandenburg, die nach der Reformation<br />
errichtet wurden. Die Gewehrfabrik lag östlich der Zitadelle am östlichen Abzugsgraben,<br />
in dem sich die Mühlengerinne der Fabrik befanden, nördlich des Zitadellenweges, und<br />
erstreckte sich nach Osten hin bis ungefähr an die Stichstraße, die vom Zitadellenweg<br />
nach Norden abgeht.<br />
Die Fabrik hatte die schreckensvolle Belagerung der von der französischen Besatzung<br />
gehaltenen Spandauer Zitadelle durch die preußischen Truppen im April 1813 trotz<br />
mancher Verluste leidlich überstanden und wurde nach und nach weiter ausgebaut. Im<br />
Jahre 1852 übernahm der preußische Staat die Gewehrfabrik, die bis dahin die Firma<br />
Gebrüder Schickler betrieben hatte, und 1855 wurde der Potsdamer Zweig der Gewehrfabrik,<br />
ebenfalls 1722 ins Leben gerufen, auch nach Spandau verlegt. Diese organisatorische<br />
Straffung hatte zur Folge, daß die auf dem Gewehrplan bestehende Werksiedlung<br />
1853 aufgelöst wurde: die dort ansässigen Handwerker und Arbeiter siedelten in die<br />
Stadt Spandau über, die bisherigen Wohn- und Gartengrundstücke wurden in das Werksgelände<br />
einbezogen. Trotz der Aussiedlung der Bewohner schuf der Militärfiskus aber<br />
wieder zahlreiche Werkswohnungen für Offiziere, Beamte und technisches Personal auf<br />
dem Fabrikgelände; 1861 wohnten 223 Personen im Gelände der Gewehr- und der an-<br />
157
'.JA<br />
J •-' 7."' *• ' \ *3> *»&.<br />
ff* & V* »V".\ • -- . *V^OB<br />
5?M fff „ ^ •• ••• Fj "=<br />
(€hemJ^br<br />
> m..<br />
N<br />
--«£fl<br />
*&&!§& -.v„.. m<br />
J m\<br />
{ Mi<br />
; ' • •^.•-'•1* , ~ '"
grenzenden Pulverfabrik. An Stelle der meist baufälligen kleinen Fachwerkkapelle der<br />
katholischen Gemeinde auf dem Plan wurde bereits 1847/48 die katholische Kirche auf<br />
dem Behnitz erbaut.<br />
Den noch unbebauten Teil zwischen dem Zitadellenweg und der Gewehrfabrik nahm<br />
seit 1874 die Munitionsfabrik ein, die anfangs noch dem militärischen Direktor der Gewehrfabrik<br />
unterstand. Beide Fabriken wurden im Laufe der Zeit immer wieder erweitert,<br />
und 1883 griff die Bebauung mit der Patronenfabrik über auf das Wiesenland<br />
südlich des Zitadellenweges. Dieser führte zu dieser Zeit noch nicht den heutigen Namen,<br />
sondern war Teil der über Haselhorst führenden „Berliner Chaussee". Um die militärischen<br />
Einrichtungen und Fertigungsstätten von der Öffentlichkeit abzuschließen und im<br />
Zuge der Chaussee eine militärfiskalische Güteranschlußbahn anlegen zu können, wurde<br />
1890/91 die Berliner Chaussee verlegt und weiter südlich außerhalb der Werksanlagen<br />
durch die Spreewiesen geführt. Dieser neue Abschnitt der Berliner Chaussee erhielt 1939<br />
den Namen „Am Juliusturm". Der alte durch die Fabriken verlaufende Teil der Chaussee<br />
wurde eingezogen, seit etwa 1929 aber wieder dem Verkehr freigegeben, er trägt jetzt<br />
die Bezeichnung „Zitadellenweg". Im ersten Weltkrieg wurden die Gewehr- und Munitionsfabriken<br />
abermals beträchtlich vergrößert. Die Fabrikbauten und Werkhallen erreichten<br />
nun die Straße „Am Juliusturm" und nahmen deren Nordseite fast in ganzer Länge<br />
ein, während an der Südseite die Geschoßfabrik sich an die Straße heranschob, so daß<br />
die Straße nun wieder streckenweise durch das Industriegebiet des Militärs führte. Im<br />
Jahre 1919, nach dem verlorenen ersten Weltkriege, mußte die Waffenproduktion, die<br />
Verwaltungsgebäude und Wohnhaus der Munitionsfabrik am Zitadellen weg (Foto: Gammrath)<br />
159
fast zwei Jahrhunderte hindurch in diesem Bereich betrieben worden war, aufgegeben<br />
werden. Die zahlreichen, über ganz Deutschland verstreuten staatlichen Waffen- und<br />
Munitionsfabriken wurden nun von den „Reichswerken" übernommen, aus denen 1920<br />
die „Deutschen Werke" hervorgingen. Diese Aktiengesellschaft, deren Kapital fast ausschließlich<br />
das Deutsche Reich besaß, sollte die großen Vermögenswerte, die in den bisherigen<br />
Heeresbetrieben steckten, vor weiterem Verfall bewahren, denn in den ersten<br />
wirren Nachkriegsmonaten waren erhebliche Bestände an Vorräten und Produktionsmitteln<br />
vergeudet oder verschoben worden, später verfielen zahlreiche Gebäude und<br />
Maschinen der Zerstörung bzw. Demontage aufgrund der Abrüstungsauflagen. Die Bestrebungen<br />
in den Kriegsfabriken, nun friedensmäßige Fertigungen für den zivilen Bedarf<br />
aufzulegen, waren zugleich von dem sozialpolitischen Bemühen geleitet, von den zehntausenden<br />
von Facharbeitern der Rüstungsbetriebe einen möglichst großen Personenbestand<br />
in die neuen Werke zu übernehmen. Audi die sieben großen Spandauer Heereswerkstätten,<br />
die im ersten Weltkriege eine ungewöhnliche Ausweitung erfahren hatten<br />
und in denen 1918 70 000 bis 80 000 Männer und Frauen beschäftigt waren, wurden in<br />
die „Reichs"- und danach in die „Deutschen Werke" eingegliedert. Die Areale und Gebäudegruppen<br />
der nördlich der Spree belegenen Rüstungsbetriebe, in der Hauptsache die<br />
Gewehr- und die Munitionsfabrik, wurden organisatorisch in dem „Werk Haselhorst"<br />
zusammengefaßt.<br />
Doch litt der bunt zusammengewürfelte Konzern des Reiches stark unter dem Mangel an<br />
Betriebs- und Investitionskapital und den Schwierigkeiten, die vielen verschiedenen Fabriken<br />
wirtschaftlich in einem Verbund zu organisieren; dazu kamen die Auflagen der<br />
die Abrüstung Deutschlands überwachenden Interalliierten Militär-Kontrollkommission,<br />
die Betriebsführung und Fertigungen erschwerten. So waren Stillegungen und Massenentlassungen<br />
unausbleiblich. Das „Werk Haselhorst" gehörte allerdings zu den Betriebszweigen,<br />
die noch verhältnismäßig erfolgreich waren. Hier wurde eine Sport- und Jagdwaffenfabrikation<br />
aufgenommen, die aber 1923 auf Anordnung der Interalliierten Militärkommission<br />
wieder stillgelegt werden mußte, was die Entlassung von etwa 2000<br />
Arbeitern im Werk Haselhorst zur Folge hatte. Hingegen brachte die 1921 begonnene<br />
Herstellung von Motorrädern seit 1923 immer bessere Ergebnisse. Das „D-Rad", das im<br />
Haselhorster Werk bis 1926 gebaut wurde, gehörte zuerst zu den leistungsfähigsten und<br />
beliebtesten deutschen Motorradmarken. Auch die Produktion eines Kleinautos, dessen<br />
Bau nach amerikanischem Vorbild vorgesehen war, befand sich 1924 in Vorbereitung.<br />
Der „D"-Wagen kam aber über eine Vorserie von 1500 Stück nicht hinaus, weil die notwendigen<br />
Investitionsmittel nicht zu beschaffen waren. Die private deutsche Automobilindustrie<br />
betrachtete diese Produktion von Motorfahrzeugen in einer staatlichen Fabrik<br />
als eine ungehörige Konkurrenz, zumal die D-Räder billiger ausgeliefert werden konnten<br />
als ihre eigenen Fabrikate; sie fragte, ob ihre Unternehmen „um der Umstellung der<br />
Munitionswerkstätten willen ruiniert werden" sollten. Schließlich wurde die erfolgreiche<br />
Fertigung der D-Räder aufgegeben, da der Absatz immer mehr sank und keine Rentabilität<br />
gegeben war.<br />
Nachdem nun die bisher noch genutzten Komplexe der ehemaligen Heeresfabriken an<br />
der Straße „Am Juliusturm" und am Zitadellenweg leer standen, begannen die Deutschen<br />
Werke 1927 das Industriegelände der alten fiskalischen Fabriken an Privatunternehmen<br />
zu veräußern. Im benachbarten Siemensstadt hatten die Siemensfirmen zu jener Zeit den<br />
höchsten Stand der Konzentration ihrer Werke erreicht. Mit ihrem weiteren Raumbedarf<br />
160
gingen die Siemensfirmen 1927/28 in das angrenzende Industriegebiet der Deutschen<br />
Werke hinein und erwarben an der Straße „Am Juliusturm" Grundstücke und Gebäude<br />
für ihr Leitungswerk sowie am Zitadellenweg Grundstücksflächen der einstigen Gewehrfabrik<br />
für ihr Flugmotorenwerk; dieses wurde 1933 in die Brandenburgischen Motorenwerke<br />
eingebracht, die dann 1939 auf die Bayerischen Motorenwerke übergingen. Auch<br />
die Firma „Auto Union" siedelte sich dort an. Das allmählich wiederbelebte Industriegebiet,<br />
vorwiegend von Firmen des Motoren- und Werkzeugbaues besetzt, diente seit der<br />
Wiederaufrüstung in den dreißiger Jahren abermals der Rüstungs- und Kriegsfertigung.<br />
Nach teilweiser erheblicher Kriegszerstörung ist es heute mit Unternehmen verschiedener<br />
Branchen belegt. Neben der Firma BMW, die hier Motorräder herstellt, der „Stahlform"<br />
und einem Zweigwerk der Firma „Bosch-Elektronik" für Funkanlagen sind hier u. a.<br />
eine Großspedition und eine Fleischwarenfabrik ansässig. Das einstige militärfiskalische<br />
Industriegebiet ist seit 1961 über die Straße „Am Juliusturm" nach Süden hin bis fast an<br />
die Spree erweitert worden. Auf dem Gelände der einstigen Rohrbruchwiesen hat sich die<br />
„Adoros"-Teppich-Fabrik mit ihrem endlos lang wirkenden Flachbau etabliert. Von dem<br />
einstigen militärfiskalischen Gebäudebestand sind noch einige Baulichkeiten vorhanden;<br />
auch zwei altertümliche achteckige Schornsteine mit knaufartigen Bekrönungen stehen<br />
noch.<br />
Das Schicksal der<br />
Kirchenmeierei<br />
war ebenfalls eng mit der Spandauer Festung und der Entwicklung der militärischen<br />
Rüstungsfabriken im näheren Bereich der Zitadelle verbunden, allerdings spielte die<br />
Meierei in diesen Beziehungen eine durchaus passive Rolle. Kurfürst Johann Georg hatte<br />
1584 dem Festungsbaumeister Graf Rochus zu Lynar die schon vorhandene Meierei geschenkt,<br />
Lynars Sohn übereignete sie der Stadt Spandau im Jahre 1611, aus dem Besitz<br />
der Stadt ging sie 1658 in den der Nikolaikirche über, wobei der Magistrat als Patron<br />
der Kirche diese in der Verwaltung des Grundstücks nachweislich seit 1800 unterstützte.<br />
Die Kirchenmeierei wurde stets verpachtet, sie bestand 1812 aus einem zweigeschossigen<br />
Fachwerkgebäude mit vier Wohnungen, Scheunen, Stallungen, Gärten und ungefähr<br />
55 Morgen Acker bzw. Wiesen. Sie erstreckte sich von der Ostgrenze der Gewehrfabrik<br />
weiter nach Osten und Norden. Das Gehöft muß, soweit die unmaßstäblichen alten Pläne<br />
einen Vergleich mit dem heutigen Gelände zulassen, in der Gegend des heutigen Telegrafenweges<br />
gelegen haben, und seine Entfernung von den Befestigungswerken der Zitadelle<br />
hat nicht mehr als 800 Schritt oder rund 600 Meter betragen, denn sie lag nach im<br />
Jahre 1814 erlassenen Vorschriften innerhalb des ersten Festungsrayons, der diese Tiefe<br />
hatte. Im Jahre 1806 errichteten die Franzosen auf einem Acker neben der Gewehrfabrik<br />
eine Befestigungsanlage, ein sogenanntes Hornwerk, womit der Kirchenmeierei über<br />
3 Morgen nutzbaren Geländes verloren gingen; außerdem brachen sie eine Scheune, die<br />
die Arbeiten an den Verschanzungen behinderte, ab. Schließlich brannten die französischen<br />
Truppen am 1. März 1813 die Kirchenmeierei mit allen Gebäuden ab, um in Anbetracht<br />
der bevorstehenden Belagerung der von ihnen gehaltenen Spandauer Festung<br />
durch die Preußen ein freies, übersehbares und deckungsloses Vorfeld vor den Festungswällen<br />
zu erhalten. Die Belagerer sollten keinerlei Möglichkeit haben, sich irgendwo verbergen<br />
und festsetzen zu können und somit ohne Schutz von den Festungsanlagen her<br />
unter Feuer genommen werden. Nach dem Ende der Kämpfe nahm das preußische Heer<br />
seine Festung wieder in Besitz, und dieses verfuhr nach den gleichen taktischen Grund-<br />
161
sätzen wie die Franzosen; das Vorfeld der Festung mußte frei bleiben und durfte<br />
keine Deckung bieten. Das im Umkreis um die Festung gelegene Gelände wurde in<br />
Rayons aufgeteilt, d. h. Zonen, die sich um die Festungsanlagen herumzogen. In dem<br />
erwähnten ersten 600 Meter tiefen Rayon waren nur kleine bretterne Nothütten zugelassen,<br />
die im Ernstfalle jederzeit beseitigt werden konnten. Im anschließenden zweiten<br />
Rayon mit einer Tiefe von 500 Schritten oder rund 375 Meter durften schon Fachwerkgebäude<br />
unter gewissen Auflagen erbaut werden, allerdings gegen „Revers", d. h. der<br />
Eigentümer wurde verpflichtet, auf Anordnung der Kommandantur seine Baulichkeiten<br />
entschädigungslos abzureißen.<br />
Diesen Vorschriften mußte sich auch der neue Pächter der verwüsteten Kirchenmeierei,<br />
der Bleicher Koch vom Eiswerder, der mit der Bewirtschaftung des Kirchenackers bereits<br />
im Frühsommer 1813 begonnen hatte, unterwerfen. Er durfte auf der Brandstätte der<br />
alten Meierei nur eine Bretterhütte aufführen. Koch erbaute dann 1819 im zweiten<br />
Rayon sein neues Meiereigebäude; dieses Gehöft wird in der Nähe der Daumstraße, und<br />
zwar östlich von ihr, zu lokalisieren sein. Die neue Meierei hat keinen langen Bestand<br />
gehabt, denn bereits 1831 mußte Koch Haus und Hof und das Pachtland räumen. Der<br />
Militärfiskus erwarb nämlich nun den größten Teil der Kirchenmeierei und dazu größere<br />
Flächen vom Gut Haselhorst, um den Bau seiner Pulverfabrik in die Wege leiten zu<br />
können. Sie wurde 1839 aus Berlin, wo sie in der Gegend des nachmaligen und jetzt<br />
wieder verschwundenen Lehrter Bahnhofs gelegen hatte, nach Spandau verlegt. Die Pulverfabrik<br />
war von eigenen Befestigungsanlagen, u. a. von sieben kleinen Lünetten umgeben,<br />
und am Fuße der Wälle floß der nachmalige Grützmachergraben in zickzackförmigem<br />
Laufe dahin. Die Ost- und Nordgrenze der alten Pulverfabrik hält die heutige<br />
Daumstraße noch ungefähr fest, sie ist hervorgegangen aus einem Wege, der außerhalb<br />
vor den Festungswerken verlief und dann nach Norden zum Salzhof führte.<br />
Von der früheren Pulverfabrik sind nur noch wenige Reste vorhanden. An der Daumstraße<br />
steht noch ein altes Wachgebäude, das gewerblich genutzt wird, ein weiterer einstiger<br />
Militärbau befindet sich am Pulvermühlenweg und wurde 1953 zum Jugendheim<br />
umgestaltet. Übrig geblieben sind ferner ein paar Meter der alten roten Backsteinmauer<br />
auf dem Grundstück des „Stahlform"-Werkes und ein kleines Stück des Eisenzauns, der<br />
einst die Pulverfabrik umgab. Und die leicht welligen Sandflächen an der Ostseite der<br />
Daumstraße sind die letzten heruntergetretenen Rudimente der einstigen Wälle, die die<br />
Pulverfabrik schützen sollten. Wegen der Explosionsgefahr bei der Fabrikation der brisanten<br />
Stoffe waren die einzelnen Fabrikationsstätten sehr weitläufig angelegt worden<br />
und mit Baumpflanzungen umgeben, die im Laufe der Jahrzehnte einen parkartigen<br />
Charakter annahmen. Nach Stillegung der Pulverfabrik 1919 blieb der größte Teil des<br />
Geländes frei von neuen Industriebetrieben, lediglich ein Teilstück am Telegrafenweg<br />
wurde 1929 an die Konsumgenossenschaft Berlin veräußert, die hier eine Großbäckerei<br />
errichtete; im Jahre 1938 zog hier das „T-Werk" der Firma Siemens ein. Die zum großen<br />
Teil ausgebombten Baulichkeiten wurden 1973 abgetragen, jetzt hat sich die „Metalu"<br />
= Metallbau GmbH mit einer Fertigung von Aluminium-Bauteilen hier niedergelassen.<br />
Das nur wenig genutzte Gelände der Pulverfabrik erwarb die Stadt Berlin im Jahre<br />
1939 als „Pulverpark", aber in den Notjahren 1945/47 wurde der alte Baumbestand von<br />
der notleidenden Bevölkerung gefällt und als Brennholz verwendet. Nur einige wenige<br />
alte Bäume wie die drei Eichen am Grützmacher- Ecke Goldbeckweg erinnern noch an<br />
162
Neue Pulverfabrik beim Salzhof (Bau aus der Zeit des 1. Weltkrieges) (Foto: Gammrath)<br />
die einst ausgedehnten Grünanlagen des Pulverparks. Da nur kleine Teile des Areals der<br />
Pulverfabrik zur Ansiedlung neuer Industrien verwendet wurden, dient der überwiegende<br />
Flächenbestand heute kommunalen Zwecken. Den nördlichen Teil nehmen ausgedehnte<br />
Sportanlagen ein. Außer dem erwähnten Jugendheim entstand 1953 noch eine<br />
städtische Wohnsiedlung, weitere Flächen nehmen eine Gartenschule und ein Lagerhof<br />
des Gartenbauamtes ein. Nach der Havel zu erstreckt sich ein Campingplatz, und die<br />
alten Mühlengerinne der Pulverfabrik wurden etwa 1957 teils zugeschüttet, teils verändert.<br />
Eine Erweiterung nach Norden erfuhr die Pulverfabrik im Jahre 1890. Das neu hinzugenommene<br />
Gebiet erstreckte sich nördlich der Daumstraße an der Havel entlang bis<br />
zum Salzhof hin. Dieser neue Teil der Pulverfabrik wurde von den „Deutschen Werken"<br />
Ende der zwanziger Jahre an mehrere Firmen, vor allem der Baubranche, verkauft. Hier<br />
erwarb z. B. die Firma Siemens-Bauunion 1929 umfangreiche Areale, um ihren Gerätepark<br />
unterzubringen. Nördlich der Daumstraße, unweit der Havel, war im letzten Weltkriege<br />
eine Giftgasfabrik betrieben worden, auf deren Gelände sich 1950 die CCC-Filmgesellschaft<br />
niederließ, die in den ersten Jahren häufig Szenen in der nächsten Umgebung<br />
ihres Ateliers drehte. Dieses Filmunternehmen war übrigens nicht das erste auf dem<br />
Gelände der Pulverfabrik. Schon 1923/25 befand sich auf deren ausgedehntem Terrain<br />
die „Ewald-Film GmbH", die Zeichentrick-Filme, u. a. für Reklamezwecke, herstellte.<br />
Von der „neuen" Pulverfabrik sind noch einige bauliche Zeugen vorhanden, z. B. ein ehemaliger<br />
Wasserturm und einige Fabrikbauten an der Straße „Salzhof".<br />
163
Nördlich des „Plans" und der Pulverfabrik lag an der Oberhavel dieser<br />
Salzhof.<br />
Die Unterlagen über dieses abgelegene Etablissement der staatlichen Salzverwaltung sind<br />
sehr lückenhaft. Es bestand aus der eigentlichen Salzniederlage, wo im ausgehenden<br />
18. Jahrhundert das in Eibkähnen aus der Provinz Sachsen herantransportierte Salz auf<br />
die kleineren Oderkähne zur weiteren Beförderung in die nördlichen Teile der Mark<br />
Brandenburg und nach Pommern umgeladen wurde. Nördlich an die Salzmagazine schloß<br />
sich der „Königliche Stabholzplatz" längs der Havel an, auf dem das für die Herstellung<br />
und Reparatur der Salztonnen benötigte Stabholz lagerte. Dieses Stabholzlager wurde<br />
1749 aus der Stadt Spandau, wo noch heute der Name „Stabholzgarten" seine Erinnerung<br />
wachhält, an die Oberhavel verlegt, und zu gleicher Zeit ist auch die dem Platz<br />
benachbarte Salzniederlage entstanden. Ende des 18. Jahrhunderts befand sich dort noch<br />
ein weiterer Holzplatz, auf dem Brennholz gelagert wurde. Verwalter des Stabholzlagers<br />
war ein „Salz-Tonnen-Holz-Schreiber". Der Name „Salzhof" taucht zum ersten<br />
Male in einer Anzeige aus dem Jahre 1833 auf, in der „zur Salztonnen-Verfertigung<br />
unbrauchbares Wrackstabholz" angeboten wurde. Der Salzinspektor auf dem Salzhof<br />
scheint nebenher Landwirtschaft betrieben zu haben, wenigstens geht das aus einer 1834<br />
erstatteten Anzeige eines Aufsehers der Baustelle der Pulverfabrik hervor, wonach die<br />
Magd des Salzbeamten vier Kühe auf Wiesen, die zum Terrain der Pulverfabrik gehörten,<br />
gehütet hatte. Aufschlußreich ist eine Anzeige aus dem Jahre 1857: „Das der Salzverwaltung<br />
gehörige baufällige Wärterhaus auf der Stabholz-Niederlage bei Saatwinkel<br />
im Jagen 38 der Königlich Tegelschen Forst soll .. . zum Abbruch verkauft werden".<br />
Demnach bestand neben dem Lager am Salzhof noch ein weiteres in dem etwa<br />
lVä km entfernten Saatwinkel.<br />
Nach Aufhebung des Salzmonopols veräußerte die Steuerverwaltung das funktionslos<br />
gewordene Salzdepot im Jahre 1869. Die Hypothekenbucheintragung aus jener Zeit<br />
beschreibt das Grundstück: „Das bei der Stadt Spandau unweit Saatwinkel belegene<br />
Grundstück, der sogenannte Salzhof, worauf sich ein Wohnhaus nebst Stall sowie drei<br />
Magazine befinden und zu welchem circa 1 Morgen Garten, 1 Morgen Wiese, 15 Morgen<br />
Acker, ein Hafen, Stichkanal und die Hafen-Schutzvorrichtungen gehören". Auf dem<br />
Grundstück des bisherigen Salzhofs wurde 1871, ohne daß zunächst die alten Salzspeicher<br />
abgerissen wurden, eine Dampfschneidemühle errichtet nebst einem viergeschossigen<br />
„Familienhaus" für die dort beschäftigten Arbeiter. Bei der abgeschiedenen Lage konnten<br />
Arbeitskräfte zum Salzhof kaum einpendeln. Der rote Ziegelrohbau steht heute noch als<br />
einzige Erinnerung an das einstige Sägewerk, in dem 1881/82 auch einmal vorübergehend<br />
eine Sargfabrik untergebracht war. Die Schneidemühle besaß eine eigene Gasanstalt<br />
mit Gasometer, die 1883 erwähnt wird, aber nicht lange bestand. Als die Pulverfabrik<br />
erweitert wurde, erwarb die Aktiengesellschaft „Chemische Fabrik Griesheim" zu<br />
Frankfurt am Main das Sägemühlengrundstück und richtete nach Abriß alter Baulichkeiten<br />
eine Zulieferfabrik für die südlich angrenzende Pulverfabrik ein: Auf dem Salzhof<br />
wurde nun aus spanischem Kies in Röstöfen und Bleikammern die zur Pulverherstellung<br />
erforderliche Salpetersäure gewonnen. „Oft zogen", wie sich ein Zeitgenosse erinnert,<br />
„braungelbe Rauchschwaden von der Fabrik über den Salzhof und die breite Havel<br />
hinweg. Heute würde man das Umweltverschmutzung nennen, damals sagten die Fahrgäste<br />
auf den Vergnügungsdampfern: Der Salzhof stinkt mal wieder, während die Salzhofer,<br />
die dort wohnten, die Fenster schlössen."<br />
164
Ehem. Wasserturm<br />
der neuen Pulverfabrik<br />
(nach 1890)<br />
(Foto: Gammrath)<br />
Mit der Stillegung der Pulverfabrik war auch das Schicksal der eng mit ihr verbundenen<br />
Säurefabrik auf dem Salzhof besiegelt. Die Firma Griesheim verkaufte 1919 das Fabrikgrundstück,<br />
dessen Anlagen nun, nach den Bestimmungen der Entmilitarisierung restlos<br />
ausgebaut und ausgeschlachtet wurden. Sogar das kleine werkseigene Elektrizitätswerk<br />
wurde ausgebaut. Wegen seiner abgeschiedenen Lage - auf dem Landwege war der Salzhof<br />
nur auf einem großen Umweg über Haselhorst zu erreichen, und selbst wer einen<br />
Passierschein besaß und auf dem kürzeren Weg über die Eiswerderbrücke und weiter<br />
durch die Pulverfabrik zum Salzhof gehen durfte, hatte einen langen Anmarsch -<br />
hielten in den Jahren vor Ausbruch des ersten Weltkrieges auch die Personendampfer am<br />
Salzhof an. Das Schiff war hier - für Berlin ist das selten - das einzige öffentliche Verkehrsmittel.<br />
Als nach 1918 infolge der Kohlennot die Fahrgastschiffahrt nur noch in sehr<br />
reduziertem Umfange aufrecht erhalten werden konnte, wurde die Anlegestelle am Salzhof<br />
aufgegeben, sehr zum Kummer der über 30 auf dem Salzhof ansässigen Arbeiterfamilien,<br />
die nun überhaupt keine Verkehrsverbindung mehr hatten. Bei der Errichtung<br />
165
der neuen Pulverfabrik im Jahre 1889 wurde auch der Weg vom Salzhof bis zu jenem<br />
im Zuge der heutigen Daumstraße eingezogen, um keinen öffentlichen Verkehr in dem<br />
Fabrikterrain zu haben. Als Ersatz wurde der „Salzhofweg" angelegt, aus dem später<br />
die Rhenaniastraße hervorging.<br />
Die Firma „Rhenania-Ossag", Vorläuferin der „Shell", erwarb das tote Grundstück des<br />
alten Salzhofes und legte hier 1926/27 ein Tanklager an, da der bereits vorhandene<br />
„Nobelshof" bei Rummelsburg für den zunehmenden Bedarf an Mineralölen nicht mehr<br />
aufnahmefähig genug war. Das mit Wasser- und Bahnanschluß versehene neue Lager -<br />
mit 35 000 cbm Kapazität war es seinerzeit eines der größten in Deutschland - sollte den<br />
Vertrieb der Mineralölprodukte in Berlin und der Provinz verbessern. Neben dem um<br />
das vielfache des einstigen Umfanges erweiterte Shell-Lager hat die Esso 1964-1966 ein<br />
zweites Großtanklager angelegt, so daß das Gelände des Salzhofs und seiner Umgebung<br />
jetzt das größte Tanklager West-Berlins aufweist.<br />
Aus drei ursprünglich verstreut liegenden, von Äckern und Wiesen getrennten kleinen<br />
Siedlungen, der Gewehrfabrik auf dem Plan, der Kirchenmeierei und der Salzniederlage,<br />
ist im 19. und 20. Jahrhundert ein zusammenhängendes Industriegebiet geworden, das<br />
1918 seine größte Ausdehnung erreicht hatte. Der Ansatz zu dieser Entwicklung war<br />
wohl in erster Linie von der Zitadelle bestimmt. In ihrem Schutze konnten sich ohne<br />
Beachtung der Rayonvorschriften die Fabriken für Rüstungsgüter entfalten, so, wie es<br />
die jeweiligen Bedürfnisse des Heeres und der Wehr- und Kriegspolitik notwendig machten.<br />
Die unbesiedelte, ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Umgebung der Fabriken<br />
nach Osten und Nordosten hin ließ auch nicht befürchten, daß sich alsbald eine städtische<br />
Bebauung zu nahe an die Pulverfabrik mit ihren Explosivstoffen heranschieben könnte.<br />
Nach dem Zusammenbruch der staatlichen Rüstungsindustrie, ihrer Auflösung und Demontage<br />
entstand hier seit den späten zwanziger Jahren ein neues Industriegebiet, in dem<br />
sich Privatfirmen niederließen und das trotz starker Kriegszerstörungen und Demontagen<br />
wieder intakt ist; die Zahl der Firmen, die Art der Branchen sind veränderlich, unverändert<br />
aber ist die Macht der Funktion: Einmal als Industriegrundstücke ausgewiesene<br />
Terrains werden meist wieder gleichen oder doch ähnlichen Zwecken zugeführt. Nur im<br />
Falle der Pulverfabrik hat schließlich der Baumbestand bewirkt, daß das Gelände aus<br />
dem zusammenhängenden Industrieband herausgelöst wurde.<br />
Nachrichten<br />
Die DressePsche Chronik von Charlottenburg<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 31, Joachim-Friedrich-Straße 2<br />
Eines der wichtigsten noch vorhandenen Quellenwerke zur Geschichte Charlottenburgs hat wieder<br />
einen Ehrenplatz und ein würdiges Aussehen erhalten: die Chronik des von 1778 bis 1824 amtierenden<br />
Oberpfarrers Jobann Christian Gottfried Dressel mit dem Titel: „Die Geschichte Charlottenburgs<br />
von der Erbauung dieser Stadt an bis auf die jetzigen Zeiten, besonders was das<br />
Kirch- und Schulwesen betrifft aus schriftlichen und mündlichen Nachrichten mit Benutzung Rathauslicher<br />
Acten gesammelt und zu beschreiben angefangen 1813 vom Ober Prediger und Senior<br />
der Cöllnischen Superint. Johann Christian Gottfried Dreßel und fortgesetzt von ... im 2ten<br />
Bande". Der Band ist, nachdem er einige Zeit vergeblich gesucht und schließlich auf einem Abfallhaufen<br />
wiedergefunden wurde, noch gut erhalten, die Schrift ist klar und leicht zu lesen. Er steht<br />
166
im Eigentum der Ev. Luisen-Kirchengemeinde, wurde jetzt restauriert und neu gebunden. Von<br />
dieser Pfarrchronik gibt es eine gekürzte Neubearbeitung des Verfassers als „Rathauschronik";<br />
sie ist Eigentum der Stadt bzw. des Bezirksamts Charlottenburg.<br />
Diese Mitteilungen verdanken wir dem geschäftsführenden Pfarrer der Luisen-Kirchengemeinde<br />
zu Charlottenburg, unserem Mitglied Klaus Eckelt.<br />
Dressel gehört ohne Zweifel in die erste Reihe der Geschichtsschreiber des Berliner Raumes, verdienstvoll<br />
als Prediger und Schulreformator, emsig als Literat, als Persönlichkeit jedoch umstritten.<br />
Wilhelm Gundlach widmet ihm in seiner 1905 erschienenen „Geschichte der Stadt Charlottenburg"<br />
naturgemäß viel Raum, beleuchtet ihn aber fast ausschließlich von der „weltlichen" Seite,<br />
bei der es mehr Schatten als Licht gab: Dressel entwickelte eine Geschäftstüchtigkeit, die sich oft<br />
nur schwer mit der Würde eines Pfarrers vereinigen ließ. Er nahm gutes Geld durch Sommergäste<br />
ein, für die er sogar ein eigenes Haus auf Pfarrterrain bauen ließ, trat als Wirtschaftspächter oder<br />
Makler auf und legte sogar eine Milchwirtschaft an, vergab Leibrenten und spekulierte auf Testamente.<br />
Seine weitverzweigten Interessen hoben ihn sichtlich über den Kreis seiner Mitbürger hinaus,<br />
brachten ihm indessen viel Ärger und Anfeindungen ein. Neben seinen zahlreichen religiösen<br />
und pädagogischen Schriften stellen vor allem sein minutiös geführtes, sechsbändiges Tagebuch,<br />
das bis unmittelbar an seinen Tod 1824 heranreicht, und die darin enthaltene „Lebensbeschreibung",<br />
die beide nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und in Familienbesitz geblieben waren,<br />
eine nicht nur biographische, sondern auch hervorragende kulturgeschichtliche Quelle dar. Im Jahre<br />
1886 verfaßte H. Rücker im 12. Jahrgang der Wochenschrift „Der Bär" (S. 242-244) eine Eloge,<br />
die vor allem Dresseis Fürsorge für Schule und Unterricht hervorhebt und ihn als „warmen treuen<br />
Menschenfreund" bezeichnet. Pfarrer Wilhelm Kraatz hat dann 1916 in der „Geschichte der Luisengemeinde<br />
zu Charlottenburg" ein ausgewogeneres Bild dieses vielseitigen und rastlosen Mannes<br />
zu geben versucht, dessen Zeugnisse - wenigstens zu einem Teil - der Nachwelt erhalten geblieben<br />
sind. Peter Letkemann<br />
Stadtbezirksarchiv Pankow<br />
In einer Bürgerwohnung aus dem Jahre 1893, die restauriert und teilweise auch mit historischen<br />
Möbeln ausgestattet ist, kann in der Pankower Heynstraße 8 das Stadtbezirksarchiv Pankow<br />
besichtigt werden. Allerdings beschränkt sich die Darstellung der Geschichte dieses Berliner Bezirks<br />
auf die Zeit von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart. Die Ausstellung umfaßt Fotografien,<br />
Broschüren, Ansichtskarten usw. und wird durch Leihgaben des Märkischen Museums<br />
abgerundet. Die Sammlung ist dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet.<br />
Franz-Neumann-Archiv<br />
Ende 1975 ist in der Rognitzstraße 8 in Berlin-Charlottenburg das Franz-Neumann-Archiv<br />
eröffnet worden, das die Rechtsform eines eingetragenen Vereins hat und hinter dem ein Freundeskreis<br />
steht, der bislang 50 000 DM als Spenden für die wissenschaftliche Arbeit aufbrachte.<br />
In etwa zwei Jahren werden der Historiker Graf Westarp und der Politologe Dietmar Staffelt<br />
eine erste zusammenfassende Darstellung über den Nachlaß von Franz Neumann, den 1974<br />
verstorbenen langjährigen Vorsitzenden der Berliner SPD, vorlegen. Das Archiv, das seine<br />
Bestände in 360 Aktenordnern gesammelt hat, ist nach vorheriger Absprache mit dem Vorsitzenden<br />
des Vereins, Bezirksstadtrat a. D. Reinhold Walz, Telefon 4 11 13 64, zugänglich.<br />
Berlin-Brunnen in München<br />
In der Stadtmitte der bayerischen Landeshauptstadt, in einer Grünanlage am Oskar-von-Miller-<br />
Ring, soll ein Berlin-Brunnen die Verbundenheit zwischen München und der alten Reichshauptstadt<br />
zum Ausdruck bringen. Dem Brunnen liegt ein Entwurf von Professor Andreas Rauch<br />
zugrunde, den die Denkmal- und Brunnenkommission der Stadt München gutgeheißen hat. Er<br />
zeigt eine schlanke weibliche Figur aus Bronze, die Berolina darstellend, die auf dem Rand eines<br />
Säulenstumpfes sitzt und mit ihrer rechten Hand einen aus der Säulenmitte aufsteigenden<br />
Wasserstrahl teilt (nicht unbedingt als Symbol der Teilung Berlins zu verstehen). Das ablaufende<br />
Wasser fließt auf eine rund gepflasterte Bodenfläche und von dort in die Umwälzanlage.<br />
Zu den 67 000 DM aus dem Haushalt der Stadt München kommen 10 000 DM eines unbekannten<br />
Spenders.<br />
167
Mit Ausnahme eines Renommierbrunnens in Berlin scheinen hierzulande nicht nur die Brunnen<br />
selbst versiegt zu sein, sondern auch die Ideen, die Stadt mit Brunnen zu beleben und zu verschönern.<br />
Nicht einmal eine städtische Denkmal- und Brunnenkommission ist vorhanden, die sich<br />
nützlich betätigen könnte. H. G. Schultze-Berndt<br />
Gymnasiast als Berlin-Botschafter<br />
„Wenn an der Spree zuweilen über die Berlin-Müdigkeit der Bundesbürger geklagt wird, darf<br />
sich ein fünfzehnjähriger Gymnasiast aus Wetter hiervon getrost ausgenommen fühlen. Für Bert<br />
Becker ist Berlin mehr als nur eine Reise wert; mehr als nur ein Bummel über den Kurfürstendamm<br />
zwischen Haiensee und KaDeWe. Die alte Reichshauptstadt ist sein liebstes Hobby, immer<br />
wieder faszinierend und zugleich schon fast vertraut." (Westfälische Rundschau v. 23. September<br />
1975.)<br />
Mit ein paar Berlin-Postkarten begann es, die ein Schuljunge vor Jahren fein säuberlich auf<br />
einen Bogen klebte und einen erklärenden Kurztext hinzufügte. Mittlerweile ist aus diesen wenigen<br />
Bogen ein ganzes Berlin-Archiv entstanden. Alljährlich reist Bert Becker nach Berlin zu<br />
seiner Großmutter, und von hier aus unternimmt er seine Streifzüge, photographiert, besucht<br />
Archive, Bibliotheken, Sammlungen und ist in seiner Heimatstadt Wetter (Ruhr) so etwas wie<br />
ein Berlin-Experte. Durch Vorträge und Gespräche wirbt er in Ausübung seines Hobbys ungewollt<br />
für Berlin in seinem Bekanntenkreis, in dem sich, wie er bei seinem letzten Besuch erzählte,<br />
manch einer befindet, der Berlin und seine Probleme kaum kennt.<br />
Für uns Ältere, die wir von Geburt her oder später in dieser Stadt Wurzeln geschlagen haben<br />
und wie John F. Kennedy sagen können „Ich bin ein Berliner", ist es erfrischend zu sehen, wie<br />
der Begriff „Berlin" auch in der jungen Generation auf Verständnis trifft. Wir Älteren sollten<br />
diese Entwicklung, wo immer es geht, unterstützen, um an die Jungen das weiterzureichen, was<br />
uns unsere Heimatstadt einst war und heute noch bedeutet. Das beginnt mit persönlichen Erlebnissen<br />
und reicht bis zu dem, was wir aus unserem Bestand an Berolinensien entbehren können,<br />
um es in jüngere Hände zu legen, bevor solche Dinge, etwa bei Haushaltsauflösungen, auf der<br />
Müllkippe landen. Der Verfasser hat gerade in dieser Beziehung nicht selten schmerzliche Erfahrungen<br />
machen müssen. Mit einem solchen Weiterreichen haben wir die Möglichkeit, mit zu verhindern,<br />
daß sich die Bewohner der Bundesrepublik gefühlsmäßig allmählich von den Berlinern<br />
entfernen. Die Jugend reicht uns, wie wir sehen, hierzu die Hand. Kurt Pierson<br />
Personalien<br />
Fidicin-Medaille für Kurt Pomplun<br />
Eingebettet in das vorweihnachtliche Beisammensein am 20. Dezember 1975 in den Festsälen<br />
„Hochschul-Brauerei" war die Verleihung der Fidicin-Medaille für Förderung der Vereinszwecke<br />
an den langjährigen 2. stellvertretenden Vorsitzenden Kurt Pomplun. Dieser hatte sich mit Rücksicht<br />
auf seine Pensionierung und die inzwischen eingetretene Vollendung seines 65. Lebensjahres<br />
einer Wiederwahl nicht mehr gestellt. Die Urkunde, die der Vorsitzende Professor Dr. Dr.<br />
W. Hoffmann-Axthelm unter dem Beifall der Teilnehmer verlas, hebt die Verdienste Kurt<br />
Pompluns um die Erforschung und Popularisierung der Geschichte Berlins sowie seine langjährige<br />
Mitarbeit im Vorstand als stellvertretender Vorsitzender hervor. In seinen Dankworten bekannte<br />
sich der neue Träger der Fidicin-Medaille dazu, ein „schlechtes Mitglied" gewesen zu<br />
sein. Er habe das Amt eines 2. stellvertretenden Vorsitzenden gern ausgeübt, doch sei es ihm nicht<br />
vergönnt gewesen, auch einmal den Vorsitzenden wirklich zu vertreten, da sich dieser wie der<br />
1. Stellvertreter einer hervorragenden Gesundheit erfreuten. Er zitierte dann Theodor Fontane<br />
aus seinen „Wanderungen", als der alte Gottfried Schadow bei der Verleihung des Ordens<br />
Pour le merite den Überbringer fragte: „Ach Majestät, watt soll ick alta Mann mit'n Orden?"<br />
und sich dann ausbat, daß dieser Orden nach seinem Tode auf seinen Sohn Wilhelm überginge.<br />
Zum allgemeinen Leidwesen ist von einer Dynastie Pomplun in vergleichbarer Weise aber nichts<br />
bekannt.<br />
Der Vortrag „Weihnachtszeit im alten Berlin" von Hans Werner Klünner war ebenso stimmungsvoll<br />
wie sachlich fundiert und mit Kenntnis und Fleiß aufgebaut. Er traf den richtigen<br />
Ton dieser Vorweihnachtsstunde, die mit Betrachtungen des Vorsitzenden zum Geschehen der<br />
Christnacht eingeleitet und in bewährter Weise von Frau Erika Wolff-Harms musikalisch umrahmt<br />
war. H. G. Schultze-Berndt<br />
168
Ehrenmitglied Walter Mügel 75 Jahre<br />
75 Jahre eines reichen Lebens, mehr als eine Generation öffentlicher Dienst, ein Vierteljahrhundert<br />
Mitgliedschaft im Verein für die Geschichte Berlins, mehr als zwei Jahrzehnte verdienstvoller<br />
Tätigkeit als Schatzmeister - das sind nur einige Daten, die Leben und Wirken von Walter Mügel<br />
kennzeichnen. Am 6. Mai 1976 vollendet er gemeinsam mit seiner lieben Gattin, unserem Mitglied,<br />
sein 75. Lebensjahr. Beiden gilt unser herzlicher Gruß!<br />
Wenn man es recht bedenkt, kann Walter Mügel auf seine Arbeit im öffentlichen Dienst ebenso<br />
stolz sein wie auf seine ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein. Seit 1934 im öffentlichen Dienst,<br />
wurde er 1947 in der Abteilung Ernährung des Bezirks Charlottenburg Hauptreferent und übernahm<br />
dann die Leitung des Verwaltungsamtes. Von 1957 bis 1961 war er Rechnungsdirektor des<br />
Haushaltsamtes Charlottenburg, danach übte er das Amt des Verwaltungsdirektors des Städtischen<br />
Bürgerhaus-Hospitals und der Frauenklinik aus. In einem Dankschreiben bei seinem Übertritt<br />
in den Ruhestand im Jahre 1966 würdigte der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg<br />
Günter Spruch die treuen Verdienste, die Walter Mügel dem Land Berlin geleistet hat: „Umfassende<br />
Verwaltungskenntnisse, stete Einsatzbereitschaft und ein besonders ausgeprägtes Geschick,<br />
Geplantes in die Wirklichkeit umzusetzen, befähigten Sie zu Leistungen, auf die Sie heute mit<br />
Stolz und Genugtuung zurückblicken dürfen. Besonders hervorzuheben ist Ihre Aufgeschlossenheit<br />
gegenüber neuen Vorstellungen, die während Ihrer Dienstzeit an Sie herangetragen wurden."<br />
Wenn gleichzeitig das „umfangreiche Wissen über die Geschichte Charlottenburgs" dankbar erwähnt<br />
wird, so ist die Brücke geschlagen zu unserem Verein, dem Obermagistratsrat a. D. Walter<br />
Mügel von 1955 bis 1973 als Schatzmeister diente. Einen Höhepunkt bildete die Verleihung der<br />
Ehrenmitgliedschaft im Rahmen einer Feierstunde am 27. November 1973 anläßlich der Übernahme<br />
der Vereinsräume im Rathaus Charlottenburg. Diese neue Heimstatt für die Bibliothek<br />
samt dem stimmungsvollen Intarsienzimmer ist wesentlich Walter Mügel zu verdanken, der damit<br />
sich, dem Vorstand und allen Mitgliedern einen Herzenswunsch erfüllte. Wenn man das Ehrenmitglied<br />
Mügel jetzt bei den Veranstaltungen sieht, wo er auch bei den organisatorischen Dingen<br />
aus altem Pflichtgefühl mit Hand anlegt, so möchte man ihm seine 75 Jahre nicht glauben. Möge<br />
er in gleicher Rüstigkeit und in unveränderter Anhänglichkeit an den Verein noch viele Jahre in<br />
unserer Mitte weilen! H. G. Schultze-Berndt<br />
*<br />
Auf der Mitgliederversammlung der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg<br />
e. V. wurde am 30. Januar 1976 Dr. Werner Vogel, Archivdirektor am Geheimen Staatsarchiv<br />
Preußischer Kulturbesitz, zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Inhaber dieses<br />
Amtes, Gerhard Küchler, hatte aus Altersgründen auf eine Wiederwahl verzichtet. In freundschaftlicher<br />
Verbundenheit gehen auch an den neuen Vorsitzenden unseres Nachbarvereins die<br />
besten Wünsche für ein erfolgreiches Wirken in der Zukunft.<br />
*<br />
Unserem Mitglied Axel C. Springer wurde für „seine hervorragenden Verdienste um das Zeitschriftenwesen"<br />
die Jakob-Fugger-Medaille verliehen.<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Herrn Wolfgang Knochenhauer, Frau Magdalena Schwenn, Herrn Hans<br />
Höltje, Herrn Dr. Roland Kuhn, Frau Ruth Sassmannshausen, Herrn Günther Linke, Herrn<br />
Kurt Kühling; zum 75. Geburtstag Herrn Reinhold Napirala, Herrn Kurt Meurer, Frau Elise<br />
Mügel, Herrn Walter Mügel, Herrn Gotthilf Hahn; zum 80. Geburtstag Frau Dr. Hildegard de<br />
la Chevallerie; zum 90. Geburtstag Herrn Johannes Posth; zum 95. Geburtstag Herrn Prof. Dr.<br />
Johannes Schultze.<br />
169
Buchbesprechungen<br />
Hans-Joachim Schreckenbach: Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg. Teil 3 und 4.<br />
Weimar: Böhlau 1972 u. 1974. 584 u. 398 S., Leinen, 48 bzw. 42 M. (Veröff. d. Staatsarchivs<br />
Potsdam, Bd. 10 u. 12.)<br />
Nach den in den „Mitteilungen", Jg. 67/1971, S. 95 angezeigten beiden ersten Teilen dieser umfangreichen<br />
Bibliographie liegen nun auch die „Orte und Ortsteile" behandelnden Bände vor. Wie<br />
in den zuvor erschienenen Teilen wird das gesamte Gebiet der ehem. Provinz Brandenburg unter<br />
Ausschluß von Groß-Berlin und der Niederlausitz, jedoch mit Einschluß der jenseits von Oder<br />
und Neiße liegenden Gebiete der ehem. Neumark behandelt. Die Ortsteile werden unter der<br />
jeweiligen Gemeinde aufgeführt. Stichjahr für die Gemeindezugehörigkeit ist für das Gebiet innerhalb<br />
der DDR 1968, für die Neumark 1927. Besonders begrüßt werden kann die Aufnahme<br />
moderner polnischer Titel bei den neumärkischen Orten. Für Orte mit umfangreicherer Literatur<br />
sind die Titel nach Bibliographien, Allgemeines, Sozialökonomische Verhältnisse, Allgemeine und<br />
politische Geschichte, Stadt und Recht, Kultur und Kunst, Sprache und Kirche sowie Geschichte<br />
der Ortsteile unterteilt. Dieses Schema, das eine weitere Unterteilung zuläßt, wird den Charakteristiken<br />
der einzelnen Orte entsprechend gehandhabt. Neben Einzeltiteln sind auch die topographischen<br />
Beschreibungen von Bratring, Berghaus und Fidicin sowie neuere Übersichten, z. B. die<br />
von B.Schulze bearbeitete Statistik der brandenburgischen Ämter und Städte 1540-1800, Berlin<br />
1935, und die in den Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte der Dt. Akademie der<br />
Wissenschaften Berlin (Ost) erschienenen Inventare von J. Herrmann: Die vor- und frühgeschichtlichen<br />
Burgwälle Groß-Berlins und des Bezirks Potsdam, Berlin (Ost) 1960 und B. Krüger: Die<br />
Kietzsiedlungen im nördlichen Mitteleuropa, Berlin (Ost) 1962, aufgeführt. Nicht zuletzt durch<br />
die Auswertung dieser Inventare wird ein großer Teil auch der kleineren und unbedeutenderen<br />
Gemeinden mit einem eigenen Stichwort erfaßt. Die Literaturangaben für die wichtigsten Plätze<br />
können dagegen innerhalb der Bibliographie selbst zu Buchstärke anwachsen. So werden für<br />
Potsdam (mit allen heutigen Ortsteilen) 1484 Titel auf nahezu 60 S. genannt. Die neuere, vor<br />
1969 in der Bundesrepublik und Berlin (West) erschienene Literatur ist - wie Stichproben erweisen<br />
- weitgehend eingearbeitet. Etwas geringeren Umfang haben die Ortsbibliographien von<br />
Brandenburg und Neuruppin.<br />
Mit dem vorliegenden Werk hat Schreckenbach nicht nur ein vorzügliches Hilfsmittel zur allgemeinen<br />
Landesgeschichte, sondern auch zur speziellen Ortsgeschichte vorgelegt. Hoffentlich gelingt<br />
es, diese große Arbeit bald durch die noch ausstehenden Register - vorgesehen ist ein Verfasserund<br />
ein Sachregister - zum Abschluß zu bringen. Felix Escher<br />
Werner Oehlmann: Das Berliner Philharmonische Orchester. Kassel: Bärenreiter-Verlag 1974.<br />
199 S., 130 Abb., Leinen, 48 DM.<br />
Hier ist ein Werk auf den Markt gebracht worden, das den Leser schon durch hervorragende<br />
textliche Information besticht. Der Verfasser des Buches hat den Weg des Orchesters über viele<br />
Jahrzehnte selbst aus nächster Nähe beobachten und begleiten können, was beim Lesen immer<br />
wieder deutlich wird. Das Buch widmet vor allem der Idee und der Geschichte des Orchesters<br />
reichlich Raum. Nicht durch staatliche Planung oder private Institutionen entstand im Frühjahr<br />
1882 mit zunächst 52 Musikern das Berliner Philharmonische Orchester, sondern aus dem Bestreben<br />
der Musiker, die Geschicke ihrer künstlerischen Gemeinschaft selbst zu lenken und in<br />
freier Entscheidung den Weg zu gehen, der ihnen zur Erfüllung des Vermächtnisses der großen<br />
Tondichter nötig erschien. Der Leser muß mit dem Verfasser übereinstimmen, daß der beschrittene<br />
Weg richtig war.<br />
Der Reichtum des Werkes an Bildmaterial, Mitgliederlisten von 1882, 1922, 1932, 1942, 1974 und<br />
einer Zeittafel von 1882-1973 verdienen hervorgehoben zu werden. Der Musikfreund erhält<br />
durch diese sinnvollen Ergänzungen eine Fülle von zusätzlichen Informationen über das traditionsreiche<br />
und wohl einmalige Orchester, wird aber nicht nur mit Namen, Daten und Ereignissen<br />
konfrontiert, sondern erfährt darüber hinaus so manches Wissenswerte aus der Historie des Berliner<br />
Musik- und Konzertlebens über eine Zeitspanne von fast 100 Jahren. Berühmte Namen,<br />
wie Hans von Bülow, Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Sergiu Celibidache und Herbert<br />
von Karajan, um nur einige zu nennen, erfahren eine Würdigung ihrer künstlerischen und<br />
menschlichen Persönlichkeit. Die klare Gliederung des Buches, die sorgfältige Auswahl des - zum<br />
Teil seltenen - Bildmaterials sowie die bereits erwähnte Zeittafel, die die im jeweiligen Spieljahr<br />
herausragenden musikalischen und künstlerischen Höhepunkte im Schaffen der Berliner Philharmoniker<br />
zum Inhalt hat, bieten dem Leser dieses Buches aus der Feder eines kompetenten<br />
Verfassers ein wohl einmaliges Erlebnis. Klaus Streu<br />
170
Berliner Abendblätter [1. X. 1810-30. III. 1811]. Hrsg. v. Heinrich von Kleist. Nachwort und<br />
Quellenregister von Helmut Sembdner. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1973. (Reprographischer<br />
Nachdruck der Ausgabe von G. Minde-Pouet, Leipzig 1925.) 306, 304 und 34 S.,<br />
Leinen, 36,50 DM (f. Mitglieder).<br />
Die schon im Jahre 1925 in der Nachfolge von Reinhold Steig durch den Kleist-Forscher Georg<br />
Minde-Pouet herausgegebenen „Berliner Abendblätter" sind vor einiger Zeit durch Helmut<br />
Sembdner dem wissenschaftlich und allgemein interessierten Leser neu zugänglich gemacht worden.<br />
Hiermit wurde einem zweifachen Bedürfnis Genüge getan: Den an der Geschichte Berlins<br />
Interessierten erwartet mit der vollständigen Textwiedergabe dieser von Kleist nur unter Aufbietung<br />
aller Kräfte von Herbst 1810 bis zum Frühjahr 1811 - seinem letzten Lebensjahr -<br />
herausgegebenen Tageszeitung ein farbenreiches, in seinen sozialen, politischen und kulturellen<br />
Details außerordentlich faszinierendes Bild Berliner Zustände im Zenit der napoleonischen Ära;<br />
auch der literarhistorisch interessierte Leser wird in seinen Erwartungen, durch den Herausgeber<br />
Helmut Sembdner neue wissenschaftlich fundierte Einsichten in die Verfasserschaft<br />
Kleists an den Beiträgen der „Berliner Abendblätter" zu erhalten, nicht enttäuscht. Neben<br />
einem Nachwort, das über die Stationen der literaturwissenschaftlichen Erschließung der „Abendblätter"<br />
im Rahmen der Kleist-Forschung berichtet, werden im Anhang die jeweiligen Verfasser<br />
bzw. - bei übernommenen Meldungen aus fremden Journalen - deren jeweilige Quelle bestimmt.<br />
Ungeachtet dieser wichtigen, von jedem Freund und Kenner des Kleistschen Werkes dankbar<br />
registrierten Informationen wird der Leser es als besonderen und eigenen Reiz dieses Bandes<br />
empfinden, im Faksimiledruck dieser Ausgabe all jene Beiträge zu entdecken, die der Dichter an<br />
dieser Stelle den Zeitgenossen zum erstenmal vorlegte. Hans Joachim Mey<br />
Felix Gilbert (Hrsg.): Bankiers, Künstler und Gelehrte. Unveröffentlichte Briefe der Familie<br />
Mendelssohn aus dem 19. Jahrhundert. Tübingen: Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1975.<br />
329 S., 12 Abb., 2 Klapptafeln, Leinen, 87 DM. (Schriftenreihe wiss. Abhandlungen des Leo<br />
Baeck Instituts, 31.)<br />
Ein Verantwortungsgefühl für geistige Werte habe in vielen der Nachkommen Moses Mendelssohns<br />
gelebt, stellt der Historiker Felix Gilbert, Professor am Institute for Advanced Study in<br />
Princeton (USA) am Ende seines Einführungsessays zu dem von ihm herausgegebenen Werk fest.<br />
Und er fügt hinzu, ein äußeres Zeichen möge man darin finden, daß die Nachkommen Wert darauf<br />
legten, gute Briefschreiber zu sein. Wie recht er damit hat, zeigt der hier vorgelegte Briefband,<br />
obwohl er natürlich nur einen gewissen Ausschnitt bieten kann.<br />
Gilberts Introduktion „Die Familie Mendelssohn in historischer Sicht" ist in ihrem Reichtum<br />
auch an sozialhistorischen Erkenntnissen und in ihrer Prägnanz der Darstellung hervorragend<br />
gelungen. Auch deshalb, weil sie wesentliche Probleme, wie den Glaubens Wechsel von Moses'<br />
Nachkommen und die Integration der Familie in die deutsche Gesellschaft so objektiv wie<br />
möglich behandelt. Zudem ist der Autor, das muß man wissen, ein emigrierter Urenkel des<br />
Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. So ist hier ein über hundert Jahre reichendes<br />
Familien- und zugleich Zeitbild entstanden, mit den vielen Erklärungen sehr aufschlußreich,<br />
fast aufschlußreicher als die 164 Briefe, die den wesentlichen Teil des Bandes ausmachen. „Die<br />
Abstammung von Moses Mendelssohn und der Stolz, der mit dieser Abstammung verbunden<br />
war", so äußert Gilbert an einer Stelle, „schuf das Bewußtsein einer Familienzusammengehörigkeit<br />
und hielt die Erinnerung an den Ursprung der Familie am Leben." Doch könne die bewußte<br />
oder unbewußte Neigung zu einer Distanzierung von der Umwelt nicht nur als Ausdruck eines<br />
Elements von Familienstolz gesehen werden. „Die Frage muß gestellt werden", so fährt Gilbert<br />
fort, „ob und inwieweit diese Zurückhaltung auch von dem Gefühl bestimmt war, nicht in<br />
Kreise eindringen zu wollen, die der Aufnahme jüdischer Elemente in Gesellschaft und Regierung<br />
feindselig gegenüberstanden." Das Problem des Aufgehens in die umgebende soziale Welt<br />
sei auch von der Reaktion dieser Welt zum Judentum und von der Art, wie die emanzipierten<br />
oder getauften Juden von dieser Welt aufgenommen wurden, bestimmt gewesen.<br />
Dieses Buch, schön ausgestattet mit einigen charakteristischen Porträts, enthält auch mehr oder<br />
minder ausführliche Biographien der „handelnden Personen" und zwei Stammbaumtafeln (Moses<br />
Mendelssohn und Daniel Itzig). Daß es lange gedauert hat, bis das schon in den fünfziger<br />
Jahren in Aussicht genommene Werk herauskam, liegt auch an der mühevollen Beschaffung und<br />
Bearbeitung des umfangreichen Materials. Das Leo-Baeck-Institut in New York hat sich durch<br />
seine intensiven Bemühungen, das Vorhaben zu verwirklichen, verdient gemacht. Übrigens: Der<br />
Band ist Professor Dr. Fritz Bamberger gewidmet, seit bald 50 Jahren ein anerkannter Moses-<br />
Mendelssohn-Forscher und seit Bestehen Vizepräsident des New Yorker L.B.I. Bis gegen Ende<br />
der dreißiger Jahre wirkte er als Pädagoge und Wissenschaftler in Berlin.<br />
Bei den Briefen, unterschiedlich in Art und Bedeutung, handelt es sich um zwei auch äußerlich<br />
171
voneinander getrennte Gruppen. Zum einen um 125 Familienbriefe, die in der Zeit von 1806<br />
und 1888 zwischen Brüdern und Schwestern, zwischen Eltern und Kindern und mit Verwandten<br />
und Freunden gewechselt worden sind. Zum andern und an Zahl weit geringer sind es sogenannte<br />
Professorenbriefe, 19 davon an Benjamin (Georg) Mendelssohn (1794-1874) gerichtet, ab<br />
1835 Geographieprofessor in Bonn, und fast ebensoviele an Karl Mendelssohn-Bartholdy<br />
(1838-1897), der bis 1874 als Historiker in Freiburg wirkte. Namentlich in der ersten Gruppe<br />
tritt neben Familienangelegenheiten und der Sorge um Angehörige das kulturelle und politische<br />
Berlin öfters hervor. Aber auch das Wetter und mancher Berlin-Klatsch kommen nicht zu kurz.<br />
Briefschreiber sind vor allem Moses Mendelssohns Söhne Joseph Mendelssohn (1770-1848), der<br />
Berliner Bankier, Abraham Mendelssohn-Bartholdy (1776-1835), gleichfalls Bankier in Berlin,<br />
der Vater des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy und dessen Schwester Fanny Hensel,<br />
sowie Nathan Mendelssohn (1782-1852), der nach Teilnahme an den Freiheitskriegen Techniker<br />
wurde und Mitbegründer der Polytechnischen Gesellschaft in Berlin war. Aber auch deren Ehefrauen<br />
Hinni, Lea und Henriette und, nicht zuletzt Moses Mendelssohns älteste Tochter, die<br />
Schriftstellerin Dorothea Veit/Schlegel (Berlin 1764 - Frankfurt/M. 1839), treten in Erscheinung.<br />
Felix Mendelssohn Bartholdy schreibt aus Berlin, Düsseldorf und Leipzig, seinen Hauptwirkungsstätten,<br />
meist kurz, aber warmherzig; einer seiner Briefe beschäftigt sich mit der Frage „einer<br />
ordentlichen Gesamtausgabe des Großvaters" (Moses Mendelssohn). Auch sein Schwager, der<br />
preußische Hofmaler Professor Wilhelm Hensel (1794-1861), ist in dem Briefband vertreten,<br />
neben ihm Persönlichkeiten wie Alexander von Humboldt (1769-1859), der dem Chef des<br />
Bankhauses Mendelssohn & Co., Alexander Mendelssohn (Berlin 1798-1871), freundschaftlich<br />
verbundene Naturforscher und Geograph, und Heinrich von Treitschke. Ernst G. Lowenthal<br />
Heinrich Braulich: Max Reinhardt. Theater zwischen Traum und Wirklichkeit. Zweite, veränderte<br />
Aufl. (Ost-)Berlin: Henschelverlag 1969. 320 S. m. Abb., Leinen, 15 M.<br />
Aus einer Ost-Berliner Dissertation von 1957 hervorgegangen, erschien Braulichs Buch zuerst<br />
1966 im Henschelverlag, der seit Jahrzehnten für seine sorgfältigen theaterhistorischen Publikationen<br />
bekannt ist. Der Erfolg der ersten wissenschaftlichen Gesamtdarstellung des Phänomens<br />
Max Reinhardt ermöglichte drei Jahre später eine zweite, vom Verlag geheimnisvoll als „verändert"<br />
bezeichnete Auflage, die man aber getrost „verbessert" nennen kann. Die um 6 Seiten<br />
erweiterte Ausgabe weist stilistische Glättungen und einige neue überleitende oder zitierende<br />
Passagen auf. Leider ist die wichtige Bibliographie am Schluß des Bandes, die trotz ihrer Reichhaltigkeit<br />
(mehr als 170 Titel) einige wesentliche Lücken enthält, nicht ergänzt worden. Die Verbreitung<br />
des Werkes auch im Westen zeugt von der Sachlichkeit der Darstellung, auch wenn von<br />
Zeit zu Zeit ideologische Pflichtübungen eingeschaltet werden, die dem Leser den „Scheidepunkt<br />
zwischen bürgerlicher und sozialistischer Kunst" deutlich machen sollen. Daß ein marxistischer<br />
Autor, der sich mit dem Inbegriff bürgerlich-kulinarischen Theaters, den die Reinhardt-Bühnen<br />
nun einmal verkörperten, befaßt, in Schwierigkeiten geraten würde, wenn er seinen Gegenstand<br />
in positivem Licht zeigen will, war von vornherein zu erwarten. Deshalb hatte er in seiner Dissertation<br />
schon „Reinhardts Weg zum Massentheater des Großen Schauspielhauses" hervorgehoben.<br />
Da aber nun in der Gesamtdarstellung diese sehr kurze Episode unter den vielen Experimenten<br />
Reinhardts nur einen Bruchteil des Stoffes ausmachen konnte, muß Braulich oft genug<br />
über die Praxis des bürgerlichen Geschäftstheaters unter Reinhardt Klage führen, die im Widerspruch<br />
zu dessen „zutiefst humanistischer Weltanschauung" gestanden habe. Abgesehen von solchen<br />
wohl unvermeidlichen ideologischen Bemühungen des Verfassers bietet Braulichs Buch jedoch<br />
einen zuverlässigen, detailreichen und zumeist treffend kommentierten Überblick über das gesamte<br />
Schaffen Max Reinhardts, so daß es trotz der genannten Einschränkungen als wichtiges<br />
Standardwerk gelten muß. Bei seiner Auswertung sollte man allerdings die ideologischen Verzerrungen<br />
nicht, wie das so oft geschieht, als sattsam bekannt hinnehmen und überlesen, sondern<br />
man sollte ihnen widersprechen, wo immer es nötig ist. Rainer Theobald<br />
Rolf König: Mit Pille, Spritze und Skalpell. Anekdoten um Berliner Ärzte und ihre Patienten.<br />
Berlin: Rembrandt Verlag 1975. 140 S. m. Zeichn., geb., 14,80 DM.<br />
Mit viel Liebe, Geschick und Ausdauer hat der Autor eine Fülle von Anekdoten um Berliner<br />
Ärzte und ihre Patienten zusammengestellt. Selbst ein in Berlin geborener Medicus, der in Berlin<br />
studiert und dort die längste Zeit seines Lebens gewirkt hat, rindet noch manches ihm Unbekannte<br />
(wenn er auch natürlich dem Autor noch einiges zu erzählen hätte). Wer sich hier und da<br />
eine fröhliche Minute machen, auch einmal auf Kosten der Großen im weißen Mantel herzhaft<br />
lachen will, der greife getrost zu diesem Buch. Walter Hojfmann-Axthelm<br />
172
Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik im 19. Jahrhundert. 6. Gespräch der<br />
Georg-Agricola-Gesellschaft. Düsseldorf: VDI-Verlag 1970. 197 S., 19 Abb., 1 Faltblatt, brosch.<br />
26 DM. (Technikgeschichte in Einzeldarstellungen, hrsg. v. Verein Dt. Ingenieure, Nr. 16.)<br />
Der vorliegende Band enthält die ausgearbeiteten Beiträge einer 1969 in Essen durchgeführten<br />
Tagung im Rahmen eines größeren Forschungsvorhabens zu Problemen des 19. Jhs. Neben<br />
anderen wissenschaftsgeschichtlichen Abhandlungen, z.B. von Alwin Diemer: „Der Begriff Wissenschaft<br />
und seine Entwicklung im 19. Jahrhundert" (S. 7-11), von Karl-Heinz Manegold:<br />
„Die Entwicklung der Technischen Hochschule Hannover zur wissenschaftlichen Hochschule. Ein<br />
Beitrag zum Thema ,Verwissenschaftlichung der Technik im 19. Jahrhundert'" (S. 13-46), von<br />
Mathias Riedel: „Die Entwicklung von Clausthal zur wissenschaftlichen Hochschule" (S. 47-80)<br />
und der Untersuchung von Heinz Gummen: „Entwicklung neuer technischer Methoden unter<br />
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der deutschen Schwerindustrie, gezeigt am<br />
Beispiel der Firma Krupp, Essen" (S. 113-132) werden besonders die beiden Berlin betreffenden<br />
Aufsätze größeres Interesse finden.<br />
Walter Ruske stellt in seinem Aufsatz zu „Wirtschaftspolitik, Unternehmertum und Wissenschaft<br />
am Beispiel der chemischen Industrie Berlins im 19. Jahrhundert" (S. 81-111) anhand der<br />
Behörden- und Firmengeschichte die Besonderheiten der Entwicklung der Berliner chemischen<br />
Industrie dar. Es lassen sich mehrere Epochen voneinander unterscheiden. In der frühen Phase<br />
war die Industrie allgemein stark von der staatlichen Gewerbeförderung abhängig, die auch eine<br />
Hebung des wissenschaftlichen Niveaus der Firmenleiter bewirkte. In der folgenden Epoche<br />
setzte das stürmische Wachstum, insbesondere der Berliner chemischen Industrie, ein. Am Ende<br />
des 19. Jahrhunderts und besonders nach der Jahrhundertwende bildeten sich auch in der Berliner<br />
chemischen Industrie einige Konzerne heraus, deren Entstehungsetappen zusätzlich durch Tabellen<br />
verdeutlicht werden, z. B. Kali-Chemie und Schering-AG. Parallel dazu veränderte sich das<br />
Produktionsprogramm: die Produktion chemischer Grundstoffe trat gegenüber der von Feinchemikalien<br />
und Synthetika zurück.<br />
Die Zusammenhänge von theoretischer und angewandter Wissenschaft sind kaum so deutlich zu<br />
erkennen wie in der Geschichte der Siemens-Werke. Bereits durch Werner v. Siemens wurde die<br />
enge Verbindung zwischen Forschung und angewandter Technik angelegt. Ferdinand Trendelenburg<br />
beschreibt diese Entwicklung in seiner Studie über „Die Verwissenschaftlichung der Technik<br />
im Bereich der elektrotechnischen Industrie gezeigt an Beispielen aus der Forschung des Hauses<br />
Siemens" (S. 133-171). Die zunächst in getrennten Einzellaboratorien arbeitenden Wissenschaftler<br />
des Hauses Siemens konnten durch Neuentwicklungen bereits um die Jahrhundertwende<br />
größere Erfolge erringen, wie das Beispiel der Entwicklung der Tantallampe (1905) zeigt. Die<br />
Zusammenlegung der Forschungsstätten zu einem Zentrallaboratorium in Siemensstadt im Jahre<br />
1924 bedeutete einen weiteren Schritt zu einer großangelegten wissenschaftlichen Forschung innerhalb<br />
der Firmengruppe. Maximal 300 Mitarbeiter waren in dem Bau am Rohrdamm beschäftigt,<br />
der zeitweise unter der Leitung von Gustav Hertz stand. Der Neuaufbau der Forschungsstätten<br />
des Hauses Siemens nach 1945 erfolgte in Erlangen und München.<br />
Notgedrungen können bei einem so weitgesteckten Problemkreis einer Tagung nicht alle Aspekte<br />
des Themas erörtert werden. So fehlt die Auseinandersetzung mit den unter maßgeblichem Mitwirken<br />
der Industrie gegründeten Behörden, wie der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und<br />
dem aus einem Institut der Technischen Hochschule in Charlottenburg entstandenen Materialprüfungsamt.<br />
Auch wäre es reizvoll gewesen, die Anfänge der Forschungsinstitute einzelner<br />
Industriezweige bis vor dem Ersten Weltkrieg zurückzuverfolgen. Zur Verwissenschaftlichung der<br />
Technik wurde im 19. Jahrhundert in Berlin Wesentliches geleistet. Felix Escher<br />
Georg Hermann: Kubinke. Roman. Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag 1974. 293 Seiten, Leinen,<br />
22 DM.<br />
Nun schon geraume Zeit dem Freund liebenswerter und dennoch anspruchsvoller Berlin-Literatur<br />
auf dem Markt der Büchereitelkeiten neu vorgelegt, gilt es auch hier davon Kenntnis zu nehmen,<br />
daß Georg Hermanns berühmter sozialkritischer Roman „Kubinke" in einer preiswerten und<br />
schönen Neuausgabe dem Lesepublikum wieder zugänglich ist. In der Sammlung „Fischernetz"<br />
hat sich der S. Fischer-Verlag als der früheste Mentor des deutschen Naturalismus dieses Buches<br />
aus der Nachfolge Fontanes und Kretzers aufs neue angenommen. Nicht weniger meisterhaft<br />
als in seinem „Jettchen Geben" hat Hermann den Berliner in seinem unverwechselbaren Naturell,<br />
seiner schlagenden Lakonik, aber auch seiner oft nur verschämt aufblitzenden Herzlichkeit<br />
festgehalten. Wie indes Hermann den Nicht-Helden Kubinke an den grausamen Härten der<br />
sozialen Wirklichkeit, und das heißt an der Häne und Rücksichtslosigkeit seiner Mitmenschen<br />
zerbrechen läßt, hebt diesen Roman über die Trivial- und Dokumentarliteratur auf die Ebene<br />
der Dichtung. Hans Joachim Mey<br />
173
Horst-Johs Tümmers (Bearb.): Kataloge und Führer der Berliner Museen. Berlin: Gebr. Mann<br />
1975. XIV, 191 S., Leinen, 80 DM. (Verzeichnis der Kataloge und Führer kunst- und kulturgeschichtlicher<br />
Museen in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin-West, Bd. 1).<br />
Die im Jahre 1964 gegründete Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken gab den Anstoß zur<br />
Zusammenstellung und Veröffentlichung dieser wichtigen Daten; die Realisation wurde durch die<br />
Fritz-Thyssen-Stiftung ermöglicht. Die bibliografischen Angaben des ersten Bandes umfassen insgesamt<br />
38 Museen in Berlin. Der erste Teil enthält zunächst die Führer und Kataloge vor 1830,<br />
danach die der Königlichen (ab 1918 Staatlichen) Museen bis 1970 mit allen ihren Abteilungen.<br />
Im zweiten Teil sind dann die Publikationen der Staatlichen Schlösser und Gärten sowie u. a.<br />
des Märkischen Museums, des Berlin-Museums, des Brücke-, des Kolbe- und des Jüdischen Museums,<br />
der Museen der Preußischen Staatstheater, des Reichsarbeitsministeriums sowie der Reichspost<br />
genannt. Weiter sind aufgeführt das Schriftmuseum, das Städtische Schulmuseum, das Gymnasium<br />
zum Grauen Kloster, der Verein für die Geschichte Berlins sowie der Kunstbesitz der<br />
Stadt Berlin.<br />
Bei fast allen Institutionen ist der Aufzählung des Schrifttums eine Einleitung vorangestellt, aus<br />
der die Gründung, Entwicklung und Bedeutung der Sammlungen hervorgeht. Nachträge und Ergänzungen<br />
und im dritten Teil Aufstellungen von Besitznachweisen und der bibliografischen<br />
Fundstellen sowie ein gutes Namensregister komplettieren diesen ,Katalog der Kataloge'. Als<br />
lobenswert soll auch die Arbeit des Autors erwähnt werden, der die über 2000 bibliografischen<br />
Angaben zusammengetragen und geordnet hat. Insgesamt gesehen liegt mit diesem Buch ein gut<br />
vorbereitetes und schon lange gesuchtes Standardwerk vor, mit dem für die Zukunft Maßstäbe<br />
gesetzt sind. Die technische Ausführung und Aufmachung entsprechen der eines guten soliden<br />
Handbuches, das auch bei täglichem Gebrauch noch ansehnlich bleiben wird. Claus P. Mader<br />
Annemarie Weber: Die jungen Götter: Roman. München: Desch 1974. 262 S., Ln., 26 DM.<br />
Brutalität am Anfang - Brutalität am Ende. Zunächst bekommt die Romanheldin Susanne Blau<br />
eine unmotivierte Tracht Prügel von ihrem Freund Max, ehe dieser Bett und Wohnung verlassen<br />
muß. Dann, am Ende geschieht die Verwüstung ihrer Habe durch die neue Freundin - von Max<br />
aus Rache angestiftet - und von einem Schlägertrupp gründlich ausgeführt. Zwischen diesen zwei<br />
extremen Handlungen wird dem Leser ein mehrjähriger Abschnitt aus dem an Episoden reichen<br />
Liebesleben einer Fünfzigerin geboten. Susanne, die der Berliner Kunstszene mannigfaltige, wenngleich<br />
keine entscheidenden Impulse gibt, sucht und findet ihre Bestätigung bei ihren „Jungen<br />
Göttern" Ewald, Leonhard, Henry u. a. Mit ihnen, den teilweise noch Pubertierenden, bricht sie<br />
mit ihrem „glückswütigen Temperament" alle bürgerlichen Tabus. Auch ihre alten Freunde und<br />
ihre Tochter Jehanne vermögen sie nicht zu zügeln, ja sie lassen sich je nach eigenem Temperament<br />
mitreißen.<br />
Wenngleich nach dieser kurzen Inhaltsangabe der Eindruck entstehen kann, es hier mit einem<br />
.unmoralischen' Buch zu tun zu haben, ist es doch ein Buch mit sehr viel Moral, einer Moral<br />
allerdings, die mit dem althergebrachten Begriff nur noch die Schreibweise teilt. Annemarie Weber<br />
hat mit diesem Roman gute deutsche Unterhaltungsliteratur geschaffen. Die Autorin mit ihrem<br />
Engagement zum Thema und ihrer Sympathie für Susanne Blau hat hier bestimmt nicht den<br />
schlechtesten Beitrag zum vergangenen „Jahr der Frau" geleistet. Claus P. Mader<br />
Berlin wie es lacht. Eine Sammlung Berliner und brandenburgischen Humors, hrsg. von Reinhold<br />
Scharnke mit Zeichnungen von Helmut Hilm Hellmessen. Frankfurt a. M.: Weidlich 1971.<br />
144 S. mit 10 Zeichn., Leinen, 12.80 DM.<br />
Hier wird eine Sammlung Berliner Humors (oder Berliner Witze) vorgelegt, die nicht besser und<br />
nicht schlechter ist als die meisten dieser Anthologien, sich aber immerhin sympathisch offen zu<br />
allen Quellen bekennt (so auch neben der DDR-Presse in Übereinstimmung mit dem Viermächtecharakter<br />
Berlins zur „National-Zeitung", Ost-Berlin). Hier hilft weniger das Rezensieren als das<br />
Lesen, und gelegentlich stößt man auf aktuelle Bezüge wie denjenigen über Herbert von Karajan:<br />
„Wie kann irgend etwas mit Karajan jemals schiefgehen? Alles, was man in der Bundesrepublik<br />
zu vergöttern pflegt, vereinigt er in seiner Person - Beethoven und Gunter Sachs!"<br />
Ein Kapitel trägt die berechtigte Oberschrift „Aus dem alten Zettelkasten", und aus diesem sei<br />
die unsterbliche Anekdote vom alten Geheimrat Heim zitiert: „Einige Studenten wollten Heims<br />
gerühmte Sicherheit in der Diagnostik erproben. Einer von ihnen hatte sich ins Bett zu legen<br />
und die ihm aus dem Kolleg bekannten Symptome irgendeiner Krankheit herzubeten. Heim<br />
sagte: ,Stecken Se mal die Zunge 'raus!' Während dies geschah, drehte sich der alte Heim um<br />
und sagte über seine Schulter weg: ,So, nu können Se mich mal!'"<br />
Vielleicht identifiziert sich auch jemand mit Adolf Glaßbrenner, der zum Thema „Bad Berlin"<br />
das folgende Gedicht beisteuerte: „Weeßte wat? / Dett beste Bad, / wo man hat, / is unsre<br />
Stadt: / Jeden Tag in'n Jrunewald, / da wirste alt. / In'n Wannsee rin mit Schwung: / Dett<br />
174
hält jung. / Und 'ne Molle druff mit'n Schuß: / Hochjenuß - Hochjenuß!" - Übrigens beziehen<br />
Glaßbrenners Hefte „Berlin wie es ist - und trinkt" ihren Witz gerade daraus, daß das „ist"<br />
nicht wie hier „ißt" geschrieben wird. H. G. Schultze-Berndt<br />
Mendelssohn-Studien. Beiträge zur neueren deutschen Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Hrsg.<br />
für die Mendelssohn-Gesellschaft e.V. von Cecile Lowenthal-Hensel. Bd. 2. Berlin: Duncker &<br />
Humblot 1975. 238 S., 9 Abb.-Taf., brosch., 36 DM.<br />
Drei Jahre nach Band 1 (vgl. P. Letkemann in den „Mitteilungen" Jg. 70/1974, Nr. 15, S. 464)<br />
legte die Berliner Mendelssohn-Gesellschaft kürzlich den 2. Band ihrer Mendelssohn-Studien vor.<br />
Er knüpft verschiedentlich an seinen Vorgänger an. Wiederum findet sich an erster Stelle ein Beitrag<br />
von Alexander Altmann über Moses Mendelssohn (Moses Mendelssohn's Proofs for the<br />
Existence of God). Boyd Alexander führt das Thema „Felix Mendelssohn Bartholdy and Young<br />
Women" fort, diesmal bezogen auf Mary Alexander, die jüngste von drei Londoner Schwestern,<br />
deren Liebe zu dem Komponisten keine Erfüllung fand. Rudolf Elvers schließlich ergänzt das<br />
„Verzeichnis der Musik-Autographen von Fanny Hensel im Mendelssohn-Archiv zu Berlin"<br />
(Bd. 1) um „Weitere Quellen zu den Werken von Fanny Hensel".<br />
Darüber hinaus betreffen noch zwei andere Aufsätze Moses Mendelssohn, und zwar von Hans<br />
von Haimberger (Die Rolle der Illusion in der Kunst nach Moses Mendelssohn) und Julius H.<br />
Schoeps (Ephraim Veitel Ephraim - Ein Vorkämpfer der Judenemanzipation). Der friderizianische<br />
„Hofjuwelier" holte erst ein Gutachten von Moses Mendelssohn ein, ehe er seine hier erstmals<br />
abgedruckte Denkschrift „Über die Lage der Juden in Preußen" aus dem Jahre 1785 dem<br />
König übermittelte.<br />
An Hand neuer Quellen, nämlich bisher unveröffentlichter Briefe von Alexander von Humboldt<br />
an Joseph Mendelssohn und seine Angehörigen, die in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz<br />
aufbewahrt werden, beleuchtet Hanns G. Reissner die engen persönlichen und wirtschaftlichen<br />
Bindungen, die zwischen dem großen Gelehrten und der Bankiersfamilie bestanden (Alexander<br />
von Humboldt im Verkehr mit der Familie Joseph Mendelssohn). Auch in Werner Vogels<br />
Aufsatz „Der Brand Hamburgs im Jahre 1842 und die preußischen Hilfsmaßnahmen" spielen die<br />
Stadt Berlin und ihre Bürger, darunter ebenfalls Joseph Mendelssohn und sein Neffe Felix Mendelssohn<br />
Bartholdy, eine wichtige Rolle.<br />
Den Abschluß bilden zwei Studien über die Historiker „Georg Benjamin Mendelssohn und Karl<br />
Mendelssohn Bartholdy - Zwei Professoren aus dem 19. Jahrhundert" (von Felix Gilbert) und<br />
den Maler „Wilhelm Hensel in England" (von Cecile Lowenthal-Hensel). - Die Beiträge von<br />
J. H. Schoeps, W. Vogel und C. Lowenthal-Hensel gehen auf Vorträge zurück, die die Genannten<br />
in den letzten Jahren auf Abendveranstaltungen der Mendelssohn-Gesellschaft hielten.<br />
Ingeborg Stolzenberg<br />
Im I.Vierteljahr 1976<br />
haben sich folgende Damen, Herren und Institutionen zur Aufnahme gemeldet:<br />
Fa. Borsig GmbH<br />
1 Berlin 27, Berliner Straße 19-37<br />
(Schriftführer)<br />
Annamarie Hagsphil, Hausfrau<br />
1 Berlin 37, Fürstenstraße 21 a<br />
Tel. 8 Ol 82 45 (Irmtraud Köhler)<br />
Heinz Knappe, Dipl.-Ing., Mitglied des Vorstandes<br />
der Bergmann-Elektricitätswerke AG<br />
1 Berlin 12, Wilmersdorfer Straße 39<br />
Tel. 3 12 44 60 (Schriftführer)<br />
Margot Krohn, Lehrerin i. R.<br />
1 Berlin 31, Brandenburgische Straße 71<br />
Tel. 8 61 43 69 (H. Müller)<br />
Hans-Joachim Müller, Angestellter<br />
1 Berlin 20, Bollmannweg 10 (R. Mücke)<br />
Margarete Petersen<br />
1 Berlin 28, Oppenheimer Weg 7<br />
Tel. 4 01 24 07 (Dr. Schultze-Berndt)<br />
Anneliese Pinnow<br />
1 Berlin 31, Bernhardstraße 17<br />
Tel. 8 53 14 74 (Gertrud Warzecha)<br />
Hilmar Schreiber, Speditions-Kaufmann<br />
1 Berlin 37, Winfriedstraße 13<br />
(Friedburg Schreiber)<br />
Dr. Wilfried Schreiber, Regierungsdirektor i. R.<br />
29ÖMenburg, Nedderend 17<br />
(Friedburg Schreiber)<br />
Hartmut Solmsdorf, Dipl.-Ing.<br />
1 Berlin 19, Kaiserdamm 10<br />
Tel. 3 06 15 47 (Schriftführer)<br />
Leo Spik, Kunstversteigerungen<br />
1 Berlin 15, Kurfürstendamm 66<br />
Tel. 8 83 61 70 (Dr. H. Leichter)<br />
Hildegard Steffen, Rentnerin<br />
1 Berlin 61, Lobeckstraße 19/IV<br />
Tel. 6 14 25 72 (W. Mügel)<br />
Gisela Steinberg<br />
1 Berlin 20, Zweibrücker Straße 51<br />
Tel. 3 71 31 04 (Kurt Mulack)<br />
175
Veranstaltungen im IL Quartal 1976<br />
1. Dienstag, 13. April 1976, 19.30 Uhr: Filmvortrag „Vom Brandenburger Tor zum<br />
Wittenbergplatz - von Asta Nielsen zu Hans Albers". Leitung: Herr Wolf Rothe.<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
2. Sonntag, 25. April 1976, 10.00 Uhr: Spaziergang zu den Denkmälern des Tiergartens<br />
- Werke Berliner Bildhauer des 19. Jahrhunderts. Leitung: Herr Hans-Werner<br />
Klünner. Treffpunkt: Eingang zur Philharmonie (Autobus 48).<br />
3. Dienstag, 27. April 1976, 19.30 Uhr: Ordentliche Mitgliederversammlung im Bürgersaal<br />
des Rathauses Charlottenburg. Tagesordnung:<br />
1. Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes, des Kassenberichtes und Bibliotheksberichtes<br />
2. Berichte der Kassen- und der Bibliotheksprüfer<br />
3. Aussprache g''<br />
4. Entlastung des Vorstandes<br />
5. Wahl von zwei Kassenprüfern und zwei Bibliotheksprüfern<br />
6. Verschiedenes<br />
Anträge aus den Kreisen der Mitglieder sind bis spätestens 17. April 1976 der<br />
Geschäftsstelle einzureichen.<br />
Im Anschluß zeigt Herr Karl-Heinz Kretschmer einen Film über die Studienfahrten<br />
des Vereins nach Celle und Hannoversch Münden.<br />
4. Dienstag, 11. Mai 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Felix Escher:<br />
„Havelberg und Bad Wilsnack - zur mittelalterlichen Geschichte der Prignitz".<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
5. Sonnabend, 22. Mai 1976: Exkursion in die Prignitz unter der Leitung von Herrn<br />
Joachim Schlenk. Besucht werden Ritter Kahlbutz in Kampehl, Dom von Havelberg,<br />
Roland von Perleberg, Wunderbiut-Wallfahrtskirche Bad Wilsnack, Johanniter-Komturei<br />
Werben. Die Teilnahme an der Veranstaltung am 11.5.1976 ist<br />
für alle Interessenten verbindlich.<br />
6. Dienstag, 1. Juni 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Prof. Hans-Dieter<br />
Holzhausen: „E. T. A. Hoffmanns Handzeichnungen - Bilder, Karikaturen, Illustrationen".<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
7. Sonnabend, 19. Juni 1976, 10.00 Uhr: Führung zu heimischen Pflanzen im Botanischen<br />
Garten. Leitung: Herr Prof. Volkmar Denckmann. Treffpunkt: Berlin-Lichterfelde,<br />
Eingang Unter den Eichen/Begonienplatz (Autobus 48).<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek<br />
ist zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen geselliges<br />
Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 30. April, 28. Mai und 25. Juni 1976, zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
ab 17.00 Uhr.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 45 30 11. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank, 1 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Claus P.<br />
Mader; Felix Escher. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt, Bezugspreis für<br />
Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
176
A 20 377 F<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
72. Jahrgang Heft 3 Juli 1976<br />
-•*• - *<br />
< S ^K^<br />
m f<br />
/g^ :<br />
^ /<br />
ADOLF<br />
CLASSBRENNfR<br />
*'*wfek •<br />
,<br />
;<br />
• • .<br />
Foto: Ellen Brast (1969)<br />
177
Adolf Glassbrenner (1810-1876)<br />
Zum Gedenken an seinen hundertsten Todestag<br />
Von Claus P. Mader<br />
„Meine Aufregung ist furchbar. Die Barrikaden wuchsen aus der Erde; nicht nur die<br />
Männer, auch die Frauen riefen zu den Waffen - das Ereignis ist groß. Versäume ja nicht<br />
die Schilderungen derselben in den Zeitungen zu lesen und dich vor dem Volke zu<br />
beugen."<br />
Diese Zeilen stammen aus einem Brief, den Adolf Glassbrenner am 21. März 1848 an<br />
seine Frau Adele in Neustrelitz schrieb. Von dort war er zwei Tage zuvor abgereist, unmittelbar<br />
nachdem auch in Neustrelitz durch die Extrapost die „ungeheuerlichen" Revolutionsnachrichten<br />
eintrafen. Obwohl von der preußischen Regierung zur „persona non<br />
grata" erklärt und ohne Rückkehrmöglichkeit nach Berlin, hielt es ihn nicht mehr in der<br />
„Verbannung", er mußte in diesen Zeiten bei „seinen" Berlinern sein.<br />
Wer war nun dieser Adolf Glassbrenner?<br />
Er wurde am 27. März 1810 in dem Bürgerhaus „Zum fliegenden Rosse" in der Leipziger<br />
Straße geboren. Sein Vater, aus Schwaben zugezogen, war Besitzer einer kleinen<br />
Schmuckfederfabrik, deren Ertrag die vielköpfige Familie zu einer einfachen Lebensweise<br />
zwang. Das war auch der Grund, den jungen Adolf nach vierjährigem Besuch des Friedrich-Werderschen<br />
Gymnasiums 1824 als Kaufmannslehrling in eine Seidenhandlung zu<br />
geben. Doch Wissensdurst und ein unruhiges Temperament ließen ihn nicht zur Ruhe<br />
kommen. Er schrieb sich an der Berliner Universität als Schüler Hegels ein, verfaßte ab<br />
1827 Literarisches für den „Berliner Courier" von Moritz Saphir und gab 1830 den<br />
Kaufmannsberuf auf, um in noch größerem Umfang an der Zeitschrift mitzuarbeiten.<br />
Nach dem Fortgang Saphirs nach München noch im selben Jahre übernahm die „Sonntags-Gesellschaft",<br />
deren Mitglied Glassbrenner auch war, die Redaktion des „Berliner<br />
Courier". Mit dem Erscheinen des „Berliner Don Quixote" im Januar 1832 trat Glassbrenner<br />
erstmalig als Herausgeber einer eigenen Zeitschrift hervor. Obwohl diese Publikation<br />
der Unterhaltung für gebildete Stände dienen und unpolitisch sein sollte, verbot<br />
die preußische Regierung nach Ermahnungen, keine „iniuriösen Artikel" aufzunehmen,<br />
das Blatt und belegte den Herausgeber mit einem auf fünf Jahre festgesetzten Berufsverbot<br />
für ein Zeitblatt. Doch trotz finanzieller Einbußen machte sich Glassbrenner zunächst<br />
keine großen Sorgen. Er hatte schon 1832 das erste Heft „Berlin, wie es ist und -<br />
trinkt" herausgegeben und der überraschend große Erfolg veranlaßte die Buchhandlung<br />
Bechthold u. Hanfe, mit ihm einen Vertrag über weitere zwölf Hefte abzuschließen. Er<br />
scheint diesen Vertrag dann sehr schnell gebrochen zu haben, denn schon Heft V zeigt<br />
das Impressum L. F. Hermann in Berlin; Heft V, zweite Auflage, bis Heft XII Vetter u.<br />
Restosky und ab Heft XIII Ignaz Jackowitz, die beiden letzteren in Leipzig, als Verlagsträger.<br />
Mit Heft 6 dieser Reihe, dem „Guckkästner" (1834), begann auch eine ständige Zusammenarbeit<br />
Glassbrenners mit Theodor Hosemann, die sich auf eine große Anzahl von<br />
Publikationen erstreckte und zum beiderseitigen Vorteil über zwei Jahrzehnte andauerte.<br />
1836 begannen für Glassbrenner, der seine Arbeiten nun immer häufiger mit Brennglas<br />
zeichnete, sehr unerfreuliche Jahre. Durch das Verbot der Jungdeutschen im Frankfurter<br />
Bundestag (1835) war die Möglichkeit liberaler Meinungsäußerung kaum noch gegeben.<br />
178
Titelkupfer von C.Reinhardt (1847) und Th. Hosemann (1851). Die Hefte erschienen zunächst<br />
in der Expedition des Komischen Kalenders von M. Simion in Berlin, später in Hamburg im Verlags-Comptoir.<br />
Hinzu kam, daß die Zensurbehörden selbst seine vergleichsweise harmlose Serie „Berlin,<br />
wie es ist und - trinkt" nach dem sechsten Heft auf den Index setzten. So sah er sich<br />
gezwungen, wollte er als freier Schriftsteller weiter existieren, zu harmloseren Themen<br />
zu greifen. Sein „Deutsches Liederbuch" (1837), seine „Taschenbücher für ernste und<br />
heitere Poesie" (1836—1838) und die Serie „Buntes Berlin" (1837-1853) geben davon<br />
Zeugnis. Schon 1838 - nach Ablauf der fünfjährigen Sperrfrist - hatte er sich um eine<br />
neue Zeitschriftenlizenz bemüht, die ihm jedoch vom Preußischen Oberzensurkollegium<br />
mit dem Bemerken „nicht würdig" versagt worden war. Als „unverantwortlicher" Mitarbeiter<br />
verdingte er sich für einige Monate beim „Freimüthigen". Nachdem sich die<br />
Arbeitsbedingungen weiter verschlechterten, ging er 1841 mit seiner Frau, der Wiener<br />
Schauspielerin Adele Peroni, nach Neustrelitz, wo dieser ein lebenslängliches Engagement
an der dortigen Hofbühne angetragen worden war. Zuvor hatte die Intendanz des Berliner<br />
Königstädtischen Theaters nach der Heirat (1840) der inzwischen bekannt gewordenen<br />
„Peroni" mit dem „berüchtigten" Volksaufwiegler und Zeitungsliteraten Glassbrenner<br />
den Vertrag gelöst.<br />
Obwohl die Jahre in Neustrelitz für ihn im persönlichen Bereich recht niederdrückend<br />
waren, sank er nicht - wie so mancher Jungdeutsche - zum Renegaten ab. Ja, er entwickelte<br />
sich in dieser Zeit zu einem typischen Vertreter des Vormärz, dessen Waffen die<br />
Satire und das Tendenziöse waren. Hier seien als Beispiel seine „Neuen Berliner Guckkastenbilder"<br />
(1841), die „Verbotenen Lieder" (1844) oder „Herrn Buffey's Wallfahrt<br />
nach dem heiligen Rocke" (1845) aufgeführt. Auch die Texte in „Berlin, wie es ist und -<br />
trinkt" und im „Neuen Reineke Fuchs" werden schärfer und stehen denen eines Herweg!?,<br />
Freiligrath oder Dingelstedt an politischer Entschiedenheit in nichts nach. Weitere, mehr<br />
oder weniger politische Schriften, so z.B. der „Komische Volkskalender" (1846-1854)<br />
und die dreibändige Sammlung „Berliner Volksleben" (1847) runden die Arbeit eines<br />
schriftstellerisch recht fruchtbaren Lebensabschnittes ab. Wiederholt hatte Glassbrenner<br />
1847 versucht, von der preußischen Regierung die Genehmigung zum Besuch seiner Vaterstadt<br />
Berlin zu erhalten, doch vergebens. Jetzt im März 1848 nahm er sich diese Freiheit.<br />
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war Berlin ohne literarische Bedeutung. Zwar gab es<br />
auf der einen Seite den zum königlichen Hof orientierten Kreis der Spätromantiker, darunter<br />
Tieck, auf der anderen Seite den skurrilen Amateursalon des „Tunnels über der<br />
Spree", in dem der junge Fontane immerhin seine ersten bescheidenen Erfolge feiern<br />
konnte. Der „Realismus" der speziellen Berliner Posse ging eigene Wege; der Kreis der<br />
Vaudeville-Autoren war beträchtlich, wenngleich überwiegend von mittelmäßigen Talenten<br />
bestimmt, deren Produktion dem Bedürfnis nach Unterhaltungslektüre und -Schauspiel<br />
offenbar sehr entgegenkam und daneben im Publikum eine Atmosphäre schuf, die<br />
auch für den treffsicheren politischen Witz einen guten Nährboden abgeben sollte. Ansonsten<br />
aber herrschte Windstille, nur unterbrochen vom Sturm der Revolution von 1848,<br />
deren politische Erfolge den Possendichtern und Satirikern mit Hilfe der errungenen<br />
Pressefreiheit ein großes und dankbares Betätigungsfeld verschafften. Die Berliner Presse<br />
und das entstehende moderne Journalistentum gewannen auch für das literarische Leben<br />
der Stadt entscheidende Bedeutung. Einige der besten Köpfe, die damals in Witz, Satire<br />
und Ironie auch zugleich die „tiefere Bedeutung" einzuflechten vermochten, wagten sich<br />
in das bewegte Fahrwasser der neuen Publizistik.<br />
Unmittelbar nach seiner Ankunft in Berlin schloß Glassbrenner mit dem Berliner Verleger<br />
M. Simion am 24. März einen Vertrag, der die Herausgabe einer wöchentlichen<br />
Zeitschrift zum Inhalt hatte. Die Konditionen waren günstig, denn Glassbrenner erhielt<br />
für die redaktionelle Mitarbeit vier und für eigene Beiträge zwanzig Taler je Ausgabe,<br />
deren Umfang auf vier Quartseiten festgelegt wurde. Obwohl mit der Arbeit sofort begonnen<br />
wurde, konnte der 1. Mai als Erscheinungstag der ersten Nummer nicht eingehalten<br />
werden. Erst am 6. Mai erschien diese unter dem Titel „Freie Blätter, illustrirte<br />
politisch humoristische Zeitung". Unter dem Motto: „Der Staat sind wir" wollten auch<br />
sie sich an der Revolution beteiligen und es auf politischem und literarischem Gebiet all<br />
jenen Schriften gleichtun, deren Geburt ebenfalls in diesen Tagen lag. Aus der Vielzahl<br />
seien nur einige der wichtigeren genannt: „Berliner Charivari", der monatlich erschien<br />
180
Erste Umschlagseite von Heft 14 aus dem Jahre Titelblatt<br />
1852. Zeichnung von Th. Hosemann<br />
und zu seinen Mitarbeitern u. a. Tb. Hosemann und W. Scholz zählen konnte, ferner die<br />
„Locomotive", der „Berliner Krakehler", „Die ewige Lampe", „Der Demokrat", „Tante<br />
Voss mit dem Besen", „Berliner Großmaul" und der „Kladderadatsch". Allein dieses<br />
„Organ für und von Bummler" konnte sich - obwohl zu Beginn mit den gleichen Schwierigkeiten<br />
kämpfend - über neunzig Jahre behaupten, ehe es 1944 nur noch als „ein Schatten<br />
seiner selbst" entschlief. Alle anderen genannten und noch mehr die ungenannten<br />
Zeitschriften, Blättchen oder Flugblätter belebten zwar die Szenerie, konnten dieser aber<br />
keine allzu nachhaltigen Impulse verschaffen.<br />
Auch die „Freien Blätter" machten da keine Ausnahme. An der Spitze der einzelnen<br />
Nummern, deren Wert sehr ungleich war, befanden sich ein oder mehrere längere Artikel.<br />
Scherzhafte Gedichte und zum Schluß ein Feuilleton aus teilweise recht boshaften Nach-<br />
181
ichten und Bemerkungen komplettierten den Inhalt. Trotz des Vermerks im Titel fand<br />
der Leser nur vereinzelte Illustrationen. Glassbrenner schrieb zunächst fast alle Artikel<br />
selbst. Erst ab Heft 9 (1. Juli 1848) wird noch Ernst Kossak als Mitredakteur genannt,<br />
doch wurden dessen Beiträge bald sehr spärlich. Unterdessen verschob sich die politische<br />
Lage zugunsten der Reaktion. So erschienen die Blätter im August und September wegen<br />
Arbeitseinstellung der Setzer und Drucker nur unregelmäßig. Im November und Dezember<br />
trat eine Pause ein, und mit Heft 56, das, wie die Ausgaben der letzten Monate, bei<br />
Reclam in Leipzig gedruckt wurde, stellte das Blatt sein Erscheinen ein: Wrangel hatte<br />
es verboten.<br />
Neben dieser Arbeit hatte Glassbrenner während der letzten Monate noch ein Heftchen<br />
„Neue Volkslieder nach alten Melodien" herausgegeben und versucht, eine Kandidatur<br />
für die Deutsche Nationalversammlung zu erhalten. Sein Programm wurde jedoch von<br />
mehreren Seiten in der Presse so stark angegriffen und fand auch bei „seinen Berlinern"<br />
so geringe Unterstützung, daß sein Name auf der offiziellen Wahlliste nicht mehr aufgeführt<br />
wurde. Ein Flugblatt ist von ihm bekannt, welches aus den Tagen des Sturmes<br />
auf das Zeughaus zu stammen scheint und in dem er die „armen Arbeiter, Landleute und<br />
Bürger Deutschlands" zur Ruhe ermahnte.<br />
Mit dem Sieg der Reaktion und um einer Inhaftierung zu entgehen, zog er sich nach Neustrelitz<br />
zurück. Hier wählten ihn die fortschrittlichen Kräfte gemeinsam mit dem Strelitzer<br />
Sprachforscher Daniel Sanders zum Führer des Reformvereins und der demokratischen<br />
Partei in Mecklenburg-Strelitz. Als am 9. November 1848 Robert Blum als Teilnehmer<br />
an den Kämpfen in Wien wegen seines „Freisinns" und als „Führer der Linken"<br />
zum Tode verurteilt und erschossen wurde, nahm sich Glassbrenner dieser Sache publizistisch<br />
u. a. in den „Blättern für freies Volkstum" an. Dieses Engagement und seine<br />
Aufsätze z. B. im „Komischen Volkskalender" und im „März-Almanach" führten mit zur<br />
Ausweisung durch die Behörden. 1850 ging er nach Hamburg.<br />
In den nun folgenden Jahren bis 1856 erschienen kleinere Beiträge in den verschiedenei:<br />
Zeitschriften, weitere Hefte einiger seiner Reihen und Kinderbücher wie „Lachende Kinder",<br />
„Insel Marzipan" oder „Sprechende Tiere". Mehrere Reisen und Vorträge vervollständigen<br />
das Programm jener sechs Jahre.<br />
Erst 1856 wandte er sich wieder einer redaktionellen Arbeit zu, doch dauerte es bis zum<br />
April 1857, bis er für den „Ernst Heiter" verantwortlich zeichnete. Schon wenige Nummern<br />
danach belegte die Regierung dieses Blatt mit Zensurauflagen. Glassbrenner ließ<br />
deshalb dieses Periodikum eingehen und gründete als Nachfolgeschrift den „Phosphor",<br />
dem aber gleichfalls nur eine Lebensdauer von 27 Heften beschieden war. Unterdessen<br />
hatte Glassbrenner sich dem Berliner Verleger Hoff mann verpflichtet und vertragsmäßig<br />
die Leitung der Montagszeitung „Berlin" übernommen. Die hiesigen Behörden hatten zuvor<br />
den Publizisten wissen lassen, daß ihm, bei noch längerem Verweilen außerhalb der<br />
preußischen Residenz, die Heimatberechtigung verlorengehen würde. So kehrte er zu<br />
Beginn des Jahres 1858 nach Berlin zurück, wo er sich nach eigenen Aussagen wie ein<br />
Fremder vorkam. Zuviel hatte sich in den vergangenen sechs Jahren verändert.<br />
Glassbrenner konzentrierte sogleich seine ganze Arbeitskraft auf diese neue Aufgabe.<br />
Literatur und Theater waren seine Lieblingsthemen, die Politik nur noch soweit, wie sie<br />
vom Schreibtisch aus erledigt werden konnte. In einem Brief schrieb er 1859 an F. Wehl:<br />
„Ich konzentriere alle meine Kräfte auf ,Berlin', auch ehrlich gestanden, um mir vielleicht<br />
für mein Alter einen materiellen Halt zu schaffen". Und an anderer Stelle des Briefes<br />
182
fährt er fort: „Die Herren vom ,Kladderadatsch' verdienen jährlich mit leichter Mühe<br />
ihre 3- bis 4000 Thaler. Kaiisch über 8000 Thaler! Was haben wir?"<br />
Nun, zunächst nichts! Die Zeitschrift geriet in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Mehrmals<br />
wechselte sie den Verleger und den Titel, ehe sie Ende der sechziger Jahre als „Berliner<br />
Montags-Zeitung" in Glassbrenners Verlag erschien und nach einigen Jahren für ihn eine<br />
gute Rendite abwarf. Diese Redaktion blieb endlich seine einzige Tätigkeit und erforderte<br />
kaum große Anstrengung, zumal ab 1860 Schmidt-Cabanis Mitredakteur war und<br />
ihm den überwiegenden Teil der Arbeit abnahm.<br />
Kurz ist die Liste der weiteren Publikationen aus diesem letzten Lebensabschnitt: „Humoristische<br />
Plauderstunden", „Burleske Novellen", eine Neuauflage von Saphirs „Konversationslexikon<br />
für Geist, Witz und Humor" in fünf Bänden und die „Neuen Gedichte".<br />
Am Sonnabend, dem 23. September 1876 verstarb er nach einem bewegten Leben in seiner<br />
Berliner Wohnung. Eine große Menschenmenge, die Vertreter der Presse und die<br />
Berliner Schriftstellerwelt hatten sich am Dönhoffplatz eingefunden, um einem der Ihren<br />
das letzte Geleit zu geben.<br />
Adele Glassbrenner machte Schmidt-Cabanis zum Hauptredakteur und führte unter<br />
finanziellen Verlusten die „Berliner Montags-Zeitung" bis zum Februar 1884 weiter, ehe<br />
sie sich schließlich genötigt sah, an das mächtig aufstrebende Mossesche „Berliner Tageblatt"<br />
zu verkaufen. Am 31. Juli 1895 starb sie 82jährig. An der Seite ihres Mannes<br />
wurde sie auf dem dritten Friedhof der Jerusalems-Gemeinde beigesetzt, in unmittelbarer<br />
Nähe E. T. A. Hoffmanns, Adelbert von Chamissos und vieler anderer Vertreter von<br />
Kunst und Wissenschaft des alten Berlins.<br />
Nach diesem kurzen Blick auf Glassbrenners Vita und seine Opera soll zum Schluß dieser<br />
Würdigung noch der Versuch unternommen werden, die Frage nach seinem politischen<br />
Konzept zu beantworten. Es läßt sich relativ leicht auf einen Grundnenner bringen.<br />
Glassbrenner, der - wie fast alle jungen Liberalen jener Jahre - in seinen Anfängen unter<br />
dem Einfluß des „Jungen Deutschland" stand, gehörte zum fiörwe-Flügel dieser Bewegung.<br />
Ihm war der Heine-Flügel zu weit vom Volkstümlichen entfernt. Auch aus sozialen<br />
Gründen hielt er es mehr mit einem kleinbürgerlichen Demokratieverständnis, welches<br />
auf einen engagierten politischen Tageskampf hinzielte. So erschöpfte sich auch seine<br />
Politik in ununterbrochener Propaganda. Er hoffte dadurch den deutschen „Michel" zu<br />
einer spontanen Tatgesinnung für die Ideale der Demokratie zu begeistern. Anders als<br />
zum Beispiel Gutzkow, Laube und Mundt, die im Verlauf der zeitlichen Ereignisse immer<br />
vorsichtiger wurden, griff Glassbrenner zu der literarischen Waffe. Unerbittlich drängte<br />
er auf einen Umbruch der bestehenden Verhältnisse. Dieser sollte aus dem politischen<br />
Zusammenschluß von Kleinbürgern, Handwerkern und Arbeitern hervorgehen. Anhaltende<br />
Verbote seiner Schriften und sogar die Ausweisung aus Berlin konnten ihn nicht<br />
von seiner Grundauffassung abbringen. Gerade die Publikationen aus den Jahren 1844<br />
bis 1848 waren voller offener Revolutionsbereitschaft. Als sich dann die langgehegten<br />
Hoffnungen zerschlugen, erging er sich noch einmal in literarischen Zornesausbrüchen<br />
gegen das Unvermeidbare, um dann - wie viele andere auch - allmählich zu resignieren.<br />
Die nun einsetzende politische Entwicklung blieb Glassbrenner weitgehend fremd. Zwar<br />
183
war er noch immer gegen die „Rrrreaktion" und gegen Bismarck und die fortschreitende<br />
Militarisierung Preußens, doch fehlte es ihm an Alternativen. Ohne den Weitblick für<br />
das Überregionale in der Politik verstand er die wirtschaftlichen und die gesellschaftlichen<br />
Wandlungen der folgenden Jahrzehnte nicht mehr; Glassbrenner war eben kein Politiker.<br />
Betrachten wir nun noch die Form seiner politischen Agitation. Es waren neben den Zeitungen<br />
und Zeitschriften vor allem jene Druckerzeugnisse, die bis in unsere Zeit nur selten<br />
Eingang in die Literatur gefunden haben: die sogenannten Dreigroschenhefte. Er ließ<br />
seine Texte, meist mit tagespolitischem Hintergrund, durch eine Reihe von Berliner Volkstypen<br />
vortragen, die er sich aus der Realität seiner täglichen Umgebung auslieh. Klatschbasige<br />
alte Weiber, Fuhrleute, besoffene und politisierende Eckensteher, Hökerinnen,<br />
Nachtwächter und Dienstmädchen belebten die Szenerie der Straßen, Märkte, Läden und<br />
Kneipen und schufen so mit ihrer ihnen in den Mund gelegten dialektischen Schnoddrigkeit<br />
und mit ihrem entlarvenden Witz jenen freien Spielraum, der notwendig schien, um<br />
Tagesprobleme unterzubringen. Dies wurde von Glassbrenner glänzend gemacht.<br />
Nach seinem Tode geriet auch er über Jahrzehnte in Vergessenheit. Erst zu Beginn<br />
unseres Jahrhunderts erschienen wieder Texte und auch vereinzelt Anthologien seiner<br />
Werke - selten jedoch mit annehmbaren Kommentaren. So bleibt bis zum heutigen Tage<br />
die Frage offen: Glassbrenner - ein kleinbürgerlich-demokratischer Börne-Anhänger und<br />
politisierender Volksdichter oder nur ein „umwerfender" Humorist? Die bislang vorliegende<br />
Sachliteratur ist unzureichend und widersprüchlich.<br />
Literaturhinweise<br />
Robert Rodenhauser: Adolf Glassbrenner. Ein Beitrag zur Geschichte des „Jungen Deutschland"<br />
und der Berliner Lokaldichtung. Nikolassee: Max Harrwitz 1912.<br />
Willi Finger: Adolf Glassbrenner. Ein Vorkämpfer der Demokratie. (Ost-)Berlin: Kongreß-<br />
Verlag 1952.<br />
Adolf Glassbrenner: Der politisierende Eckensteher. Auswahl und Nachwort von Jost Hermand.<br />
Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1969. (Universal-Bibliothek Nr. 5226-28).<br />
(Die aufgeführten Bücher verfügen über weiterreichende Literaturhinweise.)<br />
184
Friedhofskapelle<br />
Aufnahme vom 1. 7. 1939<br />
aus dem Ardiiv des Autors<br />
Der jüdische Friedhof in Spandau im 19. und 20. Jahrhundert<br />
Von Jürgen Grothe<br />
Ein schwieriges Kapitel in der Spandauer Geschichte ist eine Chronik der jüdischen Friedhöfe.<br />
Bereits 1324 wird ein „Juden Kiewer" in Spandau genannt. Herzog Rudolph von<br />
Sachsen überließ der Stadt einen Hof, mit allen Rechten und Freiheiten, den ein „Nicolaus<br />
Toepper gehabt" und der neben dem „Juden Kiewer" lag. Die bisherige Meinung,<br />
daß dieser Begräbnisplatz bis 1510 bestand und dann innerhalb eines Pogroms eingeebnet<br />
wurde, ist nicht mehr haltbar. Man war bisher der Ansicht, die Steine wurden um<br />
1520-1523 beim Umbau der Burg als Baumaterial verwendet. Seit 1957 konnten in der<br />
Zitadelle in den Wänden des Palas sowie in Mauerteilen südlich und östlich des Gebäudes<br />
über 30 jüdische Grabsteine freigelegt werden; die bis jetzt identifizierten sind von<br />
1244-1347 datierbar. Da sie teilweise direkt auf dem Eichenpfahlfundament des Palas<br />
auflagen, ist auch eine Datierung des Palas heute möglich: Er muß um 1350 in gotischen<br />
Formen erbaut oder umgebaut worden sein. Für diese Datierung spricht ebenfalls ein<br />
gotisches Portal, das im Juli 1971 an der Nordseite freigelegt werden konnte. In seiner<br />
185
gedrückten Form kann es in die Mitte des 14. Jahrhunderts gehören. Bis heute ist ungeklärt,<br />
aus welchem Grund zu ebendiesem Zeitpunkt der jüdische Friedhof in Spandau<br />
eingeebnet wurde. 1428 wird der „Juden Kiewer" erneut genannt. Er war Eigentum der<br />
Stadt und die Juden mußten eine jährliche Abgabe für die Benutzung zahlen. Er diente<br />
auch Berliner Juden als Begräbnisplatz. Die Lage dieses Friedhofes ist bis heute unbekannt<br />
geblieben.<br />
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts besaßen die Spandauer Juden keinen eigenen<br />
Friedhof. Sie begruben ihre Toten in Berlin. Eine Angliederung der Spandauer an die<br />
Berliner Synagogengemeinde lehnten die Berliner aus finanziellen Gründen ab. 1854<br />
wollte die Potsdamer Regierung für die Spandauer Gemeinde einen Friedhof anlegen.<br />
Wegen der zu erwartenden Kosten lehnten die Spandauer Juden ihrerseits dieses ab.<br />
1859 kaufte man dennoch eine Fläche Forstland in den Schülerbergen. Im Spandauer<br />
Grundbuch findet sich dazu folgende Eintragung: „Der jüdische Ortsverband zu Spandau<br />
hat von der Stadtgemeinde zu Spandau und zwar von dem vor dem Oranienburger Tor<br />
belegenen Forstgrunde, die Schülerberge genannt, für welche ein Folium im Hypothekenbuche<br />
noch nicht besteht, die auf dem Titelblatte I verzeichnete Parzelle von 96 Quadratruten<br />
Flächeninhalt mittels Vertrages vom 24. Februar/7. Juli 1859, notariell anerkannt,<br />
den 13. April 1865 für 35 Thaler zu einem Begräbnisplatz erworben und ist der Titel<br />
auf Grund des Attestes des Magistrats zu Spandau vom 18. Juli 1865 über den mehr als<br />
zehnjährigen Besitzstand der Stadtgemeinde zu Spandau und des obigen Vertrages berichtigt<br />
worden zufolge Verfügung vom 30. September 1865."<br />
Die Schülerberge bildeten eine Hügelkette, die sich von der Havel an der Schützenstraße<br />
bis zur Schönwalder Straße erstreckte. Sie wurde für den Bau der Artillerie-Wagenhäuser,<br />
der im Februar 1872 begann, abgetragen. Der Militärfiskus wollte dazu auch das<br />
jüdische Friedhofsgelände, das nördlich der heutigen Neuen Bergstraße lag, erwerben.<br />
Die Gemeinde verkaufte das Gelände indes nicht. Da der Friedhof sich jetzt innerhalb<br />
des Areals der Artillerie-Wagenhäuser befand, pachtete man vom Militärfiskus, gegen<br />
eine Anerkennungsgebühr von 1,- Mark jährlich, einen Geländestreifen als Zugang. 1907<br />
wurde eine provisorische Leichenhalle errichtet und 1913 ein massiver Neubau nach Plänen<br />
des Architekten Adolf Steil, den die Firma Haertner-Herfarth ausführte.<br />
Nach dem ersten Weltkrieg kaufte die Gemeinde, nach Verhandlungen mit dem Reichswehrministerium,<br />
vom Fiskus ein Gelände von 500 qm zur Vergrößerung des Friedhofes.<br />
Der Vertrag war auf den 20. Juni 1923 datiert, 400 000 Mark waren zu zahlen.<br />
Eine Mauer grenzte den Friedhof gegen das militärfiskalische Gelände ab. 1939 mußte<br />
die Begräbnisstätte aufgegeben werden; sämtliche Gräber wurden nach Berlin-Weißensee<br />
umgebettet und das Gelände vom Heereszeugamt genutzt. Den ursprünglichen Zugang<br />
auf den Friedhof mauerte man zu. Er ist heute gegenüber dem Eingang zum Stadt.<br />
Krankenhaus an der Lynarstraße noch erkennbar.<br />
Auf den Friedhof führte ein Doppelportal für Fußgänger und Leichentransportwagen.<br />
Den Zufahrtsweg säumten Rasenstreifen. Am Weg stand ein fensterloser Geräteschuppen<br />
für den Transportwagen und die Geräte für die Bestattung. Der Bau war aus genuteten<br />
Brettern zusammengefügt und mit einem grünen Anstrich versehen. Das Dach zeigte eine<br />
Walmkonstruktion. Wilder Wein rankte an den Wänden empor.<br />
Am Ende des Weges stand die Leichenhalle, ein Rundbau aus Ziegelsteinen mit grauem<br />
Edelputz verkleidet. Das als Kuppel ausgebaute Dach war mit Kupferplatten belegt, die<br />
durch ihre Oxydation dem Bau den typischen Farbakzent gaben. Die bleiverglasten Fen-<br />
186
Eingang zur<br />
Fricdhofskapclle<br />
Aufnahme vom 1. 7. 1939<br />
aus dem Archiv des Autors<br />
ster zeigten jeweils eine andere Gestaltung, aber ohne figürliche Darstellung. Das nach<br />
Westen gerichtete enthielt als beherrschendes Motiv den Davidstern, das gegenüberliegende<br />
besaß eine einfache Aufteilung von drei gleichmäßig geformten und gefärbten<br />
Rillenglasscheiben. An den Rundbau waren im Nordosten und Südwesten je ein halbrunder<br />
Bau angefügt, der die Formen des Hauptbaues wiederholte. Auch die Dachdeckung<br />
und Gliederung der Fenster entsprach der des Hauptbaues. Den Eingang betonten<br />
zwei halbrunde Säulen, auf denen ein dreieckiger Giebel mit eingelegtem Davidstern<br />
ruhte. Das Portal aus Eichenholz besaß in der Mitte ein ovales Fenster, das durch einen<br />
Davidstern aus Holz gegliedert war. Drei Stufen aus handgestrichenen Verblendern, von<br />
zwei gebogenen, einfachen schmiedeeisernen Gittern flankiert, führten in den Innenraum.<br />
1939 wurde der Bau abgerissen.<br />
Ansdirift des Verfassers: 1 Berlin 20, Kellerwaldweg 9<br />
187
Nachrichten<br />
Mitgliederversammlung 1976<br />
Die Ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins am 27. April 1976 im Bürgersaal des Rathauses<br />
Charlottenburg wurde in Vertretung des durch einen Empfang des Senats von Berlin verhinderten<br />
Vorsitzenden, Professor Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm, vom Schriftführer, Dr. H. G.<br />
Schultze-Berndt, eröffnet und mit den Regularien eingeleitet. Nach seinem Eintreffen konnte<br />
Professor Ho ff mann-Axthelm dann die Ehrung der Toten vornehmen. Seit der letzten Hauptversammlung<br />
sind die folgenden Mitglieder verstorben, deren die Versammlung mit einer Schweigeminute<br />
gedachte: Professor Dr. Walter Artelt, Herbert Bantelmann, Magdalena Beilee, Dr.<br />
Albert Brandes, Professor Dr. Wilhelm Moritz Freiherr von Bissing, Dr. Joachim Härtel, Ernst<br />
Hartmann, Friedel Holtz, Walter Marziellier, Annemarie Neitzel, Adolf Persdike, Dr. Kurt<br />
Sdimeisser, Dr. Fritz Taute, Lucia Winter, Herbert Wollstein, Arno Wagner, Susanne Heller.<br />
Der Tätigkeitsbericht lag der Versammlung schriftlich vor; er wird im Jahrbuch 1976 „Der Bär<br />
von Berlin" abgedruckt werden. Auch der Kassenbericht sowie der Voranschlag für 1976 waren<br />
schriftlich vorgelegt worden. Der Schatzmeister, Frau R. Koepke, erläuterte die einzelnen Positionen.<br />
Ausdruck des engen Zusammengehörigkeitsgefühls der Betreuer der Bibliothek war die Tatsache,<br />
daß der Bibliotheksbericht diesmal von H. Schiller erstattet wurde. Aus den Berichten der<br />
Kassenprüfer Mulack und Kretschmer (von diesem verlesen) und der Bibliotheksprüfer Kemnitz<br />
und Schlenk (von Schlenk vorgetragen) ergaben sich die Sorgfalt in der Arbeit der ehrenamtlich<br />
tätigen Kräfte und die Ordnungsmäßigkeit ihrer Handlungen. In der Aussprache wurde von<br />
K. Pierson unter Hinweis auf den Tätigkeitsbericht die weitergehende Zerstörung des Stadtbildes<br />
von Berlin bedauert (H. Müller vertrat ein ähnliches Anliegen) und die Möglichkeit diskutiert,<br />
vom Verein aus dieser Entwicklung zu wehren. Landgerichtsrat a. D. Rechtsanwalt D. Franz beantragte<br />
die Entlastung des Vorstandes, der einmütig zugestimmt wurde. Für den auf eigenen<br />
Wunsch nicht mehr kandidierenden Kassenprüfer Mulack wurde das Mitglied Degenhardt neu<br />
gewählt und der bisherige Kassenprüfer Kretschmer in seinem Amt bestätigt. Nach dem Verzicht<br />
des Mitgliedes Kemnitz wurden die Mitglieder Mende und Schlenk gleichfalls einstimmig zu<br />
Bibliotheksprüfern gewählt.<br />
Weitere Fragen in der zügig abgewickelten Jahreshauptversammlung galten dem Jahrbuch „Der<br />
Bär von Berlin", den historischen Stätten in Charlottenburg im Hinblick auf die Tätigkeit der<br />
Eosander-Gesellschaft sowie den künftigen Veranstaltungen des Vereins. Freundlicher Ausklang<br />
der Mitgliederversammlung waren Filme, die das Mitglied Kretschmer auf den Studienfahrten<br />
nach Celle und nach Hann.-Münden gedreht hatte. Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung gehörten<br />
dem Verein 827 Mitglieder an. H. G. Schultze-Berndt<br />
Themenheft „Städte + Landschaften"<br />
Das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel bringt als Heft 32 T vom 22. April 1976 zum<br />
ersten Mal ein Themenheft unter dem Titel „Städte 4- Landschaften" heraus. Es gilt zu einem<br />
sehr großen Teil der Stadt Berlin. Namhafte Autoren schreiben nicht nur über Buchhandlungen<br />
und Verlage, Bücher und Autoren, Bibliotheken, Fachorganisationen und Vereinigungen, sondern<br />
sie versuchen vielmehr durch einzelne Beiträge die Berliner Kulturlandschaft aufzuzeigen. So widmet<br />
Robert Wolf gang Schnell seinen Aufsatz der Berliner Kneipenkultur; Ilse Nicolas schreibt<br />
über Berliner Friedhöfe; Detlev Meier berichtet über die „Vernichtung" von Kreuzberg; Professor<br />
Friedrich Luft zieht eine kritische Bilanz der Schauspielbühnen unserer Stadt, und Dr. Lucie<br />
Schauer stellt Museen, Maler und Galerien vor. Aber auch der Deutsche Verein für Kunstwissenschaft<br />
und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz fehlen nicht.<br />
In einem Grußwort spricht der Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Schütz, dem Börsenblatt<br />
seinen Dank aus. Er weist darauf hin, daß die Berliner seit je ein lesefreudiges Publikum<br />
gewesen sind, die sich über Zuspruch freuen, aber auch überzeugende Kritik gern entgegennehmen.<br />
Jährlich werden allein in den öffentlichen Büchereien unserer Stadt mehr als 11 Millionen Bücher<br />
ausgeliehen - Zahlen, die in Europa nur schwer zu überbieten sind, stellt man dieser Menge die<br />
zwei Millionen Mitbürger gegenüber. CPM<br />
*<br />
Vom 11. bis zum 26. September dieses Jahres stellt die Arbeitsgruppe Berliner Architektur-Maler<br />
in Spandau im Schützenhof, Niederneuendorfer Allee 12-18, Spandauer Motive aus.<br />
188
Ein Bachfest in Berlin<br />
Es ist erfreulich, daß auch die Neue Bachgesellschaft den Weg wieder nach Berlin gefunden hat,<br />
um nach 75 Jahren auf Einladung der Stadt ihr 51. Bachfest vom 25. bis 30. August 1976 zu<br />
feiern. In Berlin finden jährlich Bachtage statt, die in diesem Jahr als „Das Fest der Neuen Bachgesellschaft"<br />
gelten.<br />
Das Musikgeschichtsbild Johann Sebastian Bachs und seine Rezeption der doppelchörigen Kompositionsweise<br />
sind Thematik dieser Tage. „Bachs Fundament ,aller gottgefälliger Kirchen-<br />
Musik'" heißt ein Vortrag der Baseler Musikwissenschaftlerin Helene Werthemann. Der Göttinger<br />
Musikwissenschaftler Alfred Dürr spricht über „Das Bachbild im 20. Jahrhundert". International<br />
sind die Interpreten der Bach-Konzerte, Messen, Kantaten, Lobgesänge usw., die - laut Programm<br />
- in vielen Festsälen und in Kirchen (hier Eintritt frei) zu Gehör kommen. Von besonderer<br />
Art ist ein Konzert mit dem Collegium Musicum Judaicum und der Choralschola der Benediktinerabtei<br />
Maria Laach. Beide Chöre treten zum ersten Male in einem weltlichen Rahmen,<br />
d. h. in der Hochschule der Künste gemeinsam mit dem Staats- und Domchor Berlin auf. Viele<br />
Berliner Chöre, aber auch der Monteverdi-Chor Hamburg und die Camerata Accademica Hamburg,<br />
sind für die Festkonzerte vorgesehen.<br />
Von ganz besonderem Interesse für die Mitglieder des Vereins für die Geschichte Berlins wird<br />
neben den Konzerten die Ausstellung im Musikinstrumentenmuseum des Staatlichen Instituts für<br />
Musikforschung Preußischer Kulturbesitz an der Bundesallee sein, die am 25. August um 17 Uhr<br />
mit der Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen" eröffnet wird. Im Programm heißt es dazu:<br />
„Bachs Besuche in Berlin und Potsdam und sein Nachwirken in der Berliner Musikgeschichte bilden<br />
die Grundlage für eine zeitgeschichtliche, auch klingende Übersicht aus Noten, Briefen,<br />
Tageszeitungen, Bildern und historischen Instrumenten aus Berlin und Potsdam. Ein reich bebilderter<br />
Ausstellungskatalog wird die Berliner Musikgeschichte zur Zeit Bachs und einige Fragen<br />
des Nachwirkens dokumentarisch belegen."<br />
„Meine Herren, der alte Bach ist gekommen!" Das waren die Worte Friedrichs des Großen, als<br />
ihm Bachs Besuch angesagt wurde. Freude und Genugtuung, aber auch ehrfürchtige Erwartung<br />
spürt man aus diesen Worten, die zugleich den Titel der jetzigen Ausstellung bilden. Gleichgültig<br />
mögen Ort und Zeit sein - wo Bach angesagt wird, erfüllt die Menschen immer wieder dieselbe<br />
ehrfürchtige und freudige Erwartung. Über das Bachfest der Neuen Bachgesellschaft können weitere<br />
Einzelheiten erfragt und auch Karten vorbestellt werden im Organisationsbüro: 1 Berlin 12<br />
(Charlottenburg), Knesebeckstraße 32. Lucie Brauer<br />
Wiederaufbau am Gendarmenmarkt<br />
Wie aus der in Ost-Berlin erscheinenden Tageszeitung „Der Morgen" vom 25. Mai 1976 zu erfahren<br />
ist, sollen die den Gendarmenmarkt - seit 1951 Platz der Akademie genannt - umrahmenden<br />
Bauten von 1978 an wiederaufgebaut werden. Dies betrifft sowohl den Französischen als auch<br />
den Deutschen Dom, die frühere Heimstatt des Vereins für die Geschichte Berlins. Das von<br />
Schinkel errichtete ehemalige Königliche Schauspielhaus wird zu einem Konzerthaus umgestaltet.<br />
Die im Norden, Süden und Osten noch klaffenden Lücken in der Umgebung werden geschlossen,<br />
wobei auch ein neuer Standort für die Akademie der Künste gefunden wurde. Neben den beiden<br />
historischen Gaststätten Lutter und Wegner und Cafe Bauer, die neu erstehen sollen, werden<br />
kleine Boutiquen den Platz beleben, der nach Westen hin in gelockerter Form zum Fußgängerboulevard<br />
der Friedrichstraße überleiten soll. Das Ensemble des Gendarmenmarktes wird zur<br />
Fußgängerzone umgebildet, der Platz selbst mit Bäumen und Bänken belebt.<br />
Im Komplex von Schloß Glienicke hatte sich der als dritter Sohn des Königs Friedrich Wilhelm<br />
III. und der Königin Luise am 29. Juni 1801 in Charlottenburg geborene Prinz Friedrich<br />
Karl Alexander von Preußen im Zusammenwirken mit seinen Baumeistern Schinkel, Persius und<br />
von Arnim in den Jahren von 1824 bis 1850 eine aus einer Barockanlage hervorgegangene Heimstatt<br />
für seine Kunstsammlungen geschaffen. Hier entstand im Biedermeier, dem Übergang von<br />
der Geistigkeit der Romantik zum Realismus, ein heiteres Abbild des Südens in der Mark, das<br />
an der Havel noch heute durch den Zusammenklang von Natur und Kunst verzaubert, weil es<br />
zugleich das Lebensgefühl dieser Epoche vermittelt. 150 Jahre nach dem Umbaubeginn des Hauptgebäudes<br />
durch Schinkel 1826 werden im kommenden Oktober die „Musischen Wochen in Glienicke"<br />
eröffnet, die auch weiterhin jeweils von Oktober bis zum Januar durchgeführt werden<br />
189
sollen. An jedem zweiten Sonnabend eines Monats werden um 16.00 Uhr Veranstaltungen Kunst<br />
und Kultur der Mark Brandenburg in dieser reizvollen Atmosphäre widerspiegeln. Weihnachtsausstellungen<br />
bildender Künstler werden das Programm vervollständigen, das rechtzeitig in Glienicke<br />
und in der Tagespresse bekanntgegeben werden wird.<br />
Um die Denkmalpflege in Ost-Berlin<br />
Nach Ausführungen der Ost-Berliner Zeitung „Der Morgen" vom 10. März 1976 wird gegenwärtig<br />
eine Bezirksdenkmalliste für Ost-Berlin entworfen, auf der ebenso wie auf der zentralen<br />
Denkmalliste rund 350 Objekte von historischem Wert stehen, die erhalten werden müssen. Im<br />
einzelnen werden aufgeführt das „Lindenensemble", das Deutsche Theater und das Berliner Ensemble<br />
(Theater am Schiffbauerdamm), der Wasserturm in der Knaackstraße im Bezirk Prenzlauer<br />
Berg, der sogenannte Magistratsschirm in der Schönhauser Allee und schließlich auch das<br />
Hochhaus an der Weberwiese als, wie es heißt, „erstes nach 1945 erbautes Wohnhaus Berlins".<br />
Auswirkung der verstärkten Bestrebungen zur Erhaltung und Rekonstruktion historischer Gebäude<br />
und Stadtviertel im heutigen Ost-Berlin ist ferner die Neugestaltung des Gebietes Sophienstraße/Hackescher<br />
Markt/Große Hamburger Straße, die für die nächsten Jahre vorgesehen ist.<br />
Alle wertvollen Fassaden in diesem Teil des alten Berlins, der vor 225 Jahren entstanden ist,<br />
sollen restauriert werden. Man verbindet diesen Plan mit dem auch an anderen Orten bewährten<br />
Vorhaben (Schnoor in Bremen!), ausgefallene Handwerksberufe wie Goldschmiede, Kunsttischler,<br />
Graveure und Instrumentenbauer in diesem Viertel anzusiedeln. SchB.<br />
Personalien<br />
Der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz hat unserem Mitglied Kurt Meurer in Firma Buchhandlung<br />
Elwert & Meurer im Zusammenhang mit der Vollendung seines 75. Lebensjahres am<br />
19. April die Ernst-Reuter-Plakette in Silber überreicht.<br />
Der österreichische Bundespräsident hat unserem Mitglied Ministerialrat a. D. Dr. Johannes<br />
Broermann, Inhaber des Verlages Duncker & Humblot, Berlin, in Anerkennung seiner wissenschaftlichen<br />
Arbeit den Titel „Professor" verliehen. Professor Dr. /. Broermann, der in der Weimarer<br />
Zeit Pressereferent im Reichsministerium des Innern war, hat den im Krieg zerstörten<br />
namhaften Verlag wieder aufgebaut und mehr als 3000 Bücher aus dem Bereich der Geisteswissenschaften<br />
und der Geschichte, aber auch der Naturwissenschaften veröffentlicht.<br />
*<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Herrn Dr. Gerhard Krause, Frau Ruth Pappenheim, Frau Hermine Pfeiffer;<br />
zum 75. Geburtstag Herrn Werner Haube, Frau Anna Kuckkuck, Herrn Dr. Robert Rieger, Herrn<br />
Dr. Robert Venter, Herrn Wilhelm Weick; zum 80. Geburtstag Herrn Eugen Ernst, Herrn Konrad<br />
Lindhorst, Frau Dr. Margarete Pfand, Frau Elisabeth Rexhausen.<br />
Unser Jahrbuch „Der Bär von Berlin", Folge 25 (1976) wird im Spätsommer dieses Jahres<br />
erscheinen.<br />
190
Buchbesprechungen<br />
Martin Sperlich u. Helmut Börsch-Supan (Hrsg.): Schloß Charlottenburg • Berlin • Preußen.<br />
Festschrift für Margarete Kühn. München, Berlin: Deutscher Kunstverlag 1975. 340 S. m. zahlr.<br />
Abb., brosch., 80 DM.<br />
Untrennbar ist der Name Margarete Kuhns mit der Erforschung preußischer Kunst- und Geistesgeschichte,<br />
die sich allseits sichtbar im Wiederaufbau des Schlosses Charlottenburg dokumentiert,<br />
verbunden. So würdigt die ihr gewidmete, von Martin Sperlich und Helmut Börsch-Supan herausgegebene<br />
und mit einem Vorwort von Georg Kauffmann und einem Brief Hann Triers eingeleitete<br />
Festschrift die Leistung, die das Wiedererstehen dieses Baudenkmals ermöglicht hat, ohne<br />
die anderen Bereiche wissenschaftlicher Tätigkeit der der Architektur verpflichteten Kunsthistorikerin<br />
außer Acht zu lassen. Die Beiträge werden daher auch zur spannenden Lektüre für den<br />
heimatkundlich interessierten Berliner. Goerd Peschken schreibt nach neuen, von Martin Sperlich<br />
beobachteten, Baubefunden Andreas Schlüter den Umbau des Corps de Logis und die Errichtung<br />
einer Orangerie (im heutigen östlichen Seitenflügel) zu. Die Bauleitung Schlüters nach dem Interim<br />
Martin Grünbergs war entgegen der auf eine Nachricht des Mitglieds der Berliner Akademie<br />
der Künste Abraham d'Humbert - eine Generation nach Schlüter - fußenden Tradition seit Ende<br />
des vorigen Jahrhunderts mehr und mehr angezweifelt worden.<br />
Martin Sperlich äußerte sich über denkmalpflegerische Prinzipien beim Wiederaufbau und streift<br />
unter anderem den Sinneswandel, der sich in der Denkmalpflege seit Dehios kategorischem Nein<br />
zu willkürlichen Restaurationen unter dem Eindruck der Vernichtung zahlloser Kulturgüter im<br />
zweiten Weltkrieg vollzogen und gerade mit dem Wiederaufbau des Schlosses Charlottenburg<br />
eingesetzt hat.<br />
Hans Reuther nennt als Vorbild des Treppenhausentwurfes von Nicodemus Tessin d. J. für<br />
Schloß Charlottenburg das von dessen Vater Nicodemus Tessin d. Ä. erstellte Stiegenhaus von<br />
Drottningholm. (Die Tessins waren die führenden Barockarchitekten Schwedens gewesen.) Er<br />
reiht den Charlottenburger Entwurf in den Zusammenhang mit dessen anderen Arbeiten und in<br />
einen größeren Rahmen ein.<br />
Den Zopfstilbau des Neuen Palais in Potsdam stellt Horst Drescher in die Traditionen des<br />
Schlüter-Kreises und in die Knobelsdorff-Nachfolge, wie man überhaupt gern in der Schlußphase<br />
einer Epoche auf die Formensprache deren Beginns zurückgreift, und weist auf die Verwandschaft<br />
mit dem Residenz-Entwurf aus Paul Deckers 1711-1716 erschienenen architektonischen Musterbuch<br />
„Fürstlicher Baumeister oder architektura civilis". Neben anderen Zeitbezügen zur Wiederbelebung<br />
barocker Traditionen sieht der Autor den speziellen Grund hierfür in der Hinwendung<br />
des Königs zur Geschichtsforschung und dessen Interesse an der politischen und kulturellen Entwicklung<br />
Preußens unter dem Einfluß Voltaires.<br />
Eva-Börsch-Supan beschreibt einen unbekannten in Privatbesitz befindlichen Entwurf Schinkels<br />
zum bereits 1848 ausgebrannten Festsaal des von Grahl aus dem Jahre 1736 stammenden Palais<br />
Redern, mit dessen Umbau der Gilly-Schüler zwanzig Jahre vorher beauftragt worden war. Sie<br />
leitet ihn direkt von antiken Vorbildern ab und begründet die Unwahrscheinlichkeit von Einwirkungen<br />
tonnengewölbter Raumformen der französischen Revolutionsarchitektur.<br />
Tilmann Buddensiegs Beitrag über Peter Behrens und die AEG gibt anhand neuer Dokumente<br />
einen Oberblick über die Baugeschichte der Fabriken am Humboldthain, der sich auf umfangreiches<br />
Photomaterial und erhaltene Bauakten stützt und generelle Arbeiten zu diesem Thema<br />
zitiert.<br />
Heinrich Brauer stellt den zu seiner Zeit in Berlin sehr erfolgreichen und später vergessenen<br />
Portraitmaler Johann Samuel Otto (1798-1878) und einiges, das sich aus dessen Werk erhalten<br />
hat, vor. Geformt durch die Romantik hält der Maler auch in der Biedermeier-Nachfolge Individualität<br />
und Geistigkeit der portraitierten Prominenten in den den Betrachter auch heute fesselnden<br />
Bildnissen fest. In diesem Aufsatz wird ebenfalls die Entwicklung des Künstlers deutlich.<br />
Liselotte Wiesingers und Eva Krafts Arbeiten über den Berliner Hofarzt und Verwalter der chinesischen<br />
Abteilung der kurfürstlichen Bibliothek Christian Mentzel gewähren Einblick in eine<br />
weithin unbekannte Epoche brandenburgischer Natur- und Geistesgeschichte der zweiten Hälfte<br />
des 17. Jahrhunderts.<br />
Hans Bleckwenns Beitrag über ein von Margarete Kühn 1964 aus dem Kunsthandel erworbenes<br />
Portrait Adam Friedrich von Wreechs, des Gatten der von Kronprinz Friedrich verehrten Eleonore<br />
von Wreech, macht wieder mit der „Chefgalerie Potsdam" bekannt, die sich Friedrich Wilhelm<br />
I. mit den Portraits seiner Generale und Regimentschefs anlegt. Helmut Börsch-Supan und<br />
Winfried Baer publizieren Nachkriegserwerbungen der Berliner Sdilösserverwaltung.<br />
Otto von Simsons Aufsatz über Karl Blechen ordnet vier undatierte Zeichnungen in die letzte<br />
Stufe dessen künstlerischer Entwicklung ein. Die Beiträge von Matthias Winner über Michel-<br />
191
angelo, von Heinz Riehn über zwei Federzeichnungen der Grotte und der Warte im Schloßpark<br />
Wiihelmsthal, von Detlef Heikamp über Leo von Klenzes Besuch in Pratolino und von Hans<br />
Huth über den Denkmalschutz in den Vereinigten Staaten seien, weil sie mit Berlin-Brandenburgischer<br />
Thematik nicht unmittelbar zusammenhängen, nur erwähnt.<br />
Diese dem Wirken Margarete Kuhns angemessene Festschrift spiegelt auch die Menschlichkeit der<br />
Kunsthistorikerin wider, der die „Verehrung eines Kunstwerkes . . . tiefes Bedürfnis ist", wie<br />
Georg Kauffmann in seinem Vorwort schreibt. Günter Wollschlaeger<br />
Walther G. Oschilewski: Ein Mann im Strom der Zeit. Richard Timm. Berlin: Westkreuz-<br />
Druckerci 1975. 68 S. m. Abb., brosch., 9,80 DM.<br />
W. G. Oschilewski setzt mit dieser Biographie einem sozialdemokratischen Politiker ein Denkmal,<br />
der niemals Schlagzeilen machte. Es ist der Bericht über einen Mann, der noch vor dem Ersten<br />
Weltkrieg zum „Verein der Lehrlinge, jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen Berlins und Umgebung"<br />
stieß, der nach Abschluß der Volksschule seine Bildung in der „Freien Hochschule Berlin"<br />
und später auf der „Arbeiterbildungsschule Berlin" erwarb, der als gelernter Tischler im gewerkschaftlichen<br />
Zusammenschluß der Holzarbeiter tätig wurde. Die politische Tätigkeit Timms, der<br />
von 1930 bis 1933 Geschäftsführer der Bundesschule des ADGB in Bernau war, wurde durch die<br />
nationalsozialistische Machtergreifung unterbrochen. 1944 erfolgte die Verhaftung Timms, der<br />
zuvor in der gewerkschaftlichen Widerstandsgruppe um Wilhelm Leuschner und Jakob Kaiser mitgearbeitet<br />
hatte. Auch nach der Befreiung aus dem Zuchthaus Brandenburg (1945) war der politische<br />
Kampf für Timm noch nicht beendet. Auf Partei und Gewerkschaftsebene setzte er der<br />
neuen Machtübernahme von kommunistischer Seite aus Widerstand entgegen. Im kommunalen<br />
Bereich wirkte er nach 1948 als zeitweiliger Bürgermeister von Neukölln und als Direktor der<br />
BVG; darüber hinaus widmete sich Timm der Tätigkeit in der Dt. Gesellschaft für die Vereinten<br />
Nationen und in internationalen Widerstandsorganisationen.<br />
Zahlreiche Namen, von Friedrich Ebert über Erich Ollenhauer, Erich Honecker (den T. im Zuchthaus<br />
Brandenburg kennenlernte) bis hin zu den Politikern des Nachkriegs-Berlin, ziehen an dem<br />
Leser vorbei.<br />
Mit dieser Biographie zeichnet Oschilewski das Bild eines Mannes und Weggenossen, der in den<br />
letzten siebzig Jahren deutscher und speziell berlinischer Geschichte stets im „Strom der Zeit"<br />
stand und seine Auffassung vertrat. Felix Escloer<br />
Stefan Heym: 5 Tage im Juni. Roman. München: C.Bertelsmann Verlag 1974. 384 S., Leinen,<br />
29,50 DM.<br />
Der Autor, deutscher Emigrant, dann Amerikaner und seit 1953 in Ost-Berlin lebend, schrieb<br />
diesen Text unmittelbar unter dem Eindruck der Ereignisse. Schon seit Mitte der 50er Jahre<br />
wanderte das Manuskript, aufgrund des schwarzen Kalikoeinbandes als „Das Schwarzbuch" bezeichnet,<br />
von Lektorat zu Lektorat einiger DDR-Verlage. Erscheinen durfte es nicht, denn die<br />
hier geschilderten „Ereignisse" waren tabu.<br />
Erst jetzt, 21 Jahre danach, wurde das Buch anläßlich der Frankfurter Buchmesse (1974) mit sehr<br />
großem Werbeaufwand dem Publikum vorgelegt. Schon hier kommen deswegen erste Zweifel an<br />
der ehrlichen Absicht des Autors auf, ein objektives Zeitdokument vorzulegen, die sich - leider -<br />
nach eingehendem Studium bestätigen.<br />
Wie seinerzeit beispielsweise bei Biermann und Havemann mußte auch bei Heym, der eigens aus<br />
Berlin zur Messe kam und den Massenmedien bereitwillig Rede und Antwort stand, ein West-<br />
Verlag publizistische Schützenhilfe leisten; die Literatur der DDR findet eben auch ihren Platz<br />
im Westen.<br />
„Der Tag X", wie der Titel ursprünglich lautete, beginnt zeitlich-chronologisch um 14 Uhr des<br />
13. Juni 1953 und endet am Mittwoch, dem 17. Juni. Ein zweiseitiges Nachspiel ist auf den<br />
14. Juni 1954 datiert.<br />
Obwohl der Roman stellenweise von beachtlicher Rapidität ist, bleibt er auf der anderen Seite ob<br />
seiner langatmigen Passagen sehr schwer lesbar und unübersichtlich. Die Handlung arrangiert sich<br />
um den Genossen Witte. Dieser, Parteiarbeiter und Gewerkschaftler im Ost-Berliner Betrieb VEB<br />
Merkur, entscheidet sich nach Schwierigkeiten mit Parteileitung und Staatssicherheitsdienst (warum?)<br />
gegen den Streik und versucht seine Kollegen ebenfalls daran zu hindern. Ohne Hilfe von<br />
„oben" irrt er, das Parteiabzeichen auf der Brust, durch jene Tage. Deutsche und sowjetische Genossen,<br />
Kumpels der Halle 7, Strichmäddien, Westler, Halbstarke auf chromblitzenden Fahrrädern<br />
und Bewohner der Gegend bilden eine lebendige Staffage. Das Geschehen, kolportagehaft aufgezeichnet,<br />
verläßt nur hin und wieder das Niveau eines Thrillers, als dessen dokumentarischer<br />
192
Anstrich die eingestreuten Reden, Ansprachen und Rundfunkansagen sowohl westlicher als auch<br />
östlicher Politiker, Kommentatoren und Nachrichtenagenturen zu werten sind.<br />
Es würde den Rahmen dieser Publikation sprengen, wollte man auf alle Banalitäten im Text<br />
eingehen, so z. B. die Liebesszene zwischen Witte und Anna im Gras des Bahndammes, dessen<br />
Schienen „zu singen begannen" oder der Tod einer West-Prostituierten am Brandenburger Tor.<br />
Hier hätte es dem Werk Heyms sicher gut getan, wenn sich das Lektorat dieses Textes angenommen<br />
und eine Straffung veranlaßt hätte. Das Buch wäre lesbarer - verständlicher geworden.<br />
Als „Wanderer zwischen zwei Welten" zeigt sich Heym, trotz aller Wertschätzung angesichts der<br />
heutigen politischen wie auch literarischen Strukturen und mitten auf der Scheidelinie von Ost<br />
und West doch überfordert, die vielschichtigen Ereignisse um den 17. Juni dem Leser überschaubar<br />
darzubringen. Er bietet eben ,nur' einen Diskussionsbeitrag. Der Zukunft und ihrer Geschichtsforschung<br />
wird es vorbehalten bleiben, den Wert dieses Beitrages herauszufinden.<br />
Claus P. Mader<br />
Uwe Bahnsen u. James P. O'Donnell: Die Katakombe. Das Ende in der Reichskanzlei. Stuttgart:<br />
Deutsche Verlags-Anstalt 1975, 437 S., Leinen, 38 DM.<br />
Boris Polewoi: Berlin 896 km. Aufzeichnungen eines Frontkorrespontenten. Aus dem Russ.<br />
2. Aufl. (Ost-)Berlin: Verlag Volk und Welt 1975. 332 S., Leinen, 7,20 M.<br />
In der Flut der Veröffentlichungen zum 30. Jahrestag des Kriegsendes ist häufig auch der Reichskanzlei<br />
mit ihren unterirdischen Bunkeranlagen gedacht worden. Für das Autorenteam Bahnsen-<br />
O'Donnell stehen dieser Bau und seine Insassen im Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Über das<br />
Leben in den Bunkeranlagen während der letzten Kriegsmonate sind allerdings insbesondere<br />
durch Autoren wie H. R. Trevor-Roper, A. Zoller und A. Speer bereits die wichtigsten Ereignisse<br />
sowie die bizarre und unwirkliche Atmosphäre dieser letzten Tage nationalsozialistischer Herrschaft<br />
bekannt geworden, daß die Vff. dazu nur noch Randbemerkungen beisteuern können. Die<br />
Detailinformationen zu ihrer Arbeit erhielten sie durch bisher kaum bekannte Augenzeugen, etwa<br />
den Chefelektriker der Reichskanzlei, Hitlers Piloten, SS-Wachmannschaften und Militärs. Die<br />
neuen Informationen können jedoch das bisher bekannte Bild vom Ende in der Reichskanzlei in<br />
wesentlichen Punkten nicht ändern. Darüber hinaus - auch dies betonen die Autoren - gelingt es<br />
nicht immer, die Augenzeugenberichte zu koordinieren.<br />
Die zweifellos interessantesten Teile dieses Buches beschäftigen sich mit den Ausbruchsversuchen<br />
einzelner Gruppen aus der eingeschlossenen Reichskanzlei. Das Ende Bormanns - ihm wurde u. a.<br />
mangelnde Kenntnis des Berliner U-Bahnnetzes bei der Flucht durch die Tunnel zum Verhängnis<br />
- ist plausibel dargestellt. Die zahlreichen Mängel dieses recht spartanisch ausgestatteten Bandes<br />
dürfen nicht verschwiegen werden. Nicht einmal ein zeitgenössischer Stadtplan war für die Autoren<br />
zu beschaffen gewesen! Zahlreiche Druckfehler verstärken den Eindruck, daß man sich bei<br />
dieser Veröffentlichung keine große Mühe gegeben hat. Das Fehlen jeglicher Anmerkungen läßt<br />
den wissenschaftlichen Wert der neuen Informationen auch etwas fragwürdig erscheinen. Auch<br />
sind die Aussagen zu Person und Bericht B. Polewois nicht zutreffend, wie die Lektüre dessen<br />
Buches „Berlin 896 km" beweist.<br />
Ganz im Gegensatz zu dem vorangegangenen Titel schreibt B. Polewoi, ein sowjetischer Frontkorrespondent,<br />
über die gleichen Ereignisse aus der Sicht der Sieger. In Episoden schildert er<br />
seine Erlebnisse während des sowjetischen Vormarsches von Moskau nach Berlin. Auch er besichtigt<br />
und beschreibt den soeben eroberten „Führerbunker" unter der Reichskanzlei. Zuvor hatte<br />
er an dem Angriff der südlich, von Zossen her, auf Berlin vordringenden Truppen teilgenommen.<br />
Nicht ohne versteckte Seitenhiebe berichtet er auch von Begegnungen mit den westlichen Verbündeten,<br />
u. a. bei Torgau und in Prag. Felix Escher<br />
Alfred Döblin: Griffe ins Leben. Berliner Theaterberichte 1921-1924, hrsg. von Manfred Beyer.<br />
Berlin-Ost: Henschelverlag 1974. 287 S., brosch., 6 DM.<br />
Wer Döblins Sprachkraft kennt, seine beißende Ironie und satirische Schlagfertigkeit anhand seiner<br />
Schriften bewundern gelernt hat, dem werden die hier gesammelten Korrespondentenberichte,<br />
die der Dichter in den Jahren 1921-1924 für das Prager Tagblatt schrieb, eine Quelle neuer<br />
Freuden sein.<br />
Bereits in seinen „Aufsätzen zur Literatur" hatte Döblin unerbittlich den bürgerlichen Theaterbetrieb<br />
samt der diesem verbundenen Kritik in seine Schranken gewiesen. In den hier vorliegenden<br />
„Theaterfeuilletons" hat er diese Grundeinsichten an zahlreichen praktischen Beispielen erläutert<br />
und daneben gleichzeitig das buntfarbige Bild vom Berliner Theaterleben in den ersten<br />
193
Jahren der Weimarer Republik Wiederaufleben lassen. Der journalistische Stil, den Döblin hier<br />
salopp handhaben darf, erhöht die Wirkung seiner Kritiken noch. Neben einem Gang durch die<br />
Berliner Theatersale werden auch immer wieder Bezüge zum Zeitgeschehen hergestellt. Döblin<br />
konnte das politische Tagesgeschehen nicht einfach vom Kulturbetrieb abtrennen. Wie eng diese<br />
Bereiche damals ineinander übergehen konnten, mögen einige Beispiele verdeutlichen.<br />
Zur Inszenierung von Schnitzlers „Professor Bernhardi" heißt es: Diese Komödie „greift munter<br />
in das hakenkreuzlerische Menschenleben - brachte es besonders im dritten Akt zu einem rauschenden<br />
Beifall, als der Augenarzt menschliches und ärztliches Gefühl gegen Parlamentarismus,<br />
Korruption und so weiter verteidigte. Die Leute applaudierten mehrmals bei offener Szene; man<br />
sage, die Berliner sind verbildet. Daß am Schluß zweier Akte aber ein Herr vortrat zu einer<br />
Ansprache für die Ruhrhilfe, gefiel mir gar nicht. Man gönne den Menschen die kurze Entrücktheit<br />
aus der ärmlichen schrecklichen Gegenwart (zwei Stunden, die sie im Residenztheater horrend<br />
bezahlen), lasse die Gefühle des Stückes sich ruhig auswirken. Diese Ansprachen sind Regiefehler."<br />
(S. 163.)<br />
Rosige Zeiten waren es in der Tat nicht! Anläßlich eines Theaterbesuches im Oktober 1923 bemerkt<br />
Döblin: „Es war mir aufgefallen, wie ich die Garderobe betrat, daß nur vier bis fünf<br />
Sachen dahingen; im Rang aber saßen mehrere Dutzend Menschen. Wo hatten sie ihre Garderobe?<br />
Als ich hinausging am Schluß, beobachtete ich die Leute. Sie gingen die Treppe hinunter;<br />
ich dachte, sie haben ihre Hüte und Mäntel unten. Nein. Sie gingen - hinaus. Sie hatten gar<br />
nichts mitgebracht. Die ganzen Scharen, Männlein, Weiblein, spazierten so! Sparten Garderobengeid.<br />
Und es - regnete." (S. 216 f.)<br />
Vierzehn Tage später - im Lessing-Theater wird Strindbergs „Rausch" aufgeführt - beschreibt<br />
Döblin selbst, wie rasch die Menschen aus der „kurzen Entrücktheit" während des Theaterbesuchs<br />
in die harte Wirklichkeit gerissen werden konnten: „Trübe Straße, da bin ich wieder.<br />
Werde wieder hell. (Aber die Straße ist nicht für lyrische Anrufe. Beim Heimgang kam ich in<br />
einen Auflauf am Straußberger Platz; da knackten sie und plünderten ein Konfektionsgeschäft.)"<br />
(S. 220.) Das politische und kulturelle Leben Berlins wird in diesen „Theaterberichten" eindringlich<br />
und anschaulich geschildert. In den wenigsten Fällen wird zuvor klar gesagt: „Kein Theaterbericht"<br />
(S. 258). Für den am schriftstellerischen Schaffen Döblins Interessierten bieten die „Theaterfeuilletons"<br />
reiches Studienmaterial. Gelegentlich geht Döblin auch auf seine eigenen Arbeiten<br />
ein. In den „Eindrücken eines Autors bei seiner Premiere" berichtet er z. B. über die Aufführung<br />
seines Stückes „Die Nonnen von Kemnade", die in Leipzig (Mai 1923) stattfand (S. 175-178).<br />
Ein Personen- und Werkregister erleichtert die Suche nach einzelnen Theaterberichten. Das Vorwort<br />
des Herausgebers liefert einen instruktiven Überblick zu diesem Band (S. 5-14).<br />
Hans Jürgen Meinik<br />
Cornelius Ryan: Der letzte Kampf. München: Droemer Knaur 1975. 416 S. mit 74 Abb. u.<br />
Karten, brosch., 9,80 DM. (Knaur-Taschenbuch Nr. 387.)<br />
Unter dem „letzten Kampf" ist die Schlacht um Berlin im April 1945 zu verstehen, und insofern<br />
ist es gerechtfertigt, daß der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt dem<br />
Buch, das er als „sehr erregend, sehr menschlich und sehr wichtig" bezeichnet, ein Geleitwort<br />
vorangestellt hat. Er knüpft an die Widmung des Buches an, die Peter Fechter gilt, der in den<br />
letzten Kriegsmonaten in Berlin geboren wurde. „1962 erschossen ihn seine Landsleute und ließen<br />
ihn an der Berliner Mauer, dem tragischen Denkmal des Sieges der Alliierten, verbluten." Hierzu<br />
Willy Brandt: „Die Mauer muß nicht nur überwunden werden, weil sie für uns Deutsche unerträglich<br />
ist. Sie muß auch überwunden werden, weil sie die großen Anstrengungen einer herausgeforderten<br />
Welt beleidigt."<br />
Cornelius Ryan wurde 1920 in Dublin geboren und starb 1974 in New York. Während des<br />
Zweiten Weltkriegs war er Kriegsberichterstatter. Er stützt seine Chronik auf umfangreiche<br />
Untersuchungen und verknüpft seine Schilderungen aus den Hauptquartieren und von den Fronten<br />
mit Episoden aus dem Leben unbekannter und bekannter Berliner, um die Authentizität des<br />
Buches zu erhöhen. So treten in Episoden Siegmund Weltlinger, Hans Rosenthal und Joachim<br />
Lipschitz auf, daneben der Pathologe Professor Rudolf Hückel, der allerdings während des Krieges<br />
nicht an der Humboldt-Universität, sondern an der Friedrich-Wilhelms-Üniversität tätig war.<br />
Ein umfangreicher Abschnitt ist auch den Deutschlandplänen der Alliierten mit ihren Überlegungen<br />
eines Berlin-Korridors gewidmet, ferner den strategischen Plänen vor allem der Westmächte<br />
im Hinblick auf Berlin, die durch die unheilvolle Überschätzung eines gar nicht existenten nationalen<br />
Bollwerks, der „Alpenfestung", geändert wurden. Der Autor ist um Wirklichkeit und um<br />
Wahrheit bemüht und frei von Vorurteilen. Wer diese schlimmen Tage miterlebt hat, wer wissen<br />
will, was es mit der Armee Wenck wirklich auf sich hatte oder wer die Leistung und das Leiden<br />
der älteren Generation aus den Seiten eines Buches ermessen will, wird zu diesem Band greifen.<br />
Selbst so vermeintlich belanglose Begebenheiten sind festgehalten worden, daß während der gan-<br />
194
zen Tage auch des Todeskampfes der Stadt elf der siebzehn Berliner Brauereien Bier herstellten.<br />
Auf der letzten Seite des Buches sind die Verluste aufgezeichnet. Die aus der Feder desselben<br />
Verfassers stammende Arbeit „Der längste Tag" über die Invasion in der Normandie ist verfilmt<br />
worden. Möge diesem Buch ein ähnliches Schicksal erspart bleiben. H. G. Schultze-Berndt<br />
Max Reinhardt: Sdiriften. Briefe, Reden, Aufsätze, Interviews, Gespräche, Auszüge aus Regiebüchern.<br />
Herausgegeben von Hugo Fetting. (Ost-)Berlin: Henschelverlag 1974. 528 S. m. Abb.,<br />
Leinen, 34 M.<br />
Nachdem schon 1963 Franz Hadamowsky in Wien mit einer mustergültigen Edition von Schriften<br />
und Reden Max Reinhardts vorangegangen war, folgte nun der gleichermaßen als Herausgeber<br />
bewährte Hugo Fetting mit einer ähnlichen Publikation für die „Akademie der Künste der<br />
DDR, Sektion Darstellende Kunst". Da sie aus einer Fülle inzwischen neu erschlossener Quellen<br />
schöpfen kann, ist Fettings Sammlung erheblich umfangreicher als die seines Vorgängers, ohne sie<br />
allerdings in jeder Hinsicht zu ersetzen. Das ausgebreitete Material entstammt zum großen Teil<br />
bereits gedruckten Vorlagen (früheren Dokumentationen über Reinhardt, Zeitungsartikeln und<br />
anderen heute schwer zugänglichen Aufsätzen), zu einem beträchtlichen Teil aber auch Archiven<br />
der DDR, der Bundesrepublik und Österreichs, die unveröffentlichte Schriftstücke beisteuern und<br />
damit den Quellenwert des Bandes erhöhen konnten. Vor allem das Staatsarchiv Potsdam, die<br />
Theatersammlung der Universität Hamburg und die kürzlich verstorbene zweite Gemahlin Max<br />
Reinhardts, Helene Thimig, haben bemerkenswerte Dokumente zur Verfügung gestellt, während<br />
leider die großen Reinhardt-Archive in Binghamton (USA) und in der österreichischen Nationalbibliothek<br />
dem Herausgeber nicht zugänglich waren. Auch die West-Berliner Archive blieben ausgespart.<br />
Das Werk ist in vier Abschnitte gegliedert: Auf die biographisch-chronologische Dokumentation<br />
des Theaterpraktikers Reinhardt folgen seine theoretischen Äußerungen; daran schließen<br />
sich Stimmen seiner Mitarbeiter zu allen Aspekten seiner Theaterführung. Da bis hierher<br />
stofflich bedingte Objektivität herrscht, wurde ein vierter Abschnitt angehängt, der dem Buch den<br />
notwendigen sozialistischen Charakter verleihen soll: „Beiträge zur Max-Reinhardt-Ehrung 1973<br />
in der DDR". Fünf Persönlichkeiten aus Theaterpraxis und -Wissenschaft kommen hier zu Wort,<br />
von denen jedoch nur Dieter Hoffmeier mit seinem „Versuch über Reinhardt" einer entschiedenen<br />
Widerlegung bedarf.<br />
Die Reichhaltigkeit an kultur- und zeitgeschichtlich bedeutsamen Schrift- und Bilddokumenten um<br />
die zentrale Gestalt Reinhardts, ihre geschickte Zusammenstellung und der vorbildliche wissenschaftliche<br />
Apparat machen Fettings Publikation, die sich im übrigen auch durch verhältnismäßig<br />
gute Papier- und Einbandqualität auszeichnet, zu einem der brauchbarsten Werke in der vielbändigen<br />
Literatur zur Reinhardt-Forschung. Der Henschelverlag setzt damit die Reihe der Anthologien<br />
von Schriften hervorragender Regisseure fort, die u. a. zu Heinrich Laube, Erwin Piscator<br />
und Erich Engel bereits ausgezeichnete Editionen hervorgebracht hat und der Förderung der<br />
Theaterwissenschaft in der DDR ein gutes Zeugnis ausstellt, während im Westen gewöhnlich nur<br />
für belanglose Fotobände oder Schauspieler-Memoiren sich ein Verleger findet. Rainer Theobald<br />
Max Mechow: Berliner Studenten. Von 1810 bis 1914. Berlin: Haude und Spenersche Verlagsbuchhandlung<br />
1975. 119 S. mit Abb., brosch., 14,80 DM. (Berlinische Reminiszenzen Bd. 42.)<br />
Nachdem zu den Jubiläen Berliner Hochschulen einige Darstellungen zur Hochschulgeschichte<br />
erschienen sind, fehlte noch eine Kulturgeschichte der Berliner Studenten. M. Mechow hat sich<br />
dieser reizvollen, aber auch problematischen Arbeit angenommen und in der nun bald 50 Bände<br />
umfassenden Reihe „Berlinische Reminiszenzen" auch diesen Aspekt städtischer Geschichte beleuchtet.<br />
Neben den großen Werken zur Hochschulgeschichte und anderen einschlägigen Werken<br />
dienten ihm vor allem gedruckte Lebenserinnerungen ehemaliger Berliner Studenten als Quelle.<br />
Der Bearbeitungszeitraum reicht von der Gründung der Berliner Universität bis zum Ersten<br />
Weltkrieg. Geboten wird nicht nur eine geistesgeschichtliche Übersicht zu Lehrplänen und studentischen<br />
Vereinigungen, sondern es werden auch, je nach Vorarbeiten, Herkunft, Zahl und<br />
materielle Situation der Studierenden behandelt. Zu jedem Zeitabschnitt stellt Mechow überdies<br />
einzelne besonders hervorragende Berliner Studenten biographisch vor.<br />
Es ist natürlich, daß dem studentischen Verbindungswesen ein breiter Raum zugewiesen wird.<br />
In der jungen Berliner Universität hatten die Burschenschaften durch administrative Maßnahmen<br />
einen schweren Stand; erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. sollte sich dies ändern. Auch die<br />
gesellschaftliche Stellung der Studenten war in der Großstadt Berlin stets geringer als in den<br />
alten kleinen Universitätsstädten. So fehlten nahezu von Beginn an speziell studentische Verlockungen.<br />
Die Hochschule galt als „Arbeitsuniversität", die nach der Reichsgründung immer<br />
stärker auch von ausländischen Studenten besucht wurde. In die Zeit der Jahrhundertwende fällt<br />
auch der Anfang des Frauenstudiums.<br />
195
Eine Geschichte der Studentenschaft ist stets auch Geschichte der wissenschaftlichen, politischen und<br />
sozialen Ideen ihrer Zeit. Dies gilt nicht nur für die Reformzeit des 19. Jh., sondern gerade für<br />
die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.<br />
Hier sieht Mechow einiges wohl zu harmlos. Dies gilt etwa für die Rolle Treitschkes im Antisemitismusstreit<br />
und die in dieser Zeit beginnende Abschließung zahlreicher Studentenverbindungen<br />
gegen jüdische Studierende. Der zunehmend unkritische Nationalismus der wilhelminischen<br />
Zeit, durch die für den öffentlichen Dienst notwendige Verkoppelung von Universitätsabschluß<br />
und Reserveoffizierspatent noch verstärkt, erleichterte sicherlich den Weg in die Katastrophe. Der<br />
Erste Weltkrieg forderte dann auch einen hohen Blutzoll von den Berliner Studenten. Doch in<br />
der Universität wurde daraus nicht gelernt. Das von einem Theologen geprägte Motto des Gefallenendenkmals<br />
der Universität, von Mechow ebenfalls erwähnt, „Invictis victi vict<br />
u r i " weist die Richtung zum Zweiten Weltkrieg.<br />
Kleinere Fehler fallen hingegen kaum ins Gewicht. So handelt es sich bei dem Droysen-Biograph<br />
(S. 32) um J. Rüsen. Teilweise scheint auch die Quellenauswahl etwas einseitig: so hätte neben<br />
anderen Zitaten aus dem „Erlebten" Friedrich Meineckes über seine Zeit als Verbindungsstudent<br />
auch der sicherlich für viele seiner Kommilitonen ebenfalls geltende Satz: „Ich hatte nach der<br />
blauen Blume der Romantik gestrebt und war dabei in Auerbachs Keller geraten" Erwähnung<br />
finden können. Nicht ausreichend ist der Kollegbetrieb beschrieben. Die neben der Universität<br />
existierenden Hochschulen bleiben etwas am Rande. Felix Escher<br />
Alfred B. Gottwaldt: Eisenbahn-Brennpunkt Berlin. Die Deutsche Reichsbahn 1920-1939. Stuttgart:<br />
Franckh 1976, 112 S. mit 190 Abb., geb., 34 DM.<br />
Dem durch zahlreiche eisenbahnhistorische Arbeiten ausgewiesenen Autor ist es gelungen, durch<br />
Zusammenstellung einer langen Reihe fotografischer Reproduktionen einen längst vergangenen<br />
Zeitabschnitt aus der Geschichte des Berliner Eisenbahnwesens mit neuem Leben zu füllen.<br />
„Eisenbahn-Brennpunkt Berlin" reiht sich nicht als ein weiteres Werk bereits vorhandenen Vorgängern<br />
der gleichen Thematik an, sondern kann durch die einmalige Aussagekraft einer Vielzahl<br />
künstlerisch und technisch erstklassig gelungener Aufnahmen mit Fug und Recht eine Sonderstellung<br />
auf dem einschlägigen Sektor beanspruchen.<br />
Die behandelte Epoche bildet den Zeitraum zwischen 1920 und 1939. Der Hauptschauplatz der<br />
aufgezeigten Entwicklung ist die alte Reichshauptstadt Berlin. Vor dieser Kulisse entfaltet sich<br />
dem Betrachter das eindrucksvolle Panorama aus dem Alltag des Berliner Eisenbahn-Nah- und<br />
Fernverkehrs, sowie die Umrüstung des Stadt-, Ringbahn- und Vorortverkehrs vom Dampfbetrieb<br />
auf elektrische Zugförderung. Auch der Fernschnellverbindungen zwischen Berlin und den<br />
Großstädten im Reich mittels des „Schienenzepp" und anderer Schnellfahrtbetriebsmittel jener<br />
Zeit ist gedacht. Jede der 190 Aufnahmen wird durch einen für den Fachmann informativen,<br />
aber dem Laien dennoch verständlichen Text erläutert.<br />
Der Bildband führt uns vornehmlich in die Gegenden Berlins, in denen Gleisanlagen verlegt<br />
sind. Schon das Aufschlagen des Bandes zeigt uns - doppelseitig - das enorme Gelände des Verschiebebahnhofs<br />
Tempelhof mit seinem verzweigten Gleisnetz und einer Vielzahl von Bahnfahrzeugen<br />
aller Art. Straff geraffte textliche Erläuterungen und Werkfotos informieren den Leser<br />
über die damals im Groß-Berliner Raum angesiedelten Lokomotivfabriken. Da die Lokomotive<br />
im Bahnbereich auch visuell die tragende Rolle spielt, befaßt sich die Bildreportage besonders<br />
ausgiebig mit der Zugbespannung, wovon eine Reihe hervorragender Fotos von Hochleistungs-<br />
Dampf- und Dieselloks zeugt. Ein bebilderter Gang, beginnend auf dem Stadtbahnsektor, schließt<br />
die Berliner Fernbahnhöfe ebenso ein wie eine Reihe von Bahnbetriebswerken in den Stadtrandzonen.<br />
Der Autor hat nicht beabsichtigt, ein rein eisenbahntechnisches Referat, mit Konstruktionszeichnungen<br />
und tabellarischen Betriebsergebnissen gewürzt, zu halten, sondern ein lebenserfülltes<br />
Lokalkolorit zu zeichnen, das die Erinnerung an eine für immer geschwundene Epoche - den<br />
Dampfbahnbetrieb im Berliner Bereich - wachhalten soll. Daß ihm dieses Vorhaben aufs beste<br />
gelungen ist, beweist eine lange Reihe besonders wirklichkeitsnaher Reproduktionen. Zu ihnen<br />
gehört der jedem Alt-Berliner lebenslang vertraute Anblick von Ringbahn- und Vorortzügen<br />
bestehend aus der für diese Zugaggregate typisch gewesenen T-12-Lok mit den schwarz-weißen<br />
Richtungsschildern wie „Vollring", „Berlin, Wannseebahnhof" oder „Beelitz, Heilstätten" und<br />
den paarweise gekoppelten, dreiachsigen Abteilwagen mit den überhöhten Zugbegleiterhäuschen<br />
und den Sondersektionen „Für Reisende mit Hunden und Traglasten". Weitere, nicht weniger<br />
aussagestarke Fotos zeigen Szenen der Zugabfertigung, des Gewühls von Reisenden auf den<br />
Bahnsteigen, fauchende Loks bei der Ausfahrt aus den Bahnhöfen und auf freier Strecke dahinbrausend.<br />
Aufnahmen wie die von Bauarbeiten am Bahnkörper (Nr. 37 und 137), von Physiognomien<br />
des Zugpersonals (Nr. 62-65), der Verabschiedung eines Ferienzuges (Nr. 166) und ein<br />
Schnappschuß aus dem Mitropa-Speisewagen (Nr. 88) vermitteln dem Betrachter die Illusion, die<br />
196
Vergangenheit als handgreiflich nahe Gegenwart wiederzuerleben. Oberhaupt besitzt der Bildteil<br />
weniger durch gestellte Industriefotos als vielmehr durch zahlreiche stimmungsvolle Liebhaberaufnahmen<br />
eine besondere Atmosphäre.<br />
Dieser „Eisenbahn-Brennpunkt" ist als ein bebilderter Meilenstein im Rahmen der Geschichtsschreibung<br />
des Berliner Verkehrswesens zu betrachten. Hans Schiller<br />
Klaus Scherff: Luftbrücke Berlin. Die Dokumentation des größten Lufttransportunternehmens<br />
aller Zeiten. Mit einem Geleitwort des Reg. Bürgermeisters Klaus Schütz. Stuttgart: Motorbuch-Verlag<br />
1976. 246 S., ca. 75 Fotos, Leinen, 26 DM.<br />
Anders als die großen offiziellen Dokumentationen des Senats wendet sich dieser journalistisch<br />
aufgemachte Band an ein breites Publikum. Anlaß, Beginn, Durchführung und Ende der Versorgung<br />
einer Millionenstadt aus der Luft wird übersichtlich dargestellt. Auch persönliche Erinnerungen<br />
des Autors kommen hier zu Recht. Die etwas gekünstelten „Reportagen" hätten allerdings<br />
getrost wegfallen können. Eine Übersicht über den zeitlichen Ablauf und die eingesetzten Flugzeuge<br />
schließen den Band ab. Hervorgehoben werden muß die gute und reichliche Bebilderung.<br />
Felix Escher<br />
Dieter F. Grote: Berlin im Blickfeld der Philatelie. Bielstein (Rheinl.): Selbstverlag 1975. 138 S.<br />
mit Abb., brosch., 11,80 DM.<br />
Hier hat sich ein Berlin-Freund und zugleich engagierter Philatelist die Aufgabe gestellt, eine<br />
kleine Berlin-Geschichte, bedeutende Persönlichkeiten dieser Stadt und deren früheres und heutiges<br />
Bild in beiden Teilen anhand von Briefmarken zu belegen. Dabei schließt er auch die Berliner<br />
Verkehrsmittel ein und würdigt Ausstellungen und Tagungen, die Anlaß zur Ausgabe einer<br />
Briefmarke waren. In dem Kapitel „Berliner Briefmarkenkrieg" wird stärker auf den Bereich<br />
der Post Bezug genommen.<br />
Der Autor erweist sich als gut unterrichtet, und wenn auch der Berlin-Kenner nur sein Wissen<br />
bestätigt findet, so eignet sich der Band doch als Geschenk vor allem für (auswärtige) Berlin-<br />
Liebhaber. Vielleicht bedauert man es, daß der Philatelist etwas zu kurz kommt, da den Abbildungen<br />
der Briefmarken keine Katalognummern oder Angaben über Erscheinungsjahr, Graphiker<br />
usw. beigegeben worden sind. Dies wäre sogar in einem Anhang möglich gewesen. Wenn dieses<br />
Buch nicht nur über den Buchhandel, sondern auch über Briefmarkengeschäfte vertrieben wird,<br />
dürfte es auf diesem Umweg zahlreiche Leser finden, denen mit einer Bekanntschaft mit Berlin<br />
und seiner Problematik gedient ist. H. G. Schultze-Berndt<br />
Berlin vor hundert Jahren. Ein Bilderalbum aus der Fontane-Zeit, ausgewählt und kommentiert<br />
von Klaus J. Lemmer. Berlin: Rembrandt-Verlag 1975, 88 S. mit 88 Abb., Linson, 28,80 DM.<br />
Der Juniorchef des Verlages Rembrandt hat hier eine Auswahl bekannter und auch besonders<br />
typischer Berlin-Ansichten aus der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts zusammengestellt und mit<br />
den notwendigen Erläuterungen versehen. Es handelt sich dabei vorwiegend um Gebäude und<br />
Interieurs, gelegentlich um Szenen und Ereignisse, wie z. B. die Enthüllung der Siegessäule oder<br />
die Beisetzung Kaiser Wilhelms I. Die Vorlagen sind zumeist Stahlstiche oder Xylographien, wie<br />
sie damals in Büchern und Zeitschriften verbreitet waren und durch die künstlerische, häufig auch<br />
idealisierende Darstellung der Stadtlandschaft ihren besonderen Reiz vermitteln. Das 1883 erschienene<br />
Ansichtenwerk „Die deutsche Kaiserstadt" von Robert Springer, inzwischen eine bibliophile<br />
Kostbarkeit geworden, stellt den Höhepunkt dieser Entwicklung dar, bevor das photographische<br />
Abbild seinen Siegeszug antritt.<br />
Berlin zwischen 1850 und 1900, zwischen Biedermeier und Kaiserglanz, zwischen Beschaulichkeit<br />
und beginnender Weltstadthektik, war eine Stadt des Umbruchs vorher nie gekannten Ausmaßes<br />
in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Der Griff in die Bildermappe der damaligen Zeit ist<br />
denn auch ebenso ergiebig wie demaskierend: die „gute alte Zeit" verfängt sich in den stillen<br />
Winkeln von gestern, allenfalls vor den Bauten des 18. Jahrhunderts, in denen Berlins architektonische<br />
„Größe" am eindrucksvollsten ist, während das neuere Stadtbild mehr von der Bewegung,<br />
der Unruhe und zunehmend auch von der Technik beherrscht wird, überschattet von der<br />
Monumentalität eines unkontrollierten Bauempfindens. Dies nur für denjenigen, der genauer hinsehen<br />
möchte und dem sich hinter den Fassaden oder Szenen mehr offenbart als nur die Atmosphäre<br />
einer versunkenen Epoche. Daß diese trotz des vereinfachenden Offsetdruckverfahrens<br />
auch zu ihrem Recht kommt, ist ein Positivum dieses Bandes, der überhaupt in seiner technischen<br />
Ausführung, ohne jedes schnörkelhafte Beiwerk, einen sehr guten Eindruck hinterläßt.<br />
Peter Letkemann<br />
197
Veröffentlichungen des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
Nachstehend aufgeführte Restauflagen von Publikationen sind noch käuflich zu erwerben. Bestellungen<br />
sind an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten.<br />
DER BÄR VON BERLIN • Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
1951<br />
1952<br />
1953<br />
1957/58<br />
1959<br />
1960<br />
1961<br />
4,80 DM<br />
4,80 DM<br />
4,80 DM<br />
4,80 DM<br />
4,80 DM<br />
4,80 DM<br />
5,80 DM<br />
1962<br />
1963<br />
1964<br />
1965<br />
1966<br />
1967<br />
1968<br />
5,80 DM<br />
5,80 DM<br />
5,80 DM<br />
38,00 DM<br />
9,80 DM<br />
9,80 DM<br />
9,80 DM<br />
MITTEILUNGEN des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
1969<br />
1970<br />
1971<br />
1972<br />
1973<br />
1974<br />
1975<br />
9,80 DM<br />
11,80 DM<br />
11,80 DM<br />
11,80 DM<br />
12,80 DM<br />
12,80 DM<br />
12,80 DM<br />
Einzelhefte aus den verschiedenen Jahrgängen sind noch zum Stückpreis von 3,- DM erhältlich.<br />
Anfragen an die Geschäftsstelle des Vereins.<br />
SCHRIFTEN des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
Heft 59: Johann David Müller: Notizen aus meinem Leben. Preis 9,80 DM.<br />
Heft 60: W. M. Frhr. v. Bissing: Königin Elisabeth von Preußen. Preis 11,80 DM.<br />
Der Beitrag „Fontanes Umgang mit Bismarck" unseres verstorbenen Mitgliedes Kurt Ihlenfeld,<br />
veröffentlicht im „Bär von Berlin" 1973, wurde mit Unterstützung von Frau Ihlenfeld in kleiner<br />
Auflage als Sonderheft herausgebracht. Er kann zum Preis von 3,- DM zuzüglich Portokosten bei<br />
der Geschäftsstelle bestellt werden.<br />
Ebenso „Unser Ehrenmitglied Theodor Fontane" von Rudolf Danke zum Preis von 2,- DM.<br />
Im IL Vierteljahr 1976<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Rosemarie Cramer, Seminarleiterin i. R.<br />
1 Berlin 38, Matterhornstraße 94<br />
Tel. 8 03 67 31 (Leonore Franz)<br />
Hertha Eichhardt, Rentnerin<br />
1 Berlin 31, Cicerostraße 54<br />
Tel. 8 86 67 48 (Ilse Kabisch)<br />
Christian-Günther Frey, Fabrikant<br />
1 Berlin 47, Walkenrieder Straße 20<br />
Tel. 6 25 27 41 (Brauer)<br />
Horst Hartstock<br />
6230 Frankfurt 80, Lutherstraße 55<br />
Tel. (06 11) 39 65 05 (Schriftführer)<br />
Erhard Ingwersen, Techniker<br />
1 Berlin 65, Togostraße 39 e<br />
Tel. 4 52 39 75 (Schriftführer)<br />
Hadwig Landmann, Heimleiterin<br />
1 Berlin 33, Eberbacher Straße 4<br />
Tel. 8 21 52 44 (Schriftführer)<br />
Hugo Oberbeck, Rentner<br />
1 Berlin 48, Bahnstraße 22 (Brauer)<br />
198<br />
Anneliese Pfeiffer-Schrutek, Lehrerin i. R.<br />
1 Berlin 41, Albrechtstraße 59 b<br />
Tel. 7 96 44 96 (Rolf Pfeiffer)<br />
Jan Rickeis, Angestellter<br />
1 Berlin 45, Ostpreußendamm 24<br />
Tel. 7 72 59 41 (Schriftführer)<br />
Ferdinand Romanski, Wäschereibesitzer<br />
1 Berlin 45, Knesebeckstraße 12<br />
Tel. 8 32 66 19 (Dr. Schultze-Berndt)<br />
Günter Rutenborn, Pfarrer i. R.,<br />
Direktor des Hugenottenmuseums<br />
1 Berlin 44, Schillerpromenade 16-17<br />
Tel. 6 23 52 19 (Vorsitzender)<br />
Lilli Silbermann, Oberstudienrätin i. R.<br />
1 Berlin 28, Huttenstraße 16<br />
Tel. 4 01 14 04 (Schriftführer)<br />
Heinz Schünemann, Regierungsdirektor a. D.<br />
1 Berlin 31, Ruhrstraße 20<br />
Tel. 8 61 34 51 (Schriftführer)<br />
Jürgen Weber, Techniker<br />
1 Berlin 45, Celsiusstraße 17<br />
Tel. 7 12 89 85 (Brauer)
Studienfahrt nach Duderstadt<br />
Die diesjährige Exkursion führt vom 3. bis 5. September 1976 nach Duderstadt und in das Untereichsfeld,<br />
das auch die „Goldene Mark" genannt wird. Das Eichsfeld mit den drei Hauptorten<br />
Duderstadt, Worbis und Heiligenstadt gehörte bis zur Säkularisation politisch zum Erzbistum<br />
Mainz und ist eine katholische Enklave zwischen Thüringer Wald und Harz. Beim Wiener Kongreß<br />
wurde das Eichsfeld geteilt: das Untereichsfeld kam zum Königreich Hannover, das Obereichsfeld<br />
zur preußischen Provinz Sachsen. Seit 1945 läuft die Zonengrenze mitten durch das<br />
Eichsfeld.<br />
Das Untereichsfeld, gut zweihundert Quadratkilometer groß, wird von 40 000 Menschen bewohnt.<br />
Duderstadt erinnert mit der Fülle seiner Fachwerkhäuser an die bei früheren Exkursionen<br />
besuchten Städte Celle, Wolfenbüttel und Homburg. Das älteste Rathaus im deutschen Sprachgebiet<br />
steht in Duderstadt, einst eine „urbs opulentissima", die noch im 19. Jahrhundert ein höheres<br />
Grundsteueraufkommen hatte als Hannover.<br />
Es ist das folgende Programm vorgesehen:<br />
PROGRAMM<br />
Freitag, 3. September 1976<br />
6.30 Uhr Abfahrt von der Hardenbergstraße 32 (Berliner Bank)<br />
13.00 Uhr Besichtigung der Städtischen Brauerei Northeim<br />
Führung durch Dipl.-Br.-Ing. Klaus Thinius und einführende Worte<br />
Dr. H. G. Schultze-Berndt „Zur Geschichte des Brauwesens in Northeim".<br />
Anschließend Mittagessen<br />
17.00 Uhr Ankunft in den Hotels in Duderstadt<br />
19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel Deutsches Haus<br />
Sonnabend, 4. September 1976<br />
9.00 Uhr Stadtrundgang unter Führung von Verkehrsdirektor Gerlach mit Besichtigung der<br />
St.-Cyriakus-Propsteikirche und St.-Servatius-Kirche<br />
Besichtigung des Rathauses mit Vortrag über die Stadtgeschichte und Besuch des<br />
Stadtarchivs (Stadtarchivar Dr. Lerch)<br />
Besichtigung des Heimatmuseums des Eichsfeldes (Museumsleiterin Frau Blaschke)<br />
12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Hotel Deutsches Haus<br />
14.00 Uhr Fahrt zur Rhumequelle und nach Pöhlde. Besichtigungen der Kirche (Pastor Gierth)<br />
und der Grabungen<br />
19.00 Uhr Essen und zwangloses Beisammensein im Hotel zum Löwen<br />
Sonntag, 5. September 1976<br />
10.00 Uhr Aufbruch mit Zwischenstationen in Germershausen (Wallfahrtskirche Maria in der<br />
Wiese), am Seeburger See und an den Thiershäuser Teichen<br />
12.00 Uhr Mittagessen, anschließend Rückfahrt<br />
22.00 Uhr Ankunft in Berlin<br />
Es werden keine gesonderten Einladungen verschickt, alle Interessenten aber weiter schriftlich<br />
unterrichtet. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 60 DM je Person und schließt die Omnibusfahrt,<br />
Eintrittsgelder und Honorare für Besichtigungen und Führungen ein. Das Städtische Verkehrsbüro<br />
Duderstadt hat vorsorglich 60 Betten reserviert und hofft, auch alle Wünsche nach Einzelzimmern<br />
befriedigen zu können. Da zwei Hauptmahlzeiten im Hotel Deutsches Haus eingenommen<br />
werden, wurden der günstigere Vollpensionspreis von durchschnittlich 34,50 DM sowie einmal<br />
Übernachtung und Frühstück zum durchschnittlichen Endpreis von 23 DM vereinbart. Für<br />
das gemeinsame Sonntagsessen im Hotel-Restaurant Rodetal, 3412 Nörten-Hardenberg, wurde<br />
ein Preis von 9 DM festgelegt (Schweinekotelett „Westmoreland" mit Sauce Robert, feinen Salaten<br />
und gebackenen Kartoffeln).<br />
Richten Sie bitte Ihre Anmeldungen formlos bis zum 25. Juli 1976 an Dr. H. G. Schultze-Berndt,<br />
Seestraße 13, 1000 Berlin 65. In gewohnter Weise werden Sie dann durch Rundsdireiben über<br />
weitere Einzelheiten einschließlich der Kontonummer für die Überweisung des Kostenbeitrags<br />
unterrichtet.<br />
199
Veranstaltungen im III. Quartal 1976<br />
1. Sonnabend, 17. Juli 1976, 10.00 Uhr: Sommerausflug nach Frohnau. Rundgang und<br />
anschließende Besichtigung des Buddhistischen Hauses. Führung durch Herrn Günter<br />
Wollschlaeger.<br />
Treffpunkt vor dem S-Bahnhof Frohnau.<br />
2. Mittwoch, 28. Juli 1976, 19.30 Uhr: Vortrag von Herrn Dr. theol. Friedrich Weichen:<br />
„Bismarck als Staatsmann und Christ".<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
Im Monat August finden keine Vorträge und Führungen statt. Die Bibliothek ist<br />
zu den üblichen Zeiten geöffnet.<br />
3. 3. bis 5. September: Studienfahrt nach Duderstadt<br />
Ausführliches Programm auf der vorhergehenden Seite. Bitte Anmeldemodus beachten.<br />
4. Dienstag, 21. September 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Prof. Dr.<br />
Peter Bloch, Direktor der Skulpturenabteilung der Staatlichen Museen Preuß. Kulturbesitz<br />
Berlin: „Berliner Denkmäler des 19. Jahrhunderts und die dringend erforderlichen<br />
Maßnahmen zu ihrer Erhaltung".<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek<br />
ist zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen geselliges<br />
Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 30. Juli, 27. August und 24. September 1976, zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
ab 17.00 Uhr.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 45 30 11. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank, 1 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Claus P.<br />
Mader; Felix Escher. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt, Bezugspreis für<br />
Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
200
. • "S&<br />
Füüjabt e»#r £»< ..;.ir SiusäisibSiothek<br />
A 20 377 F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
72. Jahrgang Heft 4 Oktober 1976<br />
DANIEL CHODÖHTECKI .<br />
201
Zwischen Rokoko und Romantik<br />
Zum 250. Geburtstag von Daniel Chodowiecki<br />
Von Walther G. Oschilewski<br />
Viele der kunst- und kulturfreudigen Berliner erinnern sich der schönen Chodowiecki-<br />
Ausstellung Ostern 1965, mit der das von dem unvergessenen Edwin Redslob gegründete<br />
Berlin-Museum in seinem ersten Domizil im „Haus am Tiergarten" eröffnet wurde. Die<br />
seit Jahren unter der umsichtigen und einfallsreichen Leitung von Frau Professor Dr.<br />
Irmgard Wirth stehenden stadtgeschichtlichen Sammlungen konnten seinerzeit bereits mit<br />
eigenen Beständen aufwarten: Es waren Teile aus der Chodowiecki-Sammlung von<br />
Friedrich Nicolai (1733-1811), die die Berliner Firma Hermann Meyer & Co. erworben<br />
und dem jungen Berlin-Museum gestiftet hatte 1 .<br />
Man hat Daniel Chodowiecki als Person und als Maler und Radierer im Zusammenhang<br />
mit der Geschichte des bürgerlichen Alltags, der Gesamtkunst des Rokoko und der Berlin-<br />
Historie immer wieder und ausgiebig geschildert und gewürdigt 2 . Dennoch wäre es ein<br />
Versäumnis, wenn nicht der Verein für die Geschichte Berlins aus Anlaß des 250. Geburtstages<br />
dieses hervorragenden künstlerischen Repräsentanten Berlins gedenken würde.<br />
Es kann sich dabei nur um einen Überblick rezeptiver Natur handeln.<br />
Daniel Nicolaus Chodowiecki, am 16. Oktober 1726 in Danzig geboren, entstammte<br />
einem ursprünglich polnischen Adelsgeschlecht. Der Vater, Gottfried Chodowiecki, betrieb<br />
einen Kornhandel, die Mutter Maria Heinrica war eine geborene Ayrer, deren<br />
Vater in Leipzig beheimatet war. Die ersten künstlerischen Anregungen erhielt der junge<br />
Daniel durch seinen zeichnerisch begabten Vater, in der Malerei wurde er frühzeitig von<br />
der Schwester seiner Mutter unterrichtet. Zunächst erlernte er den Kaufmannsberuf in<br />
seiner Vaterstadt; 1743 kam der Siebzehnjährige nach Berlin, um die Lehre in der Eisen -<br />
und Kurzwarenhandlung seines Onkels Antoine Ayrer fortzusetzen. Gemeinsam mit seinem<br />
Bruder und Lehrkollegen Gottfried wurde er hier nebenher mit Aquarellminiaturen<br />
auf Dosen beschäftigt, für die französische Kupferstiche als Vorlagen dienten. Durch den<br />
Maler Johann Jakob Haid (1704-1767), aus der berühmten Augsburger Künstlerfamilie,<br />
wurden er und sein Bruder auch in der Emailmalerei unterrichtet. Diese Tätigkeiten wurden<br />
für die beiden Brüder bald zur einträglichen Hauptbeschäftigung. Aber Daniel, der<br />
stärker Begabte, wollte höher hinaus. Die kunsthandwerkliche Brotarbeit war das eine,<br />
künstlerische Ambitionen in freier Selbstentfaltung das andere. Das Zeichnen wurde ihm<br />
zur Leidenschaft. In seinem Tagebuch schreibt er: „War ich in Gesellschaft, so setzte ich<br />
mich so, daß ich die Gesellschaft oder eine Gruppe aus derselben oder auch nur eine ein-<br />
1 Edwin Redslob: Daniel Chodowiecki, Führer durch die Ausstellung im Haus am Tiergarten.<br />
Zweite Veröffentlidiung des Berlin-Museums, Berlin 1965. - Es sei in diesem Zusammenhang<br />
auch an die Chodowiecki-Ausstellung im Märkischen Museum im Oktober/November 1926<br />
erinnert.<br />
2 Zur Literatur über Chodowiecki siehe die Berlin-Bibliographie (bis 1960), 1965, S. 154 sowie<br />
den Folgeband (1961-1966), 1973, S. 68; Ernst Wermke, Bibliographie der Geschichte von Ostund<br />
Westpreußen (bis 1929), Königsberg 1933, Nr. 13271-13283 (bes. zu Herkunft u. Familie);<br />
desgl. Bd. II f. d. Jahre 1930-1938, Aalen 1964, Nr. 6579-6586; desgl. Bd. III f. d. Jahre<br />
1939-1970, Bonn 1974, Nr. 18045-18073; ferner die Angaben in dem oben Anm. 1 genannten<br />
Ausstellungsführer. Zuletzt erschien die romaneske Biographie von Carl Brinitzer: Die Geschichte<br />
des Daniel Ch., Stuttgart 1973.<br />
202
„Le Cabinet d'un Peintre" — Das Familienblatt des Künstlers, 1771<br />
zige Figur übersehen konnte, und zeichnete sie so geschwind oder auch mit so vielem<br />
Fleiß, als es die Zeit oder auch die Stetigkeit der Personen erlaubte. Bat niemals um<br />
Erlaubnis, sondern suchte es so verstohlen wie möglich zu machen; denn wenn ein Frauenzimmer<br />
(oder auch zuweilen Mannspersonen) weiß, daß man's zeichnen will, so will es<br />
sich angenehm stellen und verdirbt alles, die Stellung wird gezwungen . . . Was habe ich<br />
da zuweilen für herrliche Gruppen mit Licht und Schatten, mit allen den Vorzügen, die<br />
die Natur, wenn sie sich selber überlassen ist, vor allen den so gerühmten Idealen hat,<br />
in mein Tagebuch eingetragen! Auch des Abends bei Licht habe ich das oft getan ... Ich<br />
habe gehend, stehend, reitend gezeichnet; ich habe Mädchen im Bette in allerliebsten, sich<br />
selbst überlassenen Stellungen durchs Schlüsselloch gezeichnet." 3<br />
Angesichts dieser natürlichen und ungezwungenen Einstellung zu den Objekten denkt<br />
man unwillkürlich an Heinrich Zille, der mit gleicher Objektivation, wenn auch in einem<br />
anderen Milieu, zu einem kongenialen Umwelt- und Sittenschilderer Berlins wurde.<br />
Chodowiecki ging es um Wirklichkeitstreue, in der das Manirierte, die Idealisation keinen<br />
Platz hatte. Das entspricht sicher nicht unseren heutigen Vorstellungen, die in der Ver-<br />
3 Zit. nach Wolfgang v. Oettingen: Daniel Chodowiecki. Ein Berliner Künstlerleben im 18. Jh.<br />
Berlin 1895 (Das Tagebuch). - Chodowieckis Autobiographie ist als Ganzes unveröffentlicht.<br />
203
deutlichung des Gegenwärtigen auch das Hintergründige, das Transzendente als autonome<br />
Elemente einbeziehen, nur sollte man dabei bedenken, daß das vor über 200 Jahren<br />
geschah. Da gab es noch keinen Klee, keinen Bellmer, Janssen, Altenbourg, und es<br />
konnte sie nicht geben. Daniel Chodowiecki war und ist der Entdecker und Schilderer<br />
des bürgerlichen Alltags, ein poetischer, empfindsamer, unkonventioneller Realist zwischen<br />
Rokoko und Romantik, jener denkwürdigen Phase am Ende des galanten Jahrhunderts,<br />
aber eben kein präsumtiver Vertreter des Zopfstils, obgleich er auch viele<br />
Zöpfe gemäß dem Stil der Zeit zeichnete.<br />
Um auf Chodowieckis Jugendentfaltung zurückzukommen, soll daran erinnert werden,<br />
daß er sich auch der Ölmalerei zuwandte. 1754 ging er zu Bernhard Rode (1725-1797) 4 ,<br />
der sich von dem nach Berlin als Hofmaler berufenen Franzosen Antoine Pesne ausbilden<br />
ließ, in die Schule. Akt war ein Thema in Rodes damaliger Privatakademie, und man<br />
konnte die Brüste- und Popomalerei recht und schlecht erlernen, das war aber auch<br />
alles. Chodowiecki versuchte sich in der Genre-, Historien-, Gesellschafts- und Bildnismalerei<br />
- aber doch ohne großen Erfolg. Hier und dort sind Boucher und Watteau Vorbilder;<br />
Stiche nach Gemälden von Boucher kopierte er sogar überflüssigerweise mit Feder<br />
und Tuschpinsel. Dennoch war er mit Bernhard Rode und Johann Christoph Frisch<br />
(1738—1815) 5 einer der ersten Historienmaler, die das Realistische betonten, eigentlich<br />
auch der Stammvater des „Berliner Realismus".<br />
Chodowieckis eigentliches Feld blieb aber die Radierung, mit der er 1756 begann. Sein<br />
Mentor war Johann Wilhelm Meil (1733-1805), der Meister der zarten Titelblätter und<br />
Vignetten im französischen Rokokogeschmack. Von ihm besitzt das Berlin-Museum über<br />
1100 Arbeiten. Chodowiecki wohnte damals in dem Rollet'schen Hause in der Brüderstraße,<br />
das in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts die Nr. 7 trug 0 . Ein Jahr vor Beginn<br />
seiner Tätigkeit als Radierer ehelichte er die aus einer Berliner Hugenottenfamilie stammende<br />
Jeanne Barez, Tochter eines angesehenen Gold- und Silberstickers. Chodowieckis<br />
zweite Wohnstätte befand sich seit 1777 im Barez'schen Hause in der Behrenstraße<br />
(seinerzeit Nr. 31). Im Oktober 1772 hatte er als Hypothekengläubiger das Grundstück<br />
Nr. 57 in der Großen Frankfurter Straße für 2500 Taler erworben, aber nie dort gewohnt.<br />
Mit seinen Radierungen beweist sich Chodowiecki trotz seines polnischen Familiennamens<br />
als ein bedeutender Künstler von unverkennbar norddeutscher Art 7 , der es durchaus mit<br />
den besten Sittenschilderern Frankreichs, sei es nun Fragonard, Laueret oder Debucourt<br />
und Moreau, aufnehmen konnte. Aus Frankreich kam seinerzeit auch die Mode der<br />
künstlerisch gestalteten Almanache und Kalender nach Deutschland. In diesem publizistischen<br />
Bereich fand Chodowiecki sein eigentliches Betätigungsfeld als Illustrator. Da war<br />
zunächst der Berliner „Historisch-Genealogische Kalender", den die Königliche Akademie<br />
der Wissenschaften alljährlich herausgab. Hierfür hat er von 1768 bis zu seinem Todesjahr<br />
1801 viele Bildbeilagen geschaffen. Diese Illustrationen standen nicht immer in unmittelbarem<br />
Zusammenhang mit dem Text des Kalenders, es waren oft selbständige,<br />
1 Thieme/Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. 28, Leipzig 1934, S. 455 ff.<br />
•"' Thieme/Becker, a. a. O. Bd. 12 (1916), S. 491 ff.<br />
• Das Entree dieses Hauses zeigt die erste Zeidinung (Absdiiedsszene) von Chodowiedcis Reiseskizzen<br />
„Von Berlin nach Danzig", 1773 (siehe unten Anm. 8).<br />
' Chodowiedci - Zwischen Rokoko und Romantik. Mit 76 Abb. Ausgew. u. eingel. von E. W.<br />
Bredt, München o. J. (1918), S. 6.<br />
204
höchst subtile Bildberichte zur Geschichte Brandenburg-Preußens und zur Geschichte<br />
Friedrichs des Großen. Darüber hinaus arbeitete er über drei Jahrzehnte für den „Gothaischen<br />
Hof-Kalender", den „Göttinger Taschen-Kalender" und für ähnliche Publikationen<br />
seiner Zeit.<br />
Viele Stiche zur Literatur Deutschlands, aber auch des Auslands (Ariost, Rasender<br />
Roland; Cervantes, Don Quichote; Goldsmith, Landprediger u. a.) bezeugen die künstlerische<br />
Essenz seiner enormen Wahrnehmungen. Mit genialer Naivität und mit dem ihm<br />
eigenen Sinn für das Wesentliche hat er die literarischen Folien in bewegte Szenerien<br />
umgesetzt. So bei dem berühmten Zyklus zu Lessings „Minna von Barnhelm" vom Jahre<br />
1769, in den acht Kupfern zu Gottfried August Bürgers „Gedichten" (1778), in Claudius'<br />
„Sämtliche Werke des Wandsbecker Bothen" (1775 ff.), in Goethes „Schriften" (1775 bis<br />
1779) und in der Ausgabe von 1787-1790, in Schillers „Historischem Kalender für Damen<br />
für die Jahre 1791 bis 1793" und mit den vier Trachtenkupfern zu Lichtenbergs<br />
„Vermischten Schriften" (1800-1806). Für Lavaters „Physiognomische Fragmente" (1775<br />
bis 1778) schuf er viele Tafeln, und für Basedows, vom Geiste Rousseaus durchwirktes<br />
dreibändiges „Elementarwerk" hat er, neben sechs selbstradierten Kupfern, von den<br />
hundert Tafeln zwei Drittel Zeichnungen in Tusche und Feder als Vorlagen beigesteuert.<br />
Das Allegorische und Mythologische, das verlangt wurde, lag ihm weniger, jedenfalls<br />
fehlte ihm hierfür die größere Erfindungskraft. Die „Spannbreite" seiner Themen ist erstaunlich:<br />
sie reicht von Modekupfern bis zu Theater- und Arbeitsdarstellungen. Zu den<br />
schönsten Arbeiten gehören wohl die Kupferstichfolge mit den zwölf verschiedenen Arten<br />
205
von Liebes- und Heiratsanträgen im „Göttinger Taschen-Kalender" vom Jahr 1781 und<br />
die brillanten 108 Tafeln seiner Reise „Von Berlin nach Danzig", 1773 8 .<br />
Als Berliner liebt man das Berlinische. Nun, im Hinblick auf Chodowieckis Werk, vergegenwärtigt<br />
der allergrößte Teil seiner über 2000 Radierungen (davon 170 Einzelblätter),<br />
der Gemälde und der Handzeichnungen Leben und Menschen der preußischen<br />
Hauptstadt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es gibt aber auch nicht wenige<br />
Kostbarkeiten, die unsere Stadt topographisch erfassen. Es sei nur auf die Bleistiftzeichnung<br />
„Die Kirche in Pankow", auf die Radierungen „Das [alte] Brandenburger Tor"<br />
(1764), „Zu den Zelten im Tiergarten" (1772), von der es auch eine ölarbeit gibt, und<br />
auf die „Wallfahrt nach Französisch Buchholz" (1775) hingewiesen.<br />
Im Zeitgenössischen war Chodowiecki stets gegenwärtig. Sein Werk präsentiert als Ganzes<br />
gesehen einen bürgerlichen Kosmos, der sowohl individuelle und gesellschaftliche<br />
Bezüglichkeiten als auch Begrenztheiten des Gesellschaftlichen sinnbildlich verdeutlicht.<br />
Vieles ist naturgemäß sehr preußisch (nicht nur im Motiv), eine Bilderwelt der friderizianischen<br />
Metropole und des geistigen Deutschland, wobei auch das politische Leben jener<br />
Zeit nicht ausgespart wurde. Eine seiner ersten Radierungen „Lesender Bauer", noch ganz<br />
dem Formwillen des Barocks verhaftet, ist ein Beispiel dafür.<br />
Zweifellos dominiert bei Chodowiecki das Rokokohafte mit seinem intimen, liebenswürdig-sinnlichen<br />
Reiz, mitunter erfüllt von Mozartschen Melodien. Mutterwitz vermischt<br />
sich mit Grazie, Drolerie mit sibyllinischer Hintergründigkeit. Der Kammerton<br />
überwiegt, aber es gibt auch eine Unmenge von faszinierenden Blättern voll praller, dramatischer<br />
Realistik. Die Kaltnadel-Radierung beherrscht Chodowiecki ebenso meisterhaft<br />
wie die Aquatinta-Technik mit ihren tonigen Wirkungen und den immer wieder verblüffenden<br />
Hell-Dunkel-Effekten.<br />
In Berlin war Daniel Chodowiecki eine stadtbekannte Persönlichkeit von europäischem<br />
Ansehen. 1764, schon nach seinen frühen geätzten Drucken, wurde er Mitglied der Akademie<br />
der bildenden Künste, 1788 ihr Vizedirektor, 1797, als Nachfolger von Bernhard<br />
Rode, Direktor. Kaum vier Jahre später, am 7. Februar 1801, starb er an den „Folgen<br />
eines Schlagflusses" (Ferdinand Meyer). Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem 1780<br />
angelegten Friedhof der Französischen Gemeinde in der Chausseestraße (heute Nr. 127)<br />
vor dem damaligen Oranienburger Tor 9 .<br />
Der Göttinger Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) nannte ihn einen „Seelenmaler",<br />
was er im „bürgerlichen" Sinne wohl auch war, aber seine Berühmtheit gewann<br />
er als einer der großen Charakterzeichner des 18. Jahrhunderts.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 37, Am Fischtal 19<br />
8 Daniel Chodowiecki: Von Berlin nadi Danzig. Eine Künstlerfahrt im Jahre 1773. 108 Facsimiledrucke<br />
nach den in der Kgl. Akademie der Künste zu Berlin aufbewahrten Originalzeidinungen<br />
hrsg. vom Verlag Amsler & Ruthardt, Berlin o. J. (1883). Nachdrucke, z.T. mit Erläuterungen<br />
und dem Text aus Chodowieckis Reisetagebuch, erschienen u. a. 1923, 1937 und 1973.<br />
8 Ferdinand Meyer, einst Hauptschriftwart des Vereins für die Geschichte Berlins, schreibt in<br />
seinem Chodowiecki-Buch (Berlin 1888, S. 109), daß das Grabmal „im Laufe von fast neun<br />
Jahrzehnten verschwunden" sei. Prof. Dr. Paul Ortwin Rave suchte Grab und Grabstein vergeblich.<br />
Willi Finger-Hain fand den kleinen Grabstein zufällig im Mittelgrund des Friedhofes<br />
vom Haupteingang rechts. Eine Abbildung zeigt er in seinem Buch: „Gräber unserer Großen<br />
in Berlin", Flensburg o. J. (1965), S. 27 vor der Erneuerung nach 1960.<br />
Bildnachweis: Titelbild: Punktierstich von Mcno Haas, Berlin 1799. Originalgröße (Geh. Staatsarchiv<br />
Berlin); Seiten 203 u. 205 nach Vorlagen aus Privatbesitz bzw. bei Ferdinand Meyer,<br />
Daniel Chodowiecki, der Peintre-Graveur, Berlin 1888.<br />
206
Adolph Donath in Berlin<br />
Zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages<br />
Von Dr. Ernst G. Lowenthal<br />
„Der Berliner Kaufmann als Kunstfreund" lautet der Titel der heute noch lesenswerten,<br />
reich illustrierten Darstellung, die Adolph Donath im Jahre 1929 in der prächtig ausgestatteten<br />
Jubiläumsschrift des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller anläßlich<br />
des 50jährigen Bestehens dieser Organisation veröffentlichte („Berlins Aufstieg zur Weltstadt",<br />
Verlag Reimar Hobbing, Berlin 1929). Der 9 Dezember 1976 erinnert an diesen<br />
Kunstschriftsteller und Kunstmarktkenner, der an diesem Tage vor 100 Jahren in Kremsier<br />
(Mähren) geboren wurde. Aber die Blütezeit seines Lebens verbrachte er in Berlin.<br />
Als Emigrant starb er 1937 in Prag.<br />
Nach Studien in Wien hatte Donath an der dortigen „Neuen Freien Presse" begonnen,<br />
aber schon damals fand er die Verbindung zu deutschen Zeitungen. So kam es, daß er<br />
1905 der Kunstkritiker der „B.Z. am Mittag" wurde. Ein Jahrzehnt übte er diese Tätigkeit<br />
aus und wechselte sodann zum „Berliner Tageblatt" über, um über die Ereignisse<br />
auf dem Kunstmarkt zu berichten und 1928, nach dem Tode von Dr. Fritz Stahl, das<br />
gesamte Kunstressort dieser großen Zeitung zu übernehmen. Daneben war er, seit dem<br />
Ende des Ersten Weltkrieges, der Herausgeber der auf dem Gebiet des Kunstmarkts und<br />
des Sammlerwesens maßgebenden Halbmonatsschrift „Der Kunstwanderer" (die er in der<br />
Emigration erneut ins Leben rufen konnte). 1933 konnte er sich in sein Heimatland nach<br />
Prag retten, wo er, ungeachtet schwerer Krankheit, noch eine Zeitlang weiterarbeitete.<br />
Es muß ihm eine besondere Genugtuung gegeben haben, daß sein Opus „Wie die Kunstfälscher<br />
arbeiten" noch 1937 in Prag herauskommen konnte. Sein breites Fachwissen und<br />
seine Erfahrungen von 40 Jahren hatten ihn zur Abfassung dieses Werkes befähigt; es<br />
reihte sich würdig an seine früheren Bücher wie „Die Psychologie des Kunstsammeins"<br />
(1911), „Die Technik des Kunstsammeins" (1925) und an das von ihm herausgegebene<br />
„Jahrbuch für Kunstsammler" an.<br />
„Kunstkritik ist Sache der Erfahrung und des Gewissens. Zum Komplex ,Gewissen' gehört<br />
auch die Andacht vor dem ernsten Schaffen." Dieses ebenso überzeugende wie verpflichtende<br />
Bekenntnis schrieb Donath in das Stammbuch des Presseball-Almanachs von<br />
1930, dem das hier beigefügte Porträt entnommen ist.<br />
Kein geringerer als sein etwas älterer Fachkollege, der Kunst- und Kulturhistoriker<br />
Dr. Max Oshorn (1946 in New York gest.), der übrigens zu der erwähnten Jubiläumsschrift<br />
den Hauptteil beisteuerte, hat Adolph Donath wiederholt nachgerühmt, daß er im<br />
Bereich der Kunst als solcher und namentlich in der Kunsthändler- und Sammlerwelt<br />
„unheimlich" Bescheid wußte. Seine Kenntnisfülle und Urteilsreife zeigen sich allein<br />
schon in der in der Form äußerst knappen, aber in der Sache ergiebigen und dazu mit<br />
vielen kleinen Geschichten ausgeschmückten Berlin-Studie. Zeitlich beginnend mit dem<br />
Großen Kurfürsten und endend mit den Fayencesammlungen Berliner Kaufleute Mitte<br />
der zwanziger Jahre, vermittelt sie einen Einblick in das Berliner Kunstsammlerwesen<br />
und dessen Aufschwung vor allem im ersten Viertel unseres Jahrhunderts. Vorher gab es<br />
nur schwache Ansätze, repräsentiert beispielsweise durch Johann Ernst Gotzkowsky, den<br />
„patriotischen Kaufmann", durch den Konsul Wagner, der 1876 den Grundstock der<br />
207
Nationalgalerie gab, den Bankier Michael Wolff und Mitglieder der Familie Mendelssohn.<br />
Nach dem Kriege von 1870/71 war es (laut Donath) Dr. Wilhelm v. Bode, ein „Menschenfänger",<br />
wie ihn Wilhelm Waetzoldt an seiner Bahre rühmend-scherzhaft charakterisierte,<br />
der es verstand, die privaten Kunstsammler für die Berliner Museen zu interessieren.<br />
Als 1883 in der Akademie der Künste eine erste Ausstellung aus Berliner Privatbesitz<br />
stattfand, zählte man unter den rund 50 Leihgebern etwa 20 aus der Kaufmannschaft<br />
(so Otto Pein, Karl von der Heydt, Wilhelm Gumprecht, Oscar Hainauer). Sammler<br />
großen Stils waren Geheimrat Eduard Arnhold (1849-1925), besonders an zeitgenössischer<br />
Malerei interessiert, der Chemie-Industrielle Professor Dr. Ludwig Darmstädter<br />
(1846-1927), der Porzellane und Autographen sammelte, und Konsul Georg Jacoby<br />
(1921 gest.), der auf Japankunst spezialisiert war. Aus einer Fülle persönlicher Erinnerungen<br />
und Beziehungen schöpfend, erinnert Donath da auch an den Uhrensammler Carl<br />
Marfels, an die reichen Sammlungen von Rudolf Mosse, die er in vielen Einzelheiten<br />
beschreibt, an Carl von Hollitscher (Rembrandt, Franz Hals), an Oskar Huldschinsky,<br />
an die Graphiksammlung des Fabrikanten Paul Davidsohn, die Gläsersammlung von<br />
Kommerzienrat ]acques Mühsam und andere mehr. Am Ende des Berlin-Aufsatzes beschäftigt<br />
sich Donath mit den Beständen und dem Schicksal der Privatsammlungen des<br />
208
Geheimen Kommerzienrats Dr. Eduard Simon und von Dr. h. c. James Simon (1851 bis<br />
1932), den er als den „gesteigerten Typus des patriotischen Kaufmanns" bezeichnet.<br />
Angesichts der Tatsache, daß so viel menschliches Leben der Verfolgung durch die Nationalsozialisten<br />
und dem Krieg zum Opfer gefallen und so viel wertvolles Kunstgut in<br />
jener Zeit untergegangen ist, kommt Adolph Donaths kleinem Berlin-Kompendium, zumal<br />
es überdies manche nützliche Information über Künstler, Kunsthändler und Kunstwerke<br />
bietet, größere Bedeutung zu, als man jemals vorausahnen konnte. Auch aus solchen<br />
Erwägungen verdient das Zentenarium des Autors an dieser Stelle Erwähnung.<br />
Karl Schmidt-Rottluff<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 37, Kaunstraße 33<br />
Zum Tode des großen Künstlers, Mäzens und Berliner Ehrenbürgers<br />
Von Günter Wollschlaeger<br />
Fast 92 Jahre alt geworden, ging in den frühen Morgenstunden des sonnigen 10. August<br />
dieses Jahres einer der großen Maler unseres Jahrhunderts von uns, den Leopold Reidemeister<br />
in seinem Nachruf so treffend charakterisiert hatte: „Verfemt oder geehrt, er<br />
blieb, der er war, der unbestechliche, nur aus dem inneren Wachstum wandelbare Künstler."<br />
Karl Schmidt, der sich ab 1905 nach seinem Heimatort benannte.<br />
Der am 1. Dezember 1884 in Rottluff in der Nähe des damaligen Chemnitz geborene<br />
junge Architekturstudent erkannte schon mit 21 Jahren seine wahre Berufung in Neigung<br />
und Leidenschaft zur Malerei. Mit seinen ihr ebenfalls verfallenen Freunden und Kommilitonen<br />
der Dresdner Technischen Hochschule Fritz Bleyl, Ernst Ludwig Kirchner und<br />
Erich Heckel - die gegenseitigen Begegnungen und Bekanntschaften datieren teilweise<br />
schon aus dem Jahre 1902 - gründet er voll jugendlichen Feuers am 7. Juni 1905 die<br />
Künstlergemeinschaft „Brücke", die - daher der Name - die im allgemeinen noch immer<br />
in überlebten Konventionen verhaftete Malerei und darüber hinaus mit ihr die deutsche<br />
Kunst in die Moderne führen sollte.<br />
„Mit dem Glauben an Entwicklung, an eine neue Generation der Schaffenden wie der<br />
Genießenden rufen wir alle Jugend zusammen, und als Jugend, die die Zukunft trägt,<br />
wollen wir uns Arm- und Lebensfreiheit verschaffen gegenüber den wohlangesessenen<br />
älteren Kräften. Jeder gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt,<br />
was ihn zum Schaffen drängt." Kein künstlerisches Programm im engen Sinne, eher ein<br />
leidenschaftlicher Aufruf von Jugend zu Jugend, sich aus akademischen Traditionen zu<br />
lösen, sich endlich freizumachen von den überkommenen Schematismen, von einer bindenden,<br />
in die Sackgasse führenden Endgültigkeit. Aber schon dieses von Ernst Ludwig<br />
Kirchner in Holz geschnittene Postulat der Gruppe, das 1906 veröffentlicht wurde, verrät,<br />
was sieben Jahre später zu ihrer Auflösung führen sollte: Die künstlerische Individualität<br />
des einzelnen stand höher als die Gemeinschaft. Schmidt-Rottluff, Kirchner und<br />
Heckel wurden hierbei die Wegweiser einer neuen Kunstrichtung, der als „Deutscher<br />
Expressionismus" internationale Geltung erlangen sollte. Wie von selbst ergab sich die<br />
Verwandtschaft mit den französischen Fauves, die unter den gleichen Einflüssen standen:<br />
209
van Gogh, Gauguin, den Neo-Impressionisten und der afrikanischen und ozeanischen<br />
Plastik, nur Munchs Einwirkung fehlt. Von ihnen standen van Dongen und Vlaminck<br />
den Brücke-Malern am nächsten, die auch deren dritter Ausstellung im Juni 1908 im<br />
Dresdner Kunstsalon Richter teilnahmen. In leuchtend intensiven Farben entwickelte<br />
sich jener ausdrucksstarke, harte Stil schroffer, eckiger Konturen, den Karl Schmidt-<br />
Rottluff am kraftvollsten vertrat. Wuchtig und grell monumentalisierte er vereinfachte<br />
Naturformen. Diese radikale Formvereinfachung und die Farbreduzierung auf ungebrochene<br />
Töne bildeten die Antwort auf den Impressionismus. Trotzdem standen, wie auch<br />
bei den anderen Brücke-Malern, psychologischer Sinn, Thema und Inhalt der Schöpfungen<br />
über allem.<br />
In der groben Eckigkeit der Formen ließ sich die Künstlergruppe ebenfalls den Holzschnitt<br />
angelegen sein und erreichte auch hier durch die Vereinfachung der Zeichnung<br />
großartige Kontraste.<br />
Man arbeitete zunächst gemeinsam in der Unterkunft Kirchners, im Atelier Heckeis,<br />
einem ehemaligen Laden in Dresden-Friedrichstadt, und im Lüttichaupalais bei Fritz<br />
Bleyl.<br />
Im Jahre 1906, als die erste Wanderausstellung der „Brücke" in der Braunschweiger<br />
Kunsthandlung Dörbrandt eröffnet wird, gewinnt Schmidt-Rottluff Emil Nolde, mit<br />
dem er im Herbst zusammen auf Alsen malt, für die Gemeinschaft. Auch Hermann Max<br />
Pechstein wird durch die Bekanntschaft mit Heckel auf der Dritten Deutschen Kunstgewerbeausstellung<br />
in Dresden jetzt Mitglied der „Brücke". Im Sommer 1907 weilt<br />
Schmidt-Rottluff zum ersten Mal in Dangastermoor am Jadebusen, wo er auch in den<br />
kommenden Jahren den Sommer über malen wird, und reist als Mitglied der Vereinigung<br />
Nordwestdeutscher Künstler im Spätherbst nach Worpswede, dem Malerdorf in der<br />
Nähe Bremens. Zwei Aufenthalte in Berlin rahmen im übernächsten Jahr gewissermaßen<br />
die Monate an der See; im März 1909 besucht er in Begleitung der Kunsthistorikerin<br />
Rosa Sckapire, die er vor drei Jahren in Hamburg kennengelernt hat, die Marees-Ausstellung<br />
der Berliner Sezession und sieht sich im November bei Cassirer Cezanne an.<br />
1910, in dem Jahr, in dem die „Brücke" der unter dem Vorsitz von Pechstein in Berlin<br />
gegründeten „Neuen Sezession" beitritt, sich an ihren Ausstellungen beteiligt, und Otto<br />
Mueller Freundschaft mit Heckel und Kirchner schließt und Mitglied der Gruppe wird,<br />
arbeitet in Dangast die Oldenburger Malerin Emmy Ritter gemeinsam mit Schmidt-<br />
Rottluff.<br />
Stolz auf ihre Erfolge, siedelt die „Brücke" im Herbst des nächsten Jahres nach Berlin<br />
über: Ernst Ludwig Kirchner nach Wilmersdorf in die Durlacher Straße 14, in das Haus,<br />
in dem auch Pechstein bis zu seiner Heirat wohnt; Erich Heckel übernimmt nach dessen<br />
Umzug in die Hewaldstraße das ehemalige Atelier Otto Muellers in Steglitz in der<br />
Mommsenstraße 60, der heutigen Markelstraße, und Karl Schmidt-Rottluff mietet sich<br />
in Friedenau ein, in der Niedstraße 14, in einem Haus, dessen Bau im Gründungsjahr<br />
der „Brücke" begonnen worden war, in unmittelbarer Nachbarschaft des Marinemalers<br />
Hans Bohrdt, dessen kleines Haus heute von Günter Grass bewohnt wird. Auch Pechstein<br />
zieht nach Friedenau um, in die Offenbacher Straße 1. In Kontakt mit Herwarth<br />
Waiden, der sich mit Zeitschrift und Galerie „Sturm" für alle ihm bedeutungsvoll erscheinenden<br />
Talente einsetzt und auch die Dresdner Maler ausstellt, wandelt sich ihr<br />
Ausdruck. Sicher unter Einwirkung des Kubismus gestalten sie ihre Kompositionen in<br />
stärkerer Betonung der Geometrie konstruktiver als bisher.<br />
210
Foto: Hans Kinkel<br />
(Brücke-Museum,<br />
Bildarchiv)<br />
In Berlin arbeiteten damals viele europäische Künstler. Hier zu leben, hier zu malen und<br />
hier auszustellen, hieß Impulse zu empfangen, Anerkennung zu erhalten, Freunde zu<br />
gewinnen, bekannt zu werden und vielleicht letztlich auch Erfolg zu haben. Den Dresdnern<br />
war er beschieden.<br />
Schon seit dem Sommer 1907 verband sie - wie schon erwähnt - nur locker die Zusammengehörigkeit.<br />
Sie stellten zwar als Gruppe aus (Schmidt-Rottlufj hatte übrigens den<br />
Namen „Brücke" gefunden), sie gaben gemeinsam ihre Grafikmappen heraus, doch in den<br />
Sommermonaten malten sie - wie Schmidt-Rottluff von Anfang an - meist allein oder<br />
zu zweit, von gegenseitigen Besuchen abgesehen, an der Nord- und Ostsee oder in der<br />
Umgebung Dresdens. Schon ab 1909 enthielten auch die Mappen nur Grafiken eines einzelnen<br />
Mitglieds. Jetzt, hier in Berlin, trennen sie ihre verschiedenen Bindungen an<br />
Architekten, Kunsthändler, Museumsdirektoren oder private Sammler noch mehr. 1912<br />
stellt die Gruppe in der Galerie Fritz Gurlitt aus, und Karl Schmidt-Rottluff schafft für<br />
die Kapelle der Sonderbundausstellung in Köln in getriebenem Messing die reliefierten<br />
Köpfe der vier Evangelisten. Meinungsverschiedenheiten mit Pechstein kommen auf und<br />
im Mai 1913 löst sich die „Brücke" auf, weil eine von Kirchner für die fördernden Mitglieder<br />
verfaßte „Chronik der Künstlergruppe Brücke" nicht die Zustimmung der an-<br />
211
deren findet. Jeder Künstler hatte seine eigene Individualität bewußter entwickelt und<br />
wollte sie wahrscheinlich auch weiterhin intensiver geltend machen. Aber die Freundschaft<br />
untereinander blieb.<br />
Schmidt-Rottlujf verbringt den Sommer 1913 auf der Kurischen Nehrung in Nidden und<br />
reist über die Masurischen Seen nach Berlin zurück. Den Kriegsausbruch 1914 kurz nach<br />
dem Tod des Vaters erlebt er in Hohwacht zwischen Kiel und der Insel Fehmarn. Dieser<br />
Sommer schlägt sich in schweren, melancholischen Bildern nieder. 1915 wird er eingezogen.<br />
Nach den Kriegsjahren an der Ostfront heiratet er 1918 die Fotografin Emy Frisch aus<br />
Chemnitz; ihre und Kirchners Eltern wohnten im selben Haus. 1919 arbeitet er wieder<br />
an der Hohwachter Bucht. Höhepunkt seines Schaffens bildet jetzt die Grafik mit der<br />
Reduzierung auf Elementarformen. Er lehnt die Berufung an das Bauhaus ab und bleibt<br />
in Berlin. Ab 1923 findet er - mehr unter dem Einfluß der beiden sächsischen Bildhauer<br />
Georg Kolbe und Richard Scheibe, mit denen er in diesem Jahr nach Italien reist, als<br />
unter der Einwirkung der Malerei der Neuen Sachlichkeit, die ihm nicht liegt - zurück<br />
zur Naturnähe. Stärker konturierte Kurven lösen die eckigen Formen ab, der Stil wird<br />
sich beruhigen. Der Frühling des nächsten Jahres sieht ihn mit Georg Kolbe in Paris.<br />
1925 weilt er in Dalmatien und in den April-Monaten der Jahre 1928 und 1929 holt er<br />
sich neue Schaffenskraft im Tessin, dessen einsame Bergwelt nun in seinen künstlerischen<br />
Motivbereich einzieht.<br />
Als Studiengast der Villa Massimo in Rom durchwandert er im nächsten Jahr antike<br />
Stätten, er malt die Villa Hadriana und in der Campagna di Roma interessieren ihn die<br />
alten römischen Aquädukte. Dann, 1931, verbringt er den elften und letzten Sommer in<br />
Jershöft in Pommern. Die Preußische Akademie der Künste trägt ihm die Mitgliedschaft<br />
an, aber schon vier Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, im Mai<br />
1933, wird ihm der Austritt nahegelegt. Er vollzieht ihn ohne Umschweife. Die Jahre<br />
als „entarteter Künstler" beginnen, er wird diffamiert und verleumdet. Von 1932 bis<br />
1943, wiederum elfmal, verlebt er den Frühling im Taunus, den Sommer und Herbst<br />
dann am Lebasee in Pommern. In diesen dreißiger Jahren stilisiert er die Landschaften<br />
weniger, legt sie aber bei klarem Bildaufbau monumentaler an als früher. Großflächig<br />
formt er die Gegenstände. Insgesamt 608 Stück seiner Schöpfungen werden ab 1937 in<br />
Museen beschlagnahmt. Vier Jahre später schließt ihn die „Reichskammer der bildenden<br />
Künste" zusammen mit Nolde aus. Damit verliert er seine Existenz, denn das Berufsverbot<br />
wird polizeilich kontrolliert. Im folgenden Sommer - man schreibt nun das<br />
Kriegsjahr 1942, und die 6. Armee stürmt ihrem Untergang in Stalingrad entgegen - verbringt<br />
er auf Einladung des Grafen von Moltke einige Monate sorgenfrei malend auf<br />
dessen Stammgut Kreisau. In nicht allzu ferner Zeit wird der britische Luftmarschall<br />
Harris seine Bomberverbände verstärkt gegen Berlin einsetzen und inmitten des Widerscheins<br />
einer grausamen, ganze Wohnviertel vernichtenden Illumination heftiger Brände<br />
pausenlos einschlagender Bomben, auf das Straßenpflaster und in Häuser fallender<br />
Phosphorkanister, inmitten des Infernos stürzender Trümmer, schwirrender Steine und<br />
Splitter wird auch Schmidt-Rottluff im August 1943 in der Wilmersdorfer Bamberger<br />
Straße Atelier und Wohnung verlieren. Mit seiner Frau zieht er sich nach seinem Heimatort<br />
zurück und findet bei seinem Bruder Unterkunft. Eine fast unübersehbare Vielzahl<br />
von Aquarellen entsteht, die sechzehn Monate nach Kriegsende, im September 1946,<br />
auf seiner ersten Nachkriegsausstellung in Chemnitz zu sehen sind. Dann kehrt das Ehe-<br />
212
paar im Spätherbst nach Berlin zurück. Mit der Aufnahme der Lehrtätigkeit an der<br />
Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Charlottenburg 1947 erfüllt der Maler die<br />
schon bald nach Kriegsende von Carl Hof er ausgesprochene Bitte. Im November 1949<br />
reist er nach vollen zwanzig Jahren erstmals wieder nach Ascona, und einige Monate<br />
später weilt er wieder in Hofheim im Taunus. 1954 scheidet er aus dem Lehrkörper der<br />
Hochschule aus; seinen 70. Geburtstag feiert man in Berlin, Hamburg, Kiel und Stuttgart<br />
mit großen Ausstellungen, aber es wird stiller um ihn. Sierksdorf an der Lübecker Bucht<br />
bildet den Endpunkt seiner Aufenthalte am Meer. In dinglicher Festigkeit haben die<br />
Farben wieder Glanz und Leuchtkraft erhalten.<br />
Er hat Landschaften, Stilleben, Aktbilder und Szenen am Meer gestaltet, er hat das<br />
Leben der Bauern und Fischer dargestellt, immer unmittelbar und aus der Natur heraus.<br />
Sie zu deuten, wie er sie erfühlt, bleibt bis in sein hohes Alter persönliches Bekenntnis.<br />
Zu seinem 80. Geburtstag regt er den Bau des „Brücke"-Museums an und schenkt der<br />
Stadt, in der er fast sieben Jahrzehnte gelebt hat, in die er immer wieder zurückgekehrt<br />
ist, in ihre Lichter und in ihre Trümmer, in der er anerkannt und verfemt worden war,<br />
die 74 ihm zu Ehren in der Akademie der Künste gezeigten Schöpfungen. Leopold<br />
Reidemeister, der Freund, gewinnt auch Erich Heckel, der seit 1944 in Hemmenhofen<br />
am Bodensee lebt, für die Idee. So kann der Senat am Geburtstag Schmidt-Rottluffs, am<br />
1. Dezember 1964, den Bau des Museums beschließen. Er wird im August 1966 nach<br />
einem Entwurf Werner Düttmanns begonnen, von dem Maler finanziell unterstützt, und<br />
nach dreizehn Monaten im September des nächsten Jahres abgeschlossen. Ein eingeschossiger<br />
Flachbau mit zweihundert laufenden Metern Ausstellungsfläche ist entstanden. Nach<br />
dem Wunsch Heckeis und Schmidt-Rottluffs, den beiden Freunden aus dem Jahre 1901,<br />
die mit ihren großzügigen Schenkungen seinen Grundstock bildeten, wird er auch die<br />
individuellen Entwicklungen der Maler nach Auflösung ihrer Gemeinschaft interpretieren<br />
und ebenfalls jenen Künstlern, die einst mit den Brücke-Malern gemeinsam ausgestellt<br />
haben, Raum gewähren. Großzügig hat Karl Schmidt-Rottluff nicht nur seine eigenen<br />
Werke geschenkt, sondern durch Ankäufe von Bildern anderer wichtiger zeitgenössischer<br />
Maler für dieses Museum dessen Präsentations- und Dokumentationsmöglichkeiten erheblich<br />
erweitert. So hält dieses Institut heute das Schaffen der „Brücke" lebendig und ist<br />
darüber hinaus durch die Einmaligkeit seiner Bestände zum Zentrum der „Brücke"-<br />
Forschung geworden.<br />
Karl Schmidt-Rottluff, der viel geehrte, stille, versonnene Mann, hat bis zum Tode seiner<br />
Kunst gelebt, und diese Kunst hat stets auf die Menschen gewirkt. Seine Schüler haben<br />
sie in der Tradition eines gemäßigten Expressionismus weitergetragen. Möge dem Haus<br />
am Bussardsteig 9 beschieden sein, diese Kunst in Ursprung und Ursprünglichkeit auch<br />
künftigen Generationen gegenüber lebendige Gegenwart werden zu lassen.<br />
In Würdigung der Verdienste um dieses künstlerische Schaffen und Bewahren ehrte die<br />
Stadt Berlin ihren Mitbürger Karl Schmidt-Rottluff mit ihrer höchsten Auszeichnung und<br />
verlieh ihm am 10. April 1970 die Rechte eines Ehrenbürgers.<br />
Anschrift des Verfassers: 1 Berlin 41, Niedstraße 14<br />
213
In memoriam E.T. A. Hoffmann<br />
Von Claus P. Mader<br />
Am 24. Januar 1976 jährte sich zum 200. Male der Geburtstag des Mannes, den die<br />
deutsche Literaturgeschichte nicht zu Unrecht als das universalste Genie unter den Spätromantikern<br />
bezeichnet. Schon aus Anlaß seines 150. Todestages, am 25. Juni 1972, erschien<br />
in den „Mitteilungen" des Vereins für die Geschichte Berlins, Hefte 7 und 8 von<br />
1972, ein Beitrag, der dem Leben und Werk dieses Berliner Bürgers gewidmet war. Es<br />
bleibt deshalb heute nur die Pflicht des Chronisten, eine Zusammenfassung der Veranstaltungen<br />
des gegenwärtigen Gedenkjahres zu erstellen.<br />
Es begann mit einer Fernsehsendung der ARD am 19. Januar. Unter dem Titel „Nach<br />
Träumen jagen . . ." trugen die Autoren Margot Berthold und Franz Baumer „Fragmente<br />
zu einer romantischen Existenz" (so der Untertitel) zusammen. Anhand von Bild- und<br />
Tonmaterialien versuchten sie der genialen Vielseitigkeit dieses Mannes gerecht zu werden.<br />
Leider gelang dies nicht so wie erhofft. Schon im Verlauf der 45minütigen Sendung<br />
konnte der „unwissende" Zuschauer zu dem trügerischen Schluß gelangen, es hier mit<br />
einem recht weinseligen und realitätsfremden Künstler zu tun zu haben, welcher nebenbei<br />
auch noch etwas Juristerei betrieb.<br />
Daß dem nicht so war, machte am Vorabend des 200. Geburtstages Hoffmanns eine<br />
Gedenkveranstaltung offenkundig, die im Berlin-Museum stattfand. Hier an seiner Wirkungsstätte,<br />
dem ehemaligen Kammergericht, gelang eine „Symbiose zwischen Kunst und<br />
Justiz". Nach der Begrüßung der 300 geladenen Gäste, zumeist Juristen, durch den<br />
Senator für Wissenschaft und Kunst Gerd Löffler ergriff der damalige Senator für Justiz<br />
und Bürgermeister Hermann Oxfort das Wort. Er war gleichzeitig mit dem Erstgenannten<br />
auch Schirmherr der Veranstaltung und der Ausstellung im Berlin-Museum. Im Verlauf<br />
seiner Rede kam der Senator nach einer Würdigung des Geburtstagskindes auf die<br />
große Anzahl von Dichter-Juristen zu sprechen und nannte die wichtigsten innerhalb der<br />
deutschsprachigen Literatur: Martin Opitz, Andreas Gryphius, Goethe, Heinrich von<br />
Kleist, Novalis, Achim von Arnim, Joseph Freiherr von Eichendorff, Ludwig Uhland,<br />
Franz Grillparzer, Karl Immermann, Adalbert Stifter, Fritz Reuter, Theodor Storm,<br />
Gottfried Keller, Josef Viktor von Scheffel, Felix Dahn, Frank Wedekind und Franz<br />
Kafka. Auch „das Kammergericht war Gott sei Dank, immer literarisch. Das Literarische<br />
macht frei". Dieser Satz aus dem Roman „Frau Jenny Treibel" von Theodor Fontane<br />
sei ebenfalls eine Anspielung auf seine Zeitgenossen, die Kammergerichträte und Dichter<br />
Ernst Wiehert und Wilhelm von Merckel sowie die Referendare dieses Hauses Heinrich<br />
Wilhelm Wackenroder, Willibald Alexis und Karl Simrock. Nach einem Wort des Dankes<br />
an alle Beteiligten schloß diese Rede mit einem Satz aus dem 10. Buch von „Dichtung<br />
und Wahrheit". Den anschließenden Festvortrag „E. T. A. Hoff mann als Jurist. Eine<br />
Würdigung zu seinem 200. Geburtstag" hielt Prof. Dr. Arwed Blomeyer, dem es ebenfalls<br />
gelang, das Motto dieser Veranstaltungen „Kunst und Justiz" zu erfassen und die<br />
vielen Komponenten dieser Verbindung aufzuzeigen. Mit einem Empfang fand die Feier<br />
ihren würdigen Abschluß.<br />
214
Natürlich nahm sich auch die hiesige Presse des Themas „E. T. A. Hoffmann" an, doch<br />
waren die Beiträge zum Teil sehr kurz und enthielten kaum die wichtigsten Daten. Aber<br />
es gab auch eine Reihe annehmbarer Aufsätze. Unter der Überschrift „Ausgezeichnet im<br />
Amte" brachte der „Tagesspiegel" am 24. Januar einen Beitrag, der sich hauptsächlich<br />
mit Hoffmanns Zeit als Kammergerichtsrat befaßte, ohne jedoch die anderen wichtigen<br />
Lebensdaten zu vergessen. Die „Berliner Liberale Zeitung" veröffentlichte in ihrer Nummer<br />
3 die Begrüßungsansprache des zuvor beschriebenen Festaktes im Berlin-Museum.<br />
„Ein Vermächtnis des romantischen Berlin" war die Titelzeile, unter der der „Tagesspiegel"<br />
am 15. Februar auf die konzertante Aufführung von Hoffmanns „Undine"<br />
durch den Chor der St.-Hedwigs-Kathedrale am 14. und 15. Februar in der Philharmonie<br />
einging.<br />
Die Uraufführung der „Undine" - Hoffmanns achtes und auch zugleich letztes Opernwerk<br />
- lief am 3. August 1816 unter der Leitung Bernhard Rombergs im Schauspielhaus<br />
am Gendarmenmarkt über die Bühne. Sie fand damals eine gute Resonanz und<br />
wurde bis zum Brand des Schauspielhauses am 30. Juli 1817 dreiundzwanzigmal vor<br />
„fortwährend gedrängt vollem Hause" gespielt. Das Textbuch der Oper stammt von<br />
Friedrich de la Motte-Fouque, der die Handlung in drei recht lange inhaltsreiche Akte<br />
zusammenfaßte. Der Inhalt, eher episch-anschaulich und lyrisch als dramatisch, ist mit<br />
dem der späteren „Undine" Lortzings bis auf Geringfügigkeiten identisch, da auch dieser<br />
sich an den Text von la Motte-Fouque hielt. Die Aufführung der ersten Fassung dieser<br />
„Zauberoper", 150 Jahre nach der Premiere, war eine gelungene Ehrung. Die Musik, von<br />
Hoffmann durch mannigfache Wechsel von Rhythmus und Tempo stark akzentuiert, soll<br />
die Doppelnatur des Geisterreiches andeuten. Diese Erstfassung ist vom Musikalischen<br />
her die weitaus diffizilste und verlangt vom Publikum ein hohes Maß an Konzentration.<br />
Ein vollbesetztes Haus dankte den Solisten, dem Chor und dem Radio-Symphonie-<br />
Orchester Berlin unter der Gesamtleitung des Dirigenten Roland Bader mit lebhaftem<br />
Beifall. Zu erwähnen ist noch, daß dieses 4. Abonnementskonzert vom Hörfunk mitgeschnitten<br />
wurde.<br />
Unmittelbar danach, am 16. Februar, ging die Premiere „Im Kabinett des E. T. A. Hoffmann"<br />
über die Bühne des Kleinen Theaters am Südwestkorso. Bis zum 27. Juli wurde<br />
dem recht zahlreich erschienenen Publikum ein „Punsch" - von Hoffmann ein immer<br />
geschätztes Getränk - angeboten, dessen Zutaten aus der Märchen- und Geisterwelt<br />
stammten und der durch hintergründigen Humor verfeinert wurde. Da tauchen<br />
jene skurrilen Gestalten auf, die wir z. B. aus dem „Goldenen Topf" und aus „Klein<br />
Zaches" kennen; der höhnende Rat Krespel, der Archivarius Lindhorst mit seinen drei<br />
Töchtern, der kleine Obergerichtsrat Drosselmeyer und viele andere, umgarnt von bösen<br />
Hexen und lieblichen Feen, um uns in eine Zauberwelt zu entführen. Es war weder eine<br />
große literarische Veranstaltung, noch gar ein anspruchsvoller Theaterabend; nein, es war<br />
ein amüsanter und befreiender Theaterspaß. Dank hierfür sei den Schauspielern Michael<br />
Chevalier, Christian Sorge, Wolf gang Wiehe und vor allem Ursula Heyer, aber auch all<br />
jenen hinter der Bühne. Die aufgeschlossenen Zuschauer waren für diese oft recht zeitkritischen,<br />
romantischen Visionen in einer unromantischen Zeit entzückt und verließen<br />
nach langanhaltendem Beifall zufrieden das Theater.<br />
Am 9. April wurde dann die Ausstellung „E. T. A. Hoffmann und seine Zeit" im Berlin-<br />
Museum von Frau Prof. Dr. Irmgard Wirth eröffnet. Nach einer Einführung in den thematischen<br />
Aufbau dieser Ausstellung und dem Dank an die zahlreichen Leihgeber, allen<br />
215
voran die verschiedenen Museen der Stadt Bamberg, die dort ansässige E. T. A. Hoffmann-Gesellschaft<br />
und die Berliner Museen, las Dr. Walter Tappe „Hoffmann in Warschau"<br />
aus Hoffmanns Leben und Nachlaß, herausgegeben von Julius Eduard Hitzig in<br />
Berlin 1823. Die Ausstellung mit ihren über 270 Exponaten - Gemälde, Graphik, Dokumente,<br />
Bücher, Photographien - enthält auch Teile einer Ausstellung der E. T. A. Hoffmann-Gesellschaft<br />
und des Kunstvereins Bamberg, welche unter dem Motto „Die Wandlungen<br />
des E. T. A.-Hoffmann-Bildes" im Januar und Februar in Bamberg gezeigt<br />
wurde. Aufgegliedert in elf Unterthemen bot sich den zahlreichen Besuchern ein recht<br />
vollständiger Überblick über das Leben des Dichters, seine Zeit und seine Zeitgenossen.<br />
Interessant war auch zu sehen, in wie vielfältiger Art und Weise sowohl von der künstlerischen<br />
Auffassung als auch von der technischen Ausführung die Werke Hoffmanns<br />
illustriert wurden - und noch werden. Neben Hoffmann selbst seien hier nur Theodor<br />
Hosemann, Alfred Kubin, Hugo Steiner-Prag, Josef Hegenbarth, Eberhardt Brucks,<br />
Gerhard Ulrich, Andreas Brylka und Erich Jasorka für viele andere genannt.<br />
Im Rahmen der eigentlichen Ausstellung lief bis zum 7. Juli eine Veranstaltungsreihe,<br />
die besondere Aspekte und Themen der Hoffmann-Forschung brachte. So hielt Prof.<br />
Hans-Dieter Holzhausen am 30. April einen informativen Lichtbildervortrag unter dem<br />
Titel „E. T. A. Hoffmann - Der Maler und Zeichner". Anhand eines ausgezeichneten<br />
Bildmaterials brachte der Vortragende die Bilder, Karikaturen und Illustrationen dieses<br />
großen Künstlers einem sehr zahlreich erschienenen Publikum näher. Die Mitglieder und<br />
Freunde des Vereins für die Geschichte Berlins hatten dann Gelegenheit, den Vortrag am<br />
1. Juni im Rathaus Charlottenburg zu hören. Hier entspann sich nach dem Vortrag noch<br />
eine lebhafte Aussprache darüber, ob die Malerei Hoffmanns den Wert seiner schriftstellerischen<br />
Arbeiten erreicht. Lobenswert soll noch kurz der Ausstellungskatalog erwähnt<br />
werden. Er bringt neben Übersichten und einem großen Abbildungsteil hervorragende<br />
Beiträge. Prof. Dr. Hans Meyer, Dr. Friedrich Schnapp, Dr. Günther, Prof. Dr.<br />
Irmgard Wirth und Dr. Elke Riemer zeichnen dafür verantwortlich.<br />
Literarisches von und über Hoffmann gab es in dieser Zeit selten. Schon 1972, zum<br />
150. Todestag, waren wohlfeile Ausgaben seiner Märchen und Geschichten herausgekommen,<br />
welche durch Sachliteratur ergänzt wurden, und hatten den Markt bereits gesättigt.<br />
Trotzdem sah man hin und wieder Buchhandlungen, die noch einmal auf Hoffmann aufmerksam<br />
machten und vor allen Taschenbuchausgaben seiner Werke anzeigten. Ein Bändchen<br />
soll dabei noch erwähnt werden. Es ist das diesjährige Heft 3 des „Berliner Forums",<br />
jener seit Jahren vom Presse- und Informationsamt des Landes Berlin herausgegebenen<br />
Schriftenreihe. Hans Günther, 1961 vom Abgeordnetenhaus von Berlin zum Generalstaatsanwalt<br />
beim Kammergericht gewählt, bis 1975 in diesem Amt und jetzt im Ruhestand,<br />
schreibt über „E. T. A. Hoffmanns Berliner Zeit als Kammergerichtsrat". Der<br />
Autor behandelt speziell den Fall „Turnvater Jahn" und erläutert die damalige juristische<br />
Situation der sogenannten Demagogenverfolgungen. Aber auch die „Knarrpanti-<br />
Episode", der „Kamptz-Knarrpanti-Skandal" und das Verbot des „Meister Floh" werden<br />
neben Privatem und Literarischem ausführlich behandelt. Der Jurist und Kammergerichtsrat<br />
Hoffmann ist jedoch stets präsent. Günther belegt durch Beispiele die „strengste<br />
Sachlichkeit", mit der jener seine Voten aufsetzte und die so gar nicht zum Bild des<br />
„Gespenster-Hoffmanns" paßten. Am 2. Januar 1820 hatte der Vorsitzende der „Königlichen<br />
Immediatkommission", der Vizepräsident von Trützschler, in seinem Jahresbericht<br />
über ihn u.a. geschrieben: „Hier steht zu meiner Freude der Kammergerichtsrat Hoff-<br />
216
mann, seit 22 Jahren im königlichen Dienst immer noch oben an. Das Vorurteil, daß ein<br />
genialer Schriftsteller für ernste Geschäfte nichts tauge, hat wohl nicht leicht jemand vollständiger<br />
widerlegt als er." Trotz dieser guten Arbeit muß auf einen Fehler hingewiesen<br />
werden. In der Bildlegende zum Grabstein auf Seite 117 heißt es: „Der originale Grabstein<br />
zerfiel Anfang dieses Jahrhunderts und wurde durch einen Graphitstein mit unveränderter<br />
Inschrift ersetzt . . ." Richtig ist vielmehr, daß sich dieses aus Sandstein gefertigte<br />
Original noch 1902 in gutem Zustand befand. Es wurde jedoch im selben Jahr vom<br />
Kirchenvorstand der Jerusalems-Gemeinde abgerissen und durch das jetzige, bar „unnützen<br />
Beiwerks", ersetzt.<br />
Neben all den vorgenannten gab es noch eine Reihe von kleineren Veranstaltungen, wie<br />
z. B. Sendungen im Hörfunk, Dichterlesungen oder die jährliche Zusammenkunft der<br />
hiesigen Mitglieder der E. T. A.-Hoffmann-Gesellschaft, zu der in diesem Jahr auch Dr.<br />
Friedrich Schnapp begrüßt werden konnte. Vermerkt sei noch an dieser Stelle die Herausgabe<br />
einer von Siegmund Schütz entworfenen Plakette der Staatlichen Porzellan-<br />
Manufaktur Berlin. Schon im Dezember 1975 war bei den Geldinstituten eine silberne<br />
E. T. A.-Hoffmann-Medaille erhältlich, für deren Erscheinen die E. T. A.-Hoffmann-<br />
Gesellschaft verantwortlich zeichnet.<br />
*<br />
Selbstverständlich ehrte auch die Stadt Bamberg E. T. A. Hoffmann, dessen musikalische<br />
Schaffensperiode hauptsächlich in die dortige Zeit (1808 bis 1813) fällt. Neben der bereits<br />
erwähnten Ausstellung „Die Wandlungen des Hoffmann-Bildes" waren es vor allem<br />
die Festtage der E. T. A.-Hoffmann-Gesellschaft vom 18. bis 20. Juni 1976. Es begann<br />
mit der Eröffnung einer weiteren Ausstellung am 18. Juni in der Eingangshalle der<br />
Staatsbibliothek: „E. T. A. Hoffmann - Leben und Werk in zeitgenössischen Dokumenten".<br />
Festvorträge, Filme, die diesjährige Mitgliederversammlung der Gesellschaft, eine<br />
„Feuchte Gedenksitzung zum 200. Geburtstag" im Keller des ehem. Katharinenspitals -<br />
„Hoffmanns Katakomben" - sowie Chor- und Orchester-Musik des Meisters, vervollständigten<br />
die Feierlichkeiten und gaben diesen einen gebührenden Rahmen. Es bleibt<br />
den jährlichen „Mitteilungen der E. T. A.-Hoffmann-Gesellschaft" vorbehalten, eine wertende<br />
Bilanz dieser Tage vorzunehmen.<br />
*<br />
Zum Abschluß dieses kurzen, sicher nicht vollständigen Rückblicks, möge noch einmal die<br />
Grabinschrift stehen: „E. T. W. Hoffmann - Kammergerichtsrat - ausgezeichnet im Amte,<br />
als Dichter, als Tonkünstler, als Maler."<br />
Dies sei hiermit von seinen Freunden bestätigt.<br />
Nachrichten<br />
Studienfahrt nach Duderstadt vom 3. bis 5. September 1976<br />
Beinahe wäre die diesjährige Exkursion nach Duderstadt und ins Untereichsfeld nodi in letzter<br />
Minute an organisatorischen Problemen gescheitert, hatte doch „Der Tempelhofer" den bei 60<br />
Teilnehmern erforderlichen doppelstöckigen Omnibus ohne vorherige Verständigung kurzfristig<br />
anderweitig vermietet und lediglich einen normalen Reisebus bereitgestellt, der auch sdion bessere<br />
Tage gesehen hatte. Mit Hilfe von privaten Personenwagen konnte dieses Debakel indes umgan-<br />
217
gen werden. Erste Etappe war fast schon traditionsgemäß der Besuch einer Brauerei, diesmal der<br />
Städtischen Brauerei Northeim, deren Prokurist und technischer Leiter Dipl.-Br.-Ing. Klaus Thinius<br />
die Gäste durch die bemerkenswert moderne Einrichtung führte, die sich auch in den alten<br />
Gemäuern eines Torturmes und in den ehemaligen Wallanlagen der Stadtbefestigung eingenistet<br />
hat. Dr. Hans Günter Schultze-Berndt berichtete „Zur Geschichte des Brauwesens in Northeim",<br />
was den munteren Zuspruch zum vorzüglichen Northeimer Bier im Rahmen des gastfrei gebotenen<br />
Imbisses nicht bremsen konnte. Sozusagen als Kontrast zu einem Gewerbe mit ehrwürdiger<br />
Tradition erwies sich der anschließende Besuch des Max-Planck-Instituts für Aeronomie in Katlenburg-Lindau,<br />
dessen Bedeutung und Aufgaben sowie bisherige Erfolge von Herrn Braun in<br />
sehr anschaulicher Weise geschildert wurden. Das Erstaunen betraf die hochmoderne Forschungsrichtung<br />
nicht minder als den Standort dieses Instituts von Weltruf.<br />
Am folgenden Sonnabend erwartete Verkehrsdirektor Gerlach seine Gäste vor dem Rathaus, aus<br />
dessen Turmluke pünktlich um 9.00 Uhr der „Anreischken" die interessierte Menge mit Kopfnicken<br />
begrüßte. Den Schaudern beim Besuch der Folterkammer dieses ältesten Rathauses im<br />
deutschen Sprachgebiet folgten die Freuden beim Kennenlernen der Schätze des Archivs Duderstadts,<br />
eines Gemeinwesens im Herzen Deutschlands, das auf eine ebenso reiche wie bewegte<br />
Geschichte zurückblicken kann. Zwischen die beiden Besichtigungen der St. Cyriakuskirche und<br />
der St. Servatiuskirche war der Besuch des Heimatmuseums eingeschoben worden, dessen Sammlungen<br />
noch längeres Verweilen gelohnt hätten. An einigen ausgewählten Straßenzügen schilderte<br />
Verkehrsdirektor Gerlach dann die Entwicklung des Fachwerkbaus von der Gotik bis zum Barock.<br />
Er tat dies ebenso kenntnisreich wie einfühlsam, und mancher Berliner schlug sich an die<br />
Brust, weil er nicht schon früher die Bekanntschaft mit Duderstadt gemacht hat, einer Stadt, die<br />
einst als ,urbs opulentissima' galt und der man heute ohne Zögern zugesteht, eine ,urbs pulcherrima'<br />
zu sein.<br />
Am Nachmittag bestaunten die Reisegefährten die Rhumequelle, eine der ergiebigsten Quellen<br />
Europas, aus der jeder Einwohner Deutschlands täglich einen Eimer Wasser erhalten könnte.<br />
Offensichtlich fühlten sich der Nöck und seine Nixen in ihrer Ruhe gestört, denn bei der Besichtigung<br />
der frühhistorischen Burganlage „König Heinrichs Vogelherd" bei Pöhlde öffnete der<br />
Himmel seine Schleusen, und die Besucher bezogen den Namen „Fluchtburg" darauf, daß sie diesen<br />
Platz fluchtartig verließen. Hier wie später auf dem Pfalzgelände und in der Kirche von<br />
Pöhlde erwies sich Pastor Klaus Gierth, in der vierhundertfünfzigjährigen Geschichte dieser Pfarrei<br />
21. Inhaber der Pfründe, als ein kenntnisreicher Liebhaber-Archäologe und als liebenswürdiger<br />
Übermittler historischer Abläufe.<br />
Die Sonne schien wieder, als am Sonntagmorgen der Konvoi in Richtung Germershausen aufbrach,<br />
um dort die Wallfahrtskirche Maria in der Wiese zu besuchen. Pfarrer Friedbert Bauer<br />
OSA schilderte die Geschichte der Marienwallfahrt des Eichsfeldes und des Gnadenbildes von<br />
Germershausen, wußte aber auch den Fragen nach der Historie des Augustiner-Ordens in Deutschland<br />
und nach ihrer heutigen Arbeit die rechte Antwort zu geben. Mit einem Dank an Pater<br />
Friedbert und mit der Erinnerung an dieses kleine Gotteshaus mit seinem wunderschönen Herbstblumenschmuck<br />
fuhren die Teilnehmer entlang des Seeburger Sees nach Ebergötzen weiter, wo<br />
Bürgermeister Edel und Geschäftsführer Klaus Dollmaier vom Förderkreis-Wilhelm-Busch-Stätten<br />
Ebergötzen ihrer bereits vor der Mühle harrten. Sie wurden in den Erdenwandel Wilhelm Buschs<br />
in Ebergötzen eingeführt und betrachteten mit Interesse die Mühle und die Erinnerungsstücke an<br />
den weisen Humoristen und Maler. Abschließend wäre noch festzustellen, daß offensichtlich allen<br />
das gemeinsame Sonntagsessen im Hotel-Restaurant Rodetal bei Nörten-Hardenberg gemundet<br />
hat und daß sie mit der Kaffeetafel im Harzhotel Kreuzeck in Hahnenklee zufrieden waren.<br />
Wirtschaft und Wissenschaft, Historie und Baukunst, Kirchengeschichte und Literaturkunde bildeten<br />
den bunten Strauß der diesjährigen Exkursion. Ihr soll im nächsten Jahr eine Studienfahrt<br />
in das Wendland und den Naturpark Elbufer-Drawehn folgen. H. G. Schultze-Berndt<br />
Der 21. Stadtbezirk Berlins<br />
Auf den westlichen Teil Berlins sind bei der Trennung zwölf, auf die östliche Stadthälfte acht<br />
Bezirke entfallen. Jetzt werden in Ost-Berlin Überlegungen angestellt, einen neunten Stadtbezirk<br />
zu gründen, der im Westen von der S-Bahnlinie in Richtung Ahrensfelde, im Süden vom Biesdorfer<br />
Kreuz und im Osten von der Hellersdorfer Kippe begrenzt wird. Im Norden reicht das<br />
Gebiet des neuen Bezirks bis etwa 2 km südöstlich von Falkenberg. Im Ortsteil Marzahn, der<br />
zu diesem neuen Bezirk gehört, soll der dörfliche Charakter beibehalten und der Dorfanger<br />
rekonstruiert werden. Von den 560 ha Fläche des neunten Stadtbezirks entfallen 200 ha auf das<br />
Naherholungsgebiet Wühle östlich des eigentlichen Wohngebietes. Man beabsichtigt, die Wühle zu<br />
stauen und die Hellersdorfer Kippe von 30 m auf 50 m aufzustocken, um hier einen Park ent-<br />
218
stehen zu lassen. Die jetzt als Tümpel zu bezeichnenden Gewässer in diesem Gebiet werden als<br />
kleine Seen zwischen den Wohnstraßen erhalten bleiben. In diesem Stadtbezirk, der in Nord-<br />
Süd-Richtung 5,5 km Ausdehnung hat und 1 bis 1,8 km breit ist, werden 35 000 neue Wohnungen<br />
errichtet, von denen 20 000 bis 1980 fertiggestellt sein sollen. Den in der Endplanung 100 000<br />
Einwohnern stehen in den Wohngebieten neun „Nebenzentren" mit je einer Kaufhalle, einer<br />
„Klubgaststätte" und einem „Dienstleistungshaus" zur Verfügung. Den Anschluß an die Innenstadt<br />
besorgt die S-Bahn, die mit fünf Bahnhöfen, von denen drei noch gebaut werden, entlang<br />
des Stadtbezirks vertreten ist. Neben Omnibussen fährt auch die ,Tatra'-Straßenbahn über Leninallee/Berliner<br />
Chaussee sowie über Herzbergstraße/Springpfuhlstraße in das neue Stadtgebiet.<br />
Durchgangsstraßen in West-Ost-Richtung sind im Gebiet dieses Bezirks nicht anzutreffen. Lediglich<br />
die Berliner Chaussee geht ihrer Funktion als Autobahnzubringer wegen quer durch den<br />
neunten (einundzwanzigsten) Bezirk Berlins. Diese Angaben sind der „Berliner Zeitung" (Ost)<br />
Nr. 106 vom 4. Mai 1976 entnommen. H. G. Schult2e-Berndt<br />
*<br />
Wie schon in unseren vorigen „Mitteilungen" angekündigt, werden diesjährig - hundertundfünfzig<br />
Jahre nach dem Umbaubeginn durch Schinkel - erstmalig die „Musischen Wochen im Schloß<br />
Glienicke" durchgeführt, deren Veranstaltungen von Oktober bis Januar an jedem zweiten<br />
Sonnabend des jeweiligen Monats um 16.00 Uhr beginnen. Wir veröffentlichen nachstehend das<br />
Programm:<br />
9. Oktober: „Schloß und Park von Glienicke - Idee und Schöpfung". Lichtbildervortrag von<br />
Günter Wollschlaeger.<br />
13. November: „Wanderungen und Fahrten in der Mark Brandenburg". Lesung von Hans Scholz.<br />
17. Dezember: „Gedanken und Betrachtungen in Reimen". Frau Margot Apostol eröffnet die<br />
Kunstausstellung mit Bildern von Ruth Rieger, Jutta Wolters, Walter Bewersdor)<br />
und August Endruschat.<br />
".Januar: „Märkische Notizen". Am Flügel: Arthur Baldszuhn, Rezitationen: Brigitta<br />
Spiegel.<br />
Personalien<br />
Walter Jarchow verstorben<br />
Wie erst jetzt bekannt wird, ist unser langjähriges Mitglied Walter Jarchow vor einiger Zeit verstorben.<br />
In den Jahren des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte er zu den tatkräftigen<br />
und bewährten Mitarbeitern des Vereins für die Geschichte Berlins, in dessen Vorstand<br />
er bis zu seinem Ausscheiden aus Altersgründen beständig, doch unauffällig mitwirkte. Auf seinen<br />
eigenen Wunsch ist nie bekannt geworden, in welch starkem Maße er unsere Arbeiten auf finanziellem<br />
Gebiet förderte. In seinem Heimatbezirk Wilmersdorf betätigte er sich eine Zeit lang<br />
auch mit Erfolg als Kommunalpolitiker. Seine umfangreiche Arbeit über die städtebauliche Entwicklung<br />
Berlins ist ein wertvoller Beitrag für das Jubiläumsjahrbuch aus Anlaß des hundertjährigen<br />
Bestehens des Vereins gewesen, an dem er auch sonst mit Tatkraft mitgearbeitet hat. Nicht<br />
minder verdienstvoll war sein Mitwirken im Verein Berliner Architekten und in deren Schinkel-<br />
Kommission. Seit er in der Nähe Riedenburgs im Altmühltal eine Wahlheimat gefunden hatte,<br />
war es ruhiger um ihn geworden. Wir werden unserem Weggefährten und verdienstvollen Mitglied<br />
Walter Jarchow ein ehrendes Andenken bewahren. H. G. Schultze-Berndt<br />
Der Fachbereich Neuere deutsche Literatur und Kunstwissenschaften der Philipps-Universität<br />
Marburg hat unser Mitglied Professor Julius Posener zum Doktor der Philosophie ehrenhalber<br />
ernannt. Dem ebenso kundigen Historiker wie streitbaren Kritiker der Architektur, von Kahlschlagsanierern<br />
besonders von Landhäusern gefürchtet, gilt ein herzlicher Glückwunsch.<br />
219
Im Beisein von Ministerpräsident Alfons Goppel und von Alt-Bundeskanzler Professor Dr. Ludwig<br />
Erhard ist unserem Mitglied, dem Verleger Axel Springer, am 18. Juni 1976 in München die<br />
„Jakob-Fugger-Medaille für hervorragende Verdienste um das Zeitungswesen" verliehen worden.<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Frau Hertha Cleinow, Frau Margarete Gauger, Herrn Prof. Dr. Wilhelm<br />
Heim, Herrn Dr. Heim Hugo, Herrn Wilhelm Kielhorn, Herrn Walter Kopp, Herrn Erwin<br />
Schulze; zum 75. Geburtstag Frau Marga Altmann, Frau Elisabeth Kühne, Herrn Prof. Dr. Karl<br />
Göpp, Herrn Dr. Kurt Haußmann, Herrn Prof. Dr. Wilhelm Richter, Herrn Günter Wichmann;<br />
zum 80. Geburtstag Herrn Wilhelm Mann.<br />
Buchbesprechungen<br />
Walther G. Oschilewski: Zeitungen in Berlin. Im Spiegel der Jahrhunderte. Berlin: Haude &<br />
Spener 1975. 326 S. m. 66 Abb., geb., 30 DM.<br />
„Zeitungen sind", wie Jean Paul einmal sagte, „Sprechwerkzeuge der Stunde, Mikroskope und<br />
folglich Brenngläser der neuen Zeit, die stärker ergreifen als die Fernrohre der Geschichtsschreiber."<br />
Dieses Zitat aus dem Vorwort des Verfassers bestimmte auch - nach eigener Aussage -<br />
den Tenor der Arbeit, die darüber hinaus auch noch ein Beitrag zur politischen und kulturellen<br />
Geschichte Berlins sein soll. Und sie ist ein guter Beitrag!<br />
Als Autor und Herausgeber vieler Artikel und Bücher ist Oschilewski weit über die Grenzen<br />
unserer Stadt bekannt und geschätzt. Bei der Ausarbeitung dieses Themas konnte er auf eine<br />
Anzahl zeitungswissenschaftlicher Veröffentlichungen seines umfangreichen Archivs zurückgreifen.<br />
Die eigentliche Würze erhält der Text jedoch durch die lebendige Schilderung eigener langjähriger<br />
journalistischer Tätigkeit, Studium, Erfahrungen und persönlichen Erinnerungen an Begegnungen<br />
mit Politikern und Staatsmännern. Überlegungen und Einsichten finden im Text ihren Ausdruck.<br />
Weit spannt sich der inhaltliche Bogen vom Entstehen der ersten Zeitungen in Deutschland bis<br />
zum Neuaufbau der Berliner Presse nach 1945. Dazwischen liegen das „tolle Jahr" 1848 und das<br />
Aufkommen der ersten Arbeiterzeitungen, liegt die Zeit Lessings als Redakteur und Heinrich von<br />
Kleists als Zeitungsherausgeber. Namen wie Mosse, Ullstein und Scher! prägen das Gesicht der<br />
Presse in der neueren Zeit. Das Entstehen der Parteipresse, der Niedergang der freien Presse und<br />
deren Gleichschaltung runden das Bild ab und dokumentieren zugleich das Schicksal dieses Mediums<br />
im politischen Kräftespiel.<br />
Ein besonderes Kapitel widmet der Autor im Anhang der „Heimatpresse", deren ältestes Exemplar<br />
mit dem „Charlottenburger Wochenblatt" (gegründet 1846) belegt ist. Noch heute belebt<br />
eine kleine Anzahl dieser Blättchen, die meist nur ein- oder zweimal wöchentlich erscheinen, die<br />
Szenerie der Berliner Kioske. Die Blätter verstehen sich als Mittler zwischen der Bevölkerung<br />
und den örtlichen Behörden und der Geschäftswelt. Die sich dem Text einpassenden Abbildungen<br />
sind in der Überzahl Reproduktionen alter Zeitungsköpfe und Urkunden.<br />
Ein kurzes Nachwort, ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie ein umfangreiches Namensregister<br />
komplettieren diesen Band, mit dessen Erscheinen eine Publikation vorliegt, die sich vor<br />
allem durch ihre verständliche Ausdrucksweise und das Bemühen um sachliche Objektivität auszeichnet.<br />
Leider ist die technische Ausführung des Drucks und des Einbandes ohne Qualitätsmerkmale.<br />
Die Schrift ist recht unleserlich, da zu grau gedruckt, und statt des weißen Einbandes hätte<br />
ein weniger empfindlicher farbiger dem - sicher sehr oft benutzten - Buch gut getan.<br />
Claus P. Mader<br />
Berlin-Literatur. Eine Modell-Liste für den Grundbestand der Buchabteilung „Heimat- und<br />
Landeskunde Berlin" öffentlicher und anderer Bibliotheken. Veröffentlichung des Instituts für<br />
Bibliothekarausbildung der Freien Universität Berlin. Red.: Hans-Dieter Holzhausen, Paul S.<br />
Ulrich. Berlin 1976. 144 S., brosch., 3 DM.<br />
Dieses Bändchen mit seiner Aufzählung von rund 750 Titeln versteht sich in erster Linie als<br />
„Ratgeber" für öffentliche Bibliotheken, in deren heimatkundliche Abteilungen Berlin-Bücher aufgenommen<br />
werden. Es ist also keine neue Berlin-Bibliographie, allenfalls die Kurzfassung eines<br />
- gelegentlich beschreibenden - Bücherverzeichnisses unter dem besonderen heimat- oder landeskundlichen<br />
Aspekt. Wie es im Vorwort zu Recht heißt, sind Umfang und Wertigkeit der Berlin-<br />
220
Literatur inzwischen so unübersichtlich geworden, daß es geraten schien, den nichtwissenschaftlichen<br />
Bibliotheken Hinweise für einen „Grundbestand" an Berlinbüchern zu geben. Das wichtigste<br />
Problem stellte dabei naturgemäß die Auswahl dar, deren Kriterien einleuchtend dargelegt<br />
sind und die hier keineswegs Gegenstand einer Diskussion sein können. Lediglich der Ausdruck<br />
„Bleibewert der Bücher" (S. 7) ist rätselhaft und damit unbrauchbar. Ebenso liegt bei der inhaltlichen<br />
Abgrenzung der Buchtitel zu den „Archivbeständen" (S. 9) ein Begriffsirrtum vor, denn<br />
mit den letzteren werden ausschließlich Archivalien bezeichnet, d. h. einmalig vorhandenes Schriftgut<br />
mit vollkommen anderer Struktur und Aussage, während im hier vorliegenden Text offenbar<br />
nur die „älteren" Bücher mit qualitativ größerem Gebrauchswert gemeint sind.<br />
Die Systematik zerfällt in 14 Abschnitte mit einem logischen Gefälle, beginnend mit den allgemeinen,<br />
topographisch-statistischen Betreffen und endend mit den Stadt- und Ortsteilbeschreibungen<br />
(nur Berlin-West), entspricht also dem üblichen bibliographischen Schema. Über die Berechtigung<br />
einzelner aufgeführter (und nicht aufgeführter) Titel ist immer zu streiten, erst recht bei<br />
Auswahlsammlungen, doch wird diese Diskussion auf einer anderen Ebene sinnvoller geführt<br />
werden können. Einzelne Titel mit zu geringer oder mißverständlicher Aussagekraft haben kurze<br />
Inhaltsangaben erhalten, ebenso wie Preis- und Antiquariatshinweise für die Bibliothekare hilfreiche<br />
Orientierungsmarken sind. Ein Register der Autoren, Herausgeber und anonymen Sachtitel<br />
schließt den Band ab. Vermerkt sei noch, daß bereits im Jahre 1937 unter der Überschrift<br />
„700 Jahre Berlin" von den damaligen Städtischen Volksbüchereien ein besprechendes Bücherverzeichnis<br />
vergleichbaren Umfangs herausgegeben wurde, das in Aufmachung und Zielsetzung allerdings<br />
auch für das lesende Publikum gedacht war und über den Ansatz der jetzt vorgelegten<br />
Modell-Liste hinausgeht. Peter Letkemann<br />
Frank Werner: Stadtplanung Berlin. Theorie und Realität. Teil I: 1900-1960. Berlin: Kiepert<br />
1976. 296 S. mit 34 Abb., brosch., 26 DM.<br />
In diesem, als dritter Band zum Thema erschienenen Werk zieht Werner die Summe aus seinen<br />
vorangegangenen Einzelstudien. Mit Recht läßt er die moderne Stadtplanung, trotz einiger Vorläufer,<br />
nach der Jahrhundertwende beginnen. Ein erster Höhepunkt Berliner Städtebaus war die<br />
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die „Ära Wagner". Diese wohl fruchtbarste Zeit ist hier nur in<br />
geringem Umfang berücksichtigt worden. Ausführlicher geht dagegen der Verfasser auf die nationalsozialistische<br />
Planung ein. Wenn in diesem Zusammenhang die ideologischen Modellvorstellungen<br />
tatsächlich eine weit geringere Bedeutung hatten als Werner ihnen beimißt, wird doch der<br />
politische Charakter des Sädtebaus stark sichtbar. Hitler - selbst sehr gut vertraut mit den Zusammenhängen<br />
zwischen Architektur und Macht - setzte 1937 Albert Speer als einen nur ihm<br />
persönlich verantwortlichen „Generalbauinspektor" für Berlin ein. Im Mittelpunkt der Speer-<br />
Planung stand die monumentale Umgestaltung des Stadtzentrums mit der gigantomanen „Nord-<br />
Süd-Achse und ihren gewaltigen Bauten. Daneben wurde vor allem den Verkehrslinien besondere<br />
Aufmerksamkeit gewidmet. Monumentalisierung durch neue architektonische Anlagen, nicht<br />
Veränderung der gewachsenen Stadtstrukturen waren - ganz im Sinne des Auftraggebers - die<br />
^iele der neuen Behörde, der städtische und staatliche Dienststellen nachgeordnet waren.<br />
Der Schwerpunkt der Arbeit aber liegt eindeutig in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die<br />
Neuplanung der furchtbar zerstörten Stadt wurde trotz äußerlicher Hemmnisse sehr bald in Angriff<br />
genommen. Ausgangspunkt und Zielvorstellungen der bald nach Kriegsende entstandenen<br />
Strukturpläne werden eingehend, z. T. mit Schaubildern, vorgestellt. Einige Aspekte der frühen<br />
Nachkriegsplanung, etwa die Idee des Citybandes aus dem Kollektivplan (1945) und das Tangentenstraßensystem<br />
des Bonatz-Plans (1948), haben bis in die jüngste Zeit hinein ihre Bedeutung<br />
behalten.<br />
Mit der Teilung der Stadt 1948 setzte nun auch die getrennte Planung in beiden Stadthälften<br />
ein. Während aus politischen Gründen in beiden Planungen noch längere Zeit von einem einheitlichen<br />
Stadtganzen ausgegangen wurde, zeigen die Einzelplanungen schon bald Divergenzen, auch<br />
im Verkehrsnetz. Planungen, die den anderen Teil der Stadt zum Inhalt hatten, etwa der im<br />
Westen initiierte Wettbewerb „Hauptstadt Berlin" (1957), besaßen keinen Einfluß auf die Stadtstruktur.<br />
Die Errichtung der Mauer beendete weitgehend die Planung für die gesamte Stadt.<br />
Auch innerhalb des Ostteiles blieben die Planungen immer wieder Änderungen unterworfen, die<br />
auch zu personellen Konsequenzen führten. Trotz gewisser Unterschiede kann der Verfasser im<br />
Aufgabenbereich der für die Planung Verantwortlichen und in ihrer Stellung zur politischen<br />
Führung Ähnlichkeiten zur Position des ehemaligen „Generalbauinspektors" feststellen. Auch<br />
das persönliche Eingreifen der Führungsspitze (Walter Ulbricht) fehlte nicht. Die Architektur<br />
jener Jahre beweist ebenfalls, daß Speer doch nicht der „letzte Klassizist" in Berlin war, als den<br />
er sich im Nachhinein gern bezeichnet. Die hohe politische Bedeutung der Ost-Berliner Planum;<br />
unterstreicht die Mitteilung, daß zeitweise die beiden verantwortlichen Planer Kandidaten bzw.<br />
Mitglieder des Politbüros im Zentralkomitee der SED waren.<br />
221
Während - wie der Verfasser zeigt - in Ost-Berlin zeitweilig die repräsentative architektonische<br />
Gestaltung im Mittelpunkt stand, die mehr und mehr durch industrielle Bauformen bestimmt<br />
wurde, so waren es im Westen vor allem funktionale Überlegungen, in denen der Tiefbau eine<br />
große Rolle spielte. Im Hochbau wurde dagegen den Architekten weitgehende Freiheiten gelassen;<br />
ein Beispiel hierfür ist die Neubebauung des Hansaviertels (1957). - In einer abschließenden<br />
Überlegung versucht der Autor das Verhältnis zwischen Stadtplanung und realer Stadtentwicklung<br />
zu klären. Für den Arbeitsbereich Berlin zeigt sich, daß die Stadtentwicklung weitgehend<br />
unabhängig von der Planung verläuft und diese nur auf Teilbereiche Einfluß hat.<br />
Zahlreiche Skizzen und Schemata zu Behördenaufbau und auch zu Plan-Zielvorstellungen erleichtern<br />
den Zugang des Lesers zu dieser recht komplizierten Materie. Leider wird der äußere Eindruck<br />
durch zahlreiche Druckfehler getrübt. Felix Escher<br />
Zimelien. Abendländische Handschriften des Mittelalters aus den Sammlungen der Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz Berlin. (Ausstellungskatalog.) Red.: Tilo Brandis. Wiesbaden: Dr. Ludwig<br />
Reichert Verlag 1975. XVI, 306 S. mit 110 Tafeln, brosch., 36 DM.<br />
Ausstellungskataloge gehören in der Regel nicht zum Repertoire unseres Besprechungsteils, es sei<br />
denn, sie gehen in Umfang und Gestaltung über den Status eines bloßen Textbegleiters hinaus.<br />
Das ist hier eindeutig der Fall. Zwar kann der Katalog, unabhängig von seiner Aufmachung, die<br />
Ausstellung und das unmittelbare Vis-a-vis der dargebotenen Schätze nicht ersetzen, aber er bietet<br />
doch eine solche Fülle weitergehender Informationen und auch des Bildmaterials, daß er<br />
bereits jetzt als unentbehrliches Handbuch der abendländischen Codices auf Berliner Boden gelten<br />
kann.<br />
Das Wort Zimelie bedeutet Kostbarkeit, Kleinod, Schatz, ursprünglich im kirchlich-liturgischen<br />
Bereich, und wird heute allgemein als Synonym für das schön geschriebene und schön gebundene<br />
Buch überwiegend des Mittelalters verwendet, zumeist noch in Verbindung mit alter oder seltener<br />
Überlieferung. So waren auf der Ausstellung im Museumsbau an der Dahlemer Lansstraße um<br />
die Jahreswende 1975/76 insgesamt 188 Schaustücke aus dem Besitz der Staatsbibliothek, des<br />
Kupferstichkabinetts und anderer Museen der Stiftung Preuß. Kulturbesitz zu sehen, deren Entstehungszeit<br />
sich von der Spätantike über 12 Jahrhunderte erstreckte: Liturgische Texte in griechisch,<br />
lateinisch und deutsch, Prunkbibeln, Heiligenleben, Stundenbücher, weltliche Chroniken,<br />
höfisch-heroische Epiken, Liederhandschriften und Romane, Rechtsbücher, schließlich humanistische<br />
Handschriften Frankreichs und Italiens mit teilweise üppigen Illustrationen, um deretwillen<br />
sie vielfach angelegt und gesammelt wurden. Neben den anonymen oder Sammelschriften fehlten<br />
auch nicht Texte von Autoren wie Aristoteles, Vergil, Ovid, Beda, Gregor d. Gr., Augustin,<br />
Bernhard von Clairvaux, Wolfram von Eschenbach und Eike von Repgow. Der Reichtum des<br />
Geschauten läßt sich nur unvollkommen wiedergeben. Um so mehr ist zu begrüßen, daß der<br />
Katalog immerhin auf 110 ganzseitigen Abbildungen, davon 40 in Farbe, einen ungefähren äußeren<br />
Eindruck vermittelt. Das gesamte Material ist chronologisch und nach Sachzusammenhängen<br />
gegliedert, wobei jeder Sachgruppe eine kunst- und geistesgeschichtliche Charakterisierung vorangestellt<br />
ist. Die einzelnen Exponate werden dann exakt beschrieben und gewürdigt. Bibliographie<br />
und Register erleichtern ein weiteres Eindringen in die Materie, wogegen das Verzeichnis der<br />
Fachausdrücke nicht in allen Punkten befriedigen kann.<br />
Da in anderen Institutionen oder Sammlungen in West-Berlin keine vergleichbaren Stücke nachgewiesen<br />
sind, dürfte hiermit der Fundus an mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Miniaturen<br />
voll ausgeschöpft sein. Neben der Ausstellung - der ersten dieser Art seit 1931 - ist mit dem<br />
systematischen Katalog ein einzigartiger historischer Überblick über das gesamte mittelalterliche<br />
Buchwesen vorgelegt worden, dem auf lange Sicht nichts Vergleichbares wird an die Seite gestellt<br />
werden können. Peter Letkemann<br />
Helmut Börsch-Supan: Marmorsaal und Blaues Zimmer. So wohnten Fürsten. Berlin: Gebrüder<br />
Mann 1976. 176 S. m. 62 Abb. u. 8 Farbtafeln, brosch., 28 DM. (4. Bd. d. Gebr. Mann „studio-<br />
Reihe".)<br />
Vor 50 Jahren übernahm die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten das kulturelle<br />
Erbe der Hohenzoliern, soweit es noch als historisches Zeugnis der Schlösser und Gartenanlagen<br />
erhalten war. Diesem Umstand verdankt die vorliegende Schrift ihr Erscheinen. Sie ist gleichzeitig<br />
das Handbuch zur Ausstellung im Neringbau des Schlosses Charlottenburg, die vom 3. 9.<br />
bis 24. 10. 1976 dort stattfindet und Innenräume preußischer Schlösser und Palais in Aquarellen<br />
des 19. Jahrhunderts zeigt.<br />
In seinem umfangreichen Vorwort geht Börsch-Supan, seit 1961 in der Berliner Verwaltung der<br />
Staatlichen Schlösser und Gärten tätig, seit 1973 deren stellvertretender Direktor und wie kaum<br />
222
ein zweiter mit den hiesigen Gegebenheiten vertraut, auf Anlaß und Motivation dieser „Zimmermalerei"<br />
ein. Wie das Porträtieren ist auch das Abbilden von Wohnräumen ein Angehen gegen die<br />
Vergänglichkeit. Während die Außenarchitektur für die Dauer gedacht ist, bleibt das Innere durch<br />
Lebensgewohnheiten, Mode und politischen Einfluß einem ständigen Wandel unterworfen. Als<br />
Dokumente erscheinen darum diese Blätter so zuverlässig, wie es auch persönliche Notizen sind.<br />
Hier kann nachvollzogen werden, wie sich das tägliche Dasein mit der Fülle seiner Erlebnisse<br />
abgespielt hat. Anders als im Ausstellungskatalog (1970) von Irmgard Wirth: „Wohnen in Berlin<br />
- Berliner Innenräume der Vergangenheit", der auch den Komplex der bürgerlichen Wohnräume<br />
behandelt, stammen die hier gezeigten und sehr ausführlich beschriebenen Exponate überwiegend<br />
aus fürstlichen Sammlungen. Diese preußischen Beispiele von Intereurmalerei zeigen hauptsächlich<br />
die zu den Wohnfluchten gehörenden Wohnräume und Festsäle. Hinzu kommen noch sakrale<br />
Räume wie z. B. die Kapelle im Charlottenburger Schloß, repräsentative Säle z. B. im Berliner<br />
Stadtschloß, oder Stätten des patriotischen Gedenkens. Die Namen der Künstler sind oftmals nur<br />
wenig bekannt. Karl Beckmann, Eduard Gaertner, Carl und Paul Graeb, Johann Heinrich Hintze,<br />
Johann Erdmann Hummel, Friedrich Wilhelm Klose, Carl Rauch und Carl Friedrich Schinkel<br />
bilden die Ausnahme.<br />
Durch den sehr interessanten und aufschlußreichen Text, durch frühere textliche Überlieferungen<br />
sinnvoll ergänzt, und das umfangreiche Bildmaterial dürfte diese Publikation sowohl bei den<br />
Kunsthistorikern wie auch bei den an der Berliner Historie Interessierten auf ein positives Echo<br />
stoßen. Die technische Ausführung ist zufriedenstellend und der geforderte Preis entspricht dem<br />
Gebotenen. Claus P. Mader<br />
Lothar Baar: Die Berliner Industrie in der industriellen Revolution. Berlin: Verlag ,das europäische<br />
buch' o. J. [1974]. Unveränd. Neudruck der Ausg. Berlin (Ost): Akademie-Verlag 1966<br />
(Veröff. d. Instituts f. Wirtschaftsgesch. an d. Hochschule f. Ökonomie Berlin-Karlshorst, Bd. 4).<br />
267 S., brosch., 14,80 DM.<br />
Der Verfasser, Schüler des in Ost-Berlin lehrenden Wirtschaftshistorikers Hans Mottek, behandelt<br />
in dieser grundlegenden Studie eines der interessantesten Themen der deutschen Wirtschaftsgeschichte:<br />
die Entstehung der größten Industriestadt Deutschlands. Die im Rahmen der gesamten<br />
Industrialisierung typischen und atypischen Züge der speziellen Berliner Entwicklung, die bereits<br />
früh eine eigene Dynamik zeigt, werden für einzelne Industriebereiche, etwa der Textilindustrie,<br />
des Maschinenbaus sowie der chemischen und Elektroindustrie herausgearbeitet und von den Ursachen<br />
her erklärt. Für Baar als marxistischen Autor ist es selbstverständlich, die Entstehung der<br />
Klassenstruktur und -gegensätze breit zu erörtern. Problematisch bleibt hier die Zuordnung der<br />
handwerklich ausgebildeten Gewerbegehilfen, die wirtschaftlich und sozial in den ersten Phasen<br />
der Industrialisierung kaum Gemeinsamkeiten mit den auf wesentlich niedrigerem Lohnniveau<br />
stehenden Tagelöhnern und Dienstboten hatten. Erst durch die fortschreitende Mechanisierung<br />
verwischen sich - wie Baar richtig bemerkt - die Gegensätze. Ausführungen zur Lohnentwicklung<br />
und zu frühen Arbeitskämpfen sowie ein umfangreicher Tabellenanhang schließen den Band.<br />
Leider konnte in dem Neudruck die seit 1966 zu dem Thema erschienene Literatur nicht mehr<br />
berücksichtigt werden. Gerade zu diesem Komplex sind in der Zwischenzeit im Forschungsschwerpunkt<br />
„Frühindustrialisierung" der Historischen Kommission zu Berlin (West) und anderswo<br />
zahlreiche Publikationen herausgekommen. Der Neudruck hätte Anlaß für einen Diskussionsbeitrag<br />
Baars bieten können. Felix Escher<br />
Hans-Jochen Kehrl: Berliner Kind. Eine Jugend in der alten Reichshauptstadt. Heilbronn:<br />
Eugen-Salzer-Verlag 1972. 101 S., lamin. Pappband, 5,80 DM. (Salzers Volksbücher Nr. 155/56.)<br />
Der Verfasser dieses literarisch nicht sehr anspruchsvollen Bändchens schildert hier gefällig seine<br />
Kindheit sowie sein Jugendleben und -lieben vor, während und kurz nach dem Ersten Weltkrieg.<br />
So steht dann auch die persönliche Biographie im Mittelpunkt. Trotz allzu „berlinischer" Anekdoten<br />
und der besonders im letzten Kapitel „Herrliches Berlin" beschworenen Erinnerungen von<br />
den Pankgrafen bis zu den ehemaligen Fernbahnhöfen bleibt der Eindruck erhalten, daß die<br />
lokalen Schauplätze einer derartigen Lebensbeschreibung austauschbar sind. Auch die Lebensumstände<br />
des in gutbürgerlichem Milieu aufgewachsenen Autors zeigen keine Besonderheiten. Der<br />
engste Lebensbereich der Kindheits- und Jugendjahre, das östliche Friedenau und das Steglitzer<br />
Bismarckviertel, hätten zudem eine kompetentere Beschreibung verdient. Liebhaber von Erinnerungsliteratur<br />
mögen an diesem Bändchen ihre Freude haben, auch wenn das speziell Berlinische,<br />
das doch schon im Titel beschworen wird, weitgehend fehlt. Felix Esdier<br />
223
Erhard Frommhold: Otto Nagel. (Ost-)Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 1974.<br />
416 S. mit 331 Abb., Leinen, 70 M.<br />
Otto Nagel: Die Gemälde und Pastelle. Bearb. von Sibylle Schallenberg-Nagel und Götz Schallenberg.<br />
Hrsg. von der Akademie der Künste der DDR und dem Märkischen Museum. (Ost-)<br />
Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 1974. 212 S., 536 Abb., Leinen, 140 M.<br />
Kenntnisreich und einfühlsam stellt Erhard Frommhold Leben und Werk Otto Nagels, des<br />
„Klassikers vom Wedding", in einen weit gespannten Bogen. Das Schaffen und das Wollen des<br />
Malers und späteren Präsidenten des Verbandes Bildender Künstler Deutschlands sowie der<br />
Deutschen Akademie der Künste zu Berlin wird anhand seiner eigenen Schriften und mit vielen<br />
Zitaten von Zeitgenossen beschrieben. Vor allem über die frühen Jahre wird man gut ins Bild<br />
gesetzt, etwa mit einer Geschichte des Weddings, wobei auch vermeintlichen Detailfragen viel<br />
Raum gelassen wird, so dem Problem des Mülls eine ganze Seite. Politisch mag eine gewisse<br />
Kopflastigkeit und gewollte Darstellungsart nicht zu übersehen sein, weil anstelle tatsächlicher<br />
Äußerungen dann „wahrscheinlich" oder „es ist anzunehmen, daß" steht. Hier schreibt Frommhold<br />
selbst: „Wenn auch die geistige Entwicklung Otto Nagels mit den von uns vorgestellten<br />
Beziehungen nicht immer ganz kongruent ist, so sind es doch ,die revolutionierenden Kräfte, die<br />
aus dem Buch in das Herz des proletarischen Lesers fluten' (Josef Luitpold Stern)".<br />
Niemand vermochte vielleicht Otto Nagel, den man einem „realistischen Expressionismus" zuordnen<br />
könnte, besser zu skizzieren als sein Weggefährte (und im übertragenen Sinne Lehrer)<br />
Heinrich Zille, der zu einer Ausstellung 1925/26 schrieb: „Die düstere Welt der Geknechteten<br />
und Versklavten - die elenden Quartiere der sonnenlosen Mietskasernen - die staubige Straße<br />
zur Erholung - die Rummelplätze, die Freude der heranwachsenden Jugend - wüste Schnapsschenken<br />
- üble Tanzsäle - Nachtasyle - arme Menschen mit verstörten, vergrämten Gesichtern -<br />
ausgemergelte, ausgesaugte Arbeitsinvaliden, hohläugig, erblindet - teilnahmslos vor sich hinstarrend<br />
- lallende Betrunkene - frierende Bettler hinter Schutthaufen der Fabriken und Zäune -<br />
die geschminkte Dirne mit flackerndem Auge im Licht der Bogenlampen, Hunger und Sinnlichkeit<br />
- all das hat uns Otto Nagel in seinen Bildern gezeigt Erschütternd - grau in grau - düster.<br />
Berlin N. Dort lebt O. Nagel und erlebte es von klein an Fabrikarbeiter, kränklich, nicht in<br />
Zeichenschulen nach Gipsköpfen und staatlich ausgesuchten Modellen gebildet - das Elend was er<br />
sah und sieht hat ihn zum Maler gemacht - er klagt an. Alles düster, trüb, grau - auch die<br />
Holzrahmen der Bilder grau - arm.<br />
Und doch - ich sah etwas freudige Farbe - die mit roter Pomade gefärbten Lippen der kleinen,<br />
verkümmerten, 16jährigen Straßendirne! Rote Farbe? - Nun so weiter. H. Zille."<br />
In den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft zog sich Otto Nagel zurück, und gerade<br />
dieser Zeit verdanken wir sein wunderbares Werk der „Berliner Bilder". Vielfach im Wettlauf<br />
mit den Bomben hat er vor allem im historischen Herzen der Stadt mit seinen malerischen<br />
Mitteln festgehalten, was dann später ohnehin der Spitzhacke zum Opfer gefallen ist. „Ich habe<br />
sie schon immer geliebt, die alte Stadt; geliebt in achtungsvoller Verehrung", bekennt Otto<br />
Nagel. Die viellen Verpflichtungen kulturpolitischer Art (Nagel war nach dem Kriege auch<br />
Landtagsabgeordneter) ließen ihn weniger an sein künstlerisches Schaffen denken, als Persönlichkeiten<br />
wie er beim Aufbau und bei der Gestaltung des neuen Staatswesens benötigt wurden.<br />
Frommhold beschreibt für diese letzte Periode Nagel als „eine ausgesprochen reife Künstlerpersönlichkeit,<br />
deren Rolle sich nun im ungefähren Gleichklang mit der objektiven Entwicklung<br />
der Gesellschaft befindet, mit einer Umwelt, die seine Hoffnungen und die auf ihre Erfüllung<br />
hinzielenden Taten, praktisch-staatlich zu verwirklichen trachtet. Nagels Persönlichkeit ist in den<br />
kulturellen Überbau der neuen Gesellschaft faktisch eingeschlossen". Sein Wächteramt nahm<br />
Nagel übrigens durchaus ernst, wenn er sich etwa 1951 über seinen Kollegen Horst Strempel<br />
äußert: „. . . es wäre an der Zeit, daß er nun endlich mal sein Friedrichstraßenbild abwäscht<br />
und den Beweis antritt, daß er jetzt zu anderen Leistungen fähig ist". In der Tat wurde dieses<br />
berühmte Wandbild im Bahnhof Friedrichstraße dann kurz darauf übertüncht.<br />
Seiner Frau Walli Nagel (Otto Nagel schrieb übrigens Wally) wird ein warmherziges Vorwort<br />
eingeräumt, bei dem allenfalls anzumerken wäre, daß man vom Haus Turiner Straße 10 nicht<br />
auf den Invalidenfriedhof blicken kann, sondern auf den heute noch bestehenden Garnisonfriedhof.<br />
Bei aller Zurückhaltung gegenüber dem privaten Lebensbereich auch eines großen<br />
Menschen muß in diesem Zusammenhang die Frage gestellt werden, warum zwar Lotte als<br />
Tochter aus erster Ehe erwähnt wird (1930 schied sie vierzehnjährig freiwillig aus dem Leben),<br />
warum bei sonst minuziösem Lebenslauf aber weder von der Eheschließung gesprochen, noch der<br />
Name dieser Frau erwähnt wird.<br />
Wer Otto Nagel als Berliner Maler schätzt und sich von der Atmosphäre seiner Berliner Bilder<br />
verzaubern läßt, wird an diesem umfassenden Werk nicht vorübergehen können.<br />
Dem Werkverzeichnis, dem zweiten hier anzuzeigenden Titel, ist eine Betrachtung der beiden<br />
Bearbeiter über das malerische Werk Otto Nagels vorangestellt worden. Das Katalogwerk<br />
bedient sich der chronologischen Reihenfolge und führt sämtliche Werke in kleinformatigen Abbil-<br />
224
düngen auf, soweit sie entsprechend belegt werden konnten. Alle auch sonst durch Ausstellungsverzeichnisse,<br />
Erwähnung in Literatur und Presse oder andere Dokumente nachweisbaren Werke<br />
sind aufgeführt worden, auch die verschollenen und die inzwischen wieder aufgetauchten Arbeiten.<br />
Diese Dokumentation wird abgerundet durch ein Verzeichnis der Ausstellungen und Angabe<br />
der dort gezeigten Bilder, durch eine Liste der Museen mit Werken Otto Nagels und einige<br />
Angaben zur Bibliographie. Vorangestellt wurden 75 zum Teil farbige Tafeln, die die wichtigsten<br />
Arbeiten Nagels im Großformat zeigen. H. G. Schultze-Berndt<br />
Ursula Herking: Das Beste aus meiner berlinerischen Witze- und Anekdotensammlung. 2. Aufl.<br />
München: Heyne 1975. 108 S., brosch., 2,80 DM. (Heyne-Buch Nr. 5181.)<br />
Ihr Vorwort leitet Ursula Herking mit den Sätzen ein: „Ich bin keine Berlinerin - ich bin eine<br />
geworden. Wenn man unter Berliner sein das versteht, was ich meine: herzerfrischende Direktheit,<br />
augenzwinkernden Mutterwitz - und die Fähigkeit, auch die seltsamsten und die bedrückendsten<br />
Lebenssituationen mit jener ganz bestimmten Mischung aus patenter Klugheit und bewußter<br />
Arroganz zu meistern." Ihr Mann Ulrich Glass teilt in einem Postskriptum mit, daß seine Frau<br />
für dieses Buch nicht mehr Korrektur lesen konnte. Sie starb am 17. November 1974.<br />
Es ist verdienstvoll, wenn Prominente, wie die hier als große Komödiantin bezeichnete Ursula<br />
Herking berlinerische (oder berlinische?) Anekdoten und Witze sammeln. Ob deren Veröffentlichung<br />
etwas über den Charakter des Herausgebers aussagt, muß in Frage gestellt werden. Die<br />
hier vorgelegte Sammlung ist ein guter Querschnitt durch alles, woran man schon einmal seine<br />
Freude gehabt hat. Lachen wir mit Ursula Herking und all ihren Verehrern über die folgende<br />
Begebenheit: „Karajan dirigierte seine Berliner Philharmoniker. Als der rauschende Begrüßungsapplaus<br />
verklungen war, hob der Gefeierte den Taktstock. Doch gerade in diesem Augenblick<br />
knallte eine Logentür zu. Mit unwilliger Gebärde ließ er den Stab sinken, konzentrierte sich<br />
einige Zeit und hob ihn erneut. Die Geiger setzten schon die Bogen an, da erlitt eine Dame im<br />
Parkett einen heftigen Hustenanfall. Der Dirigent klopfte ab und schüttelte böse den Kopf. Als<br />
er dann den Taktstock zum drittenmal aufnahm, ertönte vom obersten Rang eine markige Männerstimme:<br />
,Na, jetzt aba Mut, Meista!'" H. G. Schultze-Berndt<br />
Per Daniel Amadeus Atterbom: Reisebilder aus dem romantischen Deutschland. Jugenderinnerungen<br />
eines romantischen Dichters und Kunstgelehrten aus den Jahren 1817 bis 1819. Neu hrsg. r*J,l^<br />
von Elmar Jansen nach dem Erstdruck „Aufzeichnungen des schwedischen Dichters P. D. A.<br />
Atterbom über berühmte deutsche Männer und Frauen nebst Reiseerinnerungen aus Deutschland<br />
und Italien aus den Jahren 1817-1819", Berlin 1867. Stuttgart: Steingrüben Verlag 1970. Leinen,<br />
439 S., 24 DM.<br />
Per Daniel Amadeus Atterbom, 1790 im schwedischen Asbo geboren, hat auf seiner Bildungsreise<br />
von 1817 bis 1819 nach Süddeutschland, Rom und Wien zweimal längere Zeit in Berlin Station<br />
gemacht. Seit 1828 war er Professor für Ästhetik, 1855 ist er vor Veröffentlichung seiner Reiseerinnerungen<br />
verstorben. Betulich und weitschweifig schildert er in Briefform seine Erlebnisse und<br />
- der Zeit entsprechend - seine Empfehlungen, mit denen er Hans Christian Andersen einerseits<br />
und Philipp Otto Runge andererseits zur Seite gestellt wird. Es ist erstaunlich, bei welchen Geistesheroen<br />
er als junger Schwede Zugang findet und wie treffsicher er sie beurteilt, so E. T. A.<br />
Hoffmann und Ludwig Devrient, Friedrich Schlegel, Grillparzer, Beethoven, Schleiermacher und<br />
Hegel, vor allem aber Jean Paul, Tieck, Rücken, Gneisenau, Schelling und Baader. Seine Beobachtungen<br />
verbindet er mit Schilderungen von der Reise, von Theater und Literatur, Architektur<br />
und Landschaft. Ist er zunächst von der geistigen Atmosphäre Berlins ganz gefangen genommen<br />
und voll des Lobes, so wird er ihr mit romantischer Heftigkeit bald überdrüssig. Es wirkt heute<br />
erheiternd, wenn man liest: „Tieck und ich sprachen auch viel über die literarischen und politischen<br />
Zustände Deutschlands, wobei er mich mit belegten Butterbroten und edlem Rheinwein<br />
erfreute." Nicht eben schmeichelhaft ist sein Eindruck vom Deutschen Dom, der „vermutlich ein<br />
Meisterstück des architektonischen Geschmacks Friedrichs des Zweiten ist, aber trotzdem aussieht<br />
als ob (er) vom Zuckerbäcker gebaut worden wäre". Auch mit den Gewässern Berlins hat er<br />
nicht viel im Sinn: „Das Trockene der Berliner Lage und das Dürre seiner Natur wird nur unbedeutend<br />
von dem kleinen Flusse Spree erfrischt, der quer durch die Stadt fließt. Man könnte<br />
ihn eher einen Bach nennen . . ." Einer Hymne auf die Herrlichkeit der Landschaft und der<br />
Schönheit der Menschen Dresdens folgt der Ausruf: „Was erlebte ich dahingegen in Berlin? Staub,<br />
Hundstagshitze, schwerfällige Eindrücke und Magenleiden." Mit diesen mag es auch zusammenhängen,<br />
daß er Charlottenburg und Stralau als die einzigen schönen Landorte in der Nachbarschaft<br />
von Berlin bezeichnete. Die „merkwürdige Passion der Berliner für Dünnbier", die ihm<br />
aufgefallen ist, scheint ein Novum in der Literatur zu sein.<br />
225
Dem Herausgeber ist dennoch beizupflichten, daß diese fast unbekannten Reiseerinnerungen in<br />
ihrer jugendlich-frischen Erzählweise 100 Jahre nach ihrem deutschen Erstdruck eine neue Ausgabe<br />
rechtfertigen. H. G. Schultze-Berndt<br />
Theodor Fontane. Briefe aus den Jahren 1856-1898. Hrsg. von Christian Andree. Berlin: Berliner<br />
Handpresse 1975. 58 S., 1 Faksimile, Großformat, biblioph. Pappbd., 38 DM. (Berliner<br />
Handpresse, Reihe Werkdruck Nr. 4.)<br />
Die hier vorliegende Sammlung umfaßt 76 Briefe, die bisher nicht oder nur sehr unvollständig<br />
veröffentlicht wurden. Sie befinden sich im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Universitätsbibliothek<br />
Bonn und in privater Hand. Es handelt sich hierbei um Briefe des Dichters an<br />
seine Frau Emilie, seine Kinder Mete und Friedrich und an fremde Persönlichkeiten wie den<br />
Literaturhistoriker und Theaterleiter Otto Brahm, den Kritiker Sigfried Samosch, Ernst Wiehert<br />
sowie Max Liebermann. Zuschriften an Verlage und Redaktionen ergänzen diese Sammlung. Der<br />
Text der einzelnen Briefe folgt den Originalen buchstabengetreu. Ein Nachwort, Anmerkungen<br />
und ein kommentierendes Register komplettieren diese Edition. Das Ganze entpuppt sich als ein<br />
buntes Allerlei aus Fontanes Lebens- und Arbeitswelt.<br />
Es bleibt jedoch zu fragen, ob die aufwendige Edition dieser Texte unbedingt zum Programm<br />
der „Handpresse" gehören mußte, deren Intentionen eigentlich auf einer anderen, mehr den<br />
bibliophilen Raritäten zugewandten Ebene liegen sollten. Wenn schon diese Briefe veröffentlicht<br />
werden mußten, so hätten bei diesem Großformat hier unbedingt Faksimiles mehrerer Briefe abgedruckt<br />
werden können. Als „Lesebuch" ist es zu unhandlich und für den Preis inhaltlich leider<br />
auch etwas zu wenig. Claus P. Mader<br />
Eingegangene Bücher<br />
(Besprechung vorbehalten)<br />
Albertz, Heinrich: Dagegen gelebt - Von den Schwierigkeiten, ein politischer Christ zu sein.<br />
Gespräche mit Gerhard Rein. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 1976. 124 S. (rororo aktuell,<br />
\ Nr. 380.)<br />
Berend, Alice: Spreemann & Co. Roman. Frankfurt a. M.: S. Fischer 1976. 287 S. "< "<br />
Carle, Wolf gang: Das hat Berlin schon mal gesehn. Eine Historie des Friedrichstadt-Palastes, nach<br />
einer Dokumentation von Heinrich Martens. (Ost-)Berlin: Henschelverlag 1975. 220 S. mit<br />
Abb.<br />
Curjel, Hans: Experiment Krolloper 1927-1931. Aus dem Nachlaß hrsg. von Eigel Kruttge.<br />
München: Prestel 1975. 504 S. mit Abb. (Studien zur Kunst des 19. Jh.s, Bd. 7.)<br />
1/ Drewitz, Ingeborg: Das Hochhaus. Roman. Stuttgart: Gebühr 1975. 247 S. TM,"<br />
Eggebrecht, Axel: Der halbe Weg. Zwischenbilanz einer Epoche. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt<br />
1975. 326 S.<br />
Fcrnau, Rudolf: Als Lied begann's. Lebenstagebuch eines Schauspielers. München: Deutscher<br />
O Taschenbuch-Verlag<br />
1975. 349 S. (dtv-Taschenbuch Nr. 1092.)<br />
Gnewuch, Gerd, und Kurt Roth: Aus der Berliner Postgeschichte. Von der OPD zur LPD Berlin -<br />
1850-1975. Hrsg. von der Gesellschaft f. deutsche Postgeschichte e. V., Bezirksgruppe Berlin<br />
1975. 256 S. mit Abb. u. Plänen.<br />
Goeser, Johannes P.: Die Geschwister Michelsohn aus der Flamingostraße. Ein Berliner Familienroman.<br />
Bremen: Jacobi 1975. 484 S.<br />
Harraeus, Karl: Beiträge zur Geschichte der Familie Spener. München: Verlag UNI-Druck 1973.<br />
135 S. mit Abb., 18 Klapptaf. 2* § J<br />
Hochhuth, Rolf: Die Berliner Antigone. Prosa und Verse. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 1975.<br />
126 S. (rororo-Taschenbuch Nr. 1842.) 3,6"<br />
Johnson, Uwe: Berliner Sachen. Aufsätze. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1975. 115 S. (Suhrkamp-<br />
Taschenbuch Nr. 249.)<br />
fugend fragt - Prominente antworten. Hrsg. von Rudolf Ossowski. Berlin: Colloquium 1975.<br />
316 S.<br />
Kocka, Jürgen: Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel Siemens 1847-1914.<br />
Zum Verhältnis von Kapitalismus und Bürokratie in der deutschen Industrialisierung. Stuttgart:<br />
Klett 1969. 639 S.<br />
König, Rolf: Det is knorke. Berliner Witze, Tvpen und Originale. Berlin: Rembrandt 1975.<br />
127 S. mit 111.<br />
Laqueur, Walter: Weimar - Die Kultur der Republik. Frankfurt a. M./Berlin/Wien: Ullstein<br />
1976. 391 S. mit 121 Abb.<br />
226
Lavater-Sloman, Mary: Der vergessene Prinz. August Wilhelm, Prinz von Preußen, Bruder Friedrichs<br />
des Großen. Zürich/München: Artemis 1973. 455 S., 1 Abb.<br />
Lemmer, Konrad (Hrsg.): Berliner Anekdoten und Geschichten. Berlin: Rembrandt 1974. 136 S.<br />
mit Abb. u. 111.<br />
Mehring,Walter: Die Linden lang, Galopp, Galopp! Songs, Balladen und Chansons. (Ost-)Berlin:<br />
Henschelverlag 1976. 188 S. mit Abb.<br />
Mete Fontane - Briefe an die Eltern 1880-1882. Hrsg. und erläutert von Edgar R. Rosen. Frankfurt<br />
a. M./Berlin/Wien: Ullstein 1975. 335 S. (Ullstein-Buch Nr. 4602.)<br />
Möller, Horst: Aufklärung in Preußen. Der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich<br />
Nicolai. Berlin: Colloquium 1974. VIII, 629 S. (Einzelveröff. d. Hist. Kommission zu Berlin,<br />
Bd. 15.)<br />
Pomplun, Kurt: Berliner Allerlei. Kreuz und quer durchs Häusermeer. Berlin: Hessling 1975.<br />
94 S. mit 111. (Schriften zur Berliner Kunst- u. Kulturgeschichte, Nr. 16.)<br />
Schlesinger, Klaus: Alte Filme. Eine Berliner Geschichte. Frankfurt a. M.: S.Fischer 1976. 124 S.<br />
Schramm, Adalhert Georg: Heiteres vom dritten Hof. Ein Blick in das Herz des Berliners. Zeichnungen<br />
von Hans Kossatz. Berlin: Rembrandt 1974. 79 S. mit 111.<br />
Schumacher, Ernst: Berliner Kritiken. Ein Theater-Dezennium 1964-1974. 2 Bände. (Ost-)Berlin:<br />
Henschelverlag 1975. Zus. 850 S. mit Abb.<br />
Seidel, Heinrich: Leberecht Hühnchen. Roman. Bremen: Jacobi 1975. 357 S.<br />
Soschka, Cyrill: Wer dann die Sonne noch sieht. Jahre einer Jugend - Fast ein Roman. München:<br />
Thiemig 1974. 301 S.<br />
Tschechne, Wolfgang: Heinrich Zille - Hofkonzert im Hinterhaus. Geschichten aus (manchmal)<br />
gemütlichen Jahren. Hannover: Fackelträger 1976. 192 S. mit Abb. u. Zeichn.<br />
Wedding - Stadt in der Stadt. Ein Berliner Bezirk stellt sich vor. Berlin/Wien: Haupt & Koska<br />
1973. 128 S. mit Abb.<br />
Widerra, Rosemarie: Hans Baluschek - Leben und Werk. Sonderausstellung anläßlich des lOOjährigen<br />
Bestehens des Märkischen Museums. Katalog. (Ost-)Berlin: Märkisches Museum 1974.<br />
84 S. mit 26 Abb.<br />
Wyssozki, V.: Westberlin. Berlin: Das europäische Buch 1974 (Lizenz: Verlag „Progress", Moskau).<br />
399 S. mit Abb. u. Zeichn.<br />
Zivier, Georg; Hellmut Kotschenreuther und Volker Ludwig: Kabarett mit K. Fünfzig Jahre<br />
große Kleinkunst. Mit Zeichn. von Rainer Hachfeld. Berlin: Berlin-Verlag 1974. 156 S. mit<br />
Abb.<br />
Im III. Vierteljahr 1976<br />
haben sich folgende Damen und Herren<br />
Helmut Camphausen, Student<br />
5 Köln 60, Mathias-Schleiden-Straße 21<br />
(Brauer)<br />
Heinz Jürgen Eichelberg, Apotheker<br />
1 Berlin 33, Miquelstraße 69<br />
Tel. 8 32 81 69 / 21 79 89 (Brauer)<br />
Dr. Heinrich Jonas, Landwirtschafts-Schuldir.<br />
238 Schleswig, Spielkoppel 7<br />
Tel. (0 46 21) 2 37 31 (Rose-Marie Cramer)<br />
Christine Linke, Bibl.-Insp.-Anwärterin<br />
1 Berlin 21, Altonaer Straße 21<br />
Tel. 3 91 32 00 (Günther Linke)<br />
zur Aufnahme gemeldet:<br />
Rudolf Maron, Techn. Angestellter<br />
1 Berlin 41, Grabertstraße 8 b<br />
Tel. 7 96 13 50 (Brauer)<br />
Gerhard Reso, Studienrat<br />
46 Dortmund 50, Stortsweg 12 a<br />
Tel. (02 31) 75 01 66 (Schriftführer)<br />
Dr. Ursula Jentzsch, Wiss. Mitarbeiterin<br />
1 Berlin 33, Lassenstraße 41<br />
Tel. 8 26 12 61 (Dr. I. Stolzenberg)<br />
227
Veranstaltungen im IV. Quartal 1976<br />
1. Sonnabend, 16. Oktober 1976, 11 Uhr: Führung durch die Ausstellung „Park und<br />
Landschaft in Berlin und in der Mark" im Berlin-Museum, 1 Berlin 61, Lindenstraße<br />
14. Leitung: Herr Christian Arndt. Treffpunkt im Foyer.<br />
2. Sonnabend, 23 Oktober 1976, 9 Uhr: Wanderung durch den Grunewald. „Erholung<br />
im naturgemäßen Wirtschaftswald". Leitung: Forstamtsleiter Martin Michaelis.<br />
Treffpunkt: S-Bahnhof Eichkamp.<br />
3. Dienstag, 26. Oktober 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Prof. Bernd<br />
Peschken: „Das Berliner Stadtschloß und die italienische Palastarchitektur". Filmsaal<br />
des Rathauses Charlottenburg.<br />
4. Dienstag, 9. November 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Dr. Michael<br />
Engel: „Berliner Synagogen, zur Topographie und Baugeschichte". Filmsaal des<br />
Rathauses Charlottenburg.<br />
5. Dienstag, 23. November 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Hans-<br />
Werner Klünner: „Die letzten 100 Jahre des Berliner Stadtschlosses". Filmsaal des<br />
Rathauses Charlottenburg.<br />
6. Dienstag, 14. Dezember 1976, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Günter<br />
Wollschlaeger: „Beispiele Berliner Jugendstilarchitektur". Filmsaal des Rathauses<br />
Charlottenburg.<br />
7. Sonnabend, 18. Dezember 1976, 14.30 Uhr: Vorweihnachtliches Beisammensein.<br />
Der „Instrumentalkreis für alte Musik auf historischen Instrumenten" (Drehleier,<br />
Dulciane, Psalter, Zink, Krummhörner u. a.) spielt Musik des 14.-17. Jahrhunderts.<br />
Leitung und Einführung in die Instrumente: Otto Ruthenberg. Restaurant der<br />
Hochschul-Brauerei, 1 Berlin 65, Amrumer Straße 31, Ecke Seestraße. (U-Bahnhof<br />
Amrumer Straße, Busse 16, 64, 65, 89.)<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek<br />
ist zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen geselliges<br />
Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 29. Oktober, 26. November, 17. Dezember, zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
ab 17 Uhr.<br />
Wir weisen darauf hin, daß der Mindest-Jahresbeitrag 36 DM beträgt und bitten um umgehende<br />
Überweisung noch ausstehender Beiträge für die Jahre 1975 und 1976. Auf Wunsch kann<br />
eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1 Berlin 31,<br />
Blisscstraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 45 30 11. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank, 1 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Claus P.<br />
Mader; Felix Escher. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt, Bezugspreis für<br />
Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
228
~- Ratsfeib!i©fef$©k A 2Q 377 F<br />
Fachabt d«rBsri!n«rStadlä<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
73.Jahrgang Heft 1 Januar 1977.<br />
^Ec"—^Z-**B~-'<br />
Lokomotivfabrik, Waggonfabrik,<br />
Weichen- und SignaTbauanstalt<br />
Abi. Lokomotivbau<br />
Jährliche Produktion unserer Lokomotivfabrik 600 Lokomotiven.<br />
BAU VON LOKOMOTIVEN JEDER ART<br />
FÜR HAUPT-, NEBEN- U. KLEINBAHNEN<br />
Lokomotiven mit kurvenbeweglichen Hohladisen<br />
Heissdampf-Lokomotiven • Trambahn-Lokomotiven<br />
Tunnel - Lokomotiven • Zahnrad - Lokomotiven<br />
!| •<br />
—j»<br />
'^fev -: ^m<br />
Hl^BH« -sP<br />
i<br />
***** *•;_<br />
JSS2g3^V?J~-'"^- • g y « H T ^ E<br />
Hff'<br />
3/4 gekuppelte 1 ender-Lokumom •• 500?. S. f-äm SfHtrwwte — 6Ü000 k# t »ienst^ewicht<br />
Geltefari tw St KSnig i and Heisiscnen Staatse^-.<br />
Lieferantin der König!. Preussischen und Hessischen Staatseisenbahnen<br />
D D D sowie der Deutschen Reichs-Kolonial-Eisenbahnen-- o a a<br />
h<br />
•<br />
•<br />
•<br />
229
(<br />
Hundert Jahre Orenstein & Koppel 1876-1976<br />
Von Kurt Pierson<br />
Geht man der Geschichte alteingesessener Berliner Maschinenbau-Betriebe nach, so<br />
verliert sie sich für die heutige Generation nicht selten in bereits verschwommene Sphären.<br />
Es ist daher für den Historiker eine reizvolle Aufgabe, soweit wie möglich diesen Vorhang<br />
zu lüften, um den Blick freizugeben in eine Vergangenheit, in der sich so mancher Betrieb<br />
in unserer Stadt zu einer Weltfirma entwickelte.<br />
Eines dieser Großunternehmen, die den Namen Berlin um den Erdball trugen und deren<br />
Hauptsitz sich heute in Dortmund befindet, ist die Firma Orenstein & Koppel, die am<br />
15. Mai 1976 auf ihr hundertjähriges Bestehen zurückblicken konnte. Ihre Gründungsakte<br />
war ein Gesellschaftervertrag, der zwischen den Herren Arthur Koppel, wohnhaft Krausnickstraße<br />
7, und Benno Orenstein, wohnhaft Grenadierstraße 7, abgeschlossen wurde. In<br />
seinem Paragraph 1 heißt es: „Die Herren Koppel und Orenstein errichten unter der<br />
gemeinschaftlichen Firma Orenstein & Koppel am hiesigen Platz eine offene Handelsgesellschaft<br />
zum Zwecke des Betriebes eines Hütten- & Bergwerksprodukten-Geschäftes."<br />
Diese Formulierung ist an sich ein dehnbarer Begriff; in Wirklichkeit schwebte den beiden<br />
Geschäftspartnern ein Industriezweig vor, durch den ihre Firma eines Tages groß und<br />
berühmt werden sollte: Der Bau von Feldbahnmaterial sowie, in ferner Zukunft, die<br />
Anlage ganzer Klein- und Nebenbahnen. Dabei kam ,ihnfen der zu dieser Zeit ungeahnte<br />
Aufschwung der Zuckerrübenindustrie in Deutschland zugute. Die dabei benutzten Pferdefuhrwerke<br />
versanken angesichts der saisonbedingten feuchten Jahreszeit während der<br />
Rübenkampagne auf den schlechten Landwegen oft bis zu den Achsen. Zum ersten Mal<br />
bewährte sich hier das System der Feldbahnen, wenn auch gegen anfänglichen Protest der<br />
Fuhrwerksbesitzer, die sich geschädigt fühlten. Andere Wirtschaftszweige wurden ebenfalls<br />
aufmerksam und bedienten sich der leichten Transportgleise und Wagen in den verschiedenartigsten<br />
Formen. Selbst der deutsche Generalstab baute diese Möglichkeit des<br />
militärischen Nachschubs in seine strategischen Pläne ein. Die Aufträge häuften sich und<br />
es sah ganz so- aus, als ob das junge Unternehmen auf dem eingeschlagenen Wege ein<br />
führender Faktor im deutschen Wirtschaftsgeschehen werden würde.<br />
Der wachsende Erfolg veranlaßte jedoch Arthur Koppel im Jahre 1885, aus dem bisherigen<br />
Partnerschaftsverhältnis auszuscheiden und sich selbständig zu machen. Es entstanden die<br />
beiden Firmen „Orenstein & Koppel" und „Arthur Koppel". In einem Vertrag von fünfjähriger<br />
Gültigkeit grenzten beide Unternehmen ihren Arbeitsbereich ab: Arthur Koppel<br />
übernahm auf dem Gebiet des Feldbahnwesens das Auslandsgeschäft, Benno Orenstein<br />
das Inlandsgeschäft.<br />
Waren beide Firmen bisher vorwiegend Handelsunternehmen, so machte der rapide<br />
ansteigende Umsatz eine Eigenproduktion erforderlich. Im Jahre 1886 entstanden die<br />
ersten Werkstätten der Firma Orenstein & Koppel am Tempelhofer Ufer in Berlin,<br />
1893/94 folgten die ersten Fabrikanlagen auf einem militärfiskalischen Gelände am Bahnhof<br />
Tempelhof bei Berlin und in Dorstfeld bei Dortmund, während Arthur Koppel neben<br />
einem gepachteten Werksgelände am Tempelhofer Ufer weitere Fabriken in Bochum<br />
und Wolgast (Pommern) schuf. Das Fertigungsprogramm beider Firmen bestand in der<br />
Herstellung von Weichen, Drehscheiben, Gleisen sowie Wagen unterschiedlichster Art<br />
230
für Feld- und Kleinbahnen mit den Spurweiten von 500 bis 900 mm, wobei das Schwergewicht<br />
nicht zuletzt auf Normung und Vorratsbau lag.<br />
Die Beförderung der Wagen auf Feldbahngleisen mit Pferden erreichte schließlich eine<br />
Grenze, die die Verwendung leichter Feldbahnlokomotiven zwingend notwendig machte.<br />
Die Erschließung billigen Waldterrains entlang der Havelseen südwestlich von Berlin<br />
durch die sog. „Wannseebahn" veranlaßte den Ingenieur Max Orenstein, ein Bruder des<br />
Firmengründers, zur Errichtung einer eigenen Lokomotivfabrik im späteren Villenvorort<br />
Schlachtensee. Hier wurden einfache, robuste Feldbahnlokomotiven von 10 bis 80 PS<br />
hergestellt; doch auch hin und wieder normalspurige Lokomotiven, wie z. B. für eine<br />
dänische Nebenbahn, verließen in der kurzen Zeit der Fertigung dieser Fabrik von 1892<br />
bis 1898 das Werk, das etwa siebzig Menschen beschäftigte und im Schnitt wöchentlich<br />
eine Lokomotive zum Versand brachte. Das „Verwaltungsgebäude" der Fabrik, ein einfaches,<br />
zweistöckiges Wohnhaus am Rande des ehemaligen Werksgeländes, heute Breisgauer<br />
Straße 5, erinnert noch an die damalige Zeit.<br />
1897 wurde die bisherige offene Handelsgesellschaft Orenstein & Koppel in die „Aktiengesellschaft<br />
für Feld- und Kleinbahnbedarf, vorm. Orenstein & Koppel" umgewandelt.<br />
Gemäß Eintragung in das Handelsregister befaßte sich die Gesellschaft mit „Fabrikation<br />
und Ankauf von Materialien, Werkzeugen, Wagen und Maschinen zum Bau und zur Ausrüstung<br />
von Eisenbahnen, insbesondere von Feld-, Industrie- und Kleinbahnen sowie zu<br />
Brücken- und Wasserbauten aller Art, ferner Verkauf und sonstige Verwertung, namentlich<br />
231
MÄRKISCHE<br />
)KOMOTIV-FABRIK<br />
3CHLACHTENSEE UND BERLIN.<br />
Telegramm - Adresse:<br />
Lokoirrttiv-FaBrik Schlachtensee.<br />
ernspreeb - Anscmuss:<br />
Amt Wannsee 25.<br />
Telegramm - .Adresse:<br />
Märkische Lokc-motiv-Fabrik<br />
Berlin 8.<br />
Fernsprech-Ansertriiss: Amt 1. 397.<br />
NämmtHche OMTWyowhaawi sind zu riehteil<br />
Stadt-Geschäft:<br />
/VI Ä RKISCHE |_OKOMOTW - j 7 ABRIK<br />
BERLIN VV.<br />
WF~ Friedrich-Strasse No. 59 60<br />
EQUITABLE -GEBÄUDE.<br />
Titelseite des Firmenkatalogs<br />
der „Märkischen Lokomotivfabrik", 1892<br />
Vermietung der zu vorgedachten Zwecken erforderlichen und geeigneten Artikeln, endlich<br />
Übernahme des Baues von Feld-, Industrie- und Kleinbahnen sowie von normalspurigen<br />
Anschlußgleisen".<br />
Zu jener Zeit waren die Fabriken in Tempelhof und Schlachtensee an ihrer Kapazitätsgrenze<br />
angelangt. Auch konnte die Firma Orenstein & Koppel nach Ablauf des fünfjährigen<br />
Abgrenzungsvertrages mit Arthur Koppel jetzt selbst exportieren und gründete<br />
ein eigenes, über die ganze Welt verzweigtes Verkaufsnetz. Aus zolltechnischen Gründen<br />
entstanden zusätzlich neue Fabriken in Lieben bei Prag, St. Lörincz bei Budapest, Kolo<br />
bei Warschau sowie in St. Petersburg (Rußland) und Val St. Lambert (Belgien).<br />
Am 31. Dezember 1898 wurde die „Märkische Lokomotivfabrik" in Schlachtensee stillgelegt<br />
und am 2. Januar 1899 ein neu errichtetes Werk in Drewitz bei Potsdam in Betrieb<br />
genommen, das sich zu einer bedeutenden Lokomotivfabrik im Berliner Raum entwickeln<br />
sollte. Gleichzeitig wurde anstelle der Werksanlagen in Tempelhof eine Waggon- und<br />
Weichenbau-Anstalt in Spandau errichtet.<br />
In Drewitz konnte Max Orenstein seine Vorstellungen von rationeller Arbeitsweise und<br />
entsprechender Lagerhaltung voll und ganz entfalten. Mittelpunkt der Lokomotivfabrik<br />
war der für Generationen von Werksangehörigen unvergessene „Cirkus", ein kreisrunder<br />
232
Teilansicht der Fabrik von Orenstein & Koppel in Drewitz mit kreisrunder Montage (Zirkus)<br />
Kuppelbau, in dessen Mitte ein um seine Mittelachse sich drehender Portalkran arbeitete.<br />
Hier lief ein ununterbrochenes Fertigungsprogramm von Feldbahnlokomotiven ab, die, wie<br />
aus einer Zentrifuge geschleudert, bis in die äußersten Winkel der Welt gelangten, wo sie<br />
vereinzelt noch heute, nach siebzig Jahren, anzutreffen sind. Als zu Beginn dieses Jahrhunderts<br />
die Fabrik auch die ersten Aufträge seitens der damaligen Kgl. Preußischen<br />
Staatsbahnen erhielt, trat sie in die Fertigung von Vollbahnlokomotiven ein und wurde<br />
neben ihrem bisherigen Fertigungsprogramm zu einer Lieferantin namhafter europäischer<br />
und außereuropäischer Eisenbahnverwaltungen.<br />
Zu den wichtigsten Arbeitsgebieten der „Aktiengesellschaft für Feld- und Kleinbahnbedarf,<br />
vorm. Orenstein & Koppel" gehörte die Bahnabteilung. Ursprünglich für die<br />
Anlage von Anschlußgleisen an die Staatsbahnen innerhalb Deutschlands gedacht, ging<br />
man bereits im Jahre 1895 zum Bau der ersten kompletten Eisenbahn über, die sowohl<br />
dem Personen- wie auch dem Güterverkehr dienen sollte: Die 22 km lange Rosenberger<br />
Kreisbahn in Oberschlesien. Es folgten als weiterer größerer Bau im Jahre 1899 eine<br />
rd. 85 km lange Bahn im Kreis Wirsitz (Prov. Posen) sowie, als Großprojekt, in der Zeit<br />
von 1903 bis 1906 im damaligen Deutsch-Südwestafrika die 600 km lange Otavi-Bahn<br />
mit allem rollenden Material, und im Jahre 1912 die 5 km lange Bahnlinie von Wannsee<br />
zu den Berliner Friedhöfen bei Stahnsdorf, um nur einige wenige Objekte zu nennen.<br />
Als Arthur Koppel im Jahre 1908 unerwartet in Baden-Baden starb, gingen seine Unternehmen,<br />
zu denen auch eine Maschinenfabrik in Koppel bei Pittsburg (USA) gehörte,<br />
an Orenstein & Koppel über. Zu dieser Zeit stand die Firma im Zenit ihres Bestehens und<br />
ihre weltumfassende Bedeutung wurde durch das Sinnbild der Weltkugel am First der<br />
Vorderfront ihres Gebäudekomplexes am Tempelhofer Ufer zum Ausdruck gebracht,<br />
der Sitz der Zentralverwaltung des Konzerns war und von dem aus die Verbindungen zu<br />
den Niederlassungen rund um den Erdball gingen. Die beiden wichtigsten Betriebe be-<br />
233
fanden sich ebenfalls im Berliner Raum, wie aus dem Titelbild eines damaligen Verkaufsprospektes<br />
hervorging: Die Lokomotivfabrik in Drewitz und die Waggonfabrik mit Weichen-<br />
und Signalbauanstalt in Spandau. Letztere hatte kurz nach der Jahrhundertwende<br />
auch mit der Herstellung von Eimerkettenbaggern begonnen. Diese zunächst noch aus<br />
Eisen und Holz konstruierten Geräte, die durch Dampflokomobile oder Spiritusmotoren<br />
angetrieben wurden, waren die Vorstufe zu den ersten, ebenfalls in Spandau entwickelten<br />
Löffelbaggern.<br />
Im Jahre 1911 kauften O & K den überwiegenden Anteil an der Lübecker Maschinenbau-<br />
Gesellschaft, deren Spezialität Eimerketten-Trockenbagger bildeten, doch auch Elevatoren,<br />
Schiffe und dergl. befanden sich im dortigen Fertigungsprogramm. Ein weiteres, für<br />
O & K wichtiges Unternehmen, die „Montania AG" in Nordhausen, die Rohölmotore,<br />
Explosionsmotor-Lokomotiven für Schmalspur sowie Gesteinsbohrmaschinen herstellte,<br />
wurde dem Konzern eingegliedert, der im Jahre 1914 über insgesamt zwölf Werke verfügte.<br />
Nach Überwindung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Ersten Weltkrieges<br />
kamen die Dessauer und Gothaer Waggonfabriken hinzu. Elektro- und Diesellokomotiven<br />
für Rangierzwecke sowie Ackerschlepper und Lastwagenanhänger, ja sogar Flugzeuge<br />
wurden in das Lieferprogramm aufgenommen. Aus Lübeck kamen die neuen Schaufelradbagger;<br />
die Schiffswerft an der Trave war vollauf beschäftigt.<br />
Die Zeit von 1933 bis 1945 brachte auch für die Firma Orenstein & Koppel tiefgreifende<br />
Veränderungen. Ihr Name wurde im Jahre 1941 in die Bezeichnung „Maschinenbau und<br />
Bahnbedarf (MBA)" geändert. Waren bis Kriegsausbruch im gesamten Konzern fast<br />
20 000 Mitarbeiter tätig, so sind es heute nur etwa die Hälfte, denn 80 % der inländischen<br />
Produktionsstätten und der gesamte Auslandsbesitz waren 1945 verlorengegangen.<br />
Seit im Jahre 1950 zwischen der MBA und der Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft die<br />
endgültige Fusion stattgefunden hatte, firmiert das heutige Unternehmen, das sich seitdem<br />
auch anderweitig wieder vergrößerte, unter dem Namen „Orenstein-Koppel und<br />
Lübecker Maschinenbau AG". Im Jahre 1965 wurde die Hauptverwaltung dorthin verlagert,<br />
wo einst Benno Orenstein eine seiner ersten Fabrikationsstätten einrichtete: nach<br />
Dortmund. Am früheren Fertigungsprogramm des einstigen Konzerns hat sich nicht viel<br />
geändert, wenn sich auch beispielsweise der Lokomotivbau heute in Dorstfeld nur noch auf<br />
Diesellokomotiven für Werks- und Anschlußgleise beschränkt. Die breite Palette an Baggern<br />
wurde ausgebaut, der Schiffsbau neuzeitlichen Verhältnissen angepaßt, der Bahnbau<br />
wieder aufgenommen. Das am Brunsbütteler Damm in Spandau gelegene Berliner Werk<br />
liefert heute wieder Waggons für Reisezüge, Gesellschafts-, Speise-, Schlaf- und Liegewagen<br />
sowie Salon-, Gepäck-, und Bahnpostwagen. U- und S-Bahn-Wagen sowie Omnibusse<br />
kamen hinzu. Die Verbundenheit dieser Fabrik mit dem Verkehrswesen ist letztes<br />
Überbleibsel aus einer Zeit, da die Gründungsfirma Orenstein & Koppel mit ihren Feldbahnen<br />
ein Wegbereiter auf Schienen bis in die entferntesten Winkel der Erde gewesen<br />
war. Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 15. Meierottostraße 4<br />
Schrifttum:<br />
Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften. Jg. 1898 — 1906<br />
Denkschrift der Firma Orenstein & Koppel zur Fertigstellung der 5000. Lokomotive. Berlin 1913<br />
Kurt Pierson: Die Märkische Lokomotivfabrik. Dortmund 1971 (Böttchers Kleine Eisenbahnschriften. Heft 74)<br />
Industrial Railway Record, Nr. 40, Leicester 1971<br />
Orenstein & Koppel. Jahrhundertschrift 1976<br />
Bildnachweis: Die Abbildungen stammen aus dem Archiv des Verfassers<br />
234
Kunstführer - Baubeschreibung - Inventarisation<br />
Zur Entwicklung der kunst- und architekturgeschichtlichen Bestandsaufnahme im Berliner<br />
Raum<br />
Von Dr. Peter Letkemann<br />
Fast gleichzeitig gingen der Redaktion der „Mitteilungen" im vergangenen Herbst die<br />
Manuskripte der beiden nachfolgenden Beiträge dieses Heftes ein, die sich mit der Inventarisation<br />
der Berliner Bauten und Denkmäler befassen: Einmal die Erinnerungen eines<br />
unmittelbar Beteiligten an den Maßnahmen vor rund 4()Jahren,die — durch die Kriegsereignisse<br />
überdeckt und in den Resultaten weitgehend ausgelöscht — heute praktisch unbekannt<br />
sind; zum anderen die sachliche Reportage über die Berliner Denkmalkartei von 1975<br />
als ein Abschlußbericht, wie er in diesem Bereich leider nicht allzu häufig anzutreffen ist.<br />
Beide Texte ergänzen sich auf ideale Weise und legen jeweils beredtes Zeugnis ab für<br />
verschiedene Stationen denkmalpflegerischen Bemühens in unserer Stadt. Auch die Zielvorstellung<br />
und der organisatorische Ansatz stimmen weitgehend überein, und verfolgt<br />
man die weiteren, auch die weiter zurückliegenden Berichte zum gleichen Anliegen, so<br />
ist auch dabei die einheitliche, „konservatorische" Richtung unverkennbar.<br />
Leider fehlt ein zusammenhängender historischer Überblick über die jeweiligen organisatorischen<br />
Maßnahmen auf dem Sektor der Baubeschreibung und der Inventarisation,<br />
obschon die publizistische Kommentierung dieser Maßnahmen - mit Ausnahme bei<br />
neuen und manchmal überraschenden kunstgeschichtlichen Ergebnissen - meist nur spärlich<br />
ausfiel. Vieles blieb auch im Programmatischen stecken und gelangte nie über das<br />
Anlegen einer ersten Karteikarte hinaus. Inventare sind ein langwieriges, arbeitsintensives<br />
und teures Unternehmen, wovon das gegenwärtige auf West-Berliner Boden ein<br />
überzeugendes Beispiel liefert. Die übrigen flankierenden Beiträge zu diesem Thema sind<br />
verstreut, stehen häufig an versteckter Stelle, für den Uneingeweihten kaum auffindbar<br />
und selbst in den ortsgeschichtlichen Bibliographien nicht immer eindeutig zugeordnet.<br />
Nur gelegentlich bieten sie auch das, was man gemeinhin „Hintergrund" nennt, weshalb<br />
sich die fehlende Gesamtdarstellung um so nachhaltiger bemerkbar macht. Von den insgesamt<br />
10 Teilen des seit 1964 in lockerer Folge erscheinenden Sammelwerks „Berlin und<br />
seine Bauten" trägt einer den Titel „Zusammenfassung der baugeschichtlichen Vorgänge.<br />
Verwaltungsgeschichte, Denkmalpflege". Hier dürfte ein historischer Rechenschaftsbericht<br />
größeren Ausmaßes zu erwarten sein, doch wird dieser Band zeitlich nach allen anderen<br />
herauskommen - als letzter.<br />
Aus der Notwendigkeit, den beiden anschließend gedruckten Beiträgen etwas von dem<br />
„Hintergrund" zu geben, sind diese Zeilen entstanden. Sie waren ursprünglich als Marginalien<br />
zu den Erinnerungen von Heinrich Richartz (die in vielen Punkten noch zu ergänzen<br />
und zu erläutern wären) gedacht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.<br />
*<br />
Das Wissen um die Bedeutung der Kunstdenkmäler (im weitesten Sinne) und das Streben<br />
nach ihrer Erhaltung sind stets auch von dem Bemühen gekennzeichnet gewesen, sie<br />
beschreibend zu besitzen, sie zu katalogisieren, und zwar nicht nur zu akademisch-kunst-<br />
235
sinniger Betrachtung oder zu touristischen Werbezwecken, sondern auch mit dem Ziel<br />
einer offiziellen Bestandsaufnahme, um den Besitz, den Wert und gegebenenfalls auch die<br />
Schutzwürdigkeit zu dokumentieren. Alle drei Zielrichtungen liegen oft sehr nahe beieinander<br />
und können sich sogar wechselseitig bedingen.<br />
Friedrich Mielke hat kürzlich in seinem aufschlußreichen Überblick „Zur Genesis der<br />
Kunstdenkmäler-Inventarisation" 1 die Stationen dieser Entwicklung kurz aufgezeigt. Von<br />
den Verzeichnissen antiker Tempelschätze und den touristischen Reisebeschreibungen<br />
eines Herodot, Pausanias oder Marco Polo spannt sich der Bogen über die mittelalterlichen<br />
Bestandsaufnahmen in den Territorien zur Manifestation der Besitzrechte, etwa<br />
im Landbuch Kaiser Karls IV. von 1375 oder den kirchlichen Visitationsbüchern, bis zu<br />
den modernen Kunstführern eines Karl Baedeker (seit 1829), Jacob Burckhardts „Cicerone"<br />
oder dem Standardwerk unserer Tage, dem 1905 von Georg Dehio begründeten<br />
„Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler". Hier setzen bereits (sieht man vom „Baedeker"<br />
ab) die großen spezialisierten Reihenwerke ein, die sich dann gleichsam zu einer<br />
Institution entwickeln und wiederkehrend neu aufgelegt werden. Als optische Ergänzung<br />
zum „Dehio" ist schließlich seit einigen Jahren das von Reinhardt Hootz besorgte, vielbändige<br />
Bildhandbuch der „Deutschen Kunstdenkmäler" zu nennen, das für Ost und<br />
West in gleicher Ausstattung erschienen und in dessen Brandenburg-Band (1971) die<br />
Stadt Berlin in zeitgemäßem Umfang vertreten ist.<br />
Beschränken wir uns auf Berlin, so beginnt die Bestandsaufnahme der Stadt (im modernen<br />
Sinn) mit Georg Gottfried Küsters voluminösem Werk „Altes und Neues Berlin", dessen<br />
4 Teile (1737—1769) ein mit „schulmeisterlicher Emsigkeit zusammengetragenes Material"<br />
2 ausbreiten, in vielem unzulänglich und nicht durchweg auf eigener Anschauung<br />
basierend, doch wegen der Detailschilderungen auch wiederum wertvoll. Unmittelbar<br />
anschließend setzte der Buchhändler und Schriftsteller Friedrich Nicolai mit seiner „Beschreibung<br />
der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam" einen bedeutsamen<br />
Markstein: seine in drei Auflagen (1769—1786) erschienene Enzyklopädie über alles<br />
lebende und steinerne „Inventar" von Preußens Hauptstadt gilt als eine der bemerkenswertesten<br />
Bestandsaufnahmen auch der Bau- und Kunstdenkmäler, zugleich eine der<br />
ersten, die sich so umfassend einer einzelnen Stadt widmeten. Freilich — bei der Vielfalt des<br />
Gebotenen konnte Nicolai oft nur an der Oberfläche bleiben, selbst dort, wo er die<br />
„inneren Merkwürdigkeiten" beschreibt. Aber er hat fleißig die Quellen benutzt und ist<br />
somit, über die bloße Anschauung hinaus, tiefer in die Geschichte einzelner Objekte eingedrungen<br />
3 .<br />
Rund ein Jahrhundert später erst kommen die Fachleute zu publizistischen Ehren, denn<br />
das vom Berliner Architekten-Verein 1877 herausgebrachte Werk „Berlin und seine<br />
Bauten" (2. Aufl. 1896) war in erster Linie für Techniker bestimmt, verdient aber gleichwohl<br />
historische und denkmalpflegerische Beachtung. Erst nach dem 2. Weltkrieg fand<br />
es eine Neubearbeitung bzw. Fortsetzung durch das vom heutigen Berliner Architektenund<br />
Ingenieur-Verein betreute Reihenwerk gleichen Titels. Da es nur „typische Beispiele"<br />
herausgreift, ist es nicht eigentlich als Inventar anzusehen und strebt auch keine Konkurrenz,<br />
lediglich eine Ergänzung zu dem vom Amt für Denkmalpflege herausgegebenen<br />
Sammelwerk der „Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin" an 4 .<br />
Dieses Nebeneinander von technisch-exemplarischer und kunstgeschichtlich-analytischer<br />
Bestandsaufnahme gab es bereits Ende des vorigen Jahrhunderts, als der Berliner Magistrat<br />
den Auftrag zu einer historischen Dokumentation der städtischen Kunstbauten<br />
236
erteilte, eben als Ergänzung zum Werk des Architekten-Vereins. Vor dem Hintergrund<br />
des durch die Gründung des Deutschen Reiches „lebhaft gesteigerten Nationalgefühls"<br />
und eines „erhöhten Interesses für vaterländische Geschichte und die Denkmäler der<br />
Vergangenheit" — so Oberbürgermeister Zelle im Geleitwort — erschien im Jahre 1893 der<br />
von Regierungs-Baumeister Richard Borrmann bearbeitete Großband über „Die Bau- und<br />
Kunstdenkmäler von Berlin", ein Standardwerk auf solider Quellenbasis, das über den<br />
aktuellen Gegenwartsbestand auch die historische Entwicklung einschließlich der untergegangenen<br />
Gebäude (z. B. des Münzturms) gebührend berücksichtigte. Nicht enthalten<br />
sind darin die Objekte in Museen und Kunstsammlungen, da hierzu vielfach schon<br />
SpezialVerzeichnisse vorlagen.<br />
Borrmanns Arbeit war gleichsam notwendig geworden, weil die Stadt Berlin in dem 1886<br />
veröffentlichten Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg keinen<br />
Platz gefunden hatte. Damit ist bereits auf ein anderes Unternehmen verwiesen, das neben<br />
den reinen kunsttopographischen Handbüchern sich seit Jahrzehnten um die Erfassung<br />
des historisch als wertvoll eingestuften Baubestandes bemühte: die Inventarisation der<br />
Bau- und Kunstdenkmäler unter dem Gesichtspunkt der staatlichen Denkmalpflege. Da<br />
diese parallel zum publizistischen Bauten- und Kunstführer läuft, ihn sogar durchweg im<br />
Gefolge hat, sollen hier einige Momente aus jener Entwicklung aufgezeigt werden, ohne<br />
den vielschichtigen Begriff etwa näher zu erläutern oder an Hand praktischer Beispiele<br />
sichtbar machen zu wollen. Die Denkmalpflege ist als kunst- und kulturpolitischer Auftrag<br />
für jede Epoche sicherlich unumstritten, in ihrer konkreten Handhabung und Durchführung<br />
jedoch an ein wechselndes Geschichtsverständnis gebunden und zusätzlich in den<br />
Streit der Interessengruppen verwickelt. Ungeteilten Erfolg erringt sie stets im dokumentarischen<br />
Bereich, eben in den Verzeichnissen und Inventaren.<br />
Bleiben wir beim historischen Ablauf: Die Denkmalpflege als Organisationsform ist ein<br />
Kind des frühen 19. Jahrhunderts, namentlich der restaurativen Ära nach den Befreiungskriegen<br />
und - zumindest in Preußen - mit dem Namen Karl Friedrich Schinkels untrennbar<br />
verknüpft. Seine Anweisungen auf theoretischem Feld blieben ebenso bedeutsam wie seine<br />
praktischen Arbeiten, etwa an den Kirchenbauten in Köln, Frankfurt/O.. Wittenberg, der<br />
Klosterkirche zu Berlin oder der Marienburg (Westpreußen) 5 . In anderen deutschen<br />
Ländern gab es ähnliche Ansätze, so in Bayern (vor 1800), Hessen-Darmstadt (1818) und<br />
Württemberg (1836); konkrete Ergebnisse kamen in den preußischen Provinzen jedoch<br />
erst Ende der 30er Jahre zustande, als die Unterbehörden zur listenmäßigen Zusammenstellung<br />
der vorhandenen Baudenkmale aufgefordert wurden. Im Jahre 1843 errichtete<br />
man im Berliner Kultusministerium ein Kunstreferat mit dem Kunsthistoriker Franz Kugler<br />
und dem Architekten Ferdinand v. Quast an der Spitze, letzterer zugleich als erster Konservator<br />
der Kunstdenkmäler in den Preußischen Ländern. Mit der am 24. 1. 1844 erlassenen<br />
„Instruktion für den Konservator" wurde die staatliche Denkmalpflege in Preußen<br />
aus der Taufe gehoben: „Der Staat selbst übernahm den Schutz der Kulturdenkmale und<br />
baute ihn in einer bis zum heutigen Tage laufenden und keineswegs abgeschlossenen Entwicklungsgeschichte<br />
aus" 6 . Seit 1870 waren die Denkmalpflege und die Inventarisation<br />
den Provinzen übertragen, die in der Folgezeit eine große Zahl z. T. aufwendiger Inventarbände<br />
vorlegen konnten. 1891 folgte die Anstellung von ehrenamtlichen Provinzialkonservatoren<br />
und - im Rahmen einer inzwischen vielgestaltigen Gesetzgebung auf diesem<br />
Sektor - im Jahre 1907 das Gesetz gegen die „Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich<br />
hervorragenden Gegenden" als wichtiges Instrument der praktischen Arbeit 7 .<br />
237
Die Reichshauptstadt nahm unterdessen eine Sonderstellung in doppelter Hinsicht ein.<br />
Zunächst einmal war die Provinzialkommission für die brandenburgische Denkmalpflege<br />
nicht für die Stadt Berlin zuständig - ein verhängnisvolles, später häufig beklagtes Manko.<br />
Hierbei verdient es besondere Erwähnung, daß der Verein für die Geschichte Berlins<br />
schon frühzeitig seine Stimme erhob. Am 20. Mai 1898 richtete er an den Magistrat die<br />
Eingabe, „so bald als möglich eine Kommission für die Denkmalpflege in Berlin nach dem<br />
Vorbild der Provinzialkommission ... ins Leben zu rufen und derselben die ehrenamtliche<br />
Überwachung der Geschichts- und Kunstdenkmäler zu übertragen" 8 . In der Begründung<br />
dazu hieß es, eine an geschichtlichen Baulichkeiten so reiche Stadt könne nicht außerhalb<br />
der amtlichen Organisation der Denkmalpflege stehen, zumal die Gefährdung des Bestandes<br />
durch das weltstädtische Verkehrsaufkommen weitaus größer als anderswo sei.<br />
Als Beispiele werden die abgerissenen alten Stadttore und die in letzter Minute geretteten<br />
Königskolonnaden genannt. Der Verein verkenne zwar nicht die bisherigen Bemühungen<br />
der Stadt um den „thunlichsten Schutz der Denkmäler" und die Aktivitäten des Märkischen<br />
Museums, doch richteten Nachlässigkeit und Unverstand weiterhin viel Schaden an. „Es<br />
fehlt eben an einer geordneten Überwachung derartiger Vorgänge, die zu einer wirksamen<br />
Thätigkeit eine bestimmte Organisation zahlreicher, über die ganze Stadt verbreiteter<br />
ehrenamtlicher, mit Legitimation versehener Pfleger erfordert. Da nun die Bauspekulation<br />
mit jedem Tage weiter um sich greift und im Innern der Stadt namentlich historische<br />
Gebäude in rücksichtsloser Weise beseitigt, so macht die darin liegende Gefahr den<br />
Betheiligten zur Pflicht, die organisirte Denkmalpflege in Brandenburg durch eine gleiche<br />
Organisation in Berlin zu ergänzen und auch einen besonderen Konservator für Berlin zu<br />
bestellen."<br />
Drei Monate später gab der Magistrat eine eindeutig negative Antwort. Für eine eigene<br />
städtische Denkmalpflegekommission, so meinte er, gebe es keine zwingende Veranlassung,<br />
da diese gegenüber den verschiedenen Eignern von Monumentalbauten in Berlin —<br />
Fiskus, Königliches Haus, Reich — „keinerlei Autorität" würde beanspruchen können.<br />
Die Bauten unter städtischem Kirchen- und Schulpatronat würden gewissenhaft beobachtet,<br />
und mit dem Polizeipräsidium sowie der Königlichen Baukommission verständige man<br />
sich dahingehend, „wonach diese Behörden auf interessante alte Gebäude, sobald deren<br />
Abbruch beschlossen ist, uns aufmerksam machen". In diesen Fällen fertige man Lichtbilder<br />
und weise die beweglichen Gegenstände den Museen zu. Mit dem Bemerken, es<br />
gebe schließlich in der Person des Geh. Oberregierungsrats Persius einen „Königlichen<br />
Konservator zur amtlichen Wahrnehmung der archäologischen und kunstgeschichtlichen<br />
Interessen für Berlin" und dieser sei in verschiedenen Fällen — Hl. Geist-Kirche, Klosterkirche,<br />
Gymnasium zum grauen Kloster - tätig geworden, glaubte der Magistrat dem<br />
Geschichtsverein den Wind vollends aus den Segeln nehmen zu können. Doch jener war<br />
im Irrtum, denn neben anderen Institutionen hielt sogar die Denkmalpflegekommission<br />
der Provinz Brandenburg die Einrichtung eines besonderen Berliner Denkmalpflegegremiums<br />
mit einem Konservator an der Spitze für erforderlich 9 .<br />
Diese verworrene Situation war eigentlich der beste Garant für eine wenig Erfolg versprechende<br />
Arbeit. Und hier macht sich der zweite Aspekt der besonderen Stellung Berlins<br />
bemerkbar, vielleicht sogar als direkte Folge des ersten: Die eklatanten Bausünden vor<br />
allem der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts infolge der wirtschaftlichen, industriellen<br />
und verkehrsmäßigen Expansion, verbunden mit einem ungeheuren Bauvolumen, das in<br />
seiner Gestaltung allerdings vieles dem Zufall überließ und in seinem Stilempfinden völlig<br />
238
aus den Fugen geriet - Max Osborn hat nicht ohne Grund hierbei regelmäßig von einer<br />
„Verwilderung" gesprochen. Diese herbe Kritik in einem beinahe noch zeitgenössischen,<br />
wenn auch privaten Kunstführer 10 zeigt die damals herrschende Kluft auf - und an ein<br />
offizielles Berliner Inventar war noch viel weniger zu denken.<br />
Die folgenden Kriegs- und Nachkriegsereignisse brachten auf diesem Gebiet ohnehin<br />
alles zum Erliegen. Kommunalpolitisch schuf die Bildung von Groß-Berlin 1920 eine<br />
zusätzlich erschwerte Situation. Sie hinderte indes nicht, über die Versäumnisse der Vergangenheit<br />
weiterhin ein hartes Urteil zu fällen, wie es beispielsweise Stadtsyndikus und<br />
Bürgermeister Friedrich Lange tat, als er unter dem 10. 1. 1923 in seinem Tagebuch<br />
notierte: „Die Denkmalpflege von Alt-Berlin ist ein trauriges Kapitel. In einer Zeit, als<br />
der Stadt reichlich Mittel zur Verfügung standen, besonders in den letzten zwanzig<br />
Jahren vor dem Kriege, wo der Berliner Haushalt im Drucksatz stehen bleiben konnte und<br />
der Kämmerer Mühe hatte, die Überschüsse zu verschleiern, ist vom Magistrat wenig<br />
genug getan worden, um historisch und künstlerisch Wertvolles vor der Spitzhacke zu<br />
retten. Man glaubte offenbar sein Gewissen damit beruhigen zu können, daß man kleine<br />
Erinnerungsstücke aus Abrissen für ein später zu errichtendes Museum in Verwahrung<br />
nahm. Wieviel hätte an den Ufern des alten Schleusengrabens, in der Friedrichsgracht, der<br />
Spree- und Petristraße, am Molkenmarkt, im Krögel und anderswo unter Schutz genommen<br />
werden müssen. Aber der Berliner Freisinn perhorreszierte nun einmal den Eingriff in<br />
das Privateigentum." 11<br />
Erst im Jahre 1934 trat mit der Errichtung des Amtes für Denkmalpflege in Berlin eine<br />
Konsolidierung ein; erster Provinzialkonservator für die Reichshauptstadt wurde Mag.-<br />
Oberbaurat Walter Peschke 12 . Unmittelbar darauf begannen die Aufnahmen zu einer Vorinventarisation<br />
der Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin, die 1935 in das Hauptunternehmen<br />
einer umfassenden Inventarisation einmündeten. Deren Bearbeiter waren der Architekt<br />
Dipl.-Ing. Heinrich Richartz und der Kunsthistoriker und Pinder-Schüler Dr. Wilhelm<br />
Boeck; Einzelheiten aus dem Wirken jener Jahre bringt der hier folgende Artikel.<br />
Der 2. Weltkrieg vernichtete nicht nur die Früchte dieser Arbeit, sondern auch das in<br />
Jahrhunderten gewachsene Tätigkeitsfeld der Denkmalpfleger. Unter völlig veränderten<br />
Voraussetzungen begannen die Konservatoren von neuem; Namen wie Hinnerk Scheper<br />
und Paul Ortwin Rave stehen dabei als Verpflichtung und Vermächtnis. Die seit 1955 in<br />
Abständen erscheinenden Inventarbände „Die Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin",<br />
ergänzt durch handliche Kurzführer wie etwa die „Kleine Baugeschichte Zehlendorfs"<br />
(1970), vermögen nun auch auf publizistischem Gebiet eine lange Zeit als schmerzlich<br />
empfundene Lücke zu schließen.<br />
Anmerkungen: I<br />
1 In: Zeitschrift f. Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalpflege, Jg. 2 (1975), S. 134—143.<br />
2 Richard Borrmann: Die Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin, Berlin 1893, S. 103.<br />
3 Zur Methode und zur Beurteilung Nicolais siehe Horst Möller: Aufklärung in Preußen. Der Verleger,<br />
Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich Nicolai. Berlin 1974, S. 324 ff. (Einzelveröff. d. Hist. Kommission<br />
zu Berlin, Bd. 15).<br />
4 So im Vorwort zu Teil II von „Berlin und seine Bauten". Berlin/München 1964.<br />
5 Über die „Denkmalpflegerischen Grundsätze Schinkels" siehe: Karl Friedrich Schinkel - Lebenswerk. Hrsg. v.<br />
Paul Ortwin Rave. Bd. 10: Mark Brandenburg, bearb. v. Hans Kania u. Hans-Herbert Möller. Berlin/München<br />
1960, S. 224. Der Text der grundlegenden, von Schinkel geprägten Denkschrift der Berliner Ober-Baudeputation<br />
von 1815 ist wiedergegeben in: Die Denkmalpflege, Jg. 3 (1901). S. 6-7. Zum Folgenden siehe Mielke (wie<br />
Anm. 1), S. 138ff., mit weiterführender Literatur.<br />
6 Walter Peschke: Aufgaben der Denkmalpflege in Berlin, in: Zeitschr. d. Vereins f. d. Geschichte Berlins.<br />
Jg. 55 (1938). S. 81.<br />
239
7 Zur rechtlichen Entwicklung des Denkmalschutzes bis in die jüngste Zeit siehe neuerdings Hans-Georg<br />
Watzke: Denkmalschutz und Stadtplanungsrecht, Berlin 1976 (Selbstverl. des Dt. Instituts für Urbanistik).<br />
8 Denkmalpflege in Berlin, in: Mitt. d. Vereins f. d. Geschichte Berlins. Jg. 15 (1898), S. 92.<br />
' Zur Organisation der Denkmalpflege in Berlin, in: ebenda Jg. 16(1899),S. llf.<br />
0 Berlin (= Berühmte Kunststätten. Bd. 43), Leipzig 1909, S. 3, 242. 262 u. a.<br />
11 Friedrich C. A. Lange: Groß-Berliner Tagebuch 1920-1933, Berlin 1951, S. 38.<br />
2 Erwähnenswert ist sein ..Grundsatzreferat'' im Verein für die Geschichte Berlins, wiedergegeben siehe Anm. 6,<br />
zugleich mit zahlreichen Bildbeispielen; die Fortsetzung dann unter dem Titel: Denkmalpflegerische Streifzüge<br />
durch Berlin, in: Zeitschr. d. Vereins f. d. Geschichte Berlins. Jg. 58 (1941), S. 76-82.<br />
Die Geschichte der Vorinventarisation in Berlin und der<br />
„Beschreibung der Bau- und Kunstdenkmäler der Reichshauptstadt"<br />
in den dreißiger Jahren<br />
Von Heinrich Richartz<br />
Vorbemerkung: Herr Dipl.-Ing. Heinrich Richartz, geb. 1903 in Düren, heute dort<br />
wohnhaft und zugleich als freischaffender Architekt und Denkmalpfleger tätig, hat<br />
im folgenden Beitrag seine Erinnerungen an seine Arbeit in Berlin (1932 — 1941)<br />
festgehalten. Sowohl durch die Ferne von Zeit und Raum als auch wegen des völligen<br />
Fehlens schriftlicher Unterlagen muß dieser Beitrag fragmentarisch bleiben;<br />
seine Aussagen ruhen in sich und wären gegebenenfalls durch entsprechende Hinweise<br />
früherer Kollegen und sonstiger Kenner der Szene zu ergänzen. Wo es uns<br />
geboten erschien, haben wir aufgrund des besseren Zugangs zu den historischen<br />
Hilfsmitteln (und im Einvernehmen mit Heinrich Richartz) die Ausführungen durch<br />
sachliche Zusätze erweitert und den Anmerkungsteil überarbeitet.<br />
*<br />
Die Schriftleitung<br />
Bald nach meinem Diplom-Examen in Aachen (1931) ging ich in den mageren Jahren um<br />
1932 wieder nach Berlin und setzte an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg<br />
das Studium, insbesondere der Baugeschichte, fort und nahm auf Anregung von<br />
Professor Dr. Arthur Mäkelt eine Promotionsarbeit in Angriff 1 . Durch einen befreundeten<br />
Ministerialrat im Kultusministerium ergab sich eine Kontaktvermittlung mit dem Staatskonservator<br />
Dr. Robert Hiecke 2 im gleichen Hause und durch diesen die Eingliederung in<br />
das erste preußische Schulungslager für Kunsthistoriker und Architekten zur Einführung<br />
in die Aufgaben der Inventarisation von Bau- und Kunstdenkmälern in Halle an der Saale<br />
unter der Leitung des Provinzialkonservators der Provinz Sachsen, Professor Dr. Hermann<br />
Giesau (1934).<br />
Nach Abschluß dieses „Schulungslagers'*, an dem zwanzig Kunsthistoriker und drei<br />
Architekten teilnahmen, ging ich als einziger Architekt neben neun Kunsthistorikern zu<br />
der Gruppe, die im Rahmen der „Notgemeinschaft deutscher Wissenschaft" zur Vorinventarisation<br />
in Berlin in Einsatz kam (1934/35). In Zweiergruppen wurden wir auf die<br />
einzelnen Stadtbezirke von Berlin angesetzt. Der eine machte Schwarzweißaufnahmen mit<br />
240
einer Kleinbildkamera, der andere die notwendigen Notizen. Mir wurde mit einer Kunsthistorikerin<br />
ein Gebiet im nördlichen Berlin zugeteilt. Schon damals sind auch Bauwerke<br />
des 19. Jahrhunderts, ganze ältere Baugruppen, sowie Parks und Friedhöfe mit ihren<br />
besonderen Monumenten erfaßt worden. Das erarbeitete Material wurde dem Denkmalarchiv<br />
der Stadtverwaltung einverleibt, ging aber am Ende des Krieges, wie der gesamte<br />
übrige Archivbestand, zugrunde.<br />
Nachdem diese erste Aktion einer Vorinventarisation von Bau- und Kunstdenkmälern in<br />
Berlin ausgelaufen war, wurde ich 1935 im Rahmen der Dienststelle des Provinzialkonservators<br />
der Reichshauptstadt mit dem Kunsthistoriker Dr. Wilhelm Boeck (geb. 1908 in Gießen)<br />
mit der Bearbeitung der Beschreibung der „Bau- und Kunstdenkmäler der Reichshauptstadt"<br />
beauftragt. Die kleine Dienststelle im Stadthaus an der Klosterstraße leitete<br />
als Provinzialkonservator der Architekt und Oberbaurat Walter Peschke. Neben einer<br />
Sekretärin gab es in zwei weiteren Räumen die Abteilung Denkmalpflege mit dem Kunsthistoriker<br />
Dr. Friedrich F. A. Kunze (lebt heute in München) und dem Architekten Dipl.-<br />
Ing. Lothar Dannenberg (fl974), sowie schließlich die Abteilung Inventarisation mit<br />
Wilhelm Boeck und mir.<br />
Wir beide mußten nun zunächst das große Arbeitsfeld mit vier alten Städten, Berlin, Kölln,<br />
Spandau und Köpenick, mit 56 ehemaligen Dörfern, aufgeteilt in 20 Verwaltungsbezirke,<br />
übersehen lernen. Die meiste Zeit verbrachten wir nicht in unserem Dienstraum, sondern<br />
am Ort und bei Forschungsarbeiten in zahlreichen Archiven und Plankammern. Das waren<br />
in erster Linie das Geheime Staatsarchiv in Berlin-Dahlem, wo wir die meiste Zeit arbeiteten<br />
und ganze Aktenberge nach Material durchforschten, dann auch das Brandenburg-<br />
Preußische Hausarchiv unweit vom Charlottenburger Schloß, das Stadtarchiv im Roten<br />
Rathaus, die Plan- und Aktenkammer der Preußischen Bau- und Finanzdirektion in der<br />
Nähe des Lehrter Bahnhofes, das Archivmaterial im Schlüterschen Schloß und im Märkischen<br />
Museum, die Staats- und Museumsbibliothek sowie die zahlreichen Orts- und<br />
Pfarrarchive.<br />
Uns wurde bald klar, daß die Notizen der sachwichtigen bau- und kunstgeschichtlichen<br />
Funde eine unübersehbare Zettelwirtschaft ergeben hätten; deshalb entwarf ich einen<br />
mehrseitigen Erfassungsbogen mit Beilageblättern, in denen für jedes Objekt alle anfallenden<br />
Feststellungen und Daten leicht einzutragen waren. Für öffentliche Bauten waren diese<br />
Erfassungsbogen rot, für kirchliche Bauten blau, für Wohnbauten gelb, für Parks und<br />
Friedhöfe grün, für technische Denkmale grau. In diesen paßartigen Bogen waren alle<br />
Bild- und Schriftquellen und alle neu anfallenden Ergebnisse einzutragen, Lichtbilder beizufügen<br />
und in einem nach Verwaltungsbezirken geordneten Kastenregal jederzeit greifbar<br />
abzulegen. So trug sich ein vielgefächertes Forschungsmaterial brauchbar zusammen.<br />
Uns schwebte das hervorragende Geisbergsche Inventar von Münster in Westfalen 3 als<br />
Ideal vor. Dort waren nicht nur die erhaltenen Bau- und Kunstdenkmäler erfaßt, beschrieben<br />
und abgebildet, sondern auch untergegangene Objekte, sofern sie zu rekonstruieren<br />
und darzustellen waren. Gerade für letztere fanden wir in unserem Forschungsbereich<br />
zahlreiche Quellen. Da gab es zum Beispiel das umfangreiche Aktenarchiv der Preußischen<br />
Bau- und Finanzdirektion, in dem wir viel altes Material an Zeichnungen und<br />
Schriften fanden, wonach umgebaute oder gar abgebrochene Kirchen, Pfarrhäuser und<br />
Schulen sich einwandfrei in ihrer ursprünglichen Gestalt bild- und schriftmäßig rekonstruieren<br />
ließen. Dabei ergaben sich hin und wieder auch kleine Sensationen. So begegnete<br />
mir im Stadtarchiv im Roten Rathaus eine Akte, in der sich ein Umbauplan mit Emporen<br />
241
für die Stadtkirche in Köpenick von dem barocken Architekten („Premier Architecte<br />
du Roi") Philipp Gerlach (1679—1748) fand, dem eine Baubestandsaufnahme zugrunde<br />
lag. Während die Köpenicker Stadtkirche sich am Ort als ein Bauwerk aus der Mitte des<br />
19. Jahrhunderts, offenbar auf alten Fundamenten, zeigte, war auf Grund dieses Fundes<br />
die romanische (!) Kirche von Köpenick einwandfrei zu rekonstruieren und darzustellen 4 .<br />
Eine weitere Entdeckung betraf das völlig in Vergessenheit geratene, um 1707—1710 von<br />
König Friedrich I. erbaute Schlößchen auf dem Gelände der nachmaligen Trabrennbahn<br />
Ruhleben 5 . Ähnliches ergab sich, wenn auch nicht so gravierend, an anderen Stellen und<br />
Objekten.<br />
Nach einer gewonnen Übersicht über den ganzen Groß-Berliner Raum beschlossen wir,<br />
den Verwaltungsbezirk Köpenick besonders intensiv zu erfassen und zu bearbeiten, um ihn<br />
als ersten Band der „Beschreibung der Bau- und Kunstdenkmäler der Reichshauptstadt"<br />
herauszubringen. Dieser Verwaltungsbezirk mit alter Stadt, bedeutendem Schloß, mit<br />
mittelalterlichen Dörfern und friderizianischen Siedlungen, vor- und frühgeschichtlichem<br />
Boden in schöner Landschaft schien uns für den Anfang ganz besonders vielseitig und<br />
ergebnisreich. Auf unsere Anregung unternahm das Institut für Vor- und Frühgeschichte<br />
der Friedrich-Wilhelms-Universität (Prof. Dorothea Waetzoldt) eine umfangreiche Ausgrabung<br />
im Hof des barocken Köpenicker Schlosses, wobei die Grundmauern der mittelalterlichen<br />
Burganlage freigelegt wurden 6 . Auch die mittelalterlichen Dorfanlagen (z. B.<br />
Schmöckwitz) und friderizianischen Siedlungen (Friedrichshagen und Müggelheim) konnten<br />
überzeugend dargestellt und beschrieben werden. Wir gingen sogar so weit, im neugotischen<br />
Rathaus zu Köpenick den Akten und Zeitungsausschnitten der bekannten<br />
Affäre des „Hauptmanns von Köpenick" ein wenig nachzugehen.<br />
Im allgemeinen hatten wir uns so abgestimmt, daß Boeck die Baugeschichte und ich die<br />
Baubeschreibung zu Papier brachte. Sämtliche erforderlichen Lichtbilder besorgte die<br />
Staatliche Bildstelle im Marstallgebäude am Schloßplatz in vorzüglicher Qualität. So<br />
wurde dieser erste Band der „Beschreibung der Bau- und Kunstdenkmäler der Reichshauptstadt"<br />
kurz vor Ausbruch des Krieges abgeschlossen und Druckerei-Verhandlungen<br />
in die Wege geleitet.<br />
Natürlich war es bei unseren Archiv- und Plankammer-Durchforschungen nicht möglich,<br />
nur Material für den als ersten ins Auge gefaßten Band des Verwaltungsbezirks Köpenick<br />
zusammenzutragen. Ganz zwangsläufig fiel dabei auch anderes aufgabenträchtige Material<br />
in großem Umfange an. Während wir in den Außenbezirken jeweils im Rahmen der Verwaltungsbezirke<br />
bleiben wollten, fanden wir es für den älteren Kern von Berlin besser,<br />
nach gegebenen historischen Entwicklungen die einzelnen geplanten Bände anzulegen,<br />
also jeweils abgeschlossen: Friedrichstadt, Friedrich-Wilhelmstadt. Dorotheenstadt, Luisenstadt.<br />
Zur 700-Jahrfeier von Berlin beauftragte uns die Berliner Stadtsynode, deren Kunstberater<br />
damals der Architekt Werner March, Erbauer des Berliner Olympia-Stadions, war, mit<br />
der Erstellung eines Buches: „Alte Berliner Kirchen", das dann auch 1937 im Atlantis-<br />
Verlag erschien. Neben knappen Texten, die wir uns aufteilten, wurden nur historische<br />
Darstellungen zur Illustration benutzt, wobei sich die Schwierigkeit ergab, daß aus Billigkeitsgründen<br />
für das Bändchen immer schwarz-weiße und farbige Darstellungen im Wechsel<br />
folgen mußten. Gleichzeitig brachte Friedrich F. A. Kunze den Band „Das alte Berlin"<br />
heraus, eine mit vorzüglichem Bildmaterial ausgestattete Stilgeschichte der Berliner<br />
Bauten vom Mittelalter bis zur Gegenwart.<br />
242
Nebenher gab es auch noch andere Arbeiten und Publikationen. So fand ich mit Boeck im<br />
Schloßpark von Friedrichsfelde im Gebüsch Fragmente von sandsteinernen Dachfiguren<br />
des dortigen Schlosses, die er Balthasar Permoser (1651 — 1732; 1704 — 1710 in Berlin<br />
tätig) zuschreiben konnte. Der Turm der Parochialkirche in der Klosterstraße war<br />
gelegentlich einer Einrüstung von Studenten der Technischen Hochschule aufgemessen<br />
und zur Darstellung gebracht worden. Nur der Helm mit dem Glockenspiel fehlte. Nach<br />
dem Meidenbauer'schen Meßbildverfahren habe ich dann in der Staatlichen Bildstelle<br />
dieses Aufmaß passend und genau ergänzt. Boeck schrieb eine kleine Publikation über die<br />
Kirche in Berlin-Buch 7 , ich zum Thema „Der Quastsche Nachlaß als Quelle zur Baugeschichte"<br />
8 . (Ferdinand v. Quast wurde nach dem Tode von Karl Friedrich Schinkel<br />
1843 zum ersten preußischen Staatskonservator berufen.)<br />
Auch gab es nette und fruchtbare Begegnungen mit manchen an der Geschichte Berlins<br />
interessierten Männern. So mit dem Pfarrer Paul Jorge, der ein wertvolles, originales Bändchen<br />
mit naiven, farbigen Darstellungen einer Reihe Berliner Dorfkirchen besaß 9 . Wie er,<br />
waren auch andere bei unseren Aufgaben hilfsbereit, wie jener Pfarrer in Berlin-<br />
Blankenfelde, der uns obendrein noch aus seiner schönen Bibliothek ein Bändchen zur<br />
Wahl schenkte, wobei Boeck eine ganz frühe Goethe-Ausgabe, ich Andersens Märchen,<br />
illustriert von Theodor Hosemann, aus jener Zeit an Land zog.<br />
Boeck wurde immer mehr ein großer Kenner der preußischen Bau- und Kunstgeschichte 10 ,<br />
während ich mich ganz von selbst zum besten Kenner der alten Berliner Dorfkirchen<br />
entwickelte. Im Laufe der Arbeiten fielen auch einige nette Nebenfunde an, die für die<br />
eigentliche Aufgabe allerdings kaum direkt zu verwenden waren 11 .<br />
Während dieser Inventarisations-Arbeiten unterlief der Abteilung Denkmalpflege unserer<br />
Dienststelle eine gravierende Panne. Das spätgotische, einschiffige Dorfkirchlein von<br />
Schmargendorf sollte eine Umluftheizung erhalten. Wir wußten, daß quer zum Schiff in<br />
einem kellerartigen Gewölbe die Gruft der Familie v. Wilmersdorf war, die sich längsseits<br />
durch ein liegendes, ovales, vergittertes Lüftungsfenster abzeichnete. Anstatt nun dem alten<br />
Beisetzungsweg im Inneren in der Mittelachse der Kirche umsichtig nachzugehen, schlug<br />
man den Scheitel des Gewölbes ein, der Schutt fiel auf die wohl sechs oder sieben beigesetzten<br />
Särge und zerstörte alles 12 . Ich sehe heute noch einen Bauarbeiter tagelang beim<br />
Sieben des Schutts beschäftigt. Nur ein Teil vom Schmuck der mumifizierten Leichen fand<br />
sich dabei, so zum Beispiel nur ein goldener Ohrring. Die schlimmste denkmalpflegerische<br />
Fehlhandlung, die mir je vor Augen gekommen ist. Der noch gerettete Schmuck ging an<br />
das Märkische Museum.<br />
Als dann der Krieg ausbrach, schloß der Provinzialkonservator 1939 etwas kopflos seine<br />
Dienststelle. Boeck wurde zu einer Kartenausgabestelle abgeordnet, ich ins Haupttiefbauamt<br />
zu der architektonischen „Gestaltung" eines vollautomatischen Getreidespeichers,<br />
der im Gleitbau an der Spree entstand. Aber bald bekam Boeck als Kunstgeschichtler eine<br />
Berufung an die Universität in Tübingen und ich als Konservator und Abteilungsleiter an<br />
die Abteilung Denkmalpflege und Naturschutz des Landesdenkmalamtes in Metz/Lothringen,<br />
einschließlich der Betreuung der dortigen Kathedrale.<br />
Dem Vernehmen nach soll indessen am Ende des Krieges das gesamte erarbeitete Inventarisationsmaterial<br />
und das Denkmalarchiv im Turm des Stadthauses an der Klosterstraße<br />
restlos verbrannt sein. Da wir für unsere Arbeit keine Schreibkraft zur Verfügung hatten<br />
und lediglich auf unsere privaten Schreibmaschinen angewiesen waren, machten wir in<br />
den seltensten Fällen Durchschläge von unseren Konzepten. Nur der Durchschlag vom<br />
243
Text der Beschreibung der Baugeschichte des Köpenicker Schlosses hat sich bei Boeck<br />
erhalten und befindet sich heute im Besitz der Staatlichen Verwaltung der Schlösser und<br />
Gärten in Berlin.<br />
Anmerkungen:<br />
' Monographie der altmärkischen Stadt Werben an der Elbe (nicht zum Abschluß gebracht). Siehe auch das<br />
Inventar des Kreises Osterburg, Halle 1936.<br />
2 Siehe Neue Deutsche Biographie Bd. 9, Berlin 1972, S. 106f.<br />
3 Max Geisberg (1875 — 1943), Kunsthistoriker und Museumsdirektor in Münster, legte 1932— 1941 ein öbändiges<br />
Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt vor. eine „gewaltige wissenschaftliche Arbeitsleistung" (Neue<br />
Dt. Biographie Bd. 6, Berlin 1964, S. 153f.).<br />
4 Mit Abbildungen wiedergegeben bei Walter Peschke: Aufgaben der Denkmalpflege in Berlin, in: Zeitschr. d.<br />
Vereins f. d. Geschichte Berlin. Jg. 55 (1938), S. 87.<br />
5<br />
Siehe Wilhelm Boeck und Heinrich Richartz: Ein Lustschloß König Friedrichs I. in Ruhleben, in: ebenda<br />
Jg. 54(1937). S.35-40.<br />
6<br />
Dorothea Waetzoldt: Ausgrabungen auf dem Gelände des Schlosses von Berlin-Köpenick, in: Prähist. Zeitschr.<br />
Bd. 28/29 (1937/1938), S. 356-365; Günter Schade: Schloß Köpenick. Ein Streifzug durch die Geschichte der<br />
Köpenicker Schloßinsel, Berlin (Ost) 1964, S. 8f.<br />
7<br />
Die Kirche in Buch 1736- 1936. (Selbstverl. der Gemeinde, 1936.)<br />
8<br />
In: Zentralblatt der Bauverwaltung, Jg. 1938, S. 367-369.<br />
9<br />
Zum Teil wiedergegeben in dem Band von Paul Torge: Rings um die alten Mauern Berlins. Berlin 1939.<br />
10<br />
Siehe Wilhelm Boeck: Inkunabeln der Bildniskarikatur, Stuttgart 1968. Dort im Anhang eine Bibliographie aller<br />
Veröffentlichungen von W. B., darunter auch diejenigen über den Berliner Raum.<br />
11<br />
Siehe Heinrich Richartz: Aus Berliner Archiven, in: Deutsches Ärzteblatt, Heft 40 v. 5. 10. 1972, S. 2588.<br />
12<br />
Blumige und offensichtlich auch verharmlosende Schilderung in: 750 Jahre Schmargendorf. Festschrift aus<br />
Anlaß des Stadtjubiläums, hrsg. vom Bezirksamt Wilmersdorf von Berlin 1955, S. 17.<br />
Anschrift des Verfassers: 5160 Düren, Cannstatter-Eifel-Straße 24<br />
Künstlerische Objekte in den öffentlichen Grünanlagen Berlins<br />
Die „Denkmalkartei Berlin (West)"<br />
Von Hartmut Solmsdorf<br />
1. Einleitung<br />
Im Sommer 1975 wurde der Verfasser vom Senator für Bau- und Wohnungswesen,<br />
Abt. III, beauftragt, im Rahmen des Denkmalschutzjahres eine „gutachterliche Erfassung<br />
der in den öffentlichen Grünanlagen Berlins vorhandenen Denkmäler" durchzuführen.<br />
Anlaß hierfür war in erster Linie die Tatsache, daß es zwar von (bisher) drei Bezirken<br />
(Tiergarten, Charlottenburg und Spandau) brauchbare, wenn auch fehlerhafte Inventare<br />
der „Bauwerke und Kunstdenkmäler" gibt, von den übrigen aber nur Listen mit teilweise<br />
unvollständigen Daten vorliegen, so daß eine Gesamtübersicht fehlt.<br />
Die Gründe dafür sind teils in den unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen oder Zuständigkeiten,<br />
teils im mangelnden Informationsaustausch der einzelnen Ämter untereinander<br />
zu suchen. Begrüßenswert wäre die Einrichtung einer zentralen Meldestelle, die bei jeder<br />
Veränderung (auch Beschädigung) des Denkmalbestandes zu benachrichtigen wäre.<br />
Ziel der Untersuchung ist die Aufstellung einer Kartei, aus der nicht nur Bestand und<br />
Zustand hervorgehen, sondern durch die man auch Hinweise auf falsch gewählte Stand-<br />
244
Büste des Julius Cäsar<br />
am Schloß Charlottenburg<br />
von Kaspar Günther, 1663<br />
(Foto: Solmsdorf)<br />
orte sowie Grünanlagen ohne oder ohne eine ausreichende Zahl Denkmäler und Skulpturen<br />
erhalten soll.<br />
Der Verfasser ist in erster Linie Herrn Dr. Klaus K. Weber zu besonderem Dank verpflichtet,<br />
da dieser durch seine Anregungen, Hinweise und Korrekturen die Untersuchung<br />
nachhaltig förderte. Neben den Gartenbau- und Kunstämtern, den Heimatvereinen und<br />
-museen sowie verschiedenen Berliner Künstlern sei allen Personen und Institutionen<br />
gedankt, die den Verfasser mit Auskünften und Hinweisen unterstützten.<br />
2. Untersuchungsverlauf<br />
Nach der Beschaffung von Unterlagen (Listen. Literatur) und der Kontaktaufnahme zu<br />
Dienststellen und Privatpersonen wurden in den Sommer- und Herbstmonaten die Objekte<br />
bezirksweise aufgesucht und - oft mehrmals, je nach Witterung - fotografiert (Schwarz-<br />
Weiß-Aufnahmen im Kleinbild-Format). Gleichzeitig wurden Angaben über Künstler,<br />
Inschrift, Größe und Zustand aufgenommen, soweit sie vor Ort ermittelt werden konnten.<br />
Fehlende Daten wurden teils aus der einschlägigen Fachliteratur, teils aus Listen der<br />
Gartenbau- und Kunstämter sowie Heimatvereine oder -museen übernommen.<br />
Von einigen Objekten, wie Laternen, „Rotunden", Geländern auf Brücken oder Ufer-<br />
245
mauern, waren keine oder nur geringe Angaben zu bekommen, da entweder wenig Aufzeichnungen<br />
existieren oder aber die Akten in Ost-Berlin liegen.<br />
Bei den einzelnen Objekten handelt es sich nicht nur um „Denkmäler" im engeren Sinne,<br />
d. h. „zur Erinnerung an eine Person oder ein Ereignis errichtete Gedächtnismale". Von<br />
vornherein bestand die Absicht, neben den eigentlichen Denkmälern auch den gesamten<br />
Skulpturen- und Brunnenbestand sowie das künstlerisch wertvolle „Parkmobiliar" (Pergolen,<br />
Laternen, Gitter, Bänke u. a. m.) mitzuerfassen.<br />
Teilweise wurden auch Objekte aufgenommen, die zwar „öffentlich", d. h. im Freiraum,<br />
aber nicht in öffentlichen Grünanlagen stehen.<br />
Aus verschiedenen Gründen (noch) nicht erfaßt wurden die Objekte im<br />
- Zoologischen Garten<br />
- Reichssportfeld<br />
- Skulpturengarten sowie<br />
Vorplatz der Neuen Nationalgalerie<br />
- Schloßpark Tegel und<br />
- in den kirchlichen Friedhöfen.<br />
Darüber hinaus läuft gegenwärtig eine Umfrageaktion bei den Wohnungsbaugesellschaften,<br />
um auch auf dem privaten Sektor das Inventar zu vervollständigen.<br />
Anschließend wurden die Angaben mit den einzelnen Bezirken sowie dem Landeskonservator<br />
abgestimmt und auf Karteiblätter (DIN A4) übertragen. Von den Kleinbild-Aufnahmen<br />
wurden Abzüge (9x13 cm) hergestellt und auf die Karteikarten geklebt. Zusätzlich<br />
wurden sämtliche Objekte mit ihrer lfd. Nummer sowohl auf den Bezirkskarten (Maßstab<br />
1 : 10 000 oder 1 : 20 000) als auch auf der Übersichtskarte von Berlin (West) (Maßstab<br />
1 : 50 000) lagerichtig eingetragen.<br />
3. Untersuchungsergebnis<br />
Im Frühjahr 1976 lag das Ergebnis in Form einer Kartei mit 1122 Blättern vor. Damit<br />
ist zwar der Bestand in den öffentlichen Grünanlagen nahezu vollständig, im gesamten<br />
West-Berliner Stadtgebiet jedoch nur zu etwa 85 % erfaßt. Die Zahl der Denkmäler,<br />
Skulpturen und Brunnen, die vor dem 2. Weltkrieg entstanden sind, überwiegt geringfügig<br />
jene der nach 1945 geschaffenen Objekte (vgl. Tab. 1 und 2). Im einzelnen trifft das aber<br />
nur für die Denkmäler und Brunnen zu, während die nach dem Krieg entstandenen Skulpturen<br />
- bedingt durch eine große Anzahl von abstrakten Bildwerken (77 Objekte) - in<br />
der Mehrzahl sind.<br />
175 Objekte, also etwa 15 %, sind im „denkmalfreudigen" 19. Jahrhundert geschaffen<br />
worden (davon sind 56 Denkmale und Baudenkmale sowie 41 Skulpturen). Viele sind<br />
durch Kriegseinwirkungen zerstört worden, einige (66 Objekte) haben im Laufe ihrer<br />
Geschichte ihren Standort mindestens einmal, manche öfter, gewechselt.<br />
Charlottenburg, Zehlendorf und Tiergarten ragen mit je ca. 150 Objekten aus der Masse<br />
der übrigen Verwaltungsbezirke hervor und erbringen mit zusammen 465 Objekten rund<br />
41 % des Gesamtbestandes. Das ist auf den ersten Blick dem hohen Grünflächenanteil<br />
in diesen Bezirken zuzuschreiben (zusammen 1412 ha = 33 % aller Parkanlagen, Friedhöfe<br />
und Sportplätze). Bei näherer Betrachtung stellt sich aber heraus, daß die Objekte<br />
auf die - gerade in diesen drei Bezirken liegenden - vier historischen Parks<br />
- Großer Tiergarten mit Schloßpark Bellevue,<br />
- Schloßgarten Charlottenburg,<br />
246
„Wolkentor",<br />
kinetische Großplastik<br />
mit Lichteffekten<br />
am Flughafen Tegel<br />
von Heinrich Brummack. 1975<br />
(Foto: Solmsdorf)<br />
— Schloß- (und Volks-)park Klein-Glienicke und<br />
— Pfaueninsel<br />
konzentriert sind, die von alters her einen überdurchschnittlich hohen Bestand an Denkmälern,<br />
Skulpturen und Parkmobiliar besaßen.<br />
Mit zusammen 430 ha, das sind 17 % der 192 Grünanlagen (58 Parke und 134 Stadtplätze),<br />
besitzen nur diese 4 Anlagen 230 Objekte (20 %, vgl. Tab. 3), davon allein<br />
134 Denkmäler und Skulpturen (22 % des Gesamtbestandes).<br />
Am besten mit Denkmälern „versorgt" ist der Große Tiergarten: Mit 73 Objekten (12 %<br />
der Gesamtzahl), davon 38 aus der Zeit zwischen 1740 und 1945, nimmt er eine Sonderstellung<br />
unter den Berliner Grünanlagen ein. Hier läßt sich eine „Denkmalsdichte" von<br />
1 Denkmal auf 2,5 ha errechnen, während die Relation im Durchschnitt 1:4,5 beträgt.<br />
Die ältesten Denkmäler (West-)Berlins stehen vor und hinter dem Charlottenburger<br />
Schloß: Vor der Nordfront die 1663 von Kaspar Günther geschaffenen 24 Büsten der<br />
römischen Kaiser nebst deren Gattinnen sowie das Reiterstandbild des „Großen Kurfürsten"<br />
von Andreas Schlüter 1703 (im Ehrenhof aufgestellt seit 1952).<br />
Danach folgen das „Schildhorn-Denkmal" (von August Stüler 1845), das Denkmal für<br />
König Friedrich Wilhelm III. (von Friedrich Drake 1849) im Großen Tiergarten sowie das<br />
247
1869 von Reinhold Begas geschaffene Schiller-Denkmal, das seit 1951 im Lietzenseepark<br />
steht (Bronzeabguß seit 1941 im Weddinger Schillerpark).<br />
Die ältesten Gedenksteine sind im Großen Tiergarten bzw. im Schloßpark Bellevue zu<br />
finden: Der Gedenkstein für den Hofmarschall von Bredow (von Antoine Tassaeri zwischen<br />
1774 und 1785) und der „Hochzeitsdenkstein" aus dem Jahre 1805 (von Gottfried Schadow).<br />
Die ältesten Skulpturen, „Flora" und „Pomona" (von Jeremias Süßner, um 1700), wären<br />
ebenfalls am Charlottenburger Schloß zu finden, wenn sie nicht nach dem Kriege durch<br />
Kopien ersetzt worden wären. So gesehen steht die älteste (Original-)Skulptur im<br />
Großen Tiergarten: „Herkules" (entgegen der amtl. Behauptung ohne Lyra, seine Gegenfigur<br />
„Apoll" besaß wohl eine solche) von Ebenhecht um 1750 geschaffen, an dieser Stelle<br />
allerdings erst seit 1893.<br />
Eines der jüngsten Objekte und — neben dem Luftbrücken-Denkmal (20 m hoch) — mit<br />
15 m Höhe eines der größten ist das „Wolkentor" von Heinrich Brummack (1975) vor<br />
dem Abfertigungsgebäude des Tegeler Flughafens.<br />
Das älteste Kriegerdenkmal, das „Denkmal für die Gefallenen von 1813—1815" von<br />
C. F. Schinkel (1816) steht auf dem Reformationsplatz in der Spandauer Altstadt. In<br />
Spandau (Seegefelder Straße 36) wurde auch 1957 eines der ersten abstrakten Bildwerke<br />
(von Joachim-Fritz Schultze) aufgestellt.<br />
Der „Wrangel-Brunnen" oder „Vier-Ströme-Brunnen" von Hugo Hagen (1876/77) im<br />
Grimmpark an der Urbanstraße ist der älteste Springbrunnen, der zudem noch in Betrieb<br />
ist; eine Feststellung, die man nur noch bei 86 Brunnen (68 %) treffen kann - die übrigen<br />
sind teils beschädigt, teils bepflanzt.<br />
Berlin (West) ist mit seinen 126 Brunnen nicht sonderlich gut ausgestattet, selbst dann<br />
nicht, wenn man die 73 Wasserspiele in Berlin (Ost) noch hinzurechnet. Zum Vergleich:<br />
München besitzt ca. 550 Lauf- oder Springbrunnen, die fast alle funktionieren. Und noch<br />
etwas: Die Münchener haben schon vor einigen Jahren ihren Bestand an Brunnen sowie<br />
an Denkmälern und Gedenktafeln aufgenommen und auch bereits in Wort und Bild<br />
veröffentlicht.<br />
Für folgende Denkmäler wäre aus verschiedenen Gründen eine Standortveränderung<br />
oder aber eine Neugestaltung ihrer Umgebung von Vorteil:<br />
Bez. Tiergarten:<br />
- Goethe-Denkmal<br />
- Lessing-Denkmal<br />
- Wagner-Denkmal<br />
- „Musikerofen"<br />
Gr. Tiergarten<br />
Gr. Tiergarten<br />
Gr. Tiergarten<br />
Gr. Tiergarten<br />
(Sperrbezirk)<br />
(Sperrbezirk)<br />
(schlechter Zugang)<br />
(Hauptverkehrsstraße)<br />
Bez. Wedding<br />
- Orpheus Eckernförder Platz (schlechter Zugang)<br />
Bez. Spandau<br />
- Friedrich Wilhelm IJ1. Zitadelle<br />
- Ares Zitadelle<br />
- Apoll Heerstraße<br />
248<br />
(versteckt)<br />
(beziehungslos)<br />
(beziehungslos)
Bez. Wilmersdorf<br />
— Winzerin Bundesplatz (Hauptverkehrsstraße)<br />
Zahlreiche Denkmäler und Skulpturen sind nicht mehr in ihrem Originalzustand erhalten.<br />
Sie sind mit Farbe verunziert, durch rohe Gewalt beschädigt, wenn nicht gar ganz oder<br />
teilweise entfernt, oder durch Bewitterung und zunehmende Umweltverschmutzung in<br />
ihrem Aussehen und ihrer Lebensdauer beeinträchtigt. Eine rasche Restaurierung wäre<br />
in solchen Fällen wünschenswert, doch würde sie bei einigen Bildwerken den Verfall<br />
wohl nur verzögern, aber nicht aufhalten.<br />
Tabelle 1<br />
Anzahl der aufgenommenen Objekte nach Objektgruppen und Entstehungszeit<br />
(des Originals oder der Vorlage)<br />
Objekt gruppe<br />
1. Baudenkmale<br />
(nach dem Verzeichnis in der Bauordnung)<br />
2. Denkmäler (i. e. S.)<br />
- Standbilder, Büsten<br />
- Reiterdenkmäler<br />
- Säulen<br />
— Siegesdenkmäler<br />
— Nationaldenkmäler<br />
- Kriegerdenkmäler<br />
- Kriegsopferzeichen<br />
- Grabdenkmäler<br />
- Gedenksteine (-tafeln)<br />
— „Berolinensia":<br />
- Trümmerdenkmal<br />
— Luftbrückendenkmal<br />
- „17. Juni"-Denkmäler<br />
— „Mauer"-Denkmäler<br />
— Flüchtlingsdenkmäler<br />
- Wiedervereinigungsdenkmäler<br />
3. Skulpturen<br />
- menschliche Gestalt<br />
- Tier<br />
- Pflanze<br />
- gem. Gruppen aus o. g.<br />
- abstrakt<br />
4. Brunnen<br />
(Lauf- und Springbrunnen)<br />
5. Park- (und angrenzendes Straßen-)mobiliar<br />
(mit künstlerischem Wert)<br />
vor<br />
1945<br />
20<br />
188<br />
65<br />
1<br />
8<br />
2<br />
-<br />
61<br />
-<br />
14<br />
37<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
111<br />
76<br />
16<br />
-<br />
19<br />
-<br />
66<br />
233<br />
Anzahl<br />
nach<br />
1945<br />
-<br />
113<br />
6<br />
-<br />
-<br />
1<br />
-<br />
9<br />
21<br />
1<br />
62<br />
13<br />
1<br />
1<br />
5<br />
2<br />
1<br />
3<br />
174<br />
26<br />
68<br />
2<br />
1<br />
77<br />
60<br />
157<br />
insgesamt<br />
20<br />
301<br />
71<br />
1<br />
8<br />
3<br />
-<br />
70<br />
21<br />
15<br />
99<br />
13<br />
285<br />
102<br />
84<br />
2<br />
20<br />
77<br />
126<br />
390<br />
Anm.<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
249
(Forts. Tab. 1)<br />
Objektgruppe<br />
- Meilen-, Kilometersteine<br />
— Laternen, Lichtständer<br />
- öffentl. Bedürfnisanstalten<br />
(„Rotunden")<br />
- Feuermelder („Schinkel-Melder")<br />
- öffentl. Straßenbrunnen<br />
(Lauchhammer- und Krauseständer)<br />
— Trinkbrunnen<br />
- Wasserfälle, Kaskaden<br />
— Pergolen<br />
- Bänke<br />
- Gitter, Geländer<br />
- Bauten und Bauteile<br />
(Pavillon, Mauer, Torpfeiler, Säule,<br />
Sockel, Kapitell)<br />
- Vogeltränken<br />
- Sonnenuhren<br />
- Pflanzschalen, -becken, Vasen<br />
— Hinweissteine, -tafeln, Richtungsweiser<br />
- Spielplastiken<br />
Summe<br />
vor<br />
1945<br />
8<br />
55<br />
16<br />
4<br />
10<br />
-<br />
5<br />
8<br />
33<br />
44<br />
24<br />
2<br />
2<br />
12<br />
8<br />
-<br />
618<br />
Anzahl<br />
nach<br />
1945<br />
1<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
32<br />
1<br />
6<br />
-<br />
1<br />
7<br />
27<br />
5<br />
5<br />
47<br />
8<br />
504<br />
insgesamt<br />
9.<br />
55<br />
16<br />
4<br />
10<br />
-<br />
6<br />
14<br />
33<br />
45<br />
29<br />
7<br />
17<br />
55<br />
8<br />
1122<br />
Anmerkungen:<br />
(1) Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg bereits in der Zahl der Baudenkmale enthalten.<br />
(2) Nur Gedenktafeln innerhalb der Anlagen berücksichtigt.<br />
(3) Holzkreuze entlang der „Mauer" nicht berücksichtigt.<br />
(4,6, 7, 8) Anzahl der Objekte im gesamten Stadtgebiet.<br />
(5, 9,10,11) Tatsächliche Gesamtzahl der aufgenommenen Objekte.<br />
250<br />
Anm.<br />
10(4)<br />
347 (5)<br />
38(6)<br />
16(7)<br />
107(8)<br />
187(9)<br />
62(10)<br />
77(11)
Tabelle 2<br />
Verteilung der Objekte auf die einzelnen Bezirke<br />
Hinweise: Obere Zahlen-Zeile jeweils: Entstehungszeit vor 1945; untere Zeile: nach 1945<br />
Letzte Spalte: Fläche der Parkanlagen (Grünanlagen, Tierparke, Kleingärten, Spielplätze)<br />
nach Statist. Jahrbuch Berlin 1975<br />
z<br />
BC7<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
20<br />
\ Objekt<br />
Bezirk \<br />
Tiergarten<br />
Wedding<br />
Kreuzberg<br />
Charlottenburg<br />
Spandau<br />
Wilmersdorf<br />
Zehlendorf<br />
Schöneberg<br />
Steglitz<br />
Tempelhof<br />
Neukölln<br />
Reinickendorf<br />
Tetlsumme<br />
Gesamtsumme<br />
&<br />
E<br />
c<br />
B<br />
-o<br />
ca<br />
2<br />
-<br />
1<br />
-<br />
1<br />
—<br />
-<br />
15<br />
1<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
20<br />
-<br />
20<br />
jg<br />
E<br />
M<br />
0J<br />
Q<br />
22<br />
17<br />
8<br />
16<br />
10<br />
5<br />
42<br />
12<br />
17<br />
5<br />
7<br />
8<br />
16<br />
12<br />
5<br />
5<br />
12<br />
12<br />
4<br />
4<br />
30<br />
7<br />
IS<br />
8<br />
188<br />
113<br />
c<br />
23<br />
35<br />
4<br />
12<br />
4<br />
5<br />
21<br />
18<br />
8<br />
15<br />
11<br />
12<br />
n<br />
20<br />
15<br />
8<br />
7<br />
11<br />
3<br />
9<br />
1<br />
17<br />
8<br />
12<br />
111<br />
174<br />
301 1 285<br />
g<br />
P<br />
3<br />
\r.<br />
C<br />
o<br />
47<br />
52<br />
12<br />
28<br />
15<br />
10<br />
64<br />
30<br />
2S<br />
20<br />
18<br />
20<br />
44<br />
32<br />
21<br />
13<br />
19<br />
23<br />
7<br />
13<br />
31<br />
24<br />
23<br />
20<br />
319<br />
287<br />
606<br />
e<br />
3<br />
CG<br />
1<br />
7<br />
5<br />
3<br />
1<br />
1<br />
6<br />
4<br />
9<br />
3<br />
5<br />
3<br />
14<br />
5<br />
11<br />
4<br />
5<br />
3<br />
8<br />
9<br />
5<br />
10<br />
4<br />
7<br />
66<br />
60<br />
126<br />
strieb<br />
oa<br />
c<br />
tu<br />
3<br />
3<br />
m<br />
7<br />
4<br />
3<br />
1<br />
1<br />
4<br />
4<br />
1<br />
2<br />
4<br />
3<br />
8<br />
3<br />
5<br />
4<br />
3<br />
1<br />
1<br />
5<br />
3<br />
9<br />
4<br />
6<br />
38<br />
48<br />
86<br />
;_<br />
1c<br />
E<br />
39<br />
7<br />
6<br />
30<br />
24<br />
-<br />
41<br />
13<br />
6<br />
3<br />
16<br />
10<br />
38<br />
21<br />
17<br />
5<br />
13<br />
31<br />
4<br />
13<br />
8<br />
17<br />
21<br />
7<br />
233<br />
157<br />
390<br />
tu<br />
E<br />
c<br />
3<br />
87<br />
66<br />
23<br />
61<br />
40<br />
11<br />
110<br />
48<br />
31<br />
26<br />
34<br />
33<br />
96<br />
58<br />
49<br />
22<br />
37<br />
57<br />
19<br />
35<br />
44<br />
52<br />
48<br />
35<br />
618<br />
504<br />
1122<br />
E<br />
E<br />
=3<br />
E<br />
es<br />
0J<br />
0<br />
153<br />
84<br />
51<br />
158<br />
57<br />
67<br />
154<br />
71<br />
94<br />
54<br />
96<br />
83<br />
1122<br />
ra<br />
x:<br />
c<br />
c<br />
-*C3<br />
278<br />
248<br />
36<br />
276<br />
164<br />
184<br />
451<br />
145<br />
314<br />
96<br />
193<br />
367<br />
2752<br />
251
Tabelle 3<br />
Grünanlagen mit der größten Anzahl an Objekten<br />
Hinweis: Obere Zahlen-Zeile jeweils: Entstehungszeit vor 1945; untere Zeile: nach 1945<br />
Bez. Nr.<br />
02<br />
07<br />
10<br />
10<br />
12<br />
14<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
252<br />
Anlage<br />
Gr. Tiergarten<br />
mit Engl. Garten<br />
und Schloßpark<br />
Bellevue<br />
Schloßgarten Charlottenburg<br />
mit Ehrenhof<br />
Schloß- und Volkspark<br />
Klein-Glienicke<br />
Pfaueninsel<br />
Stadtpark<br />
Steglitz<br />
Volkspark<br />
Hasenheide<br />
Viktoriapark<br />
Lietzenseepark<br />
H.-v.-Kleist-Park<br />
Botan. Garten<br />
Teilsumme<br />
Gesamtsumme<br />
Baudenkmäler<br />
2<br />
-<br />
10<br />
5<br />
-<br />
-<br />
1<br />
-<br />
-<br />
1<br />
19<br />
19<br />
Denkmäler<br />
16<br />
10<br />
29<br />
2<br />
1<br />
1<br />
4<br />
1<br />
4<br />
1<br />
2<br />
6<br />
64<br />
13<br />
77<br />
Skulpturen<br />
20<br />
25<br />
8<br />
1<br />
5<br />
-<br />
i<br />
1<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
7<br />
4<br />
49<br />
33<br />
82<br />
Zwischensumme<br />
38<br />
35<br />
37<br />
1<br />
17<br />
6<br />
2<br />
2<br />
4<br />
4<br />
6<br />
1<br />
4<br />
3<br />
8<br />
10<br />
132<br />
46<br />
178<br />
Brunnen<br />
3<br />
1<br />
7<br />
1<br />
3<br />
-<br />
1<br />
-<br />
1<br />
_<br />
1<br />
13<br />
5<br />
18<br />
Brunnen in Betrieb<br />
3<br />
1<br />
3<br />
1<br />
2<br />
1<br />
_<br />
_<br />
1<br />
-<br />
1<br />
8<br />
5<br />
13<br />
Parkmobiliai<br />
32<br />
3<br />
18<br />
9<br />
3<br />
16<br />
2<br />
13<br />
1<br />
8<br />
5<br />
4<br />
6<br />
2<br />
6<br />
2<br />
97<br />
33<br />
130<br />
Gesamtsumme<br />
111<br />
57<br />
37<br />
25<br />
20<br />
17<br />
16<br />
16<br />
14<br />
13<br />
326<br />
Fläche in ha<br />
187<br />
53<br />
90<br />
100<br />
12<br />
56<br />
13<br />
10<br />
6<br />
42<br />
569
4. Quellenverzeichnis<br />
Alckens, A.: München in Erz und Stein. Gedenktafeln, Denkmäler, Gedenkbrunnen. Mainburg 1973.<br />
Badstübner-Gröger. S.: Bibliographie zur Kunstgeschichte von Berlin und Potsdam. Berlin 1968.<br />
(Schriften zur Kunstgeschichte H. 13.)<br />
Baedeker, K.: Berlin-Schöneberg (Stadtführer). Freiburg 1974.<br />
Ders.: Berlin-Wedding. Freiburg<br />
Ders.: Berlin-Wilmersdorf. Freiburg 1975.<br />
Barth. J.: Stadtplätze. In: Berlin und seine Bauten, Teil XI: Gartenwesen. Berlin 1972, S. 153-175.<br />
Bauordnung für Berlin. Hrsg. v. Senator f. Justiz. Berlin 1971. In: GVB1. f. Berlin, 27, Nr. 24.<br />
S. 481 —483 (Verzeichnis der Baudenkmale).<br />
Berliner Grün - Ein Wegweiser. Hrsg. vom Senator f. Bau- und Wohnungswesen. Berlin 1972.<br />
Berlin und seine Bauten. Bearb. u. hrsg. vom Architekten-Verein zu Berlin u. der Vereinigung Berliner<br />
Architekten, 1. Aufl. Berlin 1877, 2. erweit. Aufl. (3 Teile in 2 Bänden) Berlin 1896.<br />
Bistritzki, O. J.: Brunnen in München. Lebendiges Wasser in einer großen Stadt. München 1974.<br />
Bloch, P.: Anmerkungen zu Berliner Skulpturen des 19. Jahrhunderts. In: Jahrbuch d. Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz. Berlin 1970, S. 162- 190.<br />
Borrmann, R.: Die Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin. Berlin 1893.<br />
Breuer, K.: Die Pfaueninsel bei Potsdam. Berlin 1922. -Diss.<br />
Die Siegesallee, eine Berliner Episode. Hrsg. vom Haus am Lützowplatz/Förderkreis Kulturzentrum<br />
Berlin e.V. Berlin 1973.<br />
Gestern noch auf hohen Sockeln .... Berliner Skulpturen des 19. Jahrhunderts. Hrsg. vom Haus<br />
am Lützowplatz/Förderkreis Kulturzentrum Berlin e.V. Berlin 1974.<br />
Hildebrandt, W.: Denkmäler und Schmuckplastiken in Berlin. Berlin 1962.<br />
Hoffmann, L.: Das Rudolf-Virchow-Krankenhaus. - Neubauten der Stadt Berlin. Berlin 1907.<br />
Hundert Jahre Berliner Grün. Hrsg. vom Senator f. Bau- u. Wohnungswesen Berlin 1970.<br />
Ingwersen, E.: Standbilder in Berlin. Berlin 1967. (Berlinische Reminiszenzen, 16.)<br />
Jahn, G.: Stadt und Bezirk Spandau. Berlin 1971. (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin.)<br />
Kleine Baugeschichte Zehlendorfs - Architektur und Gartenkunst im grünen Bezirk. Hrsg. vom<br />
Bezirksamt Zehlendorf von Berlin. 2. Aufl. Berlin 1972.<br />
Kühn. M.: Schloß Charlottenburg. Berlin 1970. (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin.)<br />
Müller-Bohn, H.: Die Denkmäler Berlins in Wort und Bild, nebst den Gedenktafeln und Wohnstätten<br />
berühmter Männer. 2. Aufl. Berlin 1905.<br />
Sasse, W.: Wege und Meilensteine weisen nach Berlin. S.-A. aus: Festschrift f. Edwin Redslob zum<br />
70. Geburtstag. Berlin 1955.<br />
Schirmer, W.: Eine Gruppe von Pavillons, Berliner Entwürfe des 19. Jahrhunderts. In: Festschrift<br />
Klaus Lankheit.<br />
Sievers. J.: Bauten für den Prinzen Karl von Preußen. Berlin 1942.<br />
Weber, K. K.: Historische Parke. In: Berlin und seine Bauten, Teil XI: Gartenwesen. Berlin 1972.<br />
S.51-69.<br />
Ders.: Berlins Parke seit 1900. In: Berlin und seine Bauten, Teil XI: Gartenwesen. Berlin 1972,<br />
S. 70-106.<br />
Wege durch Berliner Grünanlagen. Hrsg. vom Senator f. Bau- u. Wohnungswesen Berlin 1975.<br />
Wenke, K.: Die Steinmetzlehrwerkstatt. Berlin 1970.<br />
Wirth, I.: Bezirk Tiergarten. Berlin 1955. (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin.)<br />
Dies.: Stadt und Bezirk Charlottenburg. Berlin 1961. (Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von<br />
Berlin.)<br />
Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 19. Kaiserdamm 10<br />
253
Nachrichten<br />
Ehrenmitglied Johannes Schultze t<br />
Am 2. Oktober 1976 verstarb in Berlin unser Ehrenmitglied und Nestor der Berlin-Brandenburgischen<br />
Landesgeschichtsforschung, Prof. Dr. Johannes Schultze, im Alter von 95 Jahren. Er wurde<br />
am 13. Mai 1881 in Groß-Krausnigk. Kreis Luckau, geboren, besuchte später die Landesschule Schulpforta<br />
und schloß sein 1901 begonnenes Studium 1905 mit einer Promotionsarbeit über die Urkunden<br />
Kaiser Lothars III. ab. Ab 1905 stand er im Dienst der preußischen Archivverwaltung, die längste<br />
Zeit davon im Preußischen Geheimen Staatsarchiv in Berlin. Nicht nur als langjähriger Herausgeber<br />
der „Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte", sondern auch als Mitbegründer<br />
der Historischen Kommission der Provinz Brandenburg und der Reichshauptstadt Berlin<br />
war er stets mit Problemen der Landesgeschichtsschreibung intensiv beschäftigt. Bis zu seiner aus<br />
politischen Gründen erfolgten vorzeitigen Pensionierung im Jahre 1944 war er auch am Aufbau und<br />
an der Lehre in dem mit dem Dahlemer Archiv eng verbundenen Institut für Archivwissenschaft (If A)<br />
beteiligt. In dieser Zeit erschienen auch seine Editionen zum Briefwechsel Kaiser Wilhelms I. sowie<br />
des Landesregisters der Herrschaft Sorau und des Landbuchs von 1375.<br />
Nach dem Krieg erwarb sich Johannes Schultze große Verdienste nicht nur um den Wiederaufbau<br />
des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem, sondern auch um die Wiederbelebung der Berliner<br />
historischen Vereine. Nicht zuletzt ihm ist der Neuanfang auch unseres Vereins in den Jahren 1949/<br />
1950 auf seinen Einsatz zurückzuführen. Der Verein für die Geschichte Berlins dankte dies Schultze<br />
im Jubiläumsjahr 1965 mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.<br />
Über die wohl schöpferischste Epoche im Leben Johannes Schultzes, die Zeit nach 1945, handeln die<br />
Worte, die Prof. Dr. Wolfgang H. Fritze in der Trauerfeier für Johannes Schultze am 12. 10. 1976 als<br />
Vertreter des Fachbereichs Geschichtswissenschaften der Freien Universität Berlin sprach. Sie sind<br />
uns vom Verfasser in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt worden:<br />
Der Fachbereich Geschichtswissenschaften der Freien Universität Berlin, für den ich hier sprechen darf,<br />
verliert in Johannes Schultze ein Mitglied der ersten Stunde. Als der 68jährige im Jahre 1949 seine<br />
Tätigkeit in dem mit allen Schwierigkeiten des Anfangs ringenden Friedrich-Meinecke-lnstitut, dem<br />
Kern unseres Fachbereichs, aufnahm, lag - wir haben davon gehört - ein langes, arbeits- und erfolgreiches<br />
Berufsleben bereits abgeschlossen hinler ihm. Er durfte auf Jahre der ruhigen Arbeit am Schreibtisch<br />
hoffen, die die Ernte von Jahrzehnten in die Scheuer bringen sollten. Doch als der Ruf an ihn erging,<br />
hat er nicht gezögert, die neue schwere Bürde auf sich zu nehmen. Über 20 Jahre lang, von 1949 bis 1970,<br />
hat Johannes Schultze am Friedrich-Meinecke-lnstitut die Fächer Historische Hilfswissenschaften und<br />
Geschichte der Mark Brandenburg in Vorlesungen und Seminarübungen vertreten. Sein gütiges Verständnis<br />
für die Schwierigkeiten von Anfängern gewann ihm die Herzen seiner Hörer, sein lebendiger<br />
Geist, sein Humor, sein ausgeprägtes kritisches Bewußtsein, seine innerste Anteilnahme am Gegenstand<br />
weckten in ihnen das Interesse für seine Themen und machten sie aufnahmebereit für die reichen Kenntnisse,<br />
die er in langen Jahren seines Archivdienstes hatte sammeln können, vor allem als Herausgeber<br />
umfangreicher Quellen zur mittleren und neueren Geschichte und als Lehrer am Institut für Archivwissenschaft.<br />
Welch reicher Erfolg seiner Lehrtätigkeit beschieden war, haben seine Schüler dankbar<br />
bezeugt. Daß das gewöhnlich als trocken geltende Gebiet der sogen. Historischen Hilfswissenschaften,<br />
die ja eigentlich Grundwissenschaften unseres Faches sind, unseren Studenten lebendig nahegebracht<br />
wurde, das danken wir Johannes Schultze. Und wenn heute die wissenschaftliche Beschäftigung mit<br />
brandenburgischer Landesgeschichte in West-Berlin nicht völlig aufgehört hat, so ist das wiederum vor<br />
allem dem Wirken Johannes Schultzes an unserem Institut zu verdanken. Er hat uns die Augen für das<br />
spezifische Interesse und die Eigenart der märkischen Geschichte, für die Vielzahl und die Besonderheit<br />
ihrer Probleme geöffnet und hat uns verlockt, uns auch selber auf diesem nur scheinbar dürren Felde<br />
zu versuchen. Aber das Interesse des Historikers Johannes Schultze ging weil über seine Lehrfächer<br />
hinaus. So ist er es gewesen, der 1950 zusammen mit Fritz Härtung die Historische Gesellschaft zu<br />
Berlin wieder zum Leben erweckte, deren Vorträge damals wie heute das weite Feld der allgemeinen<br />
Geschichte umgreifen und so das Lehrprogramm unseres Fachbereichs auf vielfältige Weise bereichern.<br />
Angesichts dieser seiner Verdienste und Leistungen verstand es sich nur von selbst, daß Johannes<br />
Schultze zu seinem 75. Geburtstage 1956 auf Betreiben der damaligen Direktoren des Friedrich-<br />
Meinecke-Instituts die Würde eines Honorarprofessors an der Freien Universität Berlin erhielt.<br />
254
Foto: Geheimes Staatsarchiv<br />
Piaton hat bekanntlich im Theaitetos als Grundvoraussetzung, als apcn des wissenschaftlichen Denkens<br />
die Begabung zum Verwundern bezeichnet, die Fähigkeil, ein Gegebenes nicht als gegeben hinzunehmen,<br />
sondern nach seinem Warum zu fragen. Diese Gabe war Johannes Schultze in hohem Maße eigen. Es<br />
überrascht deshalb nicht, daß seine Lehrtätigkeit an unserem Institut von einer großen Zahl gelehrter<br />
Abhandlungen begleitet wurde, die - mit den Mitteln formaler wie inhaltlicher Quellenkritik — dem<br />
Warum von Gegebenheiten der märkischen Geschichte nachgingen, Gegebenheiten, die zu nicht geringem<br />
Teil bisher unbefragt geblieben waren. Politische Geschichte, Territorialgeschichte, Verfassungsgeschichte,<br />
Ständegeschichte, Städtegeschichte, alle diese Bereiche des geschichtlichen Lebens beschäftigten<br />
ihn in gleicher Weise, „ von der Mark Brandenburg zum Großstaat Preußen" - so der Titel eines<br />
seiner Aufsätze - schlug er den Bogen, die Stellung des Jaxa von Köpenick im Jahre 1150 fesselte ihn<br />
ebenso wie die Haltung Hannovers 1866. Grundfragen der älteren märkischen Geschichte sind durch<br />
Johannes Schultze erst eigentlich als Fragen erkannt worden, wie etwa die des Rechtsverhältnisses der<br />
Mark zum Reich, der verfassungsrechtlichen Stellung der Stadt Brandenburg in der Mark, der Unterscheidung<br />
von ritterlichem Eigen und Lehen in den Ländern östlich der Elbe, der Stadtviertel als städtegeschichtlichen<br />
Problems. Bis in seine letzte Lebenszeit hinein hat er in solcher Weise am wissenschaftlichen<br />
Leben teilgenommen. An Widerspruch hat es seinen Arbeiten keineswegs gefehlt. Aber gerade darin,<br />
daß sie Mitstrebende zur Auseinandersetzung zwangen, zeigte sich der wissenschaftliche Wert seiner<br />
Untersuchungen. An einer von Johannes Schultze aufgestellten These konnte und kann keiner vorüber,<br />
der sich mit diesen Fragen beschäftigt.<br />
Seine gelehrten Abhandlungen würden vollauf ausreichen, um Schultze seinen Ruf als bester Kenner<br />
der märkischen Geschichte zu sichern. Aber damit war es ihm nicht genug. Vielleicht war auch der Geschichtsschreiber<br />
der Mark eine „Natur, der das Greisenalter das Gemäße ist", wie Thomas Mann einmal<br />
von dem großen märkischen Wanderer gesagt hat. Doch müssen wir hier dankbar auch der hingegangenen<br />
Gattin und der Tochter gedenken, deren aufopfernde Fürsorge es Johannes Schultze ermöglichte,<br />
im biblischen Alter noch die Früchte lebenslanger Bemühung zu ernten. Denn als 75jähriger ließ er<br />
1956 sein erstes größeres Werk zur märkischen Geschichte erscheinen, sein Buch über die Prignitz, eine<br />
vortrefflich gearbeitete, nach allen Richtungen ausgreifende, moderne Fragestellung aufnehmende Landesgeschichte.<br />
1960 folgte ein Buch von nur scheinbar geringerem Rang, seine Geschichte von Rixdorf-<br />
Neukölln, das Modell geradezu einer Ortsgeschichte, in dem er exemplarisch eine Vielzahl von Phänomenen<br />
des strukturellen und kulturellen Werdens in der Mark behandelte und das ihm nicht ohne Grund<br />
besonders wert war. Von der Arbeit an diesen Bänden hat sein Hauptwerk profitiert, von dem er 1961,<br />
255
nun HOjährig, den 1. Band vorlegte, die Geschichte der Mark Brandenburg; bis 1969 folgten vier weitere<br />
Bände, die bis zur Auflösung der Mark Brandenburg im Jahre 1815 führten. Johannes Schultze<br />
hat uns damit die erste große Darstellung der märkischen Geschichte überhaupt gegeben und darüber<br />
hinaus die erste Geschichte der Mark, die durchgehend auf einer kritischen Aufarbeitung der Quellen<br />
aufgebaut ist. Auch in diesem opus maximum war sein Blick ebenso wie in seinen Abhandlungen und in<br />
seinem Prignitz-Buch stets auf das geschichtliche Leben in seiner Ganzheit und in seiner inneren Verflochtenheil<br />
gerichtet; was Strukturgeschichte und was sozialer Konflikt ist, das hat Johannes Schultze<br />
sehr gut gewußt, wenn er auch die Termini nicht gebraucht hat. Johannes Schultze hat für die märkische<br />
Geschichtsforschung einen neuen Grund gelegt. Wer immer jetzt und in Zukunft märkische Geschichte<br />
treibt, er wird von seinem Werk auszugehen haben.<br />
So groß die Bedeutung gewesen ist, die Schultze als Lehrer und als Forscher für unseren Fachbereich<br />
gehabt hat, so sind wir ihm doch noch auf eine andere Weise Dank schuldig. Eine nicht geringe Wirkung<br />
ist auch von der besonderen Art ausgegangen, auf die er Mensch war. Johannes Schultze konnte nach<br />
außen gelegentlich ein rauhes Wesen zeigen. Aber jeder, der ihn näher kennenlernen durfte, weiß, daß<br />
dahinter ein fast kindhaft reines Herz voll Liebe und Güte schlug, das gänzlich außerstande war, einem<br />
anderen Menschen Böses zuzufügen. Diesem seinem Daimonion gesellte sich das Teil, das Tyche ihm<br />
verliehen hatte. Johannes Schultze war seinem Wesen nach ein Preuße, aber freilich ein Preuße von<br />
besonderer Art. In diesem alten Gelehrten lebte unter uns ein Stück des alten Preußen, das Preußen der<br />
Schlichtheit und Anspruchslosigkeit, des treuen und hingebenden Dienstes an der Sache, der gehorsamen<br />
Pflichterfüllung, der unbedingten Rechtlichkeit und Redlichkeit, der Nüchternheit auch und der<br />
Skepsis gegenüber den großen Worten. In dem Sohne eines protestantischen märkischen Pfarrhauses<br />
und dem Zögling der altehrwürdigen hohen Schule zur Pforte verband sich das altpreußische Ethos des<br />
„Mehr sein als scheinen" mit der Tradition des protestantischen Humanismus Wittenberger Prägung.<br />
Dies treu bewahrte Erbe hat ihn gefeit gegenüber den Versuchungen seiner Zeit, dem Borussismus, dem<br />
Wilhelminismus und schließlich dem Hitlerismus. Auch für ihn, der das Preußentum des alten Fontane<br />
gelebt hat, gilt das Wort aus dem „Stechlin": „Aber die wirklich Vornehmen, die gehorchen; nicht einem<br />
Machthaber, sondern dem Gefühl der Pflicht."<br />
Der Fachbereich Geschichtswissenschaften der Freien Universität Berlin ist stolz darauf, daß er diesen<br />
hervorragenden Gelehrten und reinen Menschen zu den Seinen zählen darf. In Dankbarkeit und Ehrfurcht<br />
nimmt er Abschied von seinem Mitglied Johannes Schultze.<br />
Zur Denkmalpflege und Stadtplanung in Ost-Berlin<br />
Nach Angaben der Zeitung „Neues Deutschland" vom 12. Oktober 1976 soll die Gegend um den Hackeschen<br />
Markt/Sophienstraße und Große Hamburger Straße rekonstruiert werden, worunter Modernisierung und Ausbau,<br />
auf jeden Fall aber Erhaltung zu verstehen ist. Man möchte dort Altberliner Handels- und Dienstleistungseinrichtungen<br />
sowie Kunsthandwerker mit kleinen Werkstätten ansiedeln. Weiter sind Boulevard-Cafes. Bierstuben und Eisdielen,<br />
Kaufhallen, sechs Gaststätten, ein Warenhaus. Bibliotheken. Filmtheater, ein Feierabendheim sowie Sportund<br />
Grünanlagen vorgesehen. Nach Abschluß dieser Maßnahmen wird das gesamte Viertel 27 000 Einwohner<br />
haben.<br />
Derartige Arbeiten zur Erhaltung von Altbausubstanz aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert sind am<br />
Arnimplatz im Bezirk Prenzlauer Berg abgeschlossen worden. Bis 1990 soll auch das Gebiet um die Wilhelm-<br />
Pieck-Straße. die frühere Lothringer Straße, umgestaltet werden; die Architekten wurden bereits zu einem Ideenwettbewerb<br />
aufgerufen. Am Deutschen Schauspielhaus wurde das Giebelrelief inzwischen weitgehend fertiggestellt,<br />
die Figurengruppe „Apollo mit den Greifen" wird in Kürze auf ihrem alten Standort über dem Dachfirst aufgestellt.<br />
Im Friedrichsfelder Barockschloß gehen die komplizierten Innenarbeiten weiter. Die Neugestaltung der Eingangshalle<br />
zum Pergamonmuseum. Ausbauarbeiten im Bode-Museum und Vorbereitungen zum Wiederaufbau des<br />
Neuen Museums sind gleichfalls in die Wege geleitet. Auf den Listen der zu schützenden Bau- und Kunstdenkmäler<br />
der DDR stehen gegenwärtig 30000 Objekte. Nicht zuletzt aus diesem Grunde nimmt am 1. Januar 1977 ein<br />
„VEB Denkmalpflege" die Arbeit in Ost-Berlin auf, der aus der Abteilung Bau des Instituts für Denkmalpflege<br />
hervorgegangen ist.<br />
im künftigen neuen (21.| Stadtbezirk im Gebiet Biesdorf-Marzahn will der Magistrat von Ost-Berlin den Grundsatz<br />
verwirklichen, daß zwischen vorhandener historischer Bausubstanz (beispielsweise wird der Dorfanger von Marzahn<br />
erhalten und erneuen) und den Neubauten eine harmonische Einheit hergestellt wird. Gegenwärtig arbeiten die<br />
Arbeitsgruppe 9. Stadtbezirk, die Aufbauleitung für die Neubauten und die Kunsthochschule Weißensee an einer<br />
Studie, die dieses Ziel aufgreift. Der neue Stadtbezirk wird nach seiner Fertigstellung insgesamt rund 170000 Einwohner<br />
zählen. H. G. Schultze-Berndt<br />
256
Das „Königin-Luise-Jahr" 1976 im Rückblick<br />
Verschiedentlich ist in der Berliner Bevölkerung (und nicht nur im Kreise unserer Mitglieder) Verwunderung<br />
darüber geäußert worden, daß im vergangenen Jahr dem 200. Geburtstag der Königin Luise von Preußen nicht die<br />
gebührende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zuteil geworden sei. Tatsächlich haben Gedenkveranstaltungen<br />
zum 10. März mehr im „engeren Familienkreis" stattgefunden, und das „offizielle" Gedenken beschränkte sich auf<br />
wenige Worte in den Massenmedien und auf die bescheidene Präsentation von Erinnerungsstücken an Preußens<br />
einzige populäre Königin. Andererseits darf nicht übersehen werden, daß der Jubiläumsimpuls als solcher allein<br />
nicht genügt, daß vielmehr sehr zeitig beginnende Aufwendungen an Arbeit und Kosten nötig sind, um eine Ausstellung,<br />
eine Festschrift oder eine sonstige Dokumentation vorzuzeigen. Als Träger dieser Aufwendungen bliebe<br />
oft nur die öffentliche Hand übrig, die — auch das sei nicht verschwiegen — dem Andenken früherer preußischdeutscher<br />
Herrschergestalten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts abzugewinnen vermag.<br />
So blieben am Geburtstag der Königin die Aktivitäten rund um das Charlottenburger Schloß in engbegrenztem<br />
Rahmen und überschaubar. Am Vormittag des 10. März 1976 übergab der Chef des Hauses Hohenzollern. Prinz<br />
Louis Ferdinand von Preußen, im Knobelsdorff-Flügel des Schlosses ein Toilettenservice, das in Potsdam für die<br />
Königin Luise hergestellt worden war, als Dauerleihgabe an die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten<br />
in Berlin. Das vielteilige Service, das alle preußischen Prinzessinnen an ihrem Hochzeitstag benutzten, stand bisher<br />
in der Schatzkammer der Burg Hohenzollern und fand jetzt seinen Platz im vor kurzem hergestellten Schlafzimmer<br />
der Königin im Charlottenburger Schloß. Anschließend fand am Sarkophag der Königin im Mausoleum eine gottesdienstliche<br />
Feier statt, zu der eine größere Zuschauermenge im Schloßgarten den äußeren Rahmen abgab. Unter<br />
ähnlich starker Teilnahme fand sich dann am Nachmittag der Zollernkreis mit der Gemeinde der Luisenkirche in<br />
Charlottenburg zu einem Gottesdienst in dem von Schinkel erbauten, unter der Schirmherrschaft des Prinzen Louis<br />
Ferdinand stehenden Gotteshaus zusammen. Neben Pfarrer Klaus Eckelt sprach Horst Behrend Worte der Begrüßung<br />
und überreichte der Gemeinde im Auftrag des Zollernkreises einen Abguß der Totenmaske von Königin<br />
Luise. Die Ansprache hielt Prof. Dr. Wolfgang Stribrny (Flensburg); ihr Text ebenso wie die weitere genaue Berichterstattung<br />
ist in Heft 2/1976 der Zeitschrift „Erbe und Auftrag" wiedergegeben.<br />
Vom selben Tage an. bis zum 20. Juni 1976, zeigte das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-<br />
Dahlem anläßlich des 200. Geburtstages der Königin Luise in einer kleinen Vitrinen-Ausstellung besondere archivalische<br />
Kostbarkeiten aus dem Besitz des Brandenburg-Preußischen Hausarchivs. Neben Bildern von ihrem Geburtshaus,<br />
dem „Alten Palais an der Leinestraße" in Hannover und dem Darmstädter „Palais am Markt", in dem<br />
Luise im Hause ihrer Großmutter, der Prinzessin Georg, ihre Jugend verbrachte, wurden Blätter aus ihrer „Description<br />
de mon voyage en Hollande" (1791) vorgelegt, in denen sie ihren Geschwistern u. a. von niederländischen<br />
„Seelenverkopern" berichtet, Schiffen, „auf denen Matrosen wie Sklaven arbeiten mußten". Unterwegs hatte sie<br />
auch Schloß Broich in Mülheim (Ruhr) besucht, die Stätte der diesjährigen Jubiläumsausstellung (s. u.). Außer<br />
ihrem Brautbild enthielten die Vitrinen Briefe, darunter auch einen ihrer Brautbriefe mit dem fast unbeschädigten<br />
Lacksiegel der Prinzessin und eine Erwiderung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm (III.) von Preußen vom 7. November<br />
1793, den er unterzeichnete: „In allen diesen Sprachen bin ich der Ihrige: Friedrich Wilhelm. Fridericus<br />
Wilhelmus, Frederic Guilaume, Frederick William".<br />
Aus der Berliner Zeit wurden neben einem Stahlstich des Charlottenburger Schlosses von G. J. F. Poppel, in dem<br />
sich die Königin besonders gern aufhielt, eine Reproduktion des bekannten Stiches von J. F. Krethlow - König<br />
Friedrich Wilhelm III. führt den am 10. Geburtstag zum Offizier ernannten Kronprinzen der Mutter und den<br />
Schwestern zu (15. Oktober 1805) - gezeigt, während die ostpreußischen Schreckenstage der Königin nach der<br />
Niederlage Preußens gegen Napoleon durch einen Brief Luises an ihren Gemahl vom 27. Juni 1807 aus Memel<br />
lebendig wurden, in dem sie über die drei gekrönten Häupter in Tilsit berichtet und den König bittet, Hardenberg<br />
„nicht zu opfern". Ein zeitgenössisches Bild illustrierte den Empfang der Königin durch Kaiser Napoleon vor dessen<br />
Quartier in Tilsit am 6. Juli 1807. Die Tagebuchnotizen der Königin über ihre Reise nach St. Petersburg gaben<br />
Einblick in eines der wichtigsten Ereignisse ihrer letzten Lebensjahre; die Reproduktion eines Porträts im Reitkleid,<br />
das unlängst im Berlin-Museum im Original, gemalt von Ternite, zu sehen war. zeigte die Königin bereits in ihrem<br />
Todesjahr (1810). Geschlossen wurde der zeitliche Bogen durch die vom König selbst eigenhändig gegebene Beschreibung<br />
der letzten Stunden der Königin Luise am 19. Juli 1810. den er als „den unglücklichsten Tag seines<br />
Lebens" bezeichnete- Abgerundet wurde diese kleine Präsentation durch eine Luise-Gedenkplakette von Posch<br />
(1810) und eine Luise-Tasse der KPM mit dem umlaufenden Text „Sie lebt auf immer im Herzen treuer Patrioten",<br />
als Zeichen der Nachwirkung und Popularität der Königin. Ihrem wissenschaftlichen Andenken diente die ausgestellte<br />
Biographie von Paul Bailleu und die Briefausgabe von Karl Griewank. - Der „Tagesspiegel" wies auf diese kleine<br />
Ausstellung am 17. März und 18. April 1976, die „Berliner Morgenpost" in ihrer Ausgabe am 19. März 1976<br />
(m. Abb.) hin.<br />
Erst spät im Jahr, vom 9. Oktober bis zum 14. November 1976, war im Stadtarchiv Mülheim a. d. Ruhr die eigentliche<br />
Gedächtnisausstellung unter dem Titel „Königin Luise von Preußen (1776—1810) und ihre Zeit" zu sehen,<br />
über 450 Exponate von rund zwei Dutzend Leihgebern des In- und Auslands vermittelten ein breitgefächertes Bild<br />
einer sowohl politisch-militärisch wie auch geistig-künstlerisch überaus bewegten Epoche der deutschen Geschichte.<br />
Das Motiv für die Wahl des Ausstellungsortes, der zum preußischen Königshaus sonst in keiner erkennbaren Beziehung<br />
steht, ist in dem Tatbestand zu suchen, daß Luise als Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz in den Jahren 1787<br />
und 1791 in Begleitung ihrer Großmutter, der Landgräfin Marie Louise Albertine von Hessen-Darmstadt, jeweils<br />
257
für einige Wochen auf Schloß Broich b. Mülheim geweilt hatte. Die noch heute spürbare „Verwurzelung der<br />
Königin Luise im Bewußtsein der Mülheimer Bevölkerung ist ein schönes Beispiel für die Volkstümlichkeit, die sie<br />
als einzige unter den preußischen Königinnen zu erringen vermochte'' - so der Leiter des Mülheimer Stadtarchivs<br />
Dr. Kurt Ortmanns im Vorwort des Katalogs. Dieser bringt, neben dem Ausstellungsverzeichnis, einen vollständigen<br />
Abdruck des in unseren „Mitteilungen" Nr. 2/1976 erschienenen Luise-Beitrages von Eckart Henning, eine<br />
Zusammenstellung von „Äußerungen der Mit- und Nachwelt über Königin Luise von Preußen" vom selben Autor<br />
sowie eine Literaturübersicht. — Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" brachte am 8. November 1976 eine kritische<br />
Reportage über die Müiheimer Ausstellung und verhehlte dabei auch nicht ihre Enttäuschung über die mangelnde<br />
Berliner Initiative.<br />
Es mag an anderen Orten weitere Gedenkveranstaitungen gegeben haben, ohne daß ihnen überregionale Bedeutung<br />
zugemessen werden dürfte; Vergleichbares gilt für die entsprechenden Äußerungen in der Publizistik. Erwähnt<br />
werden soll noch der numismatische Beitrag: eine über die Geldinstitute vertriebene Gedenkmedaille in Sterlingsilber<br />
(23 g, 40 mm), auf der Vorderseite der Kopf der Königin im Profil und die Namensinschrift, auf der Rückseite<br />
der preußische Adler.<br />
Diese Notizen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, beschränken sich auf die mit Berlin verbundenen<br />
Aktivitäten. Für hierfür geleistete Informationen sei an dieser Stelle Herrn Archivrat Eckart Henning M. A. und<br />
Herrn Pfarrer Klaus Eckelt herzlich gedankt. Peter Letkemann<br />
Autographen berühmter Berliner Autoren<br />
Vom 5. bis 17. November 1976 fand in der Halle 2 des Messegeländes unter dem Funkturm die 25. Internationale<br />
Buchausstellung Berlin statt. Mit ihren ca. 30000 Titeln aus den Verlagsproduktionen der Bundesrepublik einschließlich<br />
West-Berlins, der DDR, des westlichen Auslandes sowie einiger Länder des Ostblocks bot diese<br />
Buchauswahl dem willigen Besucher eine Menge von Informationen und Anregungen zu einem umfangreichen<br />
Rahmenprogramm. Neben Diskussionsgesprächen und Dichterlesungen gehörten auch zwei Sonderschauen dazu:<br />
„Zeitschriften" und „Handschriften berühmter Berliner Autoren", von denen die letztere hier kurz angesprochen<br />
werden soll.<br />
Aus den umfangreichen Beständen der Handschriften-Abteilungen der Staatsbibliothek Preuß. Kulturbesitz und<br />
der Amerika-Gedenkbibliothek konnten in mehreren Vitrinen Autographen von berühmten Dichtern. Schriftstellern<br />
und Philosophen gezeigt werden, die einmal in unserer Stadt gelebt und zu ihrer kulturellen Größe beigetragen<br />
haben. So sah dann ein interessiertes Publikum z. B. die recht unausgeglichen und zerfahren wirkenden<br />
Handschriften eines Heinrich von Kleist und Peter Hille, deren innere Unruhe und Zerrissenheit auch in ihren<br />
Schriftbildern offenbar wird. Dagegen zeigen die Schriftzüge Theodor Fontanes, Willibald Alexis'. Adolf Glassbrenners<br />
und Arno Holz" ein sehr gut lesbares — oftmals unpersönliches - Schriftbild. Diese Manuskripte waren obendrein<br />
nicht selten die Vorlage für den Setzer. Neben den bereits erwähnten konnte der Besucher noch die Handschriften<br />
von den Brüdern Grimm, Adelbert von Chamisso, Gotthold Ephraim Lessing und den Philosophen<br />
Georg Wilhem Friedrich Hegel sowie Arthur Schopenhauer betrachten. Die hier gezeigten Exponate, zumeist<br />
Fotos und Faksimiles, sind nur ein verschwindend kleiner Teil des in Archiven noch Vorhandenen. Allein die<br />
Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek besitzt mit rund 300000 Autographen eine Sammlung von großem<br />
internationalen Rang. Hinzu kommen noch die Bestände der Amerika-Gedenkbibliothek, in der sich auch eine<br />
Kleist-Spezialsammlung und das Arno-Holz-Archiv befinden. Die Sonderschau wurde von unserem Mitglied<br />
Georg Holmsten zusammengestellt, dem auch an dieser Stelle für seine Arbeit Dank gesagt werden soll.<br />
Der „Bär von Berlin". Band 25<br />
. . . wurde im vergangenen Jahr erst verhältnismäßig spät (November), dafür in erheblich erweitertem Umfang ausgeliefert:<br />
es handelte sich, wie aus der „runden" Zahl ersichtlich, um einen Jubiläumsband. Mit insgesamt zehn Beiträgen<br />
aus den verschiedensten Bereichen der berlinisch-preußischen Geschichte besitzt er das zweitstärkste Volumen<br />
aller bisherigen Ausgaben. Ferner enthält er im Anhang ein fortlaufendes Inhaltsverzeichnis der Bände 1 —25<br />
und informiert somit auch über die bisher abgehandelten Themen des Jahrbuchs.<br />
Es ist zugleich aber auch ein Abschiedsband: Nach fast einem Vierteijahrhundert ununterbrochener Mitarbeit<br />
legt Walther G. Oschilewski die Redaktion des „Bär von Berlin" aus Altersgründen aus der Hand. Sein unermüdliches<br />
Wirken für die editorischen und verlegerischen Belange unseres Jahrbuchs hat dessen erfolgreichen Weg in<br />
der Vergangenheit bestimmt und für die Zukunft Maßstäbe gesetzt. Wir wollen diesen Abschied nicht hinnehmen,<br />
ohne Walther Oschilewski für seine mit großem persönlichen Einsatz geleistete Arbeit zum Wohle des Vereins<br />
und seiner Publikationen aufrichtig Dank zu sagen. Der „Bär von Berlin" wird weiter erscheinen und eine Tradition<br />
weiterführen, die noch lange Zeit mit dem Namen Walther Oschilewskis verbunden sein wird.<br />
258
Landesarchiv Berlin in neuem Domizil<br />
Am 3. Dezember 1976 übergab Schulsenator Walter Rasch (in Vertretung des Senators für Wissenschaft und Kunst)<br />
den Neubau des Landesarchivs Berlin an der Kleiststraße in Schöneberg der Öffentlichkeit. Innerhalb des von der<br />
Firma Mosch erstellten „Berlin-Centers" gegenüber der Urania besitzt das Archiv in drei Etagen des bis zur<br />
Kalckreuthstraße reichenden Flachbaus jetzt moderne und wohlausgestattete, vor allem aber ausreichende Räume<br />
für seine vielfältigen Aufgaben. In seiner Eröffnungsansprache wies Archivdirektor Dr. Gerhard Kutzsch auf die<br />
zum Teil völlig unzureichenden Unterbringungsverhältnisse früherer Jahrzehnte hin und dankte dem Senat von<br />
Berlin für die Bereitstellung der zu diesem Bauvorhaben erforderlich gewesenen Mittel, die es zugleich der Stadt<br />
Berlin ermöglichten, ihr Archiv im Herbst 1977 den Teilnehmern des in Berlin stattfindenden 51. Deutschen Archivtages<br />
in angemessener Form und Ausstattung zu präsentieren. Wir werden in Verbindung mit der Berichterstattung<br />
über den Archivtag darauf an dieser Stelle noch näher eingehen.<br />
Der Bau- und Vergabeausschuß der Stadt München hat einstimmig beschlossen, einen Weg im Stadtteil Neuperlach<br />
..Kiaulehnweg" zu nennen. Damit wird der bekannte Schriftsteller und Journalist Walter Kiaulehn geehrt, der<br />
gebürtiger Berliner war und als Journalist beim „Berliner Tageblatt" und bei der „BZ am Mittag" gearbeitet hat.<br />
Von 1950 bis zu seinem Tode im Jahre 1968 lebte er in München. Sein Buch „Berlin:Schicksal einer Weltstadt"<br />
gehört zu den markantesten Erscheinungen der Berliner Nachkriegsliteratur.<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche zum 70. Geburtstag<br />
Herrn Rudolf Beyer, Frau Eva Maria Lüdecke, Frau Luise Leichter; zum 75. Geburtstag Herrn Dr. Georg<br />
Krüger-Wittmack, Herrn Willy Strach; zum 80. Geburtstag Frau Erna Ballhausen, Herrn Georg Müller, Frau<br />
Edith Tielebier; zum 85. Geburtstag Herrn Dr. Joachim Kühn; zum 90. Geburtstag Herrn Walter Michaelis und<br />
Herrn Emil Poredda.<br />
Buchbesprechungen<br />
Burkhard Hofmeister: Berlin. Eine geographische Strukturanalyse der zwölf westlichen Bezirke. Darmstadt: Wiss.<br />
Buchgesellschaft 1975. XX, 468 S. mit 44 Fig.. 59 Tabellen und 16 Bildtafeln, brosch.. 98 DM (für Mitglieder:<br />
56 DM). (Wissenschaftl. Länderkunden Bd. 8/1.)<br />
Als erster Band einer modernen, großangelegten geographischen Länderkunde erschien 1975 das hier anzuzeigende<br />
Werk. Es ist dies auch die erste umfassende geographische „Bestandsaufnahme" der Stadtstrukturen im Westteil<br />
Berlins. Die Beschränkung auf den Westteil ergab sich aus der Schwierigkeit, vergleichbares Material für die acht<br />
Ostbezirke zu beschaffen.<br />
Das in drei Teile gegliederte Buch beginnt mit einer Analyse des „Lagewertes" der Stadt in einem Längsschnitt von<br />
den frühesten Anfängen der Doppelstadt Berlin-Cölln bis heute. Es zeigt sich hier, daß dieser Lagewert schon<br />
immer, spätestens aber durch die Einrichtung einer festen Residenz durch die hohenzollernschen Kurfürsten in der<br />
Mitte des 15. Jhs. untrennbar mit den Geschicken des brandenburgisch-preußischen Staates und seiner Herrscher<br />
verknüpft war. Dieser Einfluß ging bis in die Siedlungsentwicklung hinein. Probleme der administrativen Gliederung<br />
im 19. und 20. Jh. sowie eine Erörterung der Probleme und Möglichkeiten des durch die Kriegsfolgen von<br />
seinem natürlichen Hinterland abgeschnittenen Westteils der Stadt schließen diesen Teil ab.<br />
Der zweite Teil ist Problemen der Bevölkerung, der Wirtschaft und des Verkehrswesens der heutigen Stadt gewidmet.<br />
Im dritten Abschnitt beschreibt der Verfasser das Siedlungsgefüge West-Berlins. Obwohl hier die bereits in der<br />
Vorkriegszeit von Leyden und Behrmann benutzten Gliederungsbegriffe wie Citybereich. Wilhelminischer Ring<br />
und Außenzone noch immer grundlegend sind, so haben sich doch innerhalb der einzelnen Bereiche starke Veränderungen<br />
ergeben. Aus der ursprünglich vor allem im Bezirk Mitte und dessen südlich und westlich anschließenden<br />
Randgebieten gelegenen „City" ist im Westen das „Cityband" mit anderen Strukturen von Charlottenburg bis<br />
Kreuzberg geworden. Durch flächenhafte Zerstörungen, Wiederauf- und Neubau haben auch die beiden anderen<br />
Siedlungsteile ihre Gestalt gewandelt. - Eine Schlußbetrachtung zu Problemen und Möglichkeiten der heutigen<br />
Stadt und ihrer zukünftigen Entwicklung rundet den Band ab. Felix Escher<br />
259
Ludwig Lewin und die Lessing-Hochschule. Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der Lessing-Hochschule nach<br />
der Neugründung im Jahre 1965. Hrsg. von der Lessing-Hochschule e.V., Berlin 1975. VIII, 48 S. mit Abb., brosch.,<br />
2 DM (Schutzgebühr).<br />
Dieses aus dem seit 1891 bestehenden Verein, der „Lessinggesellschaft für Kunst und Wissenschaft", hervorgegangene<br />
Berliner Institut zur Förderung anspruchsvoller Erwachsenen Weiterbildung ist, genau genommen, zweimal<br />
gegründet worden: einmal 1900 und ein weiteres Mal 1965, nach der Rückkehr ihres 1933 in die Emigration gezwungenen<br />
Leiters, Dr. Ludwig Lewin (Berlin 1887—1967), als „Lessing-Hochschule an der Urania". Die Gesamtgeschichte<br />
dieser Hochschule ist ein Stück Berliner Bildungsgeschichte; sie ist, um Professor Dr. Waither Huder, den<br />
Archivar der Akademie der Künste, zu zitieren, „ohne den Namen Ludwig Lewin nicht denkbar".<br />
Das Kernstück der vorliegenden Festschrift bildet die Wiedergabe eines von Lewin noch in Amerika verfaßten und<br />
i960 in den „Berliner Arbeitsblättern für die Deutsche Volkshochschule" (Heft XI, S. 1 — 48) veröffentlichten<br />
Berichts „Zur Geschichte der Lessing-Hochschule 1914—1933". Er ist geordnet im wesentlichen nach den Veranstaltungen<br />
und ihren Themen während jener zwei Jahrzehnte. Dabei treten die Mannigfaltigkeit, das Niveau<br />
und, bei Vorlesungen politischer Natur, die Aktualität des Gebotenen deutlich in Erscheinung. Die Namen der<br />
Dozenten zeigen, daß hier durchweg prominente Vertreter deutschen Geisteslebens mitwirkten. Den gesellschaftlichen,<br />
zuweilen internationalen Ambitionen dieser Bildungsstätte wurde ein ihr gemäßer Rahmen gegeben. Das<br />
alles ging mit der sogenannten Gleichschaltung nach und nach in die Brüche ...<br />
Der Vorspann der Schrift ist dem Andenken an den Werdegang, das Schicksal und das Werk Lewins gewidmet. Noch<br />
kurz vor seinem Tode konnte er äußere Anerkennungen seiner Verdienste erleben, nämlich die Auszeichnung mit<br />
dem philosophischen Ehrendoktor der Freien Universität Berlin und die Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes<br />
durch den Bundespräsidenten. Es sei daran erinnert, daß im Frühjahr 1965 in der Akademie der Künste eine<br />
Ausstellung „Lessing-Hochschule 1899—1933" stattfand, deren (von Lewin nach Amerika gerettete) Exponate<br />
der Berliner Bevölkerung und zahlreichen auswärtigen Besuchern einen starken und bleibenden Eindruck von der<br />
Existenz dieser ausgezeichneten kulturellen Einrichtung zu vermitteln vermochten. Ernst G. Lowenthal<br />
Adolf Glaßbrenner: ne scheene .feiend is det hier! Humoresken, Satiren und komische Szenen. Hrsg. von Kurt<br />
und Gerda Böttcher. Berlin: Arani Verlag 1977. 342 S., m. 120 Abb. u. 16 Farhtafeln, Leinen, 36 DM.<br />
Nur wenige Wochen nach dem 100. Todestag Glaßbrenners legt der Arani Verlag in einer Co-Produktion mit dem<br />
Eulenspiegel Verlag (Ost-Berlin) eine Edition vor, die einen Querschnitt der schriftstellerischen und auch verlegerischen<br />
Arbeit dieses Mannes aufzeigen und damit den „Schöpfer des heiteren und spottenden Berliner Schrifttums<br />
des 19. Jahrhunderts" vor dem totalen Vergessenwerden bewahren soll. Wie schon frühere Ausgaben dieser<br />
Art findet auch diese ihren überwiegenden Schwerpunkt in der Wiedergabe der humoristischen Prosastücke,<br />
der Dialogszenen und Satiren mit lokalpolitischem Hintergrund. Das wird recht ansprechend geboten, wenngleich<br />
die damalige Situation schwer in unsere heutige Zeit zu transponieren ist. Dadurch bleiben auch einige Dialoge<br />
und Zeichnungen unklar. Festzustellen ist an dieser Stelle, daß Glaßbrenner „sein" preußisches Berlin mit den<br />
Nöten und Sorgen des „kleinen Mannes" sehr gut gekannt haben muß.<br />
Die inhaltliche Gliederung des Bandes umfaßt 7 Hauptabteilungen, die nur von der Thematik der einzelnen Beiträge<br />
bestimmt werden. Eine zeitliche Ordnung ist nicht erkennbar. Mit den Kapiteln „Der Ärger mit der Obrigkeit"<br />
und „Revolution — Rrrreaktion" seien hier zwei aufgeführt.<br />
Glaßbrenner konnte das große Plus für sich verbuchen, stets die besten Illustratoren des damaligen Berlins für seine<br />
Arbeiten gewonnen zu haben. So stammt auch der überwiegende Teil der Zeichnungen dieser Ausgabe von dem<br />
kongenialen Theodor Hosemann. Aber auch Franz Burchard Dörbeck. Gustav Heil, Julius Peters, Karl Reinhardt,<br />
Wilhelm Scholz und Adolf Schroedter sind jeder mit mehreren Abbildungen vertreten. Hier soll auch gleich das<br />
größte Manko dieser Veröffentlichung aufgezeigt werden: das Fehlen einer Quellenangabe unter den einzelnen<br />
Texten und Illustrationen. Damit fällt das Niveau dieses Buches auf das einer anspruchslosen Volkstümlichkeit<br />
und ist für eventuelle weitere Forschungen nur in sehr geringem Umfang zu gebrauchen.<br />
Der Anhang umfaßt ein kurzes Nachwort des DDR-Literaturhistorikers Kurt Böttcher, der stichpunktartig einen<br />
Abriß der Vita und der Arbeiten Glaßbrenners gibt. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß Glaßbrenner ein<br />
hauptsächlich an der lokalen Tagespolitik interessierter Volksschriftsteller war. Ohne den Weitblick für das Überregionale<br />
in der Politik und die nach 1849 einsetzenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandlungen, die er<br />
nicht mehr verstand, war er nie als Politiker einzustufen. Eine Liste mit Worterklärungen ist gleichfalls im Anhang<br />
enthalten. Die typografische Gestaltung ist auf den Inhalt abgestimmt. Die technische Ausführung ist als befriedigend<br />
zu akzeptieren. Claus P. Mader<br />
Hans-Werner Klünner: Potsdam - so wie es war. Düsseldorf: Droste 1975. 103 S. mit 160 Abb., Leinen, 32 DM.<br />
Wohl kaum eine deutsche Stadt hat in den letzten 50 Jahren nicht nur im äußeren Stadtbild, sondern auch in der<br />
Struktur der Bewohner stärkere Wandlungen erfahren als Potsdam, und so ist es eine besonders schwierige Aufgabe,<br />
ein Bild dieser Stadt, die für die Berliner immer einen besonderen Stellenwert hatte, in der Vorkriegszeit zu zeichnen,<br />
ohne in ein so beliebtes „nostalgisches" Schwärmen zu geraten.<br />
H. W. Klünner hat diese Aufgabe gelöst. In der Form eines Stadtrundganges führt er an die Gebäude und deren<br />
Bewohner heran; dieser Teil ist zugleich eine kleine zuverlässige Geschichte zur Stadt Potsdam. Die auf Seite 31<br />
wiederholte Geschichte, daß die Potsdamer Giebelbauten, ein beliebter Schmuck des 18. Jhs., nur auf die<br />
Bedürfnisse der Garnison zurückzuführen seien, ist offenbar unausrottbar. Nicht nur die bekannten Sehenswürdig-<br />
260
keiten der Stadt, die der frühere Besucher Potsdams vom Bahnhof kommend auf dem Wege zu den Parkanlagen von<br />
Sanssouci ebenfalls aufsuchte, werden dargestellt, vielmehr wird das gesamte Stadtgebiet von der friderizianischen<br />
Textilarbeitersiedlung Nowawes und den wissenschaftlichen Instituten im Osten bis zur evangelischen Hofbauer-<br />
Stiftung mit ihren ausgedehnten Anlagen im Südwesten und den peripheren Siedlungen der Zwischenkriegszeit<br />
gleichermaßen gründlich vor Augen geführt. Das reiche Bildmaterial zeigt nicht nur die Bauwerke dieser Stadt,<br />
sondern auch ihre Bewohner in typischen Umgebungen, ob sie nun Hohenzollernabkömmlinge oder die Familie<br />
eines Ratsmaurermeisters, Gardesoldaten der Zeit vor 1914 oder Mitglieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold<br />
sind. Auch kulturelle Wirksamkeiten dieser durch zahlreiche wissenschaftliche Institutionen geprägten Stadt -<br />
etwa das Theaterwesen der städtischen wie der privaten Liebhabertheater der städtischen Oberschicht - zeigt<br />
der Band auf und gibt so eine Empfindung dafür, daß der oft beschworene „Geist von Potsdam" mehr mit<br />
Kultur als mit Militarismus verbunden gesehen werden muß.<br />
Besonders anzumerken ist. daß der Autor es nicht versäumt hat. bei zahlreichen — leider nicht allen — Objekten den<br />
heutigen Zustand zu erwähnen. So ragt der Band durch die fundierte Darstellung und die vorzügliche Bebüderung<br />
auch aus der Reihe, in der er erschienen ist. heraus. Felix Escher<br />
E. T. A. Hoffmann. Hrsg. von Friedrich Schnapp. München; Heimeran Verlag 1974. 436 S., Leinen, 35 DM.<br />
(Dichter über ihre Dichtungen. Verantwortl. Hrsg. Rudolf Hirsch und Werner Vordfriede. Bd. 13.)<br />
Die hier vorliegende Ausgabe kann für sich beanspruchen, für die E. T. A. Hoffmann-Forschung als sehr gutes<br />
Handbuch, wenn nicht sogar als ein Standardwerk eingestuft zu werden. Sicher sind viele Äußerungen des Dichters<br />
über seine literarischen Werke, über Dichter und Dichtungen, über Schriften zur Musik sowie über seine nicht zur<br />
Ausführung gelangten literarischen Werke in dickleibigen Editionen schon einmal abgedruckt. Was diesen Band<br />
dennoch aus der großen Anzahl ähnlicher Publikationen positiv heraushebt, ist die im Hauptteil gebotene sachliche<br />
und gleichzeitig chronologische Ordnung. Als Quellen dienten bereits veröffentlichte, zu einem großen Teil aber<br />
auch unveröffentlichte Briefe, Tagebuchnotizen sowie Gespräche und Erinnerungen des Dichters, soweit diese<br />
uns von seinen Zeitgenossen überliefert wurden.<br />
Ein Drittel des Gesamtumfanges ist dem wissenschaftlichen Anhang vorbehalten, für den Friedrich Schnapp -<br />
sicherlich der bedeutendste Kenner dieser Materie — verantwortlich zeichnet. Eine ausführliche Zeittafel, ein<br />
Quellen- und gleichzeitig Abkürzungsverzeichnis, ein Register der literarischen W ; erke und Einzelstücke sowie<br />
ein Namensregister für den Hauptteil komplettieren dieses ausgezeichnete Buch. Claus P. Mader<br />
Kurt Mühlenhaupt: Haus Blücherstraße 13. Aufgeschrieben und illustriert mit 6 Original-Holzschnitten und<br />
4 Farbreproduktionen nach Originalölbildern vom Meister sowie vielen Alugrafien und Nachbildungen von<br />
Holzschnitten, Radierungen und Lithografien. Berlin: Selbstverlag 1976. 96 S., Linson.<br />
Das vorliegende Buch, mit dem sich Kurt Mühlenhaupt von seinen Mitbewohnern in der Blücherstraße 13 verabschiedete<br />
(er zog im März 1976 nach Kladow), enthält neue Texte von Kurt Mühlenhaupt sowie Nachdrucke bereits<br />
vergriffener Texte von ihm und außerdem eine Fülle von Abbildungen seiner Werke. Neu sind 6 Originalholzschnitte<br />
sowie die Abbildungen (Zeichnungen) auf S. 30, S. 65. S. 69 und S. 76. Neu sind auch die im Berliner<br />
Dialekt gehaltenen Texte „Der Granatapfel" (S. 54) und „Tante Grete" (S. 64f.). Im wesentlichen enthält das<br />
Buch die vollständigen Texte der seit langem vergriffenen Graphikmappe „Blücherstraße 13" und der ebenfalls<br />
vergriffenen Erzählungen „Eine Bartgeschichte aus Berlin", beide von Kurt Mühlenhaupt im Berliner Dialekt<br />
geschrieben. An Abbildungen enthält das Buch vier Farbreproduktionen von Ölbildern sowie die Nachbildungen<br />
vieler Alugraphien, Holzschnitte, Radierungen und Lithographien von Kurt Mühlenhaupt, z. T. durch hinzugefügte<br />
Zeichnungen verändert. Diese Abbildungen wurden seinen oben genannten Werken, der losen Folge seiner<br />
Berliner Blätter und seiner Graphikmappe „Rund um den Chamissoplatz" entnommen, aus der sowie aus seinem<br />
Buch „Ringelblumen" auch einzelne Textstellen stammen (ebenfalls im Berliner Dialekt verfaßt).<br />
Allen diesen Texten liegen persönliche Erlebnisse von Kurt Mühienhaupt zugrunde. Wir nehmen Anteil an dem<br />
Leben in dem großen Kreuzberger Mietshaus Blücherstraße 13, das nicht ohne Komik ist. Den Hausbewohnern<br />
bleibt nichts verborgen, im Guten wie im Bösen, schon gar nicht in erotischer Beziehung. „Eine Bartgeschichte aus<br />
Berlin" zeigt die Schwierigkeiten beim Grenzübergang in der geteilten Stadt von einer ungewohnt heiteren Seite,<br />
nicht ohne nachdenklichen Schluß.<br />
Mit der vorliegenden Veröffentlichung zeigt der Schriftsteller, Maler und Graphiker Kurt Mühlenhaupt erneut<br />
seine innige Verbundenheit mit den Menschen seiner Heimatstadt, die er meisterlich zu porträtieren versteht.<br />
Bild und Wort — gerade auch das berlinerische Wort - gehören zusammen und zeigen liebevoll allzu Menschliches<br />
im Gewände des „Milljöhs". Das Layout wurde vom Künstler mitgestaltet, so daß das Buch eine bibliophile Kostbarkeit<br />
ist. (Vgl. auch die Besprechungen zu „Inmitten von Berlin". Zeichnungen von Kurt Mühlenhaupt zu<br />
Gedichten und Texten von Herta Zerna; „Ringelblumen" von Curt Mühlenhaupt; in: Mitt. d. Vereins f. d. Gesch.<br />
Berlins, H. 4/1975, S. 107f.) Erika Schachinger<br />
— Polyglott-Reiseführer: Deutsche Demokratische Republik. Bearb.: Hans Lajta. L Aufl. München: Polyglott-<br />
Verlag 1976. 64 S. mit 15 111. und 17 Karten und Plänen, brosch.. 4.80 DM.<br />
Die Polyglott-Reiseführer haben sich in ihrer knappen Form und in ihrer handlichen Art einen guten Namen gemacht.<br />
Hier wird nun die Deutsche Demokratische Republik (DDR) „als Reiseland" (sie) vorgestellt. An dieser Stelle<br />
interessiert „Berlin (etwa 1,09 Mill. Einw.), die Hauptstadt der DDR". Ihre Sehenswürdigkeiten werden mit<br />
261
historischen Angaben beschrieben, wenn auch selektiv. Daß das Berliner Schloß im Zweiten Weltkrieg zerstört<br />
wurde und nun an seiner Stelle der „Palast der Republik" steht, wird mitgeteilt, nicht aber die Tatsache der sinnlosen<br />
Sprengung der durchaus wieder aufzubauenden Gebäude 1950/1951. Man erfährt, daß an der gleichen<br />
Platzanlage das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 1967 fertiggestellt wurde, nicht aber, daß diesem<br />
gesichtslosen Neubau die Schinkelsche Bauakademie weichen mußte. In südlicher Richtung sind im ehemaligen<br />
„Alt-Berlin" die „meisten Häuser im Krieg leider zerstört worden" (und der Rest fiel der Spitzhacke zum Opfer).<br />
Das Köpenicker Rathaus wurde durch den Schuhmacher Wilhelm Voigt weltbekannt, „der hier als Hauptmann<br />
von Köpenick den Militarismus mit dessen Forderung nach blindem Gehorsam lächerlich machte" (und auch<br />
heute noch einiges zu tun hätte). Wenn man schließlich noch liest, daß die offizielle Sprache Deutsch ist. blättert<br />
man noch einmal zum Impressum, wo dem Reisebüro der DDR und dem VEB Brockhaus Verlag Leipzig für Unterstützung<br />
gedankt wird. H. G. Schultze-Berndt<br />
Berlin-Fibel. Berichte zur Lage der Stadt, hrsg. von Dieter Baumeister. Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz 1975.<br />
384 S. mit 17 Tafel-Abb.. brosch.. 18,80 DM. (Politische Dokumente. Bd. 6.)<br />
An „Berlin-Fibeln" jeglicher Art herrscht momentan auf dem Büchermarkt kein Mangel. In ihrem Bemühen um<br />
Unterhaltung, Belehrung oder schlichte Information sind sie wesentliche Kommunikationshilfen für das Verständnis<br />
der besonderen Situation dieser Stadt. Ihr Aktualitätsgrad ist allerdings schwankend und reicht oft nur<br />
bis zum Erscheinen der nächsten einschlägigen Publikation. So würde auch die vorliegende Berlin-Fibel nicht sonderlich<br />
aus dem Rahmen fallen, wenn sie nicht eine von kompetenten Autoren verfaßte Bestandsaufnahme der Entwicklung<br />
Berlins seit 1945 böte, deren solides Fundament nicht nur dem Tagesbedarf genügt, deren Themenstellung<br />
die entscheidenden Punkte der Berlin-Problematik - im positiven wie im negativen Sinne - markiert und deren<br />
vielfältige Aussagen zum Nachdenken zwingen. Hier ist auf knappem Raum, aber übersichtlich und ohne viel<br />
schmückendes Beiwerk eine kleine Berliner Nachkriegsgeschichte entstanden, die die Leistungen auf politischem,<br />
wirtschaftlichem und geistig-künstlerischem Gebiet darlegt. Das geschieht nicht ausschließlich in kompilatorischer<br />
Manier, in einer Anhäufung von Fakten, sondern durchaus kritisch und auch mit Ausleuchtung der Schattenseiten,<br />
des Fehlerhaften, Untypischen. Gewagten. Und von dieser realistischen Einschätzung des Vergangenen und Gegenwärtigen<br />
ist es nur ein kleiner Schritt zu den Perspektiven der Zukunft, die für Berlin ungleich mehr Gewicht haben<br />
als für jedes andere Gemeinwesen. Dabei werden in diesem Buch keine Patentrezepte oder Analysen aus dem<br />
Bereich der Zukunftsforschung gegeben, vielmehr aus der Gegenwartsposition „Anregungen vom Elementaren<br />
her" geboten zu der Frage, „was eigentlich mit diesem Berlin werden soll" (S. 9). Das geht nicht ohne Spekulationen<br />
ab, denen zusätzlich oftmals ein irrationaler Zug anhaftet, sobald man des grellen Ost-West-Kontrastes im Antlitz<br />
dieser Stadt gewärtig wird. Das hindert andererseits jedoch nicht, konkrete Aufgaben zu formulieren und nach<br />
neuen Impulsen zu suchen, denn — so klingt es gelegentlich an - die Konfrontation zum östlichen Regime ist das<br />
eine Problem, die Bewältigung der eigenen Zukunft West-Berlins das andere. Für die letztere ist die Standortbestimmung<br />
(und -besinnung) unerläßlich, die in dem vorliegenden Werk in umfassender und zudem leicht lesbarer<br />
Form vorgenommen wird.<br />
Seit es ein „Berlin-Problem" in der Geschichte gibt, ist dieses mit der Auseinandersetzung um den politischen<br />
Status der Stadt untrennbar verknüpft. Die Darlegungen zu diesem Thema bilden auch die Klammer der Berlin-<br />
Fibel: Gottfried Zieger zeichnet einleitend den Weg von „Berlin 1945 bis zum Viermächte-Abkommen 1971". Die<br />
Differenzen, vor allem über das Recht der Zufahrtswege, begannen bereits im Sommer 1945 zwischen den alliierten<br />
Mächten und ziehen sich fortan wie ein roter Faden durch die Berlin-Politik. Von Anfang an fehlten klare schriftliche<br />
Vereinbarungen; sie wurden bei gebotenen Anlässen, z. B. bei Aufhebung der Blockade 1949. nicht nachgeholt<br />
(was Zieger nicht erwähnt). So bestand ein latentes Spannungsverhältnis zwischen der Verfassungsnorm und<br />
der Verwaltungswirklichkeit in Berlin, das durch den östlichen Machtanspruch noch weiter strapaziert wurde.<br />
Das Viermächte-Abkommen von 1971 führte endlich zu praktischen Regelungen auf der Basis des Status quo. d. h.<br />
mit der Fixierung unterschiedlicher Rechtsauffassungen zu ein und demselben Thema. Jens Hacker beschreibt<br />
abschließend die Entwicklungsstufen des „Viermächte-Status von Berlin", seine Handhabung und seine Bedeutung<br />
für alle Seiten, nicht zuletzt im Hinblick auf die jüngsten Berlin-Abkommen, die zumindest Rudimente der alten<br />
Viermächte-Verantwortung für die ganze Stadt erkennen ließen. Daß die divergierenden Auffassungen auch<br />
erheblich abweichende Interpretationen des Vertragswerks im Gefolge hatten, ist eine der weniger erfreulichen<br />
Aussichten für Berlins Zukunft und wird vom Autorauch nicht beschönigt.<br />
Neben der politischen Existenzfrage besitzt das Wirtschaftsgefüge in der Stadt die nächstwichtige Bedeutung.<br />
Joachim Sawrocki gibt einen differenzierten Überblick über die einzelnen Phasen der Berliner Wirtschaft nach<br />
dem Kriege, die mit materiellen und politischen Schwierigkeiten ganz anderen Ausmaßes zu kämpfen hatte als im<br />
Bundesgebiet. Durch Investitions- und Absatzförderung machte das „Wachstum auf begrenztem Raum" bemerkenswerte<br />
Fortschritte und konnte mit dem Bundesdurchschnitt weitgehend mithalten. Die enge wirtschaftliche Verflechtung<br />
West-Berlins mit der Bundesrepublik ist mehr als nur eine optische Geste: Einmal ist Berlin nach wie vor<br />
die größte deutsche Industriestadt mit wichtigen Produktionszweigen, zum anderen bleibt dadurch die Lebensfähigkeit<br />
entscheidend gewährleistet. Kritische Ausblicke auf die Haushalts-, Verkehrs- und Forschungssituation<br />
sowie auf die Planungskonzepte geben dem Artikel Nawrockis ein besonderes Gewicht.<br />
Unter dem Titel „Wissenschaft in Berlin" beschreibt Hermann Hildebrandt nicht nur die zahlreichen Institutionen.<br />
die sich in Berlin mit Forschung. Lehre und Studium befassen, sondern auch das Gefüge, in dem sie zueinander<br />
stehen. Die tiefgreifenden Veränderungen auf hochschuipoiitischem Sektor im letzten Jahrzehnt haben auch Rück-<br />
262
Wirkungen auf das Verhältnis der Universitäten zu Staat und Gesellschaft gehabt, wobei Berlin in vorderster Linie<br />
stand. Motive und Ergebnisse der Reformen, die Struktur der Forschungseinrichtungen und ihr weiterer Ausbau sind<br />
die zentralen Themen des Berichts.<br />
Zwei sich ergänzende Beiträge sind den bildenden Künsten und den Museen in Berlin gewidmet. Helmut BÖrsch-<br />
Supan, stellv. Direktor in der Verwaltung der Staatl. Schlösser und Gärten, gibt „Zur Lage der bildenden Künste<br />
in Berlin" zunächst einen künsthistorischen Abriß ihrer Entwicklung, um dann die Frage aufzuwerfen: Berlin -<br />
eine Kunststadt oder eine Künstlerstadt? Er führt den Leser zu der bedauerlichen Feststellung, daß der größere<br />
Kreis der Intelligenz von der modernen Kunst unserer Tage leider nur geringe Notiz nimmt. Die führende Rolle<br />
früherer Jahrzehnte auf diesem Gebiet konnte Berlin nach 1945 nicht mehr zurückerhalten. Politik und kommerzielle<br />
Denkart beeinflussen heute vielleicht mehr denn je die künstlerischen Strömungen auch in unserer Stadt.<br />
Gedanken über die Kunstschaffenden und die Kunstvereine sowie über Ausstellungsgestaltung und Publikum<br />
machen diesen Artikel lesenswert und bieten eine große Fülle an Information. - Daß trotz Kriegseinwirkungen<br />
und Teilung vieler Sammlungen „Die Landschaft der Berliner Museen" eine der reichhaltigsten in Deutschland<br />
geblieben ist, beweist Andreas Grote. Der Leiter des Außenamtes der Staatlichen Museen Preuß. Kulturbesitz<br />
durchwandert die vielen Abteilungen des West-Berliner Museumskomplexes in sachkundiger Manier. Leider fehlen<br />
in dieser sehr guten Übersicht die ca. 120 meist privaten Sammlungen, die doch in einem nicht geringen Umfang den<br />
Spiegel unseres bildenden Kunstschaffens facettieren.<br />
Die „Berliner Literatur seit 1945" hat trotz vieler Mühen und guter Ansätze nie wieder jenen Glanz erreicht, der<br />
dem literarischen Berlin der zwanziger Jahre zeitweilig einen exorbitanten Rang innerhalb der Weltliteratur einräumte<br />
(was vor allem für den literarischen Expressionismus galt). Gustav Sichelschmidt kommt zu diesem Ergebnis<br />
und nennt auch gleich die hinreichend bekannten Gründe: die nach 1945 einsetzendeDezentralisierung der literarischen<br />
Szene sowie des belletristischen Verlagswesens. Hinzu kam die Emigration, das weitere Verbleiben in der<br />
neuen Heimat und der Tod vieler Literaten, die einst vom geistigen Fluidum unserer Stadt angezogen und zu großen<br />
Leistungen inspiriert wurden. Was Berlin nach dem Krieg blieb, war der Versuch, sich im Reigen der anderen<br />
deutschen Städte und Dichterstätten einen Platz zu sichern. Er gelang trotz (oder gerade wegen) der politischen<br />
und wirtschaftlichen Situation recht gut, ja. Berlin konnte sogar als Mittler und geistiger Umschlagplatz zwischen<br />
Ost und West Erfolge verbuchen. Sichelschmidt, exzellenter Kenner dieser Materie, gibt hier eine sehr gute, zu<br />
weiteren Studien anregende Übersicht.<br />
Friedrich Luft geht in seinem Beitrag „Die Theaterstadt Berlin" auf den Wiederaufbau der hiesigen Theaterszene<br />
ein, wobei er sein Hauptaugenmerk auf die ersten Wochen und Monate nach dem Kriegsende richtet. Er tut dies<br />
in der ihm eigenen, oft auch persönlich angehauchten Weise. Nach der Gründung einer „Kammer der Kunstschaffenden"<br />
unter Paul Wegener formierten sich überall in der Stadt Kleinkunstbühnen, um in Gemeindesälen, Schulaulen<br />
oder anderen leerstehenden Räumen, mit oder ohne Kulissen, oftmals gegen Entgelt von Naturalien, wieder<br />
ITieater zu spielen. Curt Goetz, Tucholsky, Goethe, aber auch Shakespeare und Cocteau standen auf dem Programm.<br />
Junge Schauspieler und aus der Emigration heimkehrende Mimen fanden in einer Spielwut zusammen, die bis zum<br />
Sommer 1946 eine fast unvorstellbar vieigesichtige Theaterlandschaft schufen. Die Anzahl der kleinen Bühnen ist<br />
bis heute nicht belegbar und viele von ihnen lebten nur kurze Zeit. Doch die damalige Begeisterung am Theaterspiel<br />
war zugleich auch jene neue Wurzel unserer Stellung im heutigen deutschen und internationalen Theaterleben.<br />
Vergleichbare Maßstäbe liefern auch Günther Kühne und Hans-Jörg v. Jena in ihren Beiträgen über die Architektur<br />
und das Musikleben in Berlin, die hier nur erwähnt werden können. Ein vielgestaltiger Anhang mit Dokumenten,<br />
Tabellen und Registern vervollständigt dieses vorzügliche Buch. Peter Letkemann/Claus P. Mader<br />
Im IV. Vierteljahr 1976<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Dr. Gerhard Baader, Akad. Oberrat, FU Berlin<br />
1000 Berlin 42, Wenckebachstraße 21<br />
Tel. 7 52 59 47 (Vorsitzender)<br />
Dr. Ernst Henri Balan, Wissensch. Assistent<br />
1000 Berlin 31, Wilhelmsaue 133<br />
Tel. 87 88 50 (Vorsitzender)<br />
Helmut Dudel, Arzt<br />
1000 Berlin 22, Alt-Gatow 57<br />
Tel. 3701491.3623804 (Frau Lemme)<br />
Gerhard Meyer, Ingenieur<br />
1000 Berlin 47, Schneeballenweg 23<br />
Tel. 661 2728 (Schriftführer)<br />
Hans-Jochen Pasenow M. A., Wissensch. Mitarbeiter<br />
1000 Berlin 33, Rüdesheimer Straße 13<br />
Tel. 821 41 03 (Schriftführer)<br />
Holger Schulz, Kaufmann<br />
1000 Berlin 62. Kufsteiner Straße 10<br />
Tel. 854 53 53 (Brauer)<br />
Werner Sperling, Pastor<br />
1000 Berlin 28, Friedrichsthaler Weg 31<br />
Tel. 404 2560 (Brauer)<br />
Prof. Dr. Dr. Rolf Winau. Hochschullehrer<br />
1000 Berlin 45, Augustastraße 37<br />
Tel. 7 98 34 66 (Prof. Dr. Hoffmann-Axthelm)<br />
Charlotte Wodrich<br />
1000 Berlin 19. Friedbergstraße 14<br />
Tel. 3073545 (Schriftführer)<br />
263
Veranstaltungen im I. Quartal 1977<br />
1. Sonnabend, 15. Januar 1977, 10 Uhr: Wanderung durch den Spandauer Forst. Führung<br />
durch Revierförster, Forstoberinspektor Klaus Hamer. Treffpunkt: Eingang des Ev.<br />
Johannesstifts. Schönwalder Allee. Fahrverbindung: Autobus 54.<br />
2. Mittwoch. 19. Januar 1977, 16 Uhr: Besichtigung der Ausstellung „Weddinger Persönlichkeiten"<br />
im Heimatarchiv Wedding. Ruheplatzstraße 4. Führung durch Herrn Wolfgang<br />
Eckert. Fahrverbindung: U-Bahnhof Leopoldplatz; Autobusse 12, 64, 79.<br />
3. Sonnabend, 12. Februar 1977, 10 Uhr: Besichtigung des Museums für Deutsche Volkskunde,<br />
Berlin-Dahlem. Im Winkel (hinter dem Gebäude des Geh. Staatsarchivs). Fahrverbindung:<br />
U-Bahnhof Dahlem-Dorf; Autobusse 1, 10, 68.<br />
4. Dienstag, 22. Februar 1977, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Prof. Dr. Martin<br />
Sperlich: ,.Schinkel*als Gärtner" in der Kapelle des Schlosses Charlottenburg.<br />
5. Sonnabend, 12. März 1977, 11 Uhr: Besichtigung der Ausstellung „Porzellane des<br />
Jugendstils und Malerei und Graphik von Hans Baluschek" in der Villa Bröhan, Berlin-<br />
Dahlem, Max-Eyth-Straße 27. Führung durch Herrn Prof. Karl H. Bröhan. Fahrverbindungen:<br />
Autobus 60 Clayallee, Autobus 10 Pacelliallee. Eintritt: 2.50 DM.<br />
6. Dienstag. 22. März 1977, 19.30 Uhr: Vortrag von Herrn Dr. Friedrich Weichert: „Die<br />
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche im Spannungsfeld ihrer Entstehungszeit". Filmsaal<br />
des Rathauses Charlottenburg.<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek ist<br />
zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen geselliges<br />
Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 28. Januar, 25. Februar und 25. März 1977. zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
im Rathaus Charlottenburg.<br />
Wir weisen darauf hin, daß der Mindest-Jahresbeitrag 36 DM beträgt und bitten um umgehende<br />
Überweisung noch ausstehender Beiträge für das Jahr 1976. Auf Wunsch kann eine Spendenbescheinigung<br />
ausgestellt werden.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer. 1000 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt. 1000 Berlin 65, Seestraße<br />
13. Ruf 45 30 11. Schatzmeister: Ruth Koepke. 1000 Berlin 61. Mehringdamm 89. Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin-Wesr'433 80-102, 1000 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank, 1000 Berlin 19. Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1000 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich.. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins.<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemami, 1000 Berlin 33. Archivstraße 12-14; Claus P.<br />
Mader; Felix Escher. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt. Bezugspreis für<br />
Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn. 1000 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
264
M. A 20 377 F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
73. Jahrgang Heft 2 April 1977<br />
fj»*%<br />
m<br />
Sfrlin-fritdenou<br />
* ' __«^BBB1<br />
• [ IT T!<br />
Rathaus<br />
FTBv*» -"2 ' •fiE^^Hp 4 "<br />
IL<br />
• • ' • - ' ' ^ ^ " T X ' " " ^<br />
H Tl 1] 21<br />
V. ti<br />
: •" : / ' : i<br />
Aufn. oben vor 1914. unten 1960 (Archiv: Neufert/Brast)<br />
265
Zur Entwicklung Friedenaus<br />
Von Günter Wollschlaeger<br />
„Beamten. Pensionierten, Lehrern. Künstlern, Literaten und all denen, deren Einkommen<br />
nicht so rasch und in gleichem Maße als die Wohnungsmiete steigt, kann ich das Unternehmen<br />
auf das angelegentlichste empfehlen." Dieser Schlußsatz gehört zu einem Artikel in<br />
der Vossischen Zeitung vom Mai 1871. mit dem der Volkswirtschaftler und Schriftsteller<br />
David Born um Beitritt zu einer Baugesellschaft warb, die die Gemeinde Friedenau begründen<br />
sollte. An ihn erinnert die Bornstraße am Forum Steglitz, die bis 1889 Steglitzer<br />
Straße geheißen hat.<br />
Der ständige Zustrom aus den Provinzen hatte eine sich in gleichem Maße ausbreitende<br />
Wohnungsnot ausgelöst, die besonders den Mittelstand traf. Der am 9. Juli 1871 gegründete<br />
„Landerwerb- und Bauverein auf Aktien" wollte daher seinen Mitgliedern geeignete<br />
billige Wohnstätten schaffen, indem er ihnen durch Ankauf von Land, Anlage von Straßen<br />
und Bau von Landhäusern schuldenfreie eigene Anwesen zu den damals üblichen Berliner<br />
Durchschnittsmietpreisen vermittelte. Aber streifen wir kurz die Vorgeschichte: Sechs<br />
Jahre früher. 1865. kaufte Johann Anton Wilhelm Carstenn die Güter Giesensdorf. Lichterfelde<br />
und Wilmersdorf, um auf diesen Landhauskolonien anzulegen. Er hatte bereits mit<br />
der Aufteilung der Güter Wandsbek und Marienthal bei Hamburg entsprechende Erfahrungen<br />
gesammelt und konnte nun mit seinen erheblichen, aus verschiedenen Bergwerksund<br />
Industrieunternehmungen und den eben erwähnten Terraingeschäften stammenden<br />
Mitteln an die Erschließung der bei Berlin erworbenen Ländereien gehen. Mit der Kaiserstraße,<br />
der späteren Kaiser- und jetzigen Bundesallee, verband er in den Jahren 1872 bis<br />
1874 seine Güter. Die Carstennsche Kolonisationsmethode am Rande wogender Getreidefelder,<br />
die sich vom Friedrich-Wilhelm-Platz nach Schmargendorf zogen, kennzeichnet am<br />
besten der zeitgenössische Berliner Mutterwitz. Auf die Frage eines Berliners, warum die<br />
Kirche auf diesem Platz „Zum Guten Hirten" heiße, antwortet der andere: „Weil die<br />
Gegend so belämmert ist."<br />
Der Gutsherr steckte gleichzeitig weitere Straßen nach einem einheitlichen Bebauungsplan<br />
ab, der - da sich das Friedenauer Straßennetz fast unverändert erhalten hat — zugleich das<br />
damalige Siedlungsideal dokumentiert: Eine durchgehende „Prachtstraße" besitzt zwei<br />
längsovale Platzerweiterungen in dem schon mehrfach erwähnten Friedrich-Wilhelm-Platz<br />
und dem ehemaligen Kaiserplatz, dem jetzigen Bundesplatz. Beide hatten ihren Charakter<br />
bis in die Mitte der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts bewahrt, ehe dieser bei der Anpassung<br />
an die modernen Verkehrserfordernisse verlorenging.<br />
Vom Friedrich-Wilhelm-Platz führten unterschiedlich geschwungene und gerade Straßen<br />
zu einem U-förmig um die damalige Kaiserstraße gelegten und diese kreuzenden Promenadenzug,<br />
der jetzigen Handjery- und Stubenrauchstraße, mit Rundplätzen. Hierbei handelt<br />
es sich um den damaligen Schmargendorfer -. den späteren Schillerplatz an der heutigen<br />
Wiesbadener Straße, und um den ehemaligen Wilmersdorfer Platz an der Schmargendorfer<br />
Straße. Diese Anlage einer Landhauskolonie entsprach englischen Vorbildern, die<br />
Carstenn am Beispiel Londons, zu seiner Zeit einer Stadt mit bereits zweieinhalb Millionen<br />
Einwohnern und einer Ausdehnung von fast sechs Quadratmeilen, sozusagen „vor Ort"<br />
studiert hatte, um die Entwicklung einer in ihren neuen Teilen rationell angelegten Weltstadt<br />
kennenzulernen und auf dem Kontinent zu verwerten. Doch hier bei Berlin widmete<br />
266
Schillerplatz in Berlin-Friedenau (um 1910) Archiv: Neufert<br />
er sich überwiegend der Villen! olonie Lichterfelde. Er und David Born, der eigentliche<br />
Gründer Friedenaus, pro! lamierten übrigens das Schlagwort: „Die Vororte müßten die<br />
Grüne Lunge der Großstadt werden", auf dem später der Architekt Hermann Muthesius,<br />
ausgehend von der englischen „Domestic Revival"-Bewegung. bei der Verbreitung seiner<br />
Garten- und Landhausideale fußen konnte.<br />
Erst nach dem deutsch-französischen Krieg, nach dessen Frankfurter Friedensschluß 1871<br />
unsere Landhauskolonie von der Gattin des Baumeisters Hermann Hähnel, eines Aufsichtsratsmitgliedes<br />
des Landerwerb- und Bauvereins, den Namen „Friedenau'* erhalten<br />
hatte, vollzog sich deren Entwicklung auf dem Oberfeld der Wilmersdorfer Gutsgemarkung.<br />
Carstenn hatte mit der Auflage, keine Fabriken, keine mehrstöckigen Wohnhäuser und<br />
auch keine Proletarierwohnungen auf dem von ihm verkauften Areal zu errichten, dem<br />
Landerwerb- und Bauverein auf Aktien rund 11 Hektar zum Preis von 28 000 Talern zur<br />
Verfügung gestellt. Dieser verkaufte bei einem Selbstkostenpreis von etwa 11 Mark, der<br />
sich durch die notwendigen Aufschließungsarbeiten auf 19,50 Mark erhöht hatte, seinen<br />
Mitgliedern die Quadratrute (etwa 14,9 m 2 ) für 25 bis 30 Mark. Südöstlich von der Berlin-<br />
Potsdamer Landstraße, der jetzigen Rheinstraße, entstanden 95 Parzellen von je 60 bis zu<br />
150 Quadratruten. 1240 Quadratruten behielt man den Straßenzügen vor. Schon Ende<br />
Oktober 1871 kaufte man weitere 86 Morgen hinzu, so daß dem Bauverein nun insgesamt<br />
129 Morgen und 19 Quadratruten gehörten. Aber der Westteil des heutigen Friedenau<br />
blieb Eigentum des „Berlin-Charlottenburger-Bauvereins", einer Gründung Carstenns,<br />
der sich auch Grundbesitz an der jetzigen Bundesallee und dem Friedrich-Wilhelm-Platz<br />
mit dem Banl ier Kämpf teilte.<br />
267
Am 1. April 1872 konnten die ersten drei Wohnhäuser von ihren Besitzern bezogen werden.<br />
Friedenau lag damals eine Stunde entfernt von der Stadtmitte im Westen Berlins<br />
zwischen Eisenbahn und Chaussee in einer nach Süden mäßig ansteigenden Feldmark,<br />
und eine projektierte Pferdebahn sollte seinen Kern durchziehen.<br />
Anderthalb Jahre später, im Oktober 1873, gab es hier bereits 44 Häuser mit 120 Haushaltungen<br />
und 540 Personen.<br />
Dem Gartenstadtcharakter entsprechend, der allen Carstennschen Gründungen zu eigen<br />
ist. achtete man auch in der neuen Kolonie Friedenau auf die Baumbepflanzung. Die heutige<br />
Bundesallee durchzog damals eine vierfache Rüsternreihe, und noch jetzt kümmern<br />
sich viele Friedenauer Hausbesitzer persönlich um Pflege und Erhaltung der Bäume, die<br />
sich hier in fast allen Straßen finden. Der Charakter der Villenkolonie wurde durch Grundbucheintragungen<br />
gewahrt, denn baupolizeiliche Auflagen kannte man in dieser Zeit noch<br />
nicht. Inzwischen hatte der Fuhrunternehmer und Gastwirt Rockel die erwähnte Pferdeomnibuslinie<br />
eröffnet, die täglich siebenmal zwischen Berlin und Friedenau verkehrte. Der<br />
Landerwerb- und Bauverein hatte das Unternehmen mit monatlich 120 Talern subventioniert.<br />
Ab 1. November 1874 hielten auch die Berlin-Steglitzer Lokalzüge der Potsdamer<br />
Bahn vierzehnmal täglich in Friedenau. Der „Gemeinnützige Verein", der ein Jahr zuvor<br />
als Selbsthilfe-Organisation gegründet worden war. weil noch fast alle Versorgungs- und<br />
Verwaltungseinrichtungen fehlten, hatte das erreicht. Die Stationsbaukosten übernahmen<br />
neben dem Landerwerb - und Bauverein auch Schöneberger Terrainunternehmen, die Berliner<br />
Bauvereinsbank und der Grundbesitzer Johann Christian August Sponholz. Nach ihm<br />
heißt die vom Bahnhof auf die jetzige Hauptstraße, die damalige Friedenauer Straße,<br />
führende Sponholzstraße, deren Anrainergebiet er ab 1873 parzellierte. Die Station lag<br />
damals auf Schöneberger Gemarkung, und das alte Fachwerkstationsgebäude steht noch<br />
heute in dieser Straße neben dem jetzigen S-Bahn-Zugang aus dem Jahre 1891. Der Ringbahnhof<br />
dagegen hatte die Stationsbezeichnung „Wilmersdorf" erhalten.<br />
Es gab auch einen „Geselligen Verein", der sich schon 1872 konstituiert hatte, und beide<br />
Organisationen waren in der jungen Kolonie vielseitig tätig. Die Probleme reichten vom<br />
Schul- über Wege- und Straßenbau, der Feuerbekämpfung und der Einrichtung von Geschäften<br />
bis zur Aufstellung von Briefkästen. Der erste kam dann im Dezember 1872 neben<br />
einem Kandelaber auf das Rondell, der heutigen Kaisereiche.<br />
Kommunalpolitisch unterstand Friedenau noch immer Carstenn, dem Besitzer des Gutes<br />
Deutsch-Wilmersdorf. Es war wieder der Gemeinnützige Verein, der beim Teltower Landrat<br />
Prinz Handjery die Bildung einer selbständigen Landgemeinde beantragte. Carstenn<br />
trat daraufhin weitere Ländereien des nunmehr aufgelösten Gutsbezirkes Deutsch-Wilmersdorf<br />
ab und zahlte 7500 Taler an die neue Gemeinde zur Ablösung seiner Verpflichtungen.<br />
Durch Allerhöchsten Erlaß wurde dann am 9. November 1874 die bisherige Kolonie<br />
zur selbständigen Landgemeinde Friedenau erhoben. Ihr Areal umfaßte - noch heute<br />
unverändert- 141,35 Hektar.<br />
Der Schöneberger Amtsvorsteher Adolf Feurig leitete am 11. Januar 1875 die Wahl der<br />
ersten Gemeindeverordneten, die nun ihrerseits den Gemeindevorstand wählen konnten.<br />
Erster ehrenamtlicher Gemeindevorsteher wurde der Geheime Rechnungsrat Georg<br />
Roenneberg, Schöffen der Geheime Rechnungsrat Johann Carl Hacker, der in der Ringstraße<br />
5. der jetzigen Dickhardtstraße. in den Jahren 1871 und 1872 das erste Haus erbaut<br />
hatte, und der Handschuhfabrikant Koppe. Die Gemeindeverfassung hatte einige Abweichungen<br />
vom üblichen Gemeinderecht hinzunehmen: Landerwerb- und Bauverein und<br />
268
Berlin-Charlottenburger Bauverein besaßen volles Stimmrecht, das sie durch einen Vertreter<br />
wahrnehmen konnten, ebenso wie jedes Gemeindeglied mit Grundbesitz ebenfalls eine<br />
Stimme bei der Wahl der Gemeindeverordneten ausübte. Die neue Gemeinde gehörte<br />
zu Deutsch-Wilmersdorf und sollte erst am 1. März 1894. fast zwanzig Jahre später, eigener<br />
Amtsbezirk werden. In diesem Jahr 1875 zählte Friedenau 1104 Einwohner und 258<br />
Haushaltungen in 83 Häusern. Dann machte sich der große „Gründerkrach'" auch hier<br />
bemerkbar. Der Landerwerb- und Bauverein war in Liquidation geraten, Hypotheken wurden<br />
gekündigt, die Bodenpreise sanken. Man handelte die Quadratrute zwischen 15 und<br />
20 Mark aus. Erst nach zehn Jahren, um 1885 etwa, stabilisierten sich die Verhältnisse, so<br />
daß von einer Weiterentwicklung gesprochen werden kann. Natürlich waren auch die Versorgungseinrichtungen<br />
zurückgeblieben. Bereits 1873 hatte es 54 Petroleumflammen als<br />
Straßenbeleuchtung gegeben. Ein Jahr später verhandelte der Gemeinnützige Verein ohne<br />
Erfolg mit der Imperial Continental Gas-Association über die Einrichtung einer Gasbeleuchtung,<br />
die erst siebzehn Jahre später. 1891. eingeführt werden konnte. 1905 wurde<br />
dann ein gemeindeeigenes Elektrizitätswerk errichtet und am 1. Oktober dieses Jahres<br />
brannte zum erstenmal die moderne Straßenbeleuchtung.<br />
Die Attraktion der Schulkinder Friedenaus auf ihrem langen Weg nach Deutsch-Wilmersdorf<br />
am Westrand der Friedenauer Gemarkung im Zuge der heutigen Laubacherstraße,<br />
dem damaligen Steglitz-Wilmersdorfer Weg, bildete die einzige Wasserstelle auf der<br />
weiten Flur. Pielerts Pfuhl, der sogenannte „Püdderingspuhl", an der jetzigen Ecke von<br />
Wilhelmshöher- und Rheingaustraße, der kurz vor der Jahrhundertwende zugeschüttet<br />
worden ist. Schließlich gründeten die Geschwister Roenneberg in ihrem Haus Moselstraße<br />
Nr. 5 eine private höhere Mädchenschule. Nach dem Ausscheiden der selbständigen<br />
Gemeinde Friedenau aus dem Schulverband Deutsch-Wilmersdorf wurde am 1. Dezember<br />
1875 eine einklassige Volksschule mit 80 Schülern in einem gemieteten Raum des Hauses<br />
Ringstraße 49 eröffnet. Sie wurde ein Jahr später in die Albestraße verlegt, nachdem<br />
die Gemeinde das dortige Landhaus Nr. 32 für 30 000 Mark erworben hatte. Zehn Jahre,<br />
bis 1886, gab es auch hier nur eine Klasse unter einem Lehrer. Erst in der zweiten Hälfte<br />
der achtziger Jahre, nachdem die Entwicklungsstagnation überwunden worden war, konnte<br />
sie vergrößert und erneuert werden. Vor wenigen Jahren sind die Bauten abgerissen worden.<br />
Friedenau gehörte zur Parochie Wilmersdorf. In den ersten Jahren hielt man Gottesdienst<br />
in einem Zimmer der Karigschen Villa in der Schöneberger Straße, der heutigen Rheinstraße,<br />
danach im Saal des Gollhardtschen Kaiser-Wilhelm-Gartens, später in einem Klassenraum<br />
der Gemeindeschule und zuletzt in ihrer 1890 errichteten Turnhalle. Schon bald,<br />
im Anfang der achtziger Jahre, war der Kirchenbau ins Gespräch gekommen.<br />
Als 1877 Wilmersdorf den dortigen Friedhof für Friedenauer Bürger aus Platzmangel sperren<br />
mußte, beschloß die Gemeindevertretung, den Gemeindefriedhof gegen das Veto der<br />
Bauvereine. Carstenns und des Hamburger Kaufmanns Hünicken, die eine Wertminderung<br />
der angrenzenden Parzellen befürchteten, auf dem von Carstenn westlich der Kaiserstraße<br />
symmetrisch zum jetzigen Perelsplatz projektierten Hamburger Platz anzulegen. Am<br />
20. Mai 1881 weihte man diesen ein und konnte acht Jahre später Leichenhalle und gotisierende<br />
Kapelle vollenden.<br />
Die Häuser der Villenkolonie lagen hinter sechs Meter tiefen Vorgärten an den teilweise<br />
gepflasterten Straßen, die nur 7,50 m Dammbreite maßen und für den damaligen Verkehr<br />
völlig ausreichten.<br />
269
Besonders erfolgreich warb im Herbst 1881 der „Verein für die Beschaffung billiger Wohnhäuser"<br />
in Beamtenkreisen. Aber schon unterschieden sich die „Alteingesessenen", die<br />
in der Ring-, Mosel- und Saarstraße ihre Häuser verputzt hatten, von den Neuzugängen,<br />
die ihre Villen in unverputztem Backstein errichteten. Der Berliner Mutterwitz teilte<br />
sie daher sofort in „Putz- und Rohbauern".<br />
Im Herbst dieses Jahres 1881 wurde übrigens auf dem ehemaligen Schulplatz, dem nunmehrigen<br />
Lauterplatz, mittwochs und sonnabends der den Familien und Hausfrauen große<br />
Erleichterung bringende Wochenmarkt eröffnet, der auf dem jetzigen Breslauer Platz<br />
bald seine Hundertjahrfeier begehen kann. Ein knappes Jahr später, an einem Augustsonntag,<br />
brach dann der erste Brand auf einem Neubau der Fregestraße aus, vor dem die<br />
Pflichtfeuerwehr der Gemeinde völlig versagte. Die Bevölkerung forderte danach energisch<br />
deren Umwandlung in eine straff organisierte Freiwillige Feuerwehr, die sich schon nach<br />
wenigen Wochen der Öffentlichkeit vorstellte und ihr Spritzenhaus auf dem Schulhof in<br />
der Albestraße erhielt.<br />
Der damaligen allgemeinen Zuzugswerbung von Baugesellschaften und Gemeinde etwa<br />
unter dem Motto:<br />
„Feldallee'n und Blütenduft vor der Weltstadt Tor<br />
Schöne Häuser, Frische Luft, alles find'st Du vor.<br />
Drum: willst Du behaglich leben, billig, gut; sei schlau,<br />
laß den weisen Rat Dir geben: Zieh nach Friedenau!"<br />
erwiderte die kesse Berliner Schnauze:<br />
„Komm mit nach Friedenau, da ist der Himmel blau,<br />
da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau Galopp!"<br />
In diesen Jahren kümmerten sich die „Freie Vereinigung" und der „Verschönerungsverein"<br />
um das äußere Bild der Gemeinde. Bürgersteige und gärtnerisch gestaltete Teile<br />
wurden angelegt, Straßen kopfsteingepflastert und die ersten Ruhebänke aufgestellt. Das<br />
Gemeindewappen aus dem Jahre 1884 zeigt dann auch einen goldenen Friedensengel mit<br />
dem Palmenzweig in der Rechten auf einer blumigen Aue vor himmelblauem Hintergrund.<br />
Der Schild trägt eine Mauerkrone.<br />
Um 1900 noch reichte der bebaute Teil der Rheinstraße, die ja innerhalb der späteren<br />
Reichsstraße 1 von Königsberg nach Aachen tatsächlich die Verbindung zum Rhein schuf,<br />
nur bis zur damaligen Kirchstraße, beziehungsweise zur am 22. März 1879 gepflanzten<br />
Kaisereiche, ebenso wie die Bebauung in Richtung Schmargendorf und Wilmersdorf am<br />
Friedrich-Wilhelm-Platz und nach Schöneberg zu am Lauterplatz endete. Die Lauterstraße,<br />
nach dem Nebenfluß des Rheins benannt, hieß ja auch bis 1875 Grenzstraße.<br />
Damals hatten andere bevorzugt bebaute Straßen ebenfalls Namen erhalten, die sich an den<br />
zur Erinnerung an den Frankfurter Frieden gegebenen Namen Friedenau teilweise auf<br />
Flüsse in Elsaß-Lothringen bezogen. Neben den eben erwähnten waren es die Mosel-,<br />
Saar- und lllstraße. während die Querstraßen III und II zu Nied- und Albestraße wurden.<br />
Mit Hilfe des am 21. Juni 1887 gegründeten örtlichen Kirchenbauvereins konnte am<br />
Geburtstag der Kaiserin Auguste Viktoria, am 22. Oktober 1891, der Grundstein der unter<br />
ihrem Protektorat stehenden Kirche „Zum guten Hirten" auf dem von der Gemeindevertretung<br />
schon achteinhalb Jahre früher geschenkten Gelände des Friedrich-Wilhelm-<br />
270
Platzes gelegt werden. Das am 10. November 1893, dem Geburtstag Luthers, in Gegenwart<br />
der Kaiserin eingeweihte Gotteshaus, von Carl Doflein entworfen, stellt eine vereinfachte<br />
Variation seiner Wettbewerbsbeteiligung für die Gnadenkirche im Berliner Invalidenpark<br />
dar, die dann von Baurat Spina errichtet worden ist. Der Bau steht in der neugotischen<br />
Schule des Berliner Architekten Johannes Otzen, dem Mitbegründer des „Wiesbadener<br />
Programms" von 1891, das „der Einheit der Gemeinde und dem Grundsatz des allgemeinen<br />
Priestertums durch die Einheitlichkeit des (Innen)raumes Ausdruck geben", im Äußeren<br />
aber durch reiche Gliederung größtmögliche Bewegtheit des Baukörpers erzielen<br />
wollte. Doflein erreicht das mit wenigen Mitteln, und inmitten der Vielzahl der verflachten<br />
und ungekonnten Lösungen in der Neugotik des ausgehenden 19. Jahrhunderts besticht<br />
sein Sakralbau auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz durch monumentale Schlichtheit.<br />
Im Amtszimmer eines Pfarrers der Gemeinde hängt wieder die lange Zeit auf dem Dachboden<br />
gelegene eigenhändige Entwurfszeichnung des Architekten mit der handschriftlichen<br />
Genehmigung der Kaiserin. Dem Tympanon des Hauptportals vorgesetzt ist unter<br />
einem Baldachin die Sandsteinfigur Christi als guter Hirte nach dem Modell Pfannschmidts<br />
in der Ausführung von Koch. Deren Konsole durchschneidet ein Schriftband über den in<br />
Stichbögen schließenden Laibungen der Doppeltüren. Auf diesem steht „in alter Technik<br />
jeder einzelne Buchstabe auf einem besonderen Tonplättchen der von der hohen Protek-<br />
271
torin angegebene Spruch, unter dessen Zeichen die Kirche erbaut ist: Der Herr ist mein<br />
Hirte, mir wird nicht mangeln". (Hoßfeld im Zentralblatt der Bauverwaltung. 1893.) Die<br />
Turm und Vorhalle flankierenden polygonalen Türme über den Seitenschiffsportalen<br />
zieren Kochs Sandsteinfiguren von Petrus und Paulus.<br />
Leider ist die Kirche 1968 im Inneren unsachgemäß modernisiert und die unzerstört über<br />
den letzten Krieg gekommene neugotische Innenausstattung - Kanzel, Altar und Taufstein<br />
— des Dresdener Bildhauers Schurig beseitigt und als Bauschutt abgefahren worden.<br />
1893 waren auch Pfarr- und Gemeindehaus auf der vom Kaufmann Hünicken unentgeltlich<br />
zur Verfügung gestellten Eckparzelle Goßlerstraße/Bundesallee, um den derzeitigen<br />
Namen zu gebrauchen, errichtet worden. Sie mußten jedoch schon 1911 dem jetzigen Gemeindehaus<br />
mit Amtsräumen und Pfarrwohnungen weichen. Dieser im Oktober des nächsten<br />
Jahres eingeweihte Bau mit seiner sich an Stilfassungen der Vergangenheit anlehnenden<br />
monumentalen Fassadengestaltung von Hans Altmann war übrigens einer der ersten<br />
in Berlin, der den Ansprüchen einer Großstadtgemeinde entsprach.<br />
Als 1904 der alte Schmargendorfer Platz zum gärtnerisch durchgestalteten Schillerplatz<br />
wurde, verschwand die von der Gemeinde vorsorglich erbaute Krankenbaracke von 1892.<br />
dem Hamburger Cholerajahr, die hier als Armenunterkunft gedient hatte. Auch dieser<br />
Platz ist um 1960 geopfert worden, um die Kreuzung Stubenrauch-/Wiesbadener Straße<br />
verkehrsgerechter werden zu lassen.<br />
Aber bleiben wir noch bei den neunziger Jahren. Kurz vor der Jahrhundertwende siedelte<br />
der dreißigjährige Bildgießer Hermann Noack nach Friedenau über und eröffnete seine<br />
Werkstatt Ende 1899 in der späteren Fehlerstraße 8. Er hatte sich bereits mit der Aufrichtung<br />
des nach Reinhold Begas' Entwürfen bei der Gladenbeck AG, Friedrichshagen,<br />
gegossenen ,,Nationaldenkmals" auf der Schloßfreiheit einen Namen gemacht und unter<br />
anderen auch Hugo Lederers bekanntes Bismarck-Denkmal für die Stadt Bremen in<br />
einem ganz gewöhnlichen Stall-Remisenkeller auf einem Hinterhof der Gasteiner Straße<br />
in Wilmersdorf gegossen. Begas, Dammann, Gaul, Geiger, Kolbe, Kraus, Lehmbruck und<br />
Touaillon ließen neben heute vergessenen Bildhauern bei ihm arbeiten. Schon 1903 mußte<br />
er vergrößern. Noch heute liegt der Familienbetrieb, in der dritten Generation geleitet,<br />
am selben Platz. Hermann Noack II. führte den mit fünfundzwanzig Jahren 1921 übernommenen<br />
Betrieb hauptsächlich mit gegossenem Kunstgewerbe, dem kommerziellen<br />
Rückgrat jeder Gießerei, durch die Inflation und erhielt in diesen Jahren auch den Staatsauftrag<br />
zur Ausführung der von Kaufmann entworfenen Lichtquellen für die Krolloper.<br />
1929 goß Noack Gaul, Kolbe, Klimsch, die Kollwitz und die Sintenis. Scheibe, Scharjj,<br />
Marcks. Barlach, der in der Varziner Straße wohnte, Karsch und Belling kamen hinzu.<br />
Bellings kubistische Deckengestaltung im Tanzcasino der Berliner Scala hatte 1920 allgemein<br />
Furore gemacht.<br />
Als vierzehn Jahre später die alliierten Luftangriffe einen hundertfachen Tod auf Berlin<br />
hinabschleuderten, zerstörte im Jahre 1943 ein Bombentreffer auch die Werkstatt. Im<br />
Mai 1945 wieder voll arbeitsfähig, wurde der Betrieb durch die Sowjets demontiert. Aber<br />
Noack sollte die russischen Siegesmale gießen, die Einrichtung wurde also teilweise zurückgegeben.<br />
Neben unzähligen Sowjetsoldaten wurden unter primitivsten Verhältnissen — wie<br />
damals im Remisenkeller auf dem Hinterhof in der Gasteiner Straße - der Bronzekrieger<br />
auf dem Ehrenmal der Roten Armee im Tiergarten, die Gedenktafeln, Bronzekränze und<br />
knieenden Soldaten im Treptower Park gearbeitet. Es folgte der amerikanische Auftrag<br />
für Tregors Eisenhower-Statue in Westpoint. Reparaturen wurden ausgeführt, so an Schlü-<br />
272
Tiele-Wincf ler-Haus in Berlin-Friedenau, Albestraße 8 (Ecke Handjerystraße) Foto: E. Brast, 1977<br />
ters Großem Kurfürsten, an Drakes Viktoria auf der Siegessäule und an vielen anderen.<br />
Werke von Härtung, dem erst vor wenigen Wochen verstorbenen Gonda, Reuter, Grzimek<br />
und Heiliger wurden jetzt gegossen, und 1957 erhielt Noack den großen und schwierigen<br />
Auftrag, Schadows Quadriga für das Brandenburger Tor wie das zerstörte Original in<br />
Kupfer zu treiben. Aber Hermann Noack II. erlebte deren Vollendung nicht mehr. Zwei<br />
Monate nach der Ablegung seiner Meisterprüfung übernahm mit siebenundzwanzig Jahren<br />
Hermann Noack III. den Betrieb, den er von 1962 bis 1965 nach eigenen Ideen ausbaute,<br />
erweiterte und modernisierte. Er „dürfte heute die technisch vollkommenste Gießerei<br />
besitzen, die es zur Zeit gibt. Sie hält jedem Vergleich mit französischen, italienischen,<br />
englischen, auch ameril anischen Unternehmen dieser Art stand", schreibt Heinz Ohff in<br />
der Festschrift zum 70jährigen Bestehen der Firma. Henry Moore, Kenneth Armitage und<br />
der Amerikaner Larry Rivers haben Noack entdeckt. Das Ansehen der Gießerei ist international<br />
geworden.<br />
Auf dem Gelände des in den neunziger Jahren entstandenen „Sportparks" mit seiner<br />
500-m-Radrennbahn, auf der Thaddäus Robl, der erfolgreichste Radrennfahrer seiner Zeit,<br />
das „Goldene Rad von Friedenau" und seine beiden Weltmeisterschaften über 100 Kilometer<br />
gewonnen hatte, und auf der der „Große Preis von Deutschland" ausgefahren wurde,<br />
entstand ab 1904 allmählich das „Wagnerviertel". Hier hatte die Stadt Berlin zu Beginn<br />
der achtziger Jahre eine Gasanstalt bauen wollen, aber mit Hilfe Bismarcks konnte die Gemeindevertretung<br />
das verhindern. Im September 1904 war das Areal für 2 875 000 Mark an<br />
die Berlinische Boden-Gesellschaft verl auft worden. Ihr Direktor, der spätere Kommerzienrat<br />
Haberland, stiftete im Juli 1909 den „Sintfluf-Brunnen von Paul Aichele, der jetzt<br />
273
auf dem Perelsplatz, dem ehemaligen Maybachplatz, gegenüber der Hähnelstraße aufgestellt<br />
ist.<br />
Ab 1891 kam es mehrfach zu Eingemeindungs- und Vereinigungsverhandlungen, zuerst<br />
mit der Stadt Berlin, ab 1897 dann mit Schöneberg. Zuerst hatte Berlin abgelehnt, dann<br />
verhinderte der Kreis Teltow den Anschluß. Auch Einverleibungsbestrebungen der Gemeinde<br />
Steglitz im Jahre 1910 scheiterten, nachdem schon 1903 zeitweise eigene Stadtrechte<br />
der Gemeinde „Berlin-Friedenau" — seit September 1909 hieß sie so - im Gespräch<br />
gewesen waren.<br />
Diese Aufwärtsentwicklung Friedenaus ist nicht zuletzt dem am 23. November 1888<br />
gegründeten Haus- und Grundbesitzer-Verein zu danken, der in der Gemeindevertretung<br />
eine wesentliche Rolle spielte und daher weitgehend das äußere Bild prägte. Erhaltung<br />
der Vorgärten. Baumbepflanzung in den Straßen. Wasserversorgung, Straßenpflasterung<br />
und Unterhaltung der Bürgersteige gehörten mit zu seinem Aufgabenkreis, aber auf der<br />
anderen Seite verfocht er hart die Aufhebung der offenen Bauweise und besiegelte damit<br />
letztlich das Schicksal des Villenvorortes.<br />
Die wachsende Gemeinde zwang auch zur Erweiterung des Schulwesens. 1895 war die alte<br />
Schulvilla in der Albestraße abgerissen und ein Jahr später ein Neubau mit 15 Klassen<br />
errichtet worden; 1902 gab es 1157 Schüler in 27 Klassen. Mit der am 1. Oktober 1906<br />
eröffneten zweiten Volksschule in der Rheingaustraße 7 wurde der Unterricht für Knaben<br />
und Mädchen getrennt. Die 1911 gegründete dritte Volksschule sollte in dem zwei Jahre<br />
später begonnenen Neubau an der Offenbacher Ecke Laubacher Straße eine Heimstatt<br />
finden, doch wurde dieser zunächst Reservelazarett: Inzwischen war der erste Weltkrieg<br />
ausgebrochen. Einen ausgezeichneten Ruf genoß der schon 1896 zwischen Stubenrauchund<br />
Fehlerstraße eingerichtete Schulgarten, der zum Musterbeispiel vieler Anlagen in anderen<br />
Ortschaften werden sollte, bevor er der Friedhofserweiterung zum Opfer fiel.<br />
Neben der schon erwähnten Roennebergschen privaten Töchterschule in der Moselstraße<br />
Nr. 5, die 1873 eröffnet worden war, führte Dr. Lorenz in der Schmargendorfer Straße<br />
Nr. 24/25 (heute befindet sich dort der Installations-Großhandel von Sandvoss & Fischer)<br />
in den achtziger Jahren eine höhere Privatschule, die schloß, als im Hoffmannschen Bau in<br />
der Albestraße am 22. April 1897 die erste öffentliche höhere Lehranstalt der Gemeinde<br />
mit 3 Vorschulklassen und der Sexta den Unterricht aufnehmen konnte. Am 20. März 1901<br />
legte man den Grundstein zum Gymnasialgebäude am Maybachplatz. das nach den Entwürfen<br />
von Landbauinspektor Engelmann und Regierungsbaumeister Blunck errichtet<br />
und am 18. April 1903 seiner Bestimmung übergeben wurde. Dieser Neo-Renaissancebau<br />
zeigt in seiner Fassadengestaltung deutlich ein Hauptanliegen des Jugendstils, das dieser<br />
auch in seinen historisierenden Variationen beibehält: die impressionistische Differenzierung<br />
durch die reine Form zu überwinden. Deren Geschlossenheit \ ommt besonders im<br />
Uhrenturm zum Ausdruck. Die Baukosten einschließlich Inneneinrichtung und Turnhalle<br />
hatten übrigens 597 000 Mark betragen.<br />
Drei Jahre später. 1906, gründete man das spätere Real-Gymnasium, die Rheingauschule,<br />
die nach weiteren vier Jahren 1910 in ihr eigenes Gebäude ziehen konnte.<br />
Im Jahre 1911 eröffnete die Königin-Luise-Schule in der Goßlerstraße ihre Pforten, die<br />
1907 als öffentliche höhere Töchterschule gegründet worden war und 1912 Lyzeum werden<br />
sollte. Es ist die heutige Paul-Natorp-Schule. die der Gemeindebaurat Hans Altmann<br />
errichtet hatte.<br />
274
Schon vor der Jahrhundertwende hatte die Verkehrsentwicklung noch heute aktuelle und<br />
für uns Großstadtbewohner unbequeme Probleme gebracht, die manchmal ebenso hart für<br />
die Betroffenen auch jetzt gelöst werden müssen. Als der Kreis Teltow die Verbreiterung<br />
der Rheinstraße als Teil der alten Provinzialchaussee Berlin-Potsdam und die Verlegung<br />
der Strßenbahnschienen an die Fahrbahnseiten forderte, wehrten sich verständlicherweise<br />
Gemeinde, Haus- und Grundbesitzer-Verein und die Anlieger gegen die notwendig werdende<br />
Auflassung und Abtretung der Vorgärten. Doch der Landrat von Stubenrauch<br />
setzte mit der Androhung der Verweigerung des Kreiszuschusses von 400 000 Mark seine<br />
Wünsche durch.<br />
In den achtziger Jahren hatte eine einzige Pferdebahn zwischen der Rhein-/Kaiserstraße<br />
und Zoologischem Garten verkehrt; im Jahre 1907 durchfuhren neun Straßenbahnlinien<br />
Friedenau nach Weißensee. Treptow. Rixdorf. Lichtenberg, Schönhauser Allee, dem Potsdamer<br />
Bahnhof und dem Zoo.<br />
Inzwischen war der Charakter des Villenvorortes verlorengegangen. Hatten um 1875 bereits<br />
80 Villen oder Landhäuser gestanden, setzte sich ab 1887 immer mehr der Miethausbau<br />
in der geschlossenen Bauweise durch. Ab 1902 hörte der Villenbau gänzlich auf. Von<br />
1890 bis 1895 wurden nur 102 meist dreistöcl ige Wohnhäuser errichtet. Bereits 1895,<br />
zwanzig Jahre nach der Gründung der selbständigen Landgemeinde, hatte der erste Villenabriß<br />
begonnen, dem nun jedes Jahr weitere folgen sollten. Im Jahre 1913 gab es etwa noch<br />
100 Landhäuser und 54 Baustellen. Schon damals also dieselben Probleme, denen wir uns<br />
heute gegen übersehen!<br />
In dieser Zeit, in der die Bebauung der Rheinstraße sich etwa bis zur Roennebergstraße<br />
ausdehnte und der Kaiser-Wilhelm-Garten an der Ringstraße zum Ausgangspunkt alljährlich<br />
stattfindender Umzüge, etwa zum Schützen- und Erntedankfest, geworden war,<br />
in der Krieger-, Turn- und Schützenverein ihre Feste feierten, diskutierte man hitzig und<br />
streitend den zukünftigen Standort des Rathausbaus. Man konnte sich nur schwer zwischen<br />
Wilmersdorfer Platz oder Marktplatz entscheiden. Inzwischen nannten die Friedenauer<br />
daher scherzhafterweise die auf dem Lauterplatz errichtete Bedürfnisanstalt das „Kleine<br />
Rathaus"!<br />
Am 20. April 1913 wurde auf dem Bauplatz, den die Berlinische Bodengesellschaft Süd-<br />
West unter Kommerzienrat Haberland nach Änderung schon bestehender Baupläne dem<br />
damaligen Pfarrer von Steglitz, Dr. Joseph Deitmer unentgeltlich übereignet hatte und der<br />
teils auf Friedenauer, teils auf Wilmersdorfer Gebiet liegt, durch den Fürstbischöflichen<br />
Delegaten Prälat Dr. Carl Kleineidam der Grundstein zur katholischen Marienkirche im<br />
Schnittpunkt von Laubacher und Schwalbacher Straße gelegt. Anderthalb Jahre später,<br />
wenige Wochen nach Kriegsausbruch, nahm am 11. Oktober 1914 Erzpriester Dr. Deitmer<br />
die Benediktion des nach einem abgewandelten Entwurf Christoph Hehls durch Carl<br />
Kühn aufgeführten, der Spätromanik angelehnten, aber eigenständig umgeformten Sakralbaus,<br />
einer Verschmelzung von Basilika und Zentralanlage mit Umgang, vor. Der Architekt<br />
hat hier noch ganz im Sinne des Gesamtkunstwerkes des Jugendstils auch Ornamente,<br />
Kapitelle, figürlichen Schmuck, Kreuzigung. Marienbild, Inneneinrichtung, Glasfenster,<br />
Hochaltar, Kanzel, Beichtstühle und alle Kultgegenstände selbst entworfen und gezeichnet.<br />
Die Kirche ist erst viele Jahre nach dem Krieg und der Inflation am 15. November 1925<br />
durch den nunmehrigen Weihbischof Dr. Deitmer konsekriert worden. Sie steht übrigens<br />
1,10 m im Zuge der Laubacher Straße auf Friedenauer Gebiet, dessen Grenze zu Wilmers-<br />
275
dorf auf der Fahrbahnmitte verläuft. Alle Eingänge liegen deshalb in diesem schmalen<br />
Streifen. Hervorgehoben sei hierbei, daß die unter dem Turm-Massiv hindurchlaufende,<br />
nicht verlegbare Kanalisation dessen Fundamentierung erheblich erschweren sollte. Eine<br />
kleine Kuriosität am Rande: Bis zur Neuausstattung mit den modernen Peitschenmasten<br />
wurden die unterschiedlichen Gaslaternen beider Bezirke auf den Bürgersteigen der Laubacher<br />
Straße auch mit einer geringen Zeitdifferenz gezündet.<br />
Das auf Wilmersdorfer Gelände an der Bergheimer Straße liegende, ebenfalls durch den<br />
Diözesanbaurat Carl Kühn errichtete Gemeindehaus steht ganz unter dem Einfluß des<br />
Expressionsimus und ist 1930 vollendet worden. Auch hierfür hatte die Terrain-Gesellschaft<br />
Berlin-Südwesten die Planung eines fünfgeschossigen Wohnhausbaus, der das<br />
Ensemble von Kirche und Kirchplatz vollständig zerschlagen hätte, rückgängig gemacht.<br />
Ein halbes Jahr nach der Grundsteinlegung für die Marienkirche, am 13. Oktober 1913.<br />
dem hundertsten Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, folgte die Fundamentierung<br />
des letzten Rathausbaus der Kaiserzeit am Lauterplatz. Die Unregelmäßigkeit des Grundstücks<br />
gleicht der Architekt Hans Altmann durch Vor- und Rücksprünge aus und erreicht<br />
in der beruhigten Manier des Jugendstils die Steigerung des Ausdrucks durch Massenwirkungen.<br />
Er läßt sich hierbei vom Historismus leiten, ohne ihm zu verfallen. Der Rathausturm<br />
wird zum Blickpunkt mehrerer Straßenfluchten und verdeutlicht so den Verwaltungssitz<br />
als Zentrum der Gemeinde.<br />
Schon am 1. Oktober 1915 nahmen einige Büros der Gemeinde ihre Arbeit in dem Neubau<br />
auf, der 1916 vollendet werden konnte. Im zweiten Weltkrieg erlitt das Rathaus<br />
schwere Schäden und wurde danach vom Hochbauamt Schöneberg in den Jahren 1950<br />
bis 1956 unter starker Vereinfachung des Traktes am heutigen Breslauer Platz wiederhergestellt.<br />
Aber blättern wir ein wenig im „Adreßbuch für Berlin-Friedenau 1914". gedruckt und<br />
verlegt „von Leo Schultz in Friedenau. Friedenauer Lokal-Anzeiger. Rheinstraße 15".<br />
Den 44 385 Einwohnern empfahl sich das Biophon-Theater in der Rheinstraße 14 als<br />
„ältestes, bedeutend vergrößertes und aufs beste ventiliertes Kinematographen-Theater<br />
am hiesigen Platze". Es zeigte „stets wechselndes Programm. Täglich zwei große Schlager.<br />
Große Revue der neuesten Ereignisse aus aller Welt." Es begann „Sonntag Nachmittags<br />
4 Uhr. Wochentags 6 Uhr" bei „billigen Eintrittspreisen". Aber Friedrich Schröders<br />
„Hohenzollern-Lichtspiele" in der Handjerystraße 64 mit „Hohenzollern-Festsälen und<br />
Restaurant", auf deren Grundstück heute ein den alten Glanz nicht mehr ahnen lassender<br />
Neubau der letzten Jahre steht, waren „größtes Kinomatographen-Theater im Orte". Sie<br />
boten ebenfalls „wöchentlich zweimal wechselndes Programm" und führten „stets das<br />
neueste der Lichtspielkunst" vor. Die Gaststätte erschien als „vornehmstes Tagesrestaurant<br />
und Familienlokal" mit „tadelloser Kegelbahn" und Zentralheizung in allen Räumen. In<br />
der Handjerystraße 80 — auch hier erhebt sich heute ein nüchterner Nachkriegsbau - lag<br />
in der Nähe des Lauterplatzes das „Sanatorium Handjery in vornehmer ruhiger Lage von<br />
Gärten umgeben", die klinisch geleitete Heilanstalt von J. H. Tarrasch mit „Dachterrasse"<br />
für „Sonnenbäder", die von jedem Arzt belegt werden konnte und „alle modernen Heilverfahren"<br />
anwandte. Ihr angeschlossen war eine „orthopädisch-chirurgische Anstalt<br />
unter ärztlicher Leitung", die „orthopädische Turnkurse für Kinder und Erwachsene" in<br />
276
Kanzel in der Kirche<br />
„Zum Guten Hirten"<br />
in<br />
Berlin-Friedenau.<br />
Friedrich-Wiiheim-Platz<br />
Bildhauerarbeit von<br />
J. Schurig. Dresden<br />
(um 1892)<br />
Foto: Werner Lehmann, 1960<br />
„großem Turnsaal" durchführte und auch „elektrische-, Massage-, Heißluft- und Röntgen-<br />
Behandlung". „Inhalationen jeder Art. System Ems und Reichenhall" sowie „elektrische.<br />
Licht-. Dampfkasten-, Sand-, Sonnen-, sowie alle anderen medizinischen Bäder" anbot.<br />
Die „gesunde Lage" Friedenaus wird den Kurbetrieb schon haben florieren lassen. Die<br />
Gemeinde besaß ja auch von Anfang an eine „günstige Sterblichkeitsziffer", weil ein eigenes<br />
Kran! enhaus fehlte und ernste Fälle nach Steglitz oder Schöneberg eingewiesen werden<br />
mußten. Eventuelle Sterbefälle wurden also diesen Orten zugerechnet.<br />
Aber genießen wir weiter die heitere Gelassenheit damaligen Lebens. Das „Grenzschlößchen"<br />
mit großem Garten und zwei Sommerkegelbahnen gehörte zum ersten der drei mit<br />
„vorzüglichen Restaurants" versehenen Sportplätze Wilhelm Grubes in Friedenau und<br />
Steglitz, und der schon erwähnte „Kaiser-Wilhelm-Garten" an der Rheinstraße 65 Ecke<br />
Ringstraße, der heutigen Dickardtstraße, führte als „vornehmes Tagesrestaurant" mit<br />
277
„großem Mittags- und Abendtisch" einen eigenen Theatersaal. Paul Dillner, dem auch das<br />
vom Kronprinzen bevorzugte Schwabes Hotel in Zinnowitz gehörte, war Eigentümer des<br />
Gartenrestaurants zum „Prinzen Handjery", Handjerystraße 42. Ecke Kirchstraße 21, in<br />
dem sich heute eine Pizzeria. der schlichte Berliner Speisungsschlager des letzten Jahrzehnts,<br />
befindet, mit „Mittagstisch von 12 — 4 Uhr" und „stets reichhaltiger Abendkarte".<br />
Biere — Münchner Franziskaner Leistbräu, Pilsener Urquell, Kulmbacher Reichel und<br />
Pilsator Hell - wurden in Ein-Liter-Krügen oder Fünf-Liter-Siphons auch außer Haus<br />
verkauft. Als letztes aus dieser Zeit mag noch Otto Wendts Milchl uranstalt Friedenau in<br />
der Handjerystraße 69 erwähnt werden, die als „Spezialität frische Milch für Kinder und<br />
Kranke" lieferte, wobei die „Kindermilch nach polizeilicher Vorschrift von geimpften<br />
Kühen" stammte und sich daher „hier die einzige Möglichkeit" bot, „dem Preis entsprechend<br />
eine saubere, unverfälschte Milch zu erhalten".<br />
Höhere und mittlere Beamte, Militärs, Mediziner und Juristen. Künstler, Rentiers. Kaufleute<br />
und Handwerker. Witwen, Lehrerinnen und eine hohe Zahl weiblicher Dienstboten<br />
hatten in diesen Jahren nach der Jahrhundertwende bis zum ersten Weltkrieg den Charakter<br />
Friedenaus geprägt. Am Maybachplatz gegenüber dem Birkenwäldchen wohnte man<br />
mit Kammerdiener und Butler und am Wagnerplatz gab sich die Demimonde ihr Stelldichein.<br />
Ältere Einwohner erinnern sich noch der mehrfachen Kaiserbesuche bei den Bildhauern<br />
Casal und Götz in der Wilhelm-, der jetzigen Görresstraße, und bei dem Marinemaler<br />
Bohrdt in der Niedstraße 13, die stets in völliger privater Ungezwungenheit ohne<br />
Sicherheitsvorkehrungen verliefen. Bohrdt war begeisterter Sportsegler und genoß internationale<br />
Anerkennung. Auch Prinz Heinrich weilte oft in seinem Atelier. Noch vor dem<br />
ersten Weltkrieg war Bohrdt nach Dahlem verzogen, wo er hochbetagt im Alter von<br />
89 Jahren 1945 sterben sollte.<br />
Als im Herbst 1911 die Maler der Dresdener „Brücke" nach Berlin übersiedelten, mietete<br />
sich Karl Schmidt-Rottluff in der Niedstraße 14 ein, in einem viergeschossigen Miethausbau,<br />
den die geometrische Versachlichung des Jugendstils kennzeichnet. Von seiner<br />
Atelierwohnung unter dem Dach genoß er einen herrlichen Rundblick auf die umliegenden<br />
Häuser und die Felder der Umgebung. Damals lebten siebzehn Architekten, siebenundzwanzig<br />
Bildhauer, siebenundvierzig Kunstmaler, zehn Gesangs-, dreißig Musik-, vier<br />
Tanzpädagoginnen und zehn Musikdirektoren in Friedenau. Kurz nach der Jahrhundertwende<br />
hatte der Schriftsteller Georg Hermann in der damaligen Kaiserallee 108 „Jettchen<br />
Gebert", seinen Roman aus dem jüdisch-bürgerlichen Leben der Biedermeierzeit, geschrieben.<br />
Aufregende Abwechslung bedeutete für die Jugend jedesmal der Einsatz der Freiwilligen<br />
Feuerwehr, die jetzt ihr Spritzenhaus am Rande eines Freiplatzes in der Schmargendorfer<br />
Ecke Handjerystraße besaß, auf dem Gelände, das für den Rathausbau vorgesehen<br />
war und das später die Post bebaute. Oft genug halfen bei der Brandbekämpfung die<br />
Berufswehren aus Steglitz, Wilmersdorf oder Schöneberg, die mit ihren pferdebespannten<br />
Leiterwagen und Dampfspritzen über die Straßen galoppierten. Das Spritzenhaus bezog<br />
später die Schmiede, aber der Name „Zur Dampfspritze" hatte sich noch lange in einem<br />
kleinen Bierlokal erhalten.<br />
Dann brach der Weltkrieg aus, und die Gemeindevertretung hielt ihre erste Kriegssitzung<br />
am 6. August 1914 ab. Am nächsten Tag wurde die „Zentralstelle für vaterländische Hilfe"<br />
eingerichtet. Wenige Wochen vor Kriegsende, am 1. Oktober 1918, konnte das neue Postamt<br />
am Wilmersdorfer Platz, dem jetzigen ReneerSintenis-Platz, eröffnet werden, dem<br />
acht Jahre später, 1926, der Erweiterungsbau in der Schmargendorfer Straße angegliedert<br />
278
wurde. Bereits am 1. Juli 1874 war die Postagentur „Stadtpostexpedition Nr. 57 W - Friedenau"<br />
eingerichtet worden.<br />
Mitten im Krieg hatte sich Friedenau ab 1917 gegen höheren Ortes wieder auflebende Vereinigungspläne<br />
mit Steglitz zu wehren und niemand achtete daher so recht auf eine Begegnung<br />
zweier Menschen, die sich in der Cranachstraße vollziehen sollte. Der Russe Wladimir<br />
lljitsch Uljanow, genannt Lenin, hatte Rosa Luxemburg, die polnisch-deutsche Revolutionärin<br />
aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie, besucht.<br />
Zwei Jahre nach dem Krieg entstand das neue Berlin. Ab 1. Oktober 1920 bildete Friedenau<br />
mit Schöneberg den Verwaltungsbezirk 11 der Großstadt. Die Baltikumtruppen,<br />
die das Rathaus, die Post und auch das Schuhgeschäft Leiser geschützt hatten, waren abgezogen<br />
worden, und das Leben schien sich zu normalisieren. Das Cafe Wörz in der 111-<br />
Ecke Saarstraße bot das beste Kabarett Berlins und im eleganten „Hähnel-Eck" traf sich<br />
wenig später die Lebewelt der Inflation. Dann flog der Währungsspuk vorüber, am Rathaus<br />
wuchs der Neubau des Roxy-Palastes empor und man flanierte wieder auf der Rheinstraße<br />
zwischen Kirch- und Schmargendorfer Straße wie eh und je am späten Nachmittag.<br />
Längst waren die Toten des Kapp-Putsches an der Rheinstraße Ecke Kaiserallee vom März<br />
1920 vergessen, und in der Fregestraße war inzwischen ein Mädchen herangewachsen, das<br />
wenig später, in den dreißiger Jahren, unter dem Mädchennamen der Mutter zum Leinwand-Liebling<br />
des Publikums werden sollte: Lilian Harvey. Der Friedenauer, der etwas<br />
auf sich hielt, genoß seinen Tropfen in Waldemar Reuters „Trarbach's Weinstuben" in der<br />
Moselstraße 1—2 oder speiste in dem von wildem Wein bewachsenen Gartenlokal in der<br />
Wieland- Ecke Bahnhofstraße, das der ehemalige Leibkoch des Kaisers eröffnet hatte.<br />
Diese Zwanziger Jahre sollten wieder einschneidend das Ortsbild verändern. Auf angrenzendem<br />
Schöneberger Gebiet hatte Heinrich Lassen 1925 für die Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft<br />
der Berliner Straßenbahn mit der Errichtung des ersten drei- und viergeschossigen<br />
Komplexes der expressionistischen Siedlung Cäciliengärten begonnen und<br />
die Einfahrt zur Wohnanlage an der Semperstraße sechsgeschossig turmartig überhöht. Die<br />
durch alternierende Erker- und Loggienzonen plastisch gegliederten Fassaden durchlaufen<br />
horizontale Fensterbegrenzungsprofile. Das war gekonnt und besaß Niveau, der Friedenauer<br />
bemerkte, daß er in einer sich dynamisch entwickelnden Großstadt lebte. Die Rheinstraße<br />
wurde modernisiert, die Straßenbahnschienen in die Fahrbahnmitte verlegt, und der<br />
mit Linden und Rosenovalen bepflanzte Rasenstreifen, die Bürgersteigbegrenzung, verschwand.<br />
Der Roxy-Palast machte den Rheinschloß- und Kronen-Lichtspielen Konkurrenz.<br />
In einer Leihbücherei am Friedrich-Wilhelm-Platz setzte Andreas Wolff Anfang der dreißiger<br />
Jahre die Tradition seines Großvaters, des Petersburger Verlegers und Buchhändlers<br />
M. O. Wolff, zu dessen literarischem Zirkel Turgenjew, Gontscharow und Tolstoi gehört<br />
hatten, fort. Am 16. September 1932 las man zum erstenmal „Junge deutsche Literatur".<br />
Peter de Mendelssohns „Fertig mit Berlin" und Hans Natoneks „Kinder einer Stadt" fanden<br />
ihr begeistertes Publikum. Aber in den Jahren, als der Werbespruch des Kaufhauses in der<br />
Lauterstraße: „Für Friedenau ein wahrer Schatz ist Leo Bry am Lauterplatz" mit dem<br />
Zweizeiler: „Es freut den Jud' das Weihnachtsfest, wenn sich's der Goy was kosten läßt"<br />
beantwortet wurde, schwieg auch Andreas Wolff, der inzwischen in seinen Eckladen<br />
Kundrystraße/Kaiserallee umgezogen war. Er trat erst wieder nach dem Krieg mit der<br />
„Friedenauer Presse" an die Öffentlichkeit, die er für die Freunde seiner Buchhandlung<br />
in Heftform oft mit Erstdrucken herausgab. Sein Gästebuch bewahrt die Erinnerungen<br />
279
an die seit 1946 regelmäßig stattfindenden Gemäldeausstellungen und Lesungen. Nach<br />
seinem Tode hatte Tochter Katarina, Katja genannt, die Buchhandlung übernommen,<br />
die seit 1. Juli 1976 von Barbara Stieß und Helga Steinhilber in seinem Sinne weitergeführt<br />
wird. Friedenau hat sein literarisches Image mit dem am 5. August 1943 hingerichteten<br />
Widerstandskämpfer Adam Kuckhoff, mit Gottfried Benn, Günter Grass, Hans Magnus<br />
Enzensberger, Uwe Johnson, Max Frisch, Christoph Meckel und dem nach Charlottenburg<br />
verzogenen Günter Bruno Fuchs bis heute wahren können.<br />
Der Schöneberger Ortsteil besitzt auch heute noch sein eigenes Bild und seinen eigenen<br />
Stil. Ein Bummel durch seine Straßen wird zum Bummel durch seine Geschichte. Klar<br />
zeichnen sich die drei Bebauungsphasen seiner Entwicklung ab. die offene und halboffene<br />
Bebauung der Gründerzeit, der viergeschossige Miethausbau der Vororte Berlins aufgrund<br />
der Bauordnung von 1891. und die wiederum halboffene Miethausbebauung seit 1910.<br />
Leider stark verändert und heute kaum erkennbar steht das zur Zeit älteste Haus. 1873<br />
erbaut, in der jetzigen Dickhardtstraße 31. (Helmut Winz: Es war in Schöneberg, Berlin<br />
1964, S. 91.) Villen der achtziger Jahre sieht man noch heute in der Lauter-, Albe-. Handjery-,<br />
Nied-, Schmargendorfer und Goßlerstraße. Zu ihnen gehört das Haus Albestraße 8.<br />
das 1897 vom „Frauenbund zum treuen Hirten" als „Zufluchtstätte" für hilfsbedürftige<br />
Frauen der Großstadt angekauft und vom Hofprediger Stoecker eingeweiht worden war.<br />
Damals lag die anheimelnde Villa noch zwischen Wiesen und Kornfeldern.<br />
Begonnen hatte dieser schwere Dienst als Einrichtung der Berliner Stadtmission dreizehn<br />
Jahre früher, am 1. April 1884, in einer kleinen Wohnung des Berliner Nordens durch zwei<br />
Schwestern des Magdalenenstiftes Plötzensee, abgelöst von Schwestern aus dem Paul-<br />
Gerhardt-Stift, aus dem Diakonissenmutterhaus Bethanien und einer Mitarbeiterin aus<br />
der Brüdergemeinde Niesky. Am 19. Mai 1911 wurden die ersten vier Friedenshortschwestern<br />
feierlich eingeführt und nach Jahren aufopfernder Arbeit ging das nunmehrige<br />
Mädchen-Erziehungsheim 1927 endgültig in die Hände des Friedenshortes über. In schweren<br />
Jahren hatten die Pfleglinge hier ihre Heimat gefunden, die „als geistig schwache, verhaltensgestörte<br />
Mädchen mit Verwahrlosungserscheinungen" in den dreißiger Jahren durch<br />
Landesjugendamt und Bezirksämter eingewiesen worden waren. Im jetzigen Heim für<br />
geistig behinderte Volljährige, das seit sieben Jahren „Tiele-Winckler-Haus" heißt, versehen<br />
die Schwestern abseits vom Großstadtlärm auch heute ihren gesegneten, schweren,<br />
aber schönen Dienst in der stillen Oase der Nächstenliebe, um diesen Mädchen von damals<br />
ein Zuhause zu bieten. Wenige Schritte weiter steht in der Handjerystraße das Haus der<br />
Gossner-Mission, das Erbe des 1773 geborenen, von der römischen Kirche befehdeten,<br />
verfolgten, eingekerkerten, evangelisch gesinnten katholischen Priesters Johannes Evangelista<br />
Gossner, der 1819 vom Zaren Alexander I. an die Malteserkirche in Petersburg<br />
berufen, aber auch hier schon nach fünf Jahren verdammt und ausgewiesen wurde. In<br />
seinen „Vagabundenjahren" kirchlich und politisch heimatlos geworden, trat er endlich<br />
am 23. Juli 1826 in der Patronatskirche des Kammerherrn von Heynitz in Königshain in<br />
Schlesien zur evangelischen Kirche über. Doch nur das persönliche Eintreten des Barons<br />
von Kottwitz und der Machtspruch des preußischen Königs verhalfen ihm drei Jahre<br />
später zu der Pfarrstelle an der böhmisch-lutherischen Bethlehemsgemeinde in der Wilhelmstraße.<br />
Schnell bildete sich auch hier eine Gossner-Gemeinde. Die Schleiermachers,<br />
Bismarck, dessen Sohn Herbert er taufte, und die Schlieffens, um nur die Bekanntesten zu<br />
nennen, gehörten dazu. Aber sein eigentliches Lebenswerk bildete die Mission. Zwei<br />
Schriften hatten ihn weltbekannt gemacht, das „Schatzkästlein", das Andachtsbuch der<br />
280
Gossnerschen Missionare in allen Kontinenten, und das „Herzbüchlein". Am 10. Oktober<br />
1837 wurde das Elisabethkrankenhaus, das erste Krankenhaus Berlins, eingeweiht und die<br />
angeschlossene „Ausbildungsschule für Pflegerinnen" eröffnet. Gossners Beitrag zur<br />
Inneren Mission. Zehn Monate vorher, am 12. Dezember 1836, hatte die Gossnersche<br />
Heidenmission begonnen, die im Verlauf von hundert Jahren nach seinem Tode am<br />
30. März 1858 insgesamt 292 Missionare und 15 Missionsschwestern in die Welt hinausgesandt<br />
hat. Gossners eigentliche Liebe galt der Kinderarbeit. Die beiden Gossner-Häuser<br />
in Friedenau und Mainz-Kastell setzen seine missionarische Arbeit nach innen und außen<br />
fort und wachen über die Entwicklung der selbständigen Gossner-Kirche in Indien.<br />
In stillen Straßen Friedenaus wechseln Miethausbauten mit den damals modernen, in den<br />
siebziger und achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts kreierten Fassaden der „nordischen<br />
Renaissance" mit repräsentativen Häusern des Jugendstils, hinter deren großen Baikonen<br />
und Loggien dunkle Räume die Sphäre privater Tabus betonen.<br />
Die „Wohltatsche Buchhandlung" in der Rheinstraße, die der Gossner-Mission in der<br />
Handjerystraße, Uhren-Lorenz und die Adler-Apotheke in der Rheinstraße gehören zu<br />
den Geschäften, die schon um 1900 am gleichen Platz existierten, wenn sie auch heute<br />
teilweise anderen Besitzern gehören.<br />
Und wenn ich vorhin vom „eigenen Stil" gesprochen habe, so gehört dazu die Aufgeschlossenheit,<br />
die Freundlichkeit und die Bereitwilligkeit, mit der mir alte Friedenauer mit Auskünften<br />
und Chroniken zur Verfügung gestanden haben. Ich habe herzlich zu danken Frau<br />
Ruth Mönnich und Frau Barbara Stieß, unseren Mitgliedern Herrn und Frau Neufert, Herrn<br />
Noack, Herrn Pfarrer Dr. Buske der Gemeinde „Zum Guten Hirten", Herrn Pfarrer<br />
Piotrowski von St. Marien, Herrn Posner vom Verein der Ehemaligen des Friedenauer<br />
Gymnasiums, Herrn Dr. Dr. Wendorff, den Schwestern des „Friedenshortes" und der<br />
Gossner-Mission.<br />
Anschrift des Verfassers: Niedstraße 14, 1000 Berlin 41<br />
Aus der Geschichte der Charlottenburger Luisenkirche<br />
und ihrer Gemeinde<br />
Von Klaus Eckelt<br />
Eine der ersten Aufgaben, denen sich Philipp Gerlach (1679—1748) 1 , der spätere Hofbaumeister<br />
König Friedrich Wilhelms /., gegenübersah, war im Jahre 1708 der Auftrag zum<br />
Bau der Charlottenburger Stadtkirche. Der Platz hierfür war bereits von Eosander im<br />
Stadtplan für Charlottenburg festgelegt worden. Auf einem alten Plan steht die Bezeichnung<br />
„Neue Kirche aufm Berg". Ein Teil des Berges wurde abgetragen; mit der Erde wurden<br />
die naheliegenden Karpfenteiche aufgefüllt. Nach vielem Geldsammeln, an dem sich<br />
auch der König beteiligte, legte man 1712 den Grundstein 2 ; der Grundriß und die Fundamente<br />
der Kirche stammen noch von Gerlach. Als Friedrich Wilhelm I. an die Regierung<br />
kam, wurden die Baugelder für die Kirche gekürzt. Martin Heinrich Böhme, ein Freund und<br />
281
Schüler Schlüters, bekam den Auftrag, die Kirche in einfacherer Form weiterzubauen. Ihm<br />
wurde empfohlen, sich in der Höhe nach Martin Grünbergs Berliner Garnisonkirche zu<br />
richten.<br />
In diesem Zusammenhang sei hingewiesen auf das sehr gründliche Buch von Günther<br />
Schiedlausky über Martin Grünberg 3 , der um die Wende vom 17./18. Jahrhundert in<br />
Berlin und in der Mark als Baumeister tätig war. Grünberg baute sehr viele Kirchen, zu<br />
denen sich „deutliche Beziehungen der Luisenkirche" finden. Charakteristisch für Grünbergs<br />
Bauten ist ihre Schlichtheit. Große Ähnlichkeit hat die Luisenkirche mit seiner<br />
Johanniskirche in Dessau. Die Fassadengestaltung stimmt fast überein. ebenso die Proportionen.<br />
Bei beiden sind die Kreuzarme dreiachsig, die Mittelachse wird durch ein<br />
Risalit hervorgehoben. Kanten und Ecken werden durch Pilaster bzw. Lisenen betont, der<br />
Verlauf der Dächer ist ähnlich. Weitere Ähnlichkeiten bestehen im Verhältnis der Einzelteile<br />
zueinander. Das weit über die Hauswand vorstehende Dach ist ein weiteres Charakteristikum<br />
Grünbergs. Gerlach hat in seiner Nachfolge mit Vorliebe die übereinanderliegenden<br />
Fenster, das untere kleiner als das obere, verwendet. Gerlach und Böhme hatten<br />
sich Grünbergs Kirchenbauten zum Vorbild genommen, so daß man fast sagen kann, daß<br />
die Luisenkirche ein Werk Grünbergs ist. Da von diesem Baumeister nur noch wenige<br />
Bauten und Umbauten (z. B. das Jagdschloß Grunewald) erhalten sind (das bekannte Berliner<br />
Rathaus wurde abgerissen), sollte man darauf hinweisen. Der Dachstuhl insbesondere<br />
soll als „ein wahres Meisterstück" gegolten haben. Die Kanzel war von Hoftischler und<br />
Kirchenvorsteher Bartsch aufgeführt und soll die schönste der Kurmark gewesen sein 4 .<br />
Auf ausdrücklichen Wunsch des Königs wurde die Kirche als Simultan-Kirche gebaut (für<br />
Lutherische und Reformierte).<br />
Friedrich Nicolai erwähnt die Kirche seltsamerweise nicht. In seiner „Beschreibung der<br />
Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam" schreibt er über Charlottenburg: „Es<br />
sind in der Stadt viele schöne Gartenhäuser und Gärten befindlich, welche meist Privatpersonen<br />
in Berlin gehören, darunter sind das v. Rochowsche, Hönigsche und von Bodensche,<br />
desgleichen in Lietzen das Dietrichsche, Smidsische und Daumische Haus, vorzüglich.<br />
An dem letzteren besonders ist ein schöner Garten, worinn viele rare ausländische Pflanzen<br />
mit großen Kosten und Sorgfalt gezogen werden."' Weiter berichtet er: „Charlottenburg<br />
hatte 1785 309 Bürgerhäuser und 14 in Liezen. Darinn waren 1996 beständige Einwohner<br />
(im Sommer sind wegen der angenehmen Gegend viele Einwohner Berlins daselbst,<br />
theils in gemietheten, theils in eigenen Häusern), ausser der mit ihren Frauen<br />
und Kindern 511 Köpfe betragenden Garnison, welche in einer Schwadron der Garde<br />
du Korps bestehet." Daß Nicolai die Kirche nicht erwähnt, ist schon deshalb bemerkenswert,<br />
weil er mit dem dortigen Pfarrer Eberhard, einem berühmten Aufklärer, eng<br />
befreundet war und in dessen Haus aus- und einging (wovon weiter unten noch die<br />
Rede sein soll). Wie die alte Charlottenburger Kirche aussah, zeigt das 1762 entstandene<br />
Gemälde von Johann Gottlieb Glume 6 : an der Seite, an der heute Schinkels Turm steht,<br />
war ein mehr oder weniger verschnörkelter Giebel, darüber ein hölzerner Dachreiter.<br />
Diese Kirche war gegen Ende des 18. Jahrhunderts so baufällig geworden - zumal der<br />
Dachreiter neigte sich bedenklich -. daß eine Renovierung unbedingt nötig wurde. Hätte<br />
Karl Friedrich Schinkel, als er den Auftrag bekam, die Kirche zu renovieren und einen<br />
Turm zu bauen, genügend Geld zur Verfügung gestanden, so wäre das Ergebnis des<br />
Umbaus beinahe eine neue Schinkel-Kirche gewesen. In Gundlachs Chronik ist sein zweiter<br />
Entwurf abgebildet 7 . Das einzige, was vom alten Bau erhalten geblieben wäre, wären<br />
282
Johann August Eberhard<br />
(1739-1809)<br />
Kupferstich von<br />
Daniel Chodowiecki.<br />
1778<br />
(Ausschnitt)<br />
die beiden Fensterreihen und der Grundriß gewesen. So aber war Schinkel gezwungen,<br />
zu sparen. Das Kirchenschiff blieb - hauptsächlich außen - fast so erhalten, wie es die<br />
beiden ersten Baumeister geplant hatten. Innen hat Schinkel sehr viel mehr umgebaut;<br />
er empfahl dem König eine „Verschönerung" der Kirche; die vorhandene Kanzel bezeichnete<br />
er als plump, die Pfeiler müßten verschönert werden und anderes mehr 8 . Leider sind<br />
keine Bilder vom Inneren der Kirche vor dem Umbau überliefert. Da gespart werden<br />
mußte, blieb immerhin der Nachwelt ein charakteristischer Kirchenbau der ersten Hälfte<br />
des 18. Jahrhunderts erhalten; vielleicht ist dies heute sogar das einzige erhaltene Bauwerk<br />
dieser Art.<br />
283
Schinkel fertigte mehrere Entwürfe an. von denen wohl der dritte dann 1826 zur Ausführung<br />
kam. Der Turm wurde aus Ersparnisgründen niedriger gebaut als ursprünglich vorgesehen,<br />
was man später sehr bedauerte. Zugleich mit dem Kirchbau war ein einstöckiges<br />
Pfarrhaus entstanden, das 1826 aufgestockt wurde. Leider melden die Chroniken nicht,<br />
wer den Entwurf hierfür angefertigt hat. Überhaupt muß man immer wieder feststellen,<br />
daß die Bau- und Kunstgeschichte in den Chroniken zu kurz kommt. Hier wäre noch eine<br />
Unmenge an Stoff zu erarbeiten. So sollte einmal nach eventuellen Entwürfen und Zeichnungen<br />
von Gerlach und Böhme gesucht werden. Bei Schinkel lassen sich sicher nicht nur<br />
Zeichnungen, sondern auch Tagebucheintragungen und Briefe finden, da er mit dem damaligen<br />
Pfarrer Dressel einen Briefwechsel geführt haben soll.<br />
Auf Schinkels Empfehlung hin malte sein Freund Franz Catel ein Altarbild, das Prinz<br />
Heinrich von Preußen der Gemeinde stiftete; dieses Bild ging bei der Zerstörung der Kirche<br />
1943 verloren. Erhalten ist nur eine undeutliche Schwarz-Weiß-Aufnahme. Vielleicht<br />
finden sich in Catels erhaltenen Werken noch Entwürfe und Skizzen darüber.<br />
1904 wurde die Luisenkirche noch einmal verändert: Sie erhielt neben dem Turm zwei<br />
Anbauten, eine Attika und einen Hintereingang in Form eines halbrunden Tempels. Nach<br />
dem Krieg wurde die Kirche wieder sehr einfach aufgebaut, wobei der Turm ein Zeltdach<br />
erhielt, Hintereingang und Attika wurden weggenommen. Der Senat wollte die Ruine<br />
beseitigen; indessen hat die Gemeinde die Kirche unter großen Opfern wiederaufgebaut.<br />
Die Außenseiten sind im alten Stil erhalten bzw. wurden wiederhergestellt. Der Innenraum<br />
wurde von Hinnerk Scheper neu gestaltet. Die Fenster im Altarraum entwarf Peter<br />
Ludwig Kowalski, das Kreuz ist eine Arbeit von Gerhard Schreiter.<br />
Der eilige Wiederaufbau machte eine baldige Renovierung erforderlich. Im Jahre des<br />
200. Geburtstages der Königin Luise, 1976, der mit einem großen Gottesdienst unter<br />
Anwesenheit des Prinzen Louis Ferdinand feierlich begangen wurde, konnte endlich mit<br />
den aufwendigen Bauarbeiten begonnen werden. Eine gründliche Isolierung der Kirche.<br />
Ausbesserung des Putzes und ein Neuanstrich waren notwendig (die Feuchtigkeit war bis zu<br />
einer Höhe von 2 m gestiegen). Der Landeskonservator und die Deutsche Klassenlotterie<br />
haben die Restaurierung ermöglicht. Nun soll auch noch der Platz um die Kirche herum ein<br />
passendes Aussehen bekommen. Die unansehnlichen Blechlaternen sind bereits durch<br />
Schinkel-Leuchten ersetzt worden und ein schmiedeeiserner Zaun soll die Kirche und den<br />
Platz vor Verschmutzung und mutwilliger Zerstörung schützen. Dann wird auch der Platz<br />
selbst noch gärtnerisch ausgestaltet werden.<br />
In unmittelbarer Umgebung der Kirche sind zwei Bauwerke aus der ganz alten Zeit zu<br />
nennen: Das alte Schulhaus aus dem Jahre 1786. das vor ein paar Jahren einen neuen<br />
Anstrich erhielt, und das Haus Schustehrusstraße 13, das in einem mehr als beklagenswerten<br />
Zustand ist und dringend restauriert werden müßte. Es hat übrigens einen sehr<br />
hübschen Innenhof.<br />
In der Kirche sind aus dem 18. Jahrhundert noch eine Taufschale, zwei Kelche, eine Abendmahlskanne<br />
und eine Altarbibel erhalten. Sie sind in einer Vitrine ausgestellt.<br />
In dem Aufsatz „Theodor Fontanes Pfarrergestalten" schreibt Agnes von Zahn-Harnack:<br />
„Man trifft in den fünf die' en Bänden der .Wanderungen' Pfarrer aller Arten und Zeiten,<br />
die wunderlichsten Originale, Einfältige und SchlangenHuge, Grobe und Feine, aber den<br />
wohllebenden Pfarrer trifft man nicht." Und ein weiterer Satz: „Er [Fontane] zeigt auch die<br />
284
esonderen Schwierigkeiten seines Standes: die häufigen Spannungen mit der Gutsherrschaft,<br />
besonders in Zeiten allgemein sinkender Moral, wohl auch die Schwierigkeiten mit<br />
Küstern und Lehrern, vor allem aber die große Armut, ja den fast ständigen Kampf um<br />
das tägliche Brot, in dem man bis ins 19. Jahrhundert in den märkischen Pfarrhäusern<br />
lebte." 9 Letzteres ließe sich am Leben und Wirken des ersten Charlottenburger Pfarrers.<br />
Michael Crusius, illustrieren. In einer kleinen Geschichte Charlottenburgs ist auch noch<br />
der Teil eines Widmungsgedichtes überliefert, das den Pfarrer mit Johannes Chrysostomus,<br />
dem griechischen Kirchenvater und großen Prediger (t407). vergleicht:<br />
„Pedant - und Quäkerei sind bei ihm ausgebannt.<br />
Nichts als der Kern von Witz und wahrer Frömmigkeit<br />
Beherrschet ihn, und. dem sein güldner Mund bekannt.<br />
Der setzt Chrysostomo ihn willig an die Seit."" 1 "<br />
Crusius und seine bald verwaiste Familie lebten, dem Bericht der Chronik zufolge, in einer<br />
uns unvorstellbaren Armut. Auch seinen Nachfolgern wird es nicht anders gegangen sein.<br />
Einer davon hat sich denn auch - vergeblich - in Spekulationen versucht. Von diesem<br />
Pfarrer Erdmann wird berichtet, daß er verordnet hatte, „daß ihm seine sämtlichen Skripturen<br />
mit in den Sarg gegeben würden. Er meinte damit einige wenige Kanzelreden, die<br />
er abwechselnd der Reihe nach jahraus, jahrein gehalten hatte; die Leichenträger, welche<br />
keinen Unterschied zwischen den einzelnen Skripturen zu machen wußten, packten aber<br />
die sämtlichen Pfarrakten zusammen und legten sie ihm statt der Hobelspäne in den<br />
Sarg." 11<br />
Nachfolger dieser zwielichtigen Persönlichkeit war Johann August Eberhard (1739— 1809).<br />
dessen Name und Bedeutung weit über die Grenzen Charlottenburgs hinausgingen. Von<br />
1774 bis 1778 war er hier Pfarrer. In einem Lexikon heißt es von ihm: „In seiner 1772<br />
erschienenen Neuen Apologie des Sokrates erblickten viele eine Ketzerei und erschwerten<br />
ihm durch Kabale die Weiterbeförderung. 1774 (auf Friedrich's des Gr. ausdrücklichen<br />
Befehl), nach vielen ihm in den Weg gelegten Hindernissen, Prediger in Charlottenburg,<br />
verwandte er hier 4 Jahre seine stille Muße zu den Werken, welche Deutschland damals<br />
bewundert hat . . ." 12 Hier sind auch seine Werke aufgeführt: Die Neue Apologie des<br />
Sokrates usw. (zuerst 1772); Allgemeine Theorie des Denkens und Empfindens, eine<br />
Preisschrift (1776); Von dem Begriff der Philosophie und ihren Theilen usw., als Ankündigung<br />
der Vorlesungen (1767—1768); Sittenlehre der Vernunft (zuerst 1781); Amyntor<br />
(1782); Theorie der schönen Wissenschaften (zuerst 1783); Geschichte der Philosophie<br />
(1787- 1796); Handbuch der Aesthetik (4 Bde., 1803-1805); Versuch einer allgemeinen<br />
deutschen Synonymik (6 Th.. zuerst 1795 — 1801).<br />
Das Lexikon rühmt Eberhard als „liebenswürdigen Philosophen, klaren Denker und zierlichen<br />
Stylisten'". Von seinen Werken heißt es. daß sie „ihrer Anmuth und klaren Besonnenheit<br />
halber eine erquickliche, anregende Lecture" gewähren „und sind den Jüngern,<br />
die E. ganz vernachlässigen, sehr zu empfehlen".<br />
Als Gelehrter stand Eberhard in seiner Zeit, für uns Heutige doch recht fern. Sein philosophischer<br />
Standpunkt war „nicht originell" 13 , und sein Vortrag wurde als nicht „glücklich"<br />
bezeichnet. Er war eng befreundet mit Friedrich Nicolai, an dessen „Sebaldus Nothanker"<br />
er mitgearbeitet haben soll und der ihm 1810 einen umfassenden, sowohl persönlich wie<br />
materiell tiefschürfenden Nekrolog als „Frucht einer vieljährigen Freundschaft" widmete 14 .<br />
Auch Moses Mendelssohn gehörte zu diesem Aufklärerkreis. In einem Brief an Nicolai<br />
285
Johann Christian Gottfried Dressel<br />
(1751-1824)<br />
Punktierstich von<br />
Friedr. Wilh. Meyer<br />
(um 1820)<br />
ist zu lesen: „Ich möchte ihn [einen Hamburger Kaufmann] sprechenswürdige Menschen<br />
sehen lassen. Wollen Sie wohl. Sie und Engel 15 uns den Sonntag Nachmittags nach Scharlottenburg<br />
zu Eberharden begleiten?" 16<br />
Sicher lassen sich in den Werken Mendelssohns und Nicolais noch mehr Hinweise auf<br />
Eberhard finden. Er ging 1778 als Philosophieprofessor nach Halle, im selben Jahr, als<br />
Chodowiecki sein Porträt stach, das wir hier in einer Abbildung wiedergeben. Eberhard<br />
war ein Gegner Kants, wovon ein lebhafter Briefwechsel Zeugnis ablegt. Matthias Claudius<br />
war wohl von der „Neuen Apologie" nicht so sehr angetan, als er sie mit den folgenden<br />
Worten bedachte: „Es ist freilich eine übertriebne Toleranzgrille, die alten Philosophen<br />
ohne Unterschied zu Christen machen wollen, weil sie eine hohe Moral gepredigt haben<br />
. . ,'' 17 . In Neuausgaben von Aufklärungsliteratur kann man einzelne Schriften Eberhards<br />
wieder lesen 18 .<br />
Gerühmt wird Eberhard als ein „vom Karakter sehr vortrefflicher Mann", „der angenehmste<br />
und unterhaltendste Gesellschafter". Sein Nachfolger schreibt, Charlottenburg<br />
sei „seiner nicht werth, . . . zumahl wie es damahls war, wo unter dem gemeinen Mann,<br />
theils Schwärmerey theils völliger Unverstand zu Hause war" 19 . Da Eberhards „Rechtgläubigkeit"<br />
bezweifelt wurde, machte man ihm in der Gemeinde häufig Schwierigkeiten,<br />
und sein Nachfolger, der ihn sehr geschätzt hat. spricht von dessen „Heterodoxie". „Wie<br />
286
es doch in der Welt geht", bemerkt er, „so mancher studierter Taugenichts, der außer seiner<br />
guten Lunge nichts Empfehlendes in sich hat, bekommt oft die einträglichste Pfründe<br />
ohne alle Widerrede; mit offnen Armen gleichsam empfängt ihn seine Gemeinde bey<br />
seinem Anzüge und so ein gelehrter und achtungswerther Mann, wie Eberhard war. mußte<br />
hier sich aufdringen und alles in Bewegung setzen lassen um diese nur mittelmäßige Pfarre<br />
zu bekommen: denn sie brachte ihm höchstens 500 rth jährlich ein."<br />
Über die Familie Eberhards meldet er: „Da Eberhard keine Kinder mit sr. Franeoise<br />
zeugte und seine Frau der Geitz selber war, dergestalt, daß sie keinen Menschen eine Tasse<br />
Coffee reichte noch weniger Jemanden zu essen gab; so konnte er in der damahligen wohlfeilen<br />
Zeit, da der Scheffel Korn 18 gr galt, nicht nur mit diesem seinen Einkommen reichen,<br />
sondern noch etwas darvon zurück legen."<br />
Für Eberhard dürfte die Pfarrstelle in Charlottenburg lediglich eine Episode gewesen<br />
sein, denn sehr glücklich hat er sich hier nicht gefühlt und umgekehrt hat auch die<br />
Gemeinde nicht allzu sehr an ihm gehangen. Man könnte also seine Jahre hier nicht unbedingt<br />
als exemplarische Pfarrgeschichte beschreiben. Was an der Persönlichkeit Eberhards<br />
fasziniert, ist sein Wirken als hervorragender aufklärerischer Philosoph, in dessen Werk<br />
und Wirken das Pfarramt nur einen Platz am Rande einnimmt.<br />
Das wurde dann bei seinem Nachfolger ganz anders, der offensichtlich mit Leib und Seele<br />
Pfarrer und der Gemeinde verbunden war. Johann Christian Gottfried Dressel war von 1778<br />
bis zu seinem Tode, im Jahre 1824, Pfarrer in Charlottenburg. Hätte Fontane von ihm<br />
gehört, so hätte er diesen in vielem originellen, eigenwilligen Mann sicher irgendwo in<br />
seinen Werken erwähnt. Auch Dressel war ein eifriger und fleißiger Schreiber, jedoch nicht<br />
von hoher Gelehrsamkeit, sondern äußerst praktisch ausgerichtet. Das Schulwesen lag<br />
ihm sehr am Herzen; so ist er auch der Verfasser von pädagogischen Schriften und veranlaßte<br />
den Bau der ersten Charlottenburger Schule. Das Gebäude wurde später vergrößert<br />
(es steht in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche). Dressel ist der Verfasser der<br />
ersten Charlottenburger Chronik 20 - was vorher über Charlottenburg geschrieben wurde,<br />
ist wenig umfangreich und nur eben von einigen Außenstehenden notiert. Mit Dressel<br />
aber hat ein Charlottenburger über Charlottenburg geschrieben — übrigens sehr persönlich!<br />
Wie er denn auch die sorgfältig geführten Kirchenbücher mit privat-kritischen Anmerkungen<br />
versah. Er hatte dafür eine gesonderte Spalte reserviert, und so kann man bei einer<br />
Trau-Eintragung etwa lesen: „Sponsa ist auch weder hübsch noch klug. Sie hat eben des<br />
wegen gar nicht heyrathen wollen und hätte wohl gethan. wenn sie dabey verharrt hätte."<br />
Oder: „Sponsus ein Schafskopf/Sponsa ein häßliches aber arbeitsames Mädchen." „Sponsa<br />
ein äußerst böses Mensch; ließ mich kurz vor der Copul. durch den Küster um eine gute<br />
Traurede bitten, weil sie sich nichts Gutes versah." 21 Allein von dieser Bemerkung her ließe<br />
sich schon eine ganze Abhandlung über Traupredigten, ihre Theorie und Praxis schreiben,<br />
wobei ein Vergleich mit Fontanes Ansichten über Kasualpredigten interessant wäre.<br />
Natürlich meldet Dressel auch positive Eigenschaften seiner Pfarrkinder, aber die negativen<br />
überwiegen und sind natürlich viel amüsanter zu lesen. In der Chronik schildert Dressel<br />
seinen Kummer mit der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit, den Ärger mit Küstern und<br />
Lehrern; aber er kommentiert auch sachkundig die Arbeit des Schloßgärtners oder die<br />
Finanzierungsschwierigkeiten einer Fabrik. Er selbst war äußerst geschäftstüchtig - so<br />
knapp und arm wie bei seinen Vorgängern ging es bei ihm nicht zu. So kaufte er ein Haus,<br />
baute es um und verkaufte es gewinnbringend. Reiche Einnahmen hatte er u. a. durch<br />
seine weitberühmte Nelkenzucht. Gundlach betont seine stark materielle Gesinnung, was<br />
287
Die Luisenkirche nach dem Schinkel-Umbau (Aufnahme um 1900)<br />
auch aus Dresseis Aufzeichnungen hervorgeht. Der Magistrat schrieb: „Auch hat der D.<br />
sich zuweilen Nebenarbeiten zur Verbesserung seiner Einnahme zugelegt, die durchaus<br />
unanständig zu nennen sind." 22 Wilhelm Kraatz berichtet aus den Tagebucheintragungen,<br />
daß Dressel an gutem Essen und Trinken Freude hatte: „Höchst eigentümlich muß es bei<br />
einem Pfarrer berühren, wenn er, wie Dressel es tut, jedesmal dort, wo er von seinem<br />
Geburtstage in seinem Tagebuch spricht, auch genau mitteilt, was es alles an köstlichen<br />
Speisen und Getränken gegeben hat. Man hat das Gefühl, daß er noch beim Niederschreiben<br />
der Schilderung zehrt von dem Genüsse, den ihm das Mahl bereitet." 23 Leider ist der<br />
Verbleib dieser Tagebücher heute unbekannt.<br />
Dressel war ein äußerst unbequemer, reizbarer und streitsüchtiger Mann, der zwar nicht<br />
immer im Unrecht war, aber oft doch peinliche und unerquickliche Szenen hervorrief.<br />
Er hatte sehr viele Schwächen und Fehler; man darf deshalb nicht übersehen, daß er sich<br />
in seiner mehr als vierzigjährigen Amtstätigkeit große Verdienste um die Stadt und<br />
Gemeinde Charlottenburg erworben hat. Aufgrund seiner Aufzeichnungen und Anmerkungen<br />
- von denen vieles verloren gegangen ist - können wir uns von ihm ein besseres<br />
Bild machen als von seinen Vorgängern und Nachfolgern; das bedeutet natürlich zugleich,<br />
daß gerade auch seine Schattenseiten mannigfach zur Sprache kommen. Diese Schattenseiten<br />
schmälern jedoch nicht seine Verdienste vielfältigster Art. Nicht vergessen sein<br />
sollen seine Tagebücher, die. als Gundlach sie gesehen hat. sechs dicke Bände umfaßten -<br />
sie sind „eine unschätzbare Quelle für die Erkenntnis der Kulturzustände nicht nur am<br />
Orte, sondern auch in dem nahen Berlin, ja im Lande überhaupt" 24 .<br />
288
Die zerstörte Luisenkirchc 1946<br />
Nun wäre aus der 260jährigen Geschichte der Luisengemeinde und Luisenkirche (wobei<br />
hier auf die Geschichte der Lietzow-Gemeinde als Vorgeschichte Charlottenburgs verzichtet<br />
wurde) noch manches zu nennen. So sollen der Oberprediger Carl Kollatz (1820 —<br />
1890) und der Pfarrer Lic. Wilhelm Kraatz nicht vergessen sein. Kollatz befaßte sich mit<br />
dem Berliner Wortschatz und legte hierüber umfangreiche Sammlungen an, die u. a. von<br />
Hans Brendicke in den „Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins", Heft 33 (1897).<br />
S. 69—196, veröffentlicht wurden. Sein Grabmal auf dem alten Luisenfriedhof in der<br />
heutigen Guerickestraße war schon damals so bemerkenswert, daß es in Gundlachs<br />
Chronik abgebildet wurde 25 . Wilhelm Kraatz verfaßte zum Jubiläumsjahr der Luisenkirche<br />
1916 eine „Geschichte der Luisengemeinde zu Charlottenburg", zu der er sehr fleißig<br />
Akten und Unterlagen studierte. Diese umfassende Chronik ist äußerst gründlich und<br />
informiert nicht nur über die Pfarrer und ihre Gemeinde, sondern auch über Baukosten.<br />
Einkommen, Friedhöfe u. a. Mit Oberhofprediger Richter-Reichhelm kam noch einmal<br />
ein schreibfreudiger Pfarrer in die Luisengemeinde, dessen Bücher und Gedichte jedoch<br />
für die Geschichte der Gemeinde nicht ergiebig sind. Es gab auch noch andere Pfarrer<br />
und andere Zeiten, die das Auf und Ab der Geschichte überhaupt widerspiegeln. Manches,<br />
was in jüngster Zeit geschah und das in umfangreichem Aktenmaterial festgelegt ist.<br />
sollte besser erst von einem Chronisten späterer Generationen beschrieben werden.<br />
Auch der hier vorgelegte Abriß muß aus Zeit- und Platzgründen fragmentarisch bleiben.<br />
Ich habe mich überwiegend an das gehalten, was mir faszinierend erschien und worüber<br />
289
noch weiteres Material zu sammeln, noch weiter zu forschen und zu arbeiten wäre. Für<br />
die jetzige redaktionelle Überarbeitung und für zahlreiche weiterführende Hinweise bin<br />
ich Herrn Dr. Peter Letkemann zu großem Dank verpflichtet.<br />
Anschrift des Verfassers: Gierkeplatz 4. 1000 Berlin 10<br />
1<br />
Thieme/Becker: Allgem. Lexikon der bildenden Künstler. Bd. 13 (1920) S. 470 f.<br />
2<br />
Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin. Charlottenburg - Teil II: Stadt und Bezirk,<br />
bearb. von Irmgard Wirth. Berlin 1961. Textband S. 58 ff.. Tafelband Abb. 31 —35.<br />
' Günther Schiedlausky: Martin Grünberg, ein märkischer Baumeister vom 17./18. Jahrhundert.<br />
Burg b. Magdeburg 1942 (Beiträge zur Kunstgeschichte. VII).<br />
4<br />
Ferdinand Schultz: Chronik der Residenzstadt Charlottenburg. Charlottenburg 1887. S. 111.<br />
5<br />
Friedrich Nicolai: Beschreibung der Königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam. 3. Aufl.<br />
Berlin 1786. Bd. 3. S. 1016 f.<br />
6<br />
Abgebildet bei Paul Torge: Rings um die alten Mauern Berlins. Berlin 1939. Tafel IX. Siehe dazu<br />
auch Thieme/Becker: Allgem. Lexikon der bildenden Künstler. Bd. 14 (1921). S. 271.<br />
7<br />
Wilhelm Gundlach: Geschichte der Stadt Charlottenburg. Berlin 1905. Bd. 1. S. 461.<br />
8<br />
Wilhelm Kraatz: Geschichte der Luisengemeinde zu Charlottenburg. Ein Rückblick auf zwei Jahr<br />
hunderte. Charlottenburg 1916. S. 47.<br />
9 In: Der Pfarrerspiegel. Hrsg. von Siegbert Stehmann, Berlin 1940, S. 265.<br />
111 Schultz: Chronil der Residenzstadt Charlottenburg, S. 99.<br />
11 Ebenda, S. 4 f.<br />
12 Neuestes Conversationslexii on für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten<br />
bearbeitet. Bd. 2, Leipzig 1833. S. 432 f.<br />
13 Neue Deutsche Biographie, Bd. 4. Berlin 1959. S. 240 f.<br />
14 Siehe darüber Horst Möller: Aufklärung in Preußen. Der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber<br />
Friedrich Nicolai, Berlin 1974, S. 178 ff. (Einzelveröff. der Hist. Kommission zu Berlin. Bd. 15).<br />
15 Über Johann Jakob Engel siehe ebenda. S. 173 ff.<br />
16 Neuerschlossene Briefe Moses Mendelssohns an Friedrich Nicolai. In Gemeinschaft mit Werner<br />
Vogel hrsg. von Alexander Altmann. Stuttgart-Bad Cannstatt 1973. S. 51.<br />
17 Matthias Claudius - Werke. Stuttgart o. J.. S. 25.<br />
18 Johann August Eberhard's Neue Apologie des Socrates. In: Bibliothek der deutschen Aufklärer<br />
des achtzehnten Jahrhunderts, hrsg. von Martin v. Geismar. Leipzig 1846/47, Bd. 1 Heft IL<br />
(Fotomechanischer Nachdruck. Darmstadt 1963.) - J. A. Eberhard: Über den Ursprung der<br />
Fabel von der weißen Frau. In: Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen Monatsschrift,<br />
hrsg. von Norbert Hinske, Darmstadt 1973, S. 5 — 22.<br />
" Aus der „Rathauschronik", eine Neubearbeitung bzw. Kürzung der sog. „Pfarrchronik" von Oberpfarrer<br />
Dressel. Sie befindet sich im Rathaus Charlottenburg.<br />
20 Johann Christian Gottfried Dressel: Die Geschichte Charlottenburgs . . . , handschriftl. beg. 1813.<br />
Siehe dazu Mitteilungen des Vereins f. d. Gesch. Berlins. Jg. 1976, H. 2, S. 166 f.<br />
21 Kirchenbuch 1794—1803. im Besitz der Luisengemeinde.<br />
22<br />
Kraatz: Geschichte der Luisengemeinde. S. 90.<br />
23<br />
Ebenda. S. 93.<br />
24<br />
Gundlach: Geschichte der Stadt Charlottenburg. Bd. 1, S. 225.<br />
25 Ebenda. Bd. 2. S. 535.<br />
290
Nachrichten<br />
Die Visitenkarte der Post - 160 Jahre Poststempel in Preußen<br />
Am 23. Dezember 1816 wurden, ausgehend von Berlin, die ersten Poststempel in Preußen eingeführt<br />
für alle Sendungen nach dem „Ausland", also damals auch die übrigen Länder innerhalb Deutschlands,<br />
und bald darauf auch „für alle übrigen eingelieferten Briefe, die ab 1. März 1817 mit Ort und<br />
Datum des Abganges bestempelt werden müssen." So stand es in der Verfügung, gegeben am 7. Februar<br />
1817 durch den Königlich Preußischen General-Post-Meister Johann Friedrich von Seegebarth.<br />
Johann Friedrich<br />
von Seegebarth (1747- 1823)<br />
Königl.-Preuß.<br />
General-Postmeister<br />
Und so schreibt man allgemein 1817 als das Geburtsjahr des Poststempels in Berlin. „Zweizeiler"<br />
waren die ersten Stempel: Ort. Tag und Monat. Aber nur zehn Jahre blieb es so. denn am 1. Dezember<br />
1827 nahm die Berliner Stadtpost den Betrieb mit ihren 60 Briefsammlungen auf. Zugleich können wir<br />
seit dieser Zeit erstmalig Stempel in Kreisform auf den Briefsendungen in Augenschein nehmen.<br />
Ein noch heute wichtiges Jahr in der Berliner Postgeschichtc war 1850. Nicht nur. daß der Postbetrieb<br />
291
* t><br />
Briefaufgabestempel aus den Jahren 1821 (links) und 1865 (rechts)<br />
(Aus der Sammlung der Berliner Post- und Fernmeldemuseums)<br />
in Preußen neu geordnet wurde, auch die erste Briefmarke ist hier in diesem Jahr eingeführt worden.<br />
Zugleich wurden mit dem Tätigkeitsbeginn der Oberpostdirektion Berlin 1850 die Briefsammlungen in<br />
sog. Stadt-Post-Expeditionen umgestaltet. Seit dieser Zeit findet eine neue Form des Stempels, der<br />
sogenannte Kastenstempel, seine Verwendung.<br />
Bald ist die Stenipelinschrift vollständig. Eine Verfügung des Generalpostamts vom 27. August 1862<br />
besagt, daß künftig die Briefaufgabestempel außer der Tages- und Monatsangabe auch noch die Jahreszahl<br />
enthalten sollen. Und nun beginnen für die Sammler einige interessante Jahre. Nicht nur. daß<br />
neben den Kastenstempcin neue „Zweikreiser" mit Jahreszahl und Tageszeit, eingeteilt in Vor- und<br />
Nachmittag, in Betrieb sind, so kommt noch eine gänzlich neue - wohl die schönste - Stempelform,<br />
der sogenannte Hufeisenstempel, hinzu. Sein Stempelbild findet man auf Briefen und Postkarten<br />
zwischen 1863 und 1884.<br />
Langsam setzte sich der kreisrunde Stempel als alleinige Form durch (Verfügung Nr. 51 vom 2. August<br />
1880). Ab 1873 ist das Stadtpostgebiet nach Himmelsrichtungen eingeteilt. Ab 1875 finden wir diese<br />
Angaben vor den Amtsnummern im Stempelbild. Hinzu kam noch der Unterscheidungsbuchstabe bei<br />
mehreren Aufgabestempeln innerhalb eines Amtes. Bis auf den heutigen Tag hat sich an dieser Form<br />
nur noch wenig geändert. So sollte noch der Einführung der Postleitzahl im Stempelbild gedacht<br />
werden (Verfügung vom 6. Juni 1944).<br />
So lang die Geschichte des Poststempels aus Berlin ist. so haben auch heute noch die Hersteller der<br />
Poststempel in unserer Stadt eine entsprechend große Tradition. Sei es die Fabrikation der Handstempel<br />
durch die Firma Gleichmann in Berlin-Kreuzberg (erster Vertrag mit der Post vom 7. August 1888),<br />
später ab 1920 die Maschinenstempel der Firma Klüssendorf in Spandau, und zuletzt das besondere<br />
Gebiet der Absenderfreistempel durch „francotyp" in Berlin-Reinickendorf seit 1925.<br />
So war der Poststempel früher eben nur die „Visitenkarte" des Postaufgabeortes, heute aber ist er<br />
aufgrund seiner vielfältigen Geschichte ein begehrtes Sammelobjekt bei Postgeschichtsforschern und<br />
bei den Philatelisten. - Ein Ausschnitt aus dieser reichhaltigen Geschichte ist noch bis zu den Sommerferien<br />
bei f reiem Eintritt in einer Sonderschau im Berliner Post- und Fernmeldemuseum in der<br />
„Urania" zu sehen. Karlheinz Grave<br />
Umweltprobleme und Heimatschutz<br />
Auf dem „Zweiten Internationalen Kongreß für Heimatschutz" in Stuttgart vom 12. bis 15. Juni<br />
1912 erklärte der Sprecher der damals sogenannten „Heimatschutzbewegung", Professor Fuchs,<br />
das ganz große Problem des Heimatschutzes sei in allen modernen Kulturstaaten ein und dasselbe,<br />
nämlich der Kampf mit dem rücksichtslos das Gewordene und seine Schönheit zerstörenden<br />
technischen Fortschritt.<br />
292
Gewiß, sagte Professor Fuchs damals, bestehe nicht immer ein Gegensatz zwischen Heimatschutz<br />
und Wirtschaft, vor allem nicht zwischen Heimatschutz und Volkswirtschaft. Auch die Volkswirtschaft,<br />
die nicht nur den Gewinn des Tages, sondern auch den Bedarf der Zukunft im Auge habe,<br />
könne einen nur im privatgeschäftlichen Interesse Einzelner liegenden Raubbau nicht dulden.<br />
Allerdings gäbe es auch unbestreitbare große Interessengebiete, wo Heimatschutz und Volkswirtschaft<br />
sich entgegenstehen .. ., aber in diesem Falle habe die Volkswirtschaft, wenn man ihre Aufgaben<br />
richtig verstände, nicht allein mitzusprechen und nicht das letzte Wort!<br />
Und Professor Fuchs schloß seine Ausführungen mit der erstaunlichen Wendung: Wenn durch die<br />
Heimatschutzbewegung unzweifelhaft die nationale Differenzierung der Völker verstärkt werde,<br />
so könne dies ihren Beziehungen zueinander doch nur nützlich sein. Denn, „wer die eigene Heimat<br />
liebt und schützt, nicht in hohem, sich überhebendem Chauvinismus, sondern in verfeinerter<br />
Gesinnung und Erkenntnis ihrer kulturellen Bedeutung, wird auch die Heimat und Eigenart<br />
anderer achten".<br />
Im Umweltprogramm der Bundesrepublik vom 29. September 1971 heißt es: „Umweltpolitik ist<br />
die Gesamtheit aller Maßnahmen, die notwendig sind,<br />
um dem Menschen eine Umwelt zu sichern, wie er sie für seine Gesundheit und für ein menschenwürdiges<br />
Dasein braucht,<br />
um Boden, Luft und Wasser, Pflanzen- und Tierwelt vor nachteiligen Wirkungen menschlicher<br />
Eingriffe zu schützen und<br />
um Schäden oder Nachteile aus menschlichen Eingriffen zu beseitigen."<br />
In der 4. These dieses Programms wird darauf hingewiesen, daß der Zustand der Umwelt „entscheidend<br />
bestimmt wird durch die Technik" und daß der technische Fortschritt „umweltschonend<br />
verwirklicht werden muß".<br />
Die Bundesregierung hat, unterstützt von allen Parteien, im Jahr 1971 ein konkretes Umweltprogramm<br />
beschlossen und damit eine entscheidende Weiche gestellt: „Seitdem muß sich in der<br />
Bundesrepublik politisches und wirtschaftliches Handeln auch am Schutz einer menschenwürdigen<br />
Umwelt messen lassen." (So der Bundesminister des Innern im Vorwort zum Umweltprogramm<br />
der Bundesregierung).<br />
Die These 1 dieses Umweltprogramms lautet:<br />
„Umweltpolitik ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die notwendig sind,<br />
um dem Menschen eine Umwelt zu sichern, wie er sie für seine Gesundheit und für ein menschenwürdiges<br />
Dasein braucht,<br />
um Boden, Luft und Wasser, Pflanzen- und Tierwelt vor nachteiligen Wirkungen menschlicher<br />
Eingriffe zu schützen und<br />
um Schäden oder Nachteile aus menschlichen Eingriffen zu beseitigen".<br />
Zur Fortsetzung dieser Umweltpolitik ist eine Reihe von Gesetzen verabschiedet worden, zum<br />
Beispiel das<br />
„Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche,<br />
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge",<br />
„Gesetz über die Beseitigung von Abfällen",<br />
„Gesetz zur Verminderung von Luftverunreinigungen durch Bleiverbindungen in Ottokraftstoffen<br />
für Kraftfahrzeugmotore",<br />
„Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm",<br />
„Gesetz über die Umweftverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln".<br />
Zahlreiche Bestimmungen dieser Umweltgesetze richten sich in erster Linie an die Behörden von<br />
Bund, Ländern und Gemeinden; einige richten sich aber auch an jeden von uns. In beiden Fällen<br />
gilt die alte Regel: Mit dem Erlaß eines Gesetzes ist es noch keineswegs getan, es kommt darauf<br />
an, daß die Behörden die Gesetze richtig ausführen, und es kommt darauf an, daß die<br />
Bürger diese Gesetze als sinnvoll akzeptieren und daß sie sich aktiv an der Verwirklichung der<br />
erlassenen Gesetze beteiligen.<br />
These 5 des Umweltprogramms lautet:<br />
„Umweltschutz ist Sache jedes Bürgers. Die Bundesregierung sieht in der Förderung des Umweltbewußtseins<br />
einen wesentlichen Bestandteil ihrer Umweltpolitik."<br />
Der Deutsche Heimatbund unterstützt mit seinen regionalen und örtlichen Gliederungen alle Entwicklungen,<br />
die folgende Aufgabengebiete beeinflussen:<br />
Schutz und Pflege der Natur, auch zur Sicherung einer naturnahen Erholung,<br />
Vermeidung von unnötigem Lärm aus Straßenverkehr, Industrie und Flugverkehr,<br />
Bekämpfung von Luftverunreinigungen aus Industrie, Haushalt und Verkehr,<br />
Kampf um reine Flüsse, Seen, lebenswichtige Trinkwasser,<br />
Verminderung der Abfallmengen, ordnungsgemäße Abfallbeseitigung und größtmögliche Wiederverwertung<br />
von Abfällen,<br />
Vermeidung von Gefahren einer umweltpolitisch nicht sorgfältig vorbereiteten Kernenergienutzung.<br />
293
Er hat drei Projekte zu realisieren begonnen:<br />
1. Einen Modellversuch einer „Junge Aktion Umweltschutz",<br />
2. ein Umwelt-Seminar,<br />
3. einen Modellversuch, Arbeitsmaterialien über Umweltprobleme für den Gebrauch in der Schule<br />
herzustellen.<br />
Die Hauptarbeit liegt künftig, wie der Bundesminister des Innern im Februar 1976 schrieb, bei<br />
einer tatkräftigen Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Vereinbarungen<br />
im Alltag!<br />
(Aus einer Erklärung von Dr. Udo Klausa, Köln, dem Präsidenten des Deutschen Heimatbundes.)<br />
Berliner Kunstpreis 1977<br />
Wie alljährlich wurde der 1948 zum 100. Jahrestag der März-Revolution von 1848 vom Land Berlin<br />
gestiftete „Berliner Kunstpreis" verliehen. Er fiel in diesem Jahr den Sparten „Bildende Kunst" und<br />
„Baukunst" zu. Neben dem Berliner Bildhauer Joachim Schmettau wurde unser Mitglied, der Architekturhistoriker<br />
Julius Posener, ausgezeichnet. Er erhielt diesen Preis in Würdigung, daß er als kritischer<br />
Beobachter der Baugeschichte „immer ganz gegenwärtig geblieben ist". Seit 1971 liegt diese<br />
Preisverteilung in der Zuständigkeit der Berliner Akademie der Künste und erfolgt seither ohne Fest-<br />
Verleihung des Ullstein-Ringes 1977<br />
Für seine Verdienste um die Druckindustrie zeichnete der Bundesverband Druck e.V. am 3. März<br />
in einer Feierstunde unser Mitglied, den Verleger Axel Springer, in seinem Berliner Verlagshaus mit<br />
dem Ullstein-Ring 1977 aus.<br />
Dieser Ring ist die einzige Auszeichnung, die von der deutschen Druckindustrie vergeben wird.<br />
Mit ihr soll eine Persönlichkeit geehrt werden, die sich besondere Verdienste um diesen Wirtschaftszweig<br />
erworben hat. Unter den zahlreich erschienenen Ehrengästen aus Politik. Wirtschaft und Kultur<br />
befand sieh auch der in London lebende Verleger Frederick Ullstein, ein Enkel des Firmengründers<br />
des Ullstein-Verlages, Leopold Ullstein, und Mitglied des Kuratoriums der Rudolf-Uilstein-Stiftung.<br />
Seit Gründung dieser Stiftung vor 14 Jahren ist diese Auszeichnung bereits elf mal vergeben worden.<br />
Der Ullstein Verlag kann in diesem Jahr auf ein lüOjähriges Bestehen zurückblicken.<br />
Unser Mitglied Axel Springer ist am 22. Februar 1977 von der „Freedom Foundation" in Valley Forge.<br />
Pennsylvania, mit der American Friendship Medal ausgezeichnet worden. Bislang haben diese nur für<br />
Nichtamerikaner bestimmte Medaille erst drei Persönlichkeiten erhalten: Winston Churchill, der<br />
frühere philippinische Präsident Magsaysay und Alexander Solschenizyn. In der Laudatio wird auf das<br />
„fortwährende und klare Eintreten für die Freiheit aller Menschen" eingegangen und das an der<br />
„schändlichen Berliner Mauer" errichtete Verlagshaus als „ein Symbol für Demokratie und freies<br />
Unternehmertum" bezeichnet.<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche zum<br />
70. Geburtstag Herrn Dr. Hans Leichter; zum 75. Geburtstag Herrn Kurt Röder. Frau Elisabeth<br />
Kordes. Herrn Helmuth Engelhardt. Frau Anne Marie Behrbohm; zum 85. Geburtstag Frau Margot<br />
Krohn und Frau Else Wetzel.<br />
294
Buchbesprechungen<br />
Lieselott Enders u. Margot Beck (Bearb.): Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Teil IV: Teltow.<br />
Weimar: Böhlau 1976. 396 S.. 1 Karte. Leinen. 36.40 M. (Veröff. d. Staatsarchivs Potsdam. Bd. 13.)<br />
Reinhard E. Fischer: Brandenburgisches Namenbuch. Teil 4: Die Ortsnamen des Havellandes. Weimar:<br />
Böhlau 1976. 415 S. 5 Abb.. 4 Karten. Leinen. 44 M. (Berliner Beiträge zur Namenforschung<br />
Bd. 4.)<br />
Innerhalb einer Kurzen Zeitspanne sind in der DDR jeweils ein Band des Brandenburgischen Namenbuches<br />
und des Historischen Ortslexikons der Marl Brandenburg erschienen. Beide Bände enthalten<br />
auch Angaben zu Ortsteilen Groß-Berlins so daß nun für den westlichen Teil der Stadt (ehem. Kr.<br />
Osthavelland) und den Süden (ehem. Kr. Teltow) sowohl ein Ortsnamenbuch wie auch ein Ortslexikon<br />
vorliegt. Anlage und Intention der beiden verschiedenen Publikationsreihen sind von W. Vogel für das<br />
Ortsnamenbuch anhand des Ortsnamenbuches Teltow in den „Mitteilungen" Jg. 69 (1973), Nr. 11.<br />
S. 333 und für das Ortslexikon Havelland durch den Rezensenten Jg. 71 (1975). Nr. 1. S. 11 f. behandelt<br />
worden.<br />
Wenn auch insgesamt die Konzeption des Ortslexii ons beibehalten wurde, so gab es doch in einigen<br />
Punkten Verbesserungen. Es werden Angaben zu Kommunalverhältnissen sowie zur Wirtschafts- und<br />
Bevölkerungsstruktur - für die außerhalb Berlin (West) liegenden Orte — bis an die Gegenwart herangeführt.<br />
Der ehemalige Kreis Teltow umfaßte nahezu den gesamten Raum des späteren Groß-Berlin<br />
östlich der Havel und südlich der Spree. Besonders positiv zu bewerten sind ferner die nun lückenlosen<br />
Angaben der Besitzverhältnisse der Ritter- und Amtsgüter vom späten Mittelalter bis in das<br />
19. Jh. Hier werden z.B. im Falle Rudow und Britz, die außerordentlich komplizierten Gutsteilungen<br />
und -Vereinigungen und in anderen Fällen. z.B. Lichterfelde die rasche Aufeinanderfolge der Gutsinhaber<br />
deutlich. Auf die Entwicklung zahlreicher Landgemeinden zu Vororten Berlins wird insofern<br />
eingegangen, als das für dörfliche Entwicklungen maßgebende Schema Angaben darüber erlaubt.<br />
Wichtige Daten innerhalb dieses Prozesses, etwa der Zeitpunkt des Bahnanschlusses oder zum Beginn<br />
der Parzellierung großer Flächen, werden in der Regel nicht gegeben. Auch innerhalb des vorgegebenen<br />
Schemas werden nicht alle möglichen Angaben gemacht. So fehlt sowohl bei Treptow als auch bei<br />
Neukölln der Hinweis auf einen 1938 erfolgten Gebietsaustausch, durch den der größte Teil von<br />
Späthsfelde an den Bezirk "Treptow fiel. Für andere in Berlin (West) liegende Orte fehlt die Kenntnis<br />
neuerer Literatur zur Ortsgeschichte; so ist den Herausgebern die Arbeit von Helmut Winz über<br />
Schöneberg unbekannt geblieben. Doch ist im Ganzen auch dieser Band ein gelungener Versuch der<br />
märkischen Landesgeschichte eine erweiterte Quellenbasis zu geben.<br />
Für das Ortsnamenbuch Havelland sind im Vergleich zu den ebenfalls vorzüglichen Vorgängerbänden<br />
noch Verbesserungen zu bemerken. Hervorzuheben in diesem Zusammenhang ist die erweiterte<br />
Form, in der Klaus Grebe die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Gebietes vorstellt und zu<br />
einer Kombination von Bodenfunden und Ortsnamen wichtige Erkenntnisse - etwa über den Siedlungsbeginn<br />
und die Siedlungsdauer einzelner Plätze - beisteuern kann. Ebenfalls ausgezeichnet sind<br />
die vom eigentlichen Ortsregister getrennten namenl undlichen Abhandlungen zu den für das Havelland<br />
typischen kleinen lerritorien. Besonderes Interesse dürften die Leser der „Mitteilungen" für die<br />
Ableitung des Ortsnamens Spandau von einem polabischen, mithin slawischen Grundwort "spad<br />
„Scheffel" haben.<br />
So sind durch diese beiden Bände weitere Materialien der landesgeschichtlichen Forschung zugänglich<br />
gemacht worden. Jedem, der sich mit diesem Gebiet ernsthaft beschäftigt, seien sie wärmstens<br />
empfohlen. Felix Escher<br />
Kurt Pierson: Lokomotiven aus Berlin. Stuttgart: Motorbuch Verlag 1977. 164 S. mit 129 Abb. und<br />
Planskizzen, geb.. 32 DM.<br />
Ein weiteres Werk aus der Feder des Berliner Eisenbahnexperten Kurt Pierson hat die Dampfbahnliteratur<br />
vermehrt. Zu einer Zeit, in der zumindest in Westeuropa die Dampflokära und damit ein<br />
Stück Technikgeschichte zu Ende geht, wird hier in konzentrierter Form und ohne bloßen „nostalgi-<br />
295
sehen" Anstrich die überragende Bedeutung Berlins auf diesem Industriesektor aufgezeigt. Die Berichterstattung<br />
beginnt diesmal mit der Geburt eines kurzlebigen „Dampfwagens" von abenteuerlichem<br />
Aussehen und ebensolchen Fahreigenschaften und -leistungen. den die Königliche Eisengießerei - in<br />
der Nähe der Sandkrugbrücke gelegen - im Jahre 1815 auf die Räder gebracht hatte. Pierson schildert<br />
mit der ihm eigenen Virtuosität, den technischen Erwartungen des Fachmanns ebenso Rechnung<br />
tragend wie dem Wissensdurst des lol.alhistorisch interessierten Lesers gerecht werdend, die Gründung<br />
und Weiterentwicklung sämtlicher Berliner Lokomotivfabriken und ihrer Erzeugnisse. Die Schilderung<br />
umfaßt diesmal nicht ausschließlich das Gebiet der Dampftraktion, vielmehr erweist sich der Autor<br />
auf dem Sektor der Diesel- und elektrischen Antriebsfahrzeuge als nicht minder bewandert.<br />
In Wort und Bild werden uns die Oldtimer der Dampfwagen ebenso vorgeführt wie die schnellste<br />
Dampflokomotive der Welt, jene von Borsig im Jahre 1935 erbaute (und heute in einem Exemplar<br />
noch vorhandene) Baureihe 05. die eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h entwickelte, ebenso wie<br />
die Schnellfahr-Elektrolok von Siemens & Halske. die im fernen Jahr 1903 die 20ü-km-Marke sogar<br />
noch überschritten hat. Die Abhandlung bietet dem Leser eine umfassende Information über die<br />
wesentlichsten Typen und Modelle von Lokomotiven, die in Berliner Fabriken während des gesamten<br />
Zeitraums ihres Bestehens gebaut wurden. Auch die Fabrikation von Zugmaschinen für Klein- und<br />
Schmalspurbahnen kommt nicht zu kurz. 117 durchweg erstklassige fotografische Reproduktionen,<br />
teilweise aus dem Piersonschen Bildarchiv, bieten dem Leser auch visuell eine willkommene Texterläuterung,<br />
die durch 12 Planskizzen ergänzt wird, auf denen die Lage der einzelnen Produktionsstätten<br />
deutlich erkennbar ist. Das fotografische Bildmaterial ist durch Grundrißskizzen, zeichnerische<br />
Darstellungen sowie einige Tabellen erweitert. Das Foto der Borsigschen Fabrik in der Chausseestraße<br />
auf Seite 33 kann indessen nicht - wie angegeben - aus dem Jahre 1868 stammen, da die deutlich<br />
erkennbare Pferdebahnanlage in der Elsasser Straße erst im Herbst 1873 in Betrieb genommen worden<br />
ist.<br />
Mühselig zu interpretieren ist lediglich das Literaturverzeichnis am Schluß des Bandes infolge der völlig<br />
außer Norm und unübersichtlich gebotenen Zusammenstellung der einzelnen Angaben. Für die im<br />
übrigen ansprechende Ausstattung des Buches, die hohe Papierqualität und die gefällige, gut lesbare<br />
grafische Gestaltung gebührt dem Stuttgarter Motorbuch-Verlag der besondere Dank einer erfreuten<br />
Leserschaft. Hans Schiller<br />
Klaus Lehnartz: Bilder aus der Mark Brandenburg. Mit einer Einführung von Hans Scholz. Berlin:<br />
Stapp Verlag 1975. 16 S. u. 184 Abb. auf Tafeln. Leinen, 28 DM.<br />
Die uns seit einigen Jahren wieder zugänglich gemachte Umgebung Berlins wird in diesem Bildband<br />
in ihrer Vielgestaltigkeit vorgestellt. Ca. 40 Orte und Landschaften in allen Teilen der Mark wurden<br />
von dem Fotografen Klaus Lehnartz und seinem Begleiter, dem Schriftsteller Hans Scholz, zumeist in<br />
Schwarzweiß-Aufnahmen festgehalten. Den großen Reiz des Abbildungsteils machen nicht nur die<br />
gekonnten Aufnahmen bekannter Kunstdenkmäler und Landschaften, sondern vor allem das Einfangen<br />
der Atmosphäre, der Menschen und ihrer Umwelt aus. So besitzt der Bildband als Zeitdokument<br />
einen bleibenden Wert.<br />
Nicht in gleicher Weise befriedigen kann die Einleitung von Hans Scholz, der hier offenbar einen<br />
kulturhistorischen Überblick über die Mark und ihre Bewohner geben wollte, jedoch seinen oft wiederholten<br />
und wissenschaftlich nicht mehr haltbaren Auffassungen zum Suebenproblem und der von W.<br />
Steller aufgestellten abseitigen ..Germanentheorie" breiten Raum gewährt. Auch die Erläuterungen<br />
zu den Bildern sind nicht frei von größeren Irrtümern; so war im Fall Brandenburg (S. 12) Parduin<br />
weder ein Fischerdorf noch das „deutsche" Dorf - der Name hat sich aus „Stutzdorf" entwickelt —<br />
Keimzelle der Neustadt, und die St.-Gotthard-Kirche hat Bauteile, die wesentlich vor 1350 entstanden.<br />
Kleinere Ungenauigkeiten finden sich auch bei den an Brandenburg anschließenden Artikeln. So ist<br />
Rathenow bereits 1216 - nicht 1217 - zum ersten Mal erwähnt worden, und das Bistum Havelberg<br />
ist erst 948 - nicht bereits 946 - gegründet worden; bei der sogenannten „Gründungsurkunde" handelt<br />
es sich um eine Fälschung, der in dieser Urkunde benutzte Terminus „civitas" kann nicht mit „Stadt"<br />
übersetzt werden, womit der Hinweis auf eine „Stadt" im 10. Jh. entfällt.<br />
Diese Einwände sind jedoch nebensächlich gegenüber dem gut gestalteten Bildteil, und so sei dieser<br />
Band allen an der Mark Interessierten empfohlen. Felix Escher<br />
296
Helmut Obst: Der Berliner Beichtstuhlstreit. Die Kritik des Pietismus an der Beichtpraxis der lutherischen<br />
Orthodoxie. Witten: Luther-Verlag 1972. 151 S., geb.. 34 DM. (Arbeiten zur Geschichte des<br />
Pietismus. Bd. 11.)<br />
Zu den leider weniger beachteten Kapiteln der Berliner Kirchengeschichte gehört auch der obige<br />
Beichtstuhlstreit; zeigt er doch eine der markantesten Zäsuren des staatskirchlichen Denkens in der<br />
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.<br />
Worum ging es in dieser Auseinandersetzung? Der von der lutherischen Orthodoxie geforderte Zwang<br />
zur Einzelbeichte hatte zu einer untragbaren Verflachung der entsprechenden Praxis geführt. Dem<br />
bloßen Lippenwerk vieler Beichtender entsprach oft ein gedankenloser und oberflächlicher Absolutionsvollzug.<br />
Hiergegen wandte sich mit zunehmender Vehemenz der Prediger Johann Caspar Schade<br />
(1666—1698). Sein Protest fand leidenschaftliche Fürsprecher, aber auch Feinde. Seine unversöhnlichsten<br />
Gegner waren die Stadtverordneten und die Vertreter der Handwerkerinnungen (Gewerke).<br />
die sich auf keinerlei Kompromißvorschläge einließen. So wurden die Gegensätze immer schärfer.<br />
Auch die 1697 berufene Untersuchungskommission vermochte den Streit nicht zu schlichten, da ihr<br />
sowohl Freunde wie Feinde Schades angehörten. Schließlich griff der Kurfürst (Friedrich 111.) ein. der<br />
den umstrittenen Prediger ein Jahr später in das kleine Städtchen Derenburg (bei Halberstadt) versetzte<br />
und auch die ihm so angelasteten Konventikel in seinem Haus verbot (was Schade infolge<br />
Erkrankung und Tod nicht mehr erfuhr). Dennoch ging der gewissenhafte Prediger aus dem mehrjährigen<br />
Kampf nicht als Verlierer hervor, da der Kurfürst ihm jedenfalls in der eigentlichen Streitfrage<br />
beipflichtete. Der Zwang zur Privatbeichte wurde vom Landesherrn aufgehoben. Soviel zum<br />
äußeren Verlauf des Beichtstuhlstreites, der natürlich viel komplexer war, als sich hier wiedergeben<br />
läßt.<br />
Es ist das Verdienst der Hallenser Habilitationsschrift, die hier früher klaffende Forschungslücke mit<br />
Hilfe eines fast durchweg exakten Textapparates besser geschlossen zu haben, als es in den entsprechenden<br />
Vorarbeiten (von Lommatzsch und Simon) geschieht. Mit dem Blick des erfahrenen Historikers<br />
entwirrt Obst die komplizierten Vorgänge dieses aufwühlenden Streites und ordnet sie auch in die<br />
größeren zeitgeschichtlichen und historischen Zusammenhänge ein (vgl. S. 5. 15, 32, 66. 98 — 99. 123 —<br />
135, 140-144, 147).<br />
Dagegen vermißt man in Obsts Buch eine jeweils kurze Orientierung über den theologischen Standort<br />
der neben Schade maßgebenden Persönlichkeiten des Berliner Beichtstuhlstreites. Dieser Standort<br />
wird kaum angesprochen. Das gilt besonders von Spener und Francke. Nun mag Obst ja die Hintergründe<br />
der dogmatischen Richtungskämpfe im 17. Jahrhundert als bekannt voraussetzen - schließlich<br />
legt er eine Habilitationsschrift vor. Aber da er sich mit der Publikation dieser Schrift nicht nur an<br />
den Fachbereich einer Universität wendet, hätte ihm die Rücksicht auf den größeren Leserkreis eine<br />
wenn auch nur knappe Genesis der verschiedenen Lehrmeinungen auf dem damals so bedeutenden<br />
Kampffeld der orthodoxen und kryptoliberalen Glaubensstreiter gebieten müssen. Allerdings vermag<br />
dieser Mangel Obsts geschichtstheologische Leistung an sich kaum zu mindern. Friedrich Weichen<br />
Anna Sticker: Agnes Karll. Die Reformerin der deutschen Krankenpflege. Ein Wegweiser für heute<br />
zu ihrem 50. Todestag am 12. Februar 1977. Wuppertal: Aussaat-Verlag 1977. 240 S.. brosch.<br />
14,80 DM.<br />
Die Diakonisse Anna Sticker. Ehrendoktor der Universität Bonn, legt anhand der Briefe der Agnes<br />
Karll eine instruktive Biographie der aus Mecklenburg stammenden Krankenpflegerin vor. 1891 war sie<br />
nach Berlin gekommen. Die Briefe an die Mutter geben ein sehr plastisches Bild vom Leben im<br />
Bayerischen Viertel um die Jahrhundertwende. Die Krankenschwester schildert, wie sich die Hauskrankenpflege<br />
im Berliner Bürgertum dieser Gegend in der damaligen Zeit abspielte. Agnes Karll<br />
strebte einen unabhängigen Frauenberuf für die Krankenpflegerinnen an und berichtet über ihre<br />
Anstrengungen, die in der Reichshauptstadt auf einen fruchtbaren Boden fielen. Mit der Biographie<br />
von Agnes Karll erwarb sich Anna Sticker weitere Verdienste um die Erforschung der Geschichte der<br />
Krankenpflege; darüber hinaus legt sie auch ein Kapitel der Berliner Kulturgeschichte zur Zeit der<br />
Jahrhundertwende vor. Manfred Stürzbecher<br />
297
Ilse Kleberger: Berlin unterm Hörrohr. Berlin: arani-Verlag 1976. 91 S. mit Zeichnungen von Hans<br />
Kossatz. Pappbd., 9,80 DM.<br />
Vom selben Referenten wurde in den „Mitteilungen" Jg. 1976. Heft 2 eine Anekdotensammlung<br />
besprochen, in deren Mittelpunkt mehr oder weniger prominente Berliner Ärzte gestanden haben. In<br />
diesem Büchlein ist es umgekehrt. Hier lauscht eine Berliner Kassenärztin, was ihre Patienten über sie<br />
und ihre therapeutischen Bemühungen denken und sagen, was sie von ihren Sorgen und Problemen<br />
erzählen und wie schlagfertig sie auf unbequeme Fragen und Verordnungen reagieren. Beruhigend zu<br />
lesen, daß es den Berliner Dialekt noch gibt, und daß auch der Berliner Witz, den wir wohl dem Schuß<br />
gallischen Blutes in unserer germanisch-slawischen Grundsubstanz verdanken, noch nicht erloschen ist.<br />
Daß Kossatz, der Urberliner aus Brandenburg, dazu die richtigen Bilder gestrichelt hat. versteht sich<br />
am Rande. Von einer Frau erlauscht und zusammengestellt, kommen wir Männer doch glimpflich darin<br />
weg. Einer vereinsamten Patientin wird ein Telefon verordnet: „Ja", sagt sie. ,.'n Telefon is wirklich was<br />
Gutes, besser als 'n Fernseher - aber'n Mann ersetzt es nich!" W. Hoff mann-Axthelm<br />
Annemarie Lange: Berlin zur Zeit Bebeis und Bismarcks. Zwischen Reichsgründung und Jahrhundertwende.<br />
Berlin: das europäische buch o. J. 928 S. mit Abb. u. III., Leinen, 29.50 DM.<br />
dies.: Das Wilhelminische Berlin. Zwischen Jahrhundertwende und Novemberrevolution. Berlin: das<br />
europäische Buch o. J. 962 S. mit Abb. u. 111., Leinen. 29,50 DM.<br />
Mit den beiden 1972 bzw. 1967 im Dietz Verlag. Berlin (Ost), erschienenen Bänden setzt der Verlag<br />
„das europäische buch" die Reihe seiner unveränderten Nachdruck e von DDR-Literatur fort. In den<br />
Bänden wird ein Überblic! über die politische, \ ulturelle und öl onomische Entwici lung der Hauptstadt<br />
des Kaiserreiches gegeben. Wie auch in anderen Veröffentlichungen der Vfn. (vgl. die Besprechung<br />
des Broc' haus-Stadtführers „Berlin" in den „Mitteilungen" Jg. 70/1974, Nr. 14, S. 435 f.) wird<br />
auch hier ihr politischer Standpun' t I lar herausgekehrt. So steht die Entwich lung der Arbeiterbewegung<br />
im Vordergrund. Von der „bürgerlichen" und „höfischen" Stadt werden vor allem die Schattenseiten<br />
geschildert. Dies führt mitunter zu Schiefheiten in der Aussage und zu Unterlassungen. So wird<br />
z. B. trotz breiter Schilderungen des Berliner Wohnungselends mit all seinen - bei annten - Auswirungen<br />
von den bereits vor der Jahrhundertwende beginnenden Gegenbestrebungen nur die „Tusch-<br />
I astensiedlung" Fall enberg genannt (Das Wilhelminische Berlin, S. 467). Anderes wird als „fragwürdig"<br />
abgetan. Hervorzuheben ist die gute Ausstattung der Bände. Felix Escher<br />
Wolfgang Carle: Das hat Berlin schon mal gesehn. Eine Historie des Friedrichstadt-Palastes, nach<br />
einer Dokumentation von Heinrich Martens. (Ost-)Berlin: Henschelverlag 1975. 220 S. mit Abb.,<br />
lamin. Pappband, 9 Mark.<br />
Es begann 1865 — 67 mit dem Bau der ersten Berliner Markthalle zwischen Karlstraße und Schiffbauerdamm.<br />
Die kiez-konservativen Berliner hielten jedoch nichts von diesem Super-Markt, und<br />
das riesige Gebäude stand bald darauf leer oder wurde zweckentfremdet. 1873 öffnete es als „Markthallen-Zirkus"<br />
wieder seine Pforten, 1879 — 97 ist es das Domizil des erfolgreichen Zirkus Renz,<br />
anschließend beherbergt es als „Neues Olympia-Riesentheater" allerhand Tingeltangel, und ab 1899<br />
ist dort der Zirkus Schumann zu Hause, der sein Programm mit schwülstigen Ausstattungspantomimen<br />
und Radrennen durchsetzt. Im Jahre 1918 dann die radikale Wendung: Max Reinhardt errichtet sein<br />
„Großes Schauspielhaus", und durch den Umbau von Hans Poelzig entsteht die legendäre „Tropfsteinhöhle".<br />
1923 kurzzeitig Operettenbühne, auf der auch kommunistische Agitpropaufführungen<br />
zu sehen sind, wird das Haus schließlich zum Revuetheater unter Erik Charell. 1933 folgt der Exodus<br />
fast der gesamten Künstlerschaft, und die Nazis machen aus dem Großen Schauspielhaus das „Theater<br />
des Volkes", das sich mühsam über die Revue- und Operettenrunden quält, bis es im Bombenhagel des<br />
2. Weltkrieges ausbrennt. Im August 1945 beginnt es als „Palast-Variete" wieder ein bescheidenes<br />
Leben, zunächst noch in Privatregie, ab 1947 unter der Ägide des Magistrats und dem neuen Namen<br />
„Friedrichstadt-Palast".<br />
Dieses ist in großen Zügen die äußere Geschichte des Friedrichstadt-Palastes, einer Institution, deren<br />
Kontinuität in einer schnellebigen Weltstadt doch immerhin erstaunlich ist. Erzählt wird aber auch<br />
die „innere" Geschichte, die Schicksale der Unternehmen und ihrer Prinzipale: von Albert<br />
Salamonsky zu Ernst Renz. dessen unerbittlicher Kampf mit den Konkurrenten und schließlich 1879<br />
sein Einzug in den Markthallenbau, in dem sein Programm Weltgeltung erreicht, bis andere<br />
Etablissements - etwa der Wintergarten im Central-Hotel - ihm den Rang ablaufen. Nach ihm versucht<br />
es Albert Schumann mit dem seinerzeit künstlerisch bedeutendsten Zirkusunternehmen Europas;<br />
298
dann der geniale Zugriff Max Reinhardts, der bereits 1910 im Zirkus Schumann ein Gastspiel gab<br />
und der jetzt seine große, aber vor den ökonomischen Realitäten nicht bestehende Schauspielkunst<br />
einsetzt. Im Souterrain hatte sich das literarisch-politische Kabarett „Schall und Rauch" etabliert und<br />
gleichfalls eine Tradition begründet. Schließlich 1924 der kometenhafte Aufstieg Erik Charells und<br />
seiner Revuen und Operetten mit einmaligen Stars. Nach der „Gleichschaltung" geht den Nazis in<br />
ihrem Bemühen, die Erfolgswelle fortzusetzen, sehr rasch die Luft aus; nur noch wenige Glanzpunkte<br />
erscheinen, bis dieses „Volkstheater" in der Kriegszeit als bloße Filmkulisse endet. Nach dem erneuten<br />
Machtwechsel und dem Wiederaufbau des Hauses (bis 1951) zieht die heitere Muse wieder ein,<br />
diesmal im Verbund mit der „sozialistischen Kunst". Hauptträger des Programms wird die sog.<br />
Variete-Revue, die das scheinbar unpolitische, reine Ausstattungsstück früherer Epochen durch eine<br />
parteiische und „geschmacksbildende" Varietefolge ersetzt, die streng an einen Leitfaden gebunden<br />
ist. Das klassenkämpferische Element findet seinen Platz demnach auch in der Show unserer Tage,<br />
wenngleich die drei Grundpfeiler der klassischen Revue - Orchester, Ballett und Ausstattung - auch<br />
im heutigen Friedrichstadt-Palast durch nichts anderes zu ersetzen sind.<br />
Das Buch ist flott und konzentriert geschrieben, das Zeitkolorit ist jeweils mit sicherem Gespür<br />
eingefangen. Der letzte Teil gerät verständlicherweise in die Nähe einer Reklamefibel, mit hausgemachter<br />
Kritik durchsetzt, was jedoch der dargebotenen Informationsfülle keinen Abbruch tut.<br />
Peter Letkemann<br />
>!-<br />
Achtung! Wir bitten unsere Mitglieder, bei Wohnungswechsel die neue Anschrift umgehend der<br />
Geschäftsstelle mitzuteilen, damit der Versand der Publikationen ohne zeit- und kostenaufwendige<br />
Verzögerungen erfolgen kann.<br />
Iml. Vierteljahr 1977<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Fritz Albert. Architekt<br />
1000 Berlin 28, Am Rosenanger 14<br />
Tel. 4 01 44 83 (Weigmann)<br />
Irma Brandenburg. Hausfrau<br />
1000 Berlin 19. Westendallee 101<br />
Tel. 3 04 49 00 , (Prof. Lüders)<br />
Gertrud Dreusici e, Kauffrau<br />
1000 Berlin 33. Furtwänglerstraße 4<br />
Tel. 8 26 19 97 (Schriftführer)<br />
Rudolf Huth. Schulleiter<br />
1000 Berlin 61. Hasenheide 19<br />
Tel. 6 9184 63 (Brauer)<br />
Dieter Klatt. Postamtmann<br />
1000 Berlin 19. Am Rupenhorn 7D<br />
Tel. 3 05 35 15 (Brauer)<br />
Georg Langermeier. Kaufmann<br />
1000 Berlin 42. Rathausstraße 20<br />
Tel. 7 06 18 91 (Schiller)<br />
Prof. Dr. Fred Niedobitek. Arzt<br />
1000 Berlin 19. Waldschulallee 11<br />
Tel. 3 02 76 23 (Prof. Lüders)<br />
Margarethe Radler. Rentnerin<br />
lOOOBerlin 45. Waltroper Platz 10<br />
Tel. 7 12 31 12 (Brauer)<br />
Leonard Rautenberg. Pensionär<br />
1000 Berlin 37. Hochsitzweg 111<br />
Tel. 8 13 18 30 (Vorsitzender)<br />
Ernst Schmidt. Rentner<br />
1000 Berlin 28, Triniusstraße 5<br />
Tel. 4 04 28 45 (Horst Michael)<br />
Dr. Klaus-Joachim Schneider. Rechtsanwalt<br />
1000 Berlin 38. Elvirasteig 6c<br />
Tel. 8 01 85 79 (Frau Dr. Hoffmann-Axthelm)<br />
Elisabeth Schoenccl.cr. Rentnerin<br />
1000 Berlin 33. Dillenburger Straße 62<br />
Tel. 8 24 52 29 (Frau Wallstein)<br />
Ingeborg Schröter. Lehrerin<br />
1000 Berlin 45. Brauerstraße 31<br />
Tel. 7 72 34 35 (Frau Radler)<br />
Elisabeth Stegmann. Sekretärin<br />
1000 Berlin 31. Livländische Straße 2<br />
Tel. 8 53 81 03 (Konrad Bohnert)<br />
Bernd Stegmann. Kaufmann<br />
1000 Berlin 31. Livländische Straße 2<br />
Tel. 8 53 81 03 (Konrad Bohnert)<br />
Dr. Peter Weichardt. Geschäftsführer<br />
1000 Berlin 37. Lco-Baeck-Straße 8<br />
Tel. 8 15 15 69 (Brauer)<br />
Rudolf Weigmann. Bauingenieur<br />
1000 Berlin 52. Pannwitzstraße 45<br />
Tel. 4 14 26 03 (Brauer)<br />
Hans Wolff-Grohmann. Architekt BDA<br />
1000 Berlin 33. Max-Eyth-Straße 3<br />
Tel. 8 23 44 89 (Prof. Lüders)<br />
Dieter Zilkenat. Regierungsamtmann<br />
1000 Berlin 62. Beiziger Straße 48<br />
Tel. 7 81 51 54 (Reiner Zilkenat)<br />
299
Veranstaltungen im II. Quartal 1977<br />
1. Freitag, 15. April 1977, 12.30 Uhr: Besichtigung des Informations- und Bildungszentrums<br />
mit Mediothek und des Schaltwerkhochhauses der Siemens AG. Anschließend<br />
Kaffeetafel. Treffpun, 1 1: Bildungszentrum der Siemens AG, Berlin 13, Rohrdamm 85/86.<br />
Fahrverbindungen: Autobus 10. 55, 72, 99.<br />
2. Sonnabend, 30. April 1977, 10 Uhr: Führung zu Pflanzen des heimischen Waldes im<br />
Botanischen Garten. Leitung: Prof. Voll mar Dencimann. Treffpunkt: Eingang des<br />
Botanischen Gartens, Berlin 45, Unter den Eichen/Begonienplatz (Autobus 48).<br />
3. Dienstag, 10. Mai 1977, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Dipl.-lng, Hans<br />
Hoppe: „75 Jahre Berliner U-Bahn". Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
4. Freitag, 13. Mai 1977, 19.30 Uhr: Ordentliche Mitgliederversammlung im Pommernsaal<br />
des Rathauses Charlottenburg.<br />
Tagesordnung:<br />
1. Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes, des Kassenberichtes und Bibliotheksberichtes<br />
2. Berichte der Kassen- und der Bibliotheksprüfer<br />
3. Aussprache<br />
4. Entlastung des Vorstandes<br />
5. Wahl des Vorstandes<br />
6. Wahl von zwei Kassenprüfern und zwei Bibliotheksprüfern<br />
7. Verschiedenes<br />
Anträge aus den Kreisen der Mitglieder sind bis spätestens 3. Mai 1977 der Geschäftsstelle<br />
einzureichen.<br />
5. Dienstag, 17. Mai 1977, 19.30 Uhr: Vonrag von Herrn Dr. Friedrich Weichen: „Wittenberg,<br />
die Stadt der Reformation und Luthers Beziehungen zur Mark Brandenburg".<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
6. Sonnabend, 4. Juni 1977, Exkursion in die Lutherstadt Wittenberg und zum ersten deutschen<br />
Landschaftspan Wörlitz. Die Teilnahme an der Veranstaltung am 17. Mai ist für<br />
alle Interessenten verbindlich.<br />
7. Mittwoch. 8. Juni 1977, 17.00 Uhr: „Denkmalpflege am Beispiel des Bezirks Kreuzberg".<br />
Führung durch Landeskonservator Prof. Dr. Helmut Engel. Treffpunl t: Berlin 36,<br />
Mariannenplatz, Portal der Thomaskirche.<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothel ist<br />
zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen geselliges<br />
Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag. 29. April, 27. Mai und 24. Juni 1977, zwangloses Treffen in der Vereinsbibiiothel<br />
ab 17 Uhr.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1000 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1000 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 45 3011. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1000 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1000 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank, 1000 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1000 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Ukr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann. 1000 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Claus P.<br />
Mader; Felix Escher. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt. Bezugspreis für<br />
Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1000 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
300
flc^tbÜa^wi A 20 377 F<br />
MITTEtttfW<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
73. Jahrgang Heft 3 Juli 1977<br />
Landesarchiv Berlin<br />
Gebäudefront (Flachbau) an der Kleiststraße, Berlin-Schöneberg. Foto: Ellen Brast<br />
301
Das Landesarchiv Berlin<br />
Von Dr. Jürgen Wetzel<br />
In einer Zeit, in der alte Fassaden, das Mobiliar und Handwerkszeug unserer Vorväter<br />
wieder zu Ehren kommen, in der das Verhältnis zur Tradition und Geschichte sich zu wandeln<br />
beginnt, kommt auch der schriftlichen Überlieferung, den Zeugnissen über Leben und<br />
Wirken vergangener Generationen eine wichtige Bedeutung zu. Seit anderthalb Jahrhunderten<br />
ist es die Aufgabe der Archive, diese Zeugnisse der Vergangenheit zusammenzutragen,<br />
um sie der Forschung und den interessierten Laien zu erhalten. Man braucht nicht so<br />
weit zu gehen wie der Journalist Paul Sethe, der die Geschichtswissenschaft als „Wächter<br />
des Gewissens" bezeichnete, doch wird man ihm in der Feststellung folgen, daß sich die<br />
Gegenwart nur aus der Vergangenheit begreifen und würdigen läßt. In diesem Sinne verstehen<br />
sich die Archive als Stätten der Wissenschaft und Forschung, die mit der Bereitstellung<br />
ihrer Quellen zur Erhellung der Vergangenheit und zum Verständnis der Gegenwart<br />
beitragen.<br />
Zentrales Archiv unserer Stadt ist das Landesarchiv Berlin. Es erfaßt alle Materialien von<br />
Bedeutung für die Geschichte der Hauptstadt, bereitet das Material auf und wertet es<br />
wissenschaftlich aus. Die Übernahme von Behördenschriftgut regelt die „Gemeinsame<br />
Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung" (GGO), die in § 82 festlegt, daß alle Akten<br />
mit geschichtlichem, kulturellem oder rechtlichem Wert dauernd aufzubewahren und dem<br />
Landesarchiv zu übergeben sind. Bei der Fülle des anfallenden Schriftgutes wird strengste<br />
Auslese getroffen, bei Massenakten werden nur repräsentative Beispiele ausgewählt. In<br />
jedem Fall wird sichergestellt, daß sich künftige Generationen anhand des überlieferten<br />
Schriftgutes ein Bild unserer Zeit machen können.<br />
Die Abteilung Zeitgeschichte des Landesarchivs führt die Stadtchronik und gibt im Auftra- '<br />
ge des Senats die „Schriftenreihe zur Berliner Zeitgeschichte" heraus. Bisher sind acht<br />
Bände erschienen, darunter „Quellen und Dokumente 1945 — 1951" (Bd. 4) und „25 Jahre<br />
Theater in Berlin" (Bd. 7). Die Chronik erfaßt das erregende Geschehen der jüngsten<br />
Berliner Geschichte von den letzten Aufrufen Goebbels' zum „Widerstand um jeden Preis"<br />
gegen die vorrückende Rote Armee bis zum Chruschtschow-Ultimatum imDezemberl958.<br />
Mit seinen Aufgaben setzt das Landesarchiv die Tradition des alten Stadtarchivs fort, dessen<br />
Ursprünge als Urkunden-Depot des Berliner und Köllner Rates bis ins 14. Jahrhundert<br />
zurückreichen. Wenn es trotz vieler Anstrengungen undtrfolge dennoch Lücken in der<br />
schriftlichen Überlieferung der Stadt gibt, liegt es an der Wechsel- und leidvollen Geschichte<br />
des Berliner Archivwesens. Wie ein roter Faden ziehen sich Katastrophen und Vernachlässigung<br />
durch die Jahrhunderte, von den Rathausbränden im Mittelalter über die Archivaliendiebstähle<br />
im 18., der Raumnot im 19. und 20. Jahrhundert bis zu den Auslagerungen<br />
und Verlusten im 2. Weltkrieg. Das Stadtarchiv hat im Bewußtsein der Öffentlichkeit auch<br />
stets im Schatten des Preußischen Geheimen Staatsarchivs gestanden. Sein desolater<br />
Zustand spiegelt ein wenig die Rolle der Berliner Kommune wider, die weit hinter den<br />
Behörden des Reiches, Brandenburg-Preußens und des Hofes der Hohenzollern rangierte.<br />
Die Urkunden und Amtsbücher der Stadt lagerten bis Anfang des vorigen Jahrhunderts in<br />
einem „roten eisernen Kasten" und zwei „Spinden" auf dem Registraturboden des alten<br />
Berliner Rathauses in der König- Ecke Spandauer Straße. Nach Jahrzehnten der Vernach-<br />
302
Pergamenturkunde vom 31. Juli 1620: Kurfürst Georg Wilhelm (1620—1640) verleiht bei seinem<br />
Regierungsantritt den beiden Städten Berlin und Kölln das untere Stadtgericht „mit aller seiner<br />
Zubehörung und gerechtigkeit nichts außgenommen, was Von alters dazu gehöret hatt und noch<br />
gehöret, und wie Sie solches Von Jürgen und Hansen Tempelhoeffen erkaufft, zu rechtem Manlehen".<br />
Die Urkunde beleuchtet die speziellen Justizverhältnisse Berlins seit dem Mittelalter: Im<br />
14. Jahrhundert war die gesamte Rechtsprechung auf den Stadtschulzen (= Richter) übergegangen,<br />
der sie dann mitsamt den Einkünften im Jahre 1391 dem Berliner Rat veräußerte.<br />
Kurfürst Friedrich II. zog jedoch diese Hoheitsrechte 1448 wieder an sich; das<br />
obere Stadtgericht behielt er für sich, das untere gab er zu Lehen aus. 1536 kam es in den<br />
Besitz der Bürgermeisterfamilie Tempelhof, die es 1544 für 2250 Gulden den Städten<br />
wieder abtrat. Diese erneute Transaktion wurde vom Kurfürsten mit der Maßgabe bestätigt,<br />
daß bei jedem Regierungswechsel die Konfirmation der Belehnung vom Rat nachgesucht<br />
werden mußte.<br />
303
lässigung beschloß 1816 der Magistrat, alle noch vorhandenen Urkunden sammeln und<br />
einige Jahre später von Rendant Zander nebenberuflich ordnen zu lassen. Erst 1826 legte<br />
der erste namentlich benannte Berliner Archivar ein Repertorium (Findbuch) vor, in dem<br />
die Urkunden chronologisch aufgeführt waren. In dieser Zeit gelangte nach einer im 18.<br />
Jahrhundert begonnenen Odyssee durch verschiedene deutsche Städte die wichtigste<br />
Geschichtsquelle, das Berliner Stadtbuch, wieder ins Archiv. Zanders Nachfolger Ernst<br />
Fidicin, der sich Verdienste um die Edition Berliner Urkunden erworben hat, verpaßte<br />
1870 die Gelegenheit, dem Archiv im neuerbauten „Roten Rathaus" eine angemessene<br />
Unterkunft zu sichern. Es mußte sich wieder mit einem schmalen gewölbten Raum begnügen.<br />
Ab 1878 wurde das Institut erstmals von einem Fachmann, dem Posener Staatsarchivar<br />
Paul Clauswitz geleitet. Er beklagte in mehreren Verwaltungsberichten, wie zuvor schon<br />
Zander, den schlechten Zustand und die Raumnot des Archivs. Bis zu seinem Ausscheiden<br />
konnten deshalb so gut wie keine Alt-Registraturen übernommen werden. Die wenigen<br />
vorhandenen Bestände ordnete er unverständlicherweise nach sachlichen Gesichtspunkten<br />
und nicht nach dem längst gültigen Herkunftsprinzip. Erst Ernst Kaeber, ab 1913 Leiter des<br />
Berliner Stadtarchivs, entwickelte den Ehrgeiz, das Archiv zu einem „der Reichshauptstadt<br />
wenigstens einigermaßen würdigen Institut" auszubauen. In schwieriger Zeit gelang es ihm,<br />
neue Räume anzumieten und mehrere Mitarbeiter hinzuzugewinnen. Wichtige Bestände<br />
verschiedener Deputationen, der Grundeigentums-, der Tiefbau- und Gewerbedeputation,<br />
der Armendirektion, der Kirchen- und Schulverwaltung sowie ältere Registraturen der<br />
Stadtverordnetenversammlung konnten nun übernommen werden. Diese Phase des Ausbaus<br />
und der Konsolidierung endete im Dritten Reich mit dem erzwungenen Rücktritt<br />
Kaebers und den Auslagerungen der Bestände im 2. Weltkrieg nach Böhmen und in den<br />
Warthegau. Nach Ende des Krieges organisierte Ernst Kaeber den Wiederaufbau. Das<br />
Stadtarchiv fand nach einigen Provisorien zunächst im Ermeler-Haus, dann im gegenüberliegenden<br />
Marstall am heutigen Marx-Engels-Platz eine neue Unterkunft. Mitte der<br />
fünfziger Jahre kehrte das ausgelagerte Aktengut nach Ost-Berlin zurück.<br />
Inzwischen war während der Blockade die administrative Spaltung Berlins erzwungen worden.<br />
Am 1. Dezember 1948 nahm der Magistrat seine Amtsgeschäfte für die Westhälfte im<br />
Schöneberger Rathaus auf. Zum selben Zeitpunkt begann auch das Stadtarchiv der neuen<br />
Verwaltung zu arbeiten. Ernst Kaeber, der mit zwei Mitarbeitern den Ostsektor verlassen<br />
hatte, fing in einem Kurfürstendamm-Hotel zum zweitenmal am Nullpunkt an. Alle im<br />
Krieg geretteten Archivalien verblieben jenseits des Brandenburger Tores. Die Anfänge<br />
waren kläglich. Zunächst werteten die Archivare nur Ost- und West-Zeitungen aus. Erst<br />
allmählich konnte durch Aktenübernahmen und Ankauf von Sammlungsstücken der<br />
Grundstein des neuen Archivs gelegt werden. Nach Zwischenstationen im Hotel Tusculum,<br />
im Deutschland-Haus und im Dahlemer Staatsarchiv fand das Landesarchiv Berlin - so die<br />
amtliche Bezeichnung seit 1951 - für zwei Jahrzehnte eine Unterkunft im Ernst-Reuter-<br />
Haus. Aber auch dort waren Lagerungs- und Arbeitsmöglichkeiten begrenzt. 1976 konnte<br />
das Landesarchiv endlich einen seiner Bedeutung entsprechenden Neubau, der nach archivischen<br />
Gesichtspunkten um- und ausgebaut wurde, in der Kalckreuth- Ecke Kleiststraße<br />
beziehen. In klimatisierten und durch C02-Feuerlöschanlagen gesicherten Magazinen können<br />
jetzt die Archivalien fachgerecht gelagert werden. Ein großer Benutzersaal, ein Lesegerät-<br />
und ein Schreibmaschinenraum gewährleisten eine optimale Besucherbetreuung.<br />
Dem breiten Publikum kann das Landesarchiv in einem speziellen Saal seine Bestände in<br />
wechselnden Ausstellungen präsentieren. Dieser Saal sowie ein größerer Vortragsraum<br />
304
dienen der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit. Das Archiv ist jetzt auch in der Lage,<br />
beschädigte Archivalien und Bücher in einer eigenen, mit neuesten Maschinen ausgerüsteten<br />
Werkstatt zu restaurieren und braucht sie nicht mehr gegen hohe Kosten an Privatfirmen<br />
zu vergeben. Die gesetzlich vorgeschriebene Sicherungsverfilmung der wertvollsten<br />
Bestände wird in modernen Fotolabors vorgenommen.<br />
Wer heute im Landesarchiv eine Spitzweg-Idylle erwartet, wird enttäuscht sein. Das Archiv<br />
305
ist ein lebendiger Organismus, in dem alle technischen und organisatorischen Möglichkeiten<br />
zum Wohl der Berliner Geschichtsforschung ausgenutzt werden.<br />
Alle jetzt im Landesarchiv deponierten Bestände aus den Jahren vor 1945 lagerten bei<br />
Kriegsende schon auf West-Berliner Boden, in den Rathäusern der Bezirke, in den Amtsgerichten<br />
und den Dienstgebäuden von Zentralbehörden. Unter ihnen befanden sich die<br />
Akten der Preußischen Bau- und Finanzdirektion, die ihren Sitz in der Invalidenstraße<br />
hatte. Neben dem Polizeipräsidium gehörte sie zur wichtigsten staatlichen Behörde Berlins.<br />
Sie war für die Errichtung und Unterhaltung der Staatsbauten, für die Kataster-, Tiergarten-<br />
und Domänenverwaltung sowie für die Zivilgehalts- und Hinterbliebenenangelegenheiten<br />
zuständig. In der Plankammer der Preußischen Bau- und Finanzdirektion befinden<br />
sich seltene Pläne, Karten und Stiche aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die häufig bei dem<br />
Wiederaufbau oder der Restaurierung beschädigter Bauten herangezogen werden.<br />
Vom ehemaligen Polizeipräsidenten befinden sich neben einigen Aktenbeständen circa<br />
10 000 Theaterzensurexemplare im Landesarchiv. Diese Bühnentextbücher enthalten<br />
Streichungen, Genehmigungs- bzw. Verbotsvermerke der staatlichen Zensoren und bilden<br />
mit drei neu erworbenen Privatsammlungen, dem Nachlaß Günter Neumann, der Matthesund<br />
der Körner-Sammlung eine wichtige Quelle für die theaterwissenschaftliche Forschung.<br />
Der Zeithistoriker findet interessantes Material im Bestand „Stadtpräsident der Reichshauptstadt<br />
Berlin" mit verschiedenartigen Akten aus dem Dritten Reich, u.a. Enteignung<br />
jüdischen Grundbesitzes, Straßenbaupolizei, Kriegssachschäden, Luftschutz- und Wohnungswesen.<br />
Von den Amtsgerichten, vor allem vom Amtsgericht Schöneberg, sind Notariats-Registraturen<br />
mit Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit übernommen worden. Sie enthalten eine<br />
Fülle von Handels- und Industrieverträgen der letzten 100 Jahre. Das Amtsgericht Charlottenburg<br />
übergab zahlreiche Vereinsakten, das Amtsgericht Spandau Testamentsakten,<br />
die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Der wertvollste Bestand aus dem Justizbereich<br />
ist der des preußischen Generalstaatsanwalts mit Material über die Parteien, vor allem über<br />
die NSDAP und deren Gliederungen, über die NS-Größen und die SA, über Kommunisten,<br />
über Beleidigungen gegen Repräsentanten der Republik, über Korruptionen und Skandale,<br />
über Juden, Grenzkämpfe, Unruhen und Streiks, über Wirtschaftsverbrechen und Sensationsprozesse.<br />
Dieser Bestand vermittelt ein eindrucksvolles Bild von den politischen,<br />
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Weimarer Zeit.<br />
Über die Verwaltung der ehemals selbständigen Kommunen Spandau, Steglitz und Wilmersdorf<br />
geben Bestände aus dem vorigen Jahrhundert Auskunft. Von den übrigen Berliner<br />
Bezirken, vor allem von Kreuzberg, Tiergarten und Charlottenburg befinden sich<br />
wertvolle Akten der Bauaufsichtsämter im Archiv. Sie vermitteln dem Historiker, aber<br />
auch dem Denkmalpfleger, dem Architekten und Soziologen interessante Aufschlüsse über<br />
die Besitzverhältnisse und den baulichen Zustand von Berliner Häusern. Ähnliche Aufschlüsse<br />
sind von den Grundbüchern des Amtsgerichts Mitte und den Katasterbänden der<br />
Feuersozietät zu gewinnen, die teilweise bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zurückreichen.<br />
Inzwischen sind auch zahlreiche Registraturen der Nachkriegszeit von den Senats- und<br />
Bezirksverwaltungen ins Archiv gelangt, darunter größere Bestände der Senatskanzlei, der<br />
Senatsverwaltungen für Inneres und Wirtschaft sowie des Polizeipräsidenten. Diese Bestände<br />
werden den Besuchern nur in Ausnahmefällen mit Zustimmung der abgebenden Behörde<br />
vorgelegt. Im allgemeinen wird vor der Freigabe der Akten eine 30-Jahres-Frist einge-<br />
306
halten. Alle Akten werden nach dem Provenienz- oder Herkunftsprinzip gelagert, einem<br />
Ordnungssystem, das Bände und Bestände gleicher Behördenherkunft beisammen läßt und<br />
sie nicht nach Pertinenz- oder Sachzugehörigkeit aufsplittert. Dieses System hat sich seit<br />
rund 100 Jahren in den deutschen Archiven bewährt; es ermöglicht einen schnellen Zugriff<br />
und gewährt den besten Überblick.<br />
Wie jedes Staatsarchiv legt auch das Berliner Institut Wert darauf, die Entwicklung seines<br />
Gebietes an Hand von Karten und Plänen zu dokumentieren. Seine Plankammer enthält<br />
umfangreiche Kartensammlungen, angefangen beim ältesten bekannten Berliner Stadtplan<br />
des kurfürstlichen Baumeisters Memhardt aus dem Jahre 1648 bis zu den jüngsten Landaufnahmen<br />
des Senators für Bau- und Wohnungswesen. Die Karten und Pläne bilden zu<br />
den im Archiv lagernden Akten die erforderliche Ergänzung.<br />
Angesichts der Lücken in der schriftlichen Überlieferung ist das Landesarchiv um die<br />
Beschaffung von Sekundärquellen, vor allem von Zeitungen und Büchern, bemüht. In den<br />
letzten Jahren konnte es seine Zeitungssammlung zur größten auf Berliner Boden ausbauen.<br />
Neben Originalbänden sind viele Zeitungen auf Mikrofilmen vorhanden. Die<br />
Bestände setzen mit den beiden ältesten Berliner Zeitungen, der Vossischen und der<br />
Haude-Spenerschen, um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein und reichen bis in die Gegenwart.<br />
Von den rund 120 Titeln sollen hier nur die wichtigsten genannt werden:<br />
Vossische Zeitung 1725 -1934<br />
Haude-Spenersche Zeitung 1763 — 1849<br />
Nationalzeitung 1848 -1910<br />
Kreuzzeitung 1848-1939<br />
Berliner Volkszeitung 1853 -1944<br />
Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1866 — 1918<br />
Germania 1871-1938<br />
Die Jüdische Presse 1872 -1923<br />
Vorwärts 1891-1933<br />
Tägliche Rundschau 1894 -1896<br />
1914-1933<br />
Berliner Illustrierte Zeitung 1895 -1945<br />
Berliner Börsen-Courier 1895 —1933<br />
Berliner Tageblatt 1895 -1939<br />
Simplicissimus 1897 — 1944<br />
Berliner Lokal-Anzeiger 1906-1944<br />
Die Rote Fahne 1918-1933<br />
Jüdische Liberale Zeitung 1920-1945<br />
Völkischer Beobachter 1927 - 1945<br />
Die angegebenen Jahre bei einigen Titeln sind nur Grenzjahre, innerhalb deren erhebliche<br />
Lücken bestehen können.<br />
Die Bibliothek des Landesarchivs enthält ausschließlich Berolinensien und bietet mit ihren<br />
32 000 Bänden gute Auskunftsmöglichkeiten. Vorhanden sind auch die Stenographischen<br />
Berichte der Stadtverordnetenversammlung von 1878 bis 1935 und die Berichte der Stadtverwaltung<br />
seit 1829.<br />
Den Besuchern sind ferner Sammlungen brandenburg-preußischer Edikte, Gesetze und<br />
Verordnungen, die Preußischen Staatshandbücher (1795 bis 1939), Adreßkalender für die<br />
Residenzstädte Berlin/Potsdam/Charlottenburg (1720 bis 1918), die Stadtadreßbücher<br />
des 19. und 20. Jahrhunderts sowie eine umfangreiche Sammlung der neuesten Amtsdrucksachen<br />
des Landes Berlin zugänglich.<br />
Insgesamt lagern im Archiv auf einer Magazinfläche von 2900 m 2 rund 50 000 Aktenpakete,<br />
32 000 Bücher, 4000 Karten und Pläne, 3500 Filmrollen und 3000 Zeitungsbände.<br />
Das Landesarchiv Berlin ergänzt laufend seine Bestände durch Ankäufe auf Auktionen<br />
und von Privathand. Auf diese Weise erfährt vor allem die Autographen-Sammlung so<br />
manchen wertvollen Zugang. Das Archiv besitzt bereits viele Handschriften Berliner Persönlichkeiten,<br />
u.a. von Humboldt, Fontane, Liebermann, Menzel und Zille. Reizvolle<br />
Berlin-Ansichten auf Postkarten, Kupfer- und Stahlstichen aus dem 17. bis 20. Jahrhundert<br />
befinden sich in der Bildersammlung.<br />
307
1962 wurde dem Landesarchiv das Ernst-Reuter-Archiv eingegliedert. Es enthält eine<br />
Dokumentation über das Leben des früheren Regierenden Bürgermeisters (1889—1953)<br />
und diente als Fundament für die Reuter-Biographie von Brandt/Löwenthal. Das Archiv<br />
bemüht sich auch um die Übernahme von Nachlässen prominenter Berliner. Es besitzt<br />
bereits eine Vielzahl von Nachlässen, darunter die der Politiker Hans E. Hirschfeld, Otto<br />
Suhr (über die in früheren „Mitteilungen" berichtet wurde) und Siegmund Weltlinger, aus<br />
dem kulturellen Bereich die der Verlegerfamilie Nicolai-Parthey und des Schriftstellers<br />
Adolf Glassbrenner.<br />
In den letzten Jahrzehnten sind in allen Archiven - so auch im Landesarchiv — Zeitgeschichtliche<br />
Sammlungen eingerichtet worden. Sie versuchen das nichtstaatliche Schriftgut,<br />
das Schriftgut von Parteien und Verbänden zu erfassen, um die Überlieferung auch dieser<br />
Gesellschaftsgruppen, die ja wesentlich das öffentliche Leben mitbestimmen, zu sichern<br />
und der Nachwelt zu übermitteln. Gesammelt werden Handzettel, Aufrufe, Plakate, Broschüren,<br />
Druckschriften, Propagandamaterial und vor allem Flugblätter der Studentenbewegung.<br />
In den fast drei Jahrzehnten seines Bestehens hat sich das Landesarchiv zur umfassenden<br />
Dokumentationsstätte für die Berliner Geschichte entwickelt. Steigende Besucherzahlen,<br />
zahlreiche Anfragen aus der Bundesrepublik Deutschland und dem Ausland zeugen von<br />
dem lebhaften Interesse an der historischen Entwicklung unserer Stadt.<br />
Die Leitung der Preußischen Archivverwaltung<br />
Von Georg Winter (f)<br />
Herausgegeben und ergänzt von Eckart Henning<br />
Anschrift des Verfassers: Grüner Weg 77,1000 Berlin 47<br />
Die hier vorliegende kleine Arbeit von Georg Winter war ursprünglich nicht zur Veröffentlichung<br />
bestimmt, sondern ist, wie man dem erhalten gebliebenen Begleitschreiben<br />
vom 23. Februar 1939 entnehmen kann, „auf Anweisung des Generaldirektors Dr. Zipfel"<br />
für Ministerialdirektor Dr. Gramsch im Preußischen Staatsministerium angefertigt worden,<br />
der es freilich noch am gleichen Tage nach mehr oder weniger eingehender Lektüre für<br />
„erledigt" erklärte und „zu den Akten" schrieb. Da Winters Aufsatz, der vom Geheimen<br />
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem noch heute im Aktenbestand des<br />
Preußischen Staatsministeriums verwahrt wird 1 , mehr als eine bloße „Liste der früheren<br />
Direktoren und Generaldirektoren der Archivverwaltung" darstellt — wie es untertreibend<br />
im Begleitschreiben heißt —, sondern in der Tat, wie die Manuskriptüberschrift verspricht,<br />
einen ausgezeichneten behördengeschichtlichen Überblick über die „Leitung der preußischen<br />
Archivverwaltung" bietet, soll er den Teilnehmern des 51. Deutschen Archivtages<br />
1977 in Berlin zur Begrüßung vorgelegt werden. Da noch immer manche von ihnen ihre<br />
berufliche Laufbahn als preußische Beamte begonnen haben, oder doch, soweit sie einer<br />
jüngeren Generation von Archivaren angehören, wie z.B. der Herausgeber, heute vielfach<br />
308
mmmmmmmmmm
U /• Nr. 9682 DER TAGESSPIEGEL i BERLINER TEIL SONNTAG, 31. JULI 1977,<br />
mm<br />
men und in. den Warthegau geendet. Nach En-<br />
Stets im Schatten des Preußischen Staatsarchivs ide des Krieges habe Kaeber den Wiederaufbau<br />
organisiert. Das Stadtarchiv'fand nadi ei<br />
Erst nach 1910 begann eine systematische Arbeit im Landesarchiv Berlin — Ausstellung in den neuen Räumen nigen Provisorien zunächst im Ermeier-Haus,<br />
Wann im gegenüberliegenden Marställ am heu<br />
Vom 19. bis zum 22. September findet in leute, um Pläne einzusehen. Im Besitz des gegen Jdie vorrückende Rote Armee bis zum<br />
West-Berlin der 51. Deutsche Ardiivtag statt Landesarchivs sind auch die Restaurierungstigen<br />
Marx-Engels-Platz eine neue Unterkunft;,<br />
Chruschtschow-Ultimatum in» Dezember 1958",<br />
400 Facbarchtvare werden erwartet. Veranstalpläne für das Brandenburger Tor,<br />
schreibt der Autor. / * '-<br />
Mitte der 50er Jahre kehrte das ausgelagerte<br />
tet wird die Tagung vom Geheimen Staatsarchiv<br />
Preußischer Kulturbesitz (Archivstraße in Fontane-Briefe in einer Vitrine<br />
Mit seinen Aufgaben setzt das Landesardiiv<br />
iAktengut nach Ost-Berlin zurück. .<br />
Dahlem) und dem Landesardiiv Berlin In der<br />
die Tradition des alten Stadtarchivs fort, des Zunächst nur Zeitungen ausgewertet<br />
Bis-zum Oktober findet im Parterre des Hau-<br />
Kaldsreutbstrane 1-3 in Schöneberg. Gesen<br />
Ursprünge als Urkuiiden-Depot-vdas Beridunückt<br />
ist die Einladung mit dem Brandenses<br />
ah der KalckreuthsH4ße^e^ * " .<br />
. Inzwischen war es zur Spaltung Berlins gekommen.<br />
Ende 1948 begann auch das Stadtarburger<br />
Tor, einer Lithographie von A. Carse, lung—j ein Querschnitt durcTrdte Berliner Ge<br />
die im neuen Haus des Landesarchivs zu den<br />
schichte; —- statt. Zu sehen sind unter anderem hundert zurückreichen. Dennoch seien.Lücken chiv der neuen westlichen Verwaltung zu ar<br />
geständen sfehßrt.<br />
die erste Ausgabe,der Vossischen Zeitung im vorhandßnr schreibt Wetzel, das liege an der beiten. Wie Jürgen Wetzel in diesem Zusam<br />
Format eines normalen Buches, Unterlagen Wechsel- und leidvollen'Geschichte des Berlimenhang berichtet, sei Ernst Kaeber „mit ei-<br />
'• Wie berichtet, haben sich die Mitarbeiter und Fotos des Schuhmachers Wilhelm Voigt, ner Archivwesens. Wie ein icter Faden zögen Jier Handvoll Archivaren" nach West-Berlin<br />
des Landesarchivs in dem ursprünglich als Ber der dann dar „Hauptmann von Köpenick" wur sich mißliche Umstände wie Rathausbrände im<br />
igekommen. Im Kurfürstendamm-Hötel fing er<br />
lin-Center deklarierten Bürohauskomplex an de. Auch Briefe von Theodor Fontane und<br />
zum zWeiten Male beim Nullpunkt an. Alle<br />
Mittelalter-r" Archjvaliendiebstfihle im 48.,<br />
der Kleiststraße in dem viergeschossige» Adolf Glaßbrenner liegen in einer Vitrine.<br />
im Krieg geretteten Akten blieben im Osten.<br />
Raumnot im 19, und 20. Jahrhundert bis zu<br />
Flachbau an der Ecke Kalckreuthstraße im Ök-i Diwe "Ausstellung ist montags bis' freitags<br />
(Zunächst Werteten die Archivare in West-Ber<br />
den Auslagerungen und Verlusten im zweiten<br />
iwüöi vorigen Jahres eingerichtet. Was dort! von 8 Uhr 30 bis 15 Uhr qeöffnet.<br />
lin nur Ost- und West-Zeitungen aus. Erst all<br />
Weltkrieg durch die Geschichte des Archivs. mählich wurde durch Aktenübernahmen und<br />
als Tiefgarage geplant war» wurde zu Maga In den (.Mitteilungen des Vereins für die Außerdem habe, so Wetzel, das Stadtarchiv Ankauf von Sammlungssrüdceri der Grundstein<br />
zin-Räumen. Vorher war das Landesardiiv im<br />
Ernst-Reuter-Haus an der Straße des 17. Juni<br />
Geschichte Berlins" (gegründet .18651, Heft 3 im Bewußtsein der Öffentlichkeit auch stets für das neue Archiv gelegt. Nach Zwischenstä-<br />
untergebracht.<br />
Vom Juli 1977, hat Dr. Jürgen.'' Wetzel einen im Schatten des Preußischen Geheimen Staatstionen im Hotel" Tusculum, im Deutschland-<br />
Bericht über die Geschichte -des Landesarchivs archivs gestanden. „Sein desolater, Zustand Haus und im Dahlemer Staatsarchiv fand, das<br />
Wie Ärchivrat Dr. J. W e t z e 1 vom Lan Berlin veröffentlicht. , Es ist das zen spiegelt ein wenig die Rolle der Berliner Kom<br />
Landesardiiv Berlin — so die amtliche Bezeichnung<br />
seit 1951 — für zwei Jahrzehnte<br />
desardiiv sagt, ist der Umzug ein rechtes trale Archiv unserer 'Stadt; hier werden alle mune wider, die weit hinter den Behörden des Unterkunft im Ernst-Reuter-Haus.<br />
1 anmut-Unternehmen gewesen. In diesem Materialien von Bedeutung für die Geschichte Reiches, Brandenburg-Preußens und des Hofes<br />
Jaar wurden im neuen Haus auch schon 500<br />
Besucher mehr registriert als im gesamten vo<br />
Berlins gesammelt und dann wissenschaftlich der Hohenzöllem rangierte."<br />
Im Herbst 1976, im Neubau endlich, entsprach<br />
rigen. Jahr. Grundsätzlich ist das Archiv Jeder ausgewertet. Die Abteilung Zeitgeschichte des Auslagerungen im Krieg<br />
alles den archivarischen Gesichtspunkten. Die<br />
mann zugängüa,- aber das Schwergewicht Landesafchivs führt die Stadtchronik; sie gibt<br />
Magazine sind klimatisiert; sie verfügen, wie<br />
liegt nach Auskunft von Dr. Wetzel bei der im Auftrag des Senats „Die Schriftenreihe -zur<br />
Erst Ernst Kaeber, seit 1913 Leiter des berichtet, über Kohlendioxvd-Feuerlöschaiila-<br />
Stadtarchivs, habe den Ehrgeiz entwickelt, das<br />
Forschung. Es kommen beispielsweise Archi Berliner Zeitgeschichte" heraus, von der bis Archiv zu einem „der Reichshauptstadt weniggen,<br />
so daß jetzt alles fachgerecht gelagert<br />
tekten, Denkmalpfleger und Historiker. Das her acht Bände erschienen sind. „Die Chronik stens würdigen Institut" "-auszubauen. Diese werden kann. Ein großer Benützersaal, ein Le<br />
Archiv verfügt über wertvolle Bauakten und erfaßt das erregende Geschehen der jüngsten Phase habe bei den Nazis mit dem erzwungesegerät und ein Schreibmaschinenraum ge<br />
Darstellungen von Fassaden aus allen Bezir Berliner Geschichte von den letzten Aufrufen nen Rücktritt Kaebers und den Auslagerungen währleisten jetzt, so Dr. Wetzel, eine „optimaken.<br />
Auch aus Ost-Berlin koamen öfter Fach Goebbels' .zum Widerstand, um jeden Preis' der Bestände im zweiten Weltkrieg nach Böhle Besucherbetreuung". . ' - hp<br />
Historisches auf dem Bildschirm. Die Vossische<br />
Zeitung vom*9. November 1923, die mit dem<br />
„Zusammenbruch des Ludendorff-Putsches"<br />
aufgemacht hatte, ist im Landesarchiv auf Mikrofilm<br />
enthalten. Auf dem Lesegerät kann<br />
der Benutzer dann die Zeitung lesen.<br />
Fotoi-von Waldütausen<br />
%
Karl Georg v. Raumer Georg Wilhelm v. Raumer Wilhelm Karl v. Lancizolle<br />
in Staatsarchiven mit preußischer Tradition ihren Dienst versehen, mag diese Zusammenstellung,<br />
nicht zuletzt auch wegen ihres Autors, ihr Interesse finden.<br />
Als Georg Winter (1895 — 1961) diese Arbeit abfaßte, war er bereits seit einem knappen<br />
halben Jahr als Staatsarchivdirektor und Referent in der Archivabteilung des Preußischen<br />
Staatsministeriums tätig 2 , in das ei* schon zwei Jahre zuvor zur Unterstützung des Generaldirektors<br />
als kommissaristirfer Sachbearbeiter eingetreten war 3 . Seine gründlichen Kenntnisse<br />
verdankt Winter noch der Ausbildung, die ihm im alten Geheimen Staatsarchiv in der<br />
Berliner Klosterstraße zuteil wurde, wo er von 1921 — 1922 am Lehrgang für den wissenschaftlichen<br />
Archivdienst teilnahm und am 6. 12. 1922 die Archivarische Staatsprüfung<br />
ablegte. Auch als junger Archivassistent (12. 12. 1922) und späterer Staatsarchivrat<br />
(1. 10. 1927) war es Winter vergönnt, in Berlin zu bleiben. 1930 übertrug ihm Albert<br />
Brackmann als Generaldirektor der Preußischen Staatsarchive die Geschäftsführung seines<br />
neugegründeten „Instituts für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung"<br />
(IfA) in der Dahlemer Archivstraße 4 , die er bis zu seinem Wechsel in die Dorotheenstraße.<br />
wo damals die Archivabteilung des Preußischen Staatsministeriums untergebracht<br />
war, besorgt hat. Doch auch später blieb Georg Winter dem Geheimen Staatsarchiv-<br />
Verbünden, das er nach Kriegsende vorübergehend vom 16. 6.— 18. 7. 1945 kommissarisch<br />
leitete und das seiner Fachaufsicht auch noch unterstand, als er Direktor (1952 — 60) des<br />
in Koblenz neugegründeten Bundesarchivs geworden war.<br />
Durch die Verordnung vom 27. 10. 1810 5 wurde „das Archiv" der unmittelbaren Leitung des<br />
Staatskanzlers unterstellt, und zwar auf persönliche Veranlassung Hardenbergs entgegen<br />
dem ursprünglichen Vorschlag, es dem Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten anzugliedern.<br />
Die Sachbearbeiter für das Archiv und Archivfragen überhaupt waren der WirklficheJ<br />
Geheime Legationsrat Karl Georg von Raumer, geb. 16. 11. 1753, und der Regierungsrat<br />
Gustav Adolf Tzschoppe, geb. 22. 8. 1794.<br />
309
Max Duncker Heinrich v. Sybel Reinhold Koser<br />
Nach dem Tode des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg bestimmte die Kfabinetts-]<br />
OfrdreJ vom 30. 4. 1823, daß die bisher unter der unmittelbaren Oberaufsicht des Staatskanzlers<br />
erfolgte Bearbeitung der das Geheime Archiv betreffenden Angelegenheiten dem<br />
gesamten Staatsministerium verbleiben sollte in der Art, daß die spezielle Bearbeitung dem<br />
Minister des Königlichen Hauses und dem Minister für die Auswärtigen Angelegenheiten<br />
gemeinsam übertragen würde.<br />
Die Archivangelegenheiten zerfielen in 2 Gruppen:<br />
l. betr. das Geheime Staatsarchiv und das Archivkabinett<br />
IL betr. Archive und Archivstücke in den Provinzen.<br />
Die genannten beiden Minister teilten demgemäß dem Oberpräsidenten [= Präsidenten des<br />
Staatsministeriums] unter dem 26. 5. 1823 mit, daß ihnen die „Leitung des Archivwesens"<br />
gemeinschaftlich übertragen sei. Die eigentliche Leitung des Geheimen Staatsarchivs und<br />
damit der Archivsachen überhaupt lag in der Hand Karl Georgs von Raumer, gest. 30. 6.<br />
1833 als Wirklicher] Gehfeimer] Rat, Exzellenz, Direktor des Geheimen Staatsarchivs 6 .<br />
Sein „vortragender Rat im Geheimen Staatsarchiv" war Gustav Adolf Tzschoppe, zugleich<br />
vortragender Rat (Regierungsrat) im Staatsministerium.<br />
Die Leitung des Geheimen Staatsarchivs wurde als ein Nebenamt wahrgenommen; Raumer<br />
war im Hauptamt vortragender Rat im Staatsministerium, im Ministerium des Königlichen<br />
Hauses und im Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten.<br />
Seit 1831 ist von einem „Direktorium der Staatsarchive" die Rede. Seit diesem Jahre gibt es<br />
einen Etat für die Provinzialarchive, während bis dahin laut KO. vom 2. 4. 1822 die zur Verwaltung<br />
der Provinzialarchive (seit 1819 im Entstehen) erforderlichen Kosten aus dem<br />
Exlraordinarium der Generalstaatskasse bestritten waren.<br />
Bis 1874 hatte das Direktorium keinen Bürobeamten, was hauptsächlich in der nebenamtlichen<br />
Wahrnehmung dieser Stelle begründet lag.<br />
Nach Karl Georg von Raumers Tode wurde gemäß seinem Vorschlage durch KO. vom 9. 8.<br />
1833 Gustav Adolf Tzschoppe (1836 geadelt) zum „Direktor des Geheimen Staats- und<br />
Kabinettsarchivs und der gesamten Archivverwaltung" [ernannt]. Er starb am 16. 9. 1842<br />
310
Paul Fridolin Kehr Albert Brackmann Ernst Zipfel<br />
als Wirklicher] Gehfeimer] Oberregierungsrat. Sein Hauptamt war zuletzt die Stelle des<br />
Direktors der 1. Abteilung des Ministeriums des Königlichen Hauses.<br />
Zum „vortragenden Rat beim Geheimen Staats- und Kabinettsarchiv und der Archivverwaltung"<br />
wurde gleichzeitig der Sohn des verstorbenen Direktors, der Regierungsrat Georg<br />
Wilhelm von Raumer, geb. 19. 9. 1800, ernannt''; auch er war außerdem als Referent im<br />
Finanzministerium, später im Hausministerium tätig.<br />
Nach von Tzschoppes Tode wurde durch KO. vom 17. 3. 1843 der Geheime Oberregierungsrat<br />
Georg Wilhelm von Raumer zum „Direktor der Archive" ernannt.<br />
Die Stelle des vortragenden Rats beim Geheimen Staatsarchiv blieb zunächst vakant; aus ihr<br />
wurden der Professor der Rechte von Lancizolle als Konsulent des Ministeriums des Königlichen<br />
Hauses und der Geheime Finanzrat von Obstfelder remuneriert für Gutachtertätigkeit<br />
auf politischem und staatsrechtlichem Gebiet. Die Stelle ist 1848 eingegangen.<br />
Im Jahre 1852 wurde die Abtrennung des Hausarchivs vom Geheimen Staatsarchiv durchgeführt.<br />
Die KO. vom 2. 2. 1852 bestimmte, daß Hausarchiv und Geheimes Staatsarchiv ein<br />
Ganzes unter der gemeinsamen Leitung des Hausministers und des Präsidenten des Staatsministeriums<br />
(dieser anstelle des bisherigen Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten) darstellen<br />
und daß dem letzteren zugleich die Provinzialarchive speziell untergeordnet bleiben<br />
sollten. Die gemeinsame Leitung des Geheimen Staatsarchivs und des Hausarchivs durch<br />
Ministerpräsidenten und Hausminister ist praktisch nicht durchgeführt worden.<br />
Gleichzeitig wurde auf eigenen Antrag der Wirkliche] Geheime Oberregierungsrat Georg<br />
Wilhelm von Raumer von seinem Amte entbunden; er starb am 11. 3. 1856. Sein Amt übernahm<br />
mit dem 1. 4. 1852 der am 17. 2. 1796 geborene Professor der Rechte, Karl Wilhelm<br />
von Deleuze de Lancizolle, Direktor der Staatsarchive, der etwas später den Titel Geheimer<br />
Oberarchivrat erhielt, wobei der Rang des Inhabers dieser Stelle als der eines Ministerialrats<br />
II. Klasse festgesetzt wurde 8 . Lancizolle war weiterhin als Universitätslehrer tätig. Er legte<br />
infolge von Kränklichkeit endgültig mit dem 1. 1. 1867 sein Amt nieder. Er wurde pensioniert<br />
durch KO. vom 22.10.1866 und starb nach schwerem Siechtum am 26. 5. 1871.<br />
Sein Nachfolger wurde am 8. 7. 1867 wieder einer der Räte des Staatsministeriums, nämlich<br />
311
der Geheime Regierungsrat Max Duncker, Direktor der Staatsarchive, geb. 15. 10. 1811,<br />
gest. 21. 7. 1886. Auch er blieb zugleich und der Form nach im Hauptamt vortragender Rat<br />
beim Kronprinzen. Der Geheime Oberregierungsrat Duncker verzichtete auf die Stellung als<br />
Direktor der Staatsarchive am 28. 9. 1874 und erhielt das Dimissoriale durch KO. vom<br />
11. 11. 1874".<br />
Zu seinem Nachfolger wurde berufen am 23. 6. 1875 Professor Heinrich von Sybel, Direktor<br />
der Staatsarchive und Direktor des Geheimen Staatsarchivs, geb. 2. 12. 1817, gest. 1. 8. 1895<br />
als Wirklicher] Gehfeimer] Rat, Exzellenz 10 . Mit seiner Ernennung wurde die Stelle des<br />
Direktors der Staatsarchive zum Hauptamt. Der Direktor der Staatsarchive war wie bisher<br />
dem Präsidium des Staatsministeriums unterstellt und daselbst zugleich Referent für Archivsachen.<br />
Mit jener Stelle wurde das neugeschaffene Amt eines Direktors des Geheimen Staatsarchivs<br />
als Nebenamt verbunden.<br />
Ihm folgte am 9. 3. 1896 Professor Reinhold Koser (1913 geadelt), Direktor der Staatsarchive<br />
und zugleich Direktor des Geheimen Staatsarchivs, geb. [7. 2.J 1852, gest. als<br />
Wirklicher] Geh/eimer] Rat, Exzellenz, am 25. 8. 1914 11 . Seine Amtsbezeichnung wurde<br />
durch Allerhöchsten Erlaß vom 27. 12. 1899 umgewandelt in die eines „Generaldirektors der<br />
Staatsarchive", indem gleichzeitig die Vorsteher der zwölf größten Staatsarchive damals die<br />
Amtsbezeichnung „Archivdirektoren" erhielten. Am Geheimen Staatsarchiv wurde die<br />
Stelle eines Zweiten Direktors des Geheimen Staatsarchivs geschaffen, durch Beschluß des<br />
Abgeordnetenhauses aber in die eines Zweiten Direktors der Staatsarchive umgewandelt. Der<br />
erste Inhaber dieser Stelle wurde im April 1896 der Archivrat Kar! Sattler (gest. 13. 7. 1906),<br />
dem im September 1906 der Geheime Archivrat Paul Bailleu folgte.<br />
Nach Kosers Tode wurde durch KO. vom 16. 8. 1915 Professor Paul Fridolin Kehr, geb.<br />
28. 12. 1860, zum Generaldirektor der Staatsarchive und zugleich zum Direktor des Geheimen<br />
Staatsarchivs unter Beilegung des Charakters als Geheimer Oberregierungsrat ernannt 12 .<br />
Als Geheimrat Bailleu am 1. 4. 1921 mit Einführung der Bestimmung wegen der Altersgrenze<br />
aus dem Dienste schied 13 , wurde die Stelle eines Zweiten Direktors der Staatsarchive in<br />
eine solche des Zweiten Direktors des Geheimen Staatsarchivs umgewandelt (Archivrat Dr.<br />
Klinkenborg 14 [Aug. 1821 — 29. 3. 1930]). Generaldirektor Professor Dr. Kehr schied nach<br />
mehrmaliger Verlängerung der infolge Erreichens der Altersgrenze abgelaufenen Dienstzeit<br />
mit dem 1. 4.1929 aus dem Amte.<br />
Ihm folgte am 1. 4. 1929—10. 9. 1936 Generaldirektor der Staatsarchive Professor Dr.<br />
Brackmann 15 . Mit der Besoldungsordnung vom 4. März 1936 und dem Haushalt 1936<br />
hörte das Verhälmis des Generaldirektors zum Geheimen Staatsarchiv als dessen Erster<br />
Direktor auf; der Leiter des Geheimen Staatsarchivs führte [bis 1946 und wiederum seit<br />
1963] die Amtsbezeichnung: „Direktor des Geheimen Staatsarchivs" 16 .<br />
Am 21. 9. 1938 wurde der bereits seit dem 29. 8. 1936 mit der Vertretung beauftragte<br />
Oberregierungsrat Dr. Ernst Zipfel (geb. 23. 3. 1891 in Dresden) zum Generaldirektorder<br />
Staatsarchive ernannt. Er war zugleich seit dem 19. 9. 1936 Direktor des Reichsarchivs<br />
Potsdam, seit 22. 5. 1940 auch Reichskommissar für den Archivschutz (für das gesamte<br />
westliche, seit 21. 4. 1941 auch für das östliche Operationsgebiet), und seit dem 18. 6. 1942<br />
daneben noch als Leiter des neugeschaffenen Sonderreferates „Archivwesen" in der<br />
Hauptabteilung I des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete, sowie seit dem<br />
21.1. 1944 als Leiter der Unterabteilung I „Archiv- und Schriftgutwesen" im Reichsministerium<br />
des Innern tätig; vom 2. 2. —30. 9. 1944 übernahm Zipfel vorübergehend noch die<br />
312
Leitung des Geheimen Staatsarchivs. Am 21. 4. 1945 wurde er, der gleichsam in seiner<br />
Person die von ihm wiederholt vergeblich geforderte Bildung einer „Reichsarchivspitze"<br />
durch Ämterkumulation verwirklicht hatte 17 , „einem Arbeitsstab des Reichsministeriums<br />
des Innern zugeteilt, der zur Aufrechterhaltung eines Notbetriebes gebildet worden" war<br />
und mit der Reichsführungsspitze nach Schleswig-Holstein versetzt, wo er am 7. 5. 1945 in<br />
den Ruhestand trat. Ernst Zipfel starb am 17. 4. 1966 in Bad Pyrmont.<br />
Zuvor ernannte man am 18. 4. 1945 noch im Falle von Zipfels Verhinderung Staatsarchivdirektor<br />
Dr. Erich Randt, seit 16. 10. 1944 selbst Direktor des Geheimen Staatsarchivs,<br />
zum stellvertretenden Generaldirektor der Preußischen Staatsarchive, ferner sollte ihm die<br />
stellvertretende Leitung der Archivabteilung des Preußischen Staatsministeriums übertragen<br />
werden 18 . Diese Funktionen suchte Randt auch über den Zeitpunkt des Zusammenbruchs<br />
hinaus aufrechtzuerhalten, bis er am 15. 6. 1945 aus dem Dienst ausschied.<br />
1 GStA, Rep. 90, Nr. 213.<br />
2 Ernannt am 9. 9. 1938.<br />
3 Über Winters archivarische Laufbahn wie über die anderer preußischer Berufskollegen vgl. Eckart<br />
Henning/Christel Wegeleben: Archivare beim Geheimen Staatsarchiv 1924 — 1974, in: Jahrbuch<br />
für brandenburgische Landesgeschichte 27 (1976), S. 155 — 178, mit Literaturang;iben. - An<br />
Würdigungen Winters sei hier nur verwiesen auf: Wilhelm Rohr, in: Der Archivar 13 (1961), Sp.<br />
137—140; Ernst Posner, in: American Archivist 24 (1961), S. 457 — 459; Wolfgang Mommsen, in:<br />
Historische Zeitschrift (künftig: HZ) Bd. 194 (1962), S. 457-459.<br />
4 Vgl. Wolfgang Leesch: Das Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung<br />
(IfA) in Berlin-Dahlem (1930—1945), in: Brandenburgische Jahrhunderte. Festschrift für<br />
Johannes Schultze zum 90. Geburtstag, hrsg. von Gerd Heinrich u. Werner Vogel. Berlin 1971.<br />
S. 219-254.<br />
5 Vgl. die Verordnung über die veränderte Verfassung aller obersten Staatsbehörden, in: Gesetz-<br />
Sammlung für die Kgl. preußischen Staaten, 1810, S. 3 — 23, hier: S. 4, u. Das Reglement für das<br />
Geheime Staatsarchiv, 1812; ferner: Reinhold Koser: Die Neuordnung des preußischen Archivwesens<br />
durch den Staatskanzler Fürsten Hardenberg. Leipzig 1904. - Adolf Brenneke: Archivkunde.<br />
Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen Archivwesens, hrsg. von W.<br />
Leesch. Leipzig 1953, hier: Brandenburg-Preußen bis 1815, S. 144—148, sowie Geheimes Staatsarchiv<br />
ab 1803 und Preußische Archivverwaltung. S. 402 — 408. - Gerhard Zimmermann: Hardenbergs<br />
Versuch einer Reform der preußischen Archivverwaltung und deren weitere Entwicklung<br />
bis 1933, in: Jahrbuch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Bd. 4 (1966), S. 69-87.<br />
6 Hermann von Raumer: Die Geschichte der Familie von Raumer. Neustadt/Aisch 1975, S. 81—83<br />
(= Bibliothek familiengeschichtl. Arbeiten, Bd. 38): - Ernst Friedlaender: Karl Georg v. Raumer,<br />
in: Allgemeine Deutsche Biographie (künftig: ADB) Bd. 27 (1888), S. 416-418. - Johannes<br />
Schultze: Karl Georg v. Raumer, in: Mitteldeutsche Lebensbilder, Bd. 4, Magdeburg 1929,<br />
S. 186-198.<br />
7 H. v. Raumer: Geschichte der Familie von Raumer, S. 83 — 87. - Ernst Friedlaender, in: ADB<br />
Bd. 27 (1888), S. 414. - Vgl. auch: Georg Wilhelm v. Raumer: Die Geschichte des Geheimen<br />
Staats- und Cabinets-Archivs zu Berlin. Hrsg. von Eckart Henning, in: Archivalische Zeitschrift<br />
(künftig: AZ) Bd. 72 (1976), S. 30-75, Vorbem. über d. Verf. S. 30-33.<br />
8 Vgl. ADB Bd. 17 (1883), S. 583-584, und [Richard Beringuier?] Guillaume Charles von<br />
Lancizolle, in: Vermischte Schriften im Anschluß an die Berlinische Chronik und an das Urkundenbuch,Bd.<br />
1,B: Namhafte Berliner, Taf. 11. Berlin 1887, S. 1-8.<br />
9 Eckart Henning: 50 Jahre Geheimes Staatsarchiv in Berlin-Dahlem - 100 Jahre seit seiner Vereinigung<br />
mit dem Ministerialarchiv, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte Bd. 25<br />
(1974), S. 154-174, hier: S. 155-157. Kurzfassung, in: Der Archivar 28 (1975), S. 143-152.<br />
-Über M. Duncker s. auch Neue Deutsche Biographie (künftig: NDB) 4 (1959), S. 195 -1%.<br />
10 E. Henning: Geheimes Staatsarchiv, S. 157—162, vgl. auch H. Rössler/G. Franz: Biographisches<br />
Wörterbuch zur deutschen Geschichte. München 1952. S. 827 — 828. Winter irrt vermutlich, wenn<br />
313
er sagt, daß D. weiterhin vortragender Rat b. Kronprinzen blieb; richtig ist vielmehr, daß er dies<br />
hauptamtl. im Staatsministerium war. Seine Bindung an den Kronprinzen hatte aufgehört, vgl.<br />
Rudolf Haym: Das Leben Max Dunckers, Berlin 1891, S. 418f.<br />
11 Vgl. Nachrufe über R. K. von Berthold Volz, in: Hohenzollern-Jahrbuch, 1914, S. 166 ff.; Otto<br />
Hintze, in: HZ 114 (1915), S. 65 ff.; Melle Klinkenborg, in: Forschungen zur Brandenburgischen<br />
und Preußischen Geschichte (künftig: FBPG) 28 (1915), S. 285-310, mit Schriftenverz.;<br />
Johannes Schultze, in: AZ 35 (1925), S. 270-272; ferner die Würdigung von Stephan Skalweit,<br />
in: Bonner Gelehrte. Beitr. z. Wissenschaft, Bonn 1968, S. 272-277; vgl. künftig Eckart Henning:<br />
Der erste Generaldirektor der preußischen Staatsarchive, Reinhold Koser (1896 — 1914), in:<br />
Neue Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Berlin 1977 (i. Vorher.) u.<br />
Bernhard vom Brocke: R.K., in: NDB (i. Druck). Von seiner persönl. Nobilitierung i.J. 1913<br />
scheint K. jedoch keinen Gebrauch gemacht zu haben.<br />
12 Aufschlußreich zum vorliegenden Thema, auch zur Würdigung seiner Amtsvorgänger, vgl. Paul<br />
Fridolin Kehr: Ein Jahrhundert preußischer Archivverwaltung. Rede gelegentl. d. Wiedereröffnung<br />
d. Geheimen Staatsarchivs am 26. 3. 1924, in: AZ 35 (1925), S. 3-21. - Über Kehr vgl.<br />
Nachrufe u.a. von Ernst Zipfel, in: Mitteilungen der preußischen Staatsarchive, 1944, S. 103 — 107;<br />
Leo Santifaller, in: Almanach d. Akademie der Wissenschaften i. Wien f.d.J. 1945, 195 (1947),<br />
S. 192-199; Walther Holtzmann, in: Deutsches Archiv 8 (1950), S. 26-58; Friedrich Baethgen,<br />
in: Jahrb. d. Deutschen Akademie d. Wiss., 1950/51, S. 157-160; Karl Brandi, in: Jahrb. d.<br />
Akademie d. Wiss. in Göttingen, Übergangs-Bd. 1944-60 (1962), Sp. 134-152 (mit Bibliographie<br />
seiner Schriften). - Vgl. auch Martha Kehr: Die Vorfahren v. P.F.K., in: Genealogie 17<br />
(1968), S. 321-330, nebst Nachtr. ib. 20 (1971), S. 471 -472.<br />
" Gest. 25. 6. 1922. Über P. B., s. Melle Klinkenborg, in: Deutsches biographisches Jahrbuch 4<br />
(1922), S. 3 — 10, u. Preußischer Wille. Gesammelte Aufsätze von P. B. mit e. Nachruf v. Melle<br />
Klinkenborg. Berlin 1924, ferner NDB 1 (1953), S. 545.<br />
14 Er war vom August 1921 bis zu seinem Tode am 29. 3. 1930 im Amt. Vgl. Johannes Schultze:<br />
M. K., in: FBPG 43 (1930), S. 1-21, mit Schriftenverz. Klinkenborgs (letzter) Nachfolger als<br />
Zweiter Direktor wurde am 1. 7. 1930 Adolf Brenneke. der bis zu seiner Ernennung zum Direktor<br />
des Geheimen Staatsarchivs am 8. 4. 1936 (— 30. 9. 1943) diese Amtsbezeichnung führte.<br />
15 Über A. Brackmann vgl. Nachrufe u.a. von: F. Baethgen, in: Bayer. Akademie d. Wiss., Jhb. f.<br />
1952, S. 169-174; W. Ohnsorge, in: HZ 166 (1952), S. 580-586; H. Meinert: A. B. u. das<br />
deutsche Archivwesen, in: AZ 49 (1954), S. 127-138; F. Steinhoff, in: Nds. Lebensbilder, Bd. 2,<br />
Hildesheim 1954, S. 20-36 (= Veröff. d. Hist. Komm. f. Nieders., 22); H. Goetting, in: NDB 2<br />
(1955), S. 504-505; L. Santifaller, in: Der Archivar 15 (1962), S. 317-328.<br />
16 Vgl. die Liste der Direktoren des Geheimen Staatsarchivs bei Johann Caspar Struckmann: Katalog<br />
der Ausstellung 50 Jahre Geheimes Staatsarchiv in Berlin-Dahlem - 100 Jahre seit seiner Vereinigung<br />
mit dem Ministerialarchiv. Berlin 1974, S. 29 — 30.<br />
17 Gerhard Zimmermann: Das Ringen um die Vereinheitlichung des Archivwesens in Preußen und im<br />
Reich von 1933-45, in: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 5 (1968), S. 129-142. - Über E.<br />
Zipfel vgl. den Nachruf von Wilhelm Rohr, in: Der Archivar 20 (1967), Sp. 206-210.<br />
18 Ein entsprechendes Gesuch Zipfels vom 18. 4. 1945 an den Preußischen Ministerpräsidenten liegt<br />
im Konzept bei den Akten; es wurde einem Bearbeitungsvermerk zufolge am selben Tage gefertigt<br />
- AV 636/45 - und abgesandt, doch scheint die erbetene Bestätigung nicht mehr eingegangen zu<br />
sein (vgl. GStA, Rep. 178 A, Nr. 39).<br />
Anschrift des Bearbeiters: Lückhoffstraße 33, 1000 Berlin 38<br />
Zum Abriß des ehemaligen Garnison-Lazaretts in Spandau<br />
Von Jürgen Grothe<br />
Seit Jahren wird in Spandau von der Sanierung der Altstadt gesprochen. Geschehen ist bis<br />
heute nichts, und wenn Aktivitäten zu beobachten sind, so heißt das meistens Abriß. So sind<br />
alle wesentlichen Zeugen der Ackerbürgerstadt, z.B. Wendenschloß, Kinkelstraße 35,<br />
314
Der Neue Packhof (Stahlstich nach einer Zeichnung von Hintze um 1833) Foto: J. Grothe<br />
Ritterstraße 6 und Fischerstraße 33, in den letzten Jahren abgebrochen worden. Gebäude,<br />
die die Garnisonstadt dokumentierten, sind ebenfalls der Spitzhacke zum Opfer gefallen.<br />
Ein Bau war erhalten geblieben — er wird gerade abgetragen: das ehemalige Lazarett am<br />
Lindenufer 2.<br />
Weshalb auch dieses Gebäude verschwinden muß, liegt auf der Hand. Spandau braucht<br />
Parkplätze als Provisorium während des U-Bahnbaues, so heißt es. Fährt die U-Bahn dann<br />
nach Spandau, soll eine Grünfläche an dieser Stelle entstehen. Wem ist mit dieser Grünfläche<br />
gedient, wenn gleichzeitig Grünflächen zwischen Altstädter Ring und Mühlengraben,<br />
die im Flächennutzungsplan als solche ausgewiesen sind, in Parkplätze umgewandelt werden?<br />
Außerdem werden nach Abriß des genannten Gebäudes die weniger dekorativen<br />
Fassaden an der Westseite des Lindenufers voll sichtbar. Eine optische Bereicherung für die<br />
Ausflügler, die auf der Havel Spandau passieren, ist das wahrlich nicht. Gern wird von den<br />
Stadtplanern im Zusammenhang mit der Spandauer Altstadt das Wort Urbanität benutzt;<br />
in Wirklichkeit ist jedoch eine immer stärker werdende Verödung der Stadtlandschaft zu<br />
beobachten. Ein alter Bau nach dem anderen wird abgerissen und durch sterile Betonarchitekturen<br />
ersetzt. Man muß leider feststellen, daß der bauliche Bestand der Altstadt<br />
stärker durch die Abrisse der letzten Jahre als durch Kriegszerstörungen dezimiert worden<br />
ist. So sind die Atmosphäre und der Charakter der Altstadt weitgehend verlorengegangen.<br />
Diese Gefahr droht auch Kolk und Behnitz. Der Eingang zu diesen Straßen, der Hohe<br />
Steinweg, soll an der Nordseite durch eine moderne Architektur verändert werden. Warum<br />
nehmen die Verantwortlichen nicht zur Kenntnis, daß in anderen Städten mit Erfolg restauriert<br />
statt abgerissen wird? Als Beispiele seien genannt: Danzig, Warschau, Bern oder der<br />
Schnoor in Bremen.<br />
315
Ehem. Garnison-Lazarett am Lindenufer 2 Foto: J. Grothe<br />
Das Lazarett Lindenufer 2 entstand 1851—53 auf militärfiskalischem Gelände. An dieser<br />
Stelle, vor der Stadtmauer, standen bereits das Salzhaus und ein Exerzierschuppen. Das<br />
Lazarett wurde als reiner Zweckbau vom Preußischen Militärbauamt errichtet. Wegen der<br />
frischen und gesunden Luft entschied man sich für die Lage am Wasser. Der Bau bestand<br />
aus roten Rathenower Verblendern. Die Architektur bestach durch klare Formen: Elf an<br />
der Havelseite paarweise zusammengefaßte rundbogige Fenster gliederten den dreistöckigen<br />
Baukörper. Den Übergang zum Dach schuf ein Zwischengeschoß mit kleineren rechteckigen<br />
Fenstern. Die Bögen der Fenster waren freitragend gewölbt, die Kanten abgestumpft,<br />
die Regenrinnen versenkt. Das ursprünglich mit Schiefer gedeckte Walmdach<br />
ruhte auf feingestuften Konsolen. Zur Straßenseite bildete der U-förmige Baublock einen<br />
Ehrenhof. Hier befand sich der Haupteingang.<br />
Das Lazarett war ein typischer Bau der Zeit nach Schinkel. Als Vorbild diente das 1832<br />
nach Entwürfen Karl Friedrich Schinkels erbaute Magazingebäude des Packhofes in Berlin.<br />
Dieses Gebäude stand auf der heutigen Museumsinsel. Es wurde 1896 für den Neubau des<br />
Kaiser-Friedrich-Museums, des heutigen Bode-Museums, abgebrochen.<br />
In Berlin wie in Spandau war die Lage der Gebäude, jeweils an einem Wasserlauf, gleich.<br />
Schwierigkeiten mit dem schlechten Baugrund gab es an beiden Baustellen, Pfahlroste<br />
tragen die Fundamente. Schinkel beschreibt den Berliner Bau ausführlich: „Durch das in<br />
einfacher und kräftiger Architektur gehaltene Äußere, ist die Bestimmung charakterisiert.<br />
Die vorzüglich gutgeformten und gebrannten Ziegel verblenden die in genauem Verbände<br />
ausgeführten Mauern." Diese Beschreibung trifft auch für den Spandauer Bau zu. Vergleicht<br />
man das Spandauer Lazarett mit dem Packhofgebäude, wird die starke Abhängig-<br />
316
keit des Hauses am Lindenufer mit dem Berliner Vorbild sichtbar. So ist die Gestaltung der<br />
Fenster, des Gesimses und des Walmdaches vom Vorbild übernommen. Auch die Umfassungsmauer<br />
war in Berlin vorhanden. In Spandau war diese Mauer mit angedeuteten<br />
Schießscharten versehen. Sie sollte die für den Bau des Lazaretts abgerissene Stadtmauer<br />
optisch ersetzen.<br />
Das vom Militär genutzte Grundstück war bis 1918 mit seinen Nebenbaulichkeiten 6300<br />
Quadratmeter groß. 1932 wurden Nebengebäude abgerissen und die freigewordenen Flächen<br />
der Grünanlage des Lindenufers hinzugefügt. Ein Kasino, das südlich des Lazaretts<br />
stand, wurde während des Zweiten Weltkrieges zerstört und nach 1945 abgebrochen.<br />
Das Gebäude Lindenufer 2 diente von 1853 — 1879 als Lazarett. Nach einem Umbau zur<br />
Kaserne II waren bis 1896 Teile des 3. Garde-Grenadier-Regiments Königin Elisabeth und<br />
anschließend bis 1914 das Garde-Fußartillerie-Regiment in dem Bau stationiert. Nach<br />
Kriegsende 1918 mußte die Kaserne einer zivilen Nutzung zugeführt werden. Die Stadt<br />
Spandau ließ die Räume für Wohnzwecke umbauen. Am Ende der 20er Jahre kaufte die<br />
Stadt Berlin das ehemalige Lazarett und ließ es erneut umgestalten. 1929 zog das Arbeitsamt,<br />
das bis 1948 die Räume nutzte, in das Gebäude. Seit 1949 wurden die ca. 9 X 5 Meter<br />
großen Räume wiederum von Familien bewohnt.<br />
Als die Abrißpläne bekannt wurden, setzte sich eine Bürgerinitiative für die Erhaltung des<br />
Baues ein; er sollte zu einem Seniorenwohnheim umgestaltet werden. Das Spandauer<br />
Volksblatt (27. Juli 1975 und 13. Juni 1976) und Der Tagesspiegel (25. April 1976)<br />
setzten sich ebenfalls für die Erhaltung des Gebäudes ein. Das Bezirksamt nannte folgende<br />
Gründe für den Abriß:<br />
1. Der Bau hätte sich durch einen Bombentreffer während des Zweiten Weltkrieges an der<br />
Westseite gesenkt. Dazu ist festzustellen, daß anläßlich einer Restaurierung 1951 Gipsmarken<br />
gesetzt worden waren, die bis zum Beginn des Abrisses keine Veränderungen<br />
gezeigt hatten.<br />
2. Die Dachbalken wären vom Schwamm durchsetzt. Beim Abriß sah man jedoch, daß die<br />
Balken nur im Südteil eine leichte Schwammbildung besaßen, die ohne weiteres hätte herausgenommen<br />
werden können. Festzustellen war ferner, daß sich die dichten Balkenlagen<br />
in den einzelnen Etagen in einem ausgezeichneten Zustand befanden.<br />
Mit dem Abriß des ehemaligen Lazaretts verschwand in der Spandauer Altstadt das letzte<br />
bauliche Zeugnis, das an die einstige Garnisonstadt erinnerte.<br />
Geschehen vor 40 Jahren<br />
Die Beschlagnahme des Logenhauses in der Kleiststraße<br />
Von Dr. Ernst G. Lowenthal<br />
Anschrift des Verfassers: Kellerwaldweg 9, 1000 Berlin 20<br />
„Ich ersuche, die Gebäude und sonstigen Räumlichkeiten des UOBB, der ihm angeschlossenen<br />
Tochter- und Neben- sowie aller dem UOBB ähnlich gearteten jüdischen Organisationen<br />
im engsten Einvernehmen mit den zuständigen SD-Oberabschnitten ... am 19.<br />
April 1937, 7 Uhr früh, schlagartig zu besetzen. Das gesamte Vermögen dieser Organisa-<br />
317
tionen, ohne Rücksicht darauf, wo es sich im Augenblick befindet, ist zu beschlagnahmen."<br />
So hieß es in einer als „Streng vertraulich!" bezeichneten Verfügung des Geheimen Staatspolizeiamts<br />
Berlin vom 10. April 1937 betr. „Auflösung des 'Unabhängigen Ordens Bne<br />
Briss'". Dieser an alle Staatspolizeistellen im Deutschen Reich gerichteten Anweisung lag<br />
ein Verzeichnis „der für den jeweiligen Dienstbereich in Betracht kommenden Organisationen<br />
und Nebenorganisationen und der Anschriften der früheren Logenangehörigen"<br />
bei.<br />
Der 1843 in New York (von ausgewanderten deutschen Juden) gegründete jüdische<br />
U.O.B.B. - Bne Briss (auch Bnai Brith) bedeutet soviel wie „Söhne des Bundes" - übt<br />
Wohltätigkeit, Bruderliebe und Eintracht. In Deutschland begann diese Bewegung 1882,<br />
verbreitete sich zusehends und umfaßte, bis in die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts,<br />
etwa 100 Logen; die Gesamtzahl ihrer Mitglieder wurde auf 12 000 bis 13 000 geschätzt.<br />
Bne Briss unterhielt in Deutschland Ausbildungsstätten, Alters-, Kinder- und Erholungsheime<br />
und hatte von 1901 bis 1937 ein eigenes gedrucktes monatliches Mitteilungsblatt mit<br />
dem Titel „Der Orden Bne Briss".<br />
Mit welcher wie stets von den Naziverfolgern betriebenen organisatorischen Minuziösität<br />
die Durchführung der zumindest intern zu einer Art kleiner Staatsaktion hochgespielten<br />
Maßnahme im einzelnen vorbereitet war, zeigen die Spezialanweisungen der Gestapo, als<br />
da sind: die restlose Erfassung der Personalakten und ähnlichen Unterlagen, die Beschlagnahme<br />
bestimmter Vermögenswerte, die Verhaftung (bis nach Beendigung der Aktion) der<br />
„führenden" Logenangehörigen (Präsidenten, Schriftführer, Kassenwarte), die Durchsuchung<br />
der Wohnungen der Genannten nach Logenmaterial sowie dessen Sichtung, Sicherstellung<br />
und Trennung nach freimaurerischem und nichtfreimaurerischem Inhalt. Die Tragweite<br />
der widerrechtlichen Entziehungsmaßnahmen ist im Einzelfall dadurch dokumentiert,<br />
daß beispielsweise ein ehemaliger Stuttgarter Logenbruder im Juni 1937 ersucht wurde,<br />
seinen rückständigen Mitgliedsbeitrag an den örtlichen „Liquidator", einen Bezirksnotar,<br />
zu entrichten!<br />
Dem Geschehnis, soweit es sich auf Berlin bezog, ging sogar im Dienstgebäude Wilhelmstraße<br />
98 eine besondere Referentenbesprechung am 14. April voran, zu der mit der gleichen<br />
Gestapo-Verfügung eingeladen wurde. Das mochte seinen Grund darin haben, daß von<br />
den ursprünglich über 100 Bnai-Brith-Logen in Deutschland (von denen sich schon vor<br />
dem „Stichtag" gut ein Drittel angeblich freiwillig aufgelöst hatte oder mehr oder weniger<br />
zwangsweise „suspendiert" worden war) sich allein neun in Berlin befanden. Sie alle hatten<br />
ihren Sitz in dem geräumigen und repräsentativen Logenhaus in der Kleiststraße 10—12,<br />
wo lange auch das Büro der Großloge für Deutschland VIII war. Seit 1924 war Dr. Leo<br />
Baeck der Großpräsident, der letzte in Deutschland; vor ihm hatten dieses Ehrenamt<br />
bekleidet: Julius Fenchel (von 1885 bis 1887), Louis Maretzki (1888/98), von dem eine<br />
Geschichte des Ordens bis 1907 stammt, und der Geheime Justizrat Berthold Timendorfer<br />
(bis 1924).<br />
Das beschlagnahmte und „entzogene" Berliner Logenhaus hat ein eigenartiges, seltsames<br />
Schicksal gehabt: Wie durch ein Wunder überlebte es die fast totale Zerstörung der Nordseite<br />
der Kleiststraße während des letzten Krieges beinahe unversehrt, so daß es in seinem<br />
äußeren Gepräge wie in seinem Interieur von Eingeweihten heute gut wiederzuerkennen<br />
ist. Nach der unrechtmäßigen Entziehung „zugunsten des preußischen Staates" wurde das<br />
Eigentum an dem um die Jahrhundertwende errichteten, repräsentativen Gebäude von der<br />
„Kleiststraße 10 — 12 Grundstücks-Aktiengesellschaft" (bis etwa Mitte 1935: „Berliner<br />
318
Logenhaus-Aktiengesellschaft") auf den preußischen Staat (Allgemeine Finanzverwaltung)<br />
offiziell umgeschrieben; dieser seinerseits beauftragte die „Fundamentum Treuhand<br />
A.-G.", Berlin NW 7, mit der Verwaltung des „neuerworbenen" Grundbesitzes. Urkundlich<br />
feststellbar ist, daß, jedenfalls im Jahre 1940, die „Reichsanstalt für Film und Bild in<br />
Wissenschaft und Unterricht (Reichserziehungsministerium)" in dem Gebäude untergebracht<br />
war. Nach Kriegsende stand es zunächst unter amerikanischer Requisition und unter<br />
der Fürsorge des Treuhänders für jüdisches Vermögen; später ging es in die Verwaltung<br />
und das vorübergehende Eigentum des JRSO (Jewish Restitution Successor Organization)<br />
über. Jetzt ist es seit geraumer Zeit Eigentum der „Urania Berlin E.V.", der weitbekannten<br />
Vereinigung zur Pflege der Kunst, Wissenschaft und des Kulturfilms, die das mit dem<br />
modernen Hauptgebäude verbundene, etwas im Hintergrund versteckt liegende ehemalige<br />
Logenhaus, besonders dessen großen Saal, für ihre Veranstaltungen benutzt.<br />
Die Aktion vollzog sich zwar unauffällig im Morgengrauen des 19. April 1937, sprach sich<br />
aber dennoch rasch herum, auch in nicht unmittelbar betroffenen jüdischen Kreisen, und<br />
rief starke Bestürzung hervor. „Was folgt?", war die bange Frage. An eine größere Öffentlichkeit<br />
gelangte, soweit erinnerlich, nichts, und die jüdische Presse, damals noch verhältnismäßig<br />
stark vertreten, doch von den Nazi-Behörden zusehends schärfer beobachtet und<br />
kontrolliert, konnte es nicht wagen, die Zwangsauflösung, d. h. das Verbot der Logen, auch<br />
nur zu erwähnen, geschweige denn zu kommentieren. Das abrupte Ausfallen des für vielerlei<br />
Zwecke geeigneten Berliner Logenhauses, in dem bis zu diesem Zeitpunkt - ganz allgemein<br />
— zahlreiche jüdische Veranstaltungen vor allem kultureller Art stattgefunden hatten,<br />
stellte die jüdischen Organisationen von heute auf morgen vor rasch zu treffende Entscheidungen.<br />
Eine von der Kleinkunstbühne des Jüdischen Kulturbundes Berlin aufgeführte<br />
Revue mußte „aus technischen Gründen", wie es in einer Mitteilung hieß, „unterbrochen<br />
werden". Als sie aber schon bald eine Ersatzaufführungsstätte im benachbarten<br />
„Brüdervereinshaus" (in der Kurfürstenstraße) gefunden hatte, wandelte Max Ehrlich, der<br />
unvergessene Kabarettist, wie stets schlagfertig und selbst noch in jener Situation um ein<br />
mutig-tröstendes Scherzwort nicht verlegen, den Titel der Revue („Bitte einsteigen!") ab<br />
in — „Bitte umsteigen!"<br />
Seit Hitler die Macht ergriffen hatte, sei, so berichtete ein zuverlässiger Gewährsmann nach<br />
dem Kriege, den Logen in Deutschland wiederholt nahegelegt worden, dem Beispiel der<br />
Freimaurer folgend, die Organisation freiwillig aufzulösen. Unter Baecks Führung habe<br />
jedoch der deutsche U.O.B.B.-Distrikt ein solches Verhalten als nicht im Einklang stehend<br />
mit den Pflichten der Logen als Kämpfer für Humanität und Gleichberechtigung abgelehnt.<br />
Rückblickend kann in dieser Haltung ein Wille zum geistigen Widerstand erblickt werden,<br />
zum Widerstand selbst im drohenden Untergang.<br />
Daß heute in West-Berlin wieder zwei und in der übrigen Bundesrepublik wieder fünf<br />
Bnai-Brith-Logen bestehen, in Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, München und Saarbrücken,<br />
ist nicht nur ein Zeichen für ausgeprägtes Gemeinschaftsbewußtsein, sondern,<br />
verglichen mit den rund 565 000 Juden und den etwa 100 Logen im Deutschland des ausgehenden<br />
Jahres 1932, auch numerisch eine beachtliche Leistung. 1982 wird sich Gelegenheit<br />
bieten, der dann hundert Jahre zuvor erfolgten Inauguration der ersten Bnai-Brith-<br />
Loge in Deutschland, der Deutschen Reichsloge in Berlin, zu gedenken. Die Gründung der<br />
Gesamtorganisation auf internationaler Ebene geht indes noch einige Dekaden weiter<br />
zurück.<br />
Anschrift des Verfassers: Kaunstraße 33, 1000 Berlin 37<br />
319
Charlotte Bara<br />
Von Karl-Robert Schütze<br />
Charlotte Bara. Scherenschnitt von Lotte Reiniger<br />
Kunst und Kultur der zwanziger Jahre sind fast nicht denkbar ohne den Beitrag des Tanzes,<br />
sogar von einer Tanzpsychose 1 wurde gesprochen. In der damaligen Weltmetropole der<br />
Kunst. Berlin, haben sie alle gastiert, die Vertreter verschiedener Schulen des Ausdruckstanzes:<br />
Mary Wigman, Niddy Impekoven, Valeska Gert— und Charlotte Bara, die hier ihre<br />
treueste Gemeinde gefunden hat. Im Jahr 1929 hat sie zuletzt auf einer Berliner Bühne<br />
gestanden und das Publikum in ihren Bann gezogen. Ihre vielen früheren Tanzabende in<br />
den Theatern des Kurfürstendamms und in verschiedenen Sälen haben insbesondere<br />
Künstler zur Beschäftigung mit dem Tanz angeregt.<br />
Martel Schwichtenberg, in Berlin und Worpswede ansässig, immer rastlos unterwegs, hat<br />
einen nicht realisierten Plakatentwurf angefertigt; Lotte Reiniger, die durch ihre Scherenschnitt-Trickfilme<br />
bekannt geworden ist, fertigte den abgebildeten Schnitt nach einer<br />
Tanzfigur von Charlotte Bara. Der heute kaum noch bekannte Dietz Edzard gehörte zu<br />
ihren Dauergästen bei einer Tournee durch Holland und Belgien. Heinrich Vogeler und<br />
Alfred Schulze, empfohlen von ihrem Onkel Dr. Emil Löhnberg aus Hamm, oblag kurz<br />
vor dem ersten Weltkrieg die Einrichtung des Elternhauses in Brüssel.<br />
Diesen Künstlern war die Familie durch Freundschaft ebenso verbunden wie Christian<br />
Rohlfs, der später ebenfalls in Ascona 2 ansässig wurde. Werke von M. Kogan, H. Vogeler,<br />
Ch. Rohlfs und M. Wels illustrieren einen kleinen Band über die Tänzerin, 1921 von Alfred<br />
Richard Meyer im eigenen Verlag herausgebracht 3 ; sie versuchen zusammen mit einer<br />
Anzahl von künstlerischen Photographien die vergängliche Kunst des Tanzes lebendig zu<br />
erhalten. Dieses Ziel zu erreichen wurde erst möglich durch den Film. „Die gotischen<br />
Tänze der Charlotte Bara" wurden produziert vom Institut für Kulturforschung unter der<br />
Leitung von Dr. Hans Cürlis. Leider ist es bisher nicht gelungen, eine Kopie nachzuweisen.<br />
Nach Auskunft von Dr. Cürlis sind die Filme des Institutes, darunter auch die frühen Trickfilme<br />
von Lotte Reiniger, von der Reichsfilmkammer ausgelagert worden und seitdem verschollen.<br />
Rochus diese — er konnte im Januar dieses Jahres seinen 86. Geburtstag feiern -<br />
320
Martel Schwichtenberg: Plakatentwurf (Farbstifte)<br />
entwarf die Dekorationen zu dem Bara-Film. Durch seinen Stil der „entrümpelten Szene"<br />
hat er sich insbesondere als Bühnenbildner und Filmarchitekt, aber auch als Regisseur<br />
einen Namen gemacht.<br />
321
Der expressionistische Dichter Ernst Blass schrieb: „Sie fühlt sich in gotische Bildwerke ein,<br />
in mystische Verschwebungen und Gebärden. Hierbei aber findet sie etwas anderes als sie<br />
suchte, in für sie fruchtbarster Weise, - die Gotik ist nicht nur 'fromm' und 'gläubig'. Hier<br />
wird sie mystisch, individuell, seelenhaft." 4 Besonders fasziniert zeigt sich Blass von dem<br />
„Totentanz", er nennt die Bara „großartig und unvergeßlich". Inspiriert von Ausdruck und<br />
Bewegung der Künstlerin zeigte sich auch Georg Kolbe — er schuf die Mappe „Eine Tänzerin"<br />
für den Seemann Verlag in Leipzig. Die originalen Tuschzeichnungen dazu werden<br />
neben anderen in einer Sonderausstellung des Kolbe-Museums anläßlich der 15. Europäischen<br />
Kunstausstellung „Tendenzen der zwanziger Jahre" zu sehen sein. Stärker als bisher 5<br />
wird dann deutlich werden, daß Plastiken wie die „Kathedrale" in diesem Zusammenhang<br />
entstanden sein müssen. Der für eine figürliche Plastik ungewöhnliche Titel weist auf die<br />
frommen Tänze der Bara hin.<br />
Else Lasker-Schüler dichtet:<br />
„Charlotte wandelt an den Nachmittagen<br />
Durch ihre Gartengänge grünen Heiligensagen<br />
Von frommer Dämmerung ins Himmelreich getragen." 6<br />
Der Garten umgibt das mittelalterliche Castello San Materno in Ascona, das die Familie<br />
Bachrach in Konkurrenz zu Gerhart Hauptmann 1919 erwerben konnte. Auf diesem<br />
Anwesen entstand 1928 nach Plänen des Worpsweder Architekten Carl Weidemeyer, DWB,<br />
das kleine Teatro San Materno als Versuchs- und Kammerspielbühne und für die Schulung<br />
des Nachwuchses. Die Gästewohnungen für Schüler und Künstler gehören zu den ersten<br />
Ferienwohnungen im Tessin überhaupt.<br />
Die Aufgaben der Schule und die politischen Verhältnisse ließen Gastspiele in Berlin nicht<br />
mehr zu, und so ist es hier still geworden um Charlotte Bara, die in Ascona lebt und aus<br />
ihrem reichen Gedächtnis Erinnerungen notiert; ein Verleger hat sich allerdings noch nicht<br />
gefunden. Zwei so vielfältig verbundene Orte, Berlin und Ascona, dazu Worpswede und die<br />
vielen Bekanntschaften von Tourneen — kaum vorstellbar, wie viele bedeutende Persönlichkeiten<br />
ihren Weg gekreuzt haben. Mancher unter den älteren Berlinern wird sich vielleicht<br />
noch erinnern können an diese Form sakraler Kunst, die ihre Vorbilder fand in bildlichen<br />
Darstellungen des Mittelalters, aber auch in den Wandmalereien Ägyptens, neuen Ausdruck<br />
suchend in mystischer Verklärung.<br />
1 Rudolf Pfister: Theodor Fischer. München 1968. S. 68.<br />
2 Christian Rohlfs: Blätter aus Ascona. München 1955 (Piper-Bücherei Nr. 80).<br />
3 Munkepunke-Bibliographie. Berlin 1933, Nr. 54.<br />
4 Ernst Blass: Das Wesen der neuen Tanzkunst. Weimar 1921, S. 38.<br />
5 Plastiken und auch einige Blätter der Mappe sind ständig im Georg-Kolbe-Museum zu besichtigen.<br />
6 Vollständig in: Margarete Kupper, Wiederentdeckte Texte Else Lasker-Schülers, in: Literaturwiss.<br />
Jahrbuch. Im Auftr. der Görres-Gesellschaft hrsg. von Hermann Kunisch, NF Bd. 5 (1964), S. 246.<br />
322<br />
Anschrift des Verfassers: Burgemeisterstraße 56 c, 1000 Berlin 42
Nachrichten<br />
Mitgliederversammlung 1977<br />
Die Ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins für die Geschichte Berlins am 13. Mai 1977 im<br />
Pommernsaa! des Rathauses Charlottenburg wurde vom Vorsitzenden, Professor Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm,<br />
geleitet, der vor Eintritt in die Tagesordnung die Totenehrung vornahm. Seit der<br />
letzten Mitgliederversammlung sind folgende Mitglieder verstorben: Elisabeth Baron, Gerd Buchwald,<br />
Eugen Ernst, Eva-Maria Gottschild, Anne-Marie Grabow, Dr. Kurt Haußmann, Dr. Waldemar<br />
Heinrich, Emil Hess, Bruno Hoffmann, Renate Jaeckel, Alexander Kreuter, Erna Laux, Dr. Hans<br />
Leichter, Erna Loebeling, Hugo Oberbeck, Thomas Runge, Günter Rutenborn, Prof. Dr. Johannes<br />
Schutze, Lothar Schulz, Edgar Stephan, Friedrich Träger, Günter Wichmann.<br />
Da der Tätigkeitsbericht des Schriftführers den Teilnehmern an der Versammlung schriftlich vorlag<br />
und auch im Jahrbuch 1977 „Der Bär von Berlin" veröffentlicht werden soll, wurde auf seine Vorlesung<br />
verzichtet. Der Schatzmeister, Frau R. Koepke, erstattete den Kassenbericht, der den Mitgliedern<br />
ebenso wie der Voranschlag 1977 in Schriftform zur Verfügung gestellt worden war. Für die<br />
Betreuer der Bibliothek berichtete K. Grave über den Ablauf des Jahres in der Bibliothek als der<br />
einzigen Einrichtung des Vereins mit wöchentlichen Zusammenkünften. Aus den Berichten der Kassenprüfer<br />
Degenhardt und Kretschmer (von diesem vorgetragen) und der Bibliotheksprüfer Mende<br />
und Schlenk (von Mende erstattet) ergaben sich keinerlei Beanstandungen. Der Wunsch nach fleißigerem<br />
Besuch der Vereinsbibliothek und nach Belebung der Bibliotheksabende war allgemein. In der<br />
Aussprache wurde auf Fragen der Bibliothek eingegangen. Der Anregung von Frau E. M. Kaatz. die<br />
Namen verstorbener Mitglieder in den Vereinsorganen bekanntzugeben, soll künftig in der bisher<br />
geübten Weise entsprochen werden.<br />
Landgerichtsrat a.D. Rechtsanwalt D. Franz beantragte mit einem Dank für die Arbeit die Entlastung<br />
des Vorstandes, und die Versammlung stimmte diesem Antrag einmütig zu. Der Vorsitzende<br />
dankte dem langjährigen, jetzt auf eigenen Wunsch ausscheidenden Vorstandsmitglied W. G.<br />
Oschilewski für sein stetes Interesse und für die Redaktion des Jahrbuches in einem Vierteljahrhundert.<br />
Auf Vorschlag des Vorstandes wurde F. Escher neu für den Beirat nominiert. Unter der Wahlleitung<br />
von Rechtsanwalt D. Franz wurden die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes einzeln<br />
ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt und die Beiratsmitglieder gemeinsam einstimmig<br />
gewählt. Der neue Vorstand hat für die kommenden zwei Jahre folgende Zusammensetzung: Vorsitzender:<br />
Professor Dr. Dr. Walter Hoffmann-Axthelm, 1. stellv. Vorsitzender: Dr. Gerhard Kutzsch,<br />
2. stellv. Vorsitzender: J. Grothe, Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, Stellv. Schriftführer:<br />
A. Brauer, Schatzmeister: Frau R. Koepke, Stellv. Schatzmeister: Frau L. Franz, Beirat: Professor Dr.<br />
H. Engel, F. Escher, Professor Dr. K. Kettig, Dr. P. Letkemann, K. P. Mader, J. Schlenk, Professor Dr.<br />
M. Sperlich, G. Wollschlaeger. Die Versammlung nahm mit Bedauern zur Kenntnis, daß Professor<br />
Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm nur noch für ein Jahr das Amt des Vorsitzenden ausüben will. Die<br />
bewährten Kassenprüfer Degenhardt und Kretschmer wie die ebenso gewissenhaften Bibliotheksprüfer<br />
Mende und Schlenk wurden einmütig in ihren Ämtern bestätigt.<br />
Am Schluß wurden Fragen des Veranstaltungsprogramms aufgeworfen. Das Mitglied Pierson fragte<br />
nach der Ausstrahlung des Vereins auf den Geschichtsunterricht. An der Erörterung dieser Fragen<br />
beteiligten sich Professor Hoffmann-Axthelm, Dr. Kutzsch, Frau Koepke und K. P. Mader. Der<br />
Mitgliederstand am 31. Dezember 1976 war 838. Vom 1. Januar 1977 bis 13. Mai 1977 sind 27 Mitglieder<br />
neu aufgenommen worden, von denen eines auf der Mitgliederversammlung mit Beifall begrüßt<br />
werden konnte. H. G. Schultze-Berndt<br />
*<br />
Achtung! Wir bitten unsere Mitglieder, bei Wohnungswechsel die neue Anschrift umgehend der<br />
Geschäftsstelle mitzuteilen, damit der Versand der Publikationen ohne zeit- und kostenaufwendige<br />
Verzögerungen erfolgen kann.<br />
323
Schadow-Statue Friedrichs des Großen für das Charlottenburger Schloß<br />
Am 13. Juni 1977 übergab unser Mitglied Herr Axel Springer im Rahmen einer Feierstunde im<br />
Gartensaal des Mittelbaues des Charlottenburger Schlosses der Schlösserverwaltung den Nachguß der<br />
im Kriege untergegangenen Friedrich-Statue von Schadow.<br />
Die Idee zu diesem ersten ausgeführten monumentalen Friedrichsdenkmal (Höhe 2.40 m) stammt von<br />
dem Minister v, Hertzberg, der seit 1791 die Pommerschen Landstände zu einer Spendenaktion für<br />
dieses Denkmal aufrief. Nach anfänglich schleppendem Verlauf der Spendenaktion kamen schließlich<br />
6.200 Taler zusammen, so daß am 3. 8. 1791 der Kontrakt mit Schadow geschlossen werden<br />
konnte.<br />
Die Statue wurde 1792 unter Mitarbeit eines Gehilfen Schadows, des Franzosen Claude Goussaut,<br />
fertiggestellt; ihre feierliche Enthüllung erfolgte am 10. 10. 1793 auf dem Stettiner Exerzier- und<br />
Paradeplatz vor dem alten Anklamer Tor. Für die Umzäunung des Denkmals fand der gleiche Zauntyp<br />
Verwendung, den Schadow für sein Zieten-Denkmal auf dem Wilhelmplatz in Berlin entworfen hatte.<br />
Napoleon wollte die Statue 1807 nach Paris entführen, ließ aber davon ab, als er hörte, daß sie nicht<br />
auf Befehl des Königs, sondern durch die Beiträge der pommerschen Provinzen errichtet worden sei.<br />
Witterungsbedingte Schäden waren 1877 der Anlaß, das Marmordenkmal durch eine Bronzekopie zu<br />
ersetzen. Die Firma Gladenbeck führte den Guß aus, den man auf einen neugeschaffenen Granitsockel<br />
anstelle des alten, aus grauem schlesischem Marmor bestehenden, setzte. Die Abgüsse der<br />
Reliefs des alten Sockels wurden in den neuen eingelassen, der alte Sockel selbst versteigert, während<br />
die drei Originalreliefs in das Stettiner Museum kamen (Verbleib unbekannt). Das verwitterte<br />
Original der Statue fand nun eine Aufstellung im Treppenhaus des Ständegebäudes in der Luisenstraße<br />
28; es ist heute verschollen. Ein Hilfsmodell in genau halber Höhe des Originals befand sich vor<br />
dem Kriege im runden Saal der Berliner Akademie der Wissenschaften. Es ist heute ebenso verschollen<br />
wie nach ihm gefertigte alte Abgüsse, von denen sich einer bei C. G. Gerolds Erben in Berlin,<br />
der andere im Schloß Charlottenburg befand.<br />
Von dem 1877 ausgeführten Bronzeguß sind noch folgende Kopien bekannt;<br />
1. Galvanoplastische Kopie, als Ersatz eines ursprünglichen Zinkgusses 1904 auf dem Friedrichsplatz<br />
in Liegnitz aufgestellt.<br />
2. Marmorkopie der Statue ohne Sockel von Tübbecke, 1902 im hinteren kleinen Treppenhaus des<br />
Kaiser-Friedrich-Museums aufgestellt.<br />
3. Bisquitstatuette (Höhe 0,17 m) der Kgl. Porzellan-Manufaktur, um 1850 entstanden.<br />
4. Größere Nachformung unter Zugrundelegung des Hilfsmodells (Höhe 1,10 m) aus glasiertem<br />
Porzellan vom Ende der 1880er Jahre.<br />
Unser Bronzeguß wurde nach einem im Besitz der Staat). Gipsformerei befindlichen Gipsabguß,<br />
der von dem verschollenen Marmor-Original genommen worden war. in der Gießerei Noack ausgeführt.<br />
Ihren endgültigen Standort wird die Statue im Knobelsdorff-Flügel des Schlosses erhalten, wenn die<br />
z. Zt. darin befindliche Sammlung des Kunstgewerbe-Museums ihren endgültigen Platz im Museumsgelände<br />
am Südrand des Tiergartens gefunden haben wird. Thilo Eggeling<br />
Historisches Archiv der Technischen Fachhochschule Berlin<br />
Seit dem Sommersemester 1976 wird im Auftrag des Rektorats der Technischen Fachhochschule<br />
Berlin von den Professoren Wefeld und Dr. Ortel eine zentrale Sammlung aller historischen Unterlagen<br />
über die früheren Ingenieurschulen seit ihrer Gründung aufgebaut und auch die neuere Zeit der<br />
Technischen Fachhochschule dokumentarisch erfaßt. Ziel des Archivs ist es zunächst, die Geschichte<br />
der ehemaligen Bereiche Bau, Beuth, Gauß und Gartenbau und ihr Weiterleben in der Technischen<br />
Fachhochschule in Bild, Text und Ton systematisch zu sammeln. Später sollen die jeweiligen Archivgruppen<br />
auch ausgewertet werden.<br />
Die 2. Oberschule Charlottenburg im Bildungszentrum Schillerstraße wurde auf den Namen „Friedensburg-Oberschule"'<br />
getauft. Dieser Name erinnert an unser verstorbenes Mitglied, den Bürgermeister<br />
Professor Dr. Ferdinand Friedensburg.<br />
324
Restaurierungsarbeiten an historischen Bauten in Potsdam<br />
Im Rahmen des jetzt laufenden Fünfjahrplans sollen nach einem Beschluß der Potsdamer Stadtverordneten<br />
die schöne Fassade des im Krieg zerstörten Langen Stalls (1737), das als Moschee verkleidete<br />
Pumpwerk für die Fontänen des Schlosses Sanssouci und der als Filmmuseum vorgesehene Marstall<br />
restauriert werden. In der Wilhelm-Külz-Straße ist die Restaurierung einer Reihe historischer Gebäude<br />
vorgesehen.<br />
Wie die BZ am Abend, Berlin (Ost), Nr. 37 vom 14. Februar 1977 weiter berichtet, soll sich durch<br />
Neubau von Wohnungen vor allem im „Stern" und in der Waldstadt II in den Ravensbergen die Einwohnerzahl<br />
Potsdams bis 1980 um 8000 auf 128 000 erhöhen. Die Planung sieht ferner 1600 neue<br />
Restaurantplätze sowie eine Beobachtungsstation für Satelliten-Geodäsie und ein Geophysikalisches<br />
Festkörper-Laboratorium für die Akademie der Wissenschaften der DDR auf dem Telegrafenberg vor.<br />
Denkmalschutz für das Holländische Viertel in Potsdam<br />
Das Holländische Viertel in Potsdam, dessen Abriß lange Zeit befürchtet werden mußte, ist jetzt in die<br />
(höchste) Kategorie I („Denkmale von republikweiter und internationaler Bedeutung") der Denkmalliste<br />
der DDR aufgenommen worden, die gemäß Denkmalpflegegesetz jetzt für alle Bezirke aufgestellt<br />
wird. Damit konnte der jahrelange Streit um die Erhaltung der 134 in vier Karrees angeordneten<br />
Backsteinhäuser mit ihren gegenwärtig unzulänglichen Wohnbedingungen entschieden werden. Auf<br />
Anordnung von König Friedrich Wilhelm 1. wurde dieses Ensemble 1737 bis 1742 von Baumeister<br />
Johann Boumann mit holländischen Handwerkern errichtet. Im Sinne der Peuplierungspolitik des<br />
Soldatenkönigs sollte es von holländischen Einwanderern bezogen werden. Die Generalrestaurierung<br />
dieses Viertels soll 1980 beginnen.<br />
Ehrung für Walther G. Oschilewski<br />
Am 9. Mai 1977 fand im Schöneberger Rathaus auf Einladung des Regierenden Bürgermeisters eine<br />
Feierstunde zu Ehren unseres Mitgliedes Walther G. Oschilewski statt. Eine stattliche Zahl von fachlich<br />
und literarisch mit dem Geehrten Verbundenen, von Freunden und Bekannten hatte sich zur<br />
Überreichung der Urkunde eines „Professors ehrenhalber" eingefunden, die in Vertretung des Bürgermeisters<br />
von Wissenschaftssenator Löffler mit anerkennenden Worten vorgenommen wurde.<br />
Prof. Oschilewski antwortete mit einer Dankesansprache, in welcher er uns mit seinem ebenso ungewöhnlichen<br />
wie tief beeindruckenden Lebenslauf bekanntmachte.<br />
Wir benutzen die Gelegenheit, auch an dieser Stelle Walther G. Oschilewski nochmals für die jahrzehntelangen<br />
Dienste zu danken, die er dem Verein in uneigennützigster Weise geleistet hat. Fast<br />
sämtliche Ausgaben unseres Jahrbuchs „Der Bär" wurden von ihm redigiert, und in zahlreichen wertvollen<br />
Aufsätzen hat er aus seinem großen Wissen über manches wichtige Detail aus der Geschichte<br />
unserer Stadt berichtet. Wenn Prof. Oschilewski jetzt auch die redaktionelle Leitung unseres Jahrbuchs<br />
abgegeben hat, so hoffen wir doch noch auf manchen Beitrag aus seiner unermüdlichen Feder.<br />
W. Hoffmann-Axthelm<br />
*<br />
Unserem Mitglied Franz Berndal ist im Rahmen einer Feierstunde vom Landesverband Berlin des Verbandes<br />
der Heimkehrer und deren Hinterbliebenen Deutschlands die „Silberne Ehrennadel" verliehen<br />
worden. Das Bezirksamt Charlottenburg zeichnete ihn anläßlich eines Lyrik-Wettbewerbs mit einem<br />
Lyrikpreis aus.<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche zum<br />
70. Geburtstag Frau Agathe Meinecke, Frau Margarete Oschilewski, Frau Waltraut Hahn, Frau Irmgard<br />
Zillessen, Herrn Paul-Michael Matern; zum 75. Geburtstag Herrn Arno Hartmann, Frau Gertrud<br />
Lauschke, Frau Irmgard Koch; zum 80. Geburtstag Frau Irmgard Zeye, Frau Gertrud Hedrich, Frau<br />
Käthe Haack-Schroth, Herrn Dr. Ernst Wiehert; zum 85. Geburtstag Frau Margarete Muthmann.<br />
325
Buchbesprechungen<br />
Max Mechow: Die Ost- und Westpreußen in Berlin. Ein Beitrag zur Bevölkerungsgeschichte der<br />
Stadt. Berlin: Haude & Spener 1975. 114 S., brosch., 14,80 DM. (Berlinische Reminiszenzen,<br />
Nr. 48.)<br />
Wie jede andere Weltmetropole der jüngsten Zeit ist auch Berlin nur durch den Zuzug Auswärtiger<br />
groß geworden. Dieses Einströmen, häufig ebenso begünstigt wie beargwöhnt, meistens jedoch unkontrolliert,<br />
führte in der Stadt nicht zur landsmannschaftlichen Separation, sondern zu einer<br />
Verschmelzung, die jenen Typ des weltoffenen und assimilierungsfreudigen Berliners erst herausbildete.<br />
Die Herkunftsmerkmale traten in dem Maße zurück, in dem die Aufnahmebereitschaft des<br />
„Schmelztiegels" zunahm und alle deutschen Landschaften gleichermaßen umfaßte. Dies dürfte jedoch<br />
nicht gleich zu „irrigen Vorstellungen" von der Herkunft der Berliner Bevölkerung geführt haben, wie<br />
der Autor des vorliegenden Buches eingangs vorgibt, denn seine nachfolgende Ausarbeitung beweist<br />
das Gegenteil. Danach steht fest, daß die Ost- und Westpreußen seit den 1890er Jahren den 2. Platz<br />
der Einwandererquote (hinter Brandenburg) innehatten und sogar die Schlesier hinter sich lassen<br />
konnten. Während 1864 die Zuwanderer aus Altpreußen - knapp 15 000 - noch die letzte Stelle<br />
hinter den anderen Ostprovinzen einnahmen, lebten 1905 bereits 143 000 gebürtige Ostpreußen und<br />
115 000 Westpreußen in Berlin. Dieses Potential blieb nicht ohne Auswirkungen auf die politische,<br />
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Reichshauptstadt.<br />
In Form von ausgewählten Kurzbiographien erscheinen dann die geschichtlich bedeutenden Ost- und<br />
Westpreußen aus 3 i /2 Jahrhunderten, beginnend mit Schlüter, Chodowiecki, Jablonski und Gotzkowsky,<br />
ferner E.T.A. Hoffmann, Schopenhauer, Otto Nicolai, Johann Jacoby und Fanny Lewald bis<br />
zu den namhaften Vertretern der jüngsten Vergangenheit wie Käthe Kollwitz, Ernst Wiechert, Leopold<br />
Jeßner, Paul Wegener und Kurt Schumacher. Dazwischen eine große Zahl nicht minder<br />
herausragender Zuwanderer - Unternehmer, Politiker, Militärs, Gelehrte, Künstler. Mechow weitet<br />
diese personale Studie zu einer Untersuchung der wirtschaftlich-ökonomischen Verhältnisse (und<br />
Verhaltensweisen) aus, die die Abwanderung aus den Ostgebieten bedingt haben. So verdienstvoll die<br />
Schilderung z. B. der Agrarsituation in der alten Heimat oder des Dienstbotenlebens im neuen Berlin<br />
auch ist, so gestattet der begrenzte Raum des Bändchens häufig nur recht undifferenzierte Äußerungen,<br />
die dem Thema nicht immer gerecht werden können. Auf dem Gebiet der Handwerks- und<br />
Gewerbeentwicklung Berlins, speziell in der Phase der Frühindustrialisierung, gibt es inzwischen<br />
einen erheblich erweiterten Forschungsstand zu berücksichtigen. Die gleichfalls eingestreuten Quellenangaben<br />
belegen neben Statistiken auch persönliche Lebensbilder und die Namensforschung.<br />
Trotz mancher Lücken in dieser Hinsicht bietet die Arbeit einen verdienstvollen Querschnitt durch<br />
ein bedeutendes Kapitel deutscher Binnenwanderung. Peter Letkemann<br />
Willy Brandt: Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960—1975. Hamburg: Hoffmann und<br />
Campe 1976.655 S., 16 Abb.-Taf., Leinen, 36 DM.<br />
Willy Brandt, Ehrenmitglied unseres Vereins und Ehrenbürger Berlins (1970), ist neben seinen weltweiten<br />
politischen und staatsmännischen Aktionen auch immer wieder als Schriftsteller hervorgetreten.<br />
Seine publizistische Produktivität ist enorm, sie richtet sich vornehmlich an den selbstbewußten Bürger,<br />
der das zerschlissene Kleid des Untertans abgestreift hat. Geschehnisse und Probleme während<br />
seiner Amtszeit als Bundeskanzler hat Willy Brandt schon in dem Zwischenbilanz-Buch „Über den<br />
Tag hinaus" (1974) dargestellt. In seinem neuen Buch „Begegnungen und Einsichten" ist der Rahmen<br />
weiter gefaßt: Hier beschreibt er die Zeit von 1960 bis 1975, d.h. die ereignisreichen Jahre, in denen<br />
er auf exponiertem Posten an den Schalthebeln der Zeitgeschichte stand: als Regierender Bürgermeister<br />
des Landes Berlin (1957-1966), Präsident des Deutschen Städtetages (1958 — 1963), Vizekanzler<br />
und Bundesaußenminister (1966 — 1969), als Bundeskanzler von 1969 bis zu seinem Rücktritt<br />
wegen der Guillaume-Affäre im Mai 1974 und nicht zuletzt auch als Vorsitzender der Sozialdemokratischen<br />
Partei Deutschlands (seit 1964).<br />
326
Die vorliegende fulminante Veröffentlichung ist nicht nur ein vorurteilsfreier und selbstkritischer<br />
Erfahrungs- und Erkenntnisbericht und eine Porträtgalerie der die weltpolitische Szene beherrschenden<br />
Akteure (so interessant dies auch erscheint), sondern sie ist in ihrer frappierenden Anschaulichkeit<br />
und sprachlichen Plastizität geradezu ein eindringliches Lehrbuch der politischen Vernunft, das über<br />
den Tag hinaus Geltung beanspruchen kann. Brandt mahnt, wo Fehlentscheidungen und Engstirnigkeit<br />
den Freiheitsraum beeinträchtigen und gefährden, er bemüht sich, Tabus, Immobilität und Verkrustungen,<br />
die die Politik oft so ungenießbar machen, aufzuweichen, und er kämpft um progressive<br />
Entwicklungen in Staat und Gesellschaft - der Menschen, ihrer Würde und ihrer Lebensbedingungen<br />
wegen.<br />
So werden hier viele Fakten und Spannungsfelder in ihren Hintergründen und Höhepunkten deutlich<br />
gemacht, Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten beleuchtet, ohne dabei die Schwierigkeiten und<br />
Hemmnisse zu verniedlichen. Es ist erstaunlich, wie viele Ereignisse und Geschehnisse von exemplarischer<br />
Bedeutung bereits vom Flugsand der Zeit verschüttet und damit aus dem Bewußtsein der<br />
Menschen geschwunden sind.<br />
Willy Brandts Begegnungen mit unzähligen Persönlichkeiten der internationalen Politik kulminieren<br />
in seinen Gesprächen mit J. F. Kennedy, Charles de Gaulle, Leonid Breschnew, Georges Pompidou,<br />
Edward Heath, Josip Broz Tito und vielen anderen, wobei die Unmittelbarkeit der reflektierenden<br />
Darstellung bei aller Wahrung der Diskretion als Stilmittel besonders auffällt.<br />
Wer sich von den leider noch immer grassierenden Diffamierungskampagnen freihält, wird Brandts<br />
Bemühungen um eine Symbiose von Politik und Moral, von Geist und Erfahrung den Respekt nicht<br />
versagen wollen. Niemand, der in der Politik kein mieses Geschäft, sondern eine staatsbürgerliche<br />
Aufgabe sieht, kann — wie immer man auch zu politischen Positionen dieses Mannes stehen mag- nicht<br />
an der Tatsache vorübergehen, daß dieser untadelige Demokrat den von ihm als richtig erkannten<br />
Weg geradlinig und konsequent zu verfolgen sucht. So ist es auch kein Zufall, daß ihm im Hinblick auf<br />
sein Engagement um Einführung der bundesdeutschen Außenpolitik in eine weltweite Entspannungs-<br />
und Friedensdiplomatie nach wie vor Achtung und Sympathie der Weltöffentlichkeit entgegengebracht<br />
wird, wie wohl kaum einem anderen Politiker der deutschen Nachkriegsgeschichte.<br />
Walther G. Oschilewski<br />
Gustav Sichelschmidt: Berlin in alten Ansichtskarten. Zaltbommel/Niederlande: Europäische Bibliothek<br />
1975 (2. Aufl. 1977). 156 Abb.-Taf. mit Text, Pappbd., 26,80 DM.<br />
Nachdem in der Buchreihe „Städte in alten Ansichten" in den Niederlanden bereits 800 Bände erschienen<br />
sind, in Belgien mehr als 300 und in Frankreich etwa 125, konnten bis zum Herbst 1976<br />
auch rund 100 deutsche Städte behandelt werden, darunter die früher selbständigen Charlottenburg,<br />
Spandau und Schöneberg. Der Verfasser, der die Ansichtskarten mit Geschick ausgewählt und mit<br />
Sachverstand kommentiert hat, schreibt in seiner Einleitung zu Recht, das in diesem Band vorgelegte<br />
Material wirke „jedenfalls wie ein imaginäres Museum einer Epoche, der man trotz aller latenten<br />
inneren Brüchigkeit heute Glanz und Glorie zugesteht". Die Ansichtskarten, so Gustav Sichelschmidt,<br />
reflektierten noch etwas von der Seele des alten Berlins, „das sich auf kärglichem Boden sein Lebensrecht<br />
in einer nicht immer wohlmeinenden Welt erringen mußte". Berlin, damals drittgrößte Stadt<br />
der Welt, wahrscheinlich interessanteste Metropole Europas und Mittelpunkt Deutschlands, ist heute<br />
um vieles ärmer geworden. Dies liegt nicht nur am nostalgischen Rückblick jeder Generation auf die<br />
„gute alte Zeit", sondern ganz gewiß auch an den Kriegszerstörungen und an der Stadtsanierung, die<br />
als „schmerzlicher Tiefschlag gegen den guten Geschmack" bezeichnet wird. Der Autor geht mit den<br />
Stadtplanern hart ins Gewicht, über deren Unfähigkeit „auch die monotonen Deklamationen unserer<br />
Denkmalschützer keineswegs hinweg (täuschen)".<br />
Dieser Band läßt sich jedem Berlinfreund empfehlen, gerade auch der jungen Generation. Wer weiß<br />
noch etwas vom Luna-Park am Haiensee, dessen Terrassen 7000 Besucher aufnehmen konnten,<br />
oder wer kann heute noch die Stelle des Wilmersdorfer Sees und von „Schramms Seebad Wilmersdorf"<br />
angeben? Die Abbildungen 133 bis 135 sind leider vertauscht. H. G. Schultze-Berndt<br />
327
Deutscher Planungsatlas. Bd. 9: Berlin (West), Lieferung 1: Verkehrserschließung Berlin (West),<br />
bearb. von Bruno Aust und Jürgen Bollmann. Hannover: Schroedel Verlag 1975. Textteil 25 S. m.<br />
5 Abb., Kartenteil 4 Karten, 28 DM.<br />
Der bereits in den 50er Jahren konzipierte und nach 1961 abgeschlossene Planungsatlas Berlin erhält<br />
mit den vorliegenden Karten eine erste Ergänzung. Dargestellt ist die Häufigkeit der Verkehrsmittel<br />
des öffentlichen Nahverkehrs sowie die Entfernung der einzelnen Stadtgebiete von Haltestellen des<br />
öffentlichen Nahverkehrs (Darstellung der Isodistanzen). Für jedes der beiden Stichdaten liegen Karten<br />
zur Verkehrshäufigkeit in den Spitzenzeiten wie auch zur verkehrsschwächeren Mittagszeit vor.<br />
Die Karten bieten eine Fülle von Aussagemöglichkeiten. Besonders deutlich wird die Umgestaltung der<br />
Verkehrsabläufe im Steglitz-Friedenauer Bereich durch die Verlängerung der U-Bahn-Linie von<br />
Spichernstraße bis Walther-Schreiber-Platz. Doch sind hier bereits wieder durch die Streckenverlängerung<br />
nach Steglitz Änderungen eingetreten.<br />
Die Möglichkeit des flexiblen - nach Bedarf gestaffelten - Einsatzes von Omnibussen zeichnet sich<br />
ebenso ab wie die Ballung von Nahverkehrsmitteln in den Spitzenzeiten etwa im Zoogebiet. In spezielle<br />
inhaltliche und kartographische Probleme, etwa des in der Hauptkarte nicht dargestellten Platzangebotes<br />
der einzelnen Verkehrsmittel, führt das Erläuterungsheft ein.<br />
Es bleibt zu wünschen, daß bald weitere Lieferungen dieses Kartenwerkes erscheinen mögen.<br />
Felix Escher<br />
Studien zur Europäischen Geschichte, Band XI. Herausgegeben von Hans Herzfeld, Wilhelm Berges,<br />
Otto Busch, Henning Köhler, Ernst Schulin: Zisterzienser-Studien I. Berlin: Colloquium-Verlag 1975.<br />
128 Seiten, brosch., 34- DM.<br />
Innerhalb der Reihe „Studien zur Europäischen Geschichte" ist im Colloquium-Verlag Berlin der<br />
erste Band der „Zisterzienser-Studien" erschienen. Mit ihm beginnt eine Publikationsreihe, in der<br />
die Ergebnisse eines „Forschungsschwerpunktes Zisterzienser", wie er verkürzt genannt wird, niedergelegt<br />
werden. Autoren sind Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter des Friedrich-<br />
Meinecke-Instituts der Freien Universität Berlin. Da sich die Zisterzienserforschung außerhalb der<br />
traditionellen Ordensgeschichtsschreibung bisher nur auf begrenzte historische Teildisziplinen beschränkt<br />
hat, wird mit dieser selbstgestellten Aufgabe, die „seit Beginn von der Freien Universität<br />
durch Sachmittelfinanzierung unterstützt wird", wie es im Vorwort Prof. Reinhard Schneiders<br />
heißt, hoffentlich eine wichtige Lücke in der Zisterzienserforschung geschlossen werden können.<br />
Interessant wird das Arbeitsprogramm durch das Zusammenwirken von Mediävisten aus der Landes-,<br />
Kirchen-, Wirtschafts-, Sozial-, Verfassung- und allgemeinen politischen Geschichte, deren unterschiedliche<br />
wissenschaftliche Erfahrungen umfassende und grundlegende Erkenntnisse bei der Lösung<br />
vieler noch offener Probleme in der Zisterzienserforschung versprechen, zumal eine Unzahl noch<br />
nicht publizierter Quellen einer intensiven Bearbeitung harrt.<br />
Im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte werden die ökonomische Bedeutung der Klöster<br />
in ihrer Umgebung und ihre Organisationsformen untersucht werden. Die Rolle der Grangien als<br />
landwirtschaftliche Großbetriebe und die der städtischen Klosterhöfe als Stapelplätze und Verkaufszentren<br />
dürften hierbei in den Vordergrund gerückt werden. Die Tätigkeit der Mönche als Diplomaten<br />
und Politiker im Dienst der jeweiligen Territorialherrschaft und das Verhältnis des Ordens zu<br />
anstehenden Reformen und seine Einstellung zu Häresien sollen ebenfalls erhellt werden. Quelleneditionen<br />
und Monographien werden die Folge ergänzen. Ziel aller am „Zisterzienserobjekt" beteiligten<br />
Wissenschaftler ist es, über die Ordensgeschichte hinaus neue Beiträge zur allgemeinen Mittelaltergeschichte<br />
West- und Mitteleuropas veröffentlichen zu können. Ein hochgestecktes, ungemein<br />
reizvolles Projekt also.<br />
Jeder Interessierte weiß, welche Bedeutung diesem Reformorden zukommt, wie schnell er speziell im<br />
12. Jahrhundert gewachsen ist, welches hohe Ansehen er besonders in diesem und im 13. Jahrhundert<br />
genoß, wie tief er im Rahmen seiner straffen Organisation und Wirtschaftsbestrebungen in die Belange<br />
von Kirche und Gesellschaft eingriff und welchen Einfluß er im Zusammenwirken mit der landesherrlichen<br />
Politik bei der Besiedlung der brandenburgischen Marken besaß.<br />
Im ersten Band untersucht Reinhard Schneider das Problem bewaffneter Dienstleute bei den Zisterziensern,<br />
deren zentralistische Ordensverfassung natürlicherweise auch Belastungen für die einzelnen<br />
Klöster hervorbrachte. Reisen der jeweiligen Äbte zum Generalkapitel, Bewachung der Güterlieferungen<br />
im allgemeinen Handelsverkehr und Schutz der manchmal weitab gelegenen Grangien dürften<br />
Bewaffnete im Dienst des Ordens notwendig gemacht haben.<br />
328
Peter Feige beleuchtet die Entstehung der Zisterzienserkongregationen auf der Iberischen Halbinsel,<br />
und Wolfgang Ribbe stellt in einem Beitrag zur Ordenspolitik der Askanier heraus, wie planmäßig<br />
sich die Landesherrschaft im Elbe-Oder-Raum der Zisterzienser zu bedienen wußte, ehe ihre eigene<br />
Verschuldung die Wirtschaftskraft und damit die Unabhängigkeit des Ordens wieder erheblich<br />
stärkte.<br />
Noch einmal berichtet Reinhard Schneider über Güter- und Gelddepositen in Zisterzienserklöstern<br />
und zeigt die Stellung des Ordens im mittelalterlichen Wirtschafts- und Finanzleben.<br />
Die nächsten zwei Bände sollen im Spätsommer erscheinen. Man sieht der Niederlegung der Forschungsergebnisse<br />
des Zisterzienserprojekts mit Spannung entgegen, weil sie die überragende Rolle<br />
des Ordens im Hohen Mittelalter weit gefächert sichtbar machen werden. Günter Wollschlaeger<br />
Olaf Groehler: Das Ende der Reichskanzlei. Herausgeber: Zentralinstitut für Geschichte der Akademie<br />
der Wissenschaften der DDR. (Ost-)Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1976.<br />
40 S. broschiert, 5,-M.<br />
Bestrebungen, die Geschichte zu popularisieren, sind allenthalben anzutreffen. Dies gilt für neue Geschichtszeitschriften<br />
mit Hinwendung an die breite Öffentlichkeit wie für die Reihe „illustrierte historische<br />
hefte" der Akademie der Wissenschaften der DDR, die mit dem hier vorliegenden Heft eingeleitet<br />
wurde. (Die Titel der Hefte 2 bis 4 sind: Evemarie Badstübner-Peters: Wie unsere Republik<br />
entstand; Willibald Gutsche: 1. August 1914; Baidur Kaulisch: U-Bootkrieg 1914/1918).<br />
Der Schilderung der Tage vom 20. April bis 1. Mai 1945 in der (Neuen) Reichskanzlei wird deren<br />
Chronik vorangestellt, vom Auftrag Ende Januar 1938 an Albert Speer zum Neubau an der Voßstraße,<br />
über die Einweihung nur ein Jahr später am 12. Januar 1939 bis zum Kriegsende und zur<br />
Sprengung der letzten Ruine im Sommer 1950 und der Verwendung von Steinen und Marmor für<br />
das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park und für den U-Bahnhof Thälmannplatz. Man erfährt hier<br />
wie auch schon in anderen Publikationen die jeweilige Frontlage und die Geschehnisse in der Reichskanzlei.<br />
Die Sprache hat nicht unbedingt populärwissenschaftliches Niveau, wenn es etwa heißt:<br />
„Dönitz mausert sich zum Stellvertreter des in Agonie liegenden faschistischen Reiches". Von Interesse<br />
ist ein Anlageplan der Reichskanzlei einschließlich der unterirdischen Anlagen.<br />
H. G. Schultze-Berndl<br />
Berliner Wände. Bilder aus einer verschwundenen Stadt. In Ost-Berlin fotografiert von Thomas<br />
Höpker. Begleittext von Günter Kunert. München/Wien: Hanser 1976. 96 Seiten Abb. mit Text,<br />
lamin. Pappbd., 38,-DM.<br />
Als farbiges Titelfoto prostet einem der offenbar unverwüstliche und auch die Ost-West-Spaltung<br />
überstehende Schultheiss auf einem lädierten Wandbild entgegen (und auch auf Seite 74 ist die<br />
reichgestaltete Fassade der Bergbrauerei abgebildet, durch deren leere Fensterhöhlungen man in das<br />
Grün der inzwischen herangewachsenen Natur blickt). Thomas Höpker, den man als einen Star-<br />
Fotografen bezeichnen könnte, wenn er nicht ein „stern"-Fotograf wäre, hat in Ost-Berlin, meist<br />
in den Bezirken Prenzlauer Berg und Mitte, seine Bilder von Berliner Wänden und Wandstücken<br />
aufgenommen, denen vom Bildmotiv her und durch die Linse des Fotografen Symbolgehalt zukommt.<br />
Günter Kunert, in Ost-Berlin lebender Lyriker und Erzähler, hat diesem eigenwilligen Band<br />
einen Essay „Besuch im versunkenen Berlin" beigegeben, den er wie folgt einleitet: „Ein neues Vineta<br />
— so liegt das alte Berlin auf dem Grunde der Vergangenheit, vom Vergessen überspült, und nur<br />
manchmal, unter besonders günstigen atmosphärischen Bedingungen, wird es wie durch einen<br />
Schleier sichtbar." Das Besondere Berlins wird ständig insularer (und zwar gerade in der „Hauptstadt<br />
der DDR"): Es schrumpft räumlich, je umfassender der Aufbau vorangeht. Kunert erkennt den<br />
Hauswänden und den auf ihnen angebrachten Zeichen eine eigene Stimme zu: Diese verkommenen<br />
und vergammelten Häuser, echte Plebejer in einer Gegenwart, die dem Plebejischen hauptsächlich<br />
Lippendienst leistet, reden lauter und ungenierter von ihrer durchlebten Zeit, und manche von ihnen<br />
tun das sogar schriftlich: in Worten, Zeichen, Symbolen, zu enigmatischen Chiffren gewordenen<br />
Buchstaben, mit Kritzeleien und Graffiti, wie es für das Altertum kennzeichnend gewesen ist.<br />
Kritisch merkt Kunert an, welches das Programm einer Sanierung hätte sein müssen, „ganz zu schweigen<br />
vom historischen Stadtkern, der nicht annähernd so beschädigt war wie die Zentren von Warschau,<br />
329
Danzig, Breslau. Spät, nämlich eine ganze Generation nach der Zerstörung, beginnt die Wiederherstellung<br />
des alten Gendarmenmarktes, . . . beginnt auch die Restaurierung des Berliner Doms." Verfremdung,<br />
Eindringlichkeit, Fälle des Inhalts und der Botschaft ergeben sich daraus, daß die hier<br />
gezeigten Dinge in den Fotografien als Medium auftauchen: ein Medium in einem anderen. Und<br />
um noch einmal auf die Eingangsworte zurückzukommen, diesmal aber Günter Kunert zu zitieren:<br />
Dem Schultheiss mit dem monströsen Bierseidel wird durch den gegenwärtigen Zustand der Beschädigung<br />
eine neue Würde verliehen; das Höpkersche Foto stattet ihn zudem mit der Qualität eines<br />
Artefaktes aus, welches, wie andere seinesgleichen, Interpretation ebenso provoziert wie legitimiert.<br />
H. G. Schultze-Bernd!<br />
*<br />
Unser Jahrbuch „Der Bar von Berlin" wird voraussichtlich Ende September ausgeliefert werden. Die<br />
Mitglieder erhalten den Band zugeschickt, soweit sie den fälligen Mitgliedsbeitrag für das laufende<br />
Jahr < /. Z. 36 DM) entrichtet haben.<br />
Im II. Vierteljahr 1977<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Heinz-Günther Bahr. Kirchenmusikdir.<br />
1000 Berlin 41, Dickhardtstraße 42<br />
Tel. 8 52 43 86 (Vorsitzender)<br />
Fritz Bunsas, Ingenieur<br />
1000 Berlin 42, Hoeppnerstraße 37<br />
(Bibliothekare)<br />
Prof. Dr. Dietrich Hahn, Physiker<br />
1000 Berlin 38. Am Schlachtensee 98<br />
Tel. 8 03 31 17 (Dr. Hans Leichter)<br />
Sigismund Keuten, Linoleumhändler<br />
1000 Berlin 31, Westfälische Straße 58<br />
Tel. 8 92 53 94 (Brauer)<br />
Erhard Mayer, Gärtner<br />
1000 Berlin 41. Rubensstraße 23<br />
Tel. 8 55 32 23 (Dieter Brozat)<br />
Rainer Peglow, Auszubildender<br />
1000 Berlin 51, Romanshorner Weg 29<br />
Tel. 4 51 83 98 (Dr. Bickerich)<br />
Angelika Rutenborn. Hausfrau<br />
1000 Berlin 44, Schillerpromenade 16/17<br />
Tel. 6 23 52 19 (Vorsitzender)<br />
Dr. Klaus-Joachim Schneider, Rechtsanwalt<br />
1000 Berlin 38, Elvirasteig 6c<br />
Tel. 8 01 85 59<br />
(Frau Dr. Hoffmann-Axthelm)<br />
Marianne Strobel<br />
1000 Berlin 31, Paulsborner Straße 20<br />
Tel. 8 91 15 65 (Günther Linke)<br />
330<br />
Ellen Wiegand, Rentnerin<br />
1000 Berlin 41, Opitzstraße 3<br />
• Tel. 8 12 21 44 (Alice Hamecher)<br />
Wilhelm Zilkenat, Reg.-Amtmann<br />
1000 Berlin 21, Jagowstraße 42<br />
Tel. 3 91 29 10 (Dieter Zilkenat)<br />
Dr. G. B. von Hartmann, Chemiker<br />
1000 Berlin 31, Ringbahnstraße 9<br />
Tel. 8 92 98 44<br />
(Frau Dr. Hoffmann-Axthelm)<br />
Werner Papke, Vertreter<br />
1000 Berlin 20, Kretzerzeile 4<br />
Tel. 3 66 84 04<br />
(Frau Dr. Hoffmann-Axthelm)<br />
Gabriele Villain, Schulleiterin<br />
1000 Berlin 19, Eichenallee 62<br />
Tel. 3 04 83 66 (Adelheid Rintelen)<br />
Hildegard Rudolph, Rentnerin<br />
1000 Berlin 30, Goltzstraße 12<br />
Tel. 2 16 18 89 (Vorsitzender)<br />
Wolfgang Liebehenschel, Dipl.-Ing., Baudirektor<br />
1000 Berlin 37, Am Lappjagen 7<br />
Tel. 8 13 58 92 (Brauer)
Studienfahrt ins Wendland<br />
Die diesjährige Exkursion führt vom 23. bis 25. September ins Hannoversche Wendland, in den Bereich<br />
des seit 1968 bestehenden Naturparks Elbufer-Drawehn (Drawehn = wendisches Wort für<br />
„Waldland") im Kreis Lüchow-Dannenberg. Die etwa um 800 eingewanderten slawischen Wenden<br />
und ihre Sprache sind um die Mitte des 18. Jahrhunderts untergegangen. Die für das Wendland<br />
typische Dorfform der Rundlinge ist allerdings von den Wenden weder geplant noch gestaltet; auch<br />
deutsche Siedler lebten zusammen mit den Wenden in Runddörfern. Der als „Wendenknüppel"<br />
bekannte hölzerne Giebelpfahl kommt in gleicher Weise außerhalb slawischer Siedlungsgebiete vor.<br />
Die Teilnehmer an der Studienfahrt werden in Hitzacker untergebracht, von dem Merlan vor 300 Jahren<br />
schrieb, „das Ampt vnd Stättlein Hitzger oder Hitzakker ist in einer lustigen Gegend an der<br />
Elbe gelegen". Zweimal ist Hitzacker ins „Rampenlicht der Weltgeschichte" getreten: einmal 1635, als<br />
Herzog August der Jüngere aus Hitzacker, der kleinen Residenz seines Anteils an der Herrschaft Dannenberg.<br />
seinem „nova Ithaka", zum Herzog von Braunschweig und Lüneburg berufen wurde und<br />
seine bedeutende Bibliotheca Augusta nach Wolfenbüttel mitnahm. Zum anderen hatte Claus von<br />
Arnsberg, Klassenkamerad unseres Schriftführers und jetzt Prinz Claus der Niederlande, seinen Wohnsitz<br />
in Hitzacker.<br />
Es ist das folgende Programm vorgesehen:<br />
Freitag, 23. September 1977<br />
6.30 Uhr Abfahrt von der Hardenbergstraße 32 (Berliner Bank)<br />
11.30 Uhr Besuch der Brauerei Wittingen, Imbiß, Führung durch die Braustätte, Referat von<br />
Dr. H. G. Schultze-Berndt „Zur Historie der Bierstadt Wittingen und ihrer<br />
Brauerei" sowie Abtrunk<br />
17.00 Uhr Ankunft in den Hotels in Hitzacker<br />
19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im „Waldfrieden"<br />
Sonnabend, 24. September 1977<br />
9.00 Uhr Abfahrt in das Rundlingsdorf Bussau<br />
9.30 Uhr Kurzreferat von Landesbaupfleger Professor Dr.-Ing. Erich Kulke, Mitbegründer<br />
des „Vereins zur Erhaltung von Rundlingen im Hannoverschen Wendland", über<br />
die Eigenart der Rundlinge<br />
Anschließend Weiterfahrt nach Lübeln in den Wendlandhof. Dort Vortrag von<br />
Dr. Berndt Wächter: „Deutsche und Slawen im Licht der archäologischen Forschung"<br />
12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Ratskeller Lüchow<br />
14.00 Uhr Dia-Vortrag im kleinen Saal des Ratskellers vom Wilhelm Meier-Peithmann über<br />
die Vogelwelt im Naturpark Elbufer-Drawehn<br />
15.30 Uhr Weiterfahrt durch die Rundlinge und anschließend durch die Göhrde mit Kaffeepause<br />
19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Schafstall auf dem Schafskovenberg in Ventschau<br />
(Spanferkel, 12,50 DM)<br />
Sonntag, 25. September 1977<br />
9.30 Uhr Abfahrt, auf der Eibuferstraße über den Kniepenberg (Gründungspunkt des Naturparks)<br />
bis nach Lauenburg<br />
12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen in Lauenburg und Rundgang durch die Elbestadt<br />
ca. 20.00 Uhr Ankunft in Berlin<br />
Änderungen vorbehalten!<br />
Auf der gesamten Fahrt am 24. September und am Sonntag bis zum Kniepenberg werden wir dankenswerterweise<br />
vom Geschäftsführer des Naturparks Elbufer-Drawehn e.V., Bürgermeister Oberstleutnant<br />
a. D. Walter Eschrlch, begleitet.<br />
331
Richten Sie bitte Ihre Anmeldungen formlos bis zum 25. Juli 1977 an Dr. H. G. Schultze-Berndt,<br />
Seestraße 13, 1000 Berlin 65. In Rundschreiben werden Sie über weitere Einzelheiten der Studienfahrt<br />
unterrichtet und dann auch um den Kostenbeitrag von 60,- DM je Person gebeten, der die<br />
Omnibusfahrt und alle weiteren Aufwendungen einschließt. In Hitzacker sind insgesamt 30 Einzelzimmer<br />
und 8 Doppelzimmer reserviert worden, etwa zur Hälfte in der gehobenen Preisklasse des<br />
Parkhotels (laut Prospekt 32,- DM bis 40,- DM Endpreis je Bett). Wenn eine niedrigere Kategorie<br />
gewünscht wird, müßten Sie dies bei der Anmeldung mitteilen.<br />
Gesonderte Einladungen werden nicht verschickt!<br />
Hatte Obersuperintendent Hildebrand: 1671 geschrieben, bei den Wenden sei ,.freßen und sauffen<br />
ihr erstes, ihr letztes, ihr aller bestes", so wurde ihm 1914 widersprochen, daß Spiel und Trunk nur<br />
Laster der „Germanen" in der Lüneburger Heide seien, die „der verschlagene Wende" nicht kenne.<br />
Wir bilden uns ein eigenes Urteil!<br />
Veranstaltungen im III. Quartal 1977<br />
1. Freitag, 15. Juli 1977, 9.30 Uhr: Besichtigung der Gipsformerei der Stiftung Preußischer<br />
Kulturbesitz. Sophie-Charlotte-Straße 17. Führung durch Herrn Ernst Kretschmann.<br />
Fahrverbindungen: Busse 54, 74, 87, S-Bahn Westend.<br />
2. Sonnabend. 16. Juli 1977, 15 Uhr: Besichtigung der Ausstellung „Theodor Hosemann"<br />
im Torhaus der Spandauer Zitadelle, 1. Stockwerk, Straße Am Juliusturm. Führung<br />
durch Herrn Wolfram Geister. Fahrverbindungen: Busse 13, 55, 99.<br />
3. Sonnabend. 23. Juli 1977, 10 Uhr: Besichtigung des Landesarchivs, Kalckreuthstraße<br />
1 — 2 Ecke Kleiststraße. Führung durch Herrn Dr. Gerhard Kutzsch. Fahrverbindungen:<br />
U-Bahn Wittenbergplatz, Busse 19, 85.<br />
Im Monat August finden keine Vorträge und Führungen statt. Die Bibliothek ist zu<br />
den üblichen Zeiten geöffnet.<br />
4. Freitag. 2. September 1977, 18 Uhr: Besichtigung des Kraftwerkes Reuter. Otternbuchtstraße.<br />
Führung durch Herrn Hauß. Fahrverbindungen: Busse 10, 55, 99, 72.<br />
5. Sonntag, 18. September 1977, 11 Uhr: „Streiflichter aus Friedenau". Führung durch<br />
Herrn Günter Wollschlaeger. Treffpunkt: Kaisereiche. Fahrverbindungen: Busse 48,<br />
75,85,25.<br />
6. 23. bis 25. September: Studienfahrt ins Wendland. Ausführliches Programm auf der<br />
vorhergehenden Seite. Bitte Anmeldungsmodus beachten.<br />
Freitag. 29. Juli, 26. August und 30. September 1977. zwangloses Treffen in der<br />
Vereinsbibliothek ab 17 Uhr.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1000 Berlin 31.<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1000 Berlin 65, Seestraße<br />
13. Ruf 45 30 11. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1000 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1000 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank, 1000 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1000 Berlin 10, Otto-Suhr-AUee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1000 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Claus P.<br />
Mader; Felix Escher. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt. Bezugspreis für<br />
Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1000 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
332
Schabt dcr7^, , ! , ?, tf, * lr A 20 377 F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
73. Jahrgang Heft 4 Oktober 1977<br />
Berliner Telefonzelle um 1913 (Foto: Landesbildstelle Berlin)<br />
333
Es begann in Berlin: Hundert Jahre Fernsprecher (1877 — 1977)<br />
Von Gerd Gnewuch<br />
„Meine Herren, diesen Tag müssen wir uns merken", sagte der Generalpostmeister<br />
Heinrich Stephan am 26. Oktober 1877, als die ersten Sprechversuche zwischen dem<br />
Generalpostamt (Leipziger Straße 15) und dem etwa 2 km entfernten Haupttelegrafenamt<br />
(Französische Straße 33 c) erfolgreich verlaufen waren. Es war der Geburtstag des deutschen<br />
Fernsprechwesens, und Stephan selbst hatte das neue Kind der Technik aus der<br />
Taufe gehoben. Kurz zuvor hatte er in einer amerikanischen Zeitschrift vom Telefon des<br />
in Boston lebenden Alexander Graham Bell gelesen und sofort die Bedeutung des Gerätes<br />
als umfassendes Kommunikationsmittel erkannt. Stephan ließ sich von dem in Berlin<br />
weilenden Leiter des Londoner Haupttelegrafenamts zwei Beil-Telefone beschaffen, die<br />
am 25. Oktober 1877 im Gebäude des Generaltelegrafenamts (Französische Str. 33b/c)<br />
erprobt wurden, einen Tag vor dem oben erwähnten „Geburtstag".<br />
Bald danach wurden weitere Versuche, im Fernverkehr über Telegrafenleitungen, zwischen<br />
Berlin und den Orten Schöneberg (6 km), Potsdam (26 km), Brandenburg (61 km) und<br />
Magdeburg (150 km) abgewickelt. Am 12. November 1877 ließ Stephan das Telefon, das<br />
er in „Fernsprecher" umbenannte, dem Reichskanzler Fürst Bismarck in Varzin und am<br />
25. November dem Kaiser in seinem Berliner Palais vorführen. Aber damit war der<br />
Siegeszug des Fernsprechers noch nicht gesichert. Den Anfang dazu machte die Reichs-<br />
Post- und Telegrafenverwaltung selbst, die das von Siemens nachgebaute und verbesserte<br />
Beil-Gerät als Hilfsmittel im Telegrafendienst einsetzte. Die erste Telegrafenbetriebsstelle<br />
arbeitete damit seit dem 12. November 1877 in Friedrichsberg bei Berlin. 18 weitere<br />
Postanstalten, darunter die in Britz, Friedrichsfelde, Reinickendorf, Weißensee und<br />
Wilmersdorf, schlössen sich an. Deutschland war somit das erste Land der Welt, das den<br />
Fernsprechverkehr in den öffentlichen Nachrichtendienst einführte.<br />
Aber Stephan kam mit seinem bereits Ende 1877 gefaßten Vorsatz, den Fernsprecher auch<br />
dem privaten Nachrichtenverkehr nutzbar zu machen, nicht voran. Bei den Berlinern galt<br />
das von Siemens für 12 Goldmark angebotene Gerätepaar als technisches Spielzeug, über<br />
das Witzblätter gern herfielen. Auch unter der Berliner Kaufmannschaft fanden sich<br />
anfangs keine ernsthaften Interessenten, obwohl Emil Rathenau, der spätere Begründer<br />
der AEG, in Stephans Auftrag werbend tätig war. Der in seinen Bemühungen wenig erfolgreiche<br />
Rathenau klagte, daß „die Einwohner unserer Stadt neuen Einrichtungen gegenüber<br />
stets ungewöhnliche Kälte bewahrt haben". Doch Stephan ließ nicht locker. Gewarnt<br />
durch die Absicht des Bankiers Gerson von Bleichröder, ein privates Fernsprechnetz einzurichten,<br />
ließ Stephan seine weitreichenden Beziehungen bei den Berliner Unternehmen<br />
spielen. Zwar blieb ein Aufruf an die Berliner Öffentlichkeit (14. Juni 1880) zur Beteiligung<br />
an einer „Stadtfernsprecheinrichtung" ohne Resonanz, die Behörde begann aber<br />
trotzdem (Winter 1880) mit dem Bau der Anlage. Schließlich konnte am 12. Januar 1881<br />
die erste deutsche Fernsprechvermittlungsstelle beim Haupttelegrafenamt in Berlin mit<br />
acht Teilnehmern einen Versuchsbetrieb aufnehmen. Die ersten wagemutigen Teilnehmer<br />
waren: sechs Banken, die Direktion der Großen Berliner Pferdeeisenbahn-Aktiengesellschaft<br />
und Cäsar Wollheim (Kohlen und Metalle). Am 1. April 1881 trat die „Berliner<br />
Stadtfernsprecheinrichtung" mit 48 Anschlüssen, darunter neun Börsensprechstellen, aus<br />
dem Versuchsstadium an die Öffentlichkeit. Das erste Teilnehmerverzeichnis, ein Heft-<br />
334
Fernsprechamt in Berlin um 1890<br />
chen mit 200 Eintragungen, erschien am 14. Juli 1881. Bis auf das Königliche Polizeipräsidium,<br />
Molkenmarkt 1, fehlen darin die Behörden (selbst die Post!) völlig. Jedoch findet<br />
man in dem Verzeichnis so bekannte Namen wie die Bankhäuser Mendelssohn u. Co..<br />
Bank für Handel und Industrie, Dresdner Bank, Delbrück, die Handelshäuser Ravene,<br />
Spindler, Gerson und Borchardt, die Vossische Zeitung und das Berliner Tageblatt sowie<br />
Siemens & Halske. Die Nr. 1 hatte die Berliner Börse (Zelle 3) erhalten.<br />
Zur ersten Vermittlungsstelle kamen noch im ersten Betriebsjahr drei weitere, und schon<br />
am 15. August 1881 wurde beim Postamt W 64 (Unter den Linden 5) dem Publikum<br />
die erste öffentliche Sprechstelle zugänglich gemacht. Ein selbständiges Stadtfernsprechamt<br />
(Oranienburger Straße 76) gab es allerdings erst seit 1887. Bis dahin gehörte der Fernsprechbetrieb<br />
zur Telegrafie. In den Vororten entwickelten sich schnell eigene „Stadtfernsprecheinrichtungen".<br />
So begann z.B. Rixdorf 1885 mit acht und Spandau 1886 mit<br />
335
16 Teilnehmern. Bald wurden auch benachbarte Ortsnetze wie Charlottenburg (1882) und<br />
Potsdam (1883) den Berliner Teilnehmern zugänglich gemacht. Zu dem anfangs<br />
erhobenen Gebühren-Pauschbetrag von 200 Mark jährlich kamen in diesen Fällen Zuschläge<br />
von 50 Mark. Der erste bedeutende Fernsprech-Fernverkehr wurde seit Dezember<br />
1883 zwischen den Börsen in Berlin und Magdeburg abgewickelt. Dem Verkehr mit<br />
Hamburg (seit 1887) und Dresden (seit 1888) dienten oberirdische Fernleitungen aus<br />
Bronzedraht. Der erste Auslandsverkehr fand 1894 zwischen Berlin und Wien statt.<br />
1889 zählte man in Berlin schon die 10 000. Sprechstelle. Damals begann man verstärkt,<br />
das bis dahin über die Dächer der Häuser gespannte Leitungsnetz durch unterirdische,<br />
in gußeisernen Röhren verlegte Kabel zu ersetzen. 1899 setzte man in Berlin, bei Postämtern,<br />
Privatgeschäften und auf Bahnhöfen versuchsweise die ersten Münzfernsprecher<br />
ein. 80 andere deutsche Orte schlössen sich diesem Beispiel an. In Berlin arbeitete auch<br />
(seit 1900) eine erste, allerdings nichtöffentliche Vermittlungsstelle mit Wählbetrieb,<br />
wobei die Teilnehmer (selbstwählend) ohne Hilfe einer Vermittlungskraft miteinander<br />
sprechen konnten. Aber erst nach dem Ersten Weltkrieg konnte damit begonnen werden,<br />
den Berliner Fernsprechbetrieb planmäßig auf Selbstwählverkehr umzustellen.<br />
Das war auch unerläßlich, denn die Aufnahmefähigkeit der technisch veralteten 41 Vermittlungsstellen<br />
mit Handbetrieb war erschöpft. Seit dem 18. Juni 1922 (zunächst nur<br />
innerdienstlich) arbeitete die erste Selbstwähl-Vermittlungsstelle (Berlin-Zehlendorf). Für<br />
das Publikum begann der Selbstwählverkehr 1926 bei den Ämtern Lichterfelde. Wannsee<br />
und Breitenbach. Die letzte Handvermittlungsstelle („Bismarck") wurde am 15. März<br />
1936 auf Wählbetrieb umgestellt. Damals gab es in Berlin sieben Fernsprechämter,<br />
75 Vermittlungsstellen und 502 000 Anschlußeinheiten, davon 291 000 Hauptanschlüsse.<br />
Unter den 5810 öffentlichen Sprechstellen befanden sich 4260 Münzfernsprecher.<br />
Bemerkenswert für den Fernverkehr waren die Kabellegungsarbeiten von Siemens &<br />
Halske gewesen. Das Unternehmen hatte 1912 mit der Verkabelung der deutschen Fernsprech-Fernlinien<br />
begonnen. Anlaß hierfür war ein schweres Unwetter, das im November<br />
1909 um Berlin die oberirdischen Leitungen zerstört und die Stadt wochenlang vom<br />
Fernsprechverkehr mit der Umwelt abgeschnitten hatte. Dem bekannten „Rheinlandkabel"<br />
(von Berlin nach Köln und Düsseldorf) folgten nach dem Ersten Weltkrieg weitere<br />
Linien unter Beteiligung der „Deutschen Fernkabelgesellschaft". Das 1929 in Berlin W 35,<br />
Winterfeldtstraße, in Betrieb genommene Fernamt entwickelte sich bald zum größten<br />
Fernamt Europas. Es vermittelte Ferngespräche in alle Welt (seit 1930 auch über Kurzwelle<br />
nach Übersee), wickelte den Schnelldienst nach 27 Orten der Berliner Umgebung ab<br />
und stellte Leitungen für Rundfunk- und Fernsehübertragungen bereit. 1945 waren dort<br />
4700 Kräfte tätig.<br />
Bei Kriegsende 1945 waren durch Bombeneinwirkung und Erdkämpfe etwa zwei Drittel<br />
aller Fernsprechanschlüsse verlorengegangen. Nur 11 von 79 Vermittlungsstellen hatten<br />
(teilweise beschädigt) den Krieg überstanden. Der gesamte innerstädtische Fernsprechverkehr<br />
war unterbrochen, denn das meist unter Trümmern begrabene Kabelnetz war<br />
entweder durch Bomben zerrissen oder an wichtigen Stellen, z.B. durch Brückensprengungen,<br />
unterbrochen worden. Was in den Vermittlungsstellen an noch brauchbaren Einrichtungen<br />
vorhanden war, verfiel (ab Mitte Mai 1945) großenteils der Demontage.<br />
Trotzdem befahl die sowjetische Militärkommandantur schon am 13. Mai 1945, bis zum<br />
20. Mai 25 000 Anschlußeinheiten in Betrieb zu setzen und Verbindungen zwischen<br />
Behörden. Krankenhäusern und lebenswichtigen Betrieben herzustellen. Zugleich mußte<br />
336
Haupttelegraphenamt Berlin, Ecke Oberwall- und Französische Straße 33 b/c<br />
der Fernsprechdienst der Besatzungsmächte vorrangig gesichert werden. Die drei Berliner<br />
Telegrafenbauämter lösten die ihnen gestellten Aufgaben trotz unüberwindlich erscheinender<br />
Schwierigkeiten.<br />
Mitte Juli 1945 erschien ein „Amtliches Verzeichnis der Fernsprechteilnehmer in Berlin<br />
1945" mit einer Auflage von 500 Stück. Es umfaßte auf 49 Seiten (Oktavformat) etwa<br />
750 Anschlüsse von Behörden, Versorgungsbetrieben usw. Die Zahl der privaten Anschlußinhaber<br />
war auf Befehl der Alliierten Kommandantur (23. August 1945) auf 2 v.H.<br />
der Zivilbevölkerung beschränkt worden. Alle Anschlüsse mußten neu beantragt werden,<br />
wobei die Stadtkommandanten, zeitweilig unter Beteiligung der Bezirksbürgermeister,<br />
ein langwieriges Prüf- und Genehmigungsverfahren ausübten.<br />
Ende 1945 waren 18 Vermittlungsstellen mit etwa 16 000 Anschlußeinheiten wieder<br />
betriebsfähig, und es erschien (Januar 1946) nach dem Stand vom Dezember 1945 das<br />
„Amtliche Fernsprechbuch für Berlin". Es enthielt auf 436 Seiten etwa 10 000 Anschlüsse<br />
meist behördlichen Charakters. Dem Mangel an Privatanschlüssen versuchte die Post<br />
durch Einrichtung öffentlicher Sprechstellen (seit November 1945) in den postalischen<br />
Schalterräumen zu begegnen. Weitere Erleichterungen brachten die seit Januar 1946 bei<br />
den Postämtern installierten Münzfernsprecher, deren Zahl bis Ende 1946 auf 1000 anwuchs.<br />
Obwohl das erste Fernsprechhäuschen schon am 20. Dezember 1945 dem Verkehr<br />
übergeben wurde (Standort: Schöneberg, Ecke Potsdamer und Grunewaldstraße), stieg<br />
337
Telefonarbeiten auf den Dächern von Berlin (Aus: „Daheim" 1882. Nr. 25)<br />
die Zahl der „Zellen" mangels Glas und anderer kaum erreichbarer Materialien dagegen<br />
nur langsam an. Der Fernverkehr war nach dem Ende des Krieges nur stockend in Gang<br />
gekommen. Die Kriegszerstörungen beim Fernamt waren zwar nicht besonders schwerwiegend,<br />
doch wurden nach der Besetzung des Gebäudes durch russische Truppen etwa<br />
70 v.H. der vorhandenen technischen Einrichtungen ausgebaut und abtransportiert.<br />
Die Demontageverluste sind auf einen Wert von 13 Mio. Mark geschätzt worden. Am<br />
7. Juli 1945 übernahm die amerikanische Besatzungsmacht die Verfügungsgewalt über<br />
das Haus.<br />
338
Leitungsgestänge<br />
der Fernlinie 8<br />
am S-Bhf. Botanischer<br />
Garten (1921)<br />
(Alle Bilder: Berliner<br />
Post- und Fernmeldemuseum)<br />
Anfang August 1945 wurde der Ferndienst für den zivilen Behördenverkehr mit fünf<br />
Orten in der SBZ aufgenommen. Nach einer Genehmigung durch die Alliierte Kommandantur<br />
konnten vom 31. Januar 1946 an bestimmte Privatteilnehmer den Fernsprechdienst<br />
zwischen Groß-Berlin und der SBZ wahrnehmen. Die Erlaubnis wurde bereits am<br />
25. Februar 1946 auf den Verkehr mit den übrigen Besatzungszonen ausgedehnt. Wer<br />
telefonieren durfte, entschieden die Stadtkommandanten für ihre jeweiligen Sektoren.<br />
Der erste (selbstverständlich ebenfalls genehmigungspflichtige) Auslandsverkehr setzte<br />
am 3. April 1948 ein.<br />
Auf Veranlassung der Deutschen Wirtschaftskommission der SBZ begannen schon 1948,<br />
und zwar vor der politischen Spaltung Berlins, die Arbeiten zum Aufbau eines separaten<br />
Fernmeldenetzes im Ostsektor. Die auf das Fernamt in Berlin W 35 zuführenden Fernkabel<br />
erhielten außerhalb West-Berlins Schaltstellen, die eine spätere Trennung ermöglichen<br />
sollten. Bei der Spaltung wurden nach dem 30. November 1948 von 99 481 Fernsprechhauptanschlüssen<br />
und 1806 öffentlichen Sprechstellen 31 710 Anschlüsse und<br />
571 Sprechstellen der Kontrolle der (westlichen) Magistratspost entzogen. Bald darauf<br />
339
wurden auch die Anschlüsse von Teilnehmern, die in der SBZ, im südwestlichen Stadtrandgebiet<br />
Berlins, wohnten und deren Vermittlungsstellen in Berlin (West) lagen, auf<br />
Fernsprechämter in Potsdam, Teltow und Kleinmachnow umgeschaltet. Vom 12. April<br />
1949 an nahm das bis dahin auf den Behördenverkehr beschränkte, im sowjetischen<br />
Sektor liegende Fernamt Lichtenberg den Dienst zwischen Ost-Berlin und der SBZ wahr.<br />
Ohne Vorankündigung wurden von der Postverwaltung im anderen Teil Berlins am<br />
14. April 1949 die 89 Fernleitungen, die vom Fernamt (Berlin W 35) in die SBZ führten,<br />
abgetrennt und auf das Amt im Ostsektor umgeschaltet. Gespräche aus Berlin (West) in<br />
die SBZ mußten nun entweder über Lichtenberg oder auf dem Umweg über Westdeutschland<br />
geführt werden.<br />
Ein wichtiges Datum, das in seiner politischen Bedeutung weit über den praktischen<br />
Fernsprechdienst hinausgeht, markiert der 27. Mai 1952. An diesem Tage wurde - vom<br />
Ostsektor aus — das innerstädtische Berliner Fernsprechnetz unterbrochen. Durch Umleitung<br />
von Gesprächen über die Bundesrepublik war wenigstens ein bescheidener, oft mit<br />
langen Wartezeiten verbundener Sprechverkehr mit Teilnehmern in Ost-Berlin möglich.<br />
Dagegen gestaltete sich der Fernsprechverkehr mit dem Westen durch Ausbau der Funkwege<br />
zunehmend günstiger. Am 5. August 1954 führte der damalige Berliner Finanzsenator<br />
Dr. Haas mit dem Bonner Oberbürgermeister das erste Selbstwähl-Ferngespräch<br />
von Berlin aus in die Bundesrepublik. 1959 stand die erforderliche Zahl der Fernleitungen<br />
für einen umfassenden Selbstwählferndienst zur Verfügung. Nur die Bereiche um Hannover<br />
und Nürnberg blieben bis zur Inbetriebnahme des Fernmeldeturms auf dem Schäferberg<br />
(1964) im handvermittelten Dienst erreichbar. Seit 1966 ist Berliner Teilnehmern auch<br />
die Selbstwahl in zahlreiche Gebiete des Auslandes möglich. Im innerstädtischen Bereich<br />
von Berlin (West) konnte das Fernmeldebauvolumen in den Jahren zwischen 1960 und<br />
1970 mit der Zahl der Anträge nicht Schritt halten. Zu der Versorgung der neuen Satellitenstädte<br />
mit Anschlüssen kam die notwendige Umstellung auf das Zehnmillionensystem<br />
(Rufnummern siebenziffrig). Viele Antragsteller kamen auf die erst Mitte 1975<br />
„abgebaute" Warteliste, auf der sich z.B. 1971 über 59 000 Antragsteller befanden.<br />
Im Januar 1971 konnten zur Erleichterung des Fernsprechverkehrs zwischen Berlin (West)<br />
und der DDR (einschließlich Ost-Berlin) 10 Handrufleitungen zwischen dem West-Berliner<br />
Fernmeldeamt 1 und dem Fernamt Potsdam geschaltet werden. Dadurch konnte seit dem<br />
31. Januar 1971 nach jahrelanger Pause wieder ein direkter - wenn auch handvermittelter<br />
— Fernsprechverkehr zwischen beiden Teilen Berlins durchgeführt werden. Als Folge<br />
weiterer, mit dem Berlin-Abkommen zusammenhängender Verhandlungen nahm die Zahl<br />
der von östlicher Seite bereitgestellten Verbindungen nach und nach zu. Heute (Stand:<br />
31. Dezember 1976) stehen im Fernsprechverkehr mit der DDR und Berlin (Ost) abgehend<br />
280 voll- und 69 halbautomatische Leitungen und ankommend dagegen nur 72 voll- und<br />
11 halbautomatische Leitungen zur Verfügung. Dem postinternen Betriebsdienst dienen<br />
einige zusätzliche Handrufleitungen.<br />
Den Dienst in Berlin (West) versehen ein Fernmeldeamt für den Weitverkehr, vier Fernmeldeämter<br />
für den Ortsverkehr, 95 Ortsvermittlungsstellen und ein Fernmeldezeugamt.<br />
Nach dem Stand vom 31. Dezember 1976 gibt es in Berlin (West) 848 772 Haupt- und<br />
247 172 Nebenanschlüsse. Unter den 4891 öffentlichen Sprechstellen sind 4718 Münzfernsprecher.<br />
Die West-Berliner wickeln im Tagesdurchschnitt etwa 2 Millionen Orts- und<br />
150 000 Ferngespräche ab (darunter 17 000 Gespräche mit Teilnehmern in Berlin [Ost]<br />
und 3300 in die DDR). Die für Berlin (West) so wichtigen Fernsprechverbindungen mit<br />
340
dem Bundesgebiet werden über Richtfunk vom Fernmeldeturm Schäferberg (nach Gartow<br />
über Lüchow bzw. Torfhaus/Harz) und vom Fernmeldeturm Frohnau (nach Clenze über<br />
Lüchow) abgewickelt.<br />
Literatur:<br />
Gerd Gnewuch und Kurt Roth: Aus der Berliner Postgeschichte. Von der OPD zur LPD Berlin<br />
1850—1975. Berlin 1975. Dort umfangreiche Quellenangaben. Die Zahlen nach dem Stand vom<br />
31. Dezember 1976 stammen aus: Landespostdirektion Berlin. Kurze Zusammenfassung wichtiger<br />
Daten aus dem Post- und Fernmeldewesen.<br />
70 Jahre Siemens-Archiv Berlin - München<br />
Von Dr. Sigfrid v. Weiher<br />
Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 37. Im Mühlenfelde 1<br />
Am 14. März 1907 gab ein Direktions-Rundschreiben der Siemens-Werke Berlin folgendes<br />
bekannt:<br />
„Herr Chefingenieur Richter 1 ist aus der Abteilung für Beleuchtung und Kraft ausgeschieden<br />
und hat im Auftrage des Herrn Geheimrat von Siemens eine neue Tätigkeit übernommen,<br />
die sich auf allgemeine, außerhalb des Geschäfts liegende, wirtschaftliche, technische<br />
und insbesondere historische Aufgaben erstrecken wird. Eine seiner wichtigsten<br />
Obliegenheiten ist die Begründung eines Archivs, zunächst der Firma Siemens & Halske.<br />
später auch der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co. Im Gebäude<br />
des Glühlampenwerkes von S&H, Helmholtzstraße 4. sind Herrn Richter für Bureau und<br />
Archiv die erforderlichen Räume zur Verfügung gestellt. Sein Assistent ist Herr Kundt."<br />
Mit dieser Verfügung hatte Wilhelm von Siemens 2 , der damalige Chef des Hauses, deutlich<br />
gemacht, daß die Traditionspflege und die Konservierung wertvoller Reminiszenzen an<br />
die Pionierzeit der Firma und der Elektrotechnik nun einen institutionellen Rahmen<br />
erhalten sollten.<br />
Der Anstoß zur Archivgründung bei Siemens kam von außen. Bereits kurz nach der Jahrhundertwende<br />
hatte Prof. Dr. Richard Ehrenber^ bei Vorbereitung seines Werkes über<br />
„Die Unternehmungen der Brüder Siemens" als erster die Briefsammlungen des Firmengründers<br />
eingesehen und für seine Arbeit ausgewertet 4 . Nachdem er im Spätjahr 1905<br />
bereits die Gründung eines ersten deutschen Werkarchivs, bei Krupp in Essen, herbeigeführt<br />
hatte, wurde nun, knapp eineinhalb Jahre später, auch bei Siemens in Berlin<br />
seinem Vorschlag entsprochen. Der Mann der ersten Stunde, Chefingenieur Richter, war<br />
zweifellos mit der ihm gestellten völlig neuartigen Aufgabe überfordert. Er hat aber in der<br />
kurzen Zeit seines Wirkens die Zusammenführung aller historisch wertvollen Dokumente<br />
eingeleitet und den Versuch unternommen, den Nachschub archivwürdiger Akten zu<br />
sichern.<br />
341
Wilhelm von Siemens<br />
(1855-1919)<br />
Nach Richters Tod im Jahre 1909 übernahm Dr. Karl Burhenne 5 die Leitung des Archivs.<br />
Es war ein mutiger Schritt der Firma, einen jungen, von der Firmentradition zunächst<br />
noch völlig unberührten, dafür aber fachlich vorgebildeten Mann für diese Aufgabe einzusetzen.<br />
Seine Studien bei Prof. Ehrenberg hatten ihm das wissenschaftliche Rüstzeug<br />
geliefert, mit neuartigen Methoden die gestellte Aufgabe anzugehen. Bei Verfeinerung<br />
und Fortsetzung der Initiativen seines Amtsvorgängers begann Burhenne nun systematisch,<br />
pensionierte Beamte und Werkmeister zu Gesprächen aufzusuchen, bei denen mit gutem<br />
Wirkungsgrad versucht wurde, Klarheit über frühere Werkverhältnisse, über die Anfänge<br />
der sozialen Einrichtungen und über technikgeschichtliche Einzelheiten zu gewinnen.<br />
Diese protokollierten Gespräche wurden für die spätere Geschichtsschreibung immer<br />
wieder herangezogen; sie ergänzten die Akten und Dokumentensammlung in nützlicher<br />
Weise. — Das 100. Geburtsjahr des Firmengründers, 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, gab<br />
Veranlassung, eine erste Sammlung musealer Objekte zur Finnengeschichte zusammenzutragen<br />
und in Siemensstadt in einer Sonderausstellung zu präsentieren. Daraus entwickelte<br />
sich dann später das Siemens-Museum. Prof. Conrad Matschoß veröffentlichte<br />
342
Werner-von-Siemens-<br />
Institut in München,<br />
Prannerstraße lü<br />
zum gleichen Anlaß eine erste Teilausgabe der Briefe von Werner Siemens in einem zweibändigen<br />
Werk 6 .<br />
Das Ende des Ersten Weltkrieges hatte gezeigt, welche große Bedeutung einer zentral<br />
gelenkten Sozialpolitik in einem Großunternehmen zukommt. So wurde Dr. Burhenne<br />
1919 mit dem Aufbau und der Leitung einer Sozialpolitischen Abteilung betraut, der er<br />
dann bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vorstand. Aus dem jungen Historiker<br />
war ein Sozialpolitiker geworden.<br />
Die Archivleitung ging 1919 auf Oberingenieur August Rotth 1 über, der während der<br />
letzten Jahre für den Firmenchef Wilhelm von Siemens als wissenschaftlicher Berater tätig<br />
war; ihm hat er 1922 ein biographisches Gedenkbuch gewidmet. Zum gleichen Zeitpunkt<br />
gedachte das Haus Siemens seines 75. Gründungsjubiläums. Man nahm dies zum Anlaß,<br />
nun im Siemensstädter Verwaltungsgebäude eine erste permanente historische Ausstellung<br />
aufzubauen, die bereits den Charakter eines echten Firmenmuseums hatte. Hierfür<br />
besorgte Rotth aus Zaukeroda in Sachsen die erste, 1882 von Siemens gebaute Grubenlokomotive,<br />
ein besonders attraktives Pionierstück der frühen Starkstromtechnik, an der<br />
jahrelang aufgrund praktischer Erfahrungen verbessert wurde.<br />
Nachdem Rotth 1929 verstorben war, übernahm Dr. Friedrich Natalis 8 die Leitung des<br />
Siemens-Archivs. Er war bis dahin praktischer Ingenieur im Bereich des Schaltwerks gewesen.<br />
Seinem Bemühen, eine möglichst lückenlose Chronologie über die wichtigsten<br />
technischen und wirtschaftlichen Leistungen des Hauses zu besitzen, verdanken wir das<br />
343
Tabellenwerk der „Pionierarbeiten", wie sie 1934 nach weitgehend selbst zusammengetragenen<br />
Einzelrecherchen und versehen mit exakten Quellennachweisen als Firmendokumentation<br />
verwirklicht wurde. Erst 33 Jahre später, 1967, gelang es, dieses Werk zu<br />
erneuern und kontinuierlich fortzuführen.<br />
1935, nachdem Natalis verstorben war, übernahm Friedrich Heintzenberg' die Archivleitung.<br />
Er hatte bis dahin die technisch-wissenschaftliche „Siemens-Zeitschrift" redigiert<br />
und herausgegeben und brachte auf dieser Grundlage auch den Sinn für publizistische<br />
Aktivierung in das Archiv. So förderte er die Benutzung des Archivs auch für Firmenfremde:<br />
der Schriftsteller Conrad Wandrey begann eine großangelegte biographische<br />
Würdigung von Werner Siemens, die wegen des zu frühen Todes des Verfassers jedoch<br />
unvollendet blieb. Georg Dettmar schrieb die Entwicklung der Starkstromtechnik in<br />
Deutschland, und Otto Mahr untersuchte die Priorität an der Entstehung der Dynamomaschine,<br />
beides technikgeschichtliche Arbeiten, die die Schätze des Siemens-Archivs<br />
zur Grundlage hatten. Heintzenberg selbst erstellte eine Stichwortkartei zu den über<br />
6000 Siemens-Brüder-Briefen und — nach dem Zweiten Weltkrieg — eine vergleichbare<br />
systematische Kartei, in der alle gesammelten Aktenstücke nachgewiesen werden und die<br />
ein breitgefächertes wissenschaftliches Arbeiten erst ermöglicht. Als Schriftsteller hatte<br />
Heintzenberg zahlreiche kleinere Arbeiten, sowohl Archivstudien als auch Veröffentlichungen,<br />
zur Siemens-Geschichte beigetragen; zuletzt gab er 1953 unter dem Titel „Aus<br />
einem reichen Leben" eine Auswahl jener Briefe von Werner Siemens heraus, die sich<br />
an Freunde und Verwandte richten. Sie bilden einen bemerkenswerten Beitrag zur Kulturgeschichte<br />
des 19. Jahrhunderts.<br />
Die Ereignisse des Jahres 1945 waren an der Firma Siemens im allgemeinen wie auch am<br />
Siemens-Archiv im besonderen nicht spurlos vorübergegangen. Nach einigen Jahren der<br />
Unschlüssigkeit mußte das Archiv 1954 auch dort etabliert werden, wohin die Firmenleitung<br />
sich aus den politischen Notwendigkeiten begeben hatte, nach München.<br />
1954 übernahm Dr. Kurt Busse 10 die Leitung des Siemens-Archivs in dem Gebäude, das<br />
seit 1903 als Technisches Büro der Siemens-Werke in München gedient hatte und nun in<br />
zweckentsprechender Weise für die Belange des Archivs und Museums der Firma umgebaut<br />
worden war. Busse hatte seit 1921 in der kulturellen Arbeit des Hauses Siemens<br />
mitgewirkt, zuletzt als Herausgeber der Werkzeitschrift „Siemens-Mitteilungen". So lag<br />
es auch nahe, daß er neben der Bekanntmachung des erweiterten Siemens-Museums,<br />
durch das er 1955 auch den Bundespräsidenten Theodor Heuss führen konnte, eine kommentierte<br />
und illustrierte Ausgabe der autobiographischen „Lebenserinnerungen" von<br />
Werner von Siemens 11 vorlegen konnte, die dieses bedeutsame Werk der Literaturgeschichte<br />
einer neuen Generation nahebrachte.<br />
Mit dem Ausscheiden von Dr. Busse 1960 trat eine strukturelle Neuordnung des Archivs<br />
insofern ein, als nun Professor Dr. Friedrich Spandöck 12 die Oberleitung von Archiv und<br />
Museum übernahm. Spandöck war Physiker, und im Ausbau des Siemens-Museums, hierbei<br />
besonders der fachbezogenen speziellen technischen Studienräume, sah er den Schwerpunkt<br />
seines Schaffens. Die Archivseite wurde von Dr. Sigfrid v. Weiher betreut, der 1951<br />
als Wirtschaftsarchivar und Technikhistoriker zum Siemens-Archiv gekommen war und<br />
der auch 1954 die Einrichtung von Archiv und Museum in München leitete.<br />
1966 entschloß sich die Firmenleitung, anläßlich des 150. Geburtstages von Werner von<br />
Siemens und des 100. Geburtstages des von Siemens gefundenen dynamoelektrischen<br />
Prinzips Archiv und Museum unter dem Namen „Werner-von-Siemens-Institut für Ge-<br />
344
Elektrische Grubenlokomotive in Zaukeroda/Sachsen von 1882 bis 1927<br />
(Alle Bilder: W.-v.-Siemens-Institut, München)<br />
345
schichte des Hauses Siemens" zusammenzufassen. Die Institutsleitung übernahmen seither:<br />
Professor Dr. Ferdinand Trendelenburg (bis 1968), Dipl.-Ing. Hans Materna (bis 1971),<br />
Dr. Kurt Reche (1972) und, nach dem sehr bald erfolgten Tod des letzteren, Dr. Karl<br />
Thalmayer. Die Archivseite im besonderen wurde und wird weiterhin von Dr. v. Weiher<br />
betreut 13 .<br />
Die Archivarbeit hatte, nachdem die Einrichtung in München vollzogen war, eine Ergänzung<br />
erfahren durch die zusätzliche wissenschaftliche Betreuung des Siemens-Familienarchivs<br />
in Goslar 14 . Die schon zu Zeiten von Friedrich Heintzenberg einsetzende Möglichkeit,<br />
fremden Benutzern das Archiv für Forschungsarbeiten zugänglich zu machen, wurde<br />
in bemerkenswerter Weise ergänzt, nachdem Professor Hans Herzfeld von der Historischen<br />
Kommission zu Berlin (FU Berlin) um 1958 gebeten hatte, die Schätze des Firmenarchivs,<br />
die ja weitgehend Berliner Geschichte dokumentieren, den Doktoranden und Diplomanden<br />
der Hochschulen zu öffnen. Diesem Gedanken wurde gern entsprochen. So sind seither<br />
zahlreiche quellenkritische Arbeiten unter mehr oder weniger Nutzung von Siemens-<br />
Archivalien in den letzten 20 Jahren zustande gekommen 15 .<br />
Das Siemens-Archiv, das sich quantitativ mit 1500 m laufenden Akten vorstellen läßt,<br />
wurde erst um 1950/52 durch eine Stichwortkartei in zweckentsprechender Weise erschlossen.<br />
Es war und ist allerdings aus den älteren Beständen immer noch erforderlich, sich<br />
an die vermuteten oder gewünschten Nachweisungen durch umständliches Nachforschen<br />
in der Akte selbst heranzutasten. Seit 1970 hat sich dieses Prozedere insofern geändert, als<br />
seither alle Neuzugänge dokumentiert werden, d.h. ein jedes aufzunehmende Aktenstück<br />
wird kritisch nach wichtigen Gesichtspunkten durchgesehen, und die anfallenden Stichwörter-<br />
für die zuvor ein einheitlicher Thesaurus erarbeitet worden war - werden in einer<br />
Schlitzlochkarte festgehalten. In absehbarer Zeit wird das System auf elektronische<br />
Datenverarbeitung übergehen, sobald die Abfrage der seit 1970 erfaßten Daten über die<br />
Lochkarten zu mühsam wird. Das bisher erfaßte Material ist dann ebenfalls auf diese<br />
Weise abfragbar, da es EDV-gerecht auf einen Archiv-Lochstreifen aufgezeichnet wurde.<br />
Die Größenordnung des Hauses Siemens, das mittlerweile weit über 300 000 Mitarbeiter<br />
in allen Teilen der Erde beschäftigt, hat seit den Jahren des schnellen Wiederaufbaues das<br />
Problem nahegelegt, eine Methode zu ermitteln, nach der die wesentlichen Unterlagen für<br />
die historische Betrachtung des Gesamthauses kontinuierlich sicher erfaßt und in das<br />
Archiv eingebracht werden. Die strukturelle Neuordnung der Unternehmens- und Zentralbereiche<br />
der Siemens AG im Jahre 1966 gaben Anlaß, entsprechende Überlegungen des<br />
Archivs nun an übergeordneter Stelle zu prüfen und in sinnvoller Weise zu regeln. So<br />
entstand 1970 eine Verfügung, nach der die Archiv-Neuzugänge wesentlich bestimmt und<br />
selektiert werden sollen durch sog. „Archiv-Verbindungsleute", die verantwortlich darüber<br />
zu wachen haben, daß aus ihren Bereichen entsprechende Dokumente, Berichte,<br />
Bilder, Tonaufnahmen usw. dem Firmenarchiv zugeführt werden. Diese Einrichtung hat<br />
sich seither gut bewährt; sie findet in gelegentlichem Gedankenaustausch aller Verbindungsleute<br />
mit der Archivleitung ihre laufende, aus der Praxis resultierende Verbesserung.<br />
Abschließend wäre noch festzustellen, daß sich seit 1952 eine historische Fachbücherei<br />
mit rund 11 000 Bänden angesammelt hat, daß das Bildarchiv - dessen Anfänge um 1935<br />
in Berlin lagen — mittlerweile über 380 000 Fotos verfügt, von denen etwa 20 % über Karteien<br />
direkt nachzuweisen sind (80 % sind in Alben) und daß dem Archiv eine eigene<br />
Dokumentationsstelle und eine Buchbinder- und Fotowerkstatt angeschlossen sind. Zur<br />
346
Zeit sind am Siemens-Archiv 11, im Gesamtbereich des Werner-von-Siemens-Instituts<br />
22 Mitarbeiter tätig. Es ist zu hoffen, daß 1982 - beim 75. Geburtstag des Siemens-<br />
Archivs - eine umfassende Dokumentation der geleisteten Arbeit dieses Instituts vorgelegt<br />
werden kann.<br />
1 Ernst Richter (1851 — 1909) trat 1878 als Ingenieur bei Siemens & Halske in Berlin ein und gehörte<br />
zum Mitarbeiterstab Friedrich v. Hefner-Altenecks. 1899 wurde er Leiter des Technischen<br />
Zentralbüros, 1907 erster Leiter des Siemens-Archivs.<br />
2 Wilhelm von Siemens (1855—1919), zweiter Sohn von Werner Siemens, trat 1879 in die väterliche<br />
Firma ein. 1890 neben seinem Onkel Carl und seinem Bruder Arnold Leiter der Firma.<br />
Nachdem die KG Siemens & Halske (im folgenden: S&H) 1897 AG geworden war und 1903 die<br />
Siemens-Schuckertwerke (im folgenden: SSW) zustande kamen, wurde Wilhelm v. Siemens Vorsitzender<br />
des Aufsichtsrates der SSW, nach dem Tode des Bruders Arnold (1918) auch Vorsitzender<br />
des AR von S&H. 1977 wurde ihm in Siemensstadt ein Denkmal gesetzt.<br />
3 Richard Ehrenberg (1857-1921) hatte um 1900 in Rostock ein Institut für exakte Wirtschaftsforschung<br />
gegründet. In seiner Zeitschrift „Thünen-Archiv" hat er sich nachhaltig für die Gründung<br />
von Betriebsarchiven eingesetzt. Sein erster Hinweis zur Gründung des Siemens-Archivs findet<br />
sich in einem Brief an Carl v. Siemens vom 26. August 1902.<br />
4 Das 1906 in lena erschienene Buch von R. Ehrenberg „Die Unternehmungen der Brüder Siemens"<br />
reicht inhaltlich bis 1870; es erschien leider nur der erste Band mit 510 Seiten.<br />
5 Dr. Karl Burhenne (1882—1963), Schüler Ehrenbergs, trat als erster wissenschaftlicher Archivar<br />
in das Haus Siemens 1909 ein. 1932 gab er in München sein Buch „Werner Siemens als Sozialpolitiker"<br />
heraus. 1919—1951 war er Leiter der Sozialpolitischen Abteilung.<br />
6 Schon 1906 hatte das Haus Siemens dem 1903 von Oskar v. Miller gegründeten Deutschen Museum<br />
in München wertvolle Geräte und Maschinen aus den ersten Jahrzehnten der Firma S&H gestiftet,<br />
Telegraphen, Meßinstrumente und die 1879 gebaute erste elektrische Lokomotive, worüber<br />
ein besonderer illustrierter Katalog mit 227 Seiten Aufschluß gibt. - C. Matschoß, Werner<br />
Siemens. Ein kurzgefaßtes Lebensbild nebst einer Auswahl seiner Briefe, 2 Bde., Berlin (Springer)<br />
1916.<br />
7 August Rotth (1854—1929) war 1895 in das Sonderbüro für Versuchskonstruktionen von S&H<br />
eingetreten und wurde 1903 Leiter des Patentbüros im Charlottenburger Werk. Sein 1922 erschienenes<br />
Werk betitelt sich „Wilhelm von Siemens, ein Lebensbild".<br />
8 Dr. Friedrich Natalis (1864—1935) war 1890 in die Bahnabteilung von S&H in Berlin eingetreten.<br />
Vorübergehend bei der El. AG vorm. Schuckert & Co. in Nürnberg tätig, kam er 1903 zu den SSW.<br />
9 Friedrich Heintzenberg (1879-1955) trat 1908 als Mitarbeiter des literarischen Büros der SSW<br />
in Berlin ein. Die 1921 von ihm gegründete „Siemens-Zeitschrift" betreute er bis zu seinem Übertritt<br />
ins Archiv 1935. - Die im Text erwähnte Arbeit C. Wandreys, die 1942 nur im ersten Teil<br />
erschien, reichte zeitlich von 1816 bis 1855. - Das im Auftrage des VDE (Verband Deutscher<br />
Elektrotechniker) erarbeitete Werk Dettmars über die Starkstromtechnik erschien 1940; es reicht<br />
inhaltlich bis 1890. - Die Entstehung der Dynamomaschine von O. Mahr war dessen Dr.-Arbeit,<br />
die Professor C. Matschoß betreute und die 1941 als Buch erschien.<br />
10 Dr. Kurt Busse (geb. 1889) war 1921 zum Hause Siemens gekommen. Er leitete zunächst den<br />
Verein der Siemens-Beamten, sodann die Werkbüchereien. Nach 1951 betreute er die wieder<br />
erscheinende Werkzeitschrift „Siemens-Mitteilungen" und 1954 bis 1960 das Siemens-Archiv.<br />
Danach wirkte er noch einige Jahre als Sekretär der Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung in<br />
Nymphenburg.<br />
11 Die erste Auflage dieses Werkes erschien bei Springer in Berlin wenige Tage vor dem Tode<br />
Werner von Siemens' im Dezember 1892 (Werner Siemens war 1888 von Kaiser Friedrich in den<br />
Adelsstand erhoben worden). 1956 erschien die hier genannte 16. Auflage dieser Autobiographie,<br />
1966 folgten eine 17. deutsche und eine 2. englische Auflage; diese drei Neuauflagen kamen bei<br />
Prestel in München heraus.<br />
12 Prof. Dr. Friedrich Spandöck (1904-1966) war 1934 in Berlin in das Haus Siemens eingetreten<br />
und hat als Physiker besonders akustische Probleme bearbeitet. Bekannt in der Fachwelt wurde er<br />
durch seine raumakustischen Modellversuche.<br />
347
11 Prof. Dr. Ferdinand Trendelenburg (1896—1973) war 1922 in das Forschungslaboratorium in<br />
Berlin-Siemensstadt eingetreten, 1950 übernahm er das SSW-Forschungslaboratorium in Erlangen<br />
bis 1962. Nach dem plötzlichen Tod von Prof. Spandöck 1966 übernahm er die kommissarische<br />
Leitung des Werner-von-Siemens-lnstituts. - Dipl.-lng. Hans Materna (geb. 1901) war seit 1925<br />
im Hause Siemens tätig, von 1952 bis 1967 als Leiter der Abteilung Serienfabrikate und ab 1961<br />
Vorstandsmitglied. Im Werner-von-Siemens-Institut hat er bis 1971 eine großzügige Modernisierung<br />
der Ausstellungsräume herbeigeführt. - Dr. Kurt Reche (1906—1972) war seit 1931 zunächst<br />
im Zentrallaboratorium der Siemens-Werke, später als Leiter des Wernerwerks für Telegrafenund<br />
Signaltechnik tätig; er war seit 1954 Mitglied des Vorstandes. Die Leitung des Werner-von-<br />
Siemens-Instituts hatte er zwei Monate vor seinem Tode übernommen. - Dr. Karl Thalmayer<br />
(geb. 1911) ist seit 1938 im Hause Siemens tätig; vor seinem Übertritt in das Werner-von-Siemens-<br />
Institut war er Geschäftsbereichsleiter für Nachrichtenkabeltechnik.<br />
14 Das Siemens-Familienhaus in Goslar, 1693 von einem Vorfahren Werners von Siemens' erbaut,<br />
wurde 1916 von der Familie Siemens käuflich erworben, nachdem es über 100 Jahre in Fremdbesitz<br />
war. Der 1873 gegründete Familienverband hat in diesem Haus mit Unterstützung des<br />
Siemens-Archivs ein Familienarchiv, eine Bücherei und zwei Ausstellungsvitrinen eingerichtet.<br />
Dem 1935 herausgegebenen Stammbaum-Buch von H. W. Siemens folgte 1973 ein von A. Siemens<br />
und S. v. Weiher bearbeiteter Ergänzungsband.<br />
15 Eine im Frühjahr 1977 erarbeitete erste Übersicht externer Arbeiten am Siemens-Archiv zeigte,<br />
daß von etwa 160 wissenschaftlichen Forschungsprojekten, die seit 1958 betrieben wurden, 56 mehr<br />
oder weniger umfangreiche Publikationen zustande gekommen waren. Als Beispiel seien hier zwei<br />
im Jahre 1969 publizierte Dissertationen genannt: Jürgen Kocka. Unternehmensverwaltung und<br />
Angestelltenschaft am Beispiel Siemens, 1847—1914. und P. Czada. Die Berliner Elektroindustrie<br />
in der Weimarer Zeit.<br />
Eine erste „Geschichte des Hauses Siemens" wurde 1947/51 von Georg Siemens (1882—1977)<br />
in 3 Bänden vorgelegt (2. Auflage in 2 Bänden unter dem Titel ,.Der Weg der Elektrotechnik -<br />
Geschichte des Hauses Siemens". Freiburg/München 1961). Diese Darstellung reicht von der<br />
Firmengründung 1847 bis zum Jahre 1945. - Eine kurzgefaßte Geschichte mit Quellenangaben und<br />
Illustrationen wurde 1972 von S. v. Weiher und H. Goetzeler unter dem Titel „Weg und Wirken<br />
der Siemens- Werke im Fortschritt der Elektrotechnik 1847 — 1972" in München (als Beiheft 8 der<br />
Zeitschrift „Tradition") herausgebracht. Eine englische, in der Zeittafel bis 1977 fortgeführte<br />
Übersetzung dieser Schrift erscheint in Kürze.<br />
Ein vergessenes Museum<br />
Von Kurt Pierson<br />
Anschrift des Verfassers: 8000 München 70, Leo-Graetz-Straße 9<br />
In der Invalidenstraße zu Berlin erhebt sich unmittelbar am Grenzübergang Sandkrugbrücke<br />
zum anderen Teil unserer Stadt der ehemalige Kopfbahnhof der Berlin-Hamburger<br />
Eisenbahn. Das durch Kriegseinwirkungen stark mitgenommene Empfangsgebäude war in<br />
zwei Flügeln nahezu symmetrisch auf beiden Seiten der vier Hallengleise angeordnet,<br />
wobei die Westseite der Ankunft, die Ostseite der Abfahrt diente.<br />
Als zu Beginn der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die Berlin-Hamburger Bahn<br />
im Zuge der Verstaatlichung mit der Lehrter Bahn gemeinsam nach Berlin hereingeführt<br />
und der Personenverkehr beider Linien in dem nur wenige hundert Meter weiter westlich<br />
gelegenen Lehrter Bahnhof zusammengefaßt wurde, fand der Personenverkehr im Hamburger<br />
Bahnhof am 15. Oktober 1884 sein Ende, und in dem Empfangsgebäude wurden<br />
Verwaltungsstellen und Dienstwohnungen der kurz vorher ins Leben gerufenen Kgl.<br />
348
Der Hamburger Bahnhof in Berlin (um 1860)<br />
Eisenbahndirektion Berlin untergebracht. Zwanzig Jahre später übergab der preußische<br />
Minister der öffentlichen Arbeiten den ehemaligen Hamburger Bahnhof seiner letzten<br />
Bestimmung: eine würdige Stätte zu sein für eine umfassende historische Darstellung<br />
der Verkehrsentwicklung, wie sie zu jener Zeit schwerpunktmäßig im Eisenbahnwesen<br />
ihren Ausdruck fand.<br />
Hervorragende Fachleute waren am Aufbau der Sammlung aus allen Sparten des Eisenbahnwesens<br />
beteiligt, die das „Verkehrs- und Baumuseum Berlin" durch seine großzügige<br />
und übersichtliche Anordnung der Exponate in aller Welt berühmt machte und deren<br />
Mittelpunkt die Fahrzeugabteilung darstellte. Eine Vielzahl von Lokomotiv- und Waggonmodellen<br />
im Maßstab 1:5, die von Lehrlingen verschiedener Eisenbahnwerkstätten der<br />
ehemaligen preußischen Staatsbahnen gebaut waren oder aus Zuwendungen der Industrie<br />
sowie aus Stiftungen von Freunden des Museums herrührten, wurden ergänzt durch zahlreiche<br />
Originalfahrzeuge, wie z.B. die erste deutsche Lokomotive mit Verbundwirkung,<br />
eine Omnibuslokomotive der Kgl. Eisenbahndirektion Hannover oder dem Salonwagen des<br />
letzten deutschen Kaisers. Für Fachleute besonders wertvoll war die von dem verstorbenen<br />
Generaldirektor des Georg-Marien-Bergwerks- und Hüttenvereins, Dr.-Ing. Haarmann,<br />
dem Museum geschenkte einmalige Sammlung von Eisenbahngleisen aus aller Welt, die<br />
eine Übersicht über die Entwicklung des Schienenweges vom 16. Jahrhundert bis in die<br />
Neuzeit vermittelte.<br />
Heute ist das einstige „Verkehrs- und Baumuseum Berlin" für die Öffentlichkeit unzugänglich.<br />
Im britischen Sektor von Berlin gelegen, untersteht es der Ost-Berliner Verwaltung<br />
der Deutschen Reichsbahn, und nur deren Vertreter sowie Vertreter der für das Gelände<br />
349
Vorderfront des<br />
• früheren Verkehrs-<br />
verantwortlichen Schutzmacht haben in Ausübung ihrer Funktionen Zutritt. Verstaubt<br />
und teilweise beschädigt schlummern seit Kriegsende hier unersetzliche Werte, die von den<br />
Briten sorgfältig inventarisiert worden sind. Wenn auch seinerzeit manch wertvolles<br />
Stück wie der oben genannte Salonwagen verlagert wurde, befinden sich trotzdem die<br />
Mehrzahl der Modelle und Originalfahrzeuge, die Sammlung der verschiedensten Bremssysteme,<br />
das Gleismuseum, eine über hunderttausend Exemplare umfassende Fahrkartensammlung<br />
und vieles andere mehr aus dem Sektor Eisenbahnwesen in den verwaisten<br />
Hallen des alten Hamburger Bahnhofs, an dessen verrammelte Tore die heutige Zeit pocht.<br />
Denn diese Zeit will nicht nur teilhaben an dem, was war, sondern auch künden von<br />
dem was ist und sein wird: ein moderner Verkehr zu Lande, zu Wasser und in der Luft.<br />
Ein Verkehrsmuseum der achtziger Jahre muß daher anders aussehen, muß allen drei<br />
Verkehrssparten gerecht werden, wenn auch der Schienenverkehr aus geschichtlicher wie<br />
technischer Sicht auf lange Zeit hin noch die Dominante einer solchen Schau sein wird,<br />
solange es noch eine in welcher Form auch immer geartete Beziehung zwischen Schiene<br />
und Fahrzeug gibt.<br />
Diese Beziehung aber reicht, wie wir sahen, weit in die Jahrhunderte zurück. Mit der<br />
Erfindung des „Dampfwagens" und den Ideen und Plänen des württembergischen Nationalökonomen<br />
und amerikanischen Konsuls Friedrich List (1789—1846) wurden vor<br />
150 Jahren auch in deutschen Landen die Grundlagen des Eisenbahnwesens und damit<br />
350
Halle für die Eisenbahnfahrzeuge des Verkehrs- und Baumuseums Berlin<br />
(Alle Bilder: Sammlung Pierson)<br />
einer Industrie geschaffen, in der das Berlin des 19. Jahrhunderts führend in der Welt<br />
wurde. Neben der damals größten deutschen Waggonfabrikation in der Chausseestraße<br />
wurden in nicht weniger als elf Fabriken Lokomotiven gebaut. Es war daher nur folgerichtig,<br />
daß in diesem universellen Brennpunkt des Verkehrs das „Berliner Verkehrs- und<br />
Baumuseum" entstand, das durch das „Museum für Meereskunde" in unmittelbarer Nähe<br />
des Bahnhofs Friedrichstraße sowie durch das „Reichspostmuseum" in der Leipziger Straße<br />
eine adäquate Ergänzung fand.<br />
Gar vielfältig waren nach Kriegsende private Bemühungen, beim Wiederaufbau Berlins<br />
das alte Verkehrsmuseum zu neuem Leben zu erwecken. Doch was sich die Bürger seit<br />
zwanzig Jahren wünschen und der Berliner Senat immer wieder versprach, ist bis heute<br />
nicht über die erste Planungsstufe hinausgekommen. Man fragt sich unwillkürlich, was<br />
aus den vor rund fünf Jahren auf den Tisch gelegten, sehr konkreten und vielversprechend<br />
klingenden Angeboten vieler „berufener" Stellen eigentlich geworden ist (nachzulesen<br />
in den „Mitteilungen" Heft 7/1972, S. 187). Nachdem die Absicht mißlang, viele wertvolle<br />
Einzelsammlungen in der Tempelhofer Abflughalle unterzubringen, blieb als Provisorium<br />
nur die verkehrstechnische Sammlung im Gebäude der heutigen „Urania".<br />
Mit Beginn des Sommerfahrplans 1977 fand auf unseren Eisenbahnen eine fast eineinhalb<br />
Jahrhunderte alte Epoche deutscher Verkehrsgeschichte durch Beendigung des Dampfbetriebes<br />
ihren Abschluß. Das Fernsehen war dabei, die Presse. Dann ging die Öffentlich-<br />
351
keit wieder zur Tagesordnung über. Doch Idealismus und Tatkraft geschichtsbewußter<br />
privater Vereinigungen und Einzelpersonen haben es sich seit Jahren angelegen sein lassen,<br />
vor allem ältere Schienenfahrzeuge vor dem Verschrotten zu bewahren, um historisch<br />
wertvolle Zeugen technischer Vergangenheit der Nachwelt zu erhalten. Leider müssen<br />
diese Stellen oft darum kämpfen, derartige kostbare Objekte vor Witterungseinflüssen<br />
und unbefugten Zugriffen zu sichern. Zwar hat die Deutsche Bundesbahn in später Erkenntnis<br />
einer vertanen Chance einige übriggebliebene Schienenfahrzeuge in ihre vorübergehende<br />
Obhut genommen, um sie für ein - irgendwann einmal in der einstigen deutschen<br />
Hauptstadt enstehendes — Verkehrsmuseum zur Verfügung zu stellen, dennoch steht zu<br />
befürchten, daß diese in ihrer Verborgenheit nicht besser werden. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe<br />
bemühen sich, ihren Anteil an der Geschichte insbesondere des Berliner<br />
Nahverkehrs in erfreulichem Umfange zu erhalten, um diesen mit einem zukünftigen<br />
Berliner Verkehrsmuseum verbinden zu können.<br />
Am 29. April 1976 hatte Bundespräsident Walter Scheel im Reichstagsgebäude in Berlin<br />
die Teilnehmer des Symposiums des Europarates begrüßt und bei dieser Gelegenheit<br />
auch zur Stadt Berlin, zu ihrer Geschichte und zu den Aufgaben des Denkmalschutzes<br />
u.a. gesagt:<br />
„Berlin ist für uns Deutsche ja nicht irgend eine Stadt. Berlin ist das Zentrum der<br />
deutschen Nation. Und es ist für die deutsche Nation nun durchaus nicht gleichgültig,<br />
ob die Zeugnisse der deutschen Geschichte, die sich in diesem Teil der Stadt befinden,<br />
erhalten bleiben oder nicht. Es ist wichtig für uns, für die Zukunft unseres Volkes,<br />
daß die deutsche Geschichte hier, in dieser Stadt, lebendig bleibt, anschaubar und erlebbar<br />
bleibt."<br />
Das gilt nicht zuletzt für die große Vergangenheit dieser Stadt auf industriellem Gebiet,<br />
die durch ihre Leistungen in einer über hundertjährigen Verkehrsgeschichte so entscheidend<br />
zur gegenseitigen Annäherung der Menschen in aller Welt beigetragen hat. Hier hatte<br />
August Borsig die entscheidende Idee für die spätere moderne Heißdampflokomotive,<br />
hier schenkte Werner Siemens der Welt die elektrische Lokomotive, hier startete Otto<br />
Lilienthal zu seinen ersten motorlosen Gleitflügen, die zur modernen Aviatik führten und<br />
Edmund Rumpier veranlaßten, in Berlin die erste deutsche Flugzeugfabrik einzurichten.<br />
Hier war es schließlich auch, wo Major v. Parseval sein Luftschiff in Johannisthai baute,<br />
das zum Vorbild heutiger Luftschiffkonstruktionen der amerikanischen Firma Goodyear<br />
wurde. Eine verständnislose Bürokratie ließ die Initiatoren der Deutschen Luftsammlung<br />
nach jahrelangen Kämpfen um entsprechende Räumlichkeiten schließlich resignieren,<br />
so daß diese einmalige Einrichtung nach München abwanderte.<br />
Wir haben in unserer Stadt ein Museum für Vor- und Frühgeschichte, ein Museum für<br />
Völkerkunde. Wir haben sachbezogene Museen für indische, islamische und ostasiatische<br />
Kunst; wir haben ein Musikinstrumenten-Museum und nicht zuletzt unser Berlin-Museum.<br />
All diese Institutionen setzen bestfundiertes Wissen voraus. Nur ein international anerkanntes<br />
Verkehrsmuseum - das haben wir nicht! Eine Abendschau-Sendung des Senders<br />
Freies Berlin am 5. September 1974 erweckte sogar den Eindruck, als ob man bei einer<br />
eventuellen Schaffung eines solchen von Vorstellungen ausgehen könnte, die dem Charakter<br />
der Darstellung verkehrsgeschichtlicher Entwicklungen nicht im erforderlichen Rahmen<br />
gerecht werden. Dies aber entspräche nicht dem Sinn dessen, was der Bundespräsident<br />
meinte, wenn er sagte:<br />
352
„Es ist wichtig für uns, für die Zukunft unseres Volkes, daß die deutsche Geschichte<br />
hier, in dieser Stadt, lebendig bleibt, anschaubar und erlebbar bleibt."<br />
Das einstige Berliner Verkehrs- und Baumuseum war von Fachleuten hohen Ranges gestaltet<br />
worden und nicht von Verwaltungsbeamten. Es wird die Aufgabe der heute Verantwortlichen<br />
sein müssen, an diese Tradition anzuknüpfen.<br />
Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 15, Meierottostraße 4<br />
Ein Berliner Napoleon-Forscher: Friedrich M. Kircheisen<br />
(1877-1933)<br />
Von Prof. Dr. Michael Erbe<br />
Der Name Kircheisen ist in Berlin nicht unbekannt, da er sogleich Erinnerungen weckt an<br />
den preußischen Justizminister Friedrich Leopold von Kircheisen (1749—1825) 1 . Ende<br />
Juni dieses Jahres nun gedachte die Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin<br />
mit einer Ausstellung des hundertsten Geburtstages seines Ururenkels, des lange Jahre in<br />
Berlin tätigen Historikers Friedrich Max Kirscheisen. Sehr viele Geschichtsforscher sind<br />
es ja nicht mehr, deren Namen mit dem unserer Stadt eng verknüpft und deren Werk weit<br />
über die Grenzen der alten preußischen Metropole hinaus bekanntgeworden sind. Um so<br />
mehr besteht Anlaß, sich der wenigen bedeutenden aus der Vergangenheit zu erinnern.<br />
Dabei ist auch das Wirken dieses Gelehrten kurz zu würdigen.<br />
Friedrich Max Kircheisen wurde am 23. Juni 1877 in Chemnitz als Sohn eines Handschuh-<br />
und Strumpf-Fabrikanten geboren und starb am 12. Februar 1933 in Berlin 2 .<br />
Seine Laufbahn als Gelehrter verlief ungewöhnlich und gewissermaßen außerhalb der<br />
üblichen Bahnen. Sie wäre in dieser Form heute wohl kaum noch denkbar. Vorgeprägt<br />
wurde sie allem Anschein nach durch die Begegnung mit Werken über Napoleon I. in<br />
der väterlichen Bibliothek eines Schulfreundes, die dem Sechzehnjährigen zur Benutzung<br />
offenstand und die er in der lesehungrigen Manier, welche diesem Lebensalter eigen<br />
ist, so in sich aufnahm, daß er zu dem Entschluß gelangte, seine ferneren Studien ganz der<br />
Lebensgeschichte des großen Korsen zu widmen. Daß dergleichen packende geistige Erlebnisse<br />
die Zielrichtung eines Arbeitslebens bestimmen, ist durchaus nichts Ungewöhnliches;<br />
ungewöhnlich ist aber, wie unbeirrbar Kircheisen dem einmal gefaßten Vorsatz treu<br />
blieb und daran trotz aller Umwege, die er zu gehen genötigt war, festhielt. Denn zunächst<br />
hat er versucht, die Laufbahn eines Ingenieurs einzuschlagen, nachdem er von 1883 bis<br />
1886 das Königliche Gymnasium auf dem Kaßberge besucht hatte und dann auf die<br />
Realschule seiner Heimatstadt übergewechselt war. Der Grund für das zunächst ins Auge<br />
gefaßte Berufsziel war der frühe Tod des Vaters und die Notwendigkeit, dessen Betrieb<br />
bald zu übernehmen. Nach dem Realschulabschluß im Jahre 1895, einem Praktikum<br />
in einer Chemnitzer Maschinenfabrik und dem obligaten Militärdienst als „Einjähriger"<br />
ging Kircheisen 1898 auf die Königliche Höhere Gewerbeschule seiner Heimatstadt, um<br />
353
sich zum Maschineningenieur ausbilden zu lassen. Allerdings trat jetzt der Widerstreit<br />
zwischen seinen eigentlichen Interessen auf historischem Gebiet, die sich durch einige<br />
Reisen (u. a. 1898 nach Paris) noch vertieft hatten, und den Wünschen der Familie<br />
offen zutage: Kircheisen verzichtete auf einen Ingenieurabschluß und beschloß, an der<br />
Universität Leipzig ein geisteswissenschaftliches Studium zu beginnen. Gutachten von<br />
Karl Lamprecht und Friedrich Ratzel über seine Kenntnisse ermöglichten die Immatrikulation<br />
ohne das sonst notwendige Reifezeugnis einer neunklassigen höheren Schule,<br />
und das Vermögen der Familie gab ihm Gelegenheit, sich seinen Neigungen ohne finanzielle<br />
Not zu widmen.<br />
Kircheisen hat indessen auch sein Universitätsstudium nicht mit einem Examen abgeschlossen.<br />
Eine bei Lamprecht eingereichte Dissertation über „Die Anfänge des literarischen<br />
Portraits in Deutschland" 3 zog er — aus nicht ganz geklärten Gründen - zurück<br />
und ließ sich zum Ende des Wintersemesters 1902/1903 exmatrikulieren. Sein anfangs<br />
recht breit angelegtes Studium hatte sich schließlich ganz auf das Fach Geschichte konzentriert,<br />
und hier muß die Beschäftigung mit Napoleon bald einen wesentlichen Schwer-<br />
354
punkt gebildet haben, da - kurz bevor er die Universität verließ - seine erste Arbeit<br />
aus diesem Bereich, die „Bibliographie Napoleons", eine Auswahl der wichtigsten Quelleneditionen<br />
und der Sekundärliteratur, erschien 4 , die unverzüglich in französischer, englischer<br />
und italienischer Übersetzung herauskam 5 . Sie war eine Vorarbeit zur 1908 publizierten<br />
„Bibliographie des napoleonischen Zeitalters" 6 , dem bisher einzigen Versuch, die Masse<br />
der Napoleon-Literatur in einer Bibliographie zu bewältigen, ein Versuch, der denn<br />
auch schon damals nicht zu Ende geführt werden konnte. Daß diese Bibliographie ihren<br />
wissenschaftlichen Wert trotzdem behalten hat, zeigt sich dadurch, daß sie soeben im<br />
Nachdruck erschienen ist 7 .<br />
Diese Bibliographie bildete nur eine Vorarbeit zu einer umfassenden Lebensgeschichte<br />
Napoleons. Weitere Früchte der Erschließung des Schrifttums über die Zeit des großen<br />
Korsen sind Übersichten über Quellen und Literatur zu Friedrich von Gentz und die<br />
preußische Königin Luise 8 . Ansonsten beschäftigten ihn Rousseau 9 , die Memoiren Segurs 10 ,<br />
der spanische Freiheitskrieg 11 und der Feldzug von 1809 12 . Zwischen 1906 und 1910 gab<br />
Kircheisen eine dreibändige Auswahl aus der Napoleon-Korrespondenz heraus, mit der<br />
zum ersten Mal ein umfangreicher Querschnitt aus dem Briefwerk des Korsen in deutscher<br />
Übersetzung vorgelegt wurde 13 . 1911 endlich erschien der erste Band von Kircheisens<br />
Hauptwerk „Napoleon I. Sein Leben und seine Zeit", dem bis 1934 acht weitere Bände<br />
folgen sollten 14 .<br />
1903 war Kircheisen, der fortan von den Erträgen seiner Feder lebte, nach Genf gezogen,<br />
wo er bis 1916 blieb. Von der Aufbruchstimmung des Sommers 1914 wie viele, die nicht<br />
auf den Grund der Dinge schauen konnten, erfaßt, versuchte er, mit einer (allerdings<br />
bald eingegangenen) Zeitschrift „Das Völkerringen" die Kriegsgeschehnisse aus deutscher<br />
Sicht zu kommentieren 15 . Von 1916 bis 1918 war er in Berlin im Kriegsministerium tätig,<br />
wo er mit der Abfassung einer Geschichte des militärischen Nachrichtenwesens beauftragt<br />
wurde. Zwar ist eine solche Darstellung nicht über die Vorarbeiten hinaus gediehen,<br />
aber die Tätigkeit in dieser Behörde brachte ihm doch manchen Einblick in die Interna<br />
und einige Bekanntschaften mit Akteuren der Kriegsszene, so die mit dem sächsischen<br />
General von Hausen, der 1914 an der Marneschlacht beteiligt gewesen war und dessen -<br />
seinerzeit Aufsehen erregende - Erinnerungen Kircheisen 1920 herausgab 15 . Entsprechende<br />
Pläne mit den Erinnerungen Falkenhayns zerschlugen sich durch den frühen Tod<br />
des Generals im April 1922.<br />
Seit 1916 war Kircheisen dauernd in Berlin ansässig, seit 1926 wohnte er in Hermsdorf.<br />
Hier führte er - neben kleineren Arbeiten zu diesem Thema - sein Werk über Napoleon<br />
zu Ende, von dem vor dem Krieg noch die Bände I bis III (bis einschließlich zum Ägyptenfeldzug<br />
reichend) erschienen waren. Band IV (bis zum Staatsstreich vom 18. Brumaire)<br />
erschien 1922, und den letzten (neunten) Band, der die Zeit vom Rußlandfeldzug bis<br />
zum Ende des Kaisers umfaßte, konnte Kircheisen einen Monat vor seinem plötzlichen<br />
Tod vollenden 16 . Gewissermaßen eine Kurzfassung des großen Werkes bilden die beiden<br />
1927/29 erschienenen Bände „Napoleon I. Ein Lebensbild" 17 .<br />
Man tut vielleicht am besten daran, wenn man Kircheisens Napoleon-Biographie mit<br />
einem anderen Werk über das gleiche Thema, das vor dem Ersten Weltkrieg von einem<br />
deutschsprachigen Historiker konzipiert wurde, vergleicht, nämlich mit der Napoleon-<br />
Biographie des österreichischen Geschichtsforschers August Fournier (1850—1920) 18 .<br />
Dabei muß man natürlich berücksichtigen, daß Fournier eine Generation älter als Kircheisen<br />
war und daß dieser das bereits Ende der achtziger Jahre publizierte Werk für seine<br />
355
Arbeiten verwenden konnte. Fournier ist, was die wissenschaftliche Gediegenheit und<br />
die Beherrschung der historischen Fakten anlangt, bis heute unerreicht geblieben. Freilich<br />
ist sein Stil trocken, und daher sind die drei Bände seines Werkes keine leichte<br />
Lektüre. Kircheisen dagegen kommt das Verdienst zu, Napoleon - im guten Sinne —<br />
popularisiert zu haben. Seine Darstellung ist breiter angelegt, dabei ist der Stil des Erzählens<br />
stärker ausgeprägt, einzelne Szenen - wie etwa der Staatsstreich von 1799 im<br />
fünften oder der Schlacht von Leipzig im neunten Band — werden breit ausgemalt, und<br />
dies wird noch dadurch verstärkt, daß Kircheisen sein Werk mit Bildbeigaben bestückt,<br />
während Fournier lieber Aktenbeilagen veröffentlicht. Beide Werke aber sind - jedes<br />
für sich Höhepunkte der deutschsprachigen Napoleon-Historiographie - schon deshalb<br />
unerreicht, weil sich seitdem kein Historiker mehr gefunden hat, der Faktenkenntnis,<br />
Interesse und Darstellungskunst genug mitbrächte, um dem Thema gerecht zu werden.<br />
Freilich darf man nicht verkennen, daß die Napoleon-Forschung mittlerweile andere<br />
Wege geht, seit die französische Sozialgeschichtsforschung nach dem noch Altes und<br />
Neues gleichermaßen berücksichtigenden Werk von Georges Lefebvre 19 neue Zeichen<br />
gesetzt hat. Während Fournier wie Kircheisen noch stark persönlichkeitsbezogen und eher<br />
chronistikartig wie heutzutage in Frankreich Jean Thiry 20 ihre Biographien anlegten,<br />
steht heute bei dem Thema „Napoleon und seine Zeit" mehr das historische Umfeld<br />
im Vordergrund, die demographische Entwicklung Frankreichs, die für unser Nachbarland<br />
bis heute prägende napoleonische Gesellschaftsordnung, die Auswirkungen der Kontinentalsperre<br />
auf das „Empire", seine Nebengebiete und seine Verbündeten, während die —<br />
freilich immer noch faszinierende - Persönlichkeit Bonapartes, seine Schlachten, seine<br />
Politik und sein Verhältnis zu den ihn umgebenden Personen auf weniger Interesse<br />
stoßen 21 . Die deutsche Forschung hat hier noch kaum aufschließen können 22 . Wer indessen<br />
an diesen Themen weniger interessiert ist, sondern etwas von der Faszination<br />
Napoleons spüren möchte, der wird nach wie vor mit Gewinn gerade zu Kircheisens<br />
biographischem Werk greifen. Wenn es je so etwas wie eine deutsche Napoleon-Forschung<br />
gegeben hat, so ist Berlin mit ihm einmal deren Zentrum gewesen — Anlaß genug<br />
für eine kurze Rückbesinnung.<br />
1 Vgl. über ihn den Artikel von Teichmann in der ADB XV, 1882, S. 789-791. K. war von 1810<br />
bis zu seinem Tode preußischer Justizminister.<br />
2 Ich benutze für die Zeit bis 1927 die Broschüre eines Freundes von K., des Chemnitzer<br />
Gymnasialprofessors Bernhard Rost: Friedrich M. Kircheisen. Lebensabriß des Geschichtsforschers<br />
und ausführliches Verzeichnis seiner Werke nebst deren Beurteilung, Chemnitz (Verl. C. Strauß)<br />
1927. Für die Zeit danach vgl. das Nachwort des Verlags Albert Langen und Georg Müller in<br />
K.s „Napoleon I." (vgl. Anm. 14), Bd. 9 (1934), S. 609-611. Im übrigen stütze ich mich<br />
auf Mitteilungen von K.s Tochter, Frau Zia-Hortense Kircheisen, Berlin-Hermsdorf.<br />
3 Teile des Dissertationsvorhabens erschienen etwas später unter dem Titel „Die Geschichte<br />
des literarischen Portraits in Deutschland, I: Von den ältesten Zeiten bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts",<br />
Leipzig (Hiersemann) 1904.<br />
4 Berlin (Mittler u. Sohn) 1902, VIII u. 188 S.<br />
5 Vgl. den bibliographischen Anhang bei Rost (Anm. 2), S. 18, Nr. 1.<br />
6 Bibliographie des napoleonischen Zeitalters, einschließlich der Vereinigten Staaten von Nordamerika,<br />
2 Bde., Berlin (Mittler u. Sohn) 1908.<br />
7 Hildesheim (Olms) 1977.<br />
8 Vgl. bei Rost (Anm. 2), S. 18 f., Nr. 3 u. 5.<br />
9 Ebd. S. 20, Nr. 8 u. 10.<br />
356
10 Ebd.S. 19 f., Nr. 7.<br />
" Ebd. S. 20, Nr. 9.<br />
12 Ebd. S. 22, Nr. 12.<br />
13 Briefe Napoleons I., 3 Bde., Stuttgart (Lutz) 1906-1910.<br />
14 Napoleon I. Sein Leben und seine Zeit, 9 Bde., München-Leipzig (Langen-Müller) 1911 - 1934.<br />
15 Vgl. bei Rost (Anm. 2), S. 29, Nr. 29.<br />
16 Das Vorwort von Bd. 9 datiert vom Januar 1933. - Laut Verlagsangabe im Anhang von Bd. 2<br />
des in der folgenden Anm. angeführten Werkes waren ursprünglich zehn Bände geplant.<br />
17 Stuttgart-Berlin(CottaNachf.) 1927-1929.<br />
18 August Fournier: Napoleon I. Eine Biographie, 3 Bde., Leipzig - Prag 1886-1889, 4. Aufl.,<br />
besorgt v. Viktor Bibl, Wien - Leipzig 1922.<br />
19 Georges Lefebvre: Napoleon, Paris 1936, 6. Aufl., besorgt v. Albert Soboul, Paris 1969 (Peuples<br />
et Civilisations, 14).<br />
20 Jean Thirys Napoleon-Biographie ist allerdings bereits auf 26 Bände angewachsen. In seiner<br />
seit 1939 erscheinenden „Collection Napoleon Ier" stehen nur noch der Band über Napoleons<br />
Jugend und der über seine Gefangenschaft auf St. Helena aus.<br />
Eine Summe der gegenwärtigen Napoleon-Forschung in Frankreich bietet die Aufsatzsammlung<br />
„La France ä l'epoque napoleonienne" in der „Revue d'histoire moderne et contemporaine" 17<br />
(1970), S. 329-912.<br />
22 Hinzuweisen wäre in diesem Zusammenhang etwa auf das Buch von Helmut Berding: Napoleonische<br />
Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen, 1807- 1813, Göttingen 1973.<br />
Nachrichten<br />
Nachruf auf Kurt Pomplun<br />
Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 28, Ringstraße 23<br />
Kurt Pomplun lebt nicht mehr! - Das ist für Berlins Heimatkunde mehr als eine betrübliche Neuigkeit,<br />
das ist in der Tat ein Ereignis. Über ein Jahrzehnt war er stellvertretender Vorsitzender des Vereins für<br />
die Geschichte Berlins, als der er oft in den Vorstandssitzungen den entscheidenden Rat gegeben hat.<br />
Auf mancher Führung durch entlegene Winkel unserer Stadt, in manchem stets den Saal füllenden<br />
Vortrag konnten wir seine von früher Jugend an gesammelten, aber auch fleißig erarbeiteten Kenntnisse<br />
entgegennehmen. Als erfolgreicher Buchautor, als Journalist und Rundfunksprecher hat er in<br />
weiten Kreisen das heimatgeschichtliche Interesse geweckt, am unscheinbaren Detail ebenso wie an<br />
den historischen Zusammenhängen.<br />
Ja, das alles war Kurt Pomplun. Aber er war mehr. Er war das, was man in unserem einerseits einsam<br />
gewordenen, andererseits fremdüberfluteten Berlin kaum noch kennt - er war ein Original, das für<br />
unsere Stadt bereits zu einer Institution geworden war. Wenn seine stattliche Erscheinung auftauchte,<br />
da wußte ein jeder: jetzt gibt es etwas Besonderes. Dann hörten wir keine billigen Berolinismen oder<br />
Witzchen, es wurden tiefschürfende Kenntnisse mit typisch-unverwechselbarem Zungenschlag in<br />
einer Form dargebracht, die wohl jeden in seinen Bann schlug, ihn mit dem Objekt identifizierte, und<br />
dieses Objekt hieß immer irgendwie Berlin. So hat der sich stets auskennende „Kutte" unvergeßlich<br />
in die Herzen seiner Berliner hineingesprochen.<br />
Kurz seine Vita: Geboren am 29. Juli 1910 in der „roten Insel" Schönebergs, dem Dreieck zwischen<br />
S-Bahngleisen und Gasanstalt, in welchem auch Marlene Dietrich das Licht der Welt erblickt hat,<br />
schickte ihn der Vater, ein Oberwerkmeister im technischen Postdienst, auf die Fichte-Realschule, die<br />
er 1926 mit der Reife für Obersekunda, dem sogenannten Einjährigen, verließ. Schon als Schüler<br />
wanderte und fuhr er mit der Straßenbahn kreuz und quer durch Berlin und legte den Grund für die<br />
geradezu enzyklopädische Kenntnis seiner Heimatstadt. Es folgte die Ausbildung als Vermessungstechniker,<br />
die er 1930 nach Besuch der Baugewerksschule Neukölln mit der Staatsprüfung als Ver-<br />
357
messungsingenieur abschloß. Im gleichen Jahre Eintritt in das Vermessungsamt des Kreises Teltow,<br />
in welchem er bald zu Sonderaufgaben herangezogen wurde, so bei der Inventarisierung der Bau- und<br />
Kunstdenkmäler durch den Provinzialverband Brandenburg. Nebenher besuchte Pomplun Vorlesungen<br />
und Übungen der Universitätsprofessoren Hoppe, Kiekebusch, Solger und Vogel. Studienreisen<br />
führten ihn durch fast ganz Europa.<br />
Dieser Zeit eines immer strebenden Bemühens machte 1940 der Einzug zum Kriegsdienst ein Ende.<br />
Nach dem Zusammenbruch zunächst freiberuflich tätig, trat er 1954 als Sachbearbeiter in das Bezirksamt<br />
Schöneberg ein und baute hier nebenher ein Heimatarchiv auf. 1965 ging er in das Amt für Denkmalpflege<br />
über, das er 1972 - nach einem chirurgischen Eingriff vorzeitig pensioniert - als Vermessungsamtsrat<br />
verließ.<br />
Doch Ruhe gab es für Pomplun nicht: Allwöchentlich war er in seiner Sendereihe im RIAS zu hören,<br />
jeden Sonntag erschien ein heimatgeschichtlicher Beitrag in der „Berliner Morgenpost". Seine zahlreichen<br />
Bücher, von denen das über „Berlins alte Dorfkirchen" wohl weiteste Verbreitung gefunden<br />
hat. wurden immer wieder aufgelegt, und noch im letzten Jahr gab es als Neuerscheinung „Berlinisch<br />
Kraut und Märkische Rüben". Weniger bekannt ist, daß er auch Baedekers Reiseführer für Berlin,<br />
Salzburg, Nürnberg, Würzburg, Regensburg, Augsburg, Bamberg, Braunschweig und Innsbruck bearbeitet<br />
hat, alles in allem eine selbst auferlegte, kaum vorstellbare und - wie sich gezeigt hat — nicht<br />
tragbare Arbeitsleistung.<br />
„Mitten im Leben sind wir vom Tode umfangen." Während der Vorstellung eines neuen Berliner<br />
Kunstführers in der Buchhandlung Elwert und Meurer ereilte ihn am 5. August 1977 der tödliche<br />
Infarkt. Welche Gnade für ihn, so aus dem vollen Leben genommen zu werden, welch Verlust für die<br />
Zurückgebliebenen. Denn Kurt Pomplun war in seiner Art einmalig und ist in der Tat unersetzlich,<br />
eben - ein Original. Walter Hoffmann-Axthelm<br />
358
Frau Gertrad Doht 90 Jahre<br />
Am 6. September 1977 konnte Frau Gertrud Doht ihr 90. Lebensjahr vollenden. Als Vorstandsmitglied<br />
des Vereins hat sie die schon seit 1905 währende Familientradition fortgesetzt, die mit<br />
dem Beitritt ihres Vaters, des Kaufmanns Max Carstens, in den Verein für die Geschichte Berlins<br />
begann. 1917 wurde auch ihr Ehemann, Handelsgerichtsrat Dr. Walter Doht, Mitglied, der seit<br />
1931 das Amt des 3. Vorsitzenden und später bis zu seinem Tode nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
dasjenige des 2. Vorsitzenden innehatte. Die Verdienste von Frau Doht reichen bis in jene Jahre<br />
zurück, in denen sie in ihrer Wohnung die Versandarbeiten der seinerzeit noch hektographierten<br />
„Mitteilungen" besorgte. Die Rücksicht auf das Alter ließ sie dann vom Vorstandsamt zurücktreten,<br />
als dank der fortschreitenden finanziellen Besserstellung des Vereins auch die „Mitteilungen"<br />
wieder in dem jetzigen, so ansprechenden Gewand erscheinen konnten.<br />
Ihr 90. Lebensjahr hat die verehrte Jubilarin im engsten Familienkreis gefeiert. An dieser Stelle<br />
sollen ihr aber herzliche Dankesgrüße und die besten Wünsche zugehen. H. G. Schultze-Berndt<br />
Käte Haack 80 Jahre<br />
Genau einen Monat nach ihrem turbulenten 80. Geburtstag am 11. August 1977 - mit zahllosen<br />
Gratulanten, Funk und Fernsehen, in einem Meer von Blumen und Geschenken - saß ich bei Käte<br />
Haack zu einem Plauderstündchen in ihrem gemütlichen, mit schönen alten Möbeln eingerichteten<br />
Heim mit dem Blick auf das Grün des Lietzenseeparks und den Funkturm. Sie erzählte aus ihrem<br />
reichen, glücklichen Leben, das natürlich auch leidvolle Tage enthielt, in das sie am Lützowplatz<br />
geboren wurde - in eine alte Berliner Familie, deren Stammhaus in der Leipziger Straße 6 stand.<br />
Mütterlicherseits hatte sie den Turnvater Jahn zum Vorfahren. Wie sie, war schon ihr Vater Paul<br />
Haack Mitglied des Vereins für die Geschichte Berlins, wie auch ihr Onkel, der Geheime Justizrat<br />
Friedrich Holtze, von dem sie viele kostbare Bücher und Erstausgaben geerbt hat, die u. a. in der<br />
Bücherwand stehen, die eine ganze Seite ihres Zimmers bis unter die Decke einnimmt. Bücher und<br />
Lesen sind Käte Haacks ganze Leidenschaft - besonders Fontane hat es ihr angetan.<br />
Aufgewachsen ist sie in der Grolmanstraße. Nach Abschluß des Lyzeums, einer ganz kurzen Schauspielausbildung<br />
und einem ebenso kurzen Engagement in Göttingen stand sie mit 16 Jahren in Berlin<br />
auf der Bühne des Lessingtheaters mit Curt Goetz und Theodor Loos. Unter den namhaftesten<br />
Theaterleitern und Regisseuren hat sie auf der Bühne und in unzähligen Filmen gespielt. Dann die<br />
beglückenden Jahre bis Kriegsende im Staatstheater bei Gustaf Gründgens, bei dem sie sich in jener<br />
schrecklichen „braunen" Zeit in einer verschworenen Gemeinschaft sicher aufgehoben fühlte. Nach<br />
dem Krieg war neben anderen ihr größter Erfolg die Mrs. Higgins in „My Fair Lady", die sie nun<br />
schon 1500mal in Berlin und anderen Städten gespielt hat. Nun freut sie sich auf die Premiere mit<br />
Rudolf Platte und Thomas Fritsch im November/Dezember bei Wölffer am Kurfürstendamm. Ein<br />
Jahr hatte sie jetzt kein festes Engagement - das war für diese noch so vitale Vollblutschauspielerin<br />
einfach schrecklich, wie sie sagte.<br />
Wir sprachen über Berlin, das sie nie verlassen würde, über die derzeit stattfindenden Festwochen, von<br />
der Diskussion über die „Goldenen 20er Jahre" im Renaissance-Theater, bei der sie mitgewirkt hat,<br />
über Politik, über den Verein, dem sie immer gern zur Verfügung stünde, wenn man sie ruft, und<br />
vieles mehr. Zu uns gesellte sich nun auch ihre reizende junge Freundin Rose Armenad - auch eine<br />
waschechte Berlinerin -, die seit einigen Jahren bei ihr wohnt und sie betreut und verwöhnt und die<br />
wir bald als Mitglied in unserem Verein begrüßen können.<br />
Der hübsche Nachmittag ging zu Ende. Ich nahm Käte Haack im Wagen mit zum Kurfürstendamm,<br />
wo sie bei Freunden eingeladen war. Die leidenschaftliche Autofahrerin - sie fuhr als erste Schauspielerin<br />
in Berlin einen Wagen - bedauerte, daß sie wegen ihrer Augen das Fahren aufgeben mußte.<br />
Wünschen wir ihr noch viele Jahre voll Aktivität in ihrem schönen Beruf zu ihrer und unserer Freude!<br />
Alice Hamecher<br />
359
Stadtteilschreiber in Hamburg<br />
Seit einigen Jahren leistet es sich die Gemeinde Bergen-Enkheim nahe Frankfurt am Main, einen<br />
„Stadtschreiber" zu besolden. Jeweils für die Dauer eines Jahres wird ein namhafter Dichter mit diesem<br />
Ehrenamt betraut.<br />
Hiermit nicht zu verwechseln ist die neue Aufgabe eines „Stadtteilschreibers", die in Hamburg geschaffen<br />
werden soll. Im Verlauf von sechs Monaten sollen drei derartige Stadtteilschreiber die Geschichte<br />
dreier Hamburger Stadtteile aufspüren und sie niederschreiben. Die Stadtteilschreiber<br />
gehen die Verpflichtung ein, in dem von ihnen gewählten Stadtteil aus der Historie von Familien,<br />
Betrieben, Gebäuden, öffentlichen Straßen und Plätzen oder in sonst geeigneter Weise ein Bild<br />
der Geschichte dieses Bezirks zu entwerfen. Im Kulturamt soll das Ergebnis in Form einer Monographie<br />
zur Veröffentlichung vorgelegt oder zumindest als Material für eine Ausstellung verwendet<br />
werden. Drei von den Schriftstellerverbänden „Literaturzentrum" e.V. und Freier Deutscher Autorenverband<br />
vorgeschlagene Literaten erhalten ein Stipendium von je 6000 DM. Als erste Hamburger<br />
Stadtteile wurden St. Georg, Ottensen und die Neustadt ausgesucht.<br />
Diese Anregung sollte auch in Berlin auf fruchtbaren Boden fallen, zumal immer wieder der Wunsch<br />
oder der Bedarf besteht, die Geschichte eines Bezirks festzuhalten, etwa in naher Zukunft die des<br />
dann 275jährigen Charlottenburg. H. G. Schultze-Berndt<br />
*<br />
Mehrfach ist an Herrn Pfarrer Dr. Thomas Buske vom Evangelischen Pfarramt zum Guten Hirten in<br />
Berlin-Friedenau, Bundesallee 76, der Wunsch herangetragen worden, das Buch der Gefallenen aus<br />
dem Ersten Weltkrieg, das seinerzeit von Prof. Schoppenmeyer kunstvoll gestaltet wurde, mit den<br />
Namen der Kriegstoten aus dem Zweiten Weltkrieg zu ergänzen. Alle, die heute in Friedenau wohnen<br />
und Angehörige während des Krieges verloren haben, entweder an der Front gefallen, während eines<br />
Bombenangriffes umgekommen oder in der Gefangenschaft oder auf der Flucht verschollen, werden<br />
gebeten, die Namen dieser Familienglieder, Verwandten und Freunde dem Pfarramt mitzuteilen<br />
(direkt an Pfarrer Dr. Buske oder an die Gemeindehelferin Frau Schwedt, Telefon 8 52 75 39).<br />
Auch das Ehrenmal in der Kirche (von dem Friedenauer Bildhauer Mißfeldt 1920 gestaltet) wird bis<br />
zum diesjährigen Volkstrauertag - aus Spenden der Gemeinde - seinen ursprünglichen Schmuck<br />
wiedererhalten, nachdem bereits Pfarrer Trompke schon vor Jahren das Ehrenmal durch die Daten<br />
des Zweiten Weltkrieges „1939— 1945" ergänzen ließ.<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Frau Alma Schnell. Frau Ilse Kabisch, Frau Dorothea Brose; zum 75. Geburtstag<br />
Herrn Prof. Dr. Karl Feußner, Frau Elsa-Marie Kaatz, Frau Anneliese Gericke, Frau Ella Dohm;<br />
zum 80. Geburtstag Herrn Dr. Joachim Lachmann, Herrn Dr. Johannes Broermann, Frau Liesbeth<br />
Zahn, Herrn Günther Grabowski, Herrn Johann Schönbeck.<br />
*<br />
Unser Jahrbuch „Der Bär von Berlin" ist erschienen und wurde im Monat September ausgeliefert.<br />
Die Mitglieder erhielten den Band zugeschickt, soweit sie den fälligen Mitgliedsbeitrag für das laufende<br />
Jahr (z. Z. 36 DM) entrichtet hatten.<br />
360
Buchbesprechungen<br />
Hsi-Huev Liang: Die Berliner Polizei in der Weimarer Republik. Aus d. Amerikanischen übersetzt<br />
von Brigitte und Wolfgang Behn. Berlin: de Gruyter 1977. XVIII u. 235 S.. 3 Karten, Leinen, 68 DM<br />
(Veröff. der Histor. Kommission zu Berlin, Bd. 47).<br />
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Raum Berlin bietet durch die zentrale Stellung der<br />
Stadt gerade in der Zwischenkriegszeit die Möglichkeit, daß die am Objekt gewonnenen historischen<br />
Aussagen sogar im europäischen Rahmen bedeutsam sind. So ist es nicht lokalgeschichtliches Interesse,<br />
das Liang zur Auseinandersetzung mit den Problemen der Berliner Polizei der Weimarer Republik<br />
angeregt hat, sondern die 1970 zunächst in den USA erschienene Arbeit ist als Versuch zu werten,<br />
umfassende Entwicklungen auf stadtgeschichtlicher Ebene zu diskutieren. Bearbeitet werden die<br />
Entwicklungen in der Kriminal- und Schutzpolizei; letztere bildete nach dem kurzen Zwischenspiel<br />
der „Sicherheitspolizei" die organisatorische Basis der politischen Arbeit in der Stadt. Es fehlen hingegen<br />
Ausführungen zur traditionell auch auf anderen Gebieten starken Stellung des Berliner Polizeipräsidenten<br />
sowie die Einbindung in das preußische Behördensystem.<br />
Der Rahmen der Darstellung spannt sich von dem Zusammenbruch im Jahre 1918, der ein zeitweises<br />
Aufhören der Tätigkeit der Schutzmannschaft, nicht aber der Kriminalpolizei zur Folge hatte, bis<br />
zu den von den Nationalsozialisten vorgenommenen personellen Veränderungen des Jahres 1933. Wie<br />
der Polizeigedanke selbst, so stammte auch der Kern der Polizeitruppe noch aus der Zeit vor 1914.<br />
Polizeiarbeit wurde als „unpolitisch" angesehen, und man versuchte bis 1933, die parteipolitische<br />
Neutralität zu wahren. Die „Politische Abteilung" der Polizei wurde als notwendiges Übel angesehen<br />
und hatte zu keiner Zeit eine hervorragende Bedeutung. Die politische Neigung der zumeist aus<br />
ländlichen Gebieten stammenden Schutzpolizisten - nur wenige gebürtige Berliner genügten den<br />
hohen gesundheitlichen Anforderungen, die bei der Rekrutierung nach 1918 an die jungen Bewerber<br />
gestellt wurden - ging eher nach rechts als nach links. Doch war eine große Zahl von Polizisten in<br />
der SPD oder in gewerkschaftsähnlichen Verbänden organisiert.<br />
Nachdem bald nach 1918 die öffentliche Sicherheit wiederhergestellt war, führte die Zeit nach 1928 zu<br />
tiefgreifenden Spannungen - auch innerhalb der Polizei. Nationalsozialisten wurden in einigen<br />
Revieren dominierend, der Einfluß der KPD war hingegen unbedeutend. Bis 1933 wurde zwar noch<br />
versucht, die Neutralität aufrechtzuerhalten, doch gelang es nicht mehr vollständig. Auch gegen die<br />
Gleichschaltung der Polizei erhob sich kein nennenswerter Widerstand. Besonderes Interesse für den<br />
lokalhistorisch Interessierten werden die Abschnitte über die geographische Verbreitung der Kriminalität<br />
sowie die Schilderung spezieller polizeilicher Aktivitäten finden.<br />
Dn# Liang keine Möglichkeit besaß, die Archive der DDR zu besuchen, stützt sich seine Argumentation<br />
vor allem auf die Befragung von Zeugen. Daneben scheinen auch das Landesarchiv Berlin, das<br />
Document Center Berlin. Akten des Polizeipräsidiums sowie Material des Bundesarchivs Koblenz<br />
benutzt worden zu sein. Leider fehlt darüber eine Aufstellung. Auch hätte man bei der deutschen<br />
Ausgabe nach der Drucklegung erschienene Literatur, etwa die Lebenserinnerungen Ferdinand<br />
Friedensburgs, in das Literaturverzeichnis aufnehmen sollen. Felix Escher<br />
Carl Brinitzer: Die Geschichte des Daniel Ch. Ein Sittenbild des 18. Jahrhunderts. Stuttgart: Deutsche<br />
Verlags-Anstalt 1973. 460 S. mit Abb., Leinen, 38 DM.<br />
Es bedarf schon einiger Phantasie und journalistischer Geschicklichkeit, um aus der Biographie eines<br />
nach Maßstäben des 19. und 20. Jahrhunderts so „bürgerlichen", fleißigen und unauffällig lebenden<br />
Künstlers wie Daniel Chodowiecki die „Geschichte des Daniel Ch." als „Sittenbild" zu formen. Vf.<br />
bringt beides ebenso auf wie die Geduld, rund neunzig Bücher heranzuziehen, um seinem romanhaft<br />
unterhaltsam geschriebenen Opus die durch Anmerkungen untermauerte Wissenschaftlichkeit zu verleihen,<br />
zu der auch Personenregister und Abbildungsverzeichnis am Schluß verhelfen. Wo das Überlieferte<br />
- vor allem der Briefwechsel Chodowieckis und seine Reisetagebücher - nicht zum Aufpolieren<br />
der Lebensgeschichte reicht, tut es Erfindung - weiß Brinitzer doch ganz genau, wie die<br />
Treffen zwischen Friedrich IL und dem Künstler verlaufen sein könnten und was Majestät dabei<br />
äußerte.<br />
361
Von solchen Einlagen und den die Biographie streckenden, teils liebevollen, teils ironischen Werkinterpretationen<br />
abgesehen ist das Buch chronologisch angelegt und schildert nach einem vielleicht<br />
etwas oberflächlichen Exkurs über die polnisch-französische Abstammung des gebürtigen Danzigers<br />
seinen Werdegang von 1740 an, als der Vierzehnjährige - bereits verwaist - als Lehrling im Spezereiwarenladen<br />
einer Tante die ersten Tuschzeichnungen und Pergamentbildchen fertigte. Diese lieferte<br />
er einem Onkel in Berlin, der sie im Rahmen seines Galanteriewarenhandels vertrieb und 1743 den<br />
Neffen als Künstler, Buchhalter und Verkaufshilfe einstellte. Von da an ist das Buch ein Stück Berliner<br />
Kulturgeschichte und weitet sich schließlich auch zu einem Überblick über die Geistesgeschichte<br />
des 18. Jahrhunderts. Denn Chodowiecki, der anfangs vorwiegend Emailbilder für Tabakdosen herstellte<br />
und in dieser Sparte mit 23 Jahren den ersten künstlerischen Unterricht erhielt, bildete sich<br />
durch Besuche in bekannten Ateliers und Zeichenkurse in der Privatakademie des Malers Rode weiter,<br />
experimentierte mit Radierungen und Kupferstichen und gelangte über Vervielfältigungen eines<br />
Miniaturporträts der Prinzessin Friederike Wilhelmine Sophie von Preußen und ihres Bräutigams<br />
schließlich zu größeren Erfolgen und zu einem Illustrationsauftrag für den Berliner Genealogischen<br />
Kalender auf das Jahr 1769. Als er für 1770 Illustrationen zu „Minna von Barnhelm'' schuf, hatte<br />
er seinen endgültigen Beruf gefunden und war seither als Illustrator u. a. für Basedows Werke und<br />
Lavaters physiognomische Fragmente, für Theaterstücke, Goethes „Werther", für Almanache usw.<br />
sehr gefragt, brachte es schließlich sogar zum Akademiedirektor.<br />
Da über das Privatleben des Künstlers so wenig zu berichten ist - von der liebevollen Schilderung der<br />
zwei größeren Reisen nach Danzig und der Reise nach Dresden und Dessau abgesehen -, liegt das<br />
Schwergewicht mehr auf dem Nachvollzug seines Schaffens, von dem reizvolle Beispiele dem Text beigegeben<br />
sind. Ob die Ausführungen immer kunsthistorischen Erkenntnissen standhalten, sei dahingestellt<br />
(die historischen Exkurse haben wenig Tiefgang); das Verdienst, Liebhaber in origineller<br />
Weise an das umfangreiche Werk Chodowieckis heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zur weiteren<br />
Vertiefung der Kenntnisse durch Lektüre von Fachbüchern aufzuzeigen, hat der Autor zweifellos.<br />
Was etwas verblüfft, ist die Tatsache, daß er eine durch Neuauflage so leicht zugängliche Quelle<br />
wie die „Beschreibung der Residenzstädte Berlin und Potsdam" von Friedrich Nicolai anläßlich der<br />
Hinweise auf die von Chodowiecki zusammengetragene Kunstsammlung, die dort im zweiten Band<br />
(1786, S. 835 f.) gewürdigt wird, nicht herangezogen hat. Eva Gießer- Wirsig<br />
Industrialisierung und Gewerbe im Raum Berlin/Brandenburg. Bd. 2: Die Zeit um 1800; die Zeit um<br />
1875. Hrsg. von Otto Busch. Berlin: Colloquium 1977. 186 S., 2 mehrfarb. Karten, 13 Abb. u. Tab.,<br />
Leinen, 98 DM. (Einzelveröff. d. Hist. Kommission zu Berlin, Bd. 19.)<br />
Während in dem 1971 erschienenen ersten Band die Gewerbeentwicklung im brandenburgischen<br />
Raum in der Zeit bis 1850 im Mittelpunkt stand und die Zeit um die Mitte des Jahrhunderts in<br />
Tabellen und einer Karte besonders herausgehoben wurde, enthält der vorliegende Band die Karten<br />
„Gewerbe in Brandenburg um 1800" und „Gewerbe in Brandenburg um 1875". Die Erläuterungen<br />
zu den beiden Karten sind von Otto Busch und Wolfgang Scharfe in dem Beitrag „Gewerbe in<br />
Brandenburg um 1800" und von Otto Busch „Das brandenburgische Gewerbe im Ergebnis der<br />
.Industriellen Revolution'" zusammengefaßt worden. Nicht nur in den Karten, sondern auch in den<br />
Auswertungen wird der zentralen Rolle Berlins bei der Industrialisierung des ganzen Raumes Rechnung<br />
getragen. Einen Einstieg in die Problematik der statistischen Grundlagen sowie der kartographischen<br />
Darstellung bietet Wolfgang Scharfe in dem Aufsatz „Brandenburg in der Gewerbekarte".<br />
Vom selben Verfasser stammt auch der Versuch, mit Hilfe des in der wissenschaftlichen Statistik<br />
ausgebildeten Dreiecksdiagramms „Wirtschaftsstrukturelle Veränderungen in brandenburgischen<br />
Städten 1800—1875" auszuwerten. Hier werden die Anteile der Beschäftigten in Gewerbe, Landwirtschaft<br />
und dem Handels- und Dienstleistungsbereich in eine Beziehung gesetzt. Auffällig ist die<br />
zunehmende landwirtschaftliche Orientierung in den kleineren Städten. - Mit beiden Bänden liegt nun<br />
eine gute Quellendarstellung und -auswertung für die Entwicklung der Industrialisierung in einem der<br />
zentralen deutschen Wirtschaftsräume vor. Felix Escher<br />
362
Dieter Hoffmann-\xthelm. Das abreißbare Klassenbewußtsein. (Baugeschichte und Wiederaufbau<br />
des Mehringplatzes in Berlin.) Gießen: Anabas-Verlag 1975. 132 S., 70 Abb., brosch., 12,80 DM.<br />
Die Tugend dieses Buches ist zugleich seine Schwierigkeit: Es ist so konzentriert geschrieben, daß<br />
selbst große Anspannung auf Seiten des Lesenden zuweilen nicht genügt, den Sinn eines Satzes zu<br />
erfassen. Und der Autor beginnt mit einem „didaktischen Teil" - und endet mit einem „didaktischen<br />
Zusatz"! Allerdings versteht er in diesem Buch, anders als in seiner Tätigkeit als Lehrer, unter<br />
Didaktik nicht die Technik, das Verstehen zu erleichtern; vielmehr ist Didaktik ihm hier das Gewinnen<br />
eines Standpunktes, der es ermöglicht, die Fehlschlüsse endlich zu vermeiden, welche wir ständig<br />
machen. Der didaktische Teil am Anfang und der didaktische Zusatz am Ende lassen erkennen, worauf<br />
es ihm ankommt: Das Anfangskapitel beschäftigt sich eingehend mit den Bedingungen, den Zielen<br />
dem Gegenstand und dem Verfahren der geplanten Vermittlung - und das heißt jeder heute möglichen<br />
Vermittlung; und es bedarf dann des ganzen Ablaufes der Geschichte des Mehringplatzes nebst<br />
Exkursen und des architekturtheoretischen Teiles, um am Ende als gewonnenes Ergebnis bekräftigen<br />
zu können, was am Anfang als Postulat gestanden hatte. Am Anfang: „Nur in dieser Lebendigkeit<br />
kann dann zwingend erkannt werden, daß das, was sich im Gegenstand ausdrückt. Element und<br />
Gegenstand einer von tödlichen Widersprüchen vorangetriebenen gesellschaftlichen Geschichte ist,<br />
und also die Vernichtung der Objekte die Konsequenz ihrer eigenen Verwirklichung." Am Ende:<br />
„Was den architektonischen Gegenstand in Bewegung hält, ist aber nicht der Gebrauchswert, sondern<br />
gerade das Wertschicksal." Das Wort bedeutet die Abnutzung aller faktischen und Gebrauchswerte<br />
und ihre Ersetzung durch die Verwertung, die „mit Abschreibung, Überalterung usw." ihr Ende<br />
nimmt. Und, kurz davor: „Dieser Widerspruch muß begriffen, und bearbeitet, nicht weggewünscht<br />
werden." Das heißt, kurz und gut. daß wir uns von der bürgerlichen Perspektive, welche sich etwa<br />
in den Worten Baukunst, Stadtbaukunst usw. ausdrückt, befreien müssen, daß wir weder von einem<br />
neuen Historismus träumen dürfen (wie manche das bereits tun) noch von Plätzen und anderen<br />
städtischen Räumen als Dingen an sich, welche unter jeder historischen Bedingung, also auch derjenigen,<br />
welcher wir unterworfen sind, herzustellen wären; daß wir nicht vorwärtskommen, wenn wir<br />
nicht bereit sind, die gegenwärtige Situation - die Situation des Bauens für die Verwertung - mit<br />
allen ihren Widersprüchen als historisch schlüssig anzuerkennen, womit allerdings nicht gesagt ist, daß<br />
wir sie bejahen sollten. Das Buch endet mit dem Satz: „Auch die architektonische Bewußtlosigkeit<br />
des Verwertungsstandpunktes wird abgerissen werden, spätestens dann, wenn die Menschen wieder<br />
Platz und Plätze brauchen, um gesellschaftlich miteinander zu verkehren." Also spätestens im<br />
Sozialismus. Man darf allerdings fragen, ob die Menschen dann Plätze brauchen werden. Das ist<br />
schwer vorauszusagen. Es mag sein, daß sie räumliche Gebilde anderer Art benötigen werden, um<br />
gesellschaftlich miteinander zu verkehren.<br />
An diesem Ende angelangt, welches auf den Anfang zurückweist, möchte man das Buch noch einmal<br />
lesen. Und das sollte man; denn zwischen Anfang und Ende enthält es keineswegs nur die Geschichte<br />
des Mehringplatzes, es enthält Zusammenfassungen von haarsträubender Knappheit: über die Piazza,<br />
die Place Royale und den Square als Ursprünge aller bürgerlichen Plätze; über Rundplätze des bürgerlichen<br />
Zeitalters - wozu die Architektur des Faschismus und die der DDR gerechnet werden; über<br />
die dialektische Beziehung zwischen dieser Architektur des Faschismus und der des Funktionalismus;<br />
über das Wesen der Ornamentlosigkeit als eines Versuches, zur reinen Form zu gelangen, wobei sich<br />
die funktionalistischen Formeln als Vorwände herausstellen; aber auch über die dialektische Beziehung<br />
zwischen Katholizismus und Protestantismus seit der Gegenreformation.<br />
Man nimmt einige dieser Thesen mit Befremden zur Kenntnis, um bald zu merken, daß sie sich auf<br />
jeden Fall vertreten lassen; denn sie sind auf bedeutendes und vielseitiges Wissen gegründet.<br />
Gleichwohl geschieht es, daß man die Fragen, die sich aufdrängen, durch die kahle und zuweilen verschlüsselte<br />
Formel, die der Autor gibt, noch nicht für beantwortet hält. Um solche Gegenstände<br />
auseinanderzusetzen, hätte man sie ein wenig mehr auseinanderlegen müssen; es hätte da in vielen<br />
Fällen statt eines Satzes eines Kapitels bedurft, in einigen eines Buches. Auch geschieht es nicht selten,<br />
daß von Gegenständen gesprochen wird, welche in dem billigen Büchlein nicht abgebildet werden<br />
konnten, ja, der Haupt- und eigentliche Gegenstand selbst, der Mehringplatz in seiner heutigen<br />
Form, ist nicht genügend dokumentiert, was nur zum Teil daran liegt, daß er, als das Buch geschrieben<br />
wurde, noch nicht ganz fertig war. Mit einem Wort, man wünscht sich eine Auseinanderfaltung: anstelle<br />
der 132 Seiten mindestens 500.<br />
Dabei handelt es sich bei dieser formelhaft knappen Sprache keineswegs um einen Jargon (wenngleich<br />
ich wünschte, das Wort „Vermittlung" wäre weniger häufig gebraucht worden). Dieter Hoffmann-<br />
363
Axthelm schreibt reines Deutsch, allerdings nicht eben das Deutsch der bürgerlichen Novelle oder<br />
des (bürgerlichen) Essays. Die Begriffe, die er benutzt, und die Art, wie er sie einsetzt, setzen voraus,<br />
daß der Leser ebenso gelehrt sei wie der Autor, daß er „nun, ach! Philosophie" und alle anderen<br />
Disziplinen studiert haben, welche Dieter Hoffmann-Axthelm offenbar „durchaus mit heißem Bemühn"<br />
studiert hat. Aber das haben die wenigsten.<br />
Das Buch ist eines der wenigen, die mir wichtig erscheinen. Es werden ja gegenwärtig sehr viele<br />
Bücher geschrieben, auch gute Bücher; aber grundsätzlich kann man nur von solchen Büchern lernen,<br />
die auf die Grundsätze zurückgehen; und das tut dieses Buch. Julius Posener<br />
Klaus Duntze: Der Geist, der Städte baut. Planquadrat - Wohnbereich - Heimat. Stuttgart: Radius-<br />
Verlag 1972. 213 S. mit 25 Abb., kart., 24 DM.<br />
Das Wohnen und die Kirche. = Kunst und Kirche, hrsg. vom Arbeitsausschuß des Ev. Kirchenbautages<br />
Marburg. H. 2. Gütersloh: Mohn 1977. 110 S., brosch.<br />
Das Interesse an Fragen des Städtebaus ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Mitwirkung der<br />
Betroffenen bereits an der Planung neuer oder zu sanierender Wohnquartiere erhält dabei ein besonderes<br />
Gewicht. Auch von Seiten der Kirche wird dem Problem der „Humanisierung" der Planung<br />
immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Ein interessantes Beispiel dafür ist das anläßlich des Ev.<br />
Kirchentages in Berlin erschienene Heft der Zeitschrift „Kunst und Kirche", das speziell diesen Fragen<br />
in Berlin gewidmet ist. Die hier gebotenen, meist sehr knappen Aufsätze reichen von allgemeinen<br />
Themen zum Wohnen und der Situation der Kirche in Berlin über spezielle Probleme der Jugendarbeit<br />
im Märkischen Viertel und anderen Neubaugebieten und Sanierungsaufgaben im Ortskern von<br />
Neukölln bis zum Aufzeigen alternativer Wohnmöglicheiten in Lichtenrade-Ost.<br />
Auch Pfarrer Duntze von der Martha-Kirchengemeinde Kreuzberg ist in dem Bd. mit einem Beitrag<br />
zu einer von ihm maßgeblich beeinflußten Ausschreibung zur Neubelebung des seit Jahrzehnten vernachlässigten<br />
Stadtteils Kreuzberg-Ost (,.SO 36") vertreten. Bereits 1972 war er mit dem Buch „Der<br />
Geist, der Städte baut" einem ähnlichen Thema nachgegangen. Ziel war, neue Denkanstöße zur Planung<br />
von Stadtquartieren, insbesondere des von der Sanierung bedrohten SO 36 zu geben. Gedanken<br />
zur Architektur, Soziologie und Theologie im Städtebau stehen oft unvermittelt nebeneinander, ohne<br />
daß eine Synthese gelingt. Dennoch bleiben der historische Abriß zur Theorie des Städtebaus und<br />
besonders die theologische Fundierung seiner Ansichten lesenswert. Felix Escher<br />
Werner Jaeger: Das Mittelrad-Dampfschiff „Prinzessin Charlotte von Preußen" 1816. Oldenburg<br />
u. Hamburg: Stalling 1977. 128 S. mit Abb. u. 6 Skizzen-Beil., Leinen, 39.80 DM. (Schriften d.<br />
Deutschen Schiffahrtsmuseums. Bd. 7.)<br />
Werner Jaeger hat sich der lohnenden Mühe unterzogen, in seinem Buch die Mysterien aufzuhellen,<br />
die 150 Jahre hindurch den Bau des ersten deutschen Dampfschiffes umgeben hatten. Das Fahrzeug<br />
ist 1816 unter Leitung eines englischen Konstrukteurs in Picheisdorf bei Spandau erbaut und noch im<br />
selben Jahr in Betrieb genommen worden. Obwohl das dampfgetriebene Fahrzeug alle technischen<br />
Erwartungen erfüllt und zum Teil übertroffen hat. war ihm dennoch nur die extrem kurze Lebensdauer<br />
von drei Jahren beschieden, da sich eine rentable Verwendung des Schiffes im Betrieb nicht hatte<br />
erreichen lassen.<br />
Die Tatsache, daß die Konstruktions- und Bauzeichnungen, die dem zuständigen preußischen Ministerium<br />
eingereicht wurden, „trotz preußischer Gründlichkeit", wie der Autor sagt, bis zum heutigen<br />
Tage unauffindbar geblieben sind, hatte bewirkt, daß sich im Laufe von mehr als hundert<br />
Jahren unter den Experten Meinungen über die Konstruktion des Schiffes gebildet haben, die,<br />
obzwar samt und sonders nur auf zeitgenössischen Presseberichten, Darstellungen von Malern<br />
sowie technischen Indizien und Hypothesen basierend, in einer immer umfangreicher werdenden<br />
Literatur von jedem einzelnen Autor mit hartnäckiger Überzeugungskraft verfochten wurden. „Aufgrund<br />
der vorliegenden Erkenntnisse" wurde 1962 ein Modell des Schiffes erstellt.Kurz darauf<br />
wurden originalgetreue Kopien der Konstruktionszeichnungen mit genauen Maßangaben im Archiv<br />
der englischen Firma entdeckt, die seinerzeit die Antriebsmaschine geliefert hatte. Dieser unerwartete<br />
Zufall bewies in Vergleichen mit dem Modell, wie weit sich die Phantasie der Berufenen von der<br />
Wirklichkeit entfernt hatte . . .<br />
364
Durch das unerwartete Wiederauftauchen der Zeichnungen wurde dem Autor die Erstellung einer<br />
weitgehend authentischen technisch-historischen Dokumentation des ersten, in Deutschland erbauten<br />
hölzernen Dampfschiffes möglich. Der Leser des gefälligen Bandes der Schriften des Deutschen<br />
Schiffahrtsmuseums erlebt die Anfänge des Schiffbaus in der Pichelsdorfer Sandbucht, die Probefahrten,<br />
den Stapellauf und den Betriebseinsatz bis hin zur Stillegung des Fahrzeuges. Die Abhandlung vermittelt<br />
dem historisch Interessierten durch den teilweise wörtlichen Abdruck zahlreicher Stellungnahmen<br />
aus der lokalen Tagespresse ein zeitgetreues Lokalkolorit und dem Techniker durch eine<br />
Vielzahl von Faksimile-Wiedergaben der englischen Kontruktionszeichnungen. mit erläuternden<br />
Begleittexten versehen, einen umfassenden Überblick über Konstruktion und Wirkungsweise des<br />
Antriebsaggregates sowie die Manövrierfähigkeit und das Fahrverhalten des ersten deutschen Flußdampfers.<br />
Im zweiten Teil des Bandes befaßt sich der Autor mit dem Bau von vier weiteren Flußdampfern<br />
ähnlicher Konstruktion zwischen 1816 und 1819, teils in Picheisdorf, teils in Potsdam erbaut. Der<br />
Anhang des Werkes enthält die Übersetzung einer langen Reihe englischer schiffsbautechnischer<br />
Fachausdrücke sowie deutschsprachige Erläuterungen zu den englischen Werkzeichnungen. Die<br />
58 Anmerkungen auf den Seiten 89— 111 bieten eine Fülle wissenswerter Details aus dem Gesamtbereich<br />
der Frühzeit des Dampfschiffbaus. Eine Quellenangabe und ein übersichtliches Verzeichnis<br />
sämtlicher Tafeln. Abbildungen und Zeichnungen befindet sich am Schluß des hochinformativen<br />
Werkes. Hans Schiller<br />
Valentin Heinrich Schmidt u. Daniel Gottlieb Gebhard Mehring: Neuestes gelehrtes Berlin oder<br />
literarische Nachrichten von jetztlebenden Berlinischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. 2 Teile,<br />
Berlin: Maurer 1795 (Nachdruck Leipzig: Zentralantiquariat der DDR 1973). XXIV, 294 u. XII,<br />
308 S., Leinen, zus. 140 M.<br />
(Hitzig, Julius Eduard:) Gelehrtes Berlin im Jahre 1825. Verzeichnis im Jahre 1825 in Berlin lebender<br />
Schriftsteller und ihrer Werke. Mit Forts.: Biographische und literarische Nachrichten von den in<br />
Berlin lebenden Schriftstellern u. Schriftstellerinnen, hrsg. von Karl Büchner. 2 Teile in 1 Bd. Berlin:<br />
Dümmler 1826 / Duncker & Humblot 1834 (Nachdruck Leipzig: Zentralantiquariat der DDR 1973).<br />
X, 327 u. XII, 48 S., Leinen, 72 M.<br />
(Koner, Wilhelm David:) Gelehrtes Berlin im Jahre 1845. Verzeichnis im Jahre 1845 in Berlin lebender<br />
Schriftsteller und ihrer Werke. Berlin: Athenäum 1846 (Nachdruck Leipzig: Zentralantiquariat<br />
der DDR 1973). XII, 390 S., Leinen, 70 M.<br />
Bereits vor der Gründung der Berliner Universität war die Stadt zu einem Mittelpunkt der Wissenschaft<br />
in Preußen geworden. Das von Valentin Heinrich Schmidt und Daniel Gottlieb Gebhard Mehring<br />
gesammelte und herausgegebene „Neueste gelehrte Berlin oder literarische Nachrichten von<br />
jetztlebenden Berlinischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen" aus dem Jahre 1795. das in zwei<br />
Bänden zusammengefaßt den ersten Teil der hier vorliegenden Sammlung bildet, gibt dafür einen<br />
überzeugenden Beweis. Nicht nur Mitglieder der bereits zahlreich entstandenen gelehrten medizinischen<br />
und naturwissenschaftlichen Institutionen sowie der gelehrten Schulen der Residenz, sondern<br />
gerade auch „private" Gelehrte und preußische Staatsbeamte werden erfaßt. Insbesondere die wissenschaftliche<br />
Tätigkeit der letzteren Gruppe hat erst in den letzten Jahren durch G. Heinrich für den<br />
Bereich der Historiographie eine umfassende Würdigung erfahren. Neben einer kurzen Biographie,<br />
die auch den wissenschaftlichen Werdegang enthalten kann, ist als kostbarster Teil eine umfassende<br />
chronologische Bibliographie der Gelehrten angefügt. Deutlicher als durch jede Darstellung wird in<br />
den Bibliographien die Breite der wissenschaftlichen Tätigkeit, die in einer Zeit vor der strengen Trennung<br />
der Disziplinen auch durchaus journalistisch gefärbt sein konnte. So stehen wir mit Staunen vor<br />
dem Lebenswerk eines der frühen Historiographen der Mark, Johann Karl Konrad Oelrichs (Bd. II,<br />
S. 70-92).<br />
Der ungeheure Fortschritt der Wissenschaften, den nicht nur die einzelnen Disziplinen, sondern auch<br />
die Wissenschaftsorganisation genommen hatte, zeigt sich in den folgenden, als „Verzeichnis im Jahre<br />
1825, bzw. 1845 in Berlin lebender Schriftsteller und ihrer Werke" 1826 bzw. 1846 erschienenen<br />
Bänden. Hier sind es die an den Universitäten und anderen wissenschaftlichen Institutionen wirkenden<br />
Fachgelehrten, die den größten Teil der aufgenommenen Schriftsteller bilden. Aber er fehlt in<br />
der Ausgabe von 1846 auch nicht der „expedirende Secretair der Stadtverordneten-Versammlung zu<br />
365
Berlin" Johann Karl Ernst Fidicin (S. 87), der (1845) erst am Anfang seiner literarischen Tätigkeit<br />
stand.<br />
Weit über die Grenzen der Stadt hinaus dürften diese seltenen, jetzt im Neudruck vorliegenden Bände<br />
Beachtung finden. Sie bilden eine repräsentative und durch die Neuauflage jeweils im Abstand einer<br />
Generation auch nahezu lückenlose Übersicht über die wissenschaftliche Tätigkeit in Berlin vom<br />
ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Felix Escher<br />
Die „Schriften" des Vereins<br />
... werden voraussichtlich noch vor Ende dieses Jahres mit dem Erscheinen von Band 61 fortgesetzt.<br />
Er wird folgende zwei Arbeiten enthalten:<br />
Wolfgang Ribbe: Quellen und Historiographie zur mittelalterlichen Geschichte von<br />
Berlin-Brandenburg<br />
Konrad Kettig: Goetheverehrung in Berlin. August und Ottilie von Goethe besuchen<br />
1819 die preußische Residenz<br />
Insgesamt ca. 128 Seiten mit zahlreichen Abbildungen.<br />
Die Mitglieder erhalten den Band nach Erscheinen zugesandt, soweit der fällige Mitgliedsbeitrag fiir<br />
das laufende Jahr entrichtet worden ist. Der Verkaufspreis wird ca. 16 DM betragen.<br />
Im III. Vierteljahr 1977<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Eva Draegert, Hausfrau<br />
1000 Berlin 33, Bitterstraße 27<br />
Tel. 8 31 12 23 (Dr. Beerbohm)<br />
Werner Freundt, Bäckermeister<br />
1000 Berlin 61. Körtestraße 8<br />
(Bibliothek)<br />
Harald Goegge, Angestellter<br />
1000 Berlin 13, Rohrdamm 70<br />
Tel. 3 81 20 70 (Brauer)<br />
Gertraud Goegge<br />
1000 Berlin 13, Rohrdamm 70<br />
Tel. 3 81 20 70 (Brauer)<br />
Bärbel Hartmann, Rechtsanwältin<br />
1000 Berlin 41, Dickhardtstraße 48<br />
Tel. 8 51 48 19 (RA Gerhard Asch)<br />
Walter Jagow, Rentner<br />
1000 Berlin 41, Perelsplatz 17<br />
Tel. 8 52 74 76 (Brauer)<br />
Margarete Jeske, kaufm. Angestellte<br />
1000 Berlin 41, Riemenschneiderweg 28<br />
Tel. 8 55 44 81 (Ellen Wiegand)<br />
Brigitte Kaul, Studentin<br />
1000 Berlin 31, Fechnerstraße 23<br />
Tel. 8 6117 75 (Brauer)<br />
Dorothea Krahn, Rentnerin<br />
1000 Berlin 41, Wilhelmshöher Straße 13<br />
Tel. 8 216619 (Brauer)<br />
366<br />
Hildegard Krause, OStR i. R.<br />
1000 Berlin 19, Horstweg 18<br />
Tel. 3 21 57 75 (Eckhard Grothe)<br />
Peter Malik, Verwaltungsangestellter<br />
1000 Berlin 61, Ritterstraße 95<br />
(Brauer)<br />
Hans-Ulrich Mehner, Oberbibl.-Rat<br />
1000 Berlin 19, Kaiserdamm 18<br />
Tel. 3 21 25 19 (Adelheid Beck)<br />
Theo Reckers, Student<br />
1000 Berlin 41, Handjerystraße 71<br />
(Brauer)<br />
Johann Schönbeck, Ing. (Rentner)<br />
1000 Berlin 13, Janischweg 25<br />
Tel. 3 81 39 42 (Schriftführer)<br />
Dietrich Stobbe, Regierender Bürgermeister<br />
von Berlin<br />
1000 Berlin 28, Hedwigstraße 15<br />
(Walter Mügel)<br />
Horst Wesolowski, Signalmechaniker<br />
1000 Berlin 41, Sembritzkistraße 18<br />
(Brauer)
Weitere Veröffentlichungen des Vereins<br />
Von den früheren Ausgaben des Jahrbuchs<br />
DER BÄR VON BERLIN<br />
sind folgende Bände noch erhältlich:<br />
1953, 1957/58 und 1960 je 4,80 DM; 1961 bis 1964 je 5,80 DM; 1965 (Festschrift)<br />
38,- DM; 1968 und 1969 je 9,80 DM; 1971 und 1972 je 11,80 DM;<br />
1973 bis 1975 je 12,80 DM; 1976 und 1977 je 18,50 DM.<br />
MITTEILUNGEN<br />
des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
erscheinen vierteljährlich im Umfang von 32 Seiten. Sie enthalten in der<br />
Regel mehrere Artikel mit Themen zur Berliner Geschichte (mit Abbildungen),<br />
Nachrichten zu aktuellen Anlässen und aus dem Vereinsleben,<br />
Buchbesprechungen und das Programm der laufenden Veranstaltungen<br />
des Vereins.<br />
Einzelhefte aus früheren Jahrgängen sind zum Stückpreis von 4,- DM<br />
noch erhältlich.<br />
Von der neuen Folge der<br />
Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
sind bisher erschienen:<br />
Heft 59: Johann David Müller, Notizen aus meinem Leben. (1973)<br />
Preis 9,80 DM<br />
Heft 60: W. M. Frhr. v. Bissing, Königin Elisabeth von Preußen. (1974)<br />
Preis 11,80 DM<br />
Bestellungen sind an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten:<br />
Albert Brauer, Blissestraße 27,1000 Berlin 31
Veranstaltungen im IV. Quartal 1977<br />
1. Sonnabend, 15. Oktober 1977, 15 Uhr: Besuch des Georg-Kolbe-Museums anläßlich des<br />
100. Geburtstages des Bildhauers. Leitung: Frau Maria Freifrau von Tiesenhausen.<br />
Treffpunkt: Georg-Kolbe-Museum, Sensburger Allee 25. Eintritt: 2,50 DM. Fahrverbindungen:<br />
S-Bahnhof Heerstraße, Autobusse 92,94.<br />
2. Sonnabend, 22. Oktober 1977, 10 Uhr: Besuch der Ausstellung „Aus der Geschichte der<br />
Burg und Zitadelle Spandau". Leitung: Jürgen Grothe. Treffpunkt: Torhaus der Zitadelle.<br />
Fahrverbindungen: Autobusse 13, 55, 99.<br />
3. Freitag, 28. Oktober 1977, 13 Uhr: Herbstwanderung durch den Düppeler Forst.<br />
Leitung: Herr Oberforstrat Dr. Friedrich Riecke. Treffpunkt: Stahnsdorfer Damm Ecke<br />
Kurfürstenweg (Wanderkarte). Fahrverbindungen: S-Bahnhof Wannsee, Autobus 18.<br />
4. Dienstag, 1. November 1977, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Prof. Dr. Peter<br />
Bloch: „Christian Daniel Rauch. Zum 100. Geburtstag eines Berliner Bildhauers".<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
5. Sonnabend, 19. November 1977, 10.15 Uhr: „Heinrich von Kleist, zum Gedenken an<br />
seinen 200. Geburtstag". Führung durch Herrn Dr. Eberhard Siebert. Treffpunkt:<br />
Orangerie des Schlosses Charlottenburg.<br />
6. Dienstag, 29. November 1977, 19.30 Uhr: Vortrag von Herrn Dr. Manfred Stürzbecher:<br />
„100 Jahre Berliner Krippenverein". Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
7. Dienstag. 6. Dezember 1977, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Friedrich<br />
Wilhelm Wentzel: „100 Jahre Ullstein". Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
8. Sonnabend, 17. Dezember 1977, 17 Uhr: Vorweihnachtliches Treffen mit „Geistlicher<br />
Abendmusik" in der Dahlemer Dorfkirche St. Annen. Leitung: Frau Adelheid Fischer.<br />
Anschließend: Beisammensein im Alten Krug. Dahlem. Königin-Luise-Straße 52. Fahrverbindungen:<br />
U-Bahn Dahlem Dorf, Autobusse: 1, 10, 68.<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek ist<br />
zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen geselliges<br />
Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 28. Oktober, 25. November und 16. Dezember zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
ab 17 Uhr.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1000 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1000 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 45 30 11. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1000 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1000 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank. 1000 Berlin 19. Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1000 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Dr. Peter Letkemann, 1000 Berlin 33, Archivstraße 12-14; Claus P.<br />
Mader; Felix Escher. Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt. Bezugspreis für<br />
Nichtmitglieder 16 DM jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1000 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
368
RctsbiblicSbek A 2Q 3?? p<br />
Fadiabt dar Berliner Ctac'ib'llieihelt<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
74. Jahrgang Heft 1 Januar 1978<br />
Kleist-Büste von Karl Friedrich Wichmann, 1816 (Foto: Bernd-Peter Keiser)<br />
369
Heinrich von Kleist zum 200. Geburtstag<br />
Ein Ausstellungsbericht<br />
Von Dr. Ingeborg Stolzenberg<br />
Berlin, die Stadt, in die Heinrich von Kleist immer wieder zurückkehrte, ohne daß er hier<br />
jedoch festen Fuß fassen konnte, ehrte den vor 200 Jahren, am 18. Oktober 1777, in Frankfurt<br />
an der Oder geborenen großen deutschen Dichter mit einer umfassenden Ausstellung,<br />
die an historischer Stelle, in der Orangerie des Charlottenburger Schlosses, vom 11. Oktober<br />
1977 bis 8. Januar 1978 sein Leben, sein Werk und seine Wirkungsgeschichte veranschaulichte.<br />
Die Initiatoren dieser Ausstellung, die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz<br />
und die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft, waren bestrebt, mit Hilfe einer Vielzahl<br />
zeitgenössischer Dokumente. Bilder, Bücher, Karten und Erinnerungsstücke dem heutigen<br />
Betrachter ein möglichst getreues und exemplarisches Bild von den Lebens- und Schaffensbedingungen<br />
des Dichters und seiner Umwelt zu vermitteln. Damit erhebt sich diese<br />
Schau über die kleineren Bibliotheksausstellungen, die ebenfalls in Berlin stattfanden,<br />
und zwar in der Amerika-Gedenkbibliothek und in der Deutschen Staatsbibliothek im<br />
Ostteil der Stadt. Auch die vorwiegend auf der Privatsammlung des Kleistforschers Helmut<br />
Sembdner beruhende Kabinettausstellung im Schiller-Nationalmuseum und Deutschen<br />
Literaturarchiv Marbach am Neckar konnte — in wesentlich kleinerem Rahmen - nichts<br />
Entsprechendes bieten, wenn auch hier erstmalig an einer Stelle über die Hälfte, nämlich<br />
10 der insgesamt 17 in der Bundesrepublik erhaltenen originalen Kleistbriefe zu sehen<br />
waren.<br />
Die Bedeutung des Unternehmens in der Orangerie wird durch einen gedruckten Katalog<br />
von 183 Seiten im Großoktavformat unterstrichen*, der in der Hauptsache von Eberhard<br />
Siebert, dem für die Konzeption und den Aufbau der Ausstellung verantwortlichen Bibliothekar,<br />
verfaßt wurde. Die Beschreibungen sämtlicher Objekte aus dem Bereich der bildenden<br />
Kunst sowie zum Teil die zugehörigen Erläuterungen lieferte Barbara Wilk, die<br />
außerdem das Kapitel über Kleists Werke in der bildenden Kunst bearbeitete, während<br />
Hans-Günter Klein den Abschnitt über Kleists Werke in der Musik betreute. Dieser<br />
Katalog enthält genaue wissenschaftliche Beschreibungen der insgesamt 366 Ausstellungsstücke<br />
mit Herkunftsangaben und Signaturen. Sie werden durch erläuternde Texte,<br />
die den Leser an vielen Stellen in allgemeinverständlicher Weise in die wissenschaftliche<br />
Diskussion, einführen sowie durch zusammenfassende Einleitungen zu jedem Kapitel ergänzt.<br />
43 Textabbildungen sowie 18 Tafeln halten die wichtigsten ausgestellten Objekte<br />
fest. Eine ausführliche Zeittafel, eine Liste ausgewählter Literatur und ein Register beschließen<br />
den Band, der über die Ausstellung hinaus als Einführung in die Quellengeschichte<br />
zu Kleists Leben und Werk dienen kann. Mit diesem Katalog übertrifft diese<br />
* Heinrich von Kleist. Zum Gedenken an seinen 200. Geburtstag. Ausstellung der Staatsbibliothek<br />
Preuß. Kulturbesitz in Verbindung mit der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft e.V. in der Orangerie<br />
des Charlottenburger Schlosses. Berlin, 11. November 1977 bis 8. Januar 1978. (Ausst. u. Katalog:<br />
Eberhard Siebert, in Zus.-Arbeit m. Barbara Wilk u. Hans-Günter Klein.) (Berlin: Staatsbibl. 1977.)<br />
(Staatsbibliothek Preuß. Kulturbesitz. Ausstellungskataloge, 8.) ISBN 3-88053-006-8. ISSN<br />
0340-0700. 12-DM.<br />
370
Ausstellung auch alle früheren Ausstellungen, selbst diejenige, die 1927 bei einer noch<br />
weitaus besseren Quellenlage von der Preußischen Staatsbibliothek, der Vorgängerin der<br />
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, und der Kleist-Gesellschaft in Berlin veranstaltet<br />
wurde.<br />
Es erheischt Respekt, was die Bearbeiter, voran Eberhard Siebert, zusammengetragen<br />
haben. Die Überlieferungssituation war für diesen Dichter, der ein unstetes Leben führte,<br />
zahlreiche Manuskripte selbst verbrannte und früh seinem Leben ein Ende setzte, von jeher<br />
schlecht. Verständnislosigkeit für sein Werk, falsch verstandene Pietät und vor allem der<br />
letzte Krieg und seine Folgen vernichteten viele Zeugnisse oder machten sie im geteilten<br />
Deutschland unerreichbar. Immerhin aber gehört die West-Berliner Staatsbibliothek,<br />
obwohl der größte Teil der Kleistautographen der Preußischen Staatsbibliothek seit Kriegsende<br />
verschollen ist. auch heute noch zu denjenigen Instituten, die wichtigste originale<br />
Unterlagen besitzen, nämlich das Manuskript der „Familie Ghonorez" (später die „Familie<br />
Schroffenstein"), die einzige vollständige Dramenniederschrift von der Hand des Dichters,<br />
eine Schreiberkopie der „Penthesilea'" mit eigenhändigen Verbesserungen des Autors,<br />
das einzige nachweislich authentische Porträt Kleists, das Peter Friedet im Frühjahr 1801<br />
in Berlin malte (es wurde 1971 von der Staatsbibliothek aus Kleistschem Familienbesitz<br />
erworben), ferner die biographischen Notizen über Kleist von Wilhelm v. Schütz. Im<br />
Buchbestand der Bibliothek befinden sich einige Stücke der von Kleist und Adam Müller<br />
herausgegebenen Zeitschrift „Phöbus" (1808/09), ein fast vollständiges Quartal der<br />
seltenen „Berliner Abendblätter", die Kleist 1810/11 veröffentlichte sowie eine Reihe<br />
von Erstausgaben des Dichters und seiner Zeitgenossen. Insgesamt stammen 151 Ausstellungsstücke<br />
aus der Staatsbibliothek. Weitere 60 steuerten andere Institute der Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz bei, von denen vor allem das Bildarchiv, das Kupferstichkabinett<br />
der Staatlichen Museen und das Geheime Staatsarchiv, das verschiedene Aktenstücke<br />
und Quellenwerke zur Verfügung stellte, genannt sein sollen. Der Stiftung gehört<br />
ferner das sonst als Leihgabe im Schinkel-Pavillon hängende Gemälde Caspar David<br />
Friedrichs „Der Mönch am Meer" (1808/10), über das sich Kleist am 13. Oktober 1810<br />
in den „Berliner Abendblättern" äußerte und das den zentralen Blickpunkt der Kleistausstellung<br />
bildete.<br />
Darüber hinaus war man auf die Mitarbeit von 50 Leihgebern angewiesen, auf die zusammen<br />
155 Objekte entfallen. Fast die Hälfte hiervon lieferte die Amerika-Gedenkbibliothek<br />
in Berlin, die den als „Sammlung Kleist" fortgeführten und laufend ergänzten<br />
Nachlaß des Kleistforschers Georg Minde-Pouel (t 1950) verwaltet. In diese Sammlung<br />
gehören ein eigenhändiger Brief des Dichters an den Berliner Verleger Georg Andreas<br />
Reimer (1811), der Gipsabguß einer allerdings nicht unumstrittenen Lebendmaske Kleists<br />
nach dem Exemplar der Kunstakademie Düsseldorf sowie zahlreiche Fotografien von<br />
Bildern und Handschriften, die zum Teil heute, nach dem Verlust der Originalvorlagen,<br />
dokumentarischen Wert bekommen haben.<br />
Wertvolle Manuskripte und Lebenszeugnisse Kleists kamen aus der Bundesrepublik nach<br />
Berlin. Die Universitätsbibliothek Heidelberg trennte sich von ihrer Prinz-von-Homburg-<br />
Handschrift, die 1811 als kalligraphische Schreiberkopie für die Prinzessin Wilhelm von<br />
Preußen, einer geborenen von Hessen-Homburg, angefertigt worden war. Die Staatsund<br />
Universitätsbibliothek Hamburg gab aus ihrer Campe-Sammlung die eigenhändig von<br />
Kleist aufgezeichneten Denkübungen für seine Braut (Nr. 1), Wilhelmine von Zenge,<br />
heraus. Ein Nachkomme von Kleists Freund, des späteren preußischen Kriegsministers<br />
371
und Ministerpräsidenten Ernst von Pfuel, deponierte eine goldene Tabakdose seines Vorfahren,<br />
die der Überlieferung nach ein Geschenk des Dichters darstellte. Das Frankfurter<br />
Goethe-Museum schickte u. a. den Rest des „Glückskranzes", den Karoline von Schlieben<br />
im Mai 1801 zusammen mit dem Dichter an der Brühischen Terrasse in Dresden band, und<br />
den letzten Brief Kleists an Wilhelmine von Zenge (Thun, 20. Mai 1802), mit dem er ihre<br />
Verlobung auflöste. Zwei weitere Originalschreiben des Dichters konnten aus westdeutschem<br />
Privatbesitz (an Reimer, 1810) und dem des Schiller-Nationalmuseums (an den<br />
Verleger Cotta, 1808) gezeigt werden. Das gleiche Institut verlieh dazu das seit 1938<br />
bekannte Kleistporträt, das wohl zur Zeit der französischen Gefangenschaft des Dichters<br />
von einem unbekannten Maler in Öl ausgeführt wurde.<br />
Einer kleinen Sensation kommt schließlich die Vorstellung einer Kleistbüste aus westdeutschem<br />
Privatbesitz gleich, von der die Kleistforschung bisher offenbar nichts wußte<br />
und die lt. Signatur der Berliner Bildhauer Karl Friedrich Wichmann 1816, also fünf<br />
Jahre nach Kleists Tod — vielleicht nach der oben erwähnten Maske —, in Gips herstellte<br />
(s. Titelbild). Außerdem förderte die Ausstellung das Original des Pastellbildes von Kleists<br />
drei Jahre jüngerem Bruder Leopold (1780— 1837) zutage, das sich bei einem Zweig der<br />
Familie von Kleist in Ratingen erhalten hat. Im Katalog ist nur die Fotografie hiervon aus<br />
der Amerika-Gedenkbibliothek angezeigt (Nr. 21).<br />
Alle diese Dokumente und Unterlagen zur Lebensgeschichte des Dichters sind zusammen<br />
mit den Zeugnissen seines Werkes in ihren biographischen Zusammenhang gebracht und<br />
auf sieben Zeitabschnitte aufgeteilt, denen räumlich im langen Gang der Orangerie mit<br />
Hilfe von Stellwänden gebildete „Nischen" entsprechen: von der Familie, Geburt und<br />
Kindheit über die Militär- und Studienzeit, die Jahre der Verlobung bis zu den Stationen<br />
von Oßmannstedt bis Königsberg, von Fort de Joux bis Prag und den letzten Lebensjahren<br />
in Berlin mit dem Ende am Kleinen Wannsee.<br />
Bei der Vorstellung der Familie durften natürlich die Bildnisse und Werke von Kleists<br />
dichtenden Angehörigen nicht fehlen, seines Großonkels Ewald Christian von Kleist<br />
(1715 — 1759), der in der Schlacht von Kunersdorf fiel, und des entfernter verwandten,<br />
früh verstorbenen Franz Alexander von Kleist (1769— 1797). Auch die Kleistsche Flasche<br />
ist abgebildet, die der Kamminer Domdekan Ewald Jürgen von Kleist (1700—1748)<br />
1745 erfand, eine Voraussetzung der drahtlosen Telegraphie (die jedoch nach ihrem<br />
zweiten Erfinder im Jahre 1746, Cunäus in Leiden, als Leidener Flasche bekannt wurde).<br />
Daß auch Heinrich von Kleist technisches Talent besaß, bezeugt ein Brief von 1805 an<br />
Ernst von Pfuel, in dem er das von ihm erfundene Unterwasserfahrzeug, das er Hydrostat<br />
nannte, vorstellte.<br />
Heinrichs Taufzeugnis ist im originalen Kirchenbuch der Garnison Frankfurt an der Oder<br />
aus dem Geheimen Staatsarchiv zusammen mit der Liste seiner neun Paten und einem<br />
Eintrag über seinen Tod nachzulesen. Bilder, meist in Form von Fotografien, zeigen seine<br />
Eltern und zwei seiner Geschwister. Ein Originalbrief von Carl Eduard Albanus an Ludwig<br />
Tieck von 1832 (aus der Amerika-Gedenkbibliothek) überliefert das Urteil des ersten<br />
Hauslehrers Martini über den jungen Kleist.<br />
Die Militärzeit kündigt sich mit Uniformbildern, einem echten Degen für preußische<br />
Infanterie-Offiziere aus dem Wehrgeschichtlichen Museum Schloß Rastatt und dem Modell<br />
einer französischen Feldkanone (die auch im preußischen Heer verwendet wurde; ebenfalls<br />
aus Rastatt) an. Der zum Fähnrich beim Regiment Garde Nr. 15 avancierte Kleist<br />
fand natürlich auch Eingang in die gedruckte Rangliste der Königlich Preußischen Armee<br />
372
für das Jahr 1796, und zusammen mit anderen Regimentskameraden erscheint sein Name<br />
1795 im Besucherbuch der Gemäldegalerie Kassel - eine Entdeckung, die Hans Joachim<br />
Kreutzer machte und die erstmalig im Ausstellungskatalog veröffentlicht wurde. Zwei<br />
zeitgenössische Musikinstrumente aus dem Staatlichen Institut für Musikforschung Preußischer<br />
Kulturbesitz, eine Querflöte und eine B-Klarinette. weisen darauf hin, daß Kleist<br />
sehr musikalisch war, beide Instrumente meisterlich beherrschte und auch das Quartettspiel<br />
pflegte.<br />
Die Schauplätze von Kleists Lebensstationen wie auch die markanten historischen Ereignisse<br />
der Zeit sind durch alte Stiche und Karten, zum Teil auch mit Hilfe jüngerer<br />
Fotografien belegt. Hinzu kommen die Bilder der Freunde, Gönner und einflußreichen<br />
Persönlichkeiten, mit denen der Dichter zu tun hatte.<br />
Gezeigt werden die Bücher, die den jungen Kleist besonders beeindruckten: die „Mathematischen<br />
Anfangsgründe", Teil 1, von Abraham Gotthelf Kästner (4. Aufl. 1786), die<br />
„Unterhaltungen über den Menschen" des Frankfurter Professors Christian Ernst Wünsch<br />
(T. 1, 2. Aufl. 1796), Wielands „Sympathien" (Erstausgabe 1756), Rousseaus „Emile"<br />
(T. 1, La Haye 1762), die „Luise" von Johann Heinrich Voß, 1795, und Kants „Kritik der<br />
reinen Vernunft" (2. Aufl. 1787).<br />
Zum „Zerbrochenen Krug" ist der Kupferstich von Le Veau „Le juge, ou la cruche<br />
cassee" aufgehängt, der Anlaß des Dichterwettstreits zwischen den Freunden Kleist,<br />
Heinrich Zschokke, Ludwig Wieland und Heinrich Geßner bildete, deren Werke dann gemeinsam<br />
in den Vitrinen eingesehen werden können. - Neben Kleists eigenhändigem<br />
Manuskript der „Familie Ghonorez" erscheinen die überwiegend positiven oder doch<br />
wohlwollenden ersten Kritiken aus den Jahren 1803 und 1804, darunter diejenige von<br />
Joseph von Görres. - Die Quelle zum „Robert Guiskard" ist mit K. W. F. v. Funcks Geschichte<br />
des Herzogs von Apulien und Calabrien in den „Hören", 1797, ebenso vertreten<br />
wie Johannes Daniel Falks „Amphitruon". 1804, der Kleist zu seinem Lustspiel „Amphitryon"<br />
anregte. - Eine Lithographie stellt Francois Dominique Toussaint l'Ouverture<br />
dar, der sich mit Hilfe der Neger zum Gouverneur von Haiti gemacht hatte, dann aber<br />
von napoleonischen Truppen besiegt und als Gefangener nach Fort de Joux verbracht<br />
worden war, wo er 1803 in denselben Gewölben starb, in denen vier Jahre später Kleists<br />
Kamerad Gauvain festgehalten wurde. Kleist hörte dadurch vom Freiheitskampf der<br />
Neger in Westindien, an den seine Novelle „Die Verlobung in St. Domingo" anknüpft.<br />
— In Hederichs „Gründlichem mythologischen Lexikon" von 1770 sind die Stichwörter<br />
„Penthesilea" und „Pentheus" aufgeschlagen, die Kleist mit zu seinem Penthesilea-Stoff<br />
verhalfen. - Als Grundlage des „Käthchen von Heilbronn" werden Gotthilf Heinrich<br />
Schuberts „Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft". 1808, gezeigt, dazu ein<br />
Foto des Wachsreliefs der somnambulen Heilbronner Ratsherrentochter Lisette Kornacher<br />
(1773—1858), ein Bild des im letzten Krieg zerstörten, aber wieder aufgebauten<br />
Käthchenhauses und Bürgers „Graf Walter" in seinen „Sämmtlichen Schriften", Band 2.<br />
1796. Das Echo, das das Stück fand, dokumentieren die Besprechungen von Wilhelm<br />
Grimm, Friedrich Wilhelm Guhitz und Friedrich Weißer, von denen der letzte sich vollkommen<br />
negativ äußerte. - In der Sammelhandschrift eines Kopisten im Nachlaß von<br />
Ludwig Tieck in der Berliner Staatsbibliothek hat sich der Anfang einer Einleitung zu der<br />
1809 von Kleist in Prag geplanten, aber nicht zustande gekommenen Zeitschrift „Germania"<br />
erhalten.—Verschiedene Quellenwerke werden zum „Michael Kohlhaas" beigebracht,<br />
und besonders ausführlich wird der historische Hintergrund des „Prinzen von Homburg" be-<br />
373
legt. Siebert baut hier die These weiter aus, daß Prinz Louis Ferdinand von Preußen das<br />
Urbild des Prinzen gewesen sei, was die Ablehnung dieses Stückes durch den mit Louis<br />
Ferdinand nicht übereinstimmenden Friedrich Wilhelm III. erklären würde. Über die<br />
Druckgeschichte dieses Werkes orientieren uns die Aufzeichnungen des Literaturhistorikers<br />
Rudolf Köpke über seine Gespräche mit Ludwig Tieck im Nachlaß Tieck, in denen<br />
Klaus Kanzog erst 1968 den entscheidenden Satz über die Weitergabe der der Prinzessin<br />
Wilhelm gewidmeten Handschrift ohne deren Wissen durch eine Hofdame an Tieck fand,<br />
wonach dieser die Erstausgabe in Kleists „Hinterlassenen Schriften" (1821) veranstaltete.<br />
Ein Gipsabguß des antiken Dornausziehers aus Rom veranschaulicht den anmutigen Jüngling<br />
im ursprünglichen Zustand des Menschen vor dem Sündenfall, den Kleist nach einer<br />
Kopie im Louvre in seinem Aufsatz „Über das Marionettentheater" beschrieb. Auf dasselbe<br />
Werk weist weiter die Radierung nach einem Gemälde von David Teniers d.J. mit<br />
tanzenden Bauern aus der Dresdener Galerie, „Die lustige Hahnreyschaft". Auch andere<br />
Dichtungen Kleists standen unter dem Einfluß dieses Künstlers.<br />
Breiten Raum nehmen dann die Quellen und Unterlagen zum Selbstmord am Kleinen<br />
Wannsee ein. Aus dem Besitz des verstorbenen Kurt Pomplun stammt das Foto von der<br />
Bauzeichnung des Neuen Kruges in der Königstraße, in dem Kleist und Henriette Vogel<br />
die letzten 24 Stunden vor ihrem Tode verbrachten. Fotos von Kleists Abschiedsbrief<br />
an seine Schwester Ulrike und von Henriettes „Todeslitanei" stehen neben Klopstocks<br />
Ode „Die todte Clarissa", die mit zur letzten Lektüre der zum Tode Entschlossenen gehörte.<br />
Es folgen die amtlichen Unterlagen über diese Verzweiflungstat, die Todeseintragung<br />
im Stahnsdorf-Machnower Kirchenbuch, Henriettes Todesanzeige und Ernst Friedrich<br />
Peguilhens erst 1909 gedruckte Verteidigungsschrift. Neben den verständnisvollen<br />
Äußerungen der Freunde fehlen auch kritische Stimmen und der Schmähartikel von<br />
Friedrich Weißer nicht. Der wechselnde Zustand des Kleistgrabes, der dem Lokalhistoriker<br />
noch einige Rätsel aufgibt, wird von den Zeiten Fontanes an mit mehreren Bildern bzw.<br />
Fotos dokumentiert.<br />
Der zweite Teil der Ausstellung ist der Wirkungsgeschichte des Dichters gewidmet, die<br />
gleichsam als Kontrapunkt zu dem anscheinend erfolglosen Leben Kleists aufgefaßt werden<br />
kann. Besonders ausführlich geht Siebert auf die Aufführungsgeschichte der Dramen<br />
ein. Sie traten ihren Siegeszug am Ende des vorigen Jahrhunderts an; Kleist selber<br />
sah kein einziges seiner Stücke auf der Bühne und hatte auch keine Gelegenheit zur praktischen<br />
Theaterarbeit. Die wichtigsten Inszenierungen des 19. Jahrhunderts, vor allem in<br />
Berlin, werden anhand von Theaterzetteln, Textbearbeitungen. Entwürfen für Bühnenbilder<br />
und Figurinen, Rezensionen und natürlich Bildern von Schauspielern und Aufführungsstätten<br />
vorgestellt.<br />
Es schließt sich ein Kapitel über Dramatisierungen, Bearbeitungen und Übersetzungen<br />
Kleistscher Werke an. Besonderes Interesse beanspruchen weiter die Vertonungen des<br />
Dichters. Es ist bemerkenswert, wieviele Komponisten in unserer Zeit sich mit Kleist<br />
beschäftigten: von Werner Egk, Fritz Geißler und Heimo Erbse bis zu Giselher Klebe und<br />
Hans Werner Henze. Auch für die bildenden Künstler unserer Tage hat Kleist eher noch<br />
an Faszination gewonnen, wenn im Zentrum ihrer Auseinandersetzung mit dem Dichter<br />
auch mehr die kleinen Schriften als die Dramen stehen. Die Beispiele sind nach den einzelnen<br />
Dichtungen geordnet und vereinigen so bekannte Namen wie Moritz von Schwind,<br />
Adolph von Menzel, Wilhelm Busch, Max Liebermann, Ernst Barlach, Oskar Kokoschka,<br />
Alfred Kubin, Max Ernst, Hann Trier u. a.<br />
374
Die Ausstellung wurde in Verbindung mit dem Senator für kulturelle Angelegenheiten<br />
von einem Veranstaltungsprogramm begleitet, das Vorträge namhafter Wissenschaftler<br />
im Schloß Charlottenburg und die Vorführung von Filmen nach Kleistschen Stoffen sowie<br />
Kleistlesungen bekannter Autoren und eine Ansprache des DDR-Dichters Günter Kunert<br />
in der Akademie der Künste vorsah. Auch hieran zeigte sich, wie stark die Wirkung ist,<br />
die von Kleists Werk heute ausgeht.<br />
Die Hauptstadt und die Havelstadt<br />
Berlin und Spandau in ihren wechselseitigen Beziehungen<br />
Von Arne Hengsbach<br />
Anschrift der Verfasserin: 1000 Berlin 30, Motzstraße 12<br />
Die Darstellung der Beziehungen zwischen Spandau und Berlin - bzw. Berlin und Spandau<br />
- ist in dem umfangreichen Schrifttum über Spandau kaum behandelt worden. Doch sind<br />
gerade diese wechselseitigen Beziehungen, die die kleine Havelstadt und die große Hauptstadt<br />
gepflegt haben, für das Verständnis des Stadt-Umlandverhältnisses beider Städte aufschlußreich.<br />
Berlin hat mannigfache Einflüsse ausgestrahlt, auch nach Spandau, sie haben<br />
sich auch verschiedentlich deutlich bemerkbar gemacht, aber sie waren doch nicht relevant<br />
genug, um die Eigenständigkeit Spandaus aufzuheben, und dieses hat seinerseits wesentlich<br />
dazu beigetragen, daß es schließlich seine Selbständigkeit verlor und in Berlin aufgehen<br />
mußte.<br />
Zunächst muß auf die Doppelfunktion hingewiesen werden, die Spandau seit dem 18. Jahrhundert<br />
innegehabt hat. Es hat für einen Teil des benachbarten Kreises Osthavelland<br />
zentralörtliche Funktionen ausgeübt, deren Ursprung z.T. noch aus dem Mittelalter herrührte.<br />
Das Spandauer Benediktinerinnen-Nonnenkloster besaß zahlreiche Dörfer in der<br />
näheren und weiteren Umgebung Spandaus entweder ganz, oder aber es zog Abgaben verschiedener<br />
Art aus ihnen. Nach der Reformation trat das Kurfürstliche, später das Königliche<br />
Amt Spandau an die Stelle des Klosters und wurde nun Verwaltungszentrum für die<br />
umliegenden Amtsdörfer. Das domänenfiskalische Rentamt Spandau hat noch bis 1874<br />
Polizei- und Verwaltungsaufgaben in jenen Dörfern wahrgenommen. Auch andere staatliche<br />
Behörden mit dem Sitz in Spandau erstreckten ihren Amtsbereich auf Ortschaften des<br />
Kreises Osthavelland, wie das Königliche Kreis-, seit 1879 Amtsgericht oder das Postamt<br />
Spandau.<br />
Die Stadtgemeinde Spandau selbst hatte im 18. Jahrhundert das Recht des Krugverlags,<br />
d.h. bestimmte Dorfkrüge im Umland sollten von Spandauer Brauern und Brennern ihr Bier<br />
und ihren Branntwein beziehen. Von erheblicher Bedeutung waren für die Stadt und ihr<br />
Umland die Spandauer Jahr- oder „Kram"- und Pferdemärkte. Riehl und Scheu schrieben<br />
1861 in ihrer Landeskunde „Berlin und die Mark Brandenburg": „Noch jetzt fährt der<br />
kurmärkische Bauer in vollem Staat und Ornat zum Spandauer Markt und macht dort seine<br />
375
Einkäufe an Stoffen und Geräten fürs Jahr, wie er auch seine Pferde daselbst ein- und verkauft."<br />
Die Bedeutung der Stadt selbst lag also auf wirtschaftlichem Gebiet; die Verwaltung<br />
des Kreises Osthavelland, zu dem auch Spandau gehörte, hatte ihren Sitz in Nauen; erst<br />
1887 schied Spandau aus dem Kreise aus und bildete einen eigenen Stadtkreis.<br />
Die Grenzen des Spandauer Umlandes waren fließend oder schwankend, z.B. je nach den<br />
verwaltungsmäßigen Abgrenzungen, die in einem Falle mehr, im anderen Falle weniger<br />
Ortschaften erfaßten. Im 18. Jahrhundert gehörten zum Amte Spandau die Dörfer Damm,<br />
Kietz-Burgwall, Picheisdorf, Gatow, Kladow, Seeburg, Rohrbeck, Wustermark, Falkenhagen,<br />
Hennigsdorf, Tegel und Lübars. Für das Jahr 1886 liegen genauere Angaben über<br />
die zu jener Zeit dem Spandauer Umland zuzurechnenden Dörfer vor. In dem in jenem<br />
Jahre erschienenen Spandauer Adreßbuch werden in dem Abschnitt „Boten aus der Umgegend<br />
und deren Absteigequartiere" die Handelsleute und Milchmänner aufgeführt, die<br />
regelmäßig, z.B. an den Wochenmarktstagen, nach Spandau kamen und hier Bestellungen<br />
und Besorgungen ausführten bzw. von hier Aufträge in ihre Heimatdörfer mitnahmen.<br />
Diese Männer kamen aus Dallgow. Dyrotz, Falkenhagen, Gatow, Pausin, Perwenitz.<br />
Schönwalde, Staaken und Wansdorf. Etwa bei Dyrotz-Wustermark grenzte die Spandauer<br />
Einflußsphäre an die von Nauen, während Kladow und Groß-Glienicke bereits im Schnittpunkt<br />
des Spandauer und des Potsdamer Einzugsgebietes lagen. Im Norden gehörten Teile<br />
des Glins zum Spandauer Umland, während im Osten der Bereich der Havelstadt bereits in<br />
Ruhleben und Haselhorst endete.<br />
Da Spandau bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus auch noch eine Ackerbürgerstadt<br />
war und viel Gärtnerei, vor allem im Stadtteil Stresow getrieben wurde, konnte der<br />
Absatz landwirtschaftlicher Produkte aus den Dörfern des Umlandes in Spandau nur einen<br />
beschränkten Umfang haben. Erst als in der zweiten Jahrhunderthälfte Spandau immer<br />
mehr zur Industrie- und Arbeiterwohnstadt wurde, kam der Belieferung der Spandauer<br />
Wochenmärkte mit ländlichen Erzeugnissen oder der Einfuhr von Milch aus den benachbarten<br />
Landgemeinden größere Bedeutung zu.<br />
So bestanden zwischen Spandau und seinem havelländischen Umland zahlreiche Beziehungen,<br />
andererseits hatte die Stadt seit dem 18. Jahrhundert mehrfache Beziehungen zu<br />
Berlin. Maßgebend für die Entstehung und Ausbildung von Stadt-Stadt-Verhältnissen<br />
zwischen Spandau und Berlin und umgekehrt ist die Lage der Havelstadt gewesen, die nur<br />
gut 15 km von Alt-Berlin entfernt lag. Besonders auf wirtschaftlichem Gebiete machte sich<br />
die Nachbarschaft Berlins bemerkbar. Schon in einer statistischen Zusammenstellung<br />
„Nachricht was vor Bürger und Einwohner vorhanden", die 1723 in Spandau gefertigt und<br />
am 29. Januar 1934 von der „Spandauer Zeitung" wiedergegeben wurde, finden sich Hinweise<br />
auf Beziehungen zwischen den beiden so ungleichen Nachbarstädten: Ein Bäcker<br />
schickte bereits damals sein Gebäck regelmäßig nach Berlin. Dilschmanns „Diplomatische<br />
Geschichte und Beschreibung der Stadt und Festung Spandow" (1785) bestätigt das: „Die<br />
Spandowsche Semmel hatte in vorigen Zeiten großen Abgang nach Berlin und wurde<br />
wöchentlich in Menge zum Verkauf dahin gebracht . . ." Ferner sagt Dilschmann: „Der<br />
größte Teil von den gefangenen Fischen und den vorzüglich wohlschmeckenden Krebsen<br />
wird den Einwohnern nach Berlin zugeführt." Auch Spandauer Bier fand nach Dilschmann<br />
in Berlin Absatz.<br />
Im Jahre 1808 erschien ein satyrischer Roman des Schriftstellers Sigismund Gottfried<br />
Dietmar, „Sirius oder die Hundspost von Spandau nach Berlin", der zeitgenössische Berliner<br />
Verhältnisse behandelte. Es kommt in ihm ein kluger Pudel vor, der einem Spandauer<br />
376
Ausschnitt aus einer Umgebungskarte von Berlin, um 1830 (Geh. Staatsarchiv Berlin)<br />
Milchbauern gehört, für den er anfänglich den Milchwagen von Spandau nach Berlin fährt.<br />
In diesem Romanmotiv kann durchaus ein Hinweis auf seinerzeit bestehende Verhältnisse<br />
in den Versorgungsfunktionen Spandaus für den Berliner Markt gegeben sein. Ein Protokoll<br />
von einer Spandauer Stadtverordneten-Versammlung aus dem Jahr 1810 liegt in der gleichen<br />
Richtung: „Es ist bekannt, daß unsere Gärtner nach Potsdam und Berlin mit ihren<br />
Gartenfrüchten fahren und da zum Verkauf zugelassen werden; schlechte Ware dürfen sie<br />
dahin nicht bringen, derweil sie solche wegen der Menge, die davon zusammenkommt, nicht<br />
los werden würden." Der Spandauer Bürgermeister Roedelius beantwortete 1853 einen<br />
Fragebogen des Professors Heinrich Berghaus, den dieser zur Materialsammlung für seine<br />
„Landeskunde der Mark Brandenburg" eingesandt hatte: „Der Absatz der Produkte,<br />
namentlich Gartengewächse und Fische, ist in der nahegelegenen Residenz Berlin."<br />
Noch in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts brachten die Spandauer Ackerbürger<br />
und Gärtner aus der Oranienburger Vorstadt, der nachmaligen Neustadt, ihr Gemüse<br />
nach Berlin, wie die „Muhme Schlei" aus der Falkenhagener Straße. Fünf Spandauer<br />
Gemüsegärtner mieteten sich damals ein Fuhrwerk, schleppten zur nachtschlafenden Zeit<br />
ihre Kiepen zum Halteplatz und fuhren dann nach Berlin zum Wochenmarkt auf dem<br />
Dönhoffplatz. Spandau hat also im 18. und 19. Jahrhundert wie die anderen ländlichen<br />
Nachbargemeinden Berlins mit zur Belieferung des hauptstädtischen Lebensmittelmarktes<br />
beigetragen. Allerdings hat Spandau nicht in der äußeren Randzone der Lebensmittellieferungen<br />
für die Hauptstadt gelegen; Molkereiprodukte kamen von noch weiter her. 1820<br />
wurde z.B. „süße Sahnenbutter" aus Seegefeld zweimal in der Woche nach Berlin gebracht,<br />
auch die Butter des Königlichen Amtes Königshorst im Havelländischen Luch nördlich von<br />
Nauen kam an zwei Wochentagen frisch in Berlin an.<br />
Infolge der geringen Entfernung von Berlin konnte sich andererseits in Spandau ein differenzierteres<br />
Gewerbe- und Geschäftsleben nicht voll entfalten. Schon in der oben erwähn-<br />
377
ten Statistik von 1723 beklagten sich die beiden Handschuhmacher, daß doch Berlin gar zu<br />
nahe liege und die zahlungskräftigen Käufer dort mit Vorliebe ihre Einkäufe machten. In<br />
der Gewerbetabelle des Jahres 1809 gab der Seifensieder Schildbach an, „daß die hiesigen<br />
Kaufleute ihre Waren von Berlin entnehmen". Und Dilschmann merkt 1785 an: „Wegen<br />
der Nähe der Hauptstadt des Landes ist leicht zu erachten, daß kein großer Handel hier<br />
getrieben wird."<br />
Ganz ausführlich ist der Bürgermeister Zimmermann im Jahre 1841, als das Projekt der<br />
Berlin-Hamburger Eisenbahn in den städtischen Körperschaften diskutiert wurde, auf den<br />
Einfluß Berlins auf das Spandauer Geschäftsleben eingegangen: „So entschieden sich nun<br />
auch die Meinung unserer Mitbürger eines Teiles für die Anlage der Eisenbahn in der Nähe<br />
der Stadt ausgesprochen hat, so sind doch auch mannigfache Stimmen dagegen aufgetreten,<br />
und es scheint nicht unbeachtenswert, die andere Meinung zu prüfen. Die Besorgnis, welche<br />
in dieser Beziehung ausgesprochen wird, bezieht sich nämlich auf den gewerblichen Verkehr;<br />
es wird behauptet, daß, ehe die Chaussee nach Berlin angelegt wurde (1822), der<br />
gewerbliche Verkehr, insbesondere der Handwerker, viel lebhafter gewesen sei, als dies<br />
jetzt der Fall ist, weil vieles aus Berlin genommen wird, was bei der früheren schwierigeren<br />
Verbindung nicht möglich war. Auch jetzt werden noch viele zurückgehalten, ihre Bedürfnisse<br />
aus Berlin zu entnehmen, weil der Zeitaufwand zu groß ist. Wird es dagegen möglich,<br />
in V4 Stunde nach Berlin hin, in ebensoviel Zeit zurückzugelangen, dann fürchten viele, daß<br />
noch mehr aller Bedarf aus Berlin bezogen werden wird, und so die Gewerbe völlig darniederliegen<br />
würden, ja daß, wenn es anginge, Spandow wie eine Vorstadt von Berlin aus<br />
mit Schuh und Stiefeln. Bekleidung, womöglich wenn es geht, mit Brot und Semmeln versorgt<br />
wird.'" Unumstößlich bliebe das Vorurteil, meinte Zimmermann, „in Berlin sei alles<br />
besser".<br />
Derartige Befürchtungen äußerten die Spandauer Geschäftsleute auch in späteren Jahren<br />
noch, vor allem in der Vorweihnachtszeit, wenn die kaufkräftige Kundschaft in der Havelstadt<br />
es vorzog, ihre Einkäufe für das Fest in Berlin zu erledigen. So schrieb der Spandauer<br />
„Anzeiger für das Havelland" am 7. Dezember 1883: „Gerade bei der bevorstehenden<br />
Weihnachtszeit wird, wie die alljährliche Erfahrung gelehrt hat, viel Geld aus Spandau herausgetragen<br />
und gerade meistens für Artikel, welche hier ebenso gut und billig zu haben<br />
sind wie in Berlin . . . Daß die Auswahl nicht überall eine so große sein kann wie dort, ist<br />
klar, dafür ist aber auch die Nachfrage keine so große wie in der Residenz. Schließlich ist es<br />
doch entschieden richtiger und gemeinnütziger gehandelt, wenn man das Geld, welches man<br />
hier verdient, so weit tunlich, auch hier läßt und nicht aus Berlin bezieht, von dessen Nähe<br />
unsere Verhältnisse überhaupt schon viel zu leiden haben." Bei der geringen Einwohnerzahl<br />
(1850 rd. 8000, 1860 rd. 11 000. 1870 rd. 15 000, 1880 rd. 25 000) und bei der wegen<br />
ihrer niedrigeren Verdienste anspruchslosen und wenig kauffreudigen Arbeiterbevölkerung<br />
konnten sich große Ladengeschäfte mit umfangreichem Sortiment natürlich nicht entfalten.<br />
Die verhältnismäßig dünne Schicht des Spandauer Mittelstandes mit höheren Ansprüchen<br />
fuhr daher, besonders in der Adventszeit, in das benachbarte Berlin, um sich in den dortigen<br />
spezialisierten Ladengeschäften anregen zu lassen und dann ihre Besorgungen von Wäsche,<br />
Textilien. Leder- und Pelzwaren, Schmuck, Büchern, Musikalien, Spielzeug usw. zu<br />
machen. Bis weit in die achtziger Jahre hinein machte sich die Konkurrenz der großen<br />
Nachbarstadt bei Käufen von Gegenständen des gehobenen Bedarfs bemerklich. Seit etwa<br />
1885 änderte sich das allmählich. Es ließen sich nämlich nun in Spandau eine Anzahl<br />
jüdischer Kaufleute nieder, die in ihren Ladengeschäften für Garderobe, Wäsche. Textilien<br />
378
usw. eine größere Auswahl als zuvor anboten, so daß bald ein guter Teil der bisher in Berlin<br />
erworbenen Artikel nun auch am Ort gekauft werden konnte. Da Spandaus Einwohnerzahl<br />
kräftig anstieg (1890 rd. 40 000, 1900 rd. 60 000). konnten sich diese neuen und größeren<br />
Geschäfte auf eine größere Kundschaft stützen. Diese neuen Geschäfte übertrugen<br />
die in Berlin entwickelten Geschäftstypen (Basare. Warenhäuser, spezialisierte Geschäfte<br />
für Damen- und Herrenoberbekleidung. Filialgeschäfte usw.) und Usancen (z.B. Ausverkäufe)<br />
nach Spandau. Es entstand das Vorortgeschäft, dessen Sortimente meist so umfangreich<br />
waren, daß in einer Vielzahl von Fällen - wenn nicht gerade spezielle Kaufwünsche<br />
vorlagen oder hohe Qualitätsansprüche gestellt wurden - die Einkaufsfahrten nach Berlin<br />
entfallen konnten. Diese Geschäftsformen, die neben Spandau auch das gesamte weitere<br />
Umland Berlins erfaßten, wanderten dann weiter in die Provinz hinein.<br />
Die mittleren Schichten der Spandauer Bevölkerung waren auch diejenigen, die im Bereich<br />
der Künste Ansprüche stellten, die ihnen in Spandau nicht erfüllt werden konnten. Theatervorstellungen<br />
und Konzerte mußten in Spandau auf Gasthofs- und Tanzsäle beschränkt<br />
bleiben, und die Darbietungen der wandernden Schauspieltruppen wurden ebenso wie die<br />
Aufführungen von den Werken der Tonkunst von den „gebildeten" Kreisen wenigstens als<br />
zweitrangig empfunden. Spandau hatte aber nicht nur keine Bühnen und Konzertsäle, es<br />
besaß auch keine Büchereien, wenn man von den privaten Leihbibliotheken absieht, weshalb<br />
die Interessenten aus Spandau nach Berlin zum Besuch der dortigen Theater. Konzerthäuser,<br />
der Oper, der Museen, von Vorträgen. Spezialbuchhandlungen usw. fahren mußten.<br />
Im Jahre 1883 gaben die Hamburger und Lehrter Eisenbahn nach Schätzungen des Kaufmännischen<br />
Vereins an Sonntagen etwa 1000, an den sechs Wochentagen zusammen 200<br />
Fahrkarten nach Berlin aus, die zumeist von Spandauern gelöst wurden, die Theater.<br />
Konzerte usw. in Berlin aufsuchten. Ein gesellschaftliches und kulturelles Leben war nach<br />
den Feststellungen des Kaufmännischen Vereins auch kaum möglich, weil die vorhandenen<br />
besseren Lokale sich für Veranstaltungen schlecht eigneten. Das eine ,.war zu klein, das<br />
andere zu kalt, dieses hatte schlechte Ventilation, jenes mangelhafte Bedienung, unangenehmen<br />
Zugang, dito Garderobenlokal, unsaubere Anstandsorte, ungemütliche Nebenräume,<br />
schlechte Akustik . . . schlechte Beleuchtung, alles schwere Mißstände, die sich<br />
jedem durch die Nähe Berlins verwöhnten Spandauer Einwohner fühlbar machen".<br />
Schließlich war auch der Berliner Arbeitsmarkt, wenn auch nur in einigen Zweigen, mit<br />
Spandau locker verknüpft. Bereits 1809 stellten die Spandauer Stadtverordneten in einer<br />
Eingabe fest: „Es wohnen hier eine große Anzahl Arbeiter. Maurer. Zimmerleute. Schiffsknechte,<br />
die nur nach Spandau mit Weibern und Kindern der wohlfeilen Miete wegen<br />
zogen. Diese Leute fanden zwar Arbeit in Berlin den Sommer durch, aber im Winter nicht,<br />
da helfen sie sich durch Plünderung der Forsten, woraus sie ihren Bedarf an Holz holen<br />
und noch was mehr, um zu verkaufen; während des Krieges, da alle Bauten lagen und sie<br />
ganz arbeitslos waren, sind sie mit ihren zahlreichen Familien ganz verarmt." Und im<br />
Jahre 1849 stellte der Spandauer Magistrat in einem Bericht über die hiesigen mißlichen<br />
Arbeitsverhältnisse fest: „ . . . nicht viel besser steht es mit den Maurer- und Zimmerleuten,<br />
da diese sonst in Berlin ihre Arbeit suchten und fanden."<br />
Enge Beziehungen zu Berlin hatte auch der militärische Standort Spandau mit seinen verschiedenen<br />
Truppenteilen und den zahlreichen „Königlichen Instituten", den staatlichen<br />
Rüstungsbetrieben, den Garnison- und Fortifikationsbehörden. Bei der streng hierarchisch<br />
geordneten Organisation der Einheiten des Heeres und der fiskalischen Fabriken fand<br />
ständig ein lebhafter Verkehr zwischen den vorgesetzten Dienststellen in Berlin (Kriegs-<br />
379
departement bzw. Kriegsministerium, Feldzeugmeisterei, Intendanturen usw.) und den<br />
nachgeordneten Einheiten usw. in Spandau oder umgekehrt statt.<br />
*<br />
Doch Spandau tendierte nicht nur nach Berlin, Berlin seinerseits kam auch nach Spandau.<br />
Mit dem allmählichen Entstehen des städtischen Ausflugsverkehrs etwa seit der Mitte des<br />
18. Jahrhunderts wurde das nähere Umland der Residenz in zunehmendem Maße von<br />
deren Bewohnern durchdrungen. Wohlhabendere Leute schufen sich in den Nachbardörfern<br />
Pankow oder Lichtenberg Sommersitze, und schon vor 1800 mieteten sich Berliner<br />
Familien in Charlottenburg, Tempelhof usw. „Sommerwohnungen", d.h. sie verbrachten<br />
in der noch ländlichen Umgegend Berlins die Sommermonate. Wieder andere wanderten<br />
durch die näheren Umgebungen. z.B. nach Wilmersdorf, um dort Schafsmilch und Schafskäse<br />
zu verzehren.<br />
Die älteste Nachricht, die darauf hindeutet, daß auch Spandau Ziel Berliner Ausflügler<br />
gewesen sein könnte, scheint eine Anzeige in der „Vossischen Zeitung'" vom 6. Juli 1754 zu<br />
enthalten: „Es wird zu wissen gegeben, daß mit dem gewöhnlichen Lustschiffe, des Sonntags<br />
früh um 7 Uhr. und des Mittags um 1 Uhr, nach Charlottenburg und dem Tiergarten<br />
und des Abends um 7 Uhr wieder zurück nach Berlin gefahren wird ... In den Wochentagen<br />
können Liebhaber dieses Schiff mietweise nach Spandau, Cöpenick. Charlottenburg,<br />
Stralau . . . haben." Man darf eine derart vereinzelte Andeutung allerdings nicht überschätzen<br />
und nun womöglich auf häufigere ..Lustfahrten" von Berlin nach Spandau schließen,<br />
das Inserat weist lediglich auf die verkehrsmäßigen Möglichkeiten für einen Besuch Berliner<br />
in Spandau hin. Über das Bestehen eines Verkehrs von Spandau nach Berlin mit dem Schiff<br />
liegen übrigens einige bruchstückhafte Andeutungen vor, die die Zusammenhänge aber<br />
keineswegs erhellen. Im Jahre 1798 schrieb das Amt Spandau die Verpachtung der „Kahnfahrt<br />
von Spandau bis Berlin und von da zurück" aus, und auch die in der Schulze'schen<br />
Chronik von Spandau mitgeteilten Etats des Amtes Spandau für 1739/40 und 1747/48<br />
enthalten unter den Pachten jeweils 25 Taler „für die Kahnfahrt".<br />
Ausführlich sind dagegen die Schilderungen im „Jahrbuch der Preußischen Monarchie",<br />
Jahrgang 1799 (wieder abgedruckt in den „Berlinischen Blättern für Geschichte und Heimatkunde",<br />
Jahrgang 1936, S. 100 ff.), die sich mit dem Treiben der Berliner Erholungssuchenden<br />
auf dem „Pichelsdorfer Werder", dem Picheiswerder befassen. Seit dieser Zeit<br />
weisen Stadtbeschreibungen und Führer immer wieder auf diese Erholungslandschaft an<br />
der Unterhavel hin. Von Picheisdorf und dem „Pichelsdorfschen Werder, im Havelländischen<br />
Kreise, bei Spandau" sagt Johann Christian Gädicke in seinem 1806 erschienenen<br />
„Lexicon von Berlin und der umliegenden Gegend": „Diese Gegend wird stark zum Vergnügen<br />
benutzt und für die schönste um Berlin gehalten." Ähnlich Hellings „Taschenbuch<br />
von Berlin . . ." von 1830 über Picheisberg. Picheisdorf und Picheiswerder: „Wegen der<br />
romantischen Lage des Berges, Dorfes und Werders oft Zielpunkt von Lustpartien." Auch<br />
der Turnvater Jahn war 1818 mit seiner Gefolgschaft hierher gezogen, dabei ertrank einer<br />
seiner Schutzbefohlenen im Stößensee, was dem exaltierten Mann sehr peinlich war.<br />
Seit 1840 rückt dann auch die Uferlandschaft der Oberhavel, nördlich von Spandau, in den<br />
Gesichtskreis der Berliner Ausflügler. Bei Saatwinkel, ganz abseits noch und von der<br />
.lungfernheide umschlossen, entstehen in dieser Zeit zwei Ausflugslokale, die trotz ihrer<br />
unerschlossenen Lage bei den Berlinern bald an Beliebtheit gewinnen. Den ersten Hinweis<br />
380
auf dieses neue Ausflugsziel findet sich schon in Alexander Cosmars „Neuestem Wegweiser<br />
durch Berlin" von 1840, wo erwähnt wird: „Saatwinkel, ein Vergnügungsort hinter Charlottenburg",<br />
wobei „Vergnügungsort" im Sprachgebrauch der Zeit als „Ausflugsort"<br />
zu verstehen ist.<br />
Mit dem Aufkommen der Torwagenfahrten von Berlin bzw. Charlottenburg nach Spandau<br />
seit den späten 20er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde der Besuch Spandaus und seiner<br />
Umgebungen bereits etwas erleichtert; noch bequemer wurde das Aufsuchen der Erholungsorte<br />
und -gebiete bei Spandau an der Ober- und Unterhavel bald nach Inbetriebnahme<br />
der Berlin-Hamburger Eisenbahn im Jahre 1846. Seit 1848 verkehrten nämlich allsonntäglich<br />
in der warmen Jahreszeit „Extrazüge" von Berlin nach Spandau, seit 1850 auch<br />
zu verbilligten Fahrpreisen, und 1851 wurden diese Züge bis Finkenkrug und Nauen weitergeführt.<br />
Da es zwischen Berlin und Spandau keine Zwischenstationen gab, waren die Berliner<br />
Wanderer tatsächlich binnen einer Viertelstunde in Spandau, von wo aus sie ihre Ausflugsziele<br />
an der Havel nach einem Fußweg von einer guten Stunde erreichen konnten,<br />
wenn sie es nicht vorzogen, sich in der Gondel oder im Kahn zu den gewünschten Orten<br />
rudern zu lassen. Am Westufer der Havel drangen die Berliner allerdings nicht weiter nach<br />
Süden vor. Gatow und Kladow blieben bis gegen Ende des Jahrhunderts noch außerhalb<br />
des Gesichtskreises der Hauptstädter.<br />
Eine Wanderung von Berlin nach Spandau, etwa im Jahre 1820, schildert Karl Gutzkow<br />
in seinem Erinnerungsbuch „Aus der Knabenzeit" sehr anschaulich und ausführlich. Das<br />
literarisch wertvolle Zeugnis kann jedoch nicht als Beleg für einen stärker ausgeprägten,<br />
von Berlin nach Spandau gerichteten Besucherverkehr gelten. Dafür gibt es andere Quellen.<br />
Sie betreffen die schon erwähnten Spandauer Jahr- und Pferdemärkte, die in stärkerem<br />
Maße von den Berlinern besucht wurden. Die ersten Hinweise auf diesen Markt finden wir<br />
in der „Vossischen Zeitung" vom Jahre 1820. Der englische Dampfschiffbauer und Reeder<br />
John Barnett Humphreys hatte im Sommer dieses Jahres einen ziemlich regelmäßigen Ausflugsverkehr<br />
mit seinem Dampfschiff „Courier" zwischen Berlin (Zelten) und Charlottenburg<br />
bzw. Potsdam betrieben. Für den 22. August zeigte er eine Fahrt nach Spandau an,<br />
die 7 Uhr früh begann mit dem ausdrücklichen Bemerken: „Nach Spandau zum dortigen<br />
Markt." Die Rückfahrt nach Berlin war auf 17 Uhr festgesetzt worden. Fast zur gleichen<br />
Zeit machte ein Kaffeehauswirt vom Gesundbrunnen in der Zeitung bekannt, daß er sein<br />
Konzert „des Spandauer Marktes wegen" auf einen anderen Tag verlegt habe.<br />
Der Spandauer Polizei-Bürgermeister Lauße klagte im Jahre 1828: „Die Unordnung und<br />
der Lärm mit den Charlottenburger und Berliner Personen Wagens ist nicht mehr an den<br />
Jahrmarkttagen zu ertragen und bedarf einer Abhülfe, wenn kein Unglück eintreten soll."<br />
Aus dem Jahre 1830 stammt eine Stellungnahme des Spandauer Magistrats: „Der hier<br />
statthabende Jahrmarktsverkehr erfordert wegen des durch die Nähe Berlins entstehenden<br />
außerordentlichen Zusammenflusses von Menschen aller Klassen eine gesteigerte polizeiliche<br />
Wachsamkeit." Helling vermerkt 1830 in seinem „Taschenbuch" von den Spandauer<br />
Jahrmärkten: „Diese Märkte werden stark von Berlinern besucht, es ist aber ein merkwürdiges<br />
Zusammentreffen, daß es in der Regel an den Tagen, wo in Spandau Markt ist, hier<br />
regnet." Der „vergnügte Weinhändler" Louis Drucker, Berliner Gastwirt und Spaßmacher,<br />
weilte 1840 während einiger Pferdemarkttage auch in Spandau, um dort seine Albernheiten<br />
abzuziehen, wie aus seinen Inseraten in der „Vossischen Zeitung" hervorgeht. Neben<br />
den Märkten scheinen auch die Spandauer Schützenfeste die Berliner angezogen zu haben.<br />
Wie auch in anderen Städten hatten die „Gewerbetreibenden" die Möglichkeit, auf dem<br />
381
Schützenplatz mit ,.Verkaufs-Gegenständen' - zu handeln, nur „Roulett-, Schum- und<br />
Toiletten-Spiele" schloß die Schützengilde 1850 ausdrücklich aus, wie auch der Spandauer<br />
Magistrat das Würfelspiel auf den Jahrmärkten schon früher nicht geduldet hatte.<br />
Noch eines weiteren Besucherstromes, der von Berlin nach Spandau ging, muß in diesem<br />
Zusammenhange gedacht werden. In den Jahren von 1817 bis 1874 pilgerten die Berliner<br />
Katholiken alljährlich an dem jeweiligen Sonntag nach Fronleichnam von Berlin, später<br />
von Moabit aus, durch die Jungfernheide nach Spandau, anfänglich zu dem kleinen katholischen<br />
Gotteshaus auf dem „Gewehrplan" in der Nähe des heutigen Zitadellenweges, seit<br />
1849, als die katholische Kirche am Behnitz fertiggestellt war, in die Stadt selbst, um hier<br />
am Kolk und Behnitz ihre Prozession abzuhalten. Bereits in den zwanziger Jahren sollen<br />
mehr als tausend Gläubige von Berlin nach Spandau gezogen sein, und in den vierziger<br />
Jahren hat die Zahl der Katholiken Berlins, die sich an dieser Wallfahrt nach Spandau beteiligten,<br />
bereits 2000 bis 3000 betragen. Als die Bevölkerung Berlins seit den fünfziger Jahren<br />
immer schneller und stärker anstieg, nahm auch die Zahl der Zuwanderer katholischen<br />
Glaubens, vor allem aus den östlichen Provinzen Posen und Schlesien zu. und damit erhöhte<br />
sich auch die Zahl derjenigen, die an dem Fronleichnamszug nach Spandau teilnahmen.<br />
Meist fielen nun Schützenfest und Fronleichnamsfeier zeitlich zusammen, so daß einige<br />
tausend Berliner in der engen Havelstadt zusammenströmten.<br />
Zeugnis für die Stärke dieses nach Spandau gerichteten Verkehrs geben die Anzeigen der<br />
Eisenbahnverwaltungen. Am 25. Mai 1864 teilte die Berlin-Hamburger Eisenbahn in der<br />
..Vossischen Zeitung" mit: „Am Sonntag, den 29. d.M. werden wir in Veranlassung des<br />
Fronleichnamsfestes und des in Spandau stattfindenden Schützenfestes außer dem gewöhnlichen<br />
Extrazuge nach Spandau. Finkenkrug und Nauen noch einen Extrazug von Berlin<br />
nach Spandau und einen solchen von Spandau nach Berlin zurück zu den tarifmäßigen<br />
Fahrpreisen abfertigen. Abgang des Extrazuges von Berlin Morgens 7 Uhr, Abgang des<br />
Extrazuges von Spandau Abends 11 Uhr." Auch im Jahre 1869 setzte wiederum „in Veranlassung<br />
des Fronleichnamsfestes und des hiesigen Schützenfestes" die Hamburger Eisenbahn<br />
einen Personenzug von Berlin nach Spandau ein. Die Rückfahrt nach Berlin konnte<br />
diesmal von 8 Uhr abends ab „mit den in Zwischenräumen von V2 bis 3 /4 Stunden von hier<br />
abzulassenden Extrazügen geschehen. Der letzte Extrazug geht von Spandau um 11 Uhr<br />
abends ab." In diesem Jahre soll der Schützenplatz einen Besuch von ca. 10 000 bis 12 000<br />
„Fremden" aufgewiesen haben. Die Fronleichnamsprozession fand am gleichen Tag „unter<br />
Teilnahme von Tausenden hierselbst in größter Ordnung statt." Bei dieser Wallfahrt ließ<br />
ein „gewisser Schubrink" von Berlin aus eine seiner fahrbaren Trinkhallen dem Fronleichnamszuge<br />
folgen. Im folgenden Jahre, 1870, hatten, wie der Spandauer „Anzeiger für das<br />
Havelland" meldete, die Fronleichnamsprozession und das Schützenfest „gewiß über<br />
10 000 Menschen von Berlin hierher geführt". Noch stärker scheint der Besuch Spandaus<br />
im Jahre 1872 gewesen zu sein. Der „Anzeiger" schrieb am 4. Juni: „Der Andrang der<br />
Berliner am Sonntag in Folge des Schützenfestes resp. der Berliner Fronleichnamsprozession<br />
(ungleich prunkvoller und zahlreicher als die vorigen Jahre) nach hier war ein so<br />
großer, wie er seit Jahren nicht dagewesen ist. Auf der Hamburger Bahn wurden allein<br />
14 500 Personen nach Berlin zurückbefördert ... 19 Extrazüge beförderten die Menschenmenge<br />
nach hier und bis spät in die Nacht nach Berlin zurück. Auch auf der Lehrter Eisenbahn<br />
wurden Extrazüge abgelassen."<br />
Doch sollten diese großen Wallfahrten der Berliner Katholiken nach Spandau ein jähes<br />
Ende finden. Der „Anzeiger" brachte am 21. Mai 1875 folgende Notiz: „Die seit mehreren<br />
382
Carl-Schurz-Straße um 1890 (Foto: Jürgen Grothe)<br />
Jahren am Fronleichnamstage von der katholischen Geistlichkeit angeordnete Prozession<br />
von Moabit über Charlottenburg nach Spandau wird in diesem Jahre polizeilich nicht geduldet<br />
werden . . . Inmitten einer protestantischen Bevölkerung, welche ohnehin durch die<br />
Ultramontanen in Aufregung gebracht ist, empfiehlt es sich nicht, auf öffentlichen Straßen<br />
ein neues Reizmittel zuzulassen . . ." Diese Maßnahme muß aus der Stimmung des damals<br />
ausgetragenen Kulturkampfes heraus verstanden werden. Das Spandauer Blatt kommentierte<br />
diese Meldung: „In geschäftlicher Beziehung wird diese Maßnahme für Spandau<br />
allerdings schädigend wirken." Ein Jahr später, am 20. Juni 1876, bemerkte die Zeitung<br />
wehmütig: „Der Ausfall der Fronleichnams-Prozession von Berlin, welche in früheren<br />
Jahren einen ganz riesigen Besuch unseres Schützenplatzes mit sich brachte, hat am Sonntag<br />
eine ganz bedeutende Abnahme desselben zur Folge gehabt und dürfte die Zahl der von<br />
hier anwesend Gewesenen kaum auf 1000 sich beziffern, während früher oft 10—12 000<br />
allein mit der Eisenbahn herangeschafft wurden. Den Schank- und Gastwirten in der Stadt<br />
ist hierdurch eine nicht unerhebliche Mindereinnahme geworden, und wird der Ausfall des<br />
auswärtigen Besuches für die Folge auch nicht ohne Rückwirkung auf den Gewerbebetrieb<br />
auf dem Schützenplatz bleiben." Ein Jahr später sah die Sache schon wieder anders aus.<br />
Die Zeitung meinte am 5. Juni 1877: „Daß trotz der Aufhebung der Fronleichnams-Prozession<br />
der hiesige Schützenplatz seine Anziehungskraft für einen Teil der Bewohner der<br />
Residenz Berlin nicht verloren hat, bewies der zahlreiche Besuch desselben von außerhalb<br />
am Sonntage, und es will uns bedünken, daß gedachte Aufhebung nur das Fehlen einer<br />
nicht unbeträchtlichen Menge rohen Gesindels zur Folge hat, welches, der Prozession<br />
folgend, schon im Zustande sinnloser Betrunkenheit hier ankam und zu Widerwärtigkeiten<br />
und Exzessen Veranlassung gab."<br />
383
Die Besuche, die die Berliner in Spandau machten, gleich ob sie dem Jahrmarktstreiben,<br />
dem Rummel des Schiitzenplatzes. den kirchlichen Feiern oder den Erholungslandschaften<br />
bei Spandau galten, hatten allerdings keine weitergehenden Wirkungen; die Ausflügler oder<br />
Wallfahrer, die in den Vormittagsstunden in der Havelstadt eingetroffen waren, verließen<br />
sie am Abend wieder, um nach Berlin zurückzukehren. Spandau war zwar in den Gesichtskreis<br />
der Berliner getreten, aber es blieb doch nur einer der vielen Orte des näheren oder<br />
weiteren Berliner Umlandes, die aus verschiedenen Gründen, in erster Linie aber zu<br />
Zwecken der Erholung und Zerstreuung aufgesucht wurden. Von Berlin gingen aber nicht<br />
nur die Ströme seiner Bewohner in das Umland aus, es wurden seit der zweiten Hälfte der<br />
sechziger Jahre auch neue Geschäftszweige und -formen in Berlin entwickelt, die alsbald<br />
weite Teile der näheren und weiteren Umgebung der Stadt erfassen sollten. Es kam nämlich<br />
die Terrainspekulation im Großen auf, überall erwarben unternehmenslustige und risikofreudige<br />
Geschäftsmänner ländliche Fluren von den Bauern mit dem Ziele, sie zu „kolonisieren",<br />
d.h. in gewinnträchtiges Bauland für Landhauskolonien umzuwandeln. Dieses<br />
spekulative Großgrundstücksgeschäft, das 1863 einsetzte und bis etwa 1874 in kräftigem<br />
Schwange war, erlebte nach dem siegreichen Abschluß des deutsch-französischen Krieges<br />
1871 seine Blütezeit; zahlreiche Aktiengesellschaften wurden zur Durchführung der nicht<br />
immer ausgereiften Projekte ins Leben gerufen, deren Geschäftsgebaren und -führung nicht<br />
in allen Fällen einwandfrei war. In dieser „Gründerzeit" waren die Unternehmer in jedem<br />
Fall bestrebt, ihre billig erworbenen Roggen- und Kartoffelfelder zu erschließen und dann<br />
die Bauparzellen ertragreich an baulustige Interessenten veräußern zu können. Bei ihren<br />
Grundstückskäufen sprangen die „Gründer" und ihre Gesellschaften kreuz und quer im<br />
Umland umher; die von ihnen geplanten und vielfach auch begonnenen — z.T. nach englischen<br />
Vorbildern konzipierten - Villenkolonien lagen punktförmig im weiteren Umlandc<br />
verstreut, während die stadtnahe gelegenen Terrains im Bereich des Hobrechtschen Bebauungsplanes<br />
zu Mietskasernenparzellen ausgeschlachtet wurden.<br />
Städtebauliche Erwägungen blieben bei diesen Grundstücks- und Baugeschäften außer<br />
acht, man beschränkte sich auf die Herstellung und Bepflanzung der notwendigen Erschließungsstraßen<br />
innerhalb des eigenen Bauterrains, aber der so wichtigen Frage der verkehrlichen<br />
Erschließung der geplanten Ansiedlungen, von der ja die gewinnbringende Verwertung<br />
der Grundstücke in hohem Grade abhängig war, wandte man vielfach nur ein flüchtiges<br />
Interesse zu. Man vertröstete die Erwerber von Bauparzellen häufig auf angeblich<br />
geplante Straßenbauten und Pferdebahnstrecken. Daß bei unzulänglicher Erschließung die<br />
neuen Gründungen dann lange Zeit in Kümmerformen dahinleben mußten, vermochten die<br />
Gründer entweder noch nicht zu übersehen oder sie interessierte das nicht weiter. So<br />
erstreckte sich die Berliner Bodenspekulation nach Westend (1866), Nordend (1872), Südende<br />
(1872). Ostend (1871) und noch darüberhinaus bis Hirschgarten (1871), Lichterfelde<br />
(1867), Wannsee (1863) usw. Die Wogen, die diese Terraingeschäfte erzeugten, schwappten<br />
auch in Richtung Spandau, soweit dort die Voraussetzungen gegeben waren.<br />
Spandau nahm eine Sonderstellung ein. Die verfügbaren Terrains um den Stadtkern herum<br />
mochten die geschäftstüchtigen Gründer nicht erfassen. Spandau war nämlich Festungsstadt<br />
und das vor den Befestigungsanlagen gelegene Gelände in Rayons eingeteilt, Zonen<br />
von 600 bzw. 375 m Tiefe. Im ersten Rayon durften, wenn überhaupt, nur ganz leichte und<br />
kleine Holzbuden oder -hütten, im zweiten in ihrem Umfange beschränkte Fachwerkbauten<br />
aufgeführt werden. In jedem Falle hatte sich der Eigentümer durch „Revers", der ins<br />
Grundbuch eingetragen wurde, zu verpflichten, seine Baulichkeiten auf Verlangen der<br />
384
Kommendantur zu beseitigen. Mit diesen Vorschriften sollte gewährleistet werden, daß die<br />
Verteidiger der Festung im Ernstfall von den Festungswerken aus freies Schußfeld hatten<br />
und dem herannahenden Feind auf dem „rasierten", d.h. von Bauten und Aufwuchs freigelegten<br />
Gelände jegliche Deckungsmöglichkeit genommen war. Die Lage Spandaus bot<br />
auch insofern noch eine Besonderheit, als sie an ihrer Berlin zugekehrten Ostflanke vom<br />
Eiswerder bis zumStresow durch einen über500 bis zu 1000m breiten Gürtel von militärfiskalischen<br />
Rüstungsfabriken umgeben war. Diese schornsteinstarrende Industrielandschaft,<br />
deren Betreten natürlich verboten war, wirkte zusätzlich wie ein Riegel nach Osten hin.<br />
Aber trotz dieser Erschwernisse betätigten sich auch bei Spandau die Berliner Gründer. Sie<br />
bemächtigten sich derjenigen Flächen im Osten der Stadt, die von den militärischen Belangen<br />
nicht berührt worden waren. Die ersten Vorbereitungen für eine spätere Grundstücksspekulation<br />
wurden in Haselhorst schon zeitig getroffen. Bereits im Jahre 1865 wurden die<br />
umfangreichen Trennstücke Gartenfeld und Sternfeld vom Rittergut Haselhorst abgeschrieben<br />
in der Absicht, diese Teilflächen zu parzellieren und als merkantiles Bauland zu<br />
verwerten. Tatsächlich wurden die neugebildeten Grundstücke Sternfeld und Gartenfeld<br />
1872 an „Gründer" veräußert, die auch hier in völlig unerschlossenem Gebiet die Anlage<br />
von Villenkolonien planten. Während in Gartenfeld außer den Projektzeichnungen nichts<br />
entstand, wurden in Sternfeld immerhin einige Ansätze für eine Grundstücksverwertung<br />
erreicht. Zwar blieb auch hier die von der Eigentümerin, der „Zentralbank für Bauten" vorgesehene<br />
Landhausansiedlung im Spreetal. schräg gegenüber von der verwirklichten Villenkolonie<br />
Westend, auf dem Papier stehen, aber ein großes Dampfsägewerk wurde 1874 von<br />
ihr in Sternfeld an der Spree errichtet; es mußte allerdings schon nach anderthalb Jahren<br />
wieder stillgelegt werden, weil es unwirtschaftlich war und in der Zeit der Flaute, die der<br />
Euphorie der Gründerjahre folgte, die „Zentralbank" mit ihren ohnehin unübersichtlichen<br />
Finanzierungskünsten immer mehr in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet.<br />
Erfolgreicher war der Berliner Unternehmer Haberkern, der 1875 die Insel Valentinswerder<br />
zu einer Art Villensiedlung gestaltete. Diese Insel, die in dem freien Winkel zwischen<br />
den militärischen Sperrzonen des Schießplatzes Tegel und der Festung Spandau lag, war<br />
völlig unerschlossen. Haberkern richtete daher eine Fahrgastschiffahrt zwischen Spandau<br />
und Tegel mit eigenen Dampfern ein, die natürlich in jedem Falle seine Schöpfung Valentinswerder<br />
berührten und deren Besuch ermöglichten. Schließlich erbaute sich der Berliner<br />
Julius Busse um 1873 eine große Villa am Pichelssee und im benachbarten Pichelsdorf<br />
1875 eine Brauerei, die er aber bald wieder aufgeben mußte. Die Berliner Terrainspekulation<br />
war also bis vor die Festungswälle Spandaus vorgestoßen, überall dahin, wo geschäftlich<br />
verwertbares Land außerhalb der militärischen Einschränkungen zur Verfügung stand.<br />
Daß diese Bestrebungen meist in den Anfangsstadien stecken blieben, lag nicht nur an den<br />
topographischen Schwierigkeiten, sondern auch an den ungenügenden oder undurchsichtigen<br />
Finanzierungen der Gründer, die — mit Ausnahme von Haberkern — ihre Grundstücke<br />
in der „Subhastation" (der Zwangsversteigerung) wieder verloren. Hätte eine solidere<br />
Gesellschaft - und auch solche gab es in der Gründerzeit - die verkehrliche Erschließung<br />
jenes Niemandslandes zwischen Spandau und Charlottenburg energisch in die Hände<br />
genommen, wären voraussichtlich im Osten der Havelstadt Siedlungsgebilde entstanden,<br />
die die wirtschaftliche und städtebauliche Integrierung Spandaus in den Berliner Einflußbereich<br />
schon vor einem Jahrhundert eingeleitet hätten.<br />
Sichtbarer als jene Spuren der meist erfolglos gebliebenen spekulativen Terraingeschäfte<br />
waren die Einflüsse Berlins im Bauwesen. Bis weit in die achtziger Jahre hinein hatte die<br />
385
Physiognomie Spandaus durchaus der anderer märkischer Mittelstädte wie etwa der<br />
Rathenows, Eberswaldes, Fürstenwaldes oder der von Nowawes geglichen. Die zweigeschossigen<br />
Ackerbürger- und Handwerkerhäuser in der Altstadt aus dem 17. und 18. Jahrhundert<br />
wurden zwar nach 1850 häufiger durch Neubauten ersetzt, doch diese blieben zweioder<br />
dreigeschossige Gebäude, die bei den beschränkten Grundstücksflächen meist nur in<br />
bescheidenen Ausmaßen errichtet werden konnten. Die Neubauten hier wie in den anderen<br />
märkischen Städten waren in ihrer Architektur dem klassizistischen Formenschatz verpflichtet:<br />
Kranz- und Gurtgesimse in sparsamen Abmessungen; die Fassaden waren meist<br />
mit geraden Fensterverdachungen und hin und wieder mit Putzfugung versehen. Die<br />
Arbeiterwohnhäuser in den Vorstädten waren - sofern sie nicht überhaupt den Rayonvorschriften<br />
entsprechend als zweigeschossige Fachwerkbauten mit flach geneigtem Dach<br />
erbaut werden mußten - bis um 1870 den zweigeschossigen Ackerbürgerhäusern oder gar<br />
den eingeschossigen Wohngebäuden der vorstädtischen Gehöfte nachgebildet, häufig mit<br />
großen Dachgauben. Erst als in den siebziger Jahren zahlreiche Mietshäuser entstanden,<br />
wurden die Berliner Bauformen übernommen; so erhielten um 1874 zwei kleine Eckhäuser<br />
an der Jordanstraße die damals in Berlin bei Mietshäusern an Straßenecken so typischen<br />
turmartigen Aufsätze. In der Altstadt begannen die Häuser seit dieser Zeit in die Höhe zu<br />
wachsen, die ersten viergeschossigen Gebäude entstanden. Als dann seit Mitte der achtziger<br />
Jahre in der Neustadt die ersten größeren zusammenhängenden Wohnquartiere entstanden,<br />
etwa an der Feld- und Groenerstraße oder zwischen der Schönwalder und Neuendorfer<br />
Straße längs der Lynar-, Luther- oder Neumeisterstraße usw., hielten die vier- und fünfgeschossigen<br />
Berliner Mietskasernen in Spandau Einzug mit ihren Seiten- und Querflügeln<br />
und Nebengebäuden auf den engen Höfen. Die Übertragung der Berliner Mietskaserne mit<br />
all ihren auch schon damals erkannten unsozialen und schädlichen Auswirkungen auf die<br />
Spandauer Verhältnisse konnte um so leichter erfolgen, als die in Spandau gültige Bauordnung<br />
von 1872 für das platte Land keine Handhabe bot, diese Entwicklung zu steuern. Die<br />
Überlagerung der alten eigenständigen Bauformen ging dann schnell voran.<br />
So war Spandau ausgangs des 19. Jahrhunderts eine Stadt, in der sich die Einflüsse der<br />
nahen großen Residenz in verschiedener Weise manifestieren, in den Ladengeschäften, in<br />
der Bauart der Häuser oder auch in den großstädtischen Ansprüchen entsprechenden Ausflugslokalen.<br />
Aber trotz derartiger adaptierter Formen bewahrte Spandau durchaus sein<br />
Eigenleben, es war trotz aller Ansätze und Verknüpfungen noch kein Vorort. Der Entwicklungsgang<br />
von der märkischen Provinzstadt zum Berliner Vorort, der kurz vor 1900 begann,<br />
soll in einem weiteren Aufsatz nachgezeichnet werden.<br />
386<br />
Anschrift des Verfassers: Joachim-Friedrich-Straße 2. 1000 Berlin 31
Portal in der Südwand des Palas 1969 nach frei- Portal in der Südwand des Palas<br />
gelegten Resten der Rustikaquaderung rekon- nach Veränderungen 1977<br />
struiert<br />
bauliche Veränderungen an der Spandauer Zitadelle<br />
Zur Zerstörung von Teilen der historischen Bausubstanz<br />
Von Jürgen Grothe<br />
In den letzten Wochen berichtete die Presse wiederholt, daß die Spandauer Zitadelle<br />
die „schönste Kneipe Berlins" erhalten wird. Der Abgeordnete Hermann Oxfort, der<br />
während einer Führung durch die Zitadelle das Ausmaß der Zerstörungen für den Kneipeneinbau<br />
erkannte, erhielt als Antwort auf eine Anfrage im Berliner Abgeordnetenhaus<br />
ebenfalls den Hinweis auf die „schönste Kneipe". Grundsätzlich ist nichts gegen<br />
Kneipen einzuwenden, doch muß deshalb historische Bausubstanz, die unter Denkmalschutz<br />
steht, zerstört werden?<br />
Vielleicht muß noch einmal auf die historische, baugeschichtliche und festungsbaugeschichtliche<br />
Bedeutung der Zitadelle hingewiesen werden. Die Zitadelle ist der einzige<br />
in Deutschland erhaltene Festungsbau aus der zweiten Hälfte des 16. Jhs., der trotz der<br />
Veränderungen des 19. Jhs. ein gutes Bild einer Festung im Stil der Neuen italienischen<br />
Befestigungsmanier vermittelt. Selbst die Vorbilder in Italien sind nicht so gut erhalten.<br />
Daraus ergibt sich die Frage, ob man es sich leisten kann, einen derartig bedeutenden<br />
Bau durch den Einbau einer Kneipe in seiner Funktion zu zerstören. Bei den erfolgten<br />
387
Wanddurchbrüche<br />
in der Poterne 1977<br />
(Alle Bilder aus dem Archiv<br />
Jürgen Grothe)<br />
Mauerdurchbrüchen und geplanten Umbauten der Kasematten muß von Zerstörungen<br />
gesprochen werden. Die Zerstörungen und Veränderungen umfassen die ältesten und<br />
festungsbaugeschichtlich wichtigsten Teile: den Palas, die Bastion König und das Torhaus.<br />
Der Palas. der nach den letzten Bauuntersuchungen in der zweiten Hälfte des 14. Jhs.<br />
erbaut worden ist, besitzt im Kellergeschoß zwei Tonnengewölbe, die durch eine starke<br />
Mittelwand getrennt sind. Der südliche Raum, in späteren Jahrhunderten verändert, wird<br />
durch Einbauten völlig entstellt. Er wird in Zukunft als Lager- und als Toilettenraum<br />
dienen. An der Südseite des Palas befand sich ein Eingang, der nach der Zuschüttung des<br />
Burggrabens im 16. Jh. eingebrochen wurde und zur Anpassung an den gesamten Zitadellenstil<br />
eine Rustikaquaderung als Umrahmung erhielt. Reste der Gliederungen kamen<br />
bei Bauuntersuchungen durch Dr. Günter Stein, 1957, zum Vorschein 1 . Sachkundig wurde<br />
die Rustikaquaderung 1969 von dem mit der Zitadellenrestaurierung betrauten Architekten<br />
Joachim Hellmich rekonstruiert. Als der Südraum des Palas der Nutzung der Kneipe<br />
zugeschlagen wurde, wurde dieses Portal ohne Rücksicht auf die Rustikaquaderung und<br />
auf die historische Öffnung verbreitert.<br />
Noch umfangreicher sind die Zerstörungen in der Poterne 2 , die in den linken Flankenhof<br />
führt. Hier ist die Funktion einer Poterne (erbaut um 1560) durch einen Wanddurchbruch<br />
als Zugang zur Kneipe und einer Wandöffnung als Entlüftungsschacht weitgehend verändert<br />
worden. (Seit 1977 besitzt Berlin die einzige Poterne der Welt mit einem Nebeneingang.)<br />
Der linke Flankenhof wurde durch Mauereinbrüche verändert. In die Südwand wird<br />
eine Tür eingesetzt, die als Notausgang für die Fleischküche dienen soll, die unter der<br />
388
Alarmtreppe der Bastion König eingebaut wird. Zu diesem Zweck wird der im 19. Jh.<br />
umgestaltete Eingang zur sog. Offizierswachstube, die sich unter der Treppe befand,<br />
verändert und der Fußboden abgesenkt.<br />
Eine noch größere Veränderung wird die Kehlkasematte der Bastion König erhalten.<br />
Hier werden Zwischenwände eingezogen, um Räume für Toiletten und Abstellmöglichkeiten<br />
für Mülltonnen zu schaffen. Somit geht auch die Funktion dieser Kasematte verloren.<br />
Wie schon erwähnt, steht die Zitadelle unter Denkmalschutz. Kann man aber bei diesen<br />
umfangreichen Eingriffen in das Festungssystem noch von Denkmalschutz sprechen?<br />
Einerseits werden die Restaurierungen durch das ZIP-Programm mit 25 Millionen Mark<br />
unterstützt, andererseits wird ohne Rücksicht auf die historische Bausubstanz die Festungsarchitektur<br />
durch Einbauten und Mauerdurchbrüche verändert.<br />
Es erhebt sich die Frage, ob man es sich in Berlin, das wahrlich arm an historischen<br />
Bauten ist. leisten kann, einen Bau des 16. Jhs. derartig zu verunstalten. Die genannten Beispiele<br />
zeigen aber auch, wie wenig Verstand und Sachkenntnis der Zitadelle entgegengebracht<br />
werden, und Denkmalschutz zur Farce werden kann.<br />
Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 20, Kellerwaldweg 9<br />
1 Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte, 1957. S. 58.<br />
Hier Bauaufnahme der Südseite und klare Erkennung der Rustikaquaderung. Bei der Restaurierung<br />
des Gebäudes 1969 kamen Reste der Quaderung noch stärker hervor. So konnten z. B. die Türanker<br />
freigelegt werden, in denen die rekonstruierte Tür bis 1977 hing. Es ist bezeichnend für die<br />
heutige Situation in der Zitadelle, daß der Bauleiter bei einer Begehung von den freigelegten Resten<br />
nichts wußte und sie sogar bestritt.<br />
2 Poterne: Bombensicherer Durchgang für den Verkehr innerhalb von Festungswerken.<br />
Nachrichten<br />
Nachlese zur 15. Europäischen Kunstausstellung 1977<br />
„Tendenzen der zwanziger Jahre".<br />
Es war, um ein reißerisches Schlagwort von heute zu gebrauchen, eine Schau der Superlative, und<br />
das gesamte kunstinteressierte Berlin hatte sich mit ihr identifiziert. Nicht nur mit ihr. Mit den<br />
„Zwanzigern" überhaupt. Nostalgie?<br />
Wehmütige Erinnerung an Aufbruch und Wandlung von damals als Reflex auf den Ersten Weltkrieg,<br />
auf die einstige Nachkriegszeit und deren Inflation? Antwortsuchen auf die resignierende Frage, was<br />
wohl geworden wäre, wenn nicht . . .? Allgemeines Interesse an der Widerspiegelung damaligen<br />
politischen Geschehens und stille Bejahung der künstlerischen Prophetien den Entwicklungstendenzen<br />
der Technik und den farbigen Visionen vermassender Anonymität gegenüber? Verständnis für den<br />
vergleichsweise zahmen Groll von einst, mit dem politisch, ästhetisch und emotionell Staat und Ordnung<br />
in Manifesten und Pamphleten, in Plakaten und Bildern bekämpft wurde? War es in der jetzigen<br />
apokalyptischen Katastrophe von Terror und Korruption Bewunderung für die aktivierte Kunst von<br />
389
damals, die politisch, idealistisch oder zynisch, immer aber geistbetont, sich aufrührerisch und weltumstürzlerisch<br />
gegen Überlieferung und Tradition auflehnte? Oder heimliche Sehnsucht nach der<br />
pulsierenden Geschäftigkeit und Aufgeschlossenheit einer noch jungen Weltstadt, die ebenfalls<br />
nach einem verlorenen Krieg die Kraft besessen hatte, geistiges Zentrum der verschiedensten Kunstströmungen<br />
zu werden? Oder Erinnerung an das avantgardistische Theater Erwin Piscators und<br />
Bert Brechts, an die Rhythmik Strawinskys und Bartöks, an die ersten Festivals moderner Musik<br />
in Donaueschingen und Salzburg, auf deren Programmen Ernst Krenek. Paul Hindenrnith. Alban<br />
Berg und Darius Milhaud standen?<br />
Wie dem auch sei - Berlin hatte Berlin wiedergefunden, lebendig und hoffnungsfroh. Großstadt<br />
Europas, deren künstlerische und kulturelle Impulse die Illusion der ,.Goldenen Zwanziger" geprägt<br />
hatten, ehe sie der Würgegriff von Diktatur und Isolation im nächsten Jahrzehnt ersticken sollte.<br />
Ein Spätsommer der Erinnerungen mit vielen lebendigen Beziehungen in die Gegenwart hatte die<br />
Stadt intensiviert: Fast neun Wochen gesungenen und instrumentierten, gemalten und konstruierten<br />
Festtaumels unter dem Motto jener Zeit zwischen Inflation und „Schwarzem Freitag" mit 90 Kunstausstellungen,<br />
135 Festwochenveranstaltungen und 211 historischen Filmvorführungen einschließlich<br />
modischen Linksdralls — nicht nur in der Eröffnungsausstellung der neugegründeten Staatlichen<br />
Kunsthalle.<br />
So konnten sich Senat und das offizielle Berlin in vornehmer Zurückhaltung üben, und der Rummel<br />
um die diesjährige Funkausstellung die Werbung für das kulturelle Geschehen zeitweilig überlagern.<br />
Die junge Generation der neuberliner Regierungsmannschaft hatte die Freisetzung der künstlerischen<br />
Kräfte zum gleichen Teil auch der Privatinitiative überlassen. Das Mammutprogramm bestritten<br />
Theater, die Deutsche Oper, die Philharmonie, die Akademie der Künste, Museen und Galerien,<br />
Kunstämter, Universitäten. Rundfunk- und Fernsehanstalten.<br />
Doch bleiben wir bei der Europarats-Ausstellung, der dritten übrigens, die die Bundesrepublik ausgerichtet<br />
hat. Nach dem „Zeitalter des Rokoko" 1958 in München und „Karl dem Großen" 1965<br />
in Aachen war Berlin prädestiniert, mit den „Tendenzen der Zwanziger Jahre" den Sinn dieser Ausstellungen<br />
bewußt zu machen, kunst- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge Europas zu verdeutlichen.<br />
Weil es sich selbst reflektierte, konnte diese Ausstellung nach nur eineinhalb Jahren Vorarbeit<br />
gelingen und zum überwältigenden Erfolg werden. Dessen ganzes Geheimnis: Die Sache als solche<br />
rechtfertigte den Ausstellungsort, fernab jeder hohlen politischen Geste. 2360 Werke hatten die<br />
wichtigsten Museen der 19 Mitgliedstaaten des Europarates neben Kanada und New York ausgeliehen,<br />
um erstmals im „bedeutendsten kulturellen Ereignis des Jahres 1977 in Deutschland" den<br />
Stilpluralismus dieser Epoche, eben die bewußten „Tendenzen" - bisher nur einzeln untersucht<br />
und ausgestellt - in einer Fülle von Materialien auszubreiten und zu veranschaulichen (Versicherungswert<br />
etwa 250 Millionen Mark). Vier Hauptausstellungen bildeten das Gerüst.<br />
„Vom Konstruktivismus zur konkreten Kunst" hieß das Thema der neuen Nationalgalerie. Hier hatten<br />
Dieter Honisch und Ursula Prinz einen großangelegten, präzisen Überblick in Theorie und Werk<br />
von der faszinierenden Wucht des Aufbruchs in ein neues Zeitalter überall in Europa, seinen Höhen<br />
und seinem letztlichen Scheitern gegeben. Kubismus und Futurismus bildeten die Grundlage der<br />
konstruierbaren Wirklichkeit aus den Jahren von 1910 bis 1916. Picasso. Balla. Delaunay und Kandinsky<br />
heißen die großen Namen, die zu den reinen Farben und geometrischen Formen von Kasimir<br />
Malewitsch im Osten und Piet Mondrian im Westen führten. „Einheit von Kunst und Leben" wollte<br />
man von 1917 bis 1922 erreichen; die politische Wirklichkeit der russischen Revolution und das<br />
neue technische Zeitalter verschmolzen zum Symbol einer künstlerischen Utopie, die auch das Tafelbild<br />
stürzte. Tatlin und El Lissitzky seien hierfür genannt. Hollands Gruppe „de Stijl" und das Bauhaus<br />
in Deutschland gehörten dazu. Die Praxis des Alltags reduzierte jedoch die großen Ideen: Funktionelle<br />
Möbel und Lampen, grad- und klarliniges Porzellan und Eßwerkzeug blieben übrig - und Wilhelm<br />
Wagenfelds Kaffeemaschine. Strzeminski wies in seinen monochromen Bildstrukturen auch wieder<br />
den Weg zu autonomen Tafelbild.<br />
Nicht ganz glücklich, wohl der Raumnot gehorchend, war das Nebeneinander in der Akademie der<br />
Künste: „Von der futuristischen zur funktionellen Stadt - Planen und Bauen in Europa 1913 — 1933"<br />
und „Dada in Europa - Werke und Dokumente" gelöst.<br />
Das Manko aller Architekturausstellungen traf natürlicherweise auch diese: Architektur läßt sich nicht<br />
ausstellen, Architektur muß man begehen und von allen Seiten besehen können. Architektur muß<br />
man erleben. Peter Pfankuch hatte seine Ideen und Pläne nicht mehr vollenden dürfen, und Achim<br />
Wendsehuh und Martina Schneider hatten die Ausstellung in begreiflicher, aber wohl falscher Zurück-<br />
390
haltung für den Durchschnittsbesucher zu sachlich-chronologisch gehängt. Doch eindrucksvolle<br />
Höhepunkte bildeten jedesmal die Wettbewerbsentwürfe, in denen die geistige Auseinandersetzung<br />
zwischen Fortschritt und Tradition jener Geniejahre lebendig wurde. „Geniejahre" haben wir gesagt.<br />
hier traf vieles zusammen. Stahl, Beton und Glas hießen die neuen Grundstoffe für neue Möglichkeiten.<br />
Der Zusammenbruch der Wilhelminischen Ordnung hatte auch die Architekten herausgefordert,<br />
in der Novembergruppe waren sie ebenfalls zu finden. Das kommunalpolitische Entstehen<br />
„Groß-Berlins" schuf vielfältige Aufgaben, aber alle Städte der Welt wären für den optimistischen<br />
Schaffensdrang dieser jungen idealistischen Generation zu eng gewesen. So gingen gerade von<br />
Berlin die Impulse des neuen Bauenwollens. das utopische Architekturträume in funktionelle Wirklichkeit<br />
umsetzte, aus, etwa wie hundert Jahre früher das Berlin Karl Friedrich Schinkels die Architektur<br />
des damaligen Europa geformt hatte. Mit einem Unterschied: die Vielschichtigkeit der zwanziger<br />
Jahre dieses Jahrhunderts dokumentieren zum Beispiel Werkbund. Bauhaus. Gläserne Kette,<br />
Zehnerring, die Brüder Max und Bruno Taut, Letzterer das Haupt des Berliner Expressionismus,<br />
die Brüder Wassili und Hans Luckhardt. Ludwig Mies van der Rohe. Walter Gropius. Erich<br />
Mendelsohn. Hugo Häring und Ludwig Hilberseimer. In ständiger Auseinandersetzung mit der<br />
Tradition entwickelten sich unter anderen Hans Poelzig, Fritz Höger und speziell im Berliner Bereich<br />
Paul Mebes. und die Konservativen scharten sich um Künstler wie Ludwig Hoffmann. Paul Bonatz<br />
und Paul Schmitthenner. Zu den Himmelsstürmern, für die nur die imaginäre Architektur wahre<br />
Architektur bedeutete, gesellten sich die vielen hier Ungenannten, die alle vorzüglich bauten, weil sie<br />
eine solide Ausbildung genossen hatten und ihr Handwerk verstanden. Trotzdem siegte schon am<br />
Ende der zwanziger Jahre überall in Europa wieder der repräsentative Klassizismus, den Peter<br />
Behrens in den Jahren 1911 und 1912 mit der kaiserlichen deutschen Botschaft in Petersburg wiederbelebt<br />
hatte. Doch noch immer haben wir die ästhetischen und sozial-moralischen Anregungen<br />
jener Architekten in dem Städte- und Wohnhausbau von heute zu verarbeiten. Das Hochhaus hatte<br />
übrigens die neue Dimension in die Stadtplanung gebracht, deshalb führten auch die Großfotos<br />
des Hochhauswettbewerbes von Chikago den Besucher in die Dada-Halle.<br />
Hier nun wirbelte auch phonetisch die verrückteste Explosion des Ersten Weltkrieges, die in einem<br />
literarischen und musikalischen, bildnerischen und gestischen Feuerwerk ohnegleichen von 1916<br />
bis 1923 über das zerstrittene und zerrissene Europa hinweggequirlt war. umher. Dynamik, Vielseitigkeit<br />
und Absurdität dieser Kunstströmung zwischen Berlin. Hannover, Köln, Zürich und Paris<br />
mit ihrem Strahl nach Osten hatten Eberhard Roters und Hanne Bergius anhand der Werke von<br />
50 Dada-Künstlern hervorragend und mitreißend interpretiert. Fast 2000 Jahre Geschichte abendländischer<br />
Kunst und Kultur hatten den vierjährigen Völkermord mit seinen zwei Millionen Toten<br />
- etwas bis dahin in seiner Grausamkeit nicht nur der großen Materialschlachten noch nie Dagewesenes<br />
- verhindern können. Wozu also Kunst und Kultur? Dada war Enttäuschung und Empörung, Protest<br />
und Provokation, Dada war gewollt primitive Ironie. Dada-Berlin soll hier erwähnt werden:<br />
Raoul Hausmanns Assemblage „Der Geist unserer Zeit", die Dada-Nofretete. der einfache Perückenkopf<br />
mit Metermaß. Nummernkarte. Taschenuhrwerk, ausziehbarem Aluminiumbecher, Schraube.<br />
Stempelwalze mit Schatulle, Portemonnaie und Reißbrettlineal. George Grosz" Photomontagezeichnung<br />
„Der Schuldige bleibt unerkannt" und Hännah Hochs Photomontage „Schnitt mit dem<br />
Kuchenmesser durch die Weimarer Bierbauchkulturepoche". Das war der am unmittelbarsten ansprechende<br />
Teil der Ausstellung. Was Wunder also, daß sich hier die Jugend und die jungen Leute<br />
drängten? Fanden sie hier doch das Ungestüme, das Unbändige ihrer eigenen heißen Herzen wieder.<br />
Denn in diesem Ausbruch wurde deutlich, wie wenig sich eigentlich geändert hat.<br />
Und nun zum reizvollsten und publikumswirksamsten Teil der großen Schau „Die neue Wirklichkeit<br />
- Surrealismus und Neue Sachlichkeit" in der ständig überfüllten Orangerie des Schlosses<br />
Charlottenburg. Auf 400 laufenden Metern Hängefläche 194 Gemälde teilweise ätzender Gesellschaftskritik<br />
und erlebt-erfundener Wirklichkeit des traumhaft-Unbewußten, geordnet in Motiv-<br />
Gruppen wie zum Beispiel „Industrie, Technik, Verkehr". „Die Straße als Ort der Bedrohung",<br />
„Das Porträt" oder „Maler und Modell" und vieles mehr. Distanzierte fotografische Genauigkeit<br />
in der Wiedergabe versinnbildlichte hierbei oft die Strömungen des Unterbewußtseins und das<br />
Unkontrollierbare der Phantasie. Zum ersten Mal - und das machte die Faszination der von Wicland<br />
Schmied und Matthias Eberle gestalteten Ausstellung aus - konnte man große Namen neben<br />
nahezu unbekannten entdecken, die gleichberechtigt das breite Spektrum - den Zusammenhang<br />
und das Gegeneinander - der Malerei vor einem halben Jahrhundert sichtbar werden ließen. Hier<br />
fanden die Älteren die Sehnsüchte ihrer Jugend und die Ängste ihres Lebens wieder, und die Jungen<br />
391
die Parallelen und die Beziehungen zu heute. Denn die Tugenden und Schwächen der „Zwanziger"<br />
bilden noch immer die Tugenden und Schwächen der siebenziger Jahre. Deshalb die Überfüllung<br />
die Parallelen und die Beziehungen zu heute. Denn die Tugenden und Schwächen der „Zwanziger"<br />
sind noch immer die Tugenden und Schwächen der siebenziger Jahre. Deshalb die Überfüllung<br />
und daher die geduldig wartenden Schlangen vor der zeitweilig geschlossenen Orangerie auch am<br />
letzten Ausstellungstag.<br />
Weit spannte sich der Bogen der Ergänzungsausstellungen. Zum Teil spiegelte er ebenfalls die verwirrende<br />
Vielfalt dieser Epoche in interessanten intellektuellen und künstlerischen Auseinandersetzungen<br />
wider. Einige - auch private - Veranstalter hatten allerdings die Akzente ein ordentliches<br />
Stück nach links geschoben und vergrößert, das Ganze damit vergröbernd und vereinfachend.<br />
Manche hatten sich mit Gleichzeitigkeit begnügt. Wenige, die die Fülle des Angebotes an Geometrie<br />
und Klarheit, Schönheit und Rationalität, Verrottetheit und Pedanterie charakteristisch auffächerten,<br />
seien herausgegriffen: „Metropolen machen Mode" im Dahlemer Kunstgewerbemuseum, „Plakate<br />
der Zwanziger Jahre" aus dem Besitz der Kunstbibliothek im Foyer des Theaters der Freien Volksbühne.<br />
„Berliner Pressezeichner der Zwanziger Jahre" im Berlin-Museum, „Dresdener Sezession<br />
1919—1923" im Neuen Berliner Kunstverein, „Die Physik der Zwanziger Jahre" im Siemens-<br />
Bildungszentrum. „Die Novembergruppe" im Rathaus Wedding, „Der Berliner Alltag der Zwanziger<br />
Jahre" in der Stiftung Deutschiandhaus. „Karl Schmidt-Rottluff. Das nachgelassene Werk seit<br />
den Zwanziger Jahren - Malerei. Plastik. Kunsthandwerk" im Brücke-Museum, „Malerei und Kunsthandwerk<br />
der Zwanziger Jahre" in der Stiftung Sammlung Bröhan, „Georg Kolbe - Tanzstudien<br />
der Zwanziger Jahre" im Georg-Kolbe-Museum, „Otto Dix - Zwischen den Kriegen" im Haus am<br />
Waldsee. „Tendenzen der Zwanziger Jahre in der Europäischen Fotografie" in der Galerie Breiting,<br />
„Licht und Schatten der Zwanziger Jahre" in der Galerie Nierendorf, „Der Anteil der Frau an<br />
der Kunst der Zwanziger Jahre" bei Pels-Leusden. „Zwanzig Künstler zitieren Künstler der Zwanziger<br />
Jahre" in der Galerie November, in der Künstler von heute Erzeugnisse von damals in eigene<br />
Bild-Ideen umsetzten, „Comedian Harmonists" im Haus am Lützowplatz. „Lebensformen der<br />
Zwanziger Jahre" im Internationalen Design Zentrum und „Die Zwanziger Jahre heute" in der Hochschule<br />
der Künste. Viele von ihnen, auch der hier unerwähnten, hätten eine ausführliche Besprechung<br />
verdient.<br />
Die 27. Berliner Festwochen vom 1. September bis zum 8. Oktober 1977 erweiterten in Konzert.<br />
Oper, Tanz, Theater. Kleinkunst, Film und Literatur die Darstellung dieser Zeit zum umfassenden<br />
„Spiegel der 20er Jahre", wie der Titel des Programmkataloges lautete. Auch hierüber wäre noch<br />
vieles zu sagen gewesen.<br />
Die Kunst der zwanziger Jahre, meinten wir am Anfang, hätte als Experimentierfeld der unbegrenzten<br />
Möglichkeiten warnende Denkanstöße gegeben. Sie sei analytisch und synthetisch gewesen -<br />
ein ästhetischer Protest gegen das Unheil der Machtpolitik, ohne diese verhindern zu können. In<br />
der Unruhe von heute bezieht sie ihre Aktualität aus der Gesellschaftskritik von damals: Die alte Ordnung<br />
war zerschlagen, die eigene Vergangenheit gehaßt, das Leben nur Gegenwart, aber die Sehnsucht<br />
nach dem Guten war geblieben. Günter Wollschlaeger<br />
*<br />
Nach dieser recht ausführlichen Betrachtung von Günter Wollschlaeger müssen leider noch ein paar<br />
kritische Anmerkungen zum wohl größten Ärgernis der Ausstellung - dem Katalog - gemacht werden.<br />
Schon die ziemlich spät anlaufenden Vorbereitungen ließen erkennbar werden, daß die Verantwortlichen<br />
sich nicht der anfallenden Schwierigkeiten, die mit der Erstellung eines derartigen Katalogs<br />
auftreten, voll bewußt waren. Vielleicht waren sie auch der Meinung gewesen, diese Sache mit der<br />
„linken Hand" erledigen zu können. Und so kam dann auch, was kommen mußte: Bereits bei der<br />
offiziellen Eröffnung reichte die erste Bindequote nicht aus und war sofort vergriffen. Die dann täglich<br />
gefertigten 500, später 1500 Kataloge waren bei einem Besucherdurchschnitt von täglich 500C)<br />
auch nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. So erlebten dann viele Ausstellungsbesucher<br />
diese komplexe Kunstveranstaltung als einen Ausflug ins Blaue. Es fehlte ihnen der Wegweiser, die<br />
Übersicht, das Orientierungsmaterial. Die nun praktizierte Ausgabe von Berechtigungsscheinen war<br />
eine provinzielle Notlösung, dieser Ausstellung unwürdig und ein Armutszeugnis für die Beteiligten.<br />
Hier ist auch der Hinweis, daß in Darmstadt anläßlich der Jugendstil-Ausstellung und in Stuttgart bei<br />
der Staufer-Ausstellung ähnliche Engpässe auftraten, als Entschuldigung nicht geeignet. Gerade aus<br />
392
diesem Grund hätte man sich in Berlin besser vorbereiten müssen, um nicht, wie Professor Stephan<br />
Waetzoldt, der Vorsitzende des verantwortlichen Arbeitsausschusses, erklärte, die Sensation dieser<br />
Ausstellung zu unterschätzen.<br />
An dieser Stelle erhebt sich die berechtigte Frage, warum statt eines kompetenten Kunstverlags ein<br />
kleiner Verlag, dessen Programm naturwissenschaftliche Veröffentlichungen sind, mit der Herstellung<br />
eines Kunstkatalogs betraut wurde.<br />
War bisher nur von organisatorischen Mängeln die Rede, so sollen jetzt die Unzulänglichkeiten am<br />
Konzept und an der technischen Ausführung aufgezeigt werden. Kurz: Dieser Katalog verfehlte seine<br />
Aufgabe, dem Betrachter eines Kunstgegenstandes am Objekt als Verständnishilfe zu dienen, vollkommen.<br />
Der Grund hierfür liegt hauptsächlich in der Unhandlichkeit des Bandes. Dem Verantwortlichen<br />
im Verlag hätte klar sein müssen, daß sich mehrere Kilogramm Papier nur schwer tragen<br />
und noch viel schwerer ohne stützende Unterlage durchblättern lassen. Auf Anhieb lassen sich drei<br />
andere Möglichkeiten aufzeigen, bei denen die an einen Katalog gestellten Aufgaben effektiver<br />
gelöst worden wären:<br />
1. eine zweibändige Ausgabe mit einem Text/Bildband und einem reinen Katalogband.<br />
2. eine dreibändige Ausgabe mit einem Band je Ausstellungsort.<br />
3. eine vierbändige, nach Themen gegliederte Ausgabe.<br />
Eine Aufteilung in kleinere Bucheinheiten wäre auch in beachtlichem Ausmaß der technischen Ausführung<br />
entgegengekommen. Sind der Satz, die Abbildungen und der Druck noch von annehmbarer<br />
Qualität, so liegen die Mängel bei der buchbinderischen Verarbeitung, wobei auch hier je nach Buchbinderei<br />
noch Unterschiede auftraten. So ließ sich oftmals beobachten, wie der Katalog bereits nach<br />
einmaligem Durchblättern auseinanderbrach und danach ohne Mühe als Loseblattsammlung „benutzt"<br />
werden konnte. Die Hauptursache für dieses Fiasko liegt in der falschen Laufrichtung des Papieres.<br />
Wenn dem Hersteller dieser kapitale Fehler nun schon bei der Erstauflage unterlaufen ist, so erscheint<br />
es geradezu unverständlich, warum dies auch bei den Nachauflagen so sein mußte, zumal zu diesem<br />
Zeitpunkt schon feststand, daß aus Termin- und wohl auch Preisgründen von der Fadenheftung auf die<br />
Klebebindung umgestellt werden mußte. Da der Kartonumschlag im Verhältnis zum Inhalt viel<br />
zu dünn ist. kann er dem ganzen keinen Halt geben; da hilft auch der reichliche Verbrauch von Leim<br />
nichts, der die Seiten oft bis ins Schriftbild hinein verklebt.<br />
So bleibt als Fazit nur der Wunsch, daß alle Beteiligten aus diesen Fehlern lernen - und das nicht nur<br />
zum Wohle der geplanten Preußen-Ausstellung. Claus P. Mader<br />
„Warum wurde das Georg-Kolbe-Museum nicht in die Europäische Kunstausstellung mit einbezogen?"<br />
lautete wiederholt die Frage an Freifrau von Tiesenhausen, die Leiterin des als private<br />
Stiftung unterhaltenen Hauses. Hängt es mit dem eher traditionellen Zuge in Kolbes Werk zusammen?<br />
Die Zukunft seiner Wirkungsstätte scheint gefährdet, da das der Bauhaustradition entstammende<br />
Ateliergebäude mit dem angrenzenden Gartengrundstück nicht mehr ohne Unterstützung<br />
durch den Berliner Senat bzw. den Bund unterhalten werden kann. Richten wir also unsere<br />
dringende Bitte an den Senator für Kunst, daß er diesen vollständig erhaltenen Wohnsitz eines<br />
hervorragenden Berliner Künstlers als Museum fördert und unterstützt. Rüdiger Brauer<br />
Studienfahrt ins Wendland<br />
Am 23. bis 25. September 1977 war das Hannoversche Wendland im Naturpark Elbufer-Drawehn<br />
Ziel der traditionellen Exkursion. Den erfreulichen Auftakt bildete eine Führung durch die Brauerei<br />
Wittingen, deren neuzeitliche Einrichtung ebenso ansprach wie die Liebenswürdigkeit der Gastgeber<br />
und die Deftigkeit des Imbisses. Dr. H. G. Schultze-Berndt schlug die Brücke zwischen den Gästen<br />
und der Brauerei und zwischen einem blühenden Wirtschaftsunternehmen und der Geschichte<br />
mit seinem Vortrag „Zur Historie der Bierstadt Wittingen und ihrer Brauerei". Hitzacker, „in<br />
einer lustigen Gegend an der Elbe gelegen", erwies sich als der freundliche Standort für die Fahrt,<br />
als der er erhofft worden war. Der Geschäftsführer des Naturparks Elbufer-Drawehn e.V.. Bürgermeister<br />
Oberstleutnant a. D. Walter Eschrich, getreuer Weggenosse auch an künftigen Tagen, erwartete<br />
hier bereits die Besucher aus Berlin.<br />
Als am Sonnabendmorgen. 24. September 1977. bei strahlendem Sonnenschein der Omnibus zur<br />
Fahrt durch die Rundlinge des Wendlandes bestiegen werden sollte, hatte der Omnibusunternehmer<br />
393
fatalerweise das Reisegefährt nach Hamburg beordert. Zwar konnte die anderthalbstündige Wartezeit<br />
mit einem Rundgang durch Hitzacker unter Führung von W. Fick und W. Eschrich überbrückt<br />
werden, der vorgesehene Besuch des Wendlandhofes in Lübeln mußte aber ausfallen, und der Aufenthalt<br />
bei Landesbaupfleger Professor Dr.-Ing. Erich Kulke in seinem Schulzenhof in Bussau<br />
verlief kürzer als geplant. Professor Kulke zeichnete in kurzen Strichen nicht nur ein sehr lebendiges<br />
Bild von den Rundlingen, ihrer Geschichte und Eigenart, mit seiner liebwerten Gattin war er auch<br />
ein begeisternder Führer durch sein Anwesen und ein charmanter Gastgeber bei einem Willkommenstrunk.<br />
Im Ratskeller Lüchow wartete das Mittagessen, dem sich die beiden kenntnisreichen Lichtbildervorträge<br />
von Dr. Berndt Wächter „Deutsche und Slawen im Licht der archäologischen Forschung'"<br />
und von Rektor Wilhelm Meier-Peithmann über Landschaft, Tier- und Vogelwelt im Naturpark<br />
Elbufer-Drawehn sowie über die Probleme ihres Schutzes anschlössen. Hier war es erfreulich<br />
festzustellen, wie intensiv und auf welch hohem wissenschaftlichen Niveau Fragen der Archäologie<br />
und Bodendenkmalpflege, aber auch der Ornithologie und des Landschaftsschutzes im Kreis Lüchow-<br />
Dannenberg behandelt werden. Die Göhrde als das große Waldgebiet dieser Region lockte zu<br />
einer Kaffeepause mit einem Spaziergang bei beginnender Dämmerung - vielleicht hat mancher<br />
Teilnehmer hier zum ersten Male Hirsche röhren gehört. Das Spanferkelessen im Schafstall des<br />
Hotels Heil auf dem Schafskovenberg in Ventschau war der atmosphärisch glücklich getroffene<br />
Abschluß dieses Reisetages. Menge und Güte der Spanferkelportionen konnten sich sehen lassen,<br />
und der Funke des Lagerfeuers vor dem Schafstall sprang über zu manch munterer Rede und Gegenrede.<br />
Am anderen Morgen. Sonntag. 25. September 1977, gab Bürgermeister W. Eschrich seinen Gästen<br />
noch einmal das Geleit auf der Eibuferstraße bis zum Kniepenberg, dem Gründungspunkt des<br />
Naturparks. Mit einem Blick auf die weite Landschaft des einstigen hannoverschen Amtes Neuhaus<br />
jenseits der Elbe verabschiedeten sich die Berliner. In Lauenburg auf den Höhen des anderen<br />
Eibufers hatte Bürgermeister Dieter Wollenberg seine Sonntagsruhe geopfert, um im Alten Schloß<br />
die Gäste über die bewegte Geschichte seiner Stadt und über deren heutige Probleme als Grenzort<br />
zu informieren. Letzter aktiver Teil der Studienfahrt war dann ein Besuch des Elbschiffahrtsmuseums<br />
mit einem Bummel durch die Unterstadt. Der harmonische Ablauf der Exkursion macht Mut, die<br />
Reihe dieser Ausflüge fortzusetzen. Mit dem Fahrtziel des Jahres 1978, der Stadt Goslar, werden schon<br />
eifrig Briefe gewechselt. H. C. Schultze-Berndl<br />
Am 16. Oktober 1977 ist die Serie „Die Unbeugsamen von der Spree" von Rainer Wagner in der<br />
„Berliner Morgenpost" vorläufig abgeschlossen worden. Sie soll - wegen der großen Resonanz<br />
bei der Leserschaft - 1978 wieder aufgenommen werden. Leider ist auch jene letzte Folge nicht<br />
frei von Unrichtigkeiten: Wilhelm Carstenn kam nicht als Adliger nach Berlin, sondern wurde<br />
erst nach seinen allzu großzügigen Geschenken an den Militärfiskus mit dem Titel „v. Carstenn-<br />
Lichterfelde" ausgezeichnet. Auch ging die von ihm gegründete Gesellschaft „Lichterfelder Bauverein"<br />
nicht im Jahre 1873 bankrott, sondern bestand noch 1890. freilich unter anderer Leitung.<br />
Das Schlößchen am Hindenburgdamm wurde zwar von Carstenn umgebaut und erweitert, ein Gutshaus<br />
bestand aber bereits zuvor.<br />
Es bleibt zu hoffen, daß bei einem Neubeginn der Serie die Sorgfalt erhöht wird, die ein Thema<br />
wie die Geschichte der Stadt Berlin es verdient.<br />
Die „Schriften" des Vereins<br />
... werden in den ersten Wochen des neuen Jahres mit dem Erscheinen von Band 61 fortgesetzt.<br />
Er enthält folgende zwei Arbeiten:<br />
Wolfgang Ribbe: Quellen und Historiographie zur mittelalterlichen Geschichte von<br />
Berlin-Brandenburg<br />
Konrad Kettig: Goetheverehrung in Berlin. Ein Besuch von August und Ottilie<br />
v. Goethe in der preußischen Residenz 1819<br />
Insgesamt 132 Seiten mit 34 Abbildungen.<br />
Die Mitglieder erhalten den Band nach Erscheinen zugesandt, soweit der fällige Mitgliedsbeitrag für<br />
das Jahr 1977 entrichtet worden ist. Der Verkaufspreis beträgt 16,80 DM zuziigl. Porto.<br />
394
Von unseren Mitgliedern<br />
Walter Schneider-Römheld f<br />
Am 3. November 1977 verstarb unser langjähriges Mitglied Walter Schneider-Römheld. Der am<br />
5. Juni 1904 in Frankfurt am Main geborene Hesse, der im vierten Lebensjahr mit seinen Eltern<br />
nach Berlin übergesiedelt war, hat seit 1953 als Vorsitzender entscheidend das Profil des Heimatvereins<br />
Steglitz, dem er schon mit achtzehn Jahren als Mitglied und bereits vierundzwanzig Monate<br />
später als Geschäftsführer angehört hatte, geprägt. Seine persönliche Freundschaft mit dem Lichterfelder<br />
Direktor Eugen Marschner bescherte dem Heimatverein das eigene Haus in der Drakestraße<br />
64 a, in dem zielbewußt das Heimatarchiv, das bis dahin an allen möglichen Orten ein unwürdiges<br />
Lagerdasein geführt hatte, aufgebaut werden konnte. Zum Gedenken an Lucie Marschner<br />
ließ Walter Schneider-Römheld das berühmte PAbaye-Essen für jeweils fünfzig sozial schwächere<br />
Kulturschaffende Berlins Wiederaufleben. Hierin wird besonders deutlich, wie weit dieser Vorsitzende<br />
das Aufgabengebiet des Heimatvereins gefaßt hatte und wie dessen Wirken in die Gegenwart und<br />
in das Heute durch Impulse und Reflexe auch über den Steglitzer Bereich hinaus zu gestalten wußte.<br />
Schon in den zwanziger Jahren hatte er heimatkundliche Führungen aufgenommen, die er auch<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg beibehalten und durch allmonatliche kunst- und kulturgeschichtliche<br />
Studienfahrten nach Westdeutschland ergänzt hatte. Auf die Liebe zur Heimat gründete sich ebenfalls<br />
sein berufliches Schaffen, wie die von ihm produzierten Kulturfilme „Sanssouci", „Das klassische<br />
Berlin" oder „Brandenburg" beweisen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Dokumentation<br />
über die jüdische Gemeinde Berlins zu einem seiner bedeutendsten Streifen. Zu den Internationalen<br />
Filmfestspielen Berlin 1951 war seine schnell vergriffene Broschüre „Steglitz und der deutsche<br />
Film" mit vielen interessanten Einzelheiten aus dessen Anfängen erschienen. Nicht nur der Heimatverein,<br />
auch der Bezirk Steglitz verliert mit ihm eine kunst- und kulturinteressierte, um die Erforschung<br />
der Heimatgeschichte verdiente Persönlichkeit.<br />
*<br />
Die erstmals 1872 verliehene und 1972 wieder erneuerte „Fidicin-Medaille für Förderung der<br />
Vereinszwecke" wurde vom Vorsitzenden Prof. Hoffmann-Axthelm anläßlich der Weihnachtsfeier<br />
1977 an drei besonders verdiente Vereinsmitglieder überreicht: Herrn Dr. Hans Günter Schultze-<br />
Berndt als Schriftführer seit nunmehr zehn Jahren, Frau Ruth Koepke als vorbildlicher Schatzmeisterin<br />
und Herrn Karlheinz Grave, der seit 17 Jahren den Wiederaufbau unserer Vereinsbibliothek<br />
betreut.<br />
*<br />
Unser Mitglied, Frau Kate Haack, wurde vom Orden „Sankt Ortunat" mit der Medaille „Recherche<br />
de la Qualite" ausgezeichnet. Diese Vereinigung hat das Ziel, Menschen in aller Welt das Leben<br />
lebenswert zu machen. Genau wie der gleichzeitig geehrte Gustav Knuth hat Käte Haack die<br />
Auszeichnung als Repräsentant vornehmer Eßkultur erhalten.<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche<br />
zum 70. Geburtstag Herrn Walter Preuß, Frau Lieselotte Amberger, Herrn Horst Gronau, Frau<br />
Erna Rosenberger, Frau Marga Schwarz; zum 75. Geburtstag Herrn Hans Müller. Herrn Otto<br />
Penneckendorf, Frau Elfriede Jarchow, Herrn Hans Hoppe, Herrn Günther Schwenn; zum 85. Geburtstag<br />
Frau Käthe Supke, Herrn Friedrich Pausin.<br />
395
Buchbesprechungen<br />
Robert Springer: Berlin. Ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebungen. Leipzig: J. J. Weber 1861.<br />
Faksimile-Ausgabe Bremen: Schünemann 1976. XII, 418 S., 110 Abb. im Text u. 2 Faltpläne, geb.,<br />
36 DM.<br />
Das Dreigespann Friedrich Nicolai - Samuel Spiker - Robert Springer markiert in der Berlinliteratur<br />
jenen Typus der Stadtbeschreibung, der über die historische Aktualität hinaus auch einen künstlerischen<br />
Wert beanspruchen darf. Die Ausgaben entwickelten sich rasch zu bibliophilen Raritäten;<br />
Zeugen dieser Beliebtheit - heute wie vor 50 Jahren - sind die Nachdrucke, die uns in Wort und Bild<br />
das heile, unzerstörte und jetzt weitgehend untergegangene Berlin noch einmal vorführen. Besonders<br />
der Letztgenannte kann als Experte solcher über den bloßen Sachweiser hinausgehender (und das<br />
„Innenleben" gebührend berücksichtigender) Stadttopographien gelten. Springer (1816—1885) war<br />
ursprünglich Lehrer, wurde dann freier Schriftsteller und Verfasser von historischen Romanen,<br />
Jugendschriften, Kunst- und Literaturfeuilletons und brachte auch einige „Kultur"führer über die<br />
preußische Metropole heraus. Bleibenden Ruhm erlangte er mit dem großen Ansichtenwerk ..Berlin<br />
die deutsche Kaiserstadf, vor genau 100 Jahren erstmals erschienen, dessen „photographisch treue"'<br />
Stahlstiche sowie der Text eine Kompilation früherer Arbeiten darstellen. Zu diesen gehört auch der<br />
Stadtführer von 1861. der jetzt in einer ansprechenden Faksimileausgabe vorgelegt wurde.<br />
Springer beschreibt „die sich wunderbar vergrößernde und zu einer Weltstadt gestaltende Residenz"<br />
auf der Grundlage eigener Anschauung, und dieser subjektive Habitus, oft zeitkritisch bis satirisch<br />
durchsetzt, ist bei der Darstellung eines so vielschichtigen Gebildes nicht ohne Reiz. Die geschichtliche<br />
Retrospektive ist notgedrungen knapp und verzichtet auf die Fischerdorf-Legende (im Gegensatz zur<br />
„Kaiserstadf 1877/1883). Um so ausführlicher ist der Stadtrundgang, der - damals wie heute - am<br />
Brandenburger Tor beginnt und bis in die letzte Butike mit ihren „wundersam gemischten Gerüchen"<br />
führt. Schlösser und Gärten, Museen, Denkmäler, Institute und Ministerien werden ebenso beschrieben<br />
wie das Interieur von Gerson's Bazar am Werderschen Markt oder die Raufereien beim Bockbierfest.<br />
Erstaunt liest man von der Schnelligkeit der neu organisierten Feuerwehr und von den 122<br />
Briefkästen in der Stadt, die stündlich (!) geleert wurden, doch alle Wehmut ist verflogen bei der<br />
Nachricht, daß zur Aufgabe einer telegraphischen Depesche „zwei glaubwürdige Zeugen" beizubringen<br />
waren und daß Zahnärzte „nur für die wohlhabende Klasse" existierten. Überhaupt stellt die<br />
Trennung der Stände und Klassen innerhalb der Berliner Bevölkerung für den Autor noch ein großes<br />
Problem dar, das er mit Sarkasmen überspielt. Die isolierte Stellung des Bürgertums sei äußerlich<br />
erst durch die Errichtung der Eisenbahnen, innerlich aber durch die - Einfuhr des bairischen Bieres<br />
gebessert worden. Ob gärungstechnisches Phänomen, ob Konzilianz gegenüber den Erzeugnissen<br />
unserer süddeutschen Stammesbrüder : Lassen wir es stehen als Pointe in einem ebenso grundsoliden<br />
wie ergötzlichen Buch, dem viele nur scheinbar unbekannte Seiten unserer Altvorderen an der Spree<br />
zu entlocken sind. Peter Letkemann<br />
Walter Artelt und Edith Heischkel-Artelt (Hrsg.): Christian IMentzel und der Hof des Großen Kurfürsten<br />
als Mittelpunkt weltweiter Forschung. Hildesheim: Georg Olms Verlag 1976. 176 S., brosch..<br />
50 - DM.<br />
Am 24. und 25. Juni 1975 fand in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz<br />
unter der Leitung unseres im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedes Walter Artelt ein Symposium<br />
statt, dessen Vorträge nun als Doppelheft des Medizinhistorischen Journals und als separate Veröffentlichung<br />
vorliegen.<br />
Walter Artelt hatte sich schon vor mehr als 40 Jahren zum ersten Mal mit der Person des brandenburgischen<br />
Leibarztes Christian Mentzel befaßt. In seinem einführenden Bericht schildert er die Rolle,<br />
die dieser in Berlin spielte, und geht auf die Forschungen zu dessen so unterschiedlichen Werk ein.<br />
das Medizinisches und Botanisches ebenso umfaßt wie Studien zur Chemie und zur chinesischen<br />
Sprache. Letzten Anstoß zu dem Symposium gab die Ausstellung „China in Europa", die von Septem-<br />
396
er bis November 1973 im Schloß Charlottenburg stattfand und die zeigte, wieviele Wissenschaftler sich<br />
mit Christian Mentzel beschäftigten und von welch verschiedenen Seiten aus man an die Probleme<br />
heranging.<br />
Von dieser Vielfalt ist auch der vorliegende Band geprägt. Der Kunsthistoriker Enrico Schaeffer<br />
(Sao Paulo) untersucht in seinem Beitrag „Die Ausbeute der Brasilien-Expedition von Johann Moritz<br />
von Nassau und ihr Niederschlag in Kunst und Wissenschaft" die Bilder, die Albert Eckhout,<br />
Zacharias Wagener und Frans Post in Brasilien malten, deren Schicksale und die Rolle, die Christian<br />
Mentzel bei der Ordnung der 1460 im Besitz des Großen Kurfürsten befindlichen Blätter gespielt hat.<br />
Lieselotte Wiesinger (Berlin) weist in ihren Untersuchungen „Erhaltene Abbildungen verschollener<br />
Zeichnungen des 17. Jahrhunderts aus Brasilien" des „Theatrum rerum naturalium Brasiliense" - so<br />
der Titel der von Mentzel in 4 Bänden zusammengefaßten brasilianischen Gemälde - und weiterer<br />
Handschriften von der Expedition nach Brasilien, die erhaltenen Abbildungen der seit dem Krieg<br />
verschollenen Handschriften nach. Ob unter den vor kurzem in Polen gefundenen Beständen, die im<br />
Krieg von Berlin nach Kloster Grüssau ausgelagert waren, auch die hier besprochenen Handschriften<br />
sind, ist ungewiß.<br />
Der niederländische Medizinhistoriker Daniel de Moulin umreißt in seinem Artikel „Medizin und<br />
Naturwissenschaft in Brasilien zur Zeit der Verwaltung des Grafen Johann Moritz von Nassau-<br />
Siegen" den Stand der Heilkunde im 17. Jahrhundert in Südamerika und die Verbindungen von dort<br />
zu Europa. Madeleine Jarry (Paris) den Einfluß, den die Zeichnungen aus Übersee auf die Gestaltung<br />
der Wandteppiche hatten: „L'Exotisme au temps de Louis XIV: Tapisseries des Gobelins et de<br />
Beauvais." Am Ende ihres Artikels geht sie auch auf den Einfluß ein, der sich aus dem fernen<br />
Osten, aus China, bemerkbar machte. Der Beziehung Christian Mentzels zum fernen Osten gelten<br />
auch die beiden folgenden Beiträge. Der Medizinalhistoriker Rolf Winau. jetzt in Berlin, stellt in seinem<br />
Beitrag aus „Christian Mentzel. die Leopoldina und der ferne Osten" Mentzels besondere Bedeutung<br />
für die Vermittlung wissenschaftlicher Kenntnisse aus Amboina, Japan und China heraus.<br />
Mentzel sorgte nicht nur dafür, daß von einer Reihe von befreundeten Männern in fernen Osten Nachrichten<br />
nach Europa kamen, er sorgte auch für deren Veröffentlichung im Rahmen der Akademie<br />
der Naturforscher Leopoldina. Eva Kraft, Sinologin an der Staatsbibliothek, zeigt in ihrem Aufsatz<br />
„Frühe chinesische Studien in Berlin", daß Berlin mit Andreas Müller und Christian Mentzel ein<br />
frühes Zentrum der Chinaforschung in Europa war. Es gelingt ihr aufgrund eingehender Archivstudien,<br />
ein umfassendes Bild der Sinologie des 17. Jahrhunderts zu entwerfen. Die beiden letzten Beiträge<br />
beschäftigen sich mit Johann Kunckel und den von ihm hergestellten Rubingläsern. H. Günter Rau<br />
berichtet über seine Ausgrabungen auf der Pfaueninsel, auf der Kunckels Laboratorium stand;<br />
Gerhard Schulze, Chemiker an der TU, über die chemische Untersuchung einiger Gläser aus diesem<br />
Laboratorium.<br />
Der Band gibt einen guten Einblick in Wissenschaft und Kultur am Hofe des Großen Kurfürsten.<br />
Er zeigt darüber hinaus, daß interdisziplinäre Forschung, wie sie zu Mentzels Zeit noch selbstverständlich<br />
war, notwendig ist. um das komplexe Bild einer Zeit entstehen zu lassen.<br />
Walter Hoff man- Axthelm<br />
Sichelschmidt, Gustav (Hrsg.): Berlin 1900. Die Reichshauptstadt in Holzstichen der Jahrhundertwende.<br />
Berlin: Rembrandt Verlag 1977. 64 S. 60 Abb. Leinen. 28,80 DM.<br />
Nach dem bereits in den „Mitteilungen". Jg. 72 (1976), H. 3, S. 197, von P. Letkemann besprochenen<br />
Bilderalbum „Berlin vor hundert Jahren" hat der Rembrandt Verlag einen weiteren Bildband mit Holzstichen<br />
aus der Zeit um die Jahrhundertwende herausgebracht. Die Abbildungen der durch die<br />
Fortschritte der Reproduktionsverfahren von Fotografien abgelösten Handwerkstechnik üben auf<br />
den Beschauer einen besonderen Reiz aus. der durch die Textwiedergabe teils bekannter, teils vergessener<br />
zeitgenössischer Berlin-Beschreibungen noch erhöht wird. Wie in dem ersten Band handelt<br />
es sich auch hier um eine gelungene Mischung von Architekturabbildungen und Szenen aus dem täglichen<br />
Leben - von der Speisung in einer Volksküche über ein Picknick im Grunewald bis zum Luxus<br />
im Kaufhaus Rudolph Hertzog.<br />
Durch die gute Papierwahl und einen vorzüglichen Druck dürfte dieser Band technisch seinen Vorgängern<br />
noch überlegen sein. Felix Escher<br />
397
Im IV. Vierteljahr 1977<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Rosemarie Armenat, Haushaltshilfe<br />
1000 Berlin 19, Kuno-Fischer-Straße 13<br />
Tel. 3 21 88 (14 (Alice Hamecher)<br />
Lothar Beckmann. Dipl.-Volkswirt<br />
1000 Berlin 37, Beerenstraße 18<br />
Tel. 8 01 73 68 (Brauer)<br />
Heinz Bischoff, Elektromeister<br />
1000 Berlin 42, Riegerzeile 8<br />
Tel. 7 06 89 99 (Brauer)<br />
Helga Bressani, Hausfrau<br />
3280 Bad Pyrmont, Seitenweg 21<br />
Tel. (0 52 81) 53 16 (Pfarrer Hahn)<br />
Heinz Dettmann. Beamter<br />
1000 Berlin 45, Bahnhofstraße 32<br />
Tel. 7 72 82 21 (Günter Schultz)<br />
Karl-Heinz Fischer, Dokumentator<br />
1000 Berlin 19, Königin-Elisabeth-Straße 20<br />
Tel. 3 02 12 37 (Jürgen Grothe)<br />
Ingrid Friedrich. Rentnerin<br />
1000 Berlin 20, Heerstraße 406<br />
Tel. 3 637124 (Brauer)<br />
Dr. Dr. Edith Heischkel-Artelt.<br />
o. em. Universitätsprof.<br />
6000 Frankfurt/Main, Adolf-Reichwein-Str. 24<br />
Tel. (06 11) 56 34 64 (Vorsitzender)<br />
Dr. Wolfgang Hofmann, Hochschullehrer<br />
1000 Berlin 33. Menzelstraße 4a<br />
Tel. 8 25 65 65 (Dr. Letkemann)<br />
Wolfgang Klempin. Rechtsanwalt und Notar<br />
1000 Berlin 33, lhnestraße 55<br />
Tel. 8 01 45 27 (RA Gerh. Asch)<br />
Robert Kullmann, Beamter<br />
1000 Berlin 19. Kaiserdamm 9<br />
Tel. 3 21 36 06 (Solmsdorf)<br />
Voranzeige einer Veranstaltung im IL Quartal 1978<br />
Joachim-Hans Raehmel, Industriekaufmann<br />
1000 Berlin 37. Sophie-Charlotte-Straße 33<br />
Tel. 8 13 82 86 (Brauer)<br />
Günter-Heinz Restel, Beamter<br />
1000 Berlin 44, Briesestraße 33<br />
Tel. 6 86 47 67 (Günter Schultz)<br />
Gerhard Roder, Chefdekorateur<br />
1000 Berlin 33, Auerbacher Straße 2<br />
Tel. 8 91 11 76 (Brauer)<br />
Michael Rudolph, Student paed.<br />
1000 Berlin 49, Bohnstedtstraße 20<br />
Tel. 7 46 36 82 (Bettina Kriewall)<br />
Erich Starick, Rentner<br />
1000 Berlin 47, Neuköllner Straße 310<br />
Tel. 66 54 82 (RA Gerh. Asch)<br />
Jürgen Stöber, Kaufm. Angestellter<br />
1000 Berlin 13, Schuckertdamm 332<br />
Tel. 3 81 88 84 (Walter Blenn)<br />
Dr. Johannes Stumm, Polizei-Präsident a. D.<br />
1000 Berlin 33, Menzelstraße 14<br />
Tel. 8 26 32 00 (Oschilewski/Brauer)<br />
Dr. Otto Uhlitz, Senatsdirektor a.D., RA<br />
1000 Berlin 19. Westendallee 71<br />
Tel. 3 21 62 72 (Dr. Letkemann)<br />
Gerda Vetter, Grafikerin<br />
1000 Berlin 42, Wolframstraße 39<br />
Tel. 7 53 20 22 (Brauer)<br />
Dr. Erika Widera, Oberstudienrätin a.D.<br />
1000 Berlin 41, Telramundweg 15<br />
Tel. 7 71 77 71 (RA Gerh. Asch)<br />
Klaus Wiedemann, Elektromechaniker<br />
6203 Hochheim, Flörsheimer Straße 24<br />
(Brauer)<br />
An den Sonnabenden 8. April. 15. April und 6. Mai 1978 besteht die Möglichkeit für jeweils 20 Personen,<br />
das Theodor-Fontane-Archiv in Potsdam zu besichtigen. Die Führung findet durch den Leiter<br />
des Archivs. Herrn Bibliotheksrat Joachim Schobeß, statt. Nach dem Mittagessen im Interhotel ist ein<br />
Spaziergang durch das Sanierungsgebiet am Brandenburger Tor zur Friedenskirche und zum Schloß<br />
Sanssouci vorgesehen.<br />
Schriftliche Anmeldung mit Angabe der genauen Teilnehmerzahl bis zum 1. März 1978 an:<br />
Herrn Joachim Schlenk, Potsdamer Straße 40,1000 Berlin 45.<br />
Die Anmeldung muß die genaue Anschrift, die Telefonnummer, den Hinweis der Anfahrt (Bus,<br />
eigener Pkw oder Mitfahrer bei. . .) und den gewünschten Termin (Ersatztermin angeben) enthalten.<br />
Die Teilnehmer an diesen Fahrten erhalten dann von Herrn Schlenk im Monat März eine Benachrichtigung<br />
mit genauen Informationen.<br />
398
Die Veröffentlichungen des Vereins<br />
Von den früheren Ausgaben des Jahrbuchs<br />
DER BÄR VON BERLIN<br />
sind folgende Bände noch erhältlich:<br />
1953, 1957/58 und 1960 je 4,80 DM; 1961 bis 1964 je 5,80 DM; 1965 (Festschrift)<br />
38,- DM; 1968 und 1969 je 9,80 DM; 1971 und 1972 je 11,80 DM;<br />
1973 bis 1975 je 12,80 DM; 1976 und 1977 je 18,50 DM.<br />
MITTEILUNGEN<br />
des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
erscheinen vierteljährlich im Umfang von 32 Seiten. Sie enthalten in der<br />
Regel mehrere Artikel mit Themen zur Berliner Geschichte (mit Abbildungen),<br />
Nachrichten zu aktuellen Anlässen und aus dem Vereinsleben,<br />
Buchbesprechungen und das Programm der laufenden Veranstaltungen<br />
des Vereins.<br />
Einzelhefte aus früheren Jahrgängen sind zum Stückpreis von 4,- DM<br />
noch erhältlich.<br />
Von der neuen Folge der<br />
Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
sind bisher erschienen:<br />
Heft 59: Johann David Müller, Notizen aus meinem Leben (1973)<br />
Preis 9,80 DM<br />
Heft 60: W. M. Frhr. v. Bissing, Königin Elisabeth von Preußen. (1974)<br />
Preis 11,80 DM<br />
Heft61: Wolfgang Ribbe, Quellen und Historiographie zur mittelalterlichen<br />
Geschichte von Berlin-Brandenburg. (1977)<br />
Konrad Kettig, Goetheverehrung in Berlin. Ein Besuch von<br />
August und Ottilie von Goethe in der preußischen Residenz1819.<br />
(1977) Preis 16,80 DM<br />
Alle Preise zuzüglich Porto<br />
Bestellungen sind an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten:<br />
Albert Brauer. Blissestraße 27,1000 Berlin 31
Veranstaltungen im I. Quartal 1978<br />
1. Dienstag. 17. Januar 1978, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Günter Wollschlaeger<br />
als Einführung für die Besichtigung des Märkischen Museums: „Zur Geschichte<br />
des Märkischen Museums*'. Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
2. Sonnabend. 21. Januar 1978, 10 Uhr: Besichtigung des Märkischen Museums. Am<br />
Köllnischen Park 5. Nähe S-Bahnhof Jannowitzbrücke. Führung durch Herrn Direktor<br />
Dipl.-Phil. Herbert Hampe.<br />
(Antrag auf Gewährung eines Berechtigungsscheines für Berlin, Übergang Friedrichstraße<br />
für Fußgänger, in einem Büro für Besuchs- und Reiseangelegenheiten bis zum<br />
16. Januar 1978 stellen.)<br />
3. Sonnabend. 4. Februar 1978, 10 Uhr: Wanderung durch den Winterwald in den Hellen<br />
Bergen in Gatow. Leitung: Forstoberinspektor Hans-Joachim Gillmeister. Treffpunkt:<br />
Bushaltestelle Breitehornweg, Busse: 34 und 35.<br />
4. Dienstag, 14. Februar 1978, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Dr. Gerhard<br />
Kutzsch: „Berlin vor 50 Jahren." Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
5. Freitag, 17. Februar 1978, 18 Uhr: Traditionelles Eisbeinessen anläßlich des 113. Jahrestages<br />
der Gründung unseres Vereins. Restaurant der Hochschul-Brauerei, 1000 Berlin<br />
65, Amrumer Straße 31, Ecke Seestraße. (U-Bahnhof Amrumer Straße, Busse 16,<br />
64,65,89.)<br />
6. Dienstag, 7. März 1978, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Arturo Walb: „Das<br />
Eisen im Berliner Stadtbild." Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
7. Dienstag, 14. März 1978, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Heinz Rütz: „Steinerne<br />
Zeugen auf Berliner Friedhöfen - Ein Stück Kunst- und Kulturgeschichte Berlins."<br />
Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek ist<br />
zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen geselliges<br />
Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 27. Januar, 24. Februar und 31. März 1978 zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
ab 17 Uhr.<br />
Bitte beachten Sie auch die Voranzeige auf Seite 398.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1000 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27. Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1000 Berlin 65, Seestraße<br />
13, Ruf 45 30 11. Schatzmeister: Ruth Koepke, 1000 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1000 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank, 1000 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1000 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung Claus P. Mader. 1000 Berlin 4L Bismarckstraße 12; Felix Escher.<br />
Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt. Bezugspreis für Nichtmitglieder 16 DM<br />
jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1000Berlin49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
400
~ICCL&ÖT üariin »s ^tu^wtwuvu'icK<br />
A 20 377 F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS^<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
74. Jahrgang Heft 2 April 1978<br />
Nach der Radierung<br />
von Otto Sager<br />
401
Gustav Stresemann 1878-1929<br />
Zum Gedenken an seinen hundertsten Geburtstag am 10. Mai 1978<br />
Von Prof. Dr. Michael Erbe<br />
Stresemann ist der einzige unter den Großen der deutschen Politik, die nicht nur in Berlin<br />
gewirkt haben, sondern auch in Berlin geboren worden sind, ja mehr noch: insofern „echte"<br />
Berliner waren, als sie einer alteingesessenen Berliner Familie entstammten.<br />
Gustav Stresemann wurde am 10. Mai 1878 im Mietshaus Köpenicker Straße Nr. 66 (Ecke<br />
Brückenstraße) - also im heutigen Bezirk Mitte - geboren. Er war das jüngste Kind des<br />
Bierwirtschaftsbesitzers Ernst Stresemann, der außerdem mit Weißbier handelte, und von<br />
dessen früh verstorbenen Frau Mathilde. Die „unfeine" Abkunft ist ihm von Honoratiorenkreisen<br />
später nicht selten vorgehalten worden, wobei man nicht ohne Ironie das Thema<br />
seiner Dissertation über die Entwicklung des Flaschenbierhandels in Berlin glossierte.<br />
Heute würde man ihn eher anerkennend als Selfmademan aus dem unteren Mittelstand<br />
bezeichnen.<br />
Wichtig für die Formung seiner politischen Ansichten war vor allem die liberale Tradition<br />
des Elternhauses. Der Großvater Stresemanns hatte 1848 aktiv an der Revolution in<br />
Berlin mitgewirkt, und auch der Vater dachte eher linksliberal und war ein Anhänger<br />
Eugen Richters. Wenn Gustav Stresemann auf dem Gipfel seiner politischen Laufbahn mit<br />
seiner eigenen Partei in Konflikt geriet, so spielen dabei sicherlich auch Vorstellungen mit,<br />
die sich im Elternhaus ausgeprägt haben, auch wenn seine lange Zeit ausgesprochen<br />
nationalliberale Orientierung diese über Jahre hinweg zu verdecken schien.<br />
Da der junge Gustav früh eine ungewöhnliche Begabung erkennen ließ, war der Vater<br />
gewillt, ihm eine bessere Schulbildung angedeihen zu lassen, als in seinen Kreisen sonst<br />
üblich war. Die nahe gelegenen Gymnasien, das Köllnische und das Leibniz-Gymnasium<br />
(in der Inselstraße bzw. am Mariannenplatz), waren allerdings überfüllt, und so wurde der<br />
junge Stresemann schließlich auf das Andreas-Realgymnasium in der Koeppenstraße<br />
geschickt, das etwas weiter entfernt lag, aber doch über die Schillingbrücke und am Schlesischen<br />
Bahnhof vorbei verhältnismäßig rasch zu erreichen war, wenn man die Lange Straße<br />
kreuzte und zum Grünen Weg (jetzt Singerstraße) hin lief. Hier legte Stresemann 1897<br />
zusammen mit sechs Klassenkameraden das Abitur ab.<br />
In seinem Abiturientenlebenslauf schreibt er, daß er nach dem Abschluß der Schulzeit „in<br />
erster Linie Literatur und Geschichte, in zweiter Philosophie und Nationalökonomie<br />
studieren" wollte 1 . Trotz ausgesprochener Vorliebe für die Geschichte und obwohl seine<br />
Lehrer durchaus damit rechneten, ihn in nicht allzuferner Zukunft als Kollegen begrüßen<br />
zu können, wandte sich Stresemann allerdings bald der Nationalökonomie zu. Die Anregungen<br />
dazu mögen neben dem in der Familie herrschenden praktischen Sinn die bedeutenden<br />
Vertreter dieses Faches gegeben haben, die damals an der Berliner Universität<br />
lehrten: Gustav Schmoller (1838- 1917), Adolph Wagner (1835-1917) und Ignaz Jastrow<br />
(1856 — 1937), wobei eine Gelehrtenpersönlichkeit wie Schmoller leicht den Weg von der<br />
Historie zur Volkswirtschaft - und umgekehrt - zu weisen vermochte. Unmittelbaer scheint<br />
Stresemann indessen in dieser Hinsicht durch einen „alten Herrn" seiner Burschenschaft<br />
„Neo-Germania" beeinflußt worden zu sein, der in der Wirtschaft tätig war. Die Burschenschaft<br />
„Neo-Germania" hat den Studenten überhaupt stark mitgeprägt. Sie gehörte<br />
402
zu jener Richtung der deutschen Burschenschaften, die sich dem langsam üblich werdenden<br />
antisemitischen Kurs und dem Überbetonen von Äußerlichkeiten wie Kneipabenden<br />
und Mensurenschlagen nicht anschloß, die diese studentische Bewegung allmählich zur<br />
Karikatur ihres einstigen Selbst entarten ließen. Stresemann wurde im zweiten Semester<br />
zum Sprecher seiner Burschenschaft gewählt und setzte u.a. durch, daß 1898 anläßlich der<br />
50-Jahr-Feier zu Ehren der Märzgefallenen eine Abordnung der „Neo-Germania" an den<br />
Gräbern der „Achtundvierziger'" im Friedrichshain einen Kranz niederlegte.<br />
Sein Studium hat Stresemann indessen nicht an der Friedrich-Wilhelms-Universität beendet,<br />
sondern in Leipzig bei dem bedeutenden Nationalökonomen Karl Bücher (1847 bis<br />
1930). Auch bei der Hinwendung zu diesem Lehrer dürfte dessen Offenheit für die Historie<br />
eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. Bücher lenkte seine Studien auf Probleme des<br />
Mittelstandsgewerbes, für die Stresemann seine Berliner Lebenserfahrungen verwerten<br />
konnte. Neben der Doktorarbeit über den Flaschenbierhandel entstand so ein Aufsatz über<br />
Entstehung, Entwicklung und Bedeutung von Warenhäusern, die Bücher in die von ihm<br />
herausgegebene Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft veröffentlichte 2 .<br />
Der frischgebackene Doktor der Nationalökonomie hatte das Glück, bereits 1901 eine<br />
Stellung als Assistent in der Geschäftsleitung des „Verbandes Deutscher Schokoladenfabrikanten"<br />
zu finden. Organisatorisches Geschick und der planerische Weitblick eines<br />
geborenen „Managers" ließen ihn bald zum Promoter der Schaffung eines sächsischen<br />
Unternehmer-Dachverbandes werden, wobei er als Syndikus dieses „Verbandes Sächsischer<br />
Industrieller" in Dresden (1902 — 1918) und bald zugleich als Mitglied des Präsidiums<br />
des „Bundes der Industriellen" in Berlin rasch Karriere machte.<br />
Die Politik hatte ihn schon als Student angezogen, und mehr und mehr wandte er sich jetzt<br />
dem politischen Geschehen zu. Zunächst hatte er sich Friedrich Naumanns (1860—1919)<br />
Nationalsozialen Verein angeschlossen, folgte allerdings 1903 dem Anschluß an die Freisinnigen<br />
nicht 3 . Sein durchaus vorhandener Instinkt für die echten Machtverhältnisse<br />
brachte ihn bald zu den in Sachsen nicht einflußlosen Nationalliberalen, rhetorische Begabung<br />
und Verhandlungsgeschick ließen ihn rasch in die Spitze dieser Partei aufsteigen.<br />
1906 war er Stadtverordneter in Dresden, dann folgte eine steile, nur kurz von 1912 bis<br />
1914 unterbrochene Karriere als Reichstagsabgeordneter (1906 — 1912 und 1914 bis<br />
1918), wo er bald nach dem Ausbruch des ersten Weltkrieges zum zweiten Mann der<br />
nationalliberalen Fraktion nach dem Parteiführer Ernst Bassermann (1854—1917) aufrückte,<br />
dessen Nachfolger er 1917 wurde. In den Kriegsjahren hat Stresemann allerdings<br />
eine politische Richtung verfolgt, die seiner Politik als Reichskanzler und Reichsaußenminister<br />
ab 1923 diametral entgegengesetzt war und das Verständnis seiner Persönlichkeit<br />
dem Historiker bis heute zu einem schweren Problem macht. Denn Stresemann war im<br />
ersten Weltkrieg einer der Wortführer einer alldeutsch orientierten Siegfriedenspolitik und<br />
Verfechter weitgehender Annexionen zu Lasten der Feindmächte, einer der Hauptbefürworter<br />
des unbeschränkten U-Boot-Krieges und einer derjenigen, die den Sturz des<br />
Reichskanzlers Bethmann-Hollweg betrieben, durch den die unheilvolle Richtung der<br />
Politik des wilhelminischen Reiches unwiderruflich festgeschrieben wurde.<br />
Die Umorientierung fiel nach der Niederlage um so schwerer, und sie ist erst unter der<br />
Bürde der Verantwortung, die 1923 die Reichskanzlerschaft mit sich brachte, endgültig<br />
vollzogen worden. Die Vereinigung der Nationalliberalen und der Fortschrittlichen Volkspartei<br />
zu einer großen liberalen Partei, nach der Spaltung des deutschen Liberalismus im<br />
Jahre 1866 gewissermaßen eine WiderVereinigung, die das Geschick der Weimarer<br />
403
Republik vielleicht hätte positiv beeinflussen können, scheiterte im Dezember 1918 mit<br />
daran, daß man den rechtslastigen Stresemann weder ganz aus allen Parteifunktionen ausschalten,<br />
noch ihn seitens der Linksliberalen mit einem einflußreichen Amt betrauen<br />
wollte. Neben der Deutschen Demokratischen Partei, der Partei Naumanns, Max Webers,<br />
Ernst Troeltschs und Hugo Preuß', entstand so im wesentlichen als Interessenvertretung der<br />
deutschen Großindustrie die Deutsche Volkspartei, deren Führer Stresemann bis zu seinem<br />
Tode war, obgleich es ihm nach 1923 zunehmend schwerer fiel, sie auf der Linie seiner<br />
inzwischen völlig gewandelten politischen Einstellung zu halten. Seit 1903 war Stresemann<br />
mit der Tochter einer wohlhabenden Berliner Bürgerfamilie, Käte Kleefeld, verheiratet, die<br />
der Rassenfanatismus des NS-Regimes zur Emigration nötigte (aus dieser Ehe stammt der<br />
seit langem als Intendant der Berliner Philharmoniker tätige Wolfgang Stresemann). Die<br />
Familie bewohnte seit 1907 eine Wohnung in der Tauentzienstraße 12 a in Charlottenburg<br />
nahe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (das Grundstück ist Teil des Areals, auf dem<br />
sich jetzt das Europa-Center erhebt). Später wohnte sie im Gebäude des Auswärtigen<br />
Amtes in der Wilhelmstraße.<br />
Stresemanns nur hunderttägige Amtszeit als Reichskanzler vom August bis zum November<br />
1923 kennzeichnet mit der bedingungslosen Aufgabe des Ruhrkampfes, der Reichsexekution<br />
gegen verschiedene Länder, der Überwindung des Hitlerputsches in München<br />
und der Stabilisierung der Reichsmark die Wende zu den „besseren Jahren" der Weimarer<br />
Republik. Sein Name ist aber vor allem verknüpft mit der Neuorientierung der deutschen<br />
Außenpolitik, die sich bereits während der Amtszeit des im Juni 1922 ermordeten Außenministers<br />
Walther Rathenau abzeichnete, nämlich der Politik des Eingehens auf die Forderungen<br />
der Siegermächte des Weltkrieges, vor allem Frankreichs, mit dem Ziel, auf der<br />
Grundlage eines auf diese Weise allmählich aufgebauten gegenseitigen Vertrauens eine<br />
möglichst weitgehende Revision der für Deutschland ungünstigen Bedingungen des<br />
Versailler Vertrages zu erreichen. Es ist dies eine Grundhaltung, die von einem anderen<br />
lange Zeit in Berlin wirkenden Staatsmann in den sechziger Jahren mit dem Schlagwort<br />
„Wandel durch Annäherung" umrissen wurde: beide Male erwuchs daraus eine Änderung<br />
der Außenpolitik, beide Male war diese Änderung heftig umstritten, schienen Erfolge sich<br />
nicht im erwarteten Maße einzustellen; beide Male aber auch sind die Träger dieser Politik<br />
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden - Stresemann erhielt ihn 1926 gemeinsam<br />
mit seinem französischen Amtskollegen Aristide Briand - eine Ehrung, die sonst keinem<br />
aktiven deutschen Politiker zuteil geworden ist.<br />
Die Etappen der Außenpolitik Stresemanns sind bekannt: Dawesplanabkommen 1924,<br />
Locarnoverträge mit Grenzgarantien 1925, Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund<br />
und Einräumung eines ständigen Sitzes im Völkerbundsrat 1926, Unterzeichnung des<br />
Kriegsächtungspaktes 1928, Youngplanabkommen 1929. Gewinn dieser Politik waren -<br />
wenigstens zeitweise — wirtschaftliche Stabilisierung, vorzeitige Räumung der besetzten<br />
Rheinlande, Regelung des Reparationsproblems zu wenigstens halbwegs erträglichen<br />
Bedingungen und Rückkehr Deutschlands in die Völkerfamilie, Orientierung nach<br />
„Westen", soweit dies damals möglich war und angesichts des im Vergleich zu heute ganz<br />
anders gearteten Verhältnisses zum östlichen Europa deutscherseits überhaupt gewünscht<br />
wurde. Die von Stresemann getragene deutsche Außenpolitik der zwanziger Jahre und die<br />
inzwischen zur Legende gewordene Offenheit der „Weltstadt" Berlin - das ja nur in den<br />
zwanziger Jahren wirklich diesen Titel beanspruchen konnte — stehen durchaus zueinander<br />
in einer Wechselbeziehung.<br />
404
Grabstätte auf dem<br />
Luisenstädtischen<br />
Friedhof<br />
Am Südstern<br />
(Foto: Ellen Brast,<br />
1978)<br />
Der Preis, den der Außenminister im Kampf um die Durchsetzung seiner Politik - selbst in<br />
der eigenen im Grunde immer „rechts" gebliebenen Partei — zahlte, war die völlige, vorzeitige<br />
Zerrüttung seiner Gesundheit. Die dauernde Überbeanspruchung seiner Arbeitskraft<br />
führte zum körperlichen Zusammenbruch und am 3. Oktober 1929 zum tödlichen<br />
Schlaganfall. Der Leitartikel der Abendausgabe der Vossischen Zeitung von diesem Tage<br />
trug neben der Überschrift „Ein großer Deutscher" den geradezu prophetischen Untertitel<br />
„Mehr als ein Verlust: ein Unglück". Es steckt eine tiefe Symbolik darin,<br />
daß im gleichen Monat der New Yorker Börsenkrach die Weltwirtschaftskrise einläutete,<br />
die die Weimarer Republik mit in den Untergang riß. Wie früh Stresemann dem politischen<br />
Leben entrissen wurde, zeigt die Tatsache, daß es nicht wenigen Männern seiner Generation<br />
vergönnt war, ihre Erfahrungen aus der Weimarer Zeit noch der jungen Bundesrepublik<br />
Deutschland zuteil werden zu lassen; ja, deren erster Kanzler und Außenminister<br />
war sogar zwei Jahre älter als Gustav Stresemann.<br />
Umstritten, wie er im Leben war, ist Stresemann auch unter den Historikern, die sich<br />
später mit ihm beschäftigt haben 4 . Die Stresemann-Forschung hat erst in den fünfziger<br />
Jahren eingesetzt, als bekannt wurde, welchen Umfang der Nachlaß besaß, der 1945 mit<br />
den Akten des Auswärtigen Amtes in die Hände der Amerikaner und Briten gefallen war.<br />
Von den über 300 Bänden mit über 10 000 beschriebenen Seiten, die sich jetzt im Archiv<br />
des Auswärtigen Amtes in Bonn-Bad Godesberg befinden, war zuvor nur ein Bruchteil<br />
publiziert worden 5 . Was bekannt war, lenkte den Blick vor allem auf die Westpolitik<br />
405
Stresemanns, und so war es kein Wunder, daß er als Vater der westorientierten Politik<br />
der Bundesrepublik in den fünfziger Jahren interpretiert und mit Briand sogar zum Vorkämpfer<br />
des Europa-Gedankens emporstilisiert wurde 6 . Als eine genauere Durchsicht der<br />
Akten ergab, daß Stresemann auch nach Osten, so mit Moskau, politisch aktiv geworden<br />
war und er — scheinbar zynisch — des öfteren betont hatte, es gehe ihm in erster Linie um<br />
die Wiedererlangung von Deutschlands Großmachtstellung, wurde dagegen das Bild des<br />
nationalistischen Revisionisten und Opportunisten, der seine Haltung im Weltkrieg nie<br />
aufgegeben habe, gezeichnet 7 . Daß wir bis heute über keine wissenschaftlichen Anforderungen<br />
genügende biographische Gesamtdarstellung verfügen und eine solche wohl auch<br />
das Stresemann-Jahr 1978 nicht bringen wird, liegt einmal an der Quellenlage und zum<br />
anderen an dem bis heute nicht überwundenen Widerstreit der Historiker.<br />
Im Grunde aber muß man beiden „Parteien" unter den Zeitgeschichtsforschern vorwerfen,<br />
daß sie Stresemann lange zu wenig aus seiner Zeit heraus verstanden haben. Die zwanziger<br />
Jahre waren für eine Verbreitung des Europa-Gedankens nach 1950 noch nicht reif, und<br />
selbst die Europa-Idee ist ja seit de Gaulle einem Wandel unterworfen worden. Stresemanns<br />
Ziel war eingestandenermaßen die Revision von Versailles und die Wiederherstellung der<br />
deutschen Großmacht. Aber dieses Ziel sollte mit friedlichen Mitteln und mit Hilfe einer<br />
Politik geduldigen Abwartens und Verhandeins erreicht werden, einer Politik, die erst im<br />
Verlauf der späten dreißiger Jahre hätte Früchte tragen können. Eine so ins Spiel der<br />
europäischen Politik wiedereingepaßte Großmacht Deutschland hätte - angesichts des sich<br />
abzeichnenden Übergewichts der Supermächte — gemeinsam mit den anderen europäischen<br />
Mächten später ein - wie immer - geeintes Europa zur gegebenen Zeit aufbauen können,<br />
ja wohl auch müssen. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß die Welt heute anders aussähe,<br />
wäre Stresemanns Politik weiterverfolgt worden. Vor allem wäre seiner Heimatstadt<br />
das bittere Schicksal erspart geblieben, das ihr die Jahre 1933 bis 1945, 1948/49, 1953 und<br />
1961 gebracht haben.<br />
Anschrift des Verfassers: Ringstraße 23, 1000 Berlin 28<br />
1 Gustav Stresemann: Schriften, hrsg. v. Arnold Harttung, Berlin 1976, S. 1 —10, vgl. S. 8.<br />
2 Die Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschäfts. Eine wirtschaftliche Studie, Berlin 1900<br />
(zugleich phil. Diss. Leipzig 1900). Die Warenhäuser, ihre Entstehung, Entwicklung und volkswirtschaftliche<br />
Bedeutung, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 56 (1900), S. 696 — 733.<br />
3 Dieses Aufsagen der Gefolgschaft mag letztlich der Grund für die recht negative Beurteilung<br />
Stresemanns durch einen großen „Wahlberliner", nämlich Theodor Heuss, sein; vgl. dessen „Erinnerungen<br />
1905-1933", Ausgabe Frankfurt/M. 1965, S. 182 ff.<br />
4 Zur Stresemann-Literatur Gerhard Zwoch: Gustav-Stresemann-Bibliographie, Düsseldorf 1953<br />
und Martin Walsdorff: Bibliographie Gustav Stresemann, Düsseldorf 1972; außerdem Karl Dietrich<br />
Erdmann in Gebhardt-Grundmann: Handbuch der deutschen Geschichte, 9. April, Bd. 4/1,<br />
Stuttgart 1973, S. 247.<br />
5 Vor allem: Gustav Stresemann: Vermächtnis. Der Nachlaß in drei Bänden, hrsg. v. Henry Bernhard,<br />
Wolfgang Goetz und Paul Wiegler, Berlin 1932—1933. Zum Problem dieser Auswahl u.a.<br />
Edward H. Carr: Was ist Geschichte?, Stuttgart 1963, S. 16-19.<br />
6 Besonders deutlich bei Martin Göhring: Stresemann. Mensch - Staatsmann - Europäer, Wiesbaden<br />
1956.<br />
7 So in verschiedenen Aufsätzen besonders Hans W. Gatzke und Anneliese Thimme; vgl. deren Buch:<br />
Gustav Stresemann. Eine politische Biographie zur Geschichte der Weimarer Republik, Hannover<br />
1957.<br />
406
Herman Grimm zum 150. Geburtstag<br />
6. Januar 1828 bis 16. Juni 1901<br />
Von Hans Joachim Mey<br />
Einst Repräsentant des klassisch-romantischen Deutschlands, nach der Gründung des<br />
Reiches oft berufener Zeuge des Geistes von Weimar, überkommt uns Heutige bei der<br />
Erinnerung an den Sohn Wilhelm Grimms und den Neffen Jacobs ein Gefühl der Überraschung<br />
und Verwunderung. Dennoch: Persönlichkeit und Wirken dieses Mannes haben<br />
ihre Spuren im geistigen Leben dieser Stadt und weit über sie hinaus hinterlassen. Das in<br />
frühen Mannesjahren entstandene Hauptwerk seiner kunsthistorischen Forschungstätigkeit,<br />
„Das Leben Michelangelos", legt hiervon Zeugnis ab, Zeugnis von einer außerordentlichen<br />
künstlerischen und historiographischen Begabung. In seiner Frische und<br />
Unmittelbarkeit zieht es noch heute den Leser in seinen Bann und bestätigt damit jenes<br />
Urteil, das noch in unserem Jahrhundert ausgesprochen wurde: „Genial!"<br />
Das stille, in sich ruhende, in seiner Ausstrahlung so unverwechselbare Elternhaus, das<br />
dennoch von den politischen Entwicklungen und Wechselfällen des Vormärz keineswegs<br />
unberührt blieb, wurde für den äußeren und inneren Weg Herman Grimms bestimmend.<br />
Mit dem Erwachen des ersten, die Grenzen des häuslichen Umkreises überschreitenden<br />
Bewußtseins des Knaben, traf den Vater und Onkel mit den Göttinger Freunden und<br />
Kollegen das Los der Landesverweisung, das Schicksal der „Göttinger Sieben". In einem<br />
sehr späten Rückblick auf jene Jahre sagt Herman Grimm: „Dieses Ereignis hatte seiner<br />
Zeit eine Bedeutung, für die heute das Verständnis schwer ist. Organisierte politische<br />
Parteien im heutigen Sinne existierten damals nicht, sondern die Eidesverweigerung der<br />
Sieben dem neuen Könige von Hannover gegenüber war eine rein menschliche Handlung,<br />
zu der Jedermann aus seinem innersten nationalen Gefühl heraus Stellung nahm. Unser<br />
Haus wurde seitdem von Vielen besucht, die das Wohl des in unbestimmter Zukunft eintretenden<br />
einigen Deutschlands im Herzen trugen. Ich hörte immer wieder darüber sprechen<br />
und wurde, da auch einem Kinde fühlbare wirtschaftliche Folgen eingreifender Art<br />
mit der Dienstentlassung meines Vaters und Onkels verbunden waren, in eine selbständige<br />
Betrachtung des Geschehenden hineingenötigt: ich gewann historische Überzeugungen,<br />
ohne von Geschichte zu wissen, hatte das Gefühl, für mein Teil politische Schicksale des<br />
Vaterlandes mitzuerleben, und sah aus dem beschränkten Kreise meines Daseins auf diejenigen<br />
als Nichtwissende herab, die an den Göttinger Ereignissen und den darauffolgenden<br />
weiteren Schicksalen Jacob und Wilhelm Grimms nicht mit dem Herzen beteiligt<br />
waren."<br />
Blieben indes die Brüder Grimm durch ihre enge freundschaftliche Verbundenheit mit<br />
Clemens Brentano, Achim und Bettina von Arnim, durch nicht abreißende Anhänglichkeit<br />
an den einstigen Lehrer Savigny und die familiär-freundschaftlichen Beziehungen zu<br />
Frankfurt nie ganz ohne Zuspruch in der Verfolgung ihrer Aufgaben und Ziele, so traten<br />
sie mit den Göttinger Geschehnissen in eine Entwicklung ein, die von der breiten Anteilnahme<br />
der Öffentlichkeit gekennzeichnet war. Es überrascht daher nicht, wenn unter der<br />
in diesen Jahren beginnenden Regierungszeit Friedrich Wilhelms IV. auf Betreiben<br />
Bettinens, ihres Schwagers Savigny und mit Hilfe Alexander von Humboldts 1841 die<br />
Berufung der Brüder an die Akademie der Wissenschaften in Berlin erfolgte. Damit schien<br />
407
(Foto: Hess. Staatsarchiv Marburg,<br />
Original im Nachlaß Grimm)<br />
nicht nur in den Augen vieler Freunde das den Brüdern widerfahrene Unrecht zum Guten<br />
gewendet, sondern mehr noch: das Recht auf politische Integrität und Selbstbestimmung<br />
weithin sichtbar bestätigt zu sein. Auch im Hinblick auf die Gelehrtenlaufbahn Jacob und<br />
Wilhelm Grimms kam dem Eintritt in Berlin keine geringe Bedeutung zu: Hier, in unmittelbarer<br />
Verbindung mit den sich lebhaft entfaltenden Wissenschaften und einer sich mehr<br />
und mehr als Zentrum liberaler und nationaler Hoffnungen verstehenden Universität,<br />
öffnete sich ihnen eine Stätte gelehrten Wirkens, deren öffentlich-politische Bedeutung für<br />
das liberale geistige Bürgertum der ersten Jahrhunderthälfte nicht zu übersehen ist.<br />
Mit dem Eintritt der Brüder in das zu neuen Entwicklungen sich anschickende Berlin taten<br />
sich auch für den jungen Herman Grimm Verhältnisse und Dimensionen auf, die in den<br />
folgenden Jahren für seinen geistigen und künstlerischen Entwicklungsgang bestimmend<br />
wurden. Jene Jahre, in denen der junge Mensch seine Zeit und seine Welt an den Idealen<br />
mißt, deren Verwirklichung er — wenn nur für die rechte Wirksamkeit der berufenen Männer<br />
gesorgt ist - unmittelbar für die nächste Zukunft erwartet, — jene Jahre fielen für<br />
Herman Grimm in die Zeit des „Vormärz". Er atmete die Luft der Jahre vor „48", die in<br />
Berlin schon früh von den heraufsteigenden Ereignissen elektrisch aufgeladen war und die<br />
in seiner nächsten Umgebung intensiver noch als sonst zu spüren war: Im täglichen Umgang<br />
mit Bettina konnte er von ihren geistigen und politischen Aktivitäten nicht unberührt<br />
bleiben. Die Unruhe und die oft wegen ihres sozialen und politischen Engagements auftretenden<br />
Konflikte mit den Staatsorganen waren nicht dazu angetan, in Grimm das Gefühl<br />
aufkommen zu lassen, in einer heilen, von keinerlei ungelösten Problemen beunruhigten<br />
Welt zu leben. Ob es Bettina um die Erwirkung eines Gnadenakts beim König für politisch<br />
Verfolgte, um Unterstützung vom Schicksal hart getroffener Frauen, Mütter, Kinder oder<br />
Männer ging, ob es das Ziel ihrer Anstrengungen war, fremde nationale Gruppen vor dem<br />
oft rücksichtslosen Zugriff staatlicher Institutionen zu schützen: immer erfuhr auch Herman<br />
408
Grimm mit aller Schärfe die Frage nach dem Menschen und seinen elementaren Lebensrechten,<br />
wenn er Bettina zusammen mit deren jüngster Tochter Giesela beim Durchfechten<br />
zahlreicher Bataillen am Hof und mit den Behörden zur Seite stand. So erstaunt es nicht,<br />
wenn wir ihn als jungen, frisch immatrikulierten Studenten der Rechte in Bonn die Berliner<br />
Ereignisse von 1848 mit gespannten Erwartungen verfolgen sehen, zu einer Zeit, in der<br />
sein Onkel Jacob - in die Nationalversammlung berufen - in der Frankfurter Paulskirche<br />
an den Ereignissen der Zeit Teil hat.<br />
Nicht weniger bedeutsam wurde für Grimm in diesen Jahren die Persönlichkeit Alexander<br />
von Humboldts: Die herausragende Stellung dieses Mannes am Hofe und in der Berliner<br />
Gesellschaft konnte nicht darüber täuschen, daß man seinem liberalen, fortschrittlichen<br />
Denken, seinen Bestrebungen, Empfehlungen und seinem Umgang von Seiten des Staates<br />
nicht ohne Argwohn begegnete. Doch gerade jenes liberale Denken, jene staunenswerte<br />
Welt- und Lebensoffenheit Humboldts waren es, die Herman Grimm im Verkehr mit diesem<br />
Mann unmittelbar erlebte und die ihn später mit ihm zu einer für Berlin bedeutsamen<br />
kunstpolitischen Unternehmung zusammenführen sollte: der ersten Werkausstellung für<br />
den Maler Peter Cornelius.<br />
In den Jahren nach 1848 läßt Herman Grimm im Cotta'schen Morgenblatt neben Berichten<br />
aus dem Berliner Kulturleben auch die Früchte seiner lyrischen und novellistischen Arbeiten<br />
erscheinen. Auf die vom Publikum und der Kritik mit kühler Zurückhaltung aufgenommene<br />
Aufführung seines „Demetrius" folgt die sich allgemeiner Zustimmung erfreuende<br />
Sammlung seiner Novellen. Die schönste unter ihnen, „Der Landschaftsmaler", noch<br />
vom Geist Arnimscher Romantik durchweht, erscheint als unmittelbarer Ausdruck des<br />
Erlebens jener Jahre, das durch den Freundschaftsbund mit Giesela von Arnim, die 1859<br />
seine Frau wird, und dem Geiger Joseph Joachim geprägt ist.<br />
Indes ist dies bereits die Zeit, in der Herman Grimm die Hinwendung zur eigenen Aufgabe<br />
vollzieht: Als bedeutendste Frucht des Arbeitsernstes dieser Jahre erscheint 1860 -<br />
drei Jahre nach seiner entscheidenden Italienreise - der erste Band seines „Michelangelo".<br />
Mit ihm tritt er als ernstzunehmender Historiker und Interpret der neueren europäischen<br />
Kunst vor die Öffentlichkeit - ein Ereignis, das in der gebildeten Welt der Jahrhundertmitte<br />
keine geringe Beachtung findet. In mühevoller, auf sich selbst gestellter Arbeit an den<br />
noch schwer auffindbaren und zugänglichen Quellen zur Künstlergeschichte gelang es<br />
ihm, ein monumentales Gemälde der politischen, geistigen und künstlerischen Ereignisse<br />
und Bewegungen jenes Jahrhunderts zu entwerfen, in dessen Mittelpunkt beherrschend<br />
der Künstler und Dichter Michelangelo steht. Mit diesem Werk wurde für jede künftige<br />
Michelangelo-Darstellung der Maßstab gesetzt. Es hat sich neben der im gleichen Jahr<br />
erscheinenden „Kultur der Renaissance in Italien" Jacob Burckhardts überzeugend<br />
behauptet.<br />
Bereits in der Zeit vor Erscheinen des „Michelangelo" hatte sich Herman Grimm, angeregt<br />
durch die Begegnung mit den Schriften des amerikanischen Philosophen und Dichters<br />
Ralph Waldo Emerson, dessen Goethe- und Shakespeare-Essays er übersetzte, der literarischen<br />
Form des Essays zugewandt, als dessen namhaftester Begründer in Deutschland er<br />
heute angesehen wird. Grimms Arbeiten stehen im Zeichen einer umfassenden Rezeption<br />
des europäischen Kulturerbes, aus deren Verflechtung und gegenseitiger Wechselwirkung<br />
wiederum die geistige und künstlerische Arbeit der eigenen Nation, die für ihn im Werk<br />
Goethes ihren bleibenden Ausdruck gefunden hat, zur Entfaltung gekommen ist. An den<br />
Gestalten von Lessing, Herder, Goethe und Schiller, den Brüdern Humboldt und den<br />
409
Brüdern Grimm, Clemens Brentano, Achim von Arnim, Schleiermacher, aber auch von<br />
Schinkel, Schadow und Rauch gewinnen seine Gedanken über den inneren Gang der<br />
Geschichte eindringliche Anschaulichkeit und Überzeugungskraft. In ihnen sucht er der<br />
Öffentlichkeit ein tiefgreifendes Verstehen für die Werke der geistigen Kultur der Vergangenheit<br />
und Gegenwart zu vermitteln. Seiner Bindung an Berlin kommt bei diesem Bemühen<br />
besondere Bedeutung zu: Hier, inmitten einer sich wandelnden Gesellschaft, gilt es<br />
stärker als anderenorts das Bewußtsein für den fortwirkenden Anspruch einer. Überlieferung<br />
wachzuhalten, auf die nach seiner Überzeugung die entscheidenden politischen Wandlungen<br />
der Zeit zurückzuführen sind: Die allen Daseinsprüfungen der Nation standhaltende<br />
Geistesarbeit der vorangegangenen Generationen.<br />
So überrascht es nicht, daß für ihn Berlin der Ort einer Aufgabe wird, die ihren Niederschlag<br />
in dem jahrelangen Bemühen findet, das er auf die geistige Anerkennung zweier<br />
Künstler und der Würdigung ihres Werkes durch die Öffentlichkeit wendet: Karl Friedrich<br />
Schinkel und Peter Cornelius.<br />
Zwei Momente bestimmten für Grimm die Bedeutung Schinkels: das der inneren Verarbeitung<br />
und Anverwandlung der kaum übersehbaren europäischen Kulturleistungen — eine<br />
Tatsache, durch die ihm sein Rang innerhalb der neueren Kunstentwicklung zugewiesen<br />
wird -, und das seiner städtebaulichen Konzeptionen, die sich mit den europäischen Vorbildern<br />
in Rom, Wien und Paris messen durften und auch unter den gewandelten Bedingungen<br />
der Zeit Gültigkeit und Anspruch auf kontinuierliche Fortentwicklung nicht verloren<br />
hatten. Wiederholt weist Grimm auf das keineswegs ausgeschöpfte, ideenreiche Werk<br />
Schinkels hin. Er selbst empfing durch ihn einen der entscheidenden Anstöße für die Hinwendung<br />
zur Kunstgeschichte. Noch im Jahre 1900, ein Jahr vor seinem Tode, schrieb er:<br />
„Es klingt in mir die freudige Überraschung noch nach, mit der ich in Schinkels hinterlassenen<br />
Schriften dem Satz begegnete, es seien Kunstwerke die feinsten historischen Quellen."<br />
An Schinkels Persönlichkeit und seinem Werk wurde ihm bewußt, in welch hohem<br />
Maße die Kunsttätigkeit der neuesten Zeit und ihr Verstehen nicht ohne die geistige<br />
Rezeption der Vergangenheit und ohne die Reflexion ihrer seelisch-geistigen Beweggründe<br />
zu denken ist.<br />
In ähnlicher Weise suchte Grimm dem Werk des lange Zeit in Italien lebenden, einst den<br />
„Nazarenern'" nahestehenden Peter Cornelius in Berlin und Deutschland zur Geltung zu<br />
verhelfen. Nicht jene von Goethe abgelehnte Kunstrichtung der in Rom lebenden Künstlergemeinschaft<br />
war es, auf die es Grimm bei dem Verständnis und der Würdigung des Schaffens<br />
von Cornelius ankam, sondern darauf, die überragende zeichnerische Begabung aufzuzeigen,<br />
mit der dieser sich bis hin zu den Kompositionen seiner Fresken in München<br />
und seiner Entwürfe zum Campo santo in Berlin als ein bedeutendes Glied der Kunsttätigkeit<br />
in Deutschland erwies. Daß dieser Künstler dennoch nicht die Würdigung durch die<br />
Öffentlichkeit fand, auf die er seiner Ansicht nach einen Anspruch hatte, war für Grimm<br />
eine enttäuschende Erfahrung.<br />
Das Jahr 1871 brachte Grimms Berufung auf den neueingerichteten Lehrstuhl für Neuere<br />
Kunstgeschichte in Berlin. Sie kam seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen entgegen,<br />
die letztlich davon bestimmt waren, diesem Gebiet geistiger und wissenschaftlicher<br />
Tätigkeit auch innerhalb der Universität ihren legitimen Platz zu sichern. Sein Wirken auf<br />
diesem Lehrstuhl war denn auch von eindrucksvollem und anhaltendem Erfolg: Der unter<br />
seiner Ägide nicht ohne Einsatz eigener Mittel geschaffene Institutsapparat nahm mit der<br />
Fülle des hier gesammelten bilddokumentarischen Materials zur Geschichte der neueren<br />
410
Kunst eine herausragende Stellung ein, so daß mit Grimms Ausscheiden Wöljflin im Jahre<br />
1901 einen Lehrstuhl übernehmen konnte, der ihm ausgezeichnete Arbeitsmöglichkeiten<br />
bot. Daß Herman Grimm in seinen Vorlesungen bereits früh den Bildwerfer, das sog.<br />
Skioptikon, zur Veranschaulichung der behandelten Kunstwerke verwandte - nicht ohne<br />
sich hierfür manchen Vorbehalt von Kollegen einzuhandeln - gab seinen Lehrveranstaltungen<br />
einen aufgeschlossenen und modernen Zug.<br />
Sowohl in diesen organisatorisch-technischen Fragen als auch in solchen nach Inhalt und<br />
Sinn dieser Tätigkeit nahm Grimm einen eigenen, vom beruflichen Selbstverständnis der<br />
Kollegen oft abweichenden Standpunkt ein. Dies resultierte aus der Spannung, die innerhalb<br />
der Universität durch den doppelten Auftrag von Lehre und Forschung wirksam ist.<br />
Indem Grimm für sich die Aufgabe vornehmlich darin sah, in den Vorlesungen einem<br />
großen, keineswegs homogenen Publikum mit den Einsichten in den Gang und die Zusammenhänge<br />
der Kunst eine diesem Phänomen angemessene Urteilsfähigkeit zu vermitteln,<br />
erhielt notwendig die Lehre ein stärkeres Gewicht. Das Moment der Forschung, zu der er<br />
mit seinem „Michelangelo" einen wichtigen Beitrag geleistet hatte, galt ihm nicht weniger<br />
berechtigt, — als Aufgabe und Ziel jedoch vornehmlich auf den Kreis Jener begrenzt, deren<br />
persönliche und berufliche Intentionen ein kritisches und noch intensiveres Durchdringen<br />
der Materie fordern.<br />
In diesem Sinne führte Grimm 1874/75 seine berühmten Goethe-Vorlesungen durch.<br />
Auch in ihnen wandte er sich an ein großes Publikum. Sie setzten frühere, sich über Jahrzehnte<br />
erstreckende Arbeiten fort und führten zur ersten deutschen Gesamtwürdigung<br />
Goethes und seiner Zeit. Nicht nur in Grimms Persönlichkeit und Herkunft, auch in seiner<br />
ausgebreiteten, die Fülle dichterischer und gelehrter Literatur in Deutschland umfassenden<br />
Kenntnis lagen die Voraussetzungen, die eine Darstellung der Goetheschen Gesamterscheinung<br />
und der mit ihr verbundenen geistigen Strömungen ermöglichten. Mit diesen<br />
Vorlesungen war zugleich der Versuch unternommen für die neuere deutsche Entwicklung<br />
eine ähnlich grundlegende Darstellung, in deren Mittelpunkt Goethe stand, zu schaffen,<br />
wie Grimm sie für Italien bereits mit seinem „Michelangelo" unternommen hatte und<br />
später in seinem Raphael-Werk fortsetzte.<br />
Welchen Einfluß die Goethe-Vorlesungen, die 1877 zum erstenmal unter dem Titel<br />
„Goethes Leben" erschienen, auf das Goethebild des ausgehenden und beginnenden<br />
neuen Jahrhunderts ausübten, vermag die Tatsache zu veranschaulichen, daß die Erscheinung<br />
des Dichters in dem von Grimm geschaffenen Bild einer fast mythisch anmutenden<br />
Wandlung des Dichters fortlebte, die dieser auf seiner ersten Italienreise an sich erfuhr.<br />
Hatte er in diesem Bilde auch einem seiner ersten und tiefsten Eindrücke Goethescher<br />
Existenz neue Gestalt gegeben - darin übrigens den von Wilhelm von Humboldt in seinem<br />
Aufsatz „Goethes zweiter römischer Aufenthalt" fortführend -, erst mit dem 1877 erschienenen<br />
Werk war dieses Bild des Weimarer Dichters in die Erinnerung und in das Bewußtsein<br />
der Öffentlichkeit gehoben, um darin bis weit in unser Jahrhundert lebendig fortzuwirken.<br />
In memoriam Dr. Ottokar Schambach, Darmstadt<br />
Anschrift des Verfassers: Cimbernstraße 3,1000 Berlin 38<br />
411
Detail der Wandverkleidung des Bahnhofs<br />
(Darstellungen von reproduzierten Bühnenbilddarstellungen zu Opern von Richard Wagner)<br />
Neugestaltung des U-Bahnhofs Richard-Wagner-Platz<br />
Von Dipl.-Ing. Gerhard Rümmler<br />
Da in den weitverzweigten U-Bahnnetzen der Großstädte, wie London, Paris und nicht<br />
zuletzt in Berlin, die Menschen einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit während des Berufsverkehrs<br />
in der U-Bahn verbringen, gewinnt der ästhetische Anspruch immer mehr an Bedeutung.<br />
Die Gestalter gingen vornehmlich in den 50er Jahren bei dem Entwurf von U-Bahnhalteplätzen<br />
davon aus, die U-Bahnhöfe nur auf die Zweckmäßigkeit abzustimmen, das heißt,<br />
etwa für eine Verkleidung der Bahnhofswände und der statisch notwendigen Stützen mit<br />
keramischem Material zu sorgen, um leichte Abwaschbarkeit zu gewährleisten. So setzten<br />
diese Bahnhöfe Assoziationen zu großen Badezimmern frei. Erst in der zweiten Hälfte der<br />
60er Jahre begann der große Gestaltungsprozeß hin zu der Unverwechselbarkeit des<br />
Ortes U-Bahnhof.<br />
Attraktivität wurde immer mehr gefragt, und hier seien nur Beispiele wie Bayerischer Platz,<br />
Fehrbelliner Platz, Zwickauer Damm u.a. genannt. Die dort angewandten Gestaltungskriterien<br />
wurden auch bei dem neuen Streckenabschnitt der Linie 7 von Fehrbelliner Platz<br />
bis Richard-Wagner-Platz fortgesetzt.<br />
412
Der Haltepunkt Richard-Wagner-Platz wird als vorläufig nördlichster Haltepunkt der<br />
Linie 7 mit dem Streckenabschnitt ab Fehrbelliner Platz und den ebenfalls neuen Bahnhöfen<br />
Konstanzer Straße, Adenauerplatz, Wilmersdorfer Straße und Bismarckstraße dem<br />
Betrieb am 28. April 1978 übergeben. Damit erhält der Richard-Wagner-Platz oder, wie<br />
er früher hieß, Wilhelm-Platz einen neuen Anschluß an das U-Bahnnetz. Der seit 1906<br />
bestehende alte U-Bahnhof wurde mit der Beendigung des Betriebes am 1. Mai 1970<br />
stillgelegt und der Pendelverkehr vom U-Bahnhof Deutsche Oper bis Richard-Wagner-<br />
Platz eingestellt.<br />
Dieser kurze Streckenabschnitt war wie die gesamte Linie von Ruhleben bis Schlesisches<br />
Tor im Kleinprofil gebaut worden und konnte somit für Zwecke und Funktion der Linie 7,<br />
die im Großprofil ausgeführt wird, nicht mehr genutzt werden. Somit hatte auch der<br />
frühere Haltepunkt seine Funktion verloren und wurde im Zuge des Neubaues des Strekkenabschnittes<br />
aufgelöst und abgebrochen. Die aus der Zeit, also 1906, stammenden<br />
eisernen Stützen sind sorgsam geborgen worden und sollen an anderer Stelle, und zwar in<br />
einem der Bahnhöfe im Bereich der Altstadt Spandau zwischen Haltepunkt Juliusturm<br />
und Rathaus Spandau, so die Vorstellung des Verfassers, Verwendung finden.<br />
Der neue Tunnelabschnitt, der dem Verlauf der Wilmersdorfer Straße folgt, schwenkt von<br />
dort in Schildvortrieb unter dem Quartier zur Richard-Wagner-Straße ab, folgt ihr ein<br />
kurzes Stück und endet, wie bereits erwähnt, vorläufig am Richard-Wagner-Platz.<br />
Bei dem U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz galt es, mit den Mitteln der Gestaltung zu dem<br />
Namen des Haltepunktes eine Beziehung herzustellen. Zum einen konnte dies die Farbkonstellation,<br />
zum zweiten die Architektur der Decke, der Wände und der Stützen und<br />
zum dritten die additive Verwendung gleichgestaltiger, aber thematisch verschieden<br />
aussagender Bildelemente sein.<br />
Die Entwicklung der Architektur des Bahnhofes, der leeren und rohen Tunnelröhre, bezog<br />
sich auf die relativ große Höhe des Rohkörpers. In dem Rohling wurde über den senkrecht<br />
zu den Bahnsteigkanten stehenden, mit statisch notwendigem rechteckigem Querschnitt<br />
versehenen Stützen eine große fischbauchähnliche Form eingehängt, aus der große Arme<br />
auskragen, die an den Vorderseiten runde hohe Tonnenformen halten, in denen die<br />
Beleuchtung der Bahnsteige liegt. Diese Kragarme stoßen in die über den Gleisen gegenläufigen<br />
und höher liegenden Deckenteile ein. Die Bahnhofswände sind mit starkfarbiger<br />
Grobkeramik belegt, aus deren Formaten 11,5 cm X 24 cm formal tunnelhohe Klammerelemente<br />
entwickelt wurden, die jeweils einen Stahlrahmen umfassen, in dem reproduzierte<br />
Entwürfe von Bühnenbildern zu Opern von Richard Wagner, im Unterdruckverfahren<br />
ausgeführt, eingelegt worden sind. Die Wände und Stützen sind mit Grobkeramik in<br />
starken gelben und blauen Farben verkleidet. Dies in Anlehnung und Assoziation zu<br />
Farbhaltungen der Zeit, in der das Rathaus Charlottenburg, also zwischen 1900 und<br />
1910, erbaut wurde, d.h. goldene, hier gelbe, blaue und lichte orangene Farbtönungen.<br />
Das Blau der Stützen, das ornamental in das Gelb einläuft, kehrt in den tieferliegenden<br />
Deckenteilen und den Auslegern wieder. Die höher liegenden Deckenbereiche über den<br />
Gleisen sind mit einem lichten Orangerot behandelt, das in die Umrahmungen der reproduzierten<br />
Bühnenbildentwürfe einläuft.<br />
Um dem wartenden Fahrgast die Möglichkeit zu geben, sich mit dem dargestellten Themenkreis<br />
zu beschäftigen, sind in die Mittelstützen kleine Hinweistafeln mit Erläuterungen zu<br />
den jeweiligen Bilddarstellungen eingelegt worden.<br />
413
Kaiser Heinrich II., der Heilige König Ludwig IV., der Bayer<br />
Mosaiken-Wandfläche in der kleinen unterirdischen Verteilerhalle<br />
Ein ganz besonders glücklicher Umstand für den Architekten ließ die Beziehung der<br />
Ausgestaltung zum Namen des Bahnhofs noch in der Attraktivität steigern:<br />
Dem Verfasser gelang es mit dankenswerter Unterstützung des Wirtschafters und des<br />
damaligen Abteilungsleiters der Abteilung Tiefbau beim Senator für Bau- und Wohnungswesen<br />
und jetzigen Senatsdirektors Lekutat, die aus dem ehem. Vergnügungsetablissement<br />
und Hotel „Bayerischer Hof" geretteten Mosaiken in der großen unterirdischen<br />
Verteilerhalle unter der Kreuzung Otto-Suhr-Allee und der Richard-Wagner-Straße, einzubauen.<br />
In dem in der Potsdamer Straße 24 gelegenen, 1903 von dem Architekten Walther erbauten<br />
Komplex befand sich ein großer Bankettsaal, der Minnesängersaal, über dessen<br />
quadratischem Grundriß eine kreisförmige Decke angebracht war, die in acht Segmentteilen<br />
in romanisierender Darstellung Figuren aus dem deutschen Mittelalter enthielt.<br />
Diese figuralen Darstellungen vornehmlich aus dem Umkreis der Wagneroper „Tannhäuser"<br />
— Hermann von Thüringen, Reinmar von Zweter, Elisabeth von Thüringen, Wolfram<br />
von Eschenbach, Tannhäuser, Ludwig von Bayern und Walther von der Vogelweide - haben<br />
durch ihren Einbau hier nun einen direkten Bezug zum Namen des Bahnhofes. In der kleinen<br />
unterirdischen Verteilerhalle in der Richard-Wagner-Straße sind Mosaiken mit den<br />
Darstellungen Kaiser Heinrichs II. und König Ludwigs des Bayern, ebenfalls restauriert,<br />
414
angebracht worden. Da der Bayernhof in der Potsdamer Straße in der Trasse der späteren<br />
Stadtautobahn lag und durch Kriegseinwirkungen sowieso stark zerstört war, wurde das<br />
Gebäude in der Zwischenzeit gesprengt. Vorher ist die gesamte Decke entspechend der<br />
Aufteilung in acht Segmente zerlegt und rechtzeitig vor der Sprengung ausgebaut<br />
worden, um diese in der unterirdischen Verteilerhalle an besonderer Stelle anzubringen.<br />
Damit konnte ein für die Berliner Landschaft der Gebrauchskunst um 1910 wichtiges<br />
Dokument gerettet und erhalten werden. Es war dem Verfasser um so wichtiger, diese<br />
Arbeiten zu bewahren, da das Mosaik aus der Fabrik Wagner stammt, deren vom Architekten<br />
Schwechten dem romanischen Stil nachempfundenes Fabrikationsgebäude in Berlin-<br />
Rudow dem Unverstand und der Spitzhacke bereits zum Opfer gefallen ist. Die Figurenteile<br />
wurden sorgfältig unter Verwendung ebenfalls geretteter Mosaiksteine restauriert<br />
und bieten sich in alter Schönheit dem Fahrgast und somit dem Bürger dieser Stadt zur<br />
ständigen Freude an.<br />
In diese Gesamtvorstellung eingebettet ist die Verwendung eines ehemaligen Zugangsportales<br />
aus dem Jahre 1906. Es wurde nach Stillegung des ehemaligen Bahnhofes Richard-<br />
Wagner-Platz am 1. Mai 1970 ausgebaut und gegenüber dem Rathaus Charlottenburg nach<br />
Restaurierung wiedererrichtet. So konnte nach der städtebaulichen Zerstörung des<br />
Richard-Wagner-Platzes noch ein kleiner Zusammenhalt eines zeitgerechten Architekturmöbels<br />
des frühen Jahrhunderts mit dem Rathausbau Charlottenburg hergestellt werden.<br />
Anschrift des Verfassers: Elsflether Weg 27, 1000 Berlin 20<br />
Die hier gezeigten Mosaiken stammen aus dem Minnesängersaal im Bayerischen Hof, der 1903 durch<br />
den Architekten Walther in der Potsdamer Straße 24 erbaut wurde. Die Mosaiken fanden jetzt durch<br />
den Architekten Gerhard Rümmler eine neue Verwendung im U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz.<br />
Alle Fotos stammen aus dem Archiv des Verfassers.<br />
415
Mosaiken -<br />
Wandfläche<br />
in der großen<br />
unterirdischen<br />
Verteilerhalle<br />
(In der Halle<br />
sind alle 8<br />
Mosaiken, 1 — 8,<br />
nebeneinander<br />
angebracht.)<br />
416<br />
Abb. 1: Hermann von Thüringen Abb. 2: Reinmar von Zweter<br />
Abb. 5: Rudolf von Habsburg Abb. 6: Tannhäuser
sfffni<br />
..Jjsj&n<br />
In<br />
^K . ****** • 1<br />
ISP<br />
•<br />
- ' P - - \\<br />
Abb. 3: Elisabeth von Thüringen<br />
Abb. 7: Ludwig von Bayern<br />
SS<br />
IUI<br />
Abb. 4: Wolfram von Eschenbach<br />
Abb. 8: Walther von der Vogel weide<br />
417
Nachrichten<br />
Rund um den Tiergarten<br />
Im Landesarchiv Berlin wurde die Ausstellung „Rund um den Tiergarten" eröffnet, die in 15 Vitrinen<br />
Aktenblätter, Drucksachen, Bilder, Karten und Pläne über die Geschichte eines Kerngebietes der<br />
Hauptstadt im 19. und 20. Jahrhundert zeigt. Nur wenige historisch versierte Berliner werden noch<br />
wissen, daß das Palais Raczynski an der Stelle des heutigen Reichstags stand oder daß die Siegessäule<br />
einmal anders ausgesehen hat als heute. Den Geschicken der „Zelten" und des Kroll-Etablissements<br />
wird nachgegangen; seltene Pläne und Ansichten von der Peripherie des schönen Wald-,<br />
späteren Parkgeländes zeigen das Schloß Bellevue, die Porzellanmanufaktur, den Zoologischen<br />
Garten, die Villen und großbürgerlichen Palais am Südrand. Mit Hilfe der INTERBAU 1957 wurde<br />
das Hansaviertel neu gestaltet. Autographen prominenter Anwohner des Tiergartens und viele bunte<br />
Postkartengrüße, wie sie zu Kaisers Zeiten „in" waren und von reisestolzen Verwandten und Bekannten<br />
in die „Provinz" geschickt wurden, beschließen die kleine, aber eindrucksvolle Schau im Landesarchiv<br />
Berlin, Kalckreuth-, Ecke Kleiststraße, gegenüber der URANIA. (Öffnungszeiten: Montag bis<br />
Freitag von 9 bis 15 Uhr, Eintritt frei.)<br />
Edvard Munch<br />
Der Lebensfries in Max Reinhardts Kammerspielen<br />
Ausstellung in der Nationalgalerie vom 24. Februar bis 16. April 1978<br />
Von Peter Krieger<br />
Seit 1892 war Edvard Munch mit Berlin eng verbunden. Damals führte seine 1. Ausstellung in der<br />
Stadt zur Spaltung des Vereins Berliner Künstler. Es bildete sich ein Kreis von skandinavischen und<br />
deutschen Literaten und Künstlern um Strindberg, Munch, Przybyszewski, Richard Dehmel, Arno<br />
Holz und Walther Leistikow. Man traf sich meist in dem Lokal Ecke Neue Wilhelm- und Friedrichstraße,<br />
das Strindberg „Zum Schwarzen Ferkel" getauft hatte. Bis 1895 blieb Munch in der deutschen<br />
Hauptstadt und fand in Julius Meier-Graefe, Harry Graf Kessler und Walther Rathenau, der 1893<br />
als erster in Berlin ein Bild des Norwegers erwarb, Förderer und Freunde. In engen Hotelzimmern<br />
entstanden viele Hauptwerke, die Munch später zum Zyklus seines „Lebensfrieses" zusammenfassen<br />
sollte.<br />
Julius Meier-Graefe gab 1895 in Berlin die avantgardistische Zeitschrift „Pan" heraus. In dieser Zeitschrift<br />
von europäischem Rang wurden die neuesten Strömungen in Literatur und Bildender Kunst<br />
vorgestellt. Man traf dort auf die Namen Strindberg, Nietzsche, Hamsun, Mallarme, Rodin, Whistler<br />
oder Liebermann. Dagny Juell, die Frau des polnischen Dichters Przybyszewski, Muse und Sphinx<br />
des Kreises um Strindberg, war es, die der Zeitschrift den Namen gab. In jenen Berliner Jahren seines<br />
künstlerischen Durchbruchs gewann auch Munchs Idee Gestalt, einen umfassenden Zyklus von den<br />
Freuden und Leiden des Menschen zu schaffen. Einen Raum mit seinem solchen „Lebensfries" auszugestalten,<br />
war Munchs Ziel. Solange der Raum fehlte, zeigte er seine Staffeleibilder, die er dem<br />
Fries zurechnete, unter wechselnden Titeln auf Ausstellungen, nicht nur in Berlin, Christiania oder<br />
Paris. 1896/97 ging Munch erneut nach Paris, wo er engen Kontakt gewann zum Symbolistenkreis um<br />
Mallarme und zum avantgardistischen „Theätre de l'Oeuvre", für das er Programmhefte zu Ibsen-<br />
Aufführungen entwarf.<br />
Im November 1901 begann der zweite längere Aufenthalt in Berlin, wo er nun jahrelang meist die<br />
Winter verbrachte. Hier konnte er 1902 seinen gesamten „Lebensfries" mit 22 Gemälden in der<br />
Vorhalle der Berliner Sezession, Kantstraße, zeigen. Den ersten Auftrag, einen Fries für einen<br />
bestimmten Raum zu malen, erhielt Munch 1904 von seinem Lübecker Mäzen, dem Augenarzt<br />
418
Dr. Max Linde. Doch lehnte Linde aus verschiedenen Gründen den für das Kinderzimmer bestimmten<br />
Fries ab, entschädigte Munch aber durch Ankauf eines Bildes zu der für den ganzen Fries vereinbarten<br />
Summe. Zwei Jahre später entstand der Kontakt zu Max Reinhardts Deutschem Theater.<br />
Reinhardt, der auf die künstlerische Gestaltung des Bühnenbildes größten Wert legte, bat Munch um<br />
Entwürfe zu Ibsens „Gespenstern". Im Todesjahr des Dichters war dies die Eröffnungsvorstellung<br />
der neuerbauten „Kammerspiele" am 8. November 1906. Anschließend entstanden noch Entwürfe<br />
zu einer „Hedda Gabler"-Inszenierung. Aus dieser Zusammenarbeit mit Reinhardt ergab sich der<br />
Auftrag, für das Foyer des neuen Theaters einen Fries zu malen.<br />
Von den 12 Gemälden des Frieses konnten 8 aus der Sammlung Moltzau stammende Werke 1966 für<br />
die Nationalgalerie erworben werden, die innerhalb des Bestandes ein entscheidendes Bindeglied<br />
zwischen der Kunst des 19. und der des 20. Jahrhunderts bilden. Auch dieser Fries hatte, wie der<br />
Linde-Fries, ein merkwürdiges Schicksal. Das Foyer, ungünstig gelegen, wurde nur zu kleinen Feiern<br />
der Schauspieler nach Premieren benutzt. So blieb dieses Hauptwerk Munchs fast unbekannt und<br />
dem Publikum verschlossen. Schließlich wurde der Fries bei einem Umbau 1912 aufgelöst und die<br />
Bilder in Privatbesitz verstreut.<br />
Die Ausstellung in der Nationalgalerie will Materialien zu diesem Fries zusammenfassen. Mit Ausnahme<br />
eines Bildes aus dem Museum Folkwang, Essen, kommen sämtliche Leihgaben aus dem Osloer<br />
Munch-Museum. Neben großformatigen Vorstudien zum Reinhardt-Fries in Tempera und Aquarell<br />
und einem Hauptbild aus dem Linde-Fries von 1904 sind zahlreiche druckgraphische Blätter zu<br />
sehen, die mit den Themen des Reinhardt-Frieses in Zusammenhang stehen. Außerdem wird die<br />
Folge der Bilder zu Ibsens „Gespenstern" gezeigt, die, weit über die üblichen Dekorationsentwürfe<br />
hinaus, Situationen des Stückes festhalten. Daneben Entwürfe zu „Hedda Gabler" sowie das monumentale<br />
Ibsen-Porträt von 1906. Die für Munchs Entwicklung so wesentliche und erstaunlich fruchtbare<br />
Phase zwischen 1905 und 1907, in deren Zentrum der Lebensfries für Max Reinhardt stand, wird<br />
noch mit weiteren wichtigen Beispielen beleuchtet:<br />
In den Selbstbildnissen, darunter das berühmte „Selbstbildnis mit Weinflasche", sowie in den Porträts<br />
der deutschen Freunde: Albert Kollmann, Gustav Schiefler, Harry Graf Kessler, Walther Leistikow<br />
zeigt sich der tieflotende Psychologe.<br />
Eine Folge von Gemälden und Graphiken, wie „Marats Tod" oder „Amor und Psyche", erhellt<br />
Aspekte in den Beziehungen zwischen Mann und Frau, die Parallelen und Variationen zu den im<br />
Reinhardt-Fries angeschlagenen Themen bieten. Schließlich soll mit einigen Beispielen Munch<br />
auch als Beobachter der Berliner Atmosphäre um die Jahrhundertwende gezeigt werden.<br />
Fotos, zum Teil Aufnahmen, die Munch selbst machte, Skizzen, Notizbücher und Bücher aus Munchs<br />
Bibliothek begleiten und kommentieren die ausgestellten Werke.<br />
(Aus: Berliner Museen. Berichte aus den Staatl. Museen Preuß. Kulturbesitz, 3. Folge, Nr. 12/1978.)<br />
*<br />
Manches Mitglied hat es schon bedauert, daß es im Verein zur Passivität verurteilt war, weil eben der<br />
Kreis der Vortragenden, Autoren und geschäftsführenden Vorstandsmitglieder von der Sache her<br />
beschränkt ist. Um derartige Unlustgefühle abzubauen, die man mit dem Modewort „Frustrationen"<br />
nennt, sei hier auf die Möglichkeit hingewiesen, freitags zwischen 16.30 und 19.00 Uhr in der Vereinsbibliothek<br />
im Rathaus Charlottenburg nützliche Arbeit zu leisten. Wer selbst zeitlich nicht in der<br />
Lage ist oder beim Umgang mit Büchern zwei linke Hände hat, könnte vielleicht seinen Ehegatten für<br />
dieses Ehrenamt interessieren. Hie bibliotheca, hie salta! SchB.<br />
*<br />
Der Fotografische Auskunftsdienst von Europa Nostra, der Internationalen Föderation der Vereinigung<br />
zum Schutz des kulturellen und natürlichen Erbes Europas, hat als erste einer Reihe von Diapositivserien<br />
48 Diapositive mit Kurzbeschreibungen zum Thema „Europas architektonisches Erbe in<br />
Gefahr" herausgebracht. Weitere Serien über architektonische Restaurierung, Schaffung von Fußgängerzonen,<br />
Neubauten in alten Städten usw. sind in Vorbereitung. Sie werden abgegeben zum<br />
Preis von £12 einschließlich Porto vom Fotografischen Auskunftsdienst Europa Nostra, 17 Carlton<br />
House Terrace, London SW 1Y5AW, Großbritannien. SchB.<br />
419
Von unseren Mitgliedern<br />
Zum Tode von Alfred Braun<br />
Alfred Braun<br />
am 85. Geburtstag, 1973<br />
Wieder hat uns eines unserer bekanntesten und profiliertesten Mitglieder für immer verlassen: am<br />
3. Januar 1978 starb Alfred Braun, fast neunzigjährig, hier in der Stadt seiner Geburt (3. Mai 1888)<br />
und seines unvergessenen Wirkens. Uns Alten seit 1923 bekannt als erster Sprecher der „Berliner<br />
Funkstunde" im Voxhaus am Potsdamer Platz, als der er das Neuland Funkreportage zunächst<br />
improvisierend, ja es recht eigentlich erfindend betreten und damit beispielgebend geprägt hat, der<br />
jungen Generation bekannt als „Spreekieker" im Sender Freies Berlin, als der er, der fast Erblindete,<br />
dank eines stupenden Gedächtnisses mit sonor-klangvollem Organ bis in die jüngste Zeit Altes und<br />
Neues in seiner Stadt zu kommentieren wußte. Auch unserem Verein für die Geschichte Berlins hat<br />
er - immer bereit - mit seinem reichen Talent genußvoll-besinnliche Stunden bereitet.<br />
Was war er, was konnte er nicht alles! Von Hause aus Schauspieler, war er neben seinem viel verlangenden<br />
Beruf auch erfolgreicher Buchautor und Filmregisseur - als echte Komödiantennatur immer<br />
agierend, immer getrieben, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. So konnte es nicht ausbleiben,<br />
daß er in den von unserer Generation durchlebten stürmischen Zeiten politisch kräftig gebeutelt<br />
wurde, bei seiner ungewöhnlichen Popularität wechselweise hier angefeindet, dort ausgenutzt, aber<br />
dank seiner glücklichen Veranlagung alles überstehend, gefragt und schaffend bis zuletzt.<br />
Nun also ging dieses unglaublich inhaltsreiche Leben still und gnädig zu Ende, und „völlig vollendet<br />
ruhet der Greis, der Sterblichen ewiges Opfer". Hoffmann-Axtheim<br />
420
Foto: Archiv des Vereins<br />
für die Geschichte Berlins<br />
Aufnahme: R. Mücke<br />
Professor Dr. Dr. Walter Hoffmann-Axthelm 70 Jahre<br />
Der Lebensweg unseres Vorsitzenden, Professor Dr. med. Dr. med. dent. Walter Hoffmann-Axthelm,<br />
der am 29. April auf sieben Jahrzehnte zurückblicken kann, könnte exemplarisch genannt werden,<br />
kann selbst ein Stück Geschichte sein. Seine Vita verzeichnet drei Berufe (praktischer Zahnarzt in<br />
Perleberg, Kieferchirurg und Facharzt in Berlin und Hamburg sowie Medizinhistoriker an der Freien<br />
Universität Berlin), zwei Promotionen, zwei Habilitationen und kurioserweise auch zwei Ernennungen<br />
zum Professor. Sie spiegeln damit den mehrfachen Neubeginn eines Mannes, an dem sich das<br />
Schicksal unseres Volkes augenfällig vollzog, sie sind aber auch Ausdruck des Willens einer Persönlichkeit,<br />
sich zu behaupten und vor sich selbst bestehen zu können.<br />
Walter Hoffmann-Axthelm wurde am 29. April 1908 in Berlin-Friedenau geboren, wo er 1927 das<br />
Abitur bestand. Vier Jahre später erhielt er nach dem Studium in Berlin und in Freiburg die zahnärztliche<br />
Approbation und promovierte in Berlin zum Dr. med. dent. Nach der zweijährigen Assistentenzeit<br />
ließ er sich in Perleberg nieder. Nachdem er von 1939 an Lazarettdienst geleistet hatte,<br />
betreute er nach Kriegsende in Hamburg Gesichtsverletzte, wurde von der Hamburger Gesundheitsverwaltung<br />
auch als Assistent eingestellt, kehrte aber 1948 zu seiner inzwischen gleichfalls approbierten<br />
Frau, zu den vier Kindern und zwei Großmüttern nach Perleberg zurück. Nach zweijähriger<br />
Praxistätigkeit wurde er als Oberarzt und Lehrbeauftragter an die Chirurgische Abteilung der<br />
Universitätsklinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten der Charite berufen, wo er<br />
sein vollmedizinisches Studium beenden und sich 1954 für das Fach „Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde"<br />
habilitieren konnte. 1961 krönte er seine erste wissenschaftliche Laufbahn mit der Ernennung<br />
zum planmäßigen Extraordinarius. Als ihn der Mauerbau 1961 gezwungen hatte, aus dem<br />
Lehrkörper der Humboldt-Universität auszuscheiden, setzte er seine Tätigkeit an der Klinik für<br />
Kiefer- und Gesichtschirurgie der Medizinischen Akademie Düsseldorf fort.<br />
Mit dem Eintritt als Wissenschaftlicher Assistent in das Institut für Geschichte der Medizin der FU<br />
Berlin am 1. Januar 1964 begann seine zweite „Ochsentour" als Hochschullehrer, die ihn über die<br />
Positionen eines Oberassistenten und Akademischen Rats, über die Habilitation für das Fach<br />
„Geschichte der Medizin" und die abermalige Ernennung zum Professor 1974 in die Stellung des<br />
421
geschäftsführenden Direktors des Instituts für Geschichte der Medizin der FU Berlin führte. Dieser<br />
Neubeginn ließ sein altes Steckenpferd, die Geschichte insbesondere seines Faches, nunmehr zu<br />
seinem Hauptberuf werden. Obwohl seit 1974 im Ruhestand, wurde sein Arbeitsverhältnis immer<br />
wieder verlängert; immer noch auf seinen Nachfolger wartend, erfüllt er seine Aufgaben in Lehre und<br />
Forschung in unvermindertem Umfang als Lehrbeauftragter, damit das Wort demonstrierend, daß<br />
auch beim Staat keine Grenze so sehr zum Schmuggel verführt wie die Altersgrenze.<br />
92 klinische und medizinhistorische Arbeiten zeugen ebenso wie die fünf Bücher aus seiner Feder von<br />
seinem eminenten Fleiß. Das 1958 erschienene „Lexikon der Zahnmedizin" wurde inzwischen siebenmal<br />
aufgelegt, eine Übersetzung in die englische und japanische Sprache wird vorbereitet, gleichfalls<br />
eine Übertragung seiner „Geschichte der Zahnheilkunde" ins Englische. Gegenwärtig arbeitet er an<br />
einem weiteren Werk.<br />
Dies alles sollte man wissen, um zu ermessen, welche Bürde es für ihn bedeutete, 1967 den Vorsitz des<br />
Vereins für die Geschichte Berlins zu übernehmen. Hier hat er größten Wert vor allem auf die<br />
literarische Erschließung der Historie unserer Stadt gelegt, ist selbst mit einer Reihe von Aufsätzen<br />
hervorgetreten, war Redakteur der „Mitteilungen" und Mitherausgeber des Jahrbuchs, hat vor allem<br />
auch die Grünen Hefte wieder neu aufleben lassen und Mäzene gefunden, die diese Edition ermöglichten.<br />
Bei kaum einer Veranstaltung hat er gefehlt, die Interessen des Vereins auch gegenüber den<br />
Behörden und in anderen Gremien vertreten. Dabei verfügt er, stets von Korrekturfahnen gejagt,<br />
nicht über ein Übermaß an freier Zeit, ist im Grunde seines Herzens auch kein Vereinsmeier und<br />
schon gar keine Stimmungskanone. Die Mitglieder mögen ihren „Professor" und warten beinahe schon<br />
darauf, daß er bei der Begrüßung vergißt, die Anwesenheit von Ehrenmitgliedern gebührend hervorzuheben.<br />
Aber selbst seine kleinen Schwächen sind so liebenswert wie der ganze Mensch, und wer ihn<br />
neben dem Schriftführer einherschreiten sieht, wird mit einem Schmunzeln an die klassischen Gestalten<br />
des Don Quichote und Sancho Pansa erinnert.<br />
Wer will es ihm verargen, daß er seine Vorstandschaft in unserem Verein nur noch bis zur Mitgliederversammlung<br />
dieses Jahres bemessen hat? Der Dank der Mitglieder ist ihm gewiß, und ein otium cum<br />
dignitate hat er sich wahrlich verdient. Daß für ihn Muße aber nicht gleichbedeutend ist mit Müßiggang<br />
versteht sich von selbst. Von den Lasten des Berufs und der Ehrenämter befreit (fast ein Jahrzehnt<br />
wirkte er auch als Kirchenältester der Kaiser-Friedrich-Gedächtnisgemeinde), will er sich nun<br />
endlich seiner speziellen Liebhaberei, der Numismatik des deutschen Mittelalters, widmen. Ist es da<br />
verwegen, ihm an der Schwelle zum achten Lebensjahrzehnt zuzurufen „Zu neuen Ufern lockt ein<br />
neuer Tag"? H. G. Schultze-Berndt<br />
Erich Borkenhagen 75 Jahre<br />
Am 4. März waren 75 Jahre vergangen, seit unser langjähriger stellvertretender Schriftführer, Chefredakteur<br />
i.R. Erich Borkenhagen, das Licht der Welt erblickte. Seinen Geburtstag feierte er in einem<br />
Kreis honoriger Gäste an seinem Ruhesitz in der Lüneburger Heide, Uhlenflucht 12, 3105 Faßberg.<br />
Vielleicht ist der Ausdruck „Ruhesitz" nicht ganz richtig gewählt, wenn man bedenkt, wie rührig und<br />
rüstig der Jubilar immer noch seinen Aufgaben als Journalist nachkommt, wie er ständig mit einer<br />
Vielzahl schriftstellerischer Arbeiten beschäftigt ist und noch mehr Pläne hat, und wie schließlich die<br />
Gesellschaft für die Geschichte und Bibliographie des Brauwesens E.V. ihren Schwung und ihre<br />
umfangreiche Tätigkeit Erich Borkenhagen verdankt. Bei seinen gar nicht so seltenen Besuchen in<br />
Berlin an der Stätte seines einstigen Wirkens kann man mit Freude feststellen, daß der Jubilar innerlich<br />
und äußerlich der alte geblieben ist, vielseitig interessiert und in seinem Tatendrang ungebrochen. Daß<br />
er sich gerade der guten Luft wegen in seiner niedersächsischen Wahlheimat wohl fühlt, sei ihm von<br />
Herzen gegönnt. Daß er unlängst die Reihe seiner Auszeichnungen vom Bundesverdienstkreuz über<br />
die Goldene Delbrück-Denkmünze bis zu einer Ehrung des Deutschen Brauerei-Museums verlängern<br />
konnte, wird ihm niemand neiden.<br />
Weil sich die Mitgliederschaft des Vereins für die Geschichte Berlins so wesentlich verjüngt hat, sei<br />
hier ausdrücklich noch einmal auf die Verdienste verwiesen, die sich Erich Borkenhagen in langen<br />
Jahren der Vorstandstätigkeit um den Verein erworben hat. Herzliche Grüße gehen auch von dieser<br />
Stelle zum Jubilar und zu seiner liebwerten Gattin. H. G. Schultze-Berndt<br />
422
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche zum<br />
70. Geburtstag Frau Gudrun Meilin, Herrn Prof. Dr. Dr. Walter Hoffmann-Axthelm, Erna Becker,<br />
Herta Canon; zum 75. Geburtstag Frau Charlotte Bormann, Herrn Hans Wolff-Grohmann, Frau<br />
Margarete Hoffmann, Herrn Gerhard Krienke, Frau Dore Müller, Jenny Beckert; zum 80. Geburtstag<br />
Frau Ella Klitzke, Herrn Prof. Dr. Adolf Jannasch, Herrn Dr. Alfred Wtorczyk, Frau Maria<br />
Thiemicke.<br />
Buchbesprechungen<br />
Peter H. Rohrlach (Bearb.): Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Teil V: Zauch-Belzig. Weimar:<br />
Böhlaul977. 527 S., 1 Karte, Ln., 36 M. (Veröff. d. Staatsarchivs Potsdam, Bd. 14.)<br />
Gründlich werden auch in diesem Band nach dem bewährten Schema (vgl. dazu die Besprechung<br />
des Bandes „Teltow" in den „Mitteilungen" Jg. 73, 1977, Nr. 2, S. 295) die wichtigsten Daten zur<br />
Geschichte der einzelnen Siedlungen - zu denen die einst so beliebten Ausflugsorte Caputh, Ferch,<br />
Seddin, Treuenbrietzen und Rabenstein gehören - aufgeführt. Da hier zum ersten Mal in der nun<br />
schon stattlichen Reihe der Ortslexika ein außerhalb der ehemaligen Kurmark gelegener Bereich,<br />
der Beiziger Anteil des bis 1952 bestehenden Kreises Zauch-Belzig, mitbehandelt wird, stellten sich<br />
bei der Auswertung des unterschiedlichen Quellenmaterials brandenburgischer und sächsischer Herkunft<br />
einige Probleme. Sie sind von dem Bearbeiter, der hier seinen ersten Band in dieser Reihe vorstellt,<br />
überzeugend gelöst worden. Auch Verbesserungen sind zu notieren: So werden die Siedlungsformen<br />
der Städte ausführlicher behandelt, desgleichen die kirchliche Verfassung. Damit ist dieses<br />
für jeden Landesgeschichtler unentbehrliche Nachschlagewerk noch reichhaltiger geworden.<br />
Felix Escher<br />
Sigurd Hilkenbach, Wolfgang Krämer, Claude Jeaninaire: Berliner Straßenbahngeschichte II. Ein<br />
Bericht über die Entwicklung der Straßenbahn in Berlin nach 1920. Villigen/Schweiz: Verlag Eisenbahn<br />
1977. 216 S. mit 376 Abb., geb. 49 DM.<br />
Das Autoren-Trio Hilkenbach, Kramer und Jeanmaire hat dem ersten Band der 1973 erschienenen<br />
„Geschichte der Berliner Straßenbahnen" einen zweiten im selben Verlag folgen lassen. Das neue<br />
Werk berichtet - gleich seinem Vorläufer - mittels einer langen Reihe fotografischer Reproduktionen<br />
über die mehr als fünfzigjährige Entwicklungsepoche des Berliner Straßenbahnwesens seit der Eingemeindung<br />
der Berliner Vororte im Jahre 1920 bis in die Gegenwart. Mit wahrhaft eindrucksvoller<br />
Akribie haben die Autoren und ihre Helfer aus der rührigen Gilde der Berliner Nahverkehrsfreunde<br />
das oft schwer zu beschaffende Bildmaterial zusammengetragen und ausgewertet.<br />
Wie ersichtlich, wurden einzelne „Oldtimer" mit offenen Plattformen, die teilweise aus den fernen<br />
Tagen des ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts stammten, noch bis zur Mitte der dreißiger Jahre<br />
zur Personenbeförderung eingesetzt. Breiten Raum nimmt die Beschreibung von Spezialfahrzeugen<br />
ein. Fast hundert Fotos führen uns Arbeits-, Kran-, Meß-, Post-, Salz-, Saug-, Schleif- und Turmwagen<br />
vor sowie Güterkipploren, Schneepflüge, Sandtrockner, Drehschemel-Schienentransporter, Unkrautvertilger<br />
und Rangierloks bis hin zur fahrbaren Leihbibliothek und den rollenden Konsum-Verkaufsstellen<br />
kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Leser wird über den Zugang von Fremdfahrzeugen<br />
und die Übergabe Berliner Wagen an ortsfremde Betriebe ebenso orientiert wie über<br />
den Verbleib der Betriebsmittel oder deren Verschrottung. Das sehr genaue Eingehen auf die wechselvolle<br />
Numeration der einzelnen Wagen auch in diesem zweiten Band ist kein Fach-Chinesisch für<br />
Fahrkurbel-Neurotiker, sondern wertvolles Hinweismaterial für die Entwicklung der Schienenfahrzeuge<br />
in Berlin.<br />
423
Es wird des Spree- und des Lindentunnels gedacht, beide über drei Jahrzehnte hindurch im Betrieb.<br />
Sehr informativ ist die lange Liste sämtlicher Berliner Straßenbahnhöfe - eine Vielzahl von ihnen<br />
erscheint im Bild — mit genauen Angaben des Zeitraums ihrer Benutzung. Eine Anzahl weiterer<br />
Fotos zeigt kriegsbedingte Zerstörungen am Wagenpark und Szenen aus der Epoche des Neubeginns<br />
am 20. Mai 1945. dem Tag. an dem ein bescheidener Linienbetrieb auf Kurzstrecken inmitten von<br />
Trümmerbergen und verödet starrender Ruinen wiederaufgenommen wurde. Bezeichnend für diese<br />
Zeit ist das Foto 222, das die im Freien sitzenden Schriftmaler beim Beschriften von Richtungsschildern<br />
auch mit kyrillischen Buchstaben zeigt . . . Bildreportagen von Schlußfahrten vor Linieneinstellungen<br />
und vom Troß zukünftiger Museumsfahrzeuge bei der endgültig letzten Fahrt der Straßenbahn<br />
in West-Berlin 1967 schließen die Berichterstattung über die Atmosphäre, die dem Berliner Straßenbild<br />
mehr als hundert Jahre hindurch sein typisches Gepräge verliehen hat. Den Abschluß des Buches<br />
bildet ein Anhang, in dem der Schweizer Verlag Eisenbahn seine ständig wachsende Leserschaft auf<br />
fast ein halbes Hundert weiterer verkehrstechnischer Schriften hinweist, die sich mit der einschlägigen<br />
Thematik im In- und Ausland befaßt.<br />
Für Papierqualität, klare Drucktypen und Ausstattung des Buches ist dem Verlag zu danken. Die<br />
Bildschärfe der Fotos ist beachtlich. Ebenso ist es der Buchpreis, der auf Anhieb ehrfurchtsvoll tiefes<br />
Durchatmen bewirkt. Die Beantwortung der Frage, ob die Numerierung der Fotos die der Buchseiten<br />
entbehrlich macht, möchte ich offenlassen. Die Nahverkehrsliteratur ist durch diese verdienstvolle<br />
Teamarbeit um eine wertvolle Neuerscheinung bereichert worden. Hans Schiller<br />
Gerhard Engelmann: Heinrich Berghaus. Der Kartograph von Potsdam. Halle/Saale: Deutsche<br />
Akademie der Naturforscher Leopoldina. 411 S., 25 Abb., 2 Tafeln, brosch., 53,40 Mark. (Acta<br />
historica Leopoldina Nr. 10.)<br />
Heinrich Berghaus (1797—1883) dürfte den meisten landesgeschichtlich Interessierten vor allem<br />
als Verfasser eines dreibändigen, 1854—1856 erschienenen „Landbuchs der Mark Brandenburg und<br />
des Markgrafthums Niederlausitz" bekannt sein; 1970 wurde es vom Zentralantiquariat Leipzig nachgedruckt.<br />
Doch stellt diese stattliche Arbeit nur einen kleinen Teil der umfangreichen Lebensarbeit<br />
des aus Westfalen stammenden Geographen, Kartographen und Topographen dar.<br />
In der vorliegenden Arbeit wird mit viel Liebe zum Detail die gesamte wissenschaftliche Leistung<br />
jenes Mannes vorgestellt, der den größten Teil seines Lebens in Potsdam und Berlin ansässig war. Wie<br />
Engelmann eindringlich nachweist, hat Berghaus als Zeitgenosse Humboldts einen nicht unbedeutenden<br />
Anteil an dem Aufstieg der deutschen Kartographie und Geographie zu ihrer Spitzenstellung<br />
gegen Mitte des 19. Jahrhunderts. Hohe öffentliche Auszeichnungen blieben ihm, der sich häufig in<br />
drückenden familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen befand, jedoch versagt. Die Gründe<br />
dafür lagen nicht zuletzt in seiner Persönlichkeit.<br />
Mit dieser Biographie wird zugleich ein Abschnitt europäischer Wissenschaftsgeschichte deutlich.<br />
Dies ist vor allem auch dem umfangreichen Anhang mit dem ausführlichen Anmerkungsapparat, der<br />
Bibliographie von Heinrich Berghaus und dem Quellen-, Literatur- und Personenverzeichnis zu verdanken.<br />
Felix Escher<br />
Max Mechow: Frohnau - die Berliner Gartenstadt. Berlin: Verlag Bruno Hessling GmbH 1977.<br />
96 S., brosch., 19,80 DM. (Berliner Kaleidoskop. Band 24.)<br />
Kurt Pomplun hatte eine seiner Betrachtungen auch Frohnau gewidmet, und das Bedauern, das man<br />
bei der Lektüre empfand, daß sich nämlich über diese Gartenstadt immer noch mehr sagen ließe,<br />
erstreckt sich auch auf den hier vorliegenden Band. Mit Liebe zur Sache und mit Forschersinn ist der<br />
Verfasser vor allem der Gründungsgeschichte Frohnaus nachgegangen, ohne beim heutigen Stand<br />
der Quellen und Erkenntnisse letzte Aufschlüsse geben zu können. Die im Grunde noch überschaubare,<br />
genau 1910 einsetzende Historie Frohnaus wird chronologisch aufgezeigt, die vorhandene<br />
Literatur wird aufgearbeitet. Alteingesessene werden befragt. So ist ein in sich abgerundeter Band entstanden,<br />
in dem man auch Parallelen zur jüngsten Vergangenheit oder zur nächsten Zukunft findet,<br />
etwa im Hinblick auf einen Autobahnbau schon vor 1914. In den dreißiger Jahren hat der Krieg dann<br />
derartige Autobahnpläne verhindert. Seinerzeit hatten es die Eigentumsverhältnisse bewirkt, daß<br />
424
Frohnau von zwei Seiten vom Wald umgeben und damit vom Verkehr abgeriegelt worden war. heute<br />
hat die Mauer diese Funktion übernommen und eine Scheinidylle geschaffen.<br />
Kann man dem Autor ein wohlgefälliges Werk bescheinigen, so müßte man den Verlag rügen, weil<br />
er es versäumt hat, dem Buch einen Lageplan oder eine Landkarte beizugeben, in der die im Text<br />
erwähnten und auch anderen sehenswerten Landhäuser eingezeichnet sind. Die Abbildungen haben<br />
ein recht kleines Format; auch hier wäre es ratsam gewesen, bei den Häusern neben der Straße auch<br />
die Hausnummer abzudrucken. Schließlich soll ein solches Buch nicht in Schränken stehen, sondern<br />
will in die Hand genommen werden. Dann wird aber eine Sammlung loser Blätter schon bald der<br />
Lohn fleißigen Lesens sein. „Nirgendwo stehen so viele Bücherregale wie in Frohnau, nirgendwo gibt<br />
es so viele Musikinstrumente" (H. Erman).<br />
M. Mechow hat seine Aufzählung der in Frohnau wohnhaft gewesenen Gelehrten selbst als unvollständig<br />
und nicht gerecht bezeichnet. Bei den Gärungswissenschaftlern wären in der Tat neben B.<br />
(nicht W.) Drews und H. Gesell ganz gewiß Paul Kolbach und K. Silbereisen zu erwähnen.<br />
„Die Sommerreise erspart, wer (in Frohnau) in frischer Waldluft auf eigener Scholle wohnt" - oder,<br />
wie es der Frohnauer Lokalpoet W. Wolff 1936 dichtete: „Ein ehrlich Stückchen deutschen Grund, /<br />
Erkämpft in sau'ren Jahren / Von Mann und Weib im tapfren Bund / Durch Schaffen und durch<br />
Sparen." Etwas von jenen Gefühlen vermittelt M. Mechows Buch. War es schon immer etwas Besonderes,<br />
ein Spandauer zu sein, so ließe sich dies auch von den Frohnauern sagen. H. G. Schultze-Berndt<br />
r>
in einem Nachtrag von 47 Seiten Länge die Geschichte des in der bisherigen Form nicht mehr weiter<br />
geführten Instituts für Zuckerindustrie Berlin (1867 bis 1977) behandelt wird. Niemand vermutet<br />
unter diesem Titel eine derartige Geschichte des Instituts, der besser ein eigenes (schmales) Heft<br />
hätte gewidmet werden sollen.<br />
Die Geschichte dieses ältesten Zuckerinstituts, das zugleich als das älteste wissenschaftliche Industrieinstitut<br />
der Erde im Lebensmittelbereich gilt, ist aufs engste mit der Geschichte Berlins und mit den<br />
Namen der großen Chemiker Andreas Sigismund Marggraf (1709 bis 1782), der in Berlin die<br />
Saccharose in Rüben entdeckte, und seines Schülers Franz Carl Achard (1753 bis 1821) verknüpft,<br />
der Zuckerrüben systematisch züchtete und den ersten Rübenzucker gewann. 1903 wurde für das<br />
Institut am Wedding in der Amrumer Straße 32 ein Neubau errichtet, dessen Abriß trotz der Bestrebungen<br />
von Denkmalschützern nunmehr beschlossene Sache geworden zu sein scheint. Die Nachkriegshistorie<br />
des Instituts hat stets unter der Tatsache gelitten, daß die westdeutsche Zuckerindustrie<br />
in Braunschweig ein neues Institut für Zuckertechnik errichtet und dann versäumt hat, die beiden<br />
bestehenden Institute zu fusionieren, wie dies etwa die Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in<br />
Berlin mit dem Brauerei-Hochschulverein e.V. in Köln getan hat. Die lesenswerte Darstellung<br />
gerät zuweilen in die Gefahr, personelle Tatbestände und menschliche Schwächen überzubewerten.<br />
Daß dieser beachtlichen Serie historischer Beiträge ein solches Ende beschert wurde und auch die<br />
Zukunft des Zucker-Museums ungewiß bleibt, hätten beide nicht verdient. H. G. Schultze-Berndt<br />
Deutscher Evangelischer Kirchentag - Berlin 1977. Dokumente. Hrsg. im Auftrag des Präsidiums<br />
des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Stuttgart/Berlin: Kreuz-Verlag 1977. 670 S., geb.,<br />
89 DM.<br />
Im Buchtitel und in der Verlagsangabe lesen wir zweimal Berlin, trotzdem fragen wir uns, ob der<br />
Kirchentag 1977 ein für die Geschichte Berlins wesentliches Ereignis war.<br />
Mit seiner Losung „Einer trage des anderen Last" wollte er ebenso den einzelnen ansprechen wie<br />
politische Anstöße geben. Er wollte erreichen, daß die Bürger es den Politikern möglich machen, ja<br />
sie dazu nötigen, im eigenen Land und weltweit Solidarität zu praktizieren. Die Absicht hat also durchaus<br />
historische Dimension. Wenn es gelingt, sie zu verwirklichen, steht das Buch vom Kirchentag 1977<br />
in Berlin mit Recht in der Bücherei des Vereins für die Geschichte Berlins. Das Buch enthält alle<br />
wesentlichen Reden und Resolutionen in vollem Wortlaut. G. Krauß<br />
Märkisches Viertel Berlin. MV Plandokumentation. Berlin: Kiepert 1972. 20 S., 160 Pläne, 6 S. farbige<br />
Abb.. Pappbd. m. Buchschraubenbindung, 96 DM.<br />
Hans Bändel, Dittmar Machule (Hrsg.): Die Gropiusstadt. Der städtebauliche Planungs- und Entscheidungsvorgang.<br />
Berlin: Kiepert 1974. 178 S. m. 78 Abb., Pappbd., 68 DM.<br />
Die beiden vorliegenden Dokumentationen über die größten Wohnsiedlungen der Nachkriegszeit in<br />
Berlin (West) unterscheiden sich sowohl in der Form wie auch im Inhalt. Während im Band über das<br />
Märkische Viertel die architektonischen Lösungsversuche in ihrer Vielfalt durch die Reproduktion<br />
von Aufrissen und Grundrißbeispielen bis hin zu Abbildungen der farbigen Gestaltung von Fassaden<br />
dargestellt werden, steht im Band über die Gropiusstadt der Entwicklungsprozeß der Gesamtkonzeption<br />
des Stadtteils von den Anfängen in den späten 50er Jahren bis 1974 im Mittelpunkt. Die von<br />
Bändel und Machule ausgewählten Aktenstücke der am Planungsvorgang maßgeblich beteiligten<br />
Stellen geben ein anschauliches Bild von dem Kampf, den Walter Gropius und das mit ihm zusammenarbeitende<br />
TAC (The Architects Collaborative) mit den an der Planung beteiligten Senatsdienststellen,<br />
Berliner Kontaktarchitekten und den Wohnungsbaugesellschaften um die Rettung einer<br />
großen Planungskonzeption geführt hat - ein Kampf, in dem Gropius mehr Niederlagen als Siege<br />
erfechten konnte. Es ist ein großes Verdienst der beteiligten Behörden, ihre Archive zur Erstellung<br />
dieser Dokumentation geöffnet zu haben, die beispielhaft den Kampf zwischen Städtebauer, Bürokratie<br />
und Geldgeber aufzeigt. Felix Escher<br />
426
So schön ist Berlin - Aus der Luft und in Farbe. lOmal Berlin. Fotos Günther Krüger. Berliner<br />
Morgenpost. Mappe 1 und Mappe 2. Format DIN A4, je 10,80 DM.<br />
//^•tf&weils zehn ungewöhnliche Motive aus einer ungewöhnlichen Stadt verheißen die Exklusivaufnahmen<br />
der Berliner Morgenpost. Zwar kennen viele Berliner ihre Heimatstadt auch aus der Vogelperspektive,<br />
aber nur im Bereich der Einflugschneisen und aus den von Start und Landung her<br />
bedingten Höhen. Rundflüge, wie sie bei vielen kleineren Städten freundliches Sonntagsvergnügen<br />
sind, verbieten sich hier. Man muß schon ein Berufsfotograf mit guten Beziehungen sein, um diese<br />
Freude vom Hubschrauber aus zu erleben. Die dabei entstandenen Fotos sind in jeder Beziehung<br />
bestechend, sie ergänzen das Bild, das man von seiner Stadt hat. H. G. Schultze-Berndt<br />
Franz Berndal: Berliner Balladen und andere mit einem Scherenschnitt von Manfred Breuer. Saar-<br />
/./brücken: Blitzdruck-Verlag Ulrich Struth, o. J. Brosch., fotomech. vervielfältigt, 56 S., 8 DM. (Zu<br />
^ erhalten über Franz Berndal, Kreuznacher Straße 68III, 1000 Berlin 33.)<br />
Unser Vereinsmitglied Franz Berndal, Inhaber zahlreicher Preise, Autor mehrerer Anthologien und<br />
beliebter Vortragender, legt hier sein 14. Buch nach dem Zweiten Weltkrieg vor.<br />
Die Themen zu den Balladen schöpfte er nach eigenen Worten aus seinen Vorträgen „in Erinnerung<br />
an unvergängliche Zeitepochen von Alt-Berlin". So ist es kein Wunder, daß Berliner und Wahlberliner<br />
Persönlichkeiten Helden seiner Balladen sind, von Theodor Fontane, Adalbert Matkowsky, E. Th. A.<br />
Hoffmann, Ludwig Devrient, Ludwig Wüllner über Otto Reutter, Rotraut Richter bis zu Arthur<br />
Fleischer. In seiner Sprache weiß der Autor den Balladenton aus vergangenen Zeiten zu treffen - der<br />
Vortragskünstler erweist sich aus dem reichen Gebrauch von Interpunktionszeichen. Diesen Band<br />
möchte man nicht nur der älteren Generation empfehlen. H. G. Schultze-Berndt<br />
Eingegangene Bücher<br />
(Besprechung vorbehalten)<br />
\>- Albertz, Heinrich: Dagegen gelebt — von den Schwierigkeiten ein politischer Christ zu sein. Reinbek:<br />
Rohwolt 1976. 124 S.<br />
Berend, Alice: Spreemann & Co. Roman. Frankfurt a. M.: S. Fischer 1976. 287 S.<br />
Behrend, Horst: St. Peter und Paul auf Nikolskoe. Berlin: Christi. Zeitschriftenverlag 1976.<br />
v<br />
63 S. mit Abb.<br />
Benckert, Michael: Brüderlich verbunden. Bischöfe in Berlin. Frankfurt: Lembeck 1977. 146 S.<br />
Brauner, „Atze": Mich gibt's nur einmal. Rückblende eines Lebens. München/Berlin: Herbig 1976.<br />
267 S. mit Abb.<br />
DDR-Handbuch. Hrsg. vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. Wiss. Leitung: Peter<br />
Christian Ludz, unter Mitwirkung von Johannes Kuppe. Köln: Verl. Wissenschaft und Politik<br />
1975. 992 S. mit 111.<br />
Döblin, Alfred: Ein Kerl muß eine Meinung haben. Berichte und Kritiken 1921-1924. 2. Aufl.<br />
Freiburg/Olten: Walter 1976.283 S.<br />
du Bois-Reymond, Manuela, und Burkhardt Soll: Neuköllner Schulbuch. 2 Bände. Frankfurt a.M.:<br />
tj.<br />
Suhrkamp 1974. Zus. 656 S. (Edition Suhrkamp, 681.)<br />
Fontane, Theodor: Briefe an Wilhelm und Hans Hertz 1859-1898. Hrsg. v. K. Schreinert und<br />
" G. Hay. Stuttgart: Klett 1972. 587 S.<br />
Fontane, Theodor: Sämtliche Werke. Hrsg. v. K. Schreinert u. H. Kunisch. München: Nymphenburger<br />
Verlagsanstalt 1975.<br />
Fragmente und frühe Erzählungen. 1194 S.<br />
Literarische Essaysund Studien. Zweiter Teil. 1031 S.<br />
Fontane, Theodor: Hrsg. von Wolfgang Preisendanz. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1973. 490 S.<br />
(Wege der Forschung, Bd. 381.)<br />
427
Graeser, Erdmann: Der blaue Amtsrichter. - Ders.: Das falsche Gebiß. Humoristische Erzählungen<br />
aus der Romanfolge Lemkes sei. Wwe. Mit Zeichnungen von Hans Kossatz. Berlin: Rembrandt<br />
1976 u. 1977.155 u. 142 S.<br />
Grieben-Reiseführer Berlin/Potsdam. München: Grieben 1977. 104 S.<br />
Grisebach, Hanna: Potsdamer Tagebuch. Mit einem Nachwort von Hilde Domin. Heidelberg: Lambert<br />
Schneider 1974. 95 S.<br />
Havemann, Robert: Berliner Schriften. Hrsg. von Andreas W. Mytze. 2. Aufl. Berlin: Verl. Europäische<br />
Ideen 1976. 122 S. mit Abb.<br />
Hennig, Ottfried: Die Bundespräsenz in West-Berlin. Entwicklung und Rechtscharakter. Köln: Verl.<br />
Wissenschaft und Politik 1976. 367 S.<br />
Kardorff, Ursula v.: Berliner Aufzeichnungen 1942—1945. München: Nymphenburger Verlagsanstalt<br />
1976. 336 S. mit Abb.<br />
König, Rolf: Det is knorke. Berliner Witze, Typen und Originale. Berlin: Rembrandt 1975. 127 S.<br />
mit Abb.<br />
Kupferberg, Herbert: Die Mendelssohns. Tübingen. Wunderlich 1972. 303 S.<br />
Maass, Joachim: Kleist. Die Geschichte seines Lebens. Bern/München: Scherz 1977. 416 S. mit<br />
Abb.<br />
Mehring, Walter: Die Linden lang, Galopp. Galopp! Songs, Balladen und Chansons. Berlin (Ost):<br />
Henschel 1976. 187 S.<br />
Möller, Horst: Aufklärung in Preußen. Der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber Friedrich<br />
Nicolai. Berlin: Colloquium 1974. 629 S. (Einzelveröff. d. Histor. Kommission zu Berlin, Bd. 15.)<br />
Müller-Seidel, Walter: Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutschland. Stuttgart: Metzler 1975.<br />
569 S.
Im I. Vierteljahr 1978<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Ursula Blank, Bibliothekarin<br />
1000 Berlin 42, Äneasstraße 21<br />
Tel. 7 05 83 90 (H. P. Freytag)<br />
Dr. Viktor Büber, Arzt<br />
1000 Berlin 42, Wilhelm-Hauff-Straße 21<br />
Tel. 8 52 80 92 (Vorsitzender)<br />
Herbert Düring, Ingenieur<br />
1000 Berlin 19, Dernburgstraße 39<br />
Tel. 3 21 83 80 (Meyer)<br />
Kurt Eichblatt. Studiendirektor i. R.<br />
1000 Berlin 33, Wangerooger Steig 7<br />
Tel. 8 24 51 75<br />
Prof. Dr. Michael Erbe, Hochschullehrer FU<br />
1000 Berlin 28, Ringstraße 23<br />
Tel. 4 04 49 56 (F. Escher)<br />
Johannes Eyfferth, Buchhaltungsleiter i. R.<br />
3430 Witzenhausen, Felsenweg 5<br />
Tel. (0 55 42) 13 03 (Brauer)<br />
Hellmut Georg, Handelsvertreter<br />
1000 Berlin 31, Emser Straße 16<br />
Tel. 87 61 40 (Brauer)<br />
Wanda Georg, Hauswirtschaftsleiterin<br />
1000 Berlin 31, Emser Straße 16<br />
Tel. 87 61 40 (Brauer)<br />
Norbert Goderski, Sozialamtmann<br />
1000 Berlin 33, Wetzlarer Straße 8<br />
Tel. 8 21 57 67 (Brauer)<br />
Klaus Hänel, Student<br />
1000 Berlin 61, Monumentenstraße 26<br />
Tel. 7 85 84 64 (R. Koepke)<br />
Gerda Heckmann, Hausfrau<br />
1000 Berlin 31, Rudolstädter Straße 94<br />
Tel. 8 23 41 76 (Bibliothek)<br />
Hans Heckmann, Ingenieur<br />
1000 Berlin 31, Rudolstädter Straße 94<br />
Tel. 8 23 41 76 (Bibliothek)<br />
Erika Knönagel, Sekretärin<br />
1000 Berlin 10, Lohmeyerstraße 6<br />
Tel. 3 42 77 23 (Dorothea Krahn)<br />
Jutta Leube, Oberregierungsrätin<br />
1000 Berlin 33, Breite Straße 44<br />
Tel. 8 25 74 70 (Brauer)<br />
Heinz Montag, Zahnarzt<br />
1000 Berlin 20, Steinmeisterweg 17 A<br />
Tel. 3 61 81 74 (E. Montag)<br />
Dr. Joachim Neß, Beamter<br />
1000 Berlin 46, Brucknerstraße 10<br />
Tel. 7 71 52 30 (W. Klempin)<br />
Frank Rose, Bibliothekar<br />
1000 Berlin 27, Alt-Heiligensee 63<br />
(Sterry)<br />
Hans-Joachim Scheil, Handelsvertreter<br />
4530 Ibbenbüren/Westf., Rählege 21/23<br />
(Brauer)<br />
Manfred Schneider, Abteilungspräsident<br />
1000 Berlin 19, Kranzallee 7 b<br />
Tel. 3 04 31 88 (Schriftführer)<br />
Ingrid Schultze. Buchbindermeisterin i. R.<br />
1000 Berlin 33, Habelschwerdter Allee 10<br />
Tel. 8 32 60 80 (Frau Kaeber)<br />
Annemarie Wockenfuß, Gewerbelehrerin i. R.<br />
1000 Berlin 62, Freiherr-vom-Stein-Straße 5<br />
Tel. 8 54 65 57 (Frau P. Struckmann)<br />
Unser Jahrbuch „Der Bär von Berlin" wird im Spätsommer erscheinen. Die Mitglieder erhalten dann<br />
den Band zugeschickt, soweit sie den fälligen Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr (z.Z. 36 DM)<br />
entrichtet haben. Der Ladenpreis wird bei ca. 20 DM liegen.<br />
An den Sonnabenden 8. April, 15. April und 6. Mai 1978 finden für die bereits gemeldeten Teilnehmer<br />
die Exkursionen nach Potsdam statt. Nach der Besichtigung des Theodor-Fontane-Archivs ist ein<br />
Spaziergang durch die Fußgängerzone am Brandenburger Tor zur Friedenskirche, zum Schloß<br />
Sanssouci und durch den in diesem Winter zurückgeschnittenen Park Charlottenhof vorgesehen. Den<br />
Teilnehmern ist bereits das genaue Programm zugegangen.<br />
429
Gleichzeitig soll hier eine weitere Exkursion angezeigt werden.<br />
Sonnabend, den 3. Juni 1978, nach Rheinsberg.<br />
Unter der Leitung von Herrn Joachim Schlenk.<br />
Dienstag, 23. Mai 1978, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Günter Wollschlaeger als Einführung<br />
für die Fahrt nach Rheinsberg im Rathaus Charlottenburg.<br />
Interessierte Mitglieder müssen sich schriftlich mit genauer Anschrift und Angabe der Telefonnummer<br />
bis zum 30. April 1978 anmelden bei:<br />
Herrn Joachim Schlenk, Potsdamer Straße 40,1000 Berlin 45.<br />
Voranzeige der Studienfahrt 1978 nach Goslar<br />
Vorsorglich sei heute schon darauf hingewiesen, daß die diesjährige Exkursion auf Anregung der Kurund<br />
Fremdenverkehrsgesellschaft Goslar vom 1. bis 3. September 1978 nach Goslar führt, um den<br />
Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, das diesjährige Goslarer Altstadtfest zu besuchen. Es ist<br />
vorgesehen, am Freitagnachmittag in den Lehrstollen im Rammeisberg einzufahren. Der ganze Sonnabend<br />
wird von der Besichtigung Goslars in Anspruch genommen. Am Sonntagvormittag schließt<br />
eine Fahrt in den Oberharz das Programm ab; es werden Gräben, Teiche und Talsperren der dortigen<br />
Wasserwirtschaft besichtigt, die im 16. Jahrhundert vom Bergbau ins Leben gerufen worden ist und<br />
erst in unseren Tagen anderen Zwecken nutzbar gemacht wurde.<br />
Um die heikle Frage der Bettenzahl möglichst frühzeitig zu klären, werden Interesseriten an dieser<br />
Studienreise gebeten, unverbindlich eine Postkarte an den Schriftführer, Dr. H. G. Schultze-Berndt.<br />
Seestraße 13. 1000 Berlin 65, zu senden und dort ihre Zimmerwünsche anzugeben. Das genaue Programm<br />
wird im nächsten Heft der „Mitteilungen" veröffentlicht; die daraufhin erbetenen festen<br />
Anmeldungen sind dann entscheidend für die Teilnahme an der Exkursion. H. G. Schultze-Berndt<br />
Tagesordnung der Ordentlichen Mitgliederversammlung<br />
1. Entgegennahme des Tätigkeitsberichts, des Kassenberichts und des Bibliotheksberichts<br />
2. Bericht der Kassenprüfer und der Bibliotheksprüfer<br />
3. Aussprache<br />
4. Entlastung des Vorstandes<br />
5. Ersatzwahl für den Vorstand<br />
6. Wahl von zwei Kassenprüfern und von zwei Bibliotheksprüfern<br />
7. Ernennung von Ehrenmitgliedern<br />
8. Verschiedenes<br />
Anträge aus dem Kreis der Mitglieder sind spätestens am 16. April 1978 der Geschäftsstelle einzureichen.<br />
Anschließend zeigt unser Mitglied Karl-Heinz Kretschmer seine Filme von der Studienfahrt 1977 ins<br />
Hannoversche Wendland.<br />
Um sehr pünktliches Erscheinen wird gebeten.<br />
430
Die Veröffentlichungen des Vereins<br />
Von den früheren Ausgaben des Jahrbuchs<br />
DER BÄR VON BERLIN<br />
sind folgende Bände noch erhältlich:<br />
1953, 1957/58 und 1960 je 4,80 DM; 1961 bis 1964 je 5,80 DM; 1965 (Festschrift)<br />
38- DM; 1968 und 1969 je 9,80 DM; 1971 und 1972 je 11,80 DM;<br />
1973 bis 1975 je 12,80 DM; 1976 und 1977 je 18,50 DM.<br />
MITTEILUNGEN<br />
des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
erscheinen vierteljährlich im Umfang von 32 Seiten. Sie enthalten in der<br />
Regel mehrere Artikel mit Themen zur Berliner Geschichte (mit Abbildungen),<br />
Nachrichten zu aktuellen Anlässen und aus dem Vereinsleben,<br />
Buchbesprechungen und das Programm der laufenden Veranstaltungen<br />
des Vereins.<br />
Einzelhefte aus früheren Jahrgängen sind zum Stückpreis von 4,- DM<br />
noch erhältlich.<br />
Von der neuen Folge der<br />
Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
sind bisher erschienen:<br />
Heft 59: Johann David Müller, Notizen aus meinem Leben (1973)<br />
Preis 9,80 DM<br />
Heft 60: W. M. Frhr. v. Bissing, Königin Elisabeth von Preußen. (1974)<br />
Preis 11,80 DM<br />
Heft 61: Wolfgang Ribbe, Quellen und Historiographie zur mittelalterlichen<br />
Geschichte von Berlin-Brandenburg. (1977)<br />
Konrad Kettig, Goetheverehrung in Berlin. Ein Besuch von<br />
August und Ottilie von Goethe in der preußischen Residenz 1819.<br />
(1977) Preis 16,80 DM<br />
Alle Preise zuzüglich Porto<br />
Bestellungen sind an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten:<br />
Albert Brauer, Blissestraße 27,1000 Berlin 31<br />
431
Veranstaltungen im II. Quartal 1978<br />
1. Dienstag, 18. April 1978, 19.30 Uhr: Lichtbildervortrag von Herrn Johann Schöbeck:<br />
„Altberliner Reminiszenzen". Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
2. Sonnabend, 29. April 1978, 15 Uhr: Besuch des Dominikanerklosters St. Paulus,<br />
Berlin 21, Oldenburger Straße 46. Führung: Pater Burkhard O.P. Busse: 23, 24, 70, 72<br />
und 89.<br />
3. Mittwoch. 10. Mai 1978, 19.30 Uhr: Ordentliche Mitgliederversammlung im Bürgersaal<br />
des Rathauses Charlottenburg.<br />
Die Tagesordnung ist auf Seite 430 ausgedruckt.<br />
4. Freitag, 12. Mai 1978, 17 Uhr: Besuch des Ateliers des Bildhauers Professor Bernhard<br />
Heiliger, Berlin 33, Käuzchensteig 12. Führung: Professor Bernhard Heiliger. Bus: 60.<br />
5. Sonnabend, 17. Juni 1978, 10 Uhr: Führung durch Herrn Felix Escher: „Entwicklung<br />
eines vorstädtischen Bereiches - Tempelhof". Treffpunkt: Reinhardtstraße Ecke Alt-<br />
Tempelhof. (U-Bahnhof Alt-Tempelhof.)<br />
6. Dienstag, 27. Juni 1978, 17 Uhr: Führung von Herrn Dr. Peter Letkemann durch die<br />
Ausstellung im Geheimen Staatsarchiv: „Der Berliner Kongreß 1878". Berlin 33,<br />
Archivstraße 12. Busse: 1 und 68, U-Bahn: Dahlem-Dorf.<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek ist<br />
zuvor jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Veranstaltungen geselliges<br />
Beisammensein im Ratskeller.<br />
Freitag, 28. April, 26. Mai und 30. Juni, zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek<br />
ab 17 Uhr.<br />
Bitte beachten Sie auch die Voranzeigen auf den Seiten 429 und 430.<br />
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. W. Hoffmann-Axthelm. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1000 Berlin 31,<br />
Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1000 Berlin 65. Seestraße<br />
13, Ruf 45 3011. Schatzmeister: Ruth Koepke. 1000 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf<br />
6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins: Berlin West 433 80-102, 1000 Berlin 21. Bankkonto<br />
Nr. 038 180 1200 bei der Berliner Bank, 1000 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1000 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung Claus P. Mader, 1000 Berlin 41, Bismarckstraße 12; Felix Escher.<br />
Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt. Bezugspreis für Nichtmitglieder 16 DM<br />
jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1000 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
432
**«***,* .ZI A20 377F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
74. Jahrgang Heft 3 Juli 1978<br />
^£&- '<br />
-•*j m sJtf'JL'<br />
Das Siegesdenkmal auf dem Königsplatz, dem heutigen Platz der Republik<br />
433
Ein hundertjähriges Buch und seine Vettern<br />
Zu Robert Springers „BERLIN UND DIE DEUTSCHE KAISERSTADT"<br />
Von Hans-Werner Klünner<br />
Vor 45 Jahren brachten unsere „Mitteilungen" im 50. Jahrgang (1933), Heft 3, Seite 86 f.,<br />
eine kleine Abhandlung von Dr. Erich Fabian unter dem Titel „Zentenarfeier eines Prachtwerkes",<br />
über einen damals Hundertjährigen, nämlich Samuel Heinrich Spikers „Berlin und<br />
seine Umgebungen im 19. Jahrhundert". Felix Hasselberg wies später im Beiblatt Nr. 1/<br />
1937 nochmals auf das Jubiläum dieses „Klassikers" unter den illustrierten Berlin-Büchern<br />
hin. Der „Spiker", damals schon selten und teuer - die Originalausgabe wurde zwischen<br />
90 und 150 RM gehandelt - ist heute im Original noch seltener und für Normalverbraucher<br />
von Berolinensien unerschwinglich geworden; in der Mai-Auktion 1977 bei<br />
Bassenge erbrachte das vollständige Exemplar (mit 104 Stichen auf 52 Tafeln) 9000 DM.<br />
Die Hälfte dieses Preises erzielte auf der gleichen Auktion der Hundertjährige, dem diese<br />
Zeilen gewidmet sind. Um die Jahreswende 1877/78 erschien - erstmals nach der Reichsgründung<br />
von 1871 als Schilderung der neuen Reichshauptstadt - das Buch: „BERLIN DIE<br />
DEUTSCHE KAISERSTADT nebst POTSDAM UND CHARLOTTENBURG in PHOTO<br />
GRAPHISCH TREUEN STAHLSTICHEN. Mit historisch topographischem Text von<br />
ROBERT SPRINGER. DARMSTADT 1877. VERLAG VON FRIEDRICH LANGE." So der<br />
gestochene Titel, der darauf folgende gesetzte Titel lautet etwas anders: „Berlin die deutsche<br />
Kaiserstadt nebst Potsdam und Charlottenburg mit ihren schönsten Bauwerken und<br />
hervorragendsten Monumenten. Eine malerische Wanderung in Buch und Bild für Einheimische<br />
und Fremde von Robert Springer. Mit 48 photographisch treu ausgeführten<br />
Original-Stahlstichen. Darmstadt 1878. Verlag von Friedrich Lange." Eine zweite Auflage<br />
des Werkes erschien Ende 1881, nach damaliger Sitte vordatiert auf 1882, im Verlag von<br />
H. Bokelmann in Frankfurt am Main. (1969 veranstaltete die Verlagsbuchhandlung Haude<br />
& Spener in Berlin einen Neudruck nach der ersten Auflage, in dem allerdings ein Stahlstich<br />
weniger als im Original enthalten ist.) Neben der Buchausgabe, die es auch als großformatige<br />
Prachtausgabe auf Japanpapier gedruckt gab, wurden die Stahlstiche auch einzeln verkauft.<br />
Noch vor dem Krieg konnte man sie billig bei den Bücherkarren rings um die Universität<br />
erwerben. Das ganze Buch war damals häufig zum Preis zwischen zehn und zwanzig<br />
Mark zu haben. Noch 1958 bot ein Berliner Antiquariat die 2. Auflage für 25 DM an.<br />
Die in den letzten Jahren lawinenartig angeschwollene Nachfrage nach Berlin-Stichen ließ<br />
denn auch den Neudruck des früher so wenig wert erachteten Buches möglich werden.<br />
Unsere Vereinsbibliothek zum Beispiel besaß den Band (nach Ausweis der gedruckten<br />
Bücherverzeichnisse) vor dem ersten Weltkrieg nicht.<br />
Das Interesse an den Stahlstichen hat den Verfasser des Textes völlig in den Hintergrund<br />
treten lassen, obwohl dieser zu seiner Zeit in Berlin kein Unbekannter war. Der „Allgemeinen<br />
Deutschen Biographie", Bd. 35 (1893), Seite 319 ff., können wir über ihn zusammengefaßt<br />
etwa folgendes entnehmen: Robert Springer, geboren am 23. November 1816 zu<br />
Berlin als Sohn eines Juweliers, besuchte 1835 bis 1838 das Berliner Stadtschullehrer-<br />
Seminar und war anschließend Lehrer an einer höheren Mädchenschule. Seit 1840 freier<br />
Schriftsteller, lebte er nach mehrjährigen Aufenthalten in Paris, Rom, Wien und Leipzig<br />
von 1853 an ständig in Berlin, wo er als Mitarbeiter im Feuilleton großer Tageszeitungen<br />
434
u CWürbs photo§:<br />
itraa Ha:K©a1>i3i:]Ka]Ra:i£i^ TX araruicass,<br />
J.KKolb siulp.' -_<br />
435
und Zeitschriften auf dem Gebiet der Kunst- und Literaturgeschichte, sowie der kultur- und<br />
lokalgeschichtlichen Skizze tätig war. Er starb in Berlin am 21. Oktober 1885.<br />
Springer war Verfasser einer längeren Reihe damals beliebter Jugendschriften, die er unter<br />
dem Pseudonym „Adam Stein" veröffentlichte, sowie von Romanen historischen oder<br />
historisch-politischen Charakters, die er unter seinem bürgerlichen Namen herausgab.<br />
Sehr intensiv befaßte er sich mit der Geschichte der klassischen Weimarer Epoche. Diese<br />
Arbeiten Springers sind heute vergessen, während seine lokalgeschichtlichen und lokalpsychologischen<br />
Studien noch unser Interesse beanspruchen können. Neben einzelnen<br />
Abhandlungen in den Zeitschriften „Gartenlaube" und „Über Land und Meer", die zum<br />
Teil in seine Bücher übernommen wurden, seien hier genannt: „Berlins Straßen, Kneipen<br />
und Klubs im Jahre 1848" (Berlin 1850); „Berlin. Ein Führer durch die Stadt und ihre<br />
Umgebungen" (Leipzig 1861); siehe hierzu die Rezension des Neudrucks durch Peter<br />
Letkemann in den „Mitteilungen", 74. Jg. (1978), Heft 1, Seite 396; „Berlin wird Weltstadt.<br />
Ernste und heitere Kulturbilder" (Berlin 1868); „Berliner Prospekte und Physiognomien"<br />
(Berlin 1870) und die Novelle „Banquier und Schriftsteller. Ein Lebensbild aus<br />
der Berliner Gesellschaft" (Berlin 1877), die unter Verwendung von Motiven, Persönlichkeiten<br />
und Schauplätzen der Wirklichkeit geschrieben ist. Diese Novelle ist eine Art<br />
Schlüsselroman und könnte vielleicht als einer der ältesten Ansätze zu einem realistischen<br />
„Berliner Roman" gesehen werden.<br />
Der Text von „Berlin — die deutsche Kaiserstadt" war in Springers Schaffen auch nur ein<br />
Nebenprodukt, er hat ihn wahrscheinlich ohne Kenntnis der vorgesehenen Illustrationen<br />
verfaßt. Die Stahlstiche wurden dann recht und schlecht - weitab von Berlin und ohne<br />
Kenntnis der Örtlichkeit - dem Text eingefügt. Er ist im Ganzen genommen eine Kompilation,<br />
in der wir neben einer geschichtlichen Einleitung, unter dem Motto „Vom Fischerdorf<br />
bis zur Kaiserstadt" an Adolf Streckfuß' „Vom Fischerdorf zur Weltstadt" anklingend,<br />
mehrere Texte aus seinen früheren Büchern finden, die mit verbindenden Abschnitten den<br />
Leser durch die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten und Errungenschaften führen. Wenn<br />
auch hier das Wort von Springers Biographen Ludwig Fränkel zutrifft, daß sein „Darstellungsvermögen<br />
sich nirgends zu künstlerischer Höhe aufschwingt", so ist der Text doch für<br />
die Zustände im Berlin der Zeit nach den Gründerjahren - 1871 bis 1875 - durchaus<br />
informativ.<br />
Ganz anders ist es mit den Stahlstichen! Der Verlag Friedrich Lange in Darmstadt war<br />
Nachfolger der Firma von Gustav Georg Lange, dem seinerzeit führenden Unternehmen<br />
auf dem Gebiet der Ansichtenwerke und der Verbreitung des Stahlstiches in Deutschland.<br />
Dieser Verlag hatte in seinem Buch „Berlin und seine nächsten Umgebungen in malerischen<br />
Originalansichten. Historisch-topographisch beschrieben von Ludwig Rellstab" (erste<br />
Auflage 1852, zweite Auflage 1855) sowie in dem gleichfalls 1852 erschienenen zehnten<br />
Band der Reihe „Original-Ansichten von Deutschland nach der Natur aufgenommen von<br />
Ludwig Rohbock, Carl Würbs u.a., in Stahl gestochen von deutschen Künstlern mit einem<br />
historisch-topographischen Text", bereits eine ganze Anzahl von Ansichten aus Berlin und<br />
seiner Umgebung veröffentlicht. Nun, nach zwanzig Jahren, finden wir viele davon im<br />
„Springer" wieder, allerdings mit zeitgemäß veränderter Staffage: die Bäume sind höher,<br />
die Gebüsche sind dichter, weitaus mehr Menschen beleben die Szenerie und der elegante<br />
Pferdeomnibus fehlt nicht. Zeichner und Stecher sind zwar dieselben geblieben, aber es<br />
heißt nicht mehr: Gez. von L. Rohbock bzw. C. Würbs, sondern: L. Rohbock Photogr.<br />
Das „Photogr." ist eine Konzession an den Publikumsgeschmack, der im Zeitalter der sich<br />
436
ausbreitenden Fotografie großen Wert auf fotografisch getreue Wiedergabe der Ansichten<br />
legte.<br />
Die Auswahl der Bilder war also vom Fundus des Verlages abhängig und paßt daher vielfach<br />
nicht zum Text. Neben den älteren, nur in der Staffage modernisierten Motiven, die in<br />
der Hauptsache die bekannten Prachtbauten zwischen Brandenburger Tor und Schloß<br />
zeigen, finden wir als Darstellung der Gegenwart - die Zeit nach 1871 - nur etwa ein<br />
Dutzend Ansichten, zum Beispiel das Rathaus, die Nationalgalerie, die Synagoge, die<br />
„Kaiserpassage" Friedrichstraße —Unter den Linden, die Englische Botschaft in der<br />
Wilhelmstraße (das vormalige Palais Strousberg), die Siegessäule, die Börse, den Zoologischen<br />
Garten und das Reichstagsgebäude. Das letztere, mit dem Titel „Das deutsche<br />
Reichstagsgebäude in Berlin. Nach seiner Vollendung" ist freilich ein Kuriosum: Der Text<br />
im Buch beschreibt nämlich kurz das provisorische Reichstagshaus in der Leipziger Straße 4,<br />
welches durch einen nach Hitzigs und Gropius' Plänen ausgeführten Umbau des ehemaligen<br />
Hauptgebäudes der Königlichen Porzellanmanufaktur entstanden war. Dieses Provisorium<br />
wurde bis zur Fertigstellung des Wallot-Baues am heutigen Platz der Republik im<br />
Jahre 1894 benutzt. Der Stahlstich jedoch zeigt - ohne einen erläuternden Hinweis im<br />
Text - den aus dem ersten Reichstagswettbewerb von 1872 stammenden und mit dem<br />
ersten Preis ausgezeichneten Entwurf des Deutsch-Russen Ludwig Bohnstedt, der wegen<br />
der ungeklärten Platzfrage damals nicht ausgeführt wurde. Für die Jahre 1877/78 ganz und<br />
gar unrichtig ist auch die Wiedergabe der Nikolaikirche in Berlin. Als das Buch erschien,<br />
war gerade die durchgreifende Restaurierung der Kirche beendet, die ihr den uns noch<br />
bekannten Doppelturm brachte, während der Stich noch die alte eintürmige Front zeigt.<br />
Mögen diese Ungereimtheiten für die Ausgabe von 1877/78 noch hingehen, so führt die in<br />
Illustration und Text völlig unveränderte zweite Auflage den Leser völlig in die Irre. Inzwischen<br />
waren in Berlin so viele Veränderungen geschehen, daß das Buch total überholt war.<br />
Es ist allerdings anzunehmen, daß die zweite Auflage ein Teildruck der ersten ist, dem man<br />
wegen des Verlagswechsels nur ein neues Titelblatt gab. Zu beachten ist, daß das Buch auf<br />
dem typographischen Titel nur noch „Die deutsche Kaiserstadt" heißt, während der vorgeklebte<br />
gestochene Titel den alten Wortlaut „Berlin die deutsche Kaiserstadt" führt. Auch<br />
auf der Einbanddecke ist das Wort „Berlin" verschwunden. Was mag der Grund für diese<br />
merkwürdige Neuauflage gewesen sein?<br />
Der Verlag von Otto Spamer, Berlin und Leipzig, hatte im Juli 1881, vordatiert auf 1882,<br />
ein illustriertes Berlin-Buch auf den Markt gebracht unter dem Titel: „Die deutsche Kaiserstadt<br />
Berlin. Stadtgeschichten, Sehens- und Wissenswerthes aus der Reichshauptstadt und<br />
deren Umgebung. Von Ernst Friedel, Stadtrath von Berlin und Dirigent des Märkischen<br />
Provinzialmuseums." Mit 110 Holzschnitten, drei Tonbildern, einer Vogelschauansicht und<br />
einem Stadtplan, war es reich ausgestattet und mit dem Preis von 4 Mark auch ziemlich<br />
wohlfeil. Zur gleichen Zeit erschien es als Band 9 des Sammelwerks „Deutsches Land und<br />
Volk", erweitert durch einen von Oskar Schwebel verfaßten Teil über die Mark, mit dem<br />
Titel „Bilder aus der Mark Brandenburg, vornehmlich der Reichshauptstadt".<br />
Stadtrat Ernst Friedel, von 1884 bis 1891 auch 1. Vorsitzender unseres Vereins, war der<br />
berufene Mann für dieses Buch, dessen Abfassung dem Magistrat sehr gelegen kam, weil<br />
die Stadt Berlin sich vom Reichskanzler Bismarck auf das heftigste angegriffen sah. Der<br />
Kanzler hatte nämlich in der Reichstagsrede am 4. März 1881 der Berliner Stadtverwaltung<br />
gedroht, den Sitz des Reichstages und der Regierung in eine andere Stadt der Monarchie<br />
zu verlegen. Der Anlaß dazu war ein Streit mit dem Magistrat über die Höhe der Miet-<br />
437
Anzeige aus: Illustrirte Berliner Wochenschrift „Der Bär", Eine Chronik für's Haus. Berlin, 16. Juli<br />
1881<br />
Steuer, welche der Kanzler für ungerechtfertigt hielt. Den tieferen Grund für diese spektakuläre<br />
Äußerung bildet aber der Groll Bismarcks über die politische Haltung der Berliner<br />
Stadtverordnetenmehrheit, den von ihm so genannten „Fortschrittsring". Nicht zuletzt dem<br />
Kronprinzen Friedrich Wilhelm, dem späteren Kaiser Friedrich III., war es zu verdanken,<br />
daß die Bismarckschen Verlegungspläne nicht weiterverfolgt wurden.<br />
Möglicherweise ist also das Friedeische Kaiserstadt-Buch der Grund für die Neuauflage des<br />
„Springer" gewesen. Vielleicht sollte sie auch Rechte am Titel sichern, denn die Übereinstimmung<br />
mit den Konkurrenten war zu augenfällig. Doch das Durcheinander sollte noch<br />
größer werden, die Kaiserstadt-Mode eine neue Blüte treiben, als im Dezember 1882 das<br />
Lieferungswerk „Die deutsche Kaiserstadt Berlin und ihre Umgebung. Geschildert von<br />
Max Ring. Verlag von Heinrich Schmidt & Carl Günther. Leipzig 1883" zu erscheinen<br />
begann. Die aufwendige Publikation mit insgesamt 313 Abbildungen umfaßte 30 Hefte<br />
zum Preise von je einer Mark. Auch hier waren die Illustrationen nur zum Teil neu angefertigt,<br />
viele waren schon früher in verschiedenen Zeitschriften, wie „Bär", „Gartenlaube",<br />
„Über Land und Meer" usw., gebracht worden; auch unser Verein hatte eine Anzahl<br />
Druckstöcke dazu hergeliehen. Im Frühjahr 1884 lag das Werk abgeschlossen vor. Sein<br />
Verfasser, Dr. med. Max Ring (1817 bis 1901), war ein im Berlin-Feuilleton geübter<br />
Schriftsteller und seit Anfang der 50er Jahre auf diesem Gebiet tätig. Interessant ist<br />
Theodor Fontanes Urteil über ihn, das wohl auch heute nicht revidiert zu werden braucht:<br />
„Die Sachen von der Marlitt, von Max Ring, von Brachvogel, Personen, die ich gar nicht<br />
als Schriftsteller gelten lasse, erleben nicht nur zahlreiche Auflagen, sondern werden<br />
womöglich ins Vorder- und Hinterindische übersetzt; um mich kümmert sich keine<br />
Katze" (aus einem Brief an seine Frau Emilievom 15. Juni 1879).<br />
438
Anzeige aus:<br />
Drittes Beiblatt zur<br />
Illustrirten<br />
Berliner Wochenschrift<br />
„Der Bär".<br />
Berlin, 23. Dezember 1882<br />
von<br />
.• Mit30ÖJllustralionen.<br />
M%(£2 l.f1lm-k.<br />
Am Schluß unserer Plauderei über das merkwürdige Kaiserstadt-Trio - August Trinius'<br />
im Herbst 1888 erschienenes Buch „Die Umgebungen der Kaiserstadt Berlin in Wort und<br />
Bild" behandelt hauptsächlich die damals nicht zu Berlin gehörenden Teile der Mark<br />
Brandenburg und bleibt hier unberücksichtigt - soll noch darauf hingewiesen werden, daß<br />
der uns so geläufige Begriff „Reichshauptstadt" damals amtlich nicht gebraucht wurde und<br />
erst langsam im Vordringen war. Berlin hieß offiziell die „Königliche Haupt- und Residenzstadt",<br />
Reichshauptstadt wurde es amtlich erst am 1. Dezember 1936 mit dem „Gesetz<br />
über die Verfassung und Verwaltung der Reichshauptstadt Berlin". Die Bezeichnung als<br />
„Kaiserstadt" zeigte in den Jahren nach der Reichsgründung den allgemeinen Stolz auf das<br />
neue Reich und den besonderen Stolz der Berliner über die Rangerhöhung der preußischen<br />
Metropole zu einer der alten Kaiserstadt Wien ebenbürtigen Residenz des neuen<br />
deutschen Kaisers.<br />
Alle Abbildungen aus dem Archiv des Verfassers.<br />
Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 42, Felixstraße. 13<br />
439
Die Hauptstadt und die Havelstadt<br />
Berlin und Spandau in ihren wechselseitigen Beziehungen<br />
(Fortsetzung und Schluß aus Heft 1/1978)<br />
Von Arne Hengsbach<br />
Nach dem großen „Krach", der die Gründerzeit beendet hatte, war im Berliner Grundstücksgeschäft<br />
eine Flaute eingetreten, der dann in den neunziger Jahren wieder eine Belebung<br />
des Grundstücksmarktes folgte. Der nun einsetzende Aufschwung der Grundstücksund<br />
Bauspekulation konnte um so erfolgreicher verlaufen, als sie durch die inzwischen<br />
getroffenen Verbesserungen im Eisenbahnverkehr, die Einrichtung der Vorortzüge und die<br />
Einführung verbilligter Vororttarife gefördert wurde. Für die Gründer jähre um 1870<br />
waren die von Aktiengesellschaften ins Leben gerufenen Landhaus- und „Cottage"-<br />
Siedlungen sowie Mietskasernenquartiere verschiedener Prägung typisch gewesen. Die<br />
Gründerzeit hatte überall Wohnraum geschaffen. Auch jetzt widmete das Grundstücksgeschäft<br />
wiederum einen großen Teil seiner Bestrebungen der Anlage von Wohnsiedlungen;<br />
daneben aber erhielt die Grundstücksbewegung neue Antriebe durch die Standortveränderungen<br />
der Berliner Industrie.<br />
Diese fand an ihren Stammsitzen, etwa in der Chausseestraße nahe beim Stettiner Bahnhof<br />
oder in der Luisenstadt, keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Überall von hochgeschossiger<br />
Bebauung umgeben waren die Firmen gezwungen, in einer Enge, die als immer drangvoller<br />
empfunden wurde, zu produzieren. Sie suchten daher mehr oder weniger umfangreiche<br />
Grundstückskomplexe im näheren und weiteren Umland der Reichshauptstadt, wo eine<br />
Vergrößerung der Werkanlagen auch für eine längere Zeit durchführbar schien. Dabei<br />
spielten die Schwierigkeiten, die eine mangelhafte Erschließung derartiger entfernt gelegener<br />
Terrains mit sich brachten, häufig eine zweitrangige Rolle. Wichtig war, daß ein<br />
Eisenbahn- oder Wasseranschluß gleich oder in absehbarer Zeit hergestellt werden konnte.<br />
Den Arbeitern konnte nach der damaligen Einstellung die Unbequemlichkeit eines langen<br />
Weges zwischen Wohnung und Arbeitsstätte durchaus zugemutet werden. Außerdem<br />
sorgte eine rührige Bauspekulation oft dafür, daß in der Nähe abgelegener Fabriken auch<br />
Wohnhäuser für die dort Beschäftigten errichtet wurden. Bei einer wohlwollenden Handhabung<br />
der Ausnahme vom ortsgesetzlichen Bauverbot an unfertigen Straßen nach § 12 des<br />
Fluchtliniengesetzes von 1875 war die Schaffung solcher abgelegenen Wohnquartiere<br />
durchaus möglich.<br />
Nun, ein Vierteljahrhundert nach der Gründerzeit, schwappten die Wellen des Berliner<br />
Grundstücks- und Baugeschäfts abermals bis nach Spandau hin, und diesmal wurde die<br />
Havelstadt mit ihrer Umgebung auf die Dauer in den Bereich des Berliner Terraingeschäftes<br />
einbezogen. Das konnte um so leichter geschehen, als jetzt, um 1900, die Aufhebung der<br />
Spandauer Festung und damit auch die der Baubeschränkungen und -verböte aufgrund der<br />
Rayonvorschriften in absehbarer Zeit zu erhoffen stand. Im einzelnen wirkte die oben<br />
skizzierte Entwicklung in und bei Spandau sich so aus:<br />
Im Jahre 1896 kaufte die Firma Schwartzkopff in Staaken, also noch jenseits von Spandau,<br />
ein großes Areal Ackerland an, um hier eine Fabrikanlage zu errichten. Von diesem Vorhaben<br />
kam das Unternehmen allerdings wieder ab; es siedelte sich 1899 nicht in Staaken,<br />
sondern in Wildau bei Königswusterhausen an. Auf dem Staakener Terrain der Firma<br />
440
sollte dann 1914 die Gartenstadt Staaken entstehen. Zwei Jahre später, 1898, ließ sich im<br />
äußersten Westen des Spandauer Weichbildes unweit der Staakener Grenze die Firma<br />
Orenstein & Koppel nieder, um hier eine Fabrik für Eisenbahnbedarf zu errichten. Im<br />
Osten Spandaus, in Paulstern und Sternfeld, richtete 1888— 1891 die alte chemische.Fabrik<br />
von A. Motard aus der Gitschiner Straße ihre Stearin- und Oleinfabrikation ein. Noch weiter<br />
östlich, in den einsamen Wiesen an der Spree und am Nonnendamm, unfern der Charlottenburger<br />
Grenze, erwarb die Firma Siemens seit 1897 Terrains, da ihre Grundstücke an<br />
der Markgrafenstraße und am Salzufer eine Erweiterung der Fertigungen nicht mehr<br />
zuließen. Das an der Unterspree neu erbaute Kabelwerk nahm 1899 seinen Betrieb auf, ein<br />
Jahr später beschäftigte es bereits 1200 Personen.<br />
Zu diesen Gründungen, die der Initiative der betroffenen Firmen entsprungen waren,<br />
gesellte sich die bewußt geplante Industrieansiedlung auf kommerzieller Grundlage. Die<br />
Berliner „Grundrentengesellschaft" erwarb im Jahre 1900 ein über 600 000 m 2 großes<br />
Wiesengelände in der „Maselake" bei Hakenfelde und erschloß dieses Terrain für industrielle<br />
Zwecke. In den Straßen, die das künftige Industriegelände durchziehen sollten,<br />
wurden die Gleise einer Güteranschlußbahn verlegt und für den Schiffsverkehr ein Stichkanal<br />
angelegt. Zwar ist in der Folgezeit die Veräußerung von Teilflächen des Geländes an<br />
Interessenten zunächst schleppend und unbefriedigend verlaufen, darüber darf aber nicht<br />
außer acht gelassen werden, daß dieses Vorhaben der Grundrentengesellschaft eines der<br />
frühesten Groß-Terraingeschäfte war, die nicht Wohnsiedlungen, sondern Industriegebiete<br />
schaffen wollten.<br />
Die allgemeine Terrainspekulation ohne spezielle Zielsetzungen sicherte sich ebenfalls seit<br />
den neunziger Jahren Grundstückskomplexe. Der Kaufmann Nathan Bernstein hatte bereits<br />
1893 das „Gut Bocksfelde" an der Scharfen Lanke erworben, um es zu gegebener Zeit<br />
parzellieren und mit Gewinn veräußern zu können. Derartige Spekulationskäufe am Ufer<br />
der Unterhavel zwischen Spandau und Weinmeisterhorn wurden in jenen Jahren wiederholt<br />
getätigt; u.a. hatte auch der bekannte Berliner Baurat Kyllmann im Spandauer Süden<br />
Grundstücksinteressen. Im Vorfeld der noch vorhandenen Festungswerke, im Bereich des<br />
östlichen Abschnittes der Falkenseer Chaussee und nördlich der Seegefelder Straße begann<br />
um 1900 der Grundstücksumsatz für künftige spekulative Absichten ebenfalls immer reger<br />
zu werden.<br />
Die zahlreichen zu künftiger Verwertung erworbenen bisherigen Acker- und Wiesenflächen<br />
wurden, damit sie wenigstens bis zur Beanspruchung geringe Erträgnisse brachten, seit<br />
etwa 1900 in zunehmendem Maße zur Nutzung an Kleingartenkolonien verpachtet. Damit<br />
wurde abermals eine Berliner Einrichtung in Spandau übernommen, und so gewann die<br />
Physiognomie Spandaus immer mehr die Züge einer Berliner Vorortgemeinde.<br />
Als die ersten privaten Industriebetriebe kurz vor der Jahrhundertwende nach Spandau<br />
überzusiedeln begannen, war die Havelstadt schon lange eine ausgesprochene Industriestadt,<br />
allerdings von ganz besonderer Art. Durch die Konzentrierung der militärfiskalischen<br />
Rüstungsfabriken in Spandau, die schon vor Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hatte<br />
und eigentlich bis 1919 nie zum Abschluß gekommen ist, war Spandau eine ausgedehnte<br />
Fabrikstadt geworden. Der alten Ackerbürger- und Handwerkerstadt mit einem bescheidenen<br />
geschäftlichen Leben war die neue Funktion der „Waffenschmiede" des preußischen<br />
und deutschen Heeres aufgepfropft worden. Gerade die im 19. Jahrhundert so krassen<br />
sozialpolitischen Probleme einer Industrie- und Arbeiterstadt konnte die Stadt kaum übersehen,<br />
geschweige denn lösen. Die staatlichen Waffen- und Munitionsfabriken durften nicht<br />
441
zu den Kommunalsteuern herangezogen werden. Viel schwerer aber als die Steuerausfälle<br />
gerade von denjenigen Institutionen, die die Industrieagglomeration in Spandau geschaffen<br />
hatten, wog, daß die Heeresbetriebe das Wirtschaftsleben der Stadt vollkommen beherrschten<br />
und diese gänzlich von ihnen abhängig war. Spandau war bis 1900 völlig den<br />
Schwankungen unterworfen, die durch die Zyklen der Vollbeschäftigung und der Arbeitseinschränkungen<br />
bei den militärfiskalischen Betrieben ausgelöst wurden.<br />
Nach dem deutsch-französischen Kriege z.B. hatten die Spandauer „Institute" von 1871 bis<br />
1875 Hochkonjunktur: die im Kriege verschlissenen Bestände an Waffen und Gerät mußten<br />
durch Neufertigungen ergänzt, die Arsenale wieder aufgefüllt werden. Hunderte von Arbeitern,<br />
die von den Instituten eingestellt worden waren, zogen mit ihren Familien nach<br />
Spandau. Diese zuströmenden Massen trieben in der Stadt, die auf einen derartigen Zuzug<br />
nicht vorbereitet war, zunächst die Mieten in die Höhe und verursachten eine krasse<br />
Wohnungsnot, bis dann die Bautätigkeit in Gang kam. Nachdem aber die von den Feldzeugdienststellen<br />
in Auftrag gegebenen Fertigungen abgewickelt waren, schränkten die<br />
Institute ihre Arbeit stark ein, und viele Hunderte Arbeiter wurden entlassen. Die Zahl der<br />
in den militärfiskalischen Spandauer Fabriken beschäftigten Arbeiter sank von 4700 im<br />
Jahre 1875 auf 2700 im Jahre 1883. Natürlich lag bei einer derartigen Situation, bei der<br />
wenigstens 20 % der arbeitsfähigen männlichen Bevölkerung ohne Beschäftigung war oder<br />
kaum das Existenzminimum verdiente, auch das örtliche Geschäftsleben darnieder. Außerdem<br />
herrschte nun ein Überangebot an leerstehenden Wohnungen, die auch bei starker<br />
Mietermäßigung nicht zu vermieten waren, so daß auch die damals kommunalpolitisch so<br />
bedeutsame Schicht der Hauseigentümer unter der Rezession litt. Die freigesetzten Arbeitskräfte<br />
konnten am Ort selbst nur in den seltensten Fällen eine neue Stellung finden, da im<br />
zivilen Sektor die Handwerksmeister, die Ackerbürger und die Geschäftsleute kaum<br />
Arbeitsplätze anzubieten hatten. Die Betroffenen konnten noch von Glück sagen, wenn sie<br />
als Erdarbeiter beim hiesigen Festungsbau oder bei den Eisenbahnen eine schlecht bezahlte<br />
Stelle fanden. Die arbeitslos gewordenen Familienväter versuchten, in Berlin Arbeit zu<br />
bekommen oder sich als Landarbeiter zu verdingen, oder aber sie wanderten, wie es<br />
1882/83 häufig geschah, nach den USA aus.<br />
Im Jahre 1884 begannen die Institute wieder mit der Herstellung neuer Waffen, u.a. wurde<br />
die Einführung eines neuen Karabiners vorbereitet, und damit wuchs auch wieder die Zahl<br />
der Neueinstellungen. 1890 waren etwa 12 000 Arbeiter bei den militärfiskalischen Fabriken<br />
in Spandau beschäftigt. Ähnlich wie 1871 lösten die vielen Einstellungen, die die<br />
Institute nun vornahmen, wiederum einen lebhaften Zuzug nach Spandau aus. Abermals<br />
trat, ehe die Wohnbautätigkeit auf den Zustrom reagierte, Wohnungsnot auf mit allen ihren<br />
unerquicklichen Erscheinungen wie Mietwucher. Schlafstellenunwesen usw. Auch dieser<br />
Boom ging vorüber, und 1896 wurden in den Instituten nur noch 7600 Arbeiter gezählt,<br />
während es ein Jahr zuvor noch 10 100 waren. Die Folgen waren, wenn auch nicht mehr<br />
ganz so kraß wie in den früheren achtziger Jahren, wiederum Arbeitslosigkeit, stagnierendes<br />
Geschäftsleben, viele leerstehende Wohnungen, in ihrer Existenz bedrohte Hauseigentümer<br />
usw.<br />
Als sich nun in den späten neunziger Jahren abzeichnete, daß Spandau in den Gesichtskreis<br />
der Berliner Industrie getreten war, hofften die Spandauer Kommunalpolitiker, vor allem<br />
der energische und weitblickende Oberbürgermeister Friedrich Koeltze, daß man sich bei<br />
einem Zuzug privater Industrieunternehmen aus der allzu starken Abhängigkeit der Stadt<br />
von den Konjunkturwellen der militärfiskalischen Institute werde lösen können. Die<br />
442
Carl-Schurz-Straße um 1890 (Foto: Jürgen Grothe)<br />
Monostruktur der Institute könne abgebaut werden, wenn die staatliche durch eine private<br />
Industrie ergänzt würde. Dann stand zu erwarten, daß die starken Spannungen, denen der<br />
Spandauer Arbeitsmarkt infolge der überproportional starken Einstellungen und Entlassungen<br />
von Seiten der Institute ausgesetzt war, gemildert werden könnten. Je nach den<br />
jeweiligen konjunkturellen Verhältnissen wären nun entweder die militärischen oder die<br />
privaten Betriebe in der Lage, freie Stellen für Arbeitsuchende anzubieten. Die Niederlassung<br />
privater Industriefirmen versprach aber nicht nur einen differenzierteren und ausgeglichenen<br />
Arbeitsmarkt zu bringen, darüber hinaus ergaben sich noch andere Vorteile:<br />
443
Die Firmen konnten zu den Kommunalsteuern herangezogen werden und brachten damit<br />
zusätzliche Einnahmen für den Haushalt der Stadt, der bei dem geringen Steueraufkommen<br />
von der Arbeiterbevölkerung immer knapp bemessen war. So standen Magistrat und<br />
Stadtverordnetenversammlung der Industrieansiedlung positiv gegenüber. In den Jahren<br />
um und nach der Jahrhundertwende diskutierte man umfangreiche Verkehrsplanungen. Ein<br />
Netz von Güteranschlußbahnen sollte die seinerzeit oft noch landwirtschaftlich genutzten<br />
Außenzonen der Stadt durchziehen, um künftige Industriegelände verkehrlich zu erschließen.<br />
In jenen noch autolosen Zeiten spielte bei der Wahl eines neuen Standortes die Frage,<br />
ob Güteran- bzw. -abtransport auf der Schiene möglich war, oft eine ausschlaggebende<br />
Rolle. Tatsächlich wurde ein Teil jener in allen Himmelsrichtungen projektierten Güterbahnen<br />
auch ausgeführt.<br />
In zunehmendem Maße wurde den Spandauer Kommunalpolitikern die Niederlassung der<br />
Firma Siemens & Halske im äußersten Osten der Stadt wichtig. Das 1899 dem Betrieb übergebene<br />
Kabelwerk „Westend" war auf Spandauer Gemeindegebiet entstanden, und zwar<br />
auf einer Exklave, einem zum Stadtkreis gehörigen, ringsum von Gebieten anderer<br />
Gemeindezugehörigkeit umgebenen Gelände in den Spreewiesen. Das Spandauer Wiesenland,<br />
weitab vom geschlossenen Weichbild, lag gänzlich abgeschieden, war unbewohnt und<br />
unerschlossen und den wenigsten bekannt. Die Exklave grenzte im Osten zwar an Charlottenburg,<br />
aber die stille Grenze am Nonnendamm und Nonnengraben in den Nonnenwiesen<br />
hatte in den knapp zwei Jahrhunderten ihres Bestehens kaum jemals die geringste Auseinandersetzung<br />
zwischen beiden Nachbarstädten ausgelöst.<br />
Da Siemens bald erkennen ließ, daß noch weitere Werkbauten in der Nachbarschaft seines<br />
neuen Kabelwerks entstehen sollten, wurde das bisher unbeachtete Wiesengelände für<br />
Spandau mehr und mehr zu einem wertvollen Besitz. Der finanzkräftige Investor Siemens,<br />
der seit 1904 Fabrikbau auf Fabrikbau in der Enklave und bald auch in den westlich<br />
angrenzenden Gutsbezirken Tegel-Forst und Sternfeld zu errichten begann, wurde der<br />
größte und wichtigste Steuerzahler Spandaus. Die Stadt überließ es der Firma Siemens, die<br />
städtebaulichen und verkehrlichen Planungen in dem ganz unerschlossenen Gebiet selbst<br />
aufzustellen und die für den jungen Industriestandort sowie für die von Anfang an vorgesehene<br />
Wohnsiedlung neben den Fabriken notwendigen Verkehrs- und Straßenanlagen<br />
selbst zu schaffen. Mit diesem Laissez-faire geriet die Havelstadt aber bald in Gegensatz zu<br />
Charlottenburg. Der Nachbarstadt war der entstehende Industrieort vor seiner Westgrenze<br />
unerfreulich, und sie versuchte nun, die ihr mißliebige Ansiedlung der Siemenswerke, wenn<br />
sie auch nicht mehr ganz zu verhindern war, mindestens unter ihren Einfluß zu bringen<br />
und ihre weitere Ausdehnung zu beeinflussen. Das beste Mittel, eine Entwicklung in diesem<br />
Sinne herbeizuführen, war, die Spandauer Exklave mitsamt den Siemenswerken sowie<br />
angrenzende Gebietsteile der Kreise Osthavelland und Niederbarnim zur Abrundung des<br />
Charlottenburger Gemeindegebietes im Westen einzugemeinden.<br />
Dieses Vorhaben war gar nicht so abwegig, denn während südlich der Spree die Stadt<br />
Charlottenburg sich bis an den Spandauer Bock heranschob, sprang die Weichbildgrenze<br />
nördlich des Flusses weit nach Osten, bis in die Nonnenwiesen hinein, zurück. Mit einer<br />
derartigen Eingemeindung hätte Charlottenburg nicht nur sein Weichbild für eine künftige<br />
Ausdehnung der Stadt erweitert, sondern auch die von ihm für erforderlich gehaltenen<br />
Straßen-, Verkehrs- und Grünplanungen durchsetzen können. Die Projekte der Firma<br />
Siemens konnten dann im Falle einer Eingemeindung durch Feststellung von Fluchtlinienplänen<br />
oder baurechtlichen Vorschriften über die Nutzung des Geländes eingeschränkt<br />
444
Carl-Schurz-Straße mit Stadtmauer und Postamt 1902 (Foto: Jürgen Grothe)<br />
oder aufgehoben werden.<br />
Ärgerlich schien es Charlottenburg auch, da 3 alles, was es auf seinem Stadtteil „Am<br />
Nonnendamm" mit 147 ha Flächengröße nur 8 bebauten Grundstücken im Jahre 1900 an<br />
Verbesserungen städtebaulicher Art ausgeführt hätte, weniger dem eigenen, fast noch<br />
unbewohnten Stadtgebiet, sondern vor allem der angrenzenden Spandauer Exklave mit<br />
den Siemensfabriken zugute gekommen wäre. Um zu vermeiden, daß Charlottenburger<br />
Haushaltsmittel indirekt auch den Spandauern bessere Verkehrsverhältnisse gebracht<br />
hätten, wurde z.B. alles unterlassen, was dazu beitragen konnte, die mangelhafte Straßenverbindung<br />
zwischen der Spandauer Exklave und Charlottenburg zu verbessern. Im übrigen<br />
wären Charlottenburgs groß angelegte und aufwendige städtebauliche Projekte am<br />
Kaiserdamm und in Neu-Westend beeinträchtigt worden, wenn gleichzeitig auch noch das<br />
umfangreiche Gelände am Nonnendamm aufgeschlossen und kanalisiert worden wäre.<br />
Soviel Geld besaß selbst das „reiche" Charlottenburg nicht.<br />
Spandau, das seine Exklave mit den für den kommunalen Etat so kostbaren Siemenswerken<br />
gegen die Begehrlichkeit Charlottenburgs verteidigte und außerdem seinerseits die<br />
Gebiete von Osthavelland und Niederbarnim, die sich zwischen Exklave und dem geschlossenen<br />
Stadtgebiet erstreckten, eingemeinden wollte, blieb schließlich in dem kommunalen<br />
Eingemeindungsstreit mit Charlottenburg, der vor allem vor den staatlichen Aufsichtsbehörden<br />
ausgetragen wurde, Sieger. Im Gegensatz zu Charlottenburg, das für die Aufschließung<br />
seines Westgeländes in den Nonnenwiesen überhaupt nichts tat, war Spandau<br />
sehr rührig. Es legte 1905 im Zuge des „Nonnendammes" (heute Nonnendammallee), der<br />
445
ein unbefestigter Landweg war, eine wenn auch nur behelfsmäßig befestigte Straße an, und<br />
zwar auf den fremden Gemeindegebieten von Haselhorst und Sternfeld, um zu demonstrieren,<br />
daß es sehr wohl in der Lage sei, für seine Exklave zu sorgen. Die 1908 von der<br />
Firma Siemens erbaute und bald danach von der Stadt Spandau übernommene Straßenbahn<br />
zwischen der Altstadt, Haselhorst und der neuen Siemensstadt sollte ebenfalls beweisen,<br />
daß von Spandau alles getan würde, um geregelte Kommunalverhältnisse zu schaffen.<br />
Um zunächst einmal eine durch Kommunalgrenzen ungestörte Entwicklung der Siemenswerke<br />
und der an diese angeschlossene Wohnsiedlung zu gewährleisten - ein Fabrikbau<br />
wie das Automobilwerk erstreckte sich z.B. in zwei Kreisgebiete -, wurde 1908 ein zusammenhängendes<br />
Gebiet zwischen Spree und Spandauer Schiffahrtskanal sowie zwischen<br />
Haselhorst und Charlottenburg nach Spandau eingemeindet. Zwei Jahre später wurde<br />
durch die Eingemeindung Haselhorsts und anderer Gebiete die Lücke zwischen Spandau<br />
und der jungen Siedlung im Osten, die einige Jahre später den Namen „Siemensstadt"<br />
tragen sollte, geschlossen; eine breite Landbrücke war zur bisherigen Exklave hergestellt<br />
worden. Nun hatte die Spandauer Ostgrenze mit Charlottenburg zwischen Mäckeritzbrücke<br />
und Spree eine Länge von rd. 2,5 km, dazu kamen noch einmal knapp 3 km gemeinsame<br />
Grenze am Südufer der Spree von den Nonnenwiesen hin bis fast nach Ruhleben.<br />
Mit seinem Vordringen nach Osten und der Bildung neuer kilometerlanger Grenzen mit<br />
Charlottenburg kam die Havelstadt zwangsläufig in nähere Berührung mit ihrer Nachbarstadt.<br />
Die neue, in stetem Wachstum begriffene „Siemensstadt" bedurfte einer Grenzregulierung,<br />
denn am Nonnendamm, der einzigen Verbindungsstraße nach Charlottenburg<br />
und damit auch Berlin, verlief der Grenzzug so ungünstig, daß der Ausbau der Straße und<br />
danach die Veranlagung der Anlieger zu den Straßenherstellungskosten nach dem Fluchtliniengesetz<br />
äußerst kompliziert geworden wäre. Charlottenburg strebte umfangreiche<br />
Grenzbereinigungen an, weil es den Spreebogen unterhalb Fürstenbrunn, bei Sternfeld,<br />
begradigen wollte und für dieses Vorhaben auch schon mit Grunderwerb begonnen hatte.<br />
Hier hätte Spandau große Flächen an Charlottenburg abtreten müssen, da das neue Flußbett<br />
nach Norden verschoben werden sollte. Ob die Projekte Charlottenburgs, an der<br />
begradigten Spree auch noch einen großen Hafen anzulegen, ernsthaft verfolgt wurden,<br />
mag dahingestellt bleiben; jedenfalls taktierte Charlottenburg in seinen Verhandlungen<br />
mit diesen Planungen. Spandau seinerseits strebte die Eingemeindung der „Lietzower<br />
Wiesen", einer Charlottenburger Exklave an der Unterspree, westlich des Kraftwerks<br />
Reuter, heute die Gegend am „Großen Spreering", in sein Weichbild an. Das kommunale<br />
Charlottenburger Wasserwerk lag westlich vom Rohrdamm auf Spandauer Gebiet, und die<br />
Druckrohre der Charlottenburger Kanalisation liefen durch das Spandauer Gebiet bis zu<br />
den Gatower Rieselfeldern. Im Jahre 1907 stoppte Charlottenburg die Bauten Spandaus<br />
am Südhafen so lange, bis Spandau der Nachbarstadt für die Umlegung der Druckrohre<br />
günstige Bedingungen eingeräumt hatte.<br />
Neben Grenzangelegenheiten und Leitungsrechten war die städtebauliche Planung zwischen<br />
beiden Städten abzustimmen, z.B. die Führung einiger Süd-Nord-Straßen, die von<br />
Nord-Westend her über die Spree in das Spandauer Gebiet hinein geführt werden sollten.<br />
Auch die Schnellbahnplanungen, die vorsahen, die Havelstadt in einer großen Schleife an<br />
die bereits bestehenden Hoch- und Untergrundbahnen anzubinden, die von Westend ausgehend<br />
über Ruhleben, Spandau-Rathaus, Hohenzollernring, Hakenfelde, Haselhorst,<br />
Siemensstadt, Charlottenburg-Nord bis zum Richard-Wagner-Platz — der schon vorhandenen<br />
U-Bahn-Endstation - gehen sollte, mußte von beiden Städten behandelt werden.<br />
446
Jahrelang dauerten dann die Verhandlungen zwischen der Firma Siemens und der Charlottenburger<br />
Verwaltung, bis endlich die Verkehrserschließung Siemensstadts und seine<br />
Anbindung an das Charlottenburger und damit an das Berliner Straßennetz durch den Bau<br />
des Siemensdammes - auf Kosten der Firma - 1914 ausgeführt werden konnte. Die zwischen<br />
Spandau und Charlottenburg gepflogenen Unterhandlungen über die Grenz- und<br />
sonstigen Fragen, die 1909 begannen, verliefen zähflüssig und schleppend und blieben<br />
ohne Resultate.<br />
Nicht nur nördlich der Spree, auch südlich gab es zwischen Spandau und Charlottenburg<br />
konkurrierende Interessen. Bereits im Jahre 1903, als die Aufteilung der bisher landwirtschaftlich<br />
genutzten Domäne Ruhleben beschlossene Sache war, wurde die kommunale<br />
Zukunft des Gutsbezirks erörtert; dabei wurden Überlegungen angestellt, Ruhleben entweder<br />
nach Charlottenburg oder Spandau einzugemeinden oder aber aus dem Gutsbezirk<br />
eine selbständige Landgemeinde zu bilden. Spandau hatte vom Chausseebaufiskus vorsorglich<br />
auch außerhalb des Spandauer Gemeindegebietes die Charlottenburger Chaussee<br />
bis zum Spandauer Bock erworben. Der östliche Restabschnitt lag bereits auf Charlottenburger<br />
Gebiet. Auch die Spandauer Straßenbahn wurde 1906 bis zum Spandauer Bock<br />
geführt, wo die Möglichkeit des Überganges auf die Linie „R" der Berliner Straßenbahn<br />
gegeben war. Ein Teil des Ruhlebener Geländes war an das Spandauer Wasserleitungs-,<br />
Kanalisations- und Elektrizitätsnetz angeschlossen. Da Ruhleben am Übergang der Ruhlebener<br />
Straße in die Charlottenburger Chaussee das Spandauer Weichbild recht ungünstig<br />
zerschnitt, war Spandau auch an einer Einverleibung dieses Geländes gelegen. Die Kasernen<br />
und sonstigen militärischen Institutionen in Ruhleben gehörten ohnehin zum Spandauer<br />
Standortbereich. Andererseits war aber auch Charlottenburg an der Einbeziehung<br />
Ruhlebens in seinen Stadtkreis interessiert.<br />
So war innerhalb eines knappen Jahrzehnts ein Geflecht von Beziehungen zwischen<br />
Spandau und Charlottenburg entstanden, bei dem die gegenläufigen Interessen überwogen.<br />
Spandau hatte sich nach Osten, in Richtung Charlottenburg —Berlin, erstreckt und geöffnet.<br />
Bezeichnend ist, daß die beiden Straßenbahnen, die nach dem Ausbau des innerstädtischen<br />
Netzes 1906 und 1908 noch entstanden, nach Osten bis an die Charlottenburger<br />
Grenze am Spandauer Bock und in Siemensstadt führten. Noch viel mehr aber tendierte die<br />
Firma Siemens nach Osten, nach Berlin hin. Die Firma hatte sich zwar auf Spandauer<br />
Gebiet niedergelassen, weil ihr dort die notwendige Planungs- und Handlungsfreiheit<br />
gelassen wurde, aber die guten Beziehungen zwischen der Geschäfts-, genauer der Bauleitung<br />
der Firma und der Spandauer Stadtverwaltung mußten sich zwangsläufig beschränken<br />
auf die Fragen des neuen Industriestandortes und seiner Infrastruktur und damit zweitrangig<br />
bleiben. Die großen Siemenskunden wie Post-, Bahn- und Militärverwaltungen, die<br />
Fernmeldegeräte, elektrische Bahnausrüstungen, Signaleinrichtungen usw. abnahmen,<br />
hatten ihren Sitz in Berlin. Hier waren auch die Banken, Verbände, Institute, mit denen<br />
Siemens in Verbindung stand, ansässig, und schließlich pendelte die Belegschaft alltäglich<br />
aus Berlin, Charlottenburg und anderen Vororten nach Siemensstadt zur Arbeit ein. Die<br />
Zahl der Siemensmitarbeiter, die in der neuen Wohnstadt neben den Werken oder in<br />
Spandau wohnten, mochte 10 bis 15 v.H. der Gesamtzahl der in den Siemensstädter Werken<br />
Beschäftigten betragen. Siemens war eine Berliner Firma, die sich im Osten Spandaus<br />
angesiedelt hatte, aber kein Spandauer Unternehmen.<br />
Mit dieser „Ostpolitik" Spandaus aber war zugleich die Axt an die Wurzel der Selbständigkeit<br />
Spandaus gelegt. Es setzte eine Entwicklung ein, die schon bald dazu führte, daß die<br />
447
Havelstadt sehr gegen ihren eigenen Willen in ihrer Selbständigkeit zunehmend eingeschränkt<br />
und schließlich ihrer ganz entkleidet werden sollte.<br />
Als die Einrichtung des Zweckverbandes Groß-Berlin in der Vorbereitung war, wirkte die<br />
Stadt Charlottenburg bei den ministeriellen Stellen, die das Gesetz bearbeiteten, darauf<br />
hin, daß auch Spandau in das künftige Verbandsgebiet einbezogen werde. Charlottenburg<br />
stellte einen Teil der oben bereits aufgeführten „Berührungspunkte des Spandauer und<br />
Charlottenburger Wirtschaftsgebietes" zusammen, also städtebauliche Fragen usw., die<br />
beide Städte betrafen und einer gemeinsamen Abstimmung bedurften, und kam zu dem<br />
Schluß, daß diese Verflechtungen eine Aufnahme Spandaus in den Zweckverband rechtfertigten.<br />
Den Gegenargumenten Spandaus, es habe zu Berlin und seinen Vororten keine<br />
wirtschaftlichen und städtebaulichen Beziehungen, stehe vielmehr in enger Verbindung mit<br />
dem westlich seiner Grenzen gelegenen Kreis Osthavelland, mußte die rechte Überzeugungskraft<br />
fehlen, wenn die Materialien, die Charlottenburg aufbereitet hatte, dagegen<br />
gehalten wurden. Für einen Teil des Osthavellandes behielt Spandau seine zentralörtlichen<br />
Funktionen, das war unbestritten. Aber durch seine Expansion nach Osten, die zu einem<br />
großen Teil durch die Niederlassung der Firma Siemens auf den Spreewiesen der Exklave<br />
ausgelöst worden war, begab es sich tatsächlich in immer engere, meist kontroverse Beziehungen<br />
zu Charlottenburg, das seinerseits ja unzweideutig zum Berliner Bereich gehörte.<br />
In der Eingemeindungsfrage war seinerzeit Spandau Sieger geblieben, in der Zweckverbandsfrage<br />
setzte sich Charlottenburg durch: Spandau wurde entsprechend den Vorschlägen<br />
Charlottenburgs in den Zweckverband Groß-Berlin einbezogen.<br />
Die ambivalente Haltung der Spandauer Körperschaften in der Ära des Oberbürgermeisters<br />
Koeltze zeigte sich deutlich in den verkehrspolitischen Bestrebungen der Havelstadt,<br />
die eindeutig auf den Osten, nach Berlin zielten, während Projekte, die eine stärkere<br />
Verbindung Spandaus mit den angrenzenden Kreisgebieten zum Gegenstand hatten, aus<br />
dem Stadium der Vorplanungen nicht herauskamen. Die Absicht, eine Kleinbahn von<br />
Spandau nach Kladow zu führen und damit eine Anbindung des westlichen Havelufers an<br />
die Stadt zu schaffen, wurde nicht ernsthaft weiter verfolgt. Auch der Plan einer Straßenbahn<br />
von Spandau nach Staaken wurde bestenfalls halbherzig bearbeitet. Spandau mochte<br />
zwar einerseits auf seine historischen Beziehungen zum anstoßenden Kreisgebiet nicht verzichten,<br />
ohne sich dabei allzusehr engagieren zu müssen, andererseits aber die Folgen, die<br />
sich aus seiner räumlichen Annäherung an Charlottenburg ergaben, nicht tragen.<br />
Trotz der Randlage Spandaus im Einzugsgebiet Berlins hatte es mancherlei Berührungen<br />
und Beeinflussungen gegeben. Aber derartige Ausstrahlungen, die von Berlin ausgingen<br />
und sich in der Physiognomie der Stadt oder in ihrem Geschäftsleben präsentierten, hatten<br />
die Einbeziehung Spandaus in den Zweckverband im Jahre 1912 und acht Jahre später in<br />
die Einheitsgemeinde Berlin nicht vermocht; dazu war trotz der Überlagerungen, die<br />
Berlin verursachte, die Eigenständigkeit der alten Havelstadt zu groß. Ausschlaggebend<br />
für das Aufgehen Spandaus im Zweckverband und später in Berlin war die Koeltzesche<br />
„Ostpolitik", zu einem Teil durch die Niederlassung der Firma Siemens ausgelöst,<br />
die die Stadt in den Gegensatz zu Charlottenburg und — ungewollt — zu einer engeren<br />
Verbindung mit dieser Nachbarstadt gebracht hatte. Die Einbeziehung Spandaus<br />
in höhere kommunale Ordnungen und Gebilde löste schließlich in einem langwierigen<br />
Prozeß die kommunalen Widersprüche auf.<br />
448<br />
Anschrift des Verfasser: 1000 Berlin 31, Joachim-Friedrich-Straße 2
„Ein ganz widerwärtiger Ort"<br />
Jacob Burckhardt (1818 bis 1897) über Berlin<br />
Von Friedrich-Wilhelm Wentzel<br />
„Auch ist Berlin ein ganz widerwärtiger Ort; eine langweilige, große Stadt in einer unabsehbaren,<br />
sandigen Ebene", schrieb der junge Studiosus Jacob Burckhardt, der beim großen<br />
Leopold Ranke in Berlin seit vier Monaten Geschichte studierte, am 22. März 1840 an<br />
Dorothea Hartmann-Brodtbeck nach Basel, seiner Heimatstadt.<br />
„Berlin ist sehr groß, und man kann sich leicht verlaufen, so daß man weder Weg noch<br />
Steg weiß und fragen muß", fährt er fort. „Ich wohne in dem neuern Theile der Stadt, welchen<br />
man die Friedrichsstadt nennt, weil ihn der alte Fritz gebaut hat. In dieser Friedrichsstadt<br />
sind lauter gerade Straßen; die Straße, wo ich wohne, geht von einem schönen Thor bis<br />
zum königlichen Schloß und ist 20 Minuten lang; sie ist die breiteste und schönste Straße<br />
Berlins und enthält vier Reihen Linden, weshalb man es 'unter den Linden' nennt. Du<br />
wirst denken, ich mache es mir bequem, indem ich die schönste Straße auswähle, aber ich<br />
wohne eben nicht vorne heraus, sondern im zweiten Hofe, wo man die Zimmer nicht<br />
theurer bezahlt als in anderen Gassen." 1<br />
Dem Sohn aus führendem Geschlecht der reichen Handelsstadt Basel sind einige soziale<br />
Umstände im sehr viel ärmeren Berlin aufgefallen, über die er ebenfalls berichtet:<br />
„Die vordem Zimmer haben zwei Grafen und eine Gräfin entlehnt, die jedes eine besondere<br />
Parthei ausmachen; die Leute schränken sich sehr ein mit dem Platz, und deßhalb<br />
kann man nicht wie bei uns eine Menge von alten Möbeln haben, sondern was man gerade<br />
nicht brauchen kann, das bekömmt der Jude. Die vornehmsten Leute, die drei oder vier<br />
Kinder haben, begnügen sich mit sechs oder acht Stuben, und es giebt Fürsten und Grafen<br />
hier, die nur über 3 Zimmer gebieten. Du kannst leicht denken, was hier für eine Armuth<br />
herrschen muß; es ist ganz unglaublich, wie elend sich hier manche Leute durchhelfen<br />
müssen. Es giebt Zimmer, wo zwei, ja selbst vier Partheien wohnen; dann spannt man Seile<br />
übers Kreuz, damit jeder weiß, in welchen Winkel er gehört Dabei giebt es 20 000<br />
Menschen hier, welche Diebe sind; darunter etwa 3000, die nur vom Diebstahl leben und<br />
von nichts anderem, so daß man in keinem Hause wohnen kann, wo nicht ein Dieb wäre.<br />
Auch in dem Hause, das ich bewohne, gerade neben meinem Zimmer, sind vor vierzehn<br />
Tagen fünf silberne Kaffeelöffel gestohlen worden; man weiß, wer die Diebin ist, sie wohnt<br />
noch dazu in unserem Hause, aber man kann ihr nichts zu Leide thun, weil man ihr nichts<br />
beweisen kann . . ."<br />
Auch das Essen gefällt dem jungen Studiosus nicht, und das Wetter scheint es in diesem<br />
Vorfrühlingsmonat des Jahres 1840 besonders schlecht mit ihm gemeint zu haben:<br />
„Das Essen ist sehr schlecht im Vergleich mit dem, was man in Basel hat; zum Glück hat<br />
man hier nicht so viel Appetit, und es giebt Tage, wo man wirklich nichts den Hals hinunter<br />
bringt ... Im Sommer werde ich bloß Morgens und Mittags etwas genießen und den Thee<br />
Thee sein lassen. Wenn man sich hier nicht sehr in Acht nähme, so würde man beständig<br />
unwohl sein.<br />
Dazu kommt noch, daß das Wetter abscheulich ist. Den Winter hindurch war es einmal<br />
19 Grad kalt und drei Tage darauf sieben Grad Wärme, und so wechselte es immer ab . . .<br />
Den ganzen März hindurch schneite es alle paar Tage und fror fast jeden Morgen; Nach-<br />
449
Jacob Burckhardt in Berlin<br />
mittags aber ist immer ein Koth zum Umkommen. Fast den ganzen Monat war kein Stückchen<br />
blauen Himmels zu sehen. Auch jetzt liegt überall tiefer Schnee und die Gassen sind<br />
so pflotzig, daß man ohne Überschuhe gewiß immer mit ganz durchnäßten Schuhen und<br />
Strümpfen nach Hause käme .. ."<br />
Zum versöhnlichen Schluß gibt es dann aber doch noch einiges Positive - nämlich vom<br />
geistigen und kulturellen Leben der ,gräßlichen Stadt' zu berichten:<br />
„Gleichwohl läßt es sich hier recht angenehm leben, auch wenn man kein überflüssiges<br />
Geld hat. Für's erste habe ich wenigstens genug zu thun und dann sind hier einige sehr<br />
schöne Anstalten, die ich oft besuche, besonders das Museum, wo über 900 der schönsten<br />
Gemälde, fernere über hundert alte Bildsäulen und sonst noch ganz unendlich viel Merkwürdigkeiten<br />
zu sehen sind. Dann ist das Theater, das ich bisweilen besuche, sehr schön mit<br />
vortrefflichen Sängern und Schauspielern versehen. Du kannst Dir denken, was man da-<br />
450
Berlin, im Tiergarten. Sommer 1840, Zeichnung von Jacob Burckhardt<br />
selbst für Wind macht, wenn ich Dir sage, daß unlängst, als man ein deutsches Fest vorstellte,<br />
vierhundert Wachskerzen auf der Bühne brannten ..."<br />
Gewiß hat der junge Burckhardt nicht von Wasser und Brot leben müssen, doch diesen<br />
beiden widmet er im gleichen Brief noch einmal ein paar Zeilen:<br />
„Das Brot hier ist völlig ungesalzen, man kann es am Anfang nicht essen; nach und nach<br />
aber gewöhnt man sich daran, und jetzt merke ich es kaum. Das Wasser ist lauter Sodbrunnenwasser;<br />
in ganz Berlin ist nicht ein einziger laufender Brunnen; weil diese Stadt<br />
ganz in einer sandigen Ebene liegt. Dagegen hat fast jedes Haus und jede Gasse ihren Zugbrunnen;<br />
glücklicherweise liefert der in unserem Hause ziemlich gutes Wasser. In einigen<br />
Gegenden von Berlin hat das Wasser einen Sumpfgeschmack."<br />
Schließlich noch ein Blick in die Berliner Umgebung:<br />
„Wenn man nun aus der Stadt hinaus bei trockenem Wetter spazieren geht und nicht der<br />
Landstraße folgen will, so geräth man auf Wege, wo einem der dürre gelbe Sand bis über<br />
die Knödlein [Knöcheln] geht, so daß man gezwungen ist in Stiefeln spazieren zu gehen.<br />
Doch hat man einen großen Wald gerade vor der Stadt, welcher Thiergarten heißt, und<br />
worin feste Wege sind. Da ich nur etwa 400 Schritte vom Thor wohne, welches dahin führt,<br />
so gehe ich sehr oft dahin, es ist aber ein langweiliger Spaziergang. Wenn man sich etwas<br />
zu gute thun will, so sitzt man auf die Eisenbahn und rutscht in 33 oder 35 Minuten nach<br />
dem gute fünf Stunden entfernten Potsdam, wo die Gegend etwas besser und sonst noch<br />
vieles zu sehen ist. Das Fahren auf den Eisenbahnen ist sehr lustig; man fliegt eigentlich wie<br />
ein Vogel dahin . . ."<br />
Ein begeisterter Eisenbahnfahrer ist Burckhardt sein Leben lang geblieben und hat auf<br />
451
diese Weise unzählige Reisen unternommen - zumeist mit größerem Komfort als damals<br />
auf der „Berlin-Potsdamer".<br />
Noch bis 1843 blieb Burckhardt in der ungeliebten preußischen Hauptstadt, ein Aufenthalt,<br />
der von ihm bereits 1840 als „absurd" gekennzeichnet wurde. Er bekannte auch, daß<br />
er so wenig Anteil an dem Berliner Leben nehme „als ein polnischer Jude, der auf die<br />
Leipziger Messe kömmt an Leipzig Theil nimmt" 2 . Die Abneigung des Basler Patriziers<br />
gegenüber der norddeutschen Metropole hatte sich bis in das Alter hinein erhalten. Als<br />
1882 der inzwischen hochangesehene Professor an der Universität seinrer Heimatstadt<br />
von einer Reise, die ihn unter anderem auch nach Berlin geführt hatte, zurückkehrte,<br />
schrieb er aus Basel an Friedrich von Preen 3 :<br />
„. . . Im Sommer hatte ich eine Studienreise durch deutsche Galerien absolviert, unter<br />
anderem einen 14tägigen Aufenthalt in Berlin. Ich glaube mich überzeugt zu haben, daß<br />
ich jetzt nicht mehr am Leben wäre, wenn ich vor zehn Jahren den Ruf dorthin (an die<br />
Universität) angenommen hätte. Das Wetter der betreffenden beiden Wochen war vorwiegend<br />
schön, ich erreichte meine Zwecke und hatte nur angenehme Begegnungen — aber<br />
Berlin hat für mich etwas Tödtliches; in der Jugend hielt ich dort 4 Jahre aus und jetzt<br />
hielte ich sie nicht mehr aus. Was es ist, weiß ich nicht; in Prag und Dresden könnte ich<br />
existieren, in Berlin nicht. Es hängt nicht bloß daran, daß ich melancholisch werde wenn<br />
einer Stadt ein Fluß und Anhöhen fehlen; die Menschen dort haben ein gewisses Etwas,<br />
wogegen ich mich hilflos fühle, und concurrenzunfähig bin . . ."<br />
Goethes Ausspruch über den „verwegenen Menschenschlag", demgegenüber „man Haare<br />
auf den Zähnen haben muß", fällt einem ein. Sicherlich besaß Burckhardt, der große<br />
Kunst- und Kulturhistoriker, Autor der „Kultur der Renaissance und der „Weltgeschichtlichen<br />
Betrachtungen" die von Goethe zitierte „Grobheit" nicht, mit der man den Berlinern<br />
begegnen müsse, um gut mit ihnen auszukommen.<br />
Doch sollten die Anregungen, die er auf der Berliner Universität, besonders in den Lehrveranstaltungen<br />
Franz Kuglers, Johann Gustav Droysens, August Boeckhs und Leopold von<br />
Rankes erhalten hatte, durch sein ganzes Leben hin weiter wirken 4 .<br />
Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 33, Berkaer Straße 6<br />
1 Jacob Burckhardt: Briefe. Hrsg. v. Max Burckhardt. 8 Bde. Basel 1949 ff. Bd. 1, 1949, S. 147 ff.<br />
2 Brief an Theodor Meyer vom 11. März 1840. Ebd. S. 138<br />
3 Ebd. Bd. 8 (1974), S. 98<br />
4 Vgl. Werner Kägi: Jacob Burckhardt. Eine Biographie, Bd. 2, Basel, 1950, S. 25 ff.<br />
452
Nachrichten<br />
Bismarck-Autographen<br />
im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz<br />
„Wer immer sich in die Geschichte Deutschlands oder Europas während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
vertiefte, mußte zu Bismarck Stellung nehmen . . ." Da sich an der Richtigkeit dieser<br />
Feststellung Erich Eycks (Bismarck - Leben und Werk, 1941 — 44) auch künftig kaum etwas<br />
ändern wird, wollen wir anläßlich von Bismarcks 80. Todestag am 30. Juni 1978 auf einige für die<br />
Urteilsbildung nötige Quellen hinweisen, die sich auch heute noch im Dahlemer Archiv befinden.<br />
Außer Akten aus seiner Amtszeit als preußischer Ministerpräsident, die häufig Bearbeitungsvermerke<br />
oder auch längere Stellungnahmen von ihm enthalten, liegen dort zahlreiche Einzelautographen,<br />
die weniger bekannt, aber recht gut geeignet sind, Politik und Persönlichkeit des<br />
„Eisernen Kanzlers", mitunter auch nur im privaten Rahmen, besser zu beleuchten.<br />
Das Geheime Staatsarchiv hatte seit Kriegsende teils durch Schenkungen von Privatleuten, denen<br />
auch an dieser Stelle gedankt sei, teils bei Autographen-Versteigerungen im In- und Ausland<br />
seinen Bestand an Einzelschriftstücken Fürst Otto von Bismarcks (1815-1898) vermehren und<br />
durch den Erwerb von Faksimiles sowie Ablichtungen entsprechender Autographen aus fremdem<br />
Besitz abrunden können. Diese sogenannten „kleinen Erwerbungen" wurden kürzlich in der Repositur<br />
90 B des Geheimen Staatsarchivs zusammengefaßt, wo sie allen interessierten Besuchern<br />
im Forschungssaal des Archivs innerhalb der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme vorgelegt werden<br />
können.<br />
In den rund hundert Einzelschriftstücken aus der Zeit von 1851 bis 1898 werden die unterschiedlichsten<br />
Themen berührt: Da gibt es politische Äußerungen Bismarcks über die Ursachen der<br />
1848er Revolution (1865), den Bonapartismus (1851), die Einstellung der hessischen Bevölkerung<br />
zur Revolution (1853), seine eigene zum Schleswig-Holstein-Konflikt (1864), zum Krieg mit Österreich<br />
(1866), zur Kaiserfrage (1870), über den Feldzug (1870) und die „Konventionen" mit<br />
Frankreich (1871), zu seiner Entbindung vom Amt des preußischen Ministerpräsidenten (1872),<br />
über Preußens Stellung zum Reich (1872), schließlich zur Deutschen Post (1879-1882) oder auch<br />
zu Finanzfragen (u.a. 1863 und 1869). Andere Stücke stehen bereits am Übergang von der öffentlichen<br />
zur privaten Sphäre, wie etwa Bismarcks Stellungnahme zu einer satirischen Zeitungsmeldung<br />
(1859), die Bitte eines Amerikaners um ein Autogramm (1864) oder die eines Hamburgers, er<br />
möge doch einem Duell mit Rudolf Virchow aus dem Wege gehen (1865), ferner einige anonyme<br />
Briefe an ihn aus der Zeit des Deutschen Krieges (1866) oder Huldigungsgedichte. Bismarcks<br />
Persönlichkeit erfassen wir deutlicher, wenn er einem Gutsbesitzer in Pommern seine Einstellung<br />
zum Christentum darlegt (1865), als Staatsbürger erhält auch er einen Einkommenssteuerbescheid<br />
(1866), als Feinschmecker zeigt ihn ein begeistertes, Dankschreiben an den britischen Gouverneur<br />
von Helgoland, dem er für eine Sendung Hummer dankt (1869). Mit seinem durch Wohlleben<br />
oftmals gefährdeten Gesundheitszustand beschäftigt sich ein Brief seines Arztes aus dem Jahre<br />
1870. Als Landwirt erscheint Bismarck in der Akte eines Baumschulenbesitzers in Klein-Flottbeck,<br />
der mit ihm ausführlich über die Einführung neuer Baumarten korrespondiert hat (1872 ff.),<br />
aber auch in anderen Schreiben, die seine Varziner Güter betreffen (1877—1879). Mit<br />
seiner Pension befaßt sich ein Brief Chrysanders (1890). Anderes Material bezieht sich auf die<br />
Feier seines 80. Geburtstages (1895), und erwähnenswert sind schließlich die Erinnerungen des<br />
Geheimen Hofrats Schulz an die Arbeitsstätte Bismarcks in der Reichskanzlei, geschrieben 1921.<br />
Der Bismarck-Interessent sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß sich der persönliche Nachlaß<br />
des Kanzlers im Schloßarchiv der fürstlichen Familie in Friedrichsruh und weiteres behördliches<br />
Schriftgut aus seiner Amtszeit als Ministerpräsident (außer im Geheimen Staatsarchiv) heute auch<br />
infolge kriegsbedingter Aktenauslagerungen im Zentralen Staatsarchiv der DDR in Merseburg befindet.<br />
Die Akten der 1878 von Bismarck als Zentralbüro des Reichskanzlers gegründeten Reichskanzlei<br />
werden, soweit sie vor 1945 bereits ins Reichsarchiv gelangt waren, bis auf weniges Verlorene<br />
heute in einer weiteren Abteilung des genannten DDR- Archivs in Potsdam verwahrt,<br />
während das Bundesarchiv in Koblenz nur über einen geringen Nachlaßrest Bismarcks, aber über<br />
453
Foto:<br />
Aus dem Eigentum des Autors<br />
117 Mikrofilmrollen (Lesefilme) des Friedrichsruher Archivs verfügt. Weitere Bismarck-Autographen<br />
liegen dort auch in den verschiedensten Nachlässen, u.a. in dem Franz v. Rottenburgs<br />
(bis 1969 im Geheimen Staatsarchiv). Außenpolitische Akten der Bismarck-Zeit verwaltet überdies<br />
das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn. Das Germanische Nationalmuseum<br />
in Nürnberg hat eine von Kurt Kabitzsch zusammengetragene Sammlung von Bismarck-Karikaturen<br />
erworben. Das archivische Schicksal der Bismarck-Akten spiegelt im ganzen das deutsche wieder;<br />
auch aus ihrer Zerrissenheit ergibt sich, wie bedürftig wir Bismarcks als „Mahner zur Einheit<br />
der Deutschen" (Eugen Gerstenmaier) wieder sind.<br />
Das Geheime Staatsarchiv, das sich in seinen Ausstellungen „Bismarck in der Karikatur" (1969)<br />
und „Der Norddeutsche Bund" (1971) schon früher kritisch mit Person und Lebenswerk dieses bedeutenden<br />
Preußen auseinandergesetzt hat, wird Bismarck erneut in einer Ausstellung zum „Berliner<br />
Kongreß 1878" als „ehrlichen Makler" vom 13. Juni 1978 an würdigen. Zugleich wird<br />
in zwei Sondervitrinen mit einigen der hier erwähnten Autographen der 80. Wiederkehr seines<br />
Todestages gedacht. Eckart Henning M. A.<br />
Aus dem Bestand des Märkischen Museums sind zwei Bildmappen mit älteren Stadtansichten von<br />
Berlin erschienen. Die „Altberliner Stadtansichten. Aus dem Märkischen Museum in Berlin, Hauptstadt<br />
der DDR" betitelten und mit jeweils 10, teilweise farbigen Reproduktionen ausgestatteten<br />
Mappen enthalten Abbildungen, die zwischen 1650 und 1860 entstanden sind. Sie sind in Format<br />
und Aufmachung unterschiedlich gestaltet. Bei dem gleichen Herausgeber, der in Berlin (Ost) ansässigen<br />
Berlin-Information, Neustädtische Kirchstraße 3, DDR—108 Berlin, ist auch eine Mappe<br />
mit 12 Abbildungen aus dem graphischen Werk Heinrich Zilles erschienen. Auch hier stammt der<br />
überwiegende Teil der Aquarelle und Zeichnungen aus dem Bestand des Märkischen Museums. SchB.<br />
454
Das KaDeWe von der Tauentzienstraße aus Foto: KaDeWe<br />
--" Das Kaufhaus des Westens — ein Stück Berliner Geschichte<br />
Das KaDeWe: Kindheitserinnerungen, Jugenderinnerungen!<br />
Mit dem „Westring", der Straßenbahn 7, fuhr man vom Bayerischen Platz zum KaDeWe - oder<br />
auch mit der U-Bahn.<br />
Was gab es dort alles zu sehen, zu bestaunen, besonders zur Weihnachtszeit, wenn die Eltern<br />
mit uns durch die einzelnen Etagen gingen und dann so mancher kindliche Wunsch erfüllt wurde:<br />
auch mein erstes Ballkleid aus hellblauem Crepe de Chine, mit kleinen bunten Perlen bestickt,<br />
stammte aus der Modellabteilung des Hauses. Und später - wie oft bin ich nach einem Tauentzienbummel<br />
immer wieder im KaDeWe gelandet.<br />
Dieses schöne Weltstadtwarenhaus wurde am 24. November 1943 das Opfer eines sinnlosen Krieges,<br />
als ein amerikanisches Kampfflugzeug in den Lichthof stürzte und das Haus total ausbrannte.<br />
Eine tote Gegend umgab nun das einstmals lebensprühende Haus. Trotzdem war der Glaube der<br />
Geschäftsleitung des Hertie-Konzerns an die Zukunft dieser Stadt so stark, daß sie den Wiederaufbau<br />
des KaDeWe trotz größter Schwierigkeiten wagte. Er wurde belohnt! Am 3. Juli 1950,<br />
dem Tag der Wiedereröffnung, strömten 180 000 treue Kunden in das inzwischen fertiggestellte<br />
Erdgeschoß und die erste Etage. 1956 war der Wiederaufbau vollendet, damals schon mit der<br />
legendären Lebensmittelabteilung im 6. Stock. Doch schon bald wurde das Haus zu klein. Die<br />
stürmische Entwicklung der 50er und 60er Jahre zwang ab 1975 zu einer Erweiterung der Nutzfläche<br />
um 30% auf insgesamt 70000 qm mit einem Kostenaufwand von 120 Mill. DM. Am<br />
3. April 1978 war es dann soweit! Das „Flaggschiff" des Hertie-Konzerns - eines der größten<br />
und attraktivsten Warenhäuser der Welt - wurde mit einem Gala-Empfang in Anwesenheit des<br />
Bundespräsidenten und 1500 Gästen aus Politik, Kultur und Wirtschaft gefeiert. Herr Seemann,<br />
der Geschäftsführer des KaDeWe, und der Innenarchitekt, Herr Rauch, haben hier Außergewöhnliches<br />
vollbracht. Von der Kosmetikabteilung im Parterre, in der man auf einer Wolke der<br />
455
Die „Zille-Stube",<br />
eines von drei<br />
Restaurants<br />
im KaDeWe.<br />
Foto: KaDeWe<br />
erlesensten Düfte schwebt, über die fünf geschmackvoll angelegten Etagen mit einem internationalen<br />
Abgebot an Waren, das seinesgleichen sucht, bis zum Schlemmerparadies im 6. Stockwerk<br />
ist es ein Haus der Superlative.<br />
Die Weltstadt Berlin ist jetzt um eine Attraktion reicher. Sie gehört für den Touristen dazu wie<br />
der Kurfürstendamm, die Gedächtniskirche, der Reichstag, der Funkturm, das Schloß Charlottenburg.<br />
Zehn Jahre Humboldt-Zentrum Berlin<br />
Alice Hamecher<br />
Das Humboldt-Zentrum Berlin kann in diesem Jahr auf die erste Dekade erfolgreicher Tätigkeit<br />
in unserer Stadt verweisen. Als Berliner Sektion der bundesweit aktiven Humboldt-Gesellschaft<br />
ist es der Pflege von Erbe und Erinnerung an Wilhelm von Humboldt (1767 — 1835), den<br />
preußischen Staatsmann und Gelehrten, und an Alexander von Humboldt (1769—1859), den<br />
bekannten Naturforscher und Geographen gewidmet, zwei Persönlichkeiten der Geschichte Preußens<br />
und Berlins, die die Entwicklung von Wissenschaft und Bildung im 19. Jahrhundert bedeutsam beeinflußt<br />
haben. Aber auch den Kreis der Freunde und Zeitgenossen der beiden Brüder in ihrer<br />
Bedeutung in ihrer sowie für unsere Zeit erkennbar werden zu lassen, hat sich das Humboldt-<br />
Zentrum zur Aufgabe gesetzt. Dabei wurde besonderes Gewicht auf die regelmäßig stattfindenden<br />
Vortragsveranstaltungen gelegt, die neben Themen verschiedener Disziplinen aus Geschichte, Kunstgeschichte<br />
und Naturwissenschaften auch die Beziehung Wilhelm und Alexander von Humboldts<br />
zu Berlin behandelt haben. Es soll hier nur an Schloß Tegel erinnert werden, deren Besitzerin,<br />
Frau Marie Agnes von Heinz, schon mehrmals Schloß und Park für Veranstaltungen des Humboldt-Zentrums<br />
zur Verfügung stellte. Zu den Vortragenden des Humboldt-Zentrums gehörten in<br />
den letzten Jahren auch immer wieder Kenner und Gelehrte, die in unserem Verein nicht unbekannt<br />
sind, wobei hier auf Frau Prof. Wirth, Herrn Dr. Zimmermann, Herrn Prof. v. Simson und<br />
Herrn Prof. Wilhelm Richter stellvertretend für alle anderen verwiesen werden soll.<br />
Unter der jetzigen Vorsitzenden, Frau Dr. habil. Hofmann-Wychgram, erscheinen seit 1975 halbjährlich<br />
Mitteilungen, in denen Vorankündigungen und Berichte über Veranstaltungen des Hum-<br />
456
oldt-Zentrums sowie Hinweise und Rezensionen zu neuerscheinender Literatur den Mitgliedern<br />
und Freunden Anregungen für ihre gemeinsamen Bemühungen um die Geschichte der Brüder<br />
Humboldt und ihre Erforschung, die gerade in den letzten Jahren sich wachsenden wissenschaftlichen<br />
Interesses erfreuen kann, vermitteln.<br />
Das Humboldt-Zentrum Berlin hat sich in den letzten zehn Jahren unter den historischen Vereinen<br />
unserer Stadt einen bedeutenden und anerkannten Platz gesichert. W. N.<br />
Arbeiten zur Geschichte Berlins in Ost-Berlin<br />
Wie die „Berliner Zeitung" Nr. 257 vom 31. Oktober 1977 berichtet, haben sich die Mitarbeiter<br />
des Zentralinstituts für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR in einem Brief an<br />
Erich Honecker mit Fragen der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung beschäftigt. Wörtlich hieß<br />
es unter anderem:<br />
Zu Ehren des 30. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik verpflichtet<br />
sich das Kollektiv des Instituts, auf der Grundlage der Beschlüsse des IX. Parteitages der SED im<br />
sozialistischen Wettbewerb 1978/79 die Pläne in hoher Qualität zu erfüllen und durch Übernahme<br />
zusätzlicher Aufgaben, die aus dem aktuell-politischen Kampf erwachsen, überzuerfüllen.<br />
Im Mittelpunkt der Aufgaben des Instituts werden unter anderem „Arbeiten zur Geschichte Berlins<br />
und der Berliner Arbeiterbewegung" stehen. SchB.<br />
Spittel-Kolonnaden entstehen neu<br />
Die Spittel-Kolonnaden wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Ihr Südteil soll nach Ausführungen<br />
im „Neuen Deutschland" vom 5. Mai 1978 nunmehr im Bereich zwischen Gertrauden-Brücke und<br />
Leipziger Straße neu errichtet werden. Die Kolonnaden werden in Grünanlagen halbkreisförmig eingebettet<br />
und von Trophäen, Putten und Vasen gekrönt. SchB.<br />
*<br />
Am 22. Februar 1978 ist in Berlin (Ost) der Bezirksvorstand der Denkmalpflege gegründet worden.<br />
Er setzt sich aus Mitgliedern der 1977 ins Leben gerufenen Interessengemeinschaft Denkmalpflege,<br />
Kultur und Geschichte zusammen, der sich jetzt erweiterte Möglichkeiten zur Arbeit<br />
bieten. In den fünf Interessengruppen Denkmalpflege, Urgeschichte, Frühgeschichte, Ortschronik<br />
und Sammlerfreunde arbeiten rund 300 Mitglieder mit, die im Jahre 1978 etwa 20 Vorträge und<br />
Exkursionen geplant haben. Auf der (Ost-)Berliner Bezirksdenkmalliste stehen rund 350 Objekte.<br />
SchB.<br />
EUROPA NOSTRA<br />
Die europäische Vereinigung für Denkmal- und Naturschutz EUROPA NOSTRA wird ihre diesjährige<br />
Hauptversammlung vom 21. bis 24. September in Hamburg abhalten.<br />
EUROPA NOSTRA wurde vor zwölf Jahren als Dachorganisation aller europäischen Vereine und<br />
Verbände für Denkmal- und Naturschutz gegründet. Heute umfaßt sie einige tausend Mitgliedsverbände<br />
mit mehreren Millionen Mitgliedern in 23 Ländern Europas.<br />
Nach Kongressen dieser Art in London, Zürich, Amsterdam und Wien findet die EUROPA-<br />
NOSTRA-Tagung erstmalig seit 1969 wieder in Deutschland statt, und zwar - auf Einladung der<br />
Stiftung F. V. S. und des Deutschen Heimatbundes - in Hamburg.<br />
Als europäischer Dachverband nationaler, regionaler und lokaler Verbände hat es sich diese Vereinigung<br />
zum Ziel gesetzt, das Verständnis der Völker Europas für ihr gemeinsames Erbe in der<br />
Kunst und der Architektur sowie für die landschaftlichen Schönheiten zu wecken. Sie will die<br />
Aufmerksamkeit auf die Gefahren lenken, durch welche diese unersetzlichen Werte bedroht werden,<br />
und auf Maßnahmen zu ihrem Schutz dringen, und sie will für ein hohes Niveau in der zeit-<br />
457
genössischen Architektur in Stadt und Land sowie für die Verbesserung der Umweltbedingungen<br />
eintreten.<br />
Seit der Gründung der EN besteht ein enger Kontakt zu anderen europäischen Körperschaften,<br />
insbesondere mit dem Europarat, mit dem zusammen die EN beispielsweise das Europäische<br />
Denkmalschutzjahr 1975 veranstaltet hat. Die ICOMOS, der internationale Gemeindeverband und<br />
der Europäische Verkehrsverband sind durch Delegierte im Präsidium der EN vertreten.<br />
In der Praxis werden die Aufgaben der EN verfolgt durch Resolutionen der Mitgliederversammlung<br />
an europäische und internationale Körperschaften, unmittelbare Interventionen zu Einzelproblemen,<br />
Erfahrungsaustausch innerhalb der Mitglieder, Seminare zu bestimmten Fragen von<br />
europäischer Bedeutung (z.B. Jugend- und Denkmalpflege) sowie Diareihen und Filme. Zum Denkmalschutzjahr<br />
1975 hat die EN beispielsweise einen Film hergestellt, der zu den höchstdekorierten<br />
Filmen auf diesem Gebiet zählt. Dem Einfluß der EN ist es u.a. zu verdanken, daß der Marktplatz<br />
von Brüssel heute frei ist von parkenden Fahrzeugen, daß die malerischen Innenstadt-<br />
Kanäle von Gent nicht zugeschüttet wurden, daß der Plan für Neubauten und moderne Straßen<br />
in der Mönchsrepublik Athos zurückgestellt wurde, daß das architektonisch wertvolle Gefängnis<br />
zu Stein am Rhein nicht einem Neubau weichen mußte, daß Straßen durch wertvollen Baubestand umgeplant<br />
wurden und anderes mehr. Als Auftragsarbeit für den Europarat und die Europäische<br />
Gemeindekonferenz hat die EN das „Forum der Historischen Städte" ins Leben gerufen, zu dem<br />
heute über 400 Städte in 18 europäischen Ländern zählen. Dieses Forum dient dem Erfahrungsaustausch<br />
insbesondere durch Studienreisen von Bürgermeistern und leitenden städtischen Beamten<br />
sowie dem Austausch von beispielhaften Projekten.<br />
In diesem Jahr verleiht die EN erstmalig Preise für außergewöhnliche Leistungen, um die internationale<br />
Aufmerksamkeit auf solche Projekte zu lenken, durch die auf die verschiedenste Weise<br />
ein Beitrag zur Erhaltung des architektonischen und landschaftlichen Erbes Europas geleistet worden<br />
ist. Es werden jährlich fünf Medaillen und zehn Diplome verliehen.<br />
Von unseren Mitgliedern<br />
Mitgliederversammlung 1978<br />
Dr. G. Kutzsch neuer Vorsitzender - Professor Dr. Dr. Hoffmann-Axthelm Ehrenvorsitzender -<br />
Professor Oschilewski Ehrenmitglied<br />
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins für die Geschichte Berlins am 10. Mai 1978 im<br />
Bürgersaal des Rathauses Charlottenburg wurde vom Vorsitzenden, Professor Dr. Dr. W. Hoffmann-<br />
Axthelm, mit einem Gruß an die 52 anwesenden von insgesamt 838 Mitgliedern und mit der Totenehrung<br />
eingeleitet. Seit der letzten Mitgliederversammlung sind die folgenden 17 Mitglieder verstorben:<br />
Dr. Karl Bergerhoff, Alfred Braun, Hans Bruhn.Lotte Fröhlich, Professor Dr. Karl Göpp, Ernst<br />
Jänicke, Gertrud Kahl, Dr. Hans Leichter, Erwin Montag, Kurt Pomplun, Johannes Posth, Georg<br />
Rosenberg, Werner Runge, Walter Schneider-Römheld, Wilhelm Schülke, Dr. Robert Venter,<br />
Karl Vogelmann.<br />
Die Versammlung verzichtete darauf, den ihr im Umdruck vorliegenden Tätigkeitsbericht des Schriftführers<br />
verlesen zu lassen, zumal dieser Bericht auch Bestandteil des Jahrbuches 1978 sein soll. Auch<br />
der Kassenbericht 1977 und der Voranschlag 1978 der Schatzmeisterin, Frau R. Koepke, waren den<br />
Mitgliedern vervielfältigt zur Verfügung gestellt worden. Frau R. Koepke erläuterte die einzelnen<br />
Positionen, und K. Grave erstattete für die Betreuer der Bibliothek den Bibliotheksbericht. Aus den<br />
Berichten der Kassenprüfer Kretschmer und Degenhardt (von diesem vorgetragen) und der Bibliotheksprüfer<br />
Mende und Schlenk (wieder von Mende erstattet) ergaben sich keine Beanstandungen,<br />
jedoch einige wertvolle Anregungen. Gegenwärtig umfaßt die Bibliothek 11 500 Bände. C. P. Mader<br />
gab in der Aussprache einen Hinweis zum Etat des laufenden Jahres.<br />
Mit einem Dank für die Arbeit des Vorstandes beantragte Landgerichtsrat a.D. Rechtsanwalt D. Franz<br />
die Entlastung, die einmütig ausgesprochen wurde. Da sich der Vorsitzende, Professor Dr. Dr.<br />
458
W. Hoffmann-Axthelm, gemäß seiner Ankündigung auf der Mitgliederversammlung 1977 nunmehr<br />
vom Amt des Vorsitzenden zurückzog, benutzte er die Gelegenheit zu einem kleinen Rechenschaftsbericht,<br />
aber auch zu einem Dank an Walther G. Oschilewski, der ein Vierteljahrhundert lang das<br />
Jahrbuch Berlins redigierte, an Dr. P. Letkemann, der hinsichtlich der „Mitteilungen" die Nägel eingeschlagen<br />
hat, die noch lange halten mögen, und an C. P. Mader, der sich um die Gestaltung der<br />
Publikationen des Vereins verdient gemacht hat, nicht zuletzt an die Vorstandsmitglieder für ihre<br />
Arbeit und an die Mitglieder für ihr Vertrauen. Auf einstimmigen Antrag des Vorstandes wurde der<br />
bisherige 1. stellvertretende Vorsitzende, Dr. Gerhard Kutzsch, für die Wahl zum neuen Vorsitzenden<br />
nominiert. Die Jahreshauptversammlung folgte dem Vorschlag einstimmig. Dr. G. Kutzsch dankte<br />
für den einmütigen Vertrauenserweis und richtete ein Dankeswort an seinen Vorgänger, der trotz<br />
starker Arbeitsbelastung den Verein mit glücklicher Hand geleitet, dessen Ansehen gemehrt und dazu<br />
beigetragen hat, daß sich in seiner Amtszeit die Zahl der Mitglieder annähernd verdreifacht hat. Bis<br />
zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes wurde der Schriftführer, Dr. H. G. Schultze-Berndt.<br />
auf Beschluß der Mitglieder kommissarisch auch mit dem Posten des 1. stellvertretenden Vorsitzenden<br />
betraut. Ebenso einmütig war die Wahl von Dr. Wetzel als Nachfolger von Professor Kettig zum Beisitzer.<br />
Einstimmig war die Wiederwahl der bewährten Kassenprüfer Deg'enhardt und Kretschmer und<br />
der versierten Bibliotheksprüfer Mende und Schlenk.<br />
Mit einer Ovation entsprach die Mitgliederversammlung dem Antrag des Vorstandes, Professor<br />
E.h. Walther G. Oschilewski die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen und Professor Dr. Dr. Walter<br />
Hoffmann-Axthelm zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Am Schluß der Jahreshauptversammlung,<br />
in der kein Widerspruch und nur wenig (berechtigte) Kritik laut wurde, standen die Frage einer Aktivierung<br />
auch der Geselligkeit im Anschluß an die Veranstaltungen des Vereins, für die sich Frau<br />
Hamecher einsetzte, und das Problem des Drucks eines neuen Mitgliederverzeichnisses, der wahrscheinlich<br />
an den Finanzen scheitern dürfte, wenn sich der Verein nicht mit einer wesentlich bescheideneren<br />
Ausstattung begnügen will. An der Diskussion beteiligten sich unter anderem Frau Wolff-<br />
Harms, Frau Brauer, C. P. Mader, Professor Hoffmann-Axthelm, Dr. Schultze-Berndt und<br />
Dr. Kutzsch. Nach dem offiziellen Schluß der Versammlung zeigte K. H. Kretschmer einen filmischen<br />
Rückblick auf die Wendlandfahrt 1977. Die Technik verhinderte es dann leider, daß auch noch ein<br />
Film über Kurt Pomplun vorgeführt werden konnte. H. G. Schultze-Berndt<br />
Professor Walther G. Oschilewski Ehrenmitglied des Vereins<br />
Auf der diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung am 10. Mai wurde Herrn Professor Walther<br />
G. Oschilewski die Ehrenmitgliedschaft unseres Vereins verliehen.<br />
W.G.O. ist Autodidakt. Er spricht einmal von seiner „tiefeingewurzelten Neigung zu tun und zu<br />
lassen, was ihm Spaß macht". Er hat sich nie bürokratischen Zwängen einordnen wollen, um ein<br />
„freier" Mann sein zu können - ein Außenseiter, wie er von sich bekannte. Der sicheren Wegführung<br />
eines festen Berufes, gerade in den Jahren des Aufbaus einer Existenz, entratend, hat er sich auf sich<br />
selbst gestellt und ist mit Selbstdisziplin, Beharrlichkeit, Fleiß und Wissen der erfolgreiche, angesehene<br />
Schriftsteller zur Literatur-, Kultur- und Geistesgeschichte im weitesten Sinne geworden, der er heute<br />
ist. Der Arbeitersohn aus dem Nordosten Berlins hat sich zeitlebens darum bemüht, durch Tun und<br />
Wirken im Sinne Goethes „ein Mensch zu werden". Menschenleben, Lebensführungen haben ihn<br />
denn auch immer wieder zur Darstellung gereizt, eine Vielzahl guter Biographien entstammt seiner<br />
Feder, vornehmlich auch über Männer, die handelnd und gestaltend in der politisch-sozialen Arena<br />
standen. W.G.O. bekannte sich von früher Jugend an zur Idee sozialistischer Lebens- und Gesellschaftsgestaltung.<br />
Aber abgesehen von wenigen Jahren der Mitgliedschaft in der sozialdemokratischen<br />
Fraktion im Berliner Stadtparlament hielt sich seine parteipolitische Aktivität in Grenzen, und sein<br />
politisches Engagement bestand im Einsatz für Recht, Würde und Erneuerung des Menschen, die ihm<br />
ein ethischer, humanitäter Sozialismus verhieß. O. wurde der Chronist der deutschen Arbeiterbewegung<br />
und ihrer politischen Organisation, der Sozialdemokratischen Partei. Er schrieb über den<br />
„sozialen Geist des alten Handwerks", über die Konsumgenossenschaftsbewegung, über den sozialen<br />
Fortschritt schlechthin. Ein gemeinsamer Nenner ist den Arbeiten eigen, und geschichtliche Zusammenhänge<br />
werden verdeutlicht - ein wichtiges Kriterium wissenschaftlicher Arbeit. Die Erinnerung an<br />
das Bildungsstreben innerhalb der frühen deutschen Arbeiterbewegung wird wachgerufen, in deren<br />
459
Geiste W.G.O. noch immer lernt und lehrt. Nicht zuletzt wendet sich der Mann der Feder an die<br />
jungen Generationen, denen er ein „altes" geistiges Fundament - soziales Denken als Aufgabe und<br />
Verpflichtung — wieder aufs neue geben will.<br />
Ein umfangreicher Teil des CEuvres W. G. Oschilewskis beschäftigt sich mit Vergangenheit und Gegenwart<br />
seiner vielgeliebten Heimatstadt Berlin, deren politische Bühne und Kulturszene von ganz unten<br />
ausgeleuchtet wird, vom kleinen Volke her, bis hin zu den Beziehungen der Berühmten aus Politik,<br />
Literatur und bildender Kunst zum Geist und Pulsschlag dieser mobilen Stadt. O. ist der Historiograph<br />
der Berliner politischen Linken und - auf dem kulturellen Sektor ihr nahestehend - der Volksbühnenbewegung,<br />
die Mittel und Wege zu neuen Formen der Eingliederung der Bühnenkunst in die<br />
Gemeinschaft des arbeitenden Volkes suchte und ermöglichte. Als freier Schriftsteller und Journalist<br />
fand W.G.O. nach dem Zweiten Weltkrieg den Zugang in ein Verlagshaus, das ihm für lange Jahre<br />
festen Boden unter den Füßen geben sollte. Er brachte seinen unermüdlichen Fleiß und sein großes<br />
Wissen ein und wurde Berlins wohl herausragendster und produktivster Fachmann in den Bereichen<br />
Druck, Schrift, Buch, Verlag, Zeitung. „Ich habe mich immer bemüht, sehr genau und präzise zu sein,<br />
ohne die lebendige Diktion für falsch zu halten." In dieser Selbstbeurteilung verbindet sich das<br />
Bedürfnis nach wissenschaftlicher Gründlichkeit mit dem Streben des Journalisten aus Leidenschaft<br />
nach wirkungsvollem, gediegenem und brillantem Ausdruck. O., umfassend gebildet, führt in die<br />
Problematik seiner Themen ein, erschließt sie quellenmäßig sauber, analysiert sie so faktenreich wie<br />
kritisch und stellt sie, Grundsätzliches herausarbeitend, Wichtiges vom Unwichtigen trennend - ein<br />
sehr wesentliches Merkmal wissenschaftlicher Qualifikation —, allgemeinverständlich dar. Er findet<br />
die Anerkennung auch der Fachwissenschaftler, die er immer sehr ernst genommen hat.<br />
W. G. Oschilewskis Leben ist erfüllt von Willens- und Erkenntnisdrang, von Arbeit an sich selbst und<br />
für andere. Wer da will, wird wertvolle Anregungen und Impulse von ihm empfangen. Um an den<br />
Titel der Festschrift zu seinem 65. Geburtstag anzuknüpfen - man darf sagen, daß er „mittels Tun ein<br />
Mensch geworden ist". Gerhard Kutzsch<br />
*<br />
Unserem Mitglied Frau Käte Haack wurde am 17. April vom Senator für Kulturelle Angelegenheiten,<br />
Dr. Dieter Sauberzweig, der ihr vom Herrn Bundespräsidenten verliehene Verdienstorden der Bundesrepublik<br />
Deutschland überreicht. Wir freuen uns über diese hohe Auszeichnung! SchB.<br />
*<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche zum<br />
70. Geburtstag Frau Ursula Arfert, Frau Eva Guth, Herrn Hans Pels-Leusden; zum 75. Geburtstag<br />
Herrn Walter Herrmann, Frau Ilse Kemnitz, Frau Rose Marie Pluta-Mende, Herrn Dr. Reinhard<br />
Bickerich; zum 80. Geburtstag Herrn Ernst Jänicke; zum 85. Geburtstag Frau Dr. Ilse Reicke.<br />
460
Buchbesprechungen<br />
Carl-Philipp Melms: Chronik von Dahlem. Berlin: arani 1978. 178 S., Pappbd., 17,80 DM.<br />
Unter den Berliner Vororten nahm Dahlem stets eine besondere Stellung ein. Seit dem Beginn des<br />
modernen Ortsausbaus um die Jahrhundertwende wurde hier versucht, eine Synthese zwischen Villenviertel<br />
und Forschungsstätte zu schaffen. Aus Interesse an der Heimatgeschichte hatte Carl-Philipp<br />
Melms 1957 eine kleine Heimatgeschichte über diesen heute zum Bezirk Zehlendorf gehörenden<br />
Ortsteil verfaßt, die in ihrer Zweiteilung in eine historische Übersicht und chronikalische Notizen das<br />
Bedürfnis nach einfacher Information über den Stadtteil befriedigte.<br />
Heute aber, 21 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage, treten in der unveränderten Neuausgabe<br />
die Schwächen des Buches stärker als die Vorzüge hervor. So hatte der Verfasser es nicht für<br />
nötig gehalten, seine Quellen und die benutzte Literatur anzugeben.<br />
Ein besonders schwerwiegender Mangel ist jedoch das Abbrechen des chronikalischen Teils mit dem<br />
Jahr 1945. Seitdem hat sich auch in Dahlem vieles verändert, und man wünschte sich die Darstellung<br />
auch der Nachkriegsgeschichte, die 1957 vom Verfasser angekündigt wurde. Der alte und neue Verlag<br />
hatte 21 Jahre Zeit, dies vorzubereiten. Die unveränderte Neuauflage bedeutet daher eine Blamage.<br />
Felix Escher<br />
Adolf Glaßbrenner: Wie war Berlin vergnügt. Geschichten und Szenen. Illustr. v. Marga Karlson.<br />
Berlin: arani 1977. 100 S., brosch., 11,80 DM.<br />
Adolf Glaßbrenner: Altes gemütliches Berlin. Geschichten und Szenen. Illustr. v. Marga Karlson.<br />
Berlin: arani 1977.126 S., brosch., 11,80 DN.<br />
Es ist gewiß verdienstlich, wenn der arani-Verlag das Werk Glaßbrenners in handlicher Form wieder<br />
vorlegt (wobei es sich diese alteingesessene Verlagsgesellschaft vor einiger Zeit gefallen lassen mußte,<br />
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als „Ost-Berliner arani-Verlag" bezeichnet zu werden). Eine<br />
Kürzestbiographie Glaßbrenners ist den Bänden vorangestellt, die dem ersten Kennenlernen Glaßbrenners<br />
dienlich sind. Der anspruchsvolle Leser hätte sich ein Minimum an bibliographischen Angaben<br />
zu den einzelnen Stücken gewünscht, die in ihrer Kürze einen gewissen Eindruck vom Humor<br />
Glaßbrenners und von seinem Berlinerisch um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts zu vermitteln<br />
vermögen. Man findet auch das geflügelte Wort „Es ist die allerhöchste Eisenbahn!" jenes Mannes,<br />
der die Worte immer umdrehte und eigentlich sagen wollte „Es ist allerhöchste Zeit".<br />
H. G. Schultze-Berndl<br />
Subskriptionsangebote<br />
1. Urkundliche Geschichte der Stadt und Festung Spandau von Enstehung der Stadt bis zur Gegenwart,<br />
bearbeitet von Dr. Otto Kuntzemüller. Mit einem Geleitwort und Nachtrag von Oberbürgermeister<br />
i. R., Geheimer Regierungsrat Friedrich Koeltze. Otto Kuntzemüller veröffentlichte die<br />
Chronik der Stadt Spandau erstmals 1881. Die Auflage, war bald vergriffen. Erst im Jahre 1928 wurde<br />
diese wichtige Stadtgeschichte wieder neu herausgegeben. Als Nachtrag kamen die Aufzeichnungen<br />
des ehemaligen Oberbürgermeisters Friedrich Koeltze aus seiner Dienstzeit in der Spandauer Verwaltung<br />
vom Juli 1884 bis zum April 1919 hinzu.<br />
Nachdruck der Ausgabe 1928/29. Zwei Bände in einem Band. VX/321 Seiten und VHI/309 Seiten.<br />
In Leinen gebunden mit Schutzumschlag. Vorbestellpreis bis zum Erscheinen (etwa im September<br />
1978) 98 DM, nach Erscheinen etwa 128 DM.<br />
2. Samuel Heinrich Spiker: Berlin und seine Umgebungen im neunzehnten Jahrhundert. Eine Sammlung<br />
in Stahl gestochener Ansichten, von den ausgezeichnetesten Künstlern Englands, nach an Ort<br />
und Stelle aufgenommenen Zeichnungen von Mauch, Gärtner, Biermann und Hintze nebst topographisch-historischen<br />
Erläuterungen von S. H. Spiker, königl. Preuß. Biliothekar. Unveränderter<br />
Nachdruck der Ausgabe Berlin 1833. Mit 105 Ansichten auf 52 Tafeln und dem gestochenen Titelblatt.<br />
Die Nachdruckausgabe (mit den Tafeln im Lichtdruck) erscheint Anfang 1979. Vorbestellpreis<br />
128 DM, nach Erscheinen etwa 148 DM.<br />
Auskunft nur: arani-Verlag, Postfach 31 08 29,1000 Berlin 31.<br />
461
Es mag in diesem Jahr, in dem sich der Geburtstag Gustav Stresemanns zum hundertsten Mal jährt,<br />
von Interesse sein, daß seine häufig und meist mit Schmunzeln zitierte Doktorarbeit in Faksimile-<br />
Ausgabe vorliegt: Die Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschaefts. Inaugural-Dissertation zur<br />
Erlangung der Doktorwürde der Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig. Vorgelegt<br />
von Gustav Stresemann, stud. phil. Gedruckt bei R. F. Funcke, Berlin SO. 16. Köpenickerstr. 114.<br />
Dieser Druck kann zum Preise von 10,60 DM bezogen werden über den Schriftführer oder unmittelbar<br />
bei der Gesellschaft für die Geschichte der Biographie des Brauwesens E.V., Seestraße 13,<br />
1000 Berlin 65.<br />
Unser diesjähriges Jahrbuch „Der Bär von Berlin" wird im September erscheinen. Es enthält acht<br />
Beiträge mit insgesamt 70 Abbildungen zur Geschichte sowie »vultur- und Kunstgeschichte unserer<br />
Stadt. Die Mitglieder erhalten den Band zugeschickt, soweit sie den fälligen Mitgliedsbeitrag für das<br />
laufende Jahr (z.Z. 36 DM) entrichtet haben. Der Ladenpreis beträgt 22,80 DM. BesteUungen von<br />
Nichtmitgliedem, Zusatzbestellungen oder Bestellungen von Buchhandlungen direkt in der Geschäftsstelle<br />
des Vereins: Albert Brauer, Blissestraße 27, 1000 Berlin 31, und beim Verlag: Westkreuz,<br />
Rehagener Straße 30,1000 Berlin 49.<br />
Im II. Vierteljahr 1978<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Dr. Michael Engel, Bibliotheksassessor<br />
1000 Berlin 19, Kaiserdamm 102<br />
Tel. 3 21 26 71 (H. P. Freytag)<br />
Hans-Peter Farchmin, Assessor<br />
1000 Berlin 31, Witteisbacherstraße 25<br />
Tel. 87 08 83 (H. Schramm)<br />
Käthe Feller, Rentnerin<br />
1000 Berlin 19, Westendallee 115<br />
Tel. 3 05 99 77 (Brauer)<br />
Dr. Rainer Hildebrandt, Geschäftsführer<br />
1000 Berlin 33, Triberger Straße 5<br />
Tel. 8 21 20 34 (Dr. Schultze-Berndt)<br />
Jörg Koch, kaufm. Angestellter<br />
3180 Wolfsburg 1, Stralsunder Ring 8<br />
Tel. (0 53 61) 70 18 85 (Gerh. Koch)<br />
Friedrich Wilhelm Kockert, Verwaltungsjurist<br />
1000 Berlin 47, Paster-Behrens-Straße 26<br />
Tel. 6 06 49 07 (K.-H. Kretschmer)<br />
Wolfgang Korth, Wissenschaftl. Dokumentär<br />
6382 Friedrichsdorf 2, Falkenweg 23<br />
Tel. (0 61 75) 18 32 (Schriftführer)<br />
Studienfahrt nach Goslar<br />
Fritz W. Obermann, Fabrikant<br />
1000 Berlin 19, Johannisburger Allee 11<br />
Tel. 6 25 80 66 (Alice Hamecher)<br />
Willy Ripken, Bez.-Ob.-Insp. i. R.<br />
8580 Bayreuth, Lotzbeckstraße 59<br />
Tel.(09 21)4 13 31 (Brauer)<br />
Rosemarie Seidel, Verwaltungsrätin<br />
1000 Berlin 38, Osthofener Weg 32<br />
Tel. 8 03 44 28 (H. Schramm)<br />
Ruth Scheid, Hausfrau<br />
1000 Berlin 33, Laubacher Straße 7<br />
Tel. 8 22 47 24 (G. Linke)<br />
Herbert Töpfer, Verw.-Amtmann<br />
1000 Berlin 10, Kohlrauschstraße 5<br />
Tel. 3 42 71 15 (H. Schramm)<br />
Gertrud Walter, Rentnerin<br />
1000 Berlin 41, Bergstraße 19<br />
Tel. 7 91 39 28 (Schriftführer)<br />
Ziel der diesjährigen Exkursion ist die Stadt Goslar, die uns vom Städtischen Archivdirektor Dr. Werner<br />
Hillebrand ein vorzügliches Programm gestalten ließ. Der in die Berliner Schulferien fallende<br />
frühe Zeitpunkt vom 1. bis 3. September 1978 ist auf Termingründe beim Gastgeber zurückzuführen,<br />
unter anderem auf das an einem späteren Wochenende stattfindende Treffen mit der Goslarer Patenstadt<br />
Brieg, aber auch auf den Wunsch, die Mitreisenden am Goslarer Altstadtfest teilnehmen zu<br />
lassen.<br />
Das Programm hat das folgende Aussehen:<br />
Freitag, 1. September 1978<br />
6.30 Uhr Abfahrt von der Hardenbergstraße 32 (Berliner Bank)<br />
12.00 Uhr Ankunft in Goslar (Hotel Berliner Bär)<br />
462.
12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen in den Gaststätten Grauhof-Brunnen, Am Grauhof-<br />
Brunnen, 3380 Goslar 1<br />
13.45 Uhr Besichtigung des Lehrstollens des Erzbergwerkes Rammeisberg in Gruppen von<br />
25 bis 30 Personen. Dauer: jeweils ca. 45 Minuten (festes Schuhwerk empfehlenswert).<br />
Für die wartenden Gruppen besteht die Möglichkeit zu einem Spaziergang am<br />
Herzberger Teich oder bei entsprechenden Temperaturen zu einem Bad im<br />
Herzberger Teich (die Talsperre liegt unmittelbar neben dem Eingang zum<br />
Stollen).<br />
Anschließend Wanderung auf den Rammeisberg zur Waldgaststätte „Maltermeister<br />
Turm" zum Kaffeetrinken. Der Aufstieg erfordert etwa eine halbe<br />
Stunde Zeit. Eine Fahrstraße zum Maltermeisterturm ist aber auch vorhanden.<br />
Nach dem Kaffeetrinken Wanderung (ca. eine halbe Stunde bergab) entlang des<br />
Waldrandes/Geologie-Pfades bis zum Berufsförderungswerk.<br />
Rückfahrt zum Hotel „Berliner Bär".<br />
19.30 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel-Restaurant „Klause", Hoher Weg 3, Goslar.<br />
Sonnabend, 2. September 1978<br />
9.00 bis 9.30 Uhr Empfang durch die Stadt Goslar im Rathaus. Anschließend Fahrt in den Oberharz<br />
(die Route richtet sich etwas nach dem Wetter): Granetalsperre, Innerstetalsperre,<br />
Lautenthal, Wildemann, Clausthal-Zellerfeld, Dammgraben - Dammhaus<br />
(Harz-Hochstraße), Andreasberg, evtl. Odertalsperre, Torfhaus, Altenau,<br />
Okertalsperre, dort<br />
ca. 12.30 Uhr Mittagessen (Hotel „Das Tanneck", Wiesenbergstraße 17, 3396 Schulenberg).<br />
Rückkehr am Nachmittag.<br />
Am Abend Besuch des Altstadtfestes, Gelegenheit zum Abendessen nach eigener<br />
Wahl.<br />
Sonntag, 3. September 1978<br />
9.30 Uhr Mönchehaus: Einführung in die Stadtgeschichte (Städtischer Archivdirektor<br />
Dr. W. Hillebrand) und Vorführung eines Goslar-Films.<br />
10.00 bis 12.00 Uhr Stadtführung in Gruppen von ca. 30 Personen.<br />
12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen im 475jährigen Hotel Kaiser Worth, Markt 3, Goslar.<br />
Anschließend Abfahrt nach Berlin.<br />
Für eine Kaffeepause wird noch eine geeignete Gaststätte gesucht,<br />
ca. 21.00 Uhr Ankunft in Berlin.<br />
Änderungen vorbehalten.<br />
In Goslar sind genügend Einzelzimmer und Doppelzimmer zum Endpreis von 30 DM bzw. 24 DM je<br />
Bett reserviert worden, sämtlich im Hotel „Berliner Bär", Krugwiese, 3380 Goslar. Alle Zimmer sind<br />
mit Bad und WC ausgestattet. Die Benutzung des Schwimmbades ist kostenlos. Für die Sauna wird<br />
ein Kostenbeitrag von 6 DM pro Person erhoben.<br />
Alle Mitglieder, die sich auf die Vorankündigung im letzten Heft der „Mitteilungen" gemeldet haben,<br />
erhalten unaufgefordert ein Rundschreiben mit verbindlichem Anmeldeschein. Alle weiteren Interessenten<br />
werden gebeten, sich formlos bis zum 22. Juli bei Dr. Hans G. Schuitze-Berndt, Seestraße 13,<br />
1000 Berlin 65, anzumelden. Gesonderte briefliche Einladungen ergehen nicht!<br />
Für die Studienfahrt wird ein Teilnehmerhonorar von 43,50 DM je Person erbeten, das die Omnibusfahrt,<br />
den Ausflug in den Oberharz sowie alle Führungen und Eintrittsgelder einschließt. Gegebenenfalls<br />
kann dieser Teilnehmerbeitrag bei Schulkindern ermäßigt werden.<br />
Wo aus Gründen der rascheren Abwicklung ein gemeinsames Mittagessen bzw. Kaffeegedeck vereinbart<br />
worden ist, entstehen die folgenden Kosten: Grauhof-Brunnen (wird noch mitgeteilt); Waldgaststätte<br />
„Maltermeister Turm": Kaffeegedeck (Kännchen, ein Stück Torte/Kuchen) 5,50 DM;<br />
Hotel-Restaurant „Klause": kalte Platte (reichlich) 9 DM; Hotel „Das Tanneck" (auf Wunsch des<br />
Hauses ä Ia carte); Hotel Kaiser Worth: Harzer Fleischspieß auf Würfelkartoffeln mit sautiertem, gemischtem<br />
Gemüse, Speck und Zwiebelwürfeln 15,70 DM. H. C. Schuitze-Berndt<br />
463
Veranstaltungen im III. Quartal 1978<br />
1. Sonnabend, 22. Juli 1978, 15 Uhr: „Natur- und Landschaftsschutz am Beispiel der<br />
Pfaueninsel". Leitung: Herr Dr. Hans-Jürgen Mielke und Herr Prof. Horst Korge<br />
(Volksbund Naturschutz). Treffpunkt: Fähre Pfaueninsel.<br />
2. Sonnabend, 29. Juli 1978, 11 Uhr: „Barock in Berlin - am Beispiel des Schlosses<br />
Charlottenburg". Leitung: Herr Günter Wollschlaeger. Treffpunkt: im Ehrenhof des<br />
Schlosses.<br />
Im Monat August finden keine Veranstaltungen statt.<br />
3. Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September 1978: Studienfahrt nach Goslar.<br />
Bitte beachten Sie das Programm auf den Seiten 462 und 463.<br />
4. Dienstag, 5. September 1978, 19.30 Uhr: „Berlin - Stadt der politischen und kulturellen<br />
Impulse''. Vortrag mit Lichtbildern von Herrn Heinz Eisberg. Filmsaal des Rathauses<br />
Charlottenburg.<br />
5. Donnerstag, 14. September 1978, 10 Uhr: Besichtigung der Staatlichen Porzellan-<br />
Manufaktur, Berlin 12, Wegelystraße 1. Treffpunkt: am Haupteingang.<br />
6. Sonnabend, 23. September 1978, 10 Uhr: Besichtigung der Deutschen Staatsbibliothek,<br />
Unter den Linden 8. Führung durch Herrn Dr. Winfried Löschburg.<br />
(Antrag auf Genehmigung eines Berechtigungsscheines für Berlin, Übergang Friedrichstraße<br />
für Fußgänger, in einem Büro für Besuchs- und Reiseangelegenheiten bis zum<br />
15. September 1978 stellen.)<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg sind Gäste willkommen. Die Bibliothek ist<br />
zuvor jevVeils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet. Nach den Vorträgen geselliges Beisammensein<br />
im Ratskeller.<br />
Freitag, 28. Juli und 30. September, zwangloses Treffen in der Vereinsbibliothek ab<br />
17 Uhr.<br />
Vorsitzender: Dr. Gerhard Kutzsch. Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1000 Berlin 31, Blissestraße 27,<br />
Ruf 8 53 49 16. Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1000 Berlin 65, Seestraße 13, Ruf 45 30 11.<br />
Schatzmeister: Ruth Koepke, 1000 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf 6 93 67 91. Postscheckkonto des<br />
Vereins: Berlin West 433 80-102, 1000 Berlin 21. Bankkonto: 038 180 1200 bei der Berliner Bank,<br />
1000 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1000 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Claus P. Mader, 1000 Berlin 41, Bismarckstraße 12; Felix Escher, Wolfgang<br />
Neugebauer.<br />
Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt. Bezugspreis für Nichtmitglieder 16 DM<br />
jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1000 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
464
KOI<br />
.,;y.<br />
A 20 377 F<br />
MITTEILUNGEN<br />
DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS<br />
GEGRÜNDET 1865<br />
74. Jahrgang Heft 4 Oktober 1978<br />
Ol Ote ei»iiet -fcf unf<br />
graSe» SnterrfTe en bicTest 5oXI babe. (£rf«acnbf» (&tl2*tet i«| .<br />
gru^ea Saal) $tr €saet«arsali, 6ur* biefe (trUänma elrtte |<br />
Presseberichte vom Giftmordprozeß 1923.<br />
Berliner Tageblatt, Nr. 121, 13. 3. 1923 (Morgenausgabe, 1. Beiblatt). Berliner Tageblatt, Nr. 123,<br />
14. 3. 1923 (Morgenausgabe, 1. Beiblatt). Vorwärts, Nr. 124, 15. 3. 1923 (Morgenausgabe, Beilage).<br />
Vossische Zeitung, Nr. 128,16. 3. 1923 (Abendausgabe).<br />
465
Alfred Döblins Versuch der literarischen Verarbeitung<br />
eines Giftmordprozesses in Berlin 1923<br />
Von Dr. Hans Jürgen Meinik<br />
Der Geburtstag des Schriftstellers Alfred Döblin jährte sich im August dieses Jahres zum<br />
einhundertsten Mal. Die Rezeption seines großen literarischen Werkes ist einem breiteren<br />
Publikum allerdings bis heute versagt geblieben. 1 Döblin hat für den Prosaschriftsteller<br />
eine Theorie des Epischen konstruiert, die man als eigenwillig ansehen muß. Einerseits tritt<br />
er für einen stark realitätsbezogenen Stil ein: „dichter heran müssen wir an das Leben", 2<br />
andererseits scheint er über diesen Appell noch hinausgehen zu wollen, indem er fordert,<br />
auch eine letzte, den Blick für die Wirklichkeit verstellende Trennwand noch zu durchbrechen.<br />
Döblin formuliert in diesem Zusammenhang geradezu eine Handlungsanweisung<br />
für den Schriftsteller: „er muß ganz nahe an die Realität heran, an ihre Sachlichkeit, ihr<br />
Blut, ihren Geruch, und dann hat er die Sache zu durchstoßen, das ist seine spezifische<br />
Arbeit".' Dieser Spürsinn für die Realität, für das Dokumentarische prägte sich bei Döblin<br />
zeitweise so stark heraus, daß er, die eigene schriftstellerische Originalität bewußt zurückstellend,<br />
oft die Aktenprosa historischer Vorgänge, auch Lexikon- und Zeitungsartikel,<br />
wörtlich in sein Werk übernahm. 4 Daß die Einarbeitung von Plakat- und Reklametexten<br />
sowie Artikeln aus der Tagespresse für Döblins Arbeitsweise nichts Ungewöhnliches ist, hat<br />
man bereits anhand des bekannten Romans „Berlin-Alexanderplatz" nachgewiesen. 5 Im<br />
Jahre 1924 erschien im Berliner Verlag „Die Schmiede" der erste Band einer von Rudolf<br />
Leonhard herausgegebenen Reihe von Prozeßberichten. Die Gesamtreihe war überschrieben:<br />
„Außenseiter der Gesellschaft. Die Verbrechen der Gegenwart", und Döblin<br />
lieferte im ersten Band einen Prozeßbericht über einen Berliner Giftmordfall in Form einer<br />
Erzählung unter dem Titel „Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord". Döblin hatte von<br />
Leonhard den Auftrag erhalten, die Schriftenreihe mit dem Bericht über diesen „Verbrecherfall"<br />
und dessen Hintergründe zu eröffnen. 6<br />
Nimmt schon Döblins Werk insgesamt eine Außenseiterstellung in Deutschland ein, so<br />
kann man ohne Übertreibung sagen, daß dieser Band, der hier einer näheren Betrachtung<br />
unterzogen werden soll, bisher auch in der Fachwissenschaft eine Außenseiterrolle gespielt<br />
hat. Eine selbständige Untersuchung zu dieser Erzählung fehlt bisher. In einer der letzten<br />
großen Arbeiten über Döblins Werk wird z.B. die Studie über den Giftmordprozeß nur<br />
ein einziges Mal ganz am Rande erwähnt. 7<br />
Das rein faktische Prozeßmaterial hat zwar schon einmal als Grundlage für ein Hörspiel<br />
gedient, aber ein Bezug zu Döblins Arbeit fehlte hier vollständig. 8 Die kürzlich im Zweiten<br />
Deutschen Fernsehen gesendete Verfilmung dieses „Kriminalfalles aus dem Berlin des<br />
Jahres 1923" 9 in der Regie von Axel Corti stützt sich immerhin auf Döblins Text, legt aber<br />
ein allzu großes Gewicht auf die Entstehung und den Verlauf des Giftmordes (der eigentliche<br />
Prozeß ist nicht mehr Gegenstand des Films), wobei die sozialen Verhältnisse der<br />
Beteiligten und die Zeitumstände besonders betont, mit Rücksicht auf das Fernsehpublikum<br />
aber in mancher Beziehung verharmlost werden.<br />
Die Fakten des rein äußeren Geschehens in diesem Giftmordfall sind rasch erzählt. Die<br />
Hauptangeklagte Ella Klein, zur Zeit des Prozesses erst 23 Jahre alt, gelernte Friseuse,<br />
Tochter des biederen Tischlers Thieme aus Braunschweig, kam 1919 nach Berlin. 10 Hier<br />
466
lernt das lebenslustige Mädchen auf einem Tanzabend den Möbelpolierer Willi Klein<br />
kennen, den sie ein Jahr später heiratet. Ein Prozeßbeobachter schrieb dazu: „Liebesheirat<br />
des menschenunerfahrenen Mädchens. Sie kommt dabei zwar aus der Provinz nach der<br />
Hauptstadt, aber sie bleibt in ihrer Sphäre: die Tischlerstochter hat sich einen Tischlergesellen<br />
erwählt. Warum sollte das Heim der Neuvermählten nicht ein Himmel werden?" 11<br />
Aber es tritt das Gegenteil ein, denn die Ehe gestaltete sich für die junge Frau zu „einer<br />
einzigen Tortur" 12 . Der Mann kam oft betrunken nach Hause und neigte dann zu sexuellen<br />
Exzessen, die zumindest nach den Moralvorstellungen der damaligen Zeit außergewöhnlich<br />
gewesen sein müssen. Rechtsanwalt Dr. Salinger, bei dem Ella Klein später ihre Ehescheidung<br />
einreichte, die sie jedoch unter den Drohungen ihres Mannes wieder zurückzog,<br />
sagte später vor Gericht aus, er habe eine große Erfahrung in Eheprozessen, doch was ihm<br />
hier vorgetragen worden sei, übersteige alles bisher Dagewesene. Deshalb habe er in die<br />
Klageschrift auch nur die körperlichen Bedrohungen und Mißhandlungen aufgenommen<br />
und die „obszönen Intimitäten weggelassen, . . . weil es ihm peinlich gewesen wäre, derartiges<br />
seiner Sekretärin zu diktieren" 13 .<br />
Während ihrer Ehe lernte Ella Klein die 26jährige Grete Nebbe kennen, die später vor<br />
Gericht behauptete, auch ihr Mann habe perverse Forderungen im ehelichen Leben an sie<br />
gestellt. Die Beziehungen der beiden Frauen gestalteten sich im Laufe der Zeit zu einem<br />
engen Liebesverhältnis. Sie wollten, „wie sie es in . . . Briefen ausdrücken, miteinander<br />
eine zweite Ehe schließen" 14 . Der Wunsch, sich von den Ehemännern zu befreien, wurde<br />
im Laufe der Zeit immer stärker. Ella Klein besorgte sich Arsenik und mischte ihrem<br />
Mann davon regelmäßig etwas in das Essen. Die Freundin beteuerte immer wieder, sie<br />
werde ihren Gatten ebenfalls vergiften, doch schreckte sie wohl aus Angst vor den Folgen<br />
davor zurück.<br />
Am 1. 4. 1922 verstarb Willi Klein im Städtischen Krankenhaus Lichtenberg am Tage<br />
seiner Einlieferung. Auf Betreiben der mißtrauischen Schwiegermutter wurde die Leiche<br />
beschlagnahmt und obduziert. Die beiden Freundinnen wurden verhaftet, nachdem in der<br />
Wohnung Ella Kleins eine umfangreiche Korrespondenz der Frauen sichergestellt werden<br />
konnte, aus deren Inhalt die Mordabsichten an den Männern klar hervorgingen. 15 Der<br />
Prozeß begann am 12. 3. 1923 vor dem Schwurgericht des Landgerichts III in Berlin<br />
„unter ungeheurem Andränge des Publikums, unter welchem das weibliche Element<br />
überwog" 16 .<br />
Die Presse griff begierig das schlagzeilenträchtige Geschehen im Gerichtssaal auf und<br />
erging sich genüßlich in ausführlichen Berichten über die „Giftmischerinnen" bzw. „Gattenmörderinnen".<br />
Alfred Döblin hat sich dagegen von Anfang an, bei dem Versuch, den Fall literarisch zu<br />
verarbeiten, um ein hohes Maß an Distanz und Objektivität bemüht. Er, der selbst eine<br />
„wahre Strindberg-Ehe" geführt hat 17 und der als Arzt und Schriftsteller für psychologische<br />
„Grenzfälle" sensibilisiert war, 18 ist durch diesen Prozeß und seine Hintergründe in hohem<br />
Maße gefesselt worden. Im Epilog zu „Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord" stellt<br />
er rückblickend noch einmal deutlich fest: „Ich war nicht auf billige Milieustudien aus" 19 .<br />
Diesen am Schluß der Erzählung fomulierten Grundsatz hat Döblin in der Tat konsequent<br />
beachtet, indem er einseitige und vorschnelle Wertungen unterläßt und auch eine „Schuldfrage"<br />
im herkömmlichen Sinne nicht untersucht. Die Frage, ob Döblin selbst als Zuschauer<br />
den Prozeßverlauf verfolgen konnte, läßt sich anhand des vorliegenden Quellenmaterials<br />
nicht beantworten. Als sich die Notwendigkeit ergab, die Öffentlichkeit zeitweise<br />
467
vom Verfahren auszuschließen, wurde dennoch den Pressevertretern „und einigen Herren,<br />
die aus wissenschaftlichem Interesse der Verhandlung beiwohnten, die Anwesenheit<br />
gestattet" 20 . Unter dieser Personengruppe befand sich auch der Vertreter der Berliner<br />
Ärztekammer Dr. Mamlock, 21 über dessen Vermittlung es Döblin vielleicht möglich<br />
gewesen wäre, den Prozeß im Gerichtssaal zu verfolgen.<br />
Döblin nennt als Quellen für seine Erzählung Berichte aus Tageszeitungen, die Gutachten<br />
der psychiatrischen Sachverständigen und Betrachtungen über den Giftmordprozeß in<br />
Fachzeitschriften. Bei der literarischen Verarbeitung dieser Quellen werden an mehreren<br />
Stellen ganze Passagen wörtlich in den Erzähltext eingearbeitet. Äußerlich deckt sich das<br />
mit dem Befund, den Stenzel für den Roman „Berlin Alexanderplatz" ermittelt hat, 22 und<br />
mit Döblins Theorie des Epischen. Während in dem Roman aber eine zufällige, wenn auch<br />
nicht willkürliche Auswahl getroffen wird, ist Döblin bei dieser Erzählung streng an das<br />
Faktische gebunden. Er kann daher sinnvollerweise nur Prozeßberichte, Zeitungsartikel<br />
und wissenschaftliche Betrachtungen, die speziell zu diesem Fall erschienen waren, in den<br />
Text seiner Erzählung über die beiden Freundinnen einarbeiten. Diese Passagen sind, da<br />
sie nicht unvermittelt eingeblendet, sondern angekündigt werden, 23 als Zitate anzusprechen.<br />
Ein solches Verfahren „evoziert den Eindruck ungefiltert-roher Tatsächlichkeit<br />
des eingefügten Materials" 24 .<br />
Döblin kürzt in der Erzählung die Namen der am Prozeß beteiligten Personen ab: „Sanitätsrat<br />
L." (Leppmann); „Drogist W." (Weber); „Dr. S." (Salinger), oder er verändert die<br />
Namen durch einfache Buchstabenumstellungen: aus Klein wird „Link", aus Nebbe wird<br />
„Bende", aus Geist wird „Fleist". Den bildhaften Namen der mitangeklagten Mutter von<br />
Grete Nebbe „Riemer" verwandelt Döblin unter Beibehaltung des bildhaften Namenscharakters<br />
einfach in „Schnürer".<br />
Bei der Einarbeitung von Zitaten aus Prozeßberichten verfährt Döblin keineswegs mechanisch.<br />
Dies soll an einem konkreten Beispiel gezeigt werden: Döblin verwendete in seiner<br />
Erzählung unter anderem „Zeitungsnotizen (von) Dr. M. in einer Berliner Zeitung" 25 .<br />
Tatsächlich handelt es sich dabei um einen mit „Dr. E. M" gezeichneten Artikel im Berliner<br />
Tageblatt. 26 Dieser Artikel unterscheidet sich insofern wohltuend von vielen anderen Prozeßberichten<br />
jener Tage, als in ihm um Verständnis für die Angeklagten und ihr Schicksal<br />
nachgesucht wird. Auffallend ist allein schon die darin vorgenommene äußere Beschreibung<br />
der Angeklagten Klein: „Man sieht dieses unscheinbare Geschöpf mit dem harmlos blonden<br />
Vogelköpfchen . . . und schüttelt den Kopf." 27 Dieses Zitat gibt Döblin am Schluß<br />
der Erzählung wieder, aber bereits auf der ersten Seite greift er dieses Bild der schutzbedürftigen,<br />
harmlos-lebhaften Elli Link auf, indem er schreibt: „Sie war harmlos frisch,<br />
von der Munterkeit eines Kanarienvogels, wie ein Kind lustig." 28<br />
Diese Art der Betrachtungsweise hält Döblin in der gesamten Erzählung durch. Mit zärtlicher<br />
Einfühlsamkeit nähert er sich den beteiligten Personen und bemüht sich um eine<br />
vorurteilslose Betrachtung der Hintergründe des Mordes. Die Schuld wird daher auch<br />
nicht einseitig in dem widernatürlichen Verhalten des rabiaten Ehemannes gesehen, denn<br />
schließlich war für die gepeinigte Frau Zeit genug vorhanden, um die Ehe friedlich auseinandergehen<br />
zu lassen. Aber Elli war zu leichtfertig in diesen Dingen: „Sie wischte darüber<br />
weg." Außerdem dachte sie in den kleinbürgerlichen Kategorien ihres Elternhauses:<br />
„Eine eigene Wirtschaft war nicht zu verachten . . . , sie würde Ehefrau sein, eine Familie<br />
haben wie die in Braunschweig." 29 Auch das normale eheliche Liebesleben befriedigte<br />
Elli nicht. Zwar bemühte sie sich ehrlich „umzufühlen, aber vermochte doch nicht. Ihr<br />
468
dämmerte ängstlich, daß sie sich da nicht zurecht fand." 30 Ja, bezogen auf diesen Befund,<br />
spitzt Döblin das Dilemma, in dem sich die Geschworenen später bei ihren Beratungen<br />
befanden, auf die Frage zu, ob man einen Eierstock schuldig sprechen könne, „weil er so<br />
und nicht so gewachsen war" 31 . Freilich deckte sich dies auch mit den kühl wissenschaftlich<br />
konstatierten Ergebnissen der Gutachter, die bei Elli Klein eine „körperliche und geistige<br />
Entwicklungshemmung" annahmen, „die sich selbst bis auf die inneren Geschlechtsorgane<br />
erstrecke" 32 .<br />
Ellis Ehemann, der dies gar nicht überblicken kann, wird durch die eheliche Situation zu<br />
einer extremen Haltung verleitet: „Ohne daß er wußte, warum und wie, unter deutlichem<br />
inneren Widerstreben, verfiel er darauf, geschlechtlich wild mit ihr zu sein. Heftiges, Wildes,<br />
Besonderes, von ihr zu verlangen." 33<br />
Das Zusammenleben der Kleins verschärft sich ins Unerträgliche, als Elli zufällig die drei<br />
Jahre ältere Grete Nebbe kennenlernt, die ebenfalls eine wenig glückliche Ehe führt. 34<br />
Nach längerem Zögern „erfolgte auf beiden Seiten die Entladung", indem sich die beiden<br />
Frauen „krampfartig, stoßartig" die in der Ehe erlittenen Torturen gestehen. 35 Das Leiden<br />
in den zerrütteten Ehen wird durch die engen Kontakte der beiden Frauen in scheinbar<br />
idealer Art aufgehoben und mündet in einen psychischen Befreiungsakt. Die muntere<br />
Elli Klein war für ihre ältere Freundin „Trost" und „Ersatz für den schlechten Mann . . .<br />
Die Link war ihr Kind". Die jüngere dagegen „fand sich aufatmend in ihrer alten Rolle<br />
wieder, war der muntere kleine Frechdachs der früheren Zeit" 36 .<br />
Im Laufe der folgenden Monate entwickelte sich zwischen den Frauen ein homosexuelles<br />
Verhältnis, das von Grete Nebbe ausging. 37 Es ist sicher keine erstaunliche Tatsache, daß<br />
gerade dieser Umstand den Prozeß für die Presse sensationsträchtig erscheinen ließ.<br />
Neben den in solchen Fällen üblichen, reißerisch aufgemachten Prozeßberichten über die<br />
„Giftmischerinnen" erschienen in einigen Blättern auch Betrachtungen abgewogenerer<br />
und grundsätzlicher Art. Besondere Beachtung verdient dabei ein Artikel des Schriftstellers<br />
Joseph Roth, den übrigens Rudolf Leonhard ebenfalls dazu ausersehen hatte, einen<br />
Beitrag in der Reihe „Außenseiter der Gesellschaft. Die Verbrechen der Gegenwart" zu<br />
schreiben. 38 Die in germanistischer Forschung bisher vertretene Auffassung, Roth habe<br />
im September 1922 seinen letzten Beitrag für den Berliner Börsen-Courier verfaßt, 39 ist<br />
trotz eines vorliegenden Abschiedsbriefes an den Redakteur Herbert Ihering vom 17. 9.<br />
1922 40 falsch, denn Roth schrieb seinen Beitrag über die beiden Hauptangeklagten im<br />
Giftmordprozeß noch im März 1923 für dieses Blatt. 41<br />
Mahnend wies Roth auf die Vielschichtigkeit der im Verlauf der ersten Prozeßtage ans<br />
Licht getretenen Probleme hin: „Wären Zuhörer und Miterleber dieses Prozesses reif<br />
genug, um das Spannende und Lüsterne der Vorgänge auszuschalten und aus den Begebnissen<br />
zu lernen, so müßten sie zu der Erkenntnis gelangen, daß in uns die Engel und Teufel<br />
mit gleichen Kräften ausgerüstet sind und gleiche Gewinnchancen haben; daß die unnatürliche<br />
Veranlagung, die von Anbeginn vorhanden war — vielleicht in jedem vorhanden ist -<br />
gezüchtet wurde durch die Befolgung der gesellschaftlichen Regel" 42 .<br />
Roth, der Döblins schriftstellerischem Schaffen sehr kritisch gegenüberstand, 43 kommt aber<br />
der Einschätzung der Prozeßhintergründe, wie sie in der Erzählung über die beiden Freundinnen<br />
niedergelegt sind, sehr nahe.<br />
Auch Döblin fragt im Epilog nach den „eigentlichen Motoren" für die Handlungsweise der<br />
Angeklagten, hält sich aber mit einem fertigen Urteil vorsichtig zurück: „Psychischer<br />
Zusammenhang oder gar Kausalität, wie soll man sich das denken.' Mit dem Kausalitäts-<br />
469
prinzip frisiert man. Zuerst weiß man, dann wendet man die Psychologie an. Die Unordnung<br />
ist da ein besseres Wissen als die Ordnung." 44<br />
Diese Erkenntnis war es, die Döblin von vorschnellen und oberflächlichen Erklärungsversuchen<br />
abhielt und die man als Bestandteil seiner poetologischen Konzeption begreifen<br />
muß. In seinem „Berliner Programm" aus dem Jahre 1913 hatte er seinen Schriftstellerkollegen<br />
bereits zugerufen: „Man lerne von der Psychiatrie, der einzigen Wissenschaft,<br />
die sich mit dem seelischen ganzen Menschen befaßt: sie hat das Naive der Psychologie<br />
längst erkannt, beschränkt sich auf die Notierung der Abläufe, Bewegungen, - mit<br />
einem Kopfschütteln, Achselzucken für das Weitere und das ,Warum' und ,Wie' ". 45<br />
Getragen von einer solchen Einsicht, näherte sich Döblin den angeklagten Frauen in diesem<br />
„von psychologischen Rätseln und sozialen Problemen strotzenden Prozeß" 46 . Während<br />
das fast einhellige Urteil der Berichterstatter in der Tagespresse lautete, die beiden<br />
Frauen hätten aufgrund ihrer homosexuellen Veranlagung den Entschluß gefaßt, ihre<br />
lästig gewordenen Ehemänner zu beseitigen, um völlig ungehindert miteinander leben zu<br />
können, blickt Döblin weiter, indem er die in dieser Konstellation angelegten Konflikte<br />
zwischen den Personen in seine Betrachtung mit einbezieht. Den aussichtslosen Kampf<br />
gegen ihren Mann führt Grete Bende jetzt, nachdem sie sich mit Elli ganz verbunden<br />
glaubt, erfolgreicher „über die Wände ihrer Wohnung hinaus" gegen den Tischler Link, in<br />
der Absicht, sich der Zuneigung und Abhängigkeit der blonden Freundin dauerhaft zu<br />
versichern. Auch Ellis Position bei den täglichen Streitereien mit Link wurde gefestigt,<br />
denn sie besaß jetzt „einen zweiten Willen, die Bende" 47 .<br />
Diese Ausgewogenheit besteht indessen nur scheinbar, weil Elli bald in einen „inneren<br />
Zwiespalt" gerät, der sie zu dem Schluß kommen läßt: „Auch die Bende war nicht gut."<br />
Döblin geht sogar soweit, eine völlig neue Ehekonstellation als überraschende Konfliktlösung<br />
anzudeuten: „Ja, Link und die Bende, fühlte Elli dunkel, gehörten zusammen." 48<br />
Diese Andeutung findet insofern einen realen Bezugspunkt zu den tatsächlichen Begebenheiten,<br />
als die Freundinnen später übereinstimmend aussagten, „daß die Männer versucht<br />
hätten, je die Frau des anderen zu verführen" 49 .<br />
Döblins Gespür für die verwickelte und ausweglos erscheinende Situation wird besonders<br />
deutlich, wenn man seine Beschreibung des Gemütszustandes der beiden Freundinnen zur<br />
Zeit der Tatausführung betrachtet. Vor den Augen des Lesers wird nicht das Bild der<br />
heimtückischen Mörderinnen, die Tag für Tag ohne Skrupel Arsenik in die Mahlzeiten<br />
ihrer Männer schütten, entfaltet, sondern „die Frauen saßen" oftmals „zusammen, weinten;<br />
sie hatten sich zu schweres übernommen;" 50 schon bald konnten sie „das Leiden, die Angst,<br />
das Hangen und Bangen nicht mehr ertragen" 51 .<br />
Der 1924 erschienenen Auflage seiner Erzählung über die beiden Freundinnen hatte<br />
Döblin einen umfangreichen Anhang mit 17 graphischen Zeichnungen und Tabellen über<br />
die „räumliche Darstellung der Seelenveränderung" der Hauptbeteiligten beigegeben. In<br />
den zeitgenössischen Rezensionen des Buches, die auffälligerweise auch in medizinischpsychiatrischen<br />
Fachzeitschriften erschienen, wurde „diese Art, Seelenvorgänge schematisch<br />
einzufangen", 52 kritisiert und als „wissenschaftlich haltlos" bezeichnet. 53 .<br />
Diese Kritik zielt insofern ins Leere, als der spezifisch literarische Aspekt der Erzählung<br />
über die beiden Freundinnen außer Acht gelassen wird, denn Döblins Überlegungen zu<br />
der „Seelenwanderung", wie sie in den Bildtafeln niedergelegt wurde, sind in den Duktus<br />
der Erzählung aufgenommen worden und verdienen größere Beachtung.<br />
Das Gift, das Elli ihrem Mann fast täglich mit den Mahlzeiten verabreicht, hat nicht den<br />
470
gewünschten schnellen Erfolg. In ihrer Verzweiflung laufen die Frauen gemeinsam zu einer<br />
Wahrsagerin, „die die üblichen dunklen Andeutungen" macht. 54 Diese Dame mit dem<br />
bildhaften Namen Geist wurde auch als Zeugin im Giftmordprozeß gehört und „erschien<br />
vor Gericht wie eine ans Licht gezogene Nachteule" 55 . In den folgenden Wochen nach<br />
dem Besuch bei der Kartenlegerin veränderte Elli sich auffällig: „Es trat eine Verschiebung<br />
ihrer ganzen seelischen Perspektiven ein; ihr inneres Timbre veränderte sich." 56<br />
Das, was Döblin im Text über die veränderte Seelenlage Elfis aussagt, ist dann später in<br />
die Graphik der Bildtafeln übertragen worden. „Das feine Spiel der statischen Kräfte war<br />
gestört; der Mechanismus mühte sich wieder, sich einzustellen, verlangte Rückkehr zum<br />
alten sicheren Zustand." Elli „mußte die übergewichtige neue Last von sich abstoßen, einer<br />
gleichmäßigen Verteilung der inneren Kräfte zustreben" 57 . Ein Problem besonderer<br />
Art bildeten die bei der Angeklagten Klein gefundenen Briefe. In den Schlagzeilen der<br />
Presse wurde die Zahl der Briefe mit 600 angegeben. Eine andere Quelle nennt nur die<br />
Zahl 300. 58 Beide Zahlenangaben sind jedoch nicht korrekt. Elli Klein hielt tatsächlich<br />
in der Matratze ihres Bettes weit über 500 Briefe verborgen, doch befanden sich auch<br />
Schreiben darunter, die mit dem Mordfall in keine Verbindung gebracht werden können.<br />
Die beiden Freundinnen hatten sich im Laufe weniger Wochen „je mehr als 200 Briefe"<br />
geschrieben. 59 Auf normalem postalischem Weg sind diese Schreiben freilich nicht befördert<br />
worden. Die Freundinnen, die sich fast täglich sahen, steckten sich häufig mehrere kurze<br />
Mitteilungen und Briefe an einem einzigen Tag zu. Diese Korrespondenz stellt zweifellos<br />
„eine psychologische Sonderbarkeit für sich" dar. 60<br />
Da in den Briefen immer wieder ganz offen die Mordabsicht an den Ehemännern ausgesprochen<br />
wird, stellt sich natürlich die Frage, warum ein derartiges Belastungsmaterial<br />
aufbewahrt wurde. Elli gab darauf vor Gericht zur Antwort, sie habe die Briefe „aus Hinneigung"<br />
gesammelt. „Sie waren mir ein Ersatz für ein Tagebuch." 61<br />
Der Prozeßberichterstatter der Deutschen Allgemeinen Zeitung machte es sich allerdings<br />
zu leicht, als er über die Korrespondenz der beiden Freundinnen pauschal urteilte: „Aus<br />
allen Briefen, die hier verlesen werden, spricht eine grenzenlose Gemeinheit, eine Roheit<br />
des Herzens und der Gesinnung, wie man sie überhaupt nicht für möglich halten sollte.<br />
Dazu sind die Schreibereien meist in einem so ordinären und mangelhaften Deutsch geschrieben,<br />
daß man sich schaudernd von solcher entsetzlichen Lektüre abwendet." 62 Will<br />
man den Versuch unternehmen, den Inhalt der Briefe möglichst unvoreingenommen zu<br />
würdigen, ist es unerläßlich, auf die Situation einzugehen, in der sich die beiden Freundinnen<br />
befanden. Elli Klein hat dann, als sie etwas Abstand von ihren Leiden gewonnen hatte,<br />
auch rückblickend erläutert: „Mein Mann hatte mich damals ganz dumm geschlagen, so<br />
daß ich nicht wußte, was ich tat. Wenn ich heute die Briefe, wie sie in der Anklageschrift<br />
stehen, lese, dann ist mir unverständlich, wie ich so etwas schreiben konnte." 63<br />
Aber auch die wesentlich optimistischere Auffassung, die ebenfalls in der Deutschen Allgemeinen<br />
Zeitung geäußert wurde, daß nämlich mit Hilfe des Briefwechsels der beiden<br />
Freundinnen „deren ganze Psyche bis in die kleinsten Details aufgedeckt werden" könne, 64<br />
trifft keineswegs den Kern der Sache. Die grundsätzliche Bedeutung der Briefe im Rahmen<br />
der Beurteilung des Giftmordes ist unbestritten. Döblin hat in der Erzählung mehrfach<br />
Zitate aus diesen Schreiben verwendet und dem Anhang der ersten Auflage zwei Handschriftenproben<br />
der Angeklagten mit kurzen Erläuterungen beigefügt. Einer der Prozeßgutachter<br />
druckte im Rahmen einer ausführlichen Würdigung des Falles vier Briefe in<br />
vollständigem Wortlaut ab. 65<br />
471
Die Frauen schrieben die Briefe „teils mit Blei" und „fast unleserlich". Einige Briefe enthielten<br />
„Gedichte, unreife, holprige Verse, lächerlich in ihrer unbeholfenen Ausdrucksweise,<br />
tragisch in ihrer glühenden Leidenschaft" 66 . Der Bearbeiter der Staatsanwaltschaft<br />
hat im Verlauf der Prozeßvorbereitungen die Briefe „mit unendlicher Sorgfalt durchgesehen<br />
und geordnet" 67 .<br />
Einer der zum Prozeß geladenen psychiatrischen Gutachter erklärte, daß „ein Rauschzustand<br />
pathologischer Natur durch die Briefe" gehe, die in einer Art von „Schreibsucht"<br />
und „Sammelwut" verfaßt und aufbewahrt worden seien. 68 Döblin mißt innerhalb seiner<br />
Erzählung diesen Briefen keine überragende Bedeutung zu. Ihn störten überhaupt „die<br />
fürchterlich unklaren Worte" der Prozeßgutachter. Sein Urteil darüber läßt sich an Schärfe<br />
kaum überbieten: „Auf Schritt und Tritt Verwaschenes, oft handgreiflich Kindisches." 69<br />
In dem Briefeschreiben der Freundinnen erkennt Döblin eine Vorstufe zu neuen „Heimlichkeiten",<br />
das heißt, zu sexuellen Handlungen. Als sie den Reiz des Schreibens erkannten,<br />
steigerte sich „das Spiel, das sich Freundschaft, Verfolgung, Liebe nannte" 70 .<br />
Im Laufe der Beschäftigung mit dem Giftmordfall begann Döblin eine Frage zu interessieren,<br />
die er zwar innerhalb seiner Erzählung vorläufig selbst beantwortet hat, die ihn aber<br />
Zu Ellis Handschrift.<br />
(Dezember 1922, Untersuchungshaft.) Augenblickseinflüsse: sie ist abgelenkt (verschreibt sich Zeile 4<br />
„daß" statt „doch", schreibt Buchstaben nicht fertig), wölbt mutlos die Grundstriche nach rechts. -<br />
Die Schrift im allgemeinen ungeistig, linear mager und arm, nüchtern, sachlich. Die Zeilenrichtung<br />
wird, trotz Okkupation, innegehalten, auch der Linksrand; die Buchstaben werden aneinandergedrängt,<br />
die Schrift ist klein: ein haushälterischer, ordentlicher, kleinbürgerlicher Mensch. - Er ist<br />
unscheinbar, ohne rechtes Selbstgefühl, vielleicht mit Eigensinn, Trotz (siehe auch „Termin", Zeile 3,<br />
mit seinem Oberbogen).<br />
Ein verschlossenes Wesen (siehe die Arkadenbildung bei der Bindung der Buchstaben „n" und „m"<br />
in „ich", „auch" Zeile 1, das Zuriegeln der Vokale a und o, der abwärts gedrehte U-Bogen). Die<br />
Schriftlage von mäßiger Linksschräge bis zum Steilen zeigt das schwache Gefühl an, Vorwiegen des<br />
Verstandes, die innere Kühle. Dabei Triebhaftigkeit, Hingabe an den Eindruck, Neigung zum Genuß<br />
ohne seelische Zentrierung (die geringe Schärfe der Schrift, ihre Teigigkeit). - Im wesentlichen Kühle,<br />
Nüchternheit, Verschlossenheit, dahinter ungeregelte Triebhaftigkeit, Entflammbarkeit, alles gedeckt<br />
durch kleinbürgerliche Haltung.<br />
472
Zu Margaretes Handschrift.<br />
(Datum unbekannt, Untersuchungshaft.) Kein so starker Hafteinfluß. Die Schrift im ganzen enorm<br />
unterschieden von Ellis: groß, weit, schräg nach links gelegt, unregelmäßig über den Linksrand verfügend,<br />
meist ihn besetzend. Ein Temperament, leidenschaftliches, exaltiertes Wesen. — Starkes<br />
Selbstgefühl, Neigung sich in Szene zu setzen. Schlecht disponierend, unfähig zu überblicken und zu<br />
ordnen, unter der Vorherrschaft des Gefühls. Dabei nicht eigentlich Mitgefühl, Weiche (siehe die doppelten<br />
Winkel in den „n" und „m"), eher Egoismus (Neigung zu rechtsläufigen Abbiegungen). Die<br />
Offenheit größer als Ellis, aber auch nicht erheblich. Wenig Energie und Zielsicherheit; leichtes<br />
Erlahmen und Wiederaufrichten (gewölbte Zeilenführung in Zeile 3). Größere innere Einheitlichkeit<br />
als Elli; die Worte fließend, gebunden; gegen Ellis Sprunghaftigkeit hier Zusammenhang, Kontinuität,<br />
ja Haftenbleiben. - Die große heftige Schrift mit ihrer selbstsicheren Art, daneben das leichte Erlahmen,<br />
die mangelhafte Fähigkeit zu berechnen, deutet auf Überkompensation. Dekorieren: sie gibt<br />
sich überkräftig, sicher, ist schwächlich. -<br />
Ellis Handschrift beunruhigender, gefährlicher trotz ihrer sauberen bürgerlichen Haltung. Margarete<br />
gesellig und schwach trotz des brüsken impulsiven Auftretens. —<br />
auch nach Erscheinen des Buches weiterbeschäftigte. Diese Frage lautete: Welche der<br />
beiden Frauen spielte die aktivere Rolle in den beiderseitigen Beziehungen? 71 In der<br />
Beurteilung dieser Frage waren sich die Prozeßgutachter ausnahmsweise einig. „Die<br />
stärkere, die aktivere Natur", sei eindeutig Frau Nebbe gewesen. 72<br />
Ungeachtet dieses Votums gelangt Döblin zu der Ansicht, Elli Link sei „die kleine entschlossene<br />
Aktive" gewesen, 73 und er gebraucht in diesem Zusammenhang sogar die<br />
Begriffe „Männlichkeit" und „Heroismus"! 74<br />
Es handelt sich aber dabei - wie oben erwähnt - keineswegs um eine abschließende Beurteilung,<br />
denn auch für Döblin ist der gesamte „Fall ... in einer bestimmten Hinsicht<br />
dunkel" geblieben. 75 Er vergleicht den Fall im Epilog der Erzählung mit einem unentwirrbaren<br />
Flickwerk: „Das Ganze ist ein Teppich, der aus vielen einzelnen Fetzen besteht,<br />
aus Tuch, Seide, auch Metallstücke, Lehmmassen dabei. Gestopft ist er mit Stroh, Draht.<br />
473
«w**t«M;<br />
l{ S<br />
Hasa,<br />
Hl<br />
rWi«*ter<br />
, HÄLFTE 1921: ENTWICKLUNG i>EK BEZIEHUNG<br />
ZWISCHEN BEIDEN FRAUEN.<br />
[ Unverändert.<br />
3. Weiteres Anwachsen der spielerisch kindlichen Art, als<br />
Lockung.<br />
4. Aktivität, die männliche Art betonend, gegen die Bende<br />
verstärkt.<br />
."i. Unverändert.<br />
!. HA1.ETE 1921: WEITERE ENTWICKLUNG DIESER «E-<br />
ZIEHlNüEN.<br />
;j Unverändert<br />
. Mächtiges Anschwellen der spielerisch lockenden Impulse<br />
Anschwellen der männlichen Aktivität.<br />
. Unverändert.<br />
PHASE 9<br />
PHASE 10<br />
!. Trübe üefülilsmasse, unter Ellis Lockung in Bew<br />
auf die Peripherie.<br />
2- Unverändert.<br />
3, Nachlaß der sexuellen Bindung an den Ehemann.<br />
4. Unverändert.<br />
MARGARETE BENDF<br />
1. Weitere zentrifugale Bewegung der umgeformten lief üb. Ismasse<br />
auf Ellis Lockung hin.<br />
3. ; Unverändert.<br />
I Lnv<br />
3a. Abspaltung eines gleichgeschlechtlichen Liebesgefuhls aus<br />
der Sexualität und der Gefühlsmasse.<br />
„Räumliche Darstellung der Seelenveränderung" bei den Hauptbeteiligten des Giftmordfalles. Die<br />
Schaubilder sind dem Anhang der Erstauflage entnommen, die in Berlin 1924 im Verlag „Die<br />
Schmiede" erschien.<br />
474
Zwirn. An manchen Stellen liegen die Teile lose nebeneinander. Manche Bruchstücke sind<br />
mit Leim oder Glas verbunden. Dennoch ist alles lückenlos und trägt den Stempel der<br />
Wahrheit." 76 Wie will Döblin diese breit ausgeführte Methapher verstanden wissen? Er<br />
hat zum Schluß die Prozeßberichte, Zeitungsnotizen und Gutachten beiseite gelegt und<br />
die Straßen aufgesucht, in der „die drei, vier Menschen dieser Affäre" jahrelang zu Hause<br />
gewesen waren. Dabei gelangte er zu der Überzeugung, man könne den Lebensabschnitt<br />
eines einzelnen Menschen gar nicht isoliert für sich betrachten, da jeder einzelne mit seiner<br />
Umwelt in einer „Symbiose" stehe. Eingebettet in ein buntfarbiges Mosaik heterogener<br />
Seinselemente, ist der einzelne Mensch von seinem gesellschaftlichen Umfeld bestimmt.<br />
Döblin glaubt hier die eigentlichen „Motore" menschlichen Verhaltens entdeckt zu haben:<br />
„Dies ist schon eine Realität: die Symbiose mit den anderen und auch mit den Wohnungen,<br />
Häusern, Straßen, Plätzen. Dies ist mir eine sichere, wenn auch dunkle Wahrheit." 77<br />
Das Gericht hörte neben einer Reihe von Zeugen auch den Vater der Angeklagten Klein.<br />
„Bei seinem Erscheinen duckt sich die Klein nieder und weint still vor sich hin." 78 Zweimal<br />
hatte die Tochter dieses biederen Tischlers den Versuch unternommen, sich den Drangsalen<br />
ihrer Ehe durch die Flucht zu entziehen. Die Rückkehr zu ihrem Ehemann war jedesmal<br />
auch auf Drängen des Vaters erfolgt. Mit dem Hinweis darauf, daß die Frau zum<br />
Mann gehöre, 79 wurde jede tiefergreifende Erörterung über die ehelichen Verhältnisse<br />
der Tochter verhindert. Es war, wie der Vertreter der Berliner Ärztekammer, Dr. Mamlock,<br />
schrieb, einfach „niemand da, der mit Verständnis rechtzeitig alle Beteiligten dem Verhängnis<br />
hätte entreißen können" 80 . Auch in der Gerichtsverhandlung ging man mit den<br />
Frauen nicht sonderlich zartfühlend um. Der Staatsanwalt bezeichnete die beiden Freundinnen<br />
als „minderwertige Frauenspersonen" 81 und stellte dem Vater der Angeklagten<br />
Klein mit entwaffnender Naivität die Frage: „War Ihre Tochter gut und häuslich? Oder<br />
las sie Romane?" 82<br />
Fragen dieser Art waren wohl wenig dazu geeignet, Licht in das Tatgeschehen zu bringen.<br />
Mehr Weitblick besaß dagegen der für das Parteiorgan der Sozialdemokratie arbeitende<br />
Prozeßberichterstatter, der nach nur drei Tagen Verhandlungsdauer schrieb: „Künstlich<br />
gezüchtete Beschränktheit und geistige Interesselosigkeit der Frau, durch Tradition und<br />
Gesetz geheiligte eheliche Knechtschaft, Unverstand der Eltern gegenüber ihren Kindern,<br />
Brutalität des ,Herrn der Schöpfung', des Mannes im ehelichen Leben, bildet den sozialen<br />
Hintergrund des Dramas." 83<br />
Moritz Goldstein sprach in der Vossischen Zeitung sogar generell von einer „gesellschaftlichen<br />
Erkrankung unserer Zeit", die sich in einer hemmungslosen Leidenschaft dokumentiere.<br />
„Sie grassiert als eine Volksepidemie, aus den Abgründen der Gesellschaft durch alle<br />
Schichten hinaufreichend bis in das scheinbar solideste Bürgertum." 84 Es ist natürlich fraglich,<br />
ob anhand eines außergewöhnlichen Giftmordfalles derart weitreichende Schlußfolgerungen<br />
hinsichtlich gesamtgesellschaftlicher Zustände gezogen werden können. Daß man<br />
aber hier und da in der Berichterstattung über die lapidaren Schlagzeilenmeldungen hinaus<br />
dachte und schrieb, verdient sicherlich als ein positives Zeichen festgehalten zu werden.<br />
Der Spruch der Geschworenen lieferte in diesem an Überraschungen nicht gerade armen<br />
Prozeß zum Schluß noch eine Sensation. Die Schuldfrage auf Mord und versuchten Mord<br />
wurde verneint. Frau Klein wurde zu vier Jahren und vier Monaten Gefängnis, Frau Nebbe<br />
zu eineinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Mutter der Angeklagten Nebbe wurde freigesprochen.<br />
Elli Klein hatte das Gericht mildernde Umstände zugebilligt, nicht aber ihrer<br />
Freundin. Daraus resultierte dann zwangsläufig die Zuchthausstrafe. 85 Dieses Urteil wurde<br />
475
„vom Publikum mit zum Teil unverhüllter Entrüstung aufgenommen," zumal die Geschworenen<br />
erklärten, sie wollten sich durch ein Gesuch für die Umwandlung der Zuchthausstrafe<br />
in Gefängnishaft einsetzen. 86 In der Öffentlichkeit reagierte man auf dieses<br />
Urteil rein emotional, weil Informationen über den Prozeß in der Regel nur über wenig<br />
faktenreiche Sensationsartikel zu erhalten waren. Die Presse hatte aus dem Briefwechsel<br />
der Freundinnen lediglich „Kraftstellen" wiedergegeben, die eine „beispiellose Kaltherzigkeit<br />
und Roheit" 87 zu offenbaren schienen. Ferner erblickte man in der Vergiftung<br />
des Ehemannes eine besonders heimtückische Art des Mordens. Dieser Auffassung ist<br />
Joseph Roth bereits nach wenigen Prozeßtagen energisch entgegengetreten, indem er einen<br />
Vergleich zwischen kriegerischen Kampfmitteln und Mordwerkzeugen von Einzeltätern<br />
herstellte. Im Grunde, so betont Roth, sei die Beschaffenheit des Mordwerkzeuges im<br />
Frieden wie im Krieg unerheblich, weil es „keine humane Art des Mordes" gebe. Er kommt<br />
deshalb zu dem Ergebnis, daß die beiden Freundinnen nicht aus Rache oder Lust am Morden<br />
zum Gift griffen, sondern „weil es am wenigsten verräterisch ist" 88 .<br />
Kritik am Spruch der Geschworenen wurde allerdings auch von juristischer Seite angemeldet.<br />
Der bekannte Justizrat Eduard Heilfron nahm dieses „Fehlurteil" zum Anlaß, die<br />
Einrichtung des Geschworenengerichts insgesamt in Frage zu stellen. 89<br />
In einem ganz anderen Licht und aus anderer Perspektive betrachtete Döblin die Urteilsverkündung.<br />
Die Strafe der Frauen bestand im Warten. „Langeweile, kein Geschehen,<br />
keine Erfüllung. Es war ein wirkliches Strafen." Die beabsichtigte Befreiung von ihren<br />
ungeliebten Ehemännern war den Freundinnen gelungen. Aber sie hatten immer gehofft,<br />
im Anschluß daran am Beginn eines neuen glücklicheren Lebensabschnittes zu stehen. Jetzt<br />
warteten sie in ihren Zellen, „zugleich wurden sie bitterer, matter, schwächer". In ihrem<br />
stumpfen Brüten beginnen die Frauen zu erkennen: „Link war nicht tot; hier war sein<br />
Testamentsvollstrecker; man gab es ihnen zurück mit Einsamkeit und dem Warten, Elli<br />
mit den Träumen." 90<br />
In der Einsamkeit der Haftanstalt, in der äußere Aktivitäten auf ein genau reglementiertes<br />
Maß eingeschränkt sind, beginnt eine ungeahnte Dynamisierung der Phantasie Ellis. Ihre<br />
Träume hat Döblin breit ausgemalt 91 . Sie kreisen fast alle um das gleiche Motiv: Den<br />
Kampf zwischen Elli und dem verstorbenen Mann. Dabei spielen nicht der Giftmord, sondern<br />
die in der Ehe erlittenen Gewalttaten eine dominierende Rolle. Elli „strafte sich<br />
überhaupt mit diesen Phantasien. Sie fürchtete sich vor ihnen und verhängte sie über<br />
sich" 92 .<br />
Döblins Erzählung über die beiden Freundinnen hat also nicht nur eine rückwärtsgewandte,<br />
auf die Erhellung des Prozeßhintergrundes gerichtete Komponente, sondern weist über<br />
Prozeß und Urteil hinaus, um mit dem Blick auf die Haftdauer der Täterinnen den Versuch<br />
zu unternehmen, dem Leser Bedeutung und Auswirkung der Strafe plastisch vor Augen<br />
zu führen. Döblin schließt sich dem allgemeinen Murren über die angeblich „milde" Strafe<br />
nicht an, weil er den über die Freundinnen verhängten Zwang des Wartens in seiner vollen<br />
Dimension einzuschätzen vermochte.<br />
Ebenso wie sich Joseph Roth in seinem Werk für die „Abseits-Menschen" 93 einsetzte, hat<br />
auch Döblin immer die Partei der sozial Schwachen ergriffen. Die „Präzision seiner großen,<br />
sicheren Sprachkraft" 94 läßt die Entwicklung der Menschen in dieser Erzählung plastisch<br />
werden. Dabei ist gerade sein „rein gedanklicher, abrupter Stil" dazu geeignet, die „nackt<br />
und kalt zur Tat treibenden Umstände" zu verdeutlichen. 95 „Scharf und zart zugleich" 96<br />
ist die Feder, die Döblins Hand beim Abfassen dieses Textes geführt hat.<br />
476
1 Matthias Prangel, Alfred Döblin (Sammlung Metzler, Bd. 105), Stuttgart 1973, S. 104f. Robert<br />
Minder, Alfred Döblin zwischen Osten und Westen, in: ders., Dichter in der Gesellschaft. Erfahrungen<br />
mit deutscher und französischer Literatur. Frankfurt am Main 1972, S. 209 f.<br />
2 Döblin, Alfred, Futuristische Worttechnik. Offener Brief an F. T. Marinetti, in: ders., Aufsätze<br />
zur Literatur, Ölten und Freiburg i. Breisgau 1963, S. 11.<br />
3 Döblin, Alfred, Der Bau des Epischen Werkes. Das epische Werk berichtet von einer Uberrealität,<br />
in: ebenda, S. 107.'<br />
4 Ebenda, S. 114.<br />
5 Stenzel, Jürgen, Mit Kleister und Schere. Zur Handschrift von „Berlin Alexanderplatz", in: Text +<br />
Kritik. Zeitschrift für Literatur, Hrsg. Heinz Ludwig Arnold, Bd. 13/14, München 1972, S. 39-44.<br />
6 A. Döblin an L. Klages, Berlin, 23. 12. 1924, in: Alfred Döblin, Briefe, Hrsg. Heinz Graber, Ölten<br />
und Freiburg i. Breisgau 1970, S. 126.<br />
7 Müller-Salget, Klaus, Alfred Döblin. Werk und Entwicklung (Bonner Arbeiten zur Deutschen<br />
Literatur, Bd. 22), Bonn 1972, S. 11.<br />
8 Hörspiel des RIAS-Berlin (Regie Werner Völkel; Manuskript Horst Cierpka), ausgestrahlt im<br />
Rahmen der Reihe „Berühmte Prozesse" unter dem Titel: „Giftmord in Lichtenberg. Der Fall<br />
Ella K. und Grete N.", gesendet über RIAS I und II am 24. 2. und 1. 3. 1971. Im folgenden wird<br />
das Manuskript zitiert als RIAS-Hörspiel.<br />
9 Fernsehwoche, Nr. 14,1978, S. 31.<br />
10 Vossische Zeitung. Nr. 120, 12. 3. 1923. Abendausgabe und Vorwärts, Nr. 125. 15. 3. 1923.<br />
Abendausgabe.<br />
11 Vossische Zeitung, Nr. 129, 17.3.1923. Morgenausgabe. Erste Beilage.<br />
12 RIAS-Hörspiel, a. a. O., S. 8.<br />
13 Berliner Tageblatt, Nr. 122,13.3.1923. Abendausgabe.<br />
14 Leppmann, Friedrich, Der Giftmordprozeß K. und Gen., in: Aerztliche Sachverständigen-Zeitung,<br />
Jg. 29, 1923, S. 127.<br />
15 Ebenda, S. 121 f.<br />
16 Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 118/119,13. 3.1923.<br />
17 Minder, Robert. Begegnungen mit Alfred Döblin in Frankreich, in: Text + Kritik Bd. 13/14,<br />
a. a. O., S. 57. Diesen Tatbestand hat Minder auch kürzlich in seinem Vortrag in der Akademie der<br />
Künste am 7. 5. 1978 über „Gespräche mit Alfred Döblin" eindrucksvoll dargelegt.<br />
18 Vgl. z.B. die Erzählung „Die Ermordung einer Butterblume" in Bd. 6 der Auswahlausgabe des<br />
Walter-Verlages, Ölten und Freiburg i. Breisgau.<br />
19 Die Zitate beziehen sich auf die 1971 in der Bibliothek Suhrkamp, Bd. 289 erschienene Neuauflage.<br />
Allerdings fehlt in dieser Ausgabe der Anhang mit den Handschriftenproben und den graphischen<br />
Tabellen der „Seelenveränderungen", die 1924 der ersten Auflage beigegeben waren;<br />
Zitat: S. 94.<br />
20 Berliner Börsen-Courier, Nr. 120,12. 3. 1923. Abendausgabe.<br />
21 Der Tag, Nr. 61, 13. 3. 1923. Beiblatt. Die Prozeßakten existieren mit großer Wahrscheinlichkeit<br />
nicht mehr; Schreiben des Generarstaatsanwalts beim Landgericht an den Verfasser vom 26. 6.<br />
1978.<br />
22 Stenzel, Mit Kleister und Schere, a. a. O.<br />
23 Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 89, 90 und 92: „Das Organ einer konfessionellen<br />
Partei äußerte: . . ."; „Der Sachverständige Dr. H. . . . veröffentlichte in einer Zeitschrift . . .";<br />
„In einer kleinen Studie . . . diskutierte K. B.... die Frage . . .".<br />
24 Stenzel, Mit Kleister und Schere, a. a. O., S. 40.<br />
25<br />
Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 88.<br />
26<br />
Berliner Tageblatt, Nr. 125,15. 3. 1923. Morgenausgabe. 1. Beiblatt.<br />
27<br />
Ebenda. Bei Döblin wird dieses Zitat irrtümlich auf beide Frauen bezogen, Die beiden Freundinnen,<br />
a. a. O..S. 89.<br />
28<br />
Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 7.<br />
29<br />
Ebenda, S. 9.<br />
30<br />
Ebenda, S.U.<br />
31<br />
Ebenda, S. 85.<br />
32<br />
Vorwärts, Nr. 126, 16. 3. 1923. Beilage; vgl. auch RIAS-Hörspiel, a. a. O., S. 21.<br />
477
33 Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 12 f. Denn „er tat es nicht aus Freude. Er war ein<br />
unglücklicher Mann", ebenda, S. 40.<br />
34 Vorwärts, Nr. 120, 13. 3. 1923. Morgenausgabe. Beilage.<br />
35 Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 20.<br />
36 Ebenda, S. 22.<br />
37 Leppmann, Der Giftmordprozeß, a. a. O., S. 127.<br />
38 Köhler, Willi, Vergessene Bücher. Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord, in: Neues Deutschland,<br />
Nr. 282,13. 10. 1965, Beilage Literatur, Nr. 10/1965, S. 16.<br />
39 Vgl. z.B. Uwe Schweikert, „Der rote Joseph"'. Politik und Feuilleton beim frühen Joseph Roth<br />
(1919—1926), in: Text + Kritik. Sonderband Joseph Roth, Hrsg. Heinz Ludwig Arnold, München<br />
1974, S. 47 f und Sonja Sasse, Der Prophet als Außenseiter. Rezeption von Zeitgeschehen bei<br />
Joseph Roth, ebenda, S. 77.<br />
40 Joseph Roth an Herbert Ihering, Berlin, 17. 9. 1922, in: Joseph Roth, Briefe 1911-1939, hrsg.<br />
und eingel. von Hermann Kesten, Köln-Berlin 1970, S. 40.<br />
41 Joseph Roth, Die Frauen Nebbe und Klein, in: Berliner Börsen-Courier, Nr. 129, 17. 3. 1923.<br />
Morgenausgabe. Beilage.<br />
42 Ebenda.<br />
43 Roth, Briefe 1911 -1939, a. a. O., S. 75 f; 215f und 285.<br />
44 Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 94.<br />
45 Döblin, Alfred, An Romanautoren und ihre Kritiker. Berliner Programm, in: Aufsätze zur Litera<br />
tur, a. a. O., S. 16.<br />
46 Vorwärts, Nr. 124,15. 3.1923. Morgenausgabe. Beilage.<br />
47 Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 23.<br />
48 Ebenda, S. 48.<br />
49 Leppmann, Der Giftmordprozeß, a. a. O., S. 127. Zum Problem einer bestehenden Eifersucht,<br />
ebenda, S. 128.<br />
50 Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 55.<br />
51 Ebenda, S. 57.<br />
52 Stekel, Wilhelm, Medizinische Psychologie, Psychotherapie, Psychoanalyse und Sexualwissenschaft,<br />
in: Medizinische Klinik. Wochenschrift für praktische Ärzte, Jg. 22, 1926/1, Nr. 4, 27. 1. 1926,<br />
S. 148. Vgl. auch Leo Greiner, Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord, in: Berliner Börsen-<br />
Courier, Nr. 149, 29. 3. 1925. Morgenausgabe. Beilage, abgedruckt in: Alfred Döblin im Spiegel<br />
der zeitgenössischen Kritik, hrsg. Ingrid Schuster und Ingrid Bode, Bern und München 1973,<br />
S. 155f.<br />
53 Rubin, Hans, Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord, in: Zeitschrift für Sexualwissenschaft,<br />
Bd. 12,1925/26, S. 98.<br />
54<br />
Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 46.<br />
55<br />
Leppmann. Der Giftmordprozeß, a. a. O., S. 124.<br />
56<br />
Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 46.<br />
57<br />
Ebenda, S. 47.<br />
58<br />
Wulffen, Erich, Kriminalpsychologie. Psychologie des Täters, Berlin 1926, S. 437 und 438.<br />
59<br />
Leppmann, Der Giftmordprozeß, a. a. O., S. 122.<br />
60<br />
Vossische Zeitung, Nr. 121,13. 3. 1923. Abendausgabe. Erste Beilage.<br />
61<br />
Berliner Tageblatt, Nr. 124,14. 3.1923. Abendausgabe.<br />
62<br />
Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 122/123,15.3. 1923.<br />
63<br />
Berliner Börsen-Courier, Nr. 120,12. 3.1923. Abendausgabe.<br />
64<br />
Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 118/119,13. 3.1923.<br />
65<br />
Leppmann, Der Giftmordprozeß, a. a. O., S. 129f.<br />
66<br />
Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 120/121,14. 3.1923.<br />
67<br />
Leppmann, Der Giftmordprozeß, a. a. O., S. 122.<br />
68<br />
Wulffen, Kriminalpsychologie, a. a. O., S. 438.<br />
69<br />
Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 93.<br />
70<br />
Ebenda, S. 24.<br />
71<br />
Döblin an Klages, 23.12. 1924, a. a. O.<br />
72<br />
Berliner Tageblatt, Nr. 127,16.3. 1923. Morgenausgabe. 1. Beiblatt.<br />
478
73 Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 29 f und 54f.<br />
74 Ebenda, S. 46.<br />
75 Döblin an Klages, 23.12. 1924, a. a. O.<br />
76 Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 93.<br />
77 Ebenda, S. 94 f.<br />
78 Vorwärts, Nr. 125, 15. 3. 1923, Abendausgabe.<br />
79 Roth, Die Frauen Nebbe und Klein, a. a. O.<br />
80 Mamlock, G., Freundinnen, in: Berliner Tageblatt, Nr. 125,15. 3. 1923. Morgenausgabe.<br />
81 Berliner Börsen Courier, Nr. 129, 17. 3. 1923, Morgenausgabe. Beilage.<br />
82 Gutmann, Paul, Der gefährliche Roman, in: Vorwärts, Nr. 129, 17. 3. 1923. Abendausgabe.<br />
83 Vorwärts, Nr. 124,15. 3. 1923. Morgenausgabe. Beilage.<br />
84 Goldstein, Moritz, Freundinnen, in: Vossische Zeitung, Nr. 129, 17. 3. 1923. Morgenausgabe.<br />
Erste Beilage.<br />
85 Berliner Börsen-Courier, Nr. 129, Morgenausgabe. Beilage.<br />
86 Ebenda, Nr. 130,17. 3. 1923. Abendausgabe. Beilage.<br />
87 Mamlock. Freundinnen, a. a. O.<br />
88 Roth, Die Frauen Nebbe und Klein, a. a. O.<br />
89 Heilfron, Eduard, Fort mit den Geschworenengerichten!, in: Deutsche Allgemeine Zeitung,<br />
Nr. 128/129,18.3.1923.<br />
90 Döblin, Die beiden Freundinnen, a. a. O., S. 88.<br />
91 Ebenda, S. 65-73.<br />
92 Ebenda, S. 72.<br />
93 Schweikert, „Der rote Joseph", a. a. O., S. 43 u. 49.<br />
94 Geroe, Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord, in: Imago. Zeitschrift für Anwendung der<br />
Psychoanalyse auf die Natur- und Geisteswissenschaften, Bd. XIV, 1928, S. 525.<br />
95 Ebermayer, Erich, Außenseiter der Gesellschaft, in: Die Literatur, Jg. 27, 1924/25, Sp. 633.<br />
96 Siemsen, Hans, Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord, in: Die Weltbühne, Jg. 21/1, 1925,<br />
S. 361.<br />
(Die abgebildeten Dokumente stammen aus dem Archiv des Autors.)<br />
Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 31, Brabanter Straße 22<br />
479
150 Jahre Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin<br />
Von Prof. Dr. Frido J. Walter Bader<br />
Im April dieses Jahres hat die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin der 150. Wiederkehr<br />
ihres Gründungsjahrs gedacht. Im Mittelpunkt der Festsitzung am 30. April in der Kongreßhalle,<br />
die unter das Generalthema „Die geographische Dimension der sich wandelnden<br />
Weltwirtschaftsordnung" gestellt worden war, stand der Festvortrag des Staatssekretärs<br />
im Auswärtigen Amt, Dr. Peter Hermes. Alle Vorträge werden in einem der nächsten<br />
Hefe der ERDE, der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, abgedruckt. Eine kleine<br />
Kartenausstellung im Foyer wurde durch die freundliche Mitarbeit der Kartenabteilung<br />
der Staatsbibliothek und der Redaktion des Afrika-Karten-Werkes ermöglicht. Der Bogen<br />
der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr spannt sich weiter bis in den Herbst, wo gemeinsam<br />
mit der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung die 11. Internationale Polartagung abgehalten<br />
wird.<br />
Es ist nun üblich, in Jubiläumsjahren den Blick zurückzulenken und Rechenschaft abzulegen<br />
über die abgelaufene Zeitspanne. So hat es auch die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin<br />
gehalten, und zwar haben dies zum 50. Geburtstag von Richthofen (gedruckt 1928) 1<br />
und Koner 2 getan, zum 55. von Schleinitz 3 , zum 75. Hellmann 4 , zum 100. wieder Hellmann 5<br />
und Penck 6 , zum 125. Quelle 7 und jetzt zum 150. der derzeitige Vorsitzer Karl Lenz 8 . Eine<br />
weitere Gelegenheit zum Rückblick bot vor 11 Jahren die Einweihung des neuen Hauses<br />
der Gesellschaft auf dem Steglitzer Fichtenberg, die durch den seinerzeitigen Generalsekretär,<br />
Peter Bloch 9 , wahrgenommen wurde. So ist es an dieser Stelle nicht notwendig,<br />
die historischen Konturen erneut nachzuzeichnen.<br />
Vielmehr soll auf die heutigen Aktivitäten der Gesellschaft hingewiesen werden. Einmal<br />
bietet sie den ortsansässigen Mitgliedern monatliche Vorträge und sonstige Veranstaltungen<br />
in ihrem Haus. Dort befindet sich auch die nach dem Krieg wieder neu aufgebaute<br />
Bibliothek, die vor allem in Bezug auf ihren Bestand an Periodika eine der größten geographischen<br />
Fachbibliotheken ist und sich regen Zuspruchs — auch von auswärts — erfreut 10 .<br />
Im Alexander-von-Humboldt-Haus auf dem Fichtenberg wird auch die Zeitschrift der<br />
Gesellschaft redigiert und von dort aus in alle Welt verschickt. Sie erscheint jetzt bereits<br />
im 109. Jahrgang, ist aber unter Einbeziehung ihrer Vorgängerinnen noch älter und kann<br />
bis 1853 („Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde") zurückverfolgt werden 11 . Weiterhin ist<br />
die Gesellschaft - dank eines kleinen Stiftungsvermögens - in der Lage, jungen Geographen,<br />
auch Studierenden, Beihilfen zu Forschungsreisen zu gewähren. Die Ergebnisse dieser<br />
Reisen werden z. T. ebenfalls in der Zeitschrift veröffentlicht.<br />
Weiter soll hier auf das Wandern des Domizils der Gesellschaft durch die Stadt Berlin hingewiesen<br />
werden. Zunächst war sie in der Innenstadt, im heutigen Bezirk Mitte, ansässig,<br />
und zwar zunächst (belegt für 1843) in zwei bescheidenen Zimmern in der Taubenstraße 40<br />
„zur Unterbringung der Bibliothek", 45 Jahre später in einer vornehmen Neun-Zimmer-<br />
Wohnung in der Zimmerstraße 90. Der Wunsch nach einem eigenen Haus war immer<br />
stärker geworden, und das Testament Gustav Nachtigals, der für diesen Zweck ein Legat<br />
von 70 000 Mark ausgesetzt hatte, legte den finanziellen Grundstock hierfür. Dazu kamen<br />
dann noch eigene Mittel der Gesellschaft, Mittel der Carl-Ritter-Stiftung und Spenden<br />
der Mitglieder 12 . So konnte im Jahr 1899 das Palais der Fürstin von Fürstenberg in der<br />
480
Wilhelmstraße 23 gekauft werden, das dann die Gesellschaft bis zu seiner Zerstörung im<br />
Bombenkrieg in der Nacht des 31. Januars 1944 beherbergte. Das Palais Fürstenberg mit<br />
seiner einen florentinischen Renaissance-Palast imitierenden Fassade lag in der südlichen<br />
Wilhelmstraße, also im Bezirk Kreuzberg und somit im heutigen West-Berlin. Dies war<br />
ein für die Nachkriegsgeschichte der Gesellschaft wichtiger Faktor. Sie war nach ihrer<br />
Wiederzulassung im Jahr 1948 jahrelang Gast beim Geographischen Institut der Freien<br />
Universität, zunächst in der sog. Rotkäppchen-Villa in der Potsdamer Straße 11 in Lichterfelde,<br />
nach deren Abriß in der Grunewaldstraße 35, ebenfalls im Bezirk Steglitz.<br />
Über das innere Leben der Gesellschaft vor 100 Jahren hat A. Woldt in der „Gartenlaube'"<br />
berichtet 13 . Ihre Sitzungen fanden damals im großen Saale des Architektenhauses zu Berlin<br />
statt und waren bedeutsame Ereignisse für die damalige Berliner Gesellschaft. Woldt<br />
beschreibt die Mitgliederstruktur folgendermaßen: „Die eine Hälfte der Gesellschaft wird<br />
vollständig vom Gelehrten- und höheren Beamtenstande eingenommen, welche beide sich<br />
ungefähr an Zahl das Gleichgewicht halten. Gehören zu den Gelehrten nicht nur viele Mitglieder<br />
der Akademie der Wissenschaften, zahlreiche Universitätsprofessoren, Vertreter<br />
von Specialfächern, wie Astronomen, Botaniker, Geographen, Kartographen, Reisende<br />
481
Alexander-von-Humboldt-Haus der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Erbaut 1966/67 mit Hilfe<br />
der Stiftung Volkswagenwerk.<br />
und Privatgelehrte, Vorstände von Museen und Sammlungen, sondern auch zahlreiche<br />
eigentliche Lehrer von Gymnasien und Realschulen, so umfaßt der zweitgenannte Stand<br />
das hohe Beamtenthum durch alle Kategorien von der Excellenz abwärts, die vortragenden<br />
und Geheimräthe, Räthe jeder Art, namentlich viele Juristen, ferner Gesandte, Diplomaten,<br />
Politiker, Directoren, Consuln u.A.m. Diesen beiden Hauptsäulen der Gesellschaft,<br />
deren jede etwa hundertsiebenzig bis hundertachtzig Mitglieder umfaßt, schließen<br />
sich drei unter sich fast ganz gleich große Kategorien von je siebenzig bis achtzig Vertretern<br />
an, die Militärs nebst Mitgliedern der Marine, die Aerzte und die Kaufleute. Dann kommen<br />
die Verlagshändler, die Künstler und die besitzende Klasse mit je etwa zwanzig Mitgliedern,<br />
und zuletzt - drei Schriftsteller — leider nur drei!" (S. 295.) Diese Notiz hat mich veranlaßt,<br />
einmal für zwei ausgewählte Jahre die Berufsstruktur der Mitglieder nach den Verzeichnissen<br />
der Mitglieder auszuzählen, die in den von 1873 bis 1901 erschienenen „Verhandlungen<br />
der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin" jährlich abgedruckt worden sind.<br />
Allerdings werden häufig hierzu gar keine Angaben gemacht, und manchmal ist auch die<br />
Zuordnung schwer. Z.B. steht bei Werner von Siemens „Geh. Reg.-Rat, Mitglied der<br />
Königl. Akademie der Wissenschaften". Interessant wäre auch eine genauere Analyse der<br />
Wohnsitze der Mitglieder, damals natürlich vorwiegend in der Innenstadt. Aber auch die<br />
Genthiner Straße, oder Groß-Lichterfelde werden 1890 mehrfach genannt. Dazu kommen<br />
Spandau. Köpenick und Potsdam. Unter den Mitgliedern findet man mehrere Minister,<br />
ferner die deutschen Botschafter in Istanbul und Wien (sie werden als ortsansässige Mitglieder<br />
geführt). Auffallend wenig vertreten sind Theologen — in beiden Jahren nur je drei,<br />
dagegen sind die Bankiers mit 12 bzw. 33 recht stark vertreten. Die 10 bzw. 49 Rentiers<br />
sind ein Zeugnis für den Lebensstil der damaligen Zeit. Die Schriftsteller scheinen sich die<br />
482
Klage der „Gartenlaube" zu Herzen genommen zu haben: 1890 taucht diese Berufsangabe<br />
achtmal auf.<br />
Berufe der Mitglieder der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin<br />
(ausgezählt nach dem Verzeichnis der Mitglieder)<br />
Zahl der ortsansässigen<br />
Mitglieder insgesamt<br />
Davon sind:<br />
Hochschullehrer<br />
Andere Lehrer<br />
Offiziere<br />
Beamte, Richter, Anwälte<br />
Ärzte<br />
Unternehmer und Kaufleute<br />
Buchhändler und Verleger<br />
Bankiers<br />
Maler und Bildhauer<br />
Redakteure<br />
Theologen<br />
Rentiers<br />
Sonstige und ohne Angaben<br />
1874<br />
454 1<br />
57<br />
58<br />
45<br />
125<br />
37<br />
40<br />
18<br />
12<br />
7<br />
2<br />
3<br />
10<br />
38<br />
1890<br />
804 2<br />
52<br />
54<br />
71<br />
180<br />
65<br />
163<br />
17<br />
33<br />
5<br />
3<br />
3<br />
49<br />
109<br />
dazu noch 9 auswärtige<br />
ordentliche, 105 korrespondierende<br />
und 62 Ehrenmitglieder.<br />
dazu 231 ordentliche auswärtige,<br />
64 korrespondierende<br />
und 65 Ehrenmitglieder.<br />
Auch heute will die Gesellschaft für Erdkunde kein enger berufsbezogener Zirkel von<br />
Geographen in Schule und Hochschule sein, sondern sie steht offen für jeden, der an der<br />
Erdkunde im weitesten Sinn interessiert ist. Dieses weite Feld zeigen auch die Berufe der<br />
heutigen Mitglieder - ohne daß diese jetzt ebenfalls ausgezählt werden sollen.<br />
(Die Abbildungen sind aus dem Besitz der Gesellschaft.)<br />
Anschrift des Verfassers: 1000 Berlin 48, Richard-Tauber-Damm 25<br />
Richthofen, Ferdinand von, 1928: Die Geographie im ersten Halbjahrhundert der Gesellschaft<br />
für Erdkunde. Festrede zum 50jährigen Stiftungsfest 1878. Z. Ges. Erdkde. Bln. Sonderband zur<br />
Hundertjahrfeier. 1928. S. 15-30.<br />
Koner, Wilhelm, 1878: Zur Erinnerung an das fünfzigjährige Bestehen der Gesellschaft für Erdkunde<br />
zu Berlin. Z. Ges. Erdkde. Bln. 13 (1878). S. 169-250.<br />
Schleinitz, Georg von, 1883: Festrede zur Feier des 55jährigen Bestehens der Gesellschaft für<br />
Erdkunde zu Berlin, gehalten am 28. April 1883. Verh. Ges. Erdkde. Bln. 10 (1883) Extra<br />
Nummer. S. 7 —21.<br />
Hellmann, Gustav, 1903: Fest-Sitzung zur Feier des 75jährigen Bestehens der Gesellschaft für<br />
Erdkunde zu Berlin. Z. Ges. Erdkde. Bln. 1903. S. 325-343.<br />
Hellmann, Gustav, 1928: Aus der Geschichte der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin im zweiten<br />
halben Jahrhundert ihres Bestehens (1879-1928). Z. Ges. Erdkde. Bln. Sonderband zur Hundertjahrfeier.<br />
1928. S. 1-4.<br />
483
6<br />
Penck, Albrecht, 1928: Hundert Jahre Gesellschaft für Erdkunde. Z. Ges. Erdkde. Bln. 1928.<br />
S. 162-169.<br />
' Quelle, Otto, 1953: 125 Jahre Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1828-1953. Berlin.<br />
8<br />
Lenz, Karl, 1978: 150 Jahre Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. DIE ERDE. 109 (1978).<br />
S. 15-35.<br />
9<br />
Bloch, Peter, 1967: Aus der Geschichte der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Vortrag, gehalten<br />
am 19. April 1967 anläßlich der Einweihung des neuen Hauses Berlin-Steglitz, Arno-Holz-Straße<br />
Nr. 14 (Berlin). Maschinenschriftl. vervielfältigt.<br />
10<br />
Leonhardy, Hans & Wolfgang Scharfe, 1966: Periodica. Verzeichnis der Zeitschriften und periodischen<br />
Veröffentlichungen in der Bibliothek der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Stand<br />
1. Oktober 1965). DIE ERDE. 97 (1966). S. I - XXXVI.<br />
11<br />
Leonhardy, Hans, 1969: Die Veröffentlichungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. DIE<br />
ERDE. 100(1969). S. 118-123.<br />
12<br />
Bloch, wie Anm. 9.<br />
13<br />
Woldt, A., 1878: Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. Zu deren Jubiläum am 30. April und<br />
1. Mai. Gartenlaube. 1878. S. 295-297.<br />
Ferner:<br />
Verzeichnis der Mitglieder der Gesellschaft für Erdkunde am 3. Januar 1874. Verh. Ges. Erdkde.<br />
Bln. 1 (1875), zweite Folge. S. 1 -22.<br />
Verzeichnis der Mitglieder der Gesellschaft für Erdkunde. Verh. Ges. Erdkde. Bln. 17 (1890).<br />
S. 2-42.<br />
Tschaikowsky in Berlin<br />
Von Dr. Werner Bollert<br />
Bereits 1861 und dann wieder 1868 hatte Peter Tschaikowsky die Stadt Berlin kennen<br />
gelernt, aber erst in seiner letzten Lebenszeit kam er dazu, jene flüchtige Bekanntschaft<br />
zu erneuern und ein wenig zu vertiefen. Dies waren ja zugleich die Jahre, in denen er<br />
auszog, um auch in fernen Ländern - wenn möglich, als Dirigent - für die eigene Kunst<br />
zu werben. Die Initialzündung, Tschaikowsky mit der Leitung eines philharmonischen<br />
Konzerts in Berlin zu betrauen, dürfte mit von Hans von Bülow ausgegangen sein, der<br />
den Komponisten sehr schätzte. Bülow, dem ja das Klavierkonzert b-moll gewidmet war<br />
und der 1885 zu St. Petersburg die 3. Orchestersuite op. 55 aus der Taufe gehoben hatte,<br />
schrieb vom gleichen Ort aus ein Jahr später an Richard Strauss: „Tschaikowsky war hier<br />
und brachte mir seine Manfredsymphonie, die ich nur erst anzublättern Zeit gefunden,<br />
die aber mehr Musik zu enthalten scheint als sämtliche Orchester-opera A. Rubinsteins.<br />
Der Verfasser ist persönlich einer der allerliebenswürdigsten Menschen, denen ich je begegnet,<br />
dabei so tolerant und lobesfreudig für seine Kollegen, kurz ein Prachtexemplar.<br />
1840 geboren, beinahe schon weißhaarig, aber voll geistiger Jugend; wenn er komponiert,<br />
vergräbt er sich in seine absoluteste Einsamkeit; ist er fertig mit der Arbeit, so erfreut er<br />
durch seinen herzlichen Verkehr alle ihm sympathischen Mitwesen."<br />
Jener erste, in der Chronik der Berliner Philharmoniker nicht zu übergehende Tschaikow-<br />
484
Desiree Artöt de Padilla<br />
* 1835 Paris, 11907 Wien<br />
Französische Bühnensängerin,<br />
lebte von 1884 bis 1889<br />
in Berlin;<br />
1868 mit Tschaikowskv verlobt.<br />
Foto:<br />
Staatl. Institut<br />
für Musikforschung<br />
Preussischer Kulturbesitz<br />
Berlin<br />
sky-Abend fand am 8. Februar 1888 statt, womit nicht gesagt sein soll, daß dessen Name<br />
und Werke bis dahin den hiesigen Musikfreunden fremd geblieben seien. Schon 1878 hatte<br />
Benjamin Bilse den Berlinern die Orchester-Fantasie „Francesca da Rimini" vorgestellt<br />
und, trotz ablehnender Pressestimmen, sogar Wiederholungs-Aufführungen gewagt. Haben<br />
vielleicht deswegen Bülow und der Konzertunternehmer Hermann Wolff dem Komponisten<br />
von der Wahl der „Francesca" abgeraten und dafür plädiert, als effektvolles Schlußtableau<br />
doch lieber die Festouvertüre „1812" ins Programm zu nehmen? Wie dem auch<br />
sei, die endgültige Vortragsfolge - offenbar dem Geschmack des Publikums Rechnung tragend<br />
- war nun zwar abwechslungsreich, aber ziemlich buntscheckig geraten: Fantasie-<br />
Ouvertüre „Romeo und Julia'VKlavierkonzert b-moll (Solist Alexander Siloti)/Introduktion<br />
und Fuge aus der 1. Orchestersuite op. 43/Andante aus dem 1. Streichquartett op. 11<br />
(von allen Streichern gespielt)/Lieder (gesungen von Aline Friede)/Festouvertüre „1812".<br />
Unter den dargebotenen Orchesterwerken scheint lediglich das Opus 43 eine Novität für<br />
Berlin gewesen zu sein, während das Andante aus Opus 11, „ein reizendes Kabinettstück<br />
von zartester Durchführung, zu den beliebtesten Repertoirestücken der Philharmonischen<br />
Kapelle gehört und, wie gewöhnlich, wiederholt werden mußte". Weshalb Tschaikowsky<br />
darauf verzichtete, seine 4. Symphonie (die er in anderen Städten dirigiert hat) auch in<br />
Berlin zu präsentieren, ist nicht recht einzusehen, zumal man weiß, daß er selbst die als<br />
pures Gelegenheitswerk entstandene Ouvertüre „1812" gering geachtet hat. An Frau von<br />
Meck berichtet Peter Iljitsch wie folgt: „Mein Konzert in Berlin war sehr gelungen. Ich<br />
485
hatte es mit einem ausgezeichneten Orchester zu tun, mit Musikern, welche mir von der<br />
ersten Probe an die größte Teilnahme entgegenbrachten. Das Publikum empfing mich begeistert.<br />
Es versteht sich von selbst, daß mir dies alles sehr angenehm ist, ich fühle mich<br />
aber so müde, daß ich nicht weiß, wie ich das Bevorstehende ertragen soll. Der Aufenthalt<br />
in Berlin war einfach ein Martyrium; nicht einen Moment konnte ich allein sein.<br />
Von früh bis spät mußte ich Gäste empfangen oder selbst Besuche machen." Einer ihm<br />
weiterhin bei einem „Frühschoppen" zugedachten Ehrung wünschte er jedoch unter allen<br />
Umständen zu entgehen. Gern nahm er dafür die Einladung zu einem Diner im Hause<br />
des Musikverlegers Hugo Bock an (den er „einen guten, netten Kerl" nennt), und es gab<br />
nun die ihm höchst willkommene Möglichkeit, Desiree Artöt, die „ungetreue Braut" von<br />
ehedem, wiederzusehen. Der Abend bei ihr, zusammen mit Edvard Grieg, verlief ungemein<br />
harmonisch und in bester Stimmung; Tschaikowsky begleitete die Sängerin zu Liedern<br />
Griegs, dieser wiederum akkompagnierte die Gesänge Tschaikowskys am Klavier.<br />
Ein Jahr später kehrte Tschaikowsky aufs neue in Berlin ein; innerhalb eines populären<br />
Abends der Philharmoniker (26. Februar 1889) dirigierte er diesmal nur zwei Nummern:<br />
die Streicherserenade op. 48 und „Francesca da Rimini" (im zweiten Teil hörte man<br />
Carl Maria von Webers ,,Preziosa"-Musik). „Der Saal war überfüllt", schrieb Peter an<br />
seinen Bruder Modest, „der Erfolg ein großer, obwohl ,Francesca' eigentlich nicht die<br />
Wirkung ausübte, die ich erwartet hätte; das Orchester spielte nämlich<br />
so herrlich, daß es mir schien, das Publikum müßte schon allein deswegen in Begeisterung<br />
geraten. Sehr deutlich vernahm ich zwei oder drei Pfiffe. Am besten hat der Walzer der<br />
Serenade gefallen. . . In Berlin mache ich den ganzen Tag Besuche, und das ist für mich<br />
das Schrecklichste. Mein einziger Trost ist — Artöt, die ich überall treffe und furchtbar<br />
gern habe. Am Abend muß ich zu Klindworth, der mir zu Ehren einen musikalischen<br />
Abend aus meinen Kompositionen veranstaltet."<br />
Während der letzten Lebensjahre gab es für Tschaikowsky noch ein paar Berliner Stippvisiten<br />
(Januar 1890; März 1891; Januar 1892; Mai 1893). Als er im Dezember 1892<br />
zum vorletztenmal in unserer Stadt weilte, „waren es keine drei lustigen Tage,,, die er<br />
hier verbrachte. Von hier erhielt sein Lieblingsneffe Wladimir („Bobik") jene Zeilen, die<br />
tief ins Innere hineinleuchten: „Ich sitze immer noch in Berlin; es fehlt mir der Mut,<br />
mich aufzuschwingen. Ich prüfte aufmerksam und sozusagen objektiv meine Symphonie,<br />
welche ich zum Glück noch nicht instrumentiert und in die Welt gesetzt habe. Der Eindruck<br />
war für sie nicht schmeichelhaft, d.h. die Symphonie ist nur um des Schreibens<br />
willen geschrieben und enthält nichts Interessantes und Sympathisches. Sie soll verworfen<br />
und vergessen werden. Dieser von mir gefaßte Entschluß ist unwiderruflich.. . Ohne Arbeit<br />
zu leben, die alle Zeit, Gedanken und Kräfte verschlänge - wäre langweilig. Was<br />
soll ich tun? Das Komponieren an den Nagel hängen und vergessen? Der Entschluß ist<br />
sehr schwer. Ich denke und denke und weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll". Dieses<br />
Opus hat Tschaikowsky tatsächlich vernichtet, doch bereits Anfang April 1893 konnte<br />
er melden, er habe inzwischen eine neue Symphonie vollendet, die ihn selbst zufriedenstelle<br />
und formal mancherlei Ungewöhnliches bringe. Wie gut es das Schicksal gerade mit<br />
dieser seiner „Symphonie pathetique" meinte und welche außerordentliche Resonanz sie<br />
beim Publikum auslöste, das alles sollte sich schon bald nach dem Tode des Komponisten<br />
(6. November 1893) zeigen.<br />
Innerhalb des Berliner (und des Leipziger) Konzertlebens gebührt das Verdienst am<br />
Nachruhm zweifelsohne dem Dirigenten Arthur Nikisch, der hier seit 1895 eine konstante<br />
486
Tschaikowsky-Pflege entfaltete. Seine erste Berliner Saison eröffnete er am 14. Oktober<br />
1895 mit der 5. Symphonie e-moll, der noch in der gleichen Spielzeit Darbietungen des<br />
Violinkonzerts (Alexander Petschnikoff) und des 1. Klavierkonzerts in b-moll (Frederic<br />
Lamond) folgten. Die zweite Saison brachte „Romeo und Julia" und die dritte, am<br />
10. Januar 1898, die 6. Symphonie h-moll. Im Februar 1899 erschien „Francesca da<br />
Rimini", ein Jahr danach die Fantasie-Ouvertüre „Hamlet" im Programm der Philharmoniker.<br />
Und am 5. November 1900 war, zum erstenmal in diesen Konzerten,die 4.<br />
Symphonie f-moll zu hören. Aufführungen der Orchestersuiten Nr. 3 und Nr. 1 (Februar<br />
bzw. Oktober 1902), der 3. Symphonie D-dur (November 1903), der „Manfred"-Symphonie<br />
(Februar 1906) und der Orchester-Fantasie „Der Sturm" (März 1908) hatten zwar<br />
auch bei Nikisch Seltenheitswert, inzwischen aber waren die Symphonien Nr. 4 — 6, das<br />
b-moll-Klavierkonzert und das Violinkonzert zu veritablen Dauerbrennern geworden, die<br />
das Publikum goutierte und offenbar immer wieder verlangte.<br />
Auch die Nikisch-Nachfolger beim Philharmonischen Orchester, Wilhelm Furtwängler<br />
ebenso wie Herbert von Karajan, haben die Tschaikowsky-Interpretation stets als eine<br />
fesselnde und lohnende Aufgabe betrachtet. Auf dem musiktheatralischen Sektor ist zudem<br />
die Geltung dieses Komponisten in der Gegenwart eher noch gewachsen: neben der<br />
unverminderten Beliebtheit seiner abendfüllenden Ballette haben da Schöpfungen wie<br />
„Eugen Onegin" und „Pique Dame" eine frische, ganz eigene Wirksamkeit erreicht.<br />
Anschrift des Verfassers: Hermannstraße 8, 1000 Berlin 37<br />
(In erheblich gekürzter Fassung erschienen in: Philharmonische Blätter, hrsg. vom Berliner Philharmonischen<br />
Orchester, Heft 8, 1977/78.)<br />
Nachrichten<br />
Um den Döblin-Platz<br />
Auf Dr. Walter Heynen gehen die Bemühungen zurück, dem bedeutenden Berliner Dichter Alfred<br />
Döblin eine Straße oder einen Platz zu widmen. Der hundertste Geburtstag am 10. August 1978 schien<br />
ein guter Anlaß, die Stadt Berlin an diese Ehrenpflicht zu erinnern. Unser damaliger Vorsitzender<br />
Professor Dr. Dr. Walter Hoffmann-Axthelm hat sich darum auch als Kollege Döblins, der von Hause<br />
aus Arzt war, bei den zuständigen Stellen und zuletzt beim Regierenden Bürgermeister von Berlin um<br />
die Namensgebung bemüht. Mit einem Brief ohne Datum teilte ihm Dietrich Stobbe dann im Sommer<br />
mit: „Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, daß nunmehr die Bezirksverordnetenversammlung<br />
des Bezirks Kreuzberg einer Neubenennung eines Platzes in ,Alfred-Döblin-Platz' zugestimmt hat . . .<br />
Herrn Claude Doblin habe ich entsprechend unterrichtet und ihm mitgeteilt, daß es sich um einen Platz<br />
im Schnittpunkt der Dresdener, Sebastian- und Luckauer Straße handelt."<br />
In Unkenntnis dieses Vorgangs hat der Leiter der Lokalredaktion des „Tagesspiegels", Günter<br />
Matthes, dann in einer Glosse am 10. August 1978 auf die Vorschläge unseres Vereins hingewiesen,<br />
zugleich aber vermerkt, daß eine Antwort „des Mitglieds Stobbe" offensichtlich noch ausstehe und<br />
man nun wohl bis zum zweihundersten Geburtstag des Dichters von „Berlin Alexanderplatz" warten<br />
müsse. Am 11. August 1978 erschien im Amtsblatt für Berlin, 28. Jahrgang, Nr. 51, Seite 1329, die<br />
folgende Nachricht: „Im Bezirk Kreuzberg wird mit Wirkung vom 11. September 1978 das von den<br />
487
Straßen Luckauer Straße, Dresdener Straße und Sebastianstraße gebildete Straßendreieck in ,Alfred-<br />
Döblin-Platz' benannt."<br />
Mit Rücksicht auf Klaus Döblin/Claude Doblin. den Sohn Alfred Döblins, der an der Würdigung seines<br />
Vaters teilnehmen wollte, sollten allerdings die neuen Straßenschilder auch am 11. September<br />
noch nicht angebracht werden.<br />
Auf eine Unart unserer Stadtväter sei in diesem Zusammenhang einmal hingewiesen: Warum muß es<br />
ausgerechnet „Alfred-Döblin-Platz" heißen? Wer ihn kennt, wird auch bei „Döblin-Platz" an diesen<br />
berühmten früheren Mitbürger erinnert, wer aber keine Beziehung zu ihm hat, erfährt hoffentlich aus<br />
einer kurzen Erläuterung an der Beschilderung des Platzes, um wen es sich handelt. Wie gut, daß wir<br />
schon unsere Goethestraßen haben, heutige Tiefbauämter als zuständige Behörden würden wohl<br />
„Johann-Wolfgang-von-Goethe-Straße" vorschlagen. H. G. Schultze-Bemdt<br />
70 Jahre Märkisches Museum<br />
Wie „Der Morgen" am 10. Juni 1978 meldete, wurde das neue Gebäude des Märkischen Museums in<br />
der Nähe der Jannowitzbrücke vor genau 70 Jahren, am 11. Juni 1908, für die Berliner Bevölkerung<br />
eröffnet. Sechs Gebäudeteile, die zwei Innenhöfe umschließen, erwecken den Anschein eines in verschiedenen<br />
Epochen von der Gotik bis zur Renaissance gewachsenen Komplexes. Auch im Inneren<br />
des Museums wechseln die Stilformen, die für die unterschiedlichen Sammlungsgebiete den jeweils<br />
passenden Rahmen abgeben sollten. Diese Konzeption einer Einheit von historischen Architekturformen<br />
und spezifischem Sammlungsinhalt eines Heimatmuseums ist ein besonders interessantes Beispiel<br />
der Museumsbauweise um die Jahrhundertwende. Im Kreuzgang mit alten Grabdenkmälern ist eine<br />
mittelalterliche Tür aus einer märkischen Kirche mit einer gotischen Steineinfassung eines Hauses der<br />
Gertraudenstraße bemerkenswert. Eine Holzbalkendecke über Konsolsteinen fällt in dem Raum auf.<br />
der jüngst eine Sonderausstellung mit Berliner Medaillen zeigte. Das Märkische Museum hat folgende<br />
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonnabend von 9 bis 17 Uhr, Sonntag von 9 bis 18 Uhr.<br />
Dorfanger Friedrichsfelde unter Denkmalschutz<br />
H. G. Schultze-Bemdt<br />
Im Frühjahr 1978 wurde der Dorfanger Friedrichsfelde unter Denkmalschutz gestellt. Damit wird die<br />
alte Angerfläche in dieser Form erhalten bleiben. Zum historisch bemerkenswerten Ensemble dieses<br />
mittelalterlichen Ortskerns gehören eine Kirche, ein ehemaliges Inspektorenhaus und ein Backofen.<br />
Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Barockkirche wurde nach dem Krieg durch einen Bau im Stil der<br />
alten Dorfkirchen ersetzt. Der große Backofen aus Kalksteinquadern auf dem Dorfanger lehnt sich<br />
heute noch an ein Gebäude an, er wird künftig wieder frei stehen. In das Inspektorenhaus sollen in den<br />
nächsten Jahren Atelierwohnungen und Räumlichkeiten für die Arbeit eines „Zirkels für künstlerisches<br />
Volksschaffen" verlegt werden. H. G. Schultze-Bemdt<br />
Von unseren Mitgliedern<br />
Studienfahrt nach Goslar<br />
Die frühe Morgenstunde des 1. September 1978 sah rund 70 Reiselustige an der traditionellen Abfahrtsstelle<br />
an der Berliner Bank in der Hardenbergstraße. Sie bestiegen frohen Mutes den doppelstöckigen<br />
Omnibus, der nicht nur schönere, sondern wohl auch schon bessere Tage gesehen hatte. In<br />
Helmstedt jedenfalls mußte er zu einer mehr als vierstündigen Reparatur in die Werkstatt, was sich<br />
zwar im Hinblick auf den weiteren Ablauf des Programms verschmerzen ließ, für die Teilnehmer aber<br />
488
deshalb so unangenehm war, weil sie halbstundenweise über den Zeitpunkt des Aufbruchs vertröstet<br />
wurden und nicht die Gelegenheit zu einer improvisierten Besichtigung Helmstedts und seiner Sehenswürdigkeiten<br />
hatten. Um so erfreulicher war dann das gemeinsame späte Mittagessen in den Gaststätten<br />
Grauhof-Brunnen, wo zur Zeit des Nachmittagskaffees das durch langes Kochen noch schmackhafter<br />
gewordene Wildgulasch „Hubertus" aufgetischt wurde. Auch Steiger Müller im Rammeisberg<br />
ließ sich die Wartezeit nicht verdrießen und zeigte den Gästen umschichtig den Lehrstollen und die<br />
200 Jahre alten hölzernen Fördereinrichtungen dieses Schicksalsberges Goslars. Die jeweils andere<br />
Gruppe brauchte nicht zu warten, sondern konnte in der Waldgaststätte „Maltermeister Turm" inzwischen<br />
ein wärmendes Getränk einnehmen. Dann erst bezogen die Reisenden ihr inzwischen von<br />
„Berliner Bär" in Harzhotel Bären umgetauftes freundliches Hotel. Für die meisten von ihnen war das<br />
gemeinsame Abendessen im Hotel-Restaurant „Klause" in Goslars Altstadt der Schlußpunkt dieses<br />
Tages.<br />
Am 2. September empfing Bürgermeister Konrad die Gruppe im historischen Rathaus, gab einen Abriß<br />
von der geschichtlichen Bedeutung Goslars und sorgte dafür, daß zumindest ein Teil der Gäste<br />
einen Blick in den berühmten Huldigungssaal werfen konnte. Anschließend übernahm Frau R. Griep<br />
das Kommando zu einer Fahrt in den Oberharz, die von ihr kenntnisreich und liebevoll kommentiert<br />
wurde. Das Augenmerk galt dabei vor allem den alten (Dammgraben) und neuen (z.B. Granetalsperre)<br />
technischen Denkmälern, die für den zweiten Schatz des Harzes, das Wasser, errichtet wurden und dem<br />
Erzbergbau wie der Trinkwasserversorgung dienen. Daß ein gutgemeinter Spaziergang durch die schönen<br />
Harzwälder zum Bahnhof Altenau statt zum Dammhaus führte, wurde trotz hereinbrechender<br />
Regenschauer nicht übel genommen. Das Mittagessen im Hotel „Das Tanneck" war eine willkommene<br />
Unterbrechung der so anregenden wie weitreichenden Rundfahrt durch den Oberharz. Der Regen<br />
störte auch mehr die Besucher des munteren Altstadtfestes als die Gäste aus Berlin.<br />
Der Sonntagmorgen, 3. September, wurde im Hotel mit einem Vortrag des Städtischen Archivdirektors<br />
Dr. W. Hillebrand über die Stadtgeschichte Goslars eröffnet. Ein sehenswerter Film ergänzte<br />
das gesprochene Wort und leitete über zum Stadtrundgang, dessen Führung sich die Herren<br />
Rehbock und Moritz mit Engagement und spürbarer Liebe zu ihrer Heimatstadt teilten. Zwar wichen<br />
die Routen und Objekte der Führung voneinander ab, doch war der Vormittag ohnehin zu kurz, als daß<br />
er der Stadt Goslar voll hätte gerecht werden können. Er verlockte aber zu einem Wiederkommen<br />
bei anderer Gelegenheit. Das Hotel Kaiser Worth hatte seine Gäste dann in den Ratskeller umquartiert,<br />
was als eine Ausladung verstanden wurde, doch verdarb dies den Teilnehmern die gute Laune<br />
so wenig wie der nach der Abfahrt folgende Wassereinbruch in den Veteranen der Landstraße. Eine<br />
Unterbrechung im Quellenhof zu Bad Helmstedt wurde zu einer Kaffeepause genutzt; pünktlich auf<br />
die Minute trafen die Ausflügler dann am Bahnhof Zoo ein. Das auf der Avus gesungene Tedeum war<br />
dann schon mehr Ausdruck von Galgenhumor. Ob die „Drohungen" wahrgemacht werden, man wolle<br />
das Ziel der Exkursion 1979 (Braunschweig) mit der Eisenbahn ansteuern? H. G. Schultze-Berndt<br />
Unser Mitglied Horst Behrend ist zum Vorsitzenden des Freien deutschen Autorenverbandes Berlin<br />
gewählt worden.<br />
*<br />
Am 23. Juli 1978 ist Prof. Dr. Wilhelm Richter in Berlin verstorben. Er wurde 1901 in Pagenkopf in<br />
Hinterpommern als Sohn eines Pfarrers geboren, siedelte aber schon 1914 nach Berlin über. An der<br />
Gründung seines Lehrers Wilhelm Blume, der Schulfarm Scharfenberg, erwarb er sich die Sporen, war<br />
dann als Lehrer und Direktor an der Humboldt-Schule in Tegel tätig und trat 1949 die Nachfolge<br />
W. Blumes beim Aufbau der Pädagogischen Hochschule an, deren Direktor er bis 1958 war. Bis zu<br />
seiner Emeritierung 1967 hatte er den Lehrstuhl für Historische Pädagogik inne.<br />
Wilhelm Richter, der sich Wilhelm von Humboldt und seiner Bildungsidee verpflichtet fühlte (1935/36<br />
hat er Humboldts politische Briefe herausgegeben), war einer der bedeutendsten Pädagogen unserer<br />
Stadt. In den rund zwei Jahrzehnten seines Wirkens an der Pädagogischen Hochschule hat er sich für<br />
die wissenschaftliche Qualität des Lehrerstudiums verwendet. Unserem Verein wird er auch mit seinen<br />
Untersuchungen zur Berliner Schulgeschichte über den Tod hinaus verbunden bleiben.<br />
489
Der Zentralverband der sozialversicherten Rentner und deren Hinterbliebenen hat unserem Mitglied<br />
Franz Berndal in Anerkennung seiner treuen Mitarbeit in der Zeitschrift „Lebensabend" die Ehrennadel<br />
in Bronze verliehen.<br />
*<br />
Am 20. August 1978 ist unserem Mitglied Axel Springer vom langjährigen Gouverneur von Texas,<br />
Conally, die „American Friendship Medai" überreicht worden, mit der sein „unermüdliches und entschiedenes<br />
Eintreten für die Freiheit aller" gewürdigt werden soll. Die Auszeichnung wird nur an<br />
Nichtamerikaner vergeben. Bisherige Träger sind Sir Winston Churchill, der ehemalige philippinische<br />
Präsident Magsaysay und der Schriftsteller Solschenizyn.<br />
Der Verein für die Geschichte Berlins übermittelt im kommenden Vierteljahr seine Glückwünsche zum<br />
70. Geburtstag Herrn Kurt Altner. Herrn Wilfried Göpel. Frau Liselotte Moesges; zum 75. Geburtstag<br />
Frau Maria Arand, Herrn Erich Heinatz, Herrn Helmut Grell; zum 80. Geburtstag Frau Dörte Neumann,<br />
Herrn Kurt Pierson, Frau Agnes Priebe; zum 85. Geburtstag Frau Helene v. Stülpnagel; zum<br />
90. Geburtstag Herrn Wilhelm Hahn.<br />
Buchbesprechungen<br />
Berlin - Chronik der Jahre 1959 — 1960. Hrsg. im Auftrage des Senats von Berlin. Bearb. durch<br />
Hans J. Reichhardt, Joachim Drogmann, Hanns U. Treutier (Landesarchiv Berlin - Abt. Zeitgeschichte).<br />
Berlin: Hans Spitzing Verlag 1978. 951 S., Leinen, 54,55 DM. (Schriftenreihe zur Berliner<br />
Zeitgeschichte, Bd. 9.).<br />
Nach rund 4jähriger Pause ist jetzt ein weiterer Fortsetzungsband der vom Berliner Senat in Auftrag<br />
gegebenen Stadtchronik erschienen; er schließt nahtlos an den vorigen Band von 1957 — 58 an (vgl.<br />
Bespr. in den „Mitteilungen", Heft 2/1975). Das bewährte Muster der Tageschronologie im sachlichen<br />
Reportagestil wurde konsequent beibehalten und bildet nach wie vor einen der großen Vorzüge dieser<br />
Bände, da es ohne thematische Einengung den sofortigen „Einstieg" in den Geschehensablauf<br />
ermöglicht. Wiederum bilden die politischen Tagesereignisse den Schwerpunkt in der Berichterstattung,<br />
belegt hauptsächlich durch Sitzungsprotokolle, Reden, Erklärungen, Artikel - kurzum durch<br />
Äußerungen jedweder Art über Berlin, unabhängig davon, wo auf der Welt und in welchem Zusammenhang<br />
sie gefallen sind. Das verleiht dem Text manche Weitschweifigkeit, zeigt aber auch deutlich,<br />
wie die Stadt nach wie vor im Brennpunkt der Weltöffentlichkeit steht. Es sind die Jahre zwischen<br />
dem Chruschtschow-Ultimatum und dem Bau der Mauer, in denen auf verschiedenen, oft auch<br />
abenteuerlichen Wegen in Ost und West nach einer Lösung des Berlin-Problems gesucht wurde. Die<br />
beiden Teile Deutschlands und ebenso Berlins drifteten immer mehr auseinander, obwohl z.B. noch<br />
gemeinsame Olympiamannschaften aufgestellt wurden; die Nadelstichpolitik seitens der Ost-Berliner<br />
Machthaber und die Versuche der Aushöhlung des Viermächtestatus durch die Sowjetunion nahmen<br />
bedenkliche Formen an. Der Flüchtlingsstrom erreichte Rekordhöhen, während im Westen die Wirtschaft<br />
sich weiter konsolidierte, die Bautätigkeit zügig voranschritt und im kulturellen Bereich beachtliche<br />
Leistungen vorzuzeigen waren. Auch hierüber wird in der Chronik, wie bisher, in jedem Einzelfall<br />
berichtet.<br />
Je mehr sich der bearbeitete Zeitraum vorschiebt, um so größer wird die Dichte der Quellen - auch<br />
der ausländischen —, und um so stärker gewinnen die Chronikbände an Intensität. Das geht vielleicht<br />
manchmal zu Lasten der schnellen Kurzinformation, doch wird man andererseits wegen der zunehmenden<br />
Interessenverflechtung in und um Berlin sowie aufgrund der inzwischen wesentlich ausführlicheren<br />
Berichterstattung kaum einen verminderten Dokumentationsstand wünschen. Auch<br />
diesmal durch Bibliographie. Personen- und Sachregister vorzüglich erschlossen, bleiben die Chronikbände<br />
in ihrer gleichbleibend soliden Aufmachung ein unentbehrlicher Begleiter beim Gang durch<br />
die Berliner Nachkriegsgeschichte. Peter Letkemann<br />
490
Hagen Schulze: Otto Braun oder Preußens demokratische Sendung. Eine Biographie. Berlin: Propyläen<br />
1977. 1094 S.. Ln.. 68 DM.<br />
Wie wenig derjenige Preußen gerecht wird, der einseitige und klischeehafte Vorstellungen mit diesem<br />
historischen Phänomen verbindet, lehrt der Blick auf seine demokratisch-republikanische Phase.<br />
Gerade in den letzten zehn Jahren sind verstärkte Bemühungen erkennbar geworden, dieses bis<br />
dato recht unerforschte Problemfeld der preußisch-deutschen Geschichte einer Untersuchung zu unterziehen,<br />
wobei hier nur an die Arbeiten von Enno Eimers, Hans-Peter Ehni und Dieter Hertz-Eichenrode<br />
stellvertretend für andere erinnert werden soll; Studien, die allerdings nur wesentliche Abschnitte<br />
der Entwicklung betrachten, nicht aber das demokratische Preußen als Ganzes in den Griff zu bekommen<br />
versuchen. Eine Biographie des preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun blieb trotz dessen<br />
1939/40 erschienenem Memoirenwerk ein Desiderat der Forschung.<br />
Das Buch Hagen Schubes, im Wintersemester 1976/77 dem Fachbereich Philosophie der Universität<br />
Kiel als Habilitationsschrift vorgelegt, soll diese Lücke schließen. Der Verf. versucht in einer nicht<br />
auf das Biographische beschränkten Aufgabenstellung, seinem Gegenstand gerecht zu werden:<br />
Otto Braun als Person und zugleich das Preußen der relativ stabilen Koalitionsregierung der Weimarer<br />
Parteien, das schon den Zeitgenossen als „Bollwerk" der Demokratie gegen den totalitären Ansturm<br />
erschien, sollen in einer Synthese von Biographie des preußischen Sozialdemokraten und Ministerpräsidenten<br />
und sachbezogener Monographie über Preußen in der Weimarer Republik zugleich dargestellt<br />
und untersucht werden. Der Problematik der „politischen Biographie" ist sich Schulze dabei<br />
durchaus bewußt (S. 32 f.); er versucht den Unzulänglichkeiten einer biographisch-antiquarischen<br />
..Personenbeschreibung" zu entgehen, indem er neben dem handelnden Menschen das historischpolitisch-soziale<br />
Umfeld deutlich werden läßt. Die Jugend und die politischen Anfänge des 1872 in<br />
Königsberg/Pr. geborenen Otto Braun werden untersucht, seine Arbeit im Parteivorstand der SPD,<br />
seine Tätigkeit als Experte für Fragen der Volksernährung, als Landwirtschaftsminister, schließlich die<br />
Wahl zum Ministerpräsidenten und sein Wirken als „roter Zar von Preußen", der bemüht war, Preußen<br />
zur demokratischen Ordnungszelle des Reiches zu machen, seine immer aussichtsloseren Bemühungen,<br />
die preußische Position zu behaupten, der „Preußenschlag" des Reichskanzlers von Papen, die<br />
Arbeit im Exil und Brauns Kampf gegen das schablonenhafte Anti-Preußenbild, die letzten Jahre bis<br />
zum Tode 1955; die ostpreußische Agrarverfassung um 1900, die Flügel- und Richtungskämpfe in der<br />
SPD vor dem Ersten Weltkrieg, die unterschiedliche Entwicklung von Reich und Preußen nach 1918,<br />
die oft vom Nebeneinander zu einem Gegeneinander ausartende Beziehung der beiden deutschen<br />
Regierungen in der Wilhelmstraße, die Problematik von Einheitsstaat und preußischer Hegemonie,<br />
die in der heiß umkämpften „Reichsreform" nicht gelöst wurde, die inneren wirtschaftlichen und<br />
sozialen Belastungen Preußens in den Zwanziger Jahren (Osthilfe), die innenpolitische Lage bis 1933<br />
und schließlich die Hoffnungen und Pläne des demokratischen Deutschlands im Exil. Dies und vieles<br />
andere mehr untersucht der Verf. und breitet unveröffentlichtes und publiziertes Material in großer<br />
Fülle aus. Er macht es dem nicht mit den Problemen vertrauten Leser nicht immer leicht, die Hauptlinien<br />
der Entwicklung in der Masse der dargebotenen Fakten mit Deutlichkeit zu erkennen. Nicht<br />
ausgewertet wurde dagegen u.a. das Werk von Arnold Brecht, Föderalismus, Regionalismus und die<br />
Teilung Preußens, (deutsche Ausgabe) Bonn 1949, pbwohl gerade diese Studie des engen Mitarbeiters<br />
von Otto Braun für die Probleme der preußisch-deutschen Staatskonstruktion unter der Weimarer<br />
Reichsverfassung wesentliche systematische Erkenntnisse anbietet.<br />
Hagen Schulze gelingt es, die bisher noch nicht in diesem Maße erkannte Bedeutung Otto Brauns für<br />
die deutsche Politik in der Weimarer Republik deutlich werden zu lassen. Dabei scheut er vor neuen,<br />
von der älteren Literatur sichtbar abweichenden Beurteilungen nicht zurück. Dies gilt z.B. für die<br />
beachtenswerten Argumente zu dem Otto Braun u.a. von Karl Dietrich Bracher gemachten Vorwurf,<br />
dem Papenschen Staatsstreich vom 20. Juli 1932 nicht entschieden genug widerstanden und sich<br />
kampflos gefügt zu haben (S. 746 — 755). Die hier vorgebrachten Argumente scheinen dem Rezensenten<br />
durchaus zutreffend zu sein, wobei es an dieser Stelle erlaubt sein wird, zu der Frage des Kräfteverhältnisses<br />
auf die Ausführungen von H.-H. Liang in seiner Arbeit über die Berliner Polizei in der<br />
Weimarer Republik (deutsche Ausgabe, S. 60 — 67) ergänzend zu verweisen. Bei aller Sympathie des<br />
Verf. für Otto Braun, die in der Studie deutlich wird, hat er es aber gerade in den letzten Passagen<br />
seines Werkes verstanden, auch die Grenzen und Schwächen des letzten demokratischen preußischen<br />
Ministerpräsidenten deutlich werden zu lassen.<br />
Schubes Darstellung zeichnet sich durch Solidität der Informationen und Nüchternheit der Sprache<br />
aus. Der in der Zuverlässigkeit begründete Wen des Werkes wird auch durch einzelne problematische<br />
491
Stellen nicht in Frage gestellt. So wurde der Regierungsbezirk Allenstein nicht (S. 89) im Jahre 1908,<br />
sondern 1905 eingerichtet, der Einmarsch französischer und belgischer Truppen in das Ruhrgebiet<br />
fand nicht (S. 425) am 11. Januar 1922, sondern am 11. Januar 1923 statt, gegen die Parallelisierung<br />
der preußischen Innenpolitik unter dem „System Braun — Severing" mit Methoden der merkantilistischen<br />
Wirtschaftspolitik hat der Rezensent Bedenken (S. 578), mit den „Preußenwahlen vom 24. Mai<br />
1932" (S. 858) dürften die vom 24. April gemeint sein (vergl. S. 725).<br />
Der Gesamteindruck vom Werk Hagen Schubes kann dadurch nicht ernstlich geschmälert werden.<br />
Er hat es verstanden, ein Stück deutscher, preußischer und damit auch Berliner Geschichte zu beleuchten,<br />
wird doch häufig übersehen, daß unsere Stadt auch nach 1918 Hauptstadt im doppelten Sinne war.<br />
Die Masse des dargebotenen Materials und die Fülle der behandelten Aspekte werden jeder künftigen<br />
Darstellung des „demokratischen Preußen" wertvolle Anregungen geben. Wolfgang Neugebauer<br />
Airred Döblin: Ein Kerl muß eine Meinung haben. Berichte und Kritiken 1921 — 1924, 2. Aufl. Freiburg/Olten:<br />
Walter 1977. 287 S., brosch., 26,80 DM.<br />
** Alfred Döblin: Die Geschichte vom Franz Biberkopf. Hörspiel nach dem Roman „Berlin Alexanderplatz".<br />
Nachwort: Heinz Schwitzke. Stuttgart: Reclam 1976, brosch., 1,60 DM (Universal Bibliothek<br />
9810).<br />
tt 5<br />
" Klaus Schröter: Alfred Döblin. Reinbek: Rowohlt 1978. 158 S., m. Abb., brosch., 6,80 DM (Rowohlt<br />
Bild-Monographie Bd. 266).<br />
Zum „Döblin-Jahr" 1978 sind eine Anzahl bemerkenswerter Veröffentlichungen über Leben und<br />
Werk des Dichters erschienen. Noch bis Ende des Jahres ist im Schiller-Nationalmuseum eine Ausstellung<br />
zu sehen, die in Form und Anlage ihresgleichen sucht. Im Katalog zu dieser Gedächtnisausstellung<br />
(„Alfred Döblin 1878—1978") ist eindrucksvolles Photo- und Schriftenmaterial ausgebreitet<br />
worden.<br />
Seit geraumer Zeit erscheinen im Walter-Verlag Ölten und Freiburg im Breisgau ausgewählte Werke<br />
Döblins. Die durch Robert Minder noch vor Döbiins Tod in Angriff genommene kritische Mainzer<br />
Gesamtausgabe des Döblinschen Werkes konnte aufgrund des schwerverständlichen Starrsinns der<br />
Erben nicht realisiert werden. Es ist durch Minder überliefert, daß das Ehepaar Döblin noch in seinen<br />
letzten Tagen (Erna Döblin ging nach dem Tode ihres Mannes in den Freitod) schwer unter dieser<br />
Tatsache litt! In die „Auswahlausgabe" des Walter-Verlages gehört auch der erste hier anzuzeigende<br />
Titel: „Ein Kerl muß eine Meinung haben". Es handelt sich dabei um einen textgleichen (einschl. des<br />
Vorwortes von Manfred Bayer) Band, der zuvor im Henschelverlag Berlin/DDR erschienenen<br />
„Griffe ins Lebens, Berliner Theaterberichte 1921 — 1924". die der Verf. bereits in den „Mitteilungen",<br />
Jg. 72/1976, Heft 3, S. 193 f., rezensiert hat, so daß ein näheres Eingehen auf diese Veröffentlichung<br />
nicht erforderlich ist. Im Reclam-Verlag erschien das Hörspiel zum Roman „Berlin Alexanderplatz".<br />
Der Text war bereits in den „Materialien zu Alfred Döblin ,Berlin Alexanderplatz'". Suhrkamp<br />
Taschenbuch Nr. 268, S. 199 — 236 zugänglich, liegt aber nun zu einem sehr günstigen Preis separat<br />
vor. Heinz Schwitzke hat in einem kurzen Nachwort (S. 61 —68) dargelegt, wie die alten Plattensätze<br />
und Manuskripte der Ursendung vom 30. 9. 1930 („Berliner Funkstunde") überliefert wurden und<br />
welche Position Döblin selbst zum Hörspiel einnahm.<br />
Der Hörspieltext muß naturgemäß das breite Romangeschehen stark gerafft wiedergeben. Den Weg<br />
der Läuterung, den Franz Biberkopf seit seiner Entlassung aus Tegel beschreiten muß, zeigt das Hörspiel<br />
anhand der drei wesentlichen Stationen. Schon kurz nach seiner Entlassung spricht Biberkopf die<br />
zweideutigen Worte: „Wir sind ehrbare Leute, wir haben im Zuchthaus gesessen, vier Jahre, da haben<br />
wir was zugelernt" (S. 8). Aber bald schon läßt sich Franz mit der Reinhold-Bande ein. die ihn nach<br />
einem Einbruch unter den Lastwagen stößt, wobei er einen Arm verliert. Nochmals kommt er jetzt zu<br />
der Einsicht: „Bin mal so verrückt gewesen, hat n Vogel gehabt, Franz will anständig sein . . ." (S. 33).<br />
Trotzdem läßt er sich wieder mit Reinhold ein, der Biberkopfs Anhänglichkeit dadurch belohnt, daß er<br />
dessen Freundin Mieze bei einem Ausflug nach Freienwalde ermordet. Völlig gebrochen kann Franz<br />
nur noch jammern: „Mir haben sie furchtbar im Leben gepiesackt, mir haben sie betrogen, den Arm<br />
hab ick verloren, dann haben sie mir meine Mieze umgebracht" (S. 58). Zwischen die Dialoge der handelnden<br />
Personen ist eine warnende „Stimme" eingeschaltet, die im Gespräch mit „Hiob" das Geschehen<br />
um Franz Biberkopf symbolisch erläutert.<br />
492
Der bekannte Germanist Klaus Schröter legt im Bd. 266 der rowohlts monographien eine Arbeit über<br />
Döblin vor, die in ihrem wissenschaftlichen Niveau die meisten bei Rowohlt erschienenen Bildmonographien<br />
überragen dürfte. Schröter analysiert Döblins Werdegang im Rahmen der persönlichen<br />
Entwicklung des Dichters, bettet ihn aber gleichzeitig in die zeitgeschichtlichen Strömungen der jeweils<br />
behandelten Jahre ein, so daß ein äußerst komplexes Bild des Arztes, Schriftstellers, Emigranten und<br />
Familienvaters Döblin entfaltet werden kann. Mit Kritik spart Schröter nicht, wenn er Döblins „Kleinbürgertum"<br />
anprangert oder dessen Haltung gegenüber Thomas Mann analysiert. So ist Schröter<br />
Döblins Tätigkeit als Kulturoffizier im Solde der Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg schlicht nicht<br />
mehr verständlich: „Schließlich fehlt eine Groteske in diesem traurigen Abgesang nicht. Der Künstler<br />
der Montagetechnik bevorzugte es, bei öffentlichen Veranstaltungen militärische Montur anzulegen.<br />
So trat der kleine Mann (160 Zentimeter groß) bei Vorträgen in Baden-Baden, Mainz, Wiesbaden und<br />
auch in Berlin in der Uniform eines französischen Obersten vor seine geschlagenen Landsleute. Wem<br />
andere Widersprüche Döblins unverständlich oder auch nur fremd geblieben waren, mußte diese<br />
letzte Adaption des Kleinbürgers an eine Macht den tiefsten Argwohn wecken" (S. 132). Der Widerspruch<br />
zu Schröters Ausführungen wird sicher nicht lange auf sich warten lassen. Auf der diesjährigen<br />
Frühjahrsveranstaltung der Berliner Akademie der Künste ist ein enger Vertrauter Döblins, Robert<br />
Minder, der „Kleinbürger-These" Schröters bereits entgegengetreten. Hans Jürgen Meinik<br />
Weitere Literatur zu diesem Thema auf Seite 498.<br />
Paul Dehnert: Daniel Chodowiecki. Berlin: Rembrandt-Verlag 1977. 79 S„ 72 Abb. auf 48 Taf.,<br />
Linson geb.. 29,80 DM.<br />
Wenn es im Klappentext des Buches heißt, es gebe zur Zeit keine Monographie über diesen populären<br />
Berliner Künstler auf dem Buchmarkt, so ist das nur zum Teil richtig. Seit vor genau 90 Jahren<br />
Ferdinand Meyer, damals Hauptschriftwart unseres Vereins, die erste volkstümliche Biographie über<br />
den „Peintre-graveur" herausbrachte (einige Werkmonographien sind noch wesentlich älter), ist der<br />
Strom der Veröffentlichungen zu Leben und Werk Chodowieckis bis in unsere Tage nicht abgerissen.<br />
Einige dieser Schriften sind auch heute noch wohlfeil in Antiquariaten zu bekommen, und sie erfüllen<br />
auch in den kritischen Augen zeitgenössischer Kunstkenner durchaus ihren Zweck. Denn eines ist<br />
sicher - und das zeigt das vorliegende Werk ebenfalls -: Es gibt kaum eine Einschränkung in der<br />
allgemeinen Wertschätzung, die dem Schaffen dieses Künstlers seit Generationen zuteil geworden ist.<br />
Gerade seine kleinformatige Graphik, die den Weg in viele Wohnstuben oder private Alben fand,<br />
konnte doch einen weit größeren Publikumskreis begeistern, als der Autor annimmt. Bei der Beurteilung<br />
Chodowieckis dürfte es nur noch um Nuancierungen gehen; neue Gesichtspunkte der künstlerischen<br />
Interpretation sind nicht zu erwarten.<br />
So resümiert dieses sehr sorgfältig zusammengestellte Buch die bekannten Tatsachen, beschreibt in<br />
großen Zügen den Werdegang und die handwerklich-künstlerische Entwicklung Chodowieckis, die<br />
schließlich in jene einzigartige Darstellungsweise des bürgerlichen Realismus auf der Zeitenwende<br />
einmündet. Zwischen Rokoko und Romantik stehend, überwand Chodowiecki in seinen Radierungen<br />
den teilweise pompösen und affektierten Stil vornehmlich der Franzosen und schuf erstmals eine<br />
natürliche, dem täglichen Leben und den bürgerlichen Umgangsformen entsprechende Ausdrucksweise.<br />
Neben historischen, moralisierenden oder auch humoristischen Szenen, hauptsächlich in Kalendern<br />
und Almanachen, hat dieser Meister der „kleinen Form" auch die bekanntesten Werke der<br />
zeitgenössischen Literatur ausgestattet und damit den Grund für das moderne illustrierte Buch gelegt.<br />
Mit seinen Arbeiten für die Dichter und Gelehrten der Epoche, von Lessing und Goethe bis zu<br />
Basedow und Lichtenberg, wurde er zum künstlerischen Interpreten der bürgerlichen Aufklärung in<br />
Deutschland.<br />
Dehnert schildert klar und leicht faßlich die Stadien dieser Entwicklung, unterstützt durch einen - zwei<br />
Drittel des Buches umfassenden - Bildteil. Hierbei reichen allerdings die Erläuterungen nicht immer<br />
für das Verständnis des Dargestellten aus. Im bibliographischen Anhang fehlen u.a. die Schrift von<br />
Johannes Jahn (Berlin-Ost 1954) sowie der Gedenkartikel von W. G. Oschilewski, der zum 250. Geburtstag<br />
Chodowieckis in Heft 4/1976 unserer „Mitteilungen" erschien. Auch dieses Buch von Paul<br />
Dehnert hätte man sich als würdigen Beitrag zum damaligen Jubiläum gewünscht. Peter Letkemann<br />
493
v ^ e s? "' Gustav Stresemann: Schriften, mit einem Vorwort von Willy Brandt, hrsg. v. Arnold Harttung. Berlin:<br />
Berlin Verlag Arno Spitz, 1976. XVI, 438 S., Ln., 38 DM.<br />
Die vorliegende, aus insgesamt 108 Stücken bestehende Sammlung ist deshalb wertvoll, weil einmal<br />
das dreibändige Stresemann-,,Vermächtnis", das 1932/33 erschien, heute zu einer antiquarischen<br />
Rarität geworden ist und zum anderen diese Schriftenauswahl ebenso wie die darauf fußende englische<br />
von 1935 ein recht einseitiges Stresemann-Bild vermitteln. Der Hrsg. hat dagegen seine Sammlung<br />
breiter angelegt und vor allem den Stresemann-Nachlaß, der sich unter den Akten des auswärtigen<br />
Amtes befand, 1945 von den Amerikanern beschlagnahmt und später an die Bundesrepublik zurückgegeben<br />
wurde, herangezogen. So konnte auch die Frühzeit Stresemanns stärker berücksichtigt werden.<br />
Ansonsten sind die Texte, obwohl chronologisch geordnet, des besseren Überblicks halber zu<br />
Sachgruppen zusammengefaßt. Die Orientierung wird außerdem durch das sorgfältige Personen- und<br />
Sachregister sowie durch ein biographisches Namensverzeichnis mit Kurzbiographien der wichtigsten<br />
Persönlichkeiten, mit denen Stresemann zu tun hatte, erleichtert. Leider erfährt man nicht, warum die<br />
ursprünglich vorgesehenen Nummern 106—110 und 113—114 entfallen sind (vermutlich handelt es<br />
sich um Nachrufe, für die die Druckgenehmigung verweigert wurde; unter den Würdigungen vermißt<br />
man im übrigen die sehr kritische von Theodor Heuss in seinen Erinnerungen, die - gewissermaßen als<br />
Kontrapunkt - die Sammlung hätte bereichern können). Insgesamt kann man aber die Auswahl -<br />
auch wenn sie kurz ausgefallen ist - nur begrüßen. Vor allem für den akademischen wie schulischen<br />
Unterricht dürfte sie wertvolle Dienste leisten. Michael Erbe<br />
Theodor Eschenburg/Ulrich Frank-Planitz: Gustav Stresemann. Eine Bildbiographie. Stuttgart:<br />
Deutsche Verlags-Anstalt 1978.168 S., Ln., 38 DM.<br />
Der Band besticht eher durch die gelungene Bildauswahl und die gediegene Ausstattung als durch<br />
seinen Inhalt, den Th. Eschenburg mit bewährtem Können, aber eben doch in der traditionellen Manier<br />
einer Stresemann-Verherrlichung und Würdigung als „großen Europäer" und Sucher des Ausgleichs<br />
mit Frankreich verfaßt hat. Insofern könnte das Buch vor 1960 geschrieben sein. Das Bildmaterial<br />
macht es indessen zu einem Werk von bleibendem Wert, da es U. Frank-Planitz gelungen ist, aus dem<br />
Besitz der Familie Stresemann und aus dem Bildarchiv des Auswärtigen Amtes eine Reihe bisher<br />
unbekannter Photographien zutage zu fördern. Sie illustrieren in reichhaltiger Weise das Leben,<br />
bilden so fast eine auf Stresemann bezogene Dokumentation eines ganzen Zeitalters. Ebenso gelungen<br />
sind etliche Skizzen (so S. 78 über die Wilhelmstraße und das Regierungsviertel) und Graphiken. Das<br />
Buch ist so geeignet, auch jüngeren Lesern einen lebendigen Eindruck von der Zeit zu vermitteln, in<br />
der das Kaiserreich zusammenbrach, die erste deutsche Demokratie errichtet wurde und in inneren<br />
Kämpfen unterzugehen begann. Wer sich künftig mit Stresemann beschäftigt, wird daher an dieser<br />
„Bildbiographie" nicht vorbeigehen können. Michael Erbe<br />
Karl Baedeker: Berlin-Spandau. Stadtführer. Freiburg: Baedeker 1977, 84 S., 10 Karten u. Pläne,<br />
30 Abb., brosch., 6,80 DM.<br />
Anders als die dickleibigen Reiseführer des Verlages, die für den Touristen bestimmt sind, haben die<br />
kleinen Stadtführer, die nun auch für mehrere Berliner Bezirke vorliegen, eine andere Aufgabe: Sie<br />
sollen die Vertrautheit der Bewohner des beschriebenen Bereiches mit ihrem Wohnort verbessern. So<br />
enthalten die „Stadtführer" nicht nur die besonderen Sehenswürdigkeiten, sondern geben eine Beschreibung<br />
der Stadt als Ganzes. Unter allen Bezirken von Berlin (West) dürfte Spandau mit seiner<br />
eigenen städtischen Tradition am besten für eine derartige Beschreibung geeignet sein. Unser Vereinsmitglied<br />
Jürgen Grothe, als Spandauer Lokalhistoriker bestens ausgewiesen, hat den Text des mit<br />
Karten und Skizzen gut ausgestatteten Bandes verfaßt, der ältere Stadtbeschreibungen, vor allem den<br />
Inventarband „Spandau" der Reihe der Bau- und Kunstdenkmäler von Berlin durch sachgerechte<br />
Korrekturen vielfach ersetzt. Manches freilich könnte auch in diesem Bändchen noch verbessert werden,<br />
angefangen bei einem Hinweis auf den seit 1952 bestehenden Kreis Nauen auf der Übersichtskarte<br />
(S. 6) bis hin zur Eintragung der Entlassungs- und Todesdaten sämtlicher bereits verstorbener<br />
Insassen des Kriegsverbrechergefängnisses (S. 55), doch sind dies nur kleine Veränderungen eines insgesamt<br />
gelungenen Bandes, dem man noch viele Auflagen wünschen kann. Felix Escher<br />
494
Eva u. Helmut Börsch-Supan, Günther Kühne, Hella Reelfs: Berlin. Kunstdenkmäler und Museen.<br />
Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1977. 800 S. mit 118 Abb., Plänen u. Übersichtskarten, Leinen,<br />
28,80 DM. (Reclam Kunstführer Deutschland VII.)<br />
Sehr schnell haben sich die Bände dieser Reihe unter der zahlreichen Konkurrenz eine hervorragende<br />
Stellung erworben. Dies gilt im besonderen Maße auch für den hier vorliegenden Band, dem ersten<br />
der allein den Kunstobjekten in den vielen Museen und den Kunstdenkmälem einer - unserer - Stadt<br />
gewidmet ist. Hier ist der besonderen Stellung Berlins als Museumsstadt und als Mittelpunkt intensiven<br />
Kunstschaffens u.a. dadurch Rechnung getragen worden, daß die einzelnen Museen mit ihren<br />
Exponaten und die über das ganze Stadtgebiet verteilten sonstigen bemerkenswerten Kunststätten<br />
jeweils mit ausführlichen Erklärungen dem Leser vorgestellt werden. So finden auch diejenigen, die<br />
meinen, Berlin zu kennen, viel Neues und Interessantes. Die Beschreibungen, nach Stadtbezirken sehr<br />
übersichtlich geordnet, bieten aber vor allem dem interessierten aber bislang nicht so sachkundigen<br />
Besucher eine sehr wertvolle Hilfe. Eine gute kunstgeschichtliche Einführung von Helmut Börsch-<br />
Supan, eine Zeittafel zur Geschichte Berlins, Literaturhinweise, Fachwort-Erläuterungen, Künstlerund<br />
Objektregister sowie Kartenskizzen und Abbildungen ergänzen den rundum gelungenen Band.<br />
Claus P. Mader<br />
Karl Friedrich Schinkel: Berlin, Bauten und Entwürfe. Ausgew., bearb. u. komment. v. Klaus J.<br />
Lemmer. Berlin: Rembrandt 1973, 88 S. 64 Abb., Ln., 38 DM.<br />
Karl Friedrich Schinkels großformatige „Sammlung architektonischer Entwürfe, enthaltend theils<br />
Werke welche ausgeführt sind, theils Gegenstände, deren Ausführung beabsichtigt wurde", Berlin<br />
1820—40 und 1858, dürfte heute fast ausschließlich noch in großen Fachbibliotheken zu finden sein.<br />
So gebührt dem Rembrandt Verlag ein Dank, zumindest einen Teil des bedeutenden Werkes wieder<br />
einem großen Publikum zugänglich gemacht zu haben. Im verkleinerten Maßstab wurde neben den<br />
schönen Bildtafeln auch der von dem großen preußischen Baukünstler verfaßte Text mit abgedruckt.<br />
Zu bedauern ist lediglich, daß, durch den geringen Buchumfang bedingt, nur eine subjektive Auswahl<br />
unter den vielen Berliner und Potsdamer Entwürfen getroffen werden konnte.<br />
Zu jedem Bauwerk hat der Bearbeiter den heutigen Zustand vermerkt - auch die würdelose Einfügung<br />
eines Portals der abgerissenen Bauakademie in den Eingang der Gaststätte „Schinkel-Klause".<br />
Die kleine Auswahl dürfte vor allem beim Leser den Wunsch wecken, das Originalwerk zu studieren.<br />
Felix Escher<br />
Ilse Nicolas: Berlin zwischen gestern und heute. Berlin: Hessling 1976. 111 S. mit Abb., Pappband,<br />
19,80 DM. (Berliner Kaleidoskop, Bd. 23.)<br />
Wanderungen durch historische Landschaften - was immer man darunter verstehen mag - gehören<br />
seit langem zum gängigen Repertoire geschichtlich ambitionierter Schriftsteller. Ihre Namen sind<br />
ebenso zahlreich wie die Themen ihrer ausgewählten Routen. Im großen Berlin findet sich immer ein<br />
Straßenzug, ein Viertel oder auch nur ein Winkel, dem mit Gespür für menschliche Schicksale und<br />
historische Abläufe nachzugehen lohnt. Es braucht ja nicht immer der große Wurf zu sein, mit dem<br />
z.B. Bogdan Krieger im Jahre 1923 in seinem Werk „Berlin im Wandel der Zeiten" der tragenden<br />
'Kulturachse' Berlin —Charlottenburg ein Denkmal setzte. Daß dazwischen noch ein weites Feld für<br />
die Kleinprosa übrig blieb, hat unser unvergessener Kurt Pomplun bis in die jüngste Vergangenheit<br />
unentwegt und meisterhaft bewiesen. Auch Ilse Nicolas ist vor Jahren die nicht minder erinnerungsträchtige<br />
Straße Berlin — Potsdam „Vom Potsdamer Platz zur Glienicker Brücke" mit lesenswertem<br />
Erfolg abgefahren.<br />
In ihrem neuesten Band führt sie den Leser zwanglos, aber faktenkundig durch die großen Straßen<br />
von heute und auch von einst: Kurfürstendamm, Bundesallee, Bendler- und Kochstraße, daneben das<br />
Kielgan-Viertel (wer kennt das noch?), die Genthiner Straße. Stadtlandschaft entfaltet sich, Ruinen<br />
und Kahlschlagviertel erwachen zum Leben, geben Verborgenes preis, erzählen von Häuser- und<br />
Menschenschicksalen. Neben die Erinnerung an die städtebaulichen Zeugen der Vergangenheit stellt<br />
die Autorin auch die aktuelle Bestandsaufnahme, so über die Situation der Kirchen an der Mauer,<br />
über die Klöster in Berlin, über Architekturdenkmale, Brücken usw. Sie zeigt sich ebenso engagiert<br />
wie einfühlsam; man läßt sich willig führen und freut sich an der gepflegten Diktion des Buches, die<br />
495
ohne Schnörkel und Abschweifungen stets dem Gegenstand verpflichtet bleibt. Ein Baedeker ohne<br />
Ausrufezeichen, der aber von der stillen Liebe zu unserer Stadt ebenso kündet wie von der schmerzhaften<br />
Erkenntnis der Vergänglichkeit aller Dinge. Peter Letkemann<br />
Winfried Löschburg: Ohne Glanz und Gloria. Die Geschichte des Hauptmanns von Köpenick. Berlin<br />
(Ost): Der Morgen 1978. 343 S., 80 Abb., Ln., 13,50 M.<br />
Die überquellende Komik des „Hauptmanns" ist in diesem Buch mit großem Fleiß aus Akten und<br />
Zeitungen der Archive zusammengetragen worden, als spannender Krimi, Zitatenschatz, Dokumentation<br />
über ein Berliner Original, Schmunzellektüre, Fall für die Psychoanalyse, selbst durch die Vorurteile<br />
und Ritualisierungen in unserer gespaltenen Stadt hindurch faßbar und vielschichtig durchschaubar.<br />
Im Anfang war der Vorsatz, Tat und Person des Maschinisten (Schuhmachers) Wilhelm Voigt von<br />
dichterischen Freiheiten, von Legenden und Widersprüchen zu reinigen, ihren historischen Kern aufzudecken.<br />
Nun haben wir das Lebensbild eines kleinen Gauners, so nuancenreich, so umfassend, daß<br />
es wohl nicht mehr wesentlich vervollständigt werden kann. Jetzt haben wir aber auch ein transparentes<br />
Zeitdokument, wie rührselig, extatisch, politisch, geschäftlich ein kalt rechnender Spitzbube zum<br />
international gefragten Star, Amerika-Reisenden, Haus- und Auto-Besitzer (um 1910!) mit Adjutant<br />
(der ihm zum Autogramm den Federhalter reicht) aufsteigt. Eine solche archivalische Paradeleistung<br />
mit zahlreichen Verweisen auf das 19 Seiten umfassende Quellenverzeichnis wirkt als Stimulanz: Der<br />
Leser möchte auch über Rechte und Pflichten des Militärs in den einschlägigen Gesetzen nachlesen,<br />
über die Abgrenzung zwischen Zivil- und Militär-Gerichtsbarkeit in der Kabinetts-Ordre vom 3. 4.<br />
1845, über das Beschwerderecht der Soldaten in den Kriegsartikeln vom 31. 10. 1872 mit Erläuterungen<br />
und Beispielen, deren achtzehnter ferner das Schießverbot gegen Wehrlose formuliert, auf das die<br />
Germania vom 18. 10. 1906 mit ihren „Schießautomaten" anspielt (S. 123).<br />
Diese Texte würden den Rahmen eines so handlichen und sehr flüssig zu lesenden Buches jedoch<br />
sprengen. Der Leser wird dagegen fündig im schillernden Witz, dem Ideenreichtum, der Schlagfertigkeit<br />
und der Vielseitigkeit des Spitzbuben sowie der sachlichen und sehr subtilen Darstellung des<br />
Autors, die etwa die Paß-Frage aus der dramatischen Fabel Zuckmayers auf einen bloßen Geistesblitz<br />
reduziert. Es geht auf und ab - Schlag auf Schlag - wie im historischen Ablauf. Tat: 16. 10. 1906,<br />
Ergreifung: 26. 10., Verhandlung, verurteilt zu 4 Jahren Gefängnis: 1. 12. 1906, Gnadenerweis seiner<br />
Majestät des Kaisers: 15. 8. 1908, Vortragsreisen, Ehrengast, fast ehrbarer Bürger; Tod im 73. Lebensjahr:<br />
3. 1. 1922. J- Schlenk<br />
Robinson: Berlin wie ich es liebe. Texte v. Kurt Pomplun. Berlin: A. u. E. Freund Verlag, 1976.<br />
48 S. m. färb. Zeichnungen, geb., 24 DM.<br />
Robinson hat sich mit seinen Zeichnungen, die zum Teil auch als einzelne Kunstblätter bezogen werden<br />
können, in Berlin einen Namen gemacht. Seiner Feder liegen die geschwungenen Formen von Bauwerken<br />
vergangener Jahrhunderte und ihres zweiten Aufgusses im Zeitalter des Historismus mehr als<br />
die glatten Fassaden unseres Säkulums. Curth Flatow springt Robinson und Pomplun in seinem<br />
Vorwort bei, wenn er doppeldeutig schreibt: Das sinnlose Abreißen sollten wir nicht einreißen lassen!<br />
Es gab oft keinen Grund dafür als den Preis des Grundes. Schöne Altbauten, Zeugen der Vergangenheit,<br />
gibt es nur noch wenige in Berlin. Robinson hat sie mit der Feder festgehalten. Erhalten müssen<br />
wir sie selbst!<br />
Quer durch den Westteil unserer Stadt hat Robinson eine Anzahl bekannter und weniger bekannter<br />
Bauwerke entdeckt und sie mit ihrer Frontalansicht, aber auch in architektonischen Details für festhaltenswert<br />
gehalten, von Riehmers Hofgarten über das Rathaus Reinickendorf, das Postamt Hauptstraße,<br />
das „Idunahaus" bis zum U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof und zur Carl-Schurz-Straße. Neben<br />
Theken und Rotunden werden auch so hehre Gebäude wie das Schloß Charlottenburg und der<br />
Reichstag festgehalten, teils in kolorierten Zeichnungen. Kurt Pomplun hat den wie stets zuverlässigen<br />
Text beigesteuert und erweitert mit seinen Worten den Kreis der im Bild festgehaltenen Dinge, wenn<br />
er etwa die Apotheken aufzählt, deren Inneneinrichtung noch der Entstehungszeit entspricht, und mit<br />
vollem Recht behauptet, zu den Hütern alter Tradition gehören in erster Linie die Apotheker.<br />
H. G. Schutze- Berndt<br />
496
Schöneberg - eine Gegend in Berlin. Fotos, Texte, Gestaltung: Werner Bethsold. Berlin: Werner<br />
Bethsold Verlag, 1977.130 S., brosch., 25 DM.<br />
Bei der Besprechung eines derartigen Fotobandes (121 Seiten sind Abbildungen) über einen bestimmten<br />
Bezirk ergibt sich die Frage, ob man nun einen Foto-Profi oder einen Beruis-Schöneberger als<br />
Rezensenten heranziehen soll oder ob es ein Amateurfotograf mit gesundem Menschenverstand auch<br />
tut. Dieser müßte dem Verfasser und Herausgeber des Buches bestätigen, daß er auch ungewöhnliche<br />
Aufnahmen seines Heimatbezirks geschossen hat - gelegentliche Unscharfen sind dann sicher<br />
ein künstlerisches Attribut. Bezirksbürgermeister W. Kabus, der dieses Buch auch gefördert hat,<br />
steuert ein Vorwort bei. In der üblichen Weise ist den ganzseitigen Abbildungen ein Verzeichnis nachgestellt.<br />
Ob Friedenau nicht vielleicht etwas „unterrepräsentiert" ist und ob Günter Grass nicht<br />
ebensoviel Recht auf Berücksichtigung gehabt hätte wie Friedrich Luft, sind eigentlich nur Randfragen<br />
bei der Durchsicht eines Bildbandes, der nicht nur allen Schönebergern seiner bunten<br />
Mischung und lebensnahen Fotos wegen Freude machen wird. H. G. Schultze-Berndt<br />
Ludwig Jungmann (Hrsg.): Berliner Gassenhauer-Büchlein. Die schönsten Berliner Volks-, Spottund<br />
Scherzlieder für Singstimme, Melodieinstrument (Blockflöte) und Gitarrenbegleitung. Wilhelmshaven:<br />
Heinrichshofen's Verlag 1977. Linolschnitte von Jutta Lamprecht, 32 S., brosch., 2,50 DM.<br />
Eine Gruppe Berliner Studenten war vor einiger Zeit bei einer Exkursion in einer Mälzerei im<br />
nordschleswigschen Hadersleben eingekehrt und wurde dort so herzlich empfangen wie fürstlich bewirtet.<br />
In der Erinnerung an die in Berlin verbrachten schönen Stunden bat der Seniorchef, man möge<br />
ihm zum Dank ein echtes Berliner Lied singen, etwa dasjenige mit dem Refrain „. .. immer an der<br />
Wand lang". Was würde der Rezensent darum gegeben haben, hätte ihm damals ein Berliner Gassenhauer-Büchlein<br />
zur Verfügung gestanden - und was gäbe er darum, enthielte die hier anzuzeigende<br />
Broschüre auch noch dieses Lied! Rund zwanzig Lieder werden mit Noten und Text vorgestellt, von<br />
„Auf einem Omnibus" bis „Wir gehn nach Friedenau" und „Wir sind Berliner Bummler". Aber<br />
auch Fritze Bollmann, der treue Husar und die Kuchenfrau vom Friedrichshaine sind vertreten.<br />
Mehr kann man vorerst fürs Geld nicht verlangen. Vielleicht hat einmal jemand den Mut und bringt<br />
ein vollständiges Berliner Liederbuch auf den Markt. H. C. Schultze-Berndt<br />
*<br />
Unser diesjähriges Jahrbuch „Der Bär von Berlin" wird z.Z. an die Mitglieder, die den fälligen<br />
Mitgliedsbeitrag von 36 DM gezahlt haben, ausgeliefert. Zusatzbände können bei der Geschäftsstelle<br />
des Vereins: Albert Brauer, Blissestraße 27, 1000 Berlin 31, zum Ladenpreis von 22,80 DM (zuziigl.<br />
Porto) bestellt werden.<br />
497
In der Vereinsbibliothek ist noch nachfolgende Literatur zu Heinrich von Kleist<br />
und Alfred Döblin eingegangen.<br />
Helmut Sembdner (Hrsg.): Heinrich von Kleists Nachruhm. Eine Wirkungsgeschichte in Dokumenten.<br />
München: dtv (wiss. Reihe) 1977. Brosch., 14,80 DM.<br />
Ders.: Geschichte meiner Seele. Das Lebenszeugnis der Briefe. Frankfurt/M.: Insel 1977. Brosch..<br />
9 DM.<br />
Klaus Kanzog: Heinrich von Kleist. Prinz Friedrich von Homburg. Text, Kontexte, Kommentar. München/Wien:<br />
Hanser 1977. Brosch., 14,80 DM. (Reihe: Hanser Literatur Kommentare.)<br />
Günter Blöcker: Heinrich von Kleist oder Das absolute Ich. Frankfurt/M.: Fischer 1977. Brosch.,<br />
5,80 DM.<br />
Klaus Birkenhauer: Kleist. Tübingen: Wunderlich 1977. 288 S., Ln., 29,80 DM.<br />
Joachim Maass: Kleist. Die Geschichte seines Lebens. Bern/München: Scherz 1977. 416 S., Ln.,<br />
29,50 DM.<br />
(Siehe auch in „Mitteilungen", Hefte 1 und 2, 1978.)<br />
Alfred Döblin: November 1918. Eine deutsche Revolution. München: dtv 1978. 4 Bände (Nr. 1389),<br />
brosch., 49 DM.<br />
Adalbert Wiehert: Alfred Döblins historisches Denken. Geleitwort v. Walter Müller-Seidel. Stuttgart:<br />
Metzlersche Verlagsbuchhdlg., Pöschel Verlag 1978. 320 S., geb. 55 DM.<br />
Alfred Döblin: Pardon wird nicht gegeben. Reinbek: Rowohlt 1978. Brosch. 6,80 DM. (Band:<br />
rororo 4243.)<br />
Die Redaktion behält sich eine ausführliche Besprechung vor.<br />
Mit dem vorliegenden Heft ist wiederum ein Zyklus von 4 Jahrgängen abgeschlossen. Ein ausführliches<br />
Inhaltsverzeichnis folgt voraussichtlich mit Heft 1 im Januar 1979.<br />
Im III. Vierteljahr 1978<br />
haben sich folgende Damen und Herren zur Aufnahme gemeldet:<br />
Peter Grohn, Selbst. Handelsvertreter<br />
1000 Berlin 42, Blumenthaistraße 22<br />
Tel. 7 06 10 49 (Bibliothek)<br />
Sigrid Gülzow, Med.-techn. Assistentin<br />
1000 Berlin 19, Reichssportfeldstraße 16/634<br />
Tel. 3 04 71 79 (Ingetraut Müller)<br />
Marga Kaesberg, Techn. Zeichnerin<br />
1000 Berlin 42, Dardanellenweg 47<br />
Tel. 7 03 11 61 (Ellen Wiegand)<br />
Heinrich Kühn, Oberstud.-Direktor<br />
1000 Berlin 41, Cranachstraße 38<br />
Tel. 8 55 43 01 (Irmtraut Köhler)<br />
Peter Mertin, Verwaltungsangestellter<br />
1000 Berlin 38, Kaiserstuhlstraße 4<br />
Tel. 8 02 68 70 (Rosemarie Seidel)<br />
Gerhard Meyer, Senator für Justiz<br />
1000 Berlin 62, Salzburger Straße 21 - 25<br />
Tel. 7 83 32 24 (Dr. Schultze-Berndt)<br />
Gertraud Polke<br />
1000 Berlin 38, Nickisch-Rosenegk-Straße 5<br />
Tel. 8 03 67 67 (Ruth Koepke)<br />
498<br />
Hanna Riemer, Kinderkrankenschwester<br />
1000 Berlin 12, Niebuhrstraße 65<br />
Tel. 3 24 26 80 (Bibliothek)<br />
Margot Schütze<br />
1000 Berlin 19, Heerstraße 8<br />
Tel. 3 02 24 08 (Brauer)<br />
Karin Schwinge. Industriekaufmann<br />
4300 Essen 1, Herwarthstraße 43<br />
Tel. (02 01) 27 72 20 (Brauer)<br />
Käthe Dietrich, Übersetzerin<br />
1000 Berlin 45, Hortensienstraße 47<br />
Tel. 8 34 61 73 (Frieda Senger)<br />
Maria Brader, Hausfrau<br />
1000 Berlin 15, Lietzenburger Straße 94<br />
Tel. 8 81 17 57 (Ellen Wiegand)<br />
Rolf Otto, Sicherheitsingenieur<br />
1000 Berlin 20, Eisgrabenweg 8<br />
Tel. 3 32 13 40 (Arne Hengsbach)
Die Veröffentlichungen des Vereins<br />
Von den früheren Ausgaben des Jahrbuchs<br />
DER BÄR VON BERLIN<br />
sind folgende Bände noch erhältlich:<br />
1957/58 und 1960 je 4,80 DM; 1961 bis 1964 je 5,80 DM; 1965 (Festschrift)<br />
38- DM; 1968 und 1969 je 9,80 DM; 1971 und 1972 je 11,80 DM; 1973 bis<br />
1975 je 12,80 DM; 1976 und 1977 je 18,50 DM; 1978 = 22,80 DM.<br />
MITTEILUNGEN<br />
des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
erscheinen vierteljährlich im Umfang von 32 Seiten. Sie enthalten in der<br />
Regel mehrere Artikel mit Themen zur Berliner Geschichte (mit Abbildungen),<br />
Nachrichten zu aktuellen Anlässen und aus dem Vereinsleben,<br />
Buchbesprechungen und das Programm der laufenden Veranstaltungen<br />
des Vereins.<br />
Einzelhefte aus früheren Jahrgängen sind zum Stückpreis von 4,- DM<br />
noch erhältlich.<br />
Von der neuen Folge der<br />
Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins<br />
sind bisher erschienen:<br />
Heft 59: Johann David Müller, Notizen aus meinem Leben (1973)<br />
Preis 9,80 DM<br />
Heft 60: W. M. Frhr. v. Bissing, Königin Elisabeth von Preußen. (1974)<br />
Preis 11,80 DM<br />
Heft 61: Wolfgang Ribbe, Quellen und Historiographie zur mittelalterlichen<br />
Geschichte von Berlin-Brandenburg. (1977)<br />
Konrad Kettig, Goetheverehrung in Berlin. Ein Besuch von<br />
August und Ottilie von Goethe in der preußischen Residenz1819.<br />
(1977) Preis 16,80 DM<br />
Alle Preise zuzüglich Porto<br />
Bestellungen sind an die Geschäftsstelle des Vereins zu richten:<br />
Albert Brauer, Blissestraße 27,1000 Berlin 31
Veranstaltungen im IV. Quartal 1978<br />
1. Sonntag, 22. Oktober 1978, 10 Uhr: „Die Spandauer Altstadt, Veränderungen im Stadtbild'".<br />
Führung: Jürgen Grothe. Treffpunkt: Portal der Nikolaikirche, Carl-Schurz-<br />
Straße.<br />
2. Sonnabend, 28. Oktober 1978, 10 Uhr: Besichtigung von Schloß Köpenick mit Kapelle.<br />
Bericht des Restaurators, Herrn Manfred Becker, über die Wiederherstellung des<br />
großen Berliner Kabinett-Schranks 1779 von David Roentgen. Vortrag über die<br />
Geschichte von Schloß und Sammlungen sowie Führung durch Herrn Direktor<br />
Dr. phil. Günter Schade.<br />
(S-Banhof Spindlersfeld, Ostkreuz in Fahrtrichtung umsteigen, ab Friedrichstraße<br />
40 min, Zugabstand 20 min - Antrag auf Gewährung eines Berechtigungsscheines für<br />
Berlin, Übergang Friedrichstraße für Fußgänger, in einem Büro für Besuchs- und Reiseangelegenheiten<br />
bis zum 20. Oktober 1978 stellen- Umlage: 2 DM.)<br />
3. Dienstag, 31. Oktober 1978, 19.30 Uhr: „Zur Geschichte der wissenschaftlichen Einrichtungen<br />
in Dahlem". Vortrag mit Lichtbildern von Dr. Michael Engel. Filmsaal des<br />
Rathauses Charlottenburg.<br />
4. Dienstag, 7. November 1978, 19.30 Uhr: Lesung aus dem 7. Band der „Wanderungen<br />
und Fahrten durch die Mark Brandenburg'" von Hans Scholz. Filmsaal des Rathauses<br />
Charlottenburg.<br />
5. Dienstag, 21. November 1978, 19.30 Uhr: „Kaleidoskop der Erinnerungen an das<br />
alte Berlin". Filme über Berlin, vorgeführt von Rolf Rothe. Filmsaal des Rathauses<br />
Charlottenburg.<br />
6. Dienstag, 5. Dezember 1978, 19.30 Uhr: „Friedrich der Große und die Müller-Arnold-<br />
Prozesse". Vortrag von Dr. Otto Uhlitz. Filmsaal des Rathauses Charlottenburg.<br />
7. Sonnabend, 16. Dezember 1978, 15.30 Uhr: Vorweihnachtliches Treffen mit „Weihnachtlicher<br />
Orgelmusik" in der Dorfkirche Gatow. Leitung: Kantor Wolfgang Wedel.<br />
Anschließend Beisammensein in der „Kajüte", Alt-Gatow 23. Fahrverbindung: Busse 34<br />
und 35.<br />
Zu den Vorträgen im Rathaus Charlottenburg und zum Orgelkonzert sind Gäste willkommen.<br />
Die Bibliothek ist vor den Vorträgen jeweils eine halbe Stunde zusätzlich geöffnet.<br />
Freitag, 27. Oktober, 24. November und 15. Dezember, ab 17 Uhr: Zwangloses Treffen<br />
in der Vereinsbibliothek im Rathaus Charlottenburg.<br />
Vorsitzender: Dr. Gerhard Kutzsch, Landesarchiv, 1000 Berlin 30, Kalckreuthstraße 1—2 (Ecke<br />
Kleiststraße). Geschäftsstelle: Albert Brauer, 1000 Berlin 31, Blissestraße 27, Ruf 8 53 49 16.<br />
Schriftführer: Dr. H. G. Schultze-Berndt, 1000 Berlin 65, Seestraße 13, Ruf 45 30 11. Schatzmeister:<br />
Ruth Koepke, 1000 Berlin 61, Mehringdamm 89, Ruf 6 93 67 91. Postscheckkonto des Vereins:<br />
Berlin West 433 80-102, 1000 Berlin 21. Bankkonto: 038 180 1200 bei der Berliner Bank,<br />
1000 Berlin 19, Kaiserdamm 95.<br />
Bibliothek: 1000 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus), Telefon 34 10 01, App. 2 34. Geöffnet:<br />
freitags 16 bis 19.30 Uhr.<br />
Die Mitteilungen erscheinen vierteljährlich. Herausgeber: Verein für die Geschichte Berlins,<br />
gegr. 1865. Schriftleitung: Claus P. Mader, 1000 Berlin 41, Bismarckstraße 12; Felix Escher, Wolfgang<br />
Neugebauer.<br />
Abonnementspreis ist durch den Mitgliedsbeitrag gedeckt. Bezugspreis für Nichtmitglieder 16 DM<br />
jährlich.<br />
Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1000 Berlin 49.<br />
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung.<br />
500<br />
•