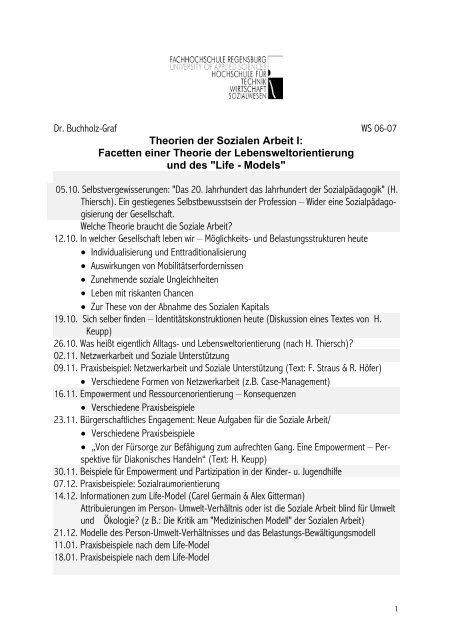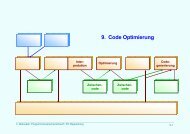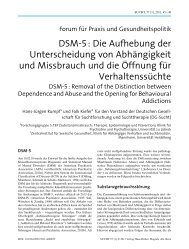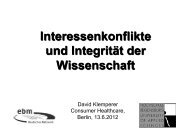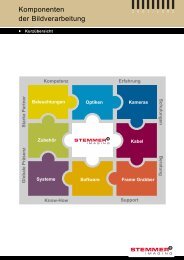Facetten einer Theorie der Lebensweltorientierung und des
Facetten einer Theorie der Lebensweltorientierung und des
Facetten einer Theorie der Lebensweltorientierung und des
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dr. Buchholz-Graf WS 06-07<br />
<strong>Theorie</strong>n <strong>der</strong> Sozialen Arbeit I:<br />
<strong>Facetten</strong> <strong>einer</strong> <strong>Theorie</strong> <strong>der</strong> <strong>Lebensweltorientierung</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong> "Life - Models"<br />
05.10. Selbstvergewisserungen: "Das 20. Jahrhun<strong>der</strong>t das Jahrhun<strong>der</strong>t <strong>der</strong> Sozialpädagogik" (H.<br />
Thiersch). Ein gestiegenes Selbstbewusstsein <strong>der</strong> Profession – Wi<strong>der</strong> eine Sozialpädagogisierung<br />
<strong>der</strong> Gesellschaft.<br />
Welche <strong>Theorie</strong> braucht die Soziale Arbeit?<br />
12.10. In welcher Gesellschaft leben wir – Möglichkeits- <strong>und</strong> Belastungsstrukturen heute<br />
• Individualisierung <strong>und</strong> Enttraditionalisierung<br />
• Auswirkungen von Mobilitätserfor<strong>der</strong>nissen<br />
• Zunehmende soziale Ungleichheiten<br />
• Leben mit riskanten Chancen<br />
• Zur These von <strong>der</strong> Abnahme <strong>des</strong> Sozialen Kapitals<br />
19.10. Sich selber finden – Identitätskonstruktionen heute (Diskussion eines Textes von H.<br />
Keupp)<br />
26.10. Was heißt eigentlich Alltags- <strong>und</strong> <strong>Lebensweltorientierung</strong> (nach H. Thiersch)?<br />
02.11. Netzwerkarbeit <strong>und</strong> Soziale Unterstützung<br />
09.11. Praxisbeispiel: Netzwerkarbeit <strong>und</strong> Soziale Unterstützung (Text: F. Straus & R. Höfer)<br />
• Verschiedene Formen von Netzwerkarbeit (z.B. Case-Management)<br />
16.11. Empowerment <strong>und</strong> Ressourcenorientierung – Konsequenzen<br />
• Verschiedene Praxisbeispiele<br />
23.11. Bürgerschaftliches Engagement: Neue Aufgaben für die Soziale Arbeit/<br />
• Verschiedene Praxisbeispiele<br />
• „Von <strong>der</strong> Fürsorge zur Befähigung zum aufrechten Gang. Eine Empowerment – Perspektive<br />
für Diakonisches Handeln“ (Text: H. Keupp)<br />
30.11. Beispiele für Empowerment <strong>und</strong> Partizipation in <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- u. Jugendhilfe<br />
07.12. Praxisbeispiele: Sozialraumorientierung<br />
14.12. Informationen zum Life-Model (Carel Germain & Alex Gitterman)<br />
Attribuierungen im Person- Umwelt-Verhältnis o<strong>der</strong> ist die Soziale Arbeit blind für Umwelt<br />
<strong>und</strong> Ökologie? (z B.: Die Kritik am "Medizinischen Modell" <strong>der</strong> Sozialen Arbeit)<br />
21.12. Modelle <strong>des</strong> Person-Umwelt-Verhältnisses <strong>und</strong> das Belastungs-Bewältigungsmodell<br />
11.01. Praxisbeispiele nach dem Life-Model<br />
18.01. Praxisbeispiele nach dem Life-Model<br />
1
Dr. Buchholz-Graf WS 06-07<br />
<strong>Theorie</strong>n <strong>der</strong> Sozialen Arbeit I:<br />
<strong>Facetten</strong> <strong>einer</strong> <strong>Theorie</strong> <strong>der</strong> <strong>Lebensweltorientierung</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong> "Life - Models"<br />
Literatur<br />
Buchholz-Graf, W. (2001). Empowerment <strong>und</strong> Ressourcenorientierung in <strong>der</strong> Sozialen<br />
Arbeit. In. Max Kreuzer (Hg.). Handlungsmodelle in <strong>der</strong> Familienhilfe. Neuwied:<br />
Luchterhand, 85-110<br />
Germain, Carol & Gitterman, Alex (1999). Praktische Sozialarbeit. Das „Life Model“<br />
<strong>der</strong> Sozialen Arbeit. Fortschritte in <strong>Theorie</strong> <strong>und</strong> Praxis. Stuttgart: Enke<br />
Grunwald, Klaus & Thiersch, Hans (Hg.). (2004). Praxis Lebensweltorientierter Sozialer<br />
Arbeit. Weinheim/ München: Juventa<br />
Keupp, H<strong>einer</strong> (2004). Sich selber finden – Erziehungsberatung in <strong>einer</strong> Gesell-<br />
schafft <strong>des</strong> Umbruchs. Vortrag im Rahmen <strong>der</strong> Jubiläumsveranstaltung <strong>der</strong> Beratungsstelle<br />
Düsseldorf-Eller am 09.09.2005.<br />
Keupp, H<strong>einer</strong> (2006). Von <strong>der</strong> Fürsorge zur Befähigung zum aufrechten Gang –<br />
Eine Empowerment – Perspektive für Diakonisches Handeln. Vortrag bei <strong>der</strong> Lan<strong>des</strong>synode<br />
<strong>der</strong> evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern am 28.03.2006<br />
Rauschenbach, T. & Züchner, I. (2002). <strong>Theorie</strong> <strong>der</strong> Sozialen Arbeit. In. Thole,<br />
Werner (Hg.) (2002). Gr<strong>und</strong>riss Soziale Arbeit. Opladen: Leske + Budrich, 139-160<br />
Straus, Florian & Höfer, Renate (1998). Die Netzwerkperspektive in <strong>der</strong> Praxis. In.<br />
Bernd Röhrle u.a. (Hg.). Netzwerkintervention. Tübingen: DGVT-Verlag, S. 77-98<br />
Thiersch, Hans u.a. (2002). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Thole, Werner<br />
(Hg.) (2002). Gr<strong>und</strong>riss Soziale Arbeit. Opladen: Leske + Budrich, 161-178<br />
Thole, Werner (Hg.) (2002). Gr<strong>und</strong>riss Soziale Arbeit. Opladen: Leske + Budrich<br />
2
<strong>Theorie</strong> <strong>der</strong> Soziale Arbeit<br />
- Einführung -<br />
• Ein Fazit, über das sich die Fachleute einig sind, vorweg: Eine, o<strong>der</strong> gar die <strong>Theorie</strong><br />
<strong>der</strong> Sozialen Arbeit gibt es nicht.<br />
• Wenn wir über <strong>Theorie</strong>n <strong>und</strong> Soziale Arbeit sprechen, dann sind nicht <strong>Theorie</strong>n<br />
aus an<strong>der</strong>en Disziplinen wie <strong>der</strong> Soziologie (z.B. labeling-Ansatz o<strong>der</strong> Etikettierungstheorie,<br />
Rollentheorie, symbolischer Interaktionismus) o<strong>der</strong> aus <strong>der</strong> Psychologie<br />
(z.B. Lerntheorien, Verhaltenstheorie, Psychoanalyse Familientherapie) gemeint,<br />
son<strong>der</strong>n eine <strong>Theorie</strong>bildung die sich auf die Soziale Arbeit selber bezieht<br />
<strong>und</strong> sich aus <strong>der</strong> Sozialen Arbeit entwickelt.<br />
• Die Disziplin Soziale Arbeit hat nicht nur keine „eigene“ <strong>Theorie</strong>, son<strong>der</strong>n es ist<br />
noch nicht einmal geklärt, wann etwas als <strong>Theorie</strong> zu gelten hat. Thomas Rauschenbach:<br />
„Schaut man... das Material, die Textsorten <strong>und</strong> Ansätze, die als<br />
„<strong>Theorie</strong>“ gehandelt o<strong>der</strong> bezeichnet werden einmal genauer, dann verschwimmen<br />
einem rasch die Konturen <strong>des</strong>sen, was <strong>Theorie</strong> überhaupt ist o<strong>der</strong> wenigstens<br />
sein könnte... Ungeklärt ist beispielsweise, ob es sich im Falle von <strong>Theorie</strong>n<br />
lediglich um ein diffuses Gegenüber zur Praxis handelt – <strong>und</strong> in diesem Sinne<br />
dann mehr o<strong>der</strong> weniger alles zu <strong>Theorie</strong> wird...“ (2002, 139)<br />
Wie sollen wir unterscheiden zwischen <strong>Theorie</strong>n <strong>und</strong> Ideen, zwischen <strong>Theorie</strong><br />
<strong>und</strong> Konzept o<strong>der</strong> <strong>Theorie</strong> <strong>und</strong> Methode?<br />
• Schon bei <strong>der</strong> begrifflichen Rahmung beginnen die Schwierigkeiten: Die Begriffe<br />
Sozialpädagogik <strong>und</strong> Sozialarbeit machen die Probleme <strong>einer</strong> klaren <strong>und</strong> eindeutigen<br />
Begriffsbildung deutlich. Erinnern wir uns an die Traditionslinien sozialer Arbeit!<br />
- Sozialpädagogik (z.B. Bäumer, Pestalozzi, Natorp <strong>und</strong> Nohl)<br />
- Fürsorgewissenschaft (z.B. Scherpner)<br />
- Social Work (Mary Richmond, Alice Salomon)<br />
Die Fürsorgewissenschaft, die sich in Deutschland entwickelt hat <strong>und</strong> das amerikanische<br />
social work kann man als Sozialarbeit zusammenfassen.<br />
Die Definition <strong>der</strong> Sozialpädagogik etwa nach Gertrud Bäumer lautet: “<br />
„Sozialpädagogik ist alles, was Erziehung, aber nicht Familie <strong>und</strong> Schule ist“<br />
Ganz an<strong>der</strong>s definiert Alice Salomon Sozialarbeit: Sie stellt Hilfebedürftigkeit in<br />
den Mittelpunkt <strong>der</strong> Sozialen Arbeit <strong>und</strong> sie sieht in <strong>der</strong> Verhin<strong>der</strong>ung von Armut<br />
<strong>und</strong> Not das Gr<strong>und</strong>problem <strong>der</strong> Sozialen Arbeit.<br />
• Heute fassen wir beide Entwicklungslinien unter dem Begriff „Soziale Arbeit“ zusammen<br />
(<strong>und</strong> da sind sich die meisten Fachleute einig), aber das unterschiedliche<br />
Selbstverständnis von Sozialpädagogik <strong>und</strong> Sozialarbeit ist damit nicht aus<br />
<strong>der</strong> Welt. Sozialpädagogik hat die „Erziehungstatsache“ im Fokus <strong>und</strong> Sozialarbeit<br />
„Soziale Probleme“ im Blick.<br />
• Der Streit um den Gegenstand <strong>und</strong> das Selbstverständnis <strong>der</strong> Sozialen Arbeit<br />
zeigt sich nicht nur zwischen den Traditionslinien Sozialpädagogik <strong>und</strong> Sozialarbeit,<br />
son<strong>der</strong>n es besteht auch die Frage, in welchem Ausmaß die gesellschaftliche<br />
Bedingtheit von Erziehung <strong>und</strong> Hilfebedürftigkeit zum Ausgangspunkt entsprechen<strong>der</strong><br />
<strong>Theorie</strong>anstrengungen gemacht wird. Theoretische Analysen müssten<br />
dann z.B. die sozialen Ungleichheiten als Ansatzpunkt wählen <strong>und</strong> damit die<br />
soziale <strong>und</strong> ökonomisch induzierte Lage ihrer AdressatInnen in den Mittelpunkt ihrer<br />
Beobachtung rücken (T. Rauschenbach 2002).<br />
Betrachtet man die Geschichte <strong>der</strong> Sozialen Arbeit, so haben beide Traditionslinien<br />
ihre Klassiker. Damit sind Personen gemeint, die mit ihren Ideen in Schrift<br />
3
<strong>und</strong> Wort die Soziale Arbeit erheblich mitbestimmt <strong>und</strong> entwickelt haben. Aber<br />
von <strong>Theorie</strong>n in einem systematischen Sinne kann eigentlich nicht gesprochen<br />
werden. Die Werk- <strong>und</strong> Wirkgeschichte dieser Klassiker <strong>der</strong> Sozialen Arbeit verstehen<br />
sich als Entwürfe, Ideen o<strong>der</strong> auch begriffsbildende Beiträge, inwieweit sie<br />
begriffsklärende <strong>und</strong> erklärende theoretische Ansätze enthalten müsste erst einmal<br />
systematisch analysiert werden.<br />
• Ein weiterer Ansatz sollte Erwähnung finden. In Anlehnung an die marxistische<br />
Gesellschaftstheorie wurde in den 1970er Jahren die gesellschaftliche Funktion<br />
<strong>der</strong> Sozialen Arbeit in kapitalistischen Gesellschaften thematisiert. Soziale Arbeit<br />
wurde danach nicht mehr als persönliche Hilfe angesehen, son<strong>der</strong>n genau umgekehrt:<br />
als ein obrigkeitsstaatliches soziales Kontrollinstrument für das Klientel (Sozialarbeit<br />
als „sanfte Kontrolle“ z.B: Peters, Cremer-Peters 1975).<br />
• Betrachtet man die aktuellen Ansätze, so sind vor allem die folgenden zu nennen:<br />
- Die lebensweltorientierte Soziale Arbeit (vor allem Hans Thiersch)<br />
- Der sozialökologische Ansatz „life model“ (Carol Germain & Alex Gitterman)<br />
- Die systemisch-ökologische Perspektive (vgl. Silvia Staub-Bernasconi)<br />
- Die systemische Sozialarbeit (Peter Lüssi)<br />
• Im Wintersemester 06-07 stehen vor allem <strong>der</strong> lebensweltorientierte Ansatz im<br />
Mittelpunkt <strong>und</strong> es werden verschiedene <strong>Theorie</strong>-Fragmente wie Partizipation,<br />
Networking, zugehende Soziale Arbeit, Empowerment <strong>und</strong> Ressourcenorientierung,<br />
Sozialraumorientierung <strong>und</strong> Stärkung <strong>des</strong> bürgerlichen Engagements. Diese<br />
Fragmente verstehen sich als <strong>Facetten</strong> <strong>einer</strong> zu entwickelnden <strong>Theorie</strong> <strong>und</strong> sollen<br />
in ihrer Praxisrelevanz vorgestellt werden.<br />
Der amerikanische Ansatz das „life model“ wird in seinen Gr<strong>und</strong>zügen vorgestellt.<br />
• Im SS 07 werden dann von Frau Gregor die Ansätze von Staub-Bernasconi <strong>und</strong><br />
Lüssi vorgestellt.<br />
Wozu braucht die Soziale Arbeit eigentlich eine <strong>Theorie</strong>?<br />
Ein bedeuten<strong>der</strong> Hintergr<strong>und</strong> für die For<strong>der</strong>ung nach <strong>einer</strong> <strong>Theorie</strong> <strong>der</strong> Sozialen Arbeit<br />
ist die gegenwärtige Formierung <strong>der</strong> Sozialen Arbeit als Sozialarbeitswissenschaft<br />
(<strong>und</strong> natürlich auch Konkurrenzsituation <strong>der</strong> Sozialen Arbeit zu Professionen<br />
wie den PädagogInnen <strong>und</strong> PsychologInnen), aber auch <strong>der</strong> große Erfolg den die<br />
Profession <strong>und</strong> Disziplin <strong>der</strong> Sozialen Arbeit im letzten Jahrhun<strong>der</strong>t hatte. Die folgenden<br />
Zitate <strong>und</strong> Statistiken machen deutlich, dass H. Thiersch zurecht vom 20.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t als dem Jahrhun<strong>der</strong>t <strong>der</strong> Sozialen Arbeit spricht.<br />
Selbstvergewisserungen zur Jahrtausendwende<br />
Michael Winkler (1995):<br />
"Die Soziale Arbeit ist eine Normalbedingung <strong>der</strong> Gesellschaft <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne geworden,<br />
mit <strong>der</strong> diese rechnet, ohne viel auf sie zu geben. es geht damit <strong>der</strong> Sozialpädagogik<br />
nicht an<strong>der</strong>s als <strong>der</strong> B<strong>und</strong>esbahn <strong>und</strong> <strong>der</strong> Post."<br />
Hans Thiersch (1992):<br />
"Das sozialpädagogische Jahrhun<strong>der</strong>t"<br />
4
Thomas Rauschenbach (1996):<br />
...Erfolgsgeschichte <strong>der</strong> Ausdifferenzierung, ihres quantitativen Wachstums, ihrer<br />
Professionalisierung, ihres Zugewinns an professioneller <strong>und</strong> disziplinärer Kontur <strong>und</strong><br />
Gewicht. Also es ist eine Erfolgsgeschichte, die zum Selbstbewußtsein von Disziplin<br />
<strong>und</strong> Profession beitragen sollte.<br />
Michael Galuske (2002, 17):<br />
Aber es gibt auch eine Kehrseite dieses Erfolges. Man kann nämlich fragen:<br />
Signalisiert die zunehmende Institutionalisierung <strong>und</strong> Verberuflichung sozialer Unterstützung<br />
nicht zugleich eine abnehmende Potenz an<strong>der</strong>er Akteure <strong>des</strong> sozialen Bedarfsausgleiches,<br />
wie <strong>der</strong> Familien, <strong>der</strong> Verwandschaftsbeziehungen, <strong>der</strong> sozialen<br />
Netze wie <strong>der</strong> etablierten Formen <strong>des</strong> bürgerlichen <strong>und</strong> ehrenamtlichen Engagements?<br />
Ist sie nicht ein Zeichen vorhandener sozialer Defizite, ist jede weitere soziale<br />
Berufsgruppe, jede weitere soziale Fachkraft, je<strong>des</strong> neue Arbeitsfeld zugleich auch<br />
Ausdruck <strong>einer</strong> gesellschaftlichen Nie<strong>der</strong>lage?<br />
Das Jahrhun<strong>der</strong>t <strong>der</strong> Sozialen Arbeit in Zahlen<br />
(1) Die Soziale Arbeit hat sich in ihrer institutionellen <strong>und</strong> verrechtlichten Gestalt<br />
seit Beginn <strong>des</strong> Jahrhun<strong>der</strong>t konsolidiert <strong>und</strong> differenziert<br />
(2) Von <strong>der</strong> bürgerliche Fürsorge für randständige, proletarische Bevölkerungsgruppen,<br />
hat sie sich zur Mitte <strong>der</strong> Gesellschaft bewegt<br />
(3) Von <strong>der</strong> ersten Frauenschule 1908 werden nun Studierende insgesamt 700<br />
Ausbildungseinrichtungen für Sozialpädagogik <strong>und</strong> Soziale Arbeit (u.a. 30 Universitäten,<br />
60 Fachhochschulen) ausgebildet<br />
Ausbildungszahlen: (ca. 4000-6000 in den 20er Jahren bis r<strong>und</strong><br />
150.000 Studierende <strong>und</strong> SchülerInnen am Ende <strong>des</strong> Jahrhun<strong>der</strong>ts)<br />
Die Fachschüler/innen verharren auf einem Niveau von 50.000 Studierenden/Jahr,<br />
so haben sich die Zahlen von FH <strong>und</strong> Uni- Studierenden zwischen<br />
1975 <strong>und</strong> 1994 verdoppelt auf jeweils 44.000<br />
(4) 1950 führten die sozialen Berufe mit r<strong>und</strong> 60.000 eine Randexistenz <strong>und</strong> heute<br />
haben sich die Zahlen mehr als verzehnfacht (820.000 Beschäftigte Ende<br />
<strong>der</strong> 90 er Jahre)<br />
<strong>und</strong> bis 2002 auf 1.255.000 erhöht!<br />
C.W. Müller: „Soziale Arbeit expandiert in <strong>der</strong> Krise....!“<br />
(5) Eine qualitative Erfolgsgeschichte ist in den Anfängen (z.B. Bemühungen um<br />
Sozialarbeitswissenschaft, Evaluationen <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> Sozialen Arbeit, um<br />
<strong>Theorie</strong>bildung)<br />
(6) Die quantitative Erfolgsgeschichte ist heute nicht mehr ungebrochen. Die Finanzsituation<br />
auf B<strong>und</strong>es- Län<strong>der</strong>n- <strong>und</strong> Kommunalebene scheinen sich inzwischen<br />
auf die zumeist mit öffentlichen Mitteln finanzierten Stellen auszuwirken.<br />
Die SZ schreibt: Die Arbeitslosigkeit für SozialpädagogInnen ist innerhalb<br />
eines Jahres um 27 % gestiegen <strong>und</strong> zugleich ist die Zahl <strong>der</strong> freien Stellen<br />
um 1/3 gesunken (SZ v. März 2004)<br />
(7) Die Berufschancen für AbsolventInnen <strong>der</strong> FH Regensburg war noch vor 3<br />
Jahren hervorragend: Die Quote arbeitsloser AbsolventInnen betrug 2002 1,3<br />
%. Ein Drittel <strong>der</strong> AbsolventInnen tritt die erste Stelle sofort nach dem Examen<br />
an, nach drei Monaten sind zwei Drittel in Arbeit <strong>und</strong> nach einem halben Jahr<br />
84 %.<br />
5
(8) Allerdings hat sich nach 2004 im Zuge <strong>der</strong> Kürzungen im Sozialbereich die<br />
Situation etwas verschlechtert. Dennoch ist die Arbeitslosenquote – b<strong>und</strong>esweit<br />
betrachtet – im Vergleich zu an<strong>der</strong>en akademischen Berufen eher unterdurchschnittlich<br />
gestiegen.<br />
Nach Rauschenbach (1999) <strong>und</strong> Kleve (2005)<br />
Und nach dem Ende <strong>des</strong> sozialpädagogischen Jahrhun<strong>der</strong>ts?<br />
Thomas Rauschenbach (1999, 292):<br />
Vieles spricht dafür, dass sie auch in Zukunft gebraucht wird!<br />
Robert Castel (2000, 376):<br />
"Worin könnte eine soziale Einglie<strong>der</strong>ung (in Zukunft) bestehen, die nicht auf eine<br />
berufliche Einglie<strong>der</strong>ung, also auf Integration hinausläuft? Unterm Strich in <strong>einer</strong> Verurteilung<br />
zu ewiger Einglie<strong>der</strong>ung. Was ist ein dauernd Einzuglie<strong>der</strong>n<strong>der</strong>? Jemand,<br />
den man nicht völlig fallen lässt, den man in s<strong>einer</strong> augenblicklichen Situation begleitet,<br />
indem man um ihn herum ein Netz aus Aktivitäten, Initiativen <strong>und</strong> Projekten<br />
spinnt."<br />
H<strong>einer</strong> Keupp (1998, 279):<br />
"Der gesellschaftliche Umbruch an unsere Jahrtausendschwelle ist radikal <strong>und</strong> vielgestaltig.<br />
Es ist ein Umbruch mit weitreichenden technologischen, ökonomischen <strong>und</strong><br />
ökologischen Konsequenzen. Aber e zeigt auch eine tiefgreifende zivilisatorische<br />
Umgestaltung, die sich in <strong>der</strong> Alltagskultur, in unseren Werthaltungen <strong>und</strong> in unserem<br />
Handeln notwendigerweise auswirken muss. Angesichts ökonomischer Turbulenzen<br />
können sich Menschen nicht (mehr einfach) in die Festung Alltag zurückziehen - in<br />
<strong>der</strong> Hoffnung dort abzuwarten bis sich diese Turbulenzen gelegt haben, um dann so<br />
weiterzumachen wie bisher, wie man es schon immer gemacht hat. Die bisherige<br />
Debatte um die "riskanten Chancen" <strong>des</strong> gesellschaftlichen Umbruchs wurden zu<br />
sehr als ökonomische Standortdebatte geführt. Ich behaupte, dass eine soziale<br />
Standortdebatte von gleicher Relevanz ist. O<strong>der</strong> lasen Sie es mich in ökonomischen<br />
Metaphern ausdrücken: Nicht nur das ökonomische Kapital, son<strong>der</strong>n ebenso das<br />
"soziale Kapital" entscheidet über die Zukunftsfähigkeit Deutschlands!"<br />
W. B.-G. 2003<br />
6
Zum <strong>Theorie</strong>-Praxis-Verhältnis<br />
in <strong>der</strong> Sozialen Arbeit<br />
<strong>Theorie</strong> ist, wenn man alles weiß <strong>und</strong> nichts funktioniert- <strong>und</strong> Praxis ist, wenn alles<br />
funktioniert, <strong>und</strong> k<strong>einer</strong> weiß warum!"<br />
”Erstens kommt es an<strong>der</strong>s <strong>und</strong> zweitens als man denkt!”<br />
Die folgenden Zitate machen deutlich: das Verhältnis zwischen dem theoretischen<br />
<strong>und</strong> dem praktischen Tun ist gespannt. Oft hat man auch den Eindruck es besteht<br />
überhaupt keine Beziehung zwischen diesen Bereichen. Es ist so als würde ein<br />
heimliches Einverständnis gelten, das sich so formulieren lässt: Lass du mich mit<br />
d<strong>einer</strong> <strong>Theorie</strong> in Ruhe, dann werde ich dich auch nicht mit den Wi<strong>der</strong>sprüchen,<br />
Zwängen <strong>und</strong> Anstrengungen m<strong>einer</strong> Praxis in Frieden lassen. Offenbar erwartet<br />
man nichts voneinan<strong>der</strong>, so jedenfalls das folgende Zitat von Silvia Staub-<br />
Bernasconi.<br />
”Verfolgt man die Diskussionen zur <strong>Theorie</strong>- <strong>und</strong> Methodenfrage in <strong>der</strong> Sozialen Arbeit,<br />
so könnte man meinen, es handele es sich um eine Form von ”Nullsummenspiel”: Wer<br />
Handlungs- <strong>und</strong> Praxisrelevanz for<strong>der</strong>t, kann nicht theoretisch-wissenschaftlich sein<br />
<strong>und</strong> wer Wissenschaftlichkeit <strong>und</strong> <strong>Theorie</strong>bildung for<strong>der</strong>t, kann nicht praktisch sein,<br />
intellektualisiert am Alltag vorbei......” (Silvia Staub-Bernasconi 1994)<br />
Dabei könnten sich beide durchaus befruchten:<br />
”Nichts ist praktischer als eine gute <strong>Theorie</strong>!” (Kurt Lewin)<br />
”Nichts bereichert eine <strong>Theorie</strong> mehr als eine gute Praxis!” (Maja H<strong>einer</strong>)<br />
Und <strong>der</strong> Alltag <strong>der</strong> Sozialen Arbeit ist auch voller Erörterungen, auf die <strong>Theorie</strong>n<br />
Antworten geben könnten bzw. die Erörterungen selber sind „theoretisch“. Wenn wir<br />
darüber diskutieren, was das Professionelle <strong>der</strong> Sozialen Arbeit ausmacht o<strong>der</strong> was<br />
professionelle Soziale Arbeit von Laienarbeit unterscheidet? Wenn wir uns überlegen,<br />
wann es sinnvoll ist Laien <strong>und</strong> wann Professionelle einzusetzen. Das sind theoretische<br />
Fragen!<br />
Wenn wir beim Thema Qualitätssicherung die Frage stellen was ist „Erfolg“ in <strong>der</strong><br />
Sozialen Arbeit o<strong>der</strong> uns fragen, wann ist es sinnvoll Erfolg zu messen?<br />
Wenn wir die Begriffe K<strong>und</strong>en <strong>und</strong> K<strong>und</strong>enorientierung in <strong>der</strong> Sozialen Arbeit reflektieren<br />
<strong>und</strong> diese dem Begriff „Hilfebedürftig“ gegenüberstellen <strong>und</strong> die jeweiligen<br />
Vorzüge untersuchen, „theoretisieren“ wir.<br />
Wenn ich darüber diskutiere, ob die Häufung von Gewaltdelikten gesellschaftliche<br />
Hintergründe hat, o<strong>der</strong> sich allein biografischen Beson<strong>der</strong>heiten <strong>der</strong> Personen verdankt,<br />
dann ist das eine theoretische Erörterung.<br />
In diesem Sinnen sind die folgenden Fragen solche auf die eine <strong>Theorie</strong> <strong>der</strong> sozialen<br />
Arbeit Antworten geben muss. Was ist Soziale Arbeit? Was hat Soziale Arbeit mit<br />
dem Staat zu tun? Was ist ihr Gegenstand? Wie werden die Adressaten <strong>der</strong> Sozialen<br />
Arbeit A gesehen? Was ist professionelles Handeln <strong>und</strong> wodurch zeichnet es sich<br />
aus? Wie werden Fragen <strong>der</strong> Normen <strong>und</strong> Ethik begründet <strong>und</strong> entwickelt... etc.?<br />
7