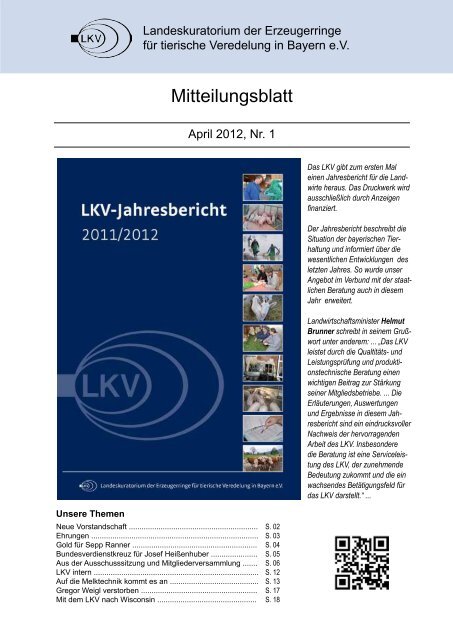Bundesverdienstkreuz für Josef Heißenhuber - LKV Bayern
Bundesverdienstkreuz für Josef Heißenhuber - LKV Bayern
Bundesverdienstkreuz für Josef Heißenhuber - LKV Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Landeskuratorium der Erzeugerringe<br />
<strong>für</strong> tierische Veredelung in <strong>Bayern</strong> e.V.<br />
Mitteilungsblatt<br />
April 2012, Nr. 1<br />
Unsere Themen<br />
Neue Vorstandschaft .............................................................<br />
Ehrungen ...............................................................................<br />
Gold <strong>für</strong> Sepp Ranner ...........................................................<br />
<strong>Bundesverdienstkreuz</strong> <strong>für</strong> <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> ......................<br />
Aus der Ausschusssitzung und Mitgliederversammlung .......<br />
<strong>LKV</strong> intern ..............................................................................<br />
Auf die Melktechnik kommt es an ..........................................<br />
Gregor Weigl verstorben .......................................................<br />
Mit dem <strong>LKV</strong> nach Wisconsin ...............................................<br />
S. 02<br />
S. 03<br />
S. 04<br />
S. 05<br />
S. 06<br />
S. 12<br />
S. 13<br />
S. 17<br />
S. 18<br />
Das <strong>LKV</strong> gibt zum ersten Mal<br />
einen Jahresbericht <strong>für</strong> die Landwirte<br />
heraus. Das Druckwerk wird<br />
ausschließlich durch Anzeigen<br />
finanziert.<br />
Der Jahresbericht beschreibt die<br />
Situation der bayerischen Tierhaltung<br />
und informiert über die<br />
wesentlichen Entwicklungen des<br />
letzten Jahres. So wurde unser<br />
Angebot im Verbund mit der staatlichen<br />
Beratung auch in diesem<br />
Jahr erweitert.<br />
Landwirtschaftsminister Helmut<br />
Brunner schreibt in seinem Grußwort<br />
unter anderem: ... „Das <strong>LKV</strong><br />
leistet durch die Qualtitäts- und<br />
Leistungsprüfung und produktionstechnische<br />
Beratung einen<br />
wichtigen Beitrag zur Stärkung<br />
seiner Mitgliedsbetriebe. ... Die<br />
Erläuterungen, Auswertungen<br />
und Ergebnisse in diesem Jahresbericht<br />
sind ein eindrucksvoller<br />
Nachweis der hervorragenden<br />
Arbeit des <strong>LKV</strong>. Insbesondere<br />
die Beratung ist eine Serviceleistung<br />
des <strong>LKV</strong>, der zunehmende<br />
Bedeutung zukommt und die ein<br />
wachsendes Betätigungsfeld <strong>für</strong><br />
das <strong>LKV</strong> darstellt.“ ...
Neue Vorstandschaft beim <strong>LKV</strong> <strong>Bayern</strong><br />
<strong>Josef</strong> Bauer ist der neue Vorsitzender des <strong>LKV</strong> <strong>Bayern</strong> und löst Sepp Ranner (MdL a.D.) ab. Stellvertretender<br />
Vorsitzender ist Thomas Schindlbeck, der Nachfolger von <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> ist. Zum weiteren<br />
Vorsitzenden wurde Georg Liegl gewählt, der den Platz von <strong>Josef</strong> Bauer einnimmt.<br />
Von links: Uwe Gottwald, <strong>LKV</strong>-Geschäftsführer, Thomas Schindlbeck, Georg Liegl, <strong>Josef</strong> Bauer, Sepp<br />
Ranner, <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> und Dr. Jürgen Duda, stellvertretender <strong>LKV</strong>-Geschäftsführer.<br />
<strong>Josef</strong> Bauer war sichtlich bewegt, als er von seiner Wahl zum Vorsitzenden erfuhr. Er sagte, dass er zwar<br />
damit gerechnet habe, aber die Realität fühlt sich dann doch ganz anders an. Er bedankte sich <strong>für</strong> das<br />
Vertrauen und stellte sich vor. <strong>Josef</strong> Bauer ist seit fünf Jahren in der <strong>LKV</strong>Vorstandschaft und Vorsitzender<br />
des Milcherzeugerringes Oberpfalz. Er bewirtschaftet mit seiner Frau Sigrid im Landkreis Regensburg im<br />
Vollerwerb siebzig Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche – Futtergrundlage <strong>für</strong> 70 Kühe plus Nachzucht<br />
und 25 Hektar Wald. <strong>Josef</strong> Bauer ist 45 Jahre alt, hat drei erwachsene Kinder. Das jüngste Kind, ein<br />
18jähriger Sohn, möchte den Betrieb übernehmen, macht aber gerade eine Lehrzeit in der Industrie. Auf<br />
dem Betrieb leben auch seine Eltern, die noch tatkräftig mitarbeiten.<br />
Thomas Schindlbeck ist seit fünf Jahren Vorsitzender des Fleischerzeugerringes Landshut, 52 Jahre<br />
alt, hat drei Kinder, das jüngste, ein 18jähriger Sohn, besucht gerade die Fachoberschule, Zweig Landwirtschaft.<br />
Thomas Schindlbeck bewirtschaftet mit seiner Frau Silvia in der Landshuter Gegend, Gemeinde<br />
Hohenthann, einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau und Schweinemast. Er ist im Vorstand der<br />
Erzeugergemeinschaft Südostbayern.<br />
Georg Liegl ist Vorsitzender des Milcherzeugerringes Miesbach, 52 Jahre alt, hat fünf Kinder und be wirt<br />
schaftet mit seiner Frau Elisabeth 52 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, davon 22 Hektar Dauergrünland.<br />
Auf seinen Ackerflächen baut er Mais und Getreide an. Grassilage, Heu und Maissilage verfüttert Georg<br />
Liegl an 70 Kühe und die Nachzucht. Seine beiden älteren Söhne sind Landwirtschaftsmeister.<br />
Zurück zu <strong>Josef</strong> Bauer. In seiner Antrittsrede erklärte er, dass er zwar den politischen Einfluss wie Sepp<br />
Ranner, <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> oder <strong>Josef</strong> Kreilinger nicht habe, aber er werde die Richtung, die seine<br />
Vorgänger eingeschlagen haben, beibehalten. Er sei sich dessen bewusst, dass er an den Dreien gemessen<br />
werde und bat um Unterstützung bei den Mitgliedern des <strong>LKV</strong>Ausschusses: „Ich brauche Euch!“<br />
2
<strong>Josef</strong> Bauer bedankte sich bei den ehemaligen Vorsitzenden und sprach seine Anerkennung aus: „Das<br />
<strong>LKV</strong> steht gut da. Ich konnte viel von Euch lernen. In all den Jahren, die wir zusammengearbeitet haben,<br />
sind wir uns immer mit Respekt und Wertschätzung begegnet und es konnte eine aufrichtige Freundschaft<br />
wachsen.“ Das <strong>LKV</strong> müsse sich weiter verändern. Die Grundlagen seien bereits gelegt. Die Bauern<br />
brauchen eine individuelle Beratung. Die LOPs und Ringassistenten müssen „Spürhunde“ sein – wo stimmt<br />
etwas nicht im Stall, bei der Fütterung, bei den Tieren? Wo gibt es noch Produktionsreserven? Wo können<br />
die Kosten verringert werden? Wie kann der Landwirt bessere Erlöse erzielen? Das <strong>LKV</strong> müsse <strong>für</strong> die<br />
Bauern unverzichtbar werden und diese dürften nicht nach den Kosten <strong>für</strong> die <strong>LKV</strong>Betreuung fragen.<br />
Ehrungen mit Gold und Silber<br />
Als „Noch<strong>LKV</strong>Vorsitzender“ überreichte Sepp Ranner <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> die ‚<strong>LKV</strong>-Medaille in Gold‘.<br />
Georg Palme, Paul Gruber, Günther Brehm und Reiner Ruth erhielten die ‚<strong>LKV</strong>-Medaille in Silber‘.<br />
Von links: Paul Gruber, Günther Brehm, Sepp Ranner, <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong>, Reiner Ruth und Georg<br />
Palme.<br />
„<strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> ist ein niederbayerisches Urgestein“, sagte Sepp Ranner. Er zählte die Jahre zusam<br />
men, die <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> mit Ehrenämtern <strong>für</strong> die Landwirtschaft und <strong>für</strong> den kommunalen Bereich<br />
befasst war – insgesamt 180 Jahre. <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> war seit 1986 im <strong>LKV</strong>-Ausschuss und seit 1996<br />
stellvertretender Vorsitzender. Von 1970 bis 2007 war er Vorsitzender des Schweineprüfringes Landau.<br />
Als Vorsitzender der Ringgemeinschaft <strong>Bayern</strong> e.V. – 16 Jahre – verbesserte er die Zusammenarbeit<br />
der Erzeugergemeinschaften mit den Erzeugerringen (siehe auch Seite 4 f.). Sepp Ranner sagte, dass<br />
<strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> der ruhende Pol in der <strong>LKV</strong>Vorstandschaft gewesen sei. Mit feinem Humor, seiner<br />
ausgleichenden Art und einem sicheren Gespür <strong>für</strong> das Machbare habe er die zahlreichen Diskussionen<br />
bereichert.<br />
Georg Palme war 27 Jahre <strong>für</strong> ganz <strong>Bayern</strong> Fachberater <strong>für</strong> Schafe. Dies sei keine leichte Aufgabe,<br />
betonte Sepp Ranner. In <strong>Bayern</strong> werden etwa 388.000 Schafe gehalten und ist damit das schafreichste<br />
Bundesland. Leider habe die Wolle <strong>für</strong> die Verbraucher keinen Wert mehr. Und Lammfleisch würden die<br />
Verbraucher ebenfalls nicht schätzen. Der ProKopfVerbrauch sei traditionell niedrig.<br />
3
Paul Gruber ist seit zehn Jahren Vorsitzender des Fleischerzeugerringes NiederbayernOst. Daneben<br />
war er Vorsitzender der Viehmarktungsgenossenschaft (VVG) Niederbayern. Er war wesentlich an<br />
deren Fusion mit der damaligen Erzeugergemeinschaft <strong>für</strong> Schlachtvieh Niederbayern zur heutigen<br />
Erzeugergemeinschaft <strong>für</strong> Qualitätsvieh und Fleisch Südostbayern, in der er im Vorstand ist, beteiligt.<br />
Sechs Jahre war er im Fachausschuss <strong>für</strong> Vieh und Fleisch des Deutschen Raiffeisenverbandes.<br />
Günther Brehm war 19 Jahre Vorsitzender des Pferdeerzeugerringes <strong>Bayern</strong> und er ist im <strong>LKV</strong>-Ausschuss.<br />
Sepp Ranner betonte, dass Günther Brehm immer ein Ziel vor Augen hatte, Ziele, die greifbar waren.<br />
Visionen gepaart mit Treue schaffe Zukunft. Leider würden Pferde immer weniger zu einer bäuerlichen<br />
Land wirtschaft gehören. Pferde seien ‚Sportgeräte‘.<br />
Reiner Ruth war 35 Jahre <strong>für</strong> den Fleischerzeugerring Traunstein tätig (sein Vater war Gründungsvorsitzender),<br />
davon 20 Jahre 1. Vorsitzender. 15 Jahre war er im <strong>LKV</strong>-Ausschuss. Neben seinem kommunalpolitischen<br />
Engagement war Reiner Ruth sechs Jahre Vorsitzender des Arbeitskreises Landwirtschaft<br />
der CSU in Traunstein. 2010 fusionierte der Fleischerzeugerring Traunstein mit dem Fleischerzeugerring<br />
Mühldorf. Damit war „das Haus gut bestellt“, so Sepp Ranner. In seiner Laudatio betonte er die ‚zwingende<br />
Sachlichkeit’ von Reiner Ruth und bedankte sich bei ihm <strong>für</strong> die 30jährige Freundschaft.<br />
Gold <strong>für</strong> Sepp Ranner<br />
<strong>Josef</strong> Bauer überreichte Sepp Ranner die ‚<strong>LKV</strong>-Medaille in Gold‘ und bedankte sich bei ihm <strong>für</strong> das<br />
familiäre Verhältnis, das er in der Vorstandschaft geschaffen habe. Über die Jahre hinweg habe sich eine<br />
aufrichtige und vertrauensvolle Freundschaft entwickelt. Sepp Ranner habe sein Ehrenamt mit „Herzblut“<br />
ausgefüllt. „Da<strong>für</strong> meine Anerkennung und mein persönlicher Dank und Dank des <strong>LKV</strong>“, so <strong>Josef</strong> Bauer in<br />
seiner Funktion als neuer <strong>LKV</strong>Vorsitzender.<br />
Er war hartnäckig und voller Leidenschaft<br />
Sepp Ranner war von Juni 2001 bis dato Vorsitzender des <strong>LKV</strong> <strong>Bayern</strong>. In seine „Regentschaft“ fiel<br />
die Umstellung des Bayerischen Landwirtschaftsfördergesetzes (LwFöG) zum Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetz<br />
(BayAgrarWiG) verbunden mit einschneidenden Veränderungen <strong>für</strong> die <strong>LKV</strong>Förderung.<br />
Zum einen bekommt das <strong>LKV</strong> weniger Fördergelder, zum anderen kamen zur Qualitäts und Leistungsprüfung<br />
Beratungsaufgaben hinzu. Das <strong>LKV</strong> bietet eine Fütterungs, Melk und Stallklimaberatung an und Beratung<br />
zur Produktionstechnik <strong>für</strong> die Ferkelerzeugung, Schweinemast und Rindermast und wurde entsprechend<br />
dem Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetz zum 1.10.2008 als nichtstaatliches Beratungsunternehmen<br />
anerkannt. Damit bietet das <strong>LKV</strong> allen Tierhaltern eine kostengünstige Beratung an. Sepp Ranner habe mit<br />
Bedacht und Weitsicht die Umstellung vom LwFöG auf das BayAgrarWig <strong>für</strong> das <strong>LKV</strong> bewerkstelligt. <strong>Josef</strong><br />
<strong>Heißenhuber</strong>, stellvertretender <strong>LKV</strong>-Vorsitzender, sagte anlässlich des 70. Geburtstages von Sepp Ranner:<br />
„Die Aufgabe als <strong>LKV</strong>Vorsitzender nimmt er mit einem menschlich feinen, fairen und vertrauensvollen<br />
Führungsstil wahr.“<br />
Mit großem Engagement, Weitblick und Zielstrebigkeit hat sich Sepp Ranner in den unterschiedlichsten<br />
Verbänden und Organisationen zum Wohle der Landwirtschaft und seiner Heimat eingesetzt. Dabei hat er<br />
4
dank seiner fachlichen Kompetenz und Bodenständigkeit nie den Blick <strong>für</strong> das Wesentliche und Machbare<br />
verloren. Sepp Ranner war<br />
• 18 Jahre Abgeordneter im Bayerischen Landtag<br />
• fast 30 Jahre Vorsitzender des Verbandes Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF) in Bad<br />
Aibling und seit 1983 stellvertretender Vorsitzender des VLF Oberbayern.<br />
• Vizepräsident des Verbandes der Deutschen Milchwirtschaft<br />
• Stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Verbandes <strong>für</strong> Leistungs und Qualitätsprüfung DLQ<br />
• Mitglied des Kreistages.<br />
20 Jahre war er Kreisobmann des BBV im Landkreis Rosenheim und im Vorstand der Trocknungs genossenschaft<br />
Kirchdorf.<br />
Mit Leidenschaft und Hartnäckigkeit hat sich Sepp Ranner als bienenpolitischer Sprecher des bayerischen<br />
Landtages <strong>für</strong> die Belange der bayerischen Bienenzucht und die Förderung des Imkernachwuchses ein gesetzt.<br />
In Bad Aibling hat er „Die Tafel“ mit aufgebaut.<br />
Landwirtschaftsminister Helmut Brunner überreichte ihm an seinem 70. Geburtstag den Bayerischen<br />
Löwen aus Nymphenburger Porzellan.<br />
Sepp Ranner gehört zu den wenigen herausragenden Persönlichkeiten, die mit dem höchsten Verdienst<br />
orden des Freistaates <strong>Bayern</strong>, dem ‚Bayerischen Verdienstorden‘, ausgezeichnet wurden. Zudem<br />
bekam er <strong>für</strong> seine Leistungen <strong>für</strong> die bayerische Land, Ernährungs und Forstwirtschaft das<br />
‚<strong>Bundesverdienstkreuz</strong> am Bande‘ verliehen.<br />
Trotz all‘ dem: An erster Stelle steht <strong>für</strong> Sepp Ranner seine Familie. Seinem Sohn nimmt er in Haus und<br />
Hof so manche Arbeit ab.<br />
Das <strong>LKV</strong>, allen voran der neue Vorsitzende <strong>Josef</strong> Bauer und Uwe Gottwald, <strong>LKV</strong>Geschäftsführer, bedankten<br />
sich bei Sepp Ranner <strong>für</strong> seine Arbeit und die ehrliche Freundschaft, die sich im Laufe der Jahre entwickelt<br />
hat. „Wir wünschen Dir und Deiner Familie Gesundheit, viel Glück und Gottes Segen.<br />
<strong>Bundesverdienstkreuz</strong> <strong>für</strong> <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong><br />
„Sie sind ein Landwirt mit Leib und Seele und<br />
haben sich von Jugend an <strong>für</strong> Ihren Berufsstand<br />
ein gesetzt“ – mit diesen Worten überreichte Landwirtschaftsminister<br />
Helmut Brunner (links) an <strong>Josef</strong><br />
<strong>Heißenhuber</strong> das ‚Verdienstkreuz am Bande der<br />
Bundesrepublik Deutschland‘. Rechts auf dem Foto<br />
Heinz Grunwald, Präsident der Regierung von<br />
Niederbayern.<br />
Die Liste der Ehrenämter von <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong><br />
ist lang. Seit 1986 ist er Ausschussmitglied des <strong>LKV</strong><br />
5
und seit 1996 stellvertretender Vorsitzender. Von 1970 bis 2007 war er Vorsitzender des Schweineprüfringes<br />
in Landau und 1986 bis 2007 Vorsitzender des Fleischerzeugerringes Landshut. <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> war<br />
Mitglied des Veredelungsausschusses des Bayerischen Bauernverbandes, stellvertretender Vorsitzender<br />
des Fleischprüfringes <strong>Bayern</strong> e.V. sowie stellvertretender Vorsitzender des Hauptverbandes <strong>für</strong> tierische<br />
Veredelung in <strong>Bayern</strong>. Im Aufsichtsrat der Erzeugergemeinschaft <strong>für</strong> Qualitätsvieh und –fleisch Niederbayern<br />
eG hat er maßgeblich zur Neustrukturierung und Fusion mit den Ferkelerzeugergemeinschaften beigetragen.<br />
<strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> war 1957 Mitbegründer und Mitglied der Jungbauernschaft in Adldorf, dann Be zirks-<br />
vorsitzender und von 1968 bis 2006 BBV-Ortsobmann und ist Mitglied im Kreisvorstand. Lange Zeit war er<br />
aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr und zwölf Jahre Mitglied des Marktgemeinderates Eichendorf.<br />
Das Motto von <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong>: „Aus der Praxis, <strong>für</strong> die Praxis!“<br />
<strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> hat den Alltag eines bäuerlichen Betriebes (auch als ‚Austragler‘) im Blick und setzt<br />
auf eine Qualitätsproduktion, die sich kostengünstig und effizient in den Betrieben umsetzen lässt. Er<br />
ist beispielsweise wesentlich an der Entwicklung des ProduktionsHygieneProgrammes des <strong>LKV</strong> in<br />
Zusammenarbeit mit dem TGD beteiligt gewesen. Ebenso forcierte er die Beratung der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe durch das <strong>LKV</strong> im Rahmen der Verbundberatung.<br />
Dass <strong>Josef</strong> <strong>Heißenhuber</strong> Landwirt mit Leib und Seele war und immer noch ist, zeigt der <strong>Heißenhuber</strong>’sche<br />
Betrieb in Wannersdorf. Mit viel Fleiß und offen <strong>für</strong> neue Produktionsverfahren und Technik hat er ihn zu<br />
einem Vorzeigebetrieb ausgebaut. 1997 baute er als einer der ersten im Landkreis Dingolfing-Landau eine<br />
Biogasanlage in der er Speisereste verwertet.<br />
Das <strong>LKV</strong>, allen voran der ehemalige Vorsitzende Sepp Ranner (MdL a.D.), der jetzige Vorsitzende <strong>Josef</strong><br />
Bauer, Geschäftsführer Uwe Gottwald und Dr. Erwin Zierer, ehemals Geschäftsführer, gratulieren recht<br />
herzlich. Sie wünschen ihm Gottes Segen, viel Glück und Gesundheit. Er möge, wie bisher, mit viel Elan<br />
weiterhin die Interessen der Bauern im Ehrenamt vertreten. Sie bedankten sich <strong>für</strong> die harmonische<br />
Zusammenarbeit und <strong>für</strong> die aufrichtige Freundschaft, die sich in den langen Jahren entwickelte.<br />
Aus der Ausschusssitzung und Mitgliederversammlung<br />
Wir brauchen uns nicht rechtfertigen<br />
Es war die letzte <strong>LKV</strong>Ausschusssitzung und Mitgliederversammlung <strong>für</strong> Sepp Ranner (MdL a.D.).<br />
Obwohl er gesundheitlich angeschlagen war, hielt er ein leidenschaftliches Plädoyer <strong>für</strong> die bäuerliche<br />
Landwirtschaft. Temperamentvoll geißelte er die schlechte Berichterstattung über die Landwirtschaft in<br />
den Medien. Produktion nach dem Stand der Technik würde als Massentierhaltung und Agrarindustrie<br />
abgetan. Die Mehrheit der Bundesbürger sähe die Tiergesundheit als problematisch an. Ebenso würde der<br />
Maisanbau disqualifiziert. Man spreche von einer ‚Vermaisung der Landschaft‘. Dabei sei Mais eine sehr<br />
wertvolle Pflanze.<br />
6
Sepp Ranner appellierte: „Wir müssen davon loskommen, uns <strong>für</strong> unsere Arbeit zu rechtfertigen“. Denn,<br />
so Sepp Ranner: „Wir Bauern sichern den Wohlstand unserer Gesellschaft. Die Bundesbürger geben<br />
nur noch zehn Prozent ihrer Konsumausgaben <strong>für</strong> Lebensmittel aus. Wir betreiben eine klassische<br />
Kreislaufwirtschaft. Wir schützen die Ressourcen. Wir hegen und pflegen die Landschaft. Wir sichern die<br />
Welternährung. Ein Landwirt ernährt 140 Menschen. Und wir regenerieren CO .“ 2<br />
Gleiche Chancen <strong>für</strong> alle<br />
Sepp Ranner forderte von der Agrarpolitik die Voraussetzungen <strong>für</strong> gleiche Marktchancen zu schaffen. Er<br />
zitierte Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner. Diese meinte, es ginge nicht an, dass wir in Deutschland<br />
die Käfighaltung verboten hätten und in Polen würden mehr als die Hälfte der Eier <strong>für</strong> Deutschland in<br />
Käfighaltung produziert.<br />
Billig, billiger, am billigsten<br />
Dass die Verbraucher bereit wären <strong>für</strong> Lebensmittel regionaler Herkunft mehr Geld auszugeben, bezeichnete<br />
Sepp Ranner als Wunschdenken. Die Verbraucher sind (es gibt Ausnahmen) bei Lebensmitteln geizig und<br />
kaufen bei Aldi, Lidl und Co.<br />
Zypern zubetoniert<br />
Täglich fallen 270 Hektar Acker- und Grünland <strong>für</strong> den Straßen-, Wohn- und Industrieanlagenbau in<br />
der EU zum Opfer. Das entspricht in zehn Jahren der Fläche Zyperns. Diese Fläche fehlt <strong>für</strong> die Nahrungsmittelproduktion<br />
- bei steigendem Bedarf. Die FAO prognostiziert, dass bis 2050 die Nachfrage nach<br />
Fleisch um 73 Prozent und nach Milch um 60 Prozent steigt. Hinzu kommt, dass Wasser weltweit jetzt<br />
schon nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Sepp Ranner meinte, die europäische Landwirtschaft<br />
hat aufgrund des überwiegend gemäßigten Klimas und guter Böden die besten Bedingungen.<br />
Ohne <strong>LKV</strong> keine Tierhaltung in <strong>Bayern</strong><br />
Der Organisationsgrad beim <strong>LKV</strong> entspricht mit deutlich mehr als 70 bis 86 Prozent fast dem des Bayerischen<br />
Bauernverbandes. Das <strong>LKV</strong> unterstützt die Landwirte in ihrem unternehmerischen Handeln. Die<br />
Be ratungsangebote werden bedarfsorientiert erweitert, zum Beispiel Beratung zur Reproduktion, Ge burtsverhalten<br />
und Anpaarung. „Die Landwirte sind Unternehmer, aber in erster Linie Bauern“, sagte Sepp<br />
Ranner.<br />
Sepp Ranner bedankte sich beim Vorstand und bei der Geschäftsführung <strong>für</strong> die einvernehmliche Zusammenarbeit.<br />
Uwe Gottwald stellte anlässlich der Ausschusssitzung und Mitgliederversammlung den Geschäfts und<br />
Jah resbericht vor. Georg Holder, Leiter der Gesamtverwaltung, stellte den Haushalt vor. Die Fördergelder<br />
<strong>für</strong> das <strong>LKV</strong> sind <strong>für</strong> den Doppelhaushalt 2011/2012 gesichert.<br />
Zu Anfang sagte Uwe Gottwald, dass dies jetzt seine vierte Ausschusssitzung und Mitgliederversammlung<br />
sei, die er bestreitet, aber von Routine sei er noch weit entfernt.<br />
7
Ohne Leistungsprüfung keine Beratung<br />
Die Qualitäts und Leistungsprüfung ist nach wie vor das Kerngeschäft des <strong>LKV</strong>. Sie liefert die Daten <strong>für</strong><br />
die Beratung. Da liegt es nahe, dass das <strong>LKV</strong> die Daten aus der Qualitäts und Leistungsprüfung <strong>für</strong> seine<br />
Beratungsangebote nutzt. Um dem steigenden Beratungsbedarf gerecht zur werden, soll es beim <strong>LKV</strong><br />
eine eigene Abteilung <strong>für</strong> Beratung geben.<br />
Laut einer Befragung von MLPBetrieben im Herbst vergangenen Jahres wünscht sich ein großer Teil der<br />
Milchkuhhalter unter anderem eine ‚Beratung zum Herdenmanagement‘ und eine ‚Beratung zur Betriebsführung‘.<br />
Befragt wurden 6.000 Betriebsleiter, 2.500 haben geantwortet.<br />
Die Entwicklung des Personalstandes spiegelt den Trend wieder. Die Zahl der LOPs und Ringassistenten<br />
ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gesunken während die Zahl der Fütterungs und Melkberater<br />
gestiegen ist.<br />
Der LOP<br />
Laut der oben genannten Umfrage wollen viele Milchkuhhalter, dass der LOP öfter mit Terminvereinbarung<br />
- auf ihren Betrieb kommt. Laut Umfrage liegt die ‚gefühlte‘ Besuchshäufigkeit zwischen 4,2 bis 8,7 Besuche<br />
pro Jahr und Betrieb. Tatsächlich sind es zwischen ein und fünfzehn Betreibsbesuche.<br />
OptiBull optimiert Anpaarung<br />
Künftig können die Milchkuhhalter das Anpaarungsprogramm OptiBull im Internet nutzen. Im ersten Jahr<br />
müssen die Betriebe da<strong>für</strong> zwanzig Euro zahlen, im Folgejahr nur noch zehn Euro. Außerdem können die<br />
Landwirte zusätzlich beim <strong>LKV</strong> eine fachkundige Beratung im Rahmen der Verbundberatung in Anspruch<br />
nehmen.<br />
Bei der <strong>LKV</strong>Beratung helfen spezialisierte LOPs den Milchkuhhaltern gegen Gebühr bei der Erstellung des<br />
IstZustandes der Herde, der Tierbeurteilung und bei der Festlegung auf eine Zuchtstrategie. Als Ergebnis<br />
erstellt er einen Anpaarungsplan. Seit Mitte Februar dieses Jahres sind zwölf <strong>LKV</strong>Berater mit dem<br />
Pilotprojekt (in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Rinderzucht) betraut jeweils zwei in den Regionen<br />
der Verwaltungsstellen Schwandorf, Wertingen und Ansbach und jeweils einer in Würzburg, Bayreuth,<br />
Landshut, Miesbach, Töging und Traunstein. Betreuer sind die staatlichen Fachberater <strong>für</strong> Rinderzucht.<br />
Daneben bieten auch einige Zuchtverbände bzw. Besamungsstationen mit dem Programm OptiBull Anpaarungsberatung<br />
an.<br />
Als weiteres Beratungsangebot soll ein Horizontaler Betriebsvergleich innerhalb der RoboterBetriebe<br />
mit roboterspezifischen Daten wie Zwischenmelkzeiten oder Melkungen je Tier usw. hinzu kommen.<br />
Derzeit gibt es in <strong>Bayern</strong> nahezu 800 Melkroboter.<br />
Zusätzlich soll es eine ‚Beratung zur Umstellung auf neue Melktechnik‘ verbunden mit ‚robo terspezifischer<br />
Fütterungs- und Managementberatung‘ geben.<br />
8
Die Milchleistungsprüfung<br />
Strukturwandel 66 Prozent (24.690 Betriebe) der<br />
bayerischen Milchkuhhalter nutzen die <strong>LKV</strong>Milch leistungsprüfung.<br />
Die Zahl der Betriebe (absolut) sinkt,<br />
der Anteil der MLPBetriebe von allen bayerischen<br />
Milchviehbetrieben steigt. Das heißt, es sind die zukunfts<br />
orientierten Betriebe, die immer mehr die <strong>LKV</strong><br />
Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Aufgrund des <br />
sen sind nahezu 80 Prozent aller bayerischen Milchkühe<br />
MLPKühe.<br />
Die Bestandsgrößen haben sich in Deutschland un ter<br />
schiedlich entwickelt. Durchschnittlich halten die baye<br />
rischen MLP-Betriebe 38,5 Kühe (plus 1,5 zum Vorjahr) – zum Vergleich: 64,2 Kühe (plus 5,2 zum Vorjahr)<br />
in den alten Bundesländern.<br />
Überwachung der MLP<br />
Der Umfang der Bestandsnachprüfungen bleibt wie bisher. In einem Prozent der Betriebe mit<br />
AMethode, und zwei Prozent derer, welche die BMethode nutzen, muss eine Bestandsnachprüfung erfolgen.<br />
Neu: Die staatlichen Sonderprobemelken gibt es seit Herbst letzten Jahres nicht mehr. Um nach wie vor<br />
exakte Daten zu den Inhaltsstoffen von Einzelgemelken zu erhalten, sind zehn Kalibrierungsprobemelken<br />
im Jahr notwendig.<br />
Die Ergebnisse aus den Bestandsnachprüfungen müssen nach einem vorgegebenen Schema bewertet<br />
werden. Bei Abweichungen über die Grenzwerte hinaus muss der Landwirt dazu Stellung nehmen.<br />
Der Trend zu mehr Milch<br />
Für das laufende Prüfungsjahr prognostizierte Uwe<br />
Gottwald „Mehr Milch im Tank“. Denn: Am 8. Januar<br />
dieses Jahres lag die Milchleistung bei 7.255 kg (plus<br />
35 kg) mit 1,3 kg mehr Fett (4,11 Prozent Fettgehalt)<br />
und 1,6 kg mehr Eiweiß (3,49 Prozent Eiweißgehalt).<br />
RDV-4-M bietet eine Vielzahl individueller betrieblicher<br />
Auswertungsmöglichkeiten. Der Milchkuhhalter kann<br />
mit RDV4M zeitnah zum letzten Probemelken seinen<br />
Betrieb checken. RDV-4-M findet immer mehr Nutzer.<br />
<strong>Bayern</strong>weit wurde im zurückliegenden Jahr RDV4M<br />
von mehr als 3.200 Betrieben regelmäßig genutzt,<br />
2010 waren es mehr als 2.500 Betriebe.<br />
10
Die Zugriffe auf RDV4M waren regional unterschiedlich hoch – fast 40 Prozent aller Zugriffe kamen aus<br />
dem Bereich der Verwaltungsstelle Ansbach, gefolgt von Oberfranken mit 30 Prozent, aus Regen kamen<br />
12 Prozent.<br />
Die Zahl der Anwender von RDV-4-M soll von monatlich 2.160 im zurückliegenden Jahr auf 3.000 gesteigert<br />
werden. Insgesamt haben sich mehr als 6.800 Betriebe mit RDV-4-M befasst.<br />
Die <strong>LKV</strong>-Fütterungsberatung<br />
Auch die Fütterungsberatung wird regional unterschiedlich genutzt. Insgesamt haben im letzten Jahr 4.100<br />
Betriebe (16,5 Prozent der MLP-Betriebe) die Fütterungsberatung in Anspruch genommen, davon fast<br />
27 Prozent der MLP-Betriebe aus der Pfaffenhofener Region gefolgt von Würzburg und Wertingen mit<br />
gut 25 Prozent bzw. knapp 22 Prozent. In den Regionen Schwandorf, Regen und Traunstein wird die<br />
Fütterungsberatung nur zögerlich beansprucht.<br />
Zur Viehverkehrsverordnung<br />
95 Prozent aller Meldungen der ViehVerkV gehen über Internet<br />
ein. Während im Jahr 2000 noch 12.100 Karten-Meldungen täglich<br />
beim <strong>LKV</strong> eingingen, waren es im vergangenen Jahr nur noch<br />
1.450.<br />
Die Fleischleistungsprüfung<br />
Ab April dieses Jahres können die Ringassistenten mit einem Wochenplaner die auf einem Betrieb<br />
durchgeführten Tätigkeiten erfassen. Mit dem Wochenplaner werden ein Diensttagebuch und Wochen berichte<br />
erstellt und die Rohdaten <strong>für</strong> die Gehaltsabrechnungen und Reisekosten geliefert.<br />
15 Ringassistenten führen mit dem Wochenplaner eine stundengenaue Erfassung der Betriebsbesuche<br />
durch. Diese ist nach Leistungsprüfung und Beratung getrennt.<br />
Strukturentwicklung<br />
In allen drei Produktionsrichtungen Ferkelerzeugung, Schweinemast und Rindermast setzte sich der<br />
Trend der vergangenen zwanzig Jahr fort: Die Zahl der Betriebe sank, die Herdengröße stieg.<br />
Die Ringassistenten <strong>für</strong> Schweinemast erhalten mit einer zeitnahen Schulung ein neues Programm „Ring<br />
MastSchwein“.<br />
Die Ringassistenten <strong>für</strong> Ferkelerzeugung, Ultraschall, Rindermast und Fischerzeugung bekommen in diesem<br />
Jahr neue Laptops.<br />
Im Programm Ring-Mast-Rind wird ab dem laufenden Wirtschaftsjahr 2011/12 die Nettozunahme<br />
errechnet und ausgewiesen (siehe dazu <strong>LKV</strong>-Mitteilungsblatt, Ausgabe Dezember 2011, Nr. 4, und unter<br />
www.lkv.bayern.de/Veröffentlichungen/Fachbeiträge/Rindermast „Die Leistungsergebnisse Rindermast<br />
2011“.<br />
11
Zu guter Letzt – das leidige Thema Mehrwertsteuer<br />
Die Förderung <strong>für</strong> die Leistungsprüfung unterliegt nicht der Mehrwertsteuer, das ist das Positive <strong>für</strong> die<br />
Landwirte. Jedoch <strong>für</strong> die Förderung der Beratung müssen seit 1. Januar dieses Jahres die Landwirte 19<br />
Prozent Mehrwertsteuer berappen. Das sind <strong>für</strong> alle Beratungs-Landwirte Mehrkosten von rund 400.000<br />
Euro pro Jahr. Landwirte, die der Pauschalbesteuerung unterliegen, können die Mehrwertsteuer nicht<br />
geltend machen.<br />
.<br />
<strong>LKV</strong> intern – das Wichtigste in Kürze<br />
Neustrukturierung der Abteilungen in der <strong>LKV</strong>-Zentrale in München<br />
Um ein geschlossenes Erscheinungsbild zu fördern, wurden die beiden EDVAbteilungen <strong>für</strong> ‚Milchleistungsprüfung‘<br />
und ‚Fleischleistungsprüfung‘ zusammengelegt. Abteilungsleiter ist Dr. Jürgen<br />
Duda, sein Stellvertreter ist Dr. <strong>Josef</strong> Bergermeier. Dr. Jürgen Duda ist wie bisher <strong>für</strong> den Milchbereich<br />
verantwortlich, Dr. <strong>Josef</strong> Bergermeier <strong>für</strong> den Fleischbereich.<br />
Die Werkstatt <strong>für</strong> LactoCorder war bisher der Abteilung ‚EDVTechnik‘ zugeordnet, jetzt gehört sie zur<br />
Fachabteilung ‚Milchleistungsprüfung‘, Abteilungsleiter Reinhard Korndörfer. Der Grund: Die Beschaffung<br />
neuer LactoCorder und Ersatzteile sowie die Organisation des LactoCorderEinsatzes gehören ohnehin zu<br />
den Aufgaben der MLPFachabteilung.<br />
Eine neue Abteilung<br />
Das <strong>LKV</strong> bekommt eine neue Abteilung ‚Beratung‘. Intern im Hause, im Bayerischen Landwirtschaftlichen<br />
Wochenblatt, in der top agrar und auf unserer Homepage wurde eine Stellenanzeige mit den Anforderungen<br />
an den Bewerber / die Bewerberin und dessen / deren Aufgaben veröffentlicht. Neben dem Aufbau der<br />
neuen Abteilung ist der/die neue Kollege/in unter anderem zuständig <strong>für</strong> neue Beratungsangebote, die<br />
Aus und Fortbildung der <strong>LKV</strong>Berater und die Koordinierung schon bestehender Beratungsangebote. Der<br />
Arbeitsschwerpunkt liegt vorerst bei der Milchviehhaltung.<br />
Das <strong>LKV</strong> steht im Wettbewerb mit anderen Beratungsanbietern. Seit Oktober 2008 ist das <strong>LKV</strong> entsprechend<br />
dem Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) als nichtstaatliches Beratungsunternehmen<br />
anerkannt und bietet folgende Beratungsmodule an:<br />
• Fütterungsberatung Milchvieh, Jungvieh, Kälber<br />
Im laufenden Jahr soll die Wirtschaftlichkeit der Fütterungsberatung überprüft werden.<br />
• Qualitätsmilchberatung (Beratung zur Melkroutine, Beratung zur Milchqualität)<br />
• Beratung zur Produktionstechnik Rindermast<br />
• Beratung zur Produktionstechnik Schweinemast<br />
• Beratung zur Produktionstechnik Zuchtsauenhaltung<br />
• Stallklimaberatung<br />
Hinzu kommt die ‚Beratung zur Anpaarung‘ mit dem internetgestützten Anpaarungsprogramm ‚OptiBull‘<br />
und die ‚Beratung zu Automatischen Melksystemen‘, kurz Melkroboter. Zu beiden Beratungsangeboten<br />
laufen derzeit Pilotprojekte.<br />
12
Das <strong>LKV</strong> im Internet<br />
Neu: <strong>LKV</strong> bei Facebook<br />
Das <strong>LKV</strong> nutzt moderne Marketingstrategien und hat deshalb seit Anfang Februar dieses Jahres eine<br />
FacebookSeite. Facebook ist ein MarketingInstrument. Immer mehr Unternehmen auch kleinere und<br />
mittelgroße präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen in Facebook. Wir wollen Facebook <strong>für</strong><br />
die Kommunikation mit den Landwirten nutzen. Beispielsweise könnte auch einmal ein FacebookPortal<br />
‚Beratung <strong>für</strong> die Nutztierhaltung‘ eingerichtet werden.<br />
Gestaltet und eingerichtet wurde sie von Thomas Hauck, <strong>LKV</strong> EDVTechnik, und Edith Luttner, <strong>LKV</strong><br />
Presse und Öffentlichkeitsarbeit. In Zusammenarbeit mit Thomas Hauk betreut und pflegt Edith Luttner<br />
die FacebookSeite. In einem nächsten Schritt wird eine TwitterSeite <strong>für</strong> das <strong>LKV</strong> angelegt (siehe dazu<br />
auch Seite 18).<br />
Wir haben den <strong>LKV</strong>-Imagefilm ins Internet gestellt. Die einzelnen FilmThemen (Qualitäts und Leis tungsprüfung<br />
und Beratung) haben wir den entsprechenden Seiten auf unserer Homepage zugeordnet.<br />
Die InternetSeite ‚Veröffentlichungen‘ erhielt eine neue Struktur. Die Beiträge sind jetzt nach Themen<br />
sortiert, zum Beispiel gibt es unter der Rubrik ‚Beratung‘ eigene Zuordnungen zu den Themen Fütterungsberatung,<br />
Melkberatung etc. Wir denken, dass dadurch unsere Fachartikel schneller gefunden werden.<br />
Auf die Melktechnik kommt es an<br />
Welche Melktechnik soll ich mir anschaffen? Alois Rehrl, <strong>LKV</strong>Melkberater, konnte anlässlich einer Informations<br />
ver anstaltung in Bad Feilnbach des Fachzentrums <strong>für</strong> Milchviehhaltung den Milchkuh haltern<br />
‚nur‘ Tipps geben, worauf sie achten sollten, wenn beispielsweise die alte Melktech nik ausgedient<br />
hat bzw. bei einem Stallneubau eine neue Melktechnik ansteht. Mehr als eineinhalb Stunden zeigte Alois<br />
Rehrl anhand von Bildern in einer Power-Point-Präsentation unterschiedliche Melksysteme – Fisch grä tenmelkstand,<br />
Tandemmelkstand, SidebySideMelkstand, Swing overMelkstand und Melk ka russell mit den<br />
Vor und Nachteilen.<br />
Franz Rehrl vom Fachzentrum <strong>für</strong> Milchviehhaltung am Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
in Traunstein (Alois und Franz Rehrl sind nicht verwandt und nicht verschwägert), hielt einen Vortrag über<br />
Rudi Linner (links) aus dem Chiemgau nutzt die<br />
Gelegenheit und stellt Alois Rehrl seine Situation<br />
vor. Er möchte <strong>für</strong> 50 Kühe einen neuen Stall bauen<br />
und der Melkstand soll ins Altgebäude. Alois Rehrl<br />
gibt Tipps <strong>für</strong> einen besse ren Kuhverkehr. Der<br />
Warteraum vor dem Melkstand muss ausreichend<br />
groß sein und genügend Platz erleich tert auch den<br />
Austrieb.<br />
Rudi Linner hat vor fast zwanzig Jahren den<br />
Hof übernommen. Schon sein Vater nutzte die<br />
Milchleistungsprüfung. Rudi Linner nimmt auch<br />
die <strong>LKV</strong>-Melkberatung und Fütterungsberatung in<br />
Anspruch.<br />
13
Melkroboter. Offiziell spricht man von Automatischen Melk systemen (AMS), Franz Rehrl nennt sie fast<br />
schon liebevoll „Robbi“.<br />
Zurück zu Alois Rehrl, dem <strong>LKV</strong>Melkberater. Er ist neben seiner Tätigkeit als LOP viel auf Betrieben zur<br />
Prüfung der Melkanlagen. Er weiß, wo den Milchkuhhaltern „der Schuh drückt“. Sein wichtigster Rat,<br />
wenn eine neue Melktechnik angeschafft werden soll – sich informieren beispiels wei se beim zuständigen<br />
Fachzentrum <strong>für</strong> Milchviehhaltung, Betriebe besuchen, die Fachpresse studie ren, Unterlagen von<br />
Herstellern anfordern und, und, und … „Das kostet zwar viel Zeit, aber eine neue Melktechnik ist teuer<br />
und man muss viele Jahre mit ihr zu recht kommen“, meinte Alois Rehrl. Welche Art des Melkstandes und<br />
der Melktechnik angeschafft wird, hängt unter anderem von den baulichen Gegebenheiten ab. Wenn die<br />
neue Melktechnik in einen alten Stall eingebaut werden muss, kommt man meist um Kompromisse nicht<br />
herum. „Da ist es manchmal schwierig den Kuhkomfort und den Komfort <strong>für</strong> den Melker unter einen Hut<br />
zu bringen“, meinte Alois Rehrl. Kühe möchten beispielsweise einen hellen Eingangs (und Ausgangs)<br />
bereich, nicht um Ecken biegen, sondern nur geradeaus laufen, ein freies Blickfeld in den Melkstand und<br />
aus den Melkstand heraus, einen trittsicheren und rutschfesten Boden und sie wollen Ruhe. Letzteres ist<br />
auch <strong>für</strong> den, wichtig, der milkt.<br />
Der beste Zitzen und Euterschutz ist ein richtig eingestelltes Melkvakuum.<br />
Hinzu kommen passende Zitzengummis, die ausreichend oft gewechselt<br />
werden müssen. Damit bleiben die Kühe gesund und die Milchqualität stimmt<br />
auch. Alois Rehrl zeigte Bilder von Zitzen mit Verhärtungen, Quetschungen<br />
oder Ringbildung – die Folgen von mangelhafter Melktechnik und Melkarbeit.<br />
„Pulsschlag 180/Minute<br />
Hier eine gesunde Zitze.<br />
… beim Melker, bei der Kuh und beim Pulsator das darf nicht sein“, sagte etwas überspitzt Alois Rehrl.<br />
Der Melker wird dabei krank (der Kuh tut’s auch nicht gut). Alois Rehrl sprach vom ‚Komfort <strong>für</strong> den Melker‘.<br />
Dazu gehört beispielsweise dass dieser die Euter ‚rücken schonend‘ erreichen kann. Das heißt, der Melker<br />
soll sich nicht nach vorne beugen müssen. Alois Rehrl sagte, dass so ein Melkzeug immerhin rund 2,5<br />
Kilo gramm wiegt. Auf Dauer treten durch falsche<br />
Haltung Rücken und Schulterprobleme auf. Wenn<br />
der Boden im Melkstand nach außen zu den Kühen<br />
hin abfällt, steht der Melker automatisch mehr<br />
zum Tier geneigt und hat da mit eine bessere<br />
Arbeitsposition.<br />
Franz Rehrl (links) überreicht an Alois Rehrl<br />
einen kleinen Geschenkkorb unter an de rem mit<br />
bayerischem Käse.<br />
14<br />
Das Melkhaus, bzw. der Melkstand, soll frostsicher<br />
und zugfrei sein. Eine Fußbodenheizung schützt<br />
vor Erkältung und Rheuma. Die Grubentiefe sollte<br />
der Körper grö ße angepasst sein und es gibt auch<br />
verstellbare Roste. Die Breite der Melkstandgrube<br />
sollte sich danach rich ten, wie viele Personen<br />
melken.
In <strong>Bayern</strong> immer mehr Melkroboter – die Kinderkrankheiten sind durch<br />
Franz Rehrl hielt ein Plädoyer ‚Pro Melkroboter‘ und wog das Für und Wider <strong>für</strong> einen Melkroboter ab.<br />
Seit Anfang Januar dieses Jahres seien in <strong>Bayern</strong> etwa 800 Melkroboter im Einsatz, Tendenz steigend.<br />
Die Technik sei inzwischen ausgereift. Beispielsweise könnten dreidimensionale Kameras die Zitzen sehr<br />
gut erkennen. Jedoch steige mit dem Melkroboter nicht automatisch die Milchleistung. Ob man einen<br />
Melkroboter anschafft, kann nicht nach einer Checkliste entschieden werden. Es hängt in di viduell vom<br />
Betrieb ab (eine positive Einstellung zur Technik des Bedienungspersonals, Bestands größe, bauliche<br />
Voraussetzungen, Fütterungsmanagement etc.).<br />
Die Pro-Argumente<br />
Die Melkroboter sind ausgelegt <strong>für</strong> 60 bis 80 Kühe – eine Bestandsgröße, welche zunehmend die zukunftsorientierten<br />
Familienbetriebe in <strong>Bayern</strong> anstreben. Deshalb stehen im Vergleich zu den anderen<br />
Bun desländern in <strong>Bayern</strong> deutlich mehr Melkroboter.<br />
Der Melkroboter lässt uns morgens länger schlafen<br />
Franz Rehrl plädierte im Sinne der Bäuerinnen, die sich laut einer Umfrage der LfL, Agrarökonomie in<br />
München, am meisten mehr freie Zeit wünschen und einmal in der Woche morgens länger als an Werktagen<br />
schlafen wollen. Mit einem Melkroboter können Bäuerin und Bauer länger im Bett bleiben, denn es fallen<br />
die festen Stallzeiten weg.<br />
Franz Rehrl sagte, es gäbe bereits Betriebe, die nicht jeden Tag zur gleichen Zeit in den Stall gehen, damit<br />
sich die Kühe nicht an einen festen Rhythmus gewöhnen, sondern selbst entscheiden wann sie zum<br />
Fressen und zum Melken gehen.<br />
Für den Familienbetrieb<br />
„Ein Melkroboter spart 0,5 AK ein“, sagte Franz Rehrl. Damit tappe die bäuerliche Familie mit einem<br />
Kuhbestand von etwa 70 Kühen (meistens kommt noch die Kalbinnenaufzucht hinzu) nicht in die ‚Arbeitsfalle‘.<br />
Mit einem Melkroboter könne man häufig auf eine Fremdarbeitskraft verzichten. Und ein Familienbetrieb<br />
könne eine wirtschaftliche Durststrecke eher überstehen als ein Betrieb mit Fremd ar beitskräften. Damit<br />
würden die bayerischen Milchkuhhalter auch längerfristig wettbewerbs fähig blei ben.<br />
Wann kommt ein Melkroboter in Frage?<br />
Da gibt es den Betriebsleiter. Die Umstellung vom Melkstand oder von der Rohrmelkanlage auf einen<br />
Melkroboter bedarf der genauen Planung und ist sehr zeitaufwändig. Der Betriebsleiter braucht technisches<br />
Verständnis und muss sich mit Tier und Technik befassen. Die tägliche Stallarbeit bleibt. Der Betriebsleiter<br />
muss erkennen, was die Tierdaten aus dem Computer bedeuten. Er muss mehr Zeit <strong>für</strong> die Tierbeobachtung<br />
aufwenden. Wenn Probleme mit der Eutergesundheit schon beim ‚alten’ Melksystem vorhanden sind, dann<br />
bleiben die auch beim Melkroboter.<br />
15
Da gibt es die baulichen Voraussetzungen. Um in einen bestehenden Stall einen Melkroboter zu installieren,<br />
müssen die räumlichen Voraussetzungen, zum Beispiel ‚sturmfreier Raum vor dem Melk roboter‘<br />
geschaffen werden. ‚Sturmfreier Raum‘, so nannte es Franz Rehrl, bedeutet, dass ausrei chend Platz beim<br />
Zutritt zum Melkroboter vorhanden sein muss, damit auch rangniedrigere Kühe sich an stellen können. Der<br />
Ausgang des Melkroboters muss derart gestaltet sein, dass die Kühe freien Blick haben und gerade heraus<br />
den Melkroboter verlassen können. Bei einem Außenklimastall muss ‚Robbi‘ frostfrei stehen.<br />
Da gibt es das Fütterungsmanagement. Die Kühe müssen mit Kraftfutter in den Melkroboter gelockt werden.<br />
Für Betriebe mit aufgewerteten Mischrationen reicht der Kraftfutterautomat des Robbi, <strong>für</strong> Betriebe ohne<br />
aufgemischtem Grundfutter ist ein extra Kraftfut ter automat sinnvoll.<br />
Da gibt es die Kosten <strong>für</strong> den Melkroboter. Laut Aussage von Franz Rehrl ist die Anschaffung eines Melkroboters<br />
nicht teurer als ein eigenständiges Melkhaus mit einer dem Robbi vergleichbaren Tech nik (Anrüst<br />
Abnahmeautomatik, Zellzahl und Milchmengen messung). Der Wasser und der Strom ver brauch nähern<br />
sich mehr und mehr dem einer herkömmlichen Melkanlage.<br />
Nach der Theorie kam die Praxis<br />
Nachmittags führten Franz Rehrl und <strong>Josef</strong> Schmalzbauer (Foto), Amt <strong>für</strong><br />
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Fachzentrum <strong>für</strong> Milchviehhaltung), je<br />
eine Gruppe zu zwei Milchviehbetrieben, der eine (90 Kühe plus Nachzucht)<br />
mit einem Melkhaus<br />
und Melktechnik „vom<br />
Feinsten“ (Side by Side<br />
mit Schnell austrieb).<br />
Der andere Betrieb<br />
mit 110 Kühen hatte<br />
zwei Melkroboter, die<br />
in einen bestehenden Laufstall integriert wurden.<br />
Beide Betriebe haben eine Milchleistung von gut<br />
9000 kg je Kuh und Jahr.<br />
Das BetriebsleiterEhepaar mit dem Melkhaus<br />
sagte, dass sie ihren Bestand Schritt <strong>für</strong><br />
Schritt auf stocken kön nen. Die Melkarbeit mit<br />
Reinigung des Melk standes daue re gerademal<br />
eine gute Stunde. Mit dem Melken würde man<br />
sich abwechseln, so dass Bauer oder Bäuerin<br />
auch einmal ausschlafen könnten. Damit die<br />
Melktechnik gut funktioniere und <strong>für</strong> die Euterge<br />
Wie funktioniert das? Die Teilnehmer an der<br />
Informationsveranstaltung konnten gar nicht<br />
genug zu sehen bekommen. Sie fragten die<br />
Betriebsleiter regelrecht ‚Löcher in den Bauch‘.<br />
16
sundheit nut zen sie die <strong>LKV</strong>Melk beratung. Der Betriebsleiter mit den Melkrobotern sagte, <strong>für</strong> ihn ist es ein<br />
Stück Lebensqualität, nicht mehr jeden Morgen um 6.00 Uhr im Stall sein zu müssen. Senior und Junior<br />
wechseln sich bei der Stallarbeit ab, damit beide mit den Gegebenheiten vertraut sind. So kann auch jeder<br />
mal ein paar Tage vom Betrieb weg. Beide sagen: „Man muss sich mit der Technik auseinandersetzen.<br />
Wenn beispielsweise der Computer anzeigt, dass eine Kuh auf einem Viertel keine Milch gegeben hat,<br />
dann müssen wir nach der Kuh schauen, was mit dem Euterviertel nicht in Ordnung ist. Tierbeobachtung<br />
und das Abarbeiten der Kontrolllisten ist die Voraussetzung <strong>für</strong> gesunde und leistungsfähige Kühe.“ Auch<br />
auf diesem Be trieb war der <strong>LKV</strong>Melkberater. Beide Betriebe nehmen auch die <strong>LKV</strong>Fütterungsberatung in<br />
An spruch.<br />
Nachruf<br />
Am 20. März 2012 verstarb Gregor Weigl. Der Verstorbene war 1970<br />
Gründungsmitglied des Milcherzeugerringes Weiden, 1974 wurde er<br />
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und 1986 zum Vorsitzenden.<br />
1996 wurde Gregor Weigl zum Vorsitzenden des neugebildeten Milcherzeugerringes<br />
Oberpfalz gewählt. Ab 1986 war er Mitglied im <strong>LKV</strong>-<br />
Ausschuss, von Dezember 1996 bis Juli 2001 war er im <strong>LKV</strong>-Vorstand.<br />
Daneben engagierte sich Gregor Weigl auch <strong>für</strong> die Milchvermarktung <br />
er war im Aufsichtsrat und im Vorstand der Käserei Bayreuth.<br />
Gregor Weigl verfügte über ein enormes Detailwissen in der Milch leis<br />
tungsprüfung. Er war stets darum bemüht, Probleme in Rücksprache und<br />
einvernehmlich mit allen Beteiligten zu lösen und aus der Welt zu schaffen.<br />
Er legte großen Wert darauf, dass fachliche Informationen <strong>für</strong> jeden, der in die Arbeit eingebunden<br />
war, uneingeschränkt zugänglich waren. Er war immer gesprächsbereit und versuchte in gutem Kontakt<br />
zur Verwaltungsstelle und zur <strong>LKV</strong>Zentrale seine fachliche Kompetenz einzubringen. Da<strong>für</strong> erhielt Gregor<br />
Weigl die ‚<strong>LKV</strong>Medaille in Gold‘.<br />
Wir bedauern den Tod von Gregor Weigl. Sein unermüdlicher Einsatz und seine Verdienste <strong>für</strong> das <strong>LKV</strong>, die<br />
Milchleistungsprüfung und damit <strong>für</strong> die bäuerliche Landwirtschaft in <strong>Bayern</strong>, wird uns stets im Bewusstsein<br />
bleiben. Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen.<br />
17
Die <strong>LKV</strong>-Fütterungstechniker und Mitarbeiter aus der <strong>LKV</strong>-Zentrale 2011 in Wisconsin .<br />
Mit dem <strong>LKV</strong> nach Wisconsin - “Americas Dairyland”!<br />
Erleben Sie vom 1. bis 8. Oktober 2012 die Milchproduktion in Wisconsin, dem Milchstaat ‚Nummer<br />
1’ in den Vereinigten Staaten! Profitieren Sie von praxisnah dargestellten Forschungsergebnissen der<br />
renommierten Universität in Madison, diskutieren Sie mit den Farmern auf deren Betrieben und besuchen<br />
Sie die weltgrößte Milchviehausstellung „WorldDairyExpo” in Madison. Englisch kenntnisse sind nicht<br />
notwendig, denn eine fachkundige Reiseleitung übersetzt!<br />
Die Reise wurde schon öfter durchgeführt. Sie ist perfekt organisiert. Sie profitieren von den neuesten<br />
Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung. Sie erhalten Tipps ‚aus der Praxis — <strong>für</strong> die Praxis’. Die<br />
Kos ten betragen ca. € 1.650,–. Im Preis enthalten sind Flug, Übernachtung mit Frühstück, Bus, Betriebsbesichtigungen,<br />
Vorträge, Über set zung. Anmeldungen bzw. Rückfragen richten Sie bitte bis 16. April an<br />
Tel. 089/54 43 48-0 oder an poststelle@lkv.bayern.de.<br />
Besuchen Sie uns auf unserer FacebookSeite.<br />
Damit haben Sie immer Aktuelles aus erster<br />
Hand.<br />
Einen Link auf unsere Facebook-Seite finden<br />
Sie unter www.lkv.bayern.de<br />
18
Landeskuratorium der Erzeugerringe<br />
<strong>für</strong> tierische Veredelung in <strong>Bayern</strong> e.V.<br />
Haydnstr. 11, 80336 München<br />
Tel.: 089/544348-0, Fax: 089/544348-10<br />
Internet: www.lkv.bayern.de<br />
EMail: poststelle@lkv.bayern.de<br />
Vorsitzender <strong>Josef</strong> Bauer<br />
Geschäftsführer Uwe Gottwald