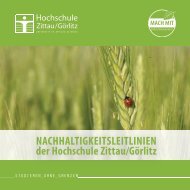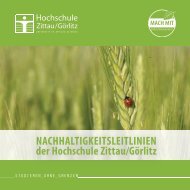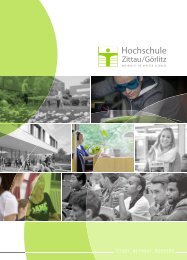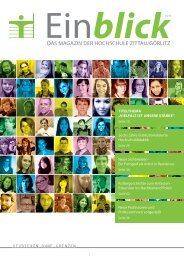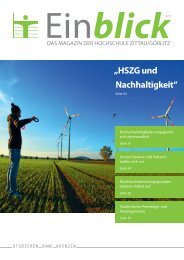Einblick 01/2018: Titelthema "Gesunde Kultur - so läuft Gesundheitsmanagement an der HSZG"
Magazin der Hochschule Zittau/Görlitz
Magazin der Hochschule Zittau/Görlitz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Einblick</strong> // Inhaltsverzeichnis<br />
28<br />
40 32<br />
GESUNDE KULTUR<br />
6 Gesundheit ist ein wichtiges Gut<br />
Für eine Hochschule ist es wichtig, dass es<br />
ihren Mitarbeitern gut geht.<br />
8 Beruf und Privates vereinen<br />
9 Einfach loslegen und kreativ<br />
sein!<br />
10 Bauchnabel küsst Wirbelsäule<br />
Unsere Autorin macht jeden Dienstag mit 15<br />
Rentnern Sport, die viel fitter sind als sie.<br />
13 Rückzug<strong>so</strong>rte für Eltern schaffen<br />
14 Gesundheit gut – alles GUt!<br />
Bereits im vierten Jahr f<strong>an</strong>den die Gesundheits-<br />
und Umwelttage (GUt) statt.<br />
HOCHSCHULE<br />
16 Newsletter Qualitätsm<strong>an</strong>agement<br />
17 Aktuelles aus <strong>der</strong> Hochschule<br />
20 Proaktiv in die Zukunft<br />
Die HSZG hat ihre Pl<strong>an</strong>ungen bis zum Jahr<br />
2025 unter Dach und Fach.<br />
22 Per<strong>so</strong>nal entwickeln und för<strong>der</strong>n<br />
23 Kunst wie<strong>der</strong> erlebbar machen!<br />
FORSCHUNG UND TRANSFER<br />
24 Im Alter auf Technik vertrauen<br />
VATI möchte älteren Menschen den Umg<strong>an</strong>g<br />
mit Assistenzsystemen nahebringen.<br />
28 Wege in eine neue Gesundheitskultur<br />
Görlitzer entwickeln praktische Forschungsräume.<br />
30 Neue E-Info Plattform<br />
AMiCE steht für mehr Wettbewerbsfähigkeit<br />
und lebendige Partnerschaften.<br />
2
Inhaltsverzeichnis // <strong>Einblick</strong><br />
10 36<br />
9 38<br />
STUDIUM UND LEHRE<br />
31 Sieben neue Ingenieurpädagogen<br />
Ingenieurdidaktische Kompetenz von<br />
Hochschulmitarbeitern <strong>der</strong> MINT-Fakultäten<br />
wird geför<strong>der</strong>t.<br />
32 „Um diese Menschen habe ich<br />
große Angst“<br />
Gerald Hüther im Interview über Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
und wie wir sie meistern<br />
können.<br />
MENSCHEN<br />
40 Heute schon gestern getroffen?<br />
Ein bek<strong>an</strong>nter Yogi-Meister aus Nepal<br />
kommt nach Görlitz.<br />
42 Herausragende Leistungen<br />
45 Neuberufungen<br />
48 Verabschiedungen<br />
34 Perspektive gewechselt<br />
INTERNATIONALES<br />
35 Auslän<strong>der</strong>in im Quadrat<br />
36 Die HSZG im Lernraum mit<br />
Tschechien<br />
Fünf wissenschaftliche Bibliotheken<br />
entwickeln einen grenzüberschreitenden<br />
Lernraum.<br />
38 Studienreise nach Schottl<strong>an</strong>d<br />
Masterstudierende reisen zum World Symposium<br />
of Responsibility <strong>an</strong>d Sustainability<br />
in Edinburgh.<br />
RUBRIKEN<br />
5 Blickf<strong>an</strong>g<br />
26 Poster Rückenschule im Büro<br />
Nur einige Minuten Bürogymnastik pro Tag<br />
können helfen, Beschwerden vorzubeugen.<br />
51 Fernblick<br />
3
EDITORIAL<br />
Liebe Leser und Leserinnen,<br />
2<strong>01</strong>4 fing es <strong>an</strong>: als ich aus meiner Elternzeit<br />
zurück in den Job kam, wollte ich<br />
wie gewohnt mit dem Fahrstuhl in mein<br />
Büro im vierten Stock fahren. Doch über<br />
dem Fahrstuhlknopf pr<strong>an</strong>gte unübersehbar<br />
ein Plakat, das mich dazu auffor<strong>der</strong>te,<br />
die Treppe zu nehmen. Ertappt<br />
schaute ich mich um. In mein Blickfeld<br />
geriet ein Aufsteller, <strong>der</strong> mir vorrechnete,<br />
wie oft ich die Treppe bis zu meinem<br />
Büro hochsteigen müsste, um ein Stück<br />
Schokolade zu verbrennen. G<strong>an</strong>ze 9,5<br />
Mal! Für ein Stück Schokolade! Okay gut,<br />
d<strong>an</strong>n eben die Treppe. Irgendjem<strong>an</strong>d<br />
war auch noch <strong>so</strong> clever und beschriftete<br />
die einzelnen Treppenstufen mit <strong>der</strong><br />
Kalorienzahl, die ich beim Erklimmen<br />
<strong>der</strong> selbigen verbrauche. Immerhin<br />
g<strong>an</strong>ze 0,030 kcal pro Stufe.<br />
Foto: HSZG<br />
Von da <strong>an</strong> spielte sich jeden Morgen,<br />
nach je<strong>der</strong> Mittagspause und jedem<br />
Dienstg<strong>an</strong>g die gleiche Diskussion in<br />
meinem Kopf ab: Treppe o<strong>der</strong> Fahrstuhl?<br />
Wenn ich recht überlege gab es<br />
diese innere Debatte auch schon früher.<br />
Aber nun redeten An<strong>der</strong>e mit: das<br />
Plakat, <strong>der</strong> Aufsteller, die Treppenstufen.<br />
Recht schnell d<strong>an</strong>n auch Kollegen.<br />
Mit dem Ergebnis, dass immer öfter die<br />
Treppe gew<strong>an</strong>n. Es war in diesen Tagen<br />
wirklich sehr schwer, sich für den Fahrstuhl<br />
zu entscheiden.<br />
Und das war gut <strong>so</strong>. Als recht sportlicher<br />
Mensch hatte ich mir bis dato nicht <strong>so</strong><br />
viele Ged<strong>an</strong>ken über Bewegung im<br />
Alltag gemacht. Als berufstätige Mehrfach-Mutter<br />
stellte ich jedoch schnell<br />
fest, dass ich mein früheres Sportpensum<br />
nicht mehr schaffe. Als ich mich<br />
d<strong>an</strong>n auch noch hochmotiviert mit<br />
einem Schrittzähler ausstattete und<br />
feststellte, das ich <strong>an</strong> einem normalen<br />
Arbeitstag meilenweit von den empfohlenen<br />
10.000 Schritten pro Tag entfernt<br />
bin, war klar, dass mehr Bewegung<br />
in meinen Arbeitstag muss.<br />
Kollegen besuchen <strong>an</strong>statt <strong>an</strong>zurufen,<br />
die Mittagspause für einen Spazierg<strong>an</strong>g<br />
nutzen, mit dem Bus o<strong>der</strong> Fahrrad auf<br />
Arbeit kommen, Treppe statt Fahrstuhl.<br />
Das klappt schon mal g<strong>an</strong>z gut. Im kommenden<br />
Semester werde ich mich beim<br />
Hochschulsportkurs Rückenfit <strong>an</strong>melden.<br />
Auch wenn meine Kollegin Sophie<br />
Herwig mich da nicht haben möchte<br />
(lesen Sie auf Seite 10). Gegen die obligatorischen<br />
Versp<strong>an</strong>nungen und Rückenschmerzen<br />
helfen mir Übungen am<br />
Schreibtisch o<strong>der</strong> kleine Yogaeinheiten.<br />
Und warum erzähle ich Ihnen nun all<br />
das? Die Hochschule Zittau/Görlitz ist<br />
ein Arbeitgeber, <strong>der</strong> die Gesundheit<br />
seiner Mitarbeiter in den Fokus rückt.<br />
Das zeigt sich <strong>an</strong> vielen Puzzleteilen,<br />
wie den Gesundheits- und Umwelttagen<br />
mit Schrittzählerchallenge und<br />
Hochschul-Stadt-Firmen-Lauf, den vielfältigen<br />
Hochschulsport<strong>an</strong>geboten, Rückenscreenings,<br />
flexiblen Arbeitszeiten,<br />
<strong>der</strong> Befragung zur psycho<strong>so</strong>zialen Lage<br />
<strong>so</strong>wie <strong>der</strong> Möglichkeit zur Telearbeit.<br />
Und es m<strong>an</strong>ifestiert sich in dem Vorhaben<br />
ein Betriebliches <strong>Gesundheitsm<strong>an</strong>agement</strong><br />
einzuführen. In dieser „<strong>Gesunde</strong>n<br />
<strong>Kultur</strong>“ fällt es mir leichter, auf<br />
mich zu achten.<br />
Die „Nimm-doch-mal-die Treppe-Aktion“<br />
war übrigens ein Projekt unseres<br />
Mach-Mit-Umweltm<strong>an</strong>agement-Teams.<br />
D<strong>an</strong>ke <strong>an</strong> dieser Stelle für den Stups in<br />
die richtige Richtung. Ein Problem habe<br />
ich jedoch: für die Treppenstufenbil<strong>an</strong>z<br />
fehlt mir inzwischen mein Büro in <strong>der</strong><br />
vierten Etage unseres alten Verwaltungsgebäudes.<br />
Im Namen <strong>der</strong> Redaktion wünsche ich<br />
Ihnen Freude beim Lesen und Impulse<br />
für ihr Wohlbefinden. Zum Beispiel mit<br />
Tipps zum Stressabbau von Yogameister<br />
und Naturarzt Dr. Subodh o<strong>der</strong> mit<br />
<strong>der</strong> praktischen Übungsreihe für den<br />
Arbeitsplatz zum Herausnehmen.<br />
Herzlich,<br />
Ihre Antje Pfitzner<br />
PS: Mein persönliches Highlight dieser<br />
Ausgabe ist unser Interview mit dem<br />
renommierten Neurobiologen Gerald<br />
Hüther auf Seite 32.<br />
4
1<br />
GESUNDHEIT IST EIN WICHTIGES GUT<br />
Für eine Hochschule ist es wichtig, dass es ihren Mitarbeitern gut geht. Nur wer gesund<br />
ist, k<strong>an</strong>n forschen, lehren o<strong>der</strong> verwalten – schlicht seinen Job gut machen. Das<br />
gilt <strong>so</strong>wohl für die physische als auch für die psychische Gesundheit. Darum wird <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> HSZG ein betriebliches <strong>Gesundheitsm<strong>an</strong>agement</strong> eingeführt. Christoph Duscha,<br />
Dezernent für Per<strong>so</strong>nal und Recht, erzählt im Interview, was es damit auf sich hat.<br />
DAS INTERVIEW FÜHRTE SABRINA WINTER<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
HERR DUSCHA, WIE FUNKTIO-<br />
NIERT DAS BETRIEBLICHE GE-<br />
SUNDHEITSMANAGEMENT AN<br />
DER HSZG?<br />
Wir verstehen darunter die Zusammenführung<br />
von drei Pfeilern: Gesundheitsför<strong>der</strong>ung,<br />
Arbeitsschutz und betriebliches<br />
Einglie<strong>der</strong>ungsm<strong>an</strong>agement. Im<br />
betrieblichen <strong>Gesundheitsm<strong>an</strong>agement</strong><br />
wollen wir diese drei Gebiete vereinen.<br />
Unser Fokus liegt dabei auf dem<br />
Per<strong>so</strong>nal <strong>der</strong> Hochschule.<br />
DIESE BEGRIFFE KLINGEN ET-<br />
WAS SPERRIG. NEHMEN WIR<br />
DAS BETRIEBLICHE EINGLIEDE-<br />
RUNGSMANAGEMENT: WAS<br />
STECKT DAHINTER?<br />
Als Arbeitgeber wollen wir dafür <strong>so</strong>rgen,<br />
dass kr<strong>an</strong>ke Mitarbeiter wie<strong>der</strong> <strong>an</strong><br />
ihren Arbeitsplatz zurückkehren können.<br />
Das gibt auch das Sozialgesetzbuch<br />
vor. Wenn jem<strong>an</strong>d länger als sechs<br />
Wochen kr<strong>an</strong>k ist, bieten wir ihm o<strong>der</strong><br />
ihr ein Gespräch <strong>an</strong>. Wir versuchen d<strong>an</strong>n<br />
gemeinsam eine Lösung zu finden, um<br />
die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden.<br />
UND WAS MACHEN SIE IM BE-<br />
REICH GESUNDHEITSFÖRDE-<br />
RUNG?<br />
Dar<strong>an</strong> arbeiten wir gerade. Es geht darum,<br />
die Gesundheit unserer Mitarbeiter<br />
zu unterstützen - <strong>so</strong>wohl physisch<br />
als auch psychisch. Wir fragen uns: Wie<br />
k<strong>an</strong>n die Gesundheit besser geför<strong>der</strong>t<br />
werden? Das fängt bei <strong>der</strong> Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Kommunikation <strong>an</strong>, geht über<br />
„Wir wollen das betriebliche <strong>Gesundheitsm<strong>an</strong>agement</strong><br />
nachhaltig und sinnvoll etablieren“<br />
CHRISTOPH DUSCHA<br />
Kurs<strong>an</strong>gebote des Hochschulsports und<br />
hört z.B. bei <strong>der</strong> Unterstützung durch<br />
technische Geräte wie zum Beispiel ein<br />
Ballonkissen für den Bürostuhl auf.<br />
DER DRITTE PFEILER IST DER<br />
ARBEITSSCHUTZ.<br />
WAS PASSIERT IN DIESEM BE-<br />
REICH?<br />
Darunter fallen Br<strong>an</strong>d- und Katastrophenschutz,<br />
Arbeitsschutzbeleh-<br />
6
<strong>Titelthema</strong> // <strong>Einblick</strong><br />
rungen, medizinische Vor<strong>so</strong>rgeuntersuchungen.<br />
Außerdem haben wir<br />
gesetzliche Beauftragte für Projekte<br />
und Geräte, zum Beispiel für Strahlenschutz,<br />
<strong>so</strong>wie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit.<br />
Ein neues Feld im Bereich Arbeitsschutz<br />
ist die psychische Belastung <strong>der</strong> Mitarbeiter.<br />
UM MEHR ÜBER DIE PSYCHO-<br />
SOZIALE SITUATION AM AR-<br />
BEITSPLATZ HERAUSZUFINDEN,<br />
HAT DIE HSZG EINE BEFRA-<br />
GUNG UNTER IHREN MITARBEI-<br />
TERN DURCHGEFÜHRT.<br />
WAS KAM DABEI HERAUS?<br />
Im Vergleich mit Referenzwerten aus<br />
g<strong>an</strong>z Deutschl<strong>an</strong>d haben wir überdurchschnittlich<br />
abgeschnitten bei <strong>der</strong><br />
Verbundenheit mit dem Arbeitsplatz,<br />
<strong>der</strong> Vorhersagbarkeit <strong>der</strong> Arbeit, dem<br />
Vertrauen und <strong>der</strong> Gerechtigkeit <strong>so</strong>wie<br />
bei <strong>der</strong> Unterstützung während <strong>der</strong> Arbeit.<br />
Es gibt zwei Punkte, bei denen wir sagen:<br />
Da <strong>so</strong>llten wir uns auf alle Fälle verbessern.<br />
Der erste ist das Feedback-Verhalten.<br />
Die Mitarbeiter wünschen sich<br />
mehr Rückmeldungen von ihren Vorgesetzten.<br />
Das ist ein Thema für unsere<br />
Führungskräfte. Der zweite Punkt ist die<br />
Menge <strong>so</strong>zialer Kontakte, die einigen zu<br />
gering ist.<br />
WELCHE MASSNAHMEN LEITEN<br />
SIE DARAUS AB, UM DIE SITUA-<br />
TION DER MITARBEITER ZU VER-<br />
BESSERN?<br />
Natürlich haben wir uns gefragt: Wie<br />
gehen wir damit um? Zunächst haben<br />
wir die Befunde <strong>an</strong> die Fakultäten weitergeleitet.<br />
Dort wurden sie diskutiert.<br />
Im Frühjahr konnten Mitarbeiter dem<br />
Arbeitskreis zum betrieblichen <strong>Gesundheitsm<strong>an</strong>agement</strong><br />
Verbesserungsvorschläge<br />
vortragen.<br />
Nun sind wir dabei, Maßnahmen umzusetzen.<br />
Zum Beispiel wollen wir Schulungen<br />
für Führungskräfte <strong>an</strong>bieten. In<br />
ihnen wird es um Gleichbeh<strong>an</strong>dlung,<br />
Per<strong>so</strong>nalführung und Achtsamkeit gehen.<br />
Dazu muss m<strong>an</strong> wissen: An Hochschulen<br />
werden einige Führungskräfte<br />
in ihr Amt gewählt. Es k<strong>an</strong>n sein, dass<br />
sie vorher nicht im Bereich <strong>der</strong> Per<strong>so</strong>nalführung<br />
gearbeitet haben. Weiterhin<br />
wollen wir den Hochschulsport beauftragen,<br />
sich um die Hilfsgeräte für den<br />
Arbeitsplatz und Sportkurse für Mitarbeiter<br />
zu kümmern.<br />
SIE HABEN GERADE DEN AR-<br />
BEITSKREIS ZUM BETRIEBLI-<br />
CHEN GESUNDHEITSMANAGE-<br />
MENT ERWÄHNT. ES GIBT IHN<br />
SEIT DEM FRÜHJAHR 2<strong>01</strong>7.<br />
WARUM WURDE ER GEGRÜN-<br />
DET?<br />
Gesundheit ist ein wichtiges Gut. Wir<br />
wollen das betriebliche <strong>Gesundheitsm<strong>an</strong>agement</strong><br />
nachhaltig und sinnvoll<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG etablieren. Dazu brauchen<br />
wir ein strategisches Gesamtkonzept.<br />
Darum hat das Rektorat den Arbeitskreis<br />
gegründet und unter die Leitung<br />
<strong>der</strong> K<strong>an</strong>zlerin gestellt.<br />
WAS SIND IHRE AUFGABEN ALS<br />
DEZERNENT FÜR PERSONAL<br />
UND RECHT?<br />
Mein Dezernat kümmert sich um die<br />
beiden Pfeiler betriebliches Einglie<strong>der</strong>ungsm<strong>an</strong>agement<br />
und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung.<br />
2<strong>01</strong>6 hat die Hochschule<br />
eine Abteilung für Per<strong>so</strong>nalentwicklung<br />
gegründet. Diese ist für Per<strong>so</strong>nalbindung<br />
und -erhaltung zuständig und das<br />
umfasst wie<strong>der</strong>um das Einglie<strong>der</strong>ungsm<strong>an</strong>agement<br />
und die Gesundheitsför<strong>der</strong>ung.<br />
Der Pfeiler Arbeitsschutz liegt<br />
nicht im Dezernat Per<strong>so</strong>nal und Recht.<br />
Dafür gibt es eine Fachkraft für Arbeitsschutz,<br />
die direkt <strong>der</strong> K<strong>an</strong>zlerin unterstellt<br />
ist.<br />
DIE HSZG BIETET IHREN MITAR-<br />
BEITERN AUCH GLEITENDE AR-<br />
BEITSZEITEN.<br />
WIE SIND DIESE GEREGELT?<br />
Das ist auch ein wichtiger Punkt des betrieblichen<br />
<strong>Gesundheitsm<strong>an</strong>agement</strong>s!<br />
Unser System ist sehr flexibel. Wir haben<br />
eine Rahmenarbeitszeit von 6:00 Uhr bis<br />
22:00 Uhr und es gibt keine Kernarbeitszeit.<br />
Damit können sich die Mitarbeiter<br />
ihre Arbeit eigenver<strong>an</strong>twortlich einteilen.<br />
Das wird sehr gut <strong>an</strong>genommen.<br />
Zusätzlich bieten wir Telearbeit <strong>an</strong>, al<strong>so</strong><br />
Homeoffice. Mitarbeiter können teilweise<br />
zu Hause arbeiten, wenn die Hochschule<br />
eine Individualvereinbarung mit<br />
dem Mitarbeiter abgeschlossen hat.<br />
Außerdem wollen wir familienfreundlich<br />
sein: Lehrende mit Kin<strong>der</strong>n unter 12<br />
Jahren <strong>so</strong>llen auf Antrag bis 14:00 Uhr in<br />
<strong>der</strong> Lehre eingesetzt werden, damit sie<br />
ihre Kin<strong>der</strong> von <strong>der</strong> KITA o<strong>der</strong> Schule abholen<br />
können.<br />
IM RAHMEN DES BETRIEBLI-<br />
CHEN GESUNDHEITSMANAGE-<br />
MENTS WERDEN WORKSHOPS<br />
ANGEBOTEN. WAS FÜR WEL-<br />
CHE?<br />
In Kooperation mit einer Kr<strong>an</strong>kenkasse<br />
gab es einen Workshop zur positiven<br />
Psychologie und Achtsamkeit. Er war<br />
vollständig ausgebucht. Wir können uns<br />
gut vorstellen, ihn zu wie<strong>der</strong>holen. Außerdem<br />
wollen wir die Fort- und Weiterbildung<br />
von Mitarbeitern för<strong>der</strong>n und<br />
Inhouse-Schulungen <strong>an</strong>bieten.<br />
WAS IST DAS BESONDERE AM<br />
BETRIEBLICHEN GESUNDHEITS-<br />
MANAGEMENT DER HSZG?<br />
Ich glaube, unser flexibles Arbeitszeitmodell<br />
unterscheidet uns von <strong>an</strong><strong>der</strong>en<br />
Hochschulen. Außerdem gibt es einmal<br />
im Jahr ein verpflichtendes Mitarbeiter-<br />
Vorgesetzten-Gespräch. Das dient nicht<br />
<strong>der</strong> Beurteilung. Es <strong>so</strong>llen beide auf<br />
Augenhöhe über die gemeinsame Zusammenarbeit,<br />
Arbeitsbedingungen,<br />
Kommunikation, Qualifizierungen und<br />
<strong>so</strong> weiter sprechen. Wir sind mit diesem<br />
Gesprächs<strong>an</strong>gebot sehr zufrieden. Es<br />
bietet einen wun<strong>der</strong>baren Rahmen, um<br />
sich immer wie<strong>der</strong> aufein<strong>an</strong><strong>der</strong> abzustimmen.<br />
1<br />
Regierungsdirektor<br />
Christoph Maria Duscha<br />
7
<strong>Einblick</strong> // <strong>Titelthema</strong><br />
BERUF UND PRIVATES VEREINEN<br />
Solvig L<strong>an</strong>gschwager nutzt die Vorteile <strong>der</strong> Telearbeit <strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG, wenn ihr Job sie<br />
nicht gerade in ferne Län<strong>der</strong> verschlägt.<br />
VON SABRINA WINTER<br />
Ohne Telearbeit würde es für Solvig<br />
L<strong>an</strong>gschwager nicht funktionieren. Nur<br />
<strong>an</strong> ihrem Schreibtisch zu Hause k<strong>an</strong>n sie<br />
störungsfrei und zusammenhängend<br />
arbeiten. Das nutzt sie vor allem, um<br />
Lehrver<strong>an</strong>staltungen zu pl<strong>an</strong>en. „Es ist<br />
eine schöne, aber <strong>an</strong>spruchsvolle Aufgabe,<br />
die Lehre ordentlich vorzubereiten“,<br />
sagt die Lehrkraft für be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e<br />
Aufgaben des Tourismusm<strong>an</strong>agements.<br />
Sie arbeitet <strong>an</strong> <strong>der</strong> Fakultät M<strong>an</strong>agement-<br />
und <strong>Kultur</strong>wissenschaften und<br />
hat mit <strong>der</strong> Hochschule Telearbeitszeiten<br />
vereinbart: Im Sommersemester arbeitet<br />
sie <strong>an</strong> zwei Tagen pro Woche zu<br />
Hause und im Wintersemester <strong>an</strong> einem<br />
Tag. Denn im Winter betreut sie mehr<br />
Studierende und ist darum öfter am<br />
Görlitzer St<strong>an</strong>dort <strong>der</strong> HSZG.<br />
Dieses Arbeitsmodell ermöglicht es ihr,<br />
Privates und Beruf zu vereinen. Als Alleinerziehende<br />
hat sie durch die Telearbeit<br />
mehr Freiraum, sich um ihr Kind zu<br />
kümmern. „Ich k<strong>an</strong>n mit <strong>der</strong> Zeit jonglieren,<br />
zum Beispiel, wenn mein Kind<br />
einen Arzttermin hat“, erklärt sie. Hinzu<br />
kommt, dass Solvig L<strong>an</strong>gschwager zu<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
1<br />
Hause ungestört und kreativ arbeiten<br />
k<strong>an</strong>n: „Meine Tage <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
sind bestimmt durch Unterricht, Treffen<br />
mit Kollegen und Studierenden,<br />
Projektarbeiten und Konsultationen.<br />
Im Homeoffice k<strong>an</strong>n ich kreativ denken,<br />
Lehrver<strong>an</strong>staltungen methodisch aufbereiten<br />
und Klausuren kontrollieren.“<br />
24 Semesterwochenstunden unterrichtet<br />
die 48-Jährige. Außerdem ist sie für<br />
die berufsbegleitenden Studiengänge<br />
ver<strong>an</strong>twortlich, die die HSZG in Österreich<br />
<strong>an</strong>bietet. Mit dem Masterstudieng<strong>an</strong>g<br />
Internationales Tourismusm<strong>an</strong>agement<br />
ist Solvig L<strong>an</strong>gschwager im<br />
Foto: privat<br />
2<br />
April 2<strong>01</strong>8 nach Vietnam gereist. Jedes<br />
Jahr findet im Modul „Zukunftswerkstatt“<br />
eine Exkursion in ein <strong>an</strong><strong>der</strong>es L<strong>an</strong>d<br />
statt. „Im Studium müssen wir raus in<br />
die Praxis und uns Beispiele <strong>an</strong>sehen. Vietnam<br />
ist da sehr interess<strong>an</strong>t! Wir wollen<br />
dort den Tourismus för<strong>der</strong>n und gleichzeitig<br />
die Bevölkerung vor Ort inkludieren“,<br />
erklärt die Lehrkraft für be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e<br />
Aufgaben. Die Exkursionsgruppe hat in<br />
Vietnam die Universitäten in H<strong>an</strong>oi, Da<br />
Lat und Th<strong>an</strong>h Hoa besucht. Aufgabe<br />
<strong>der</strong> Studierenden ist es, zum Thema Destinationsentwicklung<br />
ein Konzept für<br />
eine l<strong>an</strong>gfristige Kooperation mit den<br />
vietnamesischen Universitäten zu erarbeiten.<br />
Seit einigen Jahren org<strong>an</strong>isiert<br />
Solvig L<strong>an</strong>gschwager die Exkursion des<br />
Masterstudieng<strong>an</strong>ges – gemeinsam mit<br />
Profes<strong>so</strong>rin Ute Pflicke und Studierenden.<br />
Jedes Jahr mit einem neuen Ziel:<br />
„Wir waren schon in Alb<strong>an</strong>ien, Estl<strong>an</strong>d<br />
und Montenegro unterwegs.“<br />
Die gebürtige Görlitzerin hat <strong>an</strong> <strong>der</strong> TU<br />
Dresden Betriebswirtschaft studiert und<br />
dort im Taschenbergpalais gearbeitet.<br />
1996 verteidigt sie ihre Diplomarbeit.<br />
D<strong>an</strong>ach will sie nach Griechenl<strong>an</strong>d gehen.<br />
Doch ihre Betreuerin Margita Großm<strong>an</strong>n<br />
nimmt zu <strong>der</strong> Zeit eine Professur<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG <strong>an</strong>. Sie überzeugt Solvig<br />
L<strong>an</strong>gschwager mitzukommen und als<br />
Lehrkraft für be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e Aufgaben zu arbeiten.<br />
Al<strong>so</strong> kehrt Solvig L<strong>an</strong>gschwager<br />
in ihre alte Heimat zurück. Noch heute<br />
unterrichtet sie am liebsten Hotelm<strong>an</strong>agement,<br />
denn schließlich kommt sie<br />
aus <strong>der</strong> Hotellerie.<br />
Dipl.-Kffr.<br />
1 Solvig L<strong>an</strong>gschwager 2<br />
Mit Studierenden reiste<br />
Solvig L<strong>an</strong>gschwager im<br />
April 2<strong>01</strong>8 nach Vietnam.<br />
Kontakt<br />
s.l<strong>an</strong>gschwager@hszg.de<br />
8
1<br />
BAUCHNABEL KÜSST WIRBELSÄULE<br />
Seit Oktober bin ich Mitarbeiterin <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule und gehe jeden Dienstag 15:30<br />
Uhr zu Rücken-Fit für Mitarbeiter. Dort mache ich mit 15 Rentnern Sport, die alle viel<br />
fitter sind als ich.<br />
Foto: Sophie Herwig<br />
VON SOPHIE HERWIG<br />
Ich wollte meine Haltung verbessern.<br />
Und den l<strong>an</strong>gen Tagen am Schreibtisch<br />
vorbeugen. Als ich die kleine Sporthalle<br />
am Pistoiaer Weg, Ecke Schwenniger<br />
Weg, betrete, sehe ich weiße Haare und<br />
Gymnastikbälle. Ich denke, ich habe<br />
mich im Kurs geirrt und alle im Kurs denken,<br />
ich habe mich in <strong>der</strong> Tür geirrt. Ich<br />
bin fünf Minuten zu spät – alle hüpfen<br />
schon auf grünen Bällen zu einem Schlager<br />
aus den Sechzigern. Die Zeit, in <strong>der</strong><br />
die meisten <strong>der</strong> Kursteilnehmer <strong>so</strong> jung<br />
waren wie ich heute. Ich verkneife mir<br />
einen Lach<strong>an</strong>fall, nehme mir einen Ball<br />
und hüpfe mit. Tipp rechts, tipp links,<br />
Arme öffnen links, Arme öffnen rechts.<br />
Vorne macht die Kursleiterin Sonja Bratoew<br />
die Übungen vor: „Vier Mal noch,<br />
jede Seite. Rechts, links, fe<strong>der</strong>n, kreisen,<br />
paddeln.“ Hinter ihr steht ein großer<br />
Spiegel, <strong>der</strong> alles sieht und nur bei Sehschwäche<br />
verzeiht. Die haben hier alle,<br />
nur ich noch nicht. Die Augen-H<strong>an</strong>d-<br />
Koordination ist wichtig bei <strong>der</strong> Erwärmung.<br />
Bei mir ist sie nonexistent. Viele<br />
<strong>der</strong> Kursteilnehmer tragen Klamotten<br />
und Schuhe von Adidas, Nike und Ski-<br />
Pullover aus den 80ern. Je<strong>der</strong> Hipster<br />
aus Berlin würde aus meinem Rückenfitkurs<br />
eine Themenparty im Berghain<br />
machen.<br />
Nie geht eine Übung länger, als das Lied<br />
im Hintergrund. Wenn Sonja Bratoew<br />
die CD mit <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Musik einlegt,<br />
kommen Lie<strong>der</strong> aus den Nuller Jahren.<br />
Alles ist perfekt abgestimmt. Dafür<br />
macht Sonja diesen Kurs auch schon<br />
sehr l<strong>an</strong>g. Er hieß nicht immer Rücken-<br />
Fit. Zu DDR Zeiten war es die Funktionelle<br />
Gymnastik, d<strong>an</strong>n kam die Popgymnastik,<br />
d<strong>an</strong>n Yoga. Obwohl Sonja<br />
Bratoew sagt, dass sie eher da war als<br />
Yoga. Sie war eh vor allen da, 40 Jahre<br />
l<strong>an</strong>g war sie Sportlehrerin <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
in Zittau. Und 1985 fing sie mit<br />
den Kursen <strong>an</strong>. Für HSZG-Mitarbeiter,<br />
ehemalige Mitarbeiter und Gäste. Viele<br />
Kursteilnehmer kommen seit über 30<br />
Jahren zu Sonja. Wie Helga. Helga hat<br />
auch mal die Kerze versucht, sich aber<br />
fast verrenkt. Sie ist 78 und macht seit<br />
18 Jahren bei Sonja Sport. Heute gibt<br />
es im Rücken-Fit Kurs auch Yoga-Elemente,<br />
meist am Ende <strong>der</strong> Stunde, und<br />
eher fürs Stretching. Die Erwärmung am<br />
Beginn <strong>der</strong> Stunde könnte m<strong>an</strong> Aerobic-<br />
Schritt-Kombination o<strong>der</strong> Funktionelle<br />
Gymnastik nennen. Den Teil dazwischen<br />
habe ich Zwiebelhacken getauft.<br />
In meinem Rücken-Fit Kurs bügeln<br />
wir und hacken Zwiebeln. Beides ist<br />
schweißtreibend. Wir liegen dabei auf<br />
dem Bauch, die Arme ausgestreckt nach<br />
vorn, die Beine l<strong>an</strong>g nach hinten. Damit<br />
wir die Halswirbelsäule nicht belasten,<br />
gucken wir auf die blaue Matte. Sonja<br />
ruft: „Pooo <strong>an</strong>sp<strong>an</strong>neeeen! Bauchnabel<br />
küsst Wirbelsäuuuuleee! Macht eure<br />
Mitte fest! Uuuuuuuund Zwiiiiiieeeebeellhaaackeeeeen!“<br />
Wir bewegen die<br />
Arme hoch und runter, die H<strong>an</strong>dk<strong>an</strong>ten<br />
schlagen auf den Boden als würden wir<br />
Zwiebeln hacken. Daher <strong>der</strong> Name. Eigentlich<br />
logisch. Beim Bügeln <strong>läuft</strong> die<br />
Übung ähnlich ab, nur bügeln wir einmal<br />
mit links und einmal mit rechts über den<br />
10
<strong>Titelthema</strong> // <strong>Einblick</strong><br />
Hallenboden. Helga macht jede Übung<br />
g<strong>an</strong>z vorsichtig, Heidis Schwester kommentiert<br />
alles, die zwei einzigen Herren<br />
schnaufen je<strong>der</strong> für sich. Zwiebelhacken<br />
macht rote Köpfe. BH Träger werden zurechtgerückt,<br />
Unterwäsche wie<strong>der</strong> <strong>an</strong><br />
die richtige Stelle geschoben. Die, die<br />
erschöpft sind, bleiben auf dem Bauch<br />
liegen (ich) und hören Seal beim singen<br />
zu. Die <strong>an</strong><strong>der</strong>en heben nochmal den<br />
Arm und hoffen, es ist die letzte Übung.<br />
„Atmen nicht vergessen, Entsp<strong>an</strong>nung,<br />
uuuuund Paaaauuuuuseeee.“<br />
„Darf ich mal fühlen?“ Schon wird mein<br />
Bein hochgerissen und meine Socken<br />
bewun<strong>der</strong>t. „Ist das Synthetik? Nein,<br />
das sehe ich auf den ersten Blick, Wolle,<br />
selbstgestrickt, o<strong>der</strong>?“ Das war Adelheid,<br />
82, gen<strong>an</strong>nt Heidi. Sie kommt<br />
gemeinsam mit ihrer Schwester zu Rücken-Fit.<br />
Nur Edith ist älter, mit 83 Jahren.<br />
Ich halte ihr seitdem jede Woche<br />
meine Socken unter die Nase und sie<br />
fühlt das Material. „Ich trage nie Socken<br />
beim Sport“, erzählt sie mir. „Ich habe<br />
keinen Grip in meinen Schuhen, wenn<br />
ich welche <strong>an</strong>habe.“ Nur letzte Woche<br />
war alles <strong>an</strong><strong>der</strong>s. Da war Heidi ein bisschen<br />
erkältet und hatte selbstgestrickte<br />
Woll<strong>so</strong>cken <strong>an</strong>. Diesmal bekam ich ihr<br />
blaues Hosenbein vor die Nase gehalten<br />
und <strong>so</strong>llte fühlen.<br />
Hier beim Sport sind alle per Du. Und<br />
Sonja ist nicht nur die Sportlehrerin dort<br />
vorn. Sie ist eine Freundin, ein Urgestein,<br />
eine Vertraute. Sie weiß, wenn Siegfried<br />
nicht kommt, weil es „in <strong>der</strong> Schulter<br />
knackert“ o<strong>der</strong> informiert den Kurs,<br />
wenn ein l<strong>an</strong>gjähriger Kursteilnehmer<br />
verstorben ist. Es gibt <strong>so</strong>gar gemeinsame<br />
Weihnachtsfeiern. Sonja bekommt<br />
ein Präsent überreicht, es gibt eine kleine<br />
Ansprache und Applaus vom g<strong>an</strong>zen<br />
Kurs. Je<strong>der</strong> hat etwas mitgebracht.<br />
Glühwein ohne Schuss, Glühwein mit<br />
einem kleinen Schuss, Plätzchen, eine<br />
Gitarre. Ich habe Cupcakes gebacken.<br />
Gemeinsam singen wir Lie<strong>der</strong> und jem<strong>an</strong>d<br />
liest ein paar Verse vor. Helga erzählt<br />
die Geschichte, wie sie mitten im<br />
Winter auf einem Feld einem nackten<br />
M<strong>an</strong>n begegnete, als sie gerade Eier<br />
holen wollte. An die Cupcakes traut sich<br />
erst niem<strong>an</strong>d her<strong>an</strong>, d<strong>an</strong>n werde ich gefragt,<br />
was das wäre. Ich sage: das sind<br />
Cupcakes. Muffins. Aber keiner begreift<br />
<strong>so</strong> wirklich. Al<strong>so</strong> sage ich: <strong>so</strong>was wie<br />
kleine Kuchen in Tassen. „Aaaah. Das<br />
schmeckt ja <strong>so</strong>gar“, sagt Siegfried mit<br />
Sahne im Mundwinkel.<br />
Seit <strong>der</strong> Weihnachtsfeier bin ich voll <strong>an</strong>gekommen<br />
in meinem Kurs. Ich sage<br />
alle Termine für Dienstagnachmittag<br />
mit dem Satz ab: „Sorry, da habe ich<br />
Rückenfit für Rentner.“ Ich kenne schon<br />
ein paar Namen, ich erkenne <strong>so</strong>gar <strong>an</strong><br />
Sonjas Tonlage, welche Art <strong>der</strong> Übung<br />
<strong>an</strong>steht. Wie<strong>der</strong>holung. Pause. O<strong>der</strong><br />
Pressen. Ziehen. Drücken. Die Bälle sind<br />
1<br />
2<br />
Bei Rücken-Fit für Mitarbeiter<br />
ist <strong>der</strong> g<strong>an</strong>ze Körper im Einsatz.<br />
Sport im Einkl<strong>an</strong>g<br />
2<br />
Foto: Sophie Herwig<br />
11
<strong>Einblick</strong> // <strong>Titelthema</strong><br />
grün, die Matten blau. Die Stunde hat<br />
60 Minuten. Mittlerweile habe ich den<br />
größten Respekt vor meinen Sportkameraden.<br />
Helga trägt jede Woche<br />
dasselbe, Kaltwelle oben, blaue Sportballerinas<br />
unten. Ich frage mich oft, wie<br />
sie wohl früher aussahen. Als sie jung<br />
M<strong>an</strong>chmal hasse ich Sonja auch, (ich<br />
weiß, die <strong>an</strong><strong>der</strong>en tun das auch) wenn<br />
wir die geraden Bauchmuskeln mit 20<br />
Wie<strong>der</strong>holungen geschafft haben, und<br />
nun die schrägen Bauchmuskeln auf<br />
zwei Zählzeiten dr<strong>an</strong> sind. Dabei weiß<br />
m<strong>an</strong> ja: die schrägen gibt es zweimal,<br />
al<strong>so</strong> rechts und links. „Zieht, zieht, zieht,<br />
g<strong>an</strong>z wichtig ist das letzte Stückchen!<br />
Bis es brennt!“ Xavier Naidoo singt im<br />
Hintergrund „Höllenqualen sind egal“,<br />
aber er war auch noch nicht bei Sonja<br />
im Rücken-Fit. Es zischt, ein Ball ist geplatzt.<br />
„Wie<strong>der</strong>hooolung. Der Bauchnabel<br />
küsst die Wirbelsäule“, ruft es von<br />
vorn. Vereinzelt höre ich ein „Nein“ o<strong>der</strong><br />
„Nicht doch“. Sonja macht die Sekunden<br />
länger: „vier, drei“, sie singt zwischendurch<br />
auch mal mit, wenn ihr ein Lied<br />
gefällt, „no Milk today, my love has gone<br />
away, zwei, eins und Paaaaauuuuseee.“<br />
und schüttelt den Kopf über das neumodische<br />
Zeugs. D<strong>an</strong>n liegen wir, platt<br />
wie Flun<strong>der</strong>n, auf unseren Matten und<br />
wissen, was wir die letzte Stunde gemacht<br />
haben. Sonja gestaltet jede Stunde<br />
ein bisschen <strong>an</strong><strong>der</strong>s. Mal Gewichte<br />
<strong>an</strong> den Knöcheln, mal Erwärmung auf<br />
3<br />
Foto: Sophie Herwig<br />
waren. Dabei sind sie eigentlich viel jünger<br />
als ich mich fühle. Sonja ruft bei <strong>der</strong><br />
dritten Runde Situps: „Die Muskeln können<br />
brennen, d<strong>an</strong>n passiert wenigstens<br />
etwas!“ Bei mir brennt alles, ich würde<br />
gern eine Tonne Wasser trinken, aber<br />
Helga lächelt mir zu und zuckt die Schultern<br />
über die lächerliche Anstrengung.<br />
Helga hat Muskeln wie Kruppstahl.<br />
Die schwierige Vari<strong>an</strong>te wählen alle außer<br />
ich. Schlicht, weil ich <strong>so</strong>nst vom Ball<br />
fallen würde. M<strong>an</strong>chmal hebt Sonja den<br />
Kopf und guckt, ob es allen gut geht<br />
und alle (noch) atmen. Am Ende haben<br />
wir 80 Wie<strong>der</strong>holungen geschafft. Das<br />
schafft m<strong>an</strong> allein zu Hause nicht, ich<br />
jedenfalls nicht. Deswegen bin ich hier.<br />
Und weil mein Papa sagt, ich gehe zu<br />
krumm.<br />
„Jetzt drehen wir uns um die Längsachse<br />
in eine Körperverwringung“, je<strong>der</strong><br />
Beruf hat seine eigenen Fachbegriffe.<br />
Bei Sonja sind das: B<strong>an</strong>kstellung, Unterarmstütz,<br />
Pfer<strong>der</strong>ücken, Katzenbuckel,<br />
Bodendrücker, Rückenstrecker, Strecksitz,<br />
Drehsitz und Unterschenkelst<strong>an</strong>d.<br />
Mobilisationsarbeit für die Wirbelsäule<br />
heißt es bei Sonja, die Kleine Kobra<br />
im Yoga. Viele Übungen heißen heute<br />
auch <strong>an</strong><strong>der</strong>s als damals. D<strong>an</strong>n sagt Sonja:<br />
„Das hieß zu DDR Zeiten noch Beugestütz,<br />
heute rückwärtiger Tip, naja“,<br />
<strong>der</strong> Steppb<strong>an</strong>k, mal auf dem Gymnastikball.<br />
Mal <strong>an</strong>strengend, mal sehr <strong>an</strong>strengend.<br />
Rückenschonend stehen wir<br />
auf, werfen glücklich die Hände nach<br />
oben, und klatschen für uns. Wir haben<br />
es geschafft – für diese Woche. Für Sonja<br />
geht es 16:30 Uhr mit dem zweiten<br />
Kurs weiter.<br />
An dieser Stelle <strong>so</strong>llte ich schreiben:<br />
kommen Sie in diesen Kurs. Er hält fit, er<br />
macht Spaß und er ist voller Vorbil<strong>der</strong>.<br />
So bleiben Sie fit im Alter und in <strong>der</strong><br />
Jugend. Aber bitte kommen Sie nicht.<br />
Bleiben Sie weg. Das ist mein Rücken-<br />
Fit für Rentner Kurs. Außer Sie haben<br />
selbstgestrickte und sehr, sehr schöne<br />
Socken <strong>an</strong>.<br />
3<br />
Mehr als nur ein Sport-Kurs,<br />
<strong>so</strong>n<strong>der</strong>n ein Ort <strong>der</strong> Begegnung<br />
und des gegenseitigen<br />
Austauschs.<br />
12
<strong>Titelthema</strong> // <strong>Einblick</strong><br />
RÜCKZUGSORTE FÜR ELTERN SCHAFFEN<br />
Studentinnen <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz engagieren sich im Bereich <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung.<br />
Ihnen geht es darum, die Familienfreundlichkeit am Zittauer<br />
St<strong>an</strong>dort zu erhöhen.<br />
VON SABRINA WINTER<br />
Nicole Polke ist ein wenig aufgeregt. Am<br />
Nachmittag findet das erste Treffen des<br />
Arbeitskreises „Familienfreundlichkeit“<br />
statt. „Wir haben uns gut vorbereitet<br />
und viele Ged<strong>an</strong>ken gemacht“, sagt die<br />
26-Jährige Studentin und Mutter. Nun<br />
hofft sie, dass viele Interessierte vorbeikommen.<br />
Nicole Polke studiert im<br />
Bachelor Heilpädagogik/Inclusion Studies<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG. Gemeinsam mit ihren<br />
Kommilitoninnen Kristin Neum<strong>an</strong>n und<br />
Linda Seelinger arbeitet sie <strong>an</strong> einem<br />
Projekt, das die Familienfreundlichkeit<br />
<strong>der</strong> Hochschule steigern <strong>so</strong>ll. Das G<strong>an</strong>ze<br />
findet im Rahmen ihres Praxissemesters<br />
statt.<br />
Die Studentinnen haben den St<strong>an</strong>dort<br />
Zittau ins Auge gefasst – be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>s die<br />
Mensa und die Bibliothek. „Wir sind zwei<br />
Muttis in <strong>der</strong> Projektgruppe und haben<br />
festgestellt, dass <strong>der</strong> Hochschulst<strong>an</strong>dort<br />
in Zittau nicht <strong>so</strong> familienfreundlich ist<br />
wie <strong>der</strong> in Görlitz“, erklärt Nicole Polke.<br />
In Görlitz gibt es einen Wickelraum in<br />
<strong>der</strong> Mensa und mehrere Möglichkeiten<br />
zum Stillen. In Zittau hingegen findet<br />
m<strong>an</strong> nur einen Wickeltisch in <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>ten-Toilette<br />
<strong>der</strong> Mensa.<br />
Nicole Polke hat selbst eine kleine Tochter<br />
und ist auf Barrieren gestoßen: „In<br />
<strong>der</strong> Bibliothek in Zittau k<strong>an</strong>n ich nicht<br />
stillen. D<strong>an</strong>n muss ich in die Mensa<br />
gehen. Auch dort schauen mich die Leute<br />
m<strong>an</strong>chmal schräg <strong>an</strong>. Dabei ist Stillen<br />
Kontaktinformationen<br />
Wer Interesse <strong>an</strong> dem Projekt hat o<strong>der</strong> sich gern dem Arbeitskreis <strong>an</strong>schließen<br />
möchte, k<strong>an</strong>n sich bei <strong>der</strong> Projektgruppe melden. Sie sind erreichbar unter:<br />
familienfreundlichkeit@hszg.de<br />
<strong>01</strong>72 5991905 (auch per WhatsApp).<br />
1<br />
doch etwas Normales.“ Der Pl<strong>an</strong> des<br />
Arbeitskreises ist es, in Mensa und Bibliothek<br />
Rückzug<strong>so</strong>rte für stillende Muttis<br />
und Schw<strong>an</strong>gere zu schaffen.<br />
In einem ersten Schritt haben die Studentinnen<br />
Fragebögen <strong>an</strong> Mitarbeiter<br />
und Studierende <strong>der</strong> HSZG verteilt.<br />
Damit wollen sie herausfinden, wie<br />
Hochschul<strong>an</strong>gehörige über Familienfreundlichkeit<br />
denken und wo sie damit<br />
in Berührung kommen.<br />
Betreut wird das Projektteam von Ingolf<br />
Prosetzky, Profes<strong>so</strong>r für Heilpädagogik.<br />
Er gibt Tipps für den Fragebogen und<br />
schafft Kontakte zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Ansprechpartnern.<br />
Einmal in <strong>der</strong> Woche trifft sich<br />
das Team mit dem Profes<strong>so</strong>r, um Fortschritte<br />
zu besprechen und Fragen zu<br />
klären.<br />
Trotz des Verbesserungsbedarfs in Zittau<br />
sieht Nicole Polke auch positive Punkte<br />
zur Familienfreundlichkeit: „In <strong>der</strong> Zittauer<br />
Mensa gibt es einen <strong>so</strong>gen<strong>an</strong>nten<br />
Räuberteller. Für 50 Cent bekommt meine<br />
Tochter einen kleinen Plastikteller mit<br />
einer Mahlzeit o<strong>der</strong> ich k<strong>an</strong>n ihr etwas<br />
von meinem Essen auftun. Das ist eine<br />
niedliche Aktion! Außerdem gibt es dort<br />
Kin<strong>der</strong>stühle.“<br />
Die junge Mutter hofft, dass sich noch<br />
weitere Studierende ihrem Projekt<br />
<strong>an</strong>schließen, und dass <strong>der</strong> Arbeitskreis<br />
auch nach ihrem Praxissemester bestehen<br />
bleibt.<br />
1<br />
Kristin Neum<strong>an</strong>n, Linda<br />
Seelinger und Nicole Polke<br />
(v.l.n.r.) setzen sich für eine<br />
familienfreundliche Hochschule<br />
ein.<br />
Foto: privat<br />
13
1<br />
GESUNDHEIT GUT – ALLES GUt!<br />
Bereits im vierten Jahr ver<strong>an</strong>staltet die Hochschule Zittau/Görlitz gemeinsam mit <strong>der</strong><br />
Stadt Zittau die Gesundheits- und Umwelttage (GUt) als Maßnahme <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule.<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
VON CORNELIA ROTHE<br />
„Es nimmt l<strong>an</strong>gsam Form <strong>an</strong> und das<br />
Wetter stimmt auch!“ Eric Schön befindet<br />
sich gerade hinter dem Haus Z IV c<br />
auf dem Zittauer Campus. In <strong>der</strong> H<strong>an</strong>d<br />
eine Rolle Absperrb<strong>an</strong>d. Das <strong>an</strong><strong>der</strong>e<br />
Ende des B<strong>an</strong>des ist nicht in Sicht, denn<br />
Eric Schön ist fast fertig mit <strong>der</strong> Markierung<br />
<strong>der</strong> 800 m l<strong>an</strong>gen Rennstrecke für<br />
den zweiten Hochschul-Stadt-Firmen-<br />
Lauf. Startpunkt ist <strong>der</strong> Platz vor dem Peter-Dierich-Haus.<br />
Es ist <strong>der</strong> 6. Juni 2<strong>01</strong>8,<br />
Tag des diesjährigen Hochschulsportund<br />
Sommerfestes <strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz<br />
und für den Mitarbeiter des<br />
MACH MIT-Umweltm<strong>an</strong>agements <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> HSZG ein weiterer Höhepunkt <strong>der</strong><br />
<strong>so</strong>gen<strong>an</strong>nten Gesundheits- und Umwelttage,<br />
die 2<strong>01</strong>8 zwischen dem 4. und<br />
8. Juni stattfinden.<br />
„Als Teil des MACH MIT-Umweltm<strong>an</strong>agements<br />
möchten wir das Wohlbefinden<br />
unserer Hochschul<strong>an</strong>gehörigen för<strong>der</strong>n<br />
und neben den Themen <strong>der</strong> Umwelt<br />
und Nachhaltigkeit auch die Bedeutung<br />
<strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung hervorheben.<br />
Deswegen ver<strong>an</strong>stalten wir nun<br />
bereits im vierten Jahr gemeinsam mit<br />
<strong>der</strong> Stadt Zittau die Gesundheits- und<br />
Umwelttage“, erklärt Eric Schön. Bei <strong>der</strong><br />
Zusammenstellung dieser mehrtägigen<br />
Ver<strong>an</strong>staltung wird auf das Zusammenspiel<br />
von Aktionen gesetzt, die Spaß<br />
machen, Stress abbauen und sich positiv<br />
auf die natürliche Umwelt und die<br />
persönliche Stimmung auswirken. „Das<br />
spielt alles eine wichtige Rolle bei <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Gesundheit“, weiß Eric<br />
Schön.<br />
So bieten die GUt immer Möglichkeiten<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
2<br />
zur körperlichen Gesundheitsvor<strong>so</strong>rge<br />
<strong>an</strong>, wie etwa ein Rückenscreening und<br />
Rückentraining zu ab<strong>so</strong>lvieren. „Das<br />
sind kostenfreie Angebote ausschließlich<br />
für das Per<strong>so</strong>nal und Studierende<br />
<strong>der</strong> Hochschule. Sie können sich über<br />
den Zust<strong>an</strong>d ihrer Wirbelsäule aufklären<br />
lassen und, falls nötig, För<strong>der</strong>maßnahmen<br />
einleiten. Der Hochschulsport bietet<br />
zum Beispiel einen Rücken-Fit-Kurs<br />
<strong>an</strong>“, berichtet Eric Schön.<br />
Maßnahmen zur Stressbewältigung<br />
und geistigen Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
<strong>an</strong> beiden St<strong>an</strong>dorten <strong>der</strong> Hochschule,<br />
Filmvorführungen und Workshops zum<br />
Beispiel über die Herstellung veg<strong>an</strong>er<br />
Bioseife runden das Programm ab. Das<br />
leibliche Wohl kommt dabei auch nicht<br />
zu kurz, wie <strong>der</strong> Ver<strong>an</strong>staltung<strong>so</strong>rg<strong>an</strong>isator<br />
erzählt: „In einem Workshop führt<br />
ein Braumeister in die Künste und das<br />
H<strong>an</strong>dwerk des Bierbrauens ein und auch<br />
das Smoothie-Bike ist wie<strong>der</strong> am Start.“<br />
Das Rad mit <strong>an</strong>gebautem Mixer dient<br />
zur Demonstration, wie viel Energie für<br />
das Mixen eines leckeren Smoothies<br />
14
<strong>Titelthema</strong> // <strong>Einblick</strong><br />
3<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
benötigt wird. Be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>s stolz ist Eric<br />
Schön, dass er den Triathlon-Profi Andreas<br />
Niedrich für den Gastvortrag über<br />
sein bewegtes Leben gewinnen konnte,<br />
das von l<strong>an</strong>gjähriger Drogenabhängigkeit<br />
und dem leidenschaftlichen Kampf<br />
zurück ins Leben und <strong>an</strong> die Weltspitze<br />
im Triathlonsport geprägt ist.<br />
„Sport und Bewegung sind Schlüssel<br />
zum Erfolg, zur Zufriedenheit und<br />
Ausgeglichenheit“, ist sich Eric Schön<br />
sicher. Davon bieten die GUt reichlich.<br />
Während <strong>der</strong> Aktionstage messen sich<br />
jeweils sieben Teams von <strong>der</strong> Stadtverwaltung<br />
Zittau und <strong>der</strong> HSZG bei <strong>der</strong><br />
<strong>so</strong>gen<strong>an</strong>nte Schrittzähler-Challenge.<br />
Für die Zwei-Per<strong>so</strong>nen-Teams winken<br />
dabei Sachpreise und ein W<strong>an</strong><strong>der</strong>pokal<br />
für die einzeln o<strong>der</strong> als Team innerhalb<br />
<strong>der</strong> fünf Ver<strong>an</strong>staltungstage am meisten<br />
erlaufenen Schritte. Der Gesamtsieg<br />
<strong>der</strong> Schrittzähler-Challenge ging<br />
2<strong>01</strong>7 übrigens mit deutlichem Abst<strong>an</strong>d<br />
von 202.932 Schritten wie<strong>der</strong>holt <strong>an</strong> die<br />
Stadtverwaltung Zittau.<br />
Spätestens am Abend des jährlich<br />
während <strong>der</strong> Gesundheits- und Umwelttage<br />
stattfindenden Hochschulsportfestes<br />
wird deutlich, dass Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />
untrennbar mit<br />
körperlicher Ertüchtigung verbunden<br />
ist. Nachdem in diesem Jahr alle Hochschul-Stadt-Firmen-Lauf-Teilnehmer<br />
ins Ziel eingelaufen und 8 km Strecke<br />
ab<strong>so</strong>lviert haben, lässt Eric Schön den<br />
ereignisreichen Tag gemeinsam mit<br />
den Sportfestgästen und Hochschul<strong>an</strong>gehörigen<br />
beim Sommerfest <strong>der</strong> HSZG<br />
auf dem Zittauer Campus ausklingen.<br />
M<strong>an</strong>chmal gehören eben auch eine<br />
Bratwurst und eine erfrischende Limonade<br />
zur Gesundheitsför<strong>der</strong>ung. Das<br />
Absperrb<strong>an</strong>d flattert dabei im Hintergrund<br />
im Sommerwind.<br />
Wer hat denn in diesem Jahr eigentlich<br />
gewonnen?<br />
WERTUNG HOCHSCHUL-STADT-FIRMEN-LAUF 2<strong>01</strong>8 WERTUNG SCHRITTZÄHLER-CHALLENGE 2<strong>01</strong>8<br />
Team/Name Platzierung Zeit (min./sec.)<br />
Team/Name Platzierung Zeit (min./sec.)<br />
WW16 Elisia Heinrich (weibl.) 1 32:43:00<br />
Bärskoletta (weibl.) 2 35:47:00<br />
Hot-Yoga-Zittau I (männl.) 1 23:38:00<br />
Come back e.V. (männl.) 2 25:19:00<br />
Pasta F<strong>an</strong>tastica (männl.) 3 25:50:00<br />
Boxteam Zittau I 1 21:16:00<br />
ITALIA 2 23:32:00<br />
Zwergenhäusel/ATM 3 23:38:00<br />
Die Hochschulsportfest Volleyball-Sieger 2<strong>01</strong>8<br />
vom<br />
Diesjährige Hochschul-Stadt-Firmen-Lauf<br />
Einzelsieger beim<br />
1 2 3<br />
Einzelwertung<br />
Teamwertung<br />
Einzelwertung<br />
Teamwertung<br />
Simone Kunze 1 323600<br />
Christi<strong>an</strong>o Marcellino 2 281191<br />
Prof. Jörg Schulze 3 279084<br />
Karolin Müller<br />
Christi<strong>an</strong>o Marcellino 1 511374<br />
Prof. Jörg Schulze<br />
Laura Herzog<br />
Annett Jähnichen<br />
Simone Kunze<br />
2 480721<br />
3 445478<br />
Gute Stimmung beim Sommerfest<br />
2<strong>01</strong>8<br />
15
<strong>Einblick</strong> // Hochschule<br />
NEWSLETTER QUALITÄTSMANAGEMENT<br />
SYSTEMAKKREDITIERUNG BEKOMMT<br />
EIN GESICHT<br />
Die Hochschule und die Akkreditierungsagentur<br />
ASIIN e.V. haben am 19.<br />
Dezember 2<strong>01</strong>7 den Vertrag zur Durchführung<br />
des Systemakkreditierungsverfahrens<br />
unterzeichnet und damit den<br />
Grundstein für die Systemakkreditierung<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG gelegt. Trotz <strong>der</strong> Neuausrichtung<br />
des Akkreditierungswesens<br />
in Deutschl<strong>an</strong>d mit dem Inkrafttreten<br />
des Studienakkreditierungsstaatsvertrags<br />
im J<strong>an</strong>uar 2<strong>01</strong>8 wird die Systemakkreditierung<br />
<strong>der</strong> HSZG nach den bisherigen<br />
Regeln des Akkreditierungsrates<br />
von 2<strong>01</strong>3 erfolgen.<br />
Die ASIIN e. V. (Akkreditierungsagentur<br />
für Studiengänge <strong>der</strong> Ingenieurwissenschaften,<br />
<strong>der</strong> Informatik, <strong>der</strong> Naturwissenschaften<br />
und <strong>der</strong> Mathematik e.V.)<br />
mit ihrem Sitz in Düsseldorf ist eine von<br />
zehn in Deutschl<strong>an</strong>d zur Akkreditierung<br />
von Hochschulen und Studienprogrammen<br />
zugelassenen, unabhängigen<br />
Agenturen. Sie ist damit berechtigt, das<br />
Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates<br />
für die Systemakkreditierung zu<br />
vergeben. Die ASIIN e. V. wird im Verlauf<br />
<strong>der</strong> Systemakkreditierung in 2<strong>01</strong>8/2<strong>01</strong>9<br />
mit folgenden Aufgaben betraut sein:<br />
• Entscheidung über den Zulassungs<strong>an</strong>trag<br />
<strong>der</strong> HSZG zur Eröffnung des<br />
Verfahrens <strong>der</strong> Systemakkreditierung<br />
• Formale Vorprüfung und Vorgespräche<br />
zur Selbstdokumentation <strong>der</strong><br />
HSZG<br />
• Auswahl, Berufung und Briefing des<br />
Gutachterteams<br />
• Durchführung von zwei zweitägigen<br />
Begehungen (Audits) <strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG<br />
• Erstellung von Akkreditierungsberichten<br />
nach je<strong>der</strong> Begehung<br />
• Beschlussfassung zur Systemakkreditierung<br />
und bei positivem Votum<br />
Vergabe des Qualitätssiegels des Akkreditierungsrates<br />
Aufgaben<br />
Besetzung (St<strong>an</strong>d Mai 2<strong>01</strong>8)<br />
Review-Jury<br />
• Entscheidung über die Akkreditierung/<br />
Zertifizierung <strong>der</strong><br />
Studiengänge<br />
• Festlegung von Auflagen zur<br />
Behebung festgestellter Mängel<br />
und von Empfehlungen zur Verbesserung<br />
des Studien<strong>an</strong>gebotes<br />
• Überprüfung <strong>der</strong> fristgerechten<br />
Erfüllung von Auflagen<br />
Hochschulleitung<br />
Prof. Dr. phil. Friedrich Albrecht (Vorsitz)Prof.<br />
Dr. rer. nat. Christa Maria<br />
Heidger<br />
Fakultäten<br />
Prof. Dr.-Ing. Steph<strong>an</strong> Kühne (F-EI)<br />
Prof. Dr. oec. Ute Pflicke (F-MK)<br />
Prof. Dr.-Ing. Markus Full<strong>an</strong>d (F-M)<br />
Prof. Dr. rer. pol. J<strong>an</strong>a Brauweiler (F-N)<br />
Prof. Dr. Andreas Hoff (F-S)<br />
Prof. Dr. iur. Erik Hahn (F-W)<br />
Weiterführende Informationen zur<br />
ASIIN e. V. finden Sie unter:<br />
www.asiin.de<br />
STUDIENGANGSREVIEW – GREMIEN<br />
BESETZT<br />
Im Kontext <strong>der</strong> Vorbereitung zur Systemakkreditierung<br />
ist mit dem Studieng<strong>an</strong>gsreview-Verfahren<br />
ein neues<br />
Instrument zur Begutachtung und zur<br />
Akkreditierung (Bachelor/Master) bzw.<br />
Zertifizierung (Diplom) <strong>der</strong> Studiengänge<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG eingeführt worden. Mit<br />
Inkrafttreten <strong>der</strong> hochschulweit geltenden<br />
Ordnung für den Studieng<strong>an</strong>gsreview<br />
im November 2<strong>01</strong>7 wurden zwei<br />
neue Gremien eingerichtet - Review-<br />
Jury und - Review-Ausschuss.<br />
Im April bzw. Mai 2<strong>01</strong>8 trafen sich die<br />
vom Rektorat bestellten Gremienmitglie<strong>der</strong><br />
zu ihren jeweiligen konstituierenden<br />
Sitzungen. Parallel dazu wurden<br />
die ersten zwei Studieng<strong>an</strong>gsreviews<br />
durchgeführt.<br />
Review-Ausschuss<br />
• Ansprechpartner für Verfahrensfragen<br />
• Überprüfung und Weiterentwicklung<br />
des Studieng<strong>an</strong>gsreview-<br />
Verfahrens<br />
• Prüfung und Bearbeitung von<br />
Beschwerden (Beschwerdestelle)<br />
Review-Beauftragte <strong>der</strong> Fakultäten<br />
Dipl.-Ing.-Ök. Norbert Kalz (Vorsitz) (F-<br />
W) Prof. Dr.-Ing. Jens Uwe Müller (F-EI)<br />
Dipl.-Kffr. Solvig L<strong>an</strong>gschwager (F-MK)<br />
Dr.-Ing. J<strong>an</strong>a Reinhold (F-M)<br />
Dipl.-Kffr. Anke Zenker-Hoffm<strong>an</strong>n (F-N)<br />
Prof. Dr. phil. Michel Hille (F-S)<br />
Dezernat Studium und Internationales<br />
Oliver Clemenz, LL.B.<br />
Stabsstelle Qualitätsm<strong>an</strong>agement<br />
Dr. rer. pol. Peggy Sommer<br />
Studierendenschaft<br />
Felix Herrm<strong>an</strong>n (BW16/2)<br />
Kontakt<br />
Dr. Peggy Sommer<br />
p.<strong>so</strong>mmer@hszg.de<br />
www.hszg.de/qm<br />
16
Hochschule // <strong>Einblick</strong><br />
BRÜCKEN BAUEN – ÜBER-<br />
GÄNGE GESTALTEN<br />
Unter diesem Thema findet vom 25.<br />
bis 27. Oktober 2<strong>01</strong>8 die 6. Tagung im<br />
Projekt ZINT „Zusammen integrative/inklusive<br />
Schule entwickeln“ statt.<br />
Brücken bauen, heißt Verbindungen<br />
schaffen, Bündnisse eingehen, Gemeinsamkeiten<br />
finden und ausbauen, heißt<br />
konstruktiver Austausch und gemeinsame<br />
Lösungssuche.<br />
Foto: HSZG<br />
Den Auftakt <strong>der</strong> Tagung bilden am 25.<br />
Oktober 2<strong>01</strong>8 ein Besuch in <strong>der</strong> Oberlausitzischen<br />
Bibliothek <strong>der</strong> Wissenschaften<br />
und im Physikalischen Kabinett <strong>so</strong>wie<br />
ein Netzwerktreffen <strong>der</strong> Multiplikatoren<br />
für Integration.<br />
1<br />
Die Tagung ist im 10. Jahr des Bestehens<br />
des Projekts ZINT <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
Zittau/Görlitz ein Höhepunkt in <strong>der</strong> Projektarbeit.<br />
Deshalb wird es innerhalb<br />
<strong>der</strong> Tagung am Freitag, den 26. Oktober<br />
2<strong>01</strong>8, einen Festvortrag <strong>so</strong>wie eine offene<br />
Projektkonferenz für interessierte<br />
Lehrer und Schulleiter geben, die sich<br />
auf <strong>der</strong> Grundlage des neuen Schulgesetzes<br />
zu ausgewählten Schwerpunkten<br />
<strong>der</strong> inklusiven Schulentwicklung informieren<br />
wollen, <strong>so</strong>zusagen Brückenbau<br />
zwischen erfahrenen Multiplikatoren<br />
und Neugierigen. Für die Eröffnung<br />
sind <strong>der</strong> Kultusminister, <strong>der</strong> Prorektor<br />
für Bildung und Internationales <strong>der</strong> Universität<br />
Leipzig <strong>so</strong>wie <strong>der</strong> Rektor <strong>der</strong><br />
Hochschule Zittau/Görlitz <strong>an</strong>gefragt.<br />
Der Nachmittag bietet mit verschiedenen<br />
Workshopthemen unterschiedliche<br />
Möglichkeiten sich mit dem Prozess <strong>der</strong><br />
inklusiven Schulentwicklung ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>zusetzen.<br />
Den Abschluss am Freitag <strong>so</strong>llen Mitmach-Workshops<br />
bilden, in denen die<br />
Pädagogen die Möglichkeit haben, sich<br />
mit dem Tagungsthema g<strong>an</strong>z verschieden,<br />
aber in aktiver Art und Weise, ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>zusetzen.<br />
Als einen Hauptreferenten <strong>der</strong> diesjährigen<br />
Tagung konnten wir Prof. Dr.<br />
phil. Bernd Ahrbeck, Prof. für Psycho<strong>an</strong>alytische<br />
Pädagogik vom IPU Berlin<br />
(International Psycho<strong>an</strong>alytic University<br />
Berlin) gewinnen. Prof. Ahrbeck bringt<br />
Fachexpertise aus seiner Arbeit am Institut<br />
für Rehabilitationswissenschaften<br />
<strong>der</strong> Humboldt UNI, Pädagogik bei Verhaltensstörungen<br />
mit und ergänzt diese<br />
durch sein Fachwissen zur psycho<strong>an</strong>alytischen<br />
Pädagogik. Die Psycho<strong>an</strong>alyse<br />
ist eine „Lebenswissenschaft“, weil sie<br />
den Menschen als individuelle Persönlichkeit,<br />
aber auch als <strong>so</strong>ziales und kulturelles<br />
Wesen versteht. Hiermit schlagen<br />
wir eine Brücke zur inklusiven Pädagogik<br />
und Schulentwicklung.<br />
Am Abend wollen wir im Rahmen<br />
eine Festver<strong>an</strong>staltung insbe<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e<br />
den Multiplikatoren für Integration<br />
für Ihre Arbeit zur Unterstützung <strong>der</strong><br />
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern<br />
durch Org<strong>an</strong>isation und Unterstützung<br />
erfolgreichen Lernens und inklusiver<br />
Schulentwicklung d<strong>an</strong>ken.<br />
Am Samstag, den 27. Oktober 2<strong>01</strong>8, werden<br />
weitere Workshops dazu beitragen,<br />
das Tagungsprogramm weiter auszudifferenzieren.<br />
Und wir wollen klären: Wie<br />
k<strong>an</strong>n das Projekt ZINT auch zukünftig<br />
die Schulen bei <strong>der</strong> Zusammenarbeit in<br />
den Kooperationsverbünden <strong>so</strong>wie in<br />
<strong>der</strong> inklusiven Schulentwicklung unterstützen?<br />
Die Ausrichtung eines Kooperationsverbundes<br />
hängt davon ab, wie es gelingt,<br />
die verschiedenen Interessenlagen <strong>der</strong><br />
selbstständig agierenden Mitglie<strong>der</strong><br />
sinngebend mitein<strong>an</strong><strong>der</strong> zu verbinden,<br />
auf gemeinsame Ziele zu fokussieren<br />
und <strong>so</strong> eine gemeinsame Identität und<br />
einen Mehrwert zu entwickeln. Dazu<br />
wollen wir mit den aktiven Netzwerkern<br />
<strong>an</strong> den Stärken und Potentialen <strong>an</strong>knüpfen,<br />
die gemeinsamen Ziele schärfen<br />
und in einem weiteren Schritt durch<br />
aktive Netzwerkarbeit neue Ideen zum<br />
Nutzen aller Schulen entwickeln:<br />
• Lern- und Entwicklungsraum für<br />
Netzwerker schaffen<br />
• Kommunikationsmöglichkeiten erweitern<br />
• Lösungsfokussierte Netzwerkarbeit<br />
betreiben<br />
1<br />
Abstimmung bei einer ZINT-<br />
Tagung<br />
17
<strong>Einblick</strong> // Hochschule<br />
NEUBAU LABORHALLE<br />
Initiiert durch die Mittelzuweisung aus<br />
<strong>der</strong> FH-Impuls För<strong>der</strong>ung des Bundes<br />
für das Projekt LaNDER³, stellte sich die<br />
Frage nach <strong>der</strong> baulichen Abdeckung<br />
dringend benötigter Laborfläche.<br />
Zusätzliche Flächen in <strong>der</strong> notwendigen<br />
Größenordnung stehen <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
nicht zur Verfügung. Bemühungen<br />
des Staatsbetriebes Sächsisches<br />
Immobilien- und Baum<strong>an</strong>agement um<br />
die Anmietung adäquater Flächen blieben<br />
erfolglos.<br />
Die zukünftige bauliche Entwicklungspl<strong>an</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Hochschule sieht eine Konzentration<br />
<strong>der</strong> Lehr- und Laborgebäude<br />
in städtischer Nähe, im Campusbereich<br />
des neu s<strong>an</strong>ierten Gebäudes Z I vor.<br />
Damit bot sich auch die S<strong>an</strong>ierung und<br />
Umwidmung des ehemaligen Zentrallagers<br />
<strong>der</strong> Hochschule auf <strong>der</strong> l<strong>an</strong>deseigenen<br />
Fläche neben <strong>der</strong> Mensa <strong>an</strong>.<br />
Berechnungen ergaben jedoch, dass<br />
sich eine S<strong>an</strong>ierung <strong>der</strong> alten Halle nicht<br />
wirtschaftlich darstellen lässt und die zu<br />
erwartende Fläche nicht ausreichend ist.<br />
So entst<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong> zum Bau einer neuen<br />
Laborhalle.<br />
Nach Abriss des alten Gebäudes Z XV<br />
1<br />
zu Jahresbeginn beg<strong>an</strong>n pl<strong>an</strong>mäßig am<br />
25. Juni dieses Jahres <strong>der</strong> Bau <strong>der</strong> neuen<br />
Halle.<br />
Die Umsetzung des Projektes, von <strong>der</strong><br />
Idee bis zur Übergabe <strong>an</strong> die Nutzer,<br />
geschieht in gerade einmal 18 Monaten<br />
ungewöhnlich schnell. Die Halle wurde<br />
für den modularen Einsatz von Versuchsständen<br />
gepl<strong>an</strong>t und wird mit flexiblen<br />
technischen Anschlussmöglichkeiten<br />
ausgestattet, um im Bedarfsfall schnell<br />
und kostengünstig auf sich än<strong>der</strong>nde<br />
Forschungsprofile reagieren zu können.<br />
Das Laborgebäude wird mit 36 x 17 x 6<br />
m L/B/H wesentlich größer und optisch<br />
sicher <strong>an</strong>sprechen<strong>der</strong> als das alte Gebäude.<br />
Die Halle <strong>so</strong>ll bis Ende dieses Jahres<br />
fertiggestellt sein und wird die Bezeichnung<br />
„Laborhalle Z XI“ tragen.<br />
Kontakt<br />
Ralf Ulbrich - Dezernat Technik und Gebäudem<strong>an</strong>agement<br />
r.ulbrich@hszg.de<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
DAS BÜNDNIS LAUSITZ – LIFE<br />
AND TECHNOLOGY GEHT AN<br />
DEN START!<br />
Wie können wir unsere Region, die<br />
Oberlausitz, attraktiver machen? Welche<br />
technologischen und welche <strong>so</strong>zialen<br />
Innovationen können dazu führen, dass<br />
die Wirtschaft belebt wird, Fachkräfte<br />
interess<strong>an</strong>te Entwicklungsch<strong>an</strong>cen entdecken<br />
und gleichzeitig Familien ein<br />
reizvolles Lebensumfeld finden?<br />
Unter Fe<strong>der</strong>führung <strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz<br />
hat sich ein Strategiekon<strong>so</strong>rtium<br />
gebildet, in dem mit <strong>der</strong> ULT AG aus<br />
Kittlitz, dem Kunststoffzentrum Oberlausitz<br />
des Fraunhofer IWU und dem<br />
L<strong>an</strong>dkreis Görlitz wichtige Akteure <strong>der</strong><br />
Oberlausitz vertreten sind – Partner aus<br />
Wirtschaft, Forschung und <strong>der</strong> öffentlichen<br />
Verwaltung. Das Ziel ist, bis zum<br />
2<br />
18
1<br />
PROAKTIV IN DIE ZUKUNFT<br />
Die Hochschule Zittau/Görlitz (HSZG) hat ihre Pl<strong>an</strong>ungen bis zum Jahr 2025 unter<br />
Dach und Fach. Nachdem <strong>der</strong> Senat in seiner Sitzung im März den Entwurf des Rektorates<br />
beschlossen hatte, wurde dieser nun auch vom Hochschulrat in dessen Mai-<br />
Sitzung genehmigt.<br />
VON HELLA TRILLENBERG<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
Be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>s erfreut zeigte sich Rektor<br />
Prof. Friedrich Albrecht darüber, dass<br />
beide Gremien ihre Beschlüsse einstimmig<br />
gefällt haben: „Es hat sich gelohnt,<br />
dass wir die Erarbeitung des Entwicklungspl<strong>an</strong>s<br />
in einen intensiven und<br />
breit <strong>an</strong>gelegten hausinternen Diskussionsprozess<br />
eingebettet haben, <strong>der</strong><br />
von <strong>der</strong> Einrichtung einer Senatskommission<br />
Hochschulentwicklung bis zu<br />
gemeinsamen Beratungen von Senat<br />
und Hochschulrat reichte. Damit wurde<br />
gewährleistet, dass die Zielrichtung<br />
und die Maßnahmen, die sich aus ihm<br />
ergeben, auf eine hohe Akzept<strong>an</strong>z unter<br />
den Mitglie<strong>der</strong>n unserer Hochschule<br />
stoßen.“<br />
Die Vorsitzende des Hochschulrates,<br />
Prof. Dr.-Ing. Sylvia Rohr, verweist in<br />
diesem Zusammenh<strong>an</strong>g insbe<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e<br />
auf die Dynamiken, die außerhalb <strong>der</strong><br />
Hochschulen liegen: „Der regionale und<br />
industrielle Strukturw<strong>an</strong>del, die zunehmende<br />
Digitalisierung <strong>der</strong> Arbeitswelt,<br />
<strong>der</strong> Wettbewerb in einem zunehmend<br />
heterogenen Bildungsmarkt, demografische<br />
Verän<strong>der</strong>ungen wie auch <strong>der</strong><br />
Bedarf <strong>an</strong> neuen digitalen Lern- und<br />
Lehrformen stellen die Hochschulen vor<br />
große Herausfor<strong>der</strong>ungen. Die HSZG<br />
muss deshalb in ihrem Kern proaktiver<br />
werden: noch offener für Verän<strong>der</strong>ung<br />
und dabei gestaltend und innovativ<br />
sein.“<br />
Als wichtigste strategische Aufgabe <strong>der</strong><br />
nächsten Jahre hat die HSZG ihre Rolle<br />
für den Strukturw<strong>an</strong>del <strong>der</strong> Lausitz<br />
identifiziert. Der avisierte Ausstieg aus<br />
<strong>der</strong> Braunkohleverstromung beinhaltet<br />
enorme Herausfor<strong>der</strong>ungen. Die Region<br />
steht vor einem wirtschaftsstrukturellen<br />
Umbruch, <strong>der</strong> in seiner Dimension<br />
<strong>an</strong> den <strong>der</strong> 90er Jahre her<strong>an</strong>reicht. Die<br />
HSZG will ihren Beitrag leisten, dass sich<br />
in <strong>der</strong> Lausitz ein wirksames Innovationsfeld<br />
etabliert, das gleichermaßen<br />
technologische wie auch <strong>so</strong>ziale Innovationen<br />
umfasst. Es geht zugleich um<br />
die Erforschung und Entwicklung effizienter,<br />
wettbewerbsfähiger Fertigungstechnologien,<br />
Produkte und Systeme<br />
als auch um innovative Arbeits- und Sozialmodelle<br />
zur Gestaltung attraktiver<br />
und nachhaltiger Lebenswelten unter<br />
Berücksichtigung regionaler Be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>heiten<br />
und Potenziale.<br />
Um diese Rolle auszufüllen, setzt die<br />
HSZG auch weiterhin auf ihr breites Fächerspektrum<br />
von über 40 Studien<strong>an</strong>geboten.<br />
Neue Studiengänge werden<br />
in den Angew<strong>an</strong>dten Pflegewissenschaften,<br />
den Angew<strong>an</strong>dten Naturwissenschaften<br />
und <strong>der</strong> Pharmazeutischen<br />
Biotechnologie eingerichtet, hinzu<br />
kommt <strong>der</strong> neue Vertiefungsbereich<br />
Cyberphysische Systeme, <strong>der</strong> auf technologische<br />
Entwicklungen rund um<br />
Industrie 4.0, aber auch auf Assistenzlösungen<br />
für ein selbstbestimmtes Leben<br />
(AAL) von zum Beispiel älteren Menschen<br />
fokussiert.<br />
Die grundsätzliche Profilierung <strong>der</strong><br />
20
Hochschule // <strong>Einblick</strong><br />
Hochschule wird beibehalten: Die Kompetenzfel<strong>der</strong><br />
„Energie und Umwelt“<br />
<strong>so</strong>wie „Tr<strong>an</strong>sformationsprozesse in Wirtschaft<br />
und Gesellschaft“ stehen weiterhin<br />
im Mittelpunkt, eben<strong>so</strong> die internationale<br />
Ausrichtung auf Mittel- und<br />
Osteuropa.<br />
Ein verstärktes Augenmerk – und damit<br />
auch ein stärkerer Mitteleinsatz – wird<br />
auf die Aufgabenbereiche Forschung,<br />
Tr<strong>an</strong>sfer und Innovation gelegt. Hier<br />
sieht die HSZG die größten Gestaltungsmöglichkeiten<br />
und Entwicklungsperspektiven<br />
basierend auf ihren bisherigen<br />
wettbewerblichen Erfolgen. So<br />
wurden in zwei Exzellenzprogrammen<br />
des BMBF für Hochschulen für Angew<strong>an</strong>dte<br />
Wissenschaften – „FH-Impuls“<br />
und „Innovative Hochschule“ – Mittel<br />
eingeworben, die auf Jahre hinaus die<br />
drittmittelbasierte Forschungs- und<br />
Entwicklungsarbeit absichern. Hinzu<br />
kommen dauerhaft etablierte bzw. sich<br />
etablierende Kooperationen mit strategischen<br />
Partnern wie <strong>der</strong> Fraunhofer<br />
Gesellschaft (Oberlausitzer Kunststoffzentrum<br />
in Zittau, Cyber-Sicherheitslabor<br />
für kritische Infrastrukturen in<br />
Görlitz) o<strong>der</strong> bundesweit einmalige Forschungs-<br />
und Entwicklungseinrichtungen<br />
wie das vom Hochschulinstitut IPM<br />
aufgebaute und betriebene Zittauer<br />
Kraftwerkslabor (ZKWL), das <strong>der</strong> Erforschung<br />
von Maßnahmen zur Erhöhung<br />
<strong>der</strong> Energieeffizienz, <strong>der</strong> Energiespeicherung<br />
<strong>so</strong>wie <strong>der</strong> Nutzung erneuerbarer<br />
Energien dient.<br />
Die HSZG geht davon aus, dass sich<br />
diese Entwicklung fortsetzt, wobei die<br />
Forschungs- und Entwicklungsthemen<br />
verstärkt interdisziplinär werden – al<strong>so</strong><br />
nicht mehr nur technologische o<strong>der</strong><br />
<strong>so</strong>ziale Fragestellungen betreffen. Diese<br />
werden zunehmend übergreifend<br />
bearbeitet werden müssen. Hierzu wird<br />
die Steuerung darauf ausgerichtet, die<br />
Zusammenarbeit über Disziplinengrenzen,<br />
Org<strong>an</strong>isationsbereiche und St<strong>an</strong>dorte<br />
hinweg zu stärken und damit das<br />
be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e Potenzial <strong>der</strong> Hochschule<br />
<strong>an</strong> den Schnittstellen von Ingenieur-,<br />
Natur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften<br />
auszubauen und in Forschung,<br />
Lehre und Tr<strong>an</strong>sfer einzubinden.<br />
Zur besseren Koordinierung und Unterstützung<br />
<strong>der</strong> hierfür erfor<strong>der</strong>lichen Prozesse<br />
richtet die HSZG eine dem Rektorat<br />
zugeordnete Stabsstelle ein. Parallel<br />
wird zur Intensivierung von Forschung<br />
und Wissens- und Technologietr<strong>an</strong>sfer<br />
in den Fakultäten und Instituten dezentral<br />
eine unterstützende per<strong>so</strong>nale<br />
Als wichtigste strategische Aufgabe <strong>der</strong> nächsten Jahre hat<br />
die HSZG ihre Rolle für den Strukturw<strong>an</strong>del <strong>der</strong> Lausitz identifiziert.<br />
2<br />
Grundausstattung für einen wissenschaftlichen<br />
Mittelbau aufgebaut.<br />
Im Bereich Studium und Lehre werden<br />
Strukturen und Prozesse etabliert<br />
bzw. bereits vorh<strong>an</strong>dene gestärkt, die<br />
<strong>der</strong> Qualitätsentwicklung und <strong>der</strong> Verbesserung<br />
des Studienerfolgs dienen:<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Beratung und Begleitung<br />
<strong>der</strong> Studierenden, Einführung<br />
<strong>der</strong> Systemakkreditierung, Ausbau <strong>der</strong><br />
hochschuldidaktischen Weiterbildung<br />
sind hier die wichtigsten Stichworte.<br />
Eine gravierende Erhöhung <strong>der</strong> Anzahl<br />
<strong>der</strong> Studierenden ist nicht vorgesehen.<br />
Der sächsische Hochschulentwicklungspl<strong>an</strong><br />
gibt vor, dass sich die Zahl <strong>der</strong><br />
Studierenden <strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG von aktuell<br />
3.000 auf 3.200 im Jahr 2025 entwickeln<br />
<strong>so</strong>ll. Dies korrespondiert mit <strong>der</strong> demografischen<br />
Ausg<strong>an</strong>gslage und dem, was<br />
das Fächerspektrum <strong>der</strong> Hochschule<br />
bereitstellen k<strong>an</strong>n. Eine realistische<br />
qu<strong>an</strong>titative Perspektive hilft zudem,<br />
dass m<strong>an</strong> sich auf qualitative Ziele konzentrieren<br />
k<strong>an</strong>n.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt <strong>der</strong> Entwicklungspl<strong>an</strong>ung<br />
ist die Per<strong>so</strong>nalentwicklung.<br />
Nicht nur in <strong>der</strong> Wirtschaft, auch<br />
im Wissenschaftsbereich ist das Thema<br />
Sicherung des Fachkräftebedarfs von<br />
steigen<strong>der</strong> Bedeutung. Die HSZG wird<br />
diesbezüglich bis Mitte 2<strong>01</strong>9 mit einem<br />
umfassenden Per<strong>so</strong>nalentwicklungskonzept<br />
<strong>an</strong>tworten, das die Kernfragen<br />
zur Per<strong>so</strong>nalausstattung, -gewinnung,<br />
-führung und Karriereentwicklung umfassend<br />
beh<strong>an</strong>delt.<br />
Die strukturellen Maßnahmen sind den<br />
Zielen <strong>der</strong> Entwicklungspl<strong>an</strong>ung <strong>an</strong>gemessen.<br />
Beispielsweise werden die zentralen<br />
Einrichtungen durch Gründung<br />
des Zentrums für fakultätsübergreifende<br />
Lehre erweitert. Dieses Zentrum wird<br />
die äußerst vielfältigen Lehr<strong>an</strong>gebote,<br />
die sich nicht mehr nur auf eine Fakultät<br />
beziehen, in einer Einheit bündeln.<br />
Kontakt<br />
Hella Trillenberg<br />
Referentin des Rektors / Pressestelle<br />
h.trillenberg@hszg.de<br />
1<br />
2<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
Hochschulrat und Hochschulleitung<br />
auf dem Görlitzer<br />
Campus<br />
Mit <strong>der</strong> Hochschulentwicklungspl<strong>an</strong>ung<br />
gingen intensive<br />
Beratungsgespräche einher.<br />
21
<strong>Einblick</strong> // Hochschule<br />
PERSONAL ENTWICKELN UND FÖRDERN<br />
Karin Hollstein hat zurzeit viel Arbeit. Die<br />
K<strong>an</strong>zlerin <strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz<br />
ist Teil <strong>der</strong> Per<strong>so</strong>nalentwicklungskommission<br />
(PEK), die durch das Rektorat<br />
eingesetzt wurde. Die Kommission bereitet<br />
ein Per<strong>so</strong>nalentwicklungskonzept<br />
zur Zukunftsfähigkeit <strong>der</strong> Hochschule<br />
vor. Neben <strong>der</strong> K<strong>an</strong>zlerin sitzen auch <strong>der</strong><br />
Hochschulrektor Friedrich Albrecht, <strong>der</strong><br />
Dezernent für Per<strong>so</strong>nal und Recht Christoph<br />
Duscha <strong>so</strong>wie die Profes<strong>so</strong>rin Maja<br />
Dshemuchadse und <strong>der</strong> Mitarbeiter Bert<br />
Salomo in <strong>der</strong> Kommission. Ihr Ziel ist<br />
es, ein Per<strong>so</strong>nalentwicklungskonzept<br />
zu erstellen – al<strong>so</strong> ein Dokument, das<br />
alle Vorgänge, die das Hochschulper<strong>so</strong>nal<br />
betreffen, beschreibt, bewertet und<br />
Maßnahmen <strong>so</strong>wie Ziele festlegt.<br />
Dieses Konzept zu erstellen, ist eine Aufgabe,<br />
die das L<strong>an</strong>d Sachsen <strong>der</strong> Hochschule<br />
gegeben hat. Genauer gesagt:<br />
das Sächsische Staatsministerium für<br />
Wissenschaft und Kunst (SMWK). Zwischen<br />
dem Ministerium und <strong>der</strong> HSZG<br />
besteht eine Zielvereinbarung für die<br />
Jahre 2<strong>01</strong>7 bis 2020. Ein Per<strong>so</strong>nalentwicklungskonzept<br />
zu erstellen, ist Teil<br />
dieser Vereinbarung. Das <strong>so</strong>ll bis zum 30.<br />
Juni 2<strong>01</strong>9 geschehen.<br />
Karin Hollstein ist es wichtig, dass das<br />
Konzept von Führungskräften, Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern <strong>der</strong><br />
Hochschule akzeptiert und inhaltlich<br />
getragen wird. „Es <strong>so</strong>ll eine runde Sache<br />
werden“, sagt sie. Doch die Kommission<br />
ist in <strong>der</strong> Gestaltung des Per<strong>so</strong>nalentwicklungskonzeptes<br />
nicht komplett frei.<br />
Sie muss die Vorgaben des Sächsischen<br />
Hochschulentwicklungspl<strong>an</strong>s 2025 beachten<br />
und Entwicklungstrends des<br />
Per<strong>so</strong>nals <strong>an</strong> Hochschulen in den Blick<br />
nehmen.<br />
Für die 3.000 Studentinnen und Studenten<br />
<strong>der</strong> HSZG bedarf es einer auskömmlichen<br />
per<strong>so</strong>nellen Ausstattung <strong>der</strong> Fakultäten,<br />
zentralen Einrichtungen und<br />
<strong>der</strong> Hochschulverwaltung, insbe<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e<br />
durch die Bereitstellung von Dauerstellen<br />
für Daueraufgaben.<br />
Um diese Stellen bedarfsgerecht zu verteilen,<br />
gibt es einen Stellenpool. Dort<br />
findet m<strong>an</strong> jede frei werdende Stelle,<br />
zum Beispiel wenn eine Profes<strong>so</strong>rin o<strong>der</strong><br />
ein Profes<strong>so</strong>r in Rente geht. „Der Stellenpool<br />
ist ein gut etabliertes Instrument<br />
bei uns“, sagt die K<strong>an</strong>zlerin. „Dieses Instrument<br />
<strong>so</strong>ll Fakultäten dazu motivieren,<br />
ihre strategische Entwicklung l<strong>an</strong>gfristig<br />
zu pl<strong>an</strong>en und auf dieser Grundlage den<br />
Per<strong>so</strong>nalbedarf zu definieren.“<br />
Die Kommission befasst sich aktuell damit,<br />
eine Übersicht über die vorh<strong>an</strong>denen<br />
Maßnahmen und Instrumente <strong>der</strong><br />
Per<strong>so</strong>nalentwicklung <strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG zu<br />
erstellen.<br />
Dazu schaut sie auf folgende H<strong>an</strong>dlungsfel<strong>der</strong>:<br />
1. Per<strong>so</strong>nalgewinnung<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
1<br />
2. Per<strong>so</strong>nalführung, Kommunikation<br />
und Zusammenarbeit<br />
3. Per<strong>so</strong>nalför<strong>der</strong>ung<br />
In jedem H<strong>an</strong>dlungsfeld wird <strong>der</strong> Status<br />
Quo <strong>der</strong> Verfahrensweisen und Instrumente<br />
beschrieben. D<strong>an</strong>n wird bewertet,<br />
wie es bisher umgesetzt wurde und<br />
schließlich ermittelt, wo weiterer o<strong>der</strong><br />
neuer H<strong>an</strong>dlungsbedarf besteht.<br />
Im gesamten Prozess wird die Kommission<br />
von dem Beratungsunternehmen<br />
CHE Consult begleitet. „Wir haben uns<br />
bewusst externen Sachverst<strong>an</strong>d ins Boot<br />
geholt, um die Thematik professionell<br />
begleiten zu lassen“, sagt Karin Hollstein.<br />
CHE Consult unterstützt darin, die Kommissionsarbeit<br />
vorzubereiten, <strong>der</strong>en Arbeit<br />
zu reflektieren, themenbezogene<br />
Workshops zu initiieren und durchzuführen<br />
<strong>so</strong>wie die hochschulinterne Kommunikation<br />
zu begleiten.<br />
Stück für Stück wird <strong>der</strong> Inhalt des Per<strong>so</strong>nalentwicklungskonzepts<br />
nach außen<br />
weitergegeben – zunächst im September<br />
2<strong>01</strong>8 auf <strong>der</strong> Dienstberatung<br />
des Rektors. D<strong>an</strong>n werden Rektorat,<br />
Per<strong>so</strong>nalrat, Schwerbehin<strong>der</strong>tenvertretung<br />
und Gleichstellungsbeauftragte<br />
informiert. Im November 2<strong>01</strong>8 <strong>so</strong>ll das<br />
Per<strong>so</strong>nalentwicklungskonzept Gegenst<strong>an</strong>d<br />
eines Workshops mit den Führungskräften<br />
<strong>der</strong> Hochschule sein. Dem<br />
Senat wird das Konzept im J<strong>an</strong>uar 2<strong>01</strong>9<br />
vorgestellt und im März 2<strong>01</strong>9 dem Hochschulrat.<br />
Das Rektorat entscheidet final<br />
über das Per<strong>so</strong>nalentwicklungskonzept<br />
und reicht dieses fristgerecht am 30. Juni<br />
2<strong>01</strong>9 beim SMWK ein. „Wir liegen gut in<br />
<strong>der</strong> Zeit“, hält Karin Hollstein fest.<br />
1<br />
Die Per<strong>so</strong>nalentwicklungskommission<br />
<strong>der</strong> Hochschule<br />
Zittau/Görlitz (v.l.n.r.): Bert<br />
Salomo, Prof. Maja Dshemuchadse,<br />
Rektor Friedrich<br />
Albrecht, Christoph Duscha,<br />
K<strong>an</strong>zlerin Karin Hollstein und<br />
Heike Kallweit<br />
22
KUNST WIEDER ERLEBBAR MACHEN!<br />
Mit Museumsführungen für Menschen mit Demenz ermöglichen Studierende <strong>der</strong><br />
Sozialen Arbeit einer be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>en Zielgruppe die Teilhabe am kulturellen Leben.<br />
VON CORNELIA ROTHE UND CHRISTIAN BÜHLER<br />
„Im Rahmen des Seminars Projektentwicklung/Projektstudium<br />
haben wir uns<br />
im Matrikel SWb16 für die Thematik <strong>Kultur</strong><br />
und Demenz entschieden“, erzählt<br />
Christi<strong>an</strong> Bühler. „Hierdurch haben wir<br />
die positive Herausfor<strong>der</strong>ung ermöglicht<br />
bekommen, ein bereits erfolgreiches<br />
Projekt fortzusetzen.“ Bei diesem<br />
Projekt h<strong>an</strong>delt es sich um Museumsführungen<br />
für Menschen, die <strong>an</strong> Demenz<br />
erkr<strong>an</strong>kt sind. Seit November 2<strong>01</strong>7 gelingt<br />
es den Studierenden <strong>der</strong> Sozialen<br />
Arbeit, diesen Menschen wie<strong>der</strong> eine<br />
<strong>so</strong>ziale Teilhabe am kulturellen Leben zu<br />
ermöglichen.<br />
„Die Initiative für dieses Projekt ging von<br />
Prof. Matthias Theodor Vogt und mir<br />
aus“, berichtet Projektleiterin Prof. Dr.<br />
habil. Gisela Thiele. „Wir hatten vor drei<br />
Jahren ein Treffen mit dem Leiter des<br />
Schlesischen Museums zu Görlitz Herrn<br />
Dr. Bauer. Ich habe d<strong>an</strong>n vorgeschlagen,<br />
dass wir innerhalb des Projektstudiums<br />
<strong>der</strong> Sozialen Arbeit im vierten und fünften<br />
Semester ein studentisches Projekt<br />
daraus entwickeln. Über das <strong>an</strong>fängliche<br />
studentische Projekt hinaus <strong>so</strong>ll nun die<br />
Zusammenarbeit mit dem Schlesischen<br />
Museum zu Görlitz fortgesetzt und das<br />
Angebot ein fester Best<strong>an</strong>dteil im Museumsprogramm<br />
werden.<br />
„Das Angebot richtet sich <strong>an</strong> alle ambul<strong>an</strong>ten,<br />
teilstationären und stationären<br />
Einrichtungen <strong>der</strong> Altenhilfe <strong>der</strong> Stadt<br />
und eben<strong>so</strong> <strong>an</strong> pflegende Angehörige“,<br />
erklärt Christi<strong>an</strong> Bühler. Die Führungen<br />
finden ohne Einschränkungen und mit<br />
einem hohen Maß <strong>an</strong> Wertschätzung<br />
statt. „Wir erleben viel positive Re<strong>so</strong>n<strong>an</strong>z<br />
und eine d<strong>an</strong>kbare Annahme des Angebotes,<br />
was nicht selbstverständlich ist,<br />
denn es wird den Menschen Einiges abverl<strong>an</strong>gt“,<br />
<strong>so</strong> <strong>der</strong> Student. An Demenz erkr<strong>an</strong>kte<br />
Per<strong>so</strong>nen erreichen in <strong>der</strong> Regel<br />
1<br />
schnell die Grenzen ihrer Konzentration.<br />
„Deshalb ist be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>es Augenmerk darauf<br />
zu legen, dass wir eine Überfor<strong>der</strong>ung<br />
nach Möglichkeit vermeiden und<br />
die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen<br />
im Blick behalten“, erklärt Christi<strong>an</strong><br />
Bühler.<br />
Der Dialog mit <strong>der</strong> Zielgruppe ermöglicht<br />
es den Projektteilnehmern, unterschiedliche<br />
Themen in Verg<strong>an</strong>genheit<br />
und Gegenwart aufzugreifen, <strong>so</strong> dass<br />
lebendige As<strong>so</strong>ziationen und Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzungen<br />
geschaffen werden können<br />
und in einem greifbaren Erlebnis<br />
münden. Prof. Gisela Thiele erklärt: „Die<br />
Erfahrung <strong>der</strong> Bildbetrachtung eröffnet<br />
einen großen Raum für eigene Ged<strong>an</strong>ken<br />
und knüpft <strong>an</strong> frühere Erfahrungen<br />
<strong>der</strong> <strong>an</strong> Demenz erkr<strong>an</strong>kten Menschen<br />
<strong>an</strong>. Erste Erfahrungen nach einem Jahr<br />
praktizierter Führungen versprechen<br />
eine rege Anteilnahme und ein kleines<br />
Stück freudiger Lebensqualität in <strong>der</strong><br />
Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit Gemälden und<br />
Skulpturen.“<br />
Im Anschluss <strong>an</strong> die Führungen folgt das<br />
Endritual. Dieses besteht aus dem Ausmalen<br />
eines einfachen Bildes mit Farbe<br />
und Pinsel. Natürlich wird auch Kaffee<br />
und Kuchen gereicht. Denn auch hier<br />
geht ein positives Erlebnis durch den<br />
Magen. Ziel ist es, eine kleine Erinnerung<br />
zu schaffen.<br />
„Das Projekt <strong>läuft</strong> jetzt mit 18 Studierenden,<br />
die sich freiwillig gemeldet haben,<br />
weiter“, freut sich Prof. Gisela Thiele.<br />
Die Führungen <strong>der</strong> aktuellen Seminargruppe<br />
beginnen im Wintersemester<br />
und schließen sich mit zwei neuen Führungslinien<br />
zu den Themen „W<strong>an</strong><strong>der</strong>n“<br />
und „Berufe“ denen <strong>der</strong> vorherigen Studierendengruppe<br />
<strong>an</strong>.<br />
1<br />
Foto: HSZG<br />
Studierende <strong>der</strong> Sozialen<br />
Arbeit entwickeln Museumsführungen<br />
für <strong>an</strong> Demenz<br />
erkr<strong>an</strong>kte Menschen unter <strong>der</strong><br />
Leitung von Prof. Gisela Thiele<br />
(vor<strong>der</strong>e Reihe, 2. v. l.).<br />
23
1<br />
IM ALTER AUF TECHNIK VERTRAUEN<br />
Foto: © ASK-Fotografie/Fotolia<br />
Das Projekt VATI möchte älteren Menschen den Umg<strong>an</strong>g mit Assistenzsystemen nahebringen<br />
und für regionale Anbieter sensibilisieren.<br />
VON SABRINA WINTER<br />
Ein Sturz k<strong>an</strong>n eine Krise auslösen –<br />
be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>s bei älteren Menschen. Da<br />
k<strong>an</strong>n ein gebrochenes Bein die Alltagsaufgaben<br />
fast unmöglich machen. Oft<br />
benötigen Seniorinnen und Senioren<br />
d<strong>an</strong>n technische Hilfsmittel, wie einen<br />
Treppenlift o<strong>der</strong> einen Notrufknopf. Diese<br />
Assistenzsysteme <strong>so</strong>llen das Leben<br />
in den eigenen vier Wänden leichter<br />
machen. Doch es gibt ein Problem mit<br />
ihnen: Ältere Menschen verstehen oft<br />
nicht, wie sie funktionieren. „Meist werden<br />
die technischen Hilfsmittel erst nach<br />
einem Sturz o<strong>der</strong> Schlag<strong>an</strong>fall installiert.<br />
D<strong>an</strong>n treffen Angehörige die Entscheidung“,<br />
erklärt Andreas Hoff, Profes<strong>so</strong>r für<br />
Soziale Gerontologie. „Sie meinen das<br />
zwar gut. Aber damit das Gerät im Alltag<br />
auch genutzt wird, ist eine umfassende<br />
Beratung entscheidend.“<br />
Wie k<strong>an</strong>n Technik Senioren helfen? Wie<br />
schafft m<strong>an</strong> es, dass sie neuen Technologien<br />
vertrauen? Diese und weitere Fragen<br />
werden im Projekt VATI erforscht.<br />
Das Akronym VATI steht für „Vertrauen<br />
in Assistenz-Technologien zur Inklusion“<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
2<br />
älterer Menschen. Bei dem Forschungsprojekt<br />
arbeiten die Fakultät für Sozialwissenschaften<br />
und <strong>der</strong> Fachbereich<br />
Informatik zusammen. Zuerst gab es<br />
eine repräsentative Befragung von Menschen<br />
im L<strong>an</strong>dkreis Görlitz, die älter als<br />
60 Jahre sind. Im zweiten Schritt wurde<br />
eine interaktive Website, <strong>der</strong> VATI-Technologie-Navigator,<br />
programmiert. Er<br />
hilft dabei herauszufinden, welche technischen<br />
Hilfsmittel nötig sind. „Auf <strong>der</strong><br />
Website können Senioren und Angehörige<br />
zuverlässige Informationen finden.<br />
Wir sind als Hochschule ja eine neutrale<br />
Einrichtung ohne Wirtschaftsinteressen“,<br />
sagt <strong>der</strong> Projektver<strong>an</strong>twortliche<br />
Andreas Hoff. Ziel von VATI ist es, die<br />
Anbieter technischer Assistenzsysteme<br />
aus <strong>der</strong> Region mit dar<strong>an</strong> interessierten<br />
Menschen aus <strong>der</strong> Region zusammenzubringen.<br />
Für Senioren hat das einen entscheidenden<br />
Vorteil: Die Anbieter vor<br />
Ort kennen ihre Bedürfnisse besser und<br />
können <strong>so</strong>mit besser beraten.<br />
Bis Ende des Jahres 2<strong>01</strong>7 hat das Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung<br />
das Projekt fin<strong>an</strong>ziert. Die Anschlussfin<strong>an</strong>zierung<br />
hat nun das Sächsische<br />
Staatsministerium für Wissenschaft und<br />
Kunst nahtlos übernommen. Das schafft<br />
Raum für vertiefende statistische Analysen.<br />
Projektleiter Andreas Hoff sagt:<br />
„Nach drei Jahren Projektlaufzeit ist<br />
1<br />
2<br />
Assistenz-Technologie <strong>so</strong>ll im<br />
Alter helfen.<br />
VATI-Projektleiter<br />
Prof. Dr. Andreas Hoff<br />
24
Forschung und Tr<strong>an</strong>sfer // <strong>Einblick</strong><br />
<strong>der</strong> Technologie-Navigator fertig. Aber<br />
seine l<strong>an</strong>gfristige Wirkung muss noch<br />
erforscht werden!“ Neben <strong>der</strong> Website<br />
gibt es Pläne, auch eine Telefon-Hotline<br />
zu schalten. Dort <strong>so</strong>llen studentische<br />
Mitarbeiter zu den Assistenztechnologien<br />
beraten. Außerdem wird es eine<br />
Musterwohnung geben, in <strong>der</strong> Senioren<br />
verschiedene Assistenztechnologien<br />
ausprobieren können. Dazu arbeitet die<br />
HSZG mit dem Görlitzer Wohnungs<strong>an</strong>bieter<br />
Kommwohnen zusammen. Die<br />
Musterwohnung <strong>so</strong>ll in <strong>der</strong> Wohn<strong>an</strong>lage<br />
Frauenburg-Karree liegen – mit betreutem<br />
Wohnen und Pflegeheim in unmittelbarer<br />
Umgebung. „Das ist perfekt für<br />
uns, weil wir <strong>so</strong> die Technik unter lebensnahen<br />
Bedingungen testen können“,<br />
sagt Andreas Hoff.<br />
Dass das Thema „technische Assistenzsysteme“<br />
im L<strong>an</strong>dkreis Görlitz noch<br />
nicht richtig <strong>an</strong>gekommen ist, zeigt die<br />
Befragung aus dem ersten Teil des Projekts<br />
VATI. Nur ein Zehntel <strong>der</strong> Befragten<br />
gab <strong>an</strong>, technische Assistenzsysteme<br />
zu nutzen. Lediglich 17 Prozent können<br />
sich vorstellen, ihren Wohnraum<br />
umzubauen. Dabei zieht es eine deutliche<br />
Mehrheit von über 90 Prozent vor,<br />
<strong>so</strong>l<strong>an</strong>ge wie möglich in den eigenen<br />
vier Wänden zu leben. Gleichzeitig ist<br />
<strong>der</strong> Wohnraum vieler Menschen in <strong>der</strong><br />
Region nicht altersgerecht ausgestattet:<br />
gerade mal 27 Prozent haben niedrigschwellige<br />
Duschen und nur 13 Prozent<br />
einen stufenlosen Zug<strong>an</strong>g zu ihrer Wohnung.<br />
Eine barrierefreie Wohnung und<br />
mo<strong>der</strong>ne Assistenztechnologien bieten<br />
die Ch<strong>an</strong>ce, bis ins hohe Lebensalter weiterhin<br />
im vertrautem Umfeld zu leben.<br />
Auch darum ist weitere Forschung dazu<br />
wichtig. Denn die Region um Zittau und<br />
Görlitz ist demografisch gesehen eine<br />
<strong>der</strong> ältesten in Deutschl<strong>an</strong>d.<br />
Infos zum Technologie-Navigator:<br />
https://www.vati-navigator.de<br />
Foto: © DOC RABE Media/Fotolia<br />
3<br />
3<br />
Ältere Menschen im L<strong>an</strong>dkreis Görlitz möchten <strong>so</strong>l<strong>an</strong>ge wie möglich im eigenen Wohnraum leben.<br />
25
Foto: GrAl/Shutterstock.com<br />
REINVENTING HEALTH -<br />
WEGE IN EINE NEUE GESUNDHEITSKULTUR<br />
MAIK HOSANG & YVE STÖBEL-RICHTER<br />
Wir leben in einer Welt im W<strong>an</strong>del, <strong>der</strong><br />
viele Dimensionen umfasst: wirtschaftliche,<br />
<strong>so</strong>ziale und kulturelle, aber auch<br />
persönliche, psychische und seelische.<br />
Ein Begriff, <strong>der</strong> vieles davon vereint, ist<br />
<strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Gesundheit. Auch die<br />
darauf bezogenen Perspektiven sind im<br />
W<strong>an</strong>del. Mit dem Arbeitsbegriff „Reinventing<br />
Health“ versuchen wir, dafür<br />
theoretische als auch praktische Forschungsräume<br />
zu entwickeln.<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
1<br />
Weil viele <strong>der</strong> neuen Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
fach- und systemübergreifende<br />
Denk<strong>an</strong>sätze erfor<strong>der</strong>n, bietet es sich<br />
<strong>an</strong>, die Vielfalt <strong>der</strong> HSZG und die kurzen<br />
Wege zwischen den Fakultäten für <strong>so</strong>lche<br />
Innovationen zu nutzen. So kam es<br />
auch zur Zusammenwirkung zwischen<br />
uns beiden – Yve Stöbel-Richter leitet<br />
den Masterstudieng<strong>an</strong>g M<strong>an</strong>agement<br />
im Gesundheitswesen und Maik Hos<strong>an</strong>g<br />
den Bachelorstudieng<strong>an</strong>g <strong>Kultur</strong><br />
und M<strong>an</strong>agement – <strong>so</strong>wohl auf fakultärer<br />
Ebene, als auch im Rahmen des<br />
Forschungsschwerpunkts „Tr<strong>an</strong>sformationsprozesse<br />
in Wirtschaft und Gesellschaft“.<br />
Einige uns <strong>der</strong>zeit beschäftigende<br />
Projekte stellen wir im Folgenden<br />
kurz vor.<br />
Ein heute zunehmend verbreiteter<br />
Zwischenbegriff für eine neue Gesundheitskultur<br />
ist <strong>der</strong> Begriff Salutogenese<br />
(aus: Salus = Heil, Gesundheit und Genese<br />
=Entstehung), <strong>der</strong> vom israelischamerik<strong>an</strong>ischen<br />
Medizin<strong>so</strong>ziologen<br />
Aaron Antonovsky in den 1970er Jahren<br />
entwickelt wurde. Nach dem Salutogenese-Modell<br />
ist Gesundheit kein<br />
Zust<strong>an</strong>d, <strong>so</strong>n<strong>der</strong>n ein Kontinuum. Ein<br />
wesentlicher Faktor dafür, auf welchen<br />
Punkt dieses Kontinuums zwischen<br />
‘Health-Ease‘ und ‘Dis-Ease‘ m<strong>an</strong> sich<br />
täglich einordnet, ist das „Kohärenzgefühl“.<br />
Das Kohärenzgefühl drückt ein<br />
durchdringendes, dynamisches Gefühl<br />
des Vertrauens aus.<br />
Der Denk<strong>an</strong>satz <strong>der</strong> Salutogenese ist<br />
zweifellos ein Fortschritt gegenüber<br />
bisherigen, vor allem auf Kr<strong>an</strong>kheit bzw.<br />
Kr<strong>an</strong>kheitsvermeidung fokussierten<br />
Gesundheitsverständnissen. Dennoch<br />
hat er unseres Erachtens zwei Mängel:<br />
Er reflektiert zum einen zu wenig die<br />
<strong>so</strong>zialen und kulturellen Bedingungen<br />
dafür, wie sich das Kohärenzgefühl im<br />
menschlichen Leben bilden k<strong>an</strong>n. Und<br />
er diskutiert zum <strong>an</strong><strong>der</strong>en auch nicht<br />
konsequent genug in die tr<strong>an</strong>sdisziplinären<br />
Grundlagen dessen, was <strong>so</strong> ein<br />
‘durchdringendes, dynamisches Gefühl<br />
des Vertrauens‘ eigentlich ist. Dies mag<br />
ein Grund dafür sein, warum wir beide<br />
dazu eingeladen wurden, beim diesjährigen<br />
Symposium ‘Wege zu einer neuen<br />
Gesundheitskultur‘ des Deutschen<br />
Dachverb<strong>an</strong>des <strong>an</strong> <strong>der</strong> Universität Göt-<br />
28
Forschung und Tr<strong>an</strong>sfer // <strong>Einblick</strong><br />
2<br />
Foto: Sophie Herwig<br />
tingen einen Input zum Thema „Wie<br />
kommt das Neue in die Welt: Ko-kreative<br />
Prozesse“ zu geben.<br />
Neben diesen theoretischen Forschungen<br />
beschäftigen uns auch praktische<br />
Entwicklungsräume für neue Gesundheitskulturen.<br />
Ein Projekt ist die Implementierung<br />
eines systemischen<br />
BGM-Konzeptes (Betriebliches <strong>Gesundheitsm<strong>an</strong>agement</strong>)<br />
beim Schüco-Konzern.<br />
Hierzu f<strong>an</strong>d am 17. April 2<strong>01</strong>8 ein<br />
Kick-off Meeting mit den Studierenden<br />
des Masterstudieng<strong>an</strong>gs M<strong>an</strong>agement<br />
im Gesundheitswesen und dem Projektteam<br />
<strong>so</strong>wie dem Geschäftsführer<br />
bei Schüco in Weißenfels statt. Neben<br />
einer umfassenden Werksbesichtigung<br />
arbeiteten die KollegInnen von Schüco<br />
und die Studierenden gemeinsam <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> Zielklärung für drei Projekte zu den<br />
Themen Arbeitsfähigkeit, Gesundheitszirkel<br />
und Motivation. In den nächsten<br />
zwölf Monaten werden die Studierenden<br />
des Matrikels WGm 17 jeweils Konzepte<br />
entwickeln und <strong>der</strong>en Umsetzung<br />
in Pilotprojekten durchführen. Dabei<br />
werden sie hautnah erfahren dürfen,<br />
wie BGM in einem Unternehmen implementiert<br />
wird und welche Sichtweisen<br />
auf die persönliche und die kollektive<br />
Gesundheit notwendig sind, um hieraus<br />
nicht nur ein Projekt, <strong>so</strong>n<strong>der</strong>n eine<br />
l<strong>an</strong>gfristige Unternehmenskultur zu machen.<br />
Mit einer weiteren Kollegin – Prof. Dr. Ute<br />
Pflicke, Leiterin des Studieng<strong>an</strong>ges Tourismusm<strong>an</strong>gement<br />
– sind wir außerdem<br />
im Beirat eines Projekts, in welchem kultur-<br />
und gesundheitstouristische Innovationen<br />
für die Regionen Oberlausitz<br />
und Sächsische Schweiz entwickelt werden.<br />
Ausgehend von entsprechenden<br />
Unternehmen in Bad Sch<strong>an</strong>dau (tosk<strong>an</strong>aworld)<br />
und Großschönau (Trixi-Park)<br />
geht es darum, neuartige und überregional<br />
attraktive Angebote zu entwickeln,<br />
welche intensive und nachhaltige<br />
Erfahrungen einer Gesundheit für Körper,<br />
Seele und Geist ermöglichen. Im<br />
Rahmen von Forschungsseminaren und<br />
Abschlussarbeiten werden auch dabei<br />
Studierende aktiv einbezogen.<br />
1<br />
Prof. Dr. phil. habil. Yve Stöbel-<br />
Richter 2<br />
Kontakt<br />
Dr. phil. habil. Maik Hos<strong>an</strong>g<br />
m.hos<strong>an</strong>g@hszg.de<br />
Prof. Dr. phil. habil. Yve Stöbel-Richter<br />
yve.stoebel-richter@hszg.de<br />
Dr. phil habil. Maik Hos<strong>an</strong>g und<br />
Neurobiologe Gerald Hüther<br />
im Gespräch<br />
29
<strong>Einblick</strong> // Studium und Lehre<br />
NEUE E-INFO PLATTFORM<br />
Das Projekt AMiCE steht für mehr Wettbewerbsfähigkeit und lebendige regionale<br />
und überregionale Partnerschaften.<br />
VON MARLEN KRAUSE<br />
Foto: Peter Hennig<br />
konkreten Durchführung <strong>der</strong> Innovationsprojekte<br />
mit interessierten Unternehmen<br />
sind die Arbeitspaket-Leiter<br />
TU Liberec und die Universität Genua<br />
betraut.<br />
1<br />
Das letzte Partnertreffen des AMiCE Projektes<br />
f<strong>an</strong>d am 3. Juli 2<strong>01</strong>8 im Prager Verbindungsbüro<br />
des Freistaates Sachsen,<br />
einen Steinwurf von <strong>der</strong> Karlsbrücke<br />
entfernt, statt. Partner aus drei Län<strong>der</strong>n<br />
waren vor Ort und weitere via WebEx<br />
zugeschaltet. Im Fokus <strong>der</strong> Agenda<br />
st<strong>an</strong>d das Konzept für die gepl<strong>an</strong>te<br />
AMiCE-E-Info Plattform. Diese wird ab<br />
Ende 2<strong>01</strong>9 als Informationsplattform in<br />
knapper Form die relev<strong>an</strong>testen Inhalte<br />
zu den Themen Adv<strong>an</strong>ced M<strong>an</strong>ufacturing-Technology,<br />
Circular Economy<br />
und <strong>der</strong>en För<strong>der</strong>ung zusammenfassen.<br />
Als Hauptzielgruppe <strong>so</strong>llen kleine und<br />
mittlere Unternehmen <strong>der</strong> fünf Partnerregionen,<br />
je nach St<strong>an</strong>d ihrer bisherigen<br />
Erfahrung, einen geeigneten und neutralen<br />
Einstieg in die Thematik finden.<br />
Noch wichtiger aber ist das Bilden von<br />
lebendigen regionalen und überregionalen<br />
Partnerschaften zwischen den<br />
Unternehmen, Forschungsinstituten<br />
und Vertretern <strong>der</strong> Politik (‘Triple Helix<br />
Model of Innovation‘). Dies <strong>so</strong>ll im ersten<br />
Schritt durch Workshops, Masterclasses<br />
und Info Sessions erreicht und<br />
zukünftig durch konkrete Innovationsprojekte<br />
gefestigt werden. Die E-Info<br />
Plattform wird darüber hinaus interessierte<br />
kleine und mittlere Unternehmen<br />
mit ortsabhängigen Funktionalitäten<br />
unterstützen, um Partner, Experten und<br />
geeignete Maschinen zu finden und<br />
sich selber zu präsentieren.<br />
Damit stellt die E-Info Plattform ein<br />
wichtiges Kommunikationsmittel und<br />
Bindeglied <strong>der</strong> insgesamt drei Arbeitspakete<br />
dar. Als Leiter von Arbeitspaket-1<br />
ist die HSZG für die Koordination und<br />
Implementation <strong>der</strong> E-Info Plattform<br />
<strong>so</strong>wie Entwicklung von Strategien <strong>der</strong><br />
generativen Fertigung zuständig. Mit<br />
<strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Geschäftsprozesse, <strong>der</strong><br />
Konzeption von Pilot-Linien und <strong>der</strong><br />
Für das verarbeitende Gewerbe sind<br />
innovative Fertigungstechnologien ein<br />
wichtiger Motor und von hoher Bedeutung<br />
für Beschäftigung und Wachstum<br />
in Europa. Das EU-Projekt AMiCE trägt<br />
maßgebend zu den Fertigungstechnologien<br />
als Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit<br />
<strong>der</strong> europäischen<br />
Wirtschaft bei. Seit Ende 2<strong>01</strong>7 arbeiten<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz Martin<br />
Sturm, Marlen Krause und Sepp Härtel<br />
gemeinsam <strong>an</strong> <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> globalen<br />
Ziele und damit einhergehend<br />
<strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Investitionen, Verbesserung<br />
des Wissenstr<strong>an</strong>sfers und<br />
Steigerung <strong>der</strong> Wettbewerbsfähigkeit.<br />
Mit einer Laufzeit von 2<strong>01</strong>7 bis 2020<br />
ermöglicht das EU-Projekt eine nachhaltige<br />
Entwicklung <strong>der</strong> additiven Fertigungstechnologie<br />
in Zentraleuropa<br />
und Unterstützung bei <strong>der</strong> Anwendung<br />
mo<strong>der</strong>ner Technologien nach dem Prinzip<br />
des ökologischen Produktlebenszyklus.<br />
Kontakt<br />
Ing. Martin Sturm, Ph.D.<br />
m.sturm@hszg.de<br />
Weitere Informationen zum Projekt:<br />
www.interreg-central.eu/AMiCE<br />
1<br />
Der für AMiCE ver<strong>an</strong>twortliche<br />
Hochschullehrer Martin Sturm<br />
zusammen mit seinem Team:<br />
Marlen Krause und Sepp Härtel<br />
(v.l.n.r.)<br />
30
Studium und Lehre // <strong>Einblick</strong><br />
ACHT NEUE INGENIEURPÄDAGOGEN<br />
Die ingenieurdidaktische Kompetenz von Lehrenden <strong>der</strong> MINT-Fakultäten wird<br />
geför<strong>der</strong>t.<br />
VON KARL-HEINZ REICHE UND DANIEL WINKLER<br />
Im J<strong>an</strong>uar 2<strong>01</strong>8 haben gleich acht<br />
Mitarbeiter den Abschluss zum Ingenieurpädagogen<br />
erfolgreich erworben.<br />
Zertifiziert wird dieser von <strong>der</strong><br />
Ingenieurpädagogischen Wissenschaftsgesellschaft<br />
(IPW) und <strong>der</strong><br />
International Society for Engineering<br />
Pedagogy (IGIP). Ver<strong>an</strong>staltet wurde<br />
die Ingenieurpädagogische Weiterbildung<br />
für Lehrende vom Projekt<br />
Makroeigenschaften/Match 3 des Karriereservice.<br />
Das Ziel <strong>der</strong> Weiterbildung war es,<br />
die ingenieurdidaktische Kompetenz<br />
unserer Hochschulmitarbeiter <strong>der</strong><br />
MINT-Fakultäten weiter auszubauen.<br />
Dafür wurde eine Ver<strong>an</strong>staltungsreihe<br />
geschaffen, die nach den Vorgaben <strong>der</strong><br />
Ingenieurpädagogischen Wissensgesellschaft<br />
konzipiert und in Kooperation<br />
mit dem Institut für Berufspädagogik<br />
<strong>der</strong> Technischen Universität Dresden<br />
durchgeführt wurde. Sie baut auf dem<br />
Weiterbildungsprojekt „Ingenieurdidaktik<br />
<strong>an</strong> Sächsischen Hochschulen‚<br />
e-Didact‘“ aus den Jahren 2<strong>01</strong>0 bis 2<strong>01</strong>3<br />
auf.<br />
Foto: David Sauer<br />
1<br />
Um eine gruppendynamische, peergrouporientierte<br />
und effektive<br />
Atmosphäre <strong>der</strong> Wissens- und Kompetenzvermittlung<br />
zu schaffen, wurden<br />
Teile <strong>der</strong> Module in Blöcke zusammengefasst,<br />
die unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em in den<br />
Tagungshäusern Bischof-Benno-Haus<br />
in Schmochtitz bei Bautzen, <strong>der</strong> Windmühle<br />
Seifhennersdorf und dem Dom<br />
Parada in Niedamirów (Polen) stattf<strong>an</strong>den.<br />
Das letztgen<strong>an</strong>nte Tagungshaus<br />
im polnischen Riesengebirge stellte<br />
dabei ein be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>es Highlight dar,<br />
da es Ver<strong>an</strong>staltung<strong>so</strong>rt <strong>der</strong> fünftägigen<br />
Summer School »Kommunikation«<br />
war. Hierbei erarbeiteten sich die<br />
Teilnehmer verschiedene Techniken<br />
für gutes Sprechen, das heißt, bewusst<br />
bzw. ökonomisch zu atmen, die eigene<br />
Körperwahrnehmung zu sensibilisieren<br />
und damit Stressbewältigung zu beför<strong>der</strong>n.<br />
Weiterhin wurden systemische<br />
und hum<strong>an</strong>psychologische Ansätze für<br />
die eigene Professionalisierung <strong>so</strong>wie<br />
Arbeitstechniken wie zielführende<br />
Gesprächsführung, zum Beispiel durch<br />
lösung<strong>so</strong>rientierte Fragestellungen,<br />
gelehrt. Die Summer School wurde<br />
abgerundet durch eine gemeinsame<br />
W<strong>an</strong><strong>der</strong>ung im Riesengebirge, auf <strong>der</strong><br />
sich die Gruppe bei gruppendynamischen<br />
Elementen als Team erwiesen hat.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Weiterbildung zum<br />
Ingenieurpädagogen ab<strong>so</strong>lvierten die<br />
Teilnehmer Ver<strong>an</strong>staltungen zu folgenden<br />
Themen: Lern-, Kontroll- und Bewertungsprozesse,<br />
Persönlichkeits- und<br />
Rollenmodelle, Lehrver<strong>an</strong>staltungsformen,<br />
Studienziel und -inhaltsbestimmung,<br />
Resilienz und Psychohygiene,<br />
Körpersprache, Stimmtraining, Beratung,<br />
Gestaltung von Laborpraktika,<br />
erlebni<strong>so</strong>rientierte Methoden, Design<br />
Thinking etc. Die einzelnen Lehrver<strong>an</strong>staltungen<br />
wurden, je nach Fachgebiet,<br />
von unterschiedlichen Dozenten gehalten.<br />
Darunter Dr. Steffen Kersten (Wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am Institut<br />
für Berufspädagogik <strong>an</strong> <strong>der</strong> TU Dresden),<br />
Timon Umlauft (Wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter <strong>an</strong> <strong>der</strong> TU Bergakademie<br />
Freiberg im Bereich Hochschuldidaktik<br />
in den MINT-Fächern), Dr. Jörg Heidig<br />
(Lehrbeauftragter für psychologische<br />
Praxisfächer und Didaktik-Fachm<strong>an</strong>n),<br />
D<strong>an</strong>iela Schober (Trainerin und Beraterin<br />
für Führungskräfte mit zehn Jahren<br />
Erfahrung auf Bühnen und vor <strong>der</strong> Fernsehkamera)<br />
und Karl-Heinz Reiche (Projektm<strong>an</strong>ager<br />
Karriereservice).<br />
HABEN SIE AUCH INTERESSE?<br />
Die nächste Ingenieurpädagogische<br />
Weiterbildung für Lehrende (Umf<strong>an</strong>g<br />
230 Stunden, berufsbegleitend) findet<br />
von Dezember 2<strong>01</strong>9 bis J<strong>an</strong>uar 2020<br />
statt. Interessenten dafür können sich<br />
gern bei D<strong>an</strong>iel Winkler melden.<br />
Weitere Informationen finden Sie hier:<br />
www.hszg.de/ipwb<br />
Kontakt<br />
D<strong>an</strong>iel Winkler<br />
Karriereservice <strong>der</strong> HSZG<br />
d<strong>an</strong>iel.winkler@hszg.de<br />
1<br />
Die HSZG-Mitarbeiter freuen<br />
sich über ihren Abschluss zum<br />
Ingenieurpädagogen.<br />
31
1<br />
Foto: Cornelia Rothe<br />
„UM DIESE MENSCHEN HABE ICH GROSSE ANGST“<br />
Gerald Hüther ist Autor bek<strong>an</strong>nter populärwissenschaftlicher Bücher wie „Jedes Kind<br />
ist hochbegabt“. Der Neurobiologe hielt im April einen Vortrag in <strong>der</strong> Görlitzer <strong>Kultur</strong>brauerei<br />
zum Thema „Bildung im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung:<br />
Wie können Schulen und Universitäten die neuen Herausfor<strong>der</strong>ungen meistern“. Wir<br />
trafen Hüther auf ein Gespräch über richtiges Lernen, Kirchturmuhren und Roboter.<br />
DAS INTERVIEW FÜHRTE SOPHIE HERWIG<br />
HERR HÜTHER, LERNEN KINDER<br />
ANDERS ALS ERWACHSENE?<br />
Kin<strong>der</strong> lernen aus sich selbst heraus.<br />
Dass m<strong>an</strong> Laufen, Krabbeln und die<br />
Sprache lernt, das sind alles Dinge, die<br />
Kin<strong>der</strong> aus sich selbst heraus lernen.<br />
Denn bei Kin<strong>der</strong>n ist <strong>der</strong> Lernprozess<br />
vollständig selbstorg<strong>an</strong>isiert – das Kind<br />
erlebt sich als Gestalter seines eigenen<br />
Lernprozesses. Bis es d<strong>an</strong>n von uns belehrt<br />
wird.<br />
UND DAS IST DER FEHLER?<br />
Das ist d<strong>an</strong>n eine völlig <strong>an</strong><strong>der</strong>e Art des<br />
Lernens, weil m<strong>an</strong> ab diesem Punkt<br />
nicht mehr lernt, was m<strong>an</strong> will, <strong>so</strong>n<strong>der</strong>n<br />
das lernen <strong>so</strong>ll, was m<strong>an</strong> muss. Und<br />
das ist eine schwierige Erfahrung für<br />
Kin<strong>der</strong>. M<strong>an</strong>che finden sich damit ab<br />
und unterwerfen sich dem Regime: Sie<br />
übernehmen die Objektrolle, die ihnen<br />
zugewiesen worden ist. M<strong>an</strong>che werden<br />
rebellisch und lehnen sich dagegen<br />
auf, <strong>so</strong>l<strong>an</strong>ge sie können, und m<strong>an</strong>che<br />
bekommen Ritalin, damit sie wie<strong>der</strong><br />
funktionieren.<br />
ABER ES GEHÖRT DOCH ZU<br />
UNSERER GESELLSCHAFT, DASS<br />
WIR ALLE IN DIE SCHULE GE-<br />
HEN MÜSSEN?<br />
Genau, diesem historisch gewachsenen<br />
Bildungssystem k<strong>an</strong>n m<strong>an</strong> sich kaum<br />
entziehen. Dadurch werden die Kin<strong>der</strong><br />
aber immer zum Objekt von Erwartungen,<br />
Bewertungen, Zielvorgaben, Lerninhalten,<br />
Unterricht und Belehrungen<br />
gemacht. D<strong>an</strong>n lernen sie zwei Dinge,<br />
um aus diesem Dilemma herauszukommen,<br />
in das sie hineingestoßen wurden.<br />
ALSO ENTWICKELN SICH ZWEI<br />
ARTEN VON LERNTYPEN?<br />
Ja, die eine Hälfte lernt, wie m<strong>an</strong> den <strong>an</strong><strong>der</strong>en,<br />
<strong>der</strong> da als Belehrer kommt, auch<br />
zum Objekt macht. Das hört m<strong>an</strong> d<strong>an</strong>n<br />
häufig, dass sie sagen: „Blö<strong>der</strong> Lehrer“.<br />
Und d<strong>an</strong>n lässt sich das aushalten. Das<br />
sind aber diejenigen, die g<strong>an</strong>z gut lernen,<br />
wie m<strong>an</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>e für seine Zwecke<br />
benutzt. Diese Kin<strong>der</strong> werden meist<br />
sehr erfolgreich in unserer Gesellschaft<br />
und besetzen Führungspositionen. Die<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en entkommen diesem Problem,<br />
dass sie sich als Objekt beh<strong>an</strong>delt fühlen,<br />
indem sie sich selbst zum Objekt<br />
ihrer eigenen Bewertung machen und<br />
sich selbst zuschreiben, sie seien zu<br />
blöd für Mathe o<strong>der</strong> in Sport eine Niete.<br />
Und wenn d<strong>an</strong>n <strong>der</strong> Sportlehrer kommt<br />
und sagt, das wird aber nichts mehr<br />
mit dir, d<strong>an</strong>n sagen sie, das weiß ich ja<br />
schon. Das tut d<strong>an</strong>n auf alle Fälle nicht<br />
mehr <strong>so</strong> weh.<br />
32
Studium und Lehre // <strong>Einblick</strong><br />
WIE SCHAFFT MAN ES, RICHTIG<br />
ZU LERNEN?<br />
Das, was m<strong>an</strong> wirklich will, das, was einen<br />
wirklich interessiert, das bleibt hängen.<br />
Al<strong>so</strong> hat m<strong>an</strong> eigentlich gar keine<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>e Ch<strong>an</strong>ce, als dem Studium o<strong>der</strong><br />
dem Unterricht etwas abzugewinnen.<br />
OFT GIBT ES JA DINGE IM LE-<br />
BEN, DIE EINEM KEINEN SPASS<br />
MACHEN, DIE EINEN GAR<br />
NICHT INTERESSIEREN UND DIE<br />
TROTZDEM ERLEDIGT WERDEN<br />
MÜSSEN – WIE SCHAFFT MAN<br />
ES DA DURCH?<br />
M<strong>an</strong> könnte sich selbst sagen, dass m<strong>an</strong><br />
sich mal beweisen will, dass m<strong>an</strong> das<br />
auch aushält. D<strong>an</strong>n bleibt m<strong>an</strong> wenigstens<br />
noch Subjekt. D<strong>an</strong>n unterwirft m<strong>an</strong><br />
sich dem nicht, <strong>so</strong>n<strong>der</strong>n m<strong>an</strong> spielt das<br />
Spiel als Theaterspieler mit: wenn es<br />
jetzt nötig ist, dass ich den g<strong>an</strong>zen Kram<br />
lerne, d<strong>an</strong>n zeig ich es denen auch gern,<br />
aber ich identifiziere mich nicht mit <strong>der</strong><br />
Rolle eines Schülers, <strong>der</strong> sein eigenes<br />
Selbstbild davon abhängig macht, ob er<br />
dem Lehrer gefällt.<br />
SOLLTEN IMMER MEHR JUNGE<br />
Foto: Sophie Herwig<br />
2<br />
LEUTE EIN STUDIUM ANFAN-<br />
GEN ODER LIEBER DEN GUTEN<br />
ALTEN HANDWERKSBERUF LER-<br />
NEN?<br />
Es gibt <strong>so</strong> viele Studenten, die am Ende<br />
ihres Studiums nicht richtig wissen,<br />
was sie machen <strong>so</strong>llen, nicht <strong>so</strong> richtig<br />
glücklich sind. Und m<strong>an</strong>ch einem geht<br />
d<strong>an</strong>n auf, dass er vielleicht lieber Kirchturmuhren<br />
repariert hätte. Wenn sich<br />
herumspricht, dass m<strong>an</strong> sich besser eine<br />
Tätigkeit sucht, die einen erfüllt, als dass<br />
m<strong>an</strong> einen Beruf ergreift, von dem m<strong>an</strong><br />
sich sehr viel Ansehen und Bedeutung<br />
verspricht, d<strong>an</strong>n werden das junge Menschen,<br />
die stärker bei sich sind, stärker<br />
auf das achten, was sich in ihnen meldet<br />
und l<strong>an</strong>gfristig mit dem zufrieden werden,<br />
was sie machen.<br />
WELCHE VORTEILE ERGEBEN<br />
SICH DANN FÜR DAS BERUFLI-<br />
CHE LEBEN?<br />
Wenn m<strong>an</strong> bei <strong>der</strong> Ausbildung die eigene<br />
Freude beim Entdecken und Gestalten<br />
nicht verloren hat, ist m<strong>an</strong> auch später<br />
im Beruf jem<strong>an</strong>d, <strong>der</strong> gerne arbeitet.<br />
Und <strong>so</strong>lche Menschen arbeiten nicht<br />
um Geld, zu verdienen. Son<strong>der</strong>n weil es<br />
ihnen Freude macht.<br />
„Das was m<strong>an</strong> wirklich will, das was einen wirklich interessiert,<br />
das bleibt hängen. “<br />
3<br />
GERALD HÜTHER<br />
UND WAS PASSIERT MIT DEN<br />
ANDEREN?<br />
Angesichts von Digitalisierungsprozessen,<br />
die jetzt überall um sich greifen,<br />
muss m<strong>an</strong> sich fragen, ob nicht diejenigen,<br />
die nicht gerne arbeiten, am ehesten<br />
Tätigkeiten ausüben, die sehr klar<br />
beschreibbar sind. Sodass die Gefahr relativ<br />
groß ist, dass die, die in <strong>der</strong> Schule<br />
o<strong>der</strong> im Studium ihre Freude am Lernen<br />
verloren haben, später eine Tätigkeit<br />
ausüben, die ersetzbar ist – durch Roboter<br />
und Automaten. Und das gilt auch<br />
für Ärzte und Juristen. Um diese Menschen<br />
habe ich große Angst.<br />
Foto: Cornelia Rothe<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Gerald Hüther im Gespräch mit<br />
Sophie Herwig<br />
Neurobiologe Gerald Hüther<br />
Mit Dr. Maik Hos<strong>an</strong>g von <strong>der</strong><br />
HSZG (li.) und SCHKOLA-<br />
Geschäftsführerin Ute Wun<strong>der</strong>lich<br />
erörterte Gerald Hüther<br />
Herausfor<strong>der</strong>ungen des<br />
Bildungssystems.<br />
33
<strong>Einblick</strong> // Studium und Lehre<br />
PERSPEKTIVE GEWECHSELT<br />
Im Juni f<strong>an</strong>den die ersten ERLEBNISTAGE INKLUSION am Campus Görlitz statt. Besucher<br />
konnten Eindrücke von einem Leben mit körperlichen Beeinträchtigungen gewinnen.<br />
VON STEFAN-TOBIAS DITTMANN UND CORNELIA ROTHE<br />
Gemäß dem im Namen versteckten Motto<br />
„Erlebe Inklusion“ hatten Studierende<br />
und Mitarbeitende die Möglichkeit, eine<br />
Vielzahl <strong>an</strong> Selbsterfahrungs<strong>an</strong>geboten<br />
zu nutzen und <strong>an</strong> fl<strong>an</strong>kierenden Ver<strong>an</strong>staltungen,<br />
wie beispielsweise <strong>an</strong> einem<br />
Schnupperkurs in Gebärdensprache und<br />
einer Vortragsreihe zum Nachteilsausgleich<br />
und dem Aktionspl<strong>an</strong> Inklusion<br />
<strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz teilzunehmen.<br />
Org<strong>an</strong>isiert hat das G<strong>an</strong>ze Stef<strong>an</strong>-Tobias<br />
Dittm<strong>an</strong>n. Der Student <strong>der</strong> Sozialen<br />
Arbeit arbeitet während seines Praxissemesters<br />
unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em für Robert Viertel,<br />
Mitarbeiter für Inklusion <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Hochschule Zittau/Görlitz. „Durch meine<br />
Tätigkeit als Erlebnispädagoge war<br />
und ist es mir ein Anliegen, diese Aktion<br />
erlebbar zu gestalten“ erzählt er. „Mir ist<br />
es wichtig, Inklusion durch eigenes Erleben<br />
zu erfahren. Denn ich bin <strong>der</strong> festen<br />
Überzeugung, dass Selbsterlebtes besser<br />
haften bleibt und in diesem Falle ein<br />
intensiveres und nachhaltiges Erlebnis<br />
ermöglicht.“ So st<strong>an</strong>den täglich am Informationspunkt<br />
vor <strong>der</strong> Mensa Rollstühle,<br />
Simulationsbrillen und Augenbinden<br />
zum Ausleihen und Nachempfinden<br />
körperlicher Beeinträchtigungen bereit.<br />
Mittels Ged<strong>an</strong>kenspielen konnten auch<br />
2<br />
Foto: HSZG<br />
1<br />
weniger sichtbare H<strong>an</strong>dicaps im Hochschulalltag<br />
erlebt werden. „Zum Beispiel<br />
<strong>so</strong>llten sich die Besucher beim G<strong>an</strong>g in<br />
die Mensa vorstellen, welches Essen sie<br />
wählen würden, wenn sie Diabetes hätten“,<br />
<strong>so</strong> Stef<strong>an</strong>-Tobias Dittm<strong>an</strong>n.<br />
Auch zwei T<strong>an</strong>demrä<strong>der</strong> und das E-Bike<br />
des Hochschulsports wurden neugierig<br />
ausprobiert. Sie ermöglichen im<br />
Hochschulalltag auch weniger geübten<br />
bzw. beeinträchtigten Per<strong>so</strong>nen <strong>an</strong><br />
gemeinsamen Teamausfahrten teilzunehmen.<br />
Und d<strong>an</strong>k einiger motivierter<br />
und begeisterter Studieren<strong>der</strong> konnten<br />
durch kleine Aktionen wie einer Rollstuhlrallye<br />
o<strong>der</strong> ‘Wikingerschach mit<br />
verbundenen Augen‘ weitere erlebbare<br />
Momente geschaffen werden, die durch<br />
Spaß am ernsthaften Thema für nachhaltige<br />
Erfahrungen <strong>so</strong>rgten.<br />
Am gut besuchten Informationsst<strong>an</strong>d<br />
gab es reichlich Zeit, um Fragen zu diskutieren<br />
und Ged<strong>an</strong>ken zur Umsetzung<br />
<strong>der</strong> inklusiven HSZG auszutauschen.<br />
Einiges wurde direkt <strong>an</strong> die bereitstehende<br />
Pinnw<strong>an</strong>d geschrieben. Vor allem<br />
Ideen zur Frage: 49.000 Euro im Jahr<br />
2<strong>01</strong>8 für Inklusion <strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG - Wofür?<br />
„Dabei wurden einige Ged<strong>an</strong>ken aufgegriffen,<br />
die bereits in Bearbeitung<br />
Foto: HSZG<br />
sind. Gen<strong>an</strong>nt wurden beispielsweise<br />
‘mehr Aufklärungsarbeit‘, ‘ein barrierefreier<br />
Campus‘ o<strong>der</strong> ‘Gastvorträge von<br />
Experten in eigener Sache‘“, zählt <strong>der</strong><br />
Ver<strong>an</strong>staltung<strong>so</strong>rg<strong>an</strong>isator auf. Das Geld<br />
dient <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> im Aktionspl<strong>an</strong><br />
Inklusion 2025 gesteckten Ziele <strong>der</strong><br />
Hochschule. Die vielen Hinweise <strong>der</strong> Studierenden<br />
verdeutlichen noch einmal<br />
die Notwendigkeit von Inklusion <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
HSZG.<br />
Ausblickend hält Stef<strong>an</strong>-Tobias Dittm<strong>an</strong>n<br />
fest, dass <strong>so</strong>lche sensibilisierenden Ver<strong>an</strong>staltungen<br />
immer wie<strong>der</strong> <strong>an</strong> beiden<br />
Hochschulst<strong>an</strong>dorten stattfinden werden.<br />
Als nächstes kommt die W<strong>an</strong><strong>der</strong>ausstellung<br />
„Behin<strong>der</strong>n Verhin<strong>der</strong>n“ des<br />
Freistaates Sachsens <strong>an</strong> die Hochschule.<br />
Diese macht voraussichtlich vom 23. bis<br />
30. Oktober 2<strong>01</strong>8 am Campus Görlitz<br />
und vom 30. Oktober bis 9. November<br />
2<strong>01</strong>8 am Campus Zittau Station.<br />
Die gleichberechtigte Teilhabe beeinträchtigter<br />
Menschen benötigt die<br />
Mitwirkung aller Hochschulmitglie<strong>der</strong>,<br />
ist sich <strong>der</strong> <strong>an</strong>gehende Sozialarbeiter<br />
sicher: „Deshalb <strong>an</strong> dieser Stelle: D<strong>an</strong>ke<br />
für alle Ideen. D<strong>an</strong>ke für die Bereitschaft<br />
zum Perspektivwechsel und die guten<br />
Gespräche! Wir wünschen uns, dass diese<br />
in Jedem g<strong>an</strong>z persönlich nachwirken“,<br />
resümiert Stef<strong>an</strong>-Tobias Dittm<strong>an</strong>n.<br />
1<br />
2<br />
Neue Perspektive. Studierende<br />
konnten den Alltag<br />
beeinträchtigter Per<strong>so</strong>nen<br />
nachempfinden.<br />
Wikingerschach mit verbundenen<br />
Augen<br />
34
Internationales // <strong>Einblick</strong><br />
AUSLÄNDERIN IM QUADRAT...<br />
... o<strong>der</strong> wie ein Mädchen aus Sibirien seine Horizonte erweitert.<br />
Inwieweit seid ihr bereit, etwas Außerordentliches zu tun? Wärt ihr bereit, euer gewöhnliches<br />
Leben hinter euch zu lassen und g<strong>an</strong>z von vorne <strong>an</strong>zuf<strong>an</strong>gen?<br />
VON ALINA EGOROVA<br />
2<br />
Als Studentin aus Sibirien f<strong>an</strong>d ich meinen<br />
Weg zur Hochschule Zittau/Görlitz<br />
2<strong>01</strong>4 über 7.000 km entfernt von<br />
meinem Zuhause. Plötzlich bef<strong>an</strong>d ich<br />
mich auf einem <strong>an</strong><strong>der</strong>en Pl<strong>an</strong>eten, auf<br />
dem alles, was ich bisher k<strong>an</strong>nte, <strong>an</strong><strong>der</strong>s<br />
war. Der größte und weiteste Schritt,<br />
den ich jemals gemacht habe. Jedoch<br />
die Entscheidung, aus meinem Heimatort<br />
mit 19 Jahren wegzuziehen, mit <strong>der</strong><br />
starken Motivation und grenzenloser<br />
Begeisterung, die Welt und mich selbst<br />
zu entdecken, war das Beste, was ich<br />
jemals get<strong>an</strong> habe. Die Hochschule ist<br />
zu meinem Anker geworden, <strong>an</strong> dem<br />
ich immer gute Unterstützung, Hilfe und<br />
Freundlichkeit von ihren Studierenden<br />
und Mitarbeitern bekomme. Nach fünf<br />
Jahren in Deutschl<strong>an</strong>d fühle ich mich<br />
wohl und als ein Teil des G<strong>an</strong>zen. Ich<br />
f<strong>an</strong>d hier mein zweites Zuhause. Dazu<br />
trägt das Studium <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
viel bei, indem es mich jeden Tag zu<br />
neuem Wissen inspiriert und mich zu<br />
weiteren Schritten motiviert. D<strong>an</strong>k <strong>der</strong><br />
erbrachten Leistungen, <strong>so</strong>wohl im Studium<br />
als auch in <strong>der</strong> <strong>so</strong>zialen Umgebung,<br />
wurde ich zur Deutschl<strong>an</strong>dstipendiatin<br />
für das Jahr 2<strong>01</strong>6/2<strong>01</strong>7 ern<strong>an</strong>nt. Das Stipendium<br />
unterstützte mich auf meinem<br />
Weg durch das Studium und schaffte mir<br />
einen freien Raum für die Erweiterung<br />
meiner künftigen Horizonte.<br />
So traf ich die Entscheidung, ein Ausl<strong>an</strong>dsstudium<br />
in Fr<strong>an</strong>kreich <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Université d’Angers in Angers zu ab<strong>so</strong>lvieren.<br />
Ich traute mir zu, noch ein Stück<br />
weiter zu gehen. Voilà, ich war für alles<br />
bereit, was auf mich zukommen konnte.<br />
Ich st<strong>an</strong>d vor <strong>der</strong> Tür, hinter <strong>der</strong> sich<br />
noch eine völlig <strong>an</strong><strong>der</strong>e Welt versteckte.<br />
Wie<strong>der</strong> bin ich in eine neue <strong>Kultur</strong> und<br />
eine neue Umgebung eingetaucht. Mitten<br />
in <strong>der</strong> Welt, wo Menschen und selbst<br />
die Zeit auf ihre eigene Weise tickten.<br />
Ich konnte mir nie vorstellen, <strong>so</strong> ein<br />
Glück zu haben, Studierende aus 33 verschiedenen<br />
Län<strong>der</strong>n <strong>an</strong> einer Universität<br />
kennenlernen zu dürfen, mich mithilfe<br />
von Verständnis, Aufmerksamkeit und<br />
Geduld mit jedem Einzelnen verständigen<br />
zu können und damit ein be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>es<br />
Gefühl zu entwickeln, die g<strong>an</strong>ze<br />
1<br />
Foto: privat<br />
1<br />
Alina Egorova studiert <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> HSZG Wirtschaft und 2<br />
Sprachen.<br />
Welt <strong>an</strong> meiner Seite zu haben. Wenn<br />
m<strong>an</strong> sich entschließt, ein Semester im<br />
Ausl<strong>an</strong>d zu ab<strong>so</strong>lvieren, weiß m<strong>an</strong>, dass<br />
es sich um <strong>so</strong> viel mehr als Studium h<strong>an</strong>delt.<br />
Das Leben fängt erst d<strong>an</strong>n <strong>an</strong>, wenn<br />
wir uns zutrauen, aus unserer Komfortzone<br />
rauszugehen und uns mutig allen<br />
bevorstehenden Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
entgegenzusetzen.<br />
Das Leben im Ausl<strong>an</strong>d bringt mir Tag für<br />
Tag viel bei. Alle Erfahrungen, die ich seit<br />
meinem Startpunkt sammelte, haben<br />
sich in einen großen und festen Baum<br />
verw<strong>an</strong>delt, <strong>der</strong> mit jedem Tag noch<br />
stärker wird und immer weiter nach<br />
oben wächst. Momente, die <strong>so</strong> schnell<br />
vergehen, mögen mit uns bleiben und<br />
uns als etwas Wertvolles und Einzigartiges<br />
bereichern. Sammelt eure unvergesslichen<br />
Augenblicke in <strong>der</strong> Welt, die<br />
<strong>so</strong> nah ist und einfach wartet, bis ihr sie<br />
entdeckt. Los geht’s!<br />
In Fr<strong>an</strong>kreich hat Alina viele<br />
neue Freundschaften geschlossen.<br />
Foto: privat<br />
35
1<br />
DIE HSZG IM LERNRAUM MIT TSCHECHIEN<br />
Fünf wissenschaftliche Bibliotheken entwickeln einen grenzüberschreitenden Lernraum<br />
zwischen Tschechien und Sachsen. Der <strong>so</strong>ll wirksame Mehrwerte für Studierende,<br />
Lehrende und Forschende <strong>der</strong> Projektpartner erzielen und Pilotcharakter haben.<br />
Foto: HSZG<br />
VON PROF. DR. FALK MAIWALD<br />
Die Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz<br />
(HSB) ist seit Oktober 2<strong>01</strong>6 aktiver<br />
Partner im sächsisch-tschechischen<br />
Forschungsprojekt Lernraum – Bibliothekarische<br />
Informationsplattform. Das<br />
Projekt baut die enge Kooperation mit<br />
<strong>der</strong> Universitätsbibliothek Chemnitz<br />
(Leadpartner), <strong>der</strong> Westböhmischen<br />
Bibliothek Pilsen und <strong>der</strong> Wissenschaftlichen<br />
Bezirksbibliothek Liberec aus, mit<br />
denen die HSB bereits von 2<strong>01</strong>3 bis 2<strong>01</strong>4<br />
ein ESF-geför<strong>der</strong>tes Projekt durchführte.<br />
Neuer Partner im bis 31.12.18 laufenden<br />
Projekt ist die Universitätsbibliothek<br />
Liberec.<br />
Wissenschaftliche Bibliotheken sehen<br />
sich mit stark verän<strong>der</strong>ten Ansprüchen<br />
von Lernenden, Lehrenden und Forschenden<br />
<strong>an</strong> den „Lernraum Bibliothek“<br />
konfrontiert: Elektronische Medien sind<br />
weiter auf dem Vormarsch, die Informationskompetenz<br />
im Umg<strong>an</strong>g mit<br />
wissenschaftlichen Medien ist durch<br />
persönliche und mediale Nutzerberatungen<br />
und -services zu steigern, Gruppenarbeit<br />
nimmt zu. Um auf diese und<br />
Foto: Sophie Herwig<br />
2<br />
weitere Entwicklungen auch grenzübergreifend<br />
zu reagieren, haben sich die<br />
Partnerbibliotheken das Ziel gesetzt,<br />
einen gemeinsamen Lernraum aufzubauen.<br />
Die wichtigsten Meilensteine<br />
des mit Mitteln <strong>der</strong> Europäischen Union<br />
aus dem Kooperationsprogramm zur<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> grenzübergreifenden<br />
Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat<br />
Sachsen und <strong>der</strong> Tschechischen<br />
Republik 2<strong>01</strong>4-2020 fin<strong>an</strong>zierten Projektes<br />
haben die Partner bereits abgeschlossen.<br />
Be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>s stolz sind sie über den<br />
erfolgreichen Abschluss des ersten<br />
deutsch-tschechischen Kon<strong>so</strong>rtiums<br />
wissenschaftlicher Bibliotheken für<br />
E-Medien. In dessen Rahmen konnten<br />
für alle Projektbibliotheken bis Ende<br />
2<strong>01</strong>8 die Zugriffsrechte zu über 5.000<br />
englischsprachigen E-Books <strong>der</strong> Verlagsgruppe<br />
Taylor & Fr<strong>an</strong>cis erworben<br />
werden, von denen die meistgenutzten<br />
auch nach 2<strong>01</strong>8 dauerhaft zur Verfügung<br />
stehen werden.<br />
Unter dem Motto „Lehre und Forschung<br />
ohne Grenzen“ wird <strong>der</strong> Lernraum durch<br />
eine gebührenfreie binationale Fernleihe<br />
für Bücher ergänzt. Dadurch können<br />
Nutzer <strong>der</strong> HSB vor allem bei den<br />
Partnerbibliotheken in Liberec auf den<br />
Best<strong>an</strong>d englischsprachiger Fachbücher<br />
<strong>so</strong>wie auf Volltext-Artikel von in Liberec<br />
und Pilsen lizensierten Datenb<strong>an</strong>ken<br />
von Taylor & Fr<strong>an</strong>cis zugreifen.<br />
Mit <strong>der</strong> Implementierung spezieller<br />
Multimedia- und Konferenztechnik <strong>an</strong><br />
beiden HSB-St<strong>an</strong>dorten verbesserte<br />
sich die Situation <strong>der</strong> mediengestützten<br />
36
Internationales // <strong>Einblick</strong><br />
Gruppenarbeit vor Ort <strong>so</strong>wie über interaktive<br />
Webkonferenzen maßgeblich.<br />
Bei <strong>der</strong> Gestaltung des grenzübergreifenden<br />
Lernraums spielt auch das Thema<br />
Open Access (OA) eine wichtige<br />
Rolle. Die HSB profitiert von den OA-<br />
Expertisen ihrer universitären Partner<br />
und trägt <strong>so</strong> zur Sensibilisierung und<br />
Etablierung von OA <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
Zittau/Görlitz bei.<br />
Das Projektteam <strong>der</strong> HSB blickt stolz<br />
auf die erreichten Verbesserungen <strong>der</strong><br />
Kommunikations- und Austauschbedingungen<br />
mit den Nachbarn im sächsischtschechischen<br />
Lernraum. Die Nutzer <strong>der</strong><br />
HSB werden diese Gelegenheiten kennen<br />
und schätzen lernen und damit Studium,<br />
Lehre und Forschung bereichern.<br />
3<br />
Foto: Sophie Herwig<br />
1 2 3<br />
Die tschechischen Leiter des sächsisch-<br />
Projektes (v.l.n.r.): Lernraum-<br />
Angela<br />
Malz (TU Chemnitz), Jitka<br />
Vencláková (TU Liberec),<br />
Miloslava Faitová (WU<br />
Pilsen), Bl<strong>an</strong>ka Konvalinková<br />
(WBB Liberec) und Prof. Falk<br />
Maiwald (HSZG)<br />
Projektmitarbeiter Andreas<br />
Sommer kennt den Wert von<br />
elektronischen Medien in<br />
Lehre und Forschung.<br />
Studentin Alina Egorova<br />
nutzt die Informationsplattform<br />
zur E-Book-Recherche.<br />
Foto: HSZG<br />
VERTIEFUNG DER BEZIEHUN-<br />
GEN MIT DER DEUTSCH-KA-<br />
SACHISCHEN UNIVERSITÄT<br />
(DKU)<br />
Die l<strong>an</strong>gjährigen Beziehungen <strong>der</strong><br />
HSZG mit <strong>der</strong> DKU in Almaty konnten<br />
bei einem Besuch von HSZG-Angehörigen<br />
im Mai in Kasachst<strong>an</strong> gestärkt und<br />
vertieft werden. Erfreulicherweise war<br />
kurz vorher bek<strong>an</strong>nt geworden, dass<br />
die HSZG als Kon<strong>so</strong>rtialpartner im DKU-<br />
1<br />
Netzwerk in den kommenden Jahren<br />
von <strong>der</strong> erfolgreichen Erasmus-weltweit<br />
Antragstellung unter <strong>der</strong> Fe<strong>der</strong>führung<br />
<strong>der</strong> Hochschule Schmalkalden profitieren<br />
k<strong>an</strong>n. Die eingeworbenen Gel<strong>der</strong><br />
werden <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung kasachischer<br />
Studieren<strong>der</strong> <strong>der</strong> Wirtschaftswissenschaften<br />
für einen Studienabschnitt in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d zu Gute kommen <strong>so</strong>wie für<br />
Lehraufenthalte eingesetzt.<br />
MEXIKANISCHE STUDIEREN-<br />
DE ZUM DOUBLE DEGREE AN<br />
DIE HSZG<br />
Erstmals empfängt die HSZG sieben Studierende<br />
unserer mexik<strong>an</strong>ischen Partnerhochschule<br />
Monterey, die nächstes<br />
Jahr ihr Mechatronik-Studium <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
HSZG mit dem Double Degree abschließen<br />
werden. Das Studium findet in englischer<br />
Sprache statt und wird parallel<br />
zu den regulären Lehrver<strong>an</strong>staltungen<br />
durchgeführt. Wir wünschen allen beteiligten<br />
Lehrenden <strong>so</strong>wie den unterstützenden<br />
Bereichen gutes Gelingen<br />
für dieses ambitionierte Vorhaben und<br />
natürlich auch den Studierenden viel<br />
Erfolg!<br />
1<br />
Studentinnen <strong>der</strong> DKU kommen<br />
ab dem Wintersemester<br />
2<strong>01</strong>8/19 <strong>an</strong> die HSZG.<br />
37
1<br />
STUDIENREISE NACH SCHOTTLAND<br />
Masterstudierende <strong>der</strong> HSZG reisen zum World Symposium of Responsibility <strong>an</strong>d Sustainability<br />
nach Edinburgh.<br />
VON JOHANNA KLUGE<br />
Foto: privat<br />
Endlich ist es <strong>so</strong>weit: Für die Studierenden<br />
des Masterstudieng<strong>an</strong>gs „Integriertes<br />
M<strong>an</strong>agement/Integrierte M<strong>an</strong>agementsysteme“<br />
geht es auf nach<br />
Schottl<strong>an</strong>d. In <strong>der</strong> Hauptstadt Edinburgh<br />
werden wir insgesamt <strong>an</strong> drei<br />
von fünf Tagen Studienreise das „World<br />
Symposium of Social Responsibility<br />
<strong>an</strong>d Sustainability“ begleiten. Dieses<br />
wird unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em von <strong>der</strong> University<br />
of Edinburgh und <strong>der</strong> Hochschule für<br />
<strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dte Wissenschaften in Hamburg<br />
(HAW) org<strong>an</strong>isiert. Ziel <strong>der</strong> Ver<strong>an</strong>staltung<br />
ist es, den interdisziplinären<br />
Austausch zwischen Wissenschaftlern,<br />
Unternehmen und politischen Org<strong>an</strong>isationen<br />
zu unterstützen, die Forschung<br />
o<strong>der</strong> Projekte betreiben, die ihren<br />
Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und<br />
<strong>so</strong>zialer Ver<strong>an</strong>twortung haben. Des Weiteren<br />
<strong>so</strong>ll sich mit <strong>der</strong> Frage beschäftigt<br />
werden, wie Unternehmen nachhaltig<br />
und mit <strong>so</strong>zialer Ver<strong>an</strong>twortung agieren<br />
können.<br />
Die Reise beginnt: Von Zittau nach Prag<br />
in vier Stunden, denn <strong>der</strong> Flug nach<br />
Edinburgh geht vom Prager Flughafen.<br />
Unterwegs regnet es und während die<br />
Tropfen gegen die Zugfenster trommeln,<br />
frage ich mich, ob uns wohl zehn Tage<br />
voll schlechtem Wetter bevorstehen. In<br />
Prag <strong>an</strong>gekommen, treffe ich mich mit<br />
meinem Bru<strong>der</strong>, <strong>der</strong> hier lebt und arbeitet.<br />
Den Tag verbringe ich gemeinsam<br />
mit ihm in einer wun<strong>der</strong>schönen Stadt<br />
voll <strong>Kultur</strong> und leckerem Essen.<br />
Am nächsten Tag klingelt <strong>der</strong> H<strong>an</strong>dywecker<br />
6.30 Uhr. Mit Metro und Bus geht es<br />
durch die Stadt direkt <strong>an</strong>s Terminal des<br />
Flughafens. Dort treffe ich meine Kommilitonen<br />
zusammen mit unserer Studieng<strong>an</strong>gsleiterin<br />
Frau Prof. Brauweiler.<br />
Nach dem Sicherheitscheck geht es endlich<br />
ins Flugzeug. Please fasten your seat<br />
belt. Wir heben ab – auf nach Edinburgh.<br />
In <strong>der</strong> schottischen Hauptstadt erwartet<br />
uns erstmal etwas Unerwartetes – Sonnenschein.<br />
Und es ist richtig warm. Ich<br />
löse ein Ticket für den Busshuttle und<br />
d<strong>an</strong>n k<strong>an</strong>n es endlich in Richtung Stadtzentrum<br />
gehen. Dort werden wir mit den<br />
Klängen eines Dudelsacks am Welverly<br />
Place empf<strong>an</strong>gen. Ich nutze gleich die<br />
Gelegenheit, mein mitgebrachtes Bargeld<br />
in Pfund umzutauschen. In unserem<br />
Hostel, dem Destiny Student Brae<br />
House, kostet eine Übernachtung ca. 30<br />
Euro im Doppelzimmer mit Bad. Alles in<br />
allem eine gute Unterkunft zum mo<strong>der</strong>aten<br />
Preis, die grad mal 10 Minuten zu<br />
Fuß vom Stadtkern entfernt liegt. Nachdem<br />
wir uns eingerichtet haben, laufen<br />
wir zum Holyrood Palace, die offizielle<br />
Residenz <strong>der</strong> Queen in Schottl<strong>an</strong>d. Von<br />
dort aus starten wir eine Hop on Hop<br />
2<br />
Foto: privat<br />
38
off Tour. Am grassmarket gibt es viele<br />
verschiedene Pubs und Restaur<strong>an</strong>ts, wo<br />
m<strong>an</strong> auch draußen sitzen k<strong>an</strong>n. Wir nutzen<br />
die Gelegenheit und verbringen in<br />
einem <strong>der</strong> Pubs den Abend. Da Haggis<br />
ein typisch schottisches Gericht ist, müssen<br />
wir das natürlich probieren. Haggis<br />
ist mit Innereien gefüllter Schafsmagen.<br />
Klingt eklig, geht aber. Wir probieren es<br />
als „Pie“, al<strong>so</strong> eine Art gefüllter (in dem<br />
Fall mit Haggis) Kuchen.<br />
Den zweiten Tag nutzen wir, um uns<br />
die Umgebung von Edinburgh und die<br />
<strong>an</strong>grenzenden Lowl<strong>an</strong>ds <strong>an</strong>zusehen.<br />
Dafür haben wir eine Bustour bei „timberbrush<br />
tours“ gebucht. Highlights<br />
sind dabei <strong>der</strong> Loch Lommond – <strong>der</strong><br />
flächenmäßig größte See in Schottl<strong>an</strong>d<br />
und Stirling Castle. Viele von euch<br />
(zumindest hoffe ich das) kennen sicher<br />
den Film „Braveheart“ mit Mel Gib<strong>so</strong>n als<br />
William Wallace in <strong>der</strong> Hauptrolle. Stirling<br />
Castle spielt dabei eine bedeutende<br />
Rolle, wie in <strong>der</strong> gesamten schottischen<br />
Geschichte. Diese wird uns auch von<br />
dem Busfahrer während <strong>der</strong> Fahrten zu<br />
den verschiedenen Orten auf witzige Art<br />
und Weise näher gebracht.<br />
Am Nachmittag des dritten Tages treffen<br />
wir uns zum ersten Mal mit Mitarbeitern<br />
<strong>der</strong> University of Edinburgh. Da<br />
die Universität Gastgeber für das „World<br />
Symposium of Responsibility <strong>an</strong>d Sustainability“<br />
ist, wird natürlich auch das Thema<br />
Nachhaltigkeit besprochen und wie<br />
die Universität versucht, in ihrem Alltag<br />
das Thema zu beh<strong>an</strong>deln und ihre Studierenden<br />
und Mitarbeiter darauf aufmerksam<br />
zu machen.<br />
Am vierten Tag beginnt das „World Symposium“.<br />
Uns erwarten viele verschiedene<br />
Vorträge und Präsentationen rund<br />
um die Themen <strong>so</strong>ziale Ver<strong>an</strong>twortung<br />
und Nachhaltigkeit. Es sind viele verschiedene<br />
Leute aus allen Teilen <strong>der</strong> Welt<br />
da, unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em: China, Australien,<br />
Brasilien, K<strong>an</strong>ada, Indien <strong>so</strong>wie natürlich<br />
Großbrit<strong>an</strong>nien und Deutschl<strong>an</strong>d. Wir<br />
sind den g<strong>an</strong>zen Tag dort und hören die<br />
verschiedenen Vorträge, die mal mehr<br />
und mal weniger interess<strong>an</strong>t sind. Im<br />
„Diese Zeit nutzen wir um noch weiter in die schottische<br />
<strong>Kultur</strong> und L<strong>an</strong>dschaft einzutauchen. Wir fahren <strong>an</strong>s Meer,<br />
klettern Berge hinauf und besichtigen <strong>an</strong><strong>der</strong>e Städte.“<br />
3<br />
Anschluss dar<strong>an</strong> gehen wir noch einmal<br />
mit unseren Profes<strong>so</strong>ren und Dozenten<br />
in einen Pub.<br />
Am letzten Tag des „World Symposiums“<br />
werden abermals verschiedene Vorträge<br />
gehalten, unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em auch von<br />
einem Mitarbeiter unserer Hochschule,<br />
Herrn Markus Will. Das war einer <strong>der</strong> besten<br />
Vorträge, wie nicht nur ich, <strong>so</strong>n<strong>der</strong>n<br />
auch meine Kommilitonen und auch<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>e Teilnehmer <strong>der</strong> Tagung finden.<br />
Herr Will erhält auch für das zum Vortrag<br />
dazugehörige Paper die Auszeichnung<br />
„Best Paper-Award“, welche vom Leiter<br />
<strong>der</strong> Tagung Walter Leal vergeben wird.<br />
Die Tagung endet im Anschluss dar<strong>an</strong>,<br />
und während unsere verbleibenden<br />
Dozenten sich auf ihre Rückreise noch<br />
am selben Tag vorbereiten, haben meine<br />
Kommilitonen und ich schon in <strong>der</strong><br />
Vorbereitung auf die Reise beschlossen,<br />
noch ein paar Tage als Urlaub dr<strong>an</strong>zuhängen.<br />
Diese Zeit nutzen wir, um<br />
noch weiter in die schottische <strong>Kultur</strong><br />
und L<strong>an</strong>dschaft einzutauchen. Wir fahren<br />
<strong>an</strong>s Meer, klettern Berge hinauf und<br />
besichtigen <strong>an</strong><strong>der</strong>e Städte, wie zum Beispiel<br />
Glasgow. Unter <strong>der</strong> Woche haben<br />
wir außerdem noch Zugtickets für die<br />
Schottische Eisenbahn gekauft, mit <strong>der</strong><br />
wir durch die Highl<strong>an</strong>ds fahren bis nach<br />
Inverness, eine Stadt die hoch im Norden<br />
Schottl<strong>an</strong>ds liegt. Dort verbringen<br />
wir noch zwei Tage.<br />
Lei<strong>der</strong> vergeht die Zeit viel zu schnell.<br />
Wir sehen noch ein letztes Mal Edinburgh<br />
und fliegen d<strong>an</strong>n wie<strong>der</strong> davon,<br />
zurück nach Deutschl<strong>an</strong>d, wo uns die<br />
Prüfungszeit erwartet. Wären wir mal<br />
lieber in Schottl<strong>an</strong>d geblieben bei den<br />
unglaublich freundlichen Menschen, <strong>der</strong><br />
tollen L<strong>an</strong>dschaft, den niedlichen Schafen<br />
und Rin<strong>der</strong>n, den unendlich weiten<br />
Seen und den rom<strong>an</strong>tischen Sonnenuntergängen.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Urquhart Castle am Loch<br />
Ness<br />
Grassmarket im Zentrum <strong>der</strong><br />
Stadt unterhalb Edinburgh<br />
Castle<br />
Gruppenfoto am Loch Lommond<br />
Foto: privat<br />
39
HEUTE SCHON GESTERN GETROFFEN?<br />
Ein bek<strong>an</strong>nter Yogi-Meister aus Nepal kommt nach Görlitz und hält einen Vortrag<br />
über Stressbewältigung im Alltag – praktische Übungen inklusive.<br />
VON SOPHIE HERWIG<br />
Foto: Freebird7977/Shutterstock.com<br />
Yoga ist schon l<strong>an</strong>ge kein Trend mehr.<br />
Yoga ist zu einer Lebenseinstellung<br />
geworden. Und zu einem eigenen<br />
Industriezweig, mit dem m<strong>an</strong> ordentlich<br />
Geld machen k<strong>an</strong>n. Dabei braucht es<br />
gar nicht viel, um Yoga zu praktizieren.<br />
Nur eine Matte und bequeme Kleidung.<br />
Beim Yoga werden geistige und körperliche<br />
Übungen praktiziert, die zum<br />
Einswerden mit dem Bewusstsein verst<strong>an</strong>den<br />
werden.<br />
Ende J<strong>an</strong>uar kam <strong>der</strong> Yogameister und<br />
Naturarzt Yogacharya Swami Yog Subodh<br />
o<strong>der</strong> einfach Dr. Subodh aus Nepal<br />
<strong>an</strong> die HSZG nach Görlitz. Er praktiziert<br />
Reiki und Yoga im Himalay<strong>an</strong> Yoga<br />
Re<strong>so</strong>rt in den Bergen von Kathm<strong>an</strong>du.<br />
Er hat über 21 Jahre Erfahrung mit Spiritueller<br />
Heilung, Yoga und Reiki. Dr. Subodh<br />
<strong>so</strong>llte einen Vortrag über die <strong>an</strong>tike<br />
Yoga-Philo<strong>so</strong>phie in <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Zeit<br />
halten. Wie k<strong>an</strong>n m<strong>an</strong> seinen Alltag mit<br />
Yoga bereichern, Stress reduzieren und<br />
g<strong>an</strong>z praktisch in einer Yoga-Stunde die<br />
ständigen Versp<strong>an</strong>nungen im Nacken<br />
loswerden?<br />
Vielleicht hatten die circa 30 Interessierten<br />
im Vortragsraum ihre g<strong>an</strong>z eigenen<br />
Vorstellungen von einem Yogimeister.<br />
L<strong>an</strong>ger weißer Bart? Schimmernde<br />
Gewän<strong>der</strong>? Doch Dr. Subodh trägt<br />
einen or<strong>an</strong>genen Leinen<strong>an</strong>zug mit<br />
einer gelben Weste, <strong>der</strong> rote Punkt auf<br />
<strong>der</strong> Stirn leuchtet. Dr. Subodh leuchtet<br />
auch, von innen und von außen. Und er<br />
lächelt. „Ich habe euch allen eine SMS<br />
geschickt“, sagt er und hält sein H<strong>an</strong>dy<br />
hoch. „Auch, wenn ihr mir nicht <strong>an</strong>twortet,<br />
SMS ist die Antwort auf alles.“<br />
„S“, spricht er, „steht für Straight Body,<br />
M steht für Mindful und S für Smiling.“<br />
Er strahlt und alle strahlen zurück. Jetzt<br />
hat er seine Antwort bekommen. „That<br />
is the way of yogic life.“<br />
Annette Drews, die den Yogi <strong>an</strong> die<br />
Hochschule einlud, erklärt zu Beginn des<br />
Vortrags, dass es für die Nepalesen nicht<br />
<strong>so</strong> einfach wäre, im englischen „sch“ auszusprechen.<br />
„Wun<strong>der</strong>t euch nicht, das<br />
´sch´ ist bei Dr. Subodh ein einfaches ´s´.<br />
Sh<strong>an</strong>ti ist bei ihm S<strong>an</strong>ti.“<br />
Um Stress zu verhin<strong>der</strong>n o<strong>der</strong> ihn zumindest<br />
zu akzeptieren, muss m<strong>an</strong> wissen,<br />
dass Stress nicht immer negativ behaftet<br />
ist. M<strong>an</strong>chmal ist er <strong>so</strong>gar hilfreich. Stress<br />
entsteht durch eine schlechte Haltung,<br />
die Ernährungsweise, die Atmosphäre<br />
zu Hause, die Schlafens- und Aufwachzeit.<br />
Stress macht sich bemerkbar, indem<br />
<strong>der</strong> Körper uns Warnsignale schickt. Und<br />
diese sind ein Liebesdienst unseres Körpers,<br />
denn oft werden wir erst aktiv,<br />
wenn wir Schmerzen spüren.<br />
Nach einer Stunde Vortrag klatscht Dr.<br />
Subodh in die Hände. „Setzt euch aufrecht<br />
hin, like a police m<strong>an</strong>, entknotet<br />
eure Beine, schlagt sie nicht überein<strong>an</strong><strong>der</strong>,<br />
nehmt die Ellbogen vom Tisch,<br />
setzt euch g<strong>an</strong>z nach hinten und flächig<br />
auf euren Stuhl. Die Füße stehen<br />
parallel zuein<strong>an</strong><strong>der</strong> auf dem Boden,<br />
fest. Zieht den Bauchnabel ged<strong>an</strong>klich<br />
bis nach hinten zur Wirbelsäule. Richtet<br />
das Becken auf. Schließt die Augen, legt<br />
die Hände auf eure Knie und atmet aus,<br />
lasst den gesamten Atem nach draußen.<br />
Bis kein Atem mehr da ist und ihr Luft<br />
40
Menschen // <strong>Einblick</strong><br />
für neuen holen müsstet. Genau d<strong>an</strong>n<br />
haltet ihr fünf Sekunden den Atem <strong>an</strong>.“<br />
D<strong>an</strong>n atmen alle ein, vom Bauchnabel<br />
bis in die Nasenspitze und <strong>der</strong> Yogi singt:<br />
„Today, I will be peaceful <strong>an</strong>d happy!“<br />
Dr. Subodh strahlt in die Runde: einmal<br />
Atmen ist „total refreshing“. Für das<br />
Gehirn, den Kreislauf, den Körper. So einfach<br />
entsteht neue Energie, neue Konzentration<br />
für den restlichen Tag. Diese<br />
Übung lässt sich gut in den Arbeitsalltag<br />
integrieren. Die aufrechte Sitzhaltung<br />
beeinflusst zudem noch die eigenen<br />
Ged<strong>an</strong>ken, die eigene Arbeit positiv.<br />
Straight Body. Mindful. Smiling.<br />
Dr. Subodh erklärt, dass das berühmte<br />
Oam im Yoga omnipräsent sei. „Es ist<br />
alles und überall, denn es ist Vibration.<br />
Und bildet <strong>der</strong> Mensch ein Oam im Kehlkopf,<br />
bringt er seinen gesamten Körper<br />
in Vibration.“ Wie ein kleiner Tsunami<br />
im eigenen Körper, kleine Wellen vibrieren<br />
und lösen inneren und äußeren<br />
Foto: Sophie Herwig<br />
1<br />
Stress. Nach einem l<strong>an</strong>gen Arbeitstag<br />
k<strong>an</strong>n m<strong>an</strong> sich vor einen niedrigen Tisch<br />
setzen und den Hinterkopf ablegen,<br />
den Nacken etwas überstrecken und<br />
das g<strong>an</strong>ze Gewicht auf <strong>der</strong> Tischplatte<br />
lassen. Der Körper, <strong>der</strong> den g<strong>an</strong>zen Tag<br />
unseren (schweren) Kopf tragen musste,<br />
entsp<strong>an</strong>nt sich augenblicklich. Wem diese<br />
Pose zu kompliziert ist, <strong>der</strong> k<strong>an</strong>n sich<br />
alternativ in den Zen-Sitz begeben. M<strong>an</strong><br />
hockt sich auf seine Knie und stellt die<br />
Zehenspitzen auf, d<strong>an</strong>n setzt m<strong>an</strong> sich<br />
ein paar Minuten auf die eigenen Beine.<br />
Die Vorteile: das physische Bewusstsein,<br />
Talent und Kreativität werden geför<strong>der</strong>t<br />
und gestärkt.<br />
Und was ist Yoga nun eigentlich Dr.<br />
Subodh? „Health <strong>an</strong>d Happiness <strong>an</strong>d<br />
Harmony“, <strong>der</strong> Yogi lächelt. Im Bewegungsraum<br />
hält er nach seinem Vortrag<br />
eine kleine Yoga-Stunde. Um gut in den<br />
Tag zu starten empfiehlt Dr. Subodh<br />
jeden Morgen nach dem Aufstehen<br />
zwei Gläser (lauwarmes) Wasser zu trinken<br />
und dazu ein paar Bewegungen zu<br />
machen. So <strong>läuft</strong> das Wasser gleich in<br />
die richtigen Bahnen, aktiviert Körper<br />
und Geist und m<strong>an</strong> wird nach <strong>der</strong> l<strong>an</strong>gen<br />
Nacht ohne Flüssigkeit zu neuem<br />
Leben erweckt.<br />
Im Yoga sind alle gleich, m<strong>an</strong> muss nicht<br />
dünn o<strong>der</strong> trainiert sein. Alle können<br />
Yoga machen. Hauptsache m<strong>an</strong> atmet.<br />
Ein. Aus. Ein. Aus. Am Ende <strong>der</strong> Yogastunde<br />
bed<strong>an</strong>kt m<strong>an</strong> sich mit einem Lächeln<br />
bei sich selbst. M<strong>an</strong> verbeugt sich leicht,<br />
vor sich selbst und dem Yogimeister.<br />
Sonne und Mond werden durch die linke<br />
und rechte H<strong>an</strong>d vor dem Körper zusammengeführt.<br />
Denn wo Licht ist, ist auch<br />
immer Schatten, da wo Tag ist, ist auch<br />
Nacht. In Namaste wird hell und dunkel<br />
vor <strong>der</strong> Brust vereint. D<strong>an</strong>ke. Namaste.<br />
Zum Schluss fragt Dr. Subodh: „Have<br />
you met tomorrow?“, „Habt ihr heute<br />
schon Gestern getroffen?“ Heute ist gestern<br />
schon Verg<strong>an</strong>genheit und morgen<br />
ist Zukunft. Wir können we<strong>der</strong> das eine<br />
noch das <strong>an</strong><strong>der</strong>e beeinflussen. Wir können<br />
uns nur selbst einen Gefallen tun<br />
und im Jetzt leben und atmen.<br />
2<br />
1<br />
2<br />
Yogameister und Naturarzt Dr.<br />
Subodh<br />
Yoga-Praxis in einem Görlitzer<br />
Seminarraum.<br />
41
<strong>Einblick</strong> // Menschen<br />
HERAUSRAGENDE LEHRE GEWÜRDIGT<br />
Am 21. April 2<strong>01</strong>8, im Rahmen <strong>der</strong> zentralen<br />
Ab<strong>so</strong>lventenfeier, erhielt Frau<br />
D<strong>an</strong>iela Ahrens vor rund 470 Gästen den<br />
Lehrpreis <strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz<br />
überreicht. Mit dem Lehrpreis werden<br />
ihr l<strong>an</strong>gjähriges überdurchschnittliches<br />
Engagement und ihre herausragenden<br />
Leistungen in <strong>der</strong> Lehre gewürdigt.<br />
Frau D<strong>an</strong>iela Ahrens ist Mitarbeiterin <strong>der</strong><br />
Fakultät Sozialwissenschaften und Lehrende<br />
im Studieng<strong>an</strong>g Soziale Arbeit.<br />
Durch eine sehr <strong>an</strong>schauliche Lehre<br />
gelingt es ihr, Studierende für <strong>so</strong>zialarbeiterische<br />
Themen zu begeistern und<br />
diese zu för<strong>der</strong>n und zu for<strong>der</strong>n. Seitens<br />
<strong>der</strong> Kollegen und Studierenden <strong>der</strong><br />
Fakultät wird Frau Ahrens eine sehr hohe<br />
Wertschätzung für ihren Einsatz in Lehre<br />
und Praxis<strong>an</strong>leitung entgegengebracht.<br />
Nach 2<strong>01</strong>5 wurde <strong>der</strong> vom För<strong>der</strong>verein<br />
<strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz e.V. gestiftete<br />
Lehrpreis zum zweiten Mal verliehen.<br />
DIE EINBLICK-REDAKTION TRAF DIE<br />
PREISTRÄGERIN ZU EINEM GESPRÄCH<br />
ÜBER WERTSCHÄTZUNG, NEUE LERN-<br />
FORMEN UND KLEIDERSCHRÄNKE.<br />
FRAU AHRENS, WAS BEDEUTET<br />
IHNEN DIESER LEHRPREIS?<br />
Der Lehrpreis bedeutet für mich einerseits<br />
eine fachliche und persönliche<br />
Foto: Paul Glaser<br />
2<br />
Foto: Ste f en Zücker<br />
1<br />
Anerkennung meiner Lehrtätigkeit<br />
durch die Studierenden und die Hochschule.<br />
An<strong>der</strong>erseits habe ich den Lehrpreis<br />
auch als Lehrkraft für be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e<br />
Aufgaben in Empf<strong>an</strong>g genommen. Es<br />
freut und motiviert mich, dass <strong>der</strong> För<strong>der</strong>verein<br />
und die Hochschule durch<br />
meine Per<strong>so</strong>n stellvertretend auch den<br />
akademischen Mittelbau würdigt, <strong>der</strong><br />
neben und mit den Profes<strong>so</strong>rinnen<br />
und Profes<strong>so</strong>ren in <strong>der</strong> Lehre engagiert<br />
tätig ist und damit einen wichtigen Beitrag<br />
zur Hochschulausbildung unseres<br />
Berufsnachwuchses leistet.<br />
HAT SICH WÄHREND DES VER-<br />
LAUFS IHRER LEHRTÄTIGKEIT<br />
DIE LEHRE VERÄNDERT?<br />
In den Seminaren „Sozialraumorientierte<br />
Soziale Arbeit“, „Sozialwirtschaft/-<br />
m<strong>an</strong>agement“ und „Projektstudium“<br />
entwickelte ich zunehmend projektorientierte<br />
Lern- und Lehrformen im Sinne<br />
des Service-Learning. Dabei stelle ich<br />
den Studierenden über ein komplexes<br />
Lernsetting und eine problemorientierte<br />
Lernumgebung Möglichkeiten bereit,<br />
fachlich und methodisch zu lernen und<br />
über selbstregulative Lernprozesse professionelle<br />
H<strong>an</strong>dlungskompetenzen<br />
zu erweitern. Das ist für alle herausfor<strong>der</strong>nd,<br />
aber auch sinnstiftend und<br />
erkenntnisreich.<br />
WELCHES PROJEKT IST IHNEN<br />
BESONDERS IN ERINNERUNG<br />
GEBLIEBEN?<br />
Im Zeitraum März 2<strong>01</strong>7 bis Februar 2<strong>01</strong>8<br />
erarbeiteten 13 Studierende des Studieng<strong>an</strong>gs<br />
Soziale Arbeit im vierten/<br />
fünften Semester mit meiner Unterstützung<br />
und in Kooperation mit den Vereinen<br />
Tierra - Eine Welt e.V. (Görlitz) und<br />
dem Entwicklungspolitischen Netzwerk<br />
Sachsen e.V. (Dresden) eine W<strong>an</strong><strong>der</strong>ausstellung<br />
zur globalen Textilindustrie<br />
in Form eines „sprechenden Klei<strong>der</strong>schr<strong>an</strong>kes“.<br />
In zehn auf Deutsch, Englisch<br />
und Polnisch erarbeiteten Hörstationen<br />
thematisiert die Ausstellung die individuelle,<br />
biographische Bedeutungsvielfalt<br />
von Kleidung, Umweltprobleme und<br />
Verstöße gegen Menschen- und Arbeitsrechte<br />
in <strong>der</strong> globalen Textilproduktion,<br />
aber auch H<strong>an</strong>dlung<strong>so</strong>ptionen und<br />
Engagementmöglichkeiten zum Abbau<br />
<strong>so</strong>zialer, ökologischer und ökonomischer<br />
Benachteiligungen von Menschen<br />
und Regionen. Bis Februar 2<strong>01</strong>9 arbeiten<br />
wir <strong>der</strong>zeit mit einer neuen studentischen<br />
Projektgruppe <strong>an</strong> diesen Themen<br />
weiter, indem wir Aktionskunstformate<br />
im öffentlichen Raum entwickeln und<br />
erproben. Es würde mich freuen, wenn<br />
wir mit <strong>der</strong> Ausstellung „Tuchfühlung –<br />
Vom Reinwaschen und Schönfärben“<br />
und den für November 2<strong>01</strong>8 gepl<strong>an</strong>ten<br />
Aktionen im öffentlichen Raum Studierende,<br />
Hochschulmitarbeitende und die<br />
Öffentlichkeit für Themen <strong>der</strong> Bildung<br />
für nachhaltige Entwicklung sensibilisieren<br />
könnten.<br />
Kontakt<br />
M.A. D<strong>an</strong>iela Ahrens<br />
d.ahrens@hszg.de<br />
1<br />
2<br />
Lehrpreisträgerin D<strong>an</strong>iela<br />
Ahrens<br />
Arbeit mit Studierenden <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> Ausstellung „Tuchfühlung<br />
- Vom Reinwaschen und<br />
Schönfärben“<br />
42
<strong>Einblick</strong> // Menschen<br />
DURCH KUNST EINEN AUSGLEICH FINDEN<br />
VON SABRINA WINTER<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
1<br />
2<br />
Ramona Böhme malt, was ihr auf dem<br />
Herzen liegt. „Häufig will ich neue Techniken<br />
ausprobieren“, sagt die Künstlerin.<br />
Weil sich ihre Werke keinem speziellen<br />
Thema zuordnen lassen, hat sie ihre<br />
Ausstellung „Zwischenst<strong>an</strong>d“ gen<strong>an</strong>nt.<br />
Sie war bis Mai 2<strong>01</strong>8 in <strong>der</strong> Hochschul-<br />
Bibliothek in Zittau zu sehen. Die Rückmeldungen<br />
auf ihre Kunst sind durchwachsen.<br />
Ramona Böhme erzählt:<br />
„M<strong>an</strong>chen gefällt es, m<strong>an</strong>chen ist es zu<br />
düster. Aber es ist halt mein Stil.“<br />
Die 35-Jährige ist nicht nur Künstlerin.<br />
Sie arbeitet auch in <strong>der</strong> Verwaltungs-IT<br />
<strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz. Konkret<br />
ist sie für die Software ver<strong>an</strong>twortlich,<br />
die das Prüfungsamt für die Notenverwaltung<br />
nutzt. Als Hochschulmtarbeiterin<br />
nimmt sie Telearbeitszeiten wahr<br />
und verbringt jeden Tag einige Stunden<br />
zu Hause. „D<strong>an</strong>n erledige ich Schreibarbeiten“,<br />
sagt Ramona Böhme. „Ein voller<br />
Tag zu Hause würde mir nichts bringen.“<br />
Denn sie hat einen Sohn, den sie allein<br />
erzieht. Die zusätzlichen Stunden zu<br />
Hause geben ihr mehr Flexibilität. Arbeit<br />
und Privatleben zu vereinen, k<strong>an</strong>n<br />
schon mal stressig werden. „Die letzten<br />
Wochen waren <strong>der</strong> Wahnsinn“, erzählt<br />
Ramona Böhme. „Unser Dezernat<br />
führt bald eine neue Software ein. Das<br />
bedeutet auch für mich mehr Arbeit.<br />
Hinzu sind meine eigenen Termine gekommen<br />
und die meines Sohnes. Privat<br />
habe ich in letzter Zeit <strong>an</strong> einigen Workshops<br />
teilgenommen. Dafür bin ich unter<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>em nach Berlin und Florenz<br />
gereist.“<br />
Wenn sie mal Freizeit hat, arbeitet Ramona<br />
Böhme dar<strong>an</strong>, ihre künstlerischen<br />
Fertigkeiten zu verbessern. Meist<br />
kommt sie erst dazu, wenn ihr Sohn<br />
schläft. Für sie ist Kunst ein Ausgleich,<br />
wie ein <strong>an</strong><strong>der</strong>es Leben nebenher. „Ich<br />
könnte nicht mehr ohne“, sagt sie.<br />
M<strong>an</strong>chmal bekommt sie auch Aufträge,<br />
mit denen sie sich etwas Geld hinzuverdient.<br />
Ihre ersten Ölfarben hat die Künstlerin<br />
2006 gekauft. L<strong>an</strong>ge liegen sie im<br />
Schr<strong>an</strong>k. Erst 2<strong>01</strong>4 holt Ramona Böhme<br />
sie wie<strong>der</strong> heraus, als sie den Künstler<br />
Hraefn Wulf<strong>so</strong>n kennenlernt und er<br />
sie zum Malen ermutigt. Nach wie vor<br />
hat sie Kontakt zu ihrem Mentor. Seit<br />
einigen Monaten konzentriert sie sich<br />
auf die digitale Malerei und das Modellieren.<br />
Um sich auf diesen Gebieten<br />
weiterzubilden, nimmt sie <strong>an</strong> Online-<br />
Workshops teil und investiert viel Zeit<br />
ins Selbststudium.<br />
Bevor Ramona Böhme die Kunst für sich<br />
entdeckt hat, hat sie eine kaufmännische<br />
Ausbildung <strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG gemacht.<br />
„Schon vor dem Studium habe ich mich<br />
sehr für Informatik interessiert. D<strong>an</strong>n<br />
war ich während meiner Ausbildung<br />
immer von Studierenden umgeben.<br />
Dadurch gab es keine Hemmschwelle<br />
mehr“, erzählt sie. 2008 schließt sie ihren<br />
Bachelor in Informatik ab und tritt<br />
2009 ihre Vollzeitstelle in <strong>der</strong> Verwaltungs-IT<br />
<strong>an</strong>. „Ich habe gleich nach <strong>der</strong><br />
Abschlussarbeit einen Platz bekommen<br />
und wurde ein halbes Jahr l<strong>an</strong>g eingearbeitet.<br />
Das war sehr gut!“, erinnert sie<br />
sich. Heute wünscht sie sich, mehr Zeit<br />
für ihre Kunst zu haben, diese auszuweiten<br />
und zum Fokus in ihrem Leben zu<br />
machen. Trotzdem mag sie ihre Arbeit<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> HSZG, auch wenn es m<strong>an</strong>chmal<br />
stressig ist. „Es ist das, was ich machen<br />
wollte“, resümiert Ramona Böhme.<br />
Ramona Böhme<br />
1 2<br />
Kunstwerk von Ramona<br />
Böhme<br />
Link zur Website von Ramona Böhme<br />
www.raboeart.com<br />
44
Menschen // <strong>Einblick</strong><br />
NEUBERUFUNGEN<br />
Foto: Christi<strong>an</strong>e Matthieu<br />
Fakultät Sozialwissenschaften<br />
Lehrgebiet: Methoden <strong>der</strong> empirischen Sozialforschung (Vertretungsprofessur)<br />
An <strong>der</strong> Hochschule seit März 2<strong>01</strong>8<br />
Geboren 1966 in Eilenburg<br />
DR. PHIL. RONALD GEBAUER<br />
Dr. phil. Ronald Gebauer ab<strong>so</strong>lvierte zunächst<br />
eine Erstausbildung zum Installateur<br />
und arbeitete <strong>an</strong>schließend u.a.<br />
im <strong>so</strong>zialdiakonischen Bereich, bevor er<br />
ab 1991 Soziologie und Psychologie <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> Universität Leipzig studierte. Dort<br />
promovierte <strong>der</strong> Diplom-Soziologe <strong>an</strong>schließend<br />
mit <strong>der</strong> Dissertation „Arbeit<br />
gegen Armut. Grundlagen, historische<br />
Genese und empirische Überprüfung<br />
des Armutsfallentheorems.“ zur Armutsforschung.<br />
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
wirkte er seit 1997 <strong>an</strong> zahlreichen<br />
Projekten u.a. <strong>an</strong> <strong>der</strong> Universität Leipzig,<br />
<strong>der</strong> Friedrich-Schiller-Universität Jena<br />
und dem Jenaer Zentrum für empirische<br />
Sozial- und <strong>Kultur</strong>forschung. An <strong>der</strong> Universität<br />
Potsdam und <strong>der</strong> Friedrich-Schiller-Universität<br />
Jena übernahm er jeweils<br />
Vertretungsprofessuren. Ab März 2<strong>01</strong>8<br />
unterrichtet Dr. phil. Ronald Gebauer<br />
als Vertretungsprofes<strong>so</strong>r Methoden <strong>der</strong><br />
empirischen Sozialforschung. Seine Arbeitsschwerpunkte<br />
liegen dabei bei <strong>der</strong><br />
Vermittlung von Grundlagenkenntnissen<br />
in den Methoden <strong>der</strong> empirischen<br />
Sozialforschung / Statistik <strong>so</strong>wie von<br />
fortgeschrittenen Auswertungsverfahren<br />
in den Studiengängen Soziale Arbeit,<br />
Kommunikationspsychologie und<br />
M<strong>an</strong>agement (z.B. <strong>Kultur</strong>, Gesundheit)<br />
<strong>so</strong>wie M<strong>an</strong>agement Sozialen W<strong>an</strong>dels<br />
und Soziale Gerontologie. Ein weiterer<br />
Schwerpunkt seiner Tätigkeit <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
HSZG bildet die Armuts- und Eliteforschung<br />
<strong>so</strong>wie die Forschung zur <strong>so</strong>zialen<br />
Lage von DDR-Zw<strong>an</strong>gsadoptierten.<br />
Foto: Privat<br />
Fakultät Sozialwissenschaften<br />
Lehrgebiet: Soziale Einzelfallhilfe, Sozialm<strong>an</strong>agement, Gleichstellung<br />
An <strong>der</strong> Hochschule seit März 2<strong>01</strong>8<br />
Geboren 1979 in Dresden<br />
DR. PHIL. JULIANE WAHREN<br />
„Um <strong>an</strong><strong>der</strong>e begeistern zu können, muss<br />
m<strong>an</strong> selbst begeistert sein und immer<br />
neugierig bleiben.“ Dieses Motto hat sich<br />
Dr. phil. Juli<strong>an</strong>e Wahren ihr Leben l<strong>an</strong>g<br />
bewahrt. Seit dem <strong>01</strong>. März 2<strong>01</strong>8 gibt<br />
sie diese Philo<strong>so</strong>phie als Vertretungsprofes<strong>so</strong>rin<br />
für Sozialwissenschaften mit<br />
dem Schwerpunkt Soziale Einzelfallhilfe,<br />
Sozialm<strong>an</strong>agement und Ethik in <strong>der</strong> Sozialen<br />
Arbeit <strong>an</strong> ihre Studentinnen und<br />
Studenten weiter. Damit ist die gebürtige<br />
Dresdnerin zu ihren akademischen<br />
Wurzeln zurückgekehrt, denn <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Hochschule Zittau/Görlitz hat sie 2002<br />
ihr Diplom als Sozialarbeiterin/-pädagogin<br />
abgelegt. Im Anschluss zog es sie in<br />
die Bundeshauptstadt, wo sie <strong>an</strong> <strong>der</strong> Katholischen<br />
Hochschule für Sozialwesen<br />
Berlin ihren Master berufsbegleitend<br />
ab<strong>so</strong>lvierte. Ihr erworbenes Fachwissen<br />
konnte sie 2003 als psycho-<strong>so</strong>ziale Betreuerin<br />
von psychisch erkr<strong>an</strong>kten alten<br />
Menschen beim PSB in Berlin <strong>an</strong>wenden.<br />
Von 2004 bis 2<strong>01</strong>7 arbeitete sie als<br />
Projektleiterin <strong>der</strong> Frauenzufluchtswohnungen<br />
und Beratungsstelle für gewaltbetroffene<br />
Frauen und ihre Kin<strong>der</strong> beim<br />
offensiv`91 e.V. in Berlin. Nach dieser für<br />
sie sehr prägenden Zeit zog es sie bis Februar<br />
2<strong>01</strong>8 als Profes<strong>so</strong>rin für allgemeine<br />
Sozialpädagogik <strong>an</strong> die FHD – Fachhochschule<br />
Dresden. In ihrer Freizeit geht sie<br />
gern auf Reisen, genießt Kino- und Theaterbesuche<br />
und in ruhigen Stunden ein<br />
gutes Buch. Mit ihrem Unterricht gibt sie<br />
den Studierenden wertvolle <strong>Einblick</strong>e<br />
in die Schwerpunkte: Klinische Sozialarbeit,<br />
biopsycho<strong>so</strong>ziale Gesundheit, Social<br />
Support und häusliche Gewalt.<br />
45
<strong>Einblick</strong> // Menschen<br />
Foto: Privat<br />
Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Lehrgebiet: Betriebswirtschaftslehre, insbe<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e Produktionswirtschaft und<br />
Logistik<br />
An <strong>der</strong> Hochschule seit Dezember 2<strong>01</strong>7<br />
Geboren 1981 auf Rügen<br />
PROF. DR. RER. POL.<br />
SOPHIA KEIL<br />
Seit Dezember 2<strong>01</strong>7 ist Prof. Dr. rer. pol.<br />
Sophia Keil Profes<strong>so</strong>rin für Betriebswirtschaftslehre,<br />
insbe<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e Produktionswirtschaft<br />
und Logistik <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
Zittau/Görlitz. Gebürtig von <strong>der</strong><br />
Ostseeinsel Rügen stammend, studierte<br />
sie Betriebswirtschaftslehre <strong>an</strong> <strong>der</strong> Fachhochschule<br />
Stralsund (1999 bis 2003). In<br />
den Jahren 2005 bis 2006 erfolgte ein<br />
berufsbegleitendes Promotionsstudium<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> TU Dresden.<br />
In ihrem beruflichen Entwicklungsweg<br />
bei dem Halbleiterhersteller Infineon<br />
Technologies Dresden GmbH, bei dem<br />
Lehrstuhl BWL, insb. Logistik, <strong>der</strong> Technischen<br />
Universität Dresden, bei <strong>der</strong> Dresden<br />
International University (DIU) <strong>so</strong>wie<br />
<strong>der</strong> Fachhochschule Stralsund konnte<br />
sie sich ein umfassendes Fach-, Erfahrungs-<br />
und Führungswissen auf den<br />
Gebieten <strong>der</strong> Unternehmensprozess-,<br />
Produktions-, Supply Chain- und Logistikoptimierung<br />
<strong>an</strong>eignen. 2<strong>01</strong>1 wurde sie<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> Technischen Universität Dresden<br />
mit einer Arbeit zum Thema „Flus<strong>so</strong>rientierte<br />
Gestaltung von Produktionssystemen<br />
am Beispiel von Halbleiterfabriken“<br />
zum Dr. rer. pol. promoviert. 2<strong>01</strong>5 erhielt<br />
sie den Ruf als Profes<strong>so</strong>rin <strong>an</strong> das SUNY<br />
Polytechnic Institute Alb<strong>an</strong>y (NY, USA),<br />
dem sie nicht folgte. Um Wissen für Studierende<br />
bestmöglich verständlich zu<br />
machen, schloss sie 2<strong>01</strong>5 berufsbegleitend<br />
das Sächsische Hochschuldidaktikzertifikat<br />
ab.<br />
In <strong>der</strong> eng verzahnten Forschung und<br />
Lehre steht bei Prof. Keil u. a. das Thema<br />
<strong>der</strong> „Digitalisierung“ im Vor<strong>der</strong>grund.<br />
Aktuell baut sie gemeinsam mit ihren<br />
Kollegen Prof. Uwe Wendt und J<strong>an</strong> Fallgatter<br />
das Digitalisierungslabor SCO-TTi<br />
(Science Café Oberlausitz – Technologie<br />
– Tr<strong>an</strong>sfer – innovativ) auf. In diesem <strong>so</strong>llen<br />
Studierende zur Gestaltung digitaler<br />
Unternehmensprozesse und zur Nutzung<br />
digitaler Technologien befähigt<br />
werden. „Mein Ziel ist es, die Studierenden<br />
zu aktiven, unabhängigen Lernenden,<br />
nach dem Motto: ‚Wissen, wie ich<br />
Wissen selbst schaffe und nutze‘, entwickeln“,<br />
<strong>so</strong> Prof. Keil.<br />
Im Juni 2<strong>01</strong>8 hat sie das europäische Forschungsprojekt<br />
„iDev40“ für die HSZG<br />
eingeworben, in dem sie gemeinsam<br />
mit 38 Partnern aus sechs Län<strong>der</strong>n <strong>an</strong><br />
Digitalisierungsthemen in Bezug auf<br />
die intelligente Vernetzung von Produktions-<br />
und Entwicklungsprozessen und<br />
<strong>der</strong> Gestaltung von Arbeitsplätzen 4.0<br />
forscht.<br />
Frau Prof. Keil ist mit weltweit agierenden<br />
High-Tech-Unternehmen und Hochschulinstituten<br />
sehr gut vernetzt. Sie ist<br />
Mitglied in den Programmkomitees <strong>der</strong><br />
Adv<strong>an</strong>ced Semiconductor M<strong>an</strong>ufacturing<br />
Conference (ASMC) <strong>so</strong>wie <strong>der</strong> Europe<strong>an</strong><br />
Adv<strong>an</strong>ced Process Control <strong>an</strong>d<br />
M<strong>an</strong>ufacturing Conference (apcm) und<br />
Autorin von über 30 Veröffentlichungen.<br />
Ab September 2<strong>01</strong>8 wird sie als Mitglied<br />
des Fakultätsrates und als Studiendek<strong>an</strong>in<br />
<strong>der</strong> Fakultät Wirtschaftswissenschaften<br />
und -ingenieurwesen tätig sein. Frau<br />
Prof. Keil ist sehr naturverbunden und<br />
sportlich. Sie unternimmt gerne W<strong>an</strong><strong>der</strong>ungen<br />
mit ihrer Familie, ihren Freunden<br />
und ihrem Hund Paul und macht gerne<br />
Radtouren.<br />
DIENSTJUBILÄEN 2<strong>01</strong>8<br />
25<br />
40<br />
25-jähriges:<br />
Prof. Dr. Tobias Zschunke<br />
40-jähriges:<br />
Dr. Arndt Schmidt, Petra Schmidt, Karin<br />
Schiffner, Jutta Haim, Evelyn Sulim<strong>an</strong>, Angelika<br />
Reinke, Prof. Dr. Reiner Böhm<br />
JUBILÄEN<br />
WIR GRATULIEREN<br />
46
Menschen // <strong>Einblick</strong><br />
STAFFELSTABÜBERGABE<br />
Dr. oec. Norbert Sturm ab<strong>so</strong>lvierte von<br />
1976 bis 1980 ein Studium <strong>der</strong> Betriebswirtschaft<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> Ingenieurhochschule<br />
Zittau. Dar<strong>an</strong> <strong>an</strong>schließend war er von<br />
September 1980 bis 1984 als befristeter<br />
wissenschaftlicher Assistent tätig und<br />
promovierte 1985 im Lehrgebiet Rechnungsführung<br />
und Fin<strong>an</strong>zen.<br />
Ab August 1984 beg<strong>an</strong>n Herr Dr. Sturm<br />
seine berufliche Laufbahn als Leiter für<br />
Haushaltwirtschaft/Leiter <strong>der</strong> Abteilung<br />
Fin<strong>an</strong>zen <strong>der</strong> Ingenieurhochschule Zittau/Technischen<br />
Hochschule Zittau.<br />
Mit den politischen Verän<strong>der</strong>ungen<br />
auch in <strong>der</strong> Hochschull<strong>an</strong>dschaft wurden<br />
Dr. Sturm 1991 die Aufgaben eines<br />
Referatsleiters Haushalt übertragen, die<br />
er bis zur Neuausrichtung <strong>der</strong> Hochschulverwaltung<br />
im Jahre 2<strong>01</strong>7 ausübte.<br />
Die sich aus <strong>der</strong> Neuen Hochschulsteuerung<br />
ergebende Notwendigkeit einer<br />
stärkeren inhaltlichen und org<strong>an</strong>isatorischen<br />
Verbindung <strong>der</strong> Referate Haushalt<br />
und Forschung hat Dr. Sturm als Dezernent<br />
Fin<strong>an</strong>zen und Projektverwaltung<br />
bis zu seinem Dienstende erfolgreich<br />
umgesetzt und gestaltet.<br />
Auf dem Weg <strong>der</strong> Hochschule zur <strong>so</strong>gen<strong>an</strong>nten<br />
Haushaltsflexibilität hat Dr.<br />
Sturm l<strong>an</strong>gfristig auch junge Kolleginnen<br />
und Kollegen für die Arbeit im Dezernat<br />
Fin<strong>an</strong>zen und Projektverwaltung<br />
gewinnen und begeistern können und<br />
damit den Überg<strong>an</strong>g zum Wirtschaften<br />
auf <strong>der</strong> Grundlage eines umfassenden<br />
Controllings vor dem Hintergrund <strong>der</strong><br />
Einführung eines ERP-Systems erfolgreich<br />
vorbereitet.<br />
Dr. Sturm hat sich stets für eine auskömmliche<br />
Fin<strong>an</strong>zsituation <strong>der</strong> Hochschule<br />
und <strong>der</strong> Struktureinheiten, auch<br />
in Zeiten von Stellen- und Mittelsperrungen,<br />
eingesetzt. In seiner Funktion war<br />
er unmittelbarer und stets verlässlicher<br />
1<br />
Partner für den K<strong>an</strong>zler als Beauftragter<br />
für den kameralistischen Haushalt bzw.<br />
bei <strong>der</strong> Bewirtschaftung <strong>der</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
zugewiesenen Mittel unter Anwendung<br />
kaufmännischer Grundsätze.<br />
Mittelverteilung und -verwendung <strong>an</strong><br />
<strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz bewertete<br />
er konsequent unter dem Aspekt <strong>der</strong><br />
Aufgabenerfüllung <strong>der</strong> Hochschule vor<br />
dem Hintergrund des jeweils geltenden<br />
Hochschulgesetzes.<br />
Über die Haushalts- und Wirtschaftsjahre<br />
seiner Tätigkeit hat Dr. Sturm die<br />
Hochschulleitungen zuverlässig und<br />
mit <strong>so</strong>lidem Fachwissen in fin<strong>an</strong>ziellen<br />
Fragen unterstützt und begleitet. Hochschulspezifische<br />
Lösungs<strong>an</strong>sätze st<strong>an</strong>den<br />
immer im Vor<strong>der</strong>grund. Die Mitglie<strong>der</strong><br />
<strong>der</strong> Fin<strong>an</strong>zkommission schätzten<br />
seine pragmatische Her<strong>an</strong>gehensweise,<br />
das Aufzeigen relev<strong>an</strong>ter Problemstellungen<br />
und die gemeinsame Lösungsfindung.<br />
Dr. Sturm ist begeisterter Fußballf<strong>an</strong>, <strong>der</strong><br />
in <strong>der</strong> Region auch als Schiedsrichter aktiv<br />
war.<br />
Zum 31. August 2<strong>01</strong>8 beendet Dr. oec.<br />
Norbert Sturm sein Arbeitsverhältnis<br />
und geht in den wohlverdienten Ruhest<strong>an</strong>d.<br />
Im Rahmen eines öffentlichen Stellenausschreibungsverfahrens<br />
wurde Frau<br />
M.Sc. Jenny König als Nachfolgerin ausgewählt.<br />
Sie wird ab dem 1. September<br />
2<strong>01</strong>8 die Funktion <strong>der</strong> Dezernentin Fin<strong>an</strong>zen<br />
und Projektverwaltung <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Hochschule Zittau/Görlitz übernehmen.<br />
1<br />
- Dipl.-Jur. Karin Hollstein -<br />
K<strong>an</strong>zlerin<br />
Dr. oec. Norbert Sturm übergibt<br />
zum 1. September 2<strong>01</strong>8<br />
das Dezernat Fin<strong>an</strong>zen und<br />
Projektverwaltung <strong>an</strong> M.Sc.<br />
Jenny König.<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
47
<strong>Einblick</strong> // Menschen<br />
VERABSCHIEDUNGEN<br />
DIPL.-ING. OEC.<br />
GABRIELE SEFRIN<br />
Frau Dipl.-Ing. oec. Gabriele Sefrin war<br />
nach dem Studium <strong>der</strong> Betriebswirtschaft<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> TU Dresden ab dem Jahre<br />
1976 in verschiedenen Unternehmen<br />
<strong>der</strong> Region beschäftigt, unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em<br />
in <strong>der</strong> Fahrzeugindustrie und dem Textilmaschinenbau.<br />
Im Jahre 1998 kam sie erstmals in Berührung<br />
mit <strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz,<br />
zunächst über den Forschungsverein<br />
Umweltschutz. Unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em war sie<br />
zu dieser Zeit mit dem Aufbau eines<br />
Weiterbildungszentrums <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
befasst. Im Zuge dessen war sie<br />
damals auch <strong>an</strong> <strong>der</strong> Schaffung <strong>der</strong> Seniorenakademie<br />
beteiligt, ein Vorläufer<br />
des heutigen Seniorenkollegs. In beiden<br />
Dezernat Studium und Internationales / Neisse University<br />
Koordinatorin „Internationale Netzwerke“<br />
An <strong>der</strong> Hochschule seit 1998<br />
Bereichen hat sie Pionierarbeit geleistet.<br />
Ihre Arbeit war von Anf<strong>an</strong>g <strong>an</strong> durch<br />
effektive Arbeit<strong>so</strong>rg<strong>an</strong>isation und eine<br />
zügige und termingerechte Bearbeitung<br />
<strong>der</strong> ihr übertragenen Aufgaben gekennzeichnet.<br />
Ihre l<strong>an</strong>gjährige Berufserfahrung<br />
in Verwaltungsprozessen konnte<br />
sie gut einbringen.<br />
Ab dem Jahre 20<strong>01</strong> war Gabriele Sefrin<br />
als Sachbearbeiterin im Rahmen des internationalen<br />
Netzwerkes „Neisse University“<br />
beschäftigt. Diese Tätigkeit füllte<br />
sie bis zuletzt mit einem hohen Maß<br />
<strong>an</strong> Selbstständigkeit, Ver<strong>an</strong>twortungsbewusstsein,<br />
Fleiß und Sachkompetenz<br />
aus. Alle Studierenden des Studieng<strong>an</strong>ges<br />
„Information <strong>an</strong>d Communication<br />
M<strong>an</strong>agement“, welcher innerhalb des<br />
Netzwerkes „Neisse University“ <strong>an</strong>geboten<br />
wird, denken gern <strong>an</strong> die Zeit des<br />
Studiums zurück, haben sie doch viele<br />
gute Erinnerungen <strong>an</strong> die ‘Mutter‘ <strong>der</strong><br />
„Neisse University“, Frau Sefrin. Sie hat<br />
ihnen bei den vielen großen und kleinen<br />
Problemen des Studiums weitergeholfen<br />
und damit wesentlich zum Gelingen<br />
beigetragen.<br />
Sehr geehrte Frau Sefrin, herzlichen<br />
D<strong>an</strong>k für die geleistete Arbeit. Wir wünschen<br />
Ihnen und Ihrer Familie für die<br />
kommenden Jahre Gesundheit und persönlich<br />
alles Gute.<br />
- Dr.-Ing. Stef<strong>an</strong> Kühne -<br />
Foto: Privat<br />
Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Lehrgebiet: Marketing / H<strong>an</strong>dels- und B<strong>an</strong>klehre<br />
An <strong>der</strong> Hochschule seit 1994<br />
PROF. DR. RER. POL. DR. H.C.<br />
CLEMENS RENKER<br />
An <strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz in Kooperation<br />
mit dem IHI <strong>der</strong> TU Dresden<br />
lehrt Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. Clemens<br />
Renker von 1994 bis 2<strong>01</strong>8 Marketing,<br />
H<strong>an</strong>dels- und B<strong>an</strong>klehre. In dieser Zeit<br />
engagierte er sich auch für seine Hochschule<br />
in <strong>der</strong> Studienkommission, als<br />
Prodek<strong>an</strong>, Hochschulrat und im Fachbeirat<br />
des SMWK <strong>so</strong>wie für die Universitätspartnerschaft<br />
St. Petersburg. Neben <strong>der</strong><br />
Betreuung von mehr als 500 Praxistr<strong>an</strong>sfers<br />
von Studierenden veröffentlichte er<br />
bis heute 10 Fachbücher und 60 Fachartikel.<br />
Nach dem hum<strong>an</strong>istischen Abitur<br />
studierte er Volkswirtschaftslehre und<br />
Betriebswirtschaft <strong>an</strong> den Universitäten<br />
Würzburg, Münster und St. Petersburg.<br />
Später folgten noch Philo<strong>so</strong>phie und<br />
slawistische Literaturwissenschaft als<br />
Gaststudien. Von 1980 bis 1990 sammelte<br />
er als Trainee, Vorst<strong>an</strong>dsreferent, Leiter<br />
Industriekredite in <strong>der</strong> Bayerischen<br />
L<strong>an</strong>desb<strong>an</strong>k und in <strong>der</strong> Leitung <strong>der</strong><br />
Sparkasse Schweinfurt umf<strong>an</strong>greiche<br />
B<strong>an</strong>kerfahrungen. Bis 2000 gestaltete er<br />
als Geschäftsführer das Industrieunternehmen<br />
C. Kreul zum Weltmarktführer.<br />
Dafür und für mehrere ehrenamtliche<br />
Vorst<strong>an</strong>dschaften wurde Clemens Renker<br />
unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em mit dem Bundesverdienstkreuz<br />
gewürdigt. Neben <strong>der</strong> Literatur,<br />
Musik und Kunst zählt <strong>der</strong> Fußball<br />
zu seinen Vorlieben.<br />
- Fakultät Wirtschaftswissenschaften<br />
und Wirtschaftsingenieurwesen -<br />
48
Menschen // <strong>Einblick</strong><br />
Dipl.-Ing. BERND KAUFMANN<br />
zum 28.02.2<strong>01</strong>8, Laborleiter Baustofftechnik/Bauwerksdiagnostik,<br />
Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen<br />
ROLAND HEIDRICH<br />
zum 31.03.2<strong>01</strong>8, Laborhilfskraft <strong>der</strong> Fakultät Maschinenwesen<br />
DANIEL SCHWERTFEGER M.A.<br />
zum 15.06.2<strong>01</strong>8, wissenschaftlicher Mitarbeiter <strong>der</strong> Fakultät Sozialwissenschaften<br />
JULIA ŠVARC B.A.<br />
zum 31.<strong>01</strong>.2<strong>01</strong>8, Lehrkraft für be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e Aufgaben im Studienkolleg<br />
WIR TRAUERN UM PROF. WOLFGANG PREIS<br />
HERR PROF. WOLFGANG PREIS<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
Mit Bestürzung haben wir die Nachricht<br />
vom Tode von Profes<strong>so</strong>r Wolfg<strong>an</strong>g Preis<br />
aufgenommen, <strong>der</strong> viel zu früh und unerwartet<br />
am 3. April 2<strong>01</strong>8 von uns geg<strong>an</strong>gen<br />
ist.<br />
Profes<strong>so</strong>r Preis hat maßgeblich den Aufbau<br />
und die Entwicklung des Studieng<strong>an</strong>gs<br />
Soziale Arbeit geprägt. Am 1. April<br />
1992 – noch vor <strong>der</strong> offiziellen Gründung<br />
<strong>der</strong> Hochschule Zittau/Görlitz – nahm er<br />
seine Tätigkeit <strong>an</strong> unserer Hochschule<br />
auf und gehörte mit Profes<strong>so</strong>r Herm<strong>an</strong>n<br />
Heitkamp zu den Gründungsvätern<br />
des Fachbereichs Sozialwesen. 25 Jahre<br />
wirkte er als Profes<strong>so</strong>r für Sozialarbeitswissenschaft,<br />
enorm engagiert in <strong>der</strong><br />
Lehre und gegenüber den Studierenden,<br />
aber auch als Autor zahlreicher<br />
wissenschaftlicher Veröffentlichungen<br />
und in <strong>der</strong> Hochschulselbstverwaltung.<br />
Viele Jahre war Wolfg<strong>an</strong>g Preis Mitglied<br />
des Fakultätsrates, Studieng<strong>an</strong>gsleiter<br />
und Triebfe<strong>der</strong> für curriculare Reformprozesse.<br />
Dabei ist <strong>der</strong> ausgebildete Sozialarbeiter<br />
seinen Überzeugungen hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> Qualität des Studiums <strong>der</strong><br />
Sozialen Arbeit, insbe<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e mit Blick<br />
auf die Theorie-Praxis-Verzahnung, stets<br />
treu geblieben.<br />
Die Studierenden und seine Kolleginnen<br />
und Kollegen trauern um einen äußerst<br />
engagierten Mitmenschen. Er bleibt als<br />
Vorbild in seinem Einsatz für die Interessen<br />
Studieren<strong>der</strong> und <strong>so</strong>zial benachteiligter<br />
Menschen in Erinnerung.<br />
Unser g<strong>an</strong>zes Mitgefühl gilt seiner Familie.<br />
- Prof. Friedrich Albrecht -<br />
Rektor<br />
49
<strong>Einblick</strong> // Menschen<br />
UND DOCH KEINE STUDENTIN AN DER HSZG<br />
VON HEIKE KALLWEIT UND CORNELIA ROTHE<br />
In l<strong>an</strong>ger Tradition bietet die Hochschule<br />
jährlich Ausbildungsplätze in den<br />
Berufen Elektroniker/in für Geräte und<br />
Systeme und Kauffrau/Kaufm<strong>an</strong>n für<br />
Bürom<strong>an</strong>agement <strong>an</strong>. Seit Herbst 2<strong>01</strong>6<br />
gibt es nun einen weiteren Baustein.<br />
Die Hochschule ist Praxispartner <strong>der</strong><br />
Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie<br />
Bautzen, für Studierende<br />
im dualen Studieng<strong>an</strong>g Public M<strong>an</strong>agement,<br />
und geht damit neue Wege auf<br />
diesem Gebiet <strong>der</strong> Per<strong>so</strong>nalentwicklung,<br />
insbe<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e für die Nachwuchsför<strong>der</strong>ung<br />
im nichtwissenschaftlichen<br />
Bereich. Fast die Hälfte <strong>der</strong> sechssemestrigen<br />
Ausbildungszeit erfolgt dabei im<br />
Rahmen <strong>der</strong> praxisintegrierenden Studienabschnitte<br />
in <strong>der</strong> Verwaltung und<br />
<strong>der</strong> Öffentlichkeitsarbeit. Mit Beginn des<br />
Wintersemesters 2<strong>01</strong>8/2<strong>01</strong>9 sind d<strong>an</strong>n<br />
bereits drei Studentinnen aus diesem<br />
Studieng<strong>an</strong>g bei uns <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule.<br />
DAS BESONDERE DARAN, KEINE<br />
STUDENTIN AN DER HSZG ZU<br />
SEIN<br />
Julia Große ist 21 Jahre alt und studiert<br />
im dritten Studienjahr Public M<strong>an</strong>agement<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> Berufsakademie Sachsen in<br />
Bautzen. Seit Oktober 2<strong>01</strong>6 ist die Hochschule<br />
Zittau/Görlitz ihr Ausbildungspartner.<br />
WAS IST BESONDERS AN EINER<br />
HOCHSCHULE ALS AUSBIL-<br />
DUNGSPARTNER?<br />
Das Be<strong>so</strong>n<strong>der</strong>e <strong>an</strong> <strong>der</strong> Situation ist, gerade<br />
NICHT als Studentin <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
zu studieren, wie m<strong>an</strong> es üblicherweise<br />
kennt. Wenn die Leute von<br />
meinem Ausbildungspartner hören,<br />
fällt die Überraschung meist groß aus.<br />
Das wird von den wenigsten erwartet.<br />
Ich bin glücklich darüber, meine Praxisphasen<br />
hier ab<strong>so</strong>lvieren zu können. Sie<br />
sind gut auf die Inhalte des Studiums<br />
abgestimmt, <strong>so</strong>dass ich die Möglichkeit<br />
1<br />
1<br />
erhalte, mir ein Bild von den verschiedenen<br />
Verwaltungsbereichen zu machen,<br />
ein Bewusstsein für <strong>der</strong>en Tätigkeiten<br />
zu entwickeln und zu verstehen, wie die<br />
einzelnen Bereiche mitein<strong>an</strong><strong>der</strong> agieren.<br />
WIE GESTALTET SICH IHR AR-<br />
BEITSALLTAG?<br />
Die Praxisphasen dauern meist zwischen<br />
zehn und elf Wochen. Entsprechend <strong>der</strong><br />
Studieninhalte werde ich in verschiedenen<br />
Stationen eingesetzt. Unter <strong>an</strong><strong>der</strong>em<br />
war ich bereits in <strong>der</strong> Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit,<br />
im Bereich Fin<strong>an</strong>zen<br />
<strong>so</strong>wie im Bereich Per<strong>so</strong>nal tätig. In den<br />
Stationen werde ich zu einem großen<br />
Teil in das Alltagsgeschäft eingebunden.<br />
So durfte ich während meiner Zeit in <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeitsarbeit News-Beiträge auf<br />
<strong>der</strong> Hochschulwebseite veröffentlichen<br />
und war <strong>an</strong> <strong>der</strong> Immatrikulationsfeier<br />
<strong>der</strong> Studien<strong>an</strong>fänger beteiligt. Im Bereich<br />
Per<strong>so</strong>nal wirke ich bei verschiedenen<br />
Prozessen mit, wie beispielsweise<br />
<strong>der</strong> Neueinstellung von Mitarbeitern<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Ausfertigung von Arbeitsverträgen.<br />
Grundsätzlich werde ich in viele Aufgaben<br />
mit eingebunden, was mir hilft, ein<br />
besseres Verständnis für die internen<br />
Abläufe und Vernetzungen zu bekommen.<br />
Hinzu kommt, dass ich in je<strong>der</strong><br />
Praxisphase eine Belegarbeit schreiben<br />
muss. Mit <strong>der</strong> Bil<strong>an</strong>zierung von Zuschüssen<br />
für die Hochschul-Projekte habe ich<br />
mich in <strong>der</strong> verg<strong>an</strong>genen Praxisphase<br />
beschäftigt. Derzeit befasse ich mich mit<br />
<strong>der</strong> Thematik, was ein Enterprise Res<strong>so</strong>urce<br />
Pl<strong>an</strong>ning-System bezüglich des<br />
Per<strong>so</strong>nalm<strong>an</strong>agements <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hochschule<br />
bieten k<strong>an</strong>n.<br />
WIE SEHEN IHRE PLÄNE FÜR DIE<br />
ZUKUNFT AUS?<br />
Im Anschluss <strong>an</strong> das Studium möchte ich<br />
noch mehr Berufserfahrung in <strong>der</strong> Verwaltung<br />
sammeln. Ich würde mich freuen,<br />
in <strong>der</strong> Heimat - bei meiner Familie<br />
- zu bleiben, glaube aber auch, dass es<br />
wichtig ist, <strong>der</strong> Heimat für eine gewisse<br />
Zeit den Rücken zu kehren. Grundsätzlich<br />
könnte ich mir vorstellen, für zwei,<br />
drei Jahre in eine <strong>an</strong><strong>der</strong>e Stadt o<strong>der</strong> gar<br />
ins Ausl<strong>an</strong>d zu gehen, um Erfahrungen<br />
zu sammeln.<br />
1<br />
Foto: Jens Freudenberg<br />
Julia Große hat während<br />
ihrer Zeit in <strong>der</strong> Stabsstelle<br />
Öffentlichkeitsarbeit bei den<br />
Vorbereitungen und Durchführungen<br />
von Ver<strong>an</strong>staltungen<br />
unterstützt.<br />
50
IMPRESSUM<br />
Herausgeber:<br />
Ver<strong>an</strong>twortlich im Sinne des Presserechts:<br />
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit<br />
Antje Pfitzner, M.A.<br />
Redaktion und Koordination:<br />
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit<br />
Antje Pfitzner, M.A.<br />
Cornelia Rothe, M.A.<br />
03583 612 3031<br />
marketing@hszg.de<br />
Redaktionsschluss:<br />
30. Juni 2<strong>01</strong>8<br />
Satz und Gestaltung:<br />
Werbeagentur 15°<br />
www.15grad.com<br />
Titelbild:<br />
Campus Zittau<br />
Druck:<br />
dieUmweltDruckerei GmbH<br />
Gedruckt wurde mit Bio-Farben auf Pfl<strong>an</strong>zenöl-Basis auf CircleoffsetPremium<br />
White Recyclingpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge<br />
geben die Meinung <strong>der</strong> Autoren wie<strong>der</strong>. Die Redaktion behält sich<br />
Än<strong>der</strong>ungen einges<strong>an</strong>dter Texte vor.