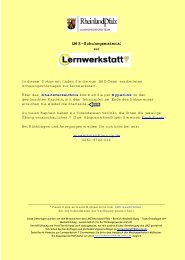Neue Informations- und Kommunikationstechnologien - Fachberater ...
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien - Fachberater ...
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien - Fachberater ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PZ-Information 6/2000 Sonderschule/<br />
Integrierte Förderung<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Kommunikationstechnologien</strong><br />
in der Sonderpädagogik<br />
Hilfsmittel<br />
beim Lernen<br />
<strong>und</strong> Üben<br />
Therapeutische<br />
<strong>und</strong><br />
prothetische Hilfe<br />
Hilfsmittel<br />
beim Informieren<br />
<strong>und</strong> Kommunizieren<br />
Schreiben,<br />
Verwalten,<br />
Steuern<br />
Gegenstand<br />
des Lernens<br />
Gestalten,<br />
Präsentieren,<br />
Publizieren<br />
Handreichung für den Computereinsatz
In den „PZ-Informationen“ werden Ergebnisse von Arbeitsgruppen veröffentlicht, die Anregungen geben<br />
wollen, wie auf Gr<strong>und</strong> neuer Erkenntnisse aus Wissenschaft <strong>und</strong> Praxis das gemeinsame Tun von<br />
Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrern bereichert werden kann.<br />
Für Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, die diese Anregung aufgreifen <strong>und</strong> durch eigene Erfahrung <strong>und</strong><br />
Erkenntnisse/Ergebnisse verändern oder ergänzen wollen, sind die Mitarbeiter des Pädagogischen Zentrums<br />
aufgeschlossene Partnerinnen <strong>und</strong> Partner, die besucht oder angerufen werden können.<br />
Die „PZ-Informationen“ im Arbeitsbereich Sonderschule/Integrierte Förderung erscheinen unregelmäßig.<br />
Eine Auflistung der bereits erschienenen Schriften zum Arbeitsbereich ist auf der rückwärtigen inneren<br />
Umschlagseite abgedruckt.<br />
Dieser „PZ-Information“ ist zusätzlich eine CD-ROM des Landesmedienzentrums beigefügt. Sie enthält<br />
neben dieser Schrift im pdf-Dateiformat den zur Nutzung erforderlichen Adobe ® Acrobat ® Reader, Demo-,<br />
Shareware- <strong>und</strong> Freewareversionen von Programmen sowie Informationen zum Landesbildungsserver. Die<br />
CD-ROM wird auch separat gegen eine Schutzgebühr von DM 5,- abgegeben. Kapitel bzw. Themen, zu<br />
denen sich Daten auf der CD-ROM befinden, sind mit einem gekennzeichnet.<br />
Herausgeber:<br />
Pädagogisches Zentrum (PZ)<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Postfach 2152, 55511 Bad Kreuznach<br />
Tel.: 06 71/8 40 88-0<br />
Fax: 06 71/8 40 88-10<br />
Autoren:<br />
Manfred Behrendt, Rüdiger Melzer<br />
Franz Josef Schwaller, Harald Schmitt<br />
Peter Weidemann, Herbert Zimmermann<br />
Redaktion:<br />
Rüdiger Melzer, PZ Bad Kreuznach<br />
Franz Josef Schwaller, LMZ Koblenz<br />
Skriptbearbeitung <strong>und</strong> Layout:<br />
Franz Josef Schwaller<br />
© Bad Kreuznach 2000<br />
ISSN 0938-748X<br />
Die "PZ-Informationen" sind für den Einsatz im Unterricht an Schulen gedacht. Zu diesem Zweck kann der<br />
Inhalt auszugsweise in der erforderlichen Zahl vervielfältigt werden.<br />
Die vorliegende PZ-Veröffentlichung wird gegen eine Schutzgebühr von DM 10,– abgegeben.
Pädagogisches Zentrum<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Bad Kreuznach<br />
PZ-Information 6/2000<br />
Landesmedienzentrum<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Koblenz<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Kommunikationstechnologien</strong><br />
in der Sonderpädagogik<br />
Handreichung für den Computereinsatz
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 3<br />
INHALT<br />
1 EINLEITUNG................................................................................................................ 5<br />
2 COMPUTEREINSATZ IN DER SONDERPÄDAGOGIK IM RAHMEN DER<br />
SCHULISCHEN MEDIENERZIEHUNG........................................................................ 7<br />
2.1 Konzept einer Medienerziehung............................................................................. 7<br />
2.2 Lernziel Medienkompetenz - neun Bausteine .............................................. 10<br />
Erste Erfahrungen mit dem Computer..............................................................................................10<br />
Schreiben <strong>und</strong> Texte gestalten (Textverarbeitung) .......................................................................... 14<br />
Mit Texten <strong>und</strong> Bildern gestalten <strong>und</strong> präsentieren.......................................................................... 17<br />
Informationen speichern <strong>und</strong> verwalten (Datenbanken)................................................................... 20<br />
Rechnen <strong>und</strong> Kalkulieren (Tabellenkalkulation) ............................................................................... 23<br />
Vorgänge <strong>und</strong> Zusammenhänge darstellen <strong>und</strong> simulieren (Modelle <strong>und</strong> Simulationen)................ 28<br />
Geräte <strong>und</strong> Maschinen steuern ........................................................................................................32<br />
Daten übertragen <strong>und</strong> Informationen suchen................................................................................... 43<br />
Gr<strong>und</strong>wissen Hard- <strong>und</strong> Software ................................................................................. 46<br />
2.3 Weitere unterrichtliche Einsatzmöglichkeiten ....................................................... 48<br />
Einsatz des Computers im Musikunterricht ..................................................................... 48<br />
Videoarbeit mit dem Computer ....................................................................................... 50<br />
2.4 Multimedia in der Schule ...................................................................................... 52<br />
2.5 Computerspiele .................................................................................................... 57<br />
3 SONDERPÄDAGOGISCHE FÖRDERUNG VON BEHINDERTEN KINDERN UND<br />
JUGENDLICHEN MIT HILFE VON IUK-TECHNOLOGIEN ....................................... 61<br />
3.1 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen mit körperlicher Behinderung ............. 62<br />
3.2 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen mit Sehbehinderung <strong>und</strong> Blindheit ..... 65<br />
3.3 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
mit Schwerhörigkeit <strong>und</strong> Gehörlosigkeit ............................................................... 67<br />
3.4 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
mit geistiger Behinderung..................................................................................... 69<br />
3.5 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
mit sprachlichen Beeinträchtigungen <strong>und</strong> Beeinträchtigungen beim Lernen ........ 70<br />
3.6 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
durch Krankenhaus- <strong>und</strong> Hausunterricht.............................................................. 71<br />
3.7 <strong>Informations</strong>system zur beruflichen Rehabilitation - REHADAT ........................... 72<br />
4 NUTZUNG DES INTERNET IN DER SCHULE .......................................................... 74<br />
4.1 Gr<strong>und</strong>lagen........................................................................................................... 74<br />
4.2 Die wichtigsten Dienste im Internet ...................................................................... 75<br />
4.3 Der Bildungsserver des Landes Rheinland-Pfalz ................................................. 79
4<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
5 PROGRAMME FÜR LEHRKRÄFTE .......................................................................... 81<br />
5.1 Schulschriften....................................................................................................... 81<br />
5.2 Programme zur Erstellung von Arbeitsblättern am Computer .............................. 84<br />
6 HARD- UND SOFTWAREAUSSTATTUNG ............................................................... 89<br />
6.1 Ausstattungsempfehlungen.................................................................................. 89<br />
6.2 Ergonomie am Arbeitsplatz „Computer“ ............................................................... 95<br />
7 COMPUTEREINSATZ IN DER SCHULVERWALTUNG............................................ 98<br />
8 PROBLEME BEIM ARBEITEN MIT DEM COMPUTER........................................... 102<br />
8.1 Allgemeine Probleme mit Programmen <strong>und</strong> Betriebssytem ............................... 102<br />
8.2 Viren auf dem Computer <strong>und</strong> im Internet............................................................ 102<br />
8.3 Datensicherung .................................................................................................. 106<br />
8.4 Datenschutz ....................................................................................................... 107<br />
9 NEUE INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN<br />
IN DER AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNG ....................................................... 111<br />
9.1 <strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> im Rahmen des<br />
Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Sonderschulen................................ 111<br />
9.2 Tätigkeit der <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong> „Computer an Sonderschulen“...... 113<br />
10 SOFTWARE FÜR DEN EINSATZ IN DER SONDERPÄDAGOGISCHEN<br />
FÖRDERUNG........................................................................................................... 115<br />
10.1 Bewertung von Lernsoftware - Kriterien ........................................................ 115<br />
10.2 Die SODIS-Datenbank .................................................................................. 120<br />
11 GLOSSAR ZUR COMPUTERFACHSPRACHE....................................................... 121<br />
12 LITERATUR ............................................................................................................. 125<br />
13 ANBIETER UND ADRESSEN.................................................................................. 128<br />
14 FACHBERATER FÜR COMPUTER AN SONDERSCHULEN ................................. 130
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 5<br />
1 Einleitung<br />
In den letzen Jahren hat der Computer auch in den Sonderschule einen festen Platz im Spektrum der<br />
schulischen Medien erobert.<br />
Waren es anfangs vorwiegend Lern- <strong>und</strong> Übungsprogramme sowie einfachere Standardanwendungen<br />
wie z.B. die Textverarbeitung, so haben sich auf Gr<strong>und</strong> der Weiterentwicklung von Hard-<br />
<strong>und</strong> Software neue Nutzungsfelder für die Arbeit der Schule eröffnet. Anspruchsvolle <strong>und</strong><br />
bedienerfre<strong>und</strong>liche Werkzeuge zur Seitengestaltung mit Text <strong>und</strong> Grafik sowie zur Datenverwaltung,<br />
einfache Techniken der Erstellung digitaler Bilder mittels Scanner oder Digitalkamera,<br />
multimediale Software (Infotainment <strong>und</strong> Edutainment) <strong>und</strong> nicht zuletzt die <strong>Neue</strong>n <strong>Informations</strong>-,<br />
Kommunikations- <strong>und</strong> Publikationsformen des Internet bieten allen Sonderschulformen ein breites<br />
Spektrum, ihre Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler angemessen<br />
in die Nutzung der „<strong>Neue</strong>n <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong><br />
(IuK-Technologien)“ einzuführen,<br />
da die zukünftige Alltags- <strong>und</strong> Berufswelt in<br />
hohem Maße von diesen neuen Technologien geprägt<br />
sein wird.<br />
Eine sinnvolle Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten,<br />
aber auch ihre kritische Würdigung sind in den<br />
Bausteinen einer neuen Kompetenz, deren Bedeutung<br />
mit der der klassischen Kulturtechniken verglichen<br />
wird, festgehalten. Mit einem problemorientierten<br />
Einsatz der neuen Technologien bietet die schulische<br />
Medienerziehung, die nicht auf einzelne Schularten,<br />
Schulstufen oder Fächer bezogen ist, Raum zum Erwerb<br />
von Medienkompetenz. Sie kann auf jedem<br />
Bildungsniveau angemessen realisiert werden <strong>und</strong><br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong><br />
in der Sonderpädagogik<br />
Hilfsmittel<br />
beim Lernen<br />
<strong>und</strong> Üben<br />
Therapeutische<br />
<strong>und</strong><br />
prothetische Hilfe<br />
Hilfsmittel<br />
beim Informieren<br />
<strong>und</strong> Kommunizieren<br />
Schreiben,<br />
Verwalten,<br />
Steuern<br />
Gegenstand<br />
des Lernens<br />
Gestalten,<br />
Präsentieren,<br />
Publizieren<br />
erfolgt in Form von rezeptiver Nutzung, aktiver Gestaltung sowie kritischer Reflexion der neuen<br />
Technologien. Die Universalität der Technologie, die in Beruf <strong>und</strong> Alltag immer mehr Bereiche<br />
erobert, verleiht der Medienkompetenz hohe Bedeutung<br />
Bereits heute ist die Lebenswirklichkeit vieler Kinder stark durch elektronische Medien geprägt. Im<br />
praktischen Umgang mit technischen Geräten <strong>und</strong> elektronischen Spielen, in der Nutzung audiovisueller<br />
Medien erwerben sie Kompetenzen, die Erwachsene oft fremd <strong>und</strong> beängstigend anmuten.<br />
Das stellt die herkömmliche Rollenverteilung zwischen Lehrenden <strong>und</strong> Lernenden nicht selten in<br />
Frage <strong>und</strong> erfordert neue Konzepte der unterrichtlichen Umsetzung. Die Vielfalt der Medientechnologien<br />
eröffnet für viele Kinder verstärkt individuelle Lernangebote im schulischen <strong>und</strong> häuslichen<br />
Bereich mit neuen Perspektiven, ihr Lernen selbst zu organisieren, indem sie Lerninhalte <strong>und</strong><br />
Lernzeit verstärkt selbst bestimmen können. Dabei kommt auch der Förderung der sozialen<br />
Kompetenzen besondere Bedeutung zu. Diese müssen durch unmittelbare Kommunikation <strong>und</strong><br />
personales Zusammenwirken auch bei der Arbeit mit <strong>Neue</strong>n Technologien aufgebaut <strong>und</strong> gestärkt<br />
werden. Durch das Angebot einer elementaren Medienerziehung in der Sonderschule sollen die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler befähigt werden, sich innerhalb einer von Medien <strong>und</strong> Technologien<br />
bestimmten Welt selbstbewusst, eigenverantwortlich <strong>und</strong> produktiv verhalten zu können. Der<br />
Gefahr einer unreflektierten Technologiegläubigkeit muss vorgebeugt werden.
6<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Für die Schule sind die <strong>Neue</strong>n <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in starker<br />
Verzahnung Gegenstand von Lehren <strong>und</strong> Lernen sowie Hilfsmittel für den Unterricht. In bestimmten<br />
Sonderschulformen eröffnen die neuen Technologien mit der Entwicklung kompensatorischer<br />
Hilfsmittel darüber hinaus neue Perspektiven für das schulische Lernen <strong>und</strong> die individuelle<br />
Lebensgestaltung (z.B. mit Hilfe von Spracherkennung, Umfeldsteuerung). Der Einsatz dieser<br />
Hilfen verbessert die Perspektiven für das schulische Lernen, für die Teilhabe am gesellschaftlichen<br />
Leben sowie für die berufliche Qualifizierung.<br />
Dabei muss der Einsatz der <strong>Neue</strong>n Technologien gerade an den Sonderschulen in hohem Maße die<br />
Lebenssituation <strong>und</strong> das kommunikative Umfeld, die Bedürfnisse <strong>und</strong> Emotionen, den Wissens<strong>und</strong><br />
Erfahrungsstand sowie das Niveau von Urteilsfähigkeit <strong>und</strong> Wertebewusstsein bei Kindern <strong>und</strong><br />
Jugendlichen zum Ausgangspunkt der pädagogischen Auseinandersetzung machen.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 7<br />
2 Computereinsatz in der Sonderpädagogik im Rahmen der<br />
schulischen Medienerziehung<br />
2.1 Konzept einer Medienerziehung<br />
Nutzungskonzepte der <strong>Neue</strong>n <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong><br />
Den pädagogischen Gr<strong>und</strong>annahmen zur Entwicklung einer angemessenen Lernkultur in einer<br />
<strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> Wissensgesellschaft‘ liegen folgende drei Nutzungskontexte der <strong>Neue</strong>n<br />
<strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> (IuK-Technologien) in der Schule zu Gr<strong>und</strong>e:<br />
� <strong>Neue</strong> IuK-Technologien als innovative Werkzeuge zur Unterstützung von Lehr-Lernprozessen<br />
<strong>und</strong> des <strong>Informations</strong>managements an Schulen<br />
� <strong>Neue</strong> IuK-Technologien als Unterrichtsgegenstand zum Erwerb der notwendigen<br />
Medienkompetenz<br />
� <strong>Neue</strong> IuK-Technologien als wichtiger Anlass zur Entwicklung einer neuen Lernkultur<br />
Da <strong>Neue</strong> IuK-Technologien eine Auflösung räumlicher, zeitlicher <strong>und</strong> zum Teil auch körperlicher<br />
Beschränkungen ermöglichen, verändern sie damit die situativen Bedingungen unter denen<br />
Menschen miteinander kommunizieren <strong>und</strong> interagieren.<br />
In zunehmendem Maße werden deshalb auch Fertigkeiten <strong>und</strong> Fähigkeiten zur Kommunikation <strong>und</strong><br />
Kooperation im Netz notwendig. Für verschiedene Gruppen von behinderten Menschen eröffnen sie<br />
neue Perspektiven einer Normalität, von der sie sonst ausgeschlossen wären bzw. bisher sind (vgl.<br />
Kapitel 3).<br />
<strong>Neue</strong> IuK-Technologien als innovative Werkzeuge zur Unterstützung von Lehr-<br />
Lernprozessen <strong>und</strong> des <strong>Informations</strong>managements an Schulen<br />
Für den Lehr-Lernprozess liegt die Bedeutung der IuK-Technologien vor allem in den<br />
multimedialen Interaktions-, Präsentations- <strong>und</strong> Simulationsmöglichkeiten. Diese lassen sich im<br />
Unterricht sowohl als Offline-Lösungen (Programm auf dem Computer gespeichert) wie auch als<br />
Online-Lösungen (z.B. Lernaktivitäten in Computernetzen) oder in Kombination beider einsetzen.<br />
Die <strong>Neue</strong>n IuK-Technologien verbessern die Möglichkeiten der flexiblen Gestaltung von Lehr-<br />
Lernprozessen, da<br />
• das Lernen entweder nur textbasiert oder mit abgestufter Unterstützung durch multimediale<br />
Komponenten (Bild, Animation, So<strong>und</strong>, Video) ablaufen kann,<br />
• lernrelevante Interaktionen sowohl zwischen den Lernenden <strong>und</strong> dem System (Hard-/Software)<br />
als auch zwischen den Lernenden selbst – <strong>und</strong> dabei mit oder ohne Lehrende – stattfinden kann,<br />
• eine Zusammenarbeit zwischen den Lernenden <strong>und</strong> System, zwischen Lernenden <strong>und</strong><br />
Lernenden sowie zwischen Lernenden <strong>und</strong> Lehrenden zeitgleich oder zeitlich verschoben<br />
erfolgen kann.<br />
Neben den großen Möglichkeiten einer Unterstützung von Lehr-Lernprozessen stellen die <strong>Neue</strong>n<br />
IuK-Technologien - insbesondere durch Computernetze - auch ein immer wichtiger werdendes<br />
Werkzeug für die Schulverwaltung (vgl. Kapitel 7) <strong>und</strong> für die Öffentlichkeitsarbeit der Schulen<br />
dar, zumal die Öffnung von Schule ein zentrales Moment in der angestrebten Profilentwicklung von<br />
Schule ausmacht. Die <strong>Neue</strong>n IuK-Technologien bieten hier neue Perspektiven der Interaktion mit
8<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
externen Personen <strong>und</strong> Institutionen. Sie sind auch zur Realisierung der verstärkt geforderten<br />
Kooperation der Schulen mit außerschulischen Einrichtungen bis hin zu Betrieben eine<br />
unerlässliche Hilfe.<br />
<strong>Neue</strong> IuK-Technologien als Unterrichtsgegenstand zum Erwerb einer notwendigen<br />
Medienkompetenz<br />
Während es der Mediendidaktik (Medien als Mittel zur Optimierung von Lehr-Lernprozessen) mehr<br />
um einen funktionalen Ansatz von Unterricht geht, strebt die Medienerziehung eher eine Anleitung<br />
zur kritischen Reflexion von Medien, deren Inhalte <strong>und</strong> Nutzung an. Eine strenge Zuordnung zu<br />
jeweils einem der beiden Teile der Medienpädagogik hat sich aber für die praktische Arbeit<br />
(insbesondere im Rahmen der informationstechnischen Gr<strong>und</strong>bildung) nicht bewährt, denn eine<br />
kritische Auseinandersetzung mit Medieninhalten kann nur über die konkrete Nutzung derselben<br />
Medien erreicht werden. Erst in der Auseinandersetzung mit Multimedia <strong>und</strong> Telekommunikation<br />
sind deren Chancen <strong>und</strong> Grenzen beim verantwortungsbewussten Umgang mit Information <strong>und</strong><br />
Wissen - der Fähigkeit zu Wissensmanagement - erkennbar <strong>und</strong> in ihrer erzieherischen <strong>und</strong><br />
unterrichtlichen (didaktischen) Relevanz erfahrbar.<br />
Medienkompetenz als Ziel der Medienerziehung ist Erziehung zum verantwortungsvollen Umgang<br />
mit Information, Wissen <strong>und</strong> Medien <strong>und</strong> umfasst eine Vielzahl von Kenntnissen, Fähigkeiten <strong>und</strong><br />
Fertigkeiten, die sich mit den Komponenten Handhabungskompetenz, Auswahl- <strong>und</strong> Bewertungskompetenz,<br />
Urteils- <strong>und</strong> Reflexionskompetenz sowie Gestaltungskompetenz beschreiben lassen.<br />
Handhabungskompetenz<br />
Sie verlangt:<br />
• Erwerb notwendiger<br />
Bedienkenntnisse<br />
zum sachgerechten<br />
Einsatz<br />
• „<strong>Neue</strong> Lesefähigkeit“:<br />
Text + Bild +<br />
dynamische<br />
Vorgänge<br />
• Fähigkeit zur<br />
netzbasierten<br />
Kommunikation <strong>und</strong><br />
Kooperation<br />
Medienkompetenz als Konstrukt von<br />
Auswahl- <strong>und</strong><br />
Bewertungskompetenz<br />
Sie verlangt:<br />
• Kenntnis der medialen<br />
Angebotsvielfalt<br />
• Sich zurechtfinden in<br />
der Medienwelt<br />
• Zugang zu Computernetzen<br />
• Unterscheiden können<br />
zwischen<br />
Realität <strong>und</strong><br />
Virtualität<br />
• Informationen mit<br />
fehlendem Kontext<br />
interpretieren<br />
können<br />
Urteils- <strong>und</strong><br />
Reflexionskompetenz<br />
Sie verlangt:<br />
• Reflexion der<br />
gesellschaftlichen<br />
Folgen der „neuen<br />
Iuk-Technologien”<br />
• Auseinandersetzung<br />
mit der Frage, in<br />
welchem Verhältnis<br />
menschliche<br />
Intelligenz <strong>und</strong><br />
technische<br />
<strong>Informations</strong>verarbeitungzueinander<br />
stehen<br />
• Entwicklung<br />
ethischer Maßstäbe<br />
Gestaltungskompetenz<br />
Sie verlangt:<br />
• Kenntnis der<br />
Gestaltungsmöglichkeiten<br />
mit<br />
Multimedia <strong>und</strong><br />
Computernetzen<br />
• Kenntnis verschiedener<br />
Zeichensysteme<br />
• Auseinandersetzung<br />
mit anderen Nutzern<br />
• Entwicklung<br />
ästhetischer<br />
Maßstäbe<br />
Diese Teilkompetenzen müssen als integratives Prinzip in allen Fächern sowie in fachbezogenen<br />
<strong>und</strong> fächerübergreifenden Unterrichtsprojekte umgesetzt werden.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 9<br />
Dabei kann der Computer mit seinem breiten Leistungsspektrum bisher isolierte Medienarten<br />
verbinden <strong>und</strong> verstärkt zur Gestaltung eines selbstgesteuerten Lernens <strong>und</strong> zu mehr Interaktion <strong>und</strong><br />
Kommunikation zwischen Lernenden <strong>und</strong> Lehrenden beitragen.<br />
<strong>Neue</strong> IuK-Technologien als wichtiger Anlass zur Entwicklung einer neuen Lernkultur<br />
Die Arbeit mit den <strong>Neue</strong>n IuK-Technologien entfernt sich mehr <strong>und</strong> mehr von der bisherigen traditionellen<br />
Lehr-/Lernphilosophie, dem Primat der Instruktion, d. h. der Wissensvermittlung <strong>und</strong> nähert<br />
sich verstärkt einer konstruktivistischen Lehr-/Lernphilosophie, die vom Primat der Konstruktion,<br />
d.h. der Wissensaneignung ausgeht, an. Ein so ausgerichtetes Lernen basiert verstärkt auf<br />
• selbstbestimmtem <strong>und</strong> entdeckendem Lernen,<br />
• handlungsorientiertem Unterricht,<br />
• Lernen in fächerübergreifenden Projekten,<br />
• kritischer Betrachtung von greifbaren Produkten aus selbstständiger Arbeit.<br />
Hierbei treten Lehren <strong>und</strong> Wissensvermittlung hinter den Lernprozessen der Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler zurück <strong>und</strong> den Lehrenden wächst verstärkt die Aufgabe zu, Problemsituationen zu<br />
arrangieren <strong>und</strong> Werkzeuge als Problemlöser für den selbsttätig Lernenden zur Verfügung zu<br />
stellen. Der Lerner konstruiert so sein Wissen selbst <strong>und</strong> setzt dieses in Verbindung zu seinem<br />
Handeln.<br />
Das heißt mit anderen Worten, dass die Einführung der <strong>Neue</strong>n IuK-Technologien an den Schulen<br />
nicht mit einem additiven Ansatz verb<strong>und</strong>en sein darf, sondern mit einem neuen Verständnis von<br />
Lernen <strong>und</strong> Lehren verknüpft werden sollte. Da die <strong>Neue</strong>n IuK-Technologien nicht einfach dem<br />
nach traditioneller Lehr-Lernauffassung verb<strong>und</strong>enen Unterricht angefügt werden können, sind sie<br />
Impuls für einen Wandel dieser ineffektiv gewordener Unterrichtsformen. Solch ein gravierender<br />
Wandel ist nicht in kurzer Zeit umsetzbar, sondern nur über Zwischenschritte erreichbar. Ein<br />
solcher könnte mit dem ‚Leitkonzept der Problemorientierung‘ - einer konzeptionellen Brücke<br />
zwischen der traditionellen <strong>und</strong> der konstruktivistischen Lehr-/Lernphilosophie - beschrieben<br />
werden.<br />
authentischer<br />
Kontexte<br />
Authentische Kontexte<br />
sind dem realen Leben<br />
entnommen <strong>und</strong><br />
ermöglichen den Umgang<br />
mit Problemen<br />
<strong>und</strong> Situationen des<br />
Alltags.<br />
Sie sind motivierend,<br />
weil sie Interesse <strong>und</strong><br />
Betroffenheit<br />
erzeugen.<br />
Problemorientiertes Lernen <strong>und</strong> Lehren anhand<br />
multipler Kontexte<br />
Das Einbetten<br />
spezifischer Inhalte in<br />
verschiedene<br />
Situationen fördert<br />
flexiblen Umgang mit<br />
Gelerntem <strong>und</strong><br />
unterstützt die<br />
Transferbildung.<br />
sozialer<br />
Kontexte<br />
Soziale Arrangements<br />
fördern kooperatives<br />
Lernen <strong>und</strong><br />
Problemlösen.<br />
Soziale Kontexte<br />
werden auch durch<br />
Öffnen der Schule<br />
nach außen realisiert.<br />
instruktionaler<br />
Kontexte<br />
Der Lehrende<br />
modelliert<br />
Lernstationen, er leitet<br />
an, unterstützt <strong>und</strong><br />
berät, wo es<br />
erforderlich ist.<br />
(adaptive Instruktion)<br />
Vor allem Simulationen <strong>und</strong> Planspiele eignen sich besonders gut für dieses Konzept eines<br />
problemorientierten Lernens, weil entsprechende Computerprogramme (z.B. Haushaltsführung,
10<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
SimCity) authentische Situationen bzw. realitätsnahe Probleme darstellen <strong>und</strong> die Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler zur aktiven <strong>und</strong> konstruktiven Bearbeitung herausfordern. Die Lernenden können dabei<br />
selbst in Systeme eingreifen bzw. Haushaltspläne manipulieren <strong>und</strong> anschließend per Bildschirm<br />
die Resultate ihres Eingreifens unmittelbar erleben.<br />
Auch das Arrangieren gemeinsamer Lernsituationen, die es den Lernenden erlauben, Wissen zu<br />
einem bestimmten Bereich - in Abstimmung miteinander - zu erarbeiten, ist notwendig. Zentraler<br />
Ausgangspunkt ist dabei vor allem, dass Lernende in ‚Lerngemeinschaften‘ gemeinsame Produkte<br />
(z.B. Texte, Animationen) erstellen <strong>und</strong> Informationen eben nicht nur rezipiert, sondern produziert<br />
<strong>und</strong> auch gegenseitig kritisiert werden. Dazu kommen netzbasierte Formen des Lernens, die die<br />
Grenzen des eigenen Klassenzimmers überschreiten <strong>und</strong> die Bildung virtueller Lerngemeinschaften<br />
anregen.<br />
Solche problemorientierten <strong>und</strong> mediengestützte Unterrichtsformen erfordern vom Lehrenden die<br />
Wahrnehmung einer anderen, einer erweiterten Rolle, in der er nicht mehr nur Wissensvermittler,<br />
sondern auch Anreger, Gestalter <strong>und</strong> Unterstützer von Lernprozessen in multimedialer Umgebung<br />
ist. Im Vordergr<strong>und</strong> steht nicht die modernste Hardwareausstattung mit einem Software-Pool<br />
inklusive einem Internetanschluss, sondern die Entwicklung eines Unterrichtskonzepts, das die<br />
Möglichkeiten der IuK-Technologien nutzt <strong>und</strong> problemorientierten Unterricht zulässt.<br />
Anhand von Bausteinen wird nachfolgend beschrieben, wie die IuK-Technologien im Unterricht<br />
umgesetzt werden können. In Form eines Strukturrasters werden konkrete Anregungen zur<br />
unterrichtlichen Umsetzung dargestellt. Darin erscheint die Urteils- <strong>und</strong> Reflexionskompetenz<br />
nicht, da sie gerade im Bereich der Sonderpädagogik in hohem Maße abhängig vom aktuellen<br />
unterrichtlichen Kontext ist.<br />
2.2 Lernziel Medienkompetenz - neun Bausteine<br />
Erste Erfahrungen mit dem Computer<br />
Die Kinder bringen im Hinblick auf die Computernutzung sehr unterschiedliche Vorerfahrungen<br />
mit in die Schule. Das Spektrum reicht von „... noch nie einen Computer bedient“ bis zur<br />
Verfügbarkeit eines leistungsfähigen Multimedia-Computers mit Internetzugang. Die Gründe<br />
hierfür liegen u.a. in der Einstellung der Eltern <strong>und</strong> der ökonomischen Situation der Familie. Aber<br />
auch in der Nutzung des Computers in der Freizeit gibt es erhebliche Unterschiede. Insbesondere<br />
bei sozial benachteiligten Jugendlichen überwiegt der Einsatz von Computerspielen. Demgegenüber<br />
werden die kreativen Möglichkeiten des Computers als Gestaltungswerkzeug hier wenig genutzt.<br />
Vor dem systematischen Einsatz des Computers als Werkzeug zum Schreiben <strong>und</strong> Lernen ist es<br />
Aufgabe insbesondere der Sonderschule, den Kindern eine dem Alter entsprechende Hinführung zu<br />
ermöglichen. Diese soll auch das Kind erreichen, das bisher noch keinen Computer bedienen<br />
konnte. Das verlangt ein pädagogischen Anforderungen entsprechendes Angebot an altersgemäßen,<br />
ansprechenden <strong>und</strong> der Erlebniswelt der Kinder angemessenen Programmen.<br />
Was kann mit Hilfe dieser Programme gelernt werden?<br />
Beim spielerischen Umgang mit diesen - sehr einfach zu bedienenden - Programmen erwerben die<br />
Kinder erste Bedienkompetenzen indem sie den Computer einschalten, das gewünschte Programm<br />
starten <strong>und</strong> sich nicht selten dort schon mit Namen oder Symbol anmelden müssen. Einfache<br />
Bedienung der Tastatur <strong>und</strong> Umgang mit der Maus, Beenden von Programmen <strong>und</strong>
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 11<br />
Programmteilen, Steuerung von Figuren oder Fahrzeugen auf dem Bildschirm, Verständnis der<br />
Funktionen verschiedener Tasten (z.B. Enter, Pfeiltasten, ESC-Taste) bzw. Symbolschaltflächen,<br />
einfache Maussteuerung, u.a. beim Malen, bei Puzzle-, Memory-, Fang- <strong>und</strong> Stapelspielen.<br />
Oft bieten diese Programme in kindgemäßer Form gr<strong>und</strong>legende Bedienfunktionen an <strong>und</strong> fördern<br />
so ein intuitives Erschließen dieser Funktionen beim spielerischen Umgang mit den Programm.<br />
Diese Erfahrungen erleichtern den Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern später das Erschließen der<br />
entsprechenden Funktionen bei Standard- oder Lernprogrammen.<br />
Einfaches Schreiben<br />
Für das erste Schreiben am Computer eignet sich z.B. das Programm „Schreiben“ des Budenberg-<br />
Programmpaketes. Ähnliche Module finden sich auch in anderen Programmen, z.T. auf Gr<strong>und</strong> der<br />
Windows-Integration mit erweiterten Funktionen. Spielerische Programme bieten hier meist eine<br />
Auswahlmöglichkeiten von Buchstaben <strong>und</strong> Wörtern am Bildschirm an, wobei diese nicht selten<br />
auch symbolisch dargestellt werden.<br />
Auch Standardsoftware wie Textverarbeitungen lassen sich wegen der sehr flexiblen Möglichkeiten<br />
der Anpassung auf einfachstes Bedienniveau anpassen, so dass nur die wichtigsten Funktionen als<br />
große Symbolschaltflächen zur Verfügung stehen.<br />
Das Softwarespektrum, das für diese Ziele eingesetzt werden kann, ist groß. Das folgende Raster<br />
„Software zwischen Spielen <strong>und</strong> Lernen“ strukturiert die komplexe Softwaregruppe. Dabei ist das<br />
Raster nicht auf den hier angesprochenen Altersbereich beschränkt. Schulrelevante Programme zu<br />
den einzelnen Erscheinungsformen der Software sind den Beschreibungen angefügt:<br />
Erscheinungsformen<br />
der Software<br />
Lehrprogramme<br />
Teachsoft<br />
Werkzeuge<br />
Toolsoft<br />
<strong>Informations</strong>systeme<br />
Infosoft<br />
Education<br />
Lernen <strong>und</strong> Bildung in<br />
schulischen Kontexten<br />
Lernsoftware; Vermittlung<br />
von Wissen, Einsichten,<br />
Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeit<br />
mit lehrorientiertem, vorgegebenem<br />
Lernweg<br />
(tutorielle Programme <strong>und</strong><br />
„Trainer“)<br />
Programme zur eigenständigen<br />
Erstellung von<br />
Produkten in schulischen<br />
<strong>und</strong> professionellen<br />
Kontexten (z.B. Textverarbeitung,<br />
Grafik, DTP).<br />
Selbständige Abfrage von<br />
Informationen <strong>und</strong><br />
Wissensbeständen aus<br />
schulischen Lehrbereichen;<br />
professionelle<br />
Expertensysteme <strong>und</strong><br />
Datenbanken.<br />
Edutainment<br />
Verbindung von Unterhaltung<br />
<strong>und</strong> Lernen<br />
Teach-Tale-Tainment:<br />
Erwerb von Fähigkeiten<br />
allgemeiner Art durch<br />
unterhaltsame Software<br />
mit lehrorientiertem,<br />
vorgegebenem Lernweg<br />
(z.B. „Living Books“,<br />
„Löwenzahn“).<br />
Tooltainment; niederschwelligeAnwendungsprogramme<br />
ohne professionellenAnwendungsbezug.<br />
Herstellung<br />
kreativer Objekte (z.B.<br />
„Creativ Writer“*, Schreibwerkzeuge<br />
in Kinderprogrammen).<br />
Infotainment: unterhaltsame<strong>Informations</strong>systeme<br />
zu interessierenden<br />
Bereichen (z.B.<br />
Musik, Dinos). Multi-<br />
mediale Struktur der<br />
Software.<br />
(z.B. „Mein erstes<br />
Lexikon“)<br />
Entertainment<br />
Unterhaltung, Spaß,<br />
Zeitvertreib<br />
Den Spielen<br />
vorgeschaltete tutorielle<br />
Spielphasen, um das Spiel<br />
zu verstehen <strong>und</strong> das<br />
spielerische Handeln zu<br />
trainieren.<br />
Programme zur Erstellung<br />
eigener Spiele („Game<br />
Creater“).<br />
Dem Spiel zugeordnete<br />
<strong>Informations</strong>systeme wie<br />
Datenbanken <strong>und</strong> Bibliotheken,<br />
um das Spiel<br />
besser handhaben zu<br />
können.<br />
(z.B. Wortlisten, Bilderliste)
12<br />
Simulationsprogramme<br />
Simsoft<br />
Spielprogramme<br />
Gamesoft<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Simulationen, um Einsichten<br />
in funktionale<br />
Abläufe zu gewinnen, die<br />
schulrelevant bzw. ausbildungsrelevant<br />
sind; Veränderungsmöglichkeiten<br />
bei<br />
den Parametern.<br />
Lernspiele, um spezielle<br />
Kenntnisse <strong>und</strong><br />
Fähigkeiten zu erwerben;<br />
Inhalte <strong>und</strong> Dramaturgie<br />
des Spiels sind<br />
Transportmittel.<br />
(aus: Handbuch Medien: Computerspiele, s.u.)<br />
Simtainment: Simulationen<br />
mit spielerischer<br />
Dramaturgie zu<br />
lernrelevanten Inhalten<br />
bzw. Kenntnisbereichen<br />
(z.B. Städtebau,<br />
Besiedelung, Ameisen).<br />
Skilltainment:<br />
Unterhaltsame Spiele, die<br />
auch allgemeine<br />
Kenntnisse <strong>und</strong><br />
Fähigkeiten fördern (z.B.<br />
„Colonization“).<br />
Simulationsspiele mit unterhaltsamen<br />
Inhalten <strong>und</strong><br />
spannender Dramaturgie<br />
(z.B. Kampfflugzeuge,<br />
Schlachten, Vereinsfußball,Wirtschaftssimulationen).<br />
Computer- <strong>und</strong><br />
Videospiele mit vorrangig<br />
unterhaltendem Charakter.<br />
Programme zur unterrichtlichen Umsetzung (Beispiele)<br />
Lernprogramme<br />
• Budenberg-Software<br />
• H13 <strong>und</strong> S13 (SoWoSoft)<br />
• Wahrnehmung (Eugen Traeger Verlag)<br />
Edutainment-Programme<br />
• Löwenzahn I-III (terzio)<br />
• Janosch: Riesenparty für den Tiger (Navigo)<br />
• Spielgeschichten (z.B. Max <strong>und</strong> Marie gehen einkaufen, Tivola)<br />
Werkzeugprogramme<br />
• Malen, Schreiben, Spielen<br />
Auch wenn Kriterienkataloge zur Beurteilung von Edutainment-Software erstellt worden sind, so<br />
bleibt doch jedem Pädagogen die Entscheidung, welche der Kriterien für seine Arbeit mit den<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern wichtig <strong>und</strong> welche weniger wichtig ist, nicht erspart. Untersuchungen<br />
mit Kindergruppen brachten selbst bei hervorragend beurteilter Software ernüchternde Ergebnisse<br />
zutage: Geringe Lerneffekte <strong>und</strong> bald nachlassende Motivation. Auch hier wird der Wert einer<br />
Software neben den inneren Qualitäten auch durch die pädagogische Situation geprägt, in der sie<br />
eingesetzt wird.<br />
Weitere Informationen zum Thema:<br />
Jürgen Fritz, Wolfgang Fehr (Hrsg.): Handbuch Medien: Computerspiele, B<strong>und</strong>eszentrale für politische<br />
Bildung, Bonn 1997
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 13<br />
Strukturraster Erste Erfahrungen mit dem Computer<br />
STUFE Lerninhalte<br />
Handhabungskompetenz<br />
Unterstufe − Die Maus handhaben:<br />
Bewegen<br />
(Koordination von<br />
visueller Wahrnehmung<br />
<strong>und</strong> Feinmotorik),<br />
Klicken (Maustaste<br />
ohne Mausbewegung<br />
drücken),<br />
Ziehen (Mausbewegung<br />
bei gedrückter<br />
Maustaste)<br />
− Die wichtigsten<br />
Funktionstasten<br />
(Pfeiltasten, Enter-,<br />
Leer- <strong>und</strong> ESC-Taste)<br />
handhaben<br />
− Einfache Interaktionsfunktionenhandhaben<br />
(Schaltflächen erkennen,<br />
optische <strong>und</strong><br />
akkustische Informationen<br />
verstehen)<br />
− Erste Eingabe von<br />
Wörtern <strong>und</strong> Zahlen<br />
Auswahl- <strong>und</strong><br />
Bewertungskompetenz<br />
− Sich für ein<br />
Programmteil bzw.<br />
Werkzeug innerhalb<br />
eines Programms<br />
entscheiden<br />
Gestaltungskompetenz<br />
− Gestaltungsmöglichkeiten<br />
eines<br />
Programms für Bild<br />
<strong>und</strong> Text nutzen
14<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Schreiben <strong>und</strong> Texte gestalten (Textverarbeitung)<br />
Vorbemerkungen<br />
Mit der massenhaften Verbreitung der elektronischen Textverarbeitung wurde ein neues Kapitel der<br />
Textproduktion aufgeschlagen. Der Prozess des Schreibens hat sich nachhaltig verwandelt, können<br />
doch Texte relativ einfach erstellt, verändert, in den unterschiedlichsten Formen gestaltet <strong>und</strong><br />
ausgegeben werden.<br />
Der Einsatz des Computers als Gestaltungswerkzeug ist am weitesten im Bereich der<br />
Textproduktion verbreitet. Für viele Nutzer war <strong>und</strong> ist der PC vornehmlich oder gar ausschließlich<br />
eine „Textmaschine“, mit der man Texte schreiben <strong>und</strong> gestalten kann. Erst langsam wandelt sich<br />
diese Einstellung hin zu einer größeren Anwendungsvielfalt des PCs.<br />
Auch Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler entdecken zunehmend die kommunikativen Möglichkeiten der<br />
Textverarbeitung <strong>und</strong> erfahren mehr Freude am eigenen Schreiben. Schon bescheidene (Schul-)<br />
Softwareprogramme haben kleine Editoren (einfache Schreibprogramme), mit deren Hilfe Texte<br />
eingegeben werden können, um z.B. Fragen zu beantworten, die das Programm stellt. Insbesondere<br />
beim Einsatz von Deutsch- bzw. Rechtschreibprogrammen werden Tastatur <strong>und</strong> Bildschirm wie<br />
eine Schreibmaschine mit Display benutzt.<br />
Die Schule hat nun die Aufgabe, an unterrichtspraktischen Beispielen handlungsorientiert <strong>und</strong> unter<br />
Beachtung der individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler zu vermitteln bzw.<br />
zu erörtern:<br />
• Gr<strong>und</strong>legende Fertigkeiten im Umgang mit Textverarbeitungsprogramme,<br />
• Spezifische Aspekte der Nutzung der Textverarbeitung in Alltag <strong>und</strong> Beruf,<br />
• Gesellschaftliche Auswirkungen der elektronischen Textverarbeitung.<br />
Neben der standardmäßigen Nutzung der Textverarbeitung, ggf. mit individueller Konfiguration der<br />
Symbolschaltflächen, können vorstrukturierte<br />
Dokumente, in die z.B. beim Lebenslauf nur noch<br />
die individuellen Angaben eingefügt werden<br />
müssen, angeboten werden. Diese Arbeitsweise<br />
entlastet den Schüler von der – recht anspruchsvollen<br />
– Aufgabe der Seitengestaltung, so dass er<br />
sich auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren kann.<br />
Als Techniken hierzu können die Tabellen- oder<br />
die Formularfunktion genutzt werden.<br />
Y Tipps für den Unterricht<br />
Im Rahmen dieser unterschiedlichen Ansätze<br />
können z.B. vielfältige Schreibanlässe genutzt<br />
werden:<br />
- Anlegen eines persönliches Datenblattes,<br />
- Briefe,<br />
- Einladungen,
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 15<br />
- Anfertigen von Bewerbung <strong>und</strong> Lebenslauf,<br />
- Schreiben <strong>und</strong> Gestalten unterrichtlicher Texte,<br />
- Anlegen von Textsammlungen,<br />
- Erstellen von Berichten über Praktikum, Klassenfahrt, Projekte,<br />
- Gestalten einer Schülerzeitung.<br />
Dabei können in unterschiedlichem Umfang erprobt <strong>und</strong> genutzt werden:<br />
- die Rechtschreibprüfung zur Verbesserung der Orthografie,<br />
- das Synonymwörterbuch bei der Textproduktion (Thesaurus),<br />
- der experimentelle Umgang mit einfachen Techniken der Textgestaltung,<br />
- Einbinden grafischer Elemente (aus Clipart-Sammlung, mit Hilfe von Grafik-<br />
/Zeichenprogramm erstellt, gescannte Vorlage, digitale Fotos),<br />
- die Handhabung <strong>und</strong> Umgang mit dem Drucker <strong>und</strong> Scanner,<br />
- die Übernahme von Texten <strong>und</strong> Bildern aus digitalen Vorlagen (CD-Rom, Internet), soweit<br />
urheberrechtlich möglich,<br />
- die Fernübertragung von Texten (E-Mail).<br />
Über die selbstverständliche Nutzung der permanent in der Klasse zur Verfügung stehende<br />
„Textmaschine“ hinaus ergeben sich besondere fachliche Bezüge zum Unterricht in Fächern wie<br />
Deutsch (Textproduktion <strong>und</strong> -gestaltung), Kunst (Text-Bild-Bearbeitung, Einladungen,<br />
Schülerausweis, Visitenkarten, Schülerzeitung, Plakate für Schulfest o.Ä.) oder Arbeitslehre<br />
(Veränderung von Büroberufen).
16<br />
Strukturraster Textverarbeitung<br />
STUFE Lerninhalte<br />
Unterstufe − Schreiben von Texten<br />
im Kontext altersgerechter<br />
Lern- <strong>und</strong><br />
Spielprogramme<br />
Mittelstufe − Schreiben <strong>und</strong><br />
Gestalten<br />
unterrichtlicher Texte<br />
Oberstufe − Schreiben, Gestalten<br />
<strong>und</strong> Verwalten<br />
unterrichtlicher Texte<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Handhabungskompetenz<br />
− Tastatur kennen<br />
lernen <strong>und</strong> bedienen<br />
− Texte eingeben<br />
− Texte korrigieren<br />
− Textteile markieren<br />
− Textteilen mit<br />
Symbolleisten Gestaltungsmerkmale<br />
zuweisen (Schriftart<br />
bzw. -größe, fett,<br />
unterstrichen, kursiv,<br />
Ausrichtung,<br />
Aufzählung)<br />
− Schriftarten <strong>und</strong><br />
Schriftgröße<br />
− Texte speichern <strong>und</strong><br />
laden<br />
− Texte drucken<br />
Textverarbeitung<br />
− Ausschneiden,<br />
Kopieren, Einfügen<br />
von Textteilen<br />
− Einfügen von<br />
Grafiken / Clipart<br />
− Suchen / Ersetzen<br />
Dokumentenverwaltung<br />
− Verzeichnis anlegen<br />
<strong>und</strong> benennen<br />
− Dateien sinnvoll<br />
benennen<br />
− Dateien kopieren /<br />
verschieben<br />
− Datei auf Diskette<br />
speichern <strong>und</strong> auf<br />
anderen Computer<br />
übertragen<br />
− Dateien im Netz<br />
übertragen (vernetzte<br />
Computer, E-Mail)<br />
Auswahl- <strong>und</strong><br />
Bewertungskompetenz<br />
− Handschriftlich <strong>und</strong><br />
mit Hilfe des<br />
Computers erstellte<br />
Texte vergleichen<br />
− Einschätzen können,<br />
wo der Einsatz von<br />
Korrektur-, Änderungs-<br />
<strong>und</strong> Speicherungsmöglichkeit<br />
sinnvoll ist<br />
− Wirkung<br />
unterschiedlich<br />
gestalteter Texte<br />
erkennen<br />
− Wirkung<br />
unterschiedlich<br />
gestalteter Texte<br />
begründen <strong>und</strong><br />
beurteilen<br />
− Vorteile der<br />
ökonomischen<br />
Verwaltung der<br />
Dokumente erkennen<br />
Gestaltungskompetenz<br />
− Abstände zwischen<br />
Buchstaben, Wörtern<br />
<strong>und</strong> Zeilen beachten<br />
− Texten ästhetisch<br />
<strong>und</strong> sachgerecht<br />
gestalten<br />
− Raumaufteilung<br />
− Einsetzen weiterer<br />
grafischer<br />
Gestaltungsmöglichkeiten<br />
− Grafiken in Text<br />
einsetzen<br />
− verschiedene<br />
Textformen (z.B.<br />
Sachtext, Brief,<br />
Gedicht, Lebenslauf,<br />
Bewerbung,<br />
Einladung,<br />
Fragebogen etc.)<br />
sachgerecht<br />
gestalten
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 17<br />
Mit Texten <strong>und</strong> Bildern gestalten <strong>und</strong> präsentieren<br />
Desktop-Publishing<br />
Unter Desktop-Publishing versteht man das Entwerfen von Seiten mit Hilfe spezieller<br />
Computerprogramme. Desktop-Publishing-Programme (DTP) bieten gegenüber Textverarbeitungsprogrammen<br />
größere Gestaltungsfreiheit <strong>und</strong> -flexibilität, sind aber in der Regel auch schwieriger<br />
zu bedienen.<br />
DTP-Programme sind in Ihrem Konzept dem Arbeitstisch<br />
des traditionellen „Layouters“ nachempf<strong>und</strong>en.<br />
Auf der Arbeitsfläche werden die Bestandteile der<br />
Publikation (Texte, Grafiken) zunächst abgelegt <strong>und</strong><br />
dann durch Verschieben, Skalieren, Zuschneiden auf der<br />
Seite zum endgültigen Layout angeordnet.<br />
Texte bzw. Grafiken befinden sich immer in Rahmen.<br />
Kurze Texte wie etwa Überschriften werden unmittelbar<br />
in einen Rahmen eingegeben, umfangreichere Texte<br />
können mit einem Textverarbeitungsprogramm<br />
geschrieben <strong>und</strong> korrigiert <strong>und</strong> anschließend in einen<br />
Textrahmen importiert werden. Bilder oder Grafiken<br />
entstammen entweder Clipart-Sammlungen, werden mit<br />
Hilfe von Mal- oder Zeichenprogrammen selbst erstellt<br />
<strong>und</strong> in geeigneter Form abgespeichert, mittels Scanner von Bildvorlagen eingescannt, mit einer<br />
digitalen Kamera aufgenommen oder aus Web-Seiten auf dem lokalen PC abgespeichert.<br />
Die freie Anordnung der Rahmen macht das gestalterische Prinzip der DTP-Programme aus.<br />
Rahmen können sich transparent oder überdeckend überlagern, Textrahmen können verb<strong>und</strong>en<br />
werden <strong>und</strong> so einen fortlaufenden Textfluss über mehrere Seiten realisieren. Text kann an den<br />
Konturen einer Grafik ausgerichtet werden (Kontursatz). Besonders mehrseitige Publikationen<br />
lassen sich mittels DTP-Programmen komfortabel <strong>und</strong><br />
in hoher Qualität realisieren.<br />
DTP-Programme lassen sich sehr gut ergänzend zur<br />
Textverarbeitung einsetzen, indem die Texte mit der<br />
Textverarbeitung geschrieben <strong>und</strong> überarbeitet werden.<br />
Dann werden sie per Dateiimport bzw. über die<br />
Zwischenablage in einen Textrahmen des DTP-Programmes<br />
übernommen. Obwohl auch die DTP-Programme<br />
die gr<strong>und</strong>legenden Textverarbeitungsfunktionen<br />
bieten, ist diese Arbeitsweise sinnvoll, da die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler weitgehend mit der vertrauteren<br />
Textverarbeitung arbeiten können. Sind die Computer<br />
vernetzt, lassen sich bei dieser Arbeitsweise auch<br />
einfache Formen der Datenübertragung realisieren. Bei<br />
nicht vernetzten Computern erfolgt der Datentransfer<br />
mittels Diskette.
18<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Dieselbe Arbeitsstruktur lässt sich bei den Grafiken realisieren. Sie werden an einem Computer<br />
erstellt, bzw. gescannt <strong>und</strong> nachbearbeitet, dann auf den DTP-Computer übertragen <strong>und</strong> ins Layout<br />
eingefügt.<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler von Förderschulen nutzen nur die Gr<strong>und</strong>funktionen eines DTP-<br />
Programmes sowie deren gestalterische Möglichkeiten (z.B. Zierrahmen, Grafikobjekte etc.). Auch<br />
dies stellt schon recht hohe Anforderungen, die nicht von allen Schülern bewältigt werden können.<br />
Der kombinierte Einsatz von DTP-Programm, Textverarbeitung <strong>und</strong> Grafikprogramm ermöglicht<br />
bei der Realisierung von Layout-Projekten jedoch durch arbeitsteiliges Vorgehen die angemessene<br />
Einbeziehung aller Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler.<br />
Eine angemessene Kombination von Computerlayout <strong>und</strong> Klebemontage ist einem ausschließlichen<br />
Computerlayout vorzuziehen. Die Erfahrung, dass der Computer nicht immer das optimale<br />
Werkzeug zur Lösung einer bestimmten Aufgabe ist, gehört auch zu den gr<strong>und</strong>legenden Zielen<br />
einer Computergr<strong>und</strong>bildung.<br />
Da dieser Einsatzbereich als Ergänzung zu Standardanwendungen wie Textverarbeitung <strong>und</strong><br />
grafische Gestaltung anzusehen ist, werden die Inhalte nicht im Strukturraster aufgearbeitet.<br />
Vielmehr muss die Lehrkraft anhand der pädagogischen Möglichkeiten entscheiden, ob sie solche<br />
Programme einsetzt <strong>und</strong> in welchem Umfange die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler diese nutzen.<br />
Wie bei anderen Programmen zur grafischen Gestaltung werden die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler auch<br />
hier oft von den grafischen Möglichkeiten stark inspiriert. Das führt nicht selten zu grafischer<br />
Überladung der Publikationen. Nach einer ersten Erk<strong>und</strong>ungsphase sollte auf eine ansprechende<br />
grafische Gestaltung hingearbeitet werden. Die Gestaltungsideen sollen nicht von den<br />
Möglichkeiten des Computers diktiert werden, sondern aus der Gruppe kommen <strong>und</strong> mit dem<br />
Werkzeug Computer realisiert werden. Dazu ist eine Übersicht der wichtigsten Realisierungsmöglichkeiten<br />
erforderlich, sowie die Fähigkeit, diese umzusetzen. Die Gestaltungsidee sollte<br />
jedoch zunächst auf dem Papier skizziert werden, um dann am PC die Umsetzung zu erfahren.<br />
Die Programme Microsoft Publisher 98/2000 (für Windows 95/98/NT) sind in ihrem<br />
Funktionsumfang für die hier beschriebenen Einsatzbereiche vollkommen ausreichend, preiswert<br />
<strong>und</strong> relativ einfach zu bedienen. Sie bieten zudem interessante Optionen wie u.a. Erstellen von<br />
Web-Seiten, Drucken von Publikationen als Broschüre, Drucken von Faltkarten. Wesentlich teurer<br />
sind die Programme, die auch von professionellen Grafikern genutzt werden wie etwa Pagemaker,<br />
InDesign <strong>und</strong> QuarkExpress. Sie können für die ambitionierte Lehrkraft von Interesse sein.<br />
Computerpräsentationen<br />
Zu den modernen Publikationsformen zählt heute auch die Bildschirmpräsentation. Sie wird<br />
eingesetzt zur optischen Unterstützung von Vorträgen wie auch zur Präsentation geeigneter Inhalte<br />
bei Publikumsveranstaltungen wie Messen oder Ausstellungen. Nicht zuletzt die starke grafische<br />
Orientierung mit meist nur geringem Textanteil macht diese Darbietungsform für den Bereich der<br />
Sonderschulen interessant. Da die Präsentation zudem mit aufgenommenen Tondokumenten sowie<br />
Video-Sequenzen ergänzt werden kann, bietet das Konzept einen interessanten Zugang zum Bereich<br />
Multimedia.<br />
Erforderlich ist neben einem leistungsfähigen PC ein geeignetes Präsentationsprogramm, das zum<br />
Lieferumfang gängiger Office-Pakete gehört (z.B. PowerPoint/Microsoft Office). Die Verwendung<br />
von Vorlagen <strong>und</strong> Standardseitenelementen ermöglicht ein durchgängiges <strong>und</strong> harmonisches<br />
Erscheinungsbild der einzelnen Seiten (Folien), erleichtert aber auch die Erstellungsarbeit.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 19<br />
Erstellte Präsentationen können auf Papier oder Folien ausgedruckt oder aber als Bildschirmpräsentation<br />
aufbereitet werden. Bei einer Bildschirmpräsentation erscheint die Folienserie am<br />
Bildschirm <strong>und</strong> der Ablauf kann mit vorher festgelegten Darbietungszeiten oder aber per Mausklick<br />
gesteuert werden. Steht ein leistungsfähiger Datenprojektor (LCD-Display oder Beamer) zur<br />
Verfügung, kann die Präsentation auch einem größeren Publikum vorgeführt werden.<br />
Für anspruchsvollere <strong>und</strong> komplexere Präsentationen werden leistungsfähigere Programme<br />
angeboten, die auf Gr<strong>und</strong> ihrer einfachen Bedienung ebenfalls in der Schule eingesetzt werden<br />
können (z.B. Mediator).<br />
Y Tipps für den Unterricht<br />
DTP-Projektskizze „Trierer Sehenswürdigkeiten“<br />
Erstellen von <strong>Informations</strong>seiten über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Trier<br />
- Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler sammeln Informationen <strong>und</strong> schreiben Texte mit der<br />
Textverarbeitung (z.B. Works),<br />
- Texte werden überarbeitet,<br />
- Sammeln von Bildmaterial, Fotospaziergang zu den Bauwerken,<br />
- Suchen nach Bildmaterial im Internet (bei Thema mit geografischer Nähe nicht erforderlich),<br />
- Einscannen der Fotos,<br />
- Seitenlayout skizzieren (ungefähres Erscheinungsbild der Seite),<br />
- Importieren der Texte in das DTP-Dokument,<br />
- Importieren der Grafiken,<br />
- Seite mit dem DTP-Programm gestalten,<br />
- Publikation ausdrucken <strong>und</strong> als Broschüre falten.<br />
Anlässe für Computerpräsentationen<br />
- Bericht über eine Klassenfahrt,<br />
- Rückblick auf das Schuljahr bei der Entlassung,<br />
- Aufbereitung eines Sachthemas im Rahmen eines Schülerwettbewerbes,<br />
- Projektdokumentation,<br />
- Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler stellen sich vor,<br />
- Bildbericht über eine Projektwoche,<br />
- Selbstdarstellung der Schule (z.B. bei einem Infostand).
20<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Informationen speichern <strong>und</strong> verwalten (Datenbanken)<br />
Vorbemerkungen<br />
Eine Datenbank ist ein Werkzeug zum Speichern <strong>und</strong><br />
Bearbeiten von Daten, die auf Gr<strong>und</strong> ihrer Struktur auf<br />
Karteikarten festgehalten werden können. Eine Karteikarte<br />
entspricht einem Datensatz. Jeder Datensatz enthält<br />
mehrere Elemente, sogenannte Datenfelder. Jedes Datenfeld<br />
hat einen Feldnamen <strong>und</strong> einen bestimmten<br />
Datentyp.<br />
Listenansicht einer Datenbank<br />
Formularansicht eines Datensatzes<br />
Unsere Beispieldatenbank „Schülerbücherei“ enthält Feldname Datentyp Besonderheit<br />
7 Datenfelder <strong>und</strong> drei Datensätze. Die nebenstehende<br />
Tabelle zeigt die Feldnamen <strong>und</strong> die Daten-<br />
Autor<br />
Titel<br />
Text<br />
Text<br />
typen.<br />
Untertitel Text<br />
Die Felder <strong>und</strong> die Datentypen werden bei der Kaufdatum Datum tt.mm.jj<br />
Erstellung der Datenbank festgelegt. Die Daten Preis Zahl 2 Dezimalstellen<br />
können in der Formular- oder der Listenansicht Ersch-jahr Zahl vierstellig<br />
eingegeben bzw. bearbeitet werden. In der Nummer Text<br />
Listendarstellung erscheint ein Datensatz in einer<br />
Zeile. Die Spaltenkopfzeilen zeigen die Feldnamen an. Die Formularansicht zeigt jeweils einen<br />
Datensatz an.<br />
Mit der Datenbank können die Daten in vielfältiger Weise bearbeitet werden:<br />
• Daten können alphabetisch oder numerisch anhand eines oder mehrere Datenfelder sortiert<br />
werden (z.B. alphabetisch nach Titel; alphabetisch nach Autor; numerisch nach<br />
Anschaffungsdatum).<br />
• Daten können gefiltert werden: (z.B. alle Datensätze mit Anschaffungsjahr 1997; alle<br />
Datensätze mit Anschaffungsdatum vor dem 01.01.96; alle Datensätze mit Preis > 50,00 DM).<br />
• Die Daten können ganz oder teilweise in gestalteten Berichten ausgegeben werden.<br />
• Mit numerischen Daten können Rechenoperationen ausgeführt werden.<br />
• Daten können in Seriendruckfunktion in die Textverarbeitung übernommen werden (z.B.<br />
Drucken von Serienbriefen; Drucken von gestalteten Karteikarten).<br />
• Daten können auf Etiketten gedruckt werden (Adressetiketten; Etiketten für Bücherei,<br />
Lernmittel).<br />
Da in Datenbanken auch personenbezogene Daten gespeichert werden können, muss in diesem<br />
Kontext das Thema „Datenschutz“ <strong>und</strong> „Datensicherheit“ aufgearbeitet werden. Bereits das<br />
Schützen einer kleinen Adressdatei mit einem Passwort ist eine erste Form des Datenschutzes <strong>und</strong>
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 21<br />
bietet Ansatzpunkte zur Thematisierung einer differenzierten Zugangskontrolle mit individuellen<br />
Rechten.<br />
Seit Erscheinen der ersten Anwendungen in den fünfziger Jahren haben Datenbanken in<br />
Industriegesellschaften derart an Bedeutung gewonnen, dass sie in fast jedem Bereich der<br />
<strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> Datenverarbeitung anzutreffen sind.<br />
Datenbanken spielen heute eine zentrale Rolle in der elektronischen Datenverarbeitung, sei es in der<br />
Verwaltung, in der Bücherei, beim Telefonanbieter oder in der Waren- oder K<strong>und</strong>enkartei eines<br />
Versandhauses. Überall werden Daten in strukturierter Form verwaltet, um den gezielten Zugriff<br />
auf die Daten zu ermöglichen. Datenbanken zum selbstständigen Recherchieren finden sich nicht<br />
nur auf leistungsfähigen Speichermedien wie CD-Roms (Telefon-Verzeichnis, elektronischer<br />
Fahrplan der Bahn, Postleitzahlen, Bankleitzahlen), sondern ebenso im Internet, wo über Online-<br />
Datenbanken auf ein riesiges Angebot an Informationen zugegriffen werden kann.<br />
Für die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler erlangt die Nutzung von Datensammlungen sowohl im privaten<br />
als auch im beruflichen Bereich eine zunehmende Bedeutung. Lexika, Telefon- <strong>und</strong><br />
Adressverzeichnisse, Kataloge usw. werden verstärkt zur privaten Nutzung für den Computer<br />
herausgebracht. In vielen Berufen ist heute eine Anwendung von Datensammlungen <strong>und</strong> die<br />
Organisation von Produktions- <strong>und</strong> Geschäftsabläufe ohne deren Einsatz nicht mehr denkbar.<br />
Auch für Sonderschüler wird deshalb der Erwerb von Kompetenzen in diesem Bereich von<br />
Bedeutung sein. Sie sollten die Struktur einer Datenbank kennen <strong>und</strong> die sachgerechte Anwendung<br />
lernen. Die gewonnenen Informationen sollten verarbeitet, überprüft <strong>und</strong> deren Einflüsse erkannt<br />
werden; ebenso sollten die Probleme des Datenschutzes deutlich gemacht <strong>und</strong> beachtet werden.<br />
Y Tipps für den Unterricht<br />
Im schulischen Bereich bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten an, die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
an den Umgang mit Datenbanken heranzuführen. Neben dem Erstellen <strong>und</strong> Verwalten einer eigenen<br />
Datenbank wie<br />
- Adressverzeichnisse<br />
- Mediendatenbank (z.B. Schülerbücherei)<br />
- Spieleausleihe<br />
- Musik-Sammlung<br />
- CD-Rom-Verwaltung<br />
ist die Nutzung von vorhandenen Datenbanken wie z.B.<br />
- Lexika<br />
- Telefonverzeichnisse<br />
zur <strong>Informations</strong>gewinnung von großer Wichtigkeit.
22<br />
Strukturraster Datenbanken<br />
STUFE Lerninhalte<br />
Mittelstufe − altersgeeignete<br />
Datenbankwerkzeuge<br />
anwenden (z.B.<br />
Toppics)<br />
Oberstufe − Datenbanken<br />
anwenden<br />
− Datenbanken<br />
erstellen<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Handhabungskompetenz<br />
− Informationen<br />
strukturiert erfassen<br />
<strong>und</strong> bearbeiten<br />
− Daten in einer<br />
Datenbank suchen /<br />
filtern<br />
− Daten sortieren<br />
− Datenblatt<br />
ausdrucken<br />
− Datenliste (Bericht)<br />
anzeigen /<br />
ausdrucken<br />
− Daten mit Hilfe eines<br />
Formulars eingeben<br />
− Datenfelder erstellen<br />
<strong>und</strong> Formular<br />
anlegen<br />
− Länge <strong>und</strong> Typ der<br />
Datenfelder festlegen<br />
− Liste / Bericht<br />
erstellen<br />
− Daten nutzen zum<br />
Ausdrucken von<br />
Serienbriefen,<br />
Etiketten, etc.<br />
Auswahl- <strong>und</strong><br />
Bewertungskompetenz <br />
Gestaltungskompetenz<br />
− Überprüfen, ob<br />
Informationen<br />
vollständig <strong>und</strong><br />
sachlich richtig sind<br />
− Auswertungsmöglichkeiten<br />
der<br />
Daten kennen<br />
− Erkennen, ob das<br />
Programm Missbrauchsmöglichkeiten<br />
(z.B. Massenbriefsendung,Spendenaufruf)<br />
ausschließen<br />
kann<br />
− Schutzwürdigkeit von<br />
Daten erkennen<br />
− Wissen, welche Vorschriften<br />
bei der<br />
Schutzwürdigkeit von<br />
Daten zu beachten<br />
sind<br />
− Datenformular<br />
funktionell <strong>und</strong><br />
ansprechend<br />
gestalten
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 23<br />
Rechnen <strong>und</strong> Kalkulieren (Tabellenkalkulation)<br />
Vorbemerkungen<br />
Die Tabellenkalkulation ist eine der klassischen Standardanwendungen der EDV <strong>und</strong> hat ihr<br />
Hauptanwendungsfeld in mathematischen Aufgabenstellungen, insbesondere im buchhalterischen<br />
Bereich <strong>und</strong> in der Kalkulation. Sie ist jedoch so vielseitig, dass ihre Nutzungsmöglichkeiten sehr<br />
breit <strong>und</strong> universell sind. Nicht zuletzt macht sie auch die einfache Handhabung zu einem<br />
interessanten Werkzeug für die Schule.<br />
Eine Rechentabelle weist eine strenge Gliederung auf: Spalten (A, B, C ...) <strong>und</strong> Zeilen (1, 2, 3, ...)<br />
teilen den Arbeitsbereich in Zellen auf, von denen jede auf Gr<strong>und</strong> ihrer Spalten- <strong>und</strong><br />
Zeilenkoordinaten eine eindeutige Adresse hat.<br />
Zeilen-<br />
bezeichnung<br />
Beispieltabelle: Klassenkasse<br />
Spalten-<br />
bezeichnung<br />
Zelle C3<br />
In die Zellen können Werte (Daten) eingegeben werden. Diese Werte können verschiedener Art<br />
sein, etwa Zahlen, Wörter, Datumsangaben, Uhrzeiten. Die verschiedenen Arten von Daten<br />
bezeichnet man als Datentypen.<br />
Die eingegebenen Daten können mit Formeln <strong>und</strong> Funktionen mathematisch miteinander verknüpft<br />
werden.<br />
Beispiel: E2 = Summe(B2,C2,D2)<br />
Zelle E2 zeigt also immer die Summe der Zellen B2, C2 <strong>und</strong> D2 an. Ändert sich der<br />
Wert einer dieser Zellen, ändert sich auch der Wert in E2.<br />
Ebenso wäre folgende Eingabe richtig:<br />
E2 = B2+C2+D2<br />
Weiterhin können zu Tabellen Diagramme erzeugt werden, die die Werte bzw. einen Teil der Werte<br />
veranschaulichen. Dazu steht eine Vielzahl an Diagrammtypen zur Verfügung. Da Visualisierung<br />
von Daten bzw. Informationen eine immer größere Bedeutung erlangt, erhalten die Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler über die Tabellenkalkulation einen Zugang zu diesen modernen Darstellungsformen.<br />
Neben der berechnenden Nutzung kann die Tabellenkalkulation aber auch für tabellarische<br />
Aufstellungen (Listen) ohne Berechnung verwendet werden.
24<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler werden gezwungen, Werte exakt in die dafür vorgesehenen Zellen<br />
einzutragen. Sie können in der Tabelle Formeln entwickeln <strong>und</strong> Kalkulationen anstellen.<br />
Y Tipps für den Unterricht<br />
Beispiel: Klassenkasse führen (Mittelstufe)<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler tragen in eine vorbereitete Tabelle jeden Monat Beträge ein<br />
0. Lehrkraft erstellt die Tabelle:<br />
Tabelle mit Namen der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler <strong>und</strong> Spalte für ersten Monat vorbereiten.<br />
Den Zellen das Währungsformat zuteilen.<br />
Die Summen-Formel für Monatsbetrag, persönliche Sparsumme vorbereiten.<br />
1. Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler tragen Beträge in Tabelle ein:<br />
Die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler tragen zur Buchführung für den ersten Monat (Januar) die<br />
einbezahlten Beträge in Liste ein. Dabei werden die Begriffe Zeile, Spalte, Zelle verdeutlicht.<br />
2. Weitere Beträge eingeben <strong>und</strong> Summen beachten:<br />
Im zweiten Monat wird vom Lehrer die Liste durch die Februar-Liste ergänzt.<br />
Die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler tragen die neuen Beträge ein <strong>und</strong> beobachten die sich ändernden<br />
Summen.<br />
Januar Februar März<br />
Bernd L. 2,00 DM 2,00 DM 4,00 DM<br />
Emilie H. 2,00 DM 2,00 DM 4,00 DM<br />
Erich B. 1,50 DM 2,00 DM 3,50 DM<br />
Eva W. 3,00 DM 3,00 DM<br />
Franz R. 2,00 DM 1,50 DM 3,50 DM<br />
Hans R. 1,00 DM 1,50 DM 2,50 DM<br />
Helga W. 2,00 DM 2,00 DM<br />
Margit E. 2,50 DM 2,50 DM<br />
Michael M. 1,50 DM 1,50 DM 3,00 DM<br />
Rudi L. 3,00 DM 1,00 DM 4,00 DM<br />
15,00 DM 17,00 DM 0,00 DM 32,00 DM<br />
3. Weitere Monate eintragen:<br />
Die Tabelle jeweils laden <strong>und</strong> speichern, ggf. auch ausdrucken.<br />
Beispiel: Haushaltsplan erstellen (Oberstufe)<br />
Erstellen eines Haushaltsplanes <strong>und</strong> Kalkulation der Ausgaben<br />
1. Ausgabenbereiche festlegen:<br />
Miete + NK, Lebensmittel, Kleidung, Versicherungen/Raten, Mofa/Auto, Zigaretten, Freizeit,<br />
Sparen ...<br />
2. Mit dem Tabellenkalkulationsprogramm eine Tabelle erstellen.<br />
Die maximale Gesamtsumme für die monatlichen Ausgaben festlegen.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 25<br />
Den Zellen für die Beträge das Datenformat „Währung” zuweisen.<br />
Formel in der Tabelle erstellen: Addition für Gesamtsumme der Ausgaben.<br />
3. Beträge eingeben <strong>und</strong> kalkulieren<br />
Die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler verteilen nach eigener Vorstellung Teilbeträge auf die einzelnen<br />
Ausgabenbereiche, beobachten die sich verändernde Gesamtsumme <strong>und</strong> verändern ihre<br />
Teilbeträge.<br />
Ausgabenbereiche Betrag/Monat<br />
Miete + NK 700,00 DM<br />
Versicherungen/Raten 220,00 DM<br />
Lebensmittel 720,00 DM<br />
Kleidung 90,00 DM<br />
Auto/Mofa 80,00 DM<br />
Zigaretten 50,00 DM<br />
Freizeit 70,00 DM<br />
Sparen 60,00 DM<br />
Summe: 1.990,00 DM<br />
4. Kalkulationen <strong>und</strong> Rückschlüsse<br />
Die Lehrkraft bespricht die einzelnen Ausgabenbereiche <strong>und</strong> gibt ggf. wirklichkeitsnähere Werte<br />
vor.<br />
Gemeinsame Diskussion der Möglichkeiten für Einsparung/Ausweitung der einzelnen Bereiche.<br />
Die Ergebnisse der Diskussion werden jeweils in die Tabelle eingeben <strong>und</strong> die neu kalkulierte<br />
Summe sofort berücksichtigt.<br />
Aus den kalkulierten Werten Rückschlüsse auf das eigene Handeln ziehen.<br />
Der Haushaltsplan ansprechend gestalten <strong>und</strong> ausdrucken.<br />
Beispiel: Diagramm erstellen (Oberstufe)<br />
Ergebnis der Klassensprecherwahl optisch aufbereiten<br />
1. Tabelle erstellen <strong>und</strong> Daten eingeben<br />
Harald 22<br />
Rüdiger 12<br />
Herbert 9<br />
Peter 5<br />
Gabriele 11<br />
Franz 15<br />
Manfred 17<br />
Die Tabelle entsprechend der Stimmenzahl sortieren.<br />
2. Diagramm erstellen<br />
Diagrammtypen erproben <strong>und</strong> Ergebnisse beurteilen.<br />
Das Diagramm auswählen, welches das Ergebnis am deutlichsten darstellt.<br />
Das Diagramm durch Titel, Rahmen <strong>und</strong> Gitternetzlinien ergänzen.
26<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Dem Diagramm entsprechend den Präsentations- oder Druckmöglichkeiten Farben/Muster<br />
zuordnen, hier z.B. Schwarz-Weiß-Muster.<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Wahlergebnis<br />
Harald Manfred Franz Rüdiger Gabriele Herbert Peter<br />
Das Ergebnis besprechen <strong>und</strong> aushängen.<br />
Stimmenzahl<br />
Weitere Themen<br />
• Geometrische Berechnungen (Flächen- <strong>und</strong> Rauminhalt) mit Zwischenergebnissen<br />
• Umrechnung von Währungen<br />
• Rechnungsformular mit Einzelpreis, Anzahl, Gesamtpreis, Mehrwertsteuer, Skonto, Endpreis<br />
• Verwaltung des Pausenverkaufs<br />
• Temperaturdiagramm für einen Tag oder einen Monates erstellen<br />
• Rechentabellen zu Themen des Mathematikunterrichts (Prozentrechnen, Zinsrechnen)<br />
• Statistische Tabellen wie EU-Staaten, ihre Landesfläche, Einwohnerzahl <strong>und</strong><br />
Bevölkerungsdichte<br />
• Kosten des Autofahrens<br />
• Kostenaufstellung zu unterrichtlichen Projekten (z.B. Produktkalkulation in der Arbeitslehre)
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 27<br />
Strukturraster Tabellenkalkulation<br />
STUFE Lerninhalte<br />
Handhabungskompetenz<br />
Mittelstufe − Daten in<br />
vorgegebene Tabelle<br />
eingeben<br />
− Begriffe Zeile, Spalte,<br />
Zelle kennen<br />
− Tabelle ausdrucken<br />
− Tabelle speichern<br />
− Tabelle laden<br />
Oberstufe − Tabellenkalkulation − Tabelle erstellen<br />
− Formeln in Tabelle<br />
erstellen<br />
− Zellen gebräuchliche<br />
Datenformate (z.B.<br />
Währung, Datum)<br />
zuweisen<br />
− Zellen Gestaltungsmerkmale<br />
(z. B.<br />
Schriftgröße, fett,<br />
Rahmen) zuweisen<br />
− durch Verändern der<br />
Daten Ergebnisse<br />
kalkulieren<br />
− Seitenausrichtung<br />
(hoch, quer)<br />
auswählen<br />
− Diagramme − anhand einer<br />
Datentabelle<br />
Diagramme erstellen<br />
− dem Diagramm<br />
Muster / Farben<br />
zuweisen<br />
Auswahl- <strong>und</strong><br />
Bewertungskompetenz<br />
− Notwendigkeit der<br />
sorgfältigen<br />
Dateneingabe in die<br />
Tabelle erkennen<br />
− Vorteile der<br />
Rechenfunktion<br />
erkennen<br />
− Richtigkeit der<br />
Ergebnisse<br />
überprüfen<br />
− Rückschlüsse aus<br />
den Kalkulationsergebnissen<br />
für das<br />
eigene Handeln<br />
ziehen können<br />
− Sind die Daten für die<br />
Diagrammdarstellung<br />
geeignet?<br />
− Bietet das Diagramm<br />
einen Vorteil<br />
gegenüber der<br />
Tabelle?<br />
− Birgt das Diagramm<br />
die Gefahr des<br />
Datenmissbrauchs<br />
durch gezielte<br />
Fehlinformation?<br />
Gestaltungskompetenz<br />
− übersichtliche, funktionale<br />
Gestaltung<br />
von Tabellen (sinnvolles<br />
Auswählen von<br />
Gestaltungsmerkmalen<br />
wie Seitenausrichtung,Schriftattributen,<br />
Linien <strong>und</strong><br />
Füllungen)<br />
− den Daten angemesseneDiagrammform<br />
(z.B.<br />
Kreisdiagramm,<br />
Säulendiagramm,<br />
etc.) auswählen <strong>und</strong><br />
gestalten
28<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Vorgänge <strong>und</strong> Zusammenhänge darstellen <strong>und</strong> simulieren<br />
(Modelle <strong>und</strong> Simulationen)<br />
Vorbemerkungen<br />
Unter einer Simulation versteht man die Abbildung der Realität in einem Modell, meist zum<br />
Zwecke der Erlangung von Kenntnissen, die ggf. auf die Realität übertragbar sind.<br />
Simulationen dienen der Veranschaulichung bzw. der Erprobung von<br />
• Vorgängen, die der unmittelbaren Beobachtung nicht zugänglich sind (z.B. Elektronenbewegung<br />
beim Stromfluss, Blutzirkulation im Körper, Vorgänge im Kolben beim Verbrennungsmotor);<br />
• Vorgängen, die auf Gr<strong>und</strong> ihrer räumlichen oder zeitlichen Dimension nicht unmittelbar im<br />
Zusammenhang beobachtet werden können (z.B. Wasserkreislauf in der Natur, Bewegung von<br />
Erde <strong>und</strong> Sonne im Jahresverlauf);<br />
• Strukturen, die auf Gr<strong>und</strong> ihrer Komplexität in der Realität nicht unmittelbar beobachtet werden<br />
können (z.B. Warenwirtschaftssystem im Supermarkt; Überlebensstrategien in Afrika);<br />
• Abläufen mit Veränderung von Bedingungen (z.B. Wirtschaftssimulationen; Ökosysteme <strong>und</strong><br />
Umweltprobleme);<br />
• Abläufen, die in der Realität nicht oder noch nicht möglich sind (z.B. Währungsumstellung auf<br />
den Euro).<br />
Dabei reicht das Spektrum von der Veranschaulichung einfacher Vorgänge (Elektronenbewegung)<br />
über Steuerungen (Ampel) <strong>und</strong> Regelungen (Wasserstandsregelung) bis zu komplizierten Wirkgefügen<br />
(komplexe Ökosysteme).<br />
Kann der Anwender bei einfachen Simulationen meist nur den Ablauf starten <strong>und</strong> unterbrechen,<br />
kann er bei komplexen Simulationen in das Geschehen eingreifen, indem er Parameter verändert<br />
oder eine Rolle im Geschehen übernimmt.<br />
Im Supermarkt etwa ist er Marktleiter <strong>und</strong> verantwortet den Wareneinkauf, oder er ist K<strong>und</strong>e <strong>und</strong><br />
simuliert die Rolle, die er im Alltag einnehmen kann.<br />
Der Computer ist in diesem Bereich prinzipiell Werkzeug, das es ermöglicht, komplexe Wirkketten<br />
zu simulieren. Voraussetzung ist geeignete Software zu schülernahen Inhalten. Vor problematischen<br />
Kompromissen sollte jedoch eher ein Verzicht des Einsatzes erwogen werden.<br />
Es ist für unsere Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Allgemeinen zu anspruchsvoll, die Entstehung einer<br />
Simulation aufzuzeigen. Voraussetzung dafür wäre vor allem die Verfügbarkeit überschaubarer<br />
Software. Für das zu simulierende System würde dann ein formales Modell entwickelt, welches auf<br />
den Computer (ein Computerprogramm) übertragen würde, um neue Zustände zu simulieren <strong>und</strong><br />
Ergebnisse berechnen <strong>und</strong> darstellen zu können.<br />
Der einfachere Weg zum Verständnis von Simulationen ist der Vergleich von „fertiger“ Simulationssoftware<br />
mit der Wirklichkeit. So lässt sich erarbeiten, dass die komplexe Wirklichkeit auf<br />
einige (quantifizierbare) Zusammenhänge reduziert, <strong>und</strong> die Aussagekraft daher relativ ist.<br />
Softwaresimulation muss daher durch andere Formen der Veranschaulichung ergänzt werden.<br />
Wenn hier jeweils nur Teilbereiche erfasst werden, so kann die Simulation am Rechner die<br />
Integration der Teile zum Gesamtprozess leisten.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 29<br />
Die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler sollten dazu geführt werden, die Reduktion der Wirklichkeit zu<br />
bedenken, die mittels Simulation erzielten Ergebnisse auf die Gr<strong>und</strong>annahmen von Modell <strong>und</strong><br />
Programm zu beziehen <strong>und</strong> ihre Aussagekraft <strong>und</strong> Reichweite kritisch zu bewerten <strong>und</strong> relativieren.<br />
Beispiel: Viertakt-Motor<br />
Die erste Abbildung zeigt den Kolben mit den Bezeichnungen der<br />
wichtigsten Teile.<br />
Nach dem Starten der Simulation läuft der Vorgang am Bildschirm<br />
kontinuierlich ab. Die Simulation kann an jeder Position angehalten<br />
werden.<br />
Ansaugen Verdichten Zünden Ausstoßen<br />
(Abbildungen aus: CD-Rom „Wie funktioniert das?“, Duden-Meyer)<br />
Y Tipps für den Unterricht<br />
Schleuse<br />
Einfaches (kostenloses) Programm, das den Ablauf einer Schleuse simuliert.<br />
Viertakt-Ottomotor<br />
Einfaches (kostenloses) Programm, das die Vorgänge im Viertakt-Ottomotor simuliert.<br />
Das W<strong>und</strong>er unseres Körpers<br />
Multimediale CD-Rom über den menschlichen Körper.<br />
Supermarkt<br />
Das Programm „Supermarkt“ simuliert gr<strong>und</strong>legende Abläufe in einem Supermarkt. Ausgehend<br />
von der modellhaft dargestellten Kaufsituation mit einem begrenzten Warenangebot gelangt der<br />
Schüler an die Scannerkasse, an der mittels Strichcode die gekauften Waren erfasst werden <strong>und</strong> ein<br />
ausdruckbarer Kassenzettel erstellt wird.
30<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Gleichzeitig erfolgt der Abgleich mit dem Lagerbestand.<br />
Im Modul „Lagerverwaltung“ werden zu jedem Artikel der Name, der Preis, die Ist-, Soll- <strong>und</strong> die<br />
Mindest-Menge verwaltet, wobei die Eingaben mit Ausnahme der Ist-Menge frei gewählt werden<br />
können.<br />
Eine K<strong>und</strong>enverwaltung mit K<strong>und</strong>enkarte<br />
simuliert den Trend zum bargeldlosen Bezahlen<br />
sowie die Möglichkeit der Analyse des<br />
Kaufverhaltens.<br />
Mit dem Programm „Supermarkt“ lassen sich<br />
eine Vielzahl an Fragestellungen wie z.B. das<br />
Einkaufsverhalten, Berufe <strong>und</strong> Tätigkeiten im<br />
Supermarkt, Marketing mit den Beispielen<br />
Produktbezeichnung <strong>und</strong> Preisgestaltung, Artikelverwaltung<br />
in der Supermarktkette, der Rationalisierung<br />
im Einzelhandel, bargeldlose Zahlungsformen,<br />
Verkaufsanalyse, Analyse des Einkaufsverhaltens<br />
von K<strong>und</strong>en, etc. thematisieren.<br />
Das Programm zeichnet sich durch eine einfache, überwiegend mausorientierte Bedienung sowie<br />
durch pädagogisch durchdachte Funktionen wie etwa das einfache Zurücksetzen auf die<br />
Standardeinstellungen oder das Löschen der Artikel- bzw. K<strong>und</strong>enlisten aus.<br />
Zum Programm liegen umfassende <strong>und</strong> vorbildliche didaktische Informationen mit Hilfen für die<br />
Umsetzung im Unterricht vor.<br />
KaufWas<br />
KaufWas enthält im Vergleich zu Supermarkt nicht die Module K<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Lagerwaltung <strong>und</strong><br />
konzentriert sich so auf den Vorgang des Einkaufens einschließlich des Bezahlens. Auch hier<br />
können in einer Artikeldatei mit 15 Einträgen Namen, Preise <strong>und</strong> Mengen der Waren eingegeben<br />
werden. Eine Geldbörse kann vor dem Einkaufen per drag and drop aufgefüllt werden, um damit<br />
die gekauften Waren an der Kasse zu bezahlen. Eine Sprachausgabe ermöglicht das Aufrufen von<br />
So<strong>und</strong>s, z.B. der Artikelnamen. Artikelgrafiken <strong>und</strong> So<strong>und</strong>s können vom Anwender editiert werden.<br />
Mit KaufWas kann z.B. der Einkauf für das Klassenfrühstück in der Vorbereitung simuliert werden.<br />
Nach einer Erhebung der Preise kann die Artikeldatei dem realen Angebot eines Einkaufsmarktes<br />
angepasst werden.<br />
Weitere Simulationen (Beispiele)<br />
Auf Simulationen basieren viele Computerspiele wie z.B. „digdogs“, das kostenlos vom Deutschen<br />
Verkehrssicherheitsrat (Internet: www.bg-dvr.de/digdogs) angeboten wird. Klassisches Beispiel<br />
einer Simulation ist auch der Flugsimulator, der als Computerspiel in sehr realitätsnahen Versionen<br />
angeboten wird. Das Programm „Vorfahrt“ (PC14, Comisoft) simuliert verschiedene Verkehrssituationen<br />
an der Straßenkreuzung.<br />
Viele Multimedia-CD-Roms enthalten Simulationen zur Veranschaulichung komplexer Abläufe<br />
oder Zusammenhänge aus der Biologie (z.B. Ökosysteme, Der menschliche Körper) der Physik <strong>und</strong><br />
Technik (z.B. Stromkreise, Kraftfahrzeugtechnik, Computer), der Astronomie, etc.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 31<br />
Strukturraster Simulation <strong>und</strong> Veranschaulichung<br />
STUFE Lerninhalte<br />
Mittelstufe − Simulation einfacher<br />
Wirkungsketten<br />
schülernaher Inhalte<br />
zu Spiel, Alltag <strong>und</strong><br />
Abenteuer<br />
Oberstufe − Simulationen<br />
komplexer (oft nicht<br />
beobachtbarer)<br />
Wirklichkeiten zu<br />
technischen,<br />
physikalischen,<br />
biologischen,<br />
ökologischen, etc.<br />
Vorgängen<br />
Handhabungskompetenz<br />
− mit geeigneter<br />
Simulationssoftware<br />
spielerisch umgehen<br />
können<br />
− in Wirkungsketten<br />
<strong>und</strong> Handlungsabläufe<br />
eingreifen<br />
können<br />
− zunehmend<br />
bewusster mit<br />
modellhafter <strong>und</strong><br />
simulierter<br />
Wirklichkeit mittels<br />
geeigneter Software<br />
umgehen können<br />
− Eingabe von Daten<br />
<strong>und</strong> Verändern von<br />
Parametern<br />
beherrschen<br />
Auswahl- <strong>und</strong><br />
Bewertungskompetenz<br />
− Lassen sich<br />
Simulation <strong>und</strong><br />
Wirklichkeit<br />
vergleichen?<br />
− Lassen sich Elemente<br />
<strong>und</strong> Bezüge<br />
wiedererkennen?<br />
− Welche Ergebnisse<br />
lassen sich auf Gr<strong>und</strong><br />
von selbstbewirkten<br />
Veränderungen<br />
beobachten <strong>und</strong><br />
erfahren?<br />
− Wie erfahre ich die<br />
Reduktion der<br />
weitaus komplexeren<br />
Realität?<br />
− Werden komplexe<br />
Zusammenhänge<br />
vereinfacht<br />
dargestellt?<br />
− Wie fällt der Vergleich<br />
zwischen der<br />
Simulation (virtuell)<br />
<strong>und</strong> dem Phänomen<br />
(Realität) aus?<br />
Gestaltungskompetenz<br />
− Eingriffsmöglichkeiten<br />
des Programms<br />
spielerisch <strong>und</strong><br />
explorativ einsetzen<br />
können<br />
− Eingriffsmöglichkeiten<br />
des Programms<br />
gezielt, sachgerecht<br />
<strong>und</strong> durchdacht<br />
einsetzen können
32<br />
Geräte <strong>und</strong> Maschinen steuern<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Vorbemerkungen<br />
Bedingt durch den Strukturwandel in unserer Gesellschaft übernehmen computergesteuerte<br />
Maschinen zunehmend bisher von Menschen geleistete Arbeit. Damit entlasten sie einerseits den<br />
Menschen von nicht selten monotonen Tätigkeiten, andererseits erfordert ihre Konstruktion,<br />
Wartung <strong>und</strong> ihre Bedienung andere Qualifikationen. Gleichzeitig sind computergesteuerte Geräte<br />
immer mehr in der Lage, kompensatorische Funktionen zu übernehmen, etwa beim Ausfall<br />
sensorischer oder motorischer Funktionen des Körpers.<br />
Diese Entwicklungen verursachen eine tiefgreifende Umorientierung beim Einsatz menschlicher<br />
Arbeitskraft, leider oft zum Nachteil behinderter Menschen. Dies kann z.B. für lernbehinderte<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler bedeuten, dass der Wegfall von weniger qualifizierten Berufen ihre<br />
Berufschancen verschlechtert. Dagegen können für körperbehinderte Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
computergesteuerte Geräte neue berufliche Perspektiven sowie eine Verbesserung ihrer<br />
Lebensqualität bedeuten.<br />
Die Schule muss auf diese Probleme eingehen, indem sie die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler in die Lage<br />
versetzt, sich mit den Chancen <strong>und</strong> Risiken des Computereinsatzes in Arbeitswelt <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
auseinander zu setzen. Mit der Arbeit an Projekten werden die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler angeregt,<br />
sich kritisch mit möglichen zukünftigen Entwicklungen - <strong>und</strong> deren Bedeutung für die eigenen<br />
beruflichen Perspektiven - zu befassen.<br />
Was ist Geräte- <strong>und</strong> Maschinensteuerung?<br />
Ohne den Computer ist Automation heute nicht mehr denkbar. Immer mehr technische<br />
Fertigungsprozesse basieren auf der Steuerung von Maschinen durch den Computer, aber auch<br />
unser alltägliches Leben wird zunehmend durch Computer geregelt, etwa an der Straßenampel, am<br />
Fahrkartenautomaten, am Telefon, beim Wäschewaschen mit der Maschine, Autofahren, Fernsehen,<br />
beim Kochen mit einem Elektroherd <strong>und</strong> bei der Heizung.<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler sollten deshalb einige gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse dieser Technologie in<br />
ihrer Schulzeit erwerben. Dazu braucht man einen PC, ein an diesen anzuschließendes Gerät (ein<br />
sogenanntes Interface: ein Gerät zur Verbindung des Computers mit Bauteilen wie Lampen,<br />
Motoren <strong>und</strong> Messfühlern) <strong>und</strong> ein Programm, das dieses Interface steuern kann. Über das Interface<br />
<strong>und</strong> das Steuerungsprogramm lassen sich z. B. Lampen, Heizgeräte <strong>und</strong> Motoren ein- <strong>und</strong><br />
ausschalten <strong>und</strong> die Dauer der Schaltzustände bestimmen. Bauteile, die vom Computer geschaltet<br />
werden, heißen Aktoren. Andere Bauteile wie Taster, Wärme- <strong>und</strong> Lichtsensoren können Signale an<br />
den Computer weitergeben, die dieser dann bei der weiteren Steuerung der angeschlossenen Geräte<br />
berücksichtigt. Bauteile, die dem Computer Signale oder Messwerte liefern, heißen Sensoren.<br />
So kann die Steuerung einer Ampelanlage durch Knopfdruck, durch einen Magnetsensor oder durch<br />
einen Helligkeitssensor beeinflusst werden. Ein Kühlventilator kann in Abhängigkeit von der durch<br />
einen Temperaturfühler erfassten Temperatur ein- <strong>und</strong> ausgeschaltet <strong>und</strong> mittels Magnetventil<br />
(automatischer Wasserhahn) <strong>und</strong> Wasserstandsmesser kann die Füllhöhe eines Wasserbehälters<br />
geregelt werden.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 33<br />
Steuerbox<br />
(Interface)<br />
Ausgänge<br />
Eingänge<br />
Lampe<br />
Motor<br />
Elektromagnet<br />
Heizdraht<br />
Taster<br />
Lichtsensor<br />
Temperaturfühler<br />
Der Waschvorgang in einer Waschmaschine läuft prinzipiell nicht anders ab: Wasserstand <strong>und</strong><br />
Wassertemperatur sind zu regeln, Motoren für Trommel <strong>und</strong> Pumpe zu steuern. Diese Prozesse, die<br />
unter Einbeziehung von Größen wie Temperatur, Wassermenge <strong>und</strong> Zeit ablaufen, sind Computerprogramme,<br />
die ein in dem Gerät eingebauter Mikroprozessor – ein Computer, der nur einige<br />
Programme umsetzen kann – ausführt. Auch eine computergesteuerte Maschine – sei es eine<br />
Drehbank, eine Fräsmaschine oder ein Industrieroboter – funktioniert nicht anders. Auch hier<br />
erhalten Schrittmotoren Anweisungen, welcher Punkt angefahren werden soll, welche Strecke<br />
verfahren werden soll oder wie tief ein Bohrer eintauchen soll.<br />
Geräte- <strong>und</strong> Maschinensteuerung in der Schule<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler sollen „Einblicke einfachster Art in die Prozessdatenverarbeitung“<br />
(Lehrplan Arbeitslehre, Schule für Lernbehinderte Rheinland-Pfalz) erhalten. Anhand schülergerechter<br />
Modelle wie z.B. eines Ampelmodells sollen sie einfache Abläufe am Computer mit Hilfe<br />
eines Programmes entwickeln <strong>und</strong> über eine Steuerbox (Interface) ausführen lassen. Ausgehend von<br />
einfachen Steuerungen können komplexere Abläufe programmiert werden. So kann eine Ampel<br />
etwa ein Programm für Tag <strong>und</strong> eines für Nacht aufweisen <strong>und</strong> mit Hilfe eines Helligkeitssensors<br />
kann für die aktuelle Helligkeit das passende Programm aktiviert werden.<br />
Mit einer computergesteuerten Bohr- <strong>und</strong> Fräsmaschine (CNC-Maschine) <strong>und</strong> geeigneter Software<br />
können Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler einfache Werkstücke mittels Bohren <strong>und</strong> Fräsen erstellen. Sogar<br />
einfache technische Zeichnungen hierzu können u.U. von den Schülern am Computer angefertigt<br />
werden.<br />
Das Problem bei der Gerätesteuerung mit dem Computer liegt weniger bei der Hardware, als<br />
vielmehr bei der für den Schüler geeigneten Software. Hier sind grafische Programmierwerkzeuge,<br />
die sich bereits in Ansätzen auf dem Markt finden, besonders geeignet. Diese verbinden einfache<br />
Bedienung mit einem hohen Grad der Veranschaulichung <strong>und</strong> erfordern somit weniger Abstraktionsfähigkeit.<br />
So kann der Schüler seine Aufmerksamkeit der Lösung des Sachproblems widmen.<br />
Zu erwartende neue Produkte sollten diesen Ansprüchen verstärkt gerecht werden.<br />
So wie es möglich ist, einen Führerschein zu erwerben <strong>und</strong> ein Auto zu fahren, ohne die<br />
Voraussetzungen zu besitzen, es reparieren zu können oder seine Funktionen in allen Einzelheiten<br />
zu kennen, können Sonderschüler lernen, mit Hilfe des Computers <strong>und</strong> geeigneter Software Geräte<br />
<strong>und</strong> Maschinen zu steuern.<br />
Aktoren<br />
Sensoren
34<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Hard- <strong>und</strong> Software<br />
Folgende technische Vorrichtungen können im experimentellen Bereich von Schülern gesteuert<br />
werden:<br />
Aktoren: Lampe, Motor, Elektromagnet, Relais, Magnetventil<br />
Sensoren: Drucktaster, Helligkeitssensor, Temperaturfühler, Reed-Kontakt (Magnetsensor)<br />
Erforderlich ist in jedem Fall ein Interface (Steuerbox), das mit dem Computer verb<strong>und</strong>en ist.<br />
Weiterhin benötigt wird ein zum Interface kompatibles Baukastensystem mit Aktoren <strong>und</strong><br />
Sensoren, z.B. entsprechende Kästen von fischertechnik (bzw. Cornelsen Experimenta) oder Lego<br />
(LegoDacta). Die Aktoren <strong>und</strong> Sensoren müssen mit den entsprechenden Anschlüssen am Interface<br />
verb<strong>und</strong>en werden.<br />
Damit sind z.B. folgende Projekte realisierbar:<br />
• Ampelsteuerungen (z.B. einfache Ampel, kombinierte Ampelanlage mit Auto- <strong>und</strong> Fußgängerampel,<br />
helligkeitsabhängige Steuerung);<br />
• Lauflichtanlagen, Mehrsegmentanzeigen;<br />
• temperaturgesteuerte Ventilatoren;<br />
• Roboter oder einfache Maschinen (z.B. Hebekran, Transportband, Rotiertisch, Aufzug).<br />
Auf Gr<strong>und</strong> der offenen Baukästen (kompatibel zu vertrauten Spielzeugkonzepten) sind vielfältige<br />
individuelle Lösungen möglich, die problemlösendes Denken beim Aufbau eines Modells <strong>und</strong> bei<br />
der Entwicklung des Programmes erfordern bzw. fördern.<br />
Am Beispiel eines einfachen Ampelmodells werden einige der zur Zeit angebotenen<br />
Gerätekonzepte, die für den Einsatz an der Sonderschule geeignet sind, kurz vorgestellt:<br />
Produktmerkmale<br />
Technologica, Lego Control Lab <strong>und</strong> LegoDacta-Modelle<br />
Beispiele:<br />
Bildschirme <strong>und</strong> Befehle<br />
Technologica Programmierbildschirm<br />
mit Interface, Befehlssymbolen <strong>und</strong> Prozedurfenster<br />
Durch Anklicken der Anschlüsse sowie der<br />
Befehlssymbole werden Aktoren geschaltet bzw.<br />
Sensoren abgefragt. Das Befehlssymbol Pause<br />
ermöglicht die Eingabe einer Zeitspanne, die der<br />
Schaltzustand beibehalten werden soll. Prozedurschritte
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 35<br />
Auf einfache Weise können so lineare Programme,<br />
Schleifen, sowie verzweigte Programme<br />
erstellt werden. Die erstellten Programme werden<br />
mittels Symbolen gespeichert <strong>und</strong> können Teil<br />
anderer Programme sein.<br />
WinLogo, Multiface <strong>und</strong> fischertechnik<br />
Das Multiface ist ein vielseitig einsetzbares Interface,<br />
mit dem z.B. fischertechnik-Modelle gesteuert<br />
werden können. Als Software kann WinLogo<br />
eingesetzt werden, eine einfache Programmiersprache<br />
mit deutschsprachigen Befehlen. Im<br />
Textfenster eingegebene Befehle werden sofort<br />
ausgeführt (Direktsteuerung). Im Lernfenster<br />
werden Programme eingegeben <strong>und</strong> gespeichert.<br />
Erstellte Prozeduren können für komplexere<br />
Programme genutzt werden.<br />
Die Befehle müssen bei WinLogo von den Schülern<br />
eingegeben (geschrieben) werden. Da es sich<br />
um eine deutschsprachige Programmiersprache<br />
handelt, sind sie jedoch gut verstehbar <strong>und</strong> können<br />
meist auch abgekürzt werden, so dass ein<br />
ökonomisches Arbeiten möglich ist. Zur Gerätesteuerung<br />
sind zudem nur wenige Befehle<br />
erforderlich.<br />
Erläuterung der Befehle (Beispiele):<br />
/DPSH DQ $XVJDQJ $ HLQVFKDOWHQ<br />
GHQ DNWXHOOHQ 6FKDOW]XVWDQG DQKDOWHQ<br />
3DXVH /lQJH EHU 6FKLHEHUHJOHU<br />
HLQVWHOOEDU<br />
/DPSH DQ $XVJDQJ $ DXVVFKDOWHQ<br />
Programmfenster:<br />
Ampelsteuerung mit WinLogo<br />
Erläuterung der Befehle:<br />
(6<br />
VFKDOWH GLH /DPSH DQ $QVFKOXVV HLQ<br />
3$86(<br />
=XVWDQG [ VHF VHF<br />
EHLEHKDOWHQ ZDUWHQ<br />
$6<br />
VFKDOWH GLH /DPSH DQ $QVFKOXVV HLQ<br />
$03(/<br />
ZLHGHUKROH DOOH 6FKULWWH<br />
(QGORVVFKOHLIH<br />
(LQVFKDOWEHIHKO 0|JOLFKH (LQJDEHQ<br />
HLQVFKDOWHQ<br />
HV<br />
(,16&+$/7(1<br />
(6
36<br />
Beim PDV-Minilabor (fischertechnik/Weber)<br />
sind ausgewählte fertige Modelle auf einer<br />
Gr<strong>und</strong>platte montiert, so dass der zeitaufwendige<br />
Aufbau der Modelle entfällt. Im Gegensatz zu<br />
vielen Baukastensystemen stehen alle Modelle<br />
gleichzeitig zur Verfügung, da die Mehrfachverwendung<br />
von Bauteilen bei verschiedenen<br />
Modellen entfällt. Alle Versuche können ohne<br />
nennenswerte Umbauten auf der Gr<strong>und</strong>platte<br />
durchgeführt werden.<br />
Das Verteilen der Einzelmodelle auf verschiedene<br />
Gr<strong>und</strong>platten erhöht die Flexibilität <strong>und</strong> reduziert<br />
das Ablenkungspotenzial.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
FiPro <strong>und</strong> Experimenta Computing (Cornelsen Experimenta)<br />
Das Programmierwerkzeug FiPro für Windows<br />
arbeitet ausschließlich mit grafischen Befehlen,<br />
die mit Hilfe der Maus im Prozedurfenster<br />
vertikal angeordnet werden.<br />
Zuvor muss die Interfacebelegung in einem<br />
ebenfalls grafischen Dialogfenster eingegeben<br />
werden. Ein Kabelplan zeigt genau, wie die<br />
einzelnen Bauteile an das Interface angeschlossen<br />
werden müssen. Ein Simulationsmodul<br />
ermöglicht die Simulation erstellter<br />
Programme am Bildschirm. Mit der integrierten<br />
Fernbedienung können die Bauteile mit dem<br />
Programm direkt angesteuert werden, was zur<br />
Überprüfung der Anschlüsse <strong>und</strong> der Einsicht<br />
in die Befehlssymbole hilfreich ist.<br />
Lineare Programme können auf diese Weise<br />
sehr einfach realisiert werden. Komplexere<br />
Programme werden mit mehreren gleichzeitig<br />
ablaufenden Prozeduren realisiert, was auf<br />
Gr<strong>und</strong> der erforderlichen zeitlichen Parallelität<br />
etwas höhere Anforderungen stellt.<br />
Programmierbildschirm mit Prozedurfenster,<br />
Befehlssymbolen <strong>und</strong> den verfügbaren<br />
Interface-Anschlüssen<br />
Dialogfenster zur Eingabe der Interface-Belegung<br />
Kabelplan
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 37<br />
LLWin <strong>und</strong> fischertechnik<br />
LLWin (Lucky Logic) ist ein grafisches Programmierwerkzeug,<br />
bei dem die Programmbausteine<br />
als Symbole in der gewünschten<br />
Abfolge am Bildschirm angeordnet werden.<br />
Parameter, wie z.B. Pausendauer (Warte)<br />
werden eingegeben <strong>und</strong> im Baustein am<br />
Bildschirm angezeigt. Über die Interfacediagnose<br />
können Interface <strong>und</strong> Bausteine<br />
überprüft werden.<br />
Das Programm bietet einen hohen Grad der<br />
Veranschaulichung der Prozessstruktur, angelehnt<br />
an das Konzept des Programmablaufplanes.<br />
Während des Programmlaufs werden<br />
die aktuellen Programmschritte farbig markiert<br />
<strong>und</strong> die Parameter in den Bausteinen angezeigt<br />
(z.B. Wartezeit).<br />
Z.Z. können mit LLWin nur die Interfaces des<br />
fischertechnik-Programmes sowie das cornelsen-Interface<br />
gesteuert werden. Ein Zusatzbauteil,<br />
das die Steuerung des Multiface mit<br />
LLWin ermöglicht, ist geplant.<br />
Platinenmodelle<br />
Diese auf Platinen fertig aufgebauten Modelle<br />
werden meist mit einem Breitbandkabel mit<br />
dem Interface verb<strong>und</strong>en, so dass die zuweilen<br />
etwas unübersichtliche Verbindung der Schaltbauteile<br />
mit Einzelkabeln entfällt. Das abgebildete<br />
Platinenmodell „HIBS-Kreuzung“ zeigt<br />
die Ampelanlage an einer Straßenkreuzung mit<br />
Autoampeln, Fußgängerampeln, Reedkontakten,<br />
Fußgängertaster <strong>und</strong> Helligkeitssensor. Das<br />
komplexe <strong>und</strong> realitätsnahe Modell bietet eine<br />
Vielzahl an Programmiermöglichkeiten. Die<br />
„HIBS-Kreuzung“ kann u.a. mit dem Multiface<br />
betrieben werden.<br />
Die HIBS-Kreuzung lässt sich auch mit dem<br />
preiswerten HIBS-Interface steuern.<br />
LLWin: Editierbildschirm mit verzweigtem Programm<br />
Platinenmodell HIBS-Kreuzung<br />
Im Gegensatz zur hier gezeigten Lösung der Programmieraufgabe innerhalb eines linearen<br />
Programmes ist das Arbeiten mit Unterprogrammen (Prozeduren) eleganter <strong>und</strong> übersichtlicher. Es<br />
kann zu jeder Ampelphase eine Prozedur erstellt werden. Die Module werden dann im<br />
Hauptprogramm in der gewünschten Abfolge aufgerufen.
38<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Das einfache Programm zur Steuerung einer Auto- <strong>und</strong> einer Fußgängerampel kann auf vielfältige<br />
Weise erweitert werden:<br />
• an einem wenig benutzten Fußgängerübergang wird ein Taster installiert <strong>und</strong> das Grün für die<br />
Fußgänger wird nach Drücken der Taste aktiviert,<br />
• bei Einbruch der Dunkelheit stellt die Ampel auf gelbes Blinken um (Helligkeitssensor),<br />
• Kombination von Hell-Dunkel-Schaltung mit Fußgängertaster,<br />
• über einen Magnetsensor kann die Anzahl der vorbeigefahrenen Fahrzeuge einbezogen werden.<br />
Unterrichtlich lassen sich eine Vielzahl an Fragestellungen aufgreifen:<br />
• historische Entwicklung der Verkehrsregelung,<br />
• Aufbau von Ampelanlagen an verschiedenen Kreuzungstypen (reale Erk<strong>und</strong>ung),<br />
• Erfassen der Schaltfolgen von Ampelanlagen <strong>und</strong> umsetzen im Modell,<br />
• spezielle Ampelanlagen <strong>und</strong> ihre Schaltfolgen (Fußgängerampel, Baustellenampel, etc.).<br />
Die vorgestellten Konzepte haben jeweils Vor- <strong>und</strong> Nachteile, weshalb keine eindeutigen<br />
Empfehlungen für bestimmte Einsatzbereiche ausgesprochen werden können. Da die Produkte<br />
jedoch weiterentwickelt werden <strong>und</strong> auch neue Produkte angekündigt sind, ist das Problem der<br />
Programmiersprache kein Hinderungsgr<strong>und</strong> für einen lehrplankonforme Behandlung der<br />
Gerätesteuerung in der Sonderschule.<br />
Die Übersicht zeigt, welches Interface mit welchen Bauteil-Systemen kombiniert werden kann. In<br />
den grau schattierten Zellen finden Sie den Namen des Programmierwerkzeuges, in der Spaltenkopfzeile<br />
den Interface-Typ <strong>und</strong> im Zeilennamen das entsprechende Material (Modelle/Bauteile).<br />
Interface-Modell<br />
Modelle/Bauteile<br />
Multiface<br />
HIBS-<br />
Interface<br />
PDV-Minilabor (Weber) * WinLogo WinLogo<br />
fischertechnik WinLogo WinLogo<br />
Cornelsen Experimenta * WinLogo WinLogo<br />
Lego Dacta<br />
* Materialien: fischertechnik<br />
Anbieterinfos<br />
LegoDacta, Technologica - Technik LPE<br />
Multiface - Knobloch GmbH, Technik LPE<br />
HIBS-Komponenten - Knobloch GmbH<br />
PDV-Minilabor - Knobloch GmbH, Dümmler Verlag<br />
WinLogo - Knobloch GmbH, Dümmler Verlag, CoTec<br />
FiProWin - cornelsen experimenta<br />
LLWin - Knobloch GmbH, fischertechnik, Fachhandel<br />
Lego Dacta<br />
Control Lab<br />
Interface<br />
Technologica<br />
WinLogo<br />
Cornelsen<br />
Experimenta<br />
Interface<br />
FiProWin<br />
LLWin<br />
WinLogo<br />
FiProWin<br />
LLWin<br />
WinLogo<br />
FiProWin<br />
LLWin<br />
WinLogo<br />
fischertechnik<br />
Interface<br />
FiProWin<br />
LLWin<br />
WinLogo<br />
FiProWin<br />
LLWin<br />
WinLogo<br />
FiProWin<br />
LLWin<br />
WinLogo
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 39<br />
Computergesteuerte Maschinen<br />
Die moderne Arbeitswelt ist geprägt durch den zunehmenden Einsatz computergesteuerter<br />
Maschinen sowie die fortschreitende Vernetzung der Computersysteme. Wurden z.B. bei<br />
Maschinen zum Fräsen, Bohren bzw. Drehen von Metallwerkstücken zunächst die<br />
Steuerungsbefehle unmittelbar in ein Steuermodul an der Maschine eingegeben (NC-Technik), so<br />
ermöglicht die CNC-Technik (CNC: ComputerisizedNumericControl) die Ansteuerung der<br />
Maschine mit Hilfe eines Computers. Zusammen mit der CAD-Technik (CAD:<br />
ComputerAidedDesign) kann die Maschine auf der Gr<strong>und</strong>lage einer technischen Zeichnung <strong>und</strong> der<br />
Festlegung der Fertigungsschritte vom Computer gesteuert werden. Komplexen wie auch einfachen<br />
Produktionsprozessen liegen dabei dieselben Strukturen zu Gr<strong>und</strong>e: Von der Produktionsentscheidung<br />
über die Planung <strong>und</strong> die Fertigung mit den jeweils geeigneten Werkzeugen <strong>und</strong><br />
Fertigungsschritten.<br />
Da die Schule auch auf die Anforderungen des Berufslebens vorbereiten soll, muss sie sich mit den<br />
veränderten Strukturen der Arbeitswelt auseinander setzen. Gerade die Sonderschule steht vor der<br />
schwierigen Aufgabe, die objektive „Logik des Gegenstandes“ mit den individuellen<br />
Lernmöglichkeiten der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler in Einklang zu bringen. Aufgr<strong>und</strong> der<br />
Komplexität des Sachverhalts sind pädagogische Konzepte zu entwickeln, die jedem Schüler eine<br />
seinen Möglichkeiten entsprechende Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichen.<br />
Dies kann nur durch praktische Auseinandersetzung in Projekten erfolgen, in denen sich die <strong>Neue</strong>n<br />
Technologien wiederfinden, da nur so die erforderlichen Kompetenzen entwickelt werden können.<br />
Für solche Projekte, die vom Schüler eigenes Tätigsein mit vorausschauendem Denken,<br />
planmäßigem Handeln <strong>und</strong> kontrolliertem Eingreifen fordern,<br />
ist schülergeeignete Hard- <strong>und</strong> Software erforderlich.<br />
Schulgeeignete einfache Fräs- <strong>und</strong> Bohrmaschinen, zu denen<br />
auch geeignete Software verfügbar ist, werden heute zu<br />
erschwinglichen Preisen angeboten. Sie ermöglichen das<br />
bohrende <strong>und</strong> fräsende Bearbeiten von Holz, Leichtmetallen<br />
<strong>und</strong> Kunststoffen sowie Verb<strong>und</strong>werkstoffen wie etwa Platinen.<br />
In der Maschine (hier in einem geschlossenen Sicherheitsgehäuse)<br />
arbeitet eine Fräsmaschine, die in drei Richtungen<br />
bewegt werden kann.<br />
Die Maschinen eignen sich zum Herstellen von Holzspielzeug<br />
(z.B. Steckspiele, Labyrinthspiele), Türschildern, Griffelkästen,<br />
Formelementen, etc.<br />
Abb.: Computergesteuerte Bohr- <strong>und</strong><br />
Fräsmaschine ISEL CPM 3020<br />
Zu den Maschinen werden CAD-Programme angeboten, die eine<br />
Schnittstelle zur Maschine aufweisen, d.h. auf der Basis einer mit dem Programm erstellten<br />
Zeichnung werden Arbeitsschritte definiert, die mit einem Verbindungskabel zur Abarbeitung an<br />
die Maschine übertragen werden.<br />
Einfache Zeichnungen können mittels CAD-Programmen auch von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
angefertigt werden.
40<br />
Y Beispiel aus dem Unterricht<br />
Steckspiel „Mensch ärgere dich nicht“<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Zeichnen<br />
Mit dem CAD-Programm (hier WinSCAD) wird die<br />
Zeichnung erstellt. Objekte, die in einem Arbeitsgang<br />
abgearbeitet werden sollen, müssen sich auf einer Ebene<br />
(Layer) befinden. Auch die Objekte, die die Maschine<br />
ignorieren muss, da sie nur als Zeichnungshilfen benötigt<br />
werden, liegen auf einer eigenen Ebene. In der Zeichnung ist<br />
jeder Ebene eine Farbe zugeordnet.<br />
Dann werden in die beiden Arbeitsschritte in einem<br />
Dialogfenster definiert: Welche Ebene wird (mit welchem<br />
Werkzeug) wie tief <strong>und</strong> mit welcher Arbeitsgeschwindigkeit<br />
abgearbeitet?<br />
Fertigen<br />
Nun wird der Rohling sorgfältig mit Beilagehölzern in die<br />
Maschine eingespannt, die Maschine wird in geschlossenem<br />
Zustand zunächst zum Maschinennullpunkt <strong>und</strong> dann zum<br />
Werkstücknullpunkt (vorne/links/oben) gefahren.<br />
Ist das richtige Werkzeug für den ersten Arbeitsschritt<br />
eingesetzt, wird zur Probe der Schritt zunächst über dem<br />
Werkstück ausgeführt, ehe die Ausführung gestartet wird.<br />
Werkzeugwechsel: Für den zweiten Arbeitsschritt (Senken) wird ein Halbr<strong>und</strong>fräser<br />
eingesetzt. Dann wird der zweite Fertigungsschritt ausgeführt.<br />
Während des Fräsens saugt ein Holzsauger die Fräsabfälle ab.<br />
Bei der Serienfertigung wird zunächst Fertigungsschritt 1 in der gewünschten Zahl<br />
ausgeführt, so dass das Werkzeug nur einmal gewechselt werden muss.<br />
Holzsteckspiele eignen<br />
sich gut für die teilweise<br />
Fertigung mit einer<br />
computergesteuerten<br />
Bohr- <strong>und</strong> Fräsmaschine,<br />
da die in Position <strong>und</strong><br />
Bohrtiefe präzisen<br />
Bohrungen manuell nur<br />
schwer erreichbar sind.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 41<br />
CNC-Fertigung<br />
Vorbereiten<br />
Entscheidung<br />
zur Fertigung<br />
eines<br />
Produktes<br />
nach Duismann 1997<br />
PC einschalten<br />
Programm starten<br />
Produkt<br />
am Bildschirm<br />
auswählen<br />
(Datei auswählen)<br />
Zeichnung<br />
erstellen <strong>und</strong><br />
Arbeitsschritte<br />
eingeben<br />
Simulation<br />
(als Probelauf)<br />
starten<br />
Serienfertigung<br />
Produzieren<br />
Anlage<br />
rüsten<br />
Anlage<br />
bestücken<br />
Fertigung<br />
starten<br />
Produkt<br />
(oder Teilprodukt)<br />
entnehmen<br />
Probelauf<br />
(z.B. oberhalb des<br />
Werkstückes)<br />
Abschließen<br />
Anlage<br />
außer Betrieb<br />
setzen<br />
ProduPlan<br />
Im Rahmen des Modellversuchs „<strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Werkstufe/Abschlussstufe<br />
der Schule für Geistigbehinderte“ (IKOG) wurde das Programm ProduPlan<br />
entwickelt, mit dessen Hilfe Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler mit geistiger Behinderung weitgehend<br />
selbstständig eine computergesteuerte Bohr- <strong>und</strong> Fräsmaschine bedienen können.<br />
Produplan ermöglicht keine Konstruktion, sondern nur eine Bedienung der Maschine zum Zwecke<br />
der Fertigung von Projekten, die bereits in ProduPlan enthalten sind, oder von einem Fachmann<br />
(z.B. Lehrer) mit einem anderen CAD-Programm erstellt <strong>und</strong> in ProduPlan importiert werden. Der<br />
Schüler sieht die verfügbaren Projekte als Abbildungen in einem Browser <strong>und</strong> wählt das<br />
gewünschte Projekt aus.<br />
Dann durchläuft er mit ProduPlan den Fertigungsprozess <strong>und</strong> erhält in jeder Phase auf dem<br />
Bildschirm in großformatiger Darstellung angezeigt, was er gerade<br />
an der Maschine oder am Computer tun muss. Diese grafische<br />
Hilfe wird durch eine Sprachausgabe unterstützt. Gerade bei den<br />
schwierigen Aufgaben, wie etwa dem Einstellen des Werkstücknullpunktes,<br />
zeigt ProduPlan sehr einfache Lösungen, die auch<br />
dem Anspruch gerecht werden, dem Schüler einen angemessenen<br />
Einblick in die Struktur des Vorgangs zu ermöglichen.<br />
Die abgestuften textlichen, grafischen <strong>und</strong> akustischen Hilfen ermöglichen eine weitgehende<br />
Anpassung der Bedienung im Hinblick auf die individuellen Erfordernisse einzelner Schüler.<br />
ProduPlan arbeitet mit der Maschine ISEL CPM 3020 zusammen.<br />
Bezugsquelle: Technik LPE, machmit e.V. Berlin
42<br />
Strukturraster Geräte <strong>und</strong> Maschinen steuern<br />
STUFE Lerninhalte<br />
Oberstufe − Maschinen mit<br />
herkömmlicher<br />
Steuerung kennen<br />
− Computer, Steuerbox<br />
<strong>und</strong> zu steuernde<br />
Geräte verbinden<br />
− An den Computer<br />
angeschlossene<br />
Geräte mit Hilfe eines<br />
Programmes steuern<br />
− Mit einer computergesteuerten<br />
Bohr-<br />
<strong>und</strong> Fräsmaschine<br />
arbeiten<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Handhabungskompetenz<br />
− Steuerbox an Computer<br />
anschließen<br />
− Ausgänge der<br />
Steuerbox mit Aktoren<br />
(Lampen <strong>und</strong><br />
Motoren) verbinden<br />
können<br />
− Eingänge der Steuerbox<br />
mit Sensoren<br />
(Taster, Helligkeitssensor)<br />
verbinden<br />
− Die Funktionstüchtigkeit<br />
des Modells<br />
überprüfen.<br />
− Ausgänge mit Hilfe<br />
geeigneter Software<br />
über den Computer<br />
schalten können<br />
(Direktsteuerung)<br />
− Wichtige Steuerungsbefehle<br />
im Direktmodus<br />
eingeben<br />
können (ein- <strong>und</strong><br />
ausschalten von<br />
Ausgängen)<br />
− Eine Folge von<br />
Steuerungsbefehlen<br />
zu einem Programm<br />
zusammenstellen <strong>und</strong><br />
ausführen lassen<br />
− Wiederkehrende<br />
Abläufe durch Erstellen<br />
von Programmschleifen<br />
erzeugen<br />
− Programme durch<br />
Unterprogramme<br />
strukturieren<br />
− Ein Programm<br />
speichern, laden,<br />
einsetzen<br />
− Eine computergesteuerte<br />
Bohr- <strong>und</strong><br />
Fräsmaschine für die<br />
Herstellung eines<br />
Werkstückes vorbereiten<br />
− Mit Hilfe einer computergesteuertenMaschine<br />
ein Produkt<br />
herstellen<br />
Auswahl- <strong>und</strong><br />
Bewertungskompetenz<br />
− Erkennen, ob ein<br />
Programm besser mit<br />
Hilfe von Unterprogrammen<br />
erstellt<br />
wird<br />
− Vor- <strong>und</strong> Nachteile<br />
der computergesteuerten<br />
Fertigung erkennen<br />
− Auswirkungen auf<br />
Arbeitsplätze <strong>und</strong><br />
berufliche<br />
Anforderungen<br />
erkennen<br />
Gestaltungskompetenz
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 43<br />
Daten übertragen <strong>und</strong> Informationen suchen<br />
Vorbemerkungen<br />
Digitale Kommunikations- <strong>und</strong> Publikationsformen nehmen einen immer größer werdenden Raum<br />
im Kommunikationsspektrum ein. Ist ihre Nutzung bislang weitgehend auf ein freiwilliges<br />
Zugreifen des Nutzers beschränkt, so ersetzen sie – nicht zuletzt aufgr<strong>und</strong> erheblicher Vorteile bei<br />
Wirtschaftlichkeit <strong>und</strong> Flexibilität – zunehmend andere Kommunikationsformen. Ihre Nutzung wird<br />
für die Teilnahme am öffentlichen Leben wachsende Bedeutung erlangen.<br />
Viele Institutionen veröffentlichen bereits wichtige Informationen im Internet oder bei Online-<br />
Diensten. Der Leser kann an seinem entsprechend ausgestatteten PC die Dokumente am Bildschirm<br />
einsehen, auf seinem Drucker drucken, dem Urheber eine Nachricht zukommen lassen, ein Online-<br />
Formular ausfüllen oder sich ein Dokument (Text-, Bild-, Ton- oder Videodokument) in den<br />
eigenen Computer zur weiteren Nutzung herunterladen (Download).<br />
Verwaltungen werden Dienstleistungen zunehmend aufs Internet verlagern <strong>und</strong> es den Bürgern<br />
ermöglichen, Verwaltungsangelegenheiten vom heimischen Computer aus zu erledigen.<br />
Banken bieten Kontoführung per Computer an, oft preisgünstiger, da ohne Personalkosten (<strong>und</strong><br />
ohne persönliche Betreuung), Datenbanken ermöglichen Recherchen (z.B. Telefonnummern,<br />
Bahnverbindungen, Reiserouten), Arbeitsvermittlungen offerieren über Online-Dienste Stellen.<br />
Städte bieten aktuelle Informationen <strong>und</strong> Veranstaltungshinweise. Elektronische Post (E-Mail) ist<br />
ein sehr schnelles <strong>und</strong> unkompliziertes Medium zur schriftlichen Kommunikation nebst<br />
Übertragung von Dateien, allerdings ohne das sonst wertvolle Briefgeheimnis.<br />
Die zunehmende Bedeutung dieser Kommunikationsformen im Alltag stellt die Förderschulen vor<br />
die Aufgabe, die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler mit diesen Kommunikationsformen vertraut zu machen.<br />
Diese sollen die wichtigsten dieser Publikations- <strong>und</strong> Kommunikationsformen, insbesondere das<br />
WorldWideWeb (WWW) sowie E-Mail kennen <strong>und</strong> nutzen können <strong>und</strong> ihre Struktur in<br />
Gr<strong>und</strong>zügen modellhaft verstehen. Sie sollen mit Hilfe geeigneter Werkzeuge (Suchmaschinen)<br />
Informationen suchen <strong>und</strong> nutzen. Indem sie selbst Informationen im Internet publizieren, können<br />
sie sich die gr<strong>und</strong>legenden Strukturen elektronischen Publizierens leichter erschließen. Die Nutzung<br />
des Internets erfordert eine gewisse Lesefertigkeit, eine kognitive <strong>und</strong> motorische Kompetenz,<br />
jedoch nur ganz geringe technische Kenntnisse.<br />
Die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler lernen auch Auswirkungen dieser Techniken auf die Arbeitswelt, auf<br />
den Lebensalltag sowie auf spezielle Berufsfelder kennen.<br />
Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden sich im Kapitel 4 „Internetnutzung“.<br />
Y Tipps für den Unterricht<br />
• Recherchieren in digitalen Datenbanken (z.B. Telefonverzeichnis, Routenplaner)<br />
• Suchen <strong>und</strong> Aufbereiten von Informationen zu aktuellen Themen<br />
• E-Mail-Kontakte mit anderen Schulen, ggf. mit Dokumentenübertragung<br />
• Regelmäßiges Lesen von geeigneten Online-Publikationen<br />
• Teilnahme an Diskussionsforen (z.B. auf Kinderwebseiten)<br />
• Chatten in geeigneten Chat-Rooms
44<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
• Download von Software (z.B. Virenscanner, Shareware, Freeware)<br />
• Übernahme von Texten in die Textverarbeitung, Speichern von Grafiken (Urheberrecht<br />
beachten)<br />
Praxisskizze: Vorbereiten der Klassenfahrt - <strong>Informations</strong>suche im Internet<br />
• Informieren über Unterkunft (z.B. Jugendherbergen)<br />
• Informieren über Zugverbindungen<br />
• Informieren über Fahrtrouten für Auto/Bus<br />
• Informieren über die Zielregion (wichtige Informationen zum Zielort, Sehenswürdigkeiten <strong>und</strong><br />
Hintergr<strong>und</strong>informationen, Stadtplan, Nahverkehrsverbindungen, Veranstaltungen)<br />
Texte <strong>und</strong> Grafiken der <strong>Informations</strong>seiten können gespeichert <strong>und</strong> bei Bedarf in einer kleinen<br />
Broschüre oder für ein Plakat ausgedruckt werden. Gespeicherte Grafiken können auch bei der<br />
Nachbereitung der Fahrt genutzt werden.<br />
Internetangebote für Kinder (Auswahl)<br />
www.blinde-kuh.de<br />
Suchmaschine für Kinder<br />
Internetseiten für Kinder bieten meist<br />
kindgerechte Nachrichten, Berichte, Fortsetzungsgeschichten,<br />
Witze, Diskussionen über<br />
aktuelle Themen, Chats. Oft wird auch über<br />
Computer <strong>und</strong> Internet informiert. Einige Seiten<br />
bieten Kindern das Publizieren eigener<br />
Infoseiten an.<br />
www.kindernetz.de<br />
Kinderseiten des SWR<br />
www.sowieso.de<br />
Online-Kinderzeitschrift<br />
www.goere.de<br />
Aktuelle Seiten für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<br />
www.kinderinfo.de<br />
Umfangreiche Linkliste für Kinder <strong>und</strong> Eltern<br />
www.lilipuz.de<br />
WDR-Kinderseiten<br />
www.wdrmaus.de<br />
Die Maus-Seiten.<br />
www.terzio.de/löwenzahn<br />
Die Seiten zur Fernsehserie <strong>und</strong> CD-Rom-Reihe<br />
www.kindersache.de<br />
Deutsches Kinderhilfswerk u.a. mit der Online-Zeitung rabatz<br />
www.greenpeace.de (dann Link „Kids“)<br />
Umweltinformationen<br />
Abb.: Internetseite SWR-Kindernetz<br />
www.geolino.de<br />
Die Internetseiten der Zeitschrift GEOLINO mit sachk<strong>und</strong>lichen Themen.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 45<br />
Übersicht: Datenfernübertragung<br />
STUFE Lerninhalte<br />
Mittelstufe − Nutzung altersgemäßerInternetangebote<br />
Oberstufe − verb<strong>und</strong>ene<br />
Computer -<br />
Computernetze<br />
Handhabungskompetenz<br />
− mit geeigneter Software<br />
altersgemäße<br />
Inter- oder Intranetangebote<br />
nutzen<br />
− Daten auf verb<strong>und</strong>enen<br />
Computer<br />
übertragen können<br />
− Zugang zum Internet − Internet-Browser starten<br />
können (konfigurierte<br />
ISDN-/Modem-<br />
Verbindung zum<br />
Internet aufrufen)<br />
− Internet als<br />
<strong>Informations</strong>medium<br />
− Kommunikationsform<br />
E-Mail<br />
− Aufbau einer<br />
Internetseite<br />
− eine Internet-Adresse<br />
eingeben können<br />
− im Internet gezielt<br />
nach Informationen<br />
suchen können<br />
− Internet-Adressen als<br />
Lesezeichen<br />
speichern können<br />
− Internetseite ausdrucken<br />
können<br />
− Texte/Grafiken aus<br />
einer Internetseite<br />
kopieren können<br />
− Suchmaschinen zur<br />
<strong>Informations</strong>recherche<br />
einsetzen können<br />
− in einer interaktiven<br />
Datenbank Informationen<br />
suchen können<br />
− geeignetes E-Mail-<br />
Programm bedienen<br />
können:<br />
E-Mail erstellen,<br />
adressieren,<br />
lesen können<br />
E-Mails abschicken<br />
<strong>und</strong> abholen können<br />
− Strukturelemente der<br />
Internetseite kennen:<br />
Text, Grafik, Links,<br />
Animationen<br />
Auswahl- <strong>und</strong><br />
Bewertungskompetenz<br />
− −<br />
− Zugriff auf externe<br />
Daten / externer<br />
Zugriff auf eigene<br />
Daten<br />
− <strong>Informations</strong>strukturen<br />
des Internet beurteilen<br />
können:<br />
- öffentliche<br />
Angebote<br />
- kommerzielle<br />
Informationen<br />
- private<br />
Informationen<br />
− Kostenseite der<br />
Internetnutzung<br />
einschätzen können<br />
− Kosten verschiedener<br />
Internet-Zugangsmöglichkeiten<br />
vergleichen können<br />
− Vorteile der elektronischenKommunikation<br />
kennen <strong>und</strong><br />
nutzen können<br />
− digitale Kommunikation<br />
als eine von<br />
vielen Kommunikationsmöglichkeiten<br />
sehen<br />
− geeignete Einsatzbereiche<br />
der elektronischen<br />
Post kennen<br />
Gestaltungskompetenz<br />
− einfache Internetseite<br />
mit geeignetem<br />
Programm erstellen<br />
können
46<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Gr<strong>und</strong>wissen Hard- <strong>und</strong> Software<br />
Vorbemerkungen<br />
Bei der Beschäftigung mit dem Computer eignen sich die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnisse über den Computer sowie über Betriebssystem <strong>und</strong> Anwendersoftware an. Diese<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnisse <strong>und</strong> Kompetenzen – ergänzt durch sinnvolle Erklärungen <strong>und</strong> Modelle – sollen<br />
einen sachgerechten <strong>und</strong> effektiven Umgang mit vertrauten <strong>und</strong> ein ökonomisches Einarbeiten bei<br />
neuen Programmen <strong>und</strong> Systemen ermöglichen. Aufgr<strong>und</strong> der schnellen Weiterentwicklung der<br />
Systeme müssen Strukturkenntnisse vermittelt werden, die übergreifend auch auf andere<br />
Programme <strong>und</strong> Betriebssysteme angewandt werden können.<br />
Dies bezieht sich auf die Hardware-Komponenten, zu denen dem Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler ein<br />
plausibles Funktionskonzept vermittelt werden sollte, in dem die wichtigsten Komponenten mit<br />
ihren Gr<strong>und</strong>funktionen enthalten sind.<br />
Der zweite Bereich ist das Betriebssystem einschließlich der Netzfunktionen. Das Netzkonzept, das<br />
– ob lokal oder global – immer mehr an Bedeutung gewinnt, erfordert spezielle Nutzungsstrukturen,<br />
die beim Einloggen beginnen <strong>und</strong> auch spezielle Aspekte wie Datenschutz <strong>und</strong> Virengefahr<br />
einschließen müssen. Auf der Programmebene begegnet der Anwender Betriebssystemstrukturen<br />
wie Zwischenablage, Verzeichnisstruktur, Druckerdialog oder Schriftenmanagement, oft in<br />
unterschiedlichen Darstellungsformen. Hat der Schüler die Gr<strong>und</strong>struktur verstanden, kann er diese<br />
in der neuen Darstellungsform leichter erkennen <strong>und</strong> diese besser verstehen. Die Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler müssen sich diese gr<strong>und</strong>legenden Funktionen <strong>und</strong> Begriffe bei der Arbeit mit den<br />
Anwendungsprogrammen erschließen. Darauf aufbauend können diese auf einer höheren Ebene<br />
aufgearbeitet werden, indem z.B. eine Verzeichnisstruktur für die geordnete Speicherung der<br />
erstellten Dateien erarbeitet <strong>und</strong> dann mit dem Explorer am Computer erstellt wird. Diese selbst<br />
erstellte Speicherstruktur kann dem Schüler dann in den verschiedensten Kontexten <strong>und</strong> ggf. auch<br />
in unterschiedlichen Darstellungen begegnen. Er benötigt sie beim Speichern einer Grafik aus dem<br />
Internet, beim Speichern seiner Texte, beim Suchen der Grafik, die er in seinen Text einfügen<br />
möchte <strong>und</strong> beim Speichern <strong>und</strong> Öffnen einer Grafik, die ihm sein Fre<strong>und</strong> mit einer E-Mail<br />
mitgeschickt hat.<br />
Mit Gr<strong>und</strong>kenntnissen über die Dateiformate weiß er, dass viele Programme nur die Dokumente<br />
öffnen (können), die ihrem Dateiformat entsprechen <strong>und</strong> dass auch im Explorer (Dateimanager) das<br />
Format einer Datei erkennbar ist. Schließlich kann z.B. bei Grafikdateien ein Übertragen in ein<br />
anderes Dateiformat (Konvertieren) erforderlich sein, ein Vorgang, in dem sich die eben genannten<br />
Aspekte wieder finden.<br />
Viele Dokumente werden mit Hilfe von Objekten erstellt, deren Behandlung programmübergreifenden<br />
Regeln gehorcht. Objekte können verschoben, gelöscht, oft skaliert, gedehnt oder<br />
gestaucht werden. Das DTP-Programm baut auf dieses Prinzip ebenso wie das Grafikprogramm <strong>und</strong><br />
auch die Text- <strong>und</strong> Grafikrahmen in der Textverarbeitung. Auf Gr<strong>und</strong> der mittlerweile erreichten<br />
Funktionsvielfalt der Programme stellen solche Bedienfunktionen zwar nur einen minimalen<br />
Ausschnitt dar.<br />
Mit dem Kombinieren der wenigen hier genannten Strukturen können bereits komplexe Abläufe<br />
realisiert werden.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 47<br />
Strukturraster Gr<strong>und</strong>wissen Hard- <strong>und</strong> Software<br />
STUFE Lerninhalte<br />
Handhabungskompetenz<br />
Unterstufe − Gerätebedienung − sachgerechte<br />
Bedienung von<br />
Geräten <strong>und</strong><br />
schülergerechter<br />
Programmen<br />
− Computernetze − sich in einem<br />
(lokalen)<br />
Computernetz an-<br />
<strong>und</strong> abmelden<br />
Mittelstufe − Dateien − erstellte Dateien in<br />
vorgegebenen<br />
Ordnern speichern<br />
− Dateien auf Diskette<br />
speichern<br />
− gespeicherte Dateien<br />
öffnen<br />
− Kopieren/Einfügen − Textteile bzw. Grafiken<br />
kopieren <strong>und</strong> an<br />
gewünschter Stelle<br />
einfügen<br />
Oberstufe − Dateien − Dateien umbenennen<br />
− Dateien löschen<br />
− Dateien kopieren <strong>und</strong><br />
verschieben<br />
− Dateien zur Sicherung<br />
auf externen<br />
Datenträger kopieren<br />
− Dateitypen − Dateien mit geeigneten<br />
Programmen<br />
öffnen<br />
− Grafikdateien in Textdokumente<br />
einbinden<br />
− Grafikdateien<br />
konvertieren<br />
− Verzeichnisse − Verzeichnisse finden<br />
− Verzeichnisse<br />
erstellen<br />
− Computeranlage − die wichtigsten Komponenten<br />
der Computeranlage<br />
miteinander<br />
verbinden können<br />
− Computernetze − Netzwerkangebote<br />
nutzen (z.B. Drucker)<br />
Auswahl- <strong>und</strong><br />
Bewertungskompetenz<br />
− erkennen, dass sachgerechteHandhabung<br />
zur Sicherung<br />
der Funktionsfähigkeit<br />
erforderlich ist<br />
− Wissen, dass Starten<br />
<strong>und</strong> Herunterfahren<br />
wichtige Prozesse<br />
sind<br />
− Vorteile fester <strong>und</strong><br />
mobiler Datenträger<br />
erkennen<br />
− Arbeitserleichterung<br />
durch Kopieren/-<br />
Einfügen bei geeigneten<br />
Aufgaben<br />
erkennen<br />
− Verschieben <strong>und</strong><br />
Kopieren sinnvoll<br />
einsetzen<br />
− Notwendigkeit der<br />
externen<br />
Datensicherung<br />
erkennen<br />
− wissen dass es<br />
verschiedene<br />
Dateitypen gibt <strong>und</strong><br />
dass sie nur von<br />
bestimmten<br />
Programmen geöffnet<br />
werden können<br />
Gestaltungskompetenz<br />
− sinnvolle Dateibezeichnungen<br />
finden<br />
− sachgerechte<br />
Verzeichnisstruktur<br />
erstellen
48<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
2.3 Weitere unterrichtliche Einsatzmöglichkeiten<br />
Einsatz des Computers im Musikunterricht<br />
Die Beeinflussung weiter Bereiche des Lebens durch den Computer hat auch vor der Musik nicht<br />
halt gemacht. Auch im Unterrichtsfach Musik müssen Lehrkräfte <strong>und</strong> Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
sich auf eine Computerwelt einstellen, die mit einer immensen <strong>Informations</strong>fülle daherkommt, viele<br />
<strong>und</strong> vielfältige neue Anwendungsmöglichkeiten mit sich bringt <strong>und</strong> somit die Reflexion neuer<br />
didaktischer <strong>und</strong> methodischer Ansätze herausfordert. Das neue Medium wird in Zukunft die<br />
Musikdidaktik nicht weniger verändern als es Edison mit seinen Walzen <strong>und</strong> später dann<br />
Schallplatte <strong>und</strong> Tonbandgerät taten.<br />
Noch immer gibt es an Schulen (die nicht mehr produzierten) ATARI-Systeme, auf denen mit<br />
einem einfachen Programm wie „musicwriter“ für 20.- DM auch in einer Klasse 6 der Förderschule<br />
recht schnell <strong>und</strong> ohne „große Notenkenntnisse“ z.B. ein mehrstimmiger Kanon „gebaut“ <strong>und</strong> zum<br />
Klingen gebracht werden kann. Durch schnelle Parameterveränderung können Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler spielerisch erfahren, was es bedeutet, die Tonhöhe zu verändern (Transponieren), das<br />
Tempo zu verändern (<strong>und</strong> mithin auch das Notenbild) oder richtige Vorzeichen wegzunehmen <strong>und</strong><br />
damit die Melodie „falsch“ klingen zu lassen.<br />
Der klingende „Notenblattbildschirm“ wird zum spielerischen Experimentierfeld - ein völlig anderer<br />
Zugang als über das traditionelle Notenlernen - <strong>und</strong> für Sonderschüler besonders geeignet.<br />
Wie weit <strong>und</strong> wie intensiv der Rechnereinsatz im Musikunterricht der Sonderschule möglich ist,<br />
hängt natürlich zum einen von der musikalischen Vorbildung <strong>und</strong> Interessenlage der<br />
Unterrichtenden <strong>und</strong> deren Zugang zur neuen Technologie ab, zum anderen aber auch von der<br />
Lerndisposition der beeinträchtigten Kinder.<br />
Die Unterrichtenden können mit diesem neuen Medium den Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern nicht nur<br />
neue Zugangswege eröffnen (z.B. bei Lernbeeinträchtigungen s.o.), sondern auch neue Erlebnis<strong>und</strong><br />
Erfahrungswelten erschließen. Körperbehinderte Kinder beispielsweise, deren motorische<br />
Fähigkeiten das Spielen eines Instrumentes nicht zulassen, können durchaus auf einer<br />
Bildschirmklaviatur spielen oder mit dem Rechner externe Instrumente steuern, Klänge erzeugen,<br />
Songs produzieren etc. Auch bei sinnesgeschädigten Kindern sind mit Hilfe des Rechners <strong>und</strong><br />
entsprechender Peripheriegeräte bessere oder gar neue Zugänge zur Welt der Musik möglich<br />
geworden.<br />
Inzwischen gibt es eine Fülle von Musiksoftware <strong>und</strong> Programmen guter Qualität für alle<br />
Computersysteme:<br />
Mit Notationsprogrammen kann man vom einstimmigen Lied bis zur Orchesterpartitur ein<br />
druckreifes Notenbild entstehen lassen <strong>und</strong> beliebig verändern, formatieren (Werkanalyse!) <strong>und</strong> als<br />
„klingendes Tafelbild“ (Hörkontrolle!) abspielen lassen kann. Auch das Einscannen von Noten<br />
gehört heute zum Standard dieser Programme.<br />
Sequenzerprogramme dienen zur Aufnahme von Musikstücken (über ein angeschlossenes<br />
Keybord) in Einzelspuren (MIDI Dateien) oder über Mikrofon <strong>und</strong> andere Tonträger (Wave<br />
Dateien) <strong>und</strong> zur Bearbeiten der Tonspuren (Schneiden, Kopieren, Verschieben, Klangfarbenzuordnen,<br />
Tempo, Tonart etc.).<br />
Arrangierprogramme erstellen nach Eingabe von Akkorden <strong>und</strong> Stilart ein fertiges Playback mit<br />
verschiedenen Instrumenten zur individuellen Weiterbearbeitung.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 49<br />
Übungssoftware für die musikalische Elementarlehre gibt es in großer Fülle, meist recht preiswert<br />
<strong>und</strong> in unterschiedlicher methodischer Qualität zum Erlernen des Notenlesens, zur Tonleiterbildung,<br />
zum Dreiklang, zur Rhythmik, zur Gehörbildung etc..<br />
Grafische Notationsprogramme lassen den Anwender auch ohne Notenkenntnisse Kompositionen<br />
entwickeln <strong>und</strong> verdeutlichen in spielerischer Form die Auswirkungen der verschiedenen<br />
Musikparameter (s.o.).<br />
Standard-Midi-Files werden inzwischen in großen Mengen angeboten, komplette Arrangements<br />
sind im Internet oder auf Diskette erhältlich. Sie können mittels Sequenzer- <strong>und</strong><br />
Notationsprogramm hörbar <strong>und</strong> sichtbar werden <strong>und</strong> sind im Gegensatz zu den traditionellen<br />
Tonträgern bearbeitbar.<br />
Unterrichtliche Relevanz<br />
Musiklehrer haben mit dem Computer <strong>und</strong> entsprechenden Programmen willkommene Arbeitsmittel<br />
für die häusliche Vorbereitung <strong>und</strong> die Chance, den (vor allem theoretischen)<br />
Musikunterricht durch das Prinzip des „learning by doing“ anschaulicher <strong>und</strong> begreifbarer als bisher<br />
zu gestalten.<br />
Das Verfügen über beliebig viel <strong>Informations</strong>material in Schrift, Wort, Musik <strong>und</strong> Bild mittels der<br />
Digitaltechniken wirft die Frage nach der „Rentabilität“ der traditionellen Tonträger <strong>und</strong><br />
Notenmaterialien auf.<br />
Die CD-Rom als Datenträger etwa für Musiklexika, <strong>Informations</strong>material zur Instrumentenk<strong>und</strong>e,<br />
Komponistenbiografien <strong>und</strong> Interpretationen von Einzelwerken gewinnt an Bedeutung. Die CD-<br />
Technik wurde inzwischen durch den CD-Brenner ergänzt, der ein Kopieren <strong>und</strong> Selbsterstellen<br />
von CD's erlaubt. Das DVD-Laufwerk wird die CD-Technik bald ablösen.<br />
Zum Recherchieren steht das Internet bereit. Verschiedenste Datenbanken enthalten Archive von<br />
Musikern, Bands, Chören, Orchestern <strong>und</strong> Komponisten. Musiktitel lassen sich sofort per<br />
Mausklick „online“ bestellen. Viele Verlage stellen ihre Titel schon z.T. kostenlos im Netz zur<br />
Verfügung. Mehrere zehntausend Musikstücke (Midi-Files) lassen sich so kostenlos auf den<br />
Computer laden. Hier finden sich neben aktuellen Titeln der Popmusik ebenso fast alle gängigen<br />
Werke der klassischen Musik. Mit der entsprechenden Software können sie nicht nur abgespielt,<br />
sondern auch weiter bearbeitet <strong>und</strong> für eigene Unterrichtszwecke ausgedruckt werden.<br />
An positiven Veränderungen zur herkömmlichen Unterrichtspraxis sind möglich:<br />
• Motivation der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler bei individuellem Training (Spiel) der Elementarlehre<br />
• Einstellung der persönlichen Übungslevel <strong>und</strong> -geschwindigkeit<br />
• Schnelle Verbindung der auditiven <strong>und</strong> visuellen Information<br />
• Unmittelbar hör- <strong>und</strong> sichtbare Ergebnisse der musikalischen Tätigkeit<br />
• Anwendung <strong>und</strong> Übung einer gesellschaftlich relevanten Technik<br />
Anmerkung zur Software<br />
In der Regel ist die Beschaffung teurer Sequenzer- <strong>und</strong> Notensatzprogramme (mit Preisen um<br />
1000.- DM) für die Sonderschule nicht angebracht, da einfache Notationsprogramme, die ab ca. 30,-<br />
DM angeboten werden, ausreichen.<br />
(vgl. <strong>Informations</strong>schrift „<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- u. Kommunikationstechniken - Computereinsatz im Musikunterricht“,<br />
Mai 1998, Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz)
50<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Videoarbeit mit dem Computer<br />
Seit Jahren gehören in vielen Schulen wie auch im privaten Bereich Camcorder <strong>und</strong> Videorecordern<br />
zu einer selbstverständlichen Ausstattung. Häufig wird die Videokamera genutzt um Schulereignisse<br />
wie Schulfeste oder Klassenausflüge o.Ä. im Bilde festzuhalten. Doch immer häufiger<br />
trifft man in den Schulen auf Gruppen oder Arbeitsgemeinschaften, die sich mit dem kreativen<br />
Umgang mit diesem Medium befassen. Aktive Videoarbeit wird somit auch Bestandteil einer<br />
Medienerziehung, die neben den kreativen Ansätzen den Schülern eine gewisse Medienkompetenz<br />
vermitteln soll. In dem rheinland-pfälzischen Modellversuch „Differenzierte Erprobung der<br />
Videoarbeit an Schulen in Rheinland-Pfalz“ (siehe auch Bildungsserver: http://bildungrp.de/LMZ/erprob2.pht)<br />
wurde dieses in Zusammenarbeit <strong>und</strong> unter der Nutzung der technischen<br />
Geräten <strong>und</strong> des Know-how mit den örtlichen Offenen Kanälen (OK) genutzt.<br />
Ohne die Möglichkeit einer technischen Unterstützung von Institutionen wie die OKs muss die<br />
Schule sich eine eigene technische Gr<strong>und</strong>ausstattung für die Videoarbeit anschaffen.<br />
Eine aktive <strong>und</strong> kreative Videoarbeit beinhaltet neben der reinen Aufnahmetechnik mit einer<br />
Videokamera (Systeme: VHS; S-VHS; Video-8; Video-Hi8 <strong>und</strong> neuerdings das digitale DV)<br />
folgende Möglichkeiten einer Nachbearbeitung der Aufnahmen:<br />
Videoschnitt: Darunter versteht man bestimmte Filmabschnitte in eine gewünschte Reihenfolge zu<br />
bringen <strong>und</strong> dann auf ein Band zu überspielen (Bemerkung: der Begriff „Schnitt“ stammt noch aus<br />
der Filmtechnik, wo die bestimmten Szenen geschnitten <strong>und</strong> dann wieder zusammengefügt<br />
wurden).<br />
Effekte: Mit Hilfe von technischen Effekten, wie verschiedene Überblendungen, Bildfiltern,<br />
Verfremdungen, Slow-Motions, Zeitraffer u.v. mehr können Videosequenzen professioneller<br />
gestaltet werden.<br />
Titeleinblendungen: Texteinblendungen wie Titel, Untertitel, Vor- <strong>und</strong> Abspänne können in<br />
verschiedenen Varianten als Stand-, Lauf- Rolltext o.Ä. dem Video ebenfalls einen professionellen<br />
Anstrich geben.<br />
Nachvertonung: Bei der Nachvertonung wird dem schon bearbeiteten Band neben oder auch<br />
anstatt des Originaltons weitere Tonspuren zugesetzt oder miteinander vermischt. Das können zum<br />
Beispiel gesprochen Texte, verschiedene Geräusche oder Musik sein.<br />
Will man all diese Möglichkeiten der Videonachbearbeitung ausnutzen, bedarf es - je nach<br />
Anspruch - verschiedener technischer Komponenten für ein „Videostudio“:<br />
• Schnitt- Mischpult für Video<br />
• Mischpult für Audio<br />
• Effektmischer<br />
• Titelgenerator<br />
• Kontrollmonitore <strong>und</strong> Aufnahmerekorder<br />
Heute kann man anstatt vieler einzelner Geräte einen PC mit Videokarte zur Videobearbeitung<br />
einsetzen, wobei die Videobearbeitung am Computer sehr komfortabel ist <strong>und</strong> nahezu unbegrenzte<br />
Möglichkeiten an Schnitten <strong>und</strong> Effekten bis hin zur Nachvertonung bieten kann.<br />
Man muss dabei verschiedene Verfahren unterscheiden, die auch mit unterschiedlicher PC-<br />
Ausstattungen verb<strong>und</strong>en sind. Neben einigen Mischformen können zwei verschiedene Schnitt- <strong>und</strong><br />
Verarbeitungsverfahren unterschieden werden.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 51<br />
Lineares Schnittverfahren<br />
Bei dieser kostengünstigen Lösung übernimmt der PC die Steuerung von Zuspieler (Camcorder<br />
oder VHS-Rekorder) <strong>und</strong> Aufnahmegerät (VHS-Rekorder), kleinere Effekte <strong>und</strong> Titeleinblendungen<br />
können ebenfalls realisiert werden. Dies ist schon mit einem gewöhnlichen PC <strong>und</strong> der<br />
dazugehörenden Software möglich (vgl. Angebote der Firmen Fast, Como, Pinnacle-System u.a.).<br />
Die Nachteile liegen in den langen Wartezeiten durch Vor- <strong>und</strong> Zurückspulen des Zuspielers sowie<br />
in der starken Beanspruchung <strong>und</strong> dem damit verb<strong>und</strong>enen höherer Verschleiß der Geräte.<br />
Nonlineares Schnittverfahren<br />
Bei diesem Verfahren wird die Videoaufzeichnung digital auf die Festplatte gespeichert. Alle<br />
Bearbeitungsphasen bis hin zur Nachvertonung werden mit spezieller Software am Computer<br />
bearbeitet <strong>und</strong> erst nach der Fertigstellung wieder auf ein Videoband gespielt. Dieses nonlineare<br />
Editing hat den Vorteil, dass im Prinzip nur ein Videogerät, das zugleich Zuspiel- <strong>und</strong><br />
Aufnahmegerät sein kann, benötigt wird. Dieses Verfahren verlangt aber eine höherwertige<br />
Hardwareausstattung, wobei der Bedarf an Festplattenkapazität besonders groß ist. Denn nur für 10<br />
Minuten Videospielzeit mit Ton auf S-VHS oder Hi8-Qualitätsniveau ist ungefähr 2 GB<br />
Festplattenkapazität notwendig, bei DV-Qualität sogar noch mehr.<br />
Die Ausrüstung eines für die<br />
Videonachbearbeitung geeigneten PC<br />
müsste als Mindestanforderung aus<br />
folgenden Komponenten bestehen:<br />
Pentium II mit 233 MHZ oder mehr<br />
mit mindestens 16 Megabyte Hauptspeicher,<br />
eine schnelle Festplatte<br />
(EIDE-, besser SCSI-Festplatte) mit<br />
mehr als 8 Gigabyte Speicherplatz,<br />
schnelle Grafikkarte, Videoschnittkarte<br />
<strong>und</strong> natürlich eine spezielle<br />
Software für die Videobearbeitung.<br />
(vgl. Angebote der o. a. Firmen)<br />
Die Abbildung zeigt die Benutzeroberfläche<br />
auf einem Windowsrechner<br />
mit der Schnittsoftware Studio 400 von Pinnacle System.<br />
Eine Variante bietet die Firma Macro-System mit dem Videobearbeitungscomputer „Casablanca“<br />
an. Dieses Komplettsystem sieht aus wie ein Videorekorder ist aber ein Computer, der Videosignale<br />
auf Festplatte aufzeichnen <strong>und</strong> nachbearbeiten kann. Software- <strong>und</strong> Hardwareausstattung sind<br />
komplett zusammengestellt <strong>und</strong> auf einander abgestimmt. Außer dem obligatorischen Zuspieler <strong>und</strong><br />
dem Aufnahmegerät ist lediglich ein Fernsehmonitor notwendig. Die Handhabung erfolgt über<br />
einen Trackball. Die Benutzerführung ist übersichtlich <strong>und</strong> klar gegliedert, so dass man im Prinzip<br />
über keine Computererfahrung verfügen muss, um sich mit diesem System zurecht zu finden.<br />
Weitere Informationen zu den verschiedenen Computerschnittsystemen bzw. über die Preisgestaltung bei diesen<br />
Produkten gibt das Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz.
52<br />
2.4 Multimedia in der Schule<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Vorbemerkungen<br />
Medium nennt man ein technisches Instrument zum Speichern <strong>und</strong> Anbieten von Informationen<br />
(z.B. Schallplatte <strong>und</strong> Plattenspieler, Videokassette <strong>und</strong> Videorecorder, Buchseite <strong>und</strong> Buch).<br />
Multimedia heißt erst einmal nichts anderes, als dass mehrere Medien nebeneinander eingesetzt<br />
werden.<br />
Wenigstens eines dieser Medien muss ein dynamisches sein, sich also in irgendeiner Form bewegen<br />
(z.B. Animation oder Video). Alle Medien werden innerhalb des Sammel-Mediums Computer,<br />
angeboten.<br />
Wer von multimedialem Lernen spricht, meint damit eigentlich das Lernen mit multiplen<br />
Sinnesmodalitäten (Auge, Ohr) <strong>und</strong> Codierungssystemen (Bild, Schrift, Zahlen).<br />
Wesentliche gemeinsame Merkmale nach dem derzeitigen Stand der Literatur sind:<br />
• Möglichkeit der interaktiven Nutzung, d.h. der Nutzer ist nicht nur ausschließlich Empfänger,<br />
sondern auch Reagierender, Auslöser von Aktionen.<br />
• Möglichkeit der integrativen Verwendung verschiedener Medientypen, wobei dynamische mit<br />
statischen Medien verknüpft werden.<br />
• Möglichkeit der Anwendung digitaler Technik, die erst die Speicherung <strong>und</strong> dann die<br />
Nachbearbeitung der Daten, die den verschiedenen Medien zu Gr<strong>und</strong>e liegen, zulässt.<br />
In der Schule sprechen multimediale Programme vor allem zwei unterschiedliche Wahrnehmungsorgane<br />
des Menschen an: das Auge <strong>und</strong> das Ohr. Die Merkmale von Multimedia lassen<br />
sich deshalb gut mit nachstehender Abbildung darstellen:<br />
Abb. 1 Merkmale von Multimedia 1<br />
„Für den Bildungsprozess <strong>und</strong> damit auch für die Schule ist es in erster Linie nicht entscheidend,<br />
auf welchen Trägern oder Übermittlungswegen (seien es Disketten, CD-ROMs, Online-Dienste<br />
1 Bauer, W.: Multimedia in der Schule?<br />
In: Issing, L. J./Klimsa, P.: Informationen <strong>und</strong> Lernen mit Multimedia, Beltz, 1997 2 , S. 377f
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 53<br />
oder dgl.) diese Informationen den Anwender erreichen. Sie werden in der Regel über einen<br />
Farbmonitor (visuelle Elemente) <strong>und</strong> Kopfhörer bzw. Stereo-Lautsprecher (auditive Elemente) als<br />
Ausgabeelemente an den Schüler herangetragen. Als interaktive Eingabe-, Steuerungs- <strong>und</strong><br />
Bedienungs-Elemente (haptisch/taktile Elemente) für die meisten multimedialen Programme dienen<br />
vielfach „mechanisch-elektronische Geräte“, wie Maus oder Tastatur, Touch-Screen-Monitor,<br />
Digitizer-Stift, Joystick u.a. Eine Sprachsteuerung des Programms <strong>und</strong>/oder eine Spracheingabe ist<br />
über ein Mikrofon evtl. auch möglich.“ (Bauer 1997, S. 379)<br />
Merkmale traditioneller <strong>und</strong> multimedialer Programme<br />
Die meisten audiovisuellen Medien werden in unseren Schulen zur Darbietung <strong>und</strong> Veranschaulichung<br />
von Wissensinhalten sowie zur Einstimmung auf ein Thema eingesetzt.<br />
Die traditionellen Medien liegen hier meist in einer analogen Form auf ihren Trägern vor, <strong>und</strong> der<br />
Zugriff auf einzelne Inhalte <strong>und</strong> Sequenzen ist zeitaufwändig, für eine didaktisch sinnvolle<br />
Kombination verschiedener Medien mit viel Aufwand <strong>und</strong> unterschiedlicher Technik verb<strong>und</strong>en<br />
oder sogar unmöglich.<br />
Multimediale Programme haben dagegen zwei Merkmalsgruppen, von denen die erste mehr<br />
technisch/technologisch bedingte, die zweite mehr didaktisch bzw. gestalterische Merkmale enthält.<br />
„Technisch/technologisch bedingte Merkmale<br />
• Alle visuellen <strong>und</strong> auditiven Elemente bzw. Informationen liegen gr<strong>und</strong>sätzlich in einer digitalen Form<br />
vor. Sie ermöglicht eine Medienintegration aller in digitale Form umwandelbarer traditioneller Medien;<br />
• die digitale Medienintegration ermöglicht zudem die Perspektive einer umfassenden „sinnlichen Entrückung“,<br />
einer interaktiven Konstruktion von virtuellen Gegenständen <strong>und</strong> Vorgängen (Virtual Reality,<br />
Cyberspace);<br />
• die digitale Form, der einheitliche Datenträger <strong>und</strong> immer leistungsfähigere Prozessoren ermöglichen<br />
meist einen sehr schnellen Zugriff auf die einzelnen Elemente;<br />
• die Elemente bzw. Informationen stehen in der Regel auf einem einzigen <strong>und</strong> einheitlichen Datenträger<br />
mit großen <strong>und</strong> preisgünstigen Speicherkapazitäten (z. B. Festplatte oder CD-ROM) zur Verfügung;<br />
• die verschiedenartigen Dateiformate, in denen diese Elemente vorliegen, z.B. Bilder (z. B. Pict, Tiff),<br />
Texte (z.B. Word, ACII), Filme (z.B. JPEG, MPEG) u. dgl. können zum allergrößten Teil in die<br />
verschiedenen Dateiträgerformate bzw. für die jeweiligen Betriebssysteme umgewandelt werden, so dass<br />
eine Integration in unterschiedliche Datensysteme zunehmend leichter wird;<br />
• die einfache <strong>und</strong> extrem billige Vervielfältigung <strong>und</strong> damit Verbreiterung multimedialer Informationen<br />
(z.B. CD-ROM oder über Online-Systeme),<br />
• multimediale Programme müssen also somit nur einmal konzipiert <strong>und</strong> gestaltet werden, da sie (in der<br />
Regel) in alle vorhandenen Systeme portierbar sind;<br />
• die rasche Austauschbarkeit der Daten ermöglicht eine ebenso schnelle – falls notwendige – Aktualisierung<br />
der Inhalte des Programms (z. B. über Telekommunikationswege, Datenautobahnen);<br />
• senkt die Kosten, ermöglicht höhere Akzeptanz <strong>und</strong> damit Wirtschaftlichkeit;<br />
• aufgr<strong>und</strong> der Angleichung <strong>und</strong> Vereinheitlichung der verschiedenen Computer-Betriebssysteme (z.B.<br />
Windows, MacOS, OS/2) entwickelt sich langsam ein einheitliches <strong>und</strong> bedienerfre<strong>und</strong>liches Interface<br />
„Mensch-Computer“;<br />
• verhältnismäßig einfache Bedienungselemente (Klicken, Pulldown-Menüs, Knöpfe, Schalter, Symbole,<br />
Leitfiguren, etc.) machen die Benutzung der Programme zunehmend einfacher <strong>und</strong> leichter;<br />
• die Möglichkeit der Verbindung von unterschiedlichen Geräten (PC), Programmen (z.B. gemeinsame<br />
Bearbeitung von Projekten), Anbietern <strong>und</strong> Anwendern über alte <strong>und</strong> neue Telekommunikationswege
54<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
(z.B. Telefon, ISDN, Glasfasernetze, Satellitentechnologie) lässt neue Kommunikations- <strong>und</strong> Kooperationsformen<br />
entstehen (z.B. Austausch von Schulen oder Schülern, auch über Länder- <strong>und</strong><br />
Staatengrenzen hinweg).<br />
Didaktisch/gestalterisch bedingte Merkmale<br />
• die gleichzeitige Verfügbarkeit verschiedener auditiver <strong>und</strong> visueller Elemente ermöglicht neuartige<br />
didaktische Einsatzmöglichkeiten (z.B. Text, Simulation, Film od. dgl. zur gleichen Zeit);<br />
• die vielfältige Verfügbarkeit aller Elemente (z.B. Bild, Film, Ton, Grafik, Text) durch Hypertextstrukturen<br />
ermöglicht eine völlig neue Qualität der didaktischen Konzeption <strong>und</strong> Präsentation,<br />
• <strong>und</strong> damit neue Zugangsweisen zu Programminhalten, die z. B. selbstständiges, entdeckendes,<br />
assoziatives, aktives, handlungsorientiertes <strong>und</strong> individualisiertes Lernen leichter <strong>und</strong> effektiver möglich<br />
machen;<br />
• der Zugang zu Inhalten, die mit herkömmlichen didaktischen Methoden nur schwer realisierbar werden,<br />
kann aufgr<strong>und</strong> der neuartigen Darstellungs- <strong>und</strong> Präsentationsmöglichkeiten (z.B. „dynamisches<br />
Layout“, Animations- <strong>und</strong> Simulationsformen, virtuelle, interaktive Darstellungsformen oder spielerische<br />
Zugangsweisen) eine neue lernpsychologische Qualität erhalten (z.B. hohe Motivation bzw.<br />
Motivationserhaltung),<br />
• die verschiedenen Möglichkeiten der Interaktivität mit einzelnen Programmelementen stellen völlig neue<br />
Lern- <strong>und</strong> (Lehr)möglichkeiten dar, lassen individuelle Reaktionsweisen des Anwenders zu <strong>und</strong> stellen<br />
damit den Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler in den Mittelpunkt des „Unterrichts“-geschehens;<br />
• multimediale Programme lassen sich auch mit herkömmlichen <strong>und</strong> neueren Lehr- <strong>und</strong> Lernverfahren gut<br />
kombinieren <strong>und</strong> verknüpfen (z.B. Hypermedia-Projekt „Das grüne Klassenzimmer“);<br />
• manche Programme eignen sich hervorragend zur interaktiven Demonstration bzw. Simulationen von<br />
komplexen Vorgängen, die sonst nur schwer darstellbar <strong>und</strong> durchführbar sind <strong>und</strong> immer wiederholt<br />
werden können, so oft der Programmautor oder der Anwender es will;<br />
• die individuelle Bearbeitung <strong>und</strong> Veränderung von dafür vorgesehenen Programminhalten durch<br />
Eingabe, z.B. von Schriftzeichen, Bildern oder Sprache (z.B. Spracherkennung bei Fremdsprachenprogrammen),<br />
die das Programm ggf. erkennen <strong>und</strong> auswerten kann, macht ein entsprechend konzipiertes<br />
Programm zu einem neuartigen persönlichen <strong>und</strong> unabhängigen Übungs- <strong>und</strong> Testpartner, der<br />
eine grenzenlose Geduld aufbringt;<br />
• darüber hinaus können multimediale Programme selbst konzipiert <strong>und</strong> gestaltet („Do-it-yourself-<br />
Multimedia“) werden (z.B. mit Werkzeugen wie HyperCard, Toolbook oder Kinderprogrammen wie<br />
Amazing Animation oder Kid Works) <strong>und</strong> können damit Kreativität anregen <strong>und</strong> fördern sowie die<br />
Transparenz von multimedialen Produkten <strong>und</strong> deren Gestaltungselementen sichtbar machen, was<br />
wiederum die Medienkompetenz des Schülers stärkt.“ (Bauer 1997, S. 380 ff.)<br />
Pädagogische Aspekte<br />
Für immer mehr Kinder <strong>und</strong> Jugendliche sind Multimediaanwendungen Mittel <strong>und</strong> Gegenstand der<br />
Freizeitbeschäftigung bei z.T. wesentlich größerer Bedienungskompetenz als Erwachsene sie<br />
vorweisen können.<br />
Darüber hinaus sind Multimediaanwendungen auf dem besten Wege, neben dem Freizeitbereich in<br />
fast sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens vorzudringen.<br />
Schließlich hat Schule die Aufgabe, auf ein Leben vorzubereiten, in dem dieses Medium neben den<br />
„klassischen“ Medien wie R<strong>und</strong>funk <strong>und</strong> Fernsehen längst seinen Platz eingenommen hat. Diese<br />
Ausgangslage zwingt die Schule zur Reaktion auch auf Phänomene, die mit dieser Entwicklung<br />
einhergehen oder diskutiert werden. Eine definitive Stellungnahme kann hierzu nicht bezogen
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 55<br />
werden, denn die Diskussionen sind meist noch offen, was bei der Rasanz der technischen<br />
Entwicklung nicht weiter verw<strong>und</strong>erlich ist.<br />
Sicher kommt es unseren pädagogischen Bemühungen insbesondere im Bereich der Lernmotivation<br />
entgegen, wenn das Lernen Spaß macht, „nahe beim Spiel ist“ oder gar im Spiel sozusagen<br />
nebenbei erfolgt. Ob dadurch dann auch gelernt wird, sich beim Lernen nicht mehr „anstrengen” zu<br />
müssen? - fragen die Kritiker. Vielleicht ist z.Z. die Lösung ein gelegentlicher Einsatz solcher<br />
Anwendungen, der die allgemeine Lernbereitschaft unserer Sonderschüler fördert <strong>und</strong> manchen<br />
völlig demotivierten wieder auf den Pfad des Lernens bringt.<br />
In diesem Zusammenhang steht auch die Frage des Einsatzes von multimedialer Software.<br />
Nachweislich halten sich die meisten unserer Kinder an die "stumpfen", weniger kreativen. Dabei<br />
könnten gerade multimediale Spiele vielerlei kreative Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Je mehr<br />
Modifikationsmöglichkeiten eine multimediale Anwendung bereitstellt, desto mehr können eigene<br />
Ideen <strong>und</strong> Material eingebracht werden <strong>und</strong> zu einem neuen Ergebnis führen. Es gibt neuere<br />
Software, die das auch für unsere Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler versucht ( z.B. animierte Geschichten<br />
zum Erleben <strong>und</strong> Erfinden.) Diese Bemühungen sind jedoch noch in den Anfängen. Unabhängig<br />
davon gibt es auch bei uns Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, die den Rechner zum kreativen Hobby<br />
machen (z.B. Bilder scannen <strong>und</strong> zu Collagen verarbeiten). Je größer die Modifikationsmöglichkeiten,<br />
desto größer sind die Freiräume kreativer Gestaltung.<br />
Diskutiert wird der „Verlust“ an realen Wirklichkeitserfahrungen aufgr<strong>und</strong> zunehmender Beschäftigung<br />
mit den so genannten virtuellen Welten. Man spricht vom allmählichen Verschwinden der<br />
Wirklichkeit <strong>und</strong> mahnt den drohenden Realitätsverlust bei vermeintlichem Erwerb neuer Freiheiten<br />
(„Scheinfreiheit“) durch den Computer an. Die Darstellungen auf dem Bildschirm werden immer<br />
„realistischer“, ohne der Wirklichkeit tatsächlich zu entsprechen. Werden dann Verhaltensweisen<br />
unreflektiert aus der virtuellen auf die reale Welt übertragen (z.B. die dreidimensionale Simulation<br />
eines Mountainbikekursus), ist es nicht auszuschließen, dass es zu folgenschwerem Fehlverhalten<br />
kommt. Viele Erfahrungen lassen sich (noch?) nicht in virtuellen Welten machen. Einem Verlust<br />
an Erfahrung der Wirklichkeit durch Multimedia kann hier natürlich keinesfalls das Wort geredet<br />
werden. Die Sonderschule weiß, dass sie vielmehr bei ihren Schülern insbesondere auf den<br />
wichtigen Erwerb der so genannten primären (Sinnes-) Erfahrungen achten <strong>und</strong> bei Defiziten für<br />
Ausgleich sorgen muss.<br />
Hinweise für Lehrkräfte<br />
Multimediale Software ist kein Zaubermittel oder elektronischer „Nürnberger Trichter“. Die<br />
anwendende Lehrkraft muss die multimediale Software an seinen eigenen pädagogischen<br />
Ansprüchen messen <strong>und</strong> sie daher selbst erproben.
56<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Kriterien Beschreibung des Kriteriums nicht<br />
erfüllt<br />
Flexibilität Das Kind sollte Lernstoff <strong>und</strong> Lernmenge, Aufgabengestaltung<br />
<strong>und</strong> Tempo sowie Schwierigkeitsgrad selbst<br />
bestimmen können.<br />
Umfassende<br />
Differenzierung<br />
Hilfen<br />
durch das<br />
Programm<br />
Umgang mit<br />
Fehlern<br />
Erfolgs-<br />
kontrolle<br />
Die Flexibilität des Programmes sollte die Anpassung an die<br />
individuellen Leistungsniveaus <strong>und</strong> Interessenlagen der<br />
Kinder ermöglichen.<br />
Das Programm sollte selbstständig <strong>und</strong> "schadfrei" Auswege<br />
<strong>und</strong> Hilfen anbieten. Gute Programme bieten darüber hinaus<br />
Eltern <strong>und</strong> Lehrern Erklärungen von Problemen <strong>und</strong> Anregungen<br />
zur Lernhilfe.<br />
Programme, die keine alternative Lösungen anbieten oder<br />
sich bei Fehlerrückmeldungen auf demotivierende<br />
Kommentare beschränken, sind nicht zu empfehlen.<br />
Wichtig ist, dass Fehler sinnvoll, d. h. differenziert, erklärt<br />
werden. Solche Erklärungen müssen Auskunft darüber<br />
geben, wo der Fehler entstanden ist (z.B. durch ein<br />
Protokoll) <strong>und</strong> wie man ihn in Zukunft vermeiden kann.<br />
Fehler müssen nicht immer auf mangelndem Verständnis<br />
beruhen, <strong>und</strong> oft sind mehrere Zugangsweisen zum Lösen<br />
eines Problems denkbar. Gute Lernprogramme nehmen<br />
darauf Rücksicht. Bei ihnen sind außerdem Eingabe <strong>und</strong><br />
unmittelbare Rückmeldung entkoppelt, damit das Kind nicht<br />
durch Herumraten nach der Lösung sucht.<br />
Lernprotokolle können das Kind motivieren <strong>und</strong> ihm (oder<br />
Eltern <strong>und</strong> Lehrern) Auskunft über seine individuellen<br />
Schwächen geben, <strong>und</strong> damit gezielte Lernhilfen anbieten.<br />
Motivation Eine interessante Rahmenhandlung, positive Rückmeldungen,<br />
Hilfestellungen <strong>und</strong> Denkanstösse bringen<br />
Spaß am Lernen. Auf Lernphasen sollten Erholungsphasen<br />
in Form von geeigneten Spielen folgen (z.B. Memory) <strong>und</strong><br />
so eine Überlastung vermieden werden.<br />
Sozialer<br />
Aspekt<br />
Das Programm sollte eventuell auch zu zweit oder in der<br />
Gruppe anwendbar sein. Lernen kann dann zu einer<br />
gemeinsamen Aufgabe werden.<br />
Fantasie Texte, Aufgaben <strong>und</strong> Handlung sollten auf die Lebensrealität<br />
oder Fantasiewelt des Kindes zugeschnitten sein.<br />
Fachliche<br />
Inhalte<br />
Der fachliche Inhalt sollte natürlich hinter der Rahmenhandlung<br />
<strong>und</strong> den Effekten nicht zu kurz kommt.<br />
Ausführlichkeit, kindgemäße Präsentation <strong>und</strong> eindeutige<br />
Aufgabenstellung müssen gewährleistet sein.<br />
Der Lernstoff muss umfassend, lehrplangerecht <strong>und</strong><br />
fehlerfrei sein.<br />
Ein extra Bonus von Programmen ist es außerdem, wenn<br />
das Kind es um eigene Themen oder Stichwörter ergänzen<br />
kann, d.h. wenn die Programmstruktur offen ist.<br />
In guter Lernsoftware <strong>und</strong> gutem Edutainment ist kein Platz<br />
für Ballerspiele, Gewaltverherrlichung, diskriminierende oder<br />
sexistische Inhalte.<br />
Grad der Erfüllung<br />
annähernd<br />
erfüllt<br />
erfüllt
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 57<br />
Mediengerechte<br />
Präsentation<br />
Ein hoher Multimediaanteil ist zwar interessant, kann jedoch<br />
auch verwirrend wirken <strong>und</strong> so den Lernprozess hemmen.<br />
Farbige Grafiken, bewegte Bilder in Form von Video <strong>und</strong><br />
Animationen, sowie Sprach- <strong>und</strong> Tonausgabe sollten in<br />
Maßen genutzt werden.<br />
Sie dienen der Unterstützung des Lernstoffes <strong>und</strong> sind kein<br />
Eigenzweck! Das Programm sollte sich auf den Lerninhalt<br />
konzentrieren, nicht auf technischen Schnickschnack oder<br />
didaktische Nebenpfade. Meiden Sie darum Programme, die<br />
mit überflüssigen Tricks <strong>und</strong> Spielereien arbeiten.<br />
Bedienung Die Installation einer CD-ROM oder einer Diskette sowie die<br />
Einführung in die Benutzung des Programmes selbst bedarf<br />
oft noch immer der Hilfe durch Erwachsene. Das Programm<br />
darf, wenn dies im didaktischen Konzept der Entwickler so<br />
geplant war, durchaus von „Großen“ unterstützt werden.<br />
Wenn ein Programm ein ausdrücklicher Selbstläufer ist,<br />
sollte es aber auch durch die "Kleinen" selbstständig zu<br />
bedienen sein.<br />
Vgl. Schönweiss, F., auf CD-Romm 1997<br />
2.5 Computerspiele<br />
Pädagogische Herausforderung<br />
Computerspiele können wie andere Spiele für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche etwas Sinnvolles,<br />
Unterhaltendes <strong>und</strong> Schönes sein. Das gilt bei einem pädagogisch sinnvollen Spielangebot auch für<br />
deren Einsatz im Unterricht. Die Schule kann sich nicht einer Entwicklung entziehen, die den Alltag<br />
der Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen mit Computerspielen überschwemmt. Es ist ihre Aufgabe,<br />
Computerspiele auch im Unterricht zu thematisieren <strong>und</strong> zu reflektieren; denn sie muss den<br />
Heranwachsenden bei der Bewältigung ihrer Lebenssituation helfen. Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
müssen über Computerspiele (<strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen Gefahren besonders bei indizierten<br />
Spielen) aufgeklärt werden, sie müssen begleitet <strong>und</strong> kompetent gemacht werden.<br />
Dazu kann im Unterricht das Behandeln nachstehender Themen beitragen:<br />
• Wie wirken sich Angebot <strong>und</strong> Nachfrage von Computerspielen auf den Markt aus?<br />
• Wie erfahre ich mich selbst beim Computerspiel? (Fühlt man sich als Spieler anders als sonst?<br />
Wirken Computerspiele vereinsamend? u.ä.)<br />
• Wie sind die Zusammenhänge zwischen Computerspielen <strong>und</strong> eigener Lebenssituation? (Was<br />
fasziniert mich beim Computerspiel? Wann spiele ich? Fliehe ich in eine andere Welt?)<br />
• Was sind die medienspezifischen Besonderheiten von Computerspielen? (z.B. im Vergleich zu<br />
Brett- <strong>und</strong> Kartenspielen)<br />
• Wann können Computerspiele können eine Bereicherung sein? (Ergänzung zu anderen<br />
Aktivitäten?)<br />
• Sollte ich spielen, was ich will <strong>und</strong> was einem so alles in die Hände kommt? (Indizierte Spiele)<br />
Faszination der Computerspiele<br />
Computerspiele faszinieren, weil sie von den Spielern benützt werden um „gute Gefühle“ zu<br />
bekommen. Der Spielcomputer vermag Vergnügen, Spaß <strong>und</strong> Freude zu bereiten, Gefühle von<br />
Leistungsfähigkeit <strong>und</strong> Kompetenz zu vermitteln, sowie Distanz zur Lebenswelt zu schaffen<br />
(abschalten können <strong>und</strong> sich ablenken).
58<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Der Wunsch nach einem "guten Gefühl", nach positiven emotionalen Erlebnissen ist untrennbar mit<br />
Erfolgen im Spiel verb<strong>und</strong>en. Der erfolgreiche Spieler hat sein „Bleiberecht“ im Spiel erstritten -<br />
<strong>und</strong> sei es nach vielen St<strong>und</strong>en. Ständige Misserfolge führen in der Regel zum Spielabbruch.<br />
Der Spielerfolg ist unmittelbar gekoppelt mit der Kontrolle des Spiels. Die allen Spielen<br />
gemeinsame Leistungsanforderung besteht darin, das Spiel kontrollieren zu können. Bildschirmspiele<br />
vermitteln das Gefühl von Macht <strong>und</strong> Kontrolle in einer miniaturisierten <strong>und</strong> auf wenige<br />
Gr<strong>und</strong>elemente reduzierten Welt. Der Begriff „Spielkontrolle“ drückt aus, dass man das Spiel<br />
beherrscht, in dem man die wesentlichen Leistungsanforderungen erfüllen kann. Durch die<br />
Kontrolle des Spiels wird die „virtuelle Welt“ zur beherrschbaren Lebenswelt: „This land is your<br />
land“.<br />
Der Spielerfolg trägt entscheidend dazu bei, sich dem Spiel längere Zeit zuzuwenden. Intensives<br />
Spielen kann dazu führen, dass die Spieler mit dem Spiel „verschmelzen“. Da es eine Fülle von<br />
Spielanforderungen gibt, die sich erst im Laufe des Spiels erschließen, kann viel Zeit mit dem<br />
Computerspiel verbracht werden. Mit steigender Bereitschaft, auch bei Misserfolgen das Spiel<br />
fortzusetzen <strong>und</strong> die Schwierigkeiten zu bewältigen, verbringen die Spieler zunehmend mehr Zeit<br />
beim Spiel. Sie haben oft Schwierigkeiten das Spiel zu beenden. Sie spielen die Nacht hindurch <strong>und</strong><br />
vergessen dabei die Zeit, teilweise auch elementare Bedürfnisse wie Essen <strong>und</strong> Schlaf.<br />
Nach den empirischen Untersuchungen liegt der Beginn der Nutzung der Bildschirmspiele<br />
zwischen 7 <strong>und</strong> 10 Jahren . Befragungen von Vorschulkindern deuteten darauf hin, dass sich dieser<br />
Zeitraum nach vorne verlagert, dass viele Kinder bereits im Vorschulalter mit den Spielen anfangen<br />
(etwa die Hälfte). 25% der Vorschüler spielen nach diesen Untersuchungen bereits täglich.<br />
Zwischen 10 <strong>und</strong> 14 Jahren liegen die intensivsten Spielphasen. Das ist ein Zeitraum, in dem bei<br />
Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen vielen Entfaltungswünschen wenig Entfaltungsmöglichkeiten gegenüber<br />
stehen. Mit etwa 15 Jahren kommt es zu einer „Bruchstelle“ in Hinblick auf Computerspiele: Das<br />
Interesse bei den meisten flacht rasch ab <strong>und</strong> „flackert“ allenfalls bei neuen Spielen noch auf. Bei<br />
Besuchern von Jugendeinrichtungen waren Entwicklungen bei der Präferierung bestimmter Spiele<br />
feststellbar: Kampforientierte Spiele wurden insbesondere von Kindern um 11 Jahren bevorzugt,<br />
Sportspiele fanden ein besonderes Interesse bei Jugendlichen zwischen 13 <strong>und</strong> 14 Jahren.<br />
Es gibt offensichtlich typische Jungen- <strong>und</strong> typische Mädchenspiele. Mädchen bevorzugen lustige,<br />
„friedliche“, comicartige Spiele, bei denen „Abenteuer“ zu bestehen sind <strong>und</strong> die „existenziellen“<br />
Gefährdungen minimalisiert erscheinen. Bei den Jungen liegen in der Präferenz kampfbestimmte<br />
Spielszenarien deutlich vorne. Autofahrspiele werden von Jungen wie Mädchen geschätzt.<br />
Bildschirmspiele sind anstrengend <strong>und</strong> kosten Kraft. Häufig geäußerte physiologische Wirkungen<br />
sind Kopfschmerzen, Augenflimmern, Verspannung der Hand <strong>und</strong> des Rückens. Diese Wirkungen<br />
werden in Kauf genommen, wenn sich die gewünschten psychischen Wirkungen („Erfolg“ <strong>und</strong><br />
„gutes Gefühl“) einstellen. Generell zeigt sich nach einer Spielphase von ca. 90 Minuten eine<br />
Zunahme der „visuellen Aufmerksamkeitskonzentration“.<br />
Die Spiele gehören mittlerweile zur Normalität in der Familie. Die Elternreaktionen bewegen sich<br />
zwischen zeitlicher Einschränkung, Tolerierung <strong>und</strong> aktiver Teilhabe. Ob das Alleinspiel oder ein<br />
gemeinsames Spiel gewählt wird, ist sowohl abhängig vom Spieltyp als auch von den sozialen<br />
Möglichkeiten, z.B. im Fre<strong>und</strong>eskreis <strong>und</strong> in der Familie. Zwar wird überwiegend das gemeinsame<br />
Spiel gewünscht (insbesondere wegen der damit verb<strong>und</strong>enen affektiven Reize), es lässt sich jedoch<br />
nicht im gewünschten Umfang realisieren. Gleichwohl entwickeln sich soziale Aktivitäten mit <strong>und</strong>
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 59<br />
um die Computerspiele. Entsprechende Angebote in Jugendeinrichtungen können die soziale<br />
Einbettung der Spiele in Gruppen von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen begünstigen <strong>und</strong> fördern. 1<br />
Unterrichtlicher Einsatz<br />
Die Fähigkeit der Einschätzung der Spielkonzeption <strong>und</strong> des Anspruchsniveaus eines<br />
Computerspiels erleichtern der Lehrkraft auch die Zielrichtung eines sinnvollen unterrichtlichen<br />
Einsatzes. Dieser könnte z.B. darin liegen, dass mit Hilfe eines überwiegend als „Knöpfchenspiel“<br />
auf niedrigem taktilen <strong>und</strong> kognitiven Anspruchslevel Kinder an die Bedienung der Pfeiltasten einer<br />
Computertastatur herangeführt werden. Am oberen Ende der Einsatzskala dagegen könnten<br />
„Köpfchenspiele“ stehen, die auf höherem kognitiven Niveau z.B. simulierte Geschehen eines<br />
komplexen Ökosystems – wie das eines natürlichen Teiches – spielerisch erfahrbar machen.<br />
Dazwischen liegen in vielfachen Abstufungen Sinn oder auch Unsinn des unterrichtlichen Einsatzes<br />
von Computerspielen.<br />
Zur besseren Übersicht über die Schwerpunktbereiche der Gr<strong>und</strong>strukturen von Computerspielen<br />
werden in der Literatur meist die unten folgenden Kategorien benützt, die natürlich oft in ihren<br />
Spielanteilen mehreren Sparten zugeordnet werden können. Solche Übersichten erleichtern dem<br />
Lehrer bei der hohen Zahl <strong>und</strong> ständigen Zunahme neuer Spiele (die die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
von zuhause natürlich auch in die Schule mitbringen wollen <strong>und</strong> dürfen) den schnellen Blick der<br />
Voreinschätzung bzw. Vorauswahl. Eine nähere Auseinandersetzung unter den Gesichtspunkten des<br />
Unterrichtseinsatzes muss dann in einem nächsten Schritt erfolgen.<br />
Erstes Sortieren<br />
Eine für die Lehrkraft zunächst einmal bedeutsame gr<strong>und</strong>sätzliche Unterscheidung ist (nach J. Fritz)<br />
die zwischen „Knöpfchen-“ <strong>und</strong> „Köpfchenspiel“. Beim ersteren geht es vornehmlich um<br />
Schnelligkeit <strong>und</strong> Geschicklichkeit der richtigen Bedienung von Tasten, Maus <strong>und</strong> Joystick, beim<br />
zweiten mehr um problemlösendes Denken, gute Übersicht <strong>und</strong> Kreativität im Rahmen des Spiels.<br />
Bei näherer Betrachtung zeigt sich oft, dass Spiele in ihrer Gr<strong>und</strong>konzeption taktile <strong>und</strong> kognitive<br />
Anforderungen kombiniert verlangen.<br />
Die verschiedenen Arten von Computerspielen<br />
• Abstrakte Denk- <strong>und</strong> Geschicklichkeitsspiele<br />
Sie beinhalten Denk- <strong>und</strong> Kombinationsaufgaben (z.B. Finden einer gesuchten Zahl mit möglichst<br />
wenig Versuchen; gelingt nur bei richtiger „strategischer” Einengung der Zahlbereiche) Gedächtnisaufgaben<br />
(z.B. Erinnern von Symbolen in einem Darbietungsraster) Stapelaufgaben (z.B.<br />
herunterfallende zwei- <strong>und</strong> dreidimensionale Figuren passend ineinander stapeln) Lenkungsaufgaben<br />
(z.B. ein Auto ohne Beschädigung durch den Verkehr steuern) <strong>und</strong> fordern oft eine<br />
besondere Reaktionsschnelligkeit (z.B. bei Ping-Pong <strong>und</strong> Abräumspielen).<br />
• Kampfspiele<br />
Im Mittelpunkt stehen fortgesetzte kampfbestimmte Handlungsmuster (Raumfahrzeuge, Kämpfer,<br />
Kampfgeräte); die Spiele erstrecken sich von einfachen Abschießspielen bis hin zu komplexeren<br />
Bewegungsanimationen der kämpfenden Figur; die Kämpfe spielen oft in futuristischen<br />
Gefechtsfeldern, in Comic-Szenerien <strong>und</strong> in Fantasy-Umwelten ab <strong>und</strong> haben oft nur einen<br />
geringen Realitätsbezug. Ziel ist meist die „Erledigung” des Gegners. Das reicht vom „einfachen”<br />
1<br />
Vgl. Jürgen Fritz (Hrsg.); Warum Computerspiele faszinieren, Empirische Annäherung an Nutzung <strong>und</strong><br />
Wirkung von Bildschirmspielen; München 1995
60<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Abschießen bis hin zum komplexen Steuern ganzer kriegerischer Szenarien <strong>und</strong> Gefechtssimulationen.<br />
• Funny-Games<br />
Der Charakter der Funny-Games ist eher lustig <strong>und</strong> spaßig <strong>und</strong> erinnert deutlich an Kinder-Comics;<br />
daher haben sie meist keine martialischen, kampforientierten, sondern lustige Comicfiguren. Auch<br />
hier finden wir einfachste Lenkungsaufgaben bis hin zu komplexen Bewegungsanimationen. Dabei<br />
geht es um laufen, hüpfen, klettern, springen, schießen, einsammeln, befreien in vielfältigen<br />
Situationen, Aufgaben <strong>und</strong> Rätseln.<br />
• Simulationen<br />
Hervorgehobenes Merkmal dieser Spiele ist die besondere Betonung des Realitätsbezuges: Aspekte<br />
der Wirklichkeit sollen möglichst genau in einspielbares Modell einbezogen werden. Da gibt es<br />
Fußballspiele, Fahrzeugspiele, Flugsimulationen, Wirtschaftsspiele (z.B. Handel treiben mit dem<br />
Schiff im Mittelalter) u.a.m.<br />
• Spielgeschichten<br />
präsentieren sich meist in der komplexen Form der Videospiele. Im Spiel entfaltet sich meist in<br />
aufeinander aufbauenden Szenenfolgen eine abenteuerliche Spielgeschichte. Ziel ist es, die<br />
Bewährungsproben zu bestehen, voranzukommen, sich weiterzuentwickeln, mächtiger/reicher zu<br />
werden, „Karriere“ zu machen in Historiengeschichten, Abenteuer („Wie werde ich ein Pirat?“)<br />
Weltraumabenteuer <strong>und</strong> Fantasiegeschichten. 1<br />
Weitere Informationen:<br />
Datenbank Search & Play<br />
B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung<br />
Referat Medienpädagogik <strong>und</strong> <strong>Neue</strong> Medien<br />
Berliner Freiheit 20, 53111 Bonn<br />
Internet: www.bdp.de/snp<br />
B<strong>und</strong>esprüfstelle für jugendgefährdende Schriften<br />
Kennedyallee 105-107, 53175 Bonn<br />
Internet: www.bmfsfj.de/bpjs<br />
1 nach Fehr/Fritz, Videospiele <strong>und</strong> ihre Typisierung in: Computerspiele - Bunte Welt im grauen Alltag, Bonn<br />
1993
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 61<br />
3 Sonderpädagogische Förderung von behinderten Kindern<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen mit Hilfe von IuK-Technologien<br />
Vorbemerkungen<br />
„Sonderpädagogische Förderung schließt begleitende spezifische Hilfen ein mit dem Ziel, für den<br />
einzelnen bestehende Abhängigkeiten <strong>und</strong> Hemmnisse so weit wie möglich zu überwinden. Dies<br />
bedeutet:<br />
• (...)<br />
• Technische <strong>und</strong> behinderungsspezifische apparative Hilfen sowie Medien sollen bereitgestellt<br />
<strong>und</strong> individuell angepasst werden; ihr Gebrauch ist einzuüben; Kenntnisse über die Beschaffung<br />
der Hilfsmittel, über Einbau, Nutzung <strong>und</strong> Wartung sind zu vermitteln.“ 1<br />
Diese o.g. individuellen Hilfen können heute verstärkt in einem multimedialen <strong>und</strong> computergestützten<br />
Unterricht sowie durch die fortschreitende Entwicklung vorhandener elektronischer, d.h.<br />
computergesteuerter Hilfsmittel, angeboten <strong>und</strong> somit selbstständige Erfahrungs-, Lern- <strong>und</strong><br />
Lebensräume eröffnet werden. Dadurch können sich beeinträchtigte <strong>und</strong> behinderte Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler auch besser mitteilen, selbstbestimmter ihre Freizeit gestalten <strong>und</strong> erweiterte<br />
Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung <strong>und</strong> sozialen Integration beanspruchen.<br />
Die <strong>Neue</strong>n <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> bieten sich also nicht nur als Hilfe zum<br />
Lernen an, sondern auch als Kommunikationshilfe, als Möglichkeit der Umfeldsteuerung von<br />
Geräten des täglichen Lebens <strong>und</strong> zum Arbeiten mit Maschinen <strong>und</strong> als Plattform für elektronische<br />
Spielzeuge.<br />
Kommunikation<br />
Schulisches Lernen<br />
insbesondere<br />
Schreiben, Lesen<br />
<strong>und</strong> Rechnen<br />
Förderung<br />
gr<strong>und</strong>legender<br />
Lernbereiche wie<br />
• Feinmotorik<br />
• Wahrnehmung<br />
• Denken<br />
Umfeld <strong>und</strong><br />
Arbeit<br />
Abb: Förderbereiche des Computers als Lernhilfe <strong>und</strong> elektronisches Hilfsmittel<br />
Spiel<br />
Die in den nachfolgenden Ausführungen aufgezeigten Ansätze versuchen einen kleinen Überblick<br />
über einen expandierenden Markt zu geben <strong>und</strong> sollen Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, aber auch Eltern<br />
1 KMK-Beschluss vom 6.5.1994: Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung<br />
in den Schulen der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland S.2f
62<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
erste Informationen geben, die bei den entsprechenden Schulformen der Sonderschulen vertiefend<br />
nachgefragt werden können.<br />
Gleichzeitig sollen aber auch die sich auf dem elektronischen Hilfsmittelmarkt abzeichnenden<br />
<strong>Neue</strong>ntwicklungen, die wahrscheinlich spürbare Verbesserungen für eine jeweils bestimmte<br />
Klientel bedeuten können, aufgezeigt werden.<br />
Vertiefende Hinweise zu diesen Entwicklungen, aber auch über das umfängliche Gesamtangebot<br />
können Interessierte bei den nachstehenden Adressen abfragen:<br />
Weitere Informationen:<br />
B<strong>und</strong>esarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR)<br />
60594 Frankfurt/Main, Walter-Kolb-Straße 9-11<br />
Tel.: 069/605018-23<br />
Fax: 069/605018-29<br />
Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation <strong>und</strong> elektronische Hilfen (BuK)<br />
55543 Bad Kreuznach, Ringstraße 58-60<br />
Tel.: 0671/605-3855<br />
E-mail: BUK@kreuznacherdiakonie.de<br />
Fürst Donnersmarck-Stiftung, Berlin<br />
Internet: www.fuerst-donnersmarck-stiftung.de<br />
3.1 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen mit körperlicher<br />
Behinderung<br />
Computer als Schreib- <strong>und</strong> Kommunikationshilfe<br />
Mit Hilfe des Computers werden Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, die nicht oder unverständlich sprechen,<br />
in die Lage versetzt, Gedanken, Empfindungen <strong>und</strong> Wünsche zu äußern <strong>und</strong> mit ihrer Mitwelt<br />
schriftsprachlich in Verbindung zu treten. Des Weiteren können Symbolsprachen (z.B. Bliss,<br />
Talking Symbols) als vereinfachte Verständigungshilfen in spezifische Softwareprogramme<br />
eingeb<strong>und</strong>en werden <strong>und</strong> über eine mit synthetischer Sprache ausgestatteten Computer in<br />
gesprochene Sprache transferiert werden.<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, die aufgr<strong>und</strong> von motorischen Beeinträchtigungen nicht mit herkömmlichen<br />
Schreibgeräten umgehen können, benutzen den Computer als Schreibmaschinenersatz.<br />
Meist kommen handelsübliche Standard-Tastaturen zur Anwendung, bisweilen sind Abdeckplatten<br />
oder Spezial-Tastaturen notwendig. Schüler, die keine Tastaturen bedienen können, brauchen<br />
spezifische Programme, die eine Steuerung mit Hilfe von Joystick gestatten. Beachtung verdient<br />
zudem, dass nicht sprechende Schüler häufig mit einem einzigen beweglichen Körperteil wie<br />
Zunge, Zehe oder Kinn über einen Schalter oder Sensor Signale auslösen können <strong>und</strong> damit die<br />
Tastatur bedienen.<br />
Auf diesem Weg wird das Werkzeug Computer zum Mittler zwischen Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
<strong>und</strong> Mitwelt. Hier ist besonders angesprochen:<br />
Das Prinzip der Zungenmaus<br />
Mit einer Zahnspange wird im M<strong>und</strong> eine druckempfindliche Folie platziert, die auf<br />
Zungenberührungen reagiert <strong>und</strong> so die Position des Bildschirmzeigers bestimmt. Das Schalten der<br />
Maus, Klicken genannt, wird durch Beißen mit den Zähnen ausgelöst (Entwicklung Siemens-<br />
Nixdorf).
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 63<br />
Steuern durch Augenbewegung<br />
Die Bedienung des Rechners erfolgt über eine Minikamera mit Videochip, die an einem<br />
brillenähnlichen Gestell befestigt ist. Die präzise Steuerung des Computers durch die<br />
Augenbewegung ist das Resultat der Integration von Videochip, holografischer Technik <strong>und</strong><br />
innovativer Signalverarbeitung. In Verbindung mit<br />
einer auf dem Computermonitor abgebildeten<br />
Tastatur können alle Funktionen eines Standard-<br />
Keyboards ohne den Einsatz der Hände genutzt<br />
werden.<br />
Durch die Reflexion eines schwachen Lichtstrahls<br />
(LED) von der Netzhaut nimmt die Kamera jede<br />
Bewegung der Pupille wahr. Der Videochip gibt die<br />
Signale an den Computer weiter, der sie in<br />
Bewegungen des Mauszeigers umwandelt. Längeres<br />
Verweilen des Blicks auf einer Taste wird vom<br />
Computer als Befehl interpretiert, diese zu betätigen. Auf diese Weise können Schwerstbehinderte<br />
Standardanwendungen wie Textverarbeitungen, Tabellenkalkulationen oder Datenbanken nutzen.<br />
Spracherkennung<br />
Spracherkennungssysteme sind Softwareprogramme, die dem Computer die Fähigkeit verleihen,<br />
Sprache zu „verstehen“, das Diktierte als Text zu schreiben, Tabellen <strong>und</strong> Bilder zu gestalten,<br />
Steuerungsbefehle umzusetzen. Mit ihnen können Programme gesteuert <strong>und</strong> Umfeldkontrollen<br />
realisiert werden. Eine Tastaturbedienung kann entfallen.<br />
In dem gemeinsamen Modellversuch „Erprobung eines Sprachererkennungssystems in der<br />
Sonderpädagogik - ESSo (1996-1999)“ der B<strong>und</strong>esländer Rheinland-Pfalz <strong>und</strong> Mecklenburg-<br />
Vorpommern wird das Spracherkennungsprogramms DragonDictate sowohl im schulischen als<br />
auch im rehabilitativen Bereich als Werkzeug <strong>und</strong> Fördermittel erfolgreich erprobt.<br />
Es wird vor allem für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler mit motorischen <strong>und</strong> sensorischen Beeinträchtigungen<br />
– hier insbesondere Muskelerkrankungen, Querschnittslähmungen <strong>und</strong> Sehschädigungen<br />
– eingesetzt, um zu überprüfen, ob durch den Einsatz des Programms eine Verbesserung<br />
hinsichtlich eines selbstgesteuerten Lernens, einer unabhängigeren Lebensführung <strong>und</strong> einer<br />
höheren Lebensqualität erreicht werden kann.<br />
Erste Erkenntnisse des Modellversuchs sind in einem Zwischenbericht, der unter der Nummer PZ-<br />
Information 19/97 beim Pädagogischen Zentrum Bad Kreuznach angefordert werden kann,<br />
zusammengestellt. Weitere <strong>und</strong> aktualisierte Informationen können über das Internet unter bildungrp.de/ESSo/<br />
abgerufen werden.<br />
Computer als Steuerungshilfe zur Umfeldkontrolle<br />
Mit Hilfe des Einsatzes stationärer <strong>und</strong> mobiler Umfeldsteuergeräte wie z.B. MEDIALINK,<br />
MAGIC CONTROL, SICARE „pilot“ u.a.m., die über den Computer gesteuert werden, können<br />
sehr viele handelsübliche Elektrogeräte, das Telefon <strong>und</strong> Hausanlagen (Tür, Fensterläden), die<br />
wichtig für die Selbstständigkeit <strong>und</strong> Unabhängigkeit von körperbehinderten Menschen sind, von<br />
diesen selbst bedient werden.
64<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Computer als Therapiehilfe<br />
Hier ist vor allem der IBM Sprechspiegel als Therapiehilfe bei Hör-, Stimm- <strong>und</strong> Sprachstörungen<br />
zu nennen.<br />
Der SprechSpiegel vermittelt eine direkte, optisch-visuelle Rückmeldung von Stimme <strong>und</strong><br />
Artikulation. Der eingegebene Sprachschall wird dazu über die Adapterkarte <strong>und</strong> das Programm im<br />
Rechner digitalisiert, analysiert <strong>und</strong> dem Klienten in Form von Bildern dargestellt. Große bewegte<br />
Bilder in Motivations- <strong>und</strong> Übungsspielen ergänzen oder ersetzen die auditive Rückmeldung <strong>und</strong><br />
regen die Sprechfreude an. Dazu nachstehende Beispiele:<br />
Übung Tonhöhe<br />
Die Hand steigt <strong>und</strong> sinkt mit der Veränderung der<br />
Tonhöhe. Die Tonhöhe wird so für den Klienten<br />
erkennbar. Sein Tonhöhenbereich kann gemessen<br />
werden.<br />
Übung Artikulation (bis 4 Laute)<br />
Diese Übung ermöglicht die Kombination von bis zu 4<br />
Lauten. Bei „korrekter“ Artikulation fliegt der Pelikan<br />
zum nächsten Laut.<br />
Der IBM SprechSpiegel hilft bei der Diagnose <strong>und</strong> beim Üben von Stimmgebung, Artikulation,<br />
Betonung <strong>und</strong> Sprechmelodie. Er fördert <strong>und</strong> intensiviert die Lernprozesse in besonderer Weise<br />
dadurch, dass alle SprechSpiegel-Übungen auf die persönlichen Förderbedürfnisse (Bef<strong>und</strong>) beim<br />
Klienten eingestellt werden können.<br />
Für Logopäden, Therapeuten <strong>und</strong> Pädagogen erschließen sich mit dem SprechSpiegel viele neue<br />
Möglichkeiten der individuellen Diagnose <strong>und</strong> Therapie.<br />
In individuellen Klientenprofilen lassen sich bestimmte Parameter speichern <strong>und</strong> bei späteren<br />
Therapiesitzungen erneut aktivieren. Einige Übungen verfügen über eine Funktion zur akustischen<br />
Wiedergabe, die mit der grafischen Darstellung der Sprechabläufe synchron läuft. Die akustische<br />
Wiedergabe kann normal oder auch verlangsamt erfolgen. Protokolle können als Tabellen oder<br />
Diagramme angezeigt <strong>und</strong> ausgedruckt werden, um die Fortschritte zu dokumentieren, die der<br />
Klient bei einer bestimmten Übung in einem bestimmten Zeitraum gemacht hat. Ebenso lassen sich<br />
die Bildschirmanzeigen ausdrucken, um Lernfortschritte aufzuzeigen.<br />
Internet: www.phnxsoft.com/ibmsprechspiegel.htm<br />
www.cseg.de/FrameSS32.html
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 65<br />
3.2 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
mit Sehbehinderung <strong>und</strong> Blindheit<br />
Mit Blick auf die Einrichtung von Bildschirm-Arbeitsplätzen für blinde <strong>und</strong> sehbehinderte<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler gelten bisher vor allem folgende Maßgaben:<br />
- Vergrößerungsbedarf (Großbildschirm, Software-Lösungen)<br />
- Sprach- <strong>und</strong> Punktschriftausgabe<br />
- sehgeschädigtenspezifische Auswahl der Anwendersoftware<br />
Diese Anforderungen werden durch folgende Konfiguration erfüllt:<br />
- Großbild-Monitor<br />
- Braille-Zeile<br />
- Sprachausgabe<br />
- Braille-Drucker<br />
- Scanner<br />
Vorteile<br />
In der Braille-Zeile werden die herkömmlichen ASCII-Zeichen in die 8-Punkt-Braille-Schrift<br />
umgeformt. Die Braille-Zeile besteht aus 40 oder 80 Modulen mit jeweils 8 Punkten, die mit den<br />
Fingern ertastet werden können. Diese können aber auch mit synthetischer Stimme ausgegeben<br />
werden, so dass der Blinde hört, was der Sehende am Bildschirm sieht. Mit dem Drucker können<br />
mit Hilfe ertastbarer Schriftzeichen auch Statistiken <strong>und</strong> Säulendiagramme dargestellt werden. Der<br />
Scanner kann Ganztexte in Braille-Schrift übertragen <strong>und</strong> der Computer dadurch zur Lesemaschine<br />
werden.<br />
Nachteile<br />
Die oftmals notwendige starke Vergrößerung am Monitor verursacht teilweise eine mangelnde<br />
Orientierung auf diesem <strong>und</strong> erschwert das Erkennen des sprachlichen Kontexten als Ganzes.<br />
Verbesserungen für diesen Bereich stellen neuere Software <strong>und</strong> Hardware-Software-Produkte dar,<br />
die in der letzten Zeit auf dem Markt angeboten werden. Es sind diese:<br />
• Der „Screen Reader“, der jeweils den aktuellen Bildschirminhalt liest, ähnlich wie ein Scanner<br />
Schwarzschrift liest <strong>und</strong> durch OCR (Erkennungssoftware) interpretiert. Dieses „Lesen“, d. h.<br />
das Umsetzen in Sprache oder Braille ermöglicht zudem nicht nur die Erfassung von Text aus<br />
Dateien, sondern auch die Nutzung anderer Bildschirminhalte, die zur Bedienung des PC’s<br />
wichtig sind, wie Menüs, Auswahlboxen, Icons.<br />
Internet: www.nb.uni-bielefeld.de/HIMILIS/4_5_scr.htm<br />
• Das „Talking TextBridge Mobile“, ein Lese-Sprech-Gerät auf Notebook Basis. Talking Text-<br />
Bridge ist eine Lese-Sprechgerät, das alle gedruckten Texte einscannen kann. Dazu ist er mit<br />
einer besonderen Version des optischen Zeichenerkennungsprogramms TextBridge ausgestattet.<br />
Gedruckte Texte werden also direkt vom Programm aus eingescannt <strong>und</strong> in vorlesbaren Text<br />
umgewandelt. Mit der Sprachkontrolle können so größere Textmengen gescannt, vorgelesen,<br />
<strong>und</strong> sogar automatisch auf Kassette aufgenommen werden.<br />
• Speak&Win ist eine neue, vollsynthetische Sprache der fünften Generation, die von jedem ohne<br />
Training sofort verstanden wird <strong>und</strong> die angenehm menschlich klingt, da die kleinsten
66<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Bestandteile der Sprache von einem Menschen gesprochen wurden. Trotzdem werden alle<br />
Wörter ausgesprochen, da das System auf Regeln beruht. Talking TextBridge ist zusammen mit<br />
Speak&Win eine perfekte Vorlesesoftware für Sehgeschädigte <strong>und</strong> Blinde.<br />
• WebSpeak als spezieller Browser, der Blinden den Zugang zum Internet, zum WWW schafft<br />
Weitere Informationen: Etex-Sprachsysteme<br />
Mit den Systemen MoBIC <strong>und</strong> Retina-Implantat machen zwei weitere Projekte derzeit verstärkt auf<br />
sich aufmerksam.<br />
Das System MoBIC<br />
Unter der Abkürzung MoBIC wird im Rahmen der EU-Initiative TIDE an einem Mobilitätssystem<br />
für Blinde gearbeitet. Mit Hilfe von elektronisch gespeicherten Landkarten, dem satellitengeschützten<br />
Positionserkennungssystems GPS (Global Positioning System) <strong>und</strong> der entsprechenden<br />
Hard- <strong>und</strong> Software kann ein Blinder durch Interaktion<br />
mit einem Computer außerhalb von Gebäuden in ihm<br />
unbekannter Umgebung <strong>und</strong> unabhängig von fremder<br />
Hilfe die aktuelle Position, an der er sich befindet,<br />
erkennen <strong>und</strong> von dieser Position zu einem von ihm<br />
gewünschten Ziel geleitet werden.<br />
Die <strong>Informations</strong>vermittlung erfolgt für den blinden<br />
Nutzer, bedingt durch seine Behinderung, nicht über<br />
einen Monitor, sondern vorwiegend über Sprache, akustische<br />
sowie taktile Signale. Die von Blinden getragene<br />
Elektronik ermittelt auf seinem Weg ständig seine Position<br />
in Längen- <strong>und</strong> Breitengraden. Dies geschieht über<br />
Signale, die von Satelliten ausgesendet <strong>und</strong> über eine<br />
Antenne empfangen werden. Um die Genauigkeit der<br />
Abb.: Mobilitätssystem für Blinde<br />
Positionsbestimmung zu erhöhen, werden Korrekturdaten<br />
verwendet. Die auf wenige Meter genau ermittelte Position wird in eine elektronische Karte<br />
(Stadtplan) eingetragen <strong>und</strong> für den Benutzer verständlich, z.B. in Straßennamen, übersetzt. Auf<br />
seinem Weg werden dem Blinden Angaben zur Entfernung, zur Richtung <strong>und</strong> zum<br />
Richtungswechsel, z. B. an Straßenkreuzungen gemacht.<br />
Weitere Informationen:<br />
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg<br />
Fakultät für Informatik – Institut für Simulation <strong>und</strong> Grafik<br />
39106 Magdeburg, Universitätsplatz 2<br />
Tel. 0391/67-18342<br />
Fax 0391/67-11164<br />
E-Mail petra@isq.cs.uni-magdeburg.de<br />
Das Retina-Implantat - ein Netzhaut-Chip<br />
Mit der Weiterentwicklung der Mikrosystemtechnik <strong>und</strong> Computertechnologie, aber auch durch<br />
Fortschritte in der Chirurgie des hinteren Augenabschnittes stellte sich die Frage nach der<br />
Machbarkeit einer solchen implantierbaren Struktur, die durch elektrische Reizung z.B. der<br />
Netzhautoberfläche zu optischen Wahrnehmungen bei einem blinden Patienten führt, um diesem ein<br />
orientierendes Sehen zu ermöglichen. Die Machbarkeit einer solchen Sehprothese wurde in einer<br />
umfangreichen Studie, die vom B<strong>und</strong>esministerium für Forschung <strong>und</strong> Technologie in Auftrag<br />
gegeben wurde, positiv beantwortet.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 67<br />
Das BMBF fördert seit dem 01.08.1995 zwei interdisziplinäre Arbeitsgruppen aus Ophthalmologen,<br />
Mikrosystemtechnikern, Neuroinformatikern <strong>und</strong> Optoelektronikern, deren Ziel es ist, eine in das<br />
Auge zu implantierende Mikrokontaktstruktur zu entwickeln, die bei Patienten mit Degenerationen<br />
der äußeren Netzhaut zur Wiederherstellung eines orientierenden Sehen führen kann.<br />
Das Institut für Neuroinformatik der Universität Bonn nutzt bei seinem Ansatz Erkenntnisse der<br />
Optik <strong>und</strong> der Mikroelektronik. Dazu wird eine Mikrokamera (Retina-Encorder) in die Brille des<br />
Patienten eingebaut. Sie empfängt das Licht <strong>und</strong> verwandelt in ihrem Prozessor anstelle der<br />
erkrankten Netzhaut diese Lichtsignale in elektronische Impulse. Diese werden weitergeleitet an<br />
eine Mikrokontaktfolie (Retina-Stimulator), die auf der Netzhaut implantiert ist. Dort werden die<br />
empfangenen elektronischen Impulse an den Sehnerv <strong>und</strong> zum Gehirn weitergeleitet.<br />
Ein anderer Ansatz kommt aus der Universitäts-Augenklinik Tübingen. Dort versucht man, die<br />
erkrankten Fotorezeptoren der Netzhaut durch künstliche Mikro-Fotodioten zu ersetzen. Noch offen<br />
ist nach Einschätzung des B<strong>und</strong>esforschungsministeriums, welche der beiden Ansätze sich<br />
durchsetzen wird. Das Ministerium fördert die Arbeiten bis 1999 mit 18 Millionen Mark. Dann<br />
sollen die Forscher ein Funktionsmuster vorstellen, das im Tierexperiment erprobt werden kann.<br />
Weitere Informationen: www.rrz.uni-koeln.de/med-fak/auge/epi-ret3.htm<br />
www-oe.uni-duisburg.de/LatestNews/EPI-RET.html<br />
www.uni-muenster.de/Dezernat2/forschung/fors-rip.htm<br />
3.3 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen mit Schwerhörigkeit<br />
<strong>und</strong> Gehörlosigkeit<br />
In den Schulen für Gehörlose <strong>und</strong> für Schwerhörige dienen optische <strong>und</strong> elektronische Hilfsmittel<br />
als Ersatz für fehlende Hörfähigkeit <strong>und</strong> zur Unterstützung der (Fern)Kommunikation.<br />
Elektronische Hilfsmittel<br />
Das Faxgerät <strong>und</strong> die E-Mail Adresse<br />
Es gibt in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland ca. 80.000 vollständig gehörlose Personen, darüber<br />
hinaus einen erheblichen größeren Personenkreis mit Hörschädigungen unterschiedlichen Grades.<br />
Die praktisch wichtigste Möglichkeit der Fernkommunikation ist hier bislang das FAX. Dieses<br />
Medium ist allerdings eher für kürzere Mitteilungen geeignet, ermöglicht nur einen zeitversetzten<br />
Austausch <strong>und</strong> setzt eine flüssige Beherrschung der Schriftsprache voraus. Insofern ist es z. B. von<br />
jüngeren Kindern nur mit externer Unterstützung zu nutzen. Ähnliches gilt auch für den E-Mail<br />
Anschluss, wobei über entsprechende Internetadressen auch der Austausch, die Kommunikation in<br />
Chatforen stattfinden kann.<br />
Schreibtelefone<br />
Das Schreibtelefon ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Kommunikation derjenigen hörgeschädigten<br />
Menschen, die aufgr<strong>und</strong> ihres Hörschadens andere Telefonhilfen nicht mehr nutzen können. Der<br />
Gesprächspartner benötigt allerdings auch ein Schreibtelefon, damit eine Gesprächsverbindung<br />
zustande kommen kann.<br />
Das Schreibtelefon arbeitet wie ein kleiner Fernschreiber, der mit der Schreibmaschinentastatur des<br />
Gerätes geschriebene Text wird in elektrische Signale umgewandelt, die über die Telefonleitung<br />
zum Schreibtelefon des Gesprächspartners übertragen werden. Dort werden die elektrischen Signale<br />
wieder als Buchstaben auf dem Display sichtbar. Es ist ein direkter Dialog möglich! Die modernen<br />
Schreibtelefone verfügen über eine Vielzahl von Zusatzmöglichkeiten z. B. Text vorschreiben, Text
68<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
speichern, Text ausdrucken, Adressen speichern, Anrufbeantworterfunktion, Fernabfrage,<br />
Direktwahl, Sprachansage, etc.<br />
Gebärdenassistent auf CD-ROM <strong>und</strong> im Internet<br />
Die Zentralstelle für Computer im Unterricht in Bayern - Augsburg - erprobt zur Zeit einen<br />
multimedialen Gebärdenassistenten auf CD-ROM mit lexikalischem Zugriff:<br />
- auf lautsprachlichen Gr<strong>und</strong>wortschatz<br />
- auf Gebärden<br />
<strong>und</strong> mit interaktivem Zugriff bei<br />
- Sprachaufbau <strong>und</strong> Kommunikation<br />
- Lautspracherwerb<br />
- Schriftspracherwerb<br />
- Sprecherziehung<br />
- Hörerziehung<br />
- Abseherziehung <strong>und</strong><br />
- Kommunikation<br />
Der Pager<br />
Mit dem Pager - einem scheckkartengroßen Funkempfänger - der Deutschen Funkruf GmbH (DFR)<br />
sind auch Taubstumme <strong>und</strong> Gehörlose unterwegs erreichbar.<br />
Mit dem Messaging-Dienst TeLMI können Nachrichten in Klartext auf etwa scheckkartengroße<br />
Funkempfänger (Pager) übermittelt werden. Das Absenden von Meldungen kann bei TeLMI<br />
ebenfalls ohne Telefon erfolgen: Die Messages lassen sich direkt am PC eingeben <strong>und</strong> per Online-<br />
Software, via E-Mail oder über das Internet verschicken.<br />
Je nach Gerät ist man in einer Großregion z. B. dem Rhein-Main-Gebiet oder sogar b<strong>und</strong>esweit im<br />
TeLMI-Funknetz erreichbar. Die Länge der Nachrichten kann bis zu 235 Zeichen betragen. Die<br />
Übertragung per E-Mail oder über das Internet ist während einer Einführungsphase kostenlos. Beim<br />
Zugang via Online-Software fallen etwa 60 Pfennig pro Message an.<br />
Das Bildtelefon<br />
Zur Zeit wird das Projekt ‚Einsatz von Bildtelefon für Gehörlose‘ durch die Universität Münster,<br />
Fachbereich Psychologie, die Deutsche Telekom, Berkom <strong>und</strong> die Westfälischen Schule für<br />
Gehörlose, Münster, durchgeführt. Das Bildtelefon bietet die Möglichkeit einer direkten<br />
Verständigung mit Hilfe der Gebärdensprache, die auch bereits von jüngeren Kindern in der Regel<br />
gut beherrscht wird <strong>und</strong> mit der sich Gehörlose untereinander gut verständigen können.<br />
Es lässt sich bereits jetzt erkennen, dass es sich bei der Bildtelefonie um eine gr<strong>und</strong>legende<br />
Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten gehörloser Personen handelt, die sehr gut <strong>und</strong> mit<br />
großem Interesse aufgenommen wird.<br />
Das Cochlear-Implantat<br />
Das Cochlear-Implantat (CI) ist eine spezielle Hörhilfe, die es Gehörlosen <strong>und</strong> Ertaubten mittels<br />
aufwändiger Elektronik ermöglicht, zu hören <strong>und</strong> besser zu kommunizieren. Das Cochlear<br />
(=Innenohr) Implantat ist eine elektrisch betriebene Innenohr-Prothese, die die Funktion des
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 69<br />
vollständig ausgefallenen Innenohrs, der häufigsten Form der Gehörlosigkeit, übernimmt. Damit ist<br />
das Cochlear-Implantat die erste routinemäßig eingesetzte Sinnesprothese.<br />
Abb.: Sprachprozessor mit Mikro <strong>und</strong> Sendespule Abb.: Implantat mit Elektroden<br />
Wie funktioniert ein CI?<br />
Ein Richtungsmikrofon leitet die akustischen Informationen über ein Kabel zum Sprachprozessor,<br />
der kleiner als ein Walkman ist. In diesem Gerät findet die Verarbeitung des Signals statt. Über die<br />
Sendespule, die magnetisch an der Kopfhaut hält, wird die Information drahtlos zum Implantat<br />
übertragen. Von dort gelangen die Signale gezielt<br />
an die einzelnen Elektroden stimulierenden Hörnerven,<br />
so dass Töne wahrgenommen werden.<br />
Ertaubte Erwachsene gewöhnen sich in der Regel<br />
schnell an die neuen Höreindrücke <strong>und</strong> können<br />
durch ein individuell angepasstes Hörtraining<br />
Sprache wieder verstehen lernen. Das Kind muss<br />
lernen, aus dem CI Nutzen zu ziehen. Es muss<br />
lernen, Umweltgeräusche zu deuten, richtig<br />
zuzuordnen. Vor allem aber steht die Erlangung<br />
einer möglichst hohen Sprachkompetenz -<br />
Sprache verstehen <strong>und</strong> Sprache einsetzen - im<br />
Mittelpunkt. Trotz aller intensiver Hör- <strong>und</strong> Spracherziehung bleibt jedoch die individuelle<br />
Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes von tragender Bedeutung. Die Eltern müssen<br />
lernen, wie sie sich nach der Implantation ihrem Kind gegenüber verhalten. Sie sind die wichtigsten<br />
Bezugspersonen <strong>und</strong> lernen, ihr Kind auf dem langen Weg zum Hören helfend zu begleiten.<br />
Weitere Informationen: CIC-Software<br />
3.4 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen mit<br />
geistiger Behinderung<br />
Computer haben mittlerweile auch verstärkt Einzug in die Schulen für geistig behinderte<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler gehalten. Aufgr<strong>und</strong> zahlreicher Erfahrungsberichte kann man davon<br />
ausgehen, dass auch diese Schülergruppe den Computer zu nutzen weiß <strong>und</strong> dass der Computer eine<br />
sinnvolle Ergänzung des didaktischen <strong>und</strong> therapeutischen Ansatzes der Schule ausmacht.<br />
Computerprogramme mit Werkzeugcharakter werden verstärkt im Unterricht erprobt <strong>und</strong><br />
eingesetzt. Es handelt sich dabei um folgende Programme:
70<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Malwas für Windows<br />
Das Programm bietet die einfachsten Malfunktionen an <strong>und</strong> ist sowohl mit der Maus als auch mit<br />
einem Finger oder Kopfschreiber zu bedienen. Die Funktionen sind über große <strong>und</strong> klar erkennbare<br />
Buttons am unteren Bildschirmrand aufrufbar, die zudem ein- <strong>und</strong> ausgeblendet werden können.<br />
Die Mauszeiger (Cursor) verändern sich entsprechend den Abbildungen auf den Buttons.<br />
MALWAS bietet die Möglichkeit, zwei unabhängige Fenster zu bearbeiten. Dadurch ergeben sich<br />
weitere Spielideen für zwei Personen oder eine Option zum Vergleichen oder zum Vormachen.<br />
Bauwas für Windows<br />
Das Computerprogramm BAUWAS für Windows bietet im Medienverb<strong>und</strong> ergänzend die<br />
Möglichkeit der computergestützten Konstruktion von Körpern sowie differenzierter<br />
Präsentationsformen. Die einfachste Form der Konstruktion ist die Positionierung von Würfeln<br />
durch Steuern des Cursors mit der Maus oder den Pfeiltasten auf eine gewünschte Position im<br />
virtuellen dreidimensionalen Raum. Linker Mausklick bedeutet das Hinzufügen eines Würfels,<br />
rechter Mausklick führt zum Entfernen eines Würfels. Schwieriger wird schon die Positionierung<br />
des Cursors mit den Pfeiltasten oder durch Mausklick auf entsprechende Buttons mit<br />
Richtungszuweisung.<br />
Kaufwas<br />
Das gemeinsame Frühstück ist ein wichtiges Ritual der Kommunikation in der Schule. Wird es zum<br />
Unterrichtsgegenstand, so bieten sich vielfältige Handlungsanlässe. Das Computerprogramm<br />
KAUFWAS kann geistig behinderte Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler bei der Vorbereitung der<br />
Lebensmitteleinkäufe unterstützen, indem es die Kaufsituation simuliert.<br />
Weitere Informationen: Softwaredokumentation (s.u.)<br />
ProduPlan<br />
ProduPlan ist eine Software, die den schulischen Einsatz von computergestützter Produktion in der<br />
Werkstufe der Schule für Geistigbehinderte ermöglicht. Sie versetzt die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
in die Lage, möglichst selbstständig eine CNC-Maschine (ISEL-Maschine) bedienen zu können <strong>und</strong><br />
damit zu produzieren.<br />
Weitere Informationen siehe Kapitel 2, Baustein „Geräte <strong>und</strong> Maschinen steuern“<br />
3.5 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen mit sprachlichen<br />
Beeinträchtigungen <strong>und</strong> Beeinträchtigungen beim Lernen<br />
In der Schule für Sprachbehinderte ist der sprechende Computer von großer Förder-Wirksamkeit.<br />
Sein Vorzug liegt in der Verknüpfung von Bild, geschriebener Sprache <strong>und</strong> gesprochener Sprache.<br />
Dieses Medium kann im Klassenunterricht (etwa bei Artikulations- <strong>und</strong> Satzbautraining), in der<br />
Freiarbeit sowie in individuellen Übungsphasen (etwa zur Lautdiskrimination oder bei der<br />
Stammler-Therapie) Anwendung finden. Bei Wortanalysen <strong>und</strong> Wortbildung bietet der sprechende<br />
Computer eine Vielfalt an Übungsformen.<br />
Das Gerät trägt vor allem dem individuellen Lerntempo des Schülers Rechnung, denn er ist als<br />
elektronischer Sprech- <strong>und</strong> Sprachpartner des jungen Menschen geduldig. Dieser bestimmt sein<br />
Arbeitstempo selbst. Lehrerkontrolle vor den Mitschülern, die zu Sprachvermeidungsverhalten<br />
führen kann, entfällt. Der Computer vollbringt also eine individuelle pädagogische Dienstleistung,<br />
die die Lehrkraft für den einzelnen Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler nicht zu leisten vermag.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 71<br />
Folgende Programme halten in dieser Schulform verstärkt Einzug:<br />
IBM-Sprechspiegel (s.o.)<br />
AudioLog<br />
AudioLog ist eine umfangreiche Sammlung von spielerischen Übungen am PC, das in der<br />
Sensibilisierung der zentralen auditiven Funktionen, sowie der Perzeption, der Merkfähigkeit, der<br />
Verarbeitung akustischer Sequenzen <strong>und</strong> der fonematischen Diskrimination erfolgreich eingesetzt<br />
werden kann. Da AudioLog aus Modulen aufgebaut wurde, kann man für weitere Therapieinhalte<br />
weitere Übungen in das vorhandene System integrieren. Solche Module werden laufend entwickelt<br />
<strong>und</strong> für diejenigen, die das Gr<strong>und</strong>paket schon besitzen, als preisgünstige Erweiterungen zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
LingWare<br />
Die Zielgruppe für die Sprachtherapie mit LingWare sind Patienten mit Sprachstörungen. Die<br />
Übungen des Programms zielen darauf ab, ihre sprachliche <strong>und</strong> schriftliche Kommunikationsfähigkeit<br />
wiederherzustellen.<br />
Im Rahmen einer b<strong>und</strong>esweiten multizentrischen Studie wurden in zehn Kliniken die<br />
Therapieeffekte von LingWare untersucht. Die Ereignisse der durch Einzelfalluntersuchungen<br />
untermauerten Studie zeigten signifikante Verbesserungen der Sprachleistungen aphasischer<br />
Patienten. Der Einsatz von LingWare in der Therapie von Sprachentwicklungsstörungen,<br />
Legasthenien <strong>und</strong> Hör-Sprachproblemen wurde erfolgreich getestet. Auf Seiten der Patienten <strong>und</strong><br />
Therapeuten traf LingWare von Anfang an auf große Akzeptanz.<br />
MatheTrainer – Akalkulietherapie<br />
Das vorliegende Programm „MatheTrainer“ unterstützt die Akalkulietherapie durch intensive<br />
Arbeit in den verschiedenen Teilbereichen wie Zahlen <strong>und</strong> Zählen, Regeln zur Lösung von<br />
Rechenaufgaben, Kurz- <strong>und</strong> Langzeitgedächtnis,<br />
Weitere Informationen: Phoenix Software<br />
3.6 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
durch Krankenhaus- <strong>und</strong> Hausunterricht<br />
Für junge Menschen, die am Krankenbett unterrichtet werden, erweisen sich elektronische Medien<br />
als Tor zur Außenwelt. Um auch bettlägerigen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern die Möglichkeiten des<br />
computerunterstützten Lernens zu eröffnen, ist eine Ausstattung mit tragbaren Computern (Notebooks)<br />
anzustreben.<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, die in einer Schule für Kranke oder zu Hause unterrichtet werden,<br />
verlieren während des oft mehrwöchigen stationären Aufenthalts den Kontakt zur Heimatschule.<br />
Das bedeutet, dass diese Schüler sofort nach ihrer Ges<strong>und</strong>ung die Schwierigkeiten, die mit der<br />
Wiedereingliederung in eine Lerngruppe verb<strong>und</strong>en sein können, bewältigen müssen. Das Internet<br />
kann diesen Schülern, von denen ein Teil zudem psychisch erkrankt ist, ermöglichen, den Kontakt<br />
zur Klasse aufrechtzuerhalten <strong>und</strong> mehr am sozialen Geschehen in der Klasse teilzuhaben.<br />
Vielleicht können auch Kommunikationsformen entwickelt werden, die es diesen Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern ermöglichen, online am Unterricht der Heimatschule teilzunehmen.
72<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Darüber hinaus können die Lehrkräfte der Heimatschulen mit den Lehrern der Schule für Kranke<br />
die Unterrichtsinhalte schnell <strong>und</strong> flexibel abstimmen sowie Unterrichtsmaterialien übermitteln<br />
bzw. austauschen.<br />
Weitere Informationen: www.erlangen.com/erlangen/loschge/sfk/y003sfkv.htm<br />
3.7 <strong>Informations</strong>system zur beruflichen Rehabilitation - REHADAT<br />
REHADAT ist ein <strong>Informations</strong>system zur Unterstützung der Integration von Behinderten in die<br />
Arbeitswelt das mit finanzieller Förderung des B<strong>und</strong>esministeriums für Arbeit <strong>und</strong> Sozialordnung<br />
durch das Institut der deutschen Wirtschaft Köln aufgebaut wurde. In insgesamt zehn Datenbanken<br />
zu verschiedenen Themenbereichen der beruflichen Rehabilitation wird umfangreiches <strong>Informations</strong>material<br />
sowohl für die Fachleute auf dem Gebiet als auch für die Betroffenen zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Die Datenbank ist auf CD-ROM (DOS- <strong>und</strong> Windows-Version) mit halbjährlicher Aktualisierung<br />
sowie im Internet verfügbar. Neben den Datenbanken bietet die Windows-Version zusätzlich die<br />
dynamische Sprachumschaltung <strong>und</strong> über 5000 Querverweise (Hyperlinks) zur integrierten<br />
Recherche über mehrere Datenbanken.<br />
In der Datenbank „Technische Hilfsmittel“ sind mit mehr als 20.000 Produkten fast alle in<br />
Deutschland erhältlichen Hilfsmittel für behinderte Menschen dokumentiert. Die Bereiche, für die<br />
Hilfsmittel angeboten werden, erstrecken sich von Hilfen im Haushalt über Orthesen <strong>und</strong> Prothesen<br />
bis hin zu behindertengerechten Maschinen <strong>und</strong> Werkzeugen. Alle Produkte sind mit Hersteller<strong>und</strong><br />
Vertriebsadressen, Preisangaben, technischer Beschreibung <strong>und</strong> Hinweisen zur Kostenübernahme<br />
durch die Krankenkassen dokumentiert.<br />
Die Datenbank „Recht“ wird in Zusammenarbeit mit dem <strong>Informations</strong>system Juris erstellt <strong>und</strong><br />
enthält die wichtigsten Gesetze <strong>und</strong> Verordnungen auf dem Gebiet der beruflichen Rehabilitation<br />
<strong>und</strong> Integration behinderter Menschen in die Arbeitswelt. Hierzu zählen auch Urteile <strong>und</strong><br />
Entscheidungen zur Hilfsmittelversorgung <strong>und</strong> zum Kündigungsschutz Behinderter. Urteile <strong>und</strong><br />
Gesetze sind über Stichworte leicht auffindbar. Neben den Angaben über Gericht, Aktenzeichen,<br />
Datum etc. erhält der Nutzer den offiziellen Leit- bzw. Orientierungssatz.<br />
Die Datenbank „Adressen“ ist eine der größten Sammlungen relevanter Adressen für den gesamten<br />
Rehabilitationsbereich <strong>und</strong> erleichtert die Kontaktaufnahme zu allen Stellen, die auf diesem Gebiet<br />
weiterhelfen können. Schwerpunkt ist die berufliche <strong>und</strong> soziale Integration. Über diese Thematik<br />
hinaus finden sich zahlreiche Adressen, die weiterführende Hilfe <strong>und</strong> Beratung bieten. So sind u.a.<br />
die Bereiche Selbsthilfe, barrierefreies Bauen <strong>und</strong> Wohnen, rechtliche <strong>und</strong> medizinische Beratung,<br />
behindertengerechtes Reisen <strong>und</strong> Hilfsmittelhersteller integriert.<br />
Die Datenbank „Einrichtungen“ enthält das Programm der Einrichtungen zur beruflichen Aus- <strong>und</strong><br />
Weiterbildung behinderter Menschen, angefangen mit den Einrichtungen der medizinischberuflichen<br />
Rehabilitation (Phase II), über Berufbildungswerke (BBW), Berufsförderungswerke in<br />
der Arbeitsgemeinschaft (BFW) <strong>und</strong> ähnliche Ausbildungseinrichtungen bis hin zu Spezialeinrichtungen.<br />
Neben den Anschriften der Einrichtungen erhält der Nutzer allgemeine Angaben<br />
über das Anmelde- <strong>und</strong> Aufnahmeverfahren <strong>und</strong> über begleitende Leistungen. Außerdem werden<br />
alle Ausbildungsberufe mit Ausbildungsdauer <strong>und</strong> Abschluss aufgeführt.<br />
Die Datenbank „Literatur“ enthält eine über 10.000 Dokumente umfassende Literatursammlung<br />
hauptsächlich zum Thema berufliche Rehabilitation <strong>und</strong> Integration. Neben den Schwerpunkten<br />
Ausbildung, Arbeit <strong>und</strong> Beruf wird auch Literatur erfasst, die zusätzlich zu diesem Gebiet<br />
weiterführende Information <strong>und</strong> Hilfestellung bietet.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 73<br />
Die Datenbank „Medien“ enthält Informationen über audiovisuelle Medien zur Rehabilitation <strong>und</strong><br />
Integration behinderter Menschen in die Arbeitswelt sowie zur sozialer Rehabilitation. Aufgeführt<br />
werden hauptsächlich Filme <strong>und</strong> Videos, die behinderte Menschen am Arbeitsplatz <strong>und</strong> in ihrem<br />
Lebensalltag zeigen. Neben einer kurzen Inhaltsangabe erhält der Nutzer die Bezugsadresse <strong>und</strong><br />
Angaben über Laufzeit <strong>und</strong> Kosten.<br />
Die „Seminardatenbank“ informiert über b<strong>und</strong>esweit stattfindende Fort- <strong>und</strong> Weiterbildungsveranstaltungen,<br />
die allen an der Rehabilitation Beteiligten Hilfe <strong>und</strong> Unterstützung in verschiedenen<br />
Bereichen ihrer täglichen Arbeit bieten sollen.<br />
Die weiteren Datenbanken informieren über „Praxisbeispiele“, „Forschung“ <strong>und</strong> „Werkstätten“.<br />
Das Internetangebot wird ergänzt durch aktuelle Nachrichten zur beruflichen <strong>und</strong> sozialen<br />
Rehabilitation.<br />
Informationen: Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
www.rehadat.de
74<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
4 Nutzung des Internet in der Schule<br />
4.1 Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Der Computer speichert Texte, Zahlen, Grafiken etc. in digitaler Form (Daten). Diese Daten können<br />
in kleinen Einheiten (Pakete) über Datenleitungen (z.B. Kabel, Telefonleitungen, Satellit, spezielle<br />
Datenleitungen) von einem Computer zu einem anderen Computer übertragen werden. Dieser<br />
Sachverhalt kann vereinfacht dargestellt werden <strong>und</strong> den Begriff <strong>und</strong> die Notwendigkeit des<br />
Übertragungsprotokolls (besser Übertra-<br />
aus PC-Magazin 10/98<br />
gungskontrolle) verständlich machen. Das<br />
Übertragungsprotokoll (im Internet wird mit<br />
der Protokollgruppe TCP/IP gearbeitet) gewährleistet<br />
das Erreichen des gewünschten<br />
Zieles sowie die korrekte Wiederherstellung<br />
der Daten am Zielort. Voraussetzung ist, dass<br />
jeder beteiligte Computer eine eindeutige Adresse<br />
hat.<br />
Begrenzte Netze mit der Struktur des Internet<br />
werden als Intranet bezeichnet. Ein Intranet<br />
ist innerhalb einer Schule mit vernetzten<br />
Computern möglich, kann aber auch als<br />
Verb<strong>und</strong> von Schulen eingerichtet werden <strong>und</strong> ermöglicht das kostengünstige <strong>und</strong> adressatenorientierte<br />
Publizieren von Informationen sowie elektronisches Kommunizieren im begrenzten Raum,<br />
ohne ständig der endlosen Datenflut des Internet ausgesetzt zu sein.<br />
Das Internet ist ein weltweites dezentrales Datennetz, das sich aus einer großen Zahl kleiner Netze<br />
zusammensetzt. Im Internet sind verschiedene Kommunikations- bzw. Publikationstechniken,<br />
sogenannte Dienste, realisiert. Die für die Schule wichtigsten Dienste sind das WorldWideWeb<br />
(WWW) <strong>und</strong> E-Mail, in zweiter Linie die Newsgroups <strong>und</strong> das Chat.<br />
Technische Voraussetzungen zur Nutzung von Online-Diensten bzw. des Internet<br />
Um die Informationen des Internet nutzen zu können, muss ein Computer die hard- <strong>und</strong> softwaremäßigen<br />
(s.u.) Voraussetzungen in Form eines Modems oder einer ISDN-Erweiterungskarte<br />
<strong>und</strong> der zugehörigen Funktions-Software erfüllen. Weiterhin erforderlich ist ein Partner, über den<br />
man die Verbindung zwischen lokalem PC <strong>und</strong> dem Internet herstellen kann, einen Internet Service<br />
Provider (ISP). Das sind im kommerziellen Bereich Anbieter, die den Zugang gegen Bezahlung<br />
bereitstellen. Im nichtkommerziellen Bereich kann der Internetzugang für einen jeweils berechtigten<br />
Personenkreis über Universitäten, große Schulen, Institute <strong>und</strong> andere Einrichtungen, die mit<br />
ihrem Computernetz mit dem Internet verb<strong>und</strong>en sind, realisiert werden. In beiden Fällen erfordert<br />
die Nutzung des Internets von einem Einzelplatz-PC aus eine Telefonverbindung zum „Partner“,<br />
weshalb für die Dauer der Verbindung Telefongebühren anfallen. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e ist es<br />
wichtig, dass der Anbieter des Internetzugangs möglichst im City-Bereich erreichbar ist, um die<br />
anfallenden Telefongebühren möglichst gering zu halten.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 75<br />
Online-Dienste<br />
T-Online, America Online (AOL) <strong>und</strong> Compuserve sind b<strong>und</strong>esweit agierende Online-Dienste mit<br />
Internet-Zugang. Diese Online-Dienste bieten ein eigenes System an <strong>Informations</strong>seiten. Ihre<br />
Nutzung erfordert einen gebührenpflichtigen Zugang zu diesem Netz sowie ein besondere Software,<br />
die der Anbieter zur Verfügung stellt. Neben den <strong>Informations</strong>seiten des eigenen Systems bieten<br />
alle genannten Online-Dienste auch einen Internetzugang mit Nutzung der wichtigsten Internet-<br />
Dienste an. Mittlerweile sind die Online-Dienste überall in Deutschland zum Ortstarif erreichbar.<br />
Internet-by-call<br />
Der Zugang zum Internet kann auch über eine Telefongesellschaft per Internet-by-call realisiert<br />
werden. Viele Telefongesellschaften bieten diesen Dienst ohne vertragliche Bindung <strong>und</strong> ohne<br />
vorherige Anmeldung an. Die Abrechnung der Verbindungs- <strong>und</strong> Zugangskosten erfolgt über die<br />
Telefonrechnung. Da der Zugang technisch über das DFÜ-Netzwerk von Windows realisiert wird,<br />
ist außer dem kostenlosen Browser (s.u.) keine zusätzliche Software erforderlich. Die Kosten<br />
unterscheiden sich je nach Gesellschaft <strong>und</strong> ändern sich häufig. Eine genaue Nutzungsanalyse bietet<br />
sich an <strong>und</strong> auch die Nutzung mehrerer Zugänge kann sich kostenmindernd auswirken.<br />
Mit der Einwahl-Nr. 01019-01929 bietet z.B. der Netzbetreiber mobilcom bei freier Wahl von<br />
Benutzername <strong>und</strong> Kennwort z.Z. ohne vorherige Anmeldung einen Internetzugang für 5 Pf pro<br />
Minute (einschl. Telefongebühren) bei einem Minutentakt an.<br />
4.2 Die wichtigsten Dienste im Internet<br />
<strong>Informations</strong>suche im WorldWideWeb<br />
Der Browser<br />
Im WorldWideWeb werden <strong>Informations</strong>seiten publiziert, die im einfachsten Falle nur Text, meist<br />
aber zusätzlich Grafiken, bewegte Objekte <strong>und</strong> auch Tondokumente enthalten. Weiterhin enthalten<br />
die meisten WWW-Seiten Hyperlinks (Schaltflächen). Hyperlinks sind Verknüpfungen mit anderen<br />
Zeile zur<br />
Eingabe/Anzeige der<br />
Internetadressse<br />
Angezeigte Internetseite<br />
Schaltflächen<br />
(Hyperlinks)<br />
Eingabezeile für die<br />
Stichwortsuche<br />
Seiten <strong>und</strong> oft nur dadurch erkennbar, dass der Mauszeiger die Form eines Zeigerfingers annimmt,<br />
wenn er sich über einem Hyperlink befindet. Durch Anklicken eines Hyperlinks wird die mit der<br />
Schaltfläche verknüpfte Seite übertragen <strong>und</strong> angezeigt. Das auf diese Weise mögliche häufige<br />
Wechseln der Internetseite durch Anklicken von Hyperlinks bezeichnet man als Internet-Surfen.
76<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Das Erscheinungsbild sowie die Hyperlinks dieser Seiten wird mit besonderen Zeichen gesteuert,<br />
den HTML-Befehlen (HTML: HypertextMarkupLanguage).<br />
Um eine Internetseite auf dem eigenen PC sehen zu können müssen die Daten auf den eigenen PC<br />
übertragen <strong>und</strong> die Seite auf dem Bildschirm dargestellt werden. Das Programm sucht beim<br />
Anklicken eines Hyperlinks die gewünschte Seite im WWW, überträgt sie auf den Computer <strong>und</strong><br />
zeigt sie an. Ein solches Programm bezeichnet man als Browser.<br />
Die verbreiteten aktuellen Browser sind Netscape Communicator <strong>und</strong> Microsoft Internet Explorer.<br />
Beide sind für den nichtkommerziellen Bereich kostenlos verfügbar. Um eine WWW-Seite zu<br />
sehen, muss im Browser ihre Internetadresse eingegeben werden. Eine Internetadresse hat folgende<br />
Form:<br />
http://www.web.de<br />
http://bildung-rp.de<br />
http://www.uni-trier.de<br />
Die Eingabe von http:// ist bei den genannten Browsern nicht erforderlich.<br />
Der Browser ermöglicht auch das Abschicken von E-Mails (s.u.) sowie das Übertragen dazu vorbereiteter<br />
Dateien auf den eigenen PC (Download). Die Adressen häufiger genutzter WWW-Seiten<br />
können als Lesezeichen (Bookmarks, Favoriten) abgespeichert werden, wodurch das wiederholte<br />
Eingeben der Adresse entfällt.<br />
Seiten können sofort ausgedruckt werden <strong>und</strong> Texte über die Zwischenablage in andere Programme<br />
übertragen werden (z.B. Textverarbeitung). Auch Grafiken, die auf WWW-Seiten abgebildet sind,<br />
können durch Klicken der rechten Maustaste <strong>und</strong> Wählen des Befehls „Grafik speichern“ schnell<br />
auf dem lokalen PC gespeichert <strong>und</strong> genutzt werden. Die neuesten Browser (z.B. Internet Explorer<br />
5) ermöglichen auch das komplette Speichern einer Internetseite mit allen Elementen.<br />
Suchhilfen<br />
Die sehr große <strong>und</strong> kaum strukturierte <strong>Informations</strong>fülle des Internet erfordert Werkzeuge <strong>und</strong><br />
Strategien, die gesuchte Information zu finden. Nur selten kennt man die Internetadresse mit der<br />
gesuchten Informationen, ja häufig weiß man nicht, ob eine Information im Internet angeboten<br />
wird. Bei der gezielten Suche nach Informationen sind die Suchmaschinen <strong>und</strong> Web-Verzeichnisse,<br />
deren man sich kostenlos im Internet bedienen kann, eine wertvolle Hilfe.<br />
Mit einem Web-Verzeichnis sucht man über<br />
hierarchisch geordnete Sachgebiete den gewünschten<br />
Themenbereich <strong>und</strong> erhält dann eine Liste der<br />
Seiten, die in dem Verzeichnis zum Thema<br />
vorgef<strong>und</strong>en werden.<br />
Eine Suchmaschine sucht zu einem Stichwort die<br />
Webseiten, auf denen das Stichwort enthalten ist<br />
<strong>und</strong> stellt eine Liste mit den entsprechenden Links<br />
bereit. Die Links mit der höchsten Übereinstimmung<br />
mit dem Suchbegriff erscheinen oben auf<br />
Abb.: Suchmaschine www.yahoo.de<br />
der Ergebnisliste. Die erweiterte Suche ermöglicht<br />
die logische Verknüpfung von Suchbegriffen mit Hilfe der Operatoren „<strong>und</strong>“ „oder“ „nicht“ <strong>und</strong><br />
damit gezieltes Suchen.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 77<br />
Die Nutzung von Suchmaschinen <strong>und</strong> Webverzeichnissen ist der sinnvolle Weg, Informationen<br />
ohne Kenntnis einer Internetadresse zu suchen. Ihr Einsatz vermindert Online-Kosten <strong>und</strong><br />
Frustrationen bei erfolgloser <strong>Informations</strong>suche. Viele Suchmaschinen sind deutschsprachig <strong>und</strong><br />
können die Suche auf Deutschsprachige Seiten begrenzen. Aufgr<strong>und</strong> unterschiedlicher<br />
Arbeitsweisen der verschiedenen Suchmaschinen können sich die Suchergebnisse etwa zu einem<br />
Stichwort stark unterscheiden, weshalb die Nutzung mehrerer Suchmaschinen empfohlen wird.<br />
Die <strong>Informations</strong>suche im Internet ist eine komplexe Tätigkeit. Aus der <strong>Informations</strong>fülle der Seiten<br />
sind die für das Weiterkommen wichtigen Informationen zu finden, wozu auch eine gute<br />
Lesefertigkeit erforderlich ist. Ein falscher Klick, nicht selten auf einen gut platzierten Werbelink,<br />
führt zu einer nicht gewünschten Seite. Da zudem keineswegs in jedem Falle sicher ist, dass die<br />
gesuchte Information im Internet zu finden ist, muss auch der ergebnislose Abbruch der Suche<br />
einkalkuliert werden.<br />
Hier eine Auflistung der wichtigsten deutschsprachigen Suchmaschinen:<br />
www.excite.de<br />
www.allesklar.de<br />
www.yahoo.de<br />
www.lycos.de<br />
www.alta-vista.de<br />
www.web.de<br />
www.fireball.de<br />
www.eule.de<br />
www.blinde-kuh.de<br />
www.infoseek.de<br />
Suchdienste werden meist über Werbeeinblendungen finanziert.<br />
Offline-Browser<br />
Spezielle Zusatzprogramme (Offline-Browser) ermöglichen das Herunterladen kompletter Web-<br />
Publikationen (die meist aus mehreren Seiten bestehen) mit den enthaltenen Verknüpfungen. Die<br />
Seiten können dann ohne Verbindung zum Internet (offline) <strong>und</strong> somit ohne Leitungskosten genutzt<br />
werden. Dies empfiehlt sich bei Seiten, die viel Text enthalten <strong>und</strong> bei Seiten, die Arbeitsaufgaben<br />
wie Rätsel o.Ä. enthalten. Auch beim Arbeiten mit leseschwachen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
empfiehlt sich der Einsatz ein Offline-Browsers.<br />
Die neueste Browser-Generation ermöglicht bereits das Offline-Browsen mit vorher besuchten<br />
Seiten.<br />
Elektronische Post<br />
E-Mail ist ein Dienst im Internet, der das Versenden elektronischer Briefe ermöglicht. Erforderlich<br />
hierfür ist neben dem Internetzugang (s.o.) eine E-Mail-Adresse, die vom Provider zugeteilt wird<br />
oder bei einem E-Mail-Dienstleister beantragt werden kann. Mit den meisten Browser kann ein E-<br />
Mail-Programm (E-Mail-Client) installiert werden, das Abschicken, Empfangen <strong>und</strong> Verwalten von<br />
E-Mails ermöglicht. Eine abgeschickte E-Mail gelangt zunächst beim Provider des Adressaten in<br />
eine Mailbox (auf dem E-Mail-Server) <strong>und</strong> kann dort vom Empfänger unter Nutzung eines<br />
zugeteilten Passwortes abgeholt werden.<br />
E-Mail-Dienste bieten kostenlos E-Mail-Adressen an. Mit einer solchen Adresse ist man nicht an<br />
einen Provider geb<strong>und</strong>en, sondern kann seine Adresse bei einem eventuellen Providerwechsel<br />
behalten. Zudem kann von jedem Browser auf das eigene Postfach zugegriffen werden, so dass man
78<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
von jedem PC mit Internet-Zugang Zugriff auf die erhaltenen E-Mail hat. (z.B. www.gmx.de,<br />
www.topmail.de)<br />
Einfache E-Mails enthalten nur Text, neuere E-Mail-Programme erlauben bereits aufwändiger<br />
gestaltete elektronische Briefe. An eine E-Mail können eine oder mehrere Dateien angehängt<br />
werden, die mit der E-Mail zum PC des Adressaten übertragen werden. Somit können per E-Mail<br />
beliebige digitale Dokumente wie etwa Textverarbeitungsdateien, Grafiken, Tondokumente <strong>und</strong><br />
Videosequenzen von PC zu PC übertragen werden.<br />
Gesprächsgruppen im Internet (Newsgroups)<br />
Newsgroups sind thematische Gesprächsforen im Internet, in denen die Teilnehmer Textbeiträge an<br />
die Newsgroup schicken, die dann im Forum veröffentlicht werden. Es gibt unmoderierte<br />
Newsgroups, bei denen alle Beiträge unkontrolliert veröffentlicht werden <strong>und</strong> moderierte<br />
Newsgroups, bei denen der Moderator entscheidet, welche Beiträge veröffentlicht werden.<br />
Newsgroups arbeiten auf der Gr<strong>und</strong>lage der E-Mail-Technik: Ein Teilnehmer schreibt eine E-Mail<br />
<strong>und</strong> schickt diese übers Internet an alle Teilnehmer der Gruppe.<br />
Newsgroups bieten eine interessante Perspektive für Lehrkräfte wie auch für Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler <strong>und</strong> werden in Zukunft hier eine Bedeutung erlangen, wenn die erforderlichen Strukturen<br />
entwickelt sind.<br />
Erstellen <strong>und</strong> Publizieren eigener WWW-Seiten<br />
Web-Publishing ergänzt zunehmend die gebräuchlichen Medien wie Buch, Zeitschrift, Zeitung,<br />
Diskette, CD-ROM, etc. Allen genannten Medien hat das Web-Publishing den Vorteil der größeren<br />
Flexibilität <strong>und</strong> Aktualität, der weitaus geringeren<br />
Kosten (bei vorhandener Infrastruktur) sowie der<br />
unmittelbaren Nutzung von Inhalten durch den<br />
Leser. Hinzu kommen Verbindungen zu anderen<br />
Seiten (Links) sowie die schnelle Möglichkeit der<br />
Rückmeldung <strong>und</strong> der Interaktivität. Diese Vorteile<br />
ermöglichen per Internet auch Schulen interessante<br />
Publikationsmöglichkeiten.<br />
Mit Hilfe moderner Textverarbeitungsprogramme<br />
oder bedienerfre<strong>und</strong>licher Programme zur Web-<br />
Abb.: Begrüßungsseite der Schloss-Schule Ludwigshafen<br />
seitenerstellung können Internetseiten auch von<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern erstellt werden. Hierzu sind nur wenige Kenntnisse erforderlich, die<br />
über die Gr<strong>und</strong>funktionen der Textverarbeitung hinausgehen. Zumindest können sie die Texte am<br />
PC erfassen, die dann vom „Spezialisten“ in die Web-Seite aufgenommen werden. Besteht das<br />
Internet-Projekt aus mehreren Seiten, so werden diese mit Hyperlinks miteinander verknüpft.<br />
Navigationshilfen vereinfachen die Orientierung auf den oft aus vielen verknüpften Seiten<br />
bestehenden Angeboten. Hierbei erfahren die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler unmittelbar die<br />
Funktionsweise der Links auf den Web-Seiten.<br />
Um die erstellten Seiten im Internet publizieren zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten:<br />
• Steht der Schule ein eigener Internet-Server zur Verfügung, können die Seiten über diesen<br />
publiziert werden. Hier sollte der Aspekt Kosten/personeller Aufwand – Nutzen kritisch in evtl.<br />
Planungen einbezogen werden.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 79<br />
• Auf dem rheinland-pfälzischen Bildungsserver können Schulen ihre Webseiten publizieren.<br />
Infos hierzu bei den <strong>Fachberater</strong>n oder der Redaktion des Landesbildungsservers<br />
(bildung-rp.de)<br />
• Kostenlose Service-Dienste im Internet<br />
• Kommerzielle Internetanbieter (Provider) bieten ihren K<strong>und</strong>en meist die Möglichkeit, in<br />
begrenztem Umfang Web-Seiten über den Provider zu publizieren.<br />
• Universitäten, Fachhochschulen, Gymnasien, Berufsschulen betreiben oft eigene Internetserver,<br />
so dass sich hier Publikationswege ergeben können.<br />
Informationen hierzu finden sich meist auf den Internetseiten dieser Server bzw. Anbieter.<br />
Die Internet- sowie die E-Mail-Adressen der rheinland-pfälzischen Schulen sind auf der Schulliste<br />
des Bildungsservers zu finden. Die Redaktion des Bildungsservers bittet darum, fehlende oder<br />
geänderte Adressen mitzuteilen.<br />
Tipps für den Unterricht<br />
• Homepage der Schule, der Klassen, der Computer-AG;<br />
• Info-Seite über Betriebspraktikum:<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler listen ihre Praktikumsberufe sowie die Betriebe auf; kurze<br />
Erfahrungsberichte, Leser können per E-Mail bzw. Formulareingabe Inhalte ergänzen bzw.<br />
Kommentare einbringen.<br />
• Rückmeldungen ehemaliger Schüler, die für aktuelle Schüler von Interesse sind.<br />
• Lehrkräfte: Arbeitsblätter zur Praktikumsmappe; rechtliche Informationen zum Praktikum,<br />
Hinweise auf <strong>Informations</strong>material, Besprechung von Materialien, Ergänzungsmöglichkeiten<br />
der Leser, Kooperationsangebote.<br />
Weitere Themen für Info-Seiten<br />
• Tipps für Klassenfahrten (Ziele, Aktivitäten, Informationen)<br />
• Arbeitsgemeinschaften an Schulen<br />
• Projekte an Schulen (Vorstellen von Projekten, Erfahrungen, Materialien, Adressen)<br />
• Texte <strong>und</strong> Gedichte von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern, Schülerwitze<br />
• Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte<br />
• Sachtexte für den Unterricht, selbsterstellte Grafiken, kleine Lernprogramme<br />
• Gedichte in der Förderschule<br />
• Rätselseiten<br />
4.3 Der Bildungsserver des Landes Rheinland-Pfalz<br />
Unter der Internetadresse bildung-rp.de publiziert das Landesmedienzentrum im Auftrage der<br />
Landesregierung Informationen zum Thema Bildung, Schule <strong>und</strong> Unterricht. Die Fortbildungsdatenbank<br />
enthält die Angebote der Lehrerfort- <strong>und</strong> -weiterbildungsinstitute des Landes.<br />
Informationen zur Schulentwicklung, Qualitätssicherung <strong>und</strong> zum Unterricht bieten die<br />
Serviceeinrichtungen LMZ, PZ, SIL <strong>und</strong> Schulpsychologischer Dienst (SpD) <strong>und</strong> u.a. auch die<br />
<strong>Fachberater</strong> für Computer an Sonderschulen an. In Mailinglisten werden Informationen zu<br />
bestimmten Themen per E-Mail publiziert <strong>und</strong> diskutiert. Mit der Mediendatenbank MIS (auch auf<br />
CD-Rom verfügbar) kann im Katalog der Bildstellen recherchiert werden. Weiterhin bietet der<br />
Bildungsserver Informationen zu schulischen Projekten, zu aktuellen pädagogischen Themen,
80<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Pressemitteilungen <strong>und</strong> Links zu anderen schulrelevanten Internetangeboten. In der Schulkurzliste<br />
bzw. Schuldatenbank sind die wichtigsten Adressdaten aller rheinland-pfälzischen Schulen zu<br />
finden, ggf. einschließlich E-Mail- <strong>und</strong> Internetadresse.<br />
Die Sonderschulseiten (bildung-rp.de/LMZ/sonder.pht) bieten Informationen für die rheinlandpfälzischen<br />
Sonderschulen. Unter anderem finden Sie dort Tipps zu Lernsoftware sowie<br />
ausgewählte Themen der Handreichungen mit zusätzlichen Informationen.<br />
Webadressen zu pädagogischen Themen<br />
Die nachstehenden Internet-Adressen bieten sich für Lehrkräfte als Ausgangspunkt der Suche nach<br />
pädagogischen Informationen im Internet an. Hier finden sich meist auch Links zur Sonderpädagogik<br />
bzw. Sonderschulen.<br />
www.zum.de<br />
Die Zentrale für Unterrichtsmedien ist eine Lehrerinitiative mit einem sehr großen Angebot an<br />
Informationen <strong>und</strong> Materialien für Schule <strong>und</strong> Unterricht.<br />
dbs.schule.de<br />
Der Deutsche Bildungsserver ist eine Einrichtung von Humboldt-Universität Berlin <strong>und</strong> DFN-<br />
Verein (Deutsches Forschungsnetz) <strong>und</strong> publiziert Links zu Bildungsinstitutionen, pädagogischen<br />
Projekten, Personen, Veranstaltungen, Verlagen etc. Die Informationen werden in einer Datenbank<br />
verwaltet <strong>und</strong> können dort recherchiert werden.<br />
www.schulweb.de<br />
Das Schulweb ist ein Teil des Deutschen Bildungsservers. Links zu Bildungsservern, Schulen im<br />
deutschsprachigen Raum, Schulprojekte, Chatadressen, Literaturinfos, Diskussionsforen etc.<br />
www.san-ev.de<br />
Umfassende administrative <strong>und</strong> pädagogische Informationen zu „Schulen ans Netz“ finden sich<br />
unter diese Adresse.<br />
www.schule.de<br />
Das Offene Deutsche Schulnetz ist ein Angebot des Landesbildstelle Berlin.<br />
Internetadressen von Bildungsservern einzelner B<strong>und</strong>esländer<br />
Bayern www.zs-augsburg.de<br />
Baden-Württemberg lbs.bw.schule.de<br />
Berlin www.be.schule.de / www.labi.be.schule.de<br />
Brandenburg www.brandenburg.de/schulen<br />
Bremen www.bremen.schule.de<br />
Hamburg lbs.hh.schule.de<br />
Hessen www.bildung.hessen.de<br />
Niedersachsen nibis.ni.schule.de<br />
Nordrhein-Westfalen www.learn-line.nrw.de<br />
Rheinland-Pfalz bildung-rp.de<br />
Sachsen www.sn.schule.de<br />
Schleswig-Holstein www.sh.schule.de<br />
Thüringen www.th.schule.de
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 81<br />
5 Programme für Lehrkräfte<br />
5.1 Schulschriften<br />
Schriften am Computer<br />
Die Gestaltungsmöglichkeiten moderner Computerprogramme, ob Textverarbeitung, ob Grafikoder<br />
DTP-Programm, basieren erheblich auf der Verfügbarkeit von verschiedenen Schriftarten<br />
(Fonts), die ohne Qualitätseinbußen in verschiedenen Größen am Bildschirm <strong>und</strong> am Drucker<br />
ausgegeben werden können. Die unter Windows installierten Schriften können mit jeder Windows-<br />
Textverarbeitung oder einem Grafikprogramm benutzt werden.<br />
Eine Computerschrift besteht aus einer Anzahl an Zeichen (Zeichensatz). Ein Teil der Zeichen ist<br />
jeweils einer Taste oder Tastenkombination zugeordnet <strong>und</strong> kann somit per Tastatur eingegeben<br />
werden. Die meisten Schriften enthalten mehr Zeichen, als über die Tastatur ausgegeben werden<br />
können. Einen Überblick über die in einer Schriftart enthaltenen Zeichen kann man sich mit dem<br />
Windows-Tools „Zeichentabelle” oder mit entsprechenden Hilfsprogrammen verschaffen. Jedem<br />
verfügbaren Zeichen eines Zeichensatzes ist eine Zeichencode zugeordnet. Gibt man bei gedrückter<br />
Alt-Taste den Zeichencode mit vorgestellter 0 (Eingabe mit dem Ziffernblock der Tastatur) ein,<br />
wird das gewünschte Zeichen ausgegeben. So ist dem Zeichen · der Code Alt+0183 zugeordnet.<br />
Dieses Zeichen, das in den Standardschriften enthalten ist, eignet sich gut als Multiplikationszeichen<br />
bei Mathematikaufgaben. Entsprechend bietet sich – als Subtraktionszeichen an. Diesem<br />
Zeichen ist der Code Alt+0150 zugeordnet.<br />
Kennt man den Zeichencode, so ist dies der schnellste Weg, ein Zeichen, das nicht über die Tastatur<br />
aktiviert werden kann, einzugeben. Mit Hilfsprogrammen wie Typograph oder den ZARB-Makros<br />
(s.u.) lassen sich Zeichentabellen ausdrucken, die auch die Zeichencodes aller Zeichen enthalten.<br />
Zeichentabelle „TIMES NEW ROMAN“ (Zeichen, darunter der Zeichen-Code: Alt + 0__)<br />
! " # $ % & ’ ( ) * + , - . /<br />
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?<br />
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63<br />
@ A B C D E F G H I J K L M N O<br />
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79<br />
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _<br />
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95<br />
‘ a b c d e f g h i j k l m n o<br />
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111<br />
p q r s t u v w x y z { | } ~<br />
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127<br />
? ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ ?<br />
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143<br />
‘ ’ “ ” – — ˜ š › œ ? Ÿ<br />
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159<br />
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ - ® ¯<br />
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175<br />
° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿<br />
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191<br />
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï<br />
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207<br />
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß<br />
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223<br />
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï<br />
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239<br />
ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ<br />
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
82<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Schreibschriften<br />
Bei den üblichen Computerschriften stehen die Einzelbuchstaben weitgehend unverb<strong>und</strong>en<br />
hintereinander. Im Unterschied dazu handelt es sich bei den Schreibschriften um verb<strong>und</strong>ene<br />
Schriften, d.h. die benachbarten Buchstaben sind miteinander verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> das<br />
genaue Aussehen eines Buchstabens kann sich abhängig vom nachfolgenden<br />
Buchstaben verändern. Um Schreibschriften in hoher Darstellungsqualität erzeugen zu<br />
können, müssen somit aufeinanderfolgende Buchstaben korrekt verb<strong>und</strong>en werden.<br />
Das gelingt, indem entweder ein passendes Verbindungsstück eingesetzt wird oder ein<br />
Buchstabe in mehreren Formen in der Schrift enthalten ist. Ein Zusatzprogramm analysiert beim<br />
Schreiben die Buchstabenfolgen <strong>und</strong> stellt die erforderlichen Buchstabenverbindungen her.<br />
Schulschriften<br />
In den Schulen können folgende Schriften eingesetzt werden:<br />
• Lateinische Ausgangsschrift (LA)<br />
• Vereinfachte Ausgangsschrift (VA)<br />
• Schulausgangsschrift (SAS)<br />
• Druckschrift Hamburg (DH)<br />
• Druckschrift Bayern (DB)<br />
Die Schriften können jeweils ohne Lineatur, mit Gr<strong>und</strong>linie, mit zwei <strong>und</strong> mit vier Hilfslinien<br />
erstellt werden. Punkteschriften zeigen die Buchstaben in gepunkteter Linie, die dann nachgespurt<br />
werden kann. Bei Umrissschriften sind nur die Außenlinien der Buchstaben sichtbar. Bei starker<br />
Vergrößerung bieten sich diese Buchstaben u.a. zum Ausmalen an.<br />
Da alle Schriften skalierbar <strong>und</strong> mit Farbdruckern auch farbig ausgedruckt werden können, ergibt<br />
sich für den Schulalltag ein sehr breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.<br />
Beispieltabelle Schulschriften<br />
Lateinische<br />
Ausgangsschrift<br />
LA<br />
Vereinfachte<br />
Ausgangsschrift<br />
VA<br />
Schulausgangsschrift<br />
SAS<br />
Druckschrift<br />
Hamburg<br />
DH<br />
Druckschrift<br />
Bayern<br />
DB<br />
Ohne Lineatur 4W?DQHA Schule Schule 6FKULIW 6FKULIW<br />
Mit Gr<strong>und</strong>linie 4YAFSJC 4AFSJC Schule 6FKULIW 6FKULIW<br />
Mit zwei<br />
Hilfslinien 4YAFSJC 4AFSJC Schule 6FKULIW 6FKULIW<br />
Mit vier<br />
Hilfslinien 4YAFSJC 4AFSJC Schule 6FKULIW 6FKULIW<br />
Punkteschrift 4W?DQHA 4?DQHA Schule 6EJTKHV 6EJTKHV<br />
Umrissschrift 2T 4?DQHA Schule 6FKULIW 6FKULIW<br />
Schulschriften werden als Schriftengruppen oder als Gesamtpaket angeboten. Sie enthalten die<br />
Schriften stets mit den gebräuchlichen Lineaturen sowie ohne Linien. Schulschriften werden<br />
angeboten von:<br />
Will-Software<br />
Gesamtpaket: LA, VA, SAS, DH, DB, Punktschriften, Umriss-Schriften,
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 83<br />
Eugen Traeger Lernsoftware<br />
Einzelpakete zu LA, VA, SAS jeweils mit Druckschriften<br />
Punkteschriften zu jeweils einer Schreibschrift<br />
Eurocomp<br />
Einzelpakete zu LA, VA <strong>und</strong> SAS mit Druckschriften <strong>und</strong> Umriss-Schriften<br />
Medienwerkstatt Mühlacker<br />
Einzelpakete zu LA, VA <strong>und</strong> SAS mit Druckschriften <strong>und</strong> Umriss-Schriften<br />
Pakete mit Mathe- oder/<strong>und</strong> Päd. Piktogrammen (s.u.)<br />
Auer-Verlag<br />
Gesamtpaket mit allen Gr<strong>und</strong>schulschriften<br />
Schulpiktogramme<br />
Schulpiktogramme sind ebenfalls Zeichensätze, allerdings handelt es sich hierbei im Gegensatz zu<br />
den Schriftzeichen der normalen Schriftarten um kleine Grafiken oder Symbole. Vergleichbare<br />
Zeichensätze sind als „Wingdings” <strong>und</strong> „Symbol” bereits in Windows enthalten.<br />
Die Schulpiktogramme bestehen meist aus mehreren thematischen Zeichensätzen. Die Zeichen<br />
können wie bei der Schriftart über die Tastatur aufgerufen werden. Da die Tastenzuordnung jedoch<br />
nicht erkennbar ist, ist auch hier für ein sinnvolles Arbeiten das Tool „Zeichentabelle”<br />
empfehlenswert. Bei intensiver Nutzung der Symbolzeichensätze ist das Ausdrucken einer<br />
Zeichentabelle ratsam, mit deren Hilfe man die gewünschten Zeichen über die zugehörige Taste<br />
oder aber den Zeichencode (Alt + 0__) sehr schnell aufrufen kann.<br />
Schulpiktogramme werden zu vielen Themenbereichen angeboten:<br />
- verschiedene Anlautgruppen<br />
- Buchstaben in Bausteinen, die am Bildschirm aneinander gefügt werden können, Ziffern in<br />
Kästchen ( )<br />
- Rahmenschriften<br />
- Balken- oder Kästchenschriften mit Ober- <strong>und</strong> Unterlängen (6EJWNG)(6EJWNG)<br />
- Mathematische Zeichensätze (Anzahlen, Brüche, geometrische Figuren, Mengenzeichen,<br />
Zahlenstrahlteile, Geldmünzen, Uhren, Kreissegmente)<br />
- Schulbezogene Piktogramme (Bsp. siehe nachfolgende Tabelle)<br />
- Rätselschriften<br />
- Namenwörter<br />
- Tunwörter<br />
- Verkehrszeichen
84<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Beispiel: Piktogramme „Schule“ (Will-Software)<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 < = ?<br />
A B C D E F G H I JK L M N O<br />
PQ R S T UVWXYZ<br />
a b c d e f g h i j k l m n o<br />
p q r s t uvw xyz<br />
Œ<br />
¥ ¦ § ¨ ª « ¬ ®<br />
Die Einsatzmöglichkeiten von Schulpiktogrammen sind äußerst vielfältig. Sie können u.a.<br />
eingesetzt werden zur grafischen Gestaltung von Arbeitsmitteln, zur visuellen Unterstützung von<br />
Arbeitsaufträgen, zum Darstellen mathematischer Aufgaben, zur Gestaltung von Einladungen,<br />
Karten, Broschüren etc., zur Gestaltung des Wochen- bzw. Freiarbeitsplans, zur Erstellung von<br />
Rätseln.<br />
Hinweis: Meist werden die Schriften <strong>und</strong> Piktogramme als Einzel- <strong>und</strong> als Schullizenz angeboten. Bei einer<br />
Schullizenz können alle Lehrkräfte der Schule die Software nutzen. Die Schullizenz kostet meist weniger als<br />
drei Einzellizenzen, so dass die Anschaffung der Schullizenz empfehlenswert ist. Sie fördert auch die<br />
Kontinuität der pädagogischen Arbeit innerhalb der Schule.<br />
Anbieter von Schulpiktogrammen<br />
Eugen Traeger Lernsoftware<br />
Bilderfonts Hauptwörter, Tun-Wörter, Mathe-Fonts<br />
Medienwerkstatt Mühlacker<br />
Pädagogische Fonts (ca. 20 Zeichensätze), Mathe-Fonts (4 Zeichensätze mit verschiedenen<br />
Themengruppen)<br />
Will-Software<br />
Gesamtpaket mit ca. 80 Zeichensätzen<br />
5.2 Programme zur Erstellung von Arbeitsblättern am Computer<br />
• Arbeitsblätter am Computer (Auer)<br />
• Primtext (Klett)<br />
• Werkstatt-Reihe (westermann multimedia)<br />
• Textassistent (Nestle)<br />
• EuroText (Eurocomp)<br />
„Arbeitsblätter am Computer“<br />
Dieses Programm wird auf CD-Rom in mehreren Versionen vertrieben. Jedes Produkt enthält neben<br />
der Software zur Erstellung von Arbeitsblättern jeweils eine Anzahl an fertigen Arbeitsblättern <strong>und</strong><br />
eine Vielzahl an Grafiken zu einem Themenschwerpunkt (z.B. Deutsch 3, Mathematik 5/6,<br />
Sachunterricht). Die Arbeitsblatt-Software selbst ist dabei jeweils identisch. Lediglich die<br />
mitgelieferten Arbeitsblätter <strong>und</strong> die Grafiken unterscheiden sich.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 85<br />
Das Auer-Arbeitsblatt-Programm verwaltet stets zwei Versionen eines Arbeitsblattes:<br />
- das Arbeitsblatt für den Schüler<br />
- das Lösungsblatt (für den Lehrer)<br />
Zusätzlich wird ein Notizblatt zur Eingabe von Anmerkungen, Kommentaren etc. angelegt.<br />
Ein Arbeitsblatt besteht aus Objekten. Objekte sind u.a. Textfelder, Schreiblinien,<br />
geometrische Formen wie Linien, Linienzüge, Rechtecke, Kreise, Vielecken, Bilder,<br />
Gestaltungsobjekte wie Sprechblasen, Schmuckrahmen, Rechenkästchen <strong>und</strong> weitere<br />
schulbezogene Elemente.<br />
Ein Objekt wird zunächst auf der Hilfsmittelpalette (Abb.) ausgewählt <strong>und</strong> dann mit<br />
der Maus auf der Arbeitsfläche aufgezogen. Größe <strong>und</strong> Position können jederzeit<br />
verändert werden.<br />
Wird ein Objekt auf dem Arbeitsblatt erstellt, wird es ebenso auf dem Lehrerblatt<br />
angelegt. Alle Manipulationen an diesem Objekt werden ebenfalls auf das jeweils<br />
andere Blatt übertragen. Zu einem Objekt kann jedoch festgelegt werden, dass es auf<br />
einem der Blätter unsichtbar sein soll.<br />
Textfelder, Vario-Textfelder <strong>und</strong> Bild+Text-Bausteine<br />
Textfelder sind Rechtecke, die Text aufnehmen können. Der Text kann vor oder nach der Eingabe<br />
formatiert werden, wobei die auf dem PC verfügbaren Windows-Schriften eingesetzt werden<br />
können. Wird die Form des Textfeldes verändert, passt sich der Zeilenumbruch der neuen Zeilenlänge<br />
an.<br />
Eine besondere Form der Textfelder sind die Vario-Textfelder. Ein solches Textfeld wird zunächst<br />
auf dem Lösungsblatt angelegt, dann eine Kopie auf das Arbeitsblatt übertragen. Die Änderungen,<br />
die im Text danach auf dem Aufgabenblatt ausgeführt werden, werden nicht auf das Lösungsblatt<br />
übernommen. So kann z.B. aus einem Text manuell ein Lückentext erzeugt werden <strong>und</strong> das<br />
Lösungsblatt enthält den vollständigen „Ur“-Text.<br />
Bild+Text-Bausteine sind grafische Elemente, die ebenfalls Text aufnehmen können<br />
(z.B. Sprechblasen, Merkkästen, Grafische Nummerierung, etc.).<br />
Aufgabengenerator<br />
Ein Aufgabengenerator erzeugt weitgehend automatisch eine Reihe von Aufgabentypen für Deutsch<br />
<strong>und</strong> Mathematik. Bei so erzeugten Aufgaben wird die Lösung jeweils auf dem Lösungsblatt<br />
angezeigt.<br />
Folgende Aufgabentypen können zum Fach Deutsch erstellt werden:<br />
• Anlautschrift<br />
Zu einem Wort werden die zugehörigen Anlautbilder gesucht <strong>und</strong> mit einem Eingabefeld für<br />
den Buchstaben auf dem Arbeitsblatt angeordnet.<br />
• Räselschrift<br />
Die Buchstaben eines Wortes werden durch senkrechte Balken oder Kästchen ersetzt, die Ober<strong>und</strong><br />
Unterlängen der Buchstaben erkennen lassen.<br />
• Wortaufbau<br />
Zu einem Wort werden Kästchenreihen erzeugt, mit denen das Wort buchstabenweise aufgebaut<br />
werden kann.
86<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
• Lückentext<br />
Mit diesem Werkzeug können Zeichen in Wörtern durch Lücken ersetzt werden. Die Lücken<br />
können per Zufall erzeugt werden, oder es können ausgewählte Zeichen ersetzt werden.<br />
• Bandwurmwörter (Abb.)<br />
Der letzte Buchstabe des ersten Wortes ist gleichzeitig<br />
der erste Buchstabe des darauf folgenden Wortes.<br />
• Buchstabenketten<br />
Zwischen die Lernwörter werden zufällig ausgewählte Buchstaben gesetzt.<br />
• Purzeltext <strong>und</strong> Purzelwörter<br />
Die Buchstabenabfolge eines Wortes oder die Wörterabfolge eines<br />
Satzes wird verstellt.<br />
• Silbenrätsel<br />
Erstellen silbenbezogener Übungen mit den Lernwörtern.<br />
• Wort-Bild-Zuordnungen (Abb.)<br />
Zum Bild muss das Wort geschrieben werden, das in einem anderen<br />
Textfeld angezeigt werden kann.<br />
Mathematische Aufgabentypen<br />
• Addition / Subtraktion / Multiplikation / Division<br />
Hier sind etwa bei der Addition mündlich <strong>und</strong> schriftlich zu bearbeitende<br />
Aufgaben möglich. Bei schriftlichen Aufgaben kann der Stellenwert mit<br />
angezeigt werden. Wählbar ist die Anzahl der Summanden sowie der<br />
Zahlbereich von Summanden <strong>und</strong> Summe, ob ein Summand oder die<br />
Summe errechnet werden soll <strong>und</strong> die möglichen Zehnerübergänge.<br />
• Turmaufgaben / Kelleraufgaben<br />
Bei diesen Aufgabentypen handelt es<br />
sich um Rechenpyramiden. Turmaufgaben<br />
werden von unten nach oben als Additionsoder<br />
Multiplikationsaufgaben bearbeitet.<br />
Kelleraufgaben von oben nach unten als<br />
Subtraktions- oder Divisionsaufgaben.<br />
• Geheimschrift<br />
Hier wird jeder Ziffer ein Buchstabe zugeordnet. Die richtig gelösten Aufgaben ergeben das<br />
Lösungswort.<br />
• Magische Quadrate<br />
Magische Quadrate mit 9, 16 oder 25 Kästchen werden erzeugt. Sie können die Größe des<br />
Quadrates sowie die anzuzeigenden Zahlen festlegen.<br />
• Puzzle<br />
Additions- oder Subtraktionsaufgaben werden gelöst <strong>und</strong> die Lösung durch Auflegen oder –<br />
kleben von Puzzleteilen auf die Aufgabenfelder überprüft.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 87<br />
Bausteine<br />
• Zeichensätze (Schulpiktogramme)<br />
sind grafische Objekte, die wie Schriftzeichen verwendet werden <strong>und</strong> so vor allem innerhalb<br />
von Texten Einsatz finden.<br />
• Sonderzeichen (Pfeile <strong>und</strong> Klammern)<br />
sind ebenfalls grafische Objekte, die jedoch als eigenständige Grafiken verwaltet werden <strong>und</strong> so<br />
beliebig auf dem Blatt positioniert werden können.<br />
• Mathematische Bausteine<br />
sind einfache Körper in räumlicher Ansicht sowie Netzbilder, Rechenbäume, Modelle zur<br />
Bruchdarstellung sowie Rechenketten.<br />
Eine Diagrammfunktion, ein Tabellengenerator, ein Modul zur Erstellung von Kreuzworträtselfeldern<br />
sowie eine Reihe von Rahmenbausteinen komplettieren die Objektvielfalt. Die OLE-<br />
Funktion ermöglicht zudem den einfachen Import von Objekten, die mit anderen Windows-<br />
Programmen erstellt wurden, die diese Funktion unterstützen. Eigene Grafiken können in das<br />
Dokument aufgenommen werden. Verschiedene Lineaturen können als Schreiblinien angelegt,<br />
jedoch nicht im Programm beschrieben werden (nicht editierbar).<br />
Dokumentenverwaltung<br />
Zu einem erstellten Arbeitsblatt können Suchbegriffe gespeichert werden, anhand derer das Blatt<br />
später gesucht werden kann. Das Programm hat ebenfalls eine Volltextsuche, die alle gespeicherten<br />
Arbeitsblätter daraufhin untersucht, ob ein Begriff in einem Textfeld des Blattes enthalten ist.<br />
Wörter- <strong>und</strong> Bilderdatenbank<br />
Das Wörterlexikon enthält mehr als 1000 Wörter, die nach verschiedenen Kategorien (Jahrgangsstufen<br />
1–4, Wortarten, Rechtschreibschwerpunkte, Sachthemen) gefiltert werden können. Die gewünschten<br />
Wörter werden in die aktuelle Liste aufgenommen <strong>und</strong> dann bei der Aufgabenerstellung<br />
genutzt. Die Bilderdatenbank verwaltet zu einem Teil der Wörter Bilder, die beim Aufgabentypen<br />
Wort-Bild-Zuordnung eingesetzt werden <strong>und</strong> als Einzelgrafiken genutzt werden können. Eine<br />
Erweiterung der beiden Datenbanken durch den Nutzer sieht das Programm nicht vor.<br />
Der große Vorteil dieser Programme liegt in der schnellen Verfügbarkeit von fertig gestalteten<br />
Elementen, die in Arbeitsblättern häufig eingesetzt werden. Die Programme sind in ihrer Funktionen<br />
gegenüber aktuellen Textverarbeitungsprogrammen erheblich eingeschränkt. So sucht man bei<br />
dem vorgestellten Programm die praktischen Absatzformate vergebens. Formatierungen sind nur<br />
über direkte Zuweisung von Zeichen- <strong>und</strong> Absatzformaten möglich. Wer jedoch den gebotenen<br />
Rahmen an Werkzeugen <strong>und</strong> Objekten akzeptiert, dem steht ein vielseitiges, ökonomisches<br />
Werkzeug für die tägliche Unterrichtsvorbereitung zur Verfügung.<br />
ZARB-Makros für Word für Windows<br />
Makros sind Befehlsfolgen, die gespeichert werden <strong>und</strong> bei Aufruf selbstständig ausgeführt werden.<br />
So können Sie in WORD ein Makro aufzeichnen <strong>und</strong> speichern, das Ihren Briefkopf erstellt. Mittels<br />
Starten des Makros erstellt das Programm in wenigen Sek<strong>und</strong>en Ihren Briefkopf. Mit einer<br />
eingebauten Programmiersprache lassen sich Makros noch komfortabler <strong>und</strong> leistungsfähiger<br />
gestalten. (Übrigens auch eine Funktion, die die Arbeitsblatt-Programme nicht haben.)
88<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Die Makro-Sammlung ZARB-Makros besteht aus 40 Makros, mit deren Hilfe man textorientierte<br />
Aufgaben für den Unterricht erstellen kann. Die Makros sind ausschließlich mit den Programmen<br />
Word für Windows in der Version 6.0/7.0 sowie 8.0 einsetzbar.<br />
Hier ein Überblick über die wichtigsten angebotenen Übungen:<br />
• Ersetzen bestimmter oder selbstgewählter Buchstaben oder Buchstabengruppen durch<br />
Leerzeichen (z.B. alle Vokale, alle Konsonanten, Diphtonge, Doppelkonsonanten,<br />
selbstgewählte Buchstaben oder Buchstabengruppen).<br />
• Erzeugen von Lückentexten<br />
Lückenwörter können einzeln ausgewählt werden, aus einer<br />
gespeicherten Wortliste erstellt werden oder aus den fett<br />
formatierten Wörtern eines Textes erzeugt werden. Die<br />
Lückenwörter können den Lücken als Schüttelwörter<br />
vorangestellt (Abb.) werden, sowie am Textende sortiert oder<br />
unsortiert angefügt werden.<br />
Die Länge der Lücken können einheitlich sein, der Anzahl der Buchstaben entsprechen oder<br />
durch gesperrten Druck der Unterstriche die Buchstabenzahl erkennbar machen.<br />
• Übungstabellen zur Beugung starker Verben<br />
• Erstellen von Aufgaben mit Auswahl-Antworten (multiple choice).<br />
1<br />
• Erzeugen von Wortlisten aus den fett formatierten Wörtern eines<br />
Textes. Die Wortliste wird gespeichert <strong>und</strong> kann u.a. zur Erstellung<br />
von Lückentexten, Rätseln, o.Ä. genutzt werden.<br />
5<br />
4<br />
2<br />
3<br />
• Erzeugen von Zeichensatztabellen zu Windows-Schriften (was bei<br />
6<br />
den Schulpiktogrammen besonders hilfreich ist; Beispiel siehe dort) Waagerecht:<br />
• Erstellen von Kopfleisten für Arbeitsblätter.<br />
1. Quellfluss der Weser<br />
2. Linksseitiger Nebenfluss des<br />
• Erstellen von Rätseln: Kreuzworträtsel (Abb.), aus Wortlisten oder<br />
Worteingabe, Kammrätsel, Wortsuchrätsel<br />
Rheins<br />
3. Nebenfluss der Elbe<br />
4. Fluss, der in die Nordsee<br />
•<br />
•<br />
Kodieren von Texten mittels Buchstabe-Zahl-Zuordnung oder<br />
Rotations-Kodierverfahren als Geheimsprache.<br />
Wort, Satz oder Text wird rückwärts angeordnet.<br />
mündet<br />
5. Fluss in Rheinland-Pfalz<br />
6. Rechtsseitiger Nebenfluss des<br />
Rheins<br />
Senkrecht:<br />
• Anagramm: Die Buchstabenfolge eines Wortes wird durcheinander<br />
geschüttelt.<br />
Das ist bei allen dabei!<br />
• Satz schütteln: Die Wortfolge eines Satzes wird durcheinander geschüttelt.<br />
• Text schütteln: Die Satzfolge eines Textes wird durcheinander geschüttelt <strong>und</strong> in einer<br />
Sortiertabelle ausgegeben.<br />
• Ein Text wird in Großbuchstaben bzw. in Kleinbuchstaben umgewandelt.<br />
• Schlangentext: Der Text wird ohne Leerstellen <strong>und</strong>/oder ohne Satzzeichen ausgegeben.<br />
Beim Einsatz der Makros steht zur weiteren Bearbeitung die volle Funktionalität der leistungsfähigen<br />
Textverarbeitung uneingeschränkt zur Verfügung. Ebenso kann man die erstellten Übungen<br />
meist über die Windows-Zwischenablage in andere Dokumente übertragen.<br />
Die Makrosammlung ist ein sehr hilfreiches Werkzeug für Anwender, die viele Dokumente mit<br />
WinWord erstellen <strong>und</strong> nicht auf die Funktionen der Textverarbeitung verzichten möchten. Die<br />
Zarb-Makros sind für sie eine sehr wertvolle Bereicherung ihrer Arbeitsumgebung.<br />
Anbieter: Hans Zybura (s. Anhang)<br />
(ieD)___ Frösche<br />
(dun)___ Kröten<br />
(ehabn)_____ die<br />
(lktea)_____<br />
Jahreszeit in<br />
(trnreasteWri)
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 89<br />
6 Hard- <strong>und</strong> Softwareausstattung<br />
Vorbemerkungen<br />
Die Vielfältigkeit der Sonderschulformen <strong>und</strong> die unterschiedlichen Größen von Sonderschulen<br />
erschweren allgemein gültige Aussagen zu deren Ausstattung mit Hard- <strong>und</strong> Software, da die<br />
verschiedenen Sonderschulformen zudem einen spezifischen Bedarf an zusätzlichen Geräten oder<br />
spezieller Software haben. So wird eine Schule für Körperbehinderte andere spezifische Soft- <strong>und</strong><br />
Hardware einsetzen als eine Förderschule, eine Schule für Blinde <strong>und</strong> Sehbehinderte wiederum<br />
andere als eine Schule für Sprachbehinderte (vgl. Kapitel 3).<br />
Sonderschulen als Stammschulen für integrierte Fördermaßnahmen sollten darüber hinaus die<br />
Chancen eines Computereinsatzes bei der Förderung von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
berücksichtigen.<br />
Den Schulen sollte deshalb bei bevorstehenden Anschaffungen klar sein, wie die Computer genutzt<br />
werden sollen bzw. welche Ziele mit dem Einsatz erreicht werden sollen. Der Computereinsatz hat<br />
Auswirkungen auf den Unterricht <strong>und</strong> wirft eine Reihe von pädagogischen <strong>und</strong> didaktischen Fragen<br />
auf.<br />
Durch die zunehmende Ausstattung mit Computern entsteht an den Schulen ein nicht zu<br />
unterschätzender Betreuungsbedarf. Die Einrichtung <strong>und</strong> Pflege der Systeme, das Installieren neuer<br />
Software, Vorsorge vor Computerviren bzw. deren Bekämpfung, sowie die Behebung von<br />
Problemen, die durch Fehlbedienung der Nutzer bzw. durch Eingriffe ins Betriebssystem<br />
aufgetreten sind, erfordern einen erheblichen Zeitaufwand.<br />
Aus diesen Gründen sollte bei umfangreicheren Neuanschaffungen immer eine Rücksprache mit<br />
den <strong>Fachberater</strong>n oder den Kollegen, an deren Schulen bereits Computer eingesetzt werden,<br />
erfolgen. Dabei ist auch zu überlegen, durch welche Maßnahmen eine möglichst effektive<br />
Betreuung, z.B. bei Virenvorsorge, Software zur Sicherung des Betriebssystems, Zugangsbeschränkungen<br />
für Personengruppen, Vernetzung gewährleistet werden kann.<br />
Eine sehr f<strong>und</strong>ierte Planungshilfe bietet die Schrift „<strong>Informations</strong>technologie - Planer für Schulen“<br />
von der Forschungsgruppe Telekommunikation der Universität Bremen. Hier werden unter dem<br />
Leitziel des „Integrierten Technikeinsatzes“ verschiedene (netzorientierte) Ausstattungskonzepte<br />
mit Umsetzungshilfen <strong>und</strong> Kostenschätzungen vorgestellt. Ein beigefügtes Kalkulationsprogramm<br />
hilft bei der Kostenermittlung vor Ort. 1<br />
6.1 Ausstattungsempfehlungen<br />
Aufgr<strong>und</strong> der schnellen Entwicklung, insbesondere auf dem Hardware-Sektor, können<br />
Empfehlungen für diesen Bereich immer nur für einen begrenzten Zeitraum gelten <strong>und</strong> deshalb nur<br />
einen vorläufigen Charakter haben. Bei Neuanschaffungen heute (z.Z. Dezember 99) könnte in etwa<br />
folgende Konfiguration empfohlen werden:<br />
Schülerarbeitsplatz<br />
- Geräte mit Prozessoren ab 400 MHz <strong>und</strong> höher<br />
- Arbeitsspeicher mindestens 32 MB<br />
1 Breiter, A: <strong>Informations</strong>Technologie-Planer für Schulen, Gütersloh 1999
90<br />
- Festplatte mit einer Kapazität von mindestens 6 GB<br />
- Grafikkarte mit mindestens 8 MB Videospeicher<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
- CD-ROM Laufwerk mit einer mindestens 40-facher Lesegeschwindigkeit<br />
- 16-bit So<strong>und</strong>karte<br />
- Lautsprecherboxen <strong>und</strong> Köpfhörer<br />
- 17" Farbbildschirm<br />
- Tintenstrahl- oder Laserdrucker<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich sollte ein Computer multimedia-tauglich (vgl. Teilkapitel 2.4) sein. Zumindest ein<br />
Computer sollte über einen Internetzugang verfügen.<br />
Leasingverträge zur Anschaffung nicht nur von neuen Computern werden von vielen Firmen<br />
angeboten <strong>und</strong> bieten einige Vorteile, wie z.B. technische Betreuung, Garantieleistungen usw. Der<br />
Sachkostenträger ist dabei in der Regel der Vertragspartner. Vor dem Zuschlag für eine Firma<br />
sollten mehrere Angebote zum Vergleich eingeholt werden.<br />
Als ein Ausstattungsziel erscheint es wünschenswert, dass mindestens für je fünf Schüler ein<br />
Computer vorhanden ist. Mehrere Computer im Klassensaal können über eine Druckerweiche einen<br />
Drucker (Tintenstrahldrucker oder Laser) ansteuern. Sowohl die Bestückung der Klassenzimmer<br />
mit Computern als auch die Einrichtung einer Computerwerkstatt sind sinnvoll. Unkomplizierter ist<br />
eine sukzessive Ausstattung der Klassen. Bei Schulneubauten sollten die Vorschläge der Schulneubaurichtlinien<br />
zur Ausstattung einer Computerwerkstatt <strong>und</strong> die gleichzeitige bzw. zukünftige<br />
Vernetzungsmöglichkeiten in die Klassenräume, Bibliotheken <strong>und</strong> Fachräume, zur Verwaltung,<br />
zum Lehrerzimmer u.Ä. berücksichtigt werden. Optimal ist eine Kombination aus Computerwerkstatt<br />
<strong>und</strong> Einzelgeräten in den Klassenräumen, die alle miteinander vernetzt sind.<br />
Zusatzausstattung<br />
An jeder Sonderschule sollte zudem wenigstens ein großer Bildschirm mit 19" bzw. 21" Bildschirmdiagonale<br />
zu Demonstrationszwecken, ein Flachbett-Scanner <strong>und</strong> ein hochwertiger Farbdrucker<br />
vorhanden sein. Zum Erstellen von Sicherungskopien wertvoller CD-ROMs ist ein CD-<br />
Brenner erforderlich.<br />
Wünschenswert ist auch die Anschaffung eines Overhead-Displays oder eines Daten-Projektors.<br />
(Beamer) zur großformatigen Projektion des Bildschirminhalts. Damit können Programme, Präsentationen,<br />
Internetseiten etc. größeren Personengruppen vorgeführt werden.<br />
Bedacht werden sollte auch die Anschaffung einer digitalen Fotokamera <strong>und</strong>/oder einer digitalen<br />
Videokamera zur Bearbeitung von Bildern <strong>und</strong> Videos sowie der entsprechenden Geräte zum<br />
Schneiden inklusive der notwendigen Software zur Bild- bzw. Filmbearbeitung. Eine Digitalkamera<br />
ist vor allem für Schulen interessant, die häufiger Fotos im Internet publizieren bzw.<br />
Computerpräsentationen erstellen.<br />
Einige computergesteuerte Funktionsmodelle <strong>und</strong> Arbeitsmaschinen, die über ein Interface zu<br />
steuern sind, sollten ebenfalls zur Ausstattung gehören, um die Anforderungen der Lehrpläne, hier<br />
insbesondere im Fach Arbeitslehre, umsetzen zu können (vgl. Kapitel 2: Baustein Geräte <strong>und</strong><br />
Maschinen steuern)<br />
Für jede Sonderschulform, wie z.B. der Seh- oder Körperbehindertenschule, ergeben sich darüber<br />
hinaus zusätzliche Anschaffungen, die zur Kompensation von Behinderungen sinnvoll, wenn nicht<br />
unumgänglich sind. Eine Auflistung würde den Rahmen dieser Darstellung jedoch sprengen.<br />
Dessen ungeachtet bleiben diese Schulen aufgefordert den Markt (vgl. Kapitel 3) ständig zu
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 91<br />
beobachten, um sich über <strong>Neue</strong> Technologien, mit der sie ihre Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler besser<br />
fördern können, zu informieren.<br />
Vernetzung<br />
Die Vernetzung von Computern – bei den anderen Schularten längst Standard –, muss auch in<br />
Sonderschulen in die Planungen einbezogen werden. Dies gilt bei Neuausstattungen ebenso wie bei<br />
sukzessiver Anschaffung einzelner PCs <strong>und</strong> der Weiterentwicklung vorhandener Ausstattungen.<br />
Dabei ist die Vernetzung nicht auf einen Raum beschränkt, sondern die Netzwerkstruktur sollte in<br />
jedem Klassen-/Gruppenraum mindestens einen Anschluss an des schulische Computernetz<br />
bereitstellen. Bei Neubauten <strong>und</strong> umfangreicheren Schulrenovierungen müssen deshalb die<br />
technischen Voraussetzungen für ein schulinternes Computernetz in Form von Datenleitungen<br />
geschaffen werden.<br />
Netzwerktypen<br />
Die einfachste Form eines Computernetzes ist ein Peer-to-Peer-Netz. Hier sind die angeschlossenen<br />
PCs mittels Netzwerkkarte <strong>und</strong> Netzkabel miteinander verb<strong>und</strong>en. Jeder PC kann dann seine<br />
Ressourcen wie Laufwerke, Verzeichnisse bzw. Drucker den angeschlossenen PCs zugänglich<br />
machen. Die effektive Vernetzung mit Twisted Pair Kabel<br />
erfordert für jeden PC eine Netzwerkkarte sowie einen<br />
Sternverteiler (Hub) <strong>und</strong> die benötigte Anzahl an Netzwerkkabel.<br />
Die Netzwerksoftware ist Bestandteil von Windows95/98/NT,<br />
wird allerdings bei der Standardinstallation<br />
nicht eingerichtet. Die Vorteile des kostengünstigen Netzes<br />
bestehen in der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen<br />
(Drucker, Datenlaufwerke wie CD-Rom) sowie der ökonomischen<br />
Wartung der einzelnen PCs, indem Daten oder<br />
Programme z.B. übers Netz von einem PC auf alle anderen PCs<br />
aufgespielt oder von einem Arbeitsplatz aus installiert werden<br />
können. Eine höhere Absicherung <strong>und</strong> Zugangskontrolle ist mit dem Einsatz zusätzlicher Software<br />
(z.B. WinSecure) möglich. Wird ein angeschlossener (älterer) Computer nur als „Server“ genutzt,<br />
kann bereits eine bessere Zugangskontrolle zu Ressourcen <strong>und</strong> z.B. die passwortgeschützte<br />
Bereitstellung von Speicherressourcen für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler bzw. Schülergruppen realisiert<br />
werden. Mit kostenloser Zusatzsoftware (PegasusMail) kann innerhalb des Netzes ein lokales E-<br />
Mail-System eingerichtet werden. Ein Peer-to-Peer-Netz kann auch sukzessive mit vorhandenen<br />
PCs aufgebaut werden. Die Sachkosten belaufen sich für eine Vernetzung von 8 PCs auf ca. 650<br />
DM.<br />
Beim Client-Server-Netz stellt ein zentraler Computer (Server)<br />
den angeschlossenen Arbeitsplätzen (Clients) Ressourcen wie<br />
Drucker, CD-ROM-Laufwerk, Speicherplatz <strong>und</strong> Programme<br />
zur Verfügung. Der Server benötigt ein Netzwerkbetriebssystem<br />
wie Novell, Windows NT oder Linux. Auf der Client-Seite kann<br />
auch Windows 95/98 zum Einsatz kommen. Ein Client-Server-<br />
Server<br />
Netz bietet hinsichtlich der Benutzerkontrolle die Möglichkeit<br />
der Erstellung individueller Benutzerprofile, um bestimmten<br />
Gruppen bzw. einzelnen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern bestimmte<br />
Programme <strong>und</strong> Ressourcen zugänglich zu machen. Die Kosten
92<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
des Client-Server-Netzes sind wesentlich höher als beim Peer-to-Peer-Netz. Der Server kann nicht<br />
als Arbeitsplatz genutzt werden <strong>und</strong> benötigt das u.U. recht teure Netzwerkbetriebssystem. Die<br />
effektive Nutzung des Netzes erfordert eine kompetente <strong>und</strong> nicht selten sehr zeitaufwendige<br />
Betreuung.<br />
Intranet <strong>und</strong> Internet<br />
Beide Netztypen ermöglichen die Einrichtung eines Intranets in der Schule. Ein Intranet ist ein<br />
lokales Netz auf der Basis des Internetstandards, das keine oder eine hoch abgesicherte Verbindung<br />
zum Internet aufweist. Da im Intranet die gleichen Programme für E-Mail <strong>und</strong> WWW wie im<br />
Internet eingesetzt werden, bietet es dem Nutzer eine zum Internet weitgehend übereinstimmende<br />
Bedienungsstruktur. Das Internet ermöglicht das Publizieren von WWW-Seiten <strong>und</strong> den Austausch<br />
von E-Mails innerhalb der Schule, so dass diese <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> Kommunikationstechniken<br />
modellhaft eingeübt werden können. Internetseiten anderer Anbieter aus dem Internet können lokal<br />
gespeichert <strong>und</strong> off-line für den Raum der eigenen Schule verfügbar gemacht werden. So haben die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler Zugriff auf die für sie bereitgestellten <strong>Informations</strong>angebote. Die eigenen<br />
Seiten können zur Probe zunächst im Intranet publiziert werden. Das Intranet kann die Basis für ein<br />
schulinternes Kommunikationssystem für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler <strong>und</strong> Lehrkräfte sein, indem<br />
wichtige Informationen dort publiziert, in den Klassen aufgerufen <strong>und</strong> dort für die Schüler<br />
ausgedruckt werden. Über Rückmeldeverfahren (z.B. Formulare, E-Mail) können Informationen,<br />
u.a. auch Empfangsbestätigungen an den Anfrager übermittelt werden. Derartige Strukturen können<br />
die Intranet-Aktivitäten vor der drohenden Unverbindlichkeit bewahren <strong>und</strong> entsprechendes<br />
Problembewusstsein auch für das Internet entwickeln. Ein Angebot an schulpraxisrelevanten Texten<br />
<strong>und</strong> Formularen, das auf dem Intranetserver bereitsteht <strong>und</strong> vom Lehrer in der Klasse bei Bedarf<br />
abgerufen <strong>und</strong> ausgedruckt werden kann, kann die Erledigung administrativer Aufgaben erheblich<br />
vereinfachen.<br />
Der Anschluss eines lokalen Computernetzes an das Internet kann über einen ISDN-Router oder<br />
einen Kommunikationsserver (Server, der nur die Verbindung zum Internet bereitstellt <strong>und</strong><br />
personbezogene Zugangskotrolle ermöglicht) sichergestellt werden.<br />
Zusatzfunktionen<br />
Aufbauend auf eine bestehende Netzstruktur können per Hard- bzw. Software weitere Funktionen<br />
implementiert werden. So etwa eine Video-Vernetzung, die das Übertragen des Bildschirminhalts<br />
eines Computers auf alle Monitore entweder in einem Fenster oder im Vollbildmodus, das<br />
Heranholen des Bildschirminhalts eines oder mehrerer Schülercomputer auf den Lehrercomputer<br />
<strong>und</strong> das Fernsteuern eines Schülercomputers vom Lehrercomputer aus ermöglicht.<br />
Bei der Planung, Ausführung <strong>und</strong> Pflege eines Schulcomputernetzes sollte mit Firmen, die bereits<br />
Erfahrungen in Aufbau <strong>und</strong> Wartung von Schulcomputernetzen haben, kooperiert werden. Am<br />
Anfang steht eine differenzierte Planung unter Einbeziehung der vorgesehenen Hard- <strong>und</strong> Software<br />
sowie der Nutzungsstrukturen. Die Betreuung des eingerichteten Netzes ist in einen technischen<br />
Bereich, der von einer Fachfirma bzw. einem Techniker an der Schule, <strong>und</strong> einen pädagogischen<br />
Bereich, der in den Aufgabenbereich der Lehrkräfte fällt, aufzuteilen. Die pädagogische<br />
Netzbetreuung beinhaltet die Verwaltung der Nutzungsrechte von Gruppen <strong>und</strong> Einzelpersonen <strong>und</strong><br />
das Dateimanagement im Netz. Die technische Betreuung hat die Aufgabe, die Funktionsfähigkeit<br />
des Netzes im Hinblick auf die festgelegten Nutzungsstrukturen zu gewährleisten. Da beide<br />
Bereiche stark verzahnt sind, ist eine intensive Kooperation unverzichtbar. Anfallende Folgekosten<br />
sind bei den Überlegungen zur Einrichtung eines Computernetzes zu berücksichtigen.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 93<br />
Spenden - Altgeräte<br />
Zunehmend geben Firmen <strong>und</strong> Institutionen bei der Umstellung ihrer EDV-Anlagen ihre Altgeräte<br />
gegen geringes Entgelt, Spendenquittungen des Fördervereins oder umsonst (sie sparen dabei<br />
immerhin die Entsorgungskosten) an Schulen ab. Dabei sollten die Schulen jedoch vorher sorgfältig<br />
prüfen, ob die dabei entstehenden technischen Probleme von dem Systembetreuer der Schule oder<br />
einer Person des unmittelbaren Umfeldes gelöst werden können.<br />
Die Frage, ob vorhandene Software auf den gespendeten Geräten problemlos läuft <strong>und</strong> ob<br />
zusätzliche Lizenzen notwendig werden, sollte vorab geklärt sein.<br />
Auch die Spenden sollten einige Mindestanforderungen erfüllen:<br />
- 486 oder Pentium-Prozessor<br />
- Festplatte, VGA-Grafikkarte<br />
- Windows oder vergleichbares Betriebssystem<br />
- VGA-Farbbildschirm<br />
Zu bedenken ist dabei, dass diese Mindestausstattung für Multimedia-Anwendungen nicht mehr<br />
ausreicht, für einfache – pädagogisch jedoch gute – Lernprogramme aber durchaus noch akzeptabel<br />
ist.<br />
Software<br />
Nicht nur bei der Neuanschaffung eines Computers ist darauf zu achten, dass neben der Hardware<br />
auch eine Mindestausstattung an Software erforderlich ist. Ein Betriebssystem <strong>und</strong> eine gängige<br />
Textverarbeitung, besser ein integriertes Paket bzw. ein Office-Paket, sollten bei einer<br />
Neuanschaffung vorinstalliert sein <strong>und</strong> auf CD-ROM beiliegen. Vor dem Einsatz jeder Software ist<br />
zu prüfen, ob die Lizenzbestimmungen auch eingehalten wurden. Eine Gr<strong>und</strong>ausstattung an<br />
Lernsoftware für die verschiedenen Fächer, Klassenstufen <strong>und</strong> Sonderschulformen lässt sich mit<br />
Hilfe des Kapitels 10 dieser Handreichung zusammenstellen. Unbedingt notwendig ist die<br />
Ausstattung der Schulen mit einem aktuellen Virenschutzprogramm (vgl. Teilkapitel 8.1).<br />
Lizenzinformationen<br />
Die Nutzung von Computersoftware ist an Lizenzen geb<strong>und</strong>en. Genau genommen erwirbt der<br />
Anwender nicht das Produkt, sondern das Recht, das Produkt im Rahmen der Nutzungsbedingungen,<br />
die der Hersteller festgelegt hat, zu nutzen. Dabei stellt sich der Hersteller weitgehend<br />
frei von Risiken, da er keine Gewähr für ggf. auftretende Probleme übernimmt, ein Tatbestand, der<br />
rechtlich nicht unumstritten ist.<br />
Die nachfolgenden Informationen geben die allgemeine lizenzrechtliche Situation wieder. Die<br />
genauen Gegebenheiten sind im Einzelfall anhand der Lizenzbedingungen des Anbieters zu<br />
überprüfen.<br />
Eine Einzellizenz berechtigt zur Nutzung der Software auf einem Computer. Meist kann der<br />
Lizenznehmer das Programm zusätzlich auf einem tragbaren Computer verwenden.<br />
Bei Standardsoftware werden für Schulen meist besondere Lizenzen angeboten, die sich nach dem<br />
Hersteller <strong>und</strong> auch nach dem Produkt richten. Die so genannten Klassenraumlizenzen umfassen<br />
meist ein Vollprodukt sowie die Erlaubnis zur Nutzung des Produkts auf 15 Schülerarbeitsplätzen.<br />
Zusätzlich gibt es Erweiterungslizenzen für eine bestimmte Anzahl an Schülerplätzen oder für die<br />
ganze Schule. Die Schullizenz schließt auch die Nutzung für die schulischen Verwaltungsaufgaben<br />
mit ein.
94<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Beispiel<br />
Microsoft Works 4.5: Klassenraumlizenz für 15 Schülerarbeitsplätze 798,-<br />
(einschließlich 10 Lehrerzusatzlizenzen für die<br />
Vorbereitung zu Hause)<br />
Erweiterungslizenz für die ganze Schule 498,-<br />
Für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, Studierende <strong>und</strong> Lehrkräfte werden besondere Lizenzen zu stark<br />
ermäßigten Preisen angeboten, wobei meist kein Handbuch mitgeliefert wird. Dabei handelt es sich<br />
um personbezogene Lizenzen, die nicht an Institutionen ausgeliefert werden.<br />
Bei Lernsoftware ist die Lizenzsituation wesentlich vielfältiger. Fast immer werden Einzellizenzen<br />
sowie unbeschränkte Schullizenzen angeboten, die teilweise auch die Nutzung durch den Lehrer zu<br />
Hause im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung einschließen. Verschiedene Anbieter offerieren auch<br />
Lizenzen für eine bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen. Außer von den Erstvertreibern werden<br />
Schullizenzen angeboten von den Firmen CoTec (Rosenheim), Logibyte (Berlin) <strong>und</strong> Steckenborn<br />
(Gießen).<br />
Besondere Vertriebswege, die insbesondere von Hobby-Programmierern genutzt werden, können<br />
für Schulen von Interesse sein:<br />
Public Domain: Die Programme werden kostenlos <strong>und</strong> ohne Einschränkungen zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Freeware: Die Programm dürfen kostenlos verwendet <strong>und</strong> weitergegeben werden. Der Autor behält<br />
jedoch die Rechte an dem Programm, so dass der Programm-Code nicht verändert werden darf.<br />
Manche Entwicklern schränken die Nutzung auf den Privatbereich <strong>und</strong> auf einen Computer ein.<br />
Shareware: Die Programme dürfen über einen bestimmten Zeitraum (z.B. 30 Tage) kostenlos<br />
genutzt werden. Nach dieser Frist ist für die weitere Nutzung die Zahlung einer<br />
Registrierungsgebühr erforderlich. Shareware-Versionen enthalten im Programm meist einen<br />
Hinweis auf diesen Status, z.B. beim Programmstart bzw. -ende. Gelegentlich können Shareware-<br />
Versionen Funktionseinschränkungen aufweisen.<br />
Updates<br />
Updates sind neue Programme, die erworben werden können, wenn eine entsprechende Lizenz einer<br />
Vorgängerversion vorliegt. Updates sind meist erheblich preiswerter als das vergleichbare<br />
Vollprodukt. Die Programme unterscheiden sich nicht.<br />
Betreuungsaufwand<br />
Auf Gr<strong>und</strong> des zunehmenden Computereinsatzes ergibt sich auch ein erheblicher<br />
Betreuungsaufwand, der z.Z. nur im Rahmen der Drittelpauschale berücksichtigt wird, obwohl der<br />
tatsächliche Zeitaufwand jedoch wesentlich größer ist. Deshalb muss in den Kollegien vorab geklärt<br />
sein, wer welche Aufgaben beim Computereinsatz übernimmt. In Zukunft muss daran gedacht<br />
werden, dass in den Schulen für den Computereinsatz solche Systembetreuer benannt werden, die<br />
zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ausgebildet sind <strong>und</strong> ein St<strong>und</strong>endeputat zur Verfügung haben.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 95<br />
6.2 Ergonomie am Arbeitsplatz „Computer“<br />
Aufgabenbereiche der Prävention<br />
Die Verhütung von Ges<strong>und</strong>heitsstörungen am Arbeitsplatz von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern sowie<br />
Sekretärinnen <strong>und</strong> Mitgliedern der Schulleitung gehört in den Verantwortungsbereich des<br />
Sachkostenträgers bzw. Arbeitgebers, die die Verantwortung für die Arbeitsplatzgestaltung<br />
mittragen. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass ergonomisch abgesicherte Arbeitsbedingungen an<br />
einem sinnvoll gestalteten Arbeitsplatz innerhalb des Mensch-Maschine-Systems eingerichtet <strong>und</strong><br />
so gestaltet <strong>und</strong> räumlich angeordnet werden, dass<br />
- das Arbeitsmittel, mit dem der längste <strong>und</strong>/oder häufigste<br />
Blickkontakt besteht, zentral angeordnet wird,<br />
- das Arbeitsmittel, zu dem am häufigsten gegriffen wird, im<br />
kleinen Greifraum liegt,<br />
- die Sehabstände zu den wesentlichen Arbeitsmitteln, die<br />
häufig nacheinander beobachtet werden, einander<br />
angeglichen werden,<br />
- länger dauernde Zwangshaltungen vermieden werden,<br />
- der Arbeitsstuhl kippsicher ist, eine bequeme Haltung<br />
ermöglicht <strong>und</strong> die Bewegungsfreiheit des Benutzers nicht<br />
einschränkt,<br />
- die Sitzhöhe verstellbar ist.<br />
- die Rückenlehne in Höhe <strong>und</strong> Neigung verstellbar ist,<br />
- der Arbeitstisch bzw. die Arbeitsfläche eine ausreichende<br />
große <strong>und</strong> reflexionsarme Oberfläche besitzt,<br />
- eine flexible Anordnung von Bildschirm, Tastatur,<br />
Schriftgut <strong>und</strong> sonstigen Arbeitsmitteln ermöglicht,<br />
- Kopf- <strong>und</strong> Augenbewegungen soweit wie möglich<br />
eingeschränkt sind,<br />
- ein ausreichender Raum für eine bequeme Arbeitshaltung<br />
vorhanden ist.<br />
Abb.: Blick- <strong>und</strong> Greifraum am<br />
Computerarbeitsplatz<br />
Abb.: Blick- <strong>und</strong><br />
Gesichtsfeldgrenzen<br />
Die Stuhlhöhe ist zum Tisch wie folgt anzupassen: Ober- <strong>und</strong> Unterarme bilden einen Winkel von<br />
90°, während die Hände auf dem Tisch aufliegen<br />
Nach der DIN 4549 muss die Beinraumbreite mindestens 580<br />
mm, die Beinraumtiefe, gemessen 120 mm über dem Fußboden,<br />
mindestens 600 mm betragen. Bei nicht höhenverstellbaren<br />
Schreibtischen <strong>und</strong> Bildschirmarbeitstischen darf die Beinraumhöhe,<br />
gemessen an der Tischplattenvorderkante von mindestens<br />
650 mm nicht unterschritten werden.<br />
Muss beim nicht höhenverstellbaren Schreibtisch <strong>und</strong><br />
Bildschirmarbeitstisch der Beinraum auch wegen technischer<br />
Einbauten eingeschränkt werden, sind für die Beinraumhöhe<br />
folgende Mindestmaße einzuhalten:<br />
Abb.: Notwendige Beinfreiheit<br />
am Bildschirmarbeitsplatz
96<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
- gemessen in einer Tiefe von 200 mm von der<br />
Tischplattenvorderkante: 620 mm<br />
- gemessen in einer Tiefe von 450 mm von der<br />
Tischplattenvorderkante: 550 mm<br />
- gemessen in einer Tiefe von 600 mm von der Tischplattenvorderkante<br />
bis Tischplattenhinterkante: 120 mm<br />
Bildschirm<br />
Die auf dem Bildschirm angezeigten Zeichen müssen scharf <strong>und</strong> deutlich, ausreichend groß <strong>und</strong> mit<br />
angemessenen Zeichen- <strong>und</strong> Zeilenabstand dargestellt werden. Das Bild muss stabil <strong>und</strong> frei von<br />
Flimmern sein, <strong>und</strong> darf keine Instabilität anderer Art aufweisen.<br />
Die Helligkeit <strong>und</strong>/oder der Kontraste zwischen Zeichen <strong>und</strong> Bildschirmhintergr<strong>und</strong> müssen leicht<br />
vom Benutzer eingestellt <strong>und</strong> den Umgebungsbedingungen angepasst werden können. In der Regel<br />
sehen dunkle Zeichen auf hellem Gr<strong>und</strong> (Positivdarstellung) schärfer aus als helle Zeichen auf<br />
dunklem Gr<strong>und</strong> (Negativdarstellung).<br />
Der Bildschirm sollte auch bei voller Helligkeit im seitlichen Gesichtsfeld nicht flimmern. Um ein<br />
Flimmern zu vermeiden, muss die Bildwiederholungsfrequenz des Bildschirmes über der<br />
Verschmelzungsfrequenz des Auges liegen. Durch eine zu geringe Bildwiederholungsfrequenz<br />
entsteht ein flimmerndes Bild – erst ab einer Frequenz von ca. 80 Hz = ca. 80 Bilder pro Sek<strong>und</strong>e<br />
verschwindet für die meisten Bildschirmbenutzer der Eindruck des Flimmerns.<br />
Der Bildschirm muss zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers frei <strong>und</strong> leicht<br />
drehbar <strong>und</strong> neigbar sein. Der Bildschirm muss frei von Reflexen <strong>und</strong> Spiegelungen sein, die den<br />
Benutzer stören können.<br />
Da Bildschirme des Standards TCO 99 diesen Anforderungen entsprechen, sollte Neuanschaffungen<br />
diesem Standard entsprechen. TCO 99 fordert z.B. eine Bildwiederholfrequenz von mindestens<br />
85 Hz.<br />
Reflexe, Blendung <strong>und</strong> Beleuchtung<br />
Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass Lichtquellen wie Fenster <strong>und</strong> sonstige<br />
Öffnungen, durchsichtige oder durchscheinende Trennwände sowie helle Einrichtungsgegenstände<br />
<strong>und</strong> Wände keine Direktblendung <strong>und</strong> möglichst keine Reflexion auf dem Bildschirm verursachen.<br />
Die Fenster müssen mit einer geeigneten verstellbaren Lichtschutzvorrichtung ausgestattet sein,<br />
durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den Arbeitsplatz vermindern lässt (Anhang zur<br />
Europäischen Richtlinie EU 90/270 EG-Mindestvorschriften).<br />
Abb.: Kritischer Bereich bzgl. Reflexblendung<br />
Abb.: Kritischer Bereich bzgl. Direktblendung<br />
Ein Absolutwert für eine gute Beleuchtung kann nicht angegeben werden. Bei der Gestaltung guter<br />
Beleuchtungsverhältnisse sollen folgende Punkte Berücksichtigung finden:
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 97<br />
- angemessene Beleuchtungsstärke<br />
- Gleichmäßigkeit der Beleuchtung (harmonische Leuchtdichteverteilung) zu große<br />
Leuchtdichteunterschiede zwischen den wichtigsten Sehobjekten vermieden werden.<br />
- Begrenzung der Blendung<br />
- Kontrast<br />
- Lichtrichtung<br />
- Schatten<br />
- Lichtfarbe<br />
- Farbwiedergabe<br />
Weitere Hinweise bei:<br />
B<strong>und</strong>esverband der Unfallkassen e. V. (Hrsg.): Bildschirm-Arbeitsplätze, Merkblatt GUV 23.3, 1997<br />
B<strong>und</strong>esverband der Unfallkassen e. V. (Hrsg.): Beurteilung von Gefährdungen <strong>und</strong> Belastungen an Bildschirmarbeitsplätzen,<br />
Merkblatt GUV 50.11.1, 1997
98<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
7 Computereinsatz in der Schulverwaltung<br />
Die Einsatzgebiete des Computers in der Schulverwaltung sind sehr vielfältig. Schon sehr früh<br />
wurde die Möglichkeiten des Computers zur Vereinfachung <strong>und</strong> Rationalisierung der<br />
Verwaltungsarbeit in der Schule entdeckt <strong>und</strong> genutzt. Standen am Anfang die Textverarbeitung<br />
sowie die Möglichkeit, den St<strong>und</strong>enplan per Computer zu erstellen, im Vordergr<strong>und</strong>, so lässt sich<br />
heute durch spezielle Verwaltungsprogramme oder durch universelle Programmpakete (Office-<br />
Programme) die Verwaltung einer Schule weitgehend mit dem Computer organisieren. Der schnelle<br />
Datenaustausch mit anderen Schulen, Behörden, Institutionen <strong>und</strong> die <strong>Informations</strong>gewinnung im<br />
weltweiten Datennetz wird in Zukunft dabei immer mehr an Bedeutung gewinnen.<br />
Für die Schulverwaltung der Sonderschulen ergeben sich folgende Einsatzbereiche:<br />
Texte verarbeiten<br />
• allgemeiner Schriftverkehr<br />
• Serienbriefe<br />
- mit Verknüpfung zu Datenbanken, z.B.: Adressdatei, Schülerdatei etc.<br />
Daten verwalten<br />
• Schülerdatei<br />
- Verwalten aktueller Schülerdaten<br />
- Organisation von Einschulungs- <strong>und</strong> Umschulungsverfahren<br />
- Verwaltung aller schülerbezogenen Daten mit der Möglichkeiten der Gestaltung von<br />
Serienbriefen, der Erstellung von Bescheinigungen <strong>und</strong> der Listenerstellung für die<br />
verschiedensten Zwecke (Klassenlisten, AG-Listen, Busschülerlisten, Entlassschülerliste,<br />
etc.)<br />
• Adressdateien<br />
- Verwaltung aller Adressen mit der Möglichkeit der Gestaltung von Serienbriefen,<br />
Beschriften von Umschlägen bzw. Adressetiketten u.Ä.<br />
• St<strong>und</strong>enplanverwaltung<br />
- Erstellen <strong>und</strong> Gestalten des Gesamtst<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> des Klassenst<strong>und</strong>enplanes, der<br />
Raumbelegung<br />
- Erstellen von Vertretungsplänen<br />
• Schuletatverwaltung<br />
- allgemeiner Schuletat<br />
- Lernmittelfreiheit<br />
- Verwalten der Haushaltsmitteln<br />
- Überblick über Ausgaben <strong>und</strong> Restmitteln<br />
- Ausdruck individueller Listen<br />
• Bestellungen<br />
- Organisation <strong>und</strong> Verwaltung von Bestellungen für den Schulbedarf<br />
- Ausdruck von Listen für den Post- oder Faxversand
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 99<br />
• Inventarverwaltung<br />
- Verwaltung, Organisation <strong>und</strong> Inventarisierung des Schuleigentums<br />
- Erstellung von Listen <strong>und</strong> Etikettenaufkleber<br />
• Medienverwaltung<br />
- Verwalten schuleigener Medien<br />
- Büchereiverwaltung<br />
- Videoverwaltung u.Ä.<br />
- Ausleihverwaltung<br />
• Zeugniserstellung<br />
- Erstellen von Zeugnissen mit oder ohne externer Noteneingabe durch die Lehrkräfte<br />
- Erstellen von Notenlisten<br />
- Stammdaten können aus der Schülerdatei übernommen werden.<br />
• Erstellen schulinterner <strong>und</strong> individueller Arbeitspläne. Aktenpläne<br />
• Verwaltung <strong>und</strong> Organisation von Akten, Schriftstücken, Amtsblättern u.Ä..<br />
• Organisation von Schulsportveranstaltungen<br />
- Organisation, Verwaltung <strong>und</strong> Auswertung von Sportveranstaltungen, z. B.:<br />
B<strong>und</strong>esjugendspiele, Bezirkssportfeste u.Ä. .<br />
- Stammdaten können aus der Schülerdatei übernommen werden<br />
- Punkteauswertung erfolgt automatisch <strong>und</strong> entsprechen den Richtlinien des DLV<br />
- Ausdruck von Punktelisten <strong>und</strong> Urk<strong>und</strong>en<br />
• Organisation von Betriebspraktika<br />
- Adressendatei der Praktikumsbetriebe<br />
- Schriftverkehr zur Praktikumsverwaltung<br />
- Dienstreiseabrechnung der Betreuer<br />
- Erstellen von Praktikumslisten<br />
• Vereinsverwaltung<br />
Organisation <strong>und</strong> Verwaltung eines Vereines, z.B.: Förderverein: Mitgliederverwaltung,<br />
Kontoführung, Schriftverkehr etc.<br />
Grafisches Gestalten<br />
• Gestalten von Infos, Einladungsschreiben, Elternbriefe, Schautafeln o.Ä.<br />
Datenfernübertragung<br />
• Übermitteln von Daten <strong>und</strong> Schriftverkehr (Fax oder E-Mail)<br />
• <strong>Informations</strong>gewinnung durch das Datennetz, z. B. Bildungsserver<br />
• Kommunikation von Schulen untereinander, z. B.„Schulen ans Netz“<br />
• Darstellung der Schule im Internet, z. B. schuleigene Internetseite (Homepage)<br />
Im Rahmen des Projektes EPOS (Elektronische Post für Schulverwaltungen) erhalten alle<br />
rheinland-pfälzischen Schulen Zugang zu einem landeseigenen E-Mail-Server mit erhöhtem Sicherheitsstandard.<br />
Dadurch wird die Kommunikation zwischen Schulen <strong>und</strong> Schulverwaltung erheblich<br />
beschleunigt <strong>und</strong> effektiviert.
100<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Hardwareausstattung<br />
Wegen der noch immer fortschreitenden Entwicklung im Hardwarebereich ist eine generelle<br />
Aussage zur Ausstattung nicht möglich. Zur Zeit (10/99) sollten bei einer Neuanschaffung folgende<br />
Kriterien erfüllt sein:<br />
Gr<strong>und</strong>ausstattung mit empfehlenswerten Erweiterungen<br />
Arbeitsplatz entsprechend der Ausstattung eines Schülerarbeitsplatzes mit folgenden Zusätzen:<br />
• Drucker: bürotauglicher Farbtintenstrahldrucker wenn gelegentliche farbige Ausdrucke<br />
erwünscht sind; Laserdrucker, wenn ausschließlich schwarz-weiß gedruckt werden soll.<br />
• Sinnvolle ergänzende Hardwareausstattung:<br />
Scanner (Flachbett) zum Einlesen von Grafiken <strong>und</strong> Texten<br />
Streamer (Bandlaufwerk) zur Datensicherung;,<br />
Alternativ: Zip-Laufwerk mit 100 bzw. 250 MB oder CD-RW- Laufwerk<br />
Modem oder ISDN-Karte mit Zugang zum Internet<br />
Netzkarte für die interne Vernetzung innerhalb der Schulverwaltung (z.B. Schulbüro,<br />
Schulleitung, Lehrerzimmer)<br />
So<strong>und</strong>karte mit Lautsprecher (Lautstärkeregler, Kopfhöreranschluss), Kopfhörer bzw. Headset<br />
(Kopfhörer + Mikrofon), Mikrofon<br />
Software<br />
Betriebssystem, Virenschutz- (s.u.) <strong>und</strong> Datensicherungsprogramm (einfache Version im<br />
Lieferumfang von Windows 98, meist auch bei Backuplaufwerken)<br />
Spezielle Schulverwaltungsprogramme<br />
Der Markt bietet eine Vielzahl von speziellen Verwaltungsprogrammen für die Schulen an.<br />
Die meisten Programme decken nur Teilbereiche der Schulverwaltung ab. Um das ganze Spektrum<br />
der Schulverwaltung abzudecken ist deshalb die Anschaffung von mehreren Programmen bzw.<br />
Modulen notwendig.<br />
Das MBWW bietet kommerziellen Anbietern Daten für Standards <strong>und</strong> Schnittstellen für deren<br />
Programme an. Damit soll sichergestellt werden, dass mit diesen Programmen die Statistik für das<br />
Statistische Landesamt Bad Ems durchgeführt werden kann. Ziel ist eine beschleunigte Auswertung<br />
der gesamten statistischen Daten.<br />
Universelle Programme<br />
Unter dem Begriff „Universelle Programme“ sind solche Programme gemeint, die im allgemeinen<br />
Sprachgebrauch unter Office-Programm laufen , z.B.:<br />
Smart Suite (Lotus)<br />
Office 97 – Professional (Microsoft)<br />
StarOffice (Stardivision) *<br />
Wordperfect Suite (Corel Corporation)<br />
Works (Integriertes Programm)<br />
(* Dieses Programm wird über das LMZ/Bildstellen den Schulen in Rheinland-Pfalz kostenlos zur<br />
Verfügung gestellt.)
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 101<br />
Mit diesen Programmen können mit den Hauptmodulen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,<br />
Datenbank <strong>und</strong> Präsentationserstellung die in der Auflistung erfassten schulischen Verwaltungsaufgaben<br />
erledigt werden. Da es bei diesen Programmpaketen keine vorgefertigte „Schulverwaltungsmodule“<br />
gibt, müssen die entsprechenden Komponenten vom Anwender selbst meist mit<br />
Hilfe von Textverarbeitung, Datenbank <strong>und</strong>/oder Tabellenkalkulation erstellt werden. Dies ist<br />
sicherlich für den individuellen Einsatz in den verschiedenen Schulen von Vorteil. Es bedeutet aber<br />
auch, dass diese individuellen Problemlösungen erst mit erheblichem Zeitaufwand entwickelt<br />
werden müssen. Der Anwender muss über eine gewisse Erfahrung im Umgang mit solchen<br />
Programmen verfügen, um eine optimale <strong>und</strong> benutzerfre<strong>und</strong>liche Anwendung zu erstellen. Sind<br />
diese Vorgaben erfüllt, dürften diese Programme den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramm<br />
gerecht werden. Der Datenaustausch mit anderen Institutionen (z.B. Statistisches Landesamt) führt<br />
wegen den unterschiedlichen Standards jedoch meist zu Schwierigkeiten.
102<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
8 Probleme beim Arbeiten mit dem Computer<br />
8.1 Allgemeine Probleme mit Programmen <strong>und</strong> Betriebssytem<br />
Leider treten bei der Nutzung des Computers immer wieder Probleme auf, deren Behebung den<br />
ungeübten Nutzer vor erhebliche Schwierigkeiten stellen kann. Sinnvolle vorbeugende Maßnahmen<br />
sowie ein einfaches Diagnosekonzept sollten auch den wenig erfahrenen Anwender in die Lage<br />
versetzen, einige Probleme selbstständig zu beheben.<br />
Die Ursachen für Probleme sind sehr vielfältig. Da nicht selten Bedienungsfehler vorliegen, sollte<br />
der Anwender zunächst sein Verhalten vor dem Auftauchen des Problems genau recherchieren. So<br />
kann z.B. eine versehentlich gedrückte Dauergroßschreibtaste oder ein Bildschirm, dessen Helligkeit<br />
von einem Schüler ganz dunkel gestellt wurde, zu erheblichen Irritationen führen.<br />
Auch moderne <strong>und</strong> komplexe Betriebssysteme wie Windows 95/98 arbeiten bekanntlich keineswegs<br />
immer zuverlässig. Da bei der Nutzung im Hintergr<strong>und</strong> komplexe Vorgänge ablaufen, sind<br />
die Einflussmöglichkeiten für den Anwender beschränkt. Nicht selten hilft nur ein Neustart des<br />
Systems oder das Beenden der aktuellen Anwendung.<br />
Wichtigste vorbeugende Maßnahme ist ein sachgerechter Umgang mit einer Computeranlage, eine<br />
gr<strong>und</strong>legende Komponente der Handlungskompetenz, zu der Unterricht hinführen soll. So sollte der<br />
Startvorgang des Computers nicht unterbrochen werden, beim Arbeiten mit Windows vor dem<br />
Ausschalten zunächst das Programm <strong>und</strong> dann das Betriebssystem ordnungsgemäß beendet werden.<br />
Bei Störungen im Programmablauf muss auf vorsichtiges Agieren geachtet werden. Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler neigen dazu, auf Störungen mit oft ungezieltem Klicken auf Menübefehle oder<br />
Symbole zu reagieren <strong>und</strong> verschlimmern damit meist das Problem. Abwartendes Vorgehen, d.h.<br />
den Computer den aktuellen Vorgang abschließen lassen, vermeidet oft eine Problemverschärfung.<br />
Auch unnötige mechanische Belastungen wie das Bewegen des Computers während des Betriebs<br />
sollten vermieden werden.<br />
Vorbeugend sollte für jeden PC eine Notfalldiskette erstellt werden, die auch den Treiber für das<br />
CD-ROM-Laufwerk enthält.<br />
8.2 Viren auf dem Computer <strong>und</strong> im Internet<br />
Computerviren sind von Menschen entwickelte Programme die sich selbst reproduzieren, indem sie<br />
sich an andere Programme anhängen. Sie enthalten fast immer einen Programmteil, der Schaden<br />
verursacht.<br />
Virentypen<br />
Bootviren<br />
Bootviren setzen sich im Bootsektor von Disketten fest. Beim Versuch, den Computer mit dieser<br />
Diskette zu Booten, springt der Virus auf den Masterbootrecord der Festplatte über <strong>und</strong> verbleibt<br />
dort. Er infiziert danach den Bootsektor jeder nicht schreibgeschützten Diskette, auf die der<br />
Computer zugreift.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 103<br />
Dateiviren<br />
Dateiviren infizieren ausführbare Dateien (Dateinamenserweiterung: exe, com, ovl), indem sie<br />
deren Programmcode erweitern <strong>und</strong> oft auch teilweise überschreiben. Nach der Ausführung eines<br />
infizierten Programms gelangt der Virus in den Arbeitsspeicher <strong>und</strong> kann dann jedes danach<br />
gestartete Programm infizieren. Dateiviren enthalten meist schädliche Funktionen wie etwa das<br />
Verändern oder Löschen von Dateien.<br />
Die modernen New-Exe-Viren infizieren gezielt Windows-Systemdateien <strong>und</strong> stören den reibungslosen<br />
Ablauf der Betriebssystemfunktionen.<br />
Makroviren<br />
Makroviren nutzen die Programmierfunktion der Microsoft Office-Programme aus <strong>und</strong> infizieren<br />
somit ausschließlich Office-Dokumente. Wurde z.B. bei Word das Makro eines infizierten<br />
Dokumentes aktiviert, so kann über die Infektion der Standardvorlage jede danach erstellte<br />
Worddatei infiziert werden. Verstärkt bedienen sich Virenentwickler auch dem E-Mail-Programm<br />
Microsoft OutlookExpress zur Verbreitung von Viren.<br />
Scriptviren<br />
Scriptviren kommen in VisualBasicScript (VBS)- <strong>und</strong> in HTML-Dateien vor. VBS-Viren können<br />
nur durch das Öffnen einer infizierten Datei im InternetExplorer aktiviert werden. Scriptviren<br />
können auf dem PC dann die verschiedensten Störaktionen ausführen.<br />
Erkennen von Virenbefall<br />
Folgende Symptome können auf einen Virenbefall hindeuten<br />
- Die Dateigröße von Programmdateien verändert sich.<br />
- Diskettenoperationen dauern länger als gewöhnlich.<br />
- Programme stürzen häufiger ab als vorher oder funktionieren nicht mehr richtig.<br />
- Meldungen oder Grafiken erscheinen auf dem Bildschirm.<br />
- Plötzlich ertönt Musik.<br />
- Die Maus zeigt ein ungewöhnliches Verhalten.<br />
- Einzelne Programme, Dateien oder Verzeichnisse sind nicht mehr vorhanden.<br />
- In Dokumenten fehlen plötzlich Wörter.<br />
- In Dokumenten werden zusätzlich Wörter <strong>und</strong> Textpassagen eingefügt.<br />
- Drucker funktioniert manchmal nicht richtig.<br />
- Einzelne Tasten der Tastatur funktionieren nicht mehr richtig.<br />
- Von einer EXE-Datei gibt es auf einmal eine gleichnamige COM-Datei<br />
- Programme lassen sich nicht mehr starten.<br />
- Der PC ist deutlich langsamer geworden.<br />
- Der PC stürzt ab <strong>und</strong> meldet einen PARITY ERROR oder PARITY CHECK.<br />
- Computer lässt sich nicht mehr starten.<br />
Die genannten Symptome können jedoch auch andere Ursachen haben, zum Beispiel<br />
Hardwarefehler oder Unverträglichkeit von Programmen mit einer Systemversion oder bestimmten<br />
Systemerweiterungen.
104<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Maßnahmen bei Virenbefall<br />
Wurden bislang keine vorbeugenden Maßnahmen getroffen, sollte die Festplatte zunächst mit einem<br />
Virenscanner auf Viren durchsucht werden. Die meisten Viren können ohne Schäden zu<br />
hinterlassen von den gängigen Virenschutzprogrammen auch entfernt werden.<br />
Bei Befall durch einen Bootvirus muss der PC jedoch mit einer virenfreien Bootdiskette gestartet<br />
werden, ehe der Virus entfernt werden kann. Infizierte Disketten können durch vollständiges<br />
Formatieren (Quickformat reicht nicht aus!) desinfiziert werden.<br />
Dateiviren werden mit ein Antivirenprogramm aufgespürt <strong>und</strong> entfernt. Anschließend kann das<br />
infizierte Programm nach der Entfernung des Virus' defekt sein <strong>und</strong> muss dann neu installiert<br />
werden.<br />
Makroviren können von Virenscannern entfernt oder durch Löschen der schädlichen Makros<br />
eliminiert werden. Eine Sicherungsfunktion in den Office-Programmen warnt beim Aktivieren von<br />
Makros, was vom Anwender abgelehnt werden kann. Verdächtige Office-Dokumente können vorsorglich<br />
mit einem (kostenlosen) Viewer betrachtet werden. Word-Dokumente können auch mit<br />
WordPad geöffnet werde, wobei viele Formatierungen nicht angezeigt werden, aber die Makros<br />
auch nicht aktiviert werden.<br />
Vorsorge<br />
Vorsorglich sollte ein PC mit einer aktuellen <strong>und</strong> bewährten Antiviren-Software ausgestattet sein.<br />
Gute Antiviren-Programm können den Tests von Computer-Fachzeitschriften entnommen werden.<br />
Jedes Virenschutzprogramm hat eine Überwachungsmodul. Dieses Programm wird beim Computerstart<br />
geladen <strong>und</strong> achtet permanent auf das Auftauchen von Viren, um ein Infizierung zu<br />
verhindern.<br />
Originalsoftware auf Disketten sollten nur im schreibgeschützten Zustand auf dem PC eingesetzt;<br />
eigene Disketten auf fremden Rechnern nur immer im schreibgeschützten Zustand verwendet<br />
werden.<br />
Einige Einstellungen im BIOS-Setup bieten in einem gewissen Umfang Schutz vor Bootviren. Im<br />
Die Einstellungen werden im CMOS-RAM des PCs gespeichert <strong>und</strong> können mit einem Passwort<br />
versehen werden. Bei älteren PCs können Einstellmöglichkeiten fehlen. Alle vorgenommenen<br />
Änderungen im Setup des BIOS lassen sich bei Bedarf wieder zurückstellen. Diese Maßnahmen<br />
sollte nur der Systembetreuer durchführen.<br />
• Bootreihenfolge (Boot Sequence) auf C: - A: einstellen (Durch diese Einstellung wird das<br />
ungewollte Booten von der Diskette verhindert.)<br />
• Viruswarnung (Virus Warning) aktivieren (enabled)<br />
Bei der Gr<strong>und</strong>einstellung / enabled erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, wenn ein<br />
Virus versucht den Partitionssektor oder den ersten Bootsektor der Festplatte zu infizieren bzw.<br />
zu ändern. Durch drücken der Taste Y wird die Infizierung bzw. Änderung akzeptiert, was im<br />
Virenfalle natürlich zu unterbleiben hat, während mit jeder anderen Taste eine Infizierung<br />
vermieden wird. In jedem Fall sollte danach mittels eines Antiviren-Programms der Virus<br />
ausfindig gemacht <strong>und</strong> beseitigt werden.<br />
• BIOS-Update deaktivieren (disabled) bei Flash-BIOS:<br />
Bei neueren PCs gibt es im BIOS (Setup) die Möglichkeit, das Flash-BIOS vor einer<br />
Veränderung (Update) zu schützen. Dazu ist die Funktion „BIOS UPDATE“ zu deaktivieren.<br />
Bei älteren PCs muss dazu auf dem Motherboard ein Jumper umgesteckt werden. Die genannten
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 105<br />
Maßnahmen schützen natürlich nicht vor Viren, die den CMOS-Inhalt des Computers, in dem<br />
diese Einstellungen gespeichert sind, verändern oder löschen.<br />
Zur Behebung von Virenproblemen ist eine Systemdiskette oder besser eine SOS-Diskette mit den<br />
notwendigen Tools <strong>und</strong> den gesicherten Systembereichen notwendig. Zur gründlichen Virenvorsorge<br />
gehört auch die regelmäßige Datensicherung (s.u.).<br />
Geringe Virengefahr besteht, wenn<br />
- keine fremden Disketten benutzt werden (z.B. Disketten von Schülern),<br />
- keine Software aus unbekannten Quellen eingesetzt wird,<br />
- der Rechner keine Verbindung zu anderen Rechnern hat (Lokales Netz, Internet),<br />
- der Rechner in ein geschlossenes, virenfreies Netzwerk (Lokales Netz) eingeb<strong>und</strong>en ist <strong>und</strong> nur<br />
die im Netzwerk verfügbare Anwendersoftware genutzt wird.<br />
Große Virengefahr besteht, wenn<br />
- ein reger Austausch <strong>und</strong> Einsatz von Disketten, CD-Roms- insbesondere „selbstgebrannte“ CD-<br />
Roms - <strong>und</strong> Software aus unterschiedlichen Quellen betrieben wird,<br />
- das Herunterladen (Downloads) von Software aus den zahlreichen obskuren Quellen im Internet<br />
ohne entsprechende Sicherung erfolgt.<br />
Antiviren-Programme<br />
Antiviren-Programme sind Softwareprogramme zum Schutz vor Virenbefall <strong>und</strong> zur Bekämpfung<br />
von Computerviren. Sie können u.a. folgende Funktionen beinhalten:<br />
Der Virenscanner überprüft den Bootsektor bzw. die Datenträger auf Virenbefall <strong>und</strong> meldet bzw.<br />
entfernt ggf. vorhandene Viren. Soll ein PC auf Viren untersucht werden (in diesem Falle genügt<br />
schon der Verdacht), so ist der Computer durch einen Kaltstart von einer virenfreien Bootdiskette<br />
zu starten <strong>und</strong> danach der Virencheck durchzuführen.<br />
Das Programm kann infizierte Dateien löschen bzw. Viren im Boot- <strong>und</strong> Masterbootbereich<br />
eliminieren. Das Entfernen von Viren aus infizierten Dateien <strong>und</strong> Bereichen, d.h. das Restaurieren<br />
verläuft nicht in allen Fällen zufrieden stellend. Manchmal funktioniert das vom Virus gereinigte<br />
Programm nicht mehr. Bereiche in Dateien, die z. B. vom Virus überschrieben wurden, können vom<br />
Antiviren-Programm nicht mehr vollständig hergestellt werden. In solchen Fällen zeigt sich, wie<br />
wichtig eine Sicherungskopie ist. Existiert keine virenfreie Sicherungskopie, sollte vorsorglich vor<br />
Durchführung der Restauration ein Kopie der virulenten Datei angefertigt werden, damit bei einer<br />
fehlgeschlagenen Virenentfernung ein weiterer Versuch mit einem anderen Antiviren-Programm<br />
unternommen werden kann. Die virulente Kopie sollte als „virulent“ gekennzeichnet werden <strong>und</strong>,<br />
falls nicht mehr benötigt, vernichtet oder gelöscht werden.<br />
Der Virenwächter überprüft den PC beim Start <strong>und</strong> überwacht ihn während des Betriebes auf<br />
Virenaktivitäten. Wird ein Virus erkannt, z.B. durch Einsatz einer virenverseuchten Diskette oder<br />
durch Starten einer virulenten Programmdatei erscheint eine entsprechende Warnmeldung, <strong>und</strong> der<br />
Abbruch des Vorgangs bzw. die Eliminierung des Virus‘ wird angeboten.<br />
Das Virenwächter-Programm ist ein speicherresidentes Programm, das beim Starten des PCs in den<br />
Arbeitsspeicher geladen <strong>und</strong> aktiviert wird. Von dort aus soll es im Hintergr<strong>und</strong> ständig alle<br />
Aktivitäten des Computers überwachen <strong>und</strong> im Virenfalle, die des Virus verhindern <strong>und</strong> eine<br />
Warnmeldung mit Hinweisen zu dem jeweiligen Virus auf dem Bildschirm ausgeben.
106<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Dies ist etwas viel verlangt, wenn man an die große Zahl von Virenarten denkt. Noch nicht einmal<br />
die Virenscanner können alle Viren eindeutig identifizieren. Trotzdem sollte ein aktueller<br />
Virenwächter auf dem PC installiert werden, da er in der Regel die bekannten Viren identifiziert.<br />
Bei der Installation von Programmen ergeben sich bei aktivem Virenwächter immer wieder<br />
Probleme, so dass er in den betreffenden Fällen vorsorglich ausgeschaltet werden muss. Auf einem<br />
Computer sollten nie zwei Virenwächter gleichzeitig aktiviert sein.<br />
Kostenlose Virenscanner<br />
Zwei Anbieter stellen Virenscanner, die erkannte Viren auch entfernen, für Privatanwender<br />
kostenlos zur Verfügung.<br />
F-Prot ist ein DOS-Programm, das auch unter Windows gestartet werden kann. Die aktuelle<br />
Version kann im Internet heruntergeladen werden<br />
Internet: www.datafellows/f-prot<br />
oder im Downloadarchiv des Verlages Ziff-Davis<br />
Internet: www.zdnet.de/download/library/001M6-wf<br />
F-Prot ist als zip-Datei gepackt (komprimiert). Zum Entpacken ist eine Packprogramm erforderlich,<br />
das ebenfalls unter www.zdnet.de/download abgerufen werden kann.<br />
Das deutschsprachige Programm AntiVir wird als Personal Edition ebenfalls kostenlos in zwei<br />
Versionen (für Windows 9x <strong>und</strong> für Windows NT) an Privatpersonen für die Nutzung auf einem<br />
Computer abgegeben:<br />
Internet: www.free-av.com/german.html<br />
8.3 Datensicherung<br />
Die regelmäßige <strong>und</strong> systematische Sicherung wichtiger Daten ist gerade in der Schule von großer<br />
Bedeutung. Zum Einen sind besonders im Verwaltungsbereich wichtige <strong>und</strong> ggf. nur mit großem<br />
Aufwand rekonstruierbare Daten vorhanden. Im pädagogischen Bereich ist verstärkt mit<br />
ungewollten Manipulationen durch die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler zu rechnen, was im Rahmen einer<br />
intensiven schulischen Computereinsatzes nicht ausgeschlossen werden kann. Gr<strong>und</strong>lage einer<br />
effektiven Datensicherung ist eine gut geplante <strong>und</strong> konsequent realisierte Datenspeicherung. So<br />
empfiehlt es sich dringend, Programmdateien <strong>und</strong> vom Anwender angelegte Dateien geflissentlich<br />
zu trennen, also die Anwenderdateien einem separaten Verzeichnisbaum zu speichern. Dann<br />
können diese beiden Bereiche bei der Datensicherung separat behandelt werden <strong>und</strong> bei begrenzter<br />
Speicherkapazität evtl. nur die Anwenderdateien zu sichern. In der Regel stehen für Probleme bei<br />
den Programmdateien die Originaldatenträger zur erneuten Installation zur Verfügung.<br />
Den Vorgang der Sicherung von Daten bezeichnet man als Backup, den der Wiederherstellung als<br />
Restore. Zur Datensicherung werden spezielle Laufwerke mit hoher Speicherkapazität eingesetzt. In<br />
ihnen kommen entweder Bänder (Streamer) oder besondere Disketten (ZIP, JAZ) als<br />
Speichermedien zum Einsatz. Zur Sicherung benutzt man spezielle Backup-Programme, die das<br />
gezielte Sichern ganzer Laufwerke, Verzeichnisbäume oder auch einzelner Dateien ermöglichen.<br />
Beim Sicherungsvorgang werden die Daten zudem komprimiert <strong>und</strong> nehmen danach erheblich<br />
weniger Speicherplatz in Anspruch.<br />
Beim vollständigen Backup werden alle Daten der ausgewählten Laufwerke bzw. Verzeichnisse<br />
(einschließlich Unterverzeichnissen) gesichert. Beim Veränderungsbackup werden nur die Dateien<br />
gesichert, die seit der letzten Sicherung neu angelegt oder verändert wurden. Aus dem vollständigen
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 107<br />
Backup <strong>und</strong> den danach erfolgten Veränderungsbackups kann das Programm jede gesicherte Datei<br />
wieder herstellen. Eine sinnvolle Sicherungsstrategie sieht meist ein gelegentliches vollständiges<br />
Backup (z.B. jede 4. Woche) <strong>und</strong> dazwischen jede Woche ein Veränderungsbackup vor.<br />
Übersicht: Laufwerke <strong>und</strong> Medien zur Datensicherung (Auswahl)<br />
Kapazität (ohne<br />
Komprimierung)<br />
Preis<br />
Laufwerk/Medium<br />
ZIP-Laufwerk 100 MB 200-250 / 25 als Laufwerk<br />
ZIP-Laufwerk 250 MB 380 / 50 als Laufwerk<br />
Verwaltung Anschlüsse<br />
ATAPI /<br />
parallel /<br />
USB / SCSI<br />
ATAPI /<br />
parallel / SCSI<br />
JAZ-Laufwerk 2GB 700 / 160 als Laufwerk ATAPI / SCSI<br />
SyQuest SyJet 1,5 GB 500 / 120 als Laufwerk ATAPI / SCSI<br />
DITTO-Streamer ab 2 GB ab 280 / ab 50<br />
Travan-Streamer 400 MB - 4 GB<br />
ab 200 /<br />
ab 30<br />
DAT-Streamer 2 - 20 GB ab 800<br />
nur Backup-<br />
Gerät<br />
nur Backup-<br />
Gerät<br />
nur Backup-<br />
Gerät<br />
ATAPI / SCSI<br />
ATAPI / SCSI<br />
SCSI<br />
CD-RW-Brenner 650 MB ab 600 / als Laufwerk IDE / SCSI<br />
Bei DITTO- <strong>und</strong> Travan-Streamern ist das Backup-Programm meist im Lieferumfang enthalten.<br />
Einfache Backup-Programme sind auch Bestandteil der Windows-Betriebssysteme. Geräte, die als<br />
Laufwerke verwaltet werden, können vielfältiger genutzt werden (z.B. Transport umfangreicher<br />
Daten), wogegen die reinen Backupgeräte meist nur über das Backup-Programm zur<br />
Datensicherung <strong>und</strong> -wiederherstellung eingesetzt werden können.<br />
Bei vernetzten Computern kann ein Backup-Laufwerk die Daten aller angeschlossenen Computer<br />
sichern. Ein sicheres Aufbewahren der Speichermedien ist obligatorisch.<br />
8.4 Datenschutz<br />
Gr<strong>und</strong>gesetz, B<strong>und</strong>esdatenschutzgesetz (BDSG) <strong>und</strong> Landesdatenschutzgesetze (LDSG) sichern<br />
den Schutz des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Bürger, durch detaillierte Vorgaben<br />
mit rechtlichen Sanktionen, Kontrollinstanzen <strong>und</strong> Auskunftsrecht der Betroffenen. Der Bürger soll<br />
selbst bestimmen können, wer was wann <strong>und</strong> bei welcher Gelegenheit über ihn weiß.<br />
Nach dem B<strong>und</strong>esdatenschutzgesetz (BDSG) stehen dem Betroffenen bezüglich seiner auf einem<br />
Computer gespeicherten Daten folgende Rechte zu:<br />
• Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten;<br />
• Recht auf Berichtigung falscher Daten;<br />
• Recht auf Löschung der Daten, wenn die Speicherung unzulässig war;<br />
• Recht auf Sperrung der Daten, wenn die Voraussetzung zu ihrer Speicherung entfallen ist, oder<br />
wenn sich ihre Richtigkeit nicht feststellen lässt.
108<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Personenbezogene Daten<br />
Eine Regelung zur Erhebung, Verarbeitung <strong>und</strong> Sicherung personenbezogener Daten in Dokumentationen<br />
<strong>und</strong> Jahresberichten findet sich in § 76 <strong>und</strong> § 77 bei der zur Zeit gültigen übergreifenden<br />
Schulordnung sowie § 52 <strong>und</strong> § 53 der zur Zeit gültigen Gr<strong>und</strong>schulordnung (Rheinland-Pfalz).<br />
Dort heißt es im Wortlaut:<br />
§ 76 Erhebung <strong>und</strong> Verarbeitung personenbezogener Daten<br />
(1) Die Erhebung <strong>und</strong> Verarbeitung von personenbezogenen Daten, insbesondere ihre Übermittlung<br />
an Dritte, richtet sich nach § 54a SchulG.<br />
(2) Die bei der Aufnahme erhobenen Daten sowie die sich im Rahmen des Schulverhältnisses<br />
ergebenden personenbezogenen Daten dürfen für die Verwaltungsaufgaben der Schule,<br />
insbesondere für die Erstellung von Zeugnissen <strong>und</strong> für die schulische Korrespondenz, im<br />
automatisierten Verfahren verarbeitet werden. Dies gilt nicht für personenbezogene Daten über<br />
besondere außerunterrichtliche, insbesondere schulärztliche <strong>und</strong> schulpsychologische Maßnahmen<br />
(§ 52 Abs. 3 SchulG) sowie über Ordnungsmaßnahmen. Automatische Textverarbeitung ist in<br />
diesen Fällen zulässig, sofern die Daten nicht gespeichert, sondern unverzüglich nach Fertigstellung<br />
des jeweiligen Textes gelöscht werden.<br />
(3) Personenbezogene Daten dürfen auf privateigenen Datenverarbeitungsgeräten von Lehrkräften<br />
zu dienstlichen Zwecken verwendet werden, wenn der Schulleiter dies im Einzelfall genehmigt hat,<br />
das Einverständnis dafür vorliegt, dass das Datenverarbeitungsgerät unter den gleichen<br />
Bedingungen wie dienstliche Geräte kontrolliert werden kann, <strong>und</strong> den Belangen des Datenschutzes<br />
Rechnung getragen ist.<br />
(4) Den Eltern kann zu Beginn eines Schuljahres eine Liste mit Namen, Anschrift <strong>und</strong><br />
Telefonverbindung der Eltern <strong>und</strong> den Namen der Kinder der Klasse übergeben werden, soweit der<br />
Aufnahme in diese Liste nicht widersprochen wird. Auf das Recht jedes Betroffenen, der Aufnahme<br />
seiner Daten zu widersprechen, ist hinzuweisen.<br />
(5) . . .<br />
(6) Gibt eine Schule für die Schüler <strong>und</strong> Eltern Dokumentationen, insbesondere Jahresberichte,<br />
heraus, so dürfen darin folgende personenbezogene Daten enthalten sein:<br />
1. Namen, Geburtsdatum, Jahrgangsstufe <strong>und</strong> Klasse der Schüler,<br />
2. Namen, Lehrbefähigung <strong>und</strong> Verwendung der einzelnen Lehrkräfte,<br />
3. Angaben über besondere schulische Tätigkeiten <strong>und</strong> Funktionen einzelner Lehrkräfte, Schüler<br />
<strong>und</strong> Eltern.<br />
(7) Die Schule kann ehemaligen Schülern die zur Organisation eines Treffens geeigneten<br />
personenbezogenen Daten von ehemaligen Schülern <strong>und</strong> Lehrern übermitteln.<br />
§ 77 Sicherung <strong>und</strong> Aufbewahrung personenbezogener Daten<br />
(1) Personenbezogene Daten, die automatisch verarbeitet werden, sind gemäß § 9 Abs. 2 des<br />
Landesdatenschutzgesetzes vom 5. Juli 1994 (GVBI. S. 293, BS 204-1) in der jeweils geltenden<br />
Fassung zu sichern. Für personenbezogene Daten, die nicht automatisch verarbeitet werden, ist<br />
sicherzustellen, dass sie nur denen zugänglich gemacht werden, die sie für die Erfüllung ihrer<br />
dienstlichen Aufgaben benötigen.<br />
(2) Personenbezogene Daten in automatisierten Dateien sind zu löschen, sobald ihre Kenntnis für<br />
die speichernde Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, spätestens jedoch
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 109<br />
ein Jahr, nachdem der Schüler die Schule verlassen hat. Hiervon ausgenommen sind die Namen <strong>und</strong><br />
Aktennachweise, die bis zur Vernichtung der Akte automatisiert gespeichert werden können.<br />
(3) Personenbezogene Daten in nicht automatisierten Dateien <strong>und</strong> in Akten sind ein Jahr, nachdem<br />
der Schüler die Schule verlassen hat, zu sperren. Sie dürfen von diesem Zeitpunkt an nicht mehr<br />
verarbeitet werden, es sei denn, dass die Verarbeitung<br />
1. zur Behebung einer bestehenden Beweisnot,<br />
2. aus sonstigen, im überwiegenden Interesse der speichernden oder einer anderen Schule liegenden<br />
Gründen oder<br />
3. im rechtlichen Interesse eines Dritten unerlässlich ist oder<br />
4. der Betroffene eingewilligt hat.<br />
(4) Personenbezogene Daten in nicht automatisierten Dateien <strong>und</strong> in Akten sind nach Maßgabe der<br />
hierfür geltenden Bestimmungen aufzubewahren <strong>und</strong> nach Ablauf der jeweiligen Frist zu vernichten<br />
oder zu archivieren.<br />
Personenbezogene Daten im Internet<br />
Daten von Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler wie Namen, Geburtsdatum, Konfession, Staatsangehörigkeit,<br />
Adresse, Jahrgangsstufe <strong>und</strong> auch Bilder dürfen nur mit Zustimmung der Eltern bzw. des<br />
volljährigen Schülers / der volljährigen Schülerin veröffentlicht werden.<br />
Anders verhält es sich, wenn Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler Funktionen innehaben, in denen sie die<br />
Schule nach außen vertreten. Dies gilt für Schülersprecherinnen / -sprecher <strong>und</strong> der<br />
Stellvertreterinnen / Stellvertreter, nicht jedoch für Klassensprecherinnen <strong>und</strong> -sprecher. In diesen<br />
Fällen ist die Veröffentlichung von Name, Schuladresse <strong>und</strong> Funktion ohne Zustimmung möglich.<br />
Bei Daten von Lehrkräften dürften nach der Rechtslage zwar ohne Zustimmung, Name,<br />
Lehrerbefähigung <strong>und</strong> Funktion im Internet veröffentlicht werden. Diese Daten unterliegen<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich nicht dem Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen, da sie einen engen Bezug zur<br />
amtlichen Tätigkeit des Staates gegenüber den Bürgern haben <strong>und</strong> damit nicht primär der<br />
Individualsphäre des Bediensteten, sondern der Sphäre des Staates zuzuordnen sind. Wegen der<br />
besonderen Öffentlichkeitswirksamkeit des Internet soll aber unabhängig von dieser rechtlichen<br />
Einschätzung den Schulen die Einholung der Zustimmung bei Lehrkräften, die nicht der<br />
Schulleitung angehören, empfohlen werden. Stimmt die Lehrkraft nicht zu, werden ihre Daten nicht<br />
im Internet veröffentlicht.<br />
Soweit Eltern besondere schulische Funktionen innehaben, in denen sie die Schule nach außen<br />
vertreten - dies gilt für Schulelternsprecherinnen /-sprecher <strong>und</strong> deren Stellvertreterinnen /<br />
Stellvertreter, nicht jedoch für Klassenelternsprecher -, dürfen Name, Schuladresse <strong>und</strong> Funktion<br />
ohne Zustimmung veröffentlicht werden.<br />
Ministerium für Bildung, Wissenschaft <strong>und</strong> Weiterbildung (1998)<br />
Personenbezogene Daten, die im Internet erfragt werden<br />
Der folgende Hinweis sollte nach Ansicht des Landesbeauftragten für den Datenschutz in einer<br />
Dialogbox erscheinen, wenn z.B. per Bildschirmformular in Internet-Angeboten öffentlicher Stellen<br />
personenbezogene Daten der Nutzer erfragt werden:
110<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Vorschlag für ein Gestaltungsmuster:<br />
Um dieses Internet-Angebot des/der ... (Bezeichnung der Daten verarbeitenden Stelle) ... nutzen zu<br />
können, ist die Verarbeitung der dargestellten personenbezogenen Daten erforderlich. Die Daten<br />
werden lediglich für ... (Verwendungszweck) ... verwendet. Ihre Daten werden nach ... (Angabe<br />
einer Speicherungsfrist / Erfüllung des Zwecks) ... gelöscht (Alternative: Ihre Daten werden ...<br />
[(dauerhaft / bis auf Widerruf) ... gespeichert].<br />
Mit der Bestätigung dieses Hinweises willigen Sie in die o.g. Verarbeitung Ihrer Daten ein. Sie<br />
können diese Einwilligung schriftlich oder per E-Mail gegenüber dem/der ... (Bezeichnung der<br />
Daten verarbeitenden Stelle) ... jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Nachteile<br />
entstehen Ihnen daraus nicht.<br />
Dieses Angebot unterstützt gegenwärtig keine Datenverschlüsselung. Bei der Übertragung Ihrer<br />
Daten im Internet besteht daher keine Datenverschlüsselung. Bei der Übertragung Ihrer Daten im<br />
Internet besteht daher die Möglichkeit, dass diese durch Unbefugte zur Kenntnis genommen oder<br />
verändert werden können.<br />
Erklärung:<br />
Ich willige in die o.g. Verarbeitung meiner Daten ein.<br />
Bestätigungs-Schalter 2:<br />
Ich willige nicht in die Verarbeitung meiner Daten ein (Abbruch)<br />
Informationen: Orientierungshilfe des Landesdatenschutzbeauftragten (LfD) Rheinland-Pfalz, „Internet-<br />
Zugänge <strong>und</strong> - Angebot“ 1998
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 111<br />
9 <strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong><br />
in der Aus-, Fort- <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
9.1 <strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> im Rahmen<br />
des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Sonderschulen 1<br />
Die rasante Entwicklung in der Mikroelektronik <strong>und</strong> Telekommunikation gewinnt zunehmend<br />
Einfluss auf die öffentliche <strong>und</strong> private Lebensgestaltung, sodass auch das Bildungswesen<br />
aufgefordert ist, sich mit dieser Entwicklung auseinander zu setzen. Somit entsteht auch für die<br />
Studienseminare für das Lehramt an Sonderschulen die Notwendigkeit, die mit den einer<br />
zukünftigen <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> Kommunikationsgesellschaft einhergehenden Erfordernisse in die<br />
Ausbildung einzubeziehen.<br />
Im Rahmen des Vorbereitungsdienstes werden <strong>Neue</strong> Medien <strong>und</strong> Telekommunikation unter<br />
folgenden Aspekten thematisiert:<br />
• als Hilfe zur Durchführung von Unterricht <strong>und</strong> Fördermaßnahmen<br />
• als wesentlicher Faktor einer Medienerziehung<br />
• als Gegenstand einer informationstechnischen Gr<strong>und</strong>bildung<br />
• als Mittel beruflicher Information sowie des Austausches <strong>und</strong> der Weiterbildung<br />
<strong>Neue</strong> Medien als Hilfe zur Durchführung von Unterricht <strong>und</strong> Fördermaßnahmen<br />
In Verbindung mit der Durchführung von Unterricht <strong>und</strong> Fördermaßnahmen stellen moderne<br />
Medien gerade im Bereich der Sonderpädagogik eine vielfältig nutzbare Bereicherung dar. Das<br />
betrifft apparative Hilfen für Schüler mit Sinnes- <strong>und</strong> Körperbeeinträchtigungen ebenso wie die<br />
vielfältigen Lernsoftwareangebote für mittlerweile fast alle Unterrichtsfächer.<br />
Ein effektiver Einsatz von Lernprogrammen <strong>und</strong> Multimediaangeboten setzt voraus, dass man<br />
- einen Überblick hat über die zur Verfügung stehenden Programme hat,<br />
- diese im Hinblick auf die anstehenden Lehr-/Lernaufgaben unter Einbeziehung<br />
lernpsychologischer Erkenntnisse gültig analysieren <strong>und</strong> beurteilen kann,<br />
- den Beitrag von modernen Medien <strong>und</strong> Technologien zur Aufgabenbewältigung bestimmen,<br />
Wirkungen <strong>und</strong> Nebenwirkungen erfassen <strong>und</strong> interpretieren <strong>und</strong><br />
- Einsatzformen bestimmen kann.<br />
Eine Qualifizierung zukünftiger Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer für einen Unterricht, der die Möglichkeiten<br />
der modernen Medien <strong>und</strong> der Telekommunikation nutzt, kann nur in Verbindung mit der konkreten<br />
Unterrichtswirklichkeit vollzogen werden. Trotz der immer noch nicht flächendeckenden<br />
Ausstattung der rheinland-pfälzischen Sonderschulen mit Computern finden die Anwärter in ihren<br />
Ausbildungsschulen immer öfter Computer vor, entweder in speziellen Computerräumen oder<br />
direkt in den Klassenzimmern. Auch wenn die vorhandenen Computer meist nicht dem neuesten<br />
technischen Stand entsprechen, werden sie von den Mentoren in unterschiedlicher Weise für<br />
Erziehung <strong>und</strong> Unterricht eingesetzt. Wenn diese Voraussetzungen in ihren Ausbildungsklassen<br />
gegeben sind, können die Anwärter Möglichkeiten erproben, wie ein sinnvoller, auf die<br />
1<br />
Text: Breiten, W./Grimm, W., Studienseminar für das Lehramt an Sonderschulen Neuwied bzw.<br />
Kaiserslautern
112<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Lernbedürfnisse der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler abgestimmter Einsatz des Computers im Unterricht<br />
erfolgen kann: z.B. das Schreiben eines Aufsatzes mittels Textverarbeitung im Deutschunterricht,<br />
der gezielte Einsatz von Lernsoftware für das Üben im Mathematikunterricht oder im<br />
Stationenlernen, das Erstellen einer Schülerzeitschrift im Projektunterricht... . Eine wichtige<br />
Bedingung für eine erfolgreiche Ausbildung ist das Engagement <strong>und</strong> die Offenheit der Mentoren<br />
<strong>und</strong> der Fachleiter, die die Anwärter in didaktisch-methodischen Fragen beraten. Die meisten<br />
Anwärter haben zwar bereits eigene Erfahrungen - meist durch die Nutzung der Textverarbeitung -<br />
gesammelt, dennoch können Ängste <strong>und</strong> Vorurteile bei dem Einsatz des Computers im eigenen<br />
Unterricht auftreten, die in Gesprächen mit Mentoren <strong>und</strong> Fachleitern thematisiert werden können.<br />
In der Seminararbeit können beispielsweise Lernprogrammen für den Mathematik- <strong>und</strong><br />
Deutschunterricht vorgestellt werden. Dabei können didaktisch-methodische Kriterien zur<br />
Beurteilung von Lernsoftware <strong>und</strong> -spielen erarbeitet werden.<br />
Ebenfalls kann die Verwendung des Computer als Hilfsmittel eine wichtige Rolle spielen. Im<br />
Seminar „Körperbehindertenpädagogik“ kommt beispielsweise der Auseinandersetzung mit<br />
technischen Hilfen, die es den Schülern ermöglichen, trotz ihrer Bewegungsbeeinträchtigung einen<br />
Computer zu bedienen, eine wichtige Rolle zu: Wichtige Beispiele sind Spracherkennungsprogramme<br />
als Hilfe für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, die keine Tastatur bedienen können, oder<br />
Sprachausgabeprogramme, die nichtsprechenden Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern die Möglichkeit zur<br />
verbalen Kommunikation geben.<br />
Dabei stehen pädagogische Zielstellungen im Mittelpunkt. So kann z.B. mit Hilfe des Computers<br />
Selbstständigkeitserziehung geistigbehinderter Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, Förderung von<br />
Handlungskompetenzen bewegungsbeeinträchtigter Schüler oder Sprachförderung von mutistischen<br />
Schülern innerhalb von Erziehung <strong>und</strong> Unterricht erfolgen.<br />
<strong>Neue</strong> Medien <strong>und</strong> Technologien als wesentlicher Faktor einer Medienerziehung<br />
Alle Analysen, die zum Thema „Kindheit heute“ (vgl. hierzu vor allem die Dokumentation zum<br />
B<strong>und</strong>esgr<strong>und</strong>schulkongress 1989 in Frankfurt/M. „Kindheit heute - Herausforderung für die<br />
Schule“) vorgelegt wurden, zeigen die Auswirkungen der modernen Medien im Hinblick auf eine<br />
veränderte Kindheit auf.<br />
Damit muss Medienerziehung, <strong>und</strong> hier in besonderer Weise die Bedeutung <strong>und</strong> die Auswirkungen<br />
von Computern <strong>und</strong> Multimediaangeboten auf die Lebensweisen <strong>und</strong> die Lebenseinstellungen von<br />
Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen, unverzichtbarer Bestandteil einer zeitgemäßen Lehrerausbildung sein.<br />
Für die Allgemeinen Seminare ist Medienerziehung wegen dieser derzeitigen gesellschaftlichen<br />
Relevanz eine eigenständige pädagogische Rahmenthematik, die Fach- <strong>und</strong> Fachrichtungsseminare<br />
setzen sich im Zusammenhang mit pädagogischen Einzelfragestellungen (z.B. reduzierte<br />
Primärerfahrungen bzgl. der Unterrichtsthemen, Verhaltensauffälligkeiten <strong>und</strong> Medienkonsum etc.)<br />
damit auseinander.<br />
<strong>Neue</strong> Medien <strong>und</strong> Telekommunikation als Gegenstand einer<br />
<strong>Informations</strong>technischen Gr<strong>und</strong>bildung<br />
Der Erwerb von Kenntnissen <strong>und</strong> Fertigkeiten in diesem Bereich ist für Sonderschüler im Hinblick<br />
auf die gegenwärtigen problematischen Entwicklungen des Arbeitsmarktes bedeutungsvoll. Das gilt<br />
nicht nur für das Fach Arbeitslehre oder die Kernfächer Deutsch <strong>und</strong> Mathematik sondern für alle<br />
Fächer, die durch den Computereinsatz Kompetenzen <strong>und</strong> Vorerfahrungen im Sinne von<br />
Schlüsselqualifikationen für die zukünftige Berufs- <strong>und</strong> Arbeitswelt vermitteln können.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 113<br />
Seit 1998 ist die <strong>Informations</strong>technische Gr<strong>und</strong>bildung fester <strong>und</strong> in verschiedenen Lehrplänen<br />
verankerter Bestandteil des Unterrichts an Schulen in Rheinland-Pfalz. Damit gehört sie auch in den<br />
Themenkatalog des Vorbereitungsdienstes.<br />
Während in den allgemeinen Seminaren das Konzept der <strong>Informations</strong>technischen Gr<strong>und</strong>bildung<br />
(Entwicklung <strong>und</strong> Stand, Zielsetzung <strong>und</strong> Umsetzungsmöglichkeiten) vorgestellt wird, setzen sich<br />
die Fachseminare, denen diese Thematik auf Gr<strong>und</strong> von Lehrplänen (z.B. Wirtschafts- <strong>und</strong><br />
Arbeitslehre, Deutsch, Mathematik) vorgegeben ist, durch die Planung, Durchführung <strong>und</strong><br />
Auswertung von exemplarischen Unterrichtsbeispielen sowie durch Hinweise zur Geräteausstattung<br />
damit auseinander.<br />
<strong>Neue</strong> Medien <strong>und</strong> Telekommunikation als Mittel beruflicher Information sowie des<br />
Austausches <strong>und</strong> der Weiterbildung<br />
Mit der Initiative „Schulen ans Netz“ <strong>und</strong> der Einrichtung eines Landesbildungsservers wurde<br />
vielen Bildungseinrichtungen der Zugang zu weltweiter Kommunikation im Internet ermöglicht.<br />
Damit werden Literaturrecherchen, Diskussionsforen für spezifische Fragestellungen oder auch<br />
Basisinformationstexte <strong>und</strong> aktuelle Mitteilungen für jeden Mitarbeiter des pädagogischen Bereichs<br />
ohne großen Zeitaufwand <strong>und</strong> kostengünstig zugänglich.<br />
Die hier zur Verfügung stehenden Möglichkeiten werden aber nur genutzt, wenn eine dazu<br />
notwendige Einweisung in das Handling der Zugangssoftware <strong>und</strong> eine berufsspezifische <strong>und</strong><br />
fragestellungsbezogene Nutzung der <strong>Informations</strong>angebote vermittelt wird.<br />
Die Initiative Schulen ans Netz könnte darüber hinaus Ausgangspunkt für einen schülerorientierten,<br />
grenzüberschreitenden Unterricht sein, in dem die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler Eigenverantwortung<br />
<strong>und</strong> Selbstständigkeit ausbilden können.<br />
Dem Studienseminar fällt deshalb hier ganz aktuell eine wichtige Ausbildungsaufgabe zu.<br />
9.2 Tätigkeit der <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong> „Computer an<br />
Sonderschulen“<br />
Die Durchführung der Aufgaben der <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong> „Computer an Sonderschulen“<br />
richten sich nach den folgenden Regelungen:<br />
Aufgaben der <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong>:<br />
• Beratung der insbesondere für die Systembetreuung zuständigen Lehrkräfte in fachlichen,<br />
methodischen, mediendidaktischen <strong>und</strong> technischen Fragen der Hard- <strong>und</strong> Softwarenutzung;<br />
• Organisation, Leitung <strong>und</strong>/oder Mitwirkung bei Veranstaltungen;<br />
• Initiative zu pädagogischen Vorhaben <strong>und</strong> Aufgaben sowie Koordination <strong>und</strong> Auswertung für<br />
den Computereinsatz an Sonderschulen;<br />
• Zusammenarbeit zwischen den <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong>n der Schulbehörden;<br />
• Zusammenarbeit mit den <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong>n anderer Schularten;<br />
• Zusammenarbeit mit Fachdidaktischen Kommissionen in Fragen des Computereinsatzes;<br />
• Ausarbeitung von Stellungnahmen <strong>und</strong> Gutachten in fachlichen <strong>und</strong> methodischen Fragen sowie<br />
Mitarbeit bei der Fortschreibung der Handreichungen „Computereinsatz an Sonderschulen“;<br />
• Beratung bei Unterrichtsprojekten;<br />
• Regelmäßige Beurteilung neuerer Hard- <strong>und</strong> Schulsoftware;<br />
• Beratung der Schulbehörde;
114<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
• Beratung der Schulleitungen hinsichtlich des Computereinsatzes in der Schulverwaltung;<br />
• Beratung in Ausstattungsfragen der Schulen;<br />
• Mitwirkung bei Unterrichtsbesuchen in jeweils besonderem Auftrag der Schulaufsicht;<br />
• Aktualisierung des eigenen Fachwissens hinsichtlich der Entwicklung von Hard- <strong>und</strong> Software;<br />
• Unterstützung der Arbeit der pädagogischen Service-Einrichtungen: Staatliches Institut für<br />
Lehrerfort- <strong>und</strong> -weiterbildung, Pädagogisches Zentrum, Landesmedienzentrum,<br />
Schulpsychologischer Dienst u.a.;<br />
• Zusammenarbeit mit Verbänden <strong>und</strong> Institutionen auf regionaler <strong>und</strong> überregionaler Ebene<br />
sowie die Übernahme von Tätigkeiten im fachwissenschaftlichen <strong>und</strong> fachdidaktischen Bereich.<br />
Fortbildung der <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong><br />
Die <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong> nehmen an gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen teil, die<br />
nach Bedarf stattfinden <strong>und</strong> von einem Vertreter des zuständigen Ministeriums oder der<br />
Bezirksregierung oder einem von der Schulbehörde Beauftragten geleitet werden. Diese<br />
Veranstaltungen dienen der allgemeinen pädagogischen <strong>und</strong> didaktischen Fortbildung sowie der<br />
fachlichen <strong>und</strong> fächerübergreifenden Zusammenarbeit aller <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong> des<br />
Landes.<br />
Planung <strong>und</strong> Durchführung von Veranstaltungen mit den <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong>n<br />
Veranstaltungen mit <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong>n können von <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong>n<br />
selbst, einem oder mehreren Kolleginnen/Kollegen, einer Konferenz, einem Schulleiter, einer<br />
Schulbehörde oder dem zuständigen Ministerium angeregt werden. Im Bedarfsfall können die<br />
Schulbehörde oder das Ministerium entsprechende Festlegungen treffen. Alle diese Veranstaltungen<br />
können nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durchgeführt werden.<br />
Die Teilnahme einer <strong>Fachberater</strong>innen/eines <strong>Fachberater</strong>s an Veranstaltungen, die zu seinem<br />
Aufgabenbereich gehören, sowie der Besuch von Fachausstellungen <strong>und</strong> Kongressen sind<br />
dienstliche Tätigkeiten im Sinne von § 31 Abs. 1 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Die<br />
vorherige Genehmigung der Dienstreise sowie die Erstattung von Reisekosten nach dem<br />
Landesreisekostengesetz erfolgen auf Antrag durch die Schulbehörde.<br />
Für die einzelnen Sonderschulen können bei Bedarf Veranstaltungen mit der zuständigen<br />
<strong>Fachberater</strong>innen/dem zuständigen <strong>Fachberater</strong> stattfinden.<br />
Zu schul- <strong>und</strong> schulartübergreifenden Veranstaltungen in seinem Zuständigkeitsbereich lädt die<br />
<strong>Fachberater</strong>in/der <strong>Fachberater</strong> bzw. laden die <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong> mit Genehmigung der<br />
Schulbehörde ein.<br />
Jede Sonderschule hat dafür Sorge zu tragen, dass die Angebote der <strong>Fachberater</strong>innen/<strong>Fachberater</strong><br />
wahrgenommen werden.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 115<br />
10 Software für den Einsatz in der sonderpädagogischen<br />
Förderung<br />
10.1 Bewertung von Lernsoftware - Kriterien<br />
Einleitung<br />
Die Suche nach geeigneter Software für den Einsatz in der Sonderpädagogik stellt sich als<br />
schwieriges Unterfangen dar. Der Markt bietet mittlerweile eine Fülle an Produkten, die in Bezug<br />
auf Inhalte, Zielgruppe, Arbeitsformen, etc. <strong>und</strong> nicht zuletzt pädagogische <strong>und</strong> technische Qualität<br />
ein sehr breites Spektrum aufweisen. Erschwerend kommt hinzu, dass dem Interessenten oft nur<br />
wenige Informationen über ein Produkt zur Verfügung stehen <strong>und</strong> beim Kauf eine Prüf- bzw.<br />
Rückgabemöglichkeit oft nicht eingeräumt wird.<br />
Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, anbieterunabhängige Informationen zu den wichtigsten<br />
Softwareprodukten zur Verfügung zu stellen. Die Bemühungen, Vielfalt mit einem Standardkatalog<br />
an Kriterien zu beurteilen, stoßen jedoch schnell an ihre Grenzen. Auch eine kurze Bewertung ist<br />
problematisch, da sie der Komplexität niemals gerecht werden kann. Stattdessen wird hier zunächst<br />
ein umfassender Kriterienkatalog vorgestellt, der bei der eigenen Urteilsbildung als Orientierungsrahmen<br />
dienen kann.<br />
Die Digita-Kriterien<br />
Die Digita-Kriterien sind Gr<strong>und</strong>lage der alljährlichen Verleihung des Schulsoftwarepreises<br />
„Digita“, im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Der vorgestellte Kriterienkatalog stammt aus dem<br />
Jahre 1997. 1<br />
Interaktivität:<br />
Begründung <strong>und</strong> Realisierung der Interaktionen von Programm <strong>und</strong> Benutzer<br />
Vielfalt, Funktionalität <strong>und</strong> Erschließbarkeit der lnteraktionsformen<br />
Interaktionstechniken<br />
Verhältnis von Variantenreichtum <strong>und</strong> Funktionalität<br />
Ist die Dialogführung (Mensch-Maschine-Dialog) benutzergerecht?<br />
Ist die Terminologie konsistent, auch bezogen auf andere Programmteile <strong>und</strong> auf gängige<br />
Softwareprodukte?<br />
Flexibilität<br />
Welche Varianten der Lernereingabe werden angeboten, welches Spektrum weisen die<br />
Programmreaktionen auf?<br />
Sind freie Eingaben Ton, Text, Zeichnung möglich?<br />
Werden die Einschränkungen bei eng begrenzten Eingaben (Auswahlantwort, Multiple Choice,<br />
Lückentext) aus dem Kontext heraus begründet?<br />
Lehrer-/Lehrmodell<br />
Ist die Software primär Lehrmittel, Lernmittel oder Arbeitsmittel?<br />
Welche Rolle spielen Lehrpersonen beim Einsatz der Software (Anreger, Coach, Moderator)?<br />
1 Quelle: bildung-rp.de/LMZ/bewert.pht
116<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Erwartungskonformität <strong>und</strong> Einarbeitungsaufwand<br />
Entsprechen die Reaktionen des Programms den Erwartungen des Lerners?<br />
Erschließen sich den Lernenden die vorgesehenen Interaktionsfolgen mit einem vertretbaren<br />
Aufwand?<br />
Sind fachliche <strong>und</strong> lerntechnische Hilfen problemlos zugänglich?<br />
Gibt es Anwendungsbeispiele für die einzelnen Arbeitsschritte?<br />
Ausführung <strong>und</strong> Funktionalität der Lernsteuerung<br />
Qualität der Rückmeldungen auf Benutzereingaben<br />
Erfolgt eine angemessene Eingabenanalyse (Analysetiefe)?<br />
Macht die Rückmeldung den Fehler verständlich, gibt sie Hinweise zur Fehlerbehebung?<br />
Werden für den Kontext irrelevante Eingaben ignoriert oder selbsttätig korrigiert?<br />
(Fehlertoleranz)<br />
Lernstandsinformationen<br />
Bekommt der Lerner Informationen über seinen aktuellen Lernstand?<br />
Sind diese Angaben f<strong>und</strong>iert (werden tatsächlich Lernstandsinformationen gegeben oder nur<br />
Punkte gesammelt)?<br />
Eröffnen unterschiedliche Leistungen auch unterschiedliche Lernwege?<br />
Gibt es Lernzielkontrollen?<br />
Grad der Lernersteuerung bzw. Lernerautonomie<br />
Ist die Ablaufgeschwindigkeit beeinflussbar?<br />
Ist die Auswahl <strong>und</strong> Reihenfolge der Arbeitsschritte bestimmbar?<br />
Lassen sich Umfang <strong>und</strong> Schwierigkeitsgrad von Aufgaben einstellen?<br />
Kann die Lernzeit bestimmt werden (Lerndauer, Unterbrechung, Wiederaufnahme, Speichern<br />
von Zwischenständen)?<br />
Ausgestaltung innovativer Interaktionen<br />
Lerntheorie<br />
Wird explizit eine bestimmte Lerntheorie zugr<strong>und</strong>e gelegt oder wird ein eklektizistisches,<br />
indifferentes Vorgehen bevorzugt ?<br />
Stimmen lerntheoretischer Ansatz <strong>und</strong> Interaktionsformen überein?<br />
Wird handlungsorientiertes Lernen unterstützt?<br />
Lerneraktivierung<br />
Sind die erwarteten Lernerreaktionen vielfältig?<br />
Werden Lernkanäle sinnvoll aktiviert (visuell, auditiv, haptisch, motorisch)?<br />
Gibt es Anregungen zur Entwicklung von Sozialkompetenz?<br />
Wird eine allgemeine Methodenkompetenz vermittelt (z.B. das Lernen lernen)?<br />
Lernverfahren<br />
präferierte Lernorganisation (Einzel-, Gruppenlernen, Frontalunterweisung)<br />
präferierte Lernmethoden (explorativ/rezeptiv, selbstgesteuert/fremdgesteuert, linear/sequentiell)<br />
präferierte Sozialformen (Einzel-, Partner-, Gruppen-, Plenumsarbeit)<br />
Sind Präferenzen begründet begründbar?<br />
Individuelle Lernweggestaltung<br />
Gibt es Speichermöglichkeiten zum Festhalten individueller Lernwege (Lesezeichen,<br />
Gedächtnis)?<br />
Können Zwischenergebnisse gespeichert werden?
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 117<br />
Sind Wechsel zwischen Arbeits- <strong>und</strong> Erholungsphasen vorgesehen?<br />
Adaptivität:<br />
Aufbereitung der Lerninhalte unter Berücksichtigung der Lernbedingungen <strong>und</strong> der<br />
Lernwege<br />
Auswahl <strong>und</strong> Aufbereitung der Inhalte<br />
Auswahl des Wissenssegments (Basiswissen, Schlüsselqualifikationen)<br />
Relevanz der Lerngegenstände <strong>und</strong> der daran geknüpften Lernziele<br />
Korrektheit der Informationen, sachadäquate Darstellung des Themas<br />
exemplarischer Gehalt<br />
Perspektiven für den Benutzer im Hinblick auf die Bewältigung gegenwärtiger oder zukünftiger<br />
Situationen oder Problemen<br />
Stellenwert in der fachwissenschaftlichen Diskussion<br />
(neu, progressiv, anerkannt, konservativ, überholt)<br />
fachspezifisch /interdisziplinär<br />
Ist die Software spezifisch für eine Lernsituation oder polyvalent in verschiedenen einsetzbar?<br />
Werden unterschiedliche Zugangsweisen zur Thematik angeboten?<br />
Konzeption<br />
Werden die didaktischen <strong>und</strong> fachlichen Gr<strong>und</strong>positionen, die Lernziele beschrieben?<br />
Sind Angaben zu Zielgruppe <strong>und</strong> Einsatzbreite vorhanden, falls ja, zutreffend?<br />
Sind qualifizierte Vorschläge zur Lernwegsgestaltung vorhanden?<br />
Innovationsgehalt<br />
Ist das Thema oder die Art seiner Realisation neuartig?<br />
Existieren fachliche Vorteile gegenüber anderen Darstellungsverfahren?<br />
Anpassungen an die Lernfaktoren<br />
Vorkenntnisse <strong>und</strong> Lernziele<br />
Welche inhaltlichen <strong>und</strong> methodischen Vorkenntnisse werden beim Lerner angenommen? Sind<br />
diese Annahmen begründet?<br />
Gibt es eine Inhaltsübersicht, einen bequemen Weg zur Information über das Leistungsspektrum<br />
der Software?<br />
Lernzieldimensionen (kognitiv, affektiv, motorisch)?<br />
Sind die Lernziele sinnvoll gewählt, erreichbar?<br />
Ermöglicht die Software originale Begegnungen oder stellt sie Bezüge zu originalen Erfahrungen<br />
der Lerner her?<br />
Motivationsfunktionen<br />
Motiviert die Software die Lernenden zur Auseinandersetzung mit den Inhalten?<br />
Besteht qualitativ <strong>und</strong> quantitativ ein ausgewogenes Verhältnis zwischen spielerischen <strong>und</strong><br />
fordernden Programmelementen?<br />
Motiviert die Software zur (kreativen, produktiven) Weiterarbeit nach der Beendigung einer<br />
Arbeitsphase?<br />
Werden den Lernenden positive Identifikationsmöglichkeiten geboten (Einsatz fiktiver<br />
Charaktere, rollengerechte Besetzung von Sprechern, Schauspielern, Zeichenfiguren)?
118<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
äußere Lernbedingungen<br />
Für welchen Lernort ist das Produkt gedacht (zu Hause, am Arbeitsplatz, in<br />
Fortbildungseinrichtungen, in der Schule, im Fachunterricht, an anderen Orten) <strong>und</strong> wird es<br />
dieser Bestimmung gerecht?<br />
kultureller Kontext<br />
Wird der allgemein kulturelle Lebenshintergr<strong>und</strong> der Zielgruppe berücksichtigt?<br />
Wird eine ausländische Produktion adaptiert?<br />
Anpassungsfähigkeit an die Veränderungen des Lernverhaltens<br />
Flexibilität<br />
Werden verschieden Vermittlungs- <strong>und</strong> Kommunikationsformen angeboten?<br />
Stehen unterschiedliche Lernwege zur Verfügung?<br />
Werden Hinweise zur weiteren Lernweggestaltung abhängig von der Lernperformanz gegeben?<br />
Werden unterschiedliche Leistungsniveaus (temporär, individuell) berücksichtigt?<br />
Sind Programmteile frei zugänglich oder ist eine feste Reihenfolge vorgesehen?<br />
Abgeschlossenheit / Offenheit<br />
Wird ein Thema vollständig, sinnvoll portioniert vorgestellt?<br />
Sind Schnittstellen zu Ergänzungen oder Weiterführungen vorgesehen?<br />
Medialität:<br />
Technische <strong>und</strong> ästhetische Umsetzung des Konzepts<br />
Softwaredesign -stabilität <strong>und</strong> -konsistenz<br />
Hardware <strong>und</strong> Installation<br />
Werden die Herstellerangaben zur notwendigen Hardwarekonfiguration eingehalten?<br />
Ist das Programm bei der angegebenen Minimalkonfiguration voll leistungsfähig?<br />
Ist eine Deinstallation verfügbar?<br />
Werden Konfigurationsdateien automatisch verändert, Systemdateien überschrieben?<br />
Verläuft die Installation so, wie im Begleitmaterial beschrieben?<br />
Handbuch <strong>und</strong> Begleitmaterial<br />
Sind Informationen zur Technik, Programmbedienung <strong>und</strong> Didaktik vorhanden?<br />
Richten sich diese Informationen inhaltlich <strong>und</strong> sprachlich an die jeweils passende<br />
Personengruppe?<br />
Sind die Beschreibungen ausführlich genug oder zu ausführlich/detailliert?<br />
Existieren Unterstützungs- <strong>und</strong> Beratungsangebote?<br />
Gibt es Hinweise zur Art <strong>und</strong> Vermeidung typischer Benutzerfehler?<br />
Gibt es Hinweise auf Programmlauffehler, auf Hard- oder Softwarekonflikte?<br />
Benutzeroberfläche<br />
Sind Steuerelemente der Oberfläche <strong>und</strong>/oder Menüs einfach <strong>und</strong> eindeutig?<br />
Wie hoch ist der Einarbeitungsaufwand im Vergleich zum Nutzen?<br />
Ist ein intuitiver Zugang möglich?<br />
Sind unterschiedliche Zugangsweisen zu Funktionen vorgesehen (Icons Steuerelemente,<br />
Menüeinträge, Tastenkombinationen / Mausklicks)?<br />
Werden die Standards zur Funktionalität der Oberflächenelemente eingehalten?<br />
Entspricht die Oberflächengestaltung lern- <strong>und</strong> wahrnehmungspsychologischen Gr<strong>und</strong>sätzen?
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 119<br />
Zugänglichkeit der Hilfsfunktionen<br />
kontextsensitiv, Fl-Taste, online, direkt, menügesteuert?<br />
Sind Texte bildschirmgerecht gestaltet (Schrifttypen, Farben, Hervorhebungen)?<br />
Ästhetik<br />
Spricht die Gestaltung der Oberfläche die Zielgruppe ästhetisch an?<br />
Komplementiert die ästhetische Ausgestaltung des Programms eine Funktionen?<br />
Funktionalität der Softwaregestaltung<br />
Variabilität der Darbietung der Informationen <strong>und</strong> Aufgaben<br />
Multimediaqualität - textlich, symbolisch, visuell (Graphiken, Stand- <strong>und</strong> Bewegtbilder), auditiv<br />
(Sprache, Geräusche, Töne)?<br />
Werden die vorhandenen technischen Möglichkeiten didaktisch hinreichend genutzt?<br />
Ist der Medieneinsatz (Texte, Sprache Geräusche, Musik, Graphiken, Fotografien, Animationen,<br />
Videoclips) funktional, motiviert, sinnvoll?<br />
Entsprechen die eingesetzten Medien technischen Standards?<br />
Programmtypen <strong>und</strong> Elemente<br />
Übung/Spiel, Tutor/Trainer, Simulation, Lexikon<br />
Hypersystem, anderer Typus<br />
Ist die Entscheidung für einen Programmtyp begründet, nachvollziehbar, offensichtlich?<br />
Welche Funktionen übernehmen einzelne Programmteile (Übungen, Aufgaben, Spiele) für das<br />
gesamte Programm?<br />
Verhältnis von Aufwand <strong>und</strong> Nutzen<br />
Ist der Lerngegenstand (nur) mit softwaretechnischen Mitteln angemessen darzustellen?<br />
Ist der Lerngegenstand mit softwaretechnischen Mitteln besser darzustellen als mit anderen<br />
Mitteln?<br />
Wird durch die Anwendung ein Mehrwert gegenüber anderen Medien erreicht?<br />
Leistungsmerkmale<br />
Verhältnis zwischen Programmiergröße <strong>und</strong> Programmleistungsfähigkeit?<br />
Sind die Antwortzeiten des Systems (bei Minimalkonfiguration) akzeptabel?<br />
Sind Ton- <strong>und</strong> Bilddokumente qualitativ ansprechend bei vertretbaren Systemanforderungen?<br />
Offenheit der Software: Lässt das Programm die Nutzung externer Software zu oder werden<br />
gängige Softwarekomponenten dupliziert (z.B. Textverarbeitung, Rechner, Druckersteuerung?<br />
Nutzungsaufwand <strong>und</strong> Kosten<br />
Werden die technischen Anforderung an die Lernumgebung durch die Leistung der Software<br />
gerechtfertigt?<br />
Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis?
120<br />
10.2 Die SODIS-Datenbank<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Am Landesinstitut für Schule <strong>und</strong> Weiterbildung in Soest wurde seit 1988 zunächst in einem<br />
dreijährigen Modellversuch ein für alle B<strong>und</strong>esländer nutzbares „Software Dokumentations- <strong>und</strong><br />
<strong>Informations</strong>system“ aufgebaut. Diese Datenbank wird seit der Beendigung des Modellversuches<br />
fortgeführt. Neben allen B<strong>und</strong>esländern ist mittlerweile auch Österreich an dem Projekt beteiligt.<br />
Die SODIS-Daten werden zweimal jährlich auf einer CD-Rom publiziert. Außerdem kann im<br />
Internet unter der URL www.sodis.de in der Datenbank recherchiert werden.<br />
Basisdaten<br />
Die SODIS-Datenbank enthält zu jedem erfassten Produkt folgende Basisinformationen:<br />
• Produktname, Version<br />
• Autoren, Erscheinungsjahr<br />
• Lieferumfang, Sek<strong>und</strong>ärmaterialien, Land der Entwicklung, ISBN, Nutzungsbedingungen,<br />
Dialogsprache, Betriebssystem, Systemvoraussetzungen,<br />
• Art des Produktes, Sachgebiete <strong>und</strong> Fächer, Themen <strong>und</strong> Themenbereiche<br />
• Adressaten<br />
• Kurzbeschreibung<br />
• Bezugsquellen<br />
Erfahrungsberichte<br />
Zusätzlich werden Bewertungen erfasst, die medientechnische, fachliche, fachdidaktische <strong>und</strong><br />
mediendidaktische Aspekte berücksichtigen sollen. Die Bewertungen werden von Lehrerinnen <strong>und</strong><br />
Lehrern erfasst, die Erfahrungen mit dem Produkt im Unterricht gemacht haben.<br />
„Beispielhafte Medien für den Unterricht“<br />
Mit diesem Prädikat werden Produkte ausgezeichnet, mit denen sich gegenüber herkömmlichen<br />
Medien Unterrichtsinhalte schneller lernen, besser veranschaulichen oder vertiefte Erkenntnisse<br />
gewinnen lassen. Das können auch Medien sein, die neue, sinnvolle Untersuchungsmethoden<br />
ermöglichen oder neue pädagogisch bedeutungsvolle Ziele erreichbar werden lassen, die bisher<br />
nicht oder kaum erreichbar waren. Darüber hinaus wird an diese neuen Medien die Anforderung<br />
gestellt, dass sie konstruktives, kommunikatives, selbstbestimmtes <strong>und</strong> eigenverantwortliches<br />
Lernen unterstützen.<br />
Landesinstitut für Schule <strong>und</strong> Weiterbildung (LSW) - SODIS -<br />
Paradieser Weg 64 D-59494 Soest<br />
Tel. (0 29 21) 6 83-2 00 Fax (0 29 21) 6 83-3 93<br />
E-Mail: sodis@mail.lsw.nrw.de<br />
Internet-Adresse: www.sodis.de
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 121<br />
11 Glossar zur Computerfachsprache<br />
Arbeitsspeicher<br />
So heißt das „Kurzzeitgedächtnis“ des Computers,<br />
kurz auch „RAM“ genannt. Die Größe<br />
des Arbeitsspeichers wird in Megabyte (MB)<br />
angegeben. Heute übliche Computer besitzen<br />
mindestens 32 MB Arbeitsspeicher.<br />
Auflösung<br />
Sie gibt an, wie viele Punkte (dots) auf einer<br />
Fläche dargestellt oder erfasst werden können.<br />
Je höher die Auflösung, desto genauer<br />
die Darstellung.<br />
Betriebssystem<br />
Es beinhaltet die zentralen Programme eines<br />
Computers. Es kümmert sich um die Ein- <strong>und</strong><br />
Ausgabe sämtlicher Daten auf Disketten,<br />
Festplatten, Drucker <strong>und</strong> andere Geräte.<br />
Bekannte Betriebssysteme sind MS-DOS<br />
oder Windows 95, 98 <strong>und</strong> NT.<br />
Bildschirmschoner<br />
Diese Programme wurden früher eingesetzt,<br />
um den Bildschirm vor Schäden zu bewahren.<br />
Heutzutage haben sie nur Unterhaltungswert.<br />
Bildschirmauflösung<br />
Sie gibt an, wie viele Punkte auf dem Bildschirm<br />
abgebildet werden können. Moderne<br />
Bildschirme können 640 Punkte horizontal<br />
<strong>und</strong> 480 Punkte vertikal (640x480), 800x600<br />
sowie 1024x768 Punkte, oftt auch mehr, anzeigen.<br />
Je höher die Bildschirmauflösung,<br />
desto genauer ist die Anzeige.<br />
Bit<br />
Die kleinste <strong>Informations</strong>einheit. Ein bit kann<br />
nur den Wert 0 oder 1 haben.<br />
Byte<br />
Ein Byte besteht als 8 bit. Da jedes bit den<br />
Wert 0 oder 1 haben kann, ergeben sich 256<br />
verschiedene Werte, die man mit 8 bit<br />
darstellen kann.<br />
KB Kilobyte 1.000 Byte<br />
MB Megabyte 1 Mio Byte<br />
GB Gigabyte 1.000 Mio Byte<br />
Bitmap<br />
Bitmap-Grafiken (Dateiendungen .bmp, .gif,<br />
.jpg, .tif) speichern ein Bild Punkt für Punkt.<br />
Die Genauigkeit hängt von der Auflösung ab.<br />
Eine Bitmap-Datei ist daher vergleichsweise<br />
groß.<br />
bps<br />
Die Übertragungsgeschwindigkeit von Modems<br />
<strong>und</strong> ISDN-Karten wird in bits per<br />
seconds (Bit pro Sek<strong>und</strong>e) angegeben. Ein<br />
hohe Geschwindigkeit verkürzt die Übertragungszeit.<br />
Bei ISDN werden maximal 64.000<br />
bps übertragen.<br />
Browser<br />
Der Browser ist ein Programm, das Internetseiten<br />
im Netz sucht <strong>und</strong> auf dem Bildschirm<br />
anzeigt. Diese Programme werden meist<br />
kostenlos angeboten. Die derzeit am häufigsten<br />
eingesetzten Browser sind der<br />
„Internet Explorer“ (Microsoft) <strong>und</strong> der<br />
„Communicator“ (Netscape).<br />
Cache<br />
Moderne Prozessoren arbeiten schneller, als<br />
die Daten vom Arbeitsspeicher geliefert oder<br />
die Ergebnisse abgespeichert werden können.<br />
Ein teurer, extrem schneller Speichertyp<br />
(SRAM) wird deshalb als Puffer (Cache)<br />
benutzt. Er speichert die zuletzt genutzten<br />
Daten, <strong>und</strong> kann sie sehr schnell wieder<br />
bereitstellen.<br />
CAD<br />
„Computer Aided Design“. Mit CAD-<br />
Programmen entstehen Zeichnungen am<br />
Bildschirm <strong>und</strong> nicht mehr wie früher am<br />
Zeichenbrett.<br />
CD-R<br />
Eine CD-R ist eine leere, einmal beschreibbare<br />
CD, die bis zu 650 Megabyte Daten<br />
speichern kann <strong>und</strong> sich mit jedem CD-ROM-<br />
Laufwerk lesen lässt.<br />
CD-Recorder<br />
CD-Recorder sind Geräte, die Programme<br />
oder andere Daten auf eine CD-R übertragen<br />
können. Sie werden auch als „CD-Brenner“<br />
bezeichnet. Gr<strong>und</strong>: Die Informationen werden<br />
mit Laserlicht auf dem Rohling „eingebrannt“:
122<br />
Chat<br />
Beim Chat kommunizieren Teilnehmer im<br />
Internet, indem sie per Tastatur ihre<br />
Mitteilungen eingeben. Die Beiträge aller<br />
Teilnehmer werden am Bildschirm angezeigt.<br />
Computer-Virus<br />
Ein Computer Virus ist ein kleines Programm,<br />
das den Computer „infizieren“ kann. Es gibt<br />
verschiedene Typen dieser „Krankheitserreger“.<br />
Sie löschen oder verschieben<br />
Daten, machen Dritten geheime Informationen<br />
zugänglich, verstopfen den Computer mit<br />
Datenmüll oder zerstören gar Teile des<br />
Computers. Mit Anti-Viren-Programmen können<br />
Computer-Viren ausfindig gemacht <strong>und</strong><br />
bekämpft werden.<br />
Datenbank<br />
Eine Datenbank ist eine Sammlung zusammenhängender<br />
Daten, etwa Adressen. Die<br />
Daten werden in Form elektronischer Karteikarten<br />
gespeichert.<br />
Desktop<br />
Der Desktop ist die Arbeitsoberfläche von<br />
Windows 95/98. Das Wort Desktop stammt<br />
aus dem Englischen <strong>und</strong> bedeutet „Schreibtisch-Oberfläche“.<br />
Auch auf dem Desktop<br />
können Dokumente, Programme, Ordner <strong>und</strong><br />
vieles mehr abgelegt werden können.<br />
digital<br />
Digitale Informationen werden als Bits<br />
gespeichert. Nur digitale Informationen können<br />
vom Computer verarbeitet werden.<br />
dpi<br />
Bei Druckern <strong>und</strong> Scannern wird die<br />
Auflösung in der englischen Maßeinheit „dots<br />
per inch“ (Bildpunkte pro Zoll, 1 Zoll=2,54 cm)<br />
angegeben. Bei 300 dpi werden auf einer<br />
Länge von 2,54 cm 300 Punkte abgetastet.<br />
DVD<br />
Die DVD ist ein Speichermedium, das so<br />
groß ist wie eine CD, aber sehr viel mehr<br />
Daten (bis zu 26 mal soviel) fasst.<br />
Editor<br />
Ein (Text-)Editor ist ein einfaches Schreibprogramm,<br />
mit dem sich Texte schreiben,<br />
aber meist nicht gestalten lassen. In<br />
Windows sind „Notpad“ <strong>und</strong> „Wordpad“ zwei<br />
Vertreter dieser Art. Textverarbeitungsprogramme<br />
sind strenggenommen auch nur<br />
Editoren, allerdings solche mit vielen eingebauten<br />
Zusatzfunktionen.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
E-Mail<br />
E-Mail ist die Kurzform von „Electronic Mail“<br />
Dieser englische Begriff heißt übersetzt<br />
„elektronische Post“. Diese Briefe oder Mitteilungen<br />
werden auf einem Computer geschrieben<br />
<strong>und</strong> über eine Daten- oder Telefonleitung<br />
an den Rechner des Empfängers<br />
geschickt. Die Übertragung dauert nur wenige<br />
Sek<strong>und</strong>en. Der Empfänger kann den<br />
Brief dann ebenfalls am Computer-Bildschirm<br />
lesen.<br />
Laserdrucker<br />
Ein Laserdrucker trägt mit Hilfe von Laserlicht<br />
sehr feines Pulver (Toner) auf die zu<br />
bedruckenden Stellen des Papiers auf, das<br />
dann mit Hitze fixiert wird. Laserdrucker können<br />
sehr genau drucken, sind aber teurer als<br />
Tintenstrahldrucker.<br />
Festplatte<br />
Im Festplattenlaufwerk auch Festplatte<br />
genannt, rotieren eine oder mehrere fest eingebaute<br />
Scheiben, auf denen Daten gespeichert<br />
werden. Sie ist das „Langzeitgedächtnis“<br />
des Computers. Inhalte bleiben<br />
auch nach dem Abschalten des Geräts<br />
erhalten.<br />
Hauptplatine<br />
Die Hauptplatine, auch „Motherboard“ genannt,<br />
beherbergt (neben vielen anderen<br />
Komponenten) den Prozessor, den Hauptspeicher<br />
<strong>und</strong> die Steckplätze für Erweiterungskarten.<br />
Außerdem sind dort die Anschlüsse<br />
für Diskettenlaufwerke, Festplatten,<br />
CD-ROM-Laufwerke, Drucker, Maus <strong>und</strong><br />
Tastatur untergebracht.<br />
Homepage<br />
Startseite jedes <strong>Informations</strong>angebots im<br />
weltweiten Datennetz. Sie bietet meist einen<br />
Überblick über das <strong>Informations</strong>angebot sowie<br />
Informationen zum Anbieter.<br />
HTML<br />
HTML (HyperTextMarkupLanguage) ist die<br />
Befehlssprache, mit der Internetseiten erstellt<br />
werden können. Der Browser versteht diese<br />
Befehle <strong>und</strong> kann die Seite richtig darstellen.<br />
Hyperlink<br />
Ein Hyperlink (oder kurz Link) ist eine<br />
Verbindung eines Textteile oder einer Grafik<br />
mit einer anderen Internet-Seite. Beim Mausklick<br />
auf den Hyperlink wird die verknüpfte<br />
Seite gesucht <strong>und</strong> am Bildschirm angezeigt.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik 123<br />
Icons<br />
So nennt man die Symbole, die Sie<br />
beispielsweise auf Ihrer Arbeitsoberfläche<br />
oder in Ordnern sehen. Klicken sie darauf,<br />
öffnet sich das entsprechende Programm <strong>und</strong><br />
zeigt Ihnen die Daten.<br />
Installation<br />
Bei der Installation eines Programms werden<br />
alle benötigten Dateien von Diskette oder<br />
CD-ROM auf die Festplatte kopiert. Während<br />
dieses Vorgangs können Sie viele Programmeinstellungen<br />
wählen oder auf den<br />
richtigen Wert bringen. Die Installation läuft<br />
bei neuen Programmen meist vollautomatisch<br />
ab.<br />
Internet<br />
Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von<br />
Tausenden von Computern, die über Telefon<strong>und</strong><br />
Datenleitungen Informationen austauschen.<br />
Intranet<br />
Ein Intranet ist ein begrenztes „Internet“, das<br />
technisch so funktioniert, wie das Internet.<br />
Innerhalb einer Schule kann ein Intranet mit<br />
WWW, E-Mail <strong>und</strong> Chat eingerichtet werden.<br />
ISDN<br />
ISDN ist ein Datennetz (der Deutschen<br />
Telekom) zur Übertagung von Sprache <strong>und</strong><br />
anderen Daten, die als digitale Informationen<br />
vorliegen müssen.<br />
ISDN-Karte<br />
Bauteil, das den Computer mit dem ISDN-<br />
Netz verbindet, um Daten über das ISDN-<br />
Netz übertragen zu können. Eine ISDN-Karte<br />
benötigt man, um mit einem ISDN-Anschluss<br />
über einen Provider ins Internet zu gelangen.<br />
TCP/IP<br />
TCP/IP sind Protokolle (Vereinbarungen, Vorschriften),<br />
die die Datenübertagung im Internet<br />
regeln. TCP regelt den Tarnsport der Daten<br />
<strong>und</strong> IP ist verantwortlich dafür, dass die<br />
Daten an der richtigen Adresse ankommen.<br />
Konvertieren<br />
Übertragen einer Datei in ein anderes<br />
Dateiformat, besonders wichtig bei Grafikdateien.<br />
Makro<br />
Makros sind gespeicherte Befehlsfolgen.<br />
Damit lassen sich häufiger verwendete<br />
Befehlskombinationen einfach per Mausklick<br />
wiederholen. Viele Programme, besonders<br />
die Textverarbeitungen, erlauben dem Benutzer<br />
das Aufzeichnen dieser Befehlsfolgen.<br />
Megahertz<br />
Hertz ist die Maßeinheit für die Frequenz,<br />
also die Häufigkeit eines Ereignisses pro<br />
Sek<strong>und</strong>e. Ein Megaherz entspricht also einer<br />
Million Wiederholungen pro Sek<strong>und</strong>e. Die<br />
Frequenz ist u.a. ein wichtiges Leistungsmerkmal<br />
des Prozessors.<br />
Menü<br />
Ein Menü ist eine Liste mit verschiedenen<br />
Auswahloptionen. Es spart Platz <strong>und</strong> ist<br />
daher Bestandteil vieler Dialogfelder von<br />
Programmen. Die Liste klappt auf, wenn Sie<br />
auf einen der Einträge klicken (Pulldown-<br />
Menü).<br />
Modem<br />
Ein Modem wird benötigt um Daten über<br />
einen analogen Telefonanschluss (T-Net) per<br />
Telefonleitung zu übertragen (z.B. um ins<br />
Internet zu gelangen).<br />
MP3<br />
Bei diesem Verfahren werden Tondateien<br />
stark verkleinert, da dass sie sehr wenig<br />
Speicherplatz benötigen. Der Klang ist nur<br />
wenig schlechter als der einer CD. Für die<br />
Tonausgabe ist allerdings ein spezielles<br />
Gerät oder Programm nötig.<br />
Netzwerk<br />
Bei einem Netzwerk sind mehrere Computer<br />
durch spezielle Kabel <strong>und</strong> Einsteckkarten<br />
miteinander verb<strong>und</strong>en. Erforderlich ist wieterhin<br />
eine besondere Software. In einem<br />
Netzwerk können Geräte, beispielsweise<br />
Drucker, von allen angeschlossenen Rechner<br />
genutzt werden.<br />
offline/online<br />
Wenn ihr Computer nicht mit einem<br />
Datennetz verb<strong>und</strong>en ist, ist er offline – das<br />
heißt „nicht an der Leitung“. Besteht eine<br />
Verbindung (z.B. zum Internet), arbeitet der<br />
Computer online.<br />
Online-Dienst<br />
Die gängigsten Online-Dienste in Deutschland<br />
sind T-Online, AOL <strong>und</strong> Compuserve.<br />
Neben dem Zugang ins Internet bieten diese<br />
noch zusätzliche Dienste <strong>und</strong> Informationen<br />
an.
124<br />
Passwort<br />
Ein Passwort ist eine Zugangsberechtigung<br />
für den Computer. Nach dem Einschalten des<br />
Rechners oder dem Starten eines Programms<br />
erscheint ein Eingabefeld, das nach<br />
dem Passwort fragt. Erst wenn Sie das<br />
richtige Wort eingegeben haben, kommen<br />
Sie an gespeicherte Daten heran.<br />
Pentium<br />
Der Prozessor-Typ des Herstellers Intel<br />
arbeitet in den meisten derzeit verkauften<br />
Computern. Der neueste, Pentium III genannt,<br />
wird mit Taktfrequenzen bis zu 550<br />
Megahertz geliefert.<br />
Plug and Play<br />
Diese Technik (auf Deutsch: „Einstöpseln<br />
<strong>und</strong> Loslegen“) sollte das Ausrüsten des<br />
Computers mit Zusatzkarten stark vereinfachen.<br />
Das automatische Einstellen der Karte<br />
funktioniert, sofern sich alle Hersteller an<br />
vereinbarte Regeln halten.<br />
Prozessor<br />
Der Prozessor ist die zentrale Recheneinheit,<br />
der „Motor“ des Computers. Er ist zuständig<br />
für alle Berechnungen. Bekannte Prozessoren<br />
sind die Pentium-Modelle der Firma<br />
Intel <strong>und</strong> der K6-III von AMD.<br />
Scanner<br />
Der Scanner tastet, ähnlich wie ein Kopierer,<br />
ein Bild Punkt für Punkt ab. Er überträgt die<br />
so erfassten Daten in eine für den Computer<br />
verständliche Form. Im Computer werden die<br />
Informationen als Bilddatei gespeichert <strong>und</strong><br />
weiter verarbeitet.<br />
Shareware<br />
Als Shareware werden Programme bezeichnet,<br />
die vor dem Kauf erst einmal in einer<br />
Testversion ausprobiert werden können. Falls<br />
das Programm nach der Testphase weiter<br />
genutzt wird, muss eine Lizenzgebühr an den<br />
Hersteller gezahlt werden.<br />
So<strong>und</strong>karte<br />
Die So<strong>und</strong>karte ist eine Einsteckkarte, mit der<br />
der Computer Töne aufnehmen <strong>und</strong> wiedergeben<br />
kann.<br />
Suchmaschine<br />
Suchmaschinen sind spezielle Programme im<br />
weltweiten Datennetz, die zu einem Suchbegriff<br />
Internetseiten suchen.<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Treiber<br />
Programm, das erforderlich ist, damit ein<br />
Bauteil (Grafikkarte, Drucker, ISDN-Karte)<br />
richtig mit dem Computer zusammenarbeitet.<br />
Updates<br />
Updates sind neue Programmversionen, die<br />
Besitzern der Lizenz der alten Version zu<br />
einem günstigeren Preis angeboten werden.<br />
URL<br />
Uniform Ressource Locator: Die Adresse<br />
einer Seite im Internet.<br />
USB<br />
Der „universelle serielle Bus“ (USB) ist ein<br />
neuer Anschluss für den Computer. Alle<br />
Geräte verwenden dabei dieselbe Stecker-Art<br />
<strong>und</strong> der Computer erkennt angeschlossene<br />
Zusatzgeräte mit USB-Anschluss automatisch.<br />
Verzeichnis<br />
Die Daten auf der Festplatte können ähnlich<br />
den Kapiteln eines Buchs geordnet werden.<br />
Diese Kapitel heißen „Verzeichnisse“ oder<br />
„Ordner“. In einem Verzeichnis können<br />
Unterverzeichnisse erstellt werden.<br />
Windows Explorer<br />
Der Windows Explorer ist die „Verwaltungszentrale“<br />
von Windows-Betriebssystemen.<br />
Hier wird der Inhalt der Laufwerke (Verzeichnisse,<br />
Dateien) angezeigt. Dokumente<br />
können gelöscht, kopiert, verschoben oder<br />
umbenannt werden.<br />
WWW<br />
Das WorldWideWeb ist der Teil des Internet,<br />
in dem die Internetseiten (WWW-Seiten) angeboten<br />
<strong>und</strong> übertragen werden.<br />
40fach<br />
Maß für die Lesegeschwidigkeit von CD-<br />
Rom-Laufwerken. Die ersten CD-Rom-<br />
Laufwerke übertrugen 150 Kilobyte Daten pro<br />
Sek<strong>und</strong>e. Heute sind die Geräte schneller.<br />
Ein 40fach-Laufwerk überträgt also bis zu<br />
6.000 Kilobyte pro Sek<strong>und</strong>e.<br />
@<br />
Das AT-Zeichen ist Teil jeder E-Mail-<br />
Adresse. Vor dem @ steht die Bezeichnung<br />
für das Postfach <strong>und</strong> nach dem @ steht die<br />
Internetadresse des Computers (Servers),<br />
auf dem sich das Postfach befindet. Eingeben:<br />
Bei gedrückter Alt Gr-Taste die Q-<br />
Taste drücken.
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
12 Literatur<br />
Ballin D., Brater M.,<br />
Handlungsorientiert lernen mit Multimedia –<br />
Lernarrangements planen, entwickeln <strong>und</strong> einsetzen<br />
Nürnberg 1996<br />
Bertelsmann Stiftung<br />
Computer, Internet, Multimedia – Potenziale für Schule <strong>und</strong> Unterricht<br />
Gütersloh 1998<br />
Bertelsmann Stiftung/Heinz Nixdorf Stiftung (Hrsg.)<br />
<strong>Neue</strong> Medien in den Schulen<br />
Projekte – Konzepte – Kompetenzen - Bestandsaufnahme<br />
Gütersloh 1996<br />
Breiter, A./ Kubicek H.<br />
<strong>Informations</strong>-Technologie-Planer für Schulen<br />
Leitfaden für allgemeine Schulen zur Planung, Kostenschätzung <strong>und</strong> Finanzierung der Medienintegration<br />
Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 1999<br />
Brinkmöller-Becker H.<br />
Die F<strong>und</strong>grube für Medienerziehung in der Sek<strong>und</strong>arstufe I <strong>und</strong> II<br />
Berlin 1997<br />
B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung (Hrsg.)<br />
Computerspiele – Bunte Welt im grauen Alltag<br />
Bonn 1993<br />
Erlinger H.D.<br />
<strong>Neue</strong> Medien, Edutainment, Medienkompetenz – Deutschunterricht im Wandel<br />
München 1997<br />
Fasching, Th.<br />
Internet <strong>und</strong> Pädagogik<br />
München 1997<br />
Fritz, J.<br />
Warum Computerspiele faszinieren<br />
Empirische Annäherung an Nutzung <strong>und</strong> Wirkung von Bildschirmspielen<br />
Weinheim 1995<br />
Fritz, J./ Fehr, W.<br />
Handbuch Medien: Computerspiele<br />
B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung, Bonn 1997<br />
Gralla P.<br />
So funktioniert das Internet<br />
Ein visueller Streifzug durch das Internet<br />
München 1996<br />
Gretsch, U./Lisner, B.<br />
Elternratgeber Computer<br />
Chancen <strong>und</strong> Risiken für die kindliche Entwicklung<br />
Hamburg 1995<br />
125
126<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Huber F.<br />
Computer für Hauptschulen<br />
München 1998<br />
Hugo, F.<br />
Computer in der Schule<br />
Baltmannsweiler 1998<br />
Issing L.J., Klimsa P.<br />
Infomation <strong>und</strong> Lernen mit Multimedia<br />
Weinheim 1995<br />
Jecht H., Sausel St.<br />
Unterrichtsprojekte mit dem Internet<br />
Darmstadt 1998<br />
Landesinstitut für Schule <strong>und</strong> Weiterbildung (Hrsg.)<br />
Anregungen für Computerkurse in der Weiterbildung<br />
Soest 1995<br />
Landesinstitut für Schule <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Gestaltung von Hypermedia-Arbeitsumgebungen<br />
Soest 1994<br />
Landesinstitut für Schule <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Gestaltung von Hypermedia-Arbeitsumgebungen<br />
Soest 1994<br />
Landesinstitut für Schule <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
Lernen mit <strong>Neue</strong>n Medien in der Gr<strong>und</strong>schule<br />
Soest 1997<br />
Landesinstitut Schleswig-Holstein<br />
<strong>Informations</strong>technische Gr<strong>und</strong>bildung<br />
Band 8, Kronshagen 1994<br />
Landesinstitut Schleswig-Holstein<br />
<strong>Informations</strong>technische Gr<strong>und</strong>bildung<br />
Band 9, Kronshagen 1994<br />
Lauer T.<br />
Internet – alles zum Internet<br />
Zugang, Einsatz, Hilfsprogramme, <strong>Informations</strong>quellen<br />
München 1998<br />
Maier R., Mikat C., Zeitter E.,<br />
Medienerziehung in Kindergarten <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schule<br />
München 1997<br />
Pädagogisches Zentrum Bad Kreuznach (Hrsg.)<br />
Der Computer in der Lebenswelt von Schülern - Ergebnisse einer Befragung<br />
Bad Kreuznach 1998<br />
Pädagogisches Zentrum Bad Kreuznach (Hrsg.)<br />
Erprobung eines Spracherkennungssystems in der Sonderpädagogik – ESSo –<br />
Zwischenbericht zu einem gemeinsamen Modellversuch der B<strong>und</strong>esländer Rheinland-Pfalz <strong>und</strong><br />
Mecklenburg-Vorpommern<br />
Bad Kreuznach 1997<br />
Ritter M.<br />
Computer <strong>und</strong> handlungsorientierter Unterricht<br />
Donauwörth 1995
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Röder R.<br />
Der Computer als Didaktisches Medium<br />
Über die Mythen des Mediums <strong>und</strong> das Lernen von Subjekten<br />
Bodenheim 1998<br />
Sander W., Hülshorster Ch., Klimek A.<br />
Wahlanalyse <strong>und</strong> Wahlprognose im Unterricht<br />
Bonn 1998<br />
Schieb J.<br />
Internet – Nichts leichter als das<br />
Berlin 1997<br />
Schnorr W., Langenbach J., Mattern K., Daum W.<br />
Medienprojekt für die Gr<strong>und</strong>schule<br />
Wie Kinder technische Bilder „erzeugen“ <strong>und</strong> „lesen“ lernen<br />
Braunschweig 1993<br />
Staatsinstitut für Schulpädagogik <strong>und</strong> Bildungforschung München<br />
Computer in der Schule zur individuellen Lebensbewältigung<br />
Donauwörth 1995<br />
Schorb, B.<br />
Medienalltag <strong>und</strong> Handeln<br />
Medienpädagogik in Geschichte, Forschung <strong>und</strong> Praxis<br />
Opladen 1995<br />
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder(Hrsg.)<br />
Medienpädagogik in der Schule<br />
Erklärung der Kultusministerkonferenz vom 12.05.1995<br />
Bonn 1995<br />
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (Hrsg.)<br />
<strong>Neue</strong> Medien <strong>und</strong> Telekommunikation im Bildungswesen<br />
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.02.1997<br />
Bonn 1997<br />
Staatsinstitut für Schulpädagogik <strong>und</strong> Bildungsforschung München (Hrsg.)<br />
Computer in der Schule zur individuellen Lebensbewältigung<br />
Donauwörth 1995<br />
van Lück E.,<br />
Gestaltung von Hypermedia-Arbeitsumgebungen<br />
Landesinstitut für Schule <strong>und</strong> Weiterbildung, Soest 1994<br />
Literaturhinweise <strong>und</strong> Informationen auf CD-ROM<br />
Schönweis, F. (Hrsg.)<br />
Jugend & neue Medien<br />
Fakten, Meinungen, Demos, Projekte <strong>und</strong> Institutionen aus der praktischen Medienarbeit <strong>und</strong><br />
Medienpädagogik<br />
Nürnberg 1997<br />
B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung (Hrsg.)<br />
Medienpädagogik 1997- Text <strong>und</strong> Materialsammlung<br />
Bonn 1997<br />
B<strong>und</strong>eszentrale für politische Bildung (Hrsg.)<br />
Search & Play<br />
Interaktive Datenbank für Computerspiele<br />
Bonn 1995<br />
127
128<br />
13 Anbieter <strong>und</strong> Adressen<br />
Auer Verlag<br />
Postfach 1152, 86601 Donauwörth<br />
Tel. 0906-73240, Fax 0906-73177<br />
Internet: www.auer.de<br />
B+E Software GmbH<br />
Itterpark 5, 40724 Hilden<br />
Tel. 02103-96570<br />
bhv Verlags GmbH<br />
Novesiastr. 60, 41564 Kaarst<br />
Tel. 02131-76501, Fax 02131-765101<br />
Internet: www.bhv.de<br />
Budenberg Lernsoftware - K. Emmig<br />
GmbH<br />
An der Wielermaar 74, 51143 Köln<br />
Tel. 02203-85563, Fax 02203-88912<br />
CES-Verlag<br />
Kleinschmidtstr. 35, 69115 Heidelberg<br />
Tel. 06221-27989, Fax 06221-182030<br />
Comisoft<br />
Postfach 2344, 72713 Reutlingen<br />
Tel. 07121-271304, Fax 07121-271244<br />
Internet: phserv.fhreutlingen.de/html/fp_math.html<br />
Computer <strong>und</strong> Lernen<br />
Im Eichelgarten 49, 76530 Baden-Baden<br />
Tel. 07454-40284, Fax 07221-271041<br />
Cornelsen Software<br />
Postfach 330109, 14171 Berlin<br />
Tel. 030-89785 600, Fax 030-89785 599<br />
www.cornelsen.de<br />
CoTec GmbH<br />
Traberhofstr. 12, 83026 Rosenheim<br />
Tel. 08031-26350, Fax 08031-263529<br />
Internet: www.cotec.de<br />
CUC Software International<br />
Robert-Bosch-Str. 32, 63303 Dreieich<br />
Dürr <strong>und</strong> Kessler<br />
Haidplatz 2, 93047 Regensburg<br />
Tel. 0941-5689-0, Fax 0941-5689-99<br />
Internet www.wolfverlag.de<br />
Epitech GmbH<br />
Pivitstr. 13, 32120 Hiddenhausen<br />
Tel. 05223-87080, Fax 05223-87008<br />
ESB<br />
Kahrstr. 45, 41379 Brüggen<br />
Eugen Traeger Lernsoftware<br />
Hohe Esch 52, 49504 Lotte<br />
Tel. 05404-71858, Fax 05404-71858<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
EUROCOMP<br />
Metjendorfer Landstraße 19<br />
26215 Wiefelstede-Metjendorf<br />
Tel. 0441-9620005, Fax 0441-63080<br />
FWU<br />
Postfach 260, 82026 Grünwald<br />
Tel. 089-6497-1, Fax 089-6497-300<br />
Internet: www.fwu.de<br />
Georg Paulke<br />
Trajanstr. 5, 50678 Köln<br />
Tel. 0221-9321291, Fax 0221-9321292<br />
Hans Zybura<br />
Waldquellenweg 52, 33649 Bielefeld<br />
Tel. 0521-9457290, Internet: www.zarb.de<br />
HEUREKA Klett<br />
Postfach 106016, 70049 Stuttgart<br />
Tel. 0711-6672-1333, Fax 0711-6672-2080<br />
INCAP GmbH<br />
Blücherstr. 32, 75177 Pforzheim<br />
Tel. 07231-94630, Fax 07231-946350<br />
Internet: www.incap.de<br />
IN-Soft<br />
Königsberger Str. 39<br />
97941 Tauberbischofsheim<br />
Tel. 09341-897555, Fax 09341-897550<br />
Internet: www.in-soft-ware.com<br />
Intra-Tel<br />
Postfach 2262, 41309 Nettetal<br />
Tel. 02158-910060, Fax 02157-8973641<br />
Internet: www.intratel.de<br />
Knobloch electronic<br />
Weedgasse 14a, 55234 Erbes-Büdesheim<br />
Tel. 06731-44005, Fax 06731-44660<br />
Internet: www.knobloch-gmbh.de<br />
Konrad Theiss Verlag<br />
Mönchhaldenstr. 28, 70191 Stuttgart<br />
Tel. 0711-2552712, Fax 0711-2552717<br />
Internet: www.theiss.de<br />
Landesinstitut für Schule <strong>und</strong><br />
Weiterbildung<br />
Paradieser Weg 64<br />
59494 Soest<br />
(Materialienvertrieb über Verlag für Schule<br />
<strong>und</strong> Weiterbildung, s.u.)<br />
Logibyte<br />
Stromstr. 39, 10551 Berlin<br />
Tel. 030-39603600, Fax 030-3969695<br />
Internet: www.logibyte.de
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
Mach mit e.V.<br />
Trachenbergring 8, 12249 Berlin<br />
Tel. 030-6248696, Fax 030-6248694<br />
Internet: www.machmit-multimedia.de<br />
Medienwerkstatt Mühlacker<br />
Pappelweg 3, 75417 Mühlacker<br />
Tel. 07041 83343, Fax 07041 860768<br />
Internet: www.medienwerkstatt-online.de<br />
M3C Systemtec<br />
Großbeerenstr. 51, 10965 Berlin<br />
NAVIGO Multimedia<br />
Frankfurter Ring 213, 80807 München<br />
Tel. 089-32466200, Fax 089-32466204<br />
Otto Mantler<br />
Wiesstraße 13, A-6844 Altach<br />
Tel. 0043 5576-77085, Fax 0043 5576-77085<br />
Internet: www.lernspiele.at<br />
N-Soft<br />
Holdergasse 10, 89291 Holzheim<br />
Ravensburger<br />
Postfach 1860, 88188 Ravensburg<br />
Reha Media<br />
Bismarckstr. 142a, 47057 Duisburg<br />
Tel. 0203-3061950, Fax 0203-3061960<br />
REHADAT<br />
<strong>Informations</strong>system zur beruflichen<br />
Rehabilitation<br />
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Gustav-Heinemann-Ufer 84-88 50968 Köln<br />
Tel. 0221/37655-13, Fax 0221/37655-55<br />
Internet: www.rehadat.de<br />
Prisma Express<br />
Neumann-Reichardt-Str. 27, 22041 Hamburg<br />
Tel. 040-657340<br />
Internet: www.ecom-shop.de<br />
Rheinisches Landesmuseum<br />
Weimarer Allee 1, 54290 Trier<br />
Tel. 0651-97740, Fax 0651-9774222<br />
Schubi Lernmedien GmbH<br />
Zeppelinstr. 8, 78244 Gottmadingen<br />
Tel. 07731-97230, Fax 07731-972394<br />
Internet: www.schubi.de<br />
SMM-Software GmbH<br />
Hechtenkaute 5, 55257 Budenheim<br />
Tel. 06139-916916, Fax 06139-916111<br />
Softline GmbH<br />
Appenweirer Str. 45, 77704 Oberkirch<br />
Tel. 07802-924300, Fax 07802-924240<br />
Internet: www.softline.de<br />
SoWoSoft<br />
Große Oker 24, 38707 Altenau<br />
Tel. 05328-90615, Fax. 05328-90616<br />
Schroedel Verlag<br />
30517 Hannover<br />
Tel. 01805-213100, Fax 0511-8388280<br />
Internet: www.schroedel.de<br />
Software Brokers<br />
Postfach 250237, 55055 Mainz<br />
Tel. 06139-960433, Fax 06139-960433<br />
Internet: www.okinol.de/sbe<br />
Steckenborn<br />
Westanlage 56, 35390 Gießen<br />
Tel. 0641-130410, Fax 0641-73452<br />
Internet: www.steckenborn.de<br />
Technik-LPE<br />
Postfach 1121, 69401 Eberbach<br />
Tel. 06271-923410, Fax 06271-923420<br />
Internet: www.technik-lpe.com<br />
Uni Erlangen-Nürnberg<br />
Regensburger Str. 160, 90478 Nürnberg<br />
Tel. 0911-5302523, Fax 0911-4010212<br />
Ursula Fau<br />
Gebr.-Grimm-Str. 11, 32791 Lage<br />
Tel. 05232-3115, Fax 05232-68196<br />
Verlag Dieter Berger<br />
Erbprinzenstr. 16, 79098 Freiburg<br />
Tel. 0761-286900, Fax 0761-287276<br />
Verlag für Schule <strong>und</strong> Weiterbildung<br />
DruckVerlag Kettler GmbH<br />
Postfach 1150<br />
59193 Bönnen<br />
Verlag Modernes Leben<br />
Hohe Straße 39, 44139 Dortm<strong>und</strong><br />
Tel. 0231-128008, Fax 0231-125640<br />
Westermann<br />
G.-Westermann-Allee 66, 38104<br />
Braunschweig<br />
whc Musiksoftware<br />
An der Sörebahn 4, 34318 Söhrewald<br />
WILL Software<br />
Gr<strong>und</strong>bergweg 10, 35428 Cleeberg<br />
Tel. 06085-98119-0, Fax 06085-98119-3<br />
Internet: www.will-software.com<br />
129
130<br />
<strong>Neue</strong> <strong>Informations</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kommunikationstechnologien</strong> in der Sonderpädagogik<br />
14 <strong>Fachberater</strong> für Computer an Sonderschulen<br />
Manfred Behrendt<br />
Landskronschule<br />
Rheinstr. 43<br />
55276 Oppenheim<br />
Tel. (d) 06133-2931<br />
Fax (d) 06133-<br />
E-Mail MBehre1414@aol.com<br />
Harald Schmitt<br />
Stephanus-Schule<br />
Ackerstr. 2–4<br />
56751 Polch<br />
Tel. (d) 02654-6200<br />
Fax (d) 02654-961121<br />
E-Mail h.schmitt@t-online.de<br />
Franz Josef Schwaller<br />
Schule für Körperbehinderte<br />
Trevererstr. 42<br />
54295 Trier<br />
Tel.(d) 0651-32850<br />
Tel. (p) 06501-998173<br />
Fax (p) 06501-998169<br />
E-Mail schwaller@gmx.de<br />
Peter Weidemann<br />
Nardini-Schule<br />
Römerweg<br />
76726 Germersheim<br />
Tel.(d) 07274-3095<br />
Fax (d) 07274-3096<br />
E-Mail Peter.Weidemann@t-online.de<br />
Herbert Zimmermann<br />
Schiller-Schule<br />
56203 Höhr-Grenzhausen<br />
Rathausstr. 132<br />
Tel.(d) 02624-954415<br />
Fax (d) 02624-954420<br />
E-Mail Herbert-Zimmermann@t-online.de