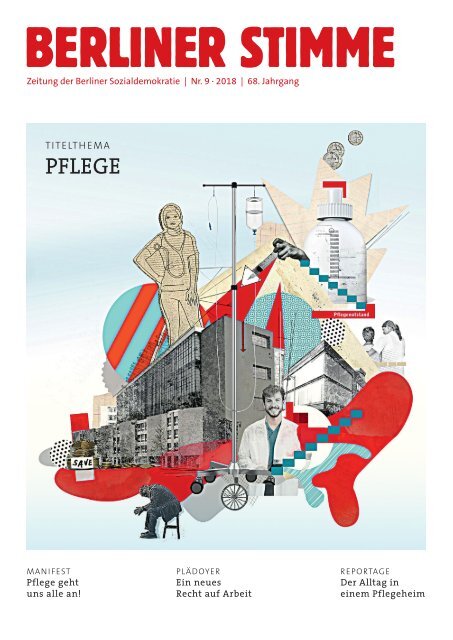Berliner Stimme Nr. 9 2018
Die Pflege steht vor enormen Herausforderungen und ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen einer solidarischen Gesellschaft. Die Berliner SPD hat in ihrem Entwurf für ein Pflege-Manifest zehn Punkte für eine gute Pflege aufgestellt. Gesundheits- und Pflegesenatorin Dilek Kolat stellt in dieser Ausgabe der Berliner Stimme die wichtigsten Kernpunkte vor. Im Interview erklärt der angehende Gesundheits- und Krankenpfleger Andre Kindler, welche Probleme derzeit Auszubildende im Care-Sektor haben und was sich ändern muss, damit junge Menschen sich wieder häufiger für diesen Beruf entscheiden. Das „Haus am Auwald“ in Marzahn ist eines von drei stationären Einrichtungen der Berliner Volkssolidarität. Die Herausforderungen der Einrichtung – ob Pflege-Leasing oder die strikte Einhaltung der Fachkräftequote – sind beispielhaft für die schwierige Pflegesituation in Deutschland. Außerdem im Heft: Rot-Rot-Grün wird im kommenden Jahr ein Pilotprojekt zum Solidarischen Grundeinkommen (SGE) starten – Michael Müller über das neue Recht auf Arbeit.
Die Pflege steht vor enormen Herausforderungen und ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen einer solidarischen Gesellschaft. Die Berliner SPD hat in ihrem Entwurf für ein Pflege-Manifest zehn Punkte für eine gute Pflege aufgestellt. Gesundheits- und Pflegesenatorin Dilek Kolat stellt in dieser Ausgabe der Berliner Stimme die wichtigsten Kernpunkte vor. Im Interview erklärt der angehende Gesundheits- und Krankenpfleger Andre Kindler, welche Probleme derzeit Auszubildende im Care-Sektor haben und was sich ändern muss, damit junge Menschen sich wieder häufiger für diesen Beruf entscheiden. Das „Haus am Auwald“ in Marzahn ist eines von drei stationären Einrichtungen der Berliner Volkssolidarität. Die Herausforderungen der Einrichtung
– ob Pflege-Leasing oder die strikte Einhaltung der Fachkräftequote – sind beispielhaft für die schwierige Pflegesituation in Deutschland. Außerdem im Heft: Rot-Rot-Grün wird im kommenden Jahr ein Pilotprojekt zum Solidarischen Grundeinkommen (SGE) starten – Michael Müller über das neue Recht auf Arbeit.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 9 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
TITELTHEMA<br />
PFLEGE<br />
MANIFEST<br />
Pflege geht<br />
uns alle an!<br />
PLÄDOYER<br />
Ein neues<br />
Recht auf Arbeit<br />
REPORTAGE<br />
Der Alltag in<br />
einem Pflegeheim
E<br />
D<br />
I<br />
T<br />
O<br />
R<br />
I<br />
A<br />
L<br />
2 BERLINER STIMME
Text Michael Müller<br />
Foto Carolin Weinkopf<br />
Zehn Punkte<br />
für eine gute Pflege<br />
Jeder kommt irgendwann in seinem<br />
Leben in die Situation, dass man sich<br />
um seine Angehörigen kümmern muss.<br />
Bei vielen sind es die Großeltern oder<br />
Eltern, manchmal sind es aber auch<br />
schon Kinder, die Pflege und Unterstützung<br />
benötigen. Viele von uns stehen<br />
dann vor großen Herausforderungen:<br />
Es mangelt an Zeit, an Geld – und immer<br />
häufiger auch an Fachkräften, die eine<br />
gute Pflege übernehmen können.<br />
Das müssen wir ändern!<br />
Die <strong>Berliner</strong> SPD hat in dem Entwurf<br />
für ein Pflege-Manifest zehn Punkte für<br />
eine gute Pflege aufgestellt. Unser<br />
Ansatz ist dabei klar: Die Bedingungen<br />
der Pflegerinnen und Pfleger müssen<br />
besser werden, die zu Pflegenden müssen<br />
ein Recht auf gute Pflege haben und die<br />
Angehörigen müssen sich auf unsere<br />
Unterstützung verlassen können.<br />
Bereits heute fehlen uns laut ver.di<br />
deutschlandweit 80.000 Pflegekräfte.<br />
Was müssen wir angesichts dieser alarmierenden<br />
Zahlen tun, um den Beruf<br />
des Pflegers oder der Pflegerin attraktiver<br />
zu machen? Es gilt zusammen mit<br />
den Gewerkschaften für bessere Arbeits-<br />
bedingungen, bessere Vergütung und<br />
eine gute Altersvorsorge der Pflegekräfte<br />
zu kämpfen.<br />
Aber auch die Angehörigen müssen<br />
wir massiv entlasten. Allein in Berlin<br />
kümmern sich 200.000 Menschen um<br />
die Pflege ihrer Angehörigen. Häufig<br />
unter widrigen Umständen. Die soziale<br />
Pflegeversicherung deckt als Teilversicherung<br />
nicht alle Kosten ab. Pflege<br />
wird so für viele zur finanziellen Not.<br />
Wir fordern eine Pflegevollversicherung,<br />
damit gute Pflege nicht vom Geldbeutel<br />
abhängt.<br />
Niemand sollte in einem Pflegefall<br />
auf sich allein gestellt ein. Mit unserem<br />
Manifest wollen wir einen radikalen<br />
Neuanfang in der Pflege, denn sie geht<br />
uns alle an.<br />
Herzlich<br />
Euer<br />
E<br />
D<br />
I<br />
T<br />
O<br />
R<br />
I<br />
A<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
3
TITELTHEMA<br />
Pflege<br />
02 EDITORIAL<br />
Zehn Punkte für eine gute Pflege<br />
Text Michael Müller<br />
Foto Carolin Weinkopf<br />
06 PFLEGE-MANIFEST<br />
Pflege geht uns alle an!<br />
Text Dilek Kolat<br />
Foto Clemens Bilan/dapd<br />
Illustration Esther Schaarhüls<br />
09 INTERVIEW MIT ANDRE KINDLER<br />
„Einfach nicht genügend Zeit“<br />
Fragen Christina Bauermeister<br />
Foto Walk of Care – pflegt die Zukunft<br />
10 GASTBEITRAG<br />
Pflege ist keine Privatsache<br />
Text Malu Dreyer<br />
Foto SPD-Landesverband<br />
Rheinland-Pfalz/Oskar Grimm<br />
12 GASTBEITRAG<br />
Nachhaltige Reformen erforderlich<br />
Text<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer<br />
Fotos Walk of Care – pflegt die Zukunft &<br />
Sven Teschke<br />
14 PFLEGEVERSICHERUNG<br />
Hoffentlich voll- und nicht teilversichert<br />
Text Martin Matz<br />
Foto DWBO/Nils Bornemann<br />
Das Pflegeheim „Haus am Auwald“ in Marzahn<br />
ist eine von drei stationären Einrichtungen<br />
der <strong>Berliner</strong> Volkssolidarität<br />
Mehr auf den Seiten 16-19<br />
Foto: Christina Bauermeister<br />
16 REPORTAGE<br />
Wer hat soviel Pinke Pinke?<br />
Text & Fotos<br />
Christina Bauermeister<br />
20 AUS- UND WEITERBILDUNG<br />
Gemeinsam für die Gesundheitsstadt<br />
Text Michael Müller & Dilek Kolat<br />
Foto Charité<br />
I<br />
N<br />
H<br />
A<br />
L<br />
T<br />
22 KULTURSENSIBLE PFLEGE<br />
Respektvoll und freundlich<br />
Text André Lossin<br />
Fotos Adobe Stock/Rawpixel.com & Privat<br />
4 BERLINER STIMME
AUS DEM LANDESVERBAND<br />
<strong>Berliner</strong> <strong>Stimme</strong>n<br />
24<br />
PLÄDOYER<br />
Auf dem Weg zu einer<br />
neuen sozialen Agenda<br />
Text<br />
Foto<br />
Michael Müller<br />
Adobe Stock/Jason Stitt<br />
27 STANDPUNKT<br />
Rettet den Ortsverein!<br />
Text Yannick Haan<br />
Fotos Marcel Mafei & Privat<br />
VERMISCHTES<br />
Kultur & Geschichte<br />
30 BUCH-TIPP<br />
Willy Brandts neues Europa<br />
Text & Foto Ulrich Horb<br />
IMPRESSUM<br />
<strong>Berliner</strong> <strong>Stimme</strong><br />
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie<br />
Herausgeber<br />
SPD Landesverband Berlin,<br />
Landesgeschäftsführerin Anett Seltz (V.i.S.d.P.),<br />
Müllerstraße 163, 13353 Berlin,<br />
Telefon: 030.4692-222, E-Mail: spd@spd.berlin<br />
Webadresse: www.spd.berlin<br />
Redaktion<br />
Christina Bauermeister und Birte Huizing<br />
Telefon: 030.4692-150<br />
E-Mail: redaktion.berlinerstimme@spd.de<br />
Mitarbeit an dieser Ausgabe<br />
Malu Dreyer, Ursula Engelen-Kefer,<br />
Yannick Haan, Ulrich Horb, Dilek Kolat,<br />
André Lossin<br />
Grafik Nico Roicke und Hans Kegel<br />
Titel-Illustration Esther Schaarhüls<br />
Abonnement 29 Euro pro Jahr im Postvertrieb<br />
Abo-Service Telefon: 030.4692-144,<br />
Fax: 030.4692-118, berliner.stimme@spd.de<br />
Druck Häuser KG Buch- und Offsetdruckerei Köln<br />
I<br />
N<br />
H<br />
A<br />
L<br />
T<br />
BERLINER STIMME<br />
5
Text Dilek Kolat<br />
Foto Clemens Bilan/dapd<br />
Illustration Esther Schaarhüls<br />
Pflege geht uns alle an!<br />
Das Pflege-Manifest der <strong>Berliner</strong> SPD<br />
Pflege hatte auf der politischen Agenda lange Jahre keine hohe Priorität.<br />
Für alle Bundesländer und alle Parteien gilt: Trotz guter Fachpolitik spielte<br />
die Pflege in Wahlkämpfen eine eher untergeordnete Rolle. Heute steht<br />
die Pflege vor enormen Herausforderungen und ist eines der wichtigsten<br />
Zukunftsthemen einer solidarischen Gesellschaft. Mit dem <strong>Berliner</strong><br />
Pflege-Manifest benennt die <strong>Berliner</strong> SPD jetzt offen die Fehler der<br />
Vergangenheit, räumt auf und fordert einen Paradigmenwechsel in der<br />
Sozialversicherung sowie konkrete Schritte für gute Arbeit und Ausbildung<br />
in den Pflegeberufen.<br />
Die Situation in der Alten- und Krankenpflege wird sich in den nächsten<br />
Jahren zuspitzen. Die offiziellen Statistiken zeigen das Ausmaß der Herausforderungen:<br />
Bundesweit sind etwa 3,3 Millionen Menschen pflegebedürftig,<br />
19,5 Millionen Patientinnen und Patienten werden in den Krankenhäusern<br />
versorgt – Tendenz steigend. Dem stehen 1,1 Millionen Pflegekräfte<br />
bei Pflegediensten und in Pflegeheimen sowie 330.000 in den<br />
Krankenhäusern gegenüber. Mehr als 85 Prozent von ihnen sind Frauen,<br />
72 Prozent arbeiten in Teilzeit. Bundesweit sind zwischen 25.000 und<br />
30.000 Stellen unbesetzt. Der prognostizierte Mehrbedarf an Pflegekräften<br />
reicht je nach Untersuchung von 110.000 bis über 900.000 bis 2025.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, müssen die Bedingungen<br />
für Ausbildung und Arbeit verbessert werden. Eine angemessene Vergütung<br />
sowie gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen sind dabei<br />
der Schlüssel. Die Zeit der Problemanalysen ist vorbei, es muss endlich<br />
gehandelt werden! Die SPD zeigt in ihrem <strong>Berliner</strong> Pflege-Manifest, wie<br />
eine zukunftsweisende Pflegepolitik aussehen kann.<br />
6 BERLINER STIMME
Gute Pflege und ein<br />
würdevolles Leben<br />
Es hat sich gezeigt: „Marktmechanismen“<br />
alleine führen nicht zu guter Pflege. Vielmehr<br />
müssen für eine bessere Pflege Arbeitgeber,<br />
Gewerkschaften, Kassen und<br />
der Staat gemeinsam handeln! In nahezu<br />
allen verschiedenen pflegerischen Versorgungsbereichen<br />
herrscht Fachkräftemangel;<br />
Qualität und Versorgungssicherheit<br />
leiden. Deshalb fordert die SPD im <strong>Berliner</strong><br />
Pflege-Manifest die deutliche Anhebung<br />
des Lohnniveaus in der Pflege. Flächendeckende<br />
(Branchen-)Tarifverträge sind<br />
dabei das Ziel. Um das zu erreichen, moderiert<br />
das Land Berlin bereits einen Dialog<br />
zwischen den Sozialpartnern. Auf Bundesebene<br />
werden einheitliche, verbindliche<br />
und bedarfsgerechte Personalbemessungsinstrumente<br />
und Pflegeschlüssel, die sich<br />
an pflegewissenschaftlichen und fachlichen<br />
Standards orientieren, eingefordert.<br />
Dazu muss der bedarfsgerechte Ausbau<br />
der Ausbildungskapazitäten kommen.<br />
Nur mehr Pflegekräfte im System<br />
können die Arbeit auf mehr<br />
Schultern verteilen und die<br />
Arbeitsverdichtung reduzieren.<br />
Denn es gilt: Nicht der Pflegeberuf<br />
ist unattraktiv für (junge)<br />
Menschen, sondern die<br />
Arbeits- und zuvor die<br />
Ausbildungsbedingungen.<br />
Um letzteres zu<br />
verbessern, formuliert<br />
das <strong>Berliner</strong><br />
Pflege-Manifest<br />
eine Ausbildungsoffensive<br />
für ein<br />
durchlässiges<br />
und anschlussfähiges<br />
Ausbildungssystem. Dazu gehören<br />
auch eine bessere Ausbildungsvergütung<br />
und eine gute Praxisanleitung.<br />
Die SPD sorgt für die größtmögliche Teilhabe<br />
und Selbstbestimmung aller Menschen<br />
mit der Garantie einer umfassenden<br />
Versorgung aller Pflegebedürftigen.<br />
Im <strong>Berliner</strong> Pflege-Manifest fordert sie<br />
konkrete Schritte zur Entlastung pflegender<br />
Angehöriger beispielsweise durch<br />
einen Einkommensausgleich, die Verankerung<br />
Interkultureller Kompetenz (IKÖ)<br />
in der Pflege sowie die Nutzung technischer<br />
Lösungen zum Wohle der Pflegebedürftigen<br />
und Pflegekräfte.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
7
LINKS<br />
Dilek Kolat ist Senatorin für<br />
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
Paradigmenwechsel<br />
durch Umwandlung in eine<br />
Pflegevollversicherung<br />
Kern des <strong>Berliner</strong> Pflege-Manifests ist<br />
allerdings das Bekenntnis zur Pflegevollversicherung.<br />
Heute bedeutet Pflegebedürftigkeit<br />
für viele Menschen eine große<br />
finanzielle Belastung. Alle Kosten, die<br />
über einen durch die Kassen gezahlten<br />
Festbetrag hinausgehen, sind von den<br />
Pflegebedürftigen oder ihre Angehörigen<br />
zu tragen. Ist das nicht möglich, springt<br />
der Sozialhilfeträger ein. Es ist unwürdig,<br />
wenn pflegebedürftige Menschen mit<br />
geringem Einkommen hier um Hilfe bitten<br />
müssen. Gute Pflege darf nicht länger<br />
vom Geldbeutel abhängen.<br />
Um Abhilfe zu schaffen, sieht das <strong>Berliner</strong><br />
Pflege-Manifest, neben der langjährigen<br />
SPD-Forderung der Einführung einer Bürgerversicherung,<br />
die Weiterentwicklung<br />
der Pflegeversicherung zu einer Pflegevollversicherung<br />
vor. Ein erster Schritt ist<br />
der sogenannte Sockel-Spitze-Tausch.<br />
Dabei werden die Kosten für die Pflegebedürftigen<br />
zum Festbetrag bzw. einem<br />
festen Sockel, und die Kassen zahlen den<br />
variablen Teil, den zuvor die Pflegebedürftigen<br />
zahlten. So liegt das Kostenrisiko<br />
für angemessene Personalschlüssel und<br />
bessere, tarifliche Bezahlung zukünftig<br />
nicht bei den Pflegebedürftigen, sondern<br />
bei den Pflegekassen. Der Ausbau einer<br />
bedarfsgerechten Pflegeinfrastruktur ist<br />
uns das wert!<br />
Stärkung der Interessenvertretung<br />
In der Pflege sind die Herausforderungen<br />
so groß, dass mehr Interessenspolitik angemessen<br />
ist. Eine starke Selbstvertretung<br />
ist nötig. Das <strong>Berliner</strong> Pflege-Manifest<br />
formuliert deshalb die Vision, dass Berufsverbände,<br />
Gewerkschaften und Pflegekammer<br />
jeweils ein eigenständig demokratisch<br />
legitimiertes Vertretungsmandat<br />
haben und jeweils originäre Aufgaben<br />
übernehmen: Gewerkschaften gestalten<br />
Tarifverträge aus, Berufsverbände vertreten<br />
die Interessen der Berufsangehörigen<br />
bezogen auf die Fachlichkeit und die Rahmenbedingungen<br />
und die Pflegekammer<br />
führt staatlich übertragene Aufgaben<br />
wie Weiterbildung aus. Mit ihrem guten<br />
Zusammenwirken wird die Pflege aufgewertet<br />
und professionalisiert.<br />
Die Politik trägt für das Gelingen einer<br />
guten Pflege insgesamt die Verantwortung.<br />
Das Pflege-Manifest der <strong>Berliner</strong> SPD zeigt,<br />
wie es geht. Es ist ein Angebot an unsere<br />
Partei, dieses wichtige Zukunftsthema<br />
anzupacken und konkret zu gestalten.<br />
Das <strong>Berliner</strong> Pflege-Manifest ist ein Entwurf<br />
des Fachausschusses Gesundheit, Soziales<br />
und Verbraucherschutz. Er wurde am<br />
20. Oktober <strong>2018</strong> auf der Klausurtagung<br />
des Landesvorstands der <strong>Berliner</strong> SPD<br />
vorgestellt und soll auf dem ersten<br />
Landesparteitag 2019 beschlossen werden.<br />
https://www.spd.berlin/pflege-manifest<br />
8 BERLINER STIMME
Fragen Christina Bauermeister<br />
Foto Walk of Care – pflegt die Zukunft<br />
„Einfach nicht genügend Zeit“<br />
Lieber Andre, du bist eine wahre Seltenheit<br />
in deinem Beruf: Du hast vor der<br />
Ausbildung Volkswirtschaftslehre studiert<br />
und bist einer von wenigen Männern<br />
im Care-Bereich. Warum wolltest<br />
du Krankenpfleger werden?<br />
Meine Mutter ist seit über 30 Jahren<br />
Krankenschwester im Akutbereich. Ich<br />
bin mit dem Beruf quasi aufgewachsen.<br />
Und erst zu studieren und dann die Ausbildung<br />
zu machen, erschien mir einfach<br />
logischer, weil der Praxisanteil viel höher<br />
ist und die Berufsperspektive für mich so<br />
klarer wird. Und was den Männeranteil<br />
betrifft: Hier beobachte ich eine langsame<br />
Auflösung der Trennung zwischen<br />
den männlich dominierten Handwerksberufen<br />
und den von Frauen dominierten<br />
sozialen Berufen. Viele Pflege-Schulen<br />
werben offensiv um männliche Auszubildende.<br />
Aus deiner Erfahrung: Welches Problem<br />
ist derzeit das drängendste im Gesundheits-<br />
und Care-Sektor?<br />
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil die<br />
Finanzierungsgrundlagen im Pflegeheim,<br />
Krankenhaus bzw. im ambulanten<br />
Bereich sehr unterschiedlich sind. Fakt ist<br />
aber, dass zum Beispiel die Krankenhäuser<br />
in Berlin im Investitionsbereich viel<br />
zu lange chronisch unterfinanziert<br />
waren. Da hat sich ein riesiger Investitionsstau<br />
gebildet, der jetzt durch Programme<br />
wie SIWANA gar nicht schnell<br />
genug wieder aufgelöst werden kann.<br />
Das hat natürlich direkte Auswirkungen<br />
auf die Arbeitsprozesse im Krankenhaus.<br />
OBEN<br />
Andre Kindler ist im dritten Ausbildungsjahr zum<br />
Gesundheits- und Krankenpfleger. Seit drei Jahren<br />
ist er im Fachausschuss Gesundheit der <strong>Berliner</strong><br />
SPD aktiv und hat am Pflege-Manifest mitgewirkt.<br />
Was muss sich gerade im Ausbildungsbereich<br />
noch verbessern?<br />
Die Praxisanleiterinnen- und -anleiter<br />
haben einfach nicht genügend Zeit für<br />
die Auszubildenden. Daher haben wir im<br />
Manifest verankert, dass sie künftig für<br />
20 Prozent ihrer täglichen Arbeitszeit für<br />
Ausbildungstätigkeiten freigestellt werden<br />
müssen. Wie das konkret im Arbeitsalltag<br />
organisiert wird, muss jedes Team<br />
klären. Aber das muss möglich sein.<br />
Du bist auch in der Ausbildungsvertretung<br />
engagiert. Worüber berichten deine<br />
Kolleginnen und Kollegen vermehrt?<br />
Leider beschränken sich die Probleme oft<br />
auf bestimmte Krankenhäuser. Dort werden<br />
Azubis als billige Servicekräfte missbraucht,<br />
das reicht vom Waschservice bis<br />
zum Betten beziehen. Mitunter sperren<br />
wir deshalb ganze Stationen für Auszubildende.<br />
Leider haben wir immer wieder<br />
auch mit Fällen von sexuellen Übergriffen<br />
zu tun, mit denen auf den Stationen zu<br />
lapidar umgegangen wird.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
9
Text Malu Dreyer<br />
Foto SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz/Oskar Grimm<br />
Pflege ist<br />
keine Privatsache<br />
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer<br />
über die Herausforderungen in der Pflegepolitik auf Bundesebene<br />
Das Thema Pflege bewegt viele Menschen in diesem Land ganz unmittelbar<br />
– sie sind damit in der Familie oder im Bekanntenkreis hautnah konfrontiert.<br />
Wenn die eigene Mutter oder der eigene Vater plötzlich pflegebedürftig<br />
werden, dann ist das eine emotionale Ausnahmesituation für<br />
die gesamte Familie. Um Menschen in dieser schwierigen Situation besser<br />
zu unterstützen, hat die Große Koalition in dieser Legislaturperiode bereits<br />
einiges auf den Weg gebracht.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
Für die SPD gilt, dass Pflege keine Privatsache ist, sondern dass wir diejenigen,<br />
die sich um andere kümmern, nicht allein lassen dürfen. Pflegende<br />
Angehörige gehen oft an ihre Grenzen – physisch wie psychisch. Deshalb<br />
werden wir sie künftig entlasten: durch flexible Pflegeangebote sowie<br />
einen Anspruch auf stationäre Reha-Leistungen.<br />
10 BERLINER STIMME
LINKS<br />
Eine spürbare Verbesserung für die<br />
Menschen ist auch der vorsorgliche<br />
Hausbesuch, der nur auf Drängen der<br />
SPD in den Koalitionsvertrag aufgenommen<br />
wurde. So sollen alte Menschen<br />
unterstützt werden, um so lange wie<br />
möglich selbständig zu Hause zu leben<br />
und um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.<br />
In Rheinland-Pfalz setzen wir seit einiger<br />
Zeit auf ein vergleichbares Projekt: Die<br />
so genannte Gemeindeschwester plus<br />
kümmert sich um ältere Menschen, die<br />
nicht pflegebedürftig sind, und berät sie<br />
in ihrem häuslichen Umfeld. Dieses präventive<br />
Angebot trägt dazu bei, dass die<br />
Selbständigkeit älterer Menschen möglichst<br />
lange erhalten bleibt.<br />
Malu Dreyer ist seit 2013 Ministerpräsidentin<br />
des Landes Rheinland-Pfalz und seit 2017 stellvertretende<br />
SPD-Bundesvorsitzende. Sie hat auf<br />
Bundesebene die Eckpunkte im Bereich Gesundheit<br />
und Pflege im Koalitionsvertrag mit ausgehandelt.<br />
Deutschlandweit geht es jetzt aber zunächst<br />
darum, die 13.000 neuen Stellen<br />
in der Pflege zu schaffen, die wir mit dem<br />
Pflegepersonalstärkungsgesetz möglich<br />
machen. Denn gute Pflege wird vor allem<br />
von Menschen gemacht. Darum brauchen<br />
wir dringend mehr Pflegekräfte. Und wir<br />
müssen sie besser bezahlen! In meinen<br />
Augen liegt der Schlüssel dafür in der<br />
Tarifpartnerschaft. Ein bundesweit geltender<br />
Tarifvertrag Soziales wäre der beste<br />
Weg, um deutliche Verbesserungen für<br />
die Beschäftigten in dieser Branche zu<br />
erreichen.<br />
Eine neue generalistische Ausbildung<br />
wird zudem dafür sorgen, dass Pflegerinnen<br />
und Pfleger sowohl im Krankenhaus<br />
als auch im Pflegeheim arbeiten können.<br />
Längst überfällig war, dass wir das Schulgeld<br />
abgeschafft haben und eine angemessene<br />
Ausbildungsvergütung gewährleisten.<br />
Denn es ist unsere Pflicht als Politik,<br />
die Arbeitsbedingungen in der Pflege<br />
so attraktiv zu machen, dass ausreichend<br />
Menschen den Pflegeberuf ergreifen.<br />
Dazu wird auch die „Konzertierte Aktion<br />
Pflege“ beitragen. Die Initiative der drei<br />
zuständigen Bundesminister Franziska<br />
Giffey, Jens Spahn und Hubertus Heil<br />
umfasst eine Ausbildungsoffensive, Anreize<br />
für eine bessere Rückkehr von Teilin<br />
Vollzeit, ein Wiedereinstiegsprogramm,<br />
eine bessere Gesundheitsvorsorge für die<br />
Beschäftigten sowie eine Weiterqualifizierung<br />
von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern<br />
zu Pflegefachkräften.<br />
All diese Vorhaben sind wichtig, um dem<br />
Mangel an guten und motivierten Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern in der<br />
Pflege zu begegnen. Sie werden Geld kosten,<br />
das nicht von den Pflegebedürftigen<br />
allein aufgebracht werden kann. Wir<br />
werden uns deshalb auch auf höhere<br />
Beiträge zur Pflegeversicherung einstellen<br />
müssen. Aber nur so kann das Vertrauen<br />
in die Pflege wachsen. Nur so können<br />
Pflegekräfte im Job gehalten und wieder<br />
mehr Menschen für diesen Beruf begeistert<br />
werden.<br />
All das zeigt: Es macht eben doch einen<br />
Unterschied, wer in der Regierung Verantwortung<br />
übernimmt. Die SPD weiß,<br />
dass eine gute Pflege Teil einer lebenswerten<br />
und solidarischen Gesellschaft<br />
ist. Als stellvertretende Parteivorsitzende<br />
werde ich mich weiterhin dafür stark<br />
machen.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
11
Text Dr. Ursula Engelen-Kefer<br />
Fotos Walk of Care – pflegt die Zukunft & Sven Teschke<br />
Nachhaltige Reformen<br />
erforderlich<br />
Auch Berlin ist vom Notstand in der Altenpflege betroffen.<br />
Sowohl der Gesetzesauftrag „ambulant vor stationär“ wie auch der<br />
Sicherstellungsauftrag für die Altenpflege können nicht mehr<br />
gewährleistet werden. Ein Meinungsbeitrag von Ursula Engelen-Kefer,<br />
Mitglied im Bundesvorstand des Sozialverbands Deutschland.<br />
Die Pflege nimmt zwar in der Koalitionsvereinbarung der Großen Koalition<br />
und auch in den Handlungsperspektiven von Bundesgesundheitsminister<br />
Jens Spahn gebührenden Raum ein. Allerdings werden die<br />
Wurzeln des Pflegenotstandes kaum angepackt. Dazu bedarf es einer<br />
grundsätzlichen Reform des Pflegesystems, wie es insbesondere in<br />
skandinavischen Ländern bei ähnlichen Strukturen von Demographie<br />
und Sozialstaat schon seit Jahren praktiziert wird.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
OBEN<br />
Mitte Mai gingen in Berlin mehr als 800 Menschen unter dem Claim „Walk of Care“ für<br />
bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege auf die Straße. Sie forderten unter anderem einen<br />
gesetzlich festgeschriebenen Personalschlüssel, Fort- und Weiterbildungen als Pflicht sowie<br />
mehr Zeit für eine gute Ausbildung.<br />
12 BERLINER STIMME
LINKS<br />
Dr. Ursula Engelen-Kefer ist Sozial- und<br />
Arbeitsmarktexpertin und war von 1990 bis 2006<br />
stellvertretende Vorsitzende des Deutschen<br />
Gewerkschaftsbundes (DGB). 2015 wurde sie<br />
in den Bundesvorstand des Sozialverbands<br />
Deutschland (SoVD) gewählt.<br />
Dazu ist die Teilversicherung in der<br />
Altenpflege zu einer Vollversicherung<br />
auszubauen. Verantwortung, Kompetenzen,<br />
Finanzen und Personal müssen auf<br />
die kommunale Ebene verlagert werden.<br />
Zu finanzieren ist dies über Steuern und<br />
nicht wie bisher über Sozialversicherungsbeiträge.<br />
Als ein Schritt in diese<br />
Richtung ist die Eigenbeteiligung der<br />
pflegebedürftigen Menschen vor allem<br />
in der stationären Pflege zu begrenzen.<br />
Vordringlich sind ebenfalls Stopp und<br />
Rückführung des teilweisen aggressiven<br />
Aufkaufs von Altenpflegeeinrichtungen<br />
durch Finanzkonzerne zur Gewinnerzielung<br />
auf dem Rücken der Pflegebedürftigen<br />
und der Pflegekräfte.<br />
Um Arbeitskräfte für die Berufe der<br />
Altenpflege zu gewinnen und zu halten,<br />
sind die Verbesserung von Entlohnung<br />
sowie Arbeitsbedingungen unerlässlich.<br />
Dazu braucht es familienfreundliche und<br />
verlässliche Arbeits- sowie Schichtzeiten<br />
sowie die Erhöhung von Personalschlüssel<br />
und Personalstellen. Die jetzt vorgesehenen<br />
13.000 zusätzlichen Personalstellen<br />
für die medizinische Pflege in stationären<br />
Einrichtungen der Altenpflege sind<br />
keinesfalls ausreichend. Zudem sind<br />
etwa 37.000 Stellen in der Altenpflege<br />
überhaupt nicht besetzt.<br />
Die dramatisch angestiegene Zahl von<br />
Minijobs ohne Sozialversicherung müssen<br />
durch reguläre Teilzeit-und Vollzeitarbeit<br />
ersetzt werden. An Stelle des<br />
zunehmenden Einsatzes von Leiharbeitnehmerinnen<br />
und Leiharbeitern muss es<br />
eine ausreichende Besetzung mit Ersatzkräften<br />
geben. Um mehr junge Menschen<br />
für die Berufe der Alten- und Krankenpflege<br />
zu gewinnen, sind Aus- und Weiterbildung<br />
transparent und durchlässig zu<br />
gestalten. Wesentliche Bedingung hierzu<br />
ist die Förderung von Tarifverträgen<br />
sowie deren Allgemeinverbindlichkeit.<br />
Das Pflegeberufegesetz von 2017 mit der<br />
gemeinsamen Ausbildung von Kranken-,<br />
Kinder- und Altenpflege in den ersten<br />
beiden Jahren und der nachfolgenden<br />
Spezialisierung wird eher zu einer Entprofessionalisierung<br />
der Pflege in den<br />
einzelnen Bereichen und einer weiteren<br />
Vernachlässigung der Altenpflege führen.<br />
Auf seinem Amts-Bonus-Konto konnte<br />
Spahn zwar die Umsetzung der von der<br />
Koalition vereinbarten Wiederherstellung<br />
der finanziellen Beitragssatzparität<br />
in der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
verbuchen. Gleichzeitig belastet er jedoch<br />
die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler<br />
mit einer Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrags<br />
um 0,5 Prozent,<br />
was die Rentnerinnen und Rentner<br />
gleich doppelt trifft. So haben sie den<br />
Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung<br />
und damit auch die Erhöhung<br />
alleine zu tragen. Von der gleichzeitigen<br />
Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung<br />
von ebenfalls 0,5 Prozent<br />
profitieren sie allerdings nicht.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
13
Text Martin Matz<br />
Foto DWBO/Nils Bornemann<br />
Hoffentlich voll- und<br />
nicht teilversichert!<br />
Das Ziel bei Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung,<br />
möglichst viele Pflegebedürftige aus der Sozialhilfe zu holen,<br />
steht zunehmend in Frage<br />
Die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung in den 90er Jahren<br />
war ein bedeutender sozialpolitischer Schritt. Professionelle Pflege-<br />
Strukturen in Deutschland wurden ermöglicht, pflegende Angehörige<br />
erstmals unterstützt und viele Menschen aus der Sozialhilfe geholt, die<br />
nur aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit zum Sozialamt mussten.<br />
Gleichzeitig wurden zwei Entscheidungen getroffen, die für die Pflege<br />
bis heute ein Problem sind: Erstmals wurden private Anbieter in den<br />
Sozialbereich geholt, die anders als ihre gemeinnützigen Kollegen auf<br />
Gewinnausschüttungen aus sind und tarifliche Bezahlung als Einschränkung<br />
ihrer unternehmerischen Freiheit empfinden – und das<br />
auch so sagen. Außerdem entschied man sich für eine Teilversicherung<br />
mit Betragsgrenzen für die Pflegekassen, die einen Teil der Kosten den<br />
Pflegebedürftigen als Eigenanteil überlässt und ihnen dadurch das<br />
Kostenrisiko allein auflädt.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
Dieses Teilversicherungsprinzip trifft die Pflegebedürftigen wieder<br />
härter: 2015 waren bundesweit schon 12,2 Prozent der Pflegebedürftigen<br />
auf Hilfe zur Pflege vom Sozialamt angewiesen, in Berlin sogar 23,5 Prozent.<br />
Das ist nicht verwunderlich, wenn Eigenanteile nicht selten bis<br />
zu 1.500 Euro monatlich betragen und damit oft – gerade in Berlin –<br />
die Rentenhöhe übersteigen. Das Ziel bei Einführung der gesetzlichen<br />
Pflegeversicherung, möglichst viele Pflegebedürftige aus der Sozialhilfe<br />
zu holen, steht zunehmend in Frage.<br />
14 BERLINER STIMME
LINKS<br />
Martin Matz ist als Vorstandsmitglied<br />
des Diakonischen Werks auch Vorsitzender<br />
des <strong>Berliner</strong> Landespflegeausschusses.<br />
Er war Gesundheitsstadtrat in Spandau<br />
und ist seit 12 Jahren Abteilungsvorsitzender<br />
der SPD in Lichterfelde-West<br />
Und was noch schlimmer ist: Jeder Schritt<br />
zu besserer und tariflicher Bezahlung<br />
in der Pflege trifft im derzeitigen Versicherungsmodell<br />
zu 100 Prozent die<br />
Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen.<br />
Die Leistungen der Kasse sind gedeckelt,<br />
die Höchstbeträge im SGB XI festgelegt.<br />
Wenn die Personalkosten steigen, müssen<br />
die Versicherten also alleine ran. Politisch<br />
ist das ein unhaltbarer Zustand, entweder<br />
pflegebedürftige Rentnerinnen und<br />
Rentner massiv zusätzlich zu belasten<br />
oder den Beschäftigten in der Pflege eine<br />
bessere und tarifliche Bezahlung weiter<br />
zu verweigern.<br />
Warum haben wir also nicht schon<br />
längst eine Pflegevollversicherung?<br />
Es geht dabei natürlich ums Geld. Die<br />
zusätzlichen Mittel wurden in einem<br />
Gutachten für die Gewerkschaft ver.di<br />
auf der Basis des Jahres 2010 auf 7,4 Milliarden<br />
Euro geschätzt. Inzwischen ist<br />
die Zahl der Leistungsempfängerinnen<br />
und -empfänger gestiegen, und auch<br />
durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff<br />
hat sich die finanzielle Basis der<br />
Berechnung verändert. Klar ist aber,<br />
dass auch bei Gegenrechnung der Einsparungen<br />
im Bereich der Sozialhilfe<br />
eine Beitragserhöhung der Pflegeversicherung<br />
um weitere 0,7 bis 1,0 Prozentpunkte<br />
erforderlich wäre. Ein Beitragspunkt<br />
entspricht im Jahr <strong>2018</strong> einer<br />
Summe von 14,8 Milliarden Euro, die<br />
Ausgaben der Pflegeversicherung haben<br />
sich seit 2010 um 74 Prozent erhöht.<br />
Daher wäre ein Zwischenschritt hilfreich:<br />
Es könnte beim Eigenanteil bleiben, aber<br />
dieser würde gedeckelt und das Kostenrisiko<br />
auf die Pflegekassen verlagert<br />
werden. Dann müssten nicht mehr die<br />
Leistungsempfangenden die Kostensteigerungen<br />
durch mehr Ausbildung und<br />
bessere Bezahlung tragen, sondern die<br />
Pflegeversicherung. Der Bremer Professor<br />
Heinz Rothgang spricht von einem<br />
„Sockel-Spitze-Tausch“, um diesen Rollenwechsel<br />
zwischen Versicherungsleistung<br />
und Eigenanteil zu beschreiben. In diesem<br />
Modell wäre die Pflegevollversicherung<br />
dann später durch eine stufenweise Reduzierung<br />
des gedeckelten Eigenanteils auf<br />
Null erreichbar.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
15
Text & Fotos Christina Bauermeister<br />
Wer hat soviel<br />
Pinke Pinke?<br />
Ob Pflege-Leasing oder die strikte Einhaltung der Fachkräftequote:<br />
Die Herausforderungen im Pflegeheim „Haus am Auwald“<br />
sind beispielhaft für die schwierige Pflegesituation in Deutschland.<br />
Der Weg zu ihrem Traumberuf begann für Dörte Herrmann mit der<br />
Scheidung von ihrem Mann. Plötzlich war sie finanziell auf sich allein<br />
gestellt. Und weil in der Pflege auch damals schon dringend Personal<br />
gesucht wurde, entschloss sich Dörte Herrmann Pflegehelferin zu werden.<br />
Sieben Jahre lang arbeitete die resolute Frau bei einem ambulanten Pflegedienst,<br />
dann begann sie berufsbegleitend eine vierjährige Weiterbildung<br />
zur examinierten Pflegefachkraft.<br />
An diesem Montagvormittag ist sie bereits seit 5.30 Uhr im Dienst und<br />
immer noch gut gelaunt. Mittlerweile ist Dörte Herrmann – dunkelblauer<br />
Kittel, Pferdeschwanz und akkurat geschnittener Pony – im Pflegeheim<br />
„Haus am Auwald“ in Marzahn beschäftigt. Sie hat Dienst auf der Etage,<br />
auf der vor allem Bewohnerinnen und Bewohner mit neurologischen<br />
Erkrankungen leben.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
Es ist Mittagszeit und die Pflegerin geht mit einer pürierten Mahlzeit<br />
in ein Zimmer, wo ein Mann mit einer sehr fortgeschrittenen Parkinson-<br />
Erkrankung liegt. Sie reicht ihm das Essen. Gleichzeitig muss sie ein Auge<br />
auf den gegenüber liegenden Gruppenraum haben, in dem drei Männer<br />
zu Mittag essen. Durch die gesundheitlichen Einschränkungen kann es<br />
jederzeit vorkommen, dass sich einer der Pflegebedürftigen verschluckt.<br />
Dann muss es sehr schnell gehen. Den Oberbauch von hinten umfassen<br />
und die Faust unterhalb der Rippen und des Brustbeins legen. So geht<br />
der Heimlich-Handgriff. Heute bleibt aber alles entspannt.<br />
16 BERLINER STIMME
OBEN<br />
Pflegedienstleiterin Ines Dubitzky (links) und Pflegedienstdirektorin Sylvia Svoboda. Beide sind<br />
gelernte Krankenschwestern, haben sich später jedoch beruflich für die Altenpflege entschieden.<br />
Auch Herr G. mit der Parkinson-Erkrankung<br />
hat seine Mahlzeit fast geschafft.<br />
Auf dem Fernsehtisch steht ein Bild von<br />
ihm und seiner zweiten Ehefrau. Daneben<br />
ein Foto der gemeinsamen Tochter.<br />
Doch Besuch hatte Herr G. schon lange<br />
nicht mehr. Seine Frau ist bereits verstorben<br />
und die Tochter war das letzte Mal<br />
bei ihm, als er vor etlichen Jahren in das<br />
Pflegeheim gezogen ist. Da hat Herr G.<br />
noch gut gelaunt mit dem Pflegepersonal<br />
sein Lieblingslied gesungen „Wer hat<br />
soviel Pinke Pinke auf der ganzen Welt?“.<br />
Natürlich stimmt es Dörte Herrmann<br />
traurig, wenn alte Menschen von ihren<br />
Angehörigen allein gelassen werden.<br />
Gleichzeitig empfindet sie es als Privileg,<br />
in ihrem Beruf Menschen durch ihren<br />
letzten Lebensabschnitt zu begleiten.<br />
„Man bekommt sehr schnell Wertschätzung<br />
zurück“, sagt sie.<br />
Sehr geärgert hat sich Dörte Herrmann<br />
über den Satz von Bundesgesundheitsminister<br />
Jens Spahn, der – angesprochen<br />
auf die hohe Teilzeitquote der Pflegekräfte<br />
– sagte: „Wenn von einer Million<br />
Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden<br />
mehr pro Woche arbeiten würden,<br />
wäre schon viel gewonnen.“ Dörte Herrmann<br />
arbeitet selbst 40 Wochenstunden.<br />
Ihr Arbeitgeber, die Volkssolidarität, hat<br />
es ihr freigestellt, einen Arbeitsvertrag<br />
mit 35 oder 40 Stunden zu unterschreiben.<br />
Herrmann kann ihre Arbeitskollegen<br />
verstehen, die etwas weniger arbeiten.<br />
Der Schichtdienst schlaucht, und mitunter<br />
hat man nur einen Tag am Stück<br />
frei. Dazu kommen Überstunden. Seit<br />
5.30 Uhr hat sie heute noch keine Pause<br />
gemacht. Vor Dienstschluss schaut Dörte<br />
Herrmann noch mal überall nach dem<br />
Rechten, denn die Spätschicht übernimmt<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
17
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
heute eine sogenannte Leasing-Firma.<br />
Das sind Leiharbeitsfirmen, die sich den<br />
Fachkräftemangel in der Altenpflege zu<br />
Nutze gemacht haben. Mit prekär beschäftigter<br />
Leiharbeit wie in anderen<br />
Branchen hat das Pflege-Leasing nichts<br />
zu tun. Im Gegenteil. Die Arbeitsverträge<br />
in den Firmen sind unbefristet, und die<br />
dort angestellten Pflegekräfte bekommen<br />
von Anfang an deutlich mehr Gehalt<br />
als die Stammbelegschaft in den<br />
Pflegeheimen. Darüber hinaus müssen<br />
die Leiharbeiter nicht am Wochenende<br />
einspringen und keine Nachtschichten<br />
übernehmen. In Berlin arbeiten rbb-<br />
Recherchen zufolge etwa fünf Prozent<br />
der Altenpflegekräfte als Leiharbeiterinnen<br />
und Leiharbeiter.<br />
Die Leasing-Firmen wissen<br />
um die Nöte in den Heimen.<br />
Diese Pflegekräfte auf Pump sind auch<br />
im Haus am Auwald keine Seltenheit.<br />
Sie springen immer dann ein, wenn es<br />
Personalengpässe gibt. „Aktuell sind bei<br />
uns vier Pflegefachkraft-Stellen nicht<br />
besetzt“, sagt die Leiterin des Hauses<br />
Solveig Lange. Hinzu kommt, dass rund<br />
zwei Drittel der Belegschaft älter als 50<br />
Jahre sind. Der hohe Altersdurchschnitt<br />
hat einen hohen Krankenstand zur Folge.<br />
Die Leasing-Firmen wissen um diese<br />
Nöte in den Heimen.<br />
„Wir können ja schlecht die Bewohnerinnen<br />
und Bewohner hier wieder nach<br />
Hause schicken, wenn uns das Personal<br />
fehlt“, sagt Pflegedienstleiterin Ines<br />
Dubitzky. Sie hält deshalb auch nichts<br />
davon, dem Leasing gesetzgeberisch<br />
einen Riegel vorzuschieben. In der Pflege<br />
herrscht ein gigantischer Fachkräftemangel.<br />
Ganze Alterskohorten fehlen auf<br />
dem Arbeitsmarkt, weil in den neunziger<br />
und 2000er Jahren viel zu wenig ausgebildet<br />
wurde. Die Volkssolidarität bildet<br />
seit rund zehn Jahren wieder selbst aus.<br />
Mit dem Pflegeberufsgesetz werden die<br />
Ausbildungen ab Januar 2020 in der<br />
Kranken- und Kinderkrankenpflege und<br />
in der Altenpflege zusammengelegt.<br />
Damit fällt das Schulgeld in der Altenpflege<br />
endlich überall weg und der Beruf<br />
wird finanziell aufgewertet. Solveig Lange<br />
und Ines Dubitzki zweifeln noch daran,<br />
dass die Generalistik – wie das Gesetz in<br />
Fachkreisen genannt wird – die erhoffte<br />
Trendwende bringt. Sie befürchten, dass<br />
sich viele Azubis im dritten Lehrjahr für<br />
18 BERLINER STIMME
LINKS<br />
Dörte Herrmann ist seit 5.30 Uhr im Dienst.<br />
Bis zum Mittagessen hat sie noch keine Pause<br />
gemacht. Trotzdem ist die Pflege ihr Traumberuf.<br />
„Man bekommt sehr schnell Wertschätzung<br />
zurück“, sagt Herrmann.<br />
Sylvia Svoboda ist langjährige Pflegedienstdirektorin<br />
bei der <strong>Berliner</strong> Volkssolidarität.<br />
Aus ihrer Sicht überwiegen<br />
die Vorteile in der Ausbildungs-Generalüberholung.<br />
„Durch die einheitlichen<br />
Curricula vertieft sich die medizinische<br />
Ausbildung des künftigen Pflege-Personals“,<br />
sagt sie. Gleichzeitig erhöhe sich<br />
der Anteil der Praxisstunden, und da<br />
müsse die Pflege eben für sich werben.<br />
„Durch unsere Tätigkeit werden wir Teil<br />
der Biografie eines anderen. Was kann es<br />
schöneres geben?“, fragt Sylvia Svoboda.<br />
die Krankenpflege entscheiden. „Die Verantwortung<br />
in der Pflege ist höher als<br />
im Krankenhaus“, meint Ines Dubitzky.<br />
Darüber hinaus verändert sich der Beruf<br />
stetig. Man ist Mediator, Seelsorger, Koordinator<br />
und Sterbebegleiter zugleich.<br />
Sehr oft werden Patienten aus dem Krankenhaus<br />
direkt ins Pflegeheim überwiesen.<br />
Die Zeit im stationären Heim hat<br />
sich für viele Pflegebedürftige verkürzt.<br />
In Zahlen bedeutet das: Allein in diesem<br />
Jahr hatte das Haus am Auwald bereits<br />
30 Sterbefälle. Auf jeder Etage gibt es deshalb<br />
einen Aushang mit kleinen Sternen,<br />
darin die Namen der Verstorbenen.<br />
„Durch unsere Tätigkeit werden<br />
wir Teil der Biografie eines anderen.“<br />
Sylvia Svoboda<br />
Mehr Sorge bereitet ihr im Moment<br />
die strikte Einhaltung der sogenannten<br />
Fachkräftequote. Diese schreibt vor, dass<br />
jede/r zweite Beschäftigte eine examinierte<br />
Pflegefachkraft sein muss. Das<br />
Haus am Auwald kann deshalb gerade<br />
keine zusätzliche Pflegehelferinnen bzw.<br />
-helfer einstellen – und dass trotz hoher<br />
Pflegegrade mancher Heimbewohner.<br />
„Da wäre jede helfende Hand ein Segen“,<br />
sagt Solveig Lange. Die unnötig starre<br />
Vorschrift sorgt im Moment für eine<br />
noch höhere Arbeitsverdichtung bei den<br />
Pflegefachkräften.<br />
Alle sind sich einig, dass in die Pflegeinfrastruktur<br />
und den Zugewinn von<br />
Fachkräften in den kommenden Jahren<br />
deutlich mehr investiert werden muss.<br />
Bereits jetzt wird die Generation pflegebedürftig,<br />
die nach der Wende beruflich<br />
nicht mehr Fuß gefasst hat. Darunter ist<br />
eine erhöhte Zahl an Demenz-Kranken.<br />
Gleichzeitig geht bald die Babyboomer-<br />
Generation in Rente. Das sind große<br />
Herausforderungen für eine Branche,<br />
die immer noch unterfinanziert ist.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
19
Text Michael Müller & Dilek Kolat<br />
Foto Charité<br />
Gemeinsam für die<br />
Gesundheitsstadt<br />
Michael Müller und Dilek Kolat<br />
über das gemeinsame Aus- und Weiterbildungszentrum<br />
für Gesundheitsberufe von Charité und Vivantes<br />
Mit der Charité und Vivantes verfügt Berlin über ein einmaliges Duo.<br />
Auf der einen Seite steht eine der größten Unikliniken Europas mit<br />
17.500 Beschäftigten, medizinischer Spitzenforschung und – zum siebten<br />
Mal in Folge – der Auszeichnung als Deutschlands beste Klinik. Auf der<br />
anderen der bundesweit größte kommunale Krankenhauskonzern mit<br />
16.000 Beschäftigen, einem breiten Portfolio an medizinischer und pflegerischer<br />
Versorgung und dem Anspruch eines Branchenvorreiters.<br />
Um dieses große Potenzial künftig noch besser zu nutzen, haben wir im<br />
Mai dieses Jahres die Kommission „Gesundheitsstadt Berlin 2030“ unter<br />
dem Vorsitz des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach einberufen.<br />
Sie erarbeitet strukturelle Empfehlungen, wie wir die bestmögliche<br />
medizinische Versorgung für eine wachsende und erfreulicherweise<br />
immer älter werdende Bevölkerung in unserer Stadt gewährleisten<br />
können. Klar ist jetzt schon, dass wir hierfür erheblich mehr hervorragend<br />
ausgebildete Fachkräfte brauchen werden. Deshalb wollen<br />
Charité und Vivantes ihre Ausbildungszweige zusammenführen und<br />
mit Unterstützung des Senats ein gemeinsames Aus- und Weiterbildungszentrum<br />
für Gesundheitsberufe aufbauen.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
Zunächst sollen die bestehenden Ausbildungseinheiten gebündelt und<br />
die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften besser abgestimmt werden,<br />
im weiteren Schritt dann ein gemeinsamer Ort für das Aus- und Weiterbildungszentrum<br />
entstehen. Das sehen die Pläne von Charité und<br />
Vivantes vor, die dem Senat vor wenigen Wochen vorgelegt wurden.<br />
20 BERLINER STIMME
OBEN<br />
Der Regierende Bürgermeister und<br />
Wissenschaftssenator Michael Müller (3. v. l.)<br />
bei der diesjährigen Langen Nacht der<br />
Wissenschaften am Campus Benjamin Franklin<br />
Dabei wird die Ausbildungskapazität<br />
der beiden Einrichtungen von derzeit gut<br />
1.600 auf insgesamt 2.660 Plätze ausgebaut,<br />
wovon mit 964 Plätzen der Löwenanteil<br />
auf den Pflegebereich entfällt.<br />
Unter dem gemeinsamen Dach sollen<br />
auch künftige Hebammen und Entbindungshelfer<br />
ausgebildet werden, ebenso<br />
wie Fachkräfte für die Physiotherapie,<br />
Logopädie, operationstechnische Assistenz,<br />
Diätassistenz, und medizinische<br />
Sektions- und Präparationsassistenz.<br />
Geprüft wird die Neueinrichtung weiterer<br />
medizinisch-technischer Ausbildungszweige,<br />
etwa im Bereich der Radiologieoder<br />
Laborassistenz, und der anästhesietechnischen<br />
Assistenz. Zu den Aufgaben<br />
des Zentrums werden zudem berufsbegleitende<br />
Angebote für Weiterbildung<br />
und Qualifizierung gehören, um den<br />
wachsenden Ansprüchen an die Fachkräfte<br />
in der Gesundheitsbranche, ganz<br />
besonders in der Pflege, gerecht zu<br />
werden.<br />
Es geht also nicht nur um einen Kapazitätsausbau,<br />
sondern auch um eine<br />
Erweiterung des Ausbildungsangebots<br />
bei gleichzeitiger Wahrung seiner hohen<br />
Qualität. Das gelingt durch den Rückgriff<br />
auf die Expertise von zwei hervorragenden<br />
medizinischen Einrichtungen und<br />
die damit verbundenen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten<br />
für die Fachkräfte in<br />
spe. Hierin liegt ein großer Mehrwert<br />
der Kooperation, von dem die Auszubildenden,<br />
Beschäftigten der <strong>Berliner</strong><br />
Gesundheitsbranche und schlussendlich<br />
die Patientinnen und Patienten sehr<br />
profitieren werden. Nicht zuletzt ist ein<br />
gemeinsames Wohnheim Teil der aktuellen<br />
Planungen von Charité und Vivantes,<br />
zweifelsohne ein weiterer Pluspunkt für<br />
künftige Auszubildende.<br />
Und wir nehmen schon weitere Kooperationsmöglichkeiten<br />
in den Blick:<br />
In der Digitalisierung wollen Charité und<br />
Vivantes künftig an einem Strang ziehen,<br />
und auch das wird sich sicherlich in der<br />
Agenda des Aus- und Weiterbildungszentrums<br />
widerspiegeln.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
21
Text André Lossin<br />
Fotos Adobe Stock/Rawpixel.com & Privat<br />
Respektvoll<br />
und freundlich<br />
Was kultursensible Pflege leisten muss<br />
OBEN<br />
Text Text<br />
Text<br />
Text<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
Die Anzahl älterer Menschen mit Migrationshintergrund steigt gegenüber<br />
Menschen ohne Migrationsgrund überproportional an. Hatten im<br />
Jahre 2011 rund 10,1 Prozent der über Sechzigjährigen einen Migrationshintergrund,<br />
so wird laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums<br />
der Anteil der Sechzigjährigen im Jahre 2030 auf 24 Prozent ansteigen.<br />
Hinzu kommt, dass Menschen mit Migrationshintergrund um zehn Jahre<br />
früher pflegebedürftiger werden als Menschen, die keinen Migrationshintergrund<br />
haben.<br />
22 BERLINER STIMME
LINKS<br />
André Lossin ist Vorsitzender<br />
des Fachausschusses für Gesundheit,<br />
Soziales und Verbraucherschutz<br />
der <strong>Berliner</strong> SPD<br />
Die besonders große Gruppe der älteren<br />
Migranten stammen aus den ehemaligen<br />
Anwerbeländern, also aus den südeuropäischen<br />
Ländern Italien, Spanien, Portugal<br />
und Griechenland, aber auch aus der Türkei<br />
sowie dem ehemaligen Jugoslawien.<br />
Für diese Menschen bildet die Sprache<br />
immer noch eine erhebliche Barriere zum<br />
Zugang zum Altenhilfesystem. Das System<br />
ist zu kompliziert. Die Hans-Böckler-<br />
Stiftung kam 2016 zu dem Schluss, dass<br />
70 Prozent der Pflegebedürftigen zu<br />
Hause und mehrheitlich von den Angehörigen<br />
gepflegt werden. Die Angehörigen<br />
erbringen demnach den größten<br />
Beitrag zur Pflegeversorgung.<br />
Die Sozialwissenschaftler Hürrem Teczan-<br />
Güntekin und Jürgen Breckenkamp haben<br />
die Anforderungen in der Pflege älterer<br />
Menschen mit Migrationshintergrund<br />
erforscht. Sie verweisen darauf, dass<br />
Menschen mit türkischem Migrationshintergrund<br />
vor allem einen respektvollen<br />
und freundlichen Umgang erwarten.<br />
Für Frauen (79 Prozent), aber auch für<br />
viele Männern (40 Prozent) ist eine gleichgeschlechtliche<br />
Pflege wichtig. Ebenso<br />
wird gewünscht, islamische Gebote einzuhalten,<br />
da das Essen in Pflegeeinrichtungen<br />
nicht den religiösen Vorgaben<br />
entspreche.<br />
Pflegende Angehörige, deren Angehörige<br />
an Demenz erkrankt sind, wünschen sich<br />
alternative Wohnformen. Hierzu gehören<br />
Demenz-WGs, die eine muttersprachliche<br />
Ansprache der Bewohnerinnen und Bewohner<br />
gewährleisten. Dabei reiche es,<br />
die Sprache in die Kommunikation im<br />
Alltag zu integrieren. Vor allem russischstämmige<br />
Menschen wünschen sich<br />
muttersprachliche Pflegekräfte. Im Falle<br />
stationärer Pflege ist beiden Gruppen<br />
ein Einzelzimmer mit eigenen Möbeln<br />
und die Möglichkeit, selbst zu kochen,<br />
wichtig. Auch das Mehrgenerationenwohnen<br />
wäre eine Betreuungsform, die<br />
den Bedürfnissen pflegender Angehöriger<br />
entsprechen würde. Hierbei steht im<br />
Vordergrund, dem zu Pflegenden nahe<br />
und weiterhin berufstätig zu sein und<br />
Raum für das eigene Leben zu haben.<br />
Damit Pflegebedürftige und ihre Angehörigen<br />
gut beraten werden, setzt die<br />
Senatsverwaltung für Gesundheit,<br />
Pflege und Gleichstellung auf den Ausbau<br />
der 36 Pflegestützpunkte in Berlin.<br />
Die Beratungsangebote für Menschen<br />
mit Migrationshintergrund wurden<br />
erheblich erweitert und viele der Pflegeschulen<br />
bilden zunehmend kultursensibel<br />
aus. Die Zahl der Pflegekräfte mit<br />
Migrationshintergrund ist in den vergangenen<br />
Jahren signifikant angestiegen.<br />
Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung<br />
müssen in der Pflege deutlich<br />
verbessert werden, sonst kommt der<br />
Pflegenotstand schneller als erwartet.<br />
T<br />
I<br />
T<br />
E<br />
L<br />
BERLINER STIMME<br />
23
Text Michael Müller<br />
Foto Adobe Stock/Jason Stitt<br />
Auf dem Weg zu einer<br />
neuen sozialen Agenda<br />
Um verloren vergangenes Vertrauen<br />
bei den Wählerinnen und Wählern zurückzugewinnen,<br />
brauchen wir ein neues Recht auf Arbeit.<br />
Ein Plädoyer von Michael Müller.<br />
Vor einem Jahr habe ich zum Beginn meiner Bundesratspräsidentschaft<br />
in einem Namensbeitrag zum Thema „Digital und sozial“ erstmals meinen<br />
Vorschlag für ein Solidarisches Grundeinkommen (SGE) vorgestellt.<br />
Als Antwort auf drohenden Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung<br />
und Automatisierung ging es mir darum, neue arbeitsmarktpolitische<br />
Instrumente zu entwickeln. Denn uns sollte klar sein: Die Herausforderungen<br />
von Arbeit 4.0, die Arbeitswelt der nächsten 15 Jahre können<br />
wir nicht mit den Instrumenten der vergangenen 15 Jahre beantworten.<br />
Es ist jetzt unsere Aufgabe, den Menschen das Vertrauen in die soziale<br />
Gestaltungskraft der Sozialdemokratie zurückzugeben.<br />
B<br />
E<br />
R<br />
L<br />
I<br />
N<br />
E<br />
R<br />
S<br />
T<br />
I<br />
M<br />
M<br />
E<br />
N<br />
Wir leben in einer Arbeitsgesellschaft<br />
Auch wenn sich Arbeit grundlegend verändert, werden wir nach meiner<br />
Überzeugung weiter in einer Arbeitsgesellschaft leben, in der gesellschaftliche<br />
Teilhabe, Anerkennung und Wohlstand über den Wert von<br />
Arbeit definiert werden. Deswegen sollten wir Teilhabe durch Arbeit in<br />
den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen.<br />
Wir müssen den Menschen jetzt realistische, gesellschaftlich akzeptierte<br />
Angebote machen. Sie müssen Hoffnung haben, mit der Veränderung<br />
mitzuhalten und ihr Leben weiter wie gewohnt leben zu können.<br />
24 BERLINER STIMME
Solidarisches Grundeinkommen<br />
statt Langzeitarbeitslosigkeit<br />
OBEN<br />
Das Solidarische Grundeinkommen bietet<br />
eine Vielzahl von gesellschaftlich relevante<br />
Tätigkeiten, wie einen Begleitservice für Menschen<br />
mit Handicap, Integrationslotsen oder die<br />
Unterstützung älterer Menschen im Haushalt.<br />
Hartz IV ist nicht gerecht<br />
Noch weiß niemand wirklich, wie sehr<br />
Digitalisierung die Arbeitswelt verändern<br />
wird. Doch eines müssen wir bedenken:<br />
Wenn neue Arbeitslosigkeit durch die<br />
sich ständig verändernde Arbeitswelt<br />
entsteht, dann müssen wir vorbereitet<br />
sein. Wir müssen verhindern, dass die<br />
Gesellschaft noch stärker mit Abstiegsängsten<br />
auf den digitalen Fortschritt<br />
reagiert. Abstiegsängste, die heute für<br />
viele Menschen mit dem Begriff Hartz IV<br />
verbunden sind. Ein System, das in über<br />
15 Jahren keine gesellschaftliche Akzeptanz<br />
erringen konnte.<br />
Das Solidarische Grundeinkommen<br />
setzt hier an. Es ist eine Alternative zu<br />
Hartz IV. Denn es macht den Menschen<br />
ein Angebot, bevor sie in das Hartz-System<br />
übergehen – also in der Regel nach einem<br />
Jahr Arbeitslosengeld I. Das SGE bietet<br />
fair bezahlte, sozialversicherungspflichtige<br />
und unbefristete Arbeit in der erweiterten<br />
sozialen Daseinsvorsorge<br />
bei einem kommunalen Unternehmen<br />
oder gemeinnützigen Verein.<br />
Noch kann man nicht sagen, ob das<br />
Solidarische Grundeinkommen im großen<br />
Stil kommen wird. Aber diese Idee hat in<br />
den vergangenen zwölf Monaten eine<br />
wichtige Diskussion angestoßen. Es wird<br />
endlich darüber gesprochen, ob wir eine<br />
neue soziale Agenda brauchen. Und viele<br />
fragen sich, ob das Sanktionssystem in<br />
Hartz IV gerecht ist und jahrzehntelange<br />
Arbeit nicht zu einem verlängerten Anspruch<br />
auf Arbeitslosengeld führen muss.<br />
Diese Diskussionen finde ich wichtig.<br />
Und ich habe es bereits mehrmals gesagt:<br />
Die Sanktionen gehören zumindest<br />
bei jungen Erwachsenen abgeschafft<br />
und das Arbeitslosengeld muss an die<br />
Erwerbsbiografie gekoppelt werden. Ich<br />
denke dabei an einen Anspruch von bis<br />
zu drei Jahren. Beides führt zu mehr Gerechtigkeit<br />
im System sowie der Abkehr<br />
von der Verwaltung von Arbeitslosigkeit<br />
zugunsten eines neuen Rechts auf Arbeit.<br />
In Berlin kommt das<br />
Solidarische Grundeinkommen<br />
Wir werden in Berlin mit einem Pilotprojekt<br />
prüfen, ob das SGE zu mehr<br />
Gerechtigkeit und dauerhafter Arbeit<br />
führen kann. Wir wollen dafür 1.000<br />
Arbeitsplätze schaffen. Und wir werden<br />
den Weg mit Verbänden, Sozialträgern,<br />
Gewerkschaften und der Arbeitsagentur<br />
konsensual klären und gemeinsam gehen.<br />
Ein zentraler Punkt ist, Arbeit an der<br />
Schwelle vom Arbeitslosengeld zu Hartz<br />
IV anzubieten. Denn nur so kann es als<br />
freiwilliges Arbeitsangebot die Angst vor<br />
dem Abstieg in Hartz IV nehmen und<br />
eine neue Chance auf dem Arbeitsmarkt<br />
bieten, bevor sich Vermittlungshemmnisse<br />
zu einer sich verstetigenden Langzeitarbeitslosigkeit<br />
aufbauen.<br />
B<br />
E<br />
R<br />
L<br />
I<br />
N<br />
E<br />
R<br />
S<br />
T<br />
I<br />
M<br />
M<br />
E<br />
N<br />
BERLINER STIMME<br />
25
B<br />
E<br />
R<br />
L<br />
I<br />
N<br />
E<br />
R<br />
S<br />
T<br />
I<br />
M<br />
M<br />
E<br />
N<br />
Ich hoffe, dass das derzeit im Bundestag<br />
diskutierte Teilhabechancengesetz<br />
durch eine Öffnung für Modellprojekte<br />
wie das Solidarische Grundeinkommen<br />
die Chance nutzt, mehrere Ideen zur<br />
Überwindung der Langzeitarbeitslosigkeit<br />
parallel umzusetzen. Denn es kann<br />
nicht Ziel von SPD-Politik sein, nur Arbeit<br />
über die üblichen maximal 24 Monate<br />
hinaus zu fördern, wenn die Menschen<br />
mindestens sieben Jahre arbeitslos<br />
sind, wie es das Teilhabechancengesetz<br />
für den sozialen Arbeitsmarkt vorsieht.<br />
Aus den Erfahrungen mit verschiedenen<br />
Projekten können wir später mit den<br />
richtigen sozialstaatlichen Instrumenten<br />
auf die Herausforderung der Digitalisierung<br />
auf dem Arbeitsmarkt reagieren.<br />
Es geht also um keine Alternative<br />
zum Teilhabechancengesetz unseres<br />
Arbeitsministers, es geht um eine gute<br />
Erweiterung der Instrumente.<br />
Umdenken zu einer<br />
neuen sozialen Agenda<br />
Vor 15 Jahren wurde als Antwort auf die<br />
wirtschaftliche Krise die Agendapolitik<br />
entwickelt. Die Welt und vor allem die<br />
Arbeitswelt hat sich seit 2003 in atemberaubender<br />
Geschwindigkeit verändert.<br />
Um Arbeit, Rente, Zusammenleben<br />
zukunftssicher zu machen, braucht es<br />
andere Instrumente als die der Agendapolitik<br />
und unseres tradierten Sozialsystems.<br />
Neben dem Solidarischen Grundeinkommen<br />
gehört dazu die Bürgerversicherung.<br />
Denn in der Arbeitswelt des<br />
Plattformkapitalismus verschwimmen<br />
die Grenzen zwischen angestellten<br />
und selbständig Arbeitenden immer<br />
mehr. Deswegen müssen wir alle gleichermaßen<br />
vor Gesundheitsrisiken<br />
absichern.<br />
Die Sozialdemokratie wird<br />
gerade heute gebraucht, um den<br />
Umbruch sozial zu gestalten.<br />
Wir müssen uns endlich der um sich<br />
greifenden Angst vor Altersarmut entgegenstellen.<br />
Den Menschen, die unseren<br />
Wohlstand mit ihrer Arbeit garantieren,<br />
ganz egal ob als Angestellte im öffentlichen<br />
Dienst, Krankenpfleger, Bau- oder<br />
Lagerarbeiterinnen, sind wir es schuldig,<br />
dass sie im Alter vor Armut gesichert sind.<br />
Die von der SPD in den Koalitionsvertrag<br />
eingebrachte Grundrente ist hier ein<br />
erster Schritt. Doch die Digitalisierung<br />
führt mitunter auch zu gebrochenen<br />
Lebensläufen. Deshalb sollten wir die<br />
Grundrente von der Lebensarbeitszeit<br />
entkoppeln und den Menschen im Alter<br />
mehr als nur die Grundsicherung garantieren.<br />
Und natürlich gehört zu einer sozialen<br />
Absicherung auch ein dafür nötiger<br />
Mindestlohn. Wir wollen in Berlin diesen<br />
entscheidenden Schritt gehen und unseren<br />
Landesmindestlohn von voraussichtlich<br />
11 Euro ab 2019 schrittweise auf<br />
12,63 Euro erhöhen und dann regelmäßig<br />
anpassen an den nötigen Betrag, der<br />
Altersarmut verhindert. Auch hier wird<br />
Berlin ein Vorbild für den Bund sein,<br />
dessen Mindestlohn von 9,19 Euro 2019<br />
und 9,35 Euro ein Jahr später nicht verhindern<br />
kann, dass Menschen Vollzeit<br />
arbeiten und trotzdem später zum Amt<br />
müssen, damit sie als „Aufstocker“ das<br />
Nötigste zum Leben haben.<br />
Es gibt viel zu tun für die Sozialdemokratie.<br />
Sie wird gerade heute gebraucht,<br />
um den Umbruch sozial zu gestalten. Denn<br />
nur durch eine grundlegende neue sozialpolitische<br />
Antwort können wir verlorenes<br />
Vertrauen in die SPD zurückgewinnen.<br />
26 BERLINER STIMME
Text Yannick Haan<br />
Fotos Marcel Mafei & Privat<br />
Rettet den Ortsverein!<br />
Die politischen Diskurse im Internet haben uns<br />
in eine digitale Unmündigkeit geführt, findet Yannick Haan,<br />
Netzexperte und Vorsitzender der SPD Alexanderplatz<br />
Ich bin ein so genannter Digital Native.<br />
Dies bedeutet, dass ich mit dem Internet<br />
aufgewachsen bin. Ich kann mich an<br />
keine Zeit mehr erinnern, in der ich mir<br />
meine neuen Schuhe nicht im Internet<br />
bestellt habe, in der ich nicht die Möglichkeit<br />
hatte, mich politisch online<br />
zu engagieren, oder in der ich nicht in<br />
Sekundenschnelle mit meinen Freunden<br />
um die Welt chatten konnte. Meine<br />
Generation, die mit dem Internet aufgewachsen<br />
ist, hat die sofortige Glückserfüllung<br />
per Mausklick gelernt. Ich<br />
klicke und bekomme eine unverzügliche<br />
Reaktion. Das ist ein wichtiges Prinzip<br />
des Internets. Mächtige Internetplattformen<br />
wie Facebook oder Google suggerieren, dass die Technik alleine<br />
unsere persönlichen, aber auch unsere gesellschaftlichen und politischen<br />
Probleme lösen kann. Der Klick ist in meiner Generation zum Symbol<br />
für die Lösung von Problemen geworden. Egal, ob die eigene mangelnde<br />
Fitness oder die Armut in der Welt: Jedes gesellschaftliche Problem lässt<br />
sich einfach mit einer neuen App auf dem Handy lösen.<br />
OBEN Yannick Haan<br />
B<br />
E<br />
R<br />
L<br />
I<br />
N<br />
E<br />
R<br />
S<br />
T<br />
I<br />
M<br />
M<br />
E<br />
N<br />
BERLINER STIMME<br />
27
RECHTS<br />
Yannick Haan beim SPD-Basecamp im April <strong>2018</strong>.<br />
Seine Abteilung Alexanderplatz kann sich ein<br />
„SPD Lab“ vorstellen, in dem Mitglieder<br />
über Themen diskutieren können, die im<br />
Ortsverein keine Rolle spielen.<br />
B<br />
E<br />
R<br />
L<br />
I<br />
N<br />
E<br />
R<br />
S<br />
T<br />
I<br />
M<br />
M<br />
E<br />
N<br />
Doch die Funktionsweise unserer<br />
Demokratie steht dem Klick diametral<br />
gegenüber. In der Demokratie kann<br />
ich nicht klicken und eine Reaktion<br />
erwarten. Ganz im Gegenteil: Unsere<br />
Demokratie ist schwerfällig, langsam<br />
und oftmals kompliziert. Ich habe selber<br />
erlebt, wie frustrierend die Arbeit<br />
in Parteien, vor allem in den heterogenen<br />
Volksparteien, sein kann. Man<br />
engagiert sich jahrelang, geht zu Sitzungen<br />
und vertritt dort die eigene<br />
Position. Dieser Aktion folgt aber nicht<br />
zwingend eine Reaktion, weshalb viele<br />
frustriert aufgeben. Die dem Internet<br />
immanente schnelle Bestätigung der<br />
Selbstwirksamkeit fehlt in der Parteiarbeit<br />
vollends.<br />
„In der digitalen<br />
Kommunikation ist die<br />
Tendenz zur Radikalisierung<br />
und Verkürzung<br />
im System angelegt.“<br />
Es hat sich in den vergangenen Jahren<br />
gezeigt, dass das Internet ein imposantes<br />
Medium für einen kurzen Aufschrei,<br />
für Shitstorms und Hashtags ist, sich<br />
aber bisher wenig für ein längerfristiges<br />
politisches Engagement eignet. In der<br />
Konsequenz verliert die klassische<br />
Demokratie meine Generation der<br />
Digital Natives zunehmend.<br />
Die politischen Diskurse im Internet haben<br />
uns zudem in eine digitale Unmündigkeit<br />
geführt. Der kleine Bildschirm<br />
unseres Smartphones eignet sich gut,<br />
um Informationen zu erhalten und für<br />
die unmittelbare Kommunikation. Aber<br />
eine politische Debatte braucht, ähnlich<br />
wie die Demokratie, Raum und Zeit. Die<br />
Verkürzung der Debatte auf 140, respektive<br />
jetzt 280 Zeichen hat dabei vor allem<br />
dem Rechtspopulismus genützt. In der<br />
digitalen Kommunikation ist die Tendenz<br />
zur Radikalisierung und Verkürzung im<br />
System angelegt. Das Sortieren durch<br />
Algorithmen verstärkt diesen Effekt.<br />
Folglich wird der Diskurs im Internet<br />
zunehmend segmentiert – und hasserfüllt.<br />
Die einzelnen Gruppen kommunizieren<br />
vermehrt unter sich und bestärken<br />
einander in den eigenen Positionen.<br />
Es zeigt sich immer mehr, dass die<br />
Geschäftsinteressen von Facebook den<br />
Geschäftsinteressen unserer Demokratie<br />
diametral gegenüberstehen.<br />
Unsere politischen Diskurse haben wir<br />
freiwillig auf Plattformen verlagert,<br />
deren Ziel es nicht ist, die Demokratie<br />
durch eine gute Debatte zu unterstützen,<br />
sondern die möglichst viel Aufschrei und<br />
damit möglichst viele Werbeeinnahmen<br />
generieren wollen. Sie wollen möglichst<br />
viel von uns erfahren, damit wir möglichst<br />
viel Zeit auf den Plattformen<br />
verbringen. Die neue Schablone, auf<br />
der unsere neuen politischen Diskurse<br />
stattfinden, wie die Begrenzung auf 280<br />
Zeichen, verändert unsere Demokratie<br />
langsam aber grundlegend – und das<br />
ohne gesellschaftliche Debatte oder Kontrolle.<br />
28 BERLINER STIMME
„Der Ortsverein kann zum neuen Symbol gegen den<br />
kaputten politischen Diskurs werden und zum Symbol<br />
gegen die politische Segmentierung.“<br />
Wir brauchen daher wieder neue politische<br />
Diskursräume. Für mich sind das<br />
inzwischen ganz klar die alten, nämlich<br />
die Volksparteien und die Ortsvereine.<br />
So anstrengend und angestaubt so ein<br />
Ortsverein vielleicht auch sein mag – er<br />
ist ein Ort, an dem ich mich mit unterschiedlichen<br />
Menschen treffe, ein Ort,<br />
an dem ich mich mit anderen Menschen<br />
auseinandersetzen muss und an dem<br />
ich nachdenken muss. Hier muss ich<br />
Kompromisse schließen, auf andere<br />
zugehen und eine Sprache sprechen,<br />
die nicht verletzend ist. Im Ortsverein<br />
kann man lernen, wie Demokratie<br />
funktioniert. Er kann daher zum neuen<br />
Symbol gegen den kaputten politischen<br />
Diskurs werden und zum Symbol gegen<br />
die politische Segmentierung.<br />
Ich weiß, dass der Ortsverein in meiner<br />
Generation nicht gerade für Begeisterungsstürme<br />
sorgt. Der Ortsverein ist<br />
heute allzu oft männlich, politisch entkernt<br />
und hat seine Arbeitsweise seit<br />
den 70er Jahren nicht mehr verändert.<br />
Aber warum kombinieren wir nicht das<br />
Gute aus dem Internet – wie die situative<br />
Zusammenarbeit, die Hierarchielosigkeit<br />
und die ortsungebundene Mitarbeit mit<br />
dem Guten aus dem Ortsverein? Es hält<br />
uns doch niemand davon ab, den Ortsverein<br />
neu zu erfinden.<br />
Es klingt abgedroschen, aber gerade jetzt<br />
braucht diese Demokratie uns Junge.<br />
Daher lasst uns zusammen einen neuen<br />
Ortsverein klicken. Ich mach’ dann auch<br />
den Kassenwart.<br />
B<br />
E<br />
R<br />
L<br />
I<br />
N<br />
E<br />
R<br />
S<br />
T<br />
I<br />
M<br />
M<br />
E<br />
N<br />
BERLINER STIMME<br />
29
Text & Foto Ulrich Horb<br />
Willy Brandts<br />
neues Europa<br />
Der Historiker Einhart Lorenz hat Willy Brandts erstes Buch<br />
aus dem Norwegischen übersetzt, das die Nazis im April 1940<br />
bis auf wenige Exemplare vernichtet hatten<br />
Kann man in einer solch dramatischen Zeit Ideen für ein friedliches<br />
Zusammenleben der Völker Europas entwickeln? Im Kriegsjahr 1940<br />
hat der 28-jährige Willy Brandt in der Osloer Emigration ein Buch über<br />
„Die Kriegsziele der Großmächte und das neue Europa“ geschrieben.<br />
Darin stellt er die Bildung einer europäischen Föderation als Weg zur<br />
Lösung von Konflikten auf dem Kontinent vor. Die Umstände, unter<br />
denen das Buch entstand, lenken den Blick wieder auf die ursprüngliche<br />
Idee eines friedlichen Europa, die es heute unter populistischen<br />
Angriffen immer schwerer hat.<br />
Willy Brandt, von seiner linkssozialistischen Arbeiterpartei SAP 1933<br />
nach Oslo entsandt, war gut vernetzt in der norwegischen Arbeiterbewegung.<br />
Er veröffentlichte Artikel in sozialistischen Zeitungen und<br />
Zeitschriften, auch längere Aufsätze. „Die Kriegsziele der Großmächte<br />
und das neue Europa“ war Brandts erste größere Buchveröffentlichung,<br />
geschrieben auf Norwegisch.<br />
Am 8. April 1940 hielt Brandt das erste Druckexemplar in Händen, die<br />
für den kommenden Tag geplante Auslieferung fand aber nicht mehr<br />
statt: Die deutsche Wehrmacht war in Norwegen einmarschiert. Die<br />
Druckauflage wurde von den Nazis bis auf wenige Exemplare vernichtet.<br />
Nun liegt der Band wieder vor, erstmals vollständig auf Deutsch.<br />
H<br />
I<br />
S<br />
T<br />
O<br />
R<br />
I<br />
E<br />
Der Historiker Einhart Lorenz hat Brandts Buch aus dem Norwegischen<br />
übersetzt. Brandt-Experte Lorenz, wesentlich an der zehnbändigen „<strong>Berliner</strong><br />
Ausgabe“ der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung mit Schriften<br />
Brandts beteiligt, sieht in dem Band „den Auftakt für Willy Brandt als<br />
politischen Schriftsteller“.<br />
30 BERLINER STIMME
OBEN<br />
Buchvorstellung mit den Historikern Einhart<br />
Lorenz (r.) und Michael F. Scholz (l.), moderiert<br />
von Bernd Rother von der Bundeskanzler Willy<br />
Brandt Stiftung<br />
Detailliert befasst sich der junge Autor,<br />
der nach 1945 wie kein zweiter das „andere<br />
Deutschland“ verkörperte, mit den<br />
unterschiedlichen Kriegs- und Friedenszielen.<br />
1939, so Brandt, sei der alte Krieg<br />
von 1914 wieder in Gang gekommen,<br />
der ohne sicheren Frieden nur vorläufig<br />
endete.<br />
und der konservativen Parteien, die<br />
Haltung der neutralen Staaten und der<br />
kleinen Länder, die unter den Druck der<br />
Großmächte geraten. Brandt argumentiert<br />
differenziert und mit viel Verständnis<br />
für die unterschiedlichen Interessen<br />
und Befindlichkeiten der Völker. Ein<br />
sicherer Friede sei der Wunsch der<br />
Menschen in allen Ländern. Und immer<br />
wieder kommt er auf den ihm logisch<br />
erscheinenden Vorschlag einer europäischen<br />
Föderation zurück, in der alle<br />
Völker selbstbestimmt und gleichberechtigt<br />
miteinander leben können.<br />
„Es besteht die Gefahr, dass das Donnern<br />
der Kanonen und die Blutströme noch<br />
einmal die Sehnsucht der Völker nach<br />
einem wahren und dauernden Frieden<br />
übertönen werden“, schreibt Brandt auf<br />
den letzten Seiten seines Buches. Er sollte<br />
recht behalten. Genauso wie mit seiner<br />
Vision von einem einigen Europa, das<br />
lange Jahre für Frieden gesorgt hat.<br />
Brandt macht den weltweiten Imperialismus<br />
für den Krieg verantwortlich,<br />
sieht nur in seiner Überwindung eine<br />
Chance für Frieden. Und er wendet sich<br />
auch scharf gegen die zu dieser Zeit mit<br />
Nazi-Deutschland verbündete Sowjetunion,<br />
die ihr Gebiet erweitern wolle<br />
und deren Planwirtschaft „auf Grund<br />
von Rückständigkeit und Isolation Opfer<br />
bürokratischer und diktatorischer Entartung<br />
wurde, statt sich weiter in sozialistischer<br />
Richtung zu entwickeln“.<br />
Untermauert mit vielen Zitaten und<br />
Quellen erläutert und hinterfragt er die<br />
offiziellen Kriegsziele der Staaten, auch<br />
Deutschlands, er zeichnet die Debatten<br />
darüber in den demokratischen Staaten<br />
nach, die Positionen der sozialistischen<br />
Willy Brandt<br />
DIE KRIEGSZIELE DER GROSSMÄCHTE<br />
UND DAS NEUE EUROPA<br />
Herausgegeben, übersetzt<br />
und eingeleitet von Einhart Lorenz<br />
Willy-Brandt-Dokumente, Band 4<br />
148 Seiten, Klappenbroschur, 18,00 Euro<br />
ISBN 978-3-8012-0535-5<br />
H<br />
I<br />
S<br />
T<br />
O<br />
R<br />
I<br />
E<br />
BERLINER STIMME<br />
31
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 1 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
PLÄDOYER<br />
Zeit für eine neue<br />
soziale Agenda<br />
INTERVI EW<br />
Lars Klingbeil über die<br />
Erneuerung der SPD<br />
TITELTHEMA<br />
ERNEUERUNG<br />
R EPORTAGE<br />
Inklusion und Teilhabe:<br />
Lisa lä st nicht locker<br />
TARIFVERTRÄGE<br />
Gleichberechtigt im Job<br />
#MET O<br />
Sexismus geht uns a le an<br />
TITELTH EMA<br />
FRAU.<br />
MACHT.<br />
ZUKUNFT.<br />
30 JAHRE QUOTE<br />
Wie hat sie die SPD verändert?<br />
INTERVIEW<br />
Christian Hoßbach: Neue Welle<br />
beim Thema Arbeitszeit<br />
ANALYSE<br />
PORTRÄT<br />
Wie können rechte Betriebsräte 50 Jahre in der SPD:<br />
verhindert werden?<br />
Klaus Böger<br />
ESSAY<br />
Die SPD und<br />
das Erbe der 68er<br />
I NTERVI EW<br />
Willkommen in<br />
Retrotopia<br />
PORTRÄT<br />
TITELTH EMA<br />
Rudi Uda und die<br />
Geschichte der Kreisfahne<br />
EUROPAWAHL<br />
Das sind die<br />
TITELTHEMA<br />
VOR 70 JAHREN<br />
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 9 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
Alle Ausgaben der BERLINER STIMME, die Erscheinungstermine<br />
und Schwerpunktthemen sowie Abo-Hinweise findest du hier:<br />
www.spd.berlin/aktuell/publikationen<br />
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 8 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 6 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 7 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
TITELTHEMA<br />
PFLEGE<br />
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 5 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 4 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
BERLINER STIMME<br />
BERLINER STIMME<br />
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 2 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
Zeitung der <strong>Berliner</strong> Sozialdemokratie | <strong>Nr</strong>. 3 · <strong>2018</strong> | 68. Jahrgang<br />
50 JAHRE 68ER<br />
Unsere Kandidatin<br />
Gabriel Bischo f im Interview<br />
LANDESPARTEITAG<br />
wichtigsten Beschlüsse<br />
EUROPA<br />
Wie die Berlin-Blockade<br />
die Stadt veränderte<br />
ÜBERBLICK<br />
Neues Miteinander –<br />
Berlin baut Bildung<br />
REPORTAGE<br />
Aus dem A ltag einer<br />
Grundschul-Rektorin<br />
TITELTHEMA<br />
BILDUNG<br />
TITELTHEMA<br />
BÜRGERSCHAFTLICHES<br />
ENGAGEMENT<br />
SAWSAN CHEBLI<br />
MEINUNG<br />
Peter Strieder:<br />
Verantwortung für Berlin<br />
Nicht im Zuschauermodus<br />
verharren<br />
BAHNHOFSMISSION<br />
„Die blaue Weste macht<br />
uns alle gleich“<br />
VOR 60 JAHREN<br />
Die „<strong>Berliner</strong> Abendschau“<br />
geht auf Sendung<br />
TITELTHEMA<br />
OST-BERLIN<br />
MARLITT KÖHNKE<br />
THOMAS KRÜGER<br />
WERNER RATAJCZAK<br />
Spaziergang durch den<br />
Gründe für die politische<br />
70 Jahre<br />
jüngsten Bezirk Berlins<br />
Resilienz im Osten<br />
für die Demokratie<br />
MANIFEST<br />
Pflege geht<br />
uns alle an!<br />
PLÄDOYER<br />
Ein neues<br />
Recht auf Arbeit<br />
REPORTAGE<br />
Der Alltag in<br />
einem Pflegeheim<br />
Die nächste Ausgabe der BERLINER STIMME<br />
mit dem Schwerpunktthema „Urbane Sicherheit“<br />
erscheint in der zweiten Dezember-Woche.<br />
UNSERE ZUKUNFT: MODERN UND SOZIAL<br />
u. a. mit<br />
Dilek Kolat<br />
Senatorin für Gesundheit,<br />
Pflege und Gleichstellung<br />
Michael Müller<br />
Landesvorsitzender<br />
der SPD Berlin<br />
Freitag<br />
30. November <strong>2018</strong><br />
18.00 Uhr · Einlass 17.30 Uhr<br />
Willy-Brandt-Haus<br />
Wilhelmstraße 141 · 10963 Berlin<br />
Wir bitten um Anmeldung unter<br />
www.spd.berlin/forum-pflege