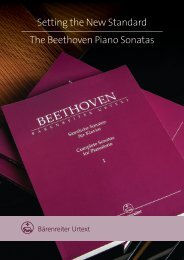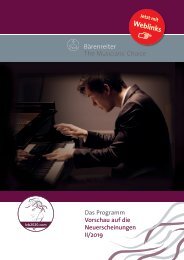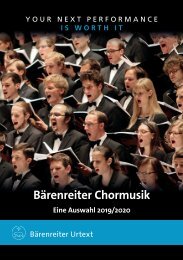Takte_2_19
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
[t]akte<br />
2I20<strong>19</strong><br />
Drachen gibt es<br />
auch heute noch<br />
Paul Dessaus Oper „Lanzelot“ wird wieder<br />
aufgeführt<br />
Fünfzig Jahre nach der Uraufführung gelangt<br />
Paul Dessaus Oper „Lanzelot“ in der ursprünglichen<br />
Fassung wieder auf die Bühne. Die Theater in<br />
Weimar und Erfurt nehmen sich ihrer an.<br />
Innere Stimmen<br />
Zwei neue Werke von Beat Furrer<br />
Nachdem Paul Dessau für seine ersten beiden Musiktheaterwerke<br />
Die Verurteilung des Lukullus (<strong>19</strong>51) und<br />
Puntila (<strong>19</strong>66) auf Vorlagen von Bertolt Brecht zurückgreifen<br />
konnte, wählte er für seine dritte, im Dezember<br />
<strong>19</strong>69 an der Deutschen Staatsoper Berlin uraufgeführte<br />
Oper Lanzelot ein Märchenstück des russischen Dramatikers<br />
Jewgeni Schwarz. Die Parabel Der Drache wurde<br />
<strong>19</strong>43 vor dem Hintergrund des Naziterrors geschrieben<br />
und war wegen der allzu deutlichen Kritik am totalitären<br />
Regime Stalins in der Sowjetunion zunächst<br />
17 Jahre lang verboten. <strong>19</strong>65 brachte Benno Besson<br />
das Stück über den Drachentöter in einer legendären<br />
Inszenierung am Deutschen Theater in Berlin heraus.<br />
Dessau entdeckte darin eine operntaugliche Vorlage<br />
mit den für ihn so wichtigen gesellschaftspolitischen<br />
Bezügen: Ein freier „Held“ möchte die Drachenstadt von<br />
seinem inhumanen, Angst und Schrecken verbreitenden<br />
Usurpator befreien, doch er stößt auf Desinteresse<br />
bei den Stadtoberen und der Bevölkerung, die sich<br />
„fressend, verdauend, fernsehend“ mit den bestehenden<br />
Verhältnissen arrangiert hat. Die Gleichgültigkeit<br />
schlägt in Feindseligkeit um, als Lanzelot den Drachen<br />
besiegt. Die offene Diktatur des Drachen wird umgemünzt<br />
in eine verdeckte Ausbeutung der Bevölkerung,<br />
in eine Herrschaft weniger über viele. Für die Liebe<br />
Elsas kehrt Lanzelot noch einmal zurück und vollendet<br />
sein Werk der Befreiung.<br />
Als Librettist wählte sich Paul Dessau (nicht ohne<br />
politische Brisanz) den befreundeten Dramatiker Heiner<br />
Müller, der wegen allzu großer Kritik am sozialistischen<br />
System seit <strong>19</strong>61 aus dem Deutschen Schriftstellerverband<br />
ausgeschlossen war und dessen Werke nicht<br />
mehr auf DDR-Bühnen gespielt werden durften. Zu der<br />
vielschichtigen textlichen Vorlage Müllers schuf Dessau<br />
eine ebenso vielfältige Musik: In ihren Grundzügen<br />
ist sie dodekaphon gearbeitet, der Drache wird mit<br />
bruitistischen Klängen des überbordenden Schlagapparats<br />
charakterisiert, daneben gibt es lyrische und<br />
karikaturistische Momente, eine Barockmusikparodie,<br />
Beat-Klänge, Mozart-Allusionen, Chopin-, Rossini-,<br />
Wagner- und nicht zuletzt Eigenzitate von Dessau. Das<br />
Finale erinnert in seiner dramaturgischen Anlage an<br />
Mozarts Zauberflöte: Letzter verzweifelter Vorstoß der<br />
Bösewichter, die Vernichtung des Bösen, glanzvoller,<br />
hymnischer Schlussgesang der Befreiten „Der Rest ist<br />
Freude. Freude der Rest“. Dem Finale ist in der ursprünglichen<br />
Fassung ein Epilog angefügt. In einem großen Diminuendo<br />
entfernen sich die Menschen von der Bühne,<br />
bis ein kleinen Kind übrig bleibt, das noch einmal die<br />
Schlussworte wiederholt, die „Freude“ aber gleichsam<br />
in Frage stellt. Nach der Uraufführung entzündete sich<br />
Kritik an diesem reduzierten, an Alban Bergs Wozzeck<br />
erinnernden Schluss. Dessau selbst scheint mit dieser<br />
dramaturgischen Lösung auch nicht zufrieden gewesen<br />
zu sein. Für die folgenden Produktionen – in München<br />
Paul Dessau (2. v. r.) im Dezember <strong>19</strong>74 bei einem Solidaritätskonzert<br />
vor seinem 80. Geburtstag zusammen mit (v. l.) Kurt Hager (Mitglied<br />
des Politbüros und Sekretär des ZK der SED), Ruth Berghaus (Intendantin<br />
des Berliner Ensembles), Werner Rackwitz (Stellvertreter des<br />
Ministers für Kultur der DDR) und Hans-Joachim Hoffmann (Minister<br />
für Kultur der DDR). (Foto: Katcherowski)<br />
(April <strong>19</strong>71) und Dresden (<strong>19</strong>71/72) – schrieb er wenige<br />
Wochen nach den Berliner Aufführungen die letzten<br />
<strong>Takte</strong> neu, so dass Lanzelot mit einem großen Chor- und<br />
Ensemblegesang optimistisch endet.<br />
Die Gattung der Oper war für Paul Dessau das<br />
„ausdrucksstärkste Genre, um die großen gesellschaftlichen<br />
Probleme unserer Zeit künstlerisch zu beleuchten“.<br />
Es spricht für Lanzelot, dass auch nach 50 Jahren<br />
die darin thematisierten Probleme und die enthaltene<br />
Gesellschaftskritik kaum an Aktualität verloren haben,<br />
denn Drachen gibt es auch heute und wird es immer<br />
wieder geben.<br />
Robert Krampe<br />
Paul Dessau<br />
Lanzelot. Oper in fünfzehn Bildern. Libretto:<br />
Heiner Müller und Ginka Tscholakowa (nach Motiven<br />
von Hans Christian Andersen und Jewgeni<br />
Schwarz‘ Märchenkomödie „Der Drache“)<br />
Premiere: 23.11.20<strong>19</strong> Weimar (Nationaltheater),<br />
Musikalische Leitung: Dominik Beykirch, Regie:<br />
Peter Konwitschny, Premiere Theater Erfurt:<br />
16.5.2020<br />
Besetzung: Lanzelot (Bariton), Drache (Bass), Elsa<br />
(Sopran), Charlesmagne (Bass), Bürgermeister<br />
(Tenor), Heinrich (Tenor), Kater (Sopran), 24 Nebenrollen,<br />
5 Tänzer/Pantomimen, Chorsolisten,<br />
großer Chor, Kinderchor<br />
Orchester: 4 (4 Picc, Afl), 3 (Eh), 3 (Bklar), Es-Klar,<br />
2Sax (S, A, T, Bar), 3 (Kfg) – 4,4,3,2 – Pk, Schlg – 2 Hfe,<br />
Git, Md – Klav (normales und präp. Klav), 2 Cemb.<br />
od. präp. Klav (auf Tonband), elOrg (auf Tonband),<br />
Cel, Akk, Harm – Str<br />
Verlag: Henschel Musik, Vertrieb: Bärenreiter ·<br />
Alkor<br />
In mia vita da vuolp<br />
„In meinem Leben als Fuchs / war ich alles und alles /<br />
war ich auch das Licht / die Sonne mein Antlitz / makellos<br />
…“ Die faszinierende Dichtung der Schweizerin<br />
Leta Semadeni wird zum Ausgangspunkt von Beat Furrers<br />
In mia vita da vuolp (Uraufführung:<br />
14.9.20<strong>19</strong> Rümlingen mit Rinnat Moriah<br />
[Sopran] und Marcus Weiss [Saxophon]).<br />
Aus der gleichnamigen Sammlung der<br />
Lyrikerin komponiert er fünf Texte, deren<br />
weitere Titel lauten: „Erinnerung an ein<br />
erschlagenes Pferd“, „Kasimir hat Liebeskummer“,<br />
„Im Weltraum“, „In den Nächten“<br />
– alle gleichermaßen enigmatisch<br />
und bilderreich. Beat Furrer fächert für<br />
den Farbenreichtum des Saxophons den<br />
Leta Semadini<br />
(Foto: Georg Luzzi)<br />
Tonraum noch weiter auf als bisher: Ein<br />
einziges unaufhaltsames Glissando zieht<br />
in der ersten dieser Allegorien des Todes<br />
den Klangraum in den Abgrund, in den Abwärtsbewegungen<br />
treten immer andere Klanglichkeiten des Saxophons<br />
hervor. Wie ein Schatten, der in immer anderen<br />
Erscheinungsweisen den Gesang begleitet, färbt das<br />
Instrument in vielfach aufgefächerten Spielweisen den<br />
Gesang. „In den Nächten / am Rande des Dorfes / wo ich<br />
wohne / am Rande der Dinge / schnappen / die Klingen<br />
/ des Winters / nach mir“ – endet das letzte Lied. Wie<br />
ein Schatten, der in immer anderen Erscheinungsweisen<br />
den Gesang begleitet, färbt das Saxophon diesen<br />
in vielfach aufgefächerten Spielweisen. Der Schluss<br />
lässt die Gesangsstimme in Saxophonmehrklängen<br />
mit komplexer Harmonik gleichsam verschwinden.<br />
Ensemblestück mit Klarinette für Donaueschingen<br />
Einem eng verwandten und doch grundverschiedenen<br />
Instrument widmet Beat Furrer sich in seinem neuen<br />
Werk für Klarinette und Ensemble für das Ensemble<br />
intercontemporain. Darin geht es ihm um die „Linie<br />
der Klarinette, um die Erscheinung dieses Soloinstruments.<br />
Alles wird Teil dieser Linie.“ Die Aufsplitterung<br />
der Solostimme in ganz verschiedene Klangqualitäten<br />
vollzieht sich in der ersten Phase des Werks. Die Klarinette<br />
wird in ihrer linearen Bewegung durch einzeln<br />
hinzutretende Instrumente verfärbt. Im großformalen<br />
Ablauf vollzieht sich ein Auffächern der Solostimme in<br />
komplexe klangliche Strukturen. Zwei Strukturen sind<br />
ineinander geführt, eine linear verlaufende und eine<br />
„kaleidoskopische“. Auf eine Verschiebung der Zeitlichkeiten<br />
zielt dieses Ineinander vielfacher Schichten. Das<br />
Stück entwickelt sich hin zu einem Unisono, in eine<br />
Quasi-Kadenz am Schluss, in der das ganz Ensemble<br />
in der Linie der Klarinette aufgeht.<br />
MLM<br />
Beat Furrer – aktuell<br />
20.10.20<strong>19</strong> Donaueschingen (Musiktage), Neues<br />
Werk für Klarinette und Ensemble (Uraufführung),<br />
Jérome Comte (Klarinette), Ensemble<br />
Intercontemporain, Leitung: Matthias Pintscher<br />
+++ 15.11.20<strong>19</strong> Dortmund, Studie II für Klavier<br />
(Uraufführung), Sergej Babayan, Klavier +++<br />
12.12.20<strong>19</strong> München, XENOS III, Münchner<br />
Kammerorchester, Leitung: Ilan Volkov +++<br />
11.1.2020 Köln, Phaos für Orchester, WDR Sinfonieorchester,<br />
Leitung: Michael Wendeberg +++<br />
10./12.1.2020 Berlin (Staatsoper), Violetter Schnee.<br />
Oper. Text von Händl Klaus basierend auf einer<br />
Vorlage von Wladimir Sorokin, Musikalische<br />
Leitung: Matthias Pintscher/Beat Furrer, Inszenierung:<br />
Claus Guth +++ 9.6.2020 Paris, Enigma<br />
I, III und VI (Frz. Erstaufführung), SWR Vokalensemble,<br />
Leitung: Yuval Weinberg<br />
Zum Tode Georg Katzers<br />
Der Komponist Georg Katzer, geboren am 10. Januar <strong>19</strong>35<br />
in Schlesien, ist am 7. Mai 20<strong>19</strong> in Berlin gestorben. Er<br />
studierte Komposition bei Rudolf Wagner-Régeny und<br />
Ruth Zechlin in Berlin (Ost) und an der Akademie der<br />
Musischen Künste in Prag. Danach<br />
war er Meisterschüler von Hanns<br />
Eisler an der Akademie der Künste<br />
der DDR, zu deren Mitglied er im<br />
Jahre <strong>19</strong>78 gewählt wurde. Er wurde<br />
zum Professor für Komposition in<br />
Verbindung mit einer Meisterklasse<br />
gewählt und gründete <strong>19</strong>82 das Studio<br />
für Elektroakustische Musik. Neben<br />
seiner kompositorischen Arbeit<br />
(Kammermusik, Orchesterwerke, Solokonzerte,<br />
drei Opern, zwei Ballette,<br />
Puppenspiele) beschäftigt sich Katzer<br />
auch mit Computermusik, Multimedia-Projekten<br />
und Improvisation.<br />
Kompositionspreise und Auszeichnungen erhielt er<br />
in der DDR, in der Schweiz, in Frankreich, in den USA<br />
und in der Bundesrepublik Deutschland, dort u. a. das<br />
Bundesverdienstkreuz (2002) und den Deutschen Musikautorenpreis<br />
(2012).<br />
Bei Henschel Musik (Bärenreiter-Verlagsgruppe) sind<br />
vier Bühnenwerke verlegt: Die Herren des Strandes. Ein<br />
Stück mit Songs von Friedrich Gerlach (<strong>19</strong>71), Das Land<br />
Bum-Bum (<strong>19</strong>78 Berlin), Gastmahl oder Über die Liebe<br />
(<strong>19</strong>88) und Antigone oder Die Stadt (<strong>19</strong>91). www.georgkatzer.de<br />
– (Foto: Angelika Katzer)<br />
]<br />
16 [t]akte 2I20<strong>19</strong><br />
[t]akte 2I20<strong>19</strong> 17