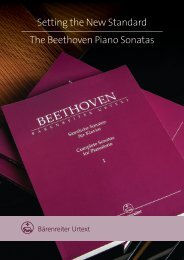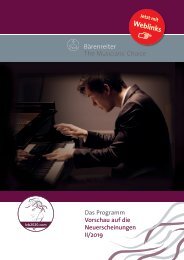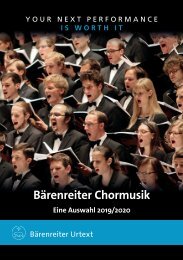Takte_2_19
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
[t]akte<br />
2I20<strong>19</strong><br />
„Faust est ressuscité!<br />
Faust vient de renaître!“<br />
Die Wiederentdeckung der Dialogfassung von<br />
Gounods „Faust“ auf der Bühne und auf CD<br />
Nach der konzertanten Erstaufführung der Dialogfassung<br />
von Charles Gounods „Faust“ ist nun<br />
die CD der Pariser Premiere erschienen, und in den<br />
USA hat die szenische Erstaufführung stattgefunden.<br />
Nicht immer nur die<br />
„Danse macabre“<br />
Die symphonischen Dichtungen<br />
von Camille Saint-Saëns<br />
Mit seinen vier symphonischen Dichtungen stellt<br />
sich Camille Saint-Saëns entschieden in die Tradition<br />
von Hector Berlioz und Franz Liszt. Die kritischen<br />
Erstausgaben bieten Gelegenheit für neue<br />
Interpretationen auf verlässlicher Quellengrundlage,<br />
nicht nur im Gedenkjahr 2021 (100. Todestag).<br />
Die konzertante Erstaufführung von Gounods Faust<br />
in seiner frühen, 1859 für das Pariser Théâtre-Lyrique<br />
entstandenen Fassung, mit wunderbaren, bislang unbekannten<br />
Melodramen und Rezitativen war eines der<br />
Präsente zu Gounods 200. Geburtstag. Inzwischen<br />
ist die Einspielung der Erstaufführung<br />
vom 14. Juni 2018 mit Véronique<br />
Gens (Marguerite), Benjamin Bernheim<br />
(Faust), Andrew Foster-Williams (Méphistophélès),<br />
dem Flemish Radio Choir<br />
und den Talens Lyriques unter der Leitung<br />
von Christophe Rousset auf CD in<br />
der Reihe Opéra français des Palazzetto<br />
Bru Zane erschienen. Auch die szenische<br />
Erstaufführung der Neuausgabe von Paul<br />
Prévost fand am 14. April 20<strong>19</strong> in Omaha<br />
(Nebraska) statt.<br />
Pressestimmen<br />
„Faust est ressuscité! Faust vient de renaître! – „Faust ist<br />
auferstanden! Faust ist wiedergeboren! Die Unterschiede<br />
gegenüber der üblicherweise aufgeführten Fassung<br />
sind zahlreich, vor allem ist es die Anwesenheit der<br />
gesprochenen Dialoge und der Mélodrames, die den<br />
generellen Tonfall des Werks verändern. Entsprechend<br />
den Prinzipien des Cromwell-Vorworts schrieben die<br />
Librettisten Jules Barbier und Michel Carré ein romantisches<br />
Drama, in dem das Groteske an das Erhabene<br />
grenzt, in dem sich Katholizismus mit französischem<br />
Witz mischt. Das Wort überlassen sie vor allem zwei<br />
Charakteren, die in der Fassung von 1869 eher diskret<br />
bzw. fast ganz gestrichen wurden: Wagner, ein Schüler<br />
Fausts, und Marthe, Marguerites Nachbarin. Beide sind<br />
Rollen der ,Opéra-comique‘, und wenn Méphisto noch<br />
mit teuflischem Schalk hinzukommt, so sind etliche<br />
Lacher sicher – was in der späteren Fassung eher nicht<br />
der Fall ist. […] Akt I, Bild 1 enthält ein substantielles<br />
Trio Faust-Siebel-Wagner. Im zweiten Bild bietet der<br />
Abschied von Marguerite und Valentin Anlass für ein<br />
kleines Duo. Während der Kirchweih singt Méphisto die<br />
,Chanson de Maître Scarabée‘ (die 1869 durch das ,Ronde<br />
du Veau d’or‘ ersetzt wurde). Im Garten-Akt sind Siebels<br />
Couplets mit gesprochenen Passagen durchsetzt. Und<br />
im Bild in Marguerites Kammer singt der junge Student<br />
nicht ,Si le bonheur à sourire t’invite‘, sondern die sehr<br />
schöne Arie ,Versez vos chagrins dans mon âme‘. In der<br />
Szene in der Kirche unterbricht der Chor mehrmals; und<br />
als Valentin aus dem Krieg heimkehrt, stürzt er, ein<br />
weit größerer Haudegen als in der bekannten Fassung,<br />
sich in martialische Couplets (die später der berühmte<br />
Soldatenchor ersetzt). Die Apothéose schließlich ist<br />
weit mehr ausgearbeitet und gibt dem Orchester deutlich<br />
mehr Gewicht.“<br />
Jacques Bonnaure, Opéra Magazine September 2018<br />
„Prévosts Arbeit ist unter musikologischem Gesichtspunkt<br />
faszinierend, aber, wichtiger noch, sie ist<br />
auch theatralisch nutzbar, wie diese berauschende<br />
Erstaufführung mit Christophe Rousset und den Talens<br />
Lyriques demonstriert, die mit der ihr eigenen<br />
Leichtigkeit und Präzision und einer toll schroffen<br />
Bläserabteilung auf zeitgenössischen Instrumenten<br />
spielen. Die traditionelle Eichen-Mahagoni-Orchestrierung<br />
des Werks macht lichteren Farben und klareren<br />
Linien Platz. Mit neuer Energie tanzt es in neuem<br />
Geist – nicht als die bekannte Tragödie, sondern mit der<br />
sprunghaften Energie einer Opéra demi-caractère. […]<br />
Vielleicht noch bemerkenswerter als die neue Musik<br />
aber ist der neue Geist, den diese Änderungen dem<br />
Werk einhauchen. Méphistophélès wird beinahe eine<br />
komische Rolle – ein städtischer, witziger Lebemann,<br />
der mit zahlreichen Spötteleien das Publikum umwirbt<br />
– assistiert von der aufgepeppten Rolle der geschwätzigen<br />
Nachbarin Dame Marthe. […] Dieser „neue“ Faust<br />
ist eine Offenbarung – eine faszinierende Ergänzung<br />
der bekannten Fassung von 1869 und zugleich eine<br />
aufregende Alternative.“<br />
Alexandra Coghlan, Opera September 2018<br />
Charles Gounod<br />
Faust. Oper in 5 Akten. Erstfassung 1859 mit Dialogen.<br />
Hrsg. von Paul Prévost. L’Opéra français.<br />
Verlag: Bärenreiter, BA 8714 (Aufführungsmaterial<br />
leihweise)<br />
„Die Opera Omaha gab der wiederhergestellten Fassung von ,Faust‘ ein himmlisches<br />
Debüt“ (World Herald 13.4.20<strong>19</strong>). Szenenfoto aus der szenischen Erstaufführung am 12.<br />
April 20<strong>19</strong> (Musikalische Leitung: Steven White, Inszeneriung: Lileana Blain-Cruz)<br />
In den 1870er Jahren ging es Camille Saint-Saëns im<br />
Umfeld der gerade gegründeten „Société nationale de<br />
musique“ darum, in der Instrumentalmusik Anschluss<br />
an die großen deutschen romantischen Orchesterwerke<br />
zu finden und für Frankreich ein genuines Repertoire<br />
zu entwickeln. Mit der Wahl der Gattung positionierte<br />
sich der Komponist zugleich musikpolitisch, nämlich<br />
auf der Seite der Neudeutschen, der „Zukunftsmusiker“,<br />
gegen reaktionäre Haltungen – und schürte damit,<br />
wie die frühen Presseberichte dokumentieren, in Paris<br />
damals gerade antideutsche Ressentiments. Diesen<br />
so spannenden wie kontroversen Prozess beschreibt<br />
ein spezielles Essay zur Rezeption des Editionsleiters<br />
Michael Stegemann im Gesamtausgaben-Band.<br />
Le Rouet d‘Omphale (Das Spinnrad der Omphale) war<br />
zunächst als ein Werk für zwei Klaviere konzipiert, und<br />
auch eine Fassung für Klavier solo erschien im Druck,<br />
bevor Saint-Saëns sein „Scherzo“ im März 1872 orchestrierte.<br />
Bereits am 14. April brachte es Jules Pasdeloup<br />
zur Aufführung. In einer der gedruckten Partitur vorangestellten<br />
Notiz erläutert der Komponist: „Sujet ist<br />
die weibliche Verführungskraft, der triumphierende<br />
Sieg der Schwäche über die Stärke. Das Spinnrad ist nur<br />
ein Vorwand, gewählt aus rhythmischen Überlegungen<br />
und wegen der grundsätzlichen Bewegtheit des Stückes.<br />
Wer sich für solche Details interessiert, kann<br />
beobachten, wie Herakles unter den Fesseln, die er<br />
nicht zerreißen kann, ächzt, und wie Omphale über die<br />
verzweifelten Versuche des Helden spottet.“<br />
Phaéton hob Édouard Colonne am 7. Dezember 1873<br />
im Théâtre du Châtelet aus der Taufe. „Der Kerngedanke<br />
von Phaéton ist der Hochmut, so wie der Kerngedanke<br />
von Le Rouet d’Omphale die Wollust ist“, erklärte<br />
Saint-Saëns. Als Quelle diente Saint-Saëns wohl der<br />
Phaeton-Mythos aus Ovids Metamorphosen. Phaeton<br />
war es gestattet, im Wagen seines Vaters, des Sonnengottes,<br />
durch den Himmel zu fahren. Doch verloren<br />
seine ungeübten Hände die Kontrolle über die Pferde.<br />
Der brennende Wagen kam vom Kurs ab und stürzte<br />
beinahe auf die Erde. Das gesamte Universum hätte in<br />
Flammen aufgehen können, hätte Zeus nicht den leichtsinnigen<br />
Phaeton mit seinem Blitz niedergestreckt.<br />
Die Danse macabre, heute wohl das bekannteste<br />
musikalische Totentanzstück überhaupt, hat ihren<br />
Ursprung in einem gleichnamigen Lied, das Saint-Saëns<br />
im August 1872 auf ein Gedicht mit dem Titel „Égalité –<br />
Fraternité“ von Henri Cazalis komponiert hatte. Nach<br />
dem Erfolg seiner beiden früheren symphonischen<br />
Dichtungen komponierte Saint-Saëns 1874 diese dritte<br />
als Erweiterung des Liedes. Der Partitur stellt er einen<br />
Ausschnitt aus dem Gedicht voran:<br />
Zig et zig et zag, la mort en cadence / Frappant une<br />
tombe avec son talon, / La mort à minuit joue un air<br />
de danse, / Zig et zig et zag, sur son violon.<br />
Édouard Colonne dirigierte,<br />
von der Presse<br />
wenig enthusiastisch<br />
aufgenommen, die erste<br />
Aufführung am 24.<br />
Januar 1875 im Concert<br />
du Châtelet sowie die<br />
Wiederholung am 7. Februar.<br />
Als Pasdeloup das<br />
Werk am 24. Oktober<br />
1875 dirigierte, reagierte<br />
das Publikum gar mit<br />
Pfiffen und Buhs; vielleicht<br />
dachte das Publikum<br />
schlicht, dass die<br />
verstimmte Geige falsch<br />
spielte? Die E-Saite der<br />
Solovioline nämlich, die<br />
die teuflische Seite der<br />
Musik verkörpert, ist auf<br />
Es heruntergestimmt und<br />
bildet so mit der leeren<br />
A-Saite das „diabolische”<br />
Intervall des Tritonus; an<br />
„Danse macabre“. Titelseite der Ausgabe für<br />
keiner Stelle geht der Solopart<br />
höher als bis zum<br />
Singstimme und Klavier (Paris, Énoch 1873)<br />
es 2 , so dass die Saite nur leer angespielt wird. Besonders<br />
ist auch der erstmalige Einsatz eines Xylophons<br />
im Orchester, das zu der ganz spezifischen Klangfarbe<br />
beiträgt.<br />
Saint-Saëns komponierte La Jeunesse d‘Hercule im<br />
Winter 1876/77 und am 28. Januar 1877 fand die Uraufführung<br />
unter der Leitung von Édouard Colonne<br />
statt. Die Xenophons Memorabilia entnommene Fabel<br />
erzählt, wie Herakles sich am Anfang seines Lebens<br />
zwischen zwei Wegen entscheiden muss: demjenigen<br />
der Lebensfreude und demjenigen der Tugend. Den<br />
Verführungskünsten der Nymphen und Bacchantinnen<br />
gegenüber unempfänglich, macht der Held sich<br />
auf seinen Lebensweg voller Kämpfe und Herausforderungen,<br />
an dessen Ende ihm durch die Flammen des<br />
Scheiterhaufens als Lohn die Unsterblichkeit winkt.<br />
Hugh Macdonald / Annette Thein<br />
Camille Saint-Saëns<br />
Le Rouet d’Omphale, op. 31, Phaéton, op. 39, Danse<br />
macabre, op. 40, La Jeunesse d’Hercule, op. 50.<br />
Édités par Hugh Macdonald. Œuvres instrumentales<br />
complètes I/4.<br />
Verlag: Bärenreiter. BA 10307-01, Aufführungsmaterial<br />
käuflich (Danse macabre), leihweise<br />
(op. 31, 39, 50)<br />
]<br />
8 [t]akte 2I20<strong>19</strong><br />
[t]akte 2I20<strong>19</strong> 9