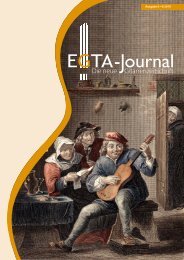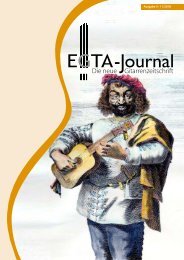EGTA-Journal 2020-11
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Michael Quell
©Raphael Ophaus
Abbildung 6: Raphael Ophaus und Michael Quell im Atelier des Komponisten während der Arbeit an
„Meister Eckhart und Suhrawardi“ im Jahr 2017.
spielen dürfen, waren die Suite für Gitarre
von Krenek und die Tentos von Henze.
Mir haben allerdings schon damals
andere Strukturen vorgeschwebt,
die in einer unglaublichen Diskrepanz
zu der Musik von
beispielsweise
Tárrega
standen. Als ich dann mit
15 oder 16 Jahren im
Theorieunterricht
das
erste Mal Atmosphères
von Ligeti hörte, ist
mir bewusst geworden,
dass es schon
einige Werke gibt,
die
meiner Vorstellung
entsprechen. Ich
dachte, dass das auch
für Gitarre möglich sein müsste und
habe dann nach entsprechenden Werken
gesucht, ohne fündig zu werden. So
entstand das Bedürfnis, derartige Räume
mit dem Instrument zu öffnen.
Darüber hinaus ist mir die Tradition sehr
wichtig. Ich habe mich intensiv mit alter
Musik - also jener Musik vor 1600 - beschäftigt.
Ich fand Dowland, Mudarra
und Narváez unglaublich spannend und
auch das schwingt in meiner Musik mit.
Die Musik heute ist nicht abgekoppelt
von dem, was dereinst war. Als Abstraktum
ist es im Hintergrund und bestimmte
abstrakte Prinzipien tauchen immer
wieder auf: strukturelles Denken, formales
Denken usw.
Die Frage nach der Tradition aufgreifend
würde mich interessieren
welche Komponisten,
du hast Ligeti bereits angesprochen, für
dich prägend waren und wie du dein
Komponieren in der Gegenwart verorten
würdest. Ernst Flammer hat dein
Schaffen beispielsweise in die Nähe von
Claus-Steffen Mahnkopf gerückt. Wie
stehst du zu dieser Einordnung?
Historisch betrachtet bin ich von dem
geprägt, was ich viel gespielt und gehört
habe. Als junger Mensch hat mich
die Tradition um Bach sehr fasziniert. Ich
habe mich aber auch bereits relativ früh
für die Musik der Renaissance interessiert.
Die Sonaten von Beethoven und
auch das Ringen von Wagner am Rande
der Tonalität hat mich sehr begeistert.
Von der Wiener Schule haben mich
Schönberg und Webern am meisten beeindruckt
und auch mit Wyschngradsky
und seinem Umgang mit der Mikrotonalität
habe ich mich früh beschäftigt.
Die Argumentation von Flammer in Bezug
auf die Nähe meiner Musik zu jener
Mahnkopfs ist natürlich plausibel.
Mahnkopf ist jemand, der auf sehr hoher
Ebene ästhetisch reflektiert und das in
einen festen Zusammenhang mit seiner
Musik bringt. Das ist faszinierend und ein
Anspruch, den auch ich habe. Trotz dessen
würde ich meine Musik anders verorten.
Ich tendiere sehr viel stärker zu einer
inneren Energetik, als dies etwa bei
Mahnkopf im Zentrum stünde.
Wie würdest du deine Musik
charakterisieren?
Für mich ist wichtig, nicht in einen reinen
Subjektivismus zu geraten. Es geht
mir darum, dass die harmonische Dispo-
Ausgabe 9 • 11/2020
13