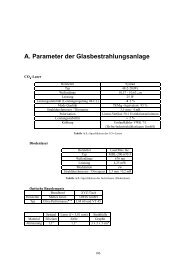Der Mittlere Muschelkalk in Bohrungen Norddeutschlands: Fazies ...
Der Mittlere Muschelkalk in Bohrungen Norddeutschlands: Fazies ...
Der Mittlere Muschelkalk in Bohrungen Norddeutschlands: Fazies ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zusammenfassung 9<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
<strong>Der</strong> <strong>Mittlere</strong> <strong>Muschelkalk</strong> des Norddeutschen Beckens besteht aus Dolomiten, Mergeln, dolomitischen<br />
Kalken, Anhydriten/Gipsen und Ste<strong>in</strong>salzen. Infolge von Ablaugung fehlen die evaporitischen<br />
Anteile heute z. T. großflächig bis <strong>in</strong> Teufen von 450 m unter Oberfläche. Vollständige, nicht abgelaugte<br />
Profile s<strong>in</strong>d nur <strong>in</strong> Tiefbohrungen und Gruben-Aufschlüssen zu beobachten.<br />
Als Ablagerungsraum wird e<strong>in</strong>e epikont<strong>in</strong>entale Karbonatplattform mit flachmar<strong>in</strong>en subtidalen bis<br />
<strong>in</strong>ter-/supratidalen niedrig-energetischen Ablagerungsbed<strong>in</strong>gungen angenommen. E<strong>in</strong> arides Klima sowie<br />
e<strong>in</strong>e periodische Abgeschlossenheit des Sedimentationsraumes begünstigen Sal<strong>in</strong>itäten bis zur Halitübersättigung.<br />
Die Bohrung Reml<strong>in</strong>gen 7 ist e<strong>in</strong>e der wenigen <strong>Bohrungen</strong> <strong>Norddeutschlands</strong>, die den <strong>Mittlere</strong>n<br />
<strong>Muschelkalk</strong> e<strong>in</strong>schließlich se<strong>in</strong>er halitischen Anteile vollständig gekernt hat. E<strong>in</strong>e auf mikrofaziellen,<br />
geochemischen und geophysikalischen Untersuchungen basierende Sequenzanalyse dieser Bohrung<br />
führte zu e<strong>in</strong>er lithostratigraphischen Fe<strong>in</strong>gliederung und zur Abgrenzung von 9 Zyklen mit transgressiv-regressiven<br />
(„shallow<strong>in</strong>g-upward“, „br<strong>in</strong><strong>in</strong>g-upward“) Trends und charakteristischem <strong>Fazies</strong>verhalten.<br />
In den geophysikalischen Bohrlochmessungen (Gamma-Ray-, Sonic-Log) s<strong>in</strong>d die Zyklen<br />
durch charakteristische Logbilder gekennzeichnet. Die Zyklen können e<strong>in</strong>deutig den lithostratigraphischen<br />
E<strong>in</strong>heiten des <strong>Mittlere</strong>n <strong>Muschelkalk</strong>s, der Karlstadt-, der Heilbronn- und der Diemel-Formation,<br />
zugeordnet werden.<br />
Basierend auf der Zyklischen Gliederung des Standardprofils Reml<strong>in</strong>gen 7 wurden 60 <strong>Bohrungen</strong><br />
<strong>Norddeutschlands</strong> mit Hilfe von Gamma-Ray- und Sonic-Log mite<strong>in</strong>ander korreliert. Die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Zyklen lassen sich trotz lateraler <strong>Fazies</strong>schwankungen und Mächtigkeitsänderungen durch das gesamte<br />
Norddeutsche Becken verfolgen.<br />
<strong>Der</strong> erste Zyklus, der der Karlstadt-Formation zugerechnet wird, wird im gesamten Becken von<br />
Dolomiten/Dolomitmergeln aufgebaut, massive Anhydrite und Ste<strong>in</strong>salz kamen nicht zur Ablagerung.<br />
Die Zyklen 2 – 8 (Heilbronn-Formation) zeigen regional e<strong>in</strong>e unterschiedliche lithologische Ausbildung<br />
und Mächtigkeitsentwicklung. <strong>Der</strong> zweite Zyklus ist mit Dolomiten bis Ste<strong>in</strong>salz nur im Beckenzentrum<br />
vollständig ausgebildet. Zum Beckenrand h<strong>in</strong> tritt Ste<strong>in</strong>salz zurück und Dolomit, Anhydrit<br />
und Ste<strong>in</strong>salz des dritten Zyklus lagern direkt auf den Sulfaten des zweiten Zyklus. Das Ste<strong>in</strong>salz des<br />
dritten Zyklus ist im Bereich des Norddeutschen Beckens am weitesten verbreitet und am mächtigsten.<br />
<strong>Der</strong> Zyklus 4 zeigt e<strong>in</strong>e dem Zyklus 3 ähnliche Ausbildung und Verbreitung. Während <strong>in</strong> mehr<br />
bec??kenrandlich gelegenen Gebieten nur die Zyklen 3 und 4 ste<strong>in</strong>salzführend s<strong>in</strong>d, enthält im<br />
Beckenzentrum neben dem Zyklus 2 auch der Zyklus 5 Halit. Die Zyklen 6 - 8 werden <strong>in</strong> der Regel im<br />
gesamten Becken von Dolomit und Anhydrit aufgebaut. Die Grenze zum Zyklus 9, der Diemel-Formation,<br />
wird durch das letztmalige Auftreten von synsedimentären Anhydrit bestimmt. Im Zyklus 9<br />
dom<strong>in</strong>iert e<strong>in</strong>e Karbonatsedimentation.<br />
Geochemisch lassen sich e<strong>in</strong>heitliche Entwicklungstendenzen sowohl der Elementverteilungen als<br />
auch der -konzentrationen <strong>in</strong>nerhalb der Zyklen aufzeigen. Gegenüber dem Zyklus 1 haben die Zyklen<br />
2 - 8 der Heilbronn-Formation deutlich höhere Gehalte an Ca und SO3, leicht erhöhte Gehalte an den<br />
terrigenen Elementen sowie ger<strong>in</strong>ge Mg-Konzentrationen. Auffällig s<strong>in</strong>d markant erhöhte Zr-Gehalte.<br />
Hohe Gehalte terrigen gebundener Elemente kennzeichnen jeweils die Basis der e<strong>in</strong>zelnen Zyklen.<br />
Diese belegen verdünnende mar<strong>in</strong>e und kont<strong>in</strong>entale Zuflüssen mit gelöster oder detritischer Fracht.<br />
Zum Hangenden nehmen diese Konzentrationen ab. Konzentrationsänderungen h<strong>in</strong> zu überwiegend<br />
hohen Gehalten an sal<strong>in</strong>aren Elementen am Top der Zyklen korrelieren sehr gut mit den ausgehaltenen<br />
Zyklen. <strong>Der</strong> Zyklus 9 lässt im Chemismus e<strong>in</strong>e deutliche Zweiteilung erkennen, die auf Konzentrationsänderungen<br />
von Ca, Mg und Sr sowie der terrigenen Elemente zurückgeführt wird. An der<br />
Grenze zum Oberen <strong>Muschelkalk</strong> steigt das Ca/Mg-Verhältnis markant an.