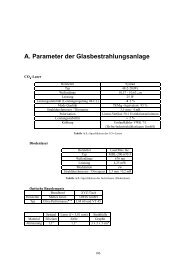Der Mittlere Muschelkalk in Bohrungen Norddeutschlands: Fazies ...
Der Mittlere Muschelkalk in Bohrungen Norddeutschlands: Fazies ...
Der Mittlere Muschelkalk in Bohrungen Norddeutschlands: Fazies ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
44<br />
Das Referenzprofil für den <strong>Mittlere</strong>n <strong>Muschelkalk</strong> – die Bohrung Reml<strong>in</strong>gen 7<br />
5.4 Lithologie und Logbild des <strong>Mittlere</strong>n <strong>Muschelkalk</strong>s <strong>in</strong> der<br />
Bohrung Reml<strong>in</strong>gen 7<br />
5.4.1 Das Liegende des <strong>Mittlere</strong>n <strong>Muschelkalk</strong>s (Abb. 14, Anl. 4,<br />
Taf. 31 - 34)<br />
<strong>Der</strong> Bereich der Schaumkalkbänke des Unteren <strong>Muschelkalk</strong>s (Jena-Formation) wird von grauen<br />
ebenflächigen, plattigen Mergelkalken aufgebaut, denen hellbraune, schwach poröse, z. T. peloidführende,<br />
mikritische Dolomite zwischengeschaltet s<strong>in</strong>d. Fe<strong>in</strong>verteilt s<strong>in</strong>d Anhydritdrusen enthalten, die<br />
z. T. Größen bis <strong>in</strong> den cm-Bereich haben können. Die grauen Mergelkalke s<strong>in</strong>d z. T. hellbraun gefleckt,<br />
was z. T. auf e<strong>in</strong>en erhöhten Anteil an organischer Substanz, z. T. auf partielle Dolomitisierung<br />
zurückzuführen ist. Die schwach porösen Dolomite werden als Äquivalente der Unteren und <strong>Mittlere</strong>n<br />
Schaumkalkbank gedeutet. Lithologisch konnten diese beiden Schaumkalkbänke nicht e<strong>in</strong>deutig abgegrenzt<br />
werden, da diese Bereiche aufgrund früherer Beprobungen nicht mehr als Bohrkern für die lithologischen<br />
Bearbeitung zur Verfügung standen. Die Abgrenzung erfolgte daher logstratigraphisch.<br />
Die Obere Schaumkalkbank ist als Peloid-Dolomit ausgebildet. Die Peloide s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Schichtung<br />
e<strong>in</strong>geregelt, Schrägschichtung konnte beobachtet werden. Innerhalb der Oberen Schaumkalkbank<br />
nimmt der Peloidanteil bis auf ca. 70 % zu. E<strong>in</strong> abrupter Wechsel von der Calcitfazies des Unteren<br />
<strong>Muschelkalk</strong>s zur Dolomitfazies wurde nicht beobachtet. Die obere Schaumkalkbank ist bereits vollständig<br />
sekundär dolomitisiert.<br />
Im Logbild lässt sich der Bereich der Schaumkalkbänke aufgrund se<strong>in</strong>er lithologischen Differenzierung<br />
gut identifizieren. Typisch s<strong>in</strong>d relativ scharfe, abrupte Wechsel der Strahlungs<strong>in</strong>tensitäten im<br />
Gamma-Ray und der Schall-Laufzeiten im Sonic-Log. Charakteristisch für die e<strong>in</strong>zelnen Schaumkalkbänke<br />
(muS1, muS2, muS3) ist e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>ge natürliche Radioaktivität. Dies bedeutet, dass <strong>in</strong> der<br />
Messkurve diese Karbonatbank-Bereiche Gamma-Ray-Ausschläge nach l<strong>in</strong>ks zu ger<strong>in</strong>geren Strahlungswerten<br />
h<strong>in</strong> aufweisen, während sie im Sonic-Log durch e<strong>in</strong>e höhere Schallhärte, d.h. ger<strong>in</strong>gere<br />
Laufzeiten (Ausschläge nach rechts) charakterisiert s<strong>in</strong>d. Die im Bereich der Schaumkalkbänke e<strong>in</strong>geschalteten<br />
mergeligen Zwischenmittel s<strong>in</strong>d, bed<strong>in</strong>gt durch ihren höheren Tonanteil, durch Gammastrahlungsspitzen<br />
(Peaks nach rechts, G1 (M), G2 (M)) sowie ger<strong>in</strong>gere Ausschläge <strong>in</strong> der Sonic-<br />
Kurve nach l<strong>in</strong>ks zu höheren Laufzeiten h<strong>in</strong> gekennzeichnet.<br />
Auf regionale <strong>Fazies</strong>wechsel <strong>in</strong>nerhalb des Bereichs der Schaumkalkbänke wies bereits KOLB<br />
(1976) im Subherzyn-Becken h<strong>in</strong>. Die typischen Schaumkalke werden teilweise von dichten Kalken<br />
bis dolomitischen Kalken ersetzt. PATZELT (1988) beschreibt aus Nordwestthür<strong>in</strong>gen das Äquivalent<br />
der <strong>Mittlere</strong>n Schaumkalkbank als massig-bankigen, 1,35 m mächtigen Dolomitmergelste<strong>in</strong>. Untypische<br />
<strong>Fazies</strong>verhältnisse der Unteren und <strong>Mittlere</strong>n Schaumkalkbank s<strong>in</strong>d ebenfalls aus Oberdorla<br />
(Thür<strong>in</strong>ger Becken) bekannt.<br />
Die Grenze Unterer/<strong>Mittlere</strong>r <strong>Muschelkalk</strong> wird def<strong>in</strong>itionsgemäß an die Oberkante der Oberen<br />
Schaumkalkbank (738,77 m) gelegt (Kap. 4.1).<br />
5.4.2 Karlstadt-Formation (Abb. 14, Anl. 4, Taf. 29 - 31)<br />
Das Gamma-Ray-Log der Bohrlochvermessung der Bohrung Reml<strong>in</strong>gen 7 weist im Grenzbereich<br />
Unterer/<strong>Mittlere</strong>r <strong>Muschelkalk</strong> e<strong>in</strong>e Messlücke auf, die sowohl den allerhöchsten Teil des Unteren<br />
<strong>Muschelkalk</strong>s als auch die basalen Partien des <strong>Mittlere</strong>n <strong>Muschelkalk</strong>s bzw. der Karlstadt-Formation<br />
umfasst. Auch im Sonic-Log liegt für diesen Bereich ke<strong>in</strong>e kont<strong>in</strong>uierliche Messung vor, liegen hier<br />
doch das Ende bzw. der Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>er Messrout<strong>in</strong>e. Für die Übertragung der an den Bohrkernen der<br />
Bohrung Reml<strong>in</strong>gen 7 erarbeiteten Fe<strong>in</strong>gliederung des <strong>Mittlere</strong>n <strong>Muschelkalk</strong>es auf andere <strong>Bohrungen</strong>