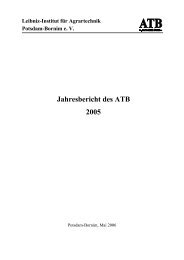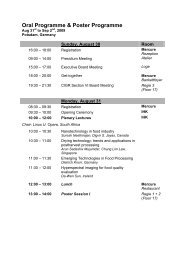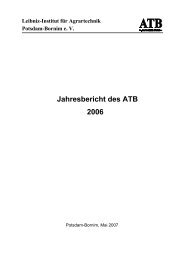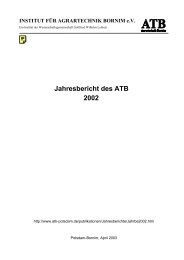Jahresbericht des ATB 2003
Jahresbericht des ATB 2003
Jahresbericht des ATB 2003
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
INSTITUT FÜR AGRARTECHNIK BORNIM e.V.<br />
Ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft<br />
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
<strong>2003</strong><br />
http://www.atb-potsdam.de/publikationen/<strong>Jahresbericht</strong>e/Jahrbe<strong>2003</strong>.htm<br />
Potsdam-Bornim, April 2004
INHALTSVERZEICHNIS<br />
I Allgemeiner Teil<br />
1 Aufgaben und Forschungsschwerpunkte ........................................................................................ 1<br />
2 Bericht <strong>des</strong> Wissenschaftlichen Direktors ....................................................................................... 2<br />
II Fachliche Ergebnisse - Berichterstattung zu den Forschungsschwerpunkten 1 bis 7<br />
1 Grundlagen für eine nachhaltige Landbewirtschaftung bei .............................................................<br />
unterschiedlicher Produktionsintensität (Forschungsschwerpunkt 1)<br />
Ökonomische Bewertung von Offenlandmanagement auf ehemaligen und in Nutzung befindlichen Truppenübungsplätzen<br />
im pleistozänen Flachland Nordostdeutschlands<br />
Optimierung der Steuerung von modernen Beregnungsanlagen und die ökologische und ökonomische Bewertung<br />
großflächiger Bewässerung<br />
Reduzieren <strong>des</strong> Frischwasserverbrauchs bei der Gemüsewäsche durch die Verwertung von aufbereitetem<br />
Waschwasser im geschlossenen Kreislauf<br />
Einfluss der Verfahrensgestaltung im Pflanzenbau und in der Tierhaltung auf Stoff- und Energieflüsse 10<br />
Stickstoffbilanz nachwachsender Rohstoffe auf sandigen Standorten 11<br />
Stickstoffumsätze auf sandigen Ackerböden 12<br />
2 Teilflächenspezifische Bewirtschaftung und Nutzung von ..............................................................<br />
Satellitentechnik im Pflanzenbau (Forschungsschwerpunkt 2)<br />
Entwicklung einer low-input Lösung für die teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Betriebsmaßstab 15<br />
Durchführung von Sensormessungen zur Variabilitätsbestimmung auf Ackerflächen und zur Stickstoffbedarfsermittlung<br />
Ökonomische und ökologische Bewertung <strong>des</strong> Einsatzes von Sensoren zum teilflächenspezifischen Pflanzenschutz 17<br />
Einsatz eines Pendelsensors zur Heterogenitätsbestimmung von landwirtschaftlichen Nutzflächen 18<br />
Sensorgestützte Applikation von Stickstoffdünger, Wachstumsreglern und Fungiziden 19<br />
Messsystem zur Bewertung <strong>des</strong> Unkrautvorkommens 20<br />
Untersuchungen zur Detektionsmöglichkeit von Krankheitsbefall in Getreide mittels Thermographie 21<br />
Untersuchungen zur Nachweisbarkeit von Pilzinfektionen an Pflanzen mit Hilfe der Fluoreszenzspektroskopie 22<br />
Untersuchungen zur Dynamik <strong>des</strong> Bestan<strong>des</strong>klimas und Infektionsgeschehens mit Pilzkrankheiten in heterogenen<br />
Getrei<strong>des</strong>chlägen<br />
Untersuchungen zur Optimierung <strong>des</strong> Einsatzes von Sensoren für die Erfassung von Boden- und Pflanzenparametern<br />
auf landwirtschaftlichen Nutzflächen<br />
3 Qualitätssicherung bei der Lagerung, Konservierung und ..............................................................<br />
Verabreichung von Futtermitteln für Nutztiere (Forschungsschwerpunkt 3)<br />
Entwicklung und Bewertung <strong>des</strong> Prinzips einer Bandmähmaschine 26<br />
Erhöhung der Stabilität von Grünfuttersilagen 27<br />
Lagern und Konservieren eiweißreicher, wirtschaftseigener Grundfuttermittel 28<br />
Untersuchungen zur on-line Messung der Siliergutdichte 29<br />
Optimierte Steuerung von Getreide-Schachttrocknern 30<br />
Untersuchungen zum Fließverhalten von landwirtschaftliche Dickstoffen 31<br />
Verschleißeinfluss auf das Förderverhalten von Drehkolbenpumpen 32<br />
5<br />
6<br />
8<br />
9<br />
13<br />
16<br />
23<br />
24<br />
25<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
4 Umweltverträgliche und tiergerechte Haltung von Rindern, ............................................................<br />
Schweinen und Geflügel (Forschungsschwerpunkt 4)<br />
Untersuchung und Bewertung von Verfahren der Rinder- und der Schweinehaltung in Bezug auf Verbraucher- und<br />
Umweltschutz, Tiergerechtheit und ökonomische Konsequenzen<br />
Einfluss verschiedener Abdeckmaterialien auf die Ammoniak- und Methanemissionen von Gülle bei der Lagerung 36<br />
Lufttechnische Systeme zur Emissions- und Immissionsminderung in der Tierhaltung 37<br />
Reduzierung der Emission von Treibhausgasen, Ammoniak und Gerüchen, die aus landwirtschaftlichen Aktivitäten<br />
insbesondere aus der Tierhaltung resultieren<br />
Analyse <strong>des</strong> Informationswertes und der Funktionalität verschiedener Systeme zur Erfassung der Tieraktivität 39<br />
Anwendungspotential bildgebender Verfahren im NIR- und MIR-Bereich für das Management von Rinderherden 40<br />
Parameter der Mastitisprüfung bei Milchkühen – physiologische Zusammenhänge und analytische Möglichkeiten 41<br />
Reduzierung der Euterbelastung beim Melkprozess durch technische Veränderungen am Melkzeug 42<br />
Untersuchungen zum Einfluss der Melktechnik auf die Qualität <strong>des</strong> Melkens 43<br />
5 Qualität und Wettbewerbsfähigkeit bei der Ernte und in der ...........................................................<br />
Nachernteperiode leichtverderblicher Produkte (Forschungsschwerpunkt 5)<br />
Physiologische Eigenschaften gartenbaulicher Produkte in der Nachernte 46<br />
Festigkeitseigenschaften gartenbaulicher Produkte 47<br />
Grundlagen der Frischemessung von Gartenbauprodukten 48<br />
Einfluss von Licht auf die physiologische Aktivität verpackter Blattgemüse 49<br />
Optische Eigenschaften gartenbaulicher Produkte 50<br />
Messung von Fruchtpigmenten mit Hilfe der Fluoreszenzspektroskopie 51<br />
Erfassung mechanischer Belastungen von Früchten 52<br />
Verfahrenstechnische Untersuchungen zur beschädigungsarmen Ernte, zum schonenden Transport und zur belastungsarmen<br />
Lagerung von Kartoffeln<br />
Anwendung der Thermografie zur Optimierung der Belüftungssteuerung bei der Lagerhaltung landwirtschaftlicher Produkte<br />
Kurzzeitlagerung von Steinobst, Optimierung der Qualitätserhaltung 55<br />
Ein System zur online Stärkebestimmung bei Einzelknollen 56<br />
Entwicklung von Waschdüsen für eine effizientere Wäsche von Gemüse und Speisekartoffeln 57<br />
Ozontes Waschwasser zur Qualitätssicherung leichtverderblicher Produkte - Entwicklung einer Fuzzy Logic Steuerung<br />
<strong>des</strong> Waschprozesses<br />
PC-Programm MELDOK 4.3 mit dem Schadbildkatalog 59<br />
Qualitätserhalten<strong>des</strong> Handling von Bioobst und Biogemüse im Einzelhandel und bei der Direktvermarktung 60<br />
Möglichkeiten zur Qualitätssicherung ökologisch erzeugter Gartenbauprodukte durch Koordinierung der Wertschöpfungsketten<br />
Bewertung von Arbeitsprozessen im Gartenbau mit Hilfe der dreidimensionalen Bewegungsanalyse 62<br />
Validieren und Bewerten verschiedener Ernte- und Aufbereitungsverfahren bei Spargel 63<br />
6 Verfahren zur Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe ..............................................<br />
(Forschungsschwerpunkt 6)<br />
Gentechnische Optimierung der Bacteriocin-Synthese bei Milchsäurebakterien 65<br />
Entwicklung diagnostischer PCR-Marker zur Diagnostik von biotechnologisch relevanten Mikroorganismen 66<br />
Grundlagen für Aufarbeitungsverfahren zur Herstellung hochreiner Milchsäure unter Berücksichtigung von Presssäften<br />
von Grünmassen<br />
Biochemikalien und Energie aus der nachhaltigen Nutzung von pflanzlichen Biomassen 68<br />
Maschine für den Faseraufschluss von Hanf- und Flachsstroh mit integrierter Schäbentrennung 69<br />
Verfahrenstechnische Untersuchungen zur Reinigung von aufgeschlossenen Naturfasern 70<br />
Konservierung und Lagerung von Hanffasern 71<br />
Untersuchungen zum Einsatz von Biogas in PEM-Brennstoffzellen 72<br />
Energielandwirtschaft – Potenzial und Risiko bei Biogas 73<br />
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beim Einsatz landwirtschaftlicher Kosubstrate zur Biogasgewinnung 74<br />
Verlustminimierte und humanhygienische Lagerung von Feldholz 75<br />
Verfahrenstechnische Grundlagen zur Lagerung und Trocknung von Holzhackgut 76<br />
Energetische Nutzung pflanzlicher Reststoffe 77<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
33<br />
35<br />
38<br />
44<br />
53<br />
54<br />
58<br />
61<br />
64<br />
67
Inhaltsverzeichnis<br />
7 Verfahren zur Behandlung und Verwertung von Reststoffen ..........................................................<br />
und Abwässern in der Landwirtschaft (Forschungsschwerpunkt 7)<br />
Wissenschaftliches Messprogramm zur Bewertung von Biogasanlagen im landwirtschaftlichen Bereich 79<br />
Kinetik der Biogasbildung bei kontinuierlicher Nassvergärung von Feldfrüchten und organischen Reststoffen 80<br />
Prozesssteuerung von Biogasanlagen mit Kofermentation 81<br />
Membranbioreaktor zur Aufbereitung von Schlachthofabwässern 82<br />
Grundlagen zum Einsatz von Membranverfahren bei der Aufbereitung schwach belasteter Abwässer 83<br />
Umweltverträgliche und nachhaltige Nutzung der Nährstoffressource Phosphor 84<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
1 Kooperation mit Wissenschaftseinrichtungen .................................................................................. 85<br />
2 Sonstige Kooperationspartner ......................................................................................................... 96<br />
3 Kurzübersicht der Forschungsvorhaben mit den Kooperationspartnern.......................................... 99<br />
4 Mitarbeit in Gremien und Gutachtertätigkeiten ................................................................................ 104<br />
5 Besuche am Institut ......................................................................................................................... 108<br />
6 Gastaufenthalte sowie Tagungs- und Konferenzteilnahmen von Institutsmitarbeitern ................... 112<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
1 Wissenschaftliche Veranstaltungen ................................................................................................. 118<br />
2 Veröffentlichungen der Einrichtung ................................................................................................. 119<br />
3 Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vorträge der Mitarbeiter .............................................. 120<br />
4 Übersichtsbeiträge der Mitarbeiter .................................................................................................. 139<br />
5 Patente, Lizenzen, Ausgründungen ................................................................................................ 144<br />
6 Preise und Auszeichnungen ............................................................................................................ 145<br />
7 Sonstige Veranstaltungen mit Praxisbezug...................................................................................... 145<br />
8 Stellungnahmen, Gutachten und sonstige Ausarbeitungen ............................................................. 146<br />
9 Beteiligung an Messen und Ausstellungen ...................................................................................... 150<br />
10 Öffentlichkeitsarbeit ......................................................................................................................... 150<br />
11 Qualifizierung von <strong>ATB</strong>-Mitarbeitern ................................................................................................ 152<br />
V Organisation und Ausstattung <strong>des</strong> Institutes<br />
1 Organisation ..................................................................................................................................... 154<br />
2 Abteilungen ...................................................................................................................................... 156<br />
3 Haushalt, Finanzen und Personal ................................................................................................... 160<br />
4 Ausstattung ...................................................................................................................................... 160<br />
78<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
VERZEICHNIS DER VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN<br />
AID - Informationsdienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft<br />
AiF - Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e. V.<br />
BLE - Bun<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br />
BMBF - Bun<strong>des</strong>ministerium für Bildung und Forschung<br />
BMVEL - Bun<strong>des</strong>ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft<br />
BMWA - Bun<strong>des</strong>ministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
BTU - Brandenburgische Technische Universität Cottbus<br />
C.A.R.M.E.N. - Centrales Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk e. V.<br />
CSB / BSB - Chemischer Sauerstoffbedarf / Biochemischer Sauerstoffbedarf<br />
DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst<br />
DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft<br />
DLG - Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft<br />
DGPS - Differential Global Positioning System<br />
FAL - Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt für Landwirtschaft<br />
FNR - Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe<br />
FSP - Forschungsschwerpunkt<br />
GIS - Geografisches Informations System<br />
GRANO - Gestaltung Regionaltypischer Agrarlandschaften Nord-Ost-Deutschlands<br />
HUB - Humboldt-Universität zu Berlin<br />
IAP - Institut für Atmosphärenphysik e.V.<br />
IGV - Institut für Getreideverarbeitung<br />
IGZ - Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau<br />
KTBL - Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft<br />
MLUR - Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg<br />
MPI - Max-Planck-Institut<br />
MWi - Ministerium für Wirtschaft <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg<br />
MWFK - Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg<br />
NIR / MIR - nahes Infrarot / mittleres Infrarot<br />
Nmin - mineralisierter Stickstoffgehalt<br />
PEM - Polymer-Elektrolyt-Membran<br />
PtJ - Projektträger Jülich<br />
TS / oTS - Trockensubstanz / organische Trockensubstanz<br />
UBA - Umweltbun<strong>des</strong>amt<br />
VDI - Verein Deutscher Ingenieure<br />
VUZT - Institut für Landtechnik Prag<br />
ZAB - Zukunftsagentur Brandenburg<br />
ZALF - Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
I Allgemeiner Teil<br />
1 Aufgaben und Forschungsschwerpunkte<br />
I Allgemeiner Teil 1<br />
Aufgabe <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> ist es, verfahrenstechnische Grundlagen für eine nachhaltige Landbewirtschaftung zu<br />
schaffen und innovative technische Lösungen für die Industrie bereitzustellen.<br />
Das <strong>ATB</strong> entwickelt in diesem Zusammenhang wissenschaftlich begründete Verfahren und technische Lösungen<br />
für die<br />
- Erzeugung von hochwertigen und sicheren tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln und von Futtermitteln,<br />
- Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen und deren Aufbereitung zu Zwischen- bzw. Endprodukten<br />
definierter Qualität,<br />
- Erzeugung von biogenen Energieträgern und die Bereitstellung erneuerbarer Energien im ländlichen<br />
Raum,<br />
- Behandlung und Verwertung von biogenen Reststoffen und für<br />
- Dienstleistungen der Landwirtschaft, insbesondere für Leistungen zum Erhalt der Kulturlandschaft.<br />
Durch entwicklungsbegleitende Technikbewertung soll sichergestellt werden, dass die neu entwickelten<br />
Verfahren und technischen Lösungen für die Hersteller und Anwender profitabel sind und gleichzeitig den<br />
Belangen von Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz sowie der Nachhaltigkeit Rechnung tragen.<br />
Nutzer der Forschungsergebnisse sind neben der wissenschaftlichen Öffentlichkeit insbesondere die Landwirtschaft<br />
und der Gartenbau, die ihnen vor- und nachgelagerten Bereiche, hier speziell die Hersteller von<br />
Landmaschinen und technischen Anlagen, sowie politische Entscheidungsträger und die Administration.<br />
Die Forschungsaktivitäten lassen sich mehrheitlich sieben Forschungsschwerpunkten zuordnen, die gleichzeitig<br />
die Kompetenzfelder <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> darstellen:<br />
1. Grundlagen für eine nachhaltige Landbewirtschaftung bei unterschiedlicher Produktionsintensität<br />
(Stoff- und Energiebilanzierung, Stoffstrommanagement, sozioökonomische Bewertung, Technikbewertung<br />
im Sinne der Technikfolgenabschätzung, Landschaftspflege)<br />
2. Teilflächenspezifische Bewirtschaftung und Nutzung von Satellitentechnik im Pflanzenbau (Heterogenitätserfassung,<br />
Informationsmanagement, Sensorentwicklung, Bestan<strong>des</strong>führung, Bewertung)<br />
3. Qualitätssicherung bei der Lagerung, Konservierung und Verabreichung von Futtermitteln für Nutztiere<br />
(Feuchtgetreide- und Halmfutterkonservierung, solare Trocknung, Prozesskettengestaltung bis zur<br />
Futtervorlage)<br />
4. Umweltverträgliche und tiergerechte Haltung von Rindern, Schweinen und Geflügel (Emissions- und<br />
Immissionsminderung, Stallklimatisierung, Herdenmanagement, Milchgewinnung)<br />
5. Qualität und Wettbewerbsfähigkeit bei der Ernte und in der Nachernteperiode leichtverderblicher<br />
Produkte (Produkteigenschaften, Qualitätsmanagement, Sensorentwicklung, Arbeitswissenschaften im<br />
Ernte- und Nachernteprozess)<br />
6. Verfahren zur Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe (Anbauverfahren, Qualitätskriterien,<br />
Logistik, energetische und stoffliche Nutzung, Emissionsminderung)<br />
7. Verfahren zur Behandlung und Verwertung von Reststoffen und Abwässern in der Landwirtschaft<br />
(Biomethanisierung, Kofermentation, naturnahe Abwasserreinigung)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
2<br />
I Allgemeiner Teil<br />
Die Forschungsarbeiten werden überwiegend interdisziplinär und abteilungsübergreifend in den sechs Fachabteilungen<br />
<strong>des</strong> <strong>ATB</strong> durchgeführt (Pkt. V. 2, Seite 156). Die fachliche Struktur <strong>des</strong> Instituts geht aus der<br />
Übersicht aus Pkt. V. 1, Seite 155 hervor.<br />
Externe Kooperationen erweitern hierbei die Kompetenz <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> insbesondere bei komplexen Forschungsvorhaben.<br />
Eine ausführliche Übersicht über die Forschungsarbeiten der Fachabteilungen sowie der jeweiligen<br />
Kooperationspartner innerhalb der Forschungsschwerpunkte enthält Punkt III. 3, Seite 99 ff.<br />
Kooperationen mit Forschungseinrichtungen in Ländern Mittel- und Osteuropas sowie in Entwicklungsländern<br />
sollen dazu dienen, regionale Forschungskompetenz weiterzuentwickeln und gemeinsam Problemlösungen<br />
für den ländlichen Raum und die regionale Industrie zu erarbeiten.<br />
Darüber hinaus ist es eine wesentliche Aufgabe <strong>des</strong> <strong>ATB</strong>, einen Beitrag zur Ausbildung <strong>des</strong> wissenschaftlichen<br />
Nachwuchses zu leisten. Dieses erfolgt i. d. R. auf der Basis von Kooperationsverträgen, (III. 1.4-1.6,<br />
Seite 88-95).<br />
Das <strong>ATB</strong> wird bei der Planung seiner Forschungsaktivitäten sowie bei deren Durchführung vom Wissenschaftlichen<br />
Beirat beraten. Dieses gilt auch für die Gestaltung der Zusammenarbeit mit Einrichtungen der<br />
Forschung und Lehre, mit der Wirtschaft und mit der Administration. Darüber hinaus bewertet der Wissenschaftliche<br />
Beirat in regelmäßigen Abständen die Forschungsleistungen und die Arbeitsplanung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
2 Bericht <strong>des</strong> Wissenschaftlichen Direktors<br />
Das Berichtsjahr <strong>2003</strong> war gekennzeichnet durch Veränderungen sowohl in der Forschungspolitik als auch<br />
in der Agrar- und Verbraucherpolitik. Das <strong>ATB</strong> hat dieses zum Anlass genommen, seine Forschungsausrichtung,<br />
aber auch seine sonstigen, forschungsbegleitenden Aktivitäten hinsichtlich der z. T. neuen Schwerpunktsetzung<br />
zu überprüfen und ggf. zu justieren.<br />
Das BMBF erwartet z. B. zunehmend eine Internationalisierung und Vernetzung von Forschung und Lehre<br />
sowie eine Intensivierung <strong>des</strong> Technologietransfers im weitesten Sinne. Hinzu kommt die Aufforderung, für<br />
Naturwissenschaften an den Schulen zu werben - mit Blick auf ausreichenden ingenieurwissenschaftlichen<br />
Nachwuchs, der letztlich die Wirtschaftskraft der Bun<strong>des</strong>republik mit bestimmt. Neben diesen gut nachvollziehbaren<br />
Forderungen war die vom BMBF angestoßene „Entflechtungsdebatte“, die u. a. auf die Übertragung<br />
der ausschließlichen Verantwortlichkeit für die Leibniz-Institute auf die Länder zielt, eher unerfreulich,<br />
da hierdurch sowohl die Finanzierung als auch die gesamtstaatliche und überregionale Orientierung der<br />
Forschung der Leibnizeinrichtungen gefährdet werden.<br />
Internationalisierung und Vernetzung<br />
Eine <strong>ATB</strong>-interne Analyse zeigt, dass Wissenschaftler <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> in erheblichen Umfang bereits in international<br />
orientierte, z. T. englischsprachige M.Sc.- und B.Sc.-Studiengänge eingebunden sind. Auch arbeiten<br />
etliche ausländische Doktoranden und Gastforscher am <strong>ATB</strong>. Hier wie auch in internationalen Forschungs-<br />
Verbundvorhaben muss sich das <strong>ATB</strong> aber noch stärker engagieren.<br />
Eine Bewertung der Einbindung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> in Netzwerke zeigt gegenüber 2002 erhebliche Fortschritte, insbesondere<br />
bei der Mitarbeit in nationalen Kompetenznetzen und Verbundprojekten. Das vom <strong>ATB</strong> im Rahmen<br />
<strong>des</strong> BMBF/PtJ-Verbundprojektes „Verbesserung der Umweltverträglichkeit landwirtschaftlicher Produktionsverfahren<br />
durch Entwicklung innovativer Sensorik und Gestaltung der Produktionsprozesse im Sinne eines<br />
integrierten Umweltschutzes“ etablierte Kompetenznetz „ProSenso.Net“, das speziell auf Kooperation mit<br />
KMU zielt, soll dabei auf ein bun<strong>des</strong>weites Netzwerk ausgeweitet werden.<br />
Auf internationaler Ebene ist das vom <strong>ATB</strong> mitinitiierte Netzwerk CEE AgEng (Central and Eastern European<br />
Institutes of Agricultural Engineering) von Bedeutung, da es die Kooperation zwischen den nationalen agrartechnischen<br />
Forschungseinrichtungen in Mittel- und Osteuropa fördert. Insbesondere sollen die Institute in<br />
den neuen EU-Beitrittsländern in die Lage versetzt werden, einen wirksameren Beitrag zur Stabilisierung der<br />
regionalen Landwirtschaft, <strong>des</strong> ländlichen Raumes und der Industrie zu leisten. Eine EU-Förderung <strong>des</strong><br />
Netzwerkes wird angestrebt.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
I Allgemeiner Teil 3<br />
Zur Verbesserung der internationalen „Sichtbarkeit“ <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> und zur Vernetzung hat ohne Zweifel die vom<br />
<strong>ATB</strong> gemeinsam mit dem ZALF Müncheberg ausgerichtete vierte „European Conference on Precision Agriculture“<br />
(4 th ECPA), kombiniert mit der ersten „European Conference on Precision Lifestock Farming“ (1st<br />
ECPLF) in Berlin beigetragen. Ca. 250 Vorträge und 200 Poster wurden präsentiert. Auf der Tagung, in<br />
Workshops und auf Exkursionen diskutierten die ca. 500 Teilnehmer Grundlagen, Strategien und Umsetzung<br />
von Verfahren der Präzisionslandwirtschaft.<br />
Technologietransfer<br />
Zur Intensivierung der Technologietransfer-Aktivitäten setzt das <strong>ATB</strong> – neben direkten Industriekooperationen<br />
– zunehmend auf professionelle Technologietransfer-Institutionen wie „Brainshell“ in Brandenburg. <strong>ATB</strong>intern<br />
wird durch entwicklungsbegleitende Technikbewertung bereits sehr früh geprüft, ob F&E-Ergebnisse<br />
<strong>des</strong> <strong>ATB</strong> Chancen auf Umsetzung haben. Zu diesem Zweck war die Abteilung 2, Technikbewertung und<br />
Stoffkreisläufe, personell aufgestockt worden. Ihre Mitarbeiter sind heute in wesentlich größerem Umfang in<br />
die technischen Entwicklungsvorhaben der technischen Fachabteilungen <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> eingebunden.<br />
Als besondere Erfolge einer intensiven Kooperation mit Unternehmen sowie der entwicklungsbegleitenden<br />
Bewertung sind die Auszeichnungen <strong>des</strong> Spargelvollernters der Fa. HMF Füchtorf und <strong>des</strong> Pendelsensors<br />
für Precision Farming, „CROP-Meter“, von Agrocom Bielefeld und Müller-Elektronik Salzkotten (Gold- bzw.<br />
Silber-Medaille auf der AGRITECHNICA <strong>2003</strong>) zu sehen. An beiden Entwicklungen war das <strong>ATB</strong> maßgeblich<br />
beteiligt.<br />
Auch die leistungsstarke Faseraufschluss-Pilotanlage <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> und die vor Baubeginn stehende, komplexe<br />
Milchsäure-Pilotanlage mit diversen Zielprodukten und Reststoffverwertung sind als wichtige Elemente der<br />
Überführung von Forschungsergebnissen in die Praxis zu werten.<br />
Verbraucherschutz und Nachhaltigkeit<br />
Die Agrar- und Verbraucherschutzpolitik sowohl <strong>des</strong> Bun<strong>des</strong> als auch <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg setzt zunehmend<br />
auf Verbraucherschutz und hier insbesondere auf Nahrungsmittelsicherheit. Etliche der notwendigen<br />
Aktivitäten wie Risikoerkennung oder Risikomanagement liegen sicher nicht im Kompetenzbereich <strong>des</strong><br />
<strong>ATB</strong>. Demgegenüber sieht das <strong>ATB</strong> aber die Entwicklung von Sensoren und deren Nutzung zum produktionsnahen<br />
Nachweis von Belastungen, zur Automatisierung von Prozessen und damit zur sicheren Prozessführung,<br />
sowie zur möglichst automatisierten Dokumentation der Prozesse als Herausforderung für eigene<br />
Forschungsaktivitäten. Zusätzlich zu umfangreichen bisherigen Forschungsaktivitäten z. B. zur Vermeidung<br />
von Verderb und damit auch von Mykotoxin-Belastungen (bei Obst, Gemüse und Futter), hat das <strong>ATB</strong> im<br />
Berichtsjahr erste Forschungsaktivitäten zu technischen Aspekten der Rückverfolgbarkeit aufgenommen.<br />
Zunehmend wird von der Öffentlichkeit – und damit auch von der Politik – gefordert, die Qualität von Produkten<br />
und deren Sicherheit mit einer nachgewiesen umweltgerechten, nachhaltigen Art und Weise der Erzeugung<br />
zu verbinden. Letzteres erfordert ressourcenschonende Verfahren, Emissionsminderung, Tiergerechtheit<br />
und nicht zuletzt auch die Berücksichtigung sozialer Aspekte (Schwere der Arbeit, Arbeitschutz). Durch<br />
die Stärkung der Bereiche Technikbewertung und Stoffkreisläufe (Abteilung 2) sowie Ergonomie (Abt. 6) soll<br />
sichergestellt werden, dass bei Neu- und Weiterentwicklung von Verfahren am <strong>ATB</strong> die zuvor genannten<br />
ökologischen Entwicklungsziele neben Wirtschaftlichkeit, Produktqualität und Produktsicherheit mit berücksichtigt<br />
werden.<br />
Auch auf dem vom <strong>ATB</strong> im September <strong>2003</strong> in Potsdam veranstalteten BMBF/PtJ-Statusseminar „High-<br />
Tech-Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion“ wurde sowohl von der Politik als auch von der<br />
Wirtschaft und der Wissenschaft unterstrichen, dass Ökonomie, Umwelt, Nachhaltigkeit und Produktqualität<br />
und -sicherheit zusammen gehören, und dass künftig der Nachweis der Einhaltung entsprechender Kriterien<br />
eine dominierende Rolle in der Agrarproduktion und im Verbraucherschutz spielen wird.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
4<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
I Allgemeiner Teil<br />
Reorganisation der Forschung am <strong>ATB</strong><br />
Die Arbeit <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> im Berichtsjahr <strong>2003</strong> war auch geprägt von einer Reorganisation der Forschungsstruktur<br />
und der Arbeitsweise. Zum einen will das <strong>ATB</strong> seine Forschung noch stärker an den Bedürfnissen der Gesellschaft<br />
und an den Erwartungen der Wirtschaft orientieren. Dieses erfordert u. a. die Formulierung von<br />
problemorientierten Forschungsthemen, möglichst gemeinsam mit den Bedarfsträgern, sowie eine zunehmend<br />
interdisziplinäre Arbeitsweise, der durch stärkere innere und externe Vernetzung entsprochen werden<br />
soll.<br />
Zum anderen musste die Forderung der Forschungspolitik umgesetzt werden, die Forschungsaktivitäten<br />
effektiver zu gestalten. Instrumente hierzu sind neben den auch am <strong>ATB</strong> üblichen externen und internen<br />
Evaluierungen die neu einzuführende Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) sowie Programm-Budgets (PB),<br />
die künftig innerhalb <strong>des</strong> Instituts eine leistungsorientierte Steuerung der Forschung erlauben (Controlling).<br />
Der zum Berichtsjahresende vorgelegte aktuelle Forschungsrahmenplan 2004-2006 <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> bildet die<br />
Grundlage hierfür. Im Zuge der Reorganisation ist die Zahl der Einzelvorhaben von 82 im Jahre <strong>2003</strong> auf 25<br />
problemorientierte Forschungsthemen ab 1. Januar 2004 reduziert worden, die i. d. R. von multidisziplinären<br />
Forschergruppen bearbeitet werden. Das <strong>ATB</strong> meint, mit den eingeleiteten Veränderungen für künftige Herausforderungen<br />
seitens Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gut präpariert zu sein.<br />
Der Wissenschaftliche Beirat <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
Der Wissenschaftliche Beirat <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> hat die Leitung <strong>des</strong> Instituts mit außerordentlichem Engagement bei<br />
der Reorganisation der Forschungsstruktur sowie bei der Einführung neuer Qualitätssicherungsverfahren<br />
(Kosten-Leistungs-Rechnung, interne Evaluierungen im zweijährigen Rhythmus) unterstützt. Hierfür gilt dem<br />
Wissenschaftlichen Beirat der besondere Dank <strong>des</strong> Instituts. Im Rahmen seines satzungsgemäßen Auftrags<br />
bewertete der Wissenschaftliche Beirat im Berichtsjahr zwei Abteilungen (Abt. 3, Technik der Aufbereitung,<br />
Lagerung und Konservierung und Abt. 6, Technik im Gartenbau), neben seinen generellen Beratungsaktivitäten.<br />
Um die Beratungskompetenz im Grenzbereich zur Nahrungsmittelindustrie zu stärken, ist mit Herrn<br />
Prof. Knorr, TU Berlin, ein kompetenter Repräsentant <strong>des</strong> Fachgebietes Nahrungsmittel-Verfahrenstechnik<br />
in den Beirat aufgenommen worden. Der Vorsitzende <strong>des</strong> Wissenschaftlichen Beirats, Prof. Auernhammer,<br />
übernahm die Aufgabe, das <strong>ATB</strong> im gemeinsamen Berufungsprozess mit der BTU Cottbus für einen Nachfolger<br />
für <strong>des</strong> Ende 2004 ausscheidenden Wissenschaftlichen Direktors zu vertreten.
II Fachliche Ergebnisse<br />
1 Grundlagen für eine nachhaltige Landbewirtschaftung<br />
bei unterschiedlicher Produktionsintensität(Forschungsschwerpunkt<br />
1)<br />
Basic research into sustainable land management<br />
with various production intensities<br />
(Koordinatorin: Annette Prochnow, Abt. 2)<br />
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist zu einem festen<br />
Bestandteil der internationalen Umwelt- und Entwicklungspolitik<br />
geworden. Das Leitbild einer<br />
nachhaltigen Entwicklung kann aus der Sicht unterschiedlicher<br />
Wissenschaftsdisziplinen und Perspektiven<br />
beschrieben werden. Bei allen Überlegungen<br />
zur Nachhaltigkeit fällt aber gerade der<br />
Land- und Forstwirtschaft eine zentrale Rolle zu.<br />
Sie nutzt natürliche Produktionsgrundlagen und ist<br />
darauf angewiesen, diese dauerhaft zu erhalten<br />
bzw. zu verbessern. Der Schutz von Boden, Wasser<br />
und Luft sowie der biologischen Vielfalt ist untrennbar<br />
mit dem dauerhaften Erhalt der Produktivität<br />
landwirtschaftlicher Standorte verbunden.<br />
Die Bewertung der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher<br />
Systeme, aber vielmehr noch die Gestaltung<br />
nachhaltiger Betriebssysteme, stellt eine beachtliche<br />
wissenschaftliche Herausforderung dar. Ein<br />
besonderer Anspruch ergibt sich daraus, dass<br />
Detailergebnisse verschiedener Disziplinen in einen<br />
größeren Zusammenhang gestellt und komplex<br />
bewertet werden müssen. Dieser ganzheitliche<br />
Ansatz ist auch <strong>des</strong>halb so schwer zu realisieren,<br />
weil die gesamte Forschung und Lehre eher<br />
auf Spezialisierung, Genauigkeit der Details und<br />
reduktionistische Sichtweisen ausgelegt sind.<br />
Innerhalb <strong>des</strong> Forschungsschwerpunktes wurden<br />
interdisziplinär sowohl Detailergebnisse als auch<br />
Bewertungen der ökologischen und sozio-ökonomischen<br />
Auswirkungen in den Bereichen Offenlandmanagement,<br />
wassersparende Beregnung<br />
und Gemüsewäsche und Stoffflüsse landwirtschaftlicher<br />
Prozesse erarbeitet.<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> Verbundprojektes "Offenlandmanagement<br />
auf ehemaligen und in Nutzung befindlichen<br />
Truppenübungsplätzen " leistete das <strong>ATB</strong><br />
einen wertvollen Beitrag zur sozio-ökonomischen<br />
Bewertung von Optionen <strong>des</strong> Offenlandmanagements<br />
auf Verfahrens-, Gebiets- und Verbundebene.<br />
Im Jahr <strong>2003</strong> erfolgte eine abschließende gemeinsame<br />
Bewertung der Managementverfahren<br />
im Gesamtverbund nach naturschutzfachlichen,<br />
ökonomischen und sozialwissenschaftlichen Kriterien.<br />
Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen.<br />
II Fachlicher Teil 5<br />
Das Ziel <strong>des</strong> Projekts "Optimierung der Steuerung<br />
von modernen Beregnungsanlagen und die ökologische<br />
und ökonomische Bewertung großflächiger<br />
Bewässerung" ist es, den Einsatzzeitpunkt der Bewässerung<br />
und die auszubringende Wassermenge<br />
zu optimieren. Neben meteorologischen Daten<br />
werden Angaben zum Pflanzenbestand und zum<br />
Boden benötigt. Im Berichtsjahr wurden Schläge in<br />
ihrer Heterogenität bezüglich Bodentyp und Nährstoffgehalt<br />
charakterisiert und in Bewirtschaftungszonen<br />
aufgeteilt. Des weiteren wurde ein Modell<br />
zur Berechnung von potentieller und aktueller<br />
Evaporation in Fuzzy-Logik umgesetzt.<br />
Im Projekt "Reduzieren <strong>des</strong> Frischwasserverbrauchs<br />
bei der Gemüsewäsche durch die Verwertung<br />
von aufbereitetem Waschwasser im geschlossenen<br />
Kreislauf" wird ein neues Verfahren<br />
zur Waschwasseraufbereitung bei der Möhrenwäsche<br />
entwickelt. Das primäre Ziel ist, den Wasserverbrauch<br />
bei gleichbleibender Reinigungsleistung<br />
und Produktqualität zu senken. Dies soll erreicht<br />
werden, indem das Waschwasser u.a. biologisch<br />
gereinigt und dem Kreislauf wieder zugeführt wird.<br />
Die bisherigen Ergebnisse zeigen die prinzipielle<br />
Eignung <strong>des</strong> neuen Verfahrens.<br />
Die Arbeiten im Rahmen <strong>des</strong> Projekts "Einfluss der<br />
Verfahrensgestaltung im Pflanzenbau und in der<br />
Tierhaltung auf Stoff- und Energieflüsse" konzentrierten<br />
sich im zurückliegenden Jahr auf die Kohlenstoff-Bilanzierung.<br />
Die methodische Grundlage<br />
der Arbeiten bildet das Bilanzierungsmodell<br />
REPRO, das unter Mitwirkung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> an der<br />
Martin-Luther-Universität Halle entstand und –<br />
auch im Rahmen dieses Projekts – weiterentwickelt<br />
wird. Unter Berücksichtigung der Standortbedingungen,<br />
Produktionsstruktur und -weise ergänzen<br />
Kohlenstoff-Bilanzen die bisher genutzten<br />
Energiebilanzen und erlauben so eine bessere<br />
Beurteilung der Umweltwirkungen landwirtschaftlicher<br />
Verfahren und Betriebe.<br />
Im Projekt "Stickstoffbilanz nachwachsender Rohstoffe<br />
auf sandigen Standorten/Ackerböden" wurden<br />
Untersuchungen zur Freisetzung klimarelevanter<br />
Spurengase beim Anbau nachwachsender<br />
Rohstoffe fortgeführt und die bisherigen Ergebnisse<br />
analysiert. Neben dem Witterungsverlauf beeinflusst<br />
die Stickstoffdüngung die Lachgasemissionen<br />
in erheblichem Maß. Ein hoher Stickstoffversorgungsgrad<br />
schlägt sich auch in stärkeren und<br />
über den Vegetationszeitraum anhaltenden Nmin-<br />
Konzentrationen nieder. Eine Erweiterung fanden<br />
diese Arbeiten durch Untersuchungen zum Denitrifikationspotenzial<br />
sandiger Ackerböden. Die Ergebnisse<br />
zeigen, dass ein Uferstreifen mit seinem<br />
hohen Stickstoff-Eliminationspotenzial einen wirksamen<br />
Gewässerschutz darstellt.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
6<br />
Projekte zum Forschungsschwerpunkt 1<br />
Arbeitsgebiet „Verfahrensbewertung“<br />
Ökonomische Bewertung von Offenlandmanagement<br />
auf ehemaligen und in Nutzung befindlichen<br />
Truppenübungsplätzen im pleistozänen<br />
Flachland Nordostdeutschlands (Projekt-Nr.: 80)<br />
Economic assessment of open landscape management<br />
of former and presently utilized military<br />
training areas in the pleistocene lowland of<br />
North-East Germany<br />
Ralf Schlauderer (Abt. 2), Richard Harnisch (2),<br />
Pia Mähnert (2), Annette Prochnow (2)<br />
BTU Cottbus; Universität Potsdam; Universität<br />
Freiburg; Museum für Naturkunde Görlitz<br />
Förderung: BMBF; Haushalt<br />
Military training areas both, abandoned or in use<br />
have a landscape-ecological substance of high<br />
quality. Since these biotopes are subject to quick<br />
alteration after they are no longer used for military<br />
training, they require measures of open landscape<br />
maintenance on large surfaces. For their maintenance<br />
ecologically and economically favorable<br />
techniques must be chosen. The analyses showed<br />
that the economic results vary very much between<br />
single sites. Here the size of the territory and the<br />
contamination with warfare agents showed a high<br />
impact on the economic performance of different<br />
maintenance strategies. Grazing by wild animals<br />
seems to be an economically interesting alternative<br />
for smaller former military training areas while<br />
this is not the case for the bigger ones. With increasing<br />
contamination with warfare agents the<br />
procedures for which man has to step on the land<br />
Nachhaltige Landbewirtschaftung<br />
Tabelle 1.1: Kosten und Leistungen von Verfahren <strong>des</strong> Offenlandmanagements<br />
Table 1.1: Cost and performance of open landscape management procedures<br />
(like sheep grazing) or man has to work the soil<br />
(like soil working) gets very expensive, while on<br />
areas with no contamination with warfare agents<br />
these techniques are economically very interesting.<br />
Ehemalige und noch in Nutzung befindliche Truppenübungsplätze<br />
weisen eine hohe Wertigkeit für<br />
den Naturschutz auf. Da diese Biotope nach der<br />
militärischen Nutzung einem starken Umwandlungsdruck<br />
unterliegen, erfordern sie Maßnahmen<br />
zur Sicherung der Offenlandschaft auf großen<br />
Flächen. Für die Erhaltung der Offenbiotope muss<br />
neben naturschutzfachlichen Gesichtspunkten<br />
auch die ökonomische Vorteilhaftigkeit der Verfahren<br />
Berücksichtigung finden. Die Bandbreite der<br />
derzeit angewandten Methoden zur Offenhaltung<br />
ehemaliger Truppenübungsplätze umfasst die<br />
Beweidung mit Haus- und Wildtieren, Mähen und<br />
Räumen oder Mulchen, das Bearbeiten oder Abtragen<br />
<strong>des</strong> Oberbodens mit landwirtschaftlichen<br />
Maschinen und Geräten, das Befahren mit Fahrzeugen<br />
und das kontrollierte Brennen.<br />
Um diese Verfahren und ihre potenziellen Auswirkungen<br />
zu analysieren, sind ökonomische Untersuchungen<br />
auf Verfahrens-, Gebiets- und volkswirtschaftlicher<br />
Ebene durchgeführt worden. Um<br />
Aussagen über die zukünftig möglichen Auswirkungen<br />
machen zu können, wurde die Szenariotechnik<br />
verwendet. Für die langjährige Analyse der<br />
ökonomischen Auswirkungen der einzelnen betrachteten<br />
Szenarien wurde die Kapitalwertmethode<br />
eingesetzt.<br />
Die einzelnen Verfahren <strong>des</strong> Offenlandmanagements<br />
unterscheiden sich erheblich hinsichtlich<br />
Kosten, Leistungen und Fördermittelbedarf (Tabelle<br />
1.1). Unter günstigen Voraussetzungen ist bei<br />
Verfahren Intervall Kosten Leistungen performances<br />
Procedures interval costs Markt<br />
market<br />
Beweidung grazing<br />
Förderung<br />
subsidies<br />
[Jahre] years [€/(ha * a)] [€/(ha * a)] [€/(ha * a)]<br />
Schafe sheep 1 175 - 385 13 - 18 160 – 260<br />
Wildtiere game 1 105 - 235 83 - 115 0<br />
Schnitt mowing<br />
Mähen und Räumen mowing and clearing 1 – 3 60 - 350 0 - 212 50 – 350<br />
Mulchen mulching 1 – 3 8 - 175 0 ≤ 175<br />
Entbuschen removal of shrubbery 2 – 20 140 - 500 0 ≤ 500<br />
Boden freilegen uncovering of soils<br />
Bodenbearbeitung agr. implements ≥ 1 ≤ 25 - 65 0 ≤ 65<br />
Abplaggen sod cutting 20 - 40 13 - 250 0 ≤ 250<br />
kontrolliertes Brennen controlled burning 2 – 10 4 - 71 0 0<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
der Beweidung mit Wildtieren und beim Mähen<br />
und Räumen die Rentabilität über Marktleistungen<br />
zu erreichen. Hierbei sind jedoch im Falle der<br />
Wildtierbeweidung die geplante Gehegegröße und<br />
das zu erwartende Besucheraufkommen zu berücksichtigen.<br />
Während kleinere Gehege wirtschaftlich<br />
interessant sein können, sind sehr große<br />
Wildgehege aufgrund der hohen Investitionen und<br />
nicht proportional steigenden Besucherzahlen<br />
voraussichtlich kaum in der Lage die Wirtschaftlichkeitsgrenze<br />
zu erreichen. Verfahren mit geringem<br />
Fördermittelbedarf sind das Mulchen, die<br />
Bodenbearbeitung und das kontrollierte Brennen.<br />
Regelmäßige Offenhaltungsmaßnahmen sind effizienter<br />
als das Entbuschen in längeren Intervallen.<br />
Für alle Verfahren, deren Anwendung auf Betretbarkeit<br />
und Bearbeitbarkeit der Flächen angewiesen<br />
ist, spielt auf ehemaligen Truppenübungsplätzen<br />
die Belastung mit Kampfmitteln eine wichtige<br />
Rolle, da die jeweilig notwendige Beräumung in<br />
der Regel mit erheblichen Kosten verbunden ist.<br />
Die Döberitzer Heide<br />
Der ehemalige Truppenübungsplatz Döberitzer<br />
Heide umfasst ca. 4.700 ha und befindet sich<br />
westlich von Berlin. Im Rahmen <strong>des</strong> Offenlandprojektes<br />
wurden die Szenarien Beweidung mit<br />
Haustieren mit graugehörnten Heidschnucken<br />
(Ovis ammon (aries) f. aries) sowie die Kontrastszenarien<br />
freie Sukzession, Beweidung mit Wildtieren<br />
und kontrolliertes Brennen bearbeitet.<br />
Wird die Kampfmittelberäumung in der Bewertung<br />
berücksichtigt, so ist die freie Sukzession im Fall<br />
Döberitzer Heide mit Abstand die kostengünstigste<br />
Variante. An zweiter Stelle folgen Einrichtung und<br />
€<br />
0<br />
-1.000.000<br />
-2.000.000<br />
-3.000.000<br />
-4.000.000<br />
-5.000.000<br />
-6.000.000<br />
II Fachlicher Teil 7<br />
Betrieb eines Wildgeheges und am Schluss, als<br />
Folge der hohen Aufwendungen für die Beräumung,<br />
das kontrollierte Brennen (Bild 1.1). Da mit<br />
dem zehnten Jahr alle relevanten Offenbiotope<br />
beräumt wären, würde die Kurve für das kontrollierte<br />
Brennen für einen Zeitraum über weitere<br />
zehn Jahre wesentlich flacher verlaufen.<br />
Wird die Kampfmittelberäumung nicht in die Kalkulation<br />
aufgenommen, so kehrt sich die Rangliste<br />
der Verfahren nahezu um. Unter diesen Bedingungen<br />
entstehen durch die Offenhaltung durch<br />
kontrolliertes Brennen kaum Mehrkosten im Vergleich<br />
zu freien Sukzession, die Schafbeweidung<br />
wäre wesentlich konkurrenzfähiger und würde auf<br />
dem dritten Platz folgen, während als konkurrenzschwächstes<br />
Verfahren die Beweidung mit Wildtieren<br />
abschneiden würde.<br />
Die Analysen zeigen, dass die Ergebnisse der<br />
ökonomischen Bewertung sehr stark von den einzelnen<br />
Charakteristika der Untersuchungsgebiete<br />
abhängen. Dabei spielen die Größe der Untersuchungsgebiete<br />
sowie die Belastung mit Kampfmitteln<br />
eine wichtige Rolle. So ist die Beweidung mit<br />
Wildtieren v.a. für kleinere ehemalige Truppenübungsplätze<br />
eine interessante Variante, während<br />
dies für größere Gebiete nicht zu gelten scheint.<br />
Mit steigender Kampfmittelbelastung werden v.a.<br />
diejenigen Verfahren sehr teuer, die eine Betretbarkeit<br />
bzw. Bearbeit- und Befahrbarkeit <strong>des</strong> Gebietes<br />
voraussetzen, wie z.B. Schafhaltung und<br />
Bodenbearbeitung. Demgegenüber sind insbesondere<br />
die Verfahren der Bodenbearbeitung ökonomisch<br />
interessante Verfahren für Gebiete, in denen<br />
keine Kampfmittelbelastung vorliegt. /4/, /7/, /15/,<br />
/27/, /58/, /130/, /166/, /189/, /193/, /195/, /323/<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Jahr<br />
Bild 1.1: Kapitalwerte für Entwicklungsszenarien der Döberitzer Heide mit Kampfmittelberäumung<br />
Freie<br />
Sukzession<br />
Schafhaltung<br />
Wildgehege<br />
Kontrolliertes<br />
Brennen<br />
Fig. 1.1: Net present values for development scenarios of the Döberitzer Heathland including evacuation of explosive<br />
ordnances<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
8<br />
Optimierung der Steuerung von modernen Beregnungsanlagen<br />
und die ökologische und<br />
ökonomische Bewertung großflächiger Bewässerung<br />
(Projekt 110-123)<br />
Optimisation of the control of modern irrigation<br />
facilities and the ecological and economic assessment<br />
of large-scale irrigation<br />
Matthias Plöchl (Abt. 2), Hilde Klauss (2), Horst<br />
Domsch (4)<br />
Finanzierung: BMBF/PtJ<br />
The aim of the project is to enhance the water use<br />
efficiency of irrigation on large-scale areas using<br />
an optimised irrigation control system. Advantages<br />
are expected by decreasing water and energy<br />
consumption and securing the quantity and quality<br />
of crop yield. The optimum scheduling and the<br />
optimum amount of water applied are determined<br />
by using a fuzzy logic model of evapotranspiration<br />
based on meteorological data, data of crop growth<br />
and of the phenological development of the crop<br />
(growth models).<br />
Modelling is supported by suitable sensors to detect<br />
the spatial soil heterogeneity, the temporal<br />
development of soil moisture and crop growth. The<br />
data sensed will be compared and tuned to the<br />
model data.<br />
Das Ziel <strong>des</strong> Projekts ist es, durch eine optimierte<br />
Steuerung der Beregnung großer landwirtschaftlicher<br />
Flächen eine Steigerung der Wassernutzungseffizienz<br />
zu erreichen. Wasser- und Energieverbrauch<br />
sollen gesenkt werden, und zugleich die<br />
Qualität und Quantität der Ernte gesichert werden.<br />
Der optimale Einsatzzeitpunkt und die optimale<br />
Wassermenge der Beregnung werden durch eine<br />
auf Fuzzy-Logik-basierende Modellierung der<br />
Evapotranspiration bestimmt, welche sich auf meteorologische<br />
Daten und Daten <strong>des</strong> Wachstums<br />
und der phänologischen Entwicklung der Pflanzen<br />
stützt. Zudem wird die Modellierung durch Sensormessungen<br />
unterstützt, welche die Bodenheterogenität<br />
und die zeitliche Entwicklung der Bodenfeuchte<br />
und <strong>des</strong> Pflanzenwachstums erfassen.<br />
Die direkte Anlagensteuerung wird in Fuzzy-Logik<br />
mit einem Feedback-Control-Loop erstellt, wodurch<br />
eine einfache Übertragung der Modelldaten<br />
in den Steuerungsmechanismus und eine reibungslose<br />
Anlagensteuerung erreicht werden<br />
kann.<br />
Im Berichtszeitraum wurden für mehrere Schläge<br />
die Heterogenität der Bodenstruktur durch einmalige<br />
Messung der elektrischen Leitfähigkeit <strong>des</strong><br />
Bodens mittels elektromagnetischer Induktion (EM-<br />
38) erfasst. In diesen Schlägen wurden durch einen<br />
eigens dafür erstellten Algorithmus geeignete<br />
Standorte für Bodenproben und kontinuierliche<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Nachhaltige Landbewirtschaftung<br />
Bodensensoren ermittelt und Bodenproben entnommen.<br />
Anhand dieser konnten die Schläge in<br />
ihrer horizontalen Heterogenität bezüglich Bodentyp,<br />
Stickstoffgehalt, Kaliumgehalt und Phosphorgehalt<br />
charakterisiert und in Bewirtschaftungszonen<br />
aufgeteilt werden (Bild 1.2). In der kommenden<br />
Saison werden an diesen Messstellen Bodenfeuchtesensoren<br />
installiert. Die dabei gewonnenen<br />
Daten werden zur Validierung <strong>des</strong> Modells dienen.<br />
Ein tragbares Radiometer wurde gebaut, mit <strong>des</strong>sen<br />
Hilfe Dauerbeobachtungen <strong>des</strong> Vegetationsindexes<br />
in der kommenden Saison durchgeführt<br />
werden sollen.<br />
Ein SVAT-Modell zur Berechnung von potentieller<br />
Evapotranspiration (PET) und aktueller Evapotranspiration<br />
(AET) wurde vollständig in Fuzzy-<br />
Logik umgesetzt. Das Verhältnis von AET zu PET<br />
dient als Maß für den Beregnungsbedarf. Erste<br />
vergleichende Simulationen mit lokalen Klimadaten<br />
zeigen, dass mit einer Einordnung der treibenden<br />
Variablen in jeweils weniger als acht Klassen ein<br />
der analytischen Lösung vergleichbares Ergebnis<br />
erreichbar ist. /97/, /186/, /187/, /188/, /207/, /285/,<br />
/316/, /318/, /319/, /320/, /336/, /390/<br />
Bild 1.2: Karte der elektrischen Leitfähigkeit <strong>des</strong> Bodens<br />
ECa (in mS·m -1 ), interpoliert gemäß dem 'ordinary kriging'<br />
Verfahren und in 5 Klassen geclustert nach Ward.<br />
Weiße Kreise zeigen statistisch und räumlich gut verteilte<br />
Messstellen im Feld.<br />
Fig. 1.2: Map of electrical soil conductivity EC a (in mS·<br />
m -1 ) after ordinary kriging interpolation and clustered in 5<br />
classes according to Ward. White circles represent sample<br />
sites, that are statistical and spatial representative.
Reduzieren <strong>des</strong> Frischwasserverbrauchs bei<br />
der Gemüsewäsche durch die Verwertung von<br />
aufbereitetem Waschwasser im geschlossenen<br />
Kreislauf (Projekt-Nr.: 6.40, 119)<br />
Reduction of fresh water consumption at the<br />
washing of vegetable by using purified water in<br />
a closed cycle<br />
Martin Geyer (Abt. 6), Werner Prystav (6)<br />
Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft e.V.<br />
(INFA) an der FH Münster; Möhrenbetrieb Abenhardt<br />
in Datteln<br />
Förderung: Haushalt; BMVEL/BLE<br />
In order to minimize the water consumption of the<br />
carrot packaging plant Abenhardt, the development<br />
of a new procedure for waste water purification<br />
is planned.<br />
The an-organic and organic load of carrot waste<br />
water is very high and varied over several weeks<br />
between 520 and 6400 mg/l for the chemical oxygen<br />
demand (COD). The use of a sequence batch<br />
reactor (SBR) combined with a sieve belt and a<br />
settling tank was the favoured cleaning system.<br />
COD could be reduced up to 93% with the semi<br />
technical waste water processing plant of INFA<br />
(Fig. 1.3).<br />
The SBR has to be integrated into a total cleaning<br />
concept, taking into consideration the dry cleaning<br />
of the carrots before washing and followed by a<br />
gentle and short washing process. The waste water<br />
cycle will be supplemented with a third component,<br />
fed by the SBR. About 60m³ of waste water<br />
should be biologically purified per day.<br />
Der Wasserverbrauch bei der Speisemöhrenwäsche<br />
im Betrieb Abenhardt soll gesenkt werden.<br />
<strong>2003</strong> wurden die Grundlagen für ein neues Anlagenkonzept<br />
geschaffen. Das Überschusswasser<br />
sowie ein Teil <strong>des</strong> im Kreislauf geführten Wassers<br />
sollen zusätzlich zur Absetzstufe biologisch gereinigt<br />
werden. Hierdurch soll die notwendige Frischwasserzufuhr<br />
minimiert werden, ohne Abstriche<br />
bei der Reinigungsleistung und der Produktqualität<br />
zu bekommen.<br />
Untersuchungen vom INFA über einen Zeitraum<br />
von mehreren Monaten zeigten, dass der Trockensubstanzgehalt<br />
und die organische Belastung<br />
<strong>des</strong> Möhrenwaschwassers sehr hoch sind und<br />
stark schwanken. Beim chemischen Sauerstoffbedarf<br />
(CSB) wurden Werte zwischen 520 und bis zu<br />
6400 mg/l gemessen. Die Reinigung mit einem<br />
Belebungsverfahren (SBR-Reaktor (sequence<br />
batch)) stellte sich gegenüber einer getauchten<br />
Festbettanlage insbesondere wegen der geringe-<br />
II Fachlicher Teil 9<br />
ren Verstopfungsgefahr und <strong>des</strong> Abbaus von Mikroorganismen<br />
als vorteilhaft heraus. Mit dem Belebungsverfahren<br />
(Bild 1.3) wurden Reinigungsleistungen<br />
beim CSB von 93 % und bei der Gesamtkeimzahl<br />
von 94 % bei einer Schlammbelastung<br />
kleiner 0,3 kg/(kg*d) erzielt.<br />
Bild 1.3: Halbtechnische Schmutzwasser Aufbereitungsanlage<br />
<strong>des</strong> INFA<br />
Fig. 1.3: Semi technical waste water processing plant of<br />
INFA<br />
Um die Frischwasserzufuhr deutlich zu reduzieren,<br />
muss der Reaktor sinnvoll in das Gesamtkonzept<br />
der Anlage eingebunden werden. Die Vorreinigung<br />
der Möhren sollte verbessert werden und die Reinigungszeit<br />
in der Waschtrommel der Verschmutzung<br />
anpassbar sein. Außerdem sollte ein bewegliches,<br />
möglichst feines Schmutzwassersieb vor<br />
dem Sedimentationsbecken eingesetzt werden.<br />
Der bisher nur aus Nachwaschwasser und Kreislaufwasser<br />
bestehende Schmutzwasserkreislauf<br />
wird um eine weitere Stufe, die aus dem SBR-<br />
Reaktor gespeist wird, ergänzt. Täglich sollen etwa<br />
60 m³ Schmutzwasser biologisch gereinigt werden.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
10<br />
Arbeitsgebiet „Umweltrelevante Stoffströme“<br />
Einfluss der Verfahrensgestaltung im Pflanzenbau<br />
und in der Tierhaltung auf Stoff- und<br />
Energieflüsse (Projekt-Nr. 2.23)<br />
The influence of process <strong>des</strong>ign in crop production<br />
and animal husbandry on biogeochemical<br />
cycles and energy fluxes<br />
Wolf-Dieter Kalk (Abt. 2), Ullrich Völker (4), Werner<br />
Berg (2), Hans Jürgen Hellebrand (2)<br />
Universität Halle; TU München; LfL Güterfelde<br />
Förderung: Haushalt<br />
Analyses of biogeochemical cycles and energy<br />
fluxes allow to assess environmental effects of<br />
agricultural operations. These methods were enhanced<br />
by analyzing the carbon balances of agricultural<br />
procedures and farms under consideration<br />
of different measures and structures of production<br />
as well as site specific conditions. One of the results<br />
is that on farms with animal husbandry negative<br />
carbon balances can occur.<br />
Mittels Analysen <strong>des</strong> Stoff- und Energiehaushaltes<br />
können landwirtschaftliche Bewirtschaftungssysteme<br />
hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit bewertet<br />
werden. Eine gegenüber bisher genutzten<br />
Energiebilanzen erweiterte Möglichkeit der Bewertung<br />
ist mit Kohlenstoff(C)-Bilanzen gegeben. C-<br />
Bilanzen erlauben Aussagen zur Bewertung von<br />
Nachhaltige Landbewirtschaftung<br />
Umweltwirkungen konkreter Betriebe unterschiedlicher<br />
Produktionsweise, Standortbedingungen und<br />
Produktionsstruktur, zu biologischen Senken für<br />
atmosphärischen Kohlenstoff, zum Verhältnis von<br />
biologisch bedingten, betrieblichen C-Flüssen und<br />
C-Zufuhren infolge <strong>des</strong> direkten (z. B. Kraftstoffe)<br />
und indirekten Einsatzes (z. B. Mineraldünger)<br />
meist fossiler Energieträger sowie zu Vermeidungsstrategien<br />
der Nutzung fossil gebundenen<br />
Kohlenstoffs.<br />
Als methodische Grundlage für die C-Bilanzierung<br />
wurde wegen <strong>des</strong> Systemansatzes und der Abbildung<br />
vernetzter Stoffflüsse auf Betriebsebene das<br />
Modell REPRO der MLU Halle zur Analyse und<br />
Bewertung von Umweltwirkungen in Landwirtschaftsbetrieben<br />
genutzt. In die Untersuchungen<br />
wurden Betriebe unterschiedlicher Produktionsintensität<br />
mit und ohne Tierhaltung einbezogen. Die<br />
Veranschaulichung der Ergebnisse erfolgte mit<br />
flächen- und produktbezogenen Kohlenstoffsalden<br />
(Tabelle 1.2) sowie mit der Kohlenstoffverwertungsrate.<br />
In viehhaltenden Betrieben wird die betriebliche C-<br />
Bilanz durch den Erhaltungsumsatz der Tiere und<br />
die Nutzung fossil gebundenen Kohlenstoffs für die<br />
Tierhaltung unabhängig vom gewählten Indikator<br />
ungünstiger. Wird der überwiegende Teil <strong>des</strong><br />
Pflanzenbauproduktes als Futtermittel auf dem<br />
Betrieb selbst eingesetzt, so wird der betriebliche<br />
C-Saldo negativ – Betrieb emittiert mehr Kohlenstoff,<br />
als er durch Photosynthese bindet. /154/,<br />
/280/, /281/<br />
Tabelle 1.2: Betriebscharakteristiken sowie flächen- und produktbezogene Kohlenstoffsalden<br />
Table 1.2: Farm characteristics and carbon balances area and product related<br />
Betriebskenngröße ME Betrieb 1 Betrieb 2 Betrieb 3 Betrieb 4 Betrieb 5<br />
Bewirtschaftung ökol konv ökol konv konv<br />
Standorttyp Schwarzerde Schwarzerde Sand Sand Schwarzerde<br />
Ackerzahl 62 79 21 48 89<br />
Landwirtschaftsfläche<br />
ha 165 2046 69 1489 2286<br />
Tierbesatz GV ha -1 0,49 0,40 0,67<br />
Tierhaltungsrichtung Milchvieh 1) Milchvieh 1) Milchvieh 1)<br />
Flächenbezogene Kohlenstoffsalden<br />
CO2-Assimilation kg C ha -1<br />
Pflanzenbau kg C ha -1<br />
Tierhaltung kg C ha -1<br />
Betrieb kg C ha -1<br />
Produktbezogene Kohlenstoffsalden<br />
Pflanzenbau kg C GE -1<br />
Tierhaltung kg C GE -1<br />
Betrieb kg C GE -1<br />
1) mit Nachzucht<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Schweinemast 1) Rindermast 1) Rindermast<br />
Schafe<br />
3088 5240 1652 3637 5778<br />
795 2419 893 1572 2739<br />
-991 -630 -790<br />
795 2419 -91 941 1948<br />
23,0 31,1 45,4 2) 31,0 31,5<br />
-77,7 -45,6 -62,7<br />
23,0 31,1 -6,5 18,4 23,7<br />
2) wegen Tierhaltung wird Stroh mit hohem C-Gehalt und niedrigem GE-Wert komplett geerntet
Stickstoffbilanz nachwachsender Rohstoffe auf<br />
sandigen Standorten (Projekt-Nr.: 2.31-I)<br />
Nitrogen balance of renewable materials cultivated<br />
at sandy soils<br />
Hans Jürgen Hellebrand (Abt. 2), Volkhard Scholz<br />
(3), Christine Idler (1) und Jürgen Kern (1)<br />
Förderung: Haushalt<br />
Nitrogen fertilisation increases the yield of renewable<br />
materials, but can result in un<strong>des</strong>ired environmental<br />
effects like nitrogen leaching and emission<br />
of nitrous oxide. Increased soil nitrate concentrations<br />
were measured at plots fertilised with<br />
higher nitrate rates (150 kg N ha -1 y -1 ; Fig. 1.4 left).<br />
The year <strong>2003</strong> was extremely dry. The emission of<br />
nitrous oxide was therefore low compared to the<br />
moister years before. Fertiliser induced N2Oemissions<br />
could only be observed after the second<br />
fertilisation (Fig 1.4 right). The clear difference in<br />
soil nitrate concentration between plots fertilised<br />
with 150 kg N ha -1 y -1 and non-fertilised soils gives<br />
evidence for higher nitrate levels in the soil due to<br />
high rates of nitrogen fertilising.<br />
Am Standort <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> wurde ab 1994 ein parzelliertes<br />
Versuchsfeld angelegt mit der Zielstellung,<br />
Eigenschaften und Umweltwirkungen nachwachsender<br />
Energieträger vom Anbau über Ernte,<br />
Transport und Lagerung bis zur Verbrennung zu<br />
untersuchen und zu bewerten. Seit diesem Zeit-<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
1 2 3<br />
10. Mrz 5. Mai 30. Jun 25. Aug 20. Okt 15. Dez<br />
<strong>2003</strong><br />
II Fachlicher Teil 11<br />
150 kg N<br />
75 kg N<br />
0 kg N<br />
raum werden festgelegte Parzellen mit drei unterschiedlichen<br />
Stickstoffgaben versorgt - ohne Düngung,<br />
mit 75 kg N ha -1 a -1 und mit 150<br />
kg N ha -1 a -1 . Stickstoffdüngung steigert die Erträge<br />
nachwachsender Rohstoffe, kann aber durch<br />
Nitratverlagerung und Lachgasemissionen Umweltbelastungen<br />
nach sich ziehen. Die mit 150<br />
kg N ha -1 a -1 gedüngten Flächen zeigen im Jahresverlauf<br />
eine deutlich erhöhte Konzentration von<br />
Nitratstickstoff in der Bodenlösung, während die<br />
Bodennitratstickstoffkonzentration bei Parzellen<br />
mit 75 kg N ha -1 a -1 nur zum Zeitpunkt der zweiten<br />
Stickstoffgabe (Bild 1.4 links) höher ausfällt.<br />
Das Jahr <strong>2003</strong> war extrem niederschlagsarm. Die<br />
Lachgasemissionen waren <strong>des</strong>halb deutlich niedriger<br />
als in den feuchteren Vorjahren. Düngungsinduzierte<br />
N2O-Emissionen treten in der Regel bei<br />
gedüngten Parzellen auf. Obwohl weniger ausgeprägt,<br />
konnten auch im Versuchsjahr <strong>2003</strong> nach<br />
der zweiten Düngergabe verstärkte Lachgasemissionen<br />
bei den mit 150 kg N ha -1 a -1 gedüngten<br />
Parzellen registriert werden (Bild 1.5 rechts). Insgesamt<br />
ergibt der langjährig hohe Stickstoffversorgungsgrad<br />
der mit 150 kg N ha -1 a -1 versorgten<br />
Parzellen eine stärkere und über den Vegetationszeitraum<br />
anhaltende Nmin-Konzentration im Boden<br />
im Vergleich zu den mit 75 kg N ha -1 a -1 gedüngten<br />
Parzellen und den ungedüngten Flächen. /16/,<br />
/138/, /196/, /197/, /266/, /284/, /325/, /326/, /327/,<br />
/361/, /362/, /372/<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
1 2 3<br />
10. Dez 8. Feb 10. Apr 10. Jun 10. Aug 10. Okt 9. Dez<br />
Bild 1.4: Einfluss der Düngung auf die Nitratstickstoffkonzentration im Bodenhorizont 0-30 cm (links) und auf die Lachgasemission<br />
aus dem Boden (rechts). In der Grafik sind die Mittelwerte gleichgedüngter Parzellen dargestellt. Pfeile<br />
weisen auf die Zeitpunkte der Düngungsgaben ( 8. April, 12. Mai und 2. Juni <strong>2003</strong>).<br />
Fig. 1.4: Impact of nitrogen fertilising on soil nitrate concentration in the 0-30 cm soil layer (left) and on the emission of<br />
nitrous oxide (right). The figure shows the means of equally fertilised plots. Arrows indicate the fertilising dates (April 8,<br />
May 12, and June 2, <strong>2003</strong>).<br />
<strong>2003</strong><br />
150 kg<br />
75 kg N<br />
0 kg N<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
12<br />
Stickstoffumsätze auf sandigen Ackerböden<br />
(Projekt-Nr.: 2.31-II)<br />
Nitrogen turnover on sandy soils<br />
Jürgen Kern (Abt. 1), Hans Jürgen Hellebrand (2),<br />
Horst Domsch (4)<br />
Förderung: Haushalt<br />
Due to sandy soils nitrogen may be leached from<br />
fields to the aquifer. One way of water protection is<br />
organic farming, which was studied for its N turnover<br />
along a transect from the field to the riparian<br />
zone of Lake Zitzel. From October to March between<br />
22 and 37 kg N ha -1 were lost from the field.<br />
Most nitrogen probably was denitrified near and<br />
within the riparian zone of the lake.<br />
Der hohe Sandanteil brandenburgischer Ackerflächen<br />
bedingt eine hohe Durchlässigkeit und damit<br />
eine hohe Auswaschungsgefährdung von Nährstoffen,<br />
insbesondere von Stickstoff. Dem trägt der<br />
ökologische Landbau mit seinem Verzicht auf den<br />
Einsatz von Mineraldüngemitteln Rechnung. Inwieweit<br />
es ohne jede Nährstoffzugabe zu unvermeidbaren<br />
Stickstoffverfrachtungen kommt, wurde<br />
im Rahmen fortlaufender Untersuchungen zusammen<br />
mit der Universität Potsdam auf einem<br />
Transekt von einer hoch gelegenen (8) und einer<br />
tief gelegenen Ackerfläche (9) bis in den ca. 5 m<br />
breiten Ufergürtel (10) <strong>des</strong> unter Naturschutz stehenden<br />
Flachsees Zitzel untersucht. Niedrige Bodenleitfähigkeitswerte<br />
(Bild 1.5) korrespondieren<br />
mit niedrigen Ackerzahlen zwischen 20 und 25.<br />
EC25, mS/m<br />
0 - 2<br />
2 - 4<br />
4 - 6<br />
6 - 8<br />
8 - 10<br />
10 - 12<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
#<br />
Probepunkt<br />
50 0 50 Meter<br />
Zitzel<br />
10 8<br />
#<br />
# #<br />
9<br />
Bild 1.5: See Zitzel und Bodenleitfähigkeit der<br />
Ackerfläche im Emster Quellgebiet (Unterschungstransekt:<br />
8-9-10)<br />
Fig. 1.5: Lake Zitzel and conductivity map of the surrounding<br />
field in the spring region of River Emster<br />
(sampling points: 8-9-10)<br />
N<br />
Nachhaltige Landbewirtschaftung<br />
Im Gegensatz zum gesamten bodenbürtigen Stickstoffvorrat<br />
ist der lösliche, pflanzenverfügbare<br />
Stickstoffgehalt (Nmin) mit durchschnittlich 9,2 kg N<br />
ha -1 auf dem Ackerstandort 8 ausgesprochen niedrig<br />
(Tabelle 1.3). Während der vegetationslosen<br />
Zeit gingen 21,7 bzw. 36,6 kg N ha -1 auf den Ackerstandorten<br />
verloren. Ein Großteil davon dürfte<br />
am Standort 9 über Denitrifikation in die Atmosphäre<br />
entbunden worden sein, wie die hohen<br />
natürlichen Denitrifikationsraten belegen (Bild 1.6).<br />
Im Uferstreifen wurde dagegen erst nach experimenteller<br />
NO3-Zugabe intensiv denitrifiziert, ein<br />
klares Indiz, dass NO3 in diesem Bereich bereits<br />
limitiert ist. Damit wird das hohe N-Eliminationspotenzial<br />
<strong>des</strong> Uferstreifen und seine Funktion<br />
als wirksamer Gewässerschutz deutlich. Nach<br />
derzeitigem Kenntnisstand repräsentiert die aktuelle<br />
Bewirtschaftung nach den Kriterien <strong>des</strong> ökologischen<br />
Landbaus eine geeignete Nutzungsform der<br />
Ackerflächen um den Zitzel und zeigt, dass Landwirtschaft<br />
und Naturschutz in unmittelbarer Nachbarschaft<br />
miteinander vereinbar sind. /16/, /138/,<br />
/196/, /197/, /266/, /284/, /325/, /326/, /327/, /361/,<br />
/362/, /372/<br />
Tabelle 1.3: Stickstoffgehalte und -verluste im Boden (0-<br />
60 cm, April 02 – März 03)<br />
Table 1.3: Nitrogen content and loss in soil (0-60 cm,<br />
April 02 – March 03)<br />
N ges (0-60 cm) kg N ha -1<br />
N min (0-60 cm) kg N ha -1<br />
N min -Verlust<br />
(Okt. 02 - März 03)<br />
µmol N 2O kg TS -1 h -1<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
kg N ha-1<br />
natürliche Rate<br />
Potenzial (+NO3)<br />
8 9<br />
Winterroggen<br />
3.667 14.444<br />
9,2 26,7<br />
21,7 36,6<br />
8 9 10<br />
Standort<br />
Bild 1.6: Denitrifikation entlang <strong>des</strong> Acker-See-Transekts<br />
(April 02 - März 03)<br />
Fig. 1.6: Denitrification along the transect from the field<br />
to the lake (April 02 – March 03)
2 Teilflächenspezifische Bewirtschaftung<br />
und Nutzung von Satellitentechnik im<br />
Pflanzenbau (Forschungsschwerpunkt 2)<br />
Precision farming and use of satellite<br />
technology in plant production<br />
(Koordinator: Detlef Ehlert, Abt. 4)<br />
Das Arbeitsgebiet zur Einführung der teilflächenspezifischen<br />
Bewirtschaftung basiert auf vier Projekten,<br />
die von Mitarbeitern der Abteilungen 2 und<br />
4 bearbeitet wurden.<br />
Die Entwicklung einer low-input Lösung für die<br />
teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Betriebsmaßstab<br />
wurde konsequent in den fünf beteiligten<br />
Projektbetrieben fortgeführt und steht nun<br />
unmittelbar vor dem Abschluss. Mit dem Berichtsjahr<br />
konnten auf insgesamt 2.250 ha Projektfläche<br />
die Erträge von Mähdruschfrüchten über drei Jahre,<br />
die elektrische Bodenleitfähigkeit (EC) und die<br />
Gehalte der Grundnährstoffe in einem 1 ha-Raster<br />
bestimmt werden. Unter Nutzung aller Daten, umfangreicher<br />
Bodenprofilaufnahmen und von Luftbildern<br />
war die Erstellung detaillierter Bodenkarten<br />
als langfristige Grundlage für die angestrebte teilflächenspezifische<br />
Bewirtschaftung möglich, die<br />
von den Projektbetrieben zukünftig selbständig<br />
ohne direkte wissenschaftliche Begleitung genutzt<br />
werden.<br />
Im Berichtszeitraum wurden zwei weitere Versuchsschläge<br />
in die Bewertung und Potenzialabschätzung<br />
der teilflächenspezifischen Stickstoffdüngung<br />
einbezogen. Betrachtet man alle Versuchsflächen,<br />
so wird deutlich, dass die lokalen<br />
bilanzrelevanten Parameter wie Düngermengen,<br />
Erträge und Kornqualitäten starken Schwankungen<br />
unterliegen, die zusätzlich von den jahresspezifischen<br />
Witterungsbedingungen überlagert werden.<br />
Aus der Summe aller Beobachtungswerte<br />
konnten Aussagen über grundsätzliche Trends<br />
abgeleitet werden, die einen Beitrag zur komplexen<br />
Bewertung der teilflächenspezifischen Stickstoffdüngung<br />
leisten.<br />
Im Rahmen der vergleichenden Sensormessungen<br />
zur Variabilitätsbestimmung auf Ackerflächen und<br />
zur Stickstoffbedarfsermittlung wurden der „Hydro<br />
N-Sensor“, spektralanalytische Messungen sowie<br />
der Pendelsensor auf einem stark heterogenen<br />
Feld eingesetzt. Trotz unterschiedlicher Messprinzipe<br />
zeigte sich, dass grundsätzliche Tendenzen<br />
bei der Ausbildung von Pflanzenbeständen übereinstimmend<br />
abgebildet werden.<br />
In einem Projekt zur ökonomischen und ökologischen<br />
Bewertung <strong>des</strong> Einsatzes von Sensoren<br />
zum teilflächenspezifischen Pflanzenschutz werden<br />
unter Annahme verschiedener Heterogeni-<br />
II Fachlicher Teil 13<br />
tätsszenarien Rentabilitätsberechnungen durchgeführt.<br />
Da am <strong>ATB</strong> bereits umfangreiche Daten zum<br />
teilflächenspezifischen Pflanzenschutz vorliegen,<br />
erfolgte in einer ersten Bearbeitungsstufe zur Nutzung<br />
von Synergieeffekten eine Aufbereitung der<br />
realisierten Mitteleinsparungen. In nachfolgenden<br />
Bearbeitungsetappen ist die Einschätzung potentieller<br />
Umwelteffekte anhand relevanter Umweltwirkungskategorien<br />
sowie die Klassifikation verschiedener<br />
Heterogenitätsstufen zur Rentabilitätsrechnung<br />
(break-even) <strong>des</strong> Sensoreinsatzes vorgesehen.<br />
Die bereits im Vorjahr begonnene großflächige<br />
Erfassung der Heterogenität hinsichtlich der Ausbildung<br />
der Pflanzenmasse wurde im Berichtsjahr<br />
auf einer Fläche von ca. 1.000 ha in Wintergerste<br />
Winterroggen, Triticale, Winterweizen und Wiesengras<br />
an unterschiedlichen Standorten fortgesetzt.<br />
Dabei konnten der dafür eingesetzte Pendelsensor<br />
technisch weiterentwickelt sowie gleichzeitig<br />
Dauertests unter Praxisbedingungen unterzogen<br />
werden. Neben der Kartierung der relativen<br />
Pflanzenmassedichte war es mit nur geringen<br />
technischen Mehraufwendungen möglich, über<br />
eine Fahrstrecke von ca. 340 km repräsentative<br />
Ergebnisse zur Tiefe von Regelspuren auf Getrei<strong>des</strong>chlägen<br />
zu gewinnen. Die in dieser Form bisher<br />
einmaligen Messungen bilden somit eine<br />
Grundlage zur Versachlichung der Diskussionen<br />
über in der Praxis auftretende Verdichtungsgefährdungen<br />
unter Regelspuren.<br />
Die vom BMBF geförderten Arbeiten zur praktischen<br />
Anwendung <strong>des</strong> Pendelsensors für die teilflächenspezifische<br />
Applikation von Stickstoffdünger,<br />
Wachstumsreglern und Fungiziden konnten<br />
zum Ende <strong>des</strong> Jahres bis auf die Erstellung <strong>des</strong><br />
Abschlussberichts weitgehend abgeschlossen<br />
werden. Zur Vegetationssaison <strong>2003</strong> wurden die<br />
steuerungstechnischen Lösungen bei der Kombination<br />
<strong>des</strong> Sensors mit einem Zentrifugal-<br />
Düngerstreuers und einer Pflanzenschutzspritze<br />
weiter verbessert und getestet. Zusammenfassend<br />
kann zur Anwendung <strong>des</strong> Pendelsensors für die<br />
teilflächenspezifische Applikation von Dünge- und<br />
Pflanzenschutzmitteln eingeschätzt werden, dass<br />
infolge der am Bedarf ausgerichteten Dosierung<br />
eine deutliche Effektivitätssteigerung hinsichtlich<br />
<strong>des</strong> Betriebsmitteleinsatzes erzielt wurde. Diese<br />
wirkt sich einerseits positiv auf das Betriebsergebnis<br />
<strong>des</strong> Landwirts aus und leistet andererseits<br />
einen messbaren Beitrag zur Entlastung der Umwelt<br />
bei landwirtschaftlichen Produktionsverfahren.<br />
Mit dem Abschluss der Vegetationssaison <strong>2003</strong><br />
konnte ein technologischer Entwicklungsstand <strong>des</strong><br />
Pendelsensors erreicht werden, der die direkte<br />
Überführung in die industrielle Produktion ermög-<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
14<br />
lichte. Der nun unter dem Handelsnamen "CROP-<br />
Meter" von den Firmen Müller-Elektronik und<br />
Agrocom auf der AGRITECHNICA <strong>2003</strong> vorgestellte<br />
Sensor wurde infolge seiner Praxisorientierung<br />
mit einer Silbermedaille ausgezeichnet und wird ab<br />
2004 der Landwirtschaft zur Verfügung stehen.<br />
Der Schwerpunkt der Forschungsarbeiten zur Entwicklung<br />
eines Messsystems zur Bewertung <strong>des</strong><br />
Unkrautvorkommens konzentrierte sich in seiner<br />
abschließenden Phase auf den Einsatz von Kameratechnik,<br />
die den spezifischen Anforderungen<br />
durch entsprechende Softwareentwicklungen seitens<br />
der beteiligten Partner angepasst wurde. Mit<br />
dem erzielten Entwicklungsstand liegt ausreichend<br />
grundlegen<strong>des</strong> Know-how für den Bau von Kameras<br />
zur Unkrauterkennung vor, so dass als nächster<br />
Schritt der Einstieg einer Herstellerfirma in die<br />
Produktion folgen könnte.<br />
Die Thermographie wird in vielen Bereichen angewendet,<br />
um Oberflächentemperaturen zu messen.<br />
Die Untersuchungen zur Erkennung von<br />
durch Pilzinfektion verursachte Pflanzenkrankheiten<br />
mittels Thermographie zeigten im Labormaßstab<br />
bei von Mehltau befallenem Weizen, dass die<br />
Oberflächentemperaturen gegenüber gesunden<br />
Pflanzen absinken. Unter Freilandbedingungen<br />
entstehen durch differenzierte mikroklimatische<br />
Bedingungen ebenfalls Unterschiede in den Oberflächentemperaturen<br />
in ähnlichen Größenordnungen.<br />
Somit kann die Schlussfolgerung gezogen<br />
werden, dass eine ausreichend sichere Erkennung<br />
von Pilzbefall mit der erforderlichen Sicherheit<br />
nicht möglich ist.<br />
Die angestrebte Neuorientierung der Arbeiten im<br />
Forschungsschwerpunkt zur Sensorentwicklung<br />
und -bewertung wurde im Berichtszeitraum durch<br />
die neuen Forschungsprojekte 4.27; 4.28; 4.29<br />
und 4.30 fortgesetzt.<br />
Ein weiterer Ansatz zur Erkennung von Pflanzenkrankheiten<br />
ist die Fluoreszenzspektroskopie. Mit<br />
ihr kann der Chlorophyllgehalt und somit die photosynthetische<br />
Aktivität von Pflanzen gemessen<br />
werden. Um durch Pilze verursachte Schädigungen<br />
zu erkennen, werden die Forschungsarbeiten<br />
insbesondere auf zeitaufgelöste Fluoreszenzmessungen<br />
gerichtet, da von ihnen eine bessere Erkennbarkeit<br />
erwartet wird.<br />
Ergänzende verfahrenstechnische Untersuchungen<br />
sollten zeigen, ob mit dem am <strong>ATB</strong> entwickelten<br />
opto-eletronischen Unkrautsensor auch die<br />
Größe und damit das Vegetationsstadium von<br />
Unkräutern erkannt werden kann. Infolge der sehr<br />
unterschiedlichen und häufig nicht kompakten<br />
Pflanzenkonturen konnten aus den relativ spotartigen<br />
Reflektionsmessungen keine ausreichend<br />
genauen Aussagen über die Größe der Unkraut-<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Pflanzenbau<br />
pflanzen abgeleitet werden. In der weiteren Bearbeitung<br />
<strong>des</strong> Projektes wird untersucht, ob die Zielstellung<br />
durch den Einsatz einer Kamera besser<br />
erfüllt werden kann. Die Entwicklung einer speziellen<br />
Softwarelösung zur Größenbestimmung von<br />
Unkräutern ist bereits begonnen worden.<br />
Bei der fahrzeuggestützten Ermittlung von Boden-<br />
und Pflanzenparametern wird nur ein Teil der Gesamtfläche<br />
berücksichtigt, da alle bekannten Sensoren<br />
die Messwerte nur punkt- oder streifenförmig<br />
erfassen. Damit besteht das Problem, dass<br />
neben dem eigentlichen Messfehler <strong>des</strong> Sensors<br />
ein weiterer Fehler entsteht, der aus der Übertragung<br />
der erfassten Flächenanteile auf die Gesamtfläche<br />
<strong>des</strong> Schlages bzw. die Arbeitsbreite resultiert.<br />
Die Größe dieses Übertragungsfehlers wird<br />
sowohl von der Form und Größe der durch den<br />
jeweiligen Sensor detektierten Fläche als auch von<br />
der räumlichen Variabilität der Boden- und Pflanzenparameter<br />
bestimmt. Durch die Untersuchungen<br />
soll geklärt werden, welche Übertragungsfehler<br />
bei pflanzenbaulichen Maßnahmen entstehen<br />
bzw. wie und in welcher Zahl Sensoren angeordnet<br />
werden müssen, um vorgegebene Fehlergrenzen<br />
nicht zu überschreiten.<br />
In dem Forschungsschwerpunkt "Teilflächenspezifische<br />
Bewirtschaftung und Nutzung von Satellitentechnik<br />
im Pflanzenbau" wurden in den zurückliegenden<br />
Jahren umfangreiche Forschungsarbeiten<br />
zur Entwicklung, Anwendung und Bewertung von<br />
Technik und Verfahren für die Einführung einer<br />
Präzisionslandwirtschaft geleistet. Die bearbeiteten<br />
Forschungsprojekte waren größtenteils darauf<br />
gerichtet, nicht nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse<br />
zu erweitern, sondern sie orientierten<br />
insbesondere auf eine unmittelbare Anwendbarkeit<br />
in der praktischen Landwirtschaft. Ausdruck dieser<br />
Forschungsausrichtung sind zahlreiche Kooperationsbeziehungen<br />
mit Landwirtschaftsbetrieben<br />
sowie die erfolgreiche Überführung von Sensorentwicklungen<br />
und Produktionstechnologien in die<br />
landwirtschaftliche Praxis.<br />
In der Ausrichtung zukünftiger Forschungsarbeiten<br />
darf dieser Praxisbezug nicht verloren gehen ohne<br />
zu übersehen, dass die Forschung von heute Antworten<br />
auf die Anforderungen von morgen geben<br />
muss.
Projekte zum Forschungsschwerpunkt 2<br />
Entwicklung einer low-input Lösung für die<br />
teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Betriebsmaßstab<br />
(Projekt-Nr.: 101)<br />
Development of a low input solution for precision<br />
agriculture on farm scale<br />
Horst Domsch (Abt. 4), Toni Kaiser (4)<br />
Förderung: BMVEL/BLE<br />
Precision agriculture (PA) needs cost-effective<br />
information about the variability within a site. Following<br />
data were collected at 2250 ha farmland:<br />
yield from three years, soil electrical conductivity<br />
(EC), nutrient level in 1 ha-grid, aerial images and<br />
soil surveys.<br />
Multi-year yield data and EC data are the most<br />
advantageous information sources because of the<br />
low-expensive collecting and the high density of<br />
the geocoded data.<br />
EC data is a basis for detailed soil maps which are<br />
useful not only for PA. It provi<strong>des</strong> a possibility to<br />
show the influence of different unidentified soil<br />
conditions (EC levels) to the yield (Figure 2.1).<br />
They reflect the yield expectation for these soil<br />
conditions depending on different climates and<br />
crop species.<br />
Despite the partially close correlation between EC<br />
data and nutrient level, the connection is not generally<br />
available. Therefore a directed soil sampling<br />
using an EC map is not recommended.<br />
Teilflächenspezifische Bewirtschaftung erfordert<br />
präzise Informationen über die wechselnden Eigenschaften<br />
<strong>des</strong> Bodens und/oder <strong>des</strong> Pflanzenbestan<strong>des</strong><br />
innerhalb eines Schlages. In dem Projekt<br />
wird untersucht, wie diese Informationen kostengünstig<br />
für spätere Entscheidungen zu ermitteln<br />
sind.<br />
In fünf Betrieben wurden auf insgesamt 2.250 ha<br />
Projektfläche die Erträge von Mähdruschfrüchten<br />
über drei Jahre, die elektrische Bodenleitfähigkeit<br />
(EC) und die Gehalte der Grundnährstoffe in einem<br />
1 ha-Raster bestimmt. Zusätzlich wurden<br />
mehrfach pro Saison Luftbilder aufgenommen und<br />
unter Nutzung aller Daten und umfangreicher Profilaufnahmen<br />
detaillierte Bodenkarten erstellt.<br />
Die jährlichen Erträge und die EC sind Informationen,<br />
die geocodiert und mit einer sehr hohen Datendichte<br />
kostengünstig ermittelt werden können.<br />
Aus Luftbildern lassen sich vergleichbare Informationen<br />
in Form von Vegetationsindizes bestimmen.<br />
Der Aufnahmezeitpunkt ist jedoch witterungsabhängig<br />
und die Datenverarbeitung wesentlich auf-<br />
II Fachlicher Teil 15<br />
wändiger. Am teuersten ist die Ermittlung der<br />
Nährstoffgehalte, obwohl die Datendichte am geringsten<br />
ist.<br />
Daraus ergibt sich, dass vorzugsweise die Erträge<br />
und die EC zu bestimmen sind, um ohne Echtzeitsensoren<br />
teilflächenspezifisch wirtschaften zu<br />
können. Das Muster der EC kennzeichnet Bereiche<br />
gleicher bzw. differierender Bodeneigenschaften<br />
und entspricht im wesentlichen damit auch<br />
dem Muster einer Bodenkarte. Es ermöglicht eine<br />
gezielte Bodenkartierung. Detaillierte Bodenkarten<br />
sind nicht nur für die teilflächenspezifische Bewirtschaftung<br />
von Bedeutung.<br />
Werden die Ertragsdaten unter Nutzung der Perzentilmethode<br />
in Abhängigkeit von den EC-Daten<br />
dargestellt, ist dies gleichbedeutend mit ihrer Darstellung<br />
in Abhängigkeit von differierenden, aber<br />
nicht näher bekannten Bodenbedingungen. Aus<br />
dem Verlauf dieser Kurven kann auf die bodenabhängige<br />
relative Ertragserwartung für eine bestimmte<br />
Kultur unter bestimmten Witterungsbedingungen<br />
geschlossen werden (Bild 2.1).<br />
Normierter Ertrag,-<br />
Normalised yield, -<br />
1.8<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
P50_Raps2002<br />
P50_Rape2002<br />
P50_Wintergerste2001<br />
P50_Winter barley2001<br />
Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3<br />
sector 1 sector 2 sector 3<br />
0 50 100 150 200<br />
EC25, mS/m<br />
Bild 2.1: Mittlerer normierter Ertrag von Wintergerste<br />
und Raps in Abhängigkeit von der elektrischen Bodenleitfähigkeit<br />
für einen Schlag in zwei Jahren<br />
Fig. 2.1: Averaged normalised yield from winter barley<br />
and rape depending on the soil electrical conductivity at<br />
the same site in two years<br />
Zwecks Senkung der Aufwendungen für die Nährstoffbeprobung<br />
wurde auf einem Altmoränenstandort<br />
untersucht, ob das Muster der EC auch<br />
als Grundlage für eine gezielte Nährstoffbeprobung<br />
dienen könnte. Trotz teilweise enger Korrelationen<br />
zwischen den Nährstoffgehalten und der EC<br />
ist der Zusammenhang nicht generell gegeben, so<br />
dass dieses Verfahren nicht empfohlen werden<br />
kann. Somit ist die Untersuchung weiterer Lösungsansätze<br />
dringend geboten. /36/, /72/, /103/,<br />
/116/, /117/, /242/, /243/, /244/<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
16<br />
Durchführung von Sensormessungen zur Variabilitätsbestimmung<br />
auf Ackerflächen und zur<br />
Stickstoffbedarfsermittlung<br />
(Projekt-Nr.: 4.32; 57)<br />
Realization of sensor measurements on arable<br />
fields for variability appointment and for determination<br />
of nitrogen demand<br />
Jürgen Schwarz (Abt. 4)<br />
ZALF Müncheberg; Südzucker AG Mannheim/<br />
Ochsenfurt<br />
Förderung: Haushalt; Agrocom Bielefeld; Amazonen<br />
Werke<br />
Detection of heterogeneity on arable fields based<br />
on soil samples is time consuming and expensive.<br />
Sensors are a promising way to detect and to react<br />
at once on different parameters. Different sensors<br />
were tested under practical circumstances on arable<br />
fields. The variability of the soil was measured<br />
with a lot of soil samples.<br />
Die Erfassung der Heterogenität von Ackerflächen<br />
mittels Bodenbeprobungen ist zeit- und kostenaufwendig.<br />
Sensortechnische Lösungen haben<br />
den großen Vorteil der Erfassung und gleichzeitigen<br />
Möglichkeit der Reaktion auf unterschiedliche<br />
Bestan<strong>des</strong>faktoren.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Pflanzenbau<br />
Eine weitverbreitete, bisherige Sensormesstechnik<br />
zur Stickstoffbedarfsermittlung berücksichtigt lediglich<br />
die Blattaufhellung als Indikator für Stickstoffmangel.<br />
Die Aufhellung von Blättern kann aber<br />
auch andere Ursachen als Stickstoffmangel haben.<br />
In diesem Jahr wurden verschiedene Systeme,<br />
Hydro-N-Sensor, Wellenlängenmessungen und<br />
Pendelsensor, unter praktischen Bedingungen<br />
getestet. Die Testung der Sensoren erfolgte auf<br />
einem stark heterogenen Feld, welches mittels<br />
eines Düngungsversuches gedüngt wurde. Dabei<br />
stellen insbesondere die acht Nullparzellen hohe<br />
Anforderungen an die Sensortechnik.<br />
Die Sensoren zeigten ähnliche Tendenzen in den<br />
Reaktionen auf die unterschiedlichen Pflanzenbestände<br />
im Feld, obwohl unterschiedliche Messprinzipe<br />
und nicht identische Detektionsflächen<br />
vorlagen.<br />
Zur Bestimmung der Bodenvariabilität wurden<br />
Beprobungen zur Nmin-Bestimmung, jeweils kurz<br />
vor einer Düngungsmaßnahme, durchgeführt.<br />
Nach der Ernte fand eine umfangreiche Bodenbeprobungskampagne<br />
statt. Erwartungsgemäß unterscheiden<br />
sich die Nmin-Werte der Nullparzellen<br />
deutlich von den anderen Punkten (Bild 2.2).<br />
Im weiteren Projektverlauf werden die Sensormessungen<br />
zur Absicherung der Ergebnisse erneut<br />
durchgeführt. /89/, /95/, /128/, /200/, /353/, /397/<br />
Bild 2.2: Beprobungsraster<br />
der Herbstbeprobung auf<br />
dem Schlag „Bei Lotte“.<br />
Fig. 2.2: Soil samples in<br />
autumn for the field “Bei<br />
Lotte”
Ökonomische und ökologische Bewertung <strong>des</strong><br />
Einsatzes von Sensoren zum teilflächenspezifischen<br />
Pflanzenschutz (Projekt-Nr.: 4.31)<br />
Economic and ecological assessment of sensor<br />
use for site-specific plant protection<br />
Jürgen Schwarz (Abt. 4), Ralf Schlauderer (2),<br />
Karl-Heinz Dammer (4)<br />
Förderung: Haushalt<br />
Sensors for site-specific plant protection allow a<br />
more efficient plant production regarding economic<br />
and environmental reasons. Practical investigations<br />
show that site-specific plant protection can be<br />
done online. This project focuses on the economical<br />
and ecological assessment of the sensor use.<br />
Different scenarios of heterogeneity are assumed.<br />
Based on these assumptions calculation of earning<br />
power is done. Also an estimation of possible ecological<br />
effects will be done.<br />
Der Einsatz von Sensoren im Bereich <strong>des</strong> Pflanzenschutzes<br />
ermöglicht es, die Effizienz der landwirtschaftlichen<br />
Bewirtschaftung aus betriebswirtschaftlich<br />
und umweltrelevanter Sicht zu verbessern.<br />
Praxisversuche mit dem am <strong>ATB</strong> entwickelten<br />
Unkraut- bzw. Pendelsensor belegen, dass ein<br />
teilflächenspezifischer Pflanzenschutz auf Praxisschlägen<br />
in Echtzeit technisch durchführbar ist<br />
(Bild 2.3). Erste Abschätzungen gehen davon aus,<br />
dass signifikante betriebswirtschaftliche Einsparpotenziale<br />
bei der Verwendung eines differenzierten<br />
Pflanzenschutzmitteleinsatzes in Verbindung<br />
mit dem Sensoreinsatz vorliegen. Neben betriebswirtschaftlichen<br />
Vorteilen sind auch die zu erwartenden<br />
ökologischen Effekte resultierend aus einer<br />
bedarfsgerechteren und damit minimierten Applikation<br />
der Betriebsmittel von Bedeutung.<br />
Im Projekt wird der Sensoreinsatz im Pflanzenschutz<br />
ökonomisch und ökologisch bewertet. Die<br />
Annahme verschiedener Heterogenitätsszenarien<br />
ermöglicht es, mittels Rentabilitätsberechnungen,<br />
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen <strong>des</strong> Sensoreinsatzes<br />
zu ermitteln. Ferner erfolgt die Einschätzung<br />
potentieller Umwelteffekte anhand relevanter<br />
Umweltwirkungskategorien.<br />
Die am <strong>ATB</strong> durchgeführten Versuche zum teilflächenspezifischen<br />
Pflanzenschutz wurden ausgewertet.<br />
Dabei konnten unter Praxisbedingungen<br />
Einsparungen der Spritzbrühe im Bereich <strong>des</strong> Herbizideinsatzes<br />
von ca. 22 l/ha und beim Fungizideinsatz<br />
von ca. 28 l/ha erreicht werden.<br />
Im weiteren Projektverlauf erfolgt die Klassifikation<br />
verschiedener Heterogenitätsstufen zu Rentabili-<br />
II Fachlicher Teil 17<br />
tätsrechnungen (break-even) <strong>des</strong> Sensoreinsatzes.<br />
Ebenfalls wird eine qualitative und quantitative<br />
Abschätzung der möglichen Umwelteffekte unter<br />
Verwendung von Prozesskettenanalysen durchgeführt.<br />
Bild 2.3: Kombination einer Feldspritze mit dem Pendelsensor<br />
zur Fungizidapplikation<br />
Fig. 2.3: Field sprayer in combination with the pendulum<br />
meter for fungicide application<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
18<br />
Einsatz eines Pendelsensors zur Heterogenitätsbestimmung<br />
von landwirtschaftlichen Nutzflächen<br />
(Projekt-Nr.: 4.21)<br />
Pendulum-meter for heterogeneity measurement<br />
on arable areas<br />
Detlef Ehlert (Abt. 4)<br />
Förderung: Haushalt<br />
To improve the work of the sensor pendulummeter<br />
under hard practical conditions a compensation<br />
unit for inclination (caused by slopes) and a<br />
compensation unit for tram lines depth was developed<br />
and tested in the vegetation seasons 2002<br />
and <strong>2003</strong>. The test of pendulum-meter for measuring<br />
relative plant mass density on arable areas<br />
was successfully continued in the crops winter<br />
barley, winter rye, triticale, winter wheat and grass<br />
on more than 2,000 ha. While surveying plant<br />
mass distribution, in addition the tram line depth<br />
was measured and monitored for about 340 km on<br />
36 cereal crop fields. Based on the positive results<br />
in tests under practical conditions, the sensor was<br />
taken into commercial manufacturing and will be<br />
market available in 2004.<br />
Die Vegetationssaison 2002 und <strong>2003</strong> wurde intensiv<br />
genutzt, um gesicherte Erkenntnisse zur<br />
Funktion und Einsetzbarkeit <strong>des</strong> weiterentwickelten<br />
Pendelsensors für die ortskorrelierte Bestimmung<br />
der Pflanzenmasse unter Praxisbedingungen<br />
zu gewinnen. Zusätzlich konnte mit dem Pendelsensor<br />
die Tiefe der Regelspuren über eine<br />
Fahrstrecke von ca.340 km auf 36 Schlägen gemessen<br />
und aufgezeichnet werden.<br />
In zahlreichen Einsätzen in verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben<br />
der Neuen Bun<strong>des</strong>ländern<br />
wurde in den Halmkulturen Wintergerste Winterroggen,<br />
Triticale, Winterweizen und Wiesengras<br />
auf insgesamt ca. 2.000 ha die relativen Pflanzenmasse<br />
kartiert. Mit der Kartierung der relativen<br />
Pflanzenmassedichte großer und standörtlich unterschiedlicher<br />
Flächen sollte eine repräsentative<br />
Bewertung der Heterogenität von landwirtschaftlich<br />
genutzten Flächen in unterschiedlichen Regionen<br />
ermöglicht werden. Auf der Grundlage der gemessenen<br />
Messwerte konnten mit entsprechender<br />
GIS-Software Karten der Verteilung der relativen<br />
Pflanzenmassedichte generiert werden. Ein Beispielschlag<br />
ist im Bild x dargestellt. Er weist eine<br />
Heterogenität auf, die nicht extrem hoch ist, sondern<br />
als typisch für viele ostdeutsche Regionen<br />
betrachtet werden kann. Es sind hier deutlich die<br />
zonenhaft ausgebildeten Teilflächen gleicher<br />
Pflanzenmassedichte zu erkennen.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Pflanzenbau<br />
Um die zahlreichen auf ca. 2.000 ha gewonnenen<br />
Messergebnisse zur Verteilung der relativen Pflanzenmassedichte<br />
in eine vergleichbare Form zu<br />
bringen, können statistische Parameter wie Standardabweichung<br />
und Variationskoeffizient errechnet<br />
werden. Nähere statistische Auswertungen der<br />
relativen Pflanzenmassedichteverteilung belegen,<br />
dass in vielen Fällen keine Normalverteilung vorliegt<br />
und demzufolge die errechneten Parameter<br />
nicht in der klassischen Form interpretiert werden<br />
können. Um dennoch eine Vergleichbarkeit zur<br />
Bewertung der Variabilität der Pflanzenmassedichte<br />
auf unterschiedlichen Schlägen zu ermöglichen,<br />
empfiehlt sich die Verwendung von Relativwerten<br />
mit festen Klasseneinteilungen.<br />
Unter den Bedingungen der Jahre 2001/2002/<strong>2003</strong><br />
traten auf den Getrei<strong>des</strong>chlägen hinsichtlich <strong>des</strong><br />
grundsätzlichen Typs ähnliche Verteilungen in der<br />
Tiefe der Regelspuren auf. Bei den vorgenommenen<br />
Grundeinstellungen am Sensor betrug im Jahr<br />
2000 die gemessene mittlere Spurtiefe 2,8 cm. Bei<br />
allen Messfahren war die Spurtiefenklasse von 0<br />
bis 5 cm am stärksten vertreten (Mittelwert 82,4 %,<br />
minimal 49,8 %). Im Jahr <strong>2003</strong> ergab sich über<br />
eine Fahrstrecke von ca. 200 km ein ähnliches<br />
Bild. Bis auf eine Ausnahme (Durchschnitt 4,8 cm)<br />
bewegten sich die Regelspurtiefen mit einem Anteil<br />
von über 95% in der Klasse von 0 – 5 cm. Der<br />
Mittelwert insgesamt betrug <strong>2003</strong> nur 1,36 cm.<br />
Mit dem Abschluss der Vegetationssaison <strong>2003</strong><br />
hatte der Pendelsensor einen technischen Entwicklungs-<br />
und Erprobungsstand erreicht, der die<br />
unmittelbare Überführung in die Industrieproduktion<br />
ermöglichte. Von den Firmen Müller Elektronik<br />
und Agrocom auf der AGRITECHNICA <strong>2003</strong> als<br />
CROP-Meter vorgestellt, wurde der Sensor mit<br />
einer Silbermedaille ausgezeichnet. Landwirte<br />
können das CROP-Meter mit Beginn <strong>des</strong> Jahres<br />
2004 von den genannten Firmen beziehen.
Sensorgestützte Applikation von Stickstoffdünger,<br />
Wachstumsreglern und Fungiziden<br />
(Projekt-Nr.: 110-121)<br />
Sensor-based application of nitrogen fertiliser,<br />
growth regulators and fungici<strong>des</strong><br />
Detlef Ehlert (Abt. 4), Ulrich Völker (4)<br />
Müller- Elektronik Salzkotten; Amazonen Werke<br />
Hasbergen-Gerste<br />
Förderung: BMBF/PtJ; Haushalt<br />
Fertilisation and plant protection are very important<br />
tasks in precision agriculture. To indicate the pendulum-meter<br />
based effects of site specific application<br />
of nitrogen fertiliser, growth regulators and<br />
fungici<strong>des</strong>, farm scale stripe trials were arranged<br />
under practical conditions.<br />
For site-specific nitrogen fertilisation a tractormounted<br />
spreader was used. The application of<br />
growth regulator and fungici<strong>des</strong> was performed by<br />
a trailed field sprayer. To achieve the electronic<br />
combination of pendulum meter and the technique<br />
for variable rate technology the board computer<br />
was modified.<br />
The application rate was adapted to plant growth.<br />
In plot parts with low plant mass density the application<br />
rate was reduced while it was increased in<br />
parts with high plant mass density.<br />
Based on the investigations it can be concluded<br />
that the sensor supported application of agrochemicals<br />
increases the profit for the farmer, saves<br />
natural resources and reduces pollution.<br />
Das Ziel der sensorgestützten bedarfsgerechten<br />
Bestan<strong>des</strong>führung ist die Verbesserung der Qualität<br />
und die Steigerung der Ernteerträge <strong>des</strong> Getrei<strong>des</strong><br />
bei gleichzeitiger Reduzierung <strong>des</strong> Einsatzes<br />
an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Der am<br />
<strong>ATB</strong> entwickelte Pendelsensor in Kombination mit<br />
einem Zentrifugaldüngerstreuer (Bild 2.4) bzw.<br />
einer Pflanzenschutzspritze, modifizierten LBS<br />
Bordcomputern und Jobrechnern stellt eine neue<br />
technisch-technologische Lösung zur Erfassung<br />
der lokalen Pflanzenmassedichte und einer darauf<br />
abgestimmten Bestan<strong>des</strong>führung im Echtzeitverfahren<br />
dar.<br />
Dank der Forschungsförderung durch das BMBF<br />
war es möglich, in mehreren Jahren auf unterschiedlichen<br />
Standorten Großfeldversuche bzw.<br />
Praxisexperimente zur Verfahrensbewertung unter<br />
realen praktischen Bedingungen durchzuführen.<br />
Durch den Einsatz <strong>des</strong> Pendelsensors zur zweiten<br />
und dritten Stickstoffgabe auf insgesamt 8 Schlägen<br />
mit einer Fläche von 425 ha konnten auf den<br />
teilflächenspezifisch gedüngten Streifen gegen-<br />
II Fachlicher Teil 19<br />
über den einheitlich gedüngten im Mittel 13 kg/ha<br />
Stickstoff eingespart werden. Diese Einsparung<br />
von fast 10 % resultiert aus der Verteilung der<br />
teilflächenspezifisch ausgebrachten Düngermengen.<br />
Obwohl teilweise in wüchsigen Bereichen die<br />
Maximalmenge geringfügig über der einheitlichen<br />
Applikationsmenge lag, konnte in den schwachen<br />
Beständen erheblich an Dünger eingespart werden.<br />
Hinsichtlich <strong>des</strong> Kornertrags wirkte sich die<br />
reduzierte Düngermenge positiv aus. Diese Aussage<br />
kann mit den ermittelten Erntemengen, die<br />
nach dem Auswiegen der geernteten Körner auf<br />
den jeweiligen Streifen teilflächenspezifisch um 1,8<br />
dt (pro Hektar) höher war, belegt werden.<br />
Bild 2.4: Pendelsensor in Kombination mit einem Zentrifugaldüngerstreuer<br />
Fig. 2.4: Pendulum-meter in combination with a spreader<br />
Durch die Anwendung <strong>des</strong> Pendelsensors im Bereich<br />
<strong>des</strong> teilflächenspezifischen Pflanzenschutzes<br />
konnten erhebliche Mitteleinsparungen im Bereich<br />
von 20.4 bis 48 % erreicht werden. Um zu untersuchen,<br />
ob durch Mitteleinsparungen negative<br />
Einflüsse auf die Höhe <strong>des</strong> Ertrages entstanden<br />
sind, wurden Ertragswerte aus Mähdreschern mit<br />
Ertragskartierungseinrichtung herangezogen. In<br />
dem Vergleich wurden Ertragswerte auf den einheitlich<br />
behandelten Vergleichsflächen mit den in<br />
unmittelbarer Nähe gemessenen Ertragsdaten in<br />
einem GIS-Programm statistisch verglichen. Zusammenfassend<br />
kann aus den durchgeführten<br />
Untersuchungen geschlussfolgert werden, dass<br />
keine Tendenz zu Mindererträgen durch die reduzierten<br />
Applikationsmengen erkennbar war. /240/<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
20<br />
Messsystem zur Bewertung <strong>des</strong> Unkrautvorkommens<br />
(Projekt-Nr.: 110/122)<br />
Measuring system for weed evaluation<br />
Helmut Böttger (Abt. 4), Hans-Reiner Langner (4)<br />
FH Osnabrück; Symacon Magdeburg<br />
Förderung: BMBF/PtJ; Haushalt<br />
The <strong>ATB</strong> Potsdam tested the sensor based herbicide<br />
application in practice on 200 ha over 3 years<br />
and achieved average herbicide savings of<br />
24.4 %. Suitable sensors for measuring site related<br />
data about weeds are image-processing systems<br />
with special cameras or photo-optical weed sensors.<br />
In the context of the project the <strong>ATB</strong> Potsdam<br />
investigated camera solutions, the Company Symacon<br />
Magdeburg derived camera software und<br />
the University of Applied Science Osnabrück investigated<br />
photo-optical solutions for weed detection.<br />
The investigations showed, that cameras with<br />
special filters are necessary to achieve weed pictures<br />
with high contrast. The weed pictures can be<br />
transformed to binary images in real time by software.<br />
The partner Symacon developed a PCbased<br />
image processing software which meets all<br />
requirements for weed detection. Some of the parameters<br />
are the number of weeds per size class<br />
and the soil-covering rate. The remaining problems<br />
are the costs of a modern image processing system<br />
and the lack of rugged and robust weed cameras<br />
for the use in agriculture.<br />
Untersuchungen <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> auf ca. 200 ha Fläche<br />
haben gezeigt, dass mit teilflächenspezifischer<br />
Herbizidapplikation durchschnittlich 24,4 % der<br />
betriebsüblichen Spritzmittel eingespart werden<br />
können. Damit sind Kostenreduzierungen zwischen<br />
8 und 15 Euro pro Hektar möglich. Die Reduzierung<br />
der Herbizidmenge führt zu einer entsprechenden<br />
Entlastung von Boden, Grundwasser<br />
und Oberflächengewässern.<br />
Mit dem entwickelten Verfahren wird die Verunkrautung<br />
zwischen den Reihen bzw. in den Regelspuren<br />
während der Fahrt in Echtzeit sensortechnisch<br />
erfasst, der Messwert nach dem Schadschwellenprinzip<br />
bewertet und in eine Spritzanweisung<br />
umgesetzt. Die Hauptaufgaben <strong>des</strong> technisch<br />
aufwendigen Projekts bestanden in der Entwicklung<br />
geeigneter optischer Sensorsysteme für<br />
die Unkrautdetektion. Im Rahmen <strong>des</strong> Projektes<br />
wurden gemeinsam vom <strong>ATB</strong> Potsdam, der Fachhochschule<br />
Osnabrück und der Firma Symacon<br />
Bildverarbeitung Magdeburg Kameralösungen und<br />
fotooptische Lösungsvarianten für die Unkrauterkennung<br />
untersucht. Zwei Varianten erreichten die<br />
zu erfüllenden Zielstellungen. Ein System beruht<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Pflanzenbau<br />
auf der Anwendung einer speziell modifizierten<br />
Multispektralkamera, das andere System auf der<br />
Anwendung einer ImSpektor-Optik mit CCD-<br />
Kamera.<br />
Das Kamerasystem mit ImSpektor-Optik wurde an<br />
der FH Osnabrück auf einem Laborprüfstand bezüglich<br />
Detektionsvermögen und Erkennungssicherheit<br />
untersucht. Hier zeigte sich, dass kleine<br />
Pflanzen mit den Abmessungen 2x2 mm bei simulierten<br />
Fahrgeschwindigkeiten bis 15 km/h sicher<br />
erkannt werden und dass eine Anpassung der<br />
Optik an unterschiedliche Beleuchtungsverhältnisse<br />
möglich ist. Am <strong>ATB</strong> wurde die speziell für<br />
Unkrautdetektionen modifizierte Multispektralkamera<br />
in Versuchsfahrten unter Feldbedingungen<br />
getestet, bei denen Anzahl und Größenklasse der<br />
Unkräuter zu erfassen waren (10 Klassen). Während<br />
der Messfahrten werden die Unkrautbilder in<br />
Echtzeit erfasst und per Software ausgewertet.<br />
Bild 2.5 zeigt beispielhaft ein Echtzeitbild mit Unkräutern<br />
im Keimblattstadium innerhalb eines<br />
Rapsschlages.<br />
Bild 2.5: Anwendung <strong>des</strong> Messsystems zur Bewertung<br />
<strong>des</strong> Unkrautvorkommens in einem Rapsschlag<br />
Fig. 2.5: Test of the measuring system for weed occurrence<br />
in a rape field<br />
Die Messfahrten mit Geschwindigkeiten von 3 bis<br />
15 km/h ergaben eine sehr geringe Streuung der<br />
Unkrautwerte. Die gemessenen Unterschiede waren<br />
auf die unvermeidlichen Abweichungen in den<br />
Fahrspuren zurückzuführen.<br />
Das gesamte Verfahren zur angepassten Herbizidapplikation<br />
ist erprobt und bietet eine Entlastung<br />
der Umwelt von Herbiziden. Einige technische<br />
Voraussetzungen für die Anwendung <strong>des</strong> Verfahrens<br />
müssen noch verbessert bzw. geschaffen<br />
werden (Spritze mit großem Regelbereich, robuste<br />
und kompakte Kamera-Hardware). /114/, /240/
Untersuchungen zur Detektionsmöglichkeit<br />
von Krankheitsbefall in Getreide mittels Thermographie<br />
(Projekt-Nr.: 4.26)<br />
Investigations to detect diseases in cereals by<br />
thermography<br />
Karl-Heinz Dammer (Abt. 4), Horst Beuche (2),<br />
Hans-Jürgen Hellebrand (2)<br />
Biologische Bun<strong>des</strong>anstalt für Land- und Forstwirtschaft,<br />
Außenstelle Kleinmachnow; Dienstleistungsgesellschaft<br />
für eine nachhaltige teilflächenspezifische<br />
Landbewirtschaftung, Hannover<br />
Förderung: Haushalt<br />
Fungicide spraying against plant diseases is only<br />
worthwhile in the parts of the field which are infected.<br />
Spraying when required would lead to fungicide<br />
savings and has economic and ecological<br />
effects. One method to detect fungal infections on<br />
plants, <strong>des</strong>cribed in the literature, is thermography.<br />
This method was tested under laboratory and field<br />
conditions. With powdery mildew (Blumeria [syn.<br />
Erysiphe graminis] DC. F. sp. tritici March.) artificial<br />
infected wheat plants (variety ‘Kanzler’)<br />
showed a lower temperature in comparison to<br />
healthy plants. The differences rise with heavier<br />
infection (2002: up to 0.7 °K, <strong>2003</strong>: up to 0.5 °K).<br />
In the field trials there was no clear tendency.<br />
Neighbouring healthy and diseased plots showed<br />
temperature differences even within itself, depending<br />
for instance on the view angle.<br />
Die Oberflächentemperatur von Pflanzengewebe<br />
wird vom Transpirationsverhalten der Pflanze beeinflusst.<br />
Krankheits- bzw. Schädlingsbefall,<br />
Stand-ortfaktoren (Wasser- und Nährstoffversorgung)<br />
oder das Wettergeschehen können die<br />
Transpiration beeinflussen und damit die Oberflächentemperatur<br />
<strong>des</strong> Pflanzengewebes verändern.<br />
Diese Temperaturänderung bildet die Grundlage,<br />
für den in der Literatur beschriebenen Ansatz,<br />
mittels Thermographie die Änderung der Oberflächentemperatur<br />
und damit beginnende Stresszustände<br />
sensorisch zu erfassen.<br />
Es sollte in Labor- und Feldversuchen untersucht<br />
werden, ob eine Unterscheidung zwischen kranken<br />
und gesunden Pflanzen unter Einsatz der<br />
Thermographie möglich ist. Weizenpflanzen (Sorte:<br />
“Kanzler”) wurden mit Mehltau (Blumeria [syn.<br />
Erysiphe graminis] DC. F. sp. tritici March.) im<br />
Gewächshaus künstlich infiziert. Die Freilandversuche<br />
erfolgten in einem Winterweizenschlag bei<br />
natürlicher Krankheitsinfektion.<br />
Die Erfassung der Oberflächentemperatur der<br />
Pflanzen erfolgte im Spektralbereich von 8 –12 µm<br />
mit einer hoch auflösenden MCT-Scannerkamera<br />
II Fachlicher Teil 21<br />
(∆T = 0,03 K ) im Labor und mit einer Bolometer-<br />
Matrixkamera (∆T = 0,1 K, Auflösung: 320 × 240<br />
Pixel ) auf dem Feld.<br />
Die gemessene Temperatur der kranken Pflanzen<br />
war unter Laborbedingungen geringer als die der<br />
gesunden. Mit stärker werdendem Mehltaubefall<br />
nahmen im ersten Jahr die Temperaturdifferenzen<br />
von 0,2 bis 0,7 °K zu. Im zweiten Versuchsjahr<br />
konnte diese Aussage mit Temperaturdifferenzen<br />
bis 0,5 °K bestätigt werden.<br />
Besonders unter Feldbedingungen beeinflussen<br />
zusätzliche Faktoren wie Pflanzendichte, Bodeneigenschaften,<br />
klimatische Einflüsse, Tageszeit usw.<br />
die Messergebnisse. In den zweijährigen Freilandversuchen<br />
konnte kein einheitlicher Trend in den<br />
Temperaturdifferenzen zwischen gesunden, mit<br />
einem Fungizid behandelten und kranken, unbehandelten<br />
Parzellen festgestellt werden. Gesunde<br />
und kranke Parzellen wiesen bereits in sich Temperaturdifferenzen<br />
auf. Diese sind zum Beispiel<br />
abhängig vom Verhältnis Aufnahmewinkel zum<br />
Einstrahlungswinkel der Sonne (Bild 2.6).<br />
Bild 2.6: Temperaturanstieg entlang der Linie LI 01 im<br />
Thermalbild (Aufnahmewinkel in Richtung der Sonneneinstrahlung);<br />
unterer Teil RGB-Bild<br />
Fig. 2.6: Increasing temperature along the line LI 01 in<br />
the thermal image (view angle in direction to the inclination<br />
of the sun); lower picture RGB<br />
Die Komplexität der störenden Umwelteinflüsse<br />
und die ständig wechselnden Bedingungen <strong>des</strong><br />
Freilan<strong>des</strong> lassen die Thermographie unter den<br />
jetzigen technischen Vorraussetzungen als keine<br />
praxistaugliche Methode für den Landwirt erscheinen,<br />
um sicher Krankheitsbefall im Anfangsstadium<br />
an der Kulturpflanze zu erkennen. /137/, /360/<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
22<br />
Untersuchungen zur Nachweisbarkeit von Pilzinfektionen<br />
an Pflanzen mit Hilfe der Fluoreszenzspektroskopie<br />
(Projekt-Nr. 4.27)<br />
Investigations in detecting fungi infections with<br />
laser induced fluorescence spectroscopy<br />
Hans-Reiner Langner (Abt. 4), Werner Herppich (6)<br />
FH Brandenburg; Fa. Planto<br />
Förderung: Haushalt<br />
Laser Induced Fluorescence (LIF) is a well-known<br />
quality determination method for cereals. With LIF<br />
it is possible to check the chlorophyll content in<br />
canopies and to calculate the demand for fertiliser.<br />
Furthermore, it is known that fungi infection on<br />
canopies led to increased fluorescence indices<br />
F685/F730 and F440/F730. The company Planto<br />
started the development of a LIF based field sensor<br />
in 2000. The Laser-N sensor was <strong>des</strong>igned as<br />
a rugged device that scans a 2m region on plants<br />
and calculates the chlorophyll content in real-time.<br />
Unfortunately the company went bankrupt in spring<br />
<strong>2003</strong>. So there was no commercialized system<br />
adapted to the fungi infection problem available for<br />
field tests in <strong>2003</strong>.<br />
Pilzinfektionen richten in der Landwirtschaft großen<br />
Schaden an. Die landwirtschaftlichen Produkte<br />
werden ungenießbar bzw. können nicht als Futtermittel<br />
verwendet werden. Es existieren keine<br />
Messgeräte für Schnelluntersuchungen mit denen<br />
ein Nachweis <strong>des</strong> Pilzbefalls frühzeitig möglich<br />
wäre. Eine Schnelluntersuchung, z. B. für Fusarium<br />
graminearum, sollte sich durch minimale Probenvorbereitung,<br />
kürzeste Messzeiten, Automatisierbarkeit<br />
und Robustheit auszeichnen.<br />
Die Laser Induzierte Fluoreszenz (LIF) ist in Getreidebeständen<br />
für die Bestimmung <strong>des</strong> Chlorophyllgehalts<br />
der Pflanzen zur Abschätzung <strong>des</strong><br />
Düngerbedarfs gut geeignet. Weiterhin ist bekannt,<br />
dass Pilzinfektionen die photosynthetische Leistungsfähigkeit<br />
negativ beeinflussen. Dies lässt sich<br />
beispielsweise mit einer LIF anhand der Erhöhung<br />
der charakteristischen Fluoreszenzindizes<br />
F685/F730 und F440/F730 erkennen.<br />
Ein anderer Ansatz für den Nachweis von Pilzbefall<br />
an Pflanzen ist das Verfahren der Chlorophyllfluoreszenzanalyse.<br />
Wie vergleichende Untersuchungen<br />
in Beständen mit Pilzmischbefall und in<br />
gesunden bzw. mit Fungiziden behandelten Flächen<br />
zeigten, lässt sich die Beeinflussung der<br />
physiologischen Aktivität befallener Pflanzen mit<br />
dieser Methodik relativ eindeutig nachweisen (Bild<br />
2.7). Unbehandelte Pflanzen wiesen speziell bei<br />
höherer Lichtintensität deutlich verringerte photo-<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Pflanzenbau<br />
synthetische Elektronentransportraten auf. Die<br />
Feldversuche mit dem Verfahren der Chlorophyllfluoreszenzanalyse<br />
werden in 2004 fortgeführt.<br />
In Abhängigkeit von den Investitionsmöglichkeiten<br />
ist für 2004 weiterhin geplant, einen Messaufbau<br />
zum Test der zeitaufgelösten Spektroskopie zu<br />
realisieren. Der Vorteil dieser Methode besteht<br />
darin, dass die Fluoreszenzsignale nur relativ zu<br />
erfassen sind und daher keine Kalibrierung der<br />
Amplituden erforderlich ist. Die Realisierung dieser<br />
Versuche soll in enger Abstimmung mit dem beteiligten<br />
Projektpartner, der FH Brandenburg, erfolgen.<br />
Mit Hilfe eines Messaufbaus für zeitaufgelöste<br />
Fluoreszenzuntersuchungen soll in Feldversuchen<br />
die prinzipielle Eignung <strong>des</strong> Verfahrens für den<br />
Nachweis von Pilzinfektionen in Getreidebeständen<br />
erbracht werden. Bei positiven Zwischenergebnissen<br />
in der Saison 2004 wird die Methodik<br />
der zeitaufgelösten Fluoreszenzspektroskopie zu<br />
einem feldtauglichen Messaufbau zum Nachweis<br />
von Pilzinfektionen in Getreidebeständen der<br />
Landwirtschaft weiter entwickelt.<br />
Photosynthetischer Elektronentransport (µmol m-2 s-1 )<br />
Photosynthetic electron transport (µmol m-2 s-1 )<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
behandelt<br />
treated<br />
0<br />
0 500 1000 1500 2000 2500<br />
Photonenflussrate (µmol m -2 s -1 )<br />
Photon fluence rate (µmol m -2 s -1 )<br />
unbehandelt<br />
untreated<br />
Bild 2.7: Photosynthetische Elektronenflussraten von<br />
unbehandelten Weizenpflanzen mit Pilzmischinfektion<br />
und solchen die mit Fungiziden behandelt wurden.<br />
Fig. 2.7: Photosynthetic electron transport rates of fungi<br />
infected and fungicide treated wheat plants as measured<br />
in the field.
Untersuchungen zur Dynamik <strong>des</strong> Bestan<strong>des</strong>klimas<br />
und Infektionsgeschehens mit Pilzkrankheiten<br />
in heterogenen Getrei<strong>des</strong>chlägen<br />
(Projekt-Nr.: 4.29)<br />
Investigations into the dynamic of climatic parameters<br />
and infections with fungal diseases in<br />
heterogeneous cereal stands<br />
Karl-Heinz Dammer (Abt. 4)<br />
ProPlant GmbH; Dienstleistungsgesellschaft für<br />
eine nachhaltige teilflächenspezifische Landbewirtschaftung<br />
mbH<br />
Förderung: Haushalt<br />
The development of fungal diseases depends<br />
mainly on weather conditions. Forecast models or<br />
expert systems calculate infection possibilities for a<br />
certain area. Practicing the spraying only where<br />
disease infection occurs, local infection probabilities<br />
within the field have to be taken into account.<br />
To investigate, if this is worthwhile, it has to be<br />
shown what is the intensity of the micro climatic<br />
differences within a field. That is why rapid online<br />
temperature measurements were conducted within<br />
winter wheat. A temperature measurement cell<br />
was guided in 20 cm height within the canopy and<br />
another one in 160 cm height above the canopy. At<br />
ear emergence on 4 th of June <strong>2003</strong>, for instance,<br />
there were differences of up to 7,5 °C. Directional<br />
variograms show a spatial dependency of this<br />
differences up to 30 m. In the kriged map the spatial<br />
variability can be clearly seen. Further investigations<br />
have to be carried out in order to prove if<br />
these differences will lead to different infection<br />
probabilities of diseases within a field.<br />
Als wichtigster Einflussfaktor auf die Entwicklung<br />
von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen in<br />
Raum und Zeit gilt das Wetter. Klimagrößen sind<br />
Eingangsparameter für Prognosemodelle und Ex-<br />
Temperaturdifferenz [°C]<br />
temperaturdifference [°C]<br />
II Fachlicher Teil 23<br />
pertensysteme, um die aktuelle Befallssituation für<br />
ein definiertes Gebiet zu simulieren. Die errechneten<br />
Infektionswahrscheinlichkeiten für die jeweiligen<br />
Erreger signalisieren dem Landwirt, dass er<br />
die gefährdeten Bestände kontrollieren muss, um<br />
bei Erreichen bestimmter Schadenschwellen gezielt<br />
Pflanzenschutzmaßnahmen einleiten zu können.<br />
Mit den Daten der von einigen Landwirtschaftsbetrieben<br />
bereits eingesetzten automatischen<br />
Wetterstationen kann nur ein Wert der Infektionswahrscheinlichkeit<br />
für den Schlag als Ganzes<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
Sollen bei einer bedarfsorientierten Fungizidapplikation<br />
nur Bereiche im Schlag gespritzt werden,<br />
wo Infektionen mit Pilzkrankheiten erfolgt sind, ist<br />
zunächst zu prüfen, ob innerhalb eines Schlages<br />
Unterschiede im Bestan<strong>des</strong>klima auftreten.<br />
Zwei Temperaturmesszellen wurden einmal in<br />
20 cm Höhe (im Bestand) und in etwa 160 cm<br />
Höhe (über dem Bestand) traktorgestützt im Abstand<br />
von 18 m (Fahrspurabstand) durch ein Winterweizenfeld<br />
(keine Höhenunterschiede, keine<br />
Saumbiotope) geführt. Die Differenz aus beiden<br />
Messwerten wurde zusammen mit der DGPS-<br />
Position mit einem Messwerterfassungssystem<br />
hochfrequent aufgezeichnet (Bild 2.8). Zur Messung<br />
am 04.06.<strong>2003</strong> zum Ährenschieben traten<br />
dabei Differenzen bis 7,5 °C auf. Die Variogrammanalyse<br />
in Fahrtrichtung ergab, dass die Werte<br />
bis zu einer Distanz von etwa 30 Metern ähnlich<br />
sind. Die mittels Punktkriging interpolierte Karte<br />
zeigt beispielhaft die kleinräumige Struktur der<br />
Temperaturdifferenzen. Inwieweit sich daraus Unterschiede<br />
hinsichtlich der Befallsgefährdung mit<br />
Pilzkrankheiten innerhalb eines Schlages ergeben,<br />
ist in weiterführenden Untersuchungen zu klären.<br />
1,4 bis 2,5 bis 3,7 bis 4,8 N<br />
Bild 2.8: Kriging-Karte der lokalen Differenzen der Bestan<strong>des</strong>temperatur<br />
Fig. 2.8: Kriging-map of the local temperature differences of the plant stand<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
24<br />
Untersuchungen zur Optimierung <strong>des</strong> Einsatzes<br />
von Sensoren für die Erfassung von Boden-<br />
und Pflanzenparametern auf landwirtschaftlichen<br />
Nutzflächen (Projekt-Nr.: 4.30)<br />
Investigations for optimising the use of sensors<br />
for the acquisition of soil and plant parameters<br />
on agricultural areas<br />
Jürgen Schwarz (Abt. 4), Detlef Ehlert (4)<br />
HU Berlin; TU Berlin<br />
Förderung: Haushalt<br />
Soil and plant parameters are heterogeneous on<br />
agricultural areas. Therefore Precision Agriculture<br />
is a promising way to react to these heterogeneous<br />
conditions. But Precision Agriculture is only feasible<br />
for practical use if adequate sensors for the<br />
detection of heterogeneity are available. The sensors<br />
cover only a limited area of the arable fields.<br />
The aim of this project is to quantify the errors<br />
resulting from the limited detection area in relation<br />
to the area of application. Also, fundamentals with<br />
respect to number and distance of sensors will be<br />
another aim of this project.<br />
Boden- und Pflanzenparameter weisen auf landwirtschaftlichen<br />
Nutzflächen räumlich heterogene<br />
Strukturen auf. Das Reagieren auf diese Unterschiede<br />
kann durch die Technik <strong>des</strong> teilflächen-<br />
d<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
s<br />
l<br />
Teilflächenspezifische Bewirtschaftung im Pflanzenbau<br />
d<br />
Bild 2.9: Beispielhafte Darstellung einer Messwerterfassung<br />
Fig. 2.9: Exemplary demonstration of measurement surveys<br />
spezifischen Pflanzenbaus erfolgen. Unter praktischen<br />
Bedingungen ist dies nur realisierbar, wenn<br />
geeignete Sensoren zur Erfassung der relevanten<br />
Parameter zur Verfügung stehen. Diese Sensoren<br />
auf Landmaschinen können aus Kosten- und<br />
Funktionsgründen nur einen Teilbereich der Arbeitsbreite<br />
erfassen.<br />
Ein Ziel dieses Projektes ist die Bezifferung der<br />
Fehler, die durch das punktuelle bzw. streifenförmige<br />
Erfassen von nur Teilen eines Schlages entstehen.<br />
Ein weiteres Ziel besteht im Erstellen von<br />
Grundlagen für die Anordnung von Sensoren nach<br />
Anzahl und Abstand (Bild 2.9). Damit soll ein bestmögliches<br />
Verhältnis zwischen Sensorkosten und<br />
tolerierbarem Sensorfehler erreicht werden.<br />
Neben einer umfassenden Literaturauswertung,<br />
wurden die in der Abteilung vorhandenen Versuchsdaten<br />
auf die Eignung zur Problemlösung<br />
geprüft. Im Folgenden werden diese Daten mittels<br />
geostatistischen Methoden verrechnet und Simulationsbetrachtungen<br />
durchgeführt. Diese Simulationsrechnungen<br />
haben das Ziel die Auswirkung der<br />
sensortechnisch erfassten Flächen in Abhängigkeit<br />
von ihrer Form, Größe und Anzahl im Verhältnis<br />
zur Gesamtfläche (Arbeitsbreite) darzustellen.<br />
s - Sensorbreite / width of sensor<br />
d - Distanz der Messpunkte innerhalb<br />
der Reihe / distance of sample points<br />
within the row<br />
l - Arbeitsbreite der eingesetzten Ma-<br />
schine / working width of the used ma-<br />
chine
3 Qualitätssicherung bei der Lagerung, Konservierung<br />
und Verabreichung von Futtermitteln<br />
für Nutztiere (Forschungsschwerpunkt<br />
3)<br />
Quality assurance in storage, preservation<br />
and supply of feed for farm animals<br />
(Koordinator: Christian Fürll, Abt. 3)<br />
Hochwertige Lebensmittel erfordern qualitativ<br />
hochwertiges Futter, das frei von Kontaminationen<br />
ist. Außerdem ist dies auch die Grundvoraussetzung<br />
für eine optimale Tiergesundheit und für hohe<br />
tierische Leistungen. Für den Landwirt sind ferner<br />
niedrige Produktionskosten und ein geringer Ressourceneinsatz<br />
entscheidend.<br />
Im Jahr <strong>2003</strong> wurden innerhalb dieses Forschungsschwerpunktes<br />
Untersuchungen zur Grünfutterernte,<br />
zur Verbesserung der Silagequalität,<br />
zur Verfahrenstechnik der Getreidekonservierung,<br />
zum Förderverhalten von Drehkolbenpumpen und<br />
zum Fließverhalten von Futtermischungen durchgeführt.<br />
Für das Mähen von Gräsern und anderen Halmgütern<br />
wurde das Prinzip einer Bandmähmaschine<br />
forschungsmäßig weiterentwickelt. Der Schwerpunkt<br />
lag <strong>2003</strong> auf der konstruktiven Beseitigung<br />
noch vorhandener Störquellen und im Vermeiden<br />
von Nachzerkleinerungseffekten. Mit den erzielten<br />
Ergebnissen wird eine Bewertung möglich, die<br />
Aufschluss über die Arbeitsqualität, die Funktionssicherheit<br />
und die Verfahrenskosten gibt.<br />
Um die Stabilität von Grünfuttersilagen zu verbessern,<br />
soll dem Siliermittel „Bornim liquid“ ein heterofermentativer<br />
Milchsäurebakterienstamm zugesetzt<br />
werden. Erste Ergebnisse in Modelllösungen<br />
ergaben höhere Essigsäuregehalte, so dass die<br />
aerobe Stabilität verbessert werden könnte. Die<br />
Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen<br />
und werden mit Modellsilierversuchen weitergeführt.<br />
Da die Erzeugung von eiweißreichen, wirtschaftseigenen<br />
Grundfuttermitteln ein steigen<strong>des</strong> Interesse<br />
erlangt, wurden Untersuchungen zu deren Konservierung<br />
durchgeführt. Erste Ergebnisse mit<br />
verschiedenen Siliermitteln, u.a. mit dem im <strong>ATB</strong><br />
entwickelten „Bornim liquid“, für die Konservierung<br />
von Luzernepresssaft zeigen, dass biologische<br />
Siliermittel, die für die Grassilierung konzipiert<br />
sind, nicht auch in eiweißreichen Substraten angewendet<br />
werden können.<br />
Innerhalb der Verfahrenstechnik für die Herstellung<br />
qualitativ hochwertiger Silagen hat die Siliergutdichte<br />
beim Einlagern einen überragenden<br />
Einfluss. Derzeit gibt es für die Online Bestimmung<br />
allerdings noch keine anwendbare, kontinuierlich<br />
II Fachlicher Teil 25<br />
arbeitende Messtechnik. In ersten Untersuchungen<br />
wurden mögliche physikalische Methoden<br />
analysiert. Ein erfolgversprechen<strong>des</strong> Prinzip ist die<br />
Anwendung der Mikrowellenstreusonde. Ergebnisse<br />
aus Tastversuchen zeigen, dass das Messsignal<br />
neben der Dichte auch durch den Trockensubstanzgehalt<br />
beeinflusst wird. Deshalb müssen<br />
künftig beide Größen entkoppelt werden.<br />
Die Trocknung von Getreide in Dächerschachttrocknern<br />
ist derzeit mit Über- oder Untertrocknung<br />
verbunden. Ein Grund dafür ist, dass die bisher<br />
bekannten Modelle und Regelungskonzepte nicht<br />
ausreichend optimiert sind. Im Rahmen eines<br />
BMBF-Projektes werden derzeit Modellierungen<br />
zum Wärme- und Stoffübergang am Einzelkorn<br />
durchgeführt. Diese Arbeiten sind notwendige<br />
Grundlagen für neue Konzepte zur verbesserten<br />
Trocknersteuerung.<br />
Zur Planung von Pumpen- und Rühranlagen sind<br />
exakte Berechnungen auf der Basis gemessener<br />
rheologischer Stoffeigenschaften notwendig. Dazu<br />
wurden Untersuchungen von Flüssigfuttermischungen<br />
mit Enzymzusätzen, von Schweine- und<br />
Rindergülle mit verschiedenen organischen Zusätzen,<br />
sowie von Biogas- und Klärschlämmen,<br />
durchgeführt.<br />
Die Strömungsverluste in Drehkolbenpumpen und<br />
deren Auswirkungen auf das Förderverhalten wurden<br />
in Abhängigkeit vom Pumpenverschleiß und<br />
vom Fließverhalten landwirtschaftlicher Fördermedien<br />
(Flüssigfutter) im Rahmen einer vom BMWi<br />
geförderten Drittmittelaufgabe untersucht. Pumpenverschleißformen<br />
wurden systematisiert und<br />
die Auswirkung auf Rückströmungsverluste und<br />
die Pumpenkennlinien bewertet. Es wurden Berechnungsgrundlagen<br />
für die Bestimmung realer<br />
Pumpenkennlinien zur Optimierung <strong>des</strong> Pumpenwirkungsgra<strong>des</strong><br />
und zur Verlängerung der Nutzungszeit<br />
entwickelt. Zusammen mit dem Industriepartner<br />
konnten verschiedene neue Pumpenelemente<br />
zur Verschleißkompensierung entwickelt<br />
und getestet werden.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
26<br />
Projekte zum Forschungsschwerpunkt 3<br />
Entwicklung und Bewertung <strong>des</strong> Prinzips einer<br />
Bandmähmaschine (Projekt.Nr. 4.33)<br />
Development and assessment of the principle<br />
of a band mower<br />
Detlef Ehlert (Abt. 4)<br />
Förderung: Haushalt<br />
In the vegetation period 2002, a first research prototype<br />
of a band mower for large scale areas was<br />
investigated. Based on positive results, a second<br />
band mower with V-belt transmission was developed<br />
and tested in the vegetation season <strong>2003</strong>.<br />
The main problems were disturbances at the bar<br />
for guiding the mowing band und secondary cuts.<br />
The made experiences were taken into consideration<br />
in the <strong>des</strong>ign of a third model of band mower<br />
with increased working width of 5m. This new band<br />
mower will be tested and assessed under practical<br />
conditions in the vegetation period 2004.<br />
Im Rahmen von Prinzipuntersuchungen wird geklärt,<br />
ob durch ein umlaufen<strong>des</strong> gezahntes<br />
Schneidband aus Stahl das Mähen von Halmfrüchten<br />
bei hoher Flächenleistung möglich ist. Dazu<br />
wurde in einer ersten Entwicklungsstufe im Jahr<br />
2002 ein Forschungsmuster einer Bandmähmaschine<br />
konstruiert und gefertigt, das in der Vegetationssaison<br />
ersten Funktionstests unterzogen wurde.<br />
Um gute Voraussetzungen für die Veränderung<br />
der Schnittgeschwindigkeit <strong>des</strong> Mähban<strong>des</strong><br />
sowie eine Überlastsicherung zu schaffen, kam ein<br />
Hydraulikmotor (Gerotormotor) zum Einsatz, der<br />
von der Bordhydraulik <strong>des</strong> Traktors angetrieben<br />
wurde. Erste Messungen ergaben einen spezifischen<br />
Energieverbrauch von 4-6 kWh/ha.<br />
Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den im<br />
Jahr 2002 erfolgten Funktionstests wurde ein<br />
zweites Forschungsmuster konzipiert, das in der<br />
Vegetationssaison <strong>2003</strong> zum Einsatz kam<br />
(Bild 3.1). Da bereits vorher Erkenntnisse zu erforderlichen<br />
Schnittgeschwindigkeiten gewonnen<br />
werden konnten, wurde das zweite Funktionsmuster<br />
über Frontzapfwelle mit einem Keilriementrieb<br />
angetrieben. Der Hauptteil der Forschungsarbeiten<br />
im Jahr <strong>2003</strong> war auf die konstruktive Beseitigung<br />
von noch vorhandenen Störquellen im Bereich der<br />
unteren Schneidbandführung sowie auf das Vermeiden<br />
von Nachzerkleinerungseffekten gerichtet.<br />
Die durchgeführten zahlreichen Funktionstests<br />
zeigten deutlich, dass neben der Ausführung <strong>des</strong><br />
Schneidbands als Arbeitswerkzeug das Vermeiden<br />
von Stau- und Aufbauerscheinungen - verursacht<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualitätssicherung von Futtermitteln<br />
durch Pflanzenmaterial - über die Funktionstüchtigkeit<br />
der Mähmaschine entscheidet. Obwohl die<br />
extreme Sommertrockenheit und das damit reduzierte<br />
Pflanzenwachstum die Untersuchungen<br />
erheblich erschwerte, konnte zum Ende der Saison<br />
neues Know-how angesammelt werden, das<br />
eine konsequente Fortführung der Forschungsarbeiten<br />
rechtfertigte.<br />
Auf der Grundlage <strong>des</strong> so erreichten Erkenntnisstan<strong>des</strong><br />
wurde ein drittes Forschungsmuster mit<br />
einer erhöhten Arbeitsbreite von 5 m konzipiert,<br />
das in den Wintermonaten gefertigt und in der<br />
Vegetationssaison 2004 für technologische Untersuchungen<br />
unter Praxisbedingungen eingesetzt<br />
werden soll. Damit wird die technische Grundlage<br />
für eine Bewertung geschaffen, die Aufschluss<br />
darüber gibt, welche Arbeitsqualität und Einsatzparameter<br />
mit dem Bandmähprinzips erzielbar sind<br />
und welches Potential Bandmähmaschinen hinsichtlich<br />
der Senkung der Herstellungskosten, <strong>des</strong><br />
Antriebsleistungsbedarfs und <strong>des</strong> Unfallrisikos<br />
besitzen.<br />
Bild 3.1: Zweites Forschungsmuster der Bandmähmaschine<br />
Fig 3.1: Second version of the band mower
Erhöhung der Stabilität von Grünfuttersilagen<br />
(Projekt-Nr.: 1.40)<br />
Increase the stability of forage silages<br />
Christine Idler (Abt. 1), Michael Klocke (1),<br />
Joachim Venus (1)<br />
Förderung: Haushalt<br />
In order to increase the stability of grass silages<br />
not only homofermentic lactic acid bacteria are<br />
essential but also heterofermentic bacteria. That is<br />
why heterofermentic lactic acid bacteria were isolated<br />
from silages (see Table 3.1) and investigated<br />
for their suitability as inoculants for the conservation<br />
of forage grasses. For the identification of the<br />
isolates as L. buchneri a new molecular genetic<br />
method was <strong>des</strong>cribed.<br />
Grünfuttersilagen werden trotz guter Bewertungen<br />
nach dem Anschnitt häufig instabil. Das führt zu<br />
erheblichen Futterverlusten und zur Qualitätsminderung.<br />
Einer der Gründe liegt bei Silagen, die<br />
mittels homofermentativer Starterkulturen erzeugt<br />
werden, darin, dass der Gehalt an Essigsäure zu<br />
gering ist. Das Ziel der Arbeiten bestand in einer<br />
Verbesserung <strong>des</strong> Siliermittels „Bornim liquid“,<br />
einer Kombination zweier homofermentativer<br />
Milchsäurebakterien, durch Zusatz eines heterofermentativen<br />
Milchsäurebakterienstammes zur<br />
Erhöhung <strong>des</strong> Essigsäuregehaltes und damit der<br />
Stabilität von Grünfuttersilagen. Diese Versuche<br />
werden gemeinsam mit der AG Niederschöna<br />
durchgeführt, die das verbesserte Siliermittel auch<br />
erzeugen und einsetzen werden. Zunächst sollte<br />
ein Pool aus verschiedenen Stämmen durch Isolierung<br />
aus pflanzlichen Habitaten gewonnen werden.<br />
Eine Auswahl der schnellsten und stärksten<br />
II Fachlicher Teil 27<br />
Essigsäurebildner wird anschließend in Silierversuchen<br />
auf ihre Praxiswirksamkeit geprüft werden.<br />
Aus zunächst zwei pflanzlichen Habitaten (Rotklee-<br />
und Weidelgrassilagen) wurden auf fünf verschiedenen<br />
Kohlenhydratquellen bei drei unterschiedlichen<br />
Temperaturen heterofermentative<br />
Milchsäurebakterien in einem stufenweise aufgebauten<br />
Screening isoliert. Insgesamt konnten 149<br />
gasbildende Milchsäurebakterien isoliert und in die<br />
Stammsammlung aufgenommen werden. Erwartungsgemäß<br />
sind die meisten Isolate mesophile<br />
bzw. thermophile Glucose- bzw. Saccharoseverwerter.<br />
Es konnten keine thermophilen Organismen<br />
bei 45°C und keine Stärkeverwerter isoliert<br />
werden.<br />
Da dem Stamm Lactobacillus buchneri eine besondere<br />
Wirkung bei der Verbesserung der aeroben<br />
Stabilität in Grassilagen zugesprochen wird,<br />
wurde eine Methode auf molekulargenetischer<br />
Ebene erarbeitet, mit <strong>des</strong>sen Hilfe die isolierten<br />
heterofermentativen Milchsäurebakterienstämme<br />
in sehr kurzer Zeit (4 bis 5 Stunden) als L. buchneri<br />
identifiziert werden können. Das PCR-gestützte<br />
Nachweissystem basierend auf der Methode von<br />
SONG et al. [2000] etabliert. Mit Hilfe dieses Systems<br />
ist es möglich, anonyme Isolate anhand der<br />
16S-23S-IRS-rDNA Sequenz als Lactobacillus zu<br />
identifizieren bzw. zu einer Lactobacillus-Untergruppe<br />
zuzuordnen. Eine weitere, eindeutige Artbestimmung<br />
kann anschließend über die Sequenzierung<br />
der Amplifikate erfolgen. Weiterhin wurde<br />
zu einem direkten Nachweis von L. buchneri für<br />
variable Bereiche der 16S rDNA artspezifische<br />
PCR-Primer entwickelt. Nach weiteren Isolierungen<br />
aus anderen Habitaten sollen die isolierten<br />
Stämme mit dieser Methode geprüft werden.<br />
Tabelle 3.1: Ergebnisse zur Isolierung von heterofermentativen Milchsäurebakterien aus verschiedenen Silagen<br />
Table 3.1: Results of the isolation of heterofermentic lactic acid bacteria from various silages<br />
Kohlenhydrat- Anzahl der heterofermentativen MSB bei Inkubationstemperatur ∑<br />
quelle 30°C 37°C 45°C -<br />
Weidelgras-<br />
silage<br />
Rotklee-<br />
silage<br />
Weidelgras-<br />
silage<br />
Rotklee-<br />
silage<br />
Weidelgras-/<br />
Rotkleesilage<br />
Glucose 13 15 0 15 0 43<br />
Arabinose 13 7 0 17 0 37<br />
Saccharose 9 19 3 13 0 44<br />
Xylose 12 0 13 0 0 25<br />
Stärke 0 0 0 0 0 0<br />
∑ 47 41 16 45 0 149<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
28<br />
Lagern und Konservieren eiweißreicher, wirtschaftseigener<br />
Grundfuttermittel<br />
(Projekt-Nr.: 1.30)<br />
Storage and preservation of protein-rich farm-<br />
own basic food<br />
Christine Idler (Abt. 1)<br />
Förderung: Haushalt<br />
The demand for protein-rich farm-own basic food<br />
gives way to a renaissance of the cultivation and<br />
storage of clover-grass and lucerne-grass. New<br />
preservation possibilities have to be examined for<br />
these food components in dependence on different<br />
plant parameters. First results indicate, that starter<br />
cultures, <strong>des</strong>igned for the preparation of grass<br />
silages, are not necessarily active in lucerne press<br />
water (Fig. 3.2). The experiments will be continued.<br />
Die Auswirkungen der BSE-Krise hat zu tiefgreifenden<br />
Veränderungen in der Landwirtschaft geführt.<br />
Dieser Prozess führte u. a zu der Forderung<br />
nach Transparenz in der Fütterung. Dabei kommt<br />
der Erzeugung wirtschafteigener, eiweißreicher<br />
Grundfuttermittel eine herausragende Bedeutung<br />
zu. Anbau, Konservierung und Lagerung neuer<br />
Qualitätssicherung von Futtermitteln<br />
Bild 3.2: Ausgewählte Gärparameter während der Säuerung von sterilem Luzernepresssaft<br />
Fig. 3.2: Selected parameters during the fermentation of sterile lucerne press water<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
bzw. „vergessener“ Futtermittel wie Klee-Gras-<br />
Mischungen und Luzerne müssen erneut betrachtet<br />
werden. Es werden Konservierungsempfehlungen<br />
für verschiedene eiweißreiche Gras-Mischungen<br />
erarbeitet. Erste Versuche wurden mit Luzernepresssäften<br />
durchgeführt. Dazu wurde das im<br />
<strong>ATB</strong> erarbeitete Siliermittel für Grassilagen „Bornim<br />
liquid“, auf seine Eignung für die Silierung<br />
eiweißreicher Säfte geprüft. Zusätzlich wurde das<br />
konventionelle biologische Siliermittel „BIOCOOL“<br />
(Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG)<br />
eingesetzt. In Bild 3.2 sind die Ergebnisse zur<br />
Silierung steriler Luzernepresssäfte dargestellt.<br />
Durch die gewählten Zusätze kam es zwar in allen<br />
Varianten zu einer beträchtlichen Bildung von Gärsäuren,<br />
jedoch war die Säuremenge nicht groß<br />
genug, um den ph-Wert unter 4,0 abzusenken.<br />
Dies wäre für eine erfolgreiche Konservierung<br />
jedoch notwendig gewesen. Entsprechend der<br />
unterschiedlichen Pufferkapazitäten sind für Luzerne<br />
höhere Milchsäuremengen für eine Ansäuerung<br />
notwendig als für Gräser: 74 g Milchsäure/ kg<br />
TS bei Luzerne, bei Gräsern nur 47 g Säure/ kg<br />
TS. Die ersten Ergebnisse lassen <strong>des</strong>halb den<br />
Schluss zu, dass biologische Siliermittel, die für die<br />
Grassilierung konzipiert sind, nicht notwendigerweise<br />
auch in eiweißreichen Substraten erfolgreich<br />
sein müssen.
Untersuchungen zur on-line Messung der<br />
Siliergutdichte (Projekt-Nr.: 3.50)<br />
Examinations on the on-line measuring of the<br />
silage density<br />
Friedrich Munder (Abt. 3), Christian Fürll (3)<br />
Förderung: Haushalt<br />
The silage density has an important influence on<br />
the silage quality. At present, it cannot be measured<br />
continuously during filling. Therefore several<br />
physical measuring methods were examined for<br />
their suitability. First results indicate that the microwave<br />
measuring principle is particularly suitable.<br />
However, density and dry mass content have<br />
influence on the measuring signal. In future examinations<br />
both influences must be separated.<br />
Die Siliergutdichte nach dem Verdichten ist eine<br />
wesentliche Einflussgröße auf die Qualität der<br />
Silage. In nicht ausreichend verdichtetem Siliergut<br />
entwickelt sich kein optimaler Gärverlauf, und es<br />
kommt bevorzugt zur Bildung von Schimmelpilzen<br />
und Toxinen. Derzeit hat jedoch der Traktorist<br />
während <strong>des</strong> Einlagerns und Verdichtens keine<br />
Möglichkeit der Kontrolle. Zielstellung dieser Forschungsarbeit<br />
ist <strong>des</strong>halb die Entwicklung und<br />
Untersuchung einer Methode zum kontinuierlichen<br />
Messen der Siliergutdichte nach einem on-line<br />
Verfahren.<br />
Nach den durchgeführten Recherchen kommen für<br />
die Anwendung mehrere physikalische Messprin-<br />
Messsignal [MHz]<br />
measuring signal<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
TM=25 [%]<br />
TM=30 [%]<br />
TM=35 [%]<br />
TM=40 [%]<br />
TM=45 [%]<br />
II Fachlicher Teil 29<br />
0 100 200 300 400 500<br />
Dichte [kg m - ³]<br />
density<br />
zipien in Betracht. Aussichtsreich erscheinen das<br />
Georadar und die Mikrowellenmesstechnik.<br />
Das Georadar arbeitet mit elektromagnetischen<br />
Wellen im Megaherzbereich. Der ausgesandte<br />
energiereiche Impuls wird vom gemessenen Medium<br />
reflektiert und als Signal empfangen. Da eine<br />
wesentliche Einflussgröße die Dielektrizitätskonstante<br />
ist, wird das Messsignal auch vom Trockensubstanzgehalt<br />
überdeckt. Die Anwendung <strong>des</strong><br />
Georadars ist derzeit mit sehr hohen Kosten verbunden.<br />
Die Mikrowellenstreufeldsonde sendet elektromagnetische<br />
Wellen im Gigahertzbereich aus. Ein<br />
großes Problem ist nach den ersten durchgeführten<br />
Versuchen auch hier der Sachverhalt, dass<br />
das Messsignal durch die Dichte und die Trockensubstanz<br />
<strong>des</strong> Messgutes statistisch gesichert beeinflusst<br />
wird. (Bild3.3). Die Regressionsanalyse<br />
hat ein sehr gutes Bestimmtheitsmaß. Die maximale<br />
Eindringtiefe der Mikrowellen beträgt etwa 10<br />
cm. Sie ist demzufolge geringer als beim Georadar.<br />
Sie ist aber wiederum ausreichend, weil es<br />
zum Vermeiden von Silierverlusten vor allem auf<br />
eine genügend hohe Verdichtung an der Siliergutoberfläche<br />
ankommt.<br />
In den folgenden Arbeiten müssen beide Einflussgrößen<br />
entkoppelt werden. Sollte dies nicht zum<br />
Ziel führen, ist der Trockenmassegehalt in den<br />
Messungen gesondert zu bestimmen, so dass die<br />
Siliergutdichte über eine implementierte Software<br />
ermittelt werden kann.<br />
Bild 3.3: Abhängigkeit <strong>des</strong><br />
Messsignals von Mikrowellenstreufeldsonden<br />
von der<br />
Dichte der und dem Trockenmassegehalt<br />
von Siliergut<br />
(y = 2,005 ρ 0,78119<br />
TM -0,7753, R 2 = 0,8980*)<br />
Fig. 3.3: Dependence of the<br />
measuring signal of microwave<br />
stray field probes on<br />
the density ρ and the dry<br />
mass content TM of silage<br />
(y = 2,005 ρ 0,78119<br />
TM -0,7753, R2 = 0,8980)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
30<br />
Optimierte Steuerung von Getreide-Schachttrocknern<br />
(Projekt-Nr.: 110/125)<br />
Optimised control of mixed-flow grain dryers<br />
Nikolaus Model (Abt. 3), Jochen Mellmann (3),<br />
Oliver Jost (3)<br />
Förderung: BMBF/PtJ; Haushalt<br />
Mixed-flow dryers are worldwide used for drying of<br />
wheat, rice and corn. For compensating the fluctuation<br />
of the grain moisture at the dryer entrance,<br />
existing models and control concepts are not sufficiently<br />
optimised.<br />
The quality characteristics of the grain are fundamentally<br />
influenced by the grain temperature .<br />
Therefore, more realistic two- and multi-shell models<br />
were derived, which were the main emphasis of<br />
the examinations in the year <strong>2003</strong>. The mathematical<br />
modeling is based on the investigations of<br />
Maltry, Ziegler and Meiering. First results show a<br />
good agreement between theoretical prognoses<br />
based on the mathematical model and comparable<br />
earlier experimental examinations. Additional<br />
experimental tests will be carried out for model<br />
validation by using the modified pilot plant.<br />
Dächerschachttrockner werden weltweit zur Trocknung<br />
von Weizen, Reis und Mais eingesetzt. Gegenwärtig<br />
sind jedoch die Schwankungen der Gutfeuchte<br />
am Trockneraustrag immer noch zu hoch.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualitätssicherung von Futtermitteln<br />
Dies führt sehr oft zur Übertrocknung und damit<br />
zur Schädigung <strong>des</strong> Getrei<strong>des</strong>, was in eigenen<br />
Messungen in der Praxis bestätigt wurde. Ein<br />
Grund dafür ist, dass die bisher bekannten<br />
Regelungskonzepte nicht ausreichend optimiert<br />
sind. Mit den Arbeiten am <strong>ATB</strong> soll ein modellbasiertes<br />
Automatisierungssystem erarbeitet werden,<br />
das auch die Wärme- und Stofftransportvorgänge<br />
im Einzelkorn berücksichtigt. Bekanntlich werden<br />
die Qualitätsmerkmale <strong>des</strong> Getrei<strong>des</strong> besonders<br />
durch die Korntemperatur beeinflusst. Um diese<br />
genauer berechnen zu können, wurden Zwei- und<br />
Mehrschalenmodelle entwickelt. Grundlage dafür<br />
bildeten die Arbeiten von Maltry, Ziegler und Meiering.<br />
Mit Hilfe <strong>des</strong> erarbeiteten Rechenprogramms<br />
können drei unterschiedliche Modelle verwendet<br />
werden. Vergleiche mit früheren Versuchen von<br />
Maltry zeigen, dass das Zehn-Schalenmodell bessere<br />
Ergebnisse liefert als das Zwei-Schalenmodell.<br />
Wie Bild 3.4 verdeutlicht, werden die Temperaturverläufe<br />
in Einzelschichten einer 5 cm hohen<br />
Weizenschüttung durch das Zehn-Schalenmodell<br />
recht gut wiedergegeben. Abweichungen<br />
sind unter anderem darin begründet, dass bisher<br />
noch keine Anpassung der Modellparameter möglich<br />
war. Entsprechende Experimente an der halbtechnischen<br />
Versuchsanlage <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> sind in Vorbereitung.<br />
/83/, /167/, /170/, /171/, /297/, /298/,<br />
/299/, /380/, /381/, /382/<br />
Bild 3.4: Gemessene und<br />
berechnete Temperaturverläufe<br />
in verschiedenen<br />
Schichten einer 5 cm hohen<br />
Weizenschüttung<br />
Fig. 3.4: Measured and<br />
computed temperature<br />
courses in different layers<br />
of a wheat bulk bed
Untersuchungen zum Fließverhalten von landwirtschaftlichen<br />
Dickstoffen (Projekt-Nr.: 5.26)<br />
Flow behaviour of semi-liquid agricultural fluids<br />
Meno Türk (Abt. 5)<br />
Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft (LFL) Groß<br />
Kreutz/Ruhlsdorf<br />
Förderung: Haushalt<br />
Agricultural suspensions have complicated flow<br />
properties. For planning of pump and mixing<br />
equipments exact calculation fundamentals and<br />
material data are necessary. Rotational viscometers<br />
with wide shear gaps and a transportable tube<br />
type viscometer for measuring of flow curves and<br />
time dependent flow properties exist. Straw addition<br />
to swine liquid manure and other co-substrates<br />
was tested. The swine liquid manure technology is<br />
not applicable for straw addition because pipes<br />
and pumps are often blocked. The flow properties<br />
of any organic co-substrates in liquid manure can<br />
calculate with help of the known software<br />
ROHRWIN.<br />
Landwirtschaftliche Suspensionen haben äußerst<br />
komplizierte Fließeigenschaften. Zur Planung von<br />
Pumpen- und Rühranlagen sind exakte Berechnungen<br />
auf der Basis gemessener rheologischer<br />
Stoffeigenschaften notwendig. Bei der Entwicklung<br />
effizienter Verfahren der Biogaserzeugung, der<br />
Schubspannung in Pa shear stress, Pa<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
ohne Stroh without straw<br />
0,5 % Stroh add of 0.5% straw<br />
1 % Stroh add of 1% straw<br />
1,5 % Stroh add of 1.5% straw<br />
Schergradient in s -1 shear gradient, s -1<br />
II Fachlicher Teil 31<br />
0 50 100 150 200 250<br />
Flüssigfütterung oder der tiergerechten Haltung<br />
von Mastschweinen ergeben sich zunehmend<br />
Probleme durch Feststoffzusätze unterschiedlichster<br />
Art. Dazu wurden Testversuche mit Schweinegülle<br />
und Zusatz von kurzgehäckseltem Stroh<br />
(Bild 3.5), Bullengülle mit Zusatz von sog. Effektiven<br />
Mikroorganismen (EM), Rindergülle mit Kosubstraten,<br />
Biogasschlämmen, Klärschlämmen<br />
und Flüssigfutter mit Enzymzusatz durchgeführt.<br />
Diese Untersuchungen erfolgten zusammen mit<br />
anderen Abteilungen im <strong>ATB</strong>, der Lan<strong>des</strong>anstalt<br />
für Landwirtschaft LFL Groß Kreutz/Ruhlsdorf und<br />
zur Beratung von Praxisbetrieben, zumeist im<br />
Zusammenhang mit Auslegungsfragen von Pumpenanlagen<br />
und Anwendungen <strong>des</strong> Rohrleitungs-<br />
Auslegungsprogramms ROHRWIN. Zur rheometrischen<br />
Untersuchung sind spezielle Rotationsviskosimeter<br />
mit großer Spaltweite und ein Rohrviskosimeter<br />
vorhanden. Diese Messeinrichtungen<br />
können auch für grobstrukturierte Dickstoffe eingesetzt<br />
werden. Bei den Untersuchungen hat sich<br />
deutlich gezeigt, dass Strohzusätze zu Schweinegülle<br />
erhebliche Probleme (Verstopfungen) verursachen<br />
und auch kleine Strohmengen (< 0,5 %)<br />
möglichst zu vermeiden sind. Gülletechnologie<br />
(Schweinegülle) ist für Strohzusätze nicht geeignet!<br />
Die Veränderung der Gülle-Fließeigenschaften<br />
durch Zusatz von anderen organischen Gülle-<br />
Kosubstraten kann mit Hilfe <strong>des</strong> Programms<br />
ROHRWIN, durch Anwendung z.B. der Mischungsregel,<br />
zumeist ausreichend genau berechnet<br />
werden.<br />
Bild 3.5: Fließkurven von<br />
Schweinegülle mit Strohzusatz<br />
Fig. 3.5 : Flow curves of<br />
swine liquid manure with<br />
straw addition<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
32<br />
Verschleißeinfluss auf das Förderverhalten von<br />
Drehkolbenpumpen (Projekt-Nr.: 5.27)<br />
Influence of mechanical wear of rotary lobe<br />
pumps on the pumping behaviour<br />
Meno Türk (Abt. 5), Thomas Zenke (5)<br />
Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH Essen<br />
Förderung: BMWi (AiF); Haushalt<br />
Two shaft rotary lobe pumps are often used for<br />
pumping slurries in waste water treatment-, biogas-,<br />
liquid manure and liquid feeding treatment<br />
plants. The gaps in rotary lobe pumps enlarge<br />
during mechanical wear, and pumping behaviour is<br />
changed. The characteristics of pumps with systematically<br />
varied gaps were measured and an<br />
algorithm for calculating them has been developed.<br />
By means of this algorithm the real characteristics<br />
depending on viscosity and wear can be calculated.<br />
The most important influence factors are<br />
dimensions of head gaps and front gaps as well as<br />
the viscosity of fluid. The gap leakage rate is reduced<br />
due to increasing viscosity. The pressureflow<br />
characteristic curve plotted at closed discharge<br />
pipe is able to <strong>des</strong>cribe the pump´s wear<br />
status.<br />
Zum Fördern von Flüssigkeiten, Schlämmen und<br />
Dickstoffen in der Landwirtschaft, Kommunaltechnik<br />
und Industrie werden oft Drehkolbenpumpen<br />
eingesetzt. Mit zunehmendem Pumpenverschleiß<br />
vergrößern sich die Spalte und damit die Rückströmungsverluste<br />
in den Pumpen. Die Förderkennlinien<br />
verändern sich, auch in Abhängigkeit<br />
vom Fließverhalten und der Struktur der Förder-<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualitätssicherung von Futtermitteln<br />
medien. Die Strömungsverluste in Drehkolbenpumpen<br />
und die Auswirkungen auf das Förderverhalten<br />
wurden in Abhängigkeit vom Verschleiß und<br />
vom Fließverhalten am Pumpenversuchsstand im<br />
<strong>ATB</strong> untersucht (Bild 3.6). Die Spaltformen wurden<br />
systematisiert und die Auswirkungen auf<br />
Rückströmungsverluste und Pumpenkennlinien<br />
bewertet.<br />
Es wurden Berechnungsgrundlagen für die Bestimmung<br />
realer Pumpenkennlinien zur Optimierung<br />
<strong>des</strong> Pumpenwirkungsgra<strong>des</strong> und zur Verlängerung<br />
der Nutzungszeit entwickelt. Die Spaltgrößen<br />
und die Pumpentypen können an konkrete<br />
Förderaufgaben angepasst werden. Dazu wurde<br />
ein Pumpenauslegungsprogramm entwickelt.<br />
Neue technische Lösungen zur Verschleißkompensation<br />
wurden entwickelt und untersucht. So<br />
können Förder- und Dosieraufgaben mit höherer<br />
Qualität erfüllt werden. Zur Verschleißdiagnose<br />
sind Druckmessungen beim Fördern gegen einen<br />
geschlossenen Schieber oder direkte Leckstrommessungen<br />
an einer blockierten Pumpe aussagefähig<br />
und auf reale Pumpenkennlinien übertragbar.<br />
Die Messungen sind auch vor Ort im praktischen<br />
Einsatz realisierbar.<br />
Diese komplexe Aufgabe wurde im Rahmen eines<br />
Drittmittelprojektes zusammen mit dem Industriepartner<br />
bearbeitet und durch das BMWi gefördert.<br />
So können u.a. Dosierpumpen für die Flüssigfütterung<br />
erheblich genauer bemessen und länger eingesetzt<br />
werden. Damit werden wichtige technische<br />
Voraussetzungen zur Qualitätssicherung bei der<br />
bedarfsgerechten Futterversorgung geschaffen.<br />
/8/, /9/, /28/, /29/, /62/, /208/, /209/, /219/, /220/,<br />
/399/, /400/<br />
Bild 3.6: Pumpenversuchsstand<br />
im <strong>ATB</strong><br />
Fig. 3.6: Pump test stand in the<br />
<strong>ATB</strong>
4 Umweltverträgliche und tiergerechte Haltung<br />
von Rindern, Schweinen und Geflügel<br />
(Forschungsschwerpunkt 4)<br />
Sustainable livestock management in line<br />
with animal welfare of cattle, pigs and<br />
poultry<br />
(Koordinator: Reiner Brunsch, Abt. 5)<br />
Eine möglichst gleichwertige Analyse und Bewertung<br />
von Tier- und von Umweltschutzaspekten<br />
sowie die damit verbundenen Schwierigkeiten sind<br />
im Berichtsjahr in unterschiedlicher Weise mit zum<br />
Teil erheblichem Öffentlichkeitsinteresse dargestellt<br />
worden. Auf europäischer Ebene wurden für<br />
die Geflügel- und Schweineproduktion ("Intensivtierhaltung")<br />
die "Besten verfügbaren Techniken"<br />
(BVT) in einem Merkblatt veröffentlicht. Seitens<br />
<strong>des</strong> <strong>ATB</strong> erfolgte hierzu fachliche Zuarbeit sowohl<br />
im Rahmen einer Arbeitsgruppe beim UBA als<br />
auch durch Mitarbeit in einer KTBL-Arbeitsgruppe.<br />
Die BVT-Merkblätter beschreiben Geflügel- und<br />
Schweinehaltungsverfahren hinsichtlich ihrer Auswirkungen<br />
auf die Umwelt (z. B. Emissionen), den<br />
Ressourcenverbrauch (z. B. Energieaufwand) und<br />
die Beeinflussung <strong>des</strong> Tierverhaltens und <strong>des</strong><br />
Wohlbefindens. Die gute fachliche Praxis ist ein<br />
wesentlicher Bestandteil von BVT. Auch wenn es<br />
schwierig ist, die Vorteile für die Umwelt zu quantifizieren,<br />
die eine Verringerung von Emissionen<br />
oder eine Verringerung <strong>des</strong> Energie- und Wasserverbrauches<br />
mit sich bringen, liegt es auf der<br />
Hand, dass eine bewusste Betriebsführung zu<br />
einer verbesserten Umweltleistung von Nutztierhaltungen<br />
führen wird. Das <strong>ATB</strong> ist im Rahmen<br />
einer KTBL-Arbeitsgruppe an der Beschreibung<br />
der guten fachlichen Praxis der Minderung von<br />
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft beteiligt<br />
gewesen. Die Ergebnisse sind in einer Monografie<br />
(aid-Broschüre) veröffentlicht. Der nationale<br />
Bericht wird in den kommenden zwei Jahren erweitert.<br />
Dabei werden weitere Haltungsverfahren<br />
von Schweinen und Geflügel aufgenommen und<br />
die Fragen der Tiergerechtheit und <strong>des</strong> Umweltschutzes<br />
sollen gleichberechtigt in die Bewertung<br />
einfließen.<br />
Aufgrund der enormen Stoffumsätze steht die Rinderproduktion<br />
besonders im Interesse, sofern es<br />
um die zwingend erforderliche Reduzierung von<br />
unerwünschten Umwelteinflüssen geht. Innerhalb<br />
<strong>des</strong> Projektes "Einfluss der Verfahrensgestaltung<br />
im Pflanzenbau und in der Tierhaltung auf Stoff-<br />
und Energieflüsse (2.23 im FSP 1) sind über drei<br />
Jahre Messungen zur Nährstoffverlagerung und zu<br />
Emissionen aus Flächen erfolgt, die als Winterquartier<br />
für Mutterkühe dienen. Die Ergebnisse<br />
werden derzeit im Rahmen einer Masterarbeit<br />
II Fachlicher Teil 33<br />
ausgewertet und lassen Aussagen zur Bewertung<br />
der Umweltverträglichkeit dieses verbreiteten Haltungsverfahrens<br />
erwarten.<br />
In Zusammenarbeit mit dem Lan<strong>des</strong>amt für<br />
Verbraucherschutz und Landwirtschaft <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
Brandenburg sind im Berichtszeitraum insbesondere<br />
neue Haltungsverfahren für Schweine und<br />
Legehennen analysiert worden. Seitens <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
wurden Stallklima- und Emissionsmessungen bei<br />
Großgruppenhaltung von Mastschweinen und in<br />
ausgestalteten Käfigen für Legehennen durchgeführt.<br />
Die Untersuchungen werden 2004 fortgeführt<br />
und ausgewertet.<br />
Verfahrenstechnische Lösungen zur Minderung<br />
von Emissionen wurden auch im vergangenen<br />
Jahr im Bereich der Güllelagerung untersucht. Die<br />
kombinierte Wirkung von Abdeckung und pH-Wert-<br />
Senkung (Patentanmeldung) ist in einer deutlichen<br />
Senkung der Ammoniak- und Methanemission<br />
erkennbar.<br />
Durch Inkrafttreten der Technischen Anleitung zur<br />
Reinhaltung der Luft (TA Luft) im Jahr 2002 gibt es<br />
für Tierhaltungen nunmehr sowohl für Geruch als<br />
auch für Ammoniak Abstandsregelungen zu<br />
Wohnbebauungen und empfindlichen Ökosystemen.<br />
Dies hat zu einigen Problemen in der Umsetzung<br />
geführt. Die im <strong>ATB</strong> vorhandene Kompetenz<br />
sowohl in der Methodenentwicklung für Emissionsmessungen<br />
in der Tierhaltung als auch der<br />
umfangreiche Datenfundus zum Emissionsgeschehen<br />
haben in jüngster Vergangenheit zu wichtigen<br />
Regelungen für die Tierhaltung im Land<br />
Brandenburg geführt, die auf andere Bun<strong>des</strong>länder<br />
übertragbar sind. So ist eine Methode entwickelt<br />
worden zur Bewertung bestehender Tierhaltungen<br />
auf der Basis von Verlaufsmessungen <strong>des</strong> Emissionsgeschehens<br />
mit Hilfe der Tracergastechnik.<br />
Speziell zur Putenhaltung wurden Daten für den<br />
"Brandenburgischen Handlungsrahmen zur Beurteilung<br />
von Waldökosystemen im Umfeld von Tierhaltungsanlagen"<br />
bereit gestellt. Der in den vergangenen<br />
Jahren mit Messtechnik ausgestattete<br />
Broilermaststall wurde im Berichtsjahr weiter untersucht.<br />
So werden in beiden Abteilen die Gaskonzentrationen<br />
in den Abluftschächten gemessen.<br />
Zur Verbesserung <strong>des</strong> Messdatenmanagements<br />
und in Vorbereitung weiterer Installationen<br />
ist das gesamte Datenerfassungssystem von<br />
Standard-Klimacomputern auf spezielle Kommunikationsmodule<br />
in Verbindung mit einem PC umgestellt<br />
worden. Mit dieser Änderung sollen die wichtigsten<br />
Messdaten online auf dem Monitor im Büro<br />
<strong>des</strong> Betriebsleiters erscheinen. Gleichzeitig ist die<br />
Voraussetzung geschaffen, für künftigen Datentransfer<br />
per Telefon. In Ergänzung zum Langzeitmonitoring<br />
<strong>des</strong> Emissionsgeschehens <strong>des</strong> beschriebenen<br />
Broilermaststandortes konnten an<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
34<br />
einem anderen Standort mit differenziertem Management<br />
Messungen durchgeführt werden.<br />
Innerhalb <strong>des</strong> Arbeitsgebietes "Sensorgestützte<br />
Datengewinnung von Nutztieren" lag der Schwerpunkt<br />
in der Bewertung verschiedener Einsatzgebiete<br />
der Thermografieanwendung bei Rindern<br />
und in der Weiterentwicklung eines speziellen<br />
Aktivitätsmessgerätes (Pedometer). Während diese<br />
Technik üblicherweise zur Aktivitätsüberwachung<br />
bei Kühen eingesetzt wird, bietet die Neuentwicklung<br />
auch die Möglichkeit der gezielten<br />
Auswertung von Aktivitäts- und Ruheverhalten.<br />
Die erste Europäische Konferenz für Präzisionstierhaltung<br />
(European Conference on Precision<br />
Livestock Farming) fand im Juni <strong>2003</strong> in Berlin<br />
statt. Die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung<br />
wurde zum erheblichen Teil von Mitarbeitern<br />
<strong>des</strong> FSP getätigt. Damit ist es weltweit erstmals<br />
gelungen, eine seit Jahren etablierte internationale<br />
Konferenz zu Precision Farming (ECPA)<br />
mit Ergebnissen aus der Tierhaltung zu bereichern.<br />
Mit der Gründung eines europäischen Programmkomitees,<br />
in dem das <strong>ATB</strong> Deutschland<br />
vertritt, wurde für die Weiterentwicklung einer disziplinenübergreifenden,<br />
managementorientierten<br />
Konferenz die Voraussetzung geschaffen.<br />
Das Arbeitsgebiet "Milchgewinnung" wird im Wesentlichen<br />
durch zwei Promotionsthemen ausgefüllt.<br />
Die erste Versuchsreihe zur Bestimmung der<br />
Variabilität der Natrium- und Kaliumionenkonzentration<br />
in der Milch ist zum Jahresende abgeschlossen<br />
worden. Aus den Daten werden Ansätze<br />
für die Sensorentwicklung und Informationsverarbeitung<br />
zur Früherkennung von Eutergesundheitsstörungen<br />
abgeleitet.<br />
Die analytischen Arbeiten zur Quantifizierung <strong>des</strong><br />
Einflusses technischer Parameter auf die Euter<br />
von Kühen (Kooperation mit der DLG-Prüfstelle<br />
für Landmaschinen) konzentrierten sich auf die<br />
Messung von Kräften, die während <strong>des</strong> Melkens<br />
auf die Zitze wirken. Aus den vorliegenden Ergebnissen<br />
wurde ein erster Bewertungsrahmen abgeleitet,<br />
mit dem vergleichende Melkanlagenprüfungen<br />
möglich werden. Neben den technischen Einflüssen<br />
ist auch der erhebliche Einfluss <strong>des</strong> Melkpersonals,<br />
insbesondere beim Auftreten von Drehkräften,<br />
herausgestellt worden.<br />
Die im Berichtszeitraum erbrachten Leistungen<br />
sind überwiegend in Kooperation mit anderen wissenschaftlichen<br />
Einrichtungen <strong>des</strong> In- und Auslan<strong>des</strong><br />
entstanden. Der Erfolg der Arbeiten basiert<br />
ganz wesentlich auf der Unterstützung der Landwirtschaftsbetriebe,<br />
in denen die Versuche stattfinden.<br />
Die aktive Teilnahme am Meinungsaustausch<br />
mit nationalen und ausländischen Fachkollegen<br />
(Konferenzen, Workshops, Studienaufenthalte) hat<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Umweltverträgliche und tiergerechte Haltung<br />
zu einer Verbesserung der Einbindung in das Netz<br />
der Nutztierwissenschaftler geführt. Das Niveau in<br />
der Entwicklung analytischer Methoden macht die<br />
Arbeiten im FSP auch für benachbarte Fachdisziplinen<br />
interessant.
Projekte zum Forschungsschwerpunkt 4<br />
Untersuchung und Bewertung von Verfahren<br />
der Rinder- und der Schweinehaltung in Bezug<br />
auf Verbraucher- und Umweltschutz, Tiergerechtheit<br />
und ökonomische Konsequenzen<br />
(Projekt-Nr.: 2.29)<br />
Investigation and assessment of procedures in<br />
cattle and in pig husbandry in consideration of<br />
consumer and environmental protection, animal<br />
welfare and economic consequences<br />
Werner Berg (Abt. 2), Reiner Brunsch (5), Günter<br />
Hörnig (5)<br />
Förderung: Haushalt<br />
Animal husbandry is subjected to an increasing<br />
economic pressure because of the tightening up<br />
demands of environmental protection and animal<br />
welfare. Further research is needed to find efficient<br />
solutions, as well as an extended knowledge realization.<br />
Ploughing under manure directly after field<br />
application constitutes an effective and economical<br />
measure for all livestock categories. Emission reduction<br />
measures during manure storage are also<br />
very effective, if slurry has no natural crust, e.g. in<br />
pig husbandry. Whereas a nutrient-adapted feeding<br />
is effective, but more expensive.<br />
Considering not only ammonia and odour emissions,<br />
but also methane and nitrous oxide, further<br />
research is still needed. Combinations of covering<br />
and acidifying slurry were investigated in laboratory<br />
scale with the aim to reduce all mentioned<br />
emissions. The results so far show good reductions<br />
of ammonia and methane emissions, nitrous<br />
oxide was not determined in contrary to the use of<br />
conventional cover material.<br />
Die steigenden Anforderungen <strong>des</strong> Umweltschutzes<br />
und der Tiergerechtheit führen zu einem verstärkten<br />
ökonomischen Druck auf die Tierhaltung.<br />
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,<br />
bedarf es weiterer Forschungsarbeiten, die zu<br />
effizienten Lösungen führen, aber auch einer Unterstützung<br />
zur Umsetzung vorhandener Forschungsergebnisse<br />
in die Praxis. Ein Beitrag dazu<br />
wurde im Rahmen einer KTBL-UBA-Arbeitsgruppe<br />
geleistet und vom aid-Infodienst in der Broschüre<br />
"Ammoniak-Emissionen in der Landwirtschaft mindern<br />
– Gute fachliche Praxis" veröffentlicht. Wie<br />
bereits in voran gegangenen Arbeiten deutlich<br />
wurde, sind vor allem Maßnahmen zur Emissionsminderung<br />
im Bereich der Wirtschaftsdüngerausbringung<br />
besonders wirkungsvoll und kostengünstig.<br />
In der Schweinehaltung bzw. überall dort,<br />
II Fachlicher Teil 35<br />
wo Gülle keine natürliche Schwimmdecke ausbildet,<br />
trifft das außerdem in ähnlichem Maß für den<br />
Bereich der Güllelagerung zu, während eine proteinangepasste<br />
Fütterung die Ammoniakemissionen<br />
zwar noch einmal wirksam reduziert, aber bereits<br />
mit spürbaren Kosten verbunden ist.<br />
Bezieht man neben den Ammoniak- und Geruchsemissionen<br />
auch die klimarelevanten Gase Methan<br />
und Distickstoffmonoxid in die Betrachtungen<br />
zur Emissionsminderung ein, zeigt sich noch ein<br />
erheblicher Forschungsbedarf. Hier bedarf es intensiver<br />
Untersuchungen, die zum einen die Emissionen<br />
offener Lagerstätten, zum anderen die<br />
Auswirkungen von Maßnahmen zur Minderung<br />
von Ammoniakemissionen aufklären. Im Bereich<br />
der Festmistlagerung liegen keine gesicherten<br />
Emissionsdaten vor und es fehlt an wirksamen<br />
Maßnahmen zur Emissionsminderung. Hier sind<br />
experimentelle Untersuchungen erforderlich, erst<br />
recht, wenn Haltungsverfahren mit Einstreu forciert<br />
werden sollen. Angesichts der Tatsache, dass ca.<br />
ein Drittel der Gülle im Stall (unter dem Spaltenboden)<br />
gelagert wird, sind auch Lösungen zur Verminderung<br />
der von dort ausgehenden Emissionen<br />
gefragt.<br />
Experimentelle Untersuchungen zur Emissionsminderung<br />
während der Güllelagerung im Labormaßstab<br />
hatten zum Ziel, durch das Kombinieren<br />
von Abdecken <strong>des</strong> Lagerbehälters und Absenken<br />
<strong>des</strong> pH-Wertes der Gülle eine wirksame Minderung<br />
aller genannten Emissionen zu erreichen. Die<br />
bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass sich<br />
mit derartigen Kombinationen die Ammoniak- und<br />
Methanemissionen wirksam verringern lassen,<br />
Distickstoffmonoxidemissionen waren im Gegensatz<br />
zur Anwendung herkömmlicher Abdeckmaterialien<br />
nicht zu verzeichnen. /67/, /68/, /69/, /70/,<br />
/71/, /101/, /122/, /155/, /224/, /225/, /226/, /232/<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
36<br />
Einfluss verschiedener Abdeckmaterialien auf<br />
die Ammoniak- und Methanemissionen von<br />
Gülle bei der Lagerung (Projekt-Nr.: 09/02)<br />
Influence of different cover materials on ammonia<br />
and methane emissions during slurry<br />
storage<br />
Reiner Brunsch (Abt. 5), Werner Berg (2)<br />
Mezőgazdasági Gépesítési Intézete (MGI)<br />
Förderung: Haushalt; BMVEL<br />
Gaseous emissions from agricultural operations<br />
have become to the fore in Germany since several<br />
years. In Hungary it is also increasing. Besi<strong>des</strong><br />
odour and ammonia, also methane and nitrous<br />
oxide are of interest.<br />
New solutions were investigated to reduce ammonia<br />
and methane emissions considering the emission<br />
of nitrous oxide during slurry storage. The<br />
investigations were done with pig slurry in the<br />
emission labs of both institutes. Nearly the same<br />
methods were used. The comparability of the results<br />
was improved also by parallel calibrating of<br />
the used measuring equipment.<br />
Results of a parallel measurement are shown for<br />
ammonia in Table 4.1. The figures are related to<br />
the control (no cover or treatment – container 1).<br />
The slurry was covered with 4 cm perlite, customarily<br />
in trade (container 3), and combined with 2 l<br />
lactic acid (container 2).<br />
Umweltverträgliche und tiergerechte Haltung<br />
Tabelle 4.1: Ammoniakemission in Bezug auf den Kontrollbehälter (Behälter 1)<br />
Table 4.1: Ammonia emission in relation to the control (container 1)<br />
Gasmessung <strong>ATB</strong><br />
Measurement <strong>ATB</strong><br />
Gasmessung MGI<br />
Measurement MGI<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Behälter 1<br />
Container 1<br />
Gasförmige Emissionen aus der Landwirtschaft<br />
stehen in der Bun<strong>des</strong>republik Deutschland schon<br />
seit einigen Jahren im öffentlichen Interesse. Auch<br />
in Ungarn ist dies zunehmend der Fall. Dabei sind<br />
nicht nur die Reduzierung der Ammoniak- und<br />
Geruchsemissionen von Interesse, sondern auch<br />
die Minderung der Emissionen von Methan- und<br />
Distickstoffmonoxid.<br />
Die im Berichtszeitraum durchgeführten Arbeiten<br />
dienten insbesondere der Untersuchung neuer<br />
Minderungsmöglichkeiten der Emissionen der<br />
Gase Ammoniak und Methan unter Berücksichtigung<br />
der Freisetzung von Distickstoffmonoxid bei<br />
der Lagerung von Gülle. In den Emissionsmesslaboren<br />
beider Institute erfolgten sich ergänzende<br />
Untersuchungen an Schweinegülle mit abgestimmten<br />
Methoden. In diesem Rahmen wurden die verwendeten<br />
Gasmessgeräte beider Institute parallel<br />
kalibriert, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse<br />
noch einmal deutlich verbessert.<br />
Tabelle 4.1 zeigt Ergebnisse einer Parallelmessung<br />
für die Ammoniakfreisetzung. Die Messungen<br />
erfolgten an 3 Versuchsbehältern mit Schweinegülle.<br />
Neben der Kontrolle (Behälter 1) war die<br />
Gülle mit Perlit abgedeckt. Behälter 3 war mit einer<br />
4 cm starken Schicht <strong>des</strong> handelsüblichen Materials<br />
(Pegülit ® ) versehen. Im Behälter 2 befand sich<br />
ebenfalls eine 4 cm starke Perlitschicht, dieses<br />
Material enthielt jedoch einen Zusatz von 2 l Milchsäure.<br />
Zum einen stimmen die Ergebnisse der<br />
Messgeräte <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> und <strong>des</strong> MGI sehr gut überein.<br />
Zum anderen wird die positive Wirkung <strong>des</strong><br />
Milchsäurezusatzes deutlich.<br />
Behälter 2<br />
Container 2<br />
Behälter 3<br />
Container 3<br />
100 18,2 46,7<br />
100 12,5 47,7
Lufttechnische Systeme zur Emissions- und<br />
Immissionsminderung in der Tierhaltung<br />
(Projekt-Nr. 5.05)<br />
Ventilation systems for the reduction of emissions<br />
and immissions from animal housing<br />
Hans-Joachim Müller (Abt. 5)<br />
FAL Braunschweig; Ingenieurbüro Dr. Eckhof Ahrensfelde<br />
Förderung: Haushalt<br />
The keeping of animals in livestock buildings requires<br />
the ventilation of these buildings. Good climate<br />
conditions for animals have to be guaranteed<br />
along with low emissions and immissions from the<br />
animal houses. In <strong>2003</strong>, the main emphasis of<br />
investigations was put on the influence of different<br />
keeping and ventilation systems for laying hen<br />
houses and the influence of animal mass in broiler<br />
houses on the emission of ammonia.<br />
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die<br />
Tierhaltung zwingen immer stärker zur Suche nach<br />
artgerechten und zugleich emissionsarmen Haltungsverfahren.<br />
In der Geflügelhaltung gibt es<br />
zahlreiche Ansätze für solche Lösungen. Häufig<br />
sind jedoch artgerechte Haltungsverfahren mit<br />
erhöhten Emissionen verbunden. In diesem Zusammenhang<br />
wurden <strong>2003</strong> in Zusammenarbeit mit<br />
dem Ingenieurbüro Dr. Eckhof verschiedene Ställe<br />
in der Geflügelhaltung hinsichtlich der Ammoniakemissionen<br />
untersucht. Da es in Deutschland bisher<br />
kein abgestimmtes Untersuchungsverfahren<br />
Ammoniakkonzeration, mg/m³<br />
ammoni concentration, mg/m³<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
II Fachlicher Teil 37<br />
Stundenmittel der Ammoniakkonzetration<br />
Tiermasse<br />
Trend - Ammoniakkonzetration<br />
Trend - Tiermasse<br />
gibt, wurde eine Methodik für diese speziellen<br />
Untersuchungen erarbeitet. Die Bestimmung der<br />
Gaskonzentrationen (NH3; CO2; SF6; N2O; CH4;<br />
H2O) wurde mit Hilfe eines Multi-Gasmonitors vorgenommen.<br />
Mit dem Gerät sind Verlaufsmessungen<br />
möglich. Zur Bestimmung <strong>des</strong> Volumenstroms<br />
wurde die Tracergastechnik eingesetzt unter Verwendung<br />
von SF6 als Tracergas. Die Dosierung<br />
erfolgte kontinuierlich, so dass der Frischluftstrom<br />
durch den Stall ebenfalls im Verlauf ermittelt werden<br />
konnte. Damit sind Verlaufsmessungen über<br />
mehrere Tage möglich.<br />
Bei den untersuchten Legehennenställen zeigte<br />
sich, dass bei Käfighaltung mit Kotbandbelüftung<br />
sehr geringe Ammoniakemissionen erreicht werden.<br />
Die Volierenhaltung führt zu höheren Ammoniakemissionen,<br />
die jedoch durch Anwendung der<br />
Kotbandbelüftung auch hier im Vergleich zu Systemen<br />
ohne Kottrocknung auf einem niedrigen<br />
Niveau gehalten werden können.<br />
In einem Broilerstall konnte mit einigen zeitlichen<br />
Unterbrechungen über die gesamte Haltungsperiode<br />
von 32 Tagen der Verlauf der Ammoniakemission<br />
bestimmt werden. Die Darstellung der Verläufe<br />
der Lebendmasseentwicklung der Tiere und der<br />
Ammoniakkonzentration in Bild 4.1 zeigt den direkten<br />
Zusammenhang zwischen Lebendmasseentwicklung<br />
und Ammoniakkonzentration. Daraus<br />
ergibt sich ein starkes Ansteigen der Ammoniakemission<br />
im Verlauf der Haltungsperiode. /54/,<br />
/112/, /158/, /172/, /173/, /174/, /236/, /288/, /302/,<br />
/303/, /383/<br />
Trendgleichung, NH3-Konzetration<br />
y = 0,0054x 2 + 0,0867x; R 2 = 0,971<br />
0 4 8 12 16 20 24 Zeit, 28 d<br />
time, d<br />
32<br />
1600<br />
1200<br />
800<br />
400<br />
0<br />
Tiermasse, g pro Tier<br />
animal mass, g per animal<br />
Bild 4.1: Verlauf der Ammoniakkonzentration und der Lebendmasse über eine Haltungsperiode in einem Broilerstall.<br />
Fig. 4.1: Run of the ammonia concentration and development of animal mass during one keeping period in a broiler<br />
house<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
38<br />
Reduzierung der Emission von Treibhausgasen,<br />
Ammoniak und Gerüchen, die aus landwirtschaftlichen<br />
Aktivitäten insbesondere aus<br />
der Tierhaltung resultieren (Projekt-Nr.: 36/01)<br />
Reduction of the emission of greenhouse<br />
gases, ammonia and smells due to agricultural<br />
activities, especially animal husbandry<br />
Hans-Joachim Müller (Abt. 5); VUZT Prag (CZ)<br />
Förderung: BMVEL; Haushalt<br />
The necessary ventilation of livestock buildings<br />
leads to emission of odor and greenhouse gases.<br />
In order to reduce the negative influence of these<br />
emissions on the environment new regulations and<br />
new keeping and ventilation systems for the animals<br />
have to be developed. For this purpose investigations<br />
were done by the <strong>ATB</strong> Bornim and the<br />
VUZT Prague. In <strong>2003</strong>, the partners carried out<br />
measurements in two different fattening pig houses<br />
in Germany and in two similar turkey houses in<br />
Czech Republic.<br />
Die Emission von Gerüchen und Gasen kann zu<br />
negativen Einflüssen auf die Umwelt führen. Zur<br />
Minimierung dieser negativen Einflüsse gibt es in<br />
Deutschland Regelwerke (u.a. VDI-Richtlinien und<br />
die TA Luft). Dabei geht es nicht nur um die Einhaltung<br />
von Min<strong>des</strong>tabständen zwischen den Tierhaltungen<br />
und Wohnbebauungen bzw. Ökosystemen.<br />
Die gesetzlichen Regelungen sollen auch zur<br />
Entwicklung von Haltungs- und Lüftungssystemen<br />
mit möglichst niedrigen Emissionen führen. Sowohl<br />
Ammoniakkonzentration, mg/m³<br />
ammonia concentration, mg/m³<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
Umweltverträgliche und tiergerechte Haltung<br />
zur Bewertung der Systemlösungen als auch zur<br />
Entwicklung neuer technischer Lösungen ist die<br />
Untersuchung <strong>des</strong> Emissionsgeschehens notwendig.<br />
Da sich die Umweltbelastungen nicht an den<br />
politischen Grenzen orientieren, ist gerade auf<br />
diesem Sektor eine Zusammenarbeit auf internationaler<br />
Ebene sinnvoll. Diese Zusammenarbeit<br />
dient nicht nur dem Erfahrungsaustausch sondern<br />
auch dem Abgleich der Untersuchungsmethoden.<br />
In Bezug auf den Methodenabgleich konnten aufgrund<br />
einer jahrelangen Zusammenarbeit gute<br />
Fortschritte erreicht werden. Das laufende Thema<br />
erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren.<br />
Im Jahr <strong>2003</strong> wurden in Deutschland in einer<br />
Versuchsanlage zwei Stallabteile für Mastschweine<br />
mit unterschiedlichen Gruppengrößen untersucht.<br />
Schwerpunkt ist die Ermittlung der Ammoniak-Emissionen.<br />
Dazu wurden Gaskonzentrations-<br />
und Volumenstrommessungen durchgeführt und<br />
die Klimaparameter im und außerhalb <strong>des</strong> Stalles<br />
registriert. Als Beispiel sind im Bild 4.2 die Ammoniakkonzentrationsverläufe<br />
in der Abluft der beiden<br />
Ställe dargestellt. Die höheren Werte beim Stall mit<br />
der Großgruppe hängen nicht nur mit dem anderen<br />
Haltungsverfahren zusammen, sondern auch<br />
mit einem geringeren Volumenstrom. Eine weitergehende<br />
Auswertung wird vorgenommen. Weitere<br />
Emissionsmessungen wurden in zwei Putenställen<br />
in Tschechien durchgeführt. Die Messungen werden<br />
2004 fortgesetzt ausgewertet und die Ergebnisse<br />
zu einem Abschlussbericht zusammengefasst.<br />
Normalgruppe Großgruppe<br />
0<br />
20. 10. 22. 10. 24. 10. 26. 10. 28. Datum 10.<br />
date<br />
30. 10.<br />
Bild 4.2: Verlauf der Ammoniakkonzentration im Abluftschacht von zwei unterschiedlichen Mastschweineställen.<br />
Fig. 4.2: Run of the ammonia concentration in the exhaust air of two different houses for fattening pigs.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
Analyse <strong>des</strong> Informationswertes und der Funktionalität<br />
verschiedener Systeme zur Erfassung<br />
der Tieraktivität (Projekt-Nr.: 5.23)<br />
Analyses of information importance and functionality<br />
of different systems for measuring<br />
animal activity<br />
Ulrich Brehme (Abt. 5)<br />
Förderung: Haushalt<br />
The development of a pedometer for measuring<br />
animal activity and lying time as well as for safe<br />
oestrus detection and early recognition of animal<br />
illness has been completed. The development of a<br />
generally accepted algorithm for activity and lying<br />
time with a freely programmable tolerance passage<br />
for the alarm level during oestrus (high activity/low<br />
lying time) and animal illness (low activity/long<br />
lying time) is being continued.<br />
Automatic continuous recording, assignment and<br />
processing of the individual animal data - animal<br />
activity, lying time and environmental temperature<br />
– gives way to a successful and fast influencing<br />
control on the health and fertility event of the individual<br />
animal in the course of the day by means of<br />
herd management. Deviations of the normal<br />
course are displayed automatically in the graph of<br />
the day’s course.<br />
Bild 4.3: Beispiel für Aktivitäts- und Liegezeitverlauf im Brunstzyklus einer Kuh<br />
Fig. 4.3: Activity and lying time in oestrus cycle of a test cow<br />
II Fachlicher Teil 39<br />
Die Neuentwicklung eines ALT- Pedometers (Aktivität/activity<br />
– Liegezeit/lying time – Temperatur/<br />
temperature) zur Aktivitäts- und Liegezeiterfassung<br />
für eine sichere Brunsterkennung und frühzeitige<br />
Erkennung von Tiererkrankungen ist abgeschlossen.<br />
An einem allgemeingültigen Algorithmus für<br />
Aktivität und Liegezeit wird gearbeitet. Durch die<br />
kontinuierliche und automatische Erfassung, Übertragung<br />
und Bearbeitung der Einzeltierdaten -<br />
Aktivität, Liegezeit und Umgebungstemperatur - im<br />
Tagesverlauf ist eine erfolgreiche und schnelle<br />
Einflussnahme auf das Fruchtbarkeits- und Gesundheitsgeschehen<br />
<strong>des</strong> Einzeltieres im Herdenmanagement<br />
möglich.<br />
Abweichungen vom Normalverlauf der Messparameter<br />
werden im Tagesverlauf der Grafik sichtbar<br />
und automatisch angezeigt.<br />
Das ALT - Pedometers ist mit vier verschiedene<br />
Sensoren zur Messung der unterschiedlichen Parameter<br />
bestückt. Ein analoger Sensor zur Erfassung<br />
der Aktivität, zwei Sensoren zur digitalen<br />
Erfassung der Liegezeit <strong>des</strong> Tieres und ein Temperatursensor<br />
zur Messung der Umgebungstemperatur.<br />
Aus den laufenden Auswertungen werden<br />
erste nachfolgende Ergebnisse mitgeteilt. Bild 4.3<br />
zeigt die eindeutige Korrespondenz (Abhängigkeit)<br />
von Tieraktivität und Liegezeit während der Brunst<br />
eines Rin<strong>des</strong>. /33/, /98/, /99/, /340/<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
40<br />
Anwendungspotential bildgebender Verfahren<br />
im NIR- und MIR-Bereich für das Management<br />
von Rinderherden (Projek-Nr. 2.30)<br />
Application potential of NIR- and MIR-imaging<br />
for cattle management<br />
Hans Jürgen Hellebrand (Abt. 2), Ulrich Brehme<br />
(5), Horst Beuche (2), Ulrich Stollberg (5)<br />
Förderung: Haushalt<br />
The aim of this project is to find out application<br />
possibilities of thermal imaging in the field of health<br />
diagnostics and tasks in livestock management like<br />
oestrus detection. The results show that the good<br />
insulating skin makes it difficult to recognise gravidity<br />
and sickness due to changed skin temperature<br />
of the body. On the other hand, less insulated<br />
skin parts like pudendum and udder reflect temperature<br />
changes of the cow tissue. Thus, oestrus<br />
diagnostics is principally possible by infrared imaging<br />
and infrared thermometry. As the accuracy of<br />
IR-measurements does not exceed the traditional<br />
way of temperature measurements, it remains an<br />
open question, if IR-oestrus diagnostics will become<br />
a routine method in the future. The easy IRmeasurement<br />
of udder and teats skin temperature<br />
makes it possible to utilise thermal imaging for the<br />
evaluation of the impacts of milking machines on<br />
the teats and udder. Images were taken before<br />
(Fig. 4.4) and after milking (Fig. 4.5). Milking<br />
forces influence the blood circulation and thus the<br />
skin temperature. The measured temperature distribution<br />
across the teats can therefore be used to<br />
analyse the effects on the teats and the quality of<br />
the milking process.<br />
Im Rahmen diese Projektes war zu untersuchen,<br />
ob die thermografische Messung der Hauttemperatur<br />
als eine zusätzliche Messmethode zur Einzeltierdiagnostik<br />
und zum Herdenmanagement eingesetzt<br />
werden kann. Aus der Literatur war bekannt,<br />
dass die Thermografie bei der medizinischen<br />
Untersuchung <strong>des</strong> Menschen als ergänzen<strong>des</strong><br />
Verfahren heran gezogen wird und bei ausgewählten<br />
Tieren für veterinärmedizinische Fragestellungen<br />
in Zoologischen Gärten erfolgreich getestet<br />
wurde. In Verbindung mit der Überwachung<br />
von Flugpassagieren hat dieses berührungslose<br />
Messsystem im Jahr <strong>2003</strong> für Schlagzeilen gesorgt.<br />
Die Untersuchungen im letztem Jahr führten zu<br />
der Erkenntnis, dass die gute thermische Isolierung<br />
<strong>des</strong> Fells eine Schnelldiagnostik hinsichtlich<br />
Trächtigkeit und Körpertemperatur verhindert.<br />
Prinzipiell kann die Temperatur zur Östrusbestimmung<br />
für die künstliche Besamung in der Milchviehhaltung<br />
an der äußeren Scheidenwand ermittelt<br />
werden. Die thermografisch ermittelte Temperatur<br />
reflektiert den Verlauf der Körperkerntempe-<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Umweltverträgliche und tiergerechte Haltung<br />
ratur, das Verfahren bietet jedoch keine höhere<br />
Genauigkeit gegenüber traditionellen Messungen<br />
und ist zu aufwendig für Milchviehbetriebe. Inwieweit<br />
künftig IR-Thermometer in die veterinärmedizinische<br />
Praxis (z.B. für die Brunstzyklusanalyse)<br />
Eingang finden werden, bleibt offen.<br />
Entzündete Euter und Änderungen der Zitzentemperaturen<br />
können im Thermobild gut dargestellt<br />
werden. Deshalb wurde in Studien zur Wirkung<br />
von Melkanlagen auf Zitzen das thermografische<br />
Messsystem eingesetzt. Mit den Thermoaufnahmen<br />
wurde die Zitzenoberflächentemperatur vor<br />
(Bild 4.4) dem Ansetzen <strong>des</strong> Melkzeuges und<br />
nach (Bild 4.5) der Melkzeugabnahme erfasst. Die<br />
Oberflächentemperaturverhältnisse an der Zitze<br />
sind in der Thermoaufnahme deutlich zu erkennen.<br />
Damit konnte die Thermografie in die Bewertung<br />
der Melktechnik und <strong>des</strong> Melkens einbezogen<br />
werden. Eine unterschiedliche Durchblutung <strong>des</strong><br />
Zitzengewebes wird in Temperaturdifferenzen<br />
sichtbar und erlaubt konkrete Rückschlüsse auf<br />
Fehler beim Melken oder eine nicht funktionstüchtige<br />
Melktechnik. /106/, /107/, /108/, /109/, /135/,<br />
/136/, /228/, /229/, /230/, /231/, /234/, /358/, /359/<br />
Bild 4.4: Infrarotbild der Zitzen vor dem Melken<br />
Fig. 4.4: Infrared image of teats before milking<br />
Bild 4.5: Infrarotbild der Zitzen nach dem Melken<br />
Fig. 4.5: Infrared image of teats after milking
Parameter der Mastitisprüfung bei Milchkühen<br />
– physiologische Zusammenhänge und analytische<br />
Möglichkeiten (Projekt-Nr.: 5.28)<br />
Parameter for a mastitis test from milk cows –<br />
physiological connection and analytic opportunity<br />
Ines Krehl (Abt. 5), Reiner Brunsch (5)<br />
Förderung: Haushalt<br />
The economical damage for the farmer caused by<br />
mastitis ranges between 15 and 200 €/animal and<br />
year. During an udder damage the blood-milk barrier<br />
will be more open for the exchange of lactose<br />
and potassium (K + ) from milk into blood as well as<br />
for chloride (Cl - 9) and sodium (Na + ) from blood into<br />
milk. This process causes the decrease of the<br />
osmotic pressure in the milk. To maintain the pressure<br />
in the udder at the same level lactose and K +<br />
will be replaced by Na + and Cl - . As a result the<br />
concentration of Na + and K + in the milk will rise<br />
whereby the concentration of lactose and potassium<br />
will decrease. The blood sees an opposite<br />
development, increasing lactose and K + and decreasing<br />
Na + and Cl - concentrations. The ions Na + ,<br />
Cl - and K + are components influencing the electrical<br />
conductivity.<br />
Based on the knowledge about the processes at<br />
the blood milk barrier and the information derived<br />
from actual udder health parameters a new measurement<br />
idea has been developed. The separate<br />
measurement of Na + and K + in foremilk and in<br />
blood to determine a beginning mastitis. The<br />
evaluation of a data basis and the establishing of<br />
threshold values for the different parameters will<br />
be necessary to establish new measurement methods.<br />
The new device will have to measure Na + and<br />
K + during the milking process for each quarter and<br />
determine udder changes. Investigations showed<br />
that during udder changes Na + and electrical conductivity<br />
decreases and K + increases in the milk.<br />
Eine Euterveränderung frühzeitig zu erkennen,<br />
liegt im großen Interesse eines jeden Landwirtes,<br />
da sich die Ausfallrate bei Mastitis in Deutschland<br />
auf 150 bis 200 € pro Kuh und Jahr beläuft. Bei der<br />
Schädigung <strong>des</strong> Euters kommt es zur Lockerung<br />
der Blut-Milch-Schranke, wodurch bestimmte Stoffe<br />
aus der Milch ins Blut (Laktose, Kalium (K + )) und<br />
umgekehrt aus dem Blut in die Milch (Chlorid (Cl - ),<br />
Natrium (Na + )) wandern. Mit dem Auswandern der<br />
Laktose und K sinkt der osmotische Druck in der<br />
Milch. Um den Druck in der Milch aufrecht zu erhalten,<br />
treten zeitgleich an die Stelle von Laktose<br />
und K die Ionen Na + und Cl - . Somit werden bei<br />
einer Euterveränderung erhöhte Na + - und Cl - - und<br />
II Fachlicher Teil 41<br />
erniedrigte Laktose- und K + -Werte in der Milch<br />
gemessen. Umgekehrt ist dies im Blut feststellbar.<br />
Die Ionen Na + , Cl - und K + beeinflussen die elektrische<br />
Leitfähigkeit (LF).<br />
Aufgrund der physikalisch-chemischen Vorgänge<br />
an der Blut-Euter-Schranke und der unzureichenden<br />
Aussagekraft derzeit angewandter Eutergesundheitsparameter<br />
ergab sich die Aufgabenstellung,<br />
die Ionen Na + und K + einzeln im Vorgemelk<br />
zu betrachten. Hierbei bestand zum einen die Zielstellung,<br />
eine Datenbasis und einen Schwellwert<br />
zu ermitteln, ab wann eine Euterveränderung signalisiert<br />
wird. Mit Hilfe dieser Datenbasis kann eine<br />
Messsonde ausgelegt werden, die während <strong>des</strong><br />
Melkvorganges viertelgetrennte Messungen vornimmt.<br />
Die Bestimmung von Na + und K + in der Milch und<br />
im Blut erfolgte mit dem Atomabsorptionsspektrometer<br />
(AAS vario 6, Jena-Analytik). Parallel dazu<br />
wurde die Leitfähigkeit in der Milch bestimmt. Die<br />
Bestimmung der Zellzahlen in der Milch erfolgte<br />
mit dem Gerät Fossomatik (Foss-Electric, Dänemark).<br />
Die Laborergebnisse zeigten, dass bei einer Erhöhung<br />
von Na + zeitgleich eine Verringerung von K +<br />
in der Milch einhergeht. /374/<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
42<br />
Reduzierung der Euterbelastung beim Melkprozess<br />
durch technische Veränderungen am<br />
Melkzeug (Projekt-Nr.: 5.29)<br />
Reduction of udder stress during milking time,<br />
through technique change at the milking units<br />
Sandra Rose (Abt. 5), Reiner Brunsch (5), Eike<br />
Scherping (5)<br />
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG)<br />
Förderung: Haushalt<br />
A high number of dairy farms have problems with<br />
udder health. This is due to incorrect placed support-arms,<br />
milking units and tubes that transmit<br />
different forces to the teats. In order to develop an<br />
udder-gently milking process, force measurements<br />
were carried out at the <strong>ATB</strong>. For measuring these<br />
forces, the DLG has developed a test machinery<br />
which works using elastic measuring-stripes. In<br />
order to determine the influence of the resulting<br />
forces by the milker or the milking technique, different<br />
measuring types were applied. As a result<br />
we ascertained that the milkers have main influence<br />
on turning forces (Fig. 4.6). A second result<br />
showed that there are big differences between the<br />
milking places in one milking parlour. The results<br />
should help to develop a udder-gently milking cluster<br />
in the future. In a second project, different influences<br />
on vacuum stability in milking parlours were<br />
examined. Vacuum stability was found important to<br />
herd health and milking efficiency. Wet-test<br />
method was applied for analysing the dynamic<br />
behaviour of periodic disturbances in milking machine<br />
vacuum systems. After testing the influence<br />
of different milk-flows, first results indicate differences<br />
in vacuum behaviour.<br />
Die Anzahl der eutererkrankenden Milchkühe hat<br />
seit Jahren ein stagnieren<strong>des</strong> hohes Niveau erreicht.<br />
Dies bedeutet, obwohl die Technisierung<br />
im Melkstand stark zugenommen hat, ist keine<br />
merkliche Verbesserung <strong>des</strong> Eutergesundheitsstatus<br />
zu erzielen gewesen! Eine mögliche Ursache<br />
stellt die technische Gestaltung der Melkzeuge<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Umweltverträgliche und tiergerechte Haltung<br />
dar. Die Melktechnik sollte weiter entwickelt werden,<br />
um unerwünschte Belastungen durch Kräfte<br />
am Euter, welche durch das Melkzeug verursacht<br />
werden, weitgehend ausschalten zu können. Messungen<br />
dazu erfolgen am <strong>ATB</strong> mit Hilfe eines<br />
Prüfstan<strong>des</strong>, welcher von der DLG entwickelt wurde.<br />
Es werden zwei Einflussfaktoren untersucht.<br />
Zum einen der Einfluss der Technik (z. B. Konstruktion<br />
<strong>des</strong> Melkzeuges u. a.). Dabei konnten<br />
bisher deutliche Unterschiede zwischen den Melkplätzen<br />
eines Melkstan<strong>des</strong> festgestellt werden.<br />
Des Weiteren liegt eine unzureichende Anpassung<br />
der Melkzeuge bei stufigem Euter vor. Um die<br />
Kräfte zu reduzieren, wird an der Entwicklung eines<br />
Melkzeuges mit veränderter Konstruktion gearbeitet.<br />
Als ein weiterer Einflussfaktor wurde die<br />
Bedeutung <strong>des</strong> Melkers untersucht. Hierbei war zu<br />
erkennen, dass eine korrekte Ausrichtung <strong>des</strong><br />
Melkzeuges und der Positionierungshilfe durch<br />
den Melker von großer Bedeutung ist (Bild 4.6.).<br />
Eine weitere Ursache für Eutergesundheitsprobleme<br />
stellen die Vakuumschwankungen in Melkanlagen<br />
dar. Durch ein oftmals zu hohes Vakuum in<br />
Zitzennähe, verursacht durch sogenannte Impacts,<br />
kommt es zu starken Belastungen <strong>des</strong> Zitzengewebes.<br />
Problematisch kann ebenso ein zu starker<br />
Vakuumabfall sein, welcher oftmals durch zu klein<br />
dimensionierte Leitungswege verursacht wird.<br />
Ziel ist es, das Vakuum in den Melkanlagen konstant<br />
zu halten, indem verschiedene Melkzeugfabrikate<br />
sowie Schlauchlängen und Durchmesser<br />
getestet werden. Die Messungen erfolgen mit Hilfe<br />
der Nassmessmethode sowie der Bovi Press-<br />
Messtechnik der Firma A & R Trading. Hierbei<br />
können mit Hilfe von Kanülen, welche an verschiedenen<br />
Punkten <strong>des</strong> Melksystems eingestochen<br />
werden, die Vakuumverhältnisse ermittelt werden.<br />
Erste Ergebnisse zeigen, dass mit steigendem<br />
Milchfluss das Vakuum in den Milchschläuchen<br />
abfällt, sofern der Innendurchmesser <strong>des</strong> Schlauches<br />
gleich ist. Dies stellt ein Problem bei den<br />
ständig steigenden Milchflüssen der Hochleistungskühe<br />
dar. /129/<br />
Bild 4.6: Mittlere Drehkraft an den hinteren<br />
und vorderen Zitzen bei verschiedenen Melkern<br />
und stufiger Euterform in unterschiedlichen<br />
Betrieben<br />
Fig. 4.6: Average turning force at back and<br />
front teats by different milkers and stuffy udder<br />
form in different farms
Untersuchungen zum Einfluss der Melktechnik<br />
auf die Qualität <strong>des</strong> Melkens (Projekt-Nr.: 37/01)<br />
Research into the influence of milking machines<br />
on the quality of milking<br />
Ulrich Brehme (Abt. 5), Sandra Rose (5)<br />
VUZT Prag/CZ; Agrargenossenschaft Friedland<br />
Förderung: BMVEL; Haushalt<br />
The subject of the co-operation is the more effective<br />
use of a specialized, complex and expensive<br />
measuring technique as well as the improvement<br />
on and co-ordination of research capacities in the<br />
field of udder-gentle milk extraction up to standard.<br />
Analyses and investigations for the optimization of<br />
the arrangement of the process of milking and the<br />
technological classification of AMS (automatic<br />
milking systems) into milk production plants of<br />
different size are carried out. It is aim to enlarge<br />
existing knowledge and to include the influences of<br />
milking plants on milk quality and udder health.<br />
According to a greater consumer safety and higher<br />
acceptance of food from the keeping of animals<br />
the common research plan is of a high topicality<br />
also from the aspect of the EU joining of Czechia.<br />
Gegenstand der Zusammenarbeit ist die effektivere<br />
Nutzung spezialisierter, aufwendiger und teurer<br />
Messtechnik sowie die Verbesserung und Koordinierung<br />
von Forschungskapazitäten auf dem Gebiet<br />
der qualitätsgerechten, euterschonenden<br />
Milchgewinnung. Analysen und Untersuchungen<br />
zur Optimierung der Gestaltung <strong>des</strong> Melkprozesses<br />
und der technologischen Einordnung von AMS<br />
(automatische Melksysteme) in Milchproduktionsanlagen<br />
unterschiedlicher Größe werden durchgeführt.<br />
Ziel ist es vorhandene Erkenntnisse zu erweitern<br />
und die Einflüsse von Melkanlagen auf<br />
Milchqualität und Eutergesundheit zu erfassen. Im<br />
Sinne einer größeren Verbrauchersicherheit und<br />
höheren Akzeptanz von Nahrungsmitteln aus der<br />
Tierhaltung ist das gemeinsame Forschungsvorhaben<br />
auch unter dem Aspekt <strong>des</strong> EU-Beitritts<br />
Tschechiens von hoher Aktualität.<br />
Im ersten Treffen wurde eine Präzisierung der<br />
Messmethodik bezüglich der Unterdruckverhältnisse<br />
in Melkanlagen, der Durchflusskurven <strong>des</strong><br />
Messmediums und der Melkintensität vorgenommen.<br />
Weitere Abstimmungspunkte waren die Präzisierung<br />
der Einstellung und Regulierung der<br />
Parameter von Melkanlagen (Melkaggregaten), die<br />
Untersuchungen der Eigenschaften von Zitzengummis<br />
und ihre Wirkung auf die Zitze (Druckverhältnisse)<br />
und die Möglichkeiten <strong>des</strong> Einsatzes der<br />
Infrarotthermografie bei der Zitzenbelastung im<br />
Melkprozess.<br />
II Fachlicher Teil<br />
Erste Vakuummessungen erfolgten am Versuchsmelkstand<br />
<strong>des</strong> <strong>ATB</strong> mit veränderten Milchflussverhältnissen.<br />
Diese wurden am Melkzeug "Classic"<br />
(Westfalia) und am Melkzeug "Harmony Plus" (De-<br />
Laval) vorgenommen. Dabei wurden unterschiedliche<br />
Messpunkte einbezogen, verschiedene Pulsfrequenzen<br />
bei einem Saug-/Druckphasenverhältnis<br />
von 60 : 40 getestet. Der Milchfluss wurde pro<br />
Gemelk zwischen 1 bis 8 kg variiert, das Anlagenvakuum<br />
in den Varianten 50, 45 und 40 kPa variiert.<br />
Für die Untersuchungen in der Agrargenossenschaft<br />
Friedland standen insgesamt drei Melkboxen<br />
– ZENITH der Firma Gascoigne/ Melotte –<br />
in Form einer Ein- bzw. einer Zweiboxenvariante<br />
zur Verfügung. In der Einzelbox wurden Messungen<br />
zu Zug- und Drehkräften am Melkzeug vorgenommen.<br />
In der Doppelbox erfolgten an 20 Kühen<br />
Arbeitszeitstudien zum Melkverlauf. Die Teilzeitstudien<br />
wurden mit Thermoaufnahmen zur Zitzenoberflächentemperatur<br />
für drei Bereiche (Zitzenspitze,<br />
Zitzenmitte, Zitzengrund) vor dem Ansetzen<br />
und nach der Melkzeugabnahme gekoppelt. Der<br />
Einsatz der Infrarottechnik macht die Oberflächentemperaturverhältnisse<br />
an der Zitze sichtbar. Damit<br />
wird eine Bewertung der Melktechnik und <strong>des</strong><br />
Melkens ermöglicht. Eine unterschiedliche Durchblutung<br />
<strong>des</strong> Zitzengewebes wird in Temperaturdifferenzen<br />
sichtbar und erlaubt konkrete Rückschlüsse<br />
auf Fehler beim Melken oder eine nicht<br />
funktionstüchtige Melktechnik. Gleichgelagerte<br />
Untersuchungen sollen im Frühjahr 2004 in tschechischen<br />
Großbetrieben mit einheimischer und<br />
Fullwood-Melktechnik durchgeführt werden. Das<br />
Datenmaterial befindet sich in der Auswertung.<br />
43<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
44<br />
5 Qualität und Wettbewerbsfähigkeit bei der<br />
Ernte und in der Nachernteperiode leichtverderblicher<br />
Produkte (Forschungsschwerpunkt<br />
5)<br />
Quality and competitiveness in the harvest<br />
and post-harvest period for perishable products<br />
(Koordinator: Martin Geyer, Abt. 6)<br />
Produktqualität und Nahrungsmittelsicherheit in<br />
allen Stufen der Wertschöpfungskette sind in den<br />
letzten Jahren aufgrund verschiedener Lebensmittelskandale<br />
aber auch wegen geänderter Verbrauchererwartungen<br />
europaweit in den Mittelpunkt<br />
<strong>des</strong> Interesses gerückt. Qualität und Sicherheit<br />
spielen gerade bei leicht verderblichen Produkten<br />
wie Obst, Gemüse und Kartoffeln eine außerordentliche<br />
Rolle. Frischecharakter und ernährungsphysiologische<br />
Aspekte führen dazu, dass sie<br />
neben dem Preis ganz oben in der Verbraucherpräferenz<br />
rangieren. Daher und insbesondere<br />
aufgrund einer geänderten Gesetzgebung (Produkthaftungsgesetz)<br />
geht der Handel immer mehr<br />
dazu über, sich Qualität und Sicherheit durch Zertifikate<br />
von den Erzeugern nachweisen zu lassen.<br />
Allerdings stehen hierfür nicht immer geeignete,<br />
klar definierte und objektiv messbare Parameter<br />
oder Methoden bereit. Oft fehlt es an geeigneten,<br />
präzisen und flexible Messsystemen. Produktsicherheit,<br />
Produktqualität und Qualitätserhaltung<br />
lassen sich in vielen Fällen auch durch Optimierung<br />
der gesamten Verfahrenstechnik sowie der<br />
Arbeitsabläufe verbessern.<br />
Im Berichtsjahr <strong>2003</strong> waren im Forschungsschwerpunkt<br />
5 (FSP 5) wieder eine Vielzahl von<br />
Forschungsaktivitäten in den genannten Bereichen<br />
zu verzeichnen, deren Ergebnisse in nationalen<br />
und internationalen Vorträgen, Postern und Veröffentlichungen<br />
publiziert wurden.<br />
Der FSP 5 wird von Wissenschaftlern aus den<br />
Abteilungen 1, 2, 3 und 6 interdisziplinär bearbeitet,<br />
und lässt sich in die drei Teilgebiete Produkteigenschaften,<br />
Verfahrenstechnik und Mensch und<br />
Arbeit aufgliedern.<br />
"Physiologische und physikalische Produkteigenschaften"<br />
Dieses Teilgebiet hat sich zum Ziel gesetzt, die<br />
spezifischen physiologischen und qualitätsrelevanten<br />
physikalischen Eigenschaften als objektive<br />
Kriterien zur Überprüfung von ausgewählten Produktgruppen<br />
zu charakterisieren und resultierend<br />
analytische Methoden abzuleiten und anwendungsgerechte<br />
Verfahrensweisen zu erarbeiten.<br />
Ein wichtiger Baustein ist dabei die Entwicklung<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
und Anpassung von Sensoren sowie ihre Applikation,<br />
insbesondere für kostengünstige, nicht <strong>des</strong>truktive<br />
und schnelle Methoden zur Qualitätsbestimmung.<br />
Als wichtigste Methoden sind hierbei<br />
die optischen Verfahren hervorzuheben, wo innerhalb<br />
der Forschergruppe umfangreiche Erfahrungen<br />
mit VIS- und NIR-Spektroskopie, Chlorophyll-<br />
Fluores-zenz-Ana-lyse und der laser-induzierten<br />
Fluoreszenzspektroskopie vorliegen.<br />
Beispielsweise konnte im Jahre <strong>2003</strong> erstmalig mit<br />
einem transportablen Funkspektrometer der Verlauf<br />
der Fruchtentwicklung und Fruchtreife von<br />
Äpfeln direkt am Baum über einen Zeitraum von<br />
sieben Wochen bis zur Ernte aufgezeichnet werden.<br />
Diese Information kann für das exakte<br />
Bestimmen <strong>des</strong> optimalen Erntezeitpunktes genutzt<br />
werden, um u.a. verbesserte Auslagerungsergebnisse<br />
der Früchte zu erzielen.<br />
Verpackte frische Gemüse, Früchte oder Salate<br />
sind auch in der Verpackung weiter physiologisch<br />
aktiv. Diese Aktivität wird von Umgebungsbedingungen,<br />
wie z.B. Temperatur und Licht, beeinflusst.<br />
Wie Ergebnisse belegen, kann sich eine<br />
gezielte Belichtung mit Beleuchtungsstärken, wie<br />
sie im Lebensmitteleinzelhandel vorliegen, positiv<br />
auf die Qualität photosynthetisch aktiver Produkte<br />
auswirken, den Alterungs- und Verderbsprozess<br />
verlangsamen und die Haltbarkeit von verpacktem<br />
Blatt- und Mischsalat verlängern.<br />
"Bewertung und Optimierung verfahrenstechnischer<br />
Prozesse"<br />
Die meisten Obst- und Gemüsearten, aber auch<br />
Kartoffeln sind extrem empfindlich gegenüber mechanischen<br />
Belastungen, und weisen ein hohes<br />
Verderbsrisiko bei Mikrobenbefall auf. Insbesondere<br />
Beerenobst und Gemüse unterliegen durch<br />
hohe Transpirations- und Atmungsraten einem<br />
hohen Verlustrisiko. Diese Produkte verlangen<br />
daher spezifische, Verfahren der Ernte, Aufbereitung<br />
und Lagerung.<br />
Große Fortschritte wurden gemeinsam mit zwei<br />
Industriepartnern bei der Erfassung von Stoßbelastungen<br />
mit Hilfe eines „elektronischen Implantats“<br />
erzielt. Auf der Grundlage kommerzieller Bausteine<br />
wurde eine mikroprozessorgesteuerte Elektronikeinheit<br />
entwickelt, welche in eine Kartoffel<br />
implantiert wurde und die Daten auch unter den<br />
schwierigen Bedingungen der Kartoffelsortierung<br />
und -verpackung zuverlässig zu einem tragbaren<br />
Empfänger überträgt.<br />
Die Umsetzung der Erfahrungen mit der Bewertung<br />
mechanischer Belastungen erfolgte in einem<br />
Projekt zur direkten Behälterbefüllung von Kartoffeln<br />
(Großkisten) auf der Erntemaschine. Durch
Bonitur und über Bestimmen der Atmungsintensität<br />
konnte eindeutig der Vorteil <strong>des</strong> neuen schonenden<br />
Verfahrens belegt werden.<br />
Durch Nutzung eines bildgebenden thermographischen<br />
Messverfahrens zur Klimasteuerung kann<br />
die nachfolgende Lagerung in Großkisten in einem<br />
„konvektiven“ Lager noch zusätzlich optimiert werden,<br />
wie neue Ergebnisse zeigen.<br />
Verschmutztes Gemüse und Kartoffeln müssen<br />
schonend und wassersparend gewaschen werden.<br />
Gestützt auf grundlegende Untersuchungen konnte<br />
für die Wäsche mit Düsen nachgewiesen werden,<br />
dass sich durch den Austausch der bisher<br />
verwendeten Agrardüsen durch optimale Industriedüsen<br />
die Reinigungszeit bzw. die erforderliche<br />
Düsenanzahl bei gleicher Anordnung sowie gleichem<br />
Abstand, Spritzdruck und Reinigungsgrad,<br />
um bis zu 75 % reduzieren lassen.<br />
Für die Gewährleistung von Hygiene und Produktsicherheit<br />
wurden im Rahmen eines weiteren<br />
Drittmittelprojektes Untersuchungen mit ozontem<br />
Waschwasser durchgeführt. Hiermit ist es möglich,<br />
bei oder nach der Wäsche, eine schonende Hygienisierung<br />
an der Oberfläche von Schnittsalaten<br />
zu realisieren. Wie Untersuchungen im Jahr <strong>2003</strong><br />
zeigten, verhalten sich Keime und Keimmischungen<br />
auf der Salatoberfläche anders als in Lösung.<br />
Des weiteren wurde festgestellt, dass ein dem<br />
Waschen mit ozontem Wasser vorgeschalteter<br />
Waschgang mit Leitungswasser die Ozonwirkung<br />
deutlich verbessert.<br />
<strong>2003</strong> wurden zwei durch das BMVEL finanziell<br />
unterstützte Projekte zum ökologischen Landbau<br />
abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich<br />
Bioprodukte in Ihrem Nachernteverhalten nicht<br />
grundlegend von konventionellen Produkten unterscheiden.<br />
Allerdings deuten die Versuchsreihen<br />
darauf hin, dass mikrobielle Aktivitäten einen weitaus<br />
größeren Einfluss auf die Nacherntequalität<br />
und Verkaufsfähigkeit von ökologisch erzeugten<br />
Produkten ausüben können, als zunächst angenommen<br />
wurde.<br />
Des weiteren konnte entlang der gesamten Wertschöpfungsketten<br />
im Hinblick auf die Qualitätserhaltung<br />
ökologischer Produkte in der Nacherntephase<br />
ein beachtliches Optimierungspotential festgestellt<br />
werden. Als besondere Schwachstellen<br />
wurden hierbei die verschiedenen Qualitätsbilder<br />
der „Akteure“, mangelhafte technische Ressourcen,<br />
wenig aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe<br />
sowie ungenügende Nachfrage durch den Verbraucher<br />
identifiziert.<br />
Lösungsansätze ergeben sich aus einer verbesserten<br />
Kommunikation aller Marktbeteiligten sowie<br />
der, qualifizierten Mitarbeiter auf allen Ebenen,<br />
einer Orientierung der Arbeitsabläufe an den Er-<br />
II Fachlicher Teil 45<br />
fordernissen eines lebendigen und stoffwechselnden<br />
Produktes, inklusive der Sicherung einer geschlossenen<br />
Kühlkette. Als notwendig erachtet<br />
werden weiterhin verstärkte Anstrengungen zur<br />
Förderung der Nachfrage.<br />
"Mensch und Arbeit"<br />
Handarbeit spielt in der Landwirtschaft und insbesondere<br />
im Gartenbau auch zukünftig eine bedeutende<br />
Rolle. Das Teilgebiet "Mensch und Arbeit"<br />
widmete sich daher der Verbesserung der Arbeitsbedingungen<br />
an gartenbaulichen Arbeitsplätzen.<br />
Die dreidimensionale digitale Bewegungsanalyse<br />
ermöglicht es dabei, Arbeitsabläufe objektiv zu<br />
bewerten. Mit Hilfe der im Rahmen eines DFG-<br />
Projektes am <strong>ATB</strong> entwickelten Software ist es nun<br />
auch möglich, nicht nur Arbeitszeiten, sondern<br />
auch einzelne Bewegungen exakt zu vergleichen<br />
und damit Arbeitsplätze zu bewerten, und ggf.<br />
bereits in der Vorentwicklung zu optimieren. Im<br />
Versuchsjahr <strong>2003</strong> lag der Schwerpunkt auf der<br />
Erarbeitung geeigneter Beurteilungskriterien zur<br />
ergonomischen Bewertung von Arbeitsplätzen.<br />
Ungünstige Körperhaltungen, repetitive und monotone<br />
Arbeitsabläufe sind kennzeichnend für die<br />
Arbeitsbedingungen von einfachen Ernte- und<br />
Aufbereitungstätigkeiten im Gartenbau und resultieren<br />
in einer hohen Belastung für die Arbeitskraft.<br />
Ein praktisches Beispiel für Handarbeit im Gartenbau<br />
ist das Stechen von Bleichspargel. Der Vergleich<br />
der Arbeitsabläufe bei Handernte und teilmechanisierten<br />
Ernteverfahren verdeutlicht den<br />
zeitlichen Vorteil der Teilmechanisierung, insbesondere<br />
durch Wegfall <strong>des</strong> Folienhandlings bzw.<br />
der Transportarbeiten. Mehrreihige Erntesysteme<br />
mit großer Folienaushebelänge erfordern einen<br />
wesentlich geringeren Arbeitsaufwand je Hektar<br />
als die konventionelle Handernte.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
46<br />
Projekte zum Forschungsschwerpunkt 5<br />
Arbeitsgebiet: "Physiologische und physikalische<br />
Produkteigenschaften"<br />
Physiologische Eigenschaften gartenbaulicher<br />
Produkte in der Nachernte (Projekt-Nr.: 6.22)<br />
Postharvest physiological properties of horticultural<br />
products<br />
Werner B. Herppich (Abt. 6), Manuela Zude (6),<br />
Manfred Linke (6)<br />
SzIE Univ. Budapest (Ungarn); Uni Potsdam; KU<br />
Leuven (B); Uni Lund (S); IGZ; HU Berlin; LVA<br />
Großbeeren; Praxisbetriebe<br />
Förderung: Haushalt<br />
High quality sweet pepper (Capsicum annuum L.)<br />
fruits are characterized by high sugar and vitamin<br />
contents, and satisfactory fruit firmness and colour.<br />
To optimise postharvest handling, the interactions<br />
between packaging, storage conditions, and physiology<br />
of ripening, senescence and decay must be<br />
known. In collaboration with the SzIE Budapest<br />
(Hungary) the effects of different storage conditions<br />
on the quality of two Hungarian paprika varieties,<br />
the red Kapia F1 and the white Ho F1 were<br />
analysed. Fruits, unpacked or sealed in LDPE<br />
plastic bags, were stored at 10 °C and 20 °C and<br />
changes in mass, mechanical properties, shape<br />
and colour, partial transmittance properties, chlorophyll<br />
fluorescence, respiration and transpiration,<br />
total soluble solid content and water relations were<br />
monitored using non-<strong>des</strong>tructive and <strong>des</strong>tructive<br />
methods.<br />
In green-ripe paprika varieties, colour measurements<br />
help to determine quality changes due the<br />
enhanced fruit maturation under inadequate storage<br />
temperatures. Colour changes are not necessarily<br />
accompanied by a decline in fruit quality. Degreening<br />
of Ho fruits is caused by a complete deactivation<br />
and degradation of chlorophylls (Fig.<br />
5.1). Inspection of the potential photochemical<br />
efficiency of fruit bodies and stalks showed that the<br />
latter fruit parts are a good indicator of postharvest<br />
stress in both varieties. Storage of packed paprika<br />
under low, non-chilling temperature improves<br />
keeping quality. Even after 30 days, fruits retained<br />
a high quality. Packing prevents mass losses and<br />
reduction of stiffness, but only low temperatures<br />
impede un<strong>des</strong>irable maturation.<br />
Qualitativ hochwertige Paprikafrüchte (Capsicum<br />
annuum L.) besitzen einen hohen Zucker- und<br />
Vitamingehalt und eine optimale Festigkeit und<br />
Farbe. Die Fruchtqualität kann nur bei richtiger<br />
Lagerung erhalten bleiben. Um die Nachernte<br />
optimieren zu können, ist die genaue Kenntnis der<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
Interaktionen zwischen Verpackung, Lagerklima<br />
und der Physiologie von Reife, Seneszenz bzw.<br />
Verderb von Nöten. Zusammen mit der SzIE Budapest<br />
(Ungarn) wurden die Einflüsse verschiedener<br />
Lagerbedingungen auf die Qualität der zwei<br />
ungarischen Paprikasorten, Kapia (rot) und Ho<br />
(grünreif), untersucht. Früchte beider Sorten wurden<br />
unverpackt bzw. in Plastiktüten (LDPE) verschweißt,<br />
bei 10 °C bzw. 20 °C gelagert. Änderungen<br />
der Masse, der mechanischen Eigenschaften,<br />
der Farbe, der partiellen Transmissionseigenschaften,<br />
der Chlorophyllfluoreszenz, der Atmung und<br />
Transpiration, <strong>des</strong> Gehaltes an gelösten Substanzen<br />
und <strong>des</strong> Wasserzustan<strong>des</strong> wurden mit <strong>des</strong>truktiven<br />
und nicht-<strong>des</strong>truktiven Methoden verfolgt.<br />
Für grünreife Paprikasorten bietet die Farbmessung<br />
eine schnelle Methode um Änderungen der<br />
Qualität durch beschleunigte Reife bei ungenügenden<br />
Temperaturen festzustellen. Eine Farbänderung<br />
geht aber nicht notwendiger Weise mit der<br />
Verringerung der Fruchtqualität einher. Bei der<br />
Sorte Ho ist die Farbänderung auf die vollständige<br />
Deaktivierung und den Abbau <strong>des</strong> Chlorophylls<br />
zurückzuführen (Bild 5.1). Bei beiden Sorten ist<br />
die Messung der potentiellen photochemischen<br />
Effizienz der Fruchtstiele ein guter Indikator von<br />
Nacherntestress. Bei 10 °C gelagert, bleiben verpackte<br />
Paprikafrüchte auch 30 Tage frisch. Ohne<br />
negativen Einfluss auf andere Qualitätsmerkmale<br />
behindert die Verpackung den Masseverlust durch<br />
Transpiration und ein Weichwerden der Früchte,<br />
niedrige Temperaturen können die bei grünreifen<br />
Paprikasorten unerwünschte weitere Reifung vermindern.<br />
/77/, /78/, /145/, /146/, /147/, /272/, /273/,<br />
/274/, /275/, /354/, /365/, /366/, /404/<br />
Potentielle photochemische Effizienz<br />
Potential photochemical efficiency<br />
0.30<br />
0.25<br />
0.20<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
10°C verpackt<br />
packaged<br />
10°C offen<br />
ope n<br />
20°C verpackt<br />
packaged<br />
20° offen<br />
ope n<br />
Ho<br />
Kapia<br />
Fruchtkörper<br />
Fruit body<br />
0 2 20 22 24 26 28 30<br />
Dauer der Lagerung (d)<br />
Duration of storage (d)<br />
Bild 5.1: Chlorophyllaktivität (potentielle photochemische<br />
Effizienz) verpackter und unverpackter Früchte der Sorten<br />
Ho und Kapia, gelagert bei 10 °C bzw. 20 °C.<br />
Fig. 5.1: Chlorophyll activity (potential photochemical<br />
efficiency) of packed and unpacked fruits of the variety<br />
Ho and Kapia stored at 10 °C and 20 °C.
Festigkeitseigenschaften gartenbaulicher Produkte<br />
(Projekt-Nr.: 6.19)<br />
Mechanical properties of horticultural products<br />
Bernd Oberbarnscheidt (Abt. 6), Bernd Herold (6),<br />
Martin Geyer (6), Werner B. Herppich (6), Manuela<br />
Zude (6), Manfred Linke (6), Thomas Hoffmann (3)<br />
Katholieke Universiteit Leuven (Belgien); SzIE Univ.<br />
Budapest (Ungarn); Institut für Agrartechnik Gödöllö<br />
(Ungarn); Industriepartner<br />
Förderung: Haushalt<br />
In horticulture, many effects of temperature and<br />
water status on mechanical produce properties are<br />
known. Bruising, splitting or breaking susceptibility<br />
of fresh fruits and vegetables may largely increase<br />
at low temperature and high produce water contents,<br />
implying that low temperature and a high<br />
water status reduce tissue strength. Comprehensive<br />
studies on the interactive effects of temperature<br />
and water status on texture are rare and their<br />
results are equivocal. Therefore, the fundamental<br />
interactive effects of produce temperature and<br />
water status on mechanical properties of intact<br />
taproots of carrots (Daucus carota L.) and of radish<br />
tubers (Raphanus sativus L.) have been studied.<br />
Both storage organs differ in structure and<br />
function.<br />
Water potential was measured with a pressure<br />
bomb, strength was determined as the force necessary<br />
to cut the entire tuber with a microtome<br />
knife adapted to a universal testing machine, and<br />
osmotic potential psychrometrically in expressed<br />
tissue sap. Hence, turgor could be calculated from<br />
water potential and osmotic potential. Cutting force<br />
was positively correlated with water potential and<br />
turgor in both species. Beyond wilting, the variation<br />
of cutting force with declining water potential was<br />
less pronounced. In carrot but not in radish tubers,<br />
cutting force and turgor were higher at lower tissue<br />
temperature (10°C compared to 20°C). Temperature<br />
did not clearly influence the relationship between<br />
water status and texture in radish. In contrast,<br />
tuber development led to an increase in cutting<br />
force. It seems obvious that the temperature<br />
effect on cutting force in carrots is mediated by<br />
affecting cell wall properties and not water status.<br />
Im Gartenbau sind viele Effekte von Temperatur<br />
und Wasserzustand auf die mechanischen Eigenschaften<br />
unterschiedlichster Produkte bekannt. Bei<br />
frischem Obst und Gemüse nehmen Quetschungs-,<br />
Reiß- und Bruchempfindlichkeit mit absinkender<br />
Temperatur und ansteigendem Wassergehalt<br />
zu. Das würde bedeuten, dass derartige<br />
Bedingungen die Gewebefestigkeit verringern.<br />
Umfassende Untersuchungen zur Wirkung der<br />
beiden Faktoren auf die mechanischen Produktei-<br />
II Fachlicher Teil 47<br />
genschaften sind selten und widersprüchlich in<br />
den Aussagen. Deshalb wurden die interaktiven<br />
Einflüsse von Temperatur und Wasserzustand auf<br />
die mechanischen Eigenschaften von Möhren<br />
(Daucus carota L.) und Radieschen (Raphanus<br />
sativus L.) untersucht. Beide Speicherorgane unterscheiden<br />
sich in Struktur und Funktion.<br />
Das Wasserpotential ganzer Möhren und Radieschen<br />
wurde mit einer Druckbombe bestimmt<br />
und die Schneidfestigkeit als die Kraft, die nötig<br />
war, um Knollen mit einer Mikrotomklinge, befestigt<br />
an einer Universalprüfmaschine, durchzuschneiden.<br />
An frischem Knollenpresssaft wurde danach<br />
das osmotische Potential erfasst und das Druckpotential<br />
aus der Differenz von Wasserpotential und<br />
osmotischem Potential berechnet. Die Schneidkraft<br />
war bei beiden Produkten positiv mit Wasserpotential<br />
und Druckpotential korreliert. Unterhalb<br />
<strong>des</strong> Welkepunktes änderte sich die Schneidkraft<br />
bei weiterer Abnahme <strong>des</strong> Wasserpotentials nur<br />
noch wenig. Im Gegensatz zu den Radieschen<br />
nahm bei Möhren sowohl die Schneidfestigkeit als<br />
auch das Druckpotential bei niedrigeren Temperaturen<br />
(10°C im Vergleich mit 20°C) zu. Bei Radieschen<br />
hatte die Temperatur keinen eindeutigen<br />
Einfluss auf die Beziehung zwischen Wasserzustand<br />
und Festigkeit. Dagegen nahm die Schneidkraft<br />
mit weiterer Entwicklung der Knollen zu<br />
(Bild 5.2). Zumin<strong>des</strong>t bei Möhren wirkt sich eine<br />
Temperaturänderung über die Beeinflussung der<br />
Zellwandeigenschaften und nicht <strong>des</strong> Wasserzustan<strong>des</strong><br />
auf die Schneidfestigkeit aus. /17/, /43/,<br />
/56/, /74/, /104/, /105/, /142/, /157/, /164/, /342/,<br />
/343/, /364/, /373/, /378/<br />
Schneidkraft (N)<br />
Cutting force (N)<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Radieschen<br />
Radish<br />
DC 35 - 37<br />
DC 39 - 40<br />
5 10 15 20<br />
Gewebetemperatur (°C)<br />
Tissue temperature (°C)<br />
Bild 5.2: Einfluss der Temperatur auf die Festigkeit von<br />
verkaufsfähigen (offene Säulen, DC-Stadium 35 - 38)<br />
und „überreifen“ (volle Säulen, DC 39 - 40) vollturgeszenten<br />
Radieschenknollen.<br />
Fig. 5.2: Effects of temperature on the strength of ripe<br />
(open bars; DC-stages 35 to 38) and “overripe” (filled<br />
bars; DC-stages 39 to 40) turgescent radish tubers.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
48<br />
Grundlagen der Frischemessung von Gartenbauprodukten<br />
(Projekt-Nr.: 6.31)<br />
Basics of freshness measurements of horticultural<br />
produce<br />
Manfred Linke (Abt. 6), Werner B. Herppich (6)<br />
IGZ Großbeeren/Erfurt; HU Berlin; Praxisbetriebe<br />
Förderung: Haushalt<br />
The evaluation of the developed method was carried<br />
out within the scope of experiments with sweet<br />
cherries, plums, and tomatoes, as well as with<br />
organic grown strawberries and carrots. During the<br />
last year the experiments were focused on effects<br />
of preharvest parameters on the postharvest behaviour<br />
of greenhouse grown tomatoes. Keeping<br />
quality at postharvest temperature 20°C increases<br />
with increasing EC (nutrition concentration) and<br />
increasing temperature during fruit growth. At a<br />
postharvest storage temperature of 12°C, keeping<br />
quality increases with temperature; however, it<br />
decreases with increasing EC during fruit growth.<br />
Die entwickelte Methodik zur Bewertung <strong>des</strong> Frischezustan<strong>des</strong><br />
von Obst und Gemüse auf der<br />
Grundlage einfacher Messungen wurde auf ihre<br />
Eignung für verschiedene Anwendungsszenarien<br />
der gartenbaulichen Praxis überprüft.<br />
Neben laufenden Untersuchungen zur Haltbarkeit<br />
von Kirschen und Pflaumen (siehe auch Projekt<br />
6.36) wurden Vorernteeinflüsse bei Gewächshaustomaten<br />
und das Nachernteverhalten von ökologisch<br />
erzeugten Tomaten, Erdbeeren und Möhren<br />
(siehe auch Projekt 6.42) einbezogen (Bild 5.3).<br />
Im Projekt „Grundlagen der Frischebestimmung“<br />
lag der Schwerpunkt der Arbeiten im Berichtszeitraum<br />
auf der Untersuchung von verschiedenen<br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
Vorerntebedingungen auf das Nachernteverhalten<br />
von Gewächshaustomaten. Dazu wurden die Ende<br />
2002 in Zusammenarbeit mit dem IGZ Großbeeren/Erfurt<br />
und der HUB durchgeführten, umfangreichen<br />
Versuche mit Tomaten (Variation der<br />
Nährstoffversorgung, <strong>des</strong> Kohlendioxidgehaltes<br />
der Gewächshausatmosphäre und lokaler Wärmequellen)<br />
ausgewertet. Ergänzend wurde im Frühjahr<br />
eine weitere, aufwendige Versuchsserie mit<br />
Tomaten (Variation der Vorerntetemperaturen und<br />
der Nährstoffversorgung) durchgeführt. In allen<br />
Fällen wurden als Nachernteparameter die Lufttemperatur<br />
und der Grenzschichtwiderstand zwischen<br />
dem Produkt und seiner Umgebung als Maß<br />
für die Strömungsverhältnisse (z. B. innerhalb einer<br />
Verpackung) variiert.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass unterschiedliche Vorerntebedingungen<br />
erheblichen Einfluss auf das<br />
Nachernteverhalten haben können. Bei üblichen<br />
Nacherntebedingungen (12°C-20°C, offene Verpackungen<br />
mit 60 s cm -1 Widerstand) schwanken die<br />
Angaben zur Haltbarkeit in weiten Bereichen (250-<br />
580 h). Die längste Haltbarkeit wird bei niedrigen<br />
Vorerntetemperaturen (17°C) und höheren Nährstoffkonzentrationen<br />
(EC9) erreicht, wenn die Lufttemperatur<br />
nach der Ernte bei 12°C gehalten werden<br />
kann.<br />
Damit stehen erste grundlegende Daten für Modellrechnungen<br />
bereit, die gleichzeitig Ertrag und<br />
Haltbarkeit (Vermarktungsfähigkeit) als Zielparameter<br />
umfassen. Mit der Kenntnis solcher Zusammenhänge<br />
können Vor- und Nachernteszenarien<br />
im Hinblick auf eine Prozessoptimierung aufeinander<br />
abgestimmt werden (z.B. für die Entwicklung<br />
von Premiumqualitäten). Dazu sind weiterführende<br />
zielgerichtete Untersuchungen notwendig. /81/,<br />
/82/, /163/, /294/, /376/, /377/, /379/<br />
Bild 5.3: Messung <strong>des</strong> Nachernteverhaltens von Tomaten (von Atmung in der Küvette (li.) und von Transpiration mittels<br />
Thermografie (re.))<br />
Fig. 5.3: Measurement of the postharvest behaviour of tomatoes (respiration, transpiration)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
Einfluss von Licht auf die physiologische Aktivität<br />
verpackter Blattgemüse (Projekt-Nr.: 6.33)<br />
Effects of lighting on the physiological activity<br />
of packed green vegetables<br />
Werner B. Herppich (Abt. 6)<br />
HU Berlin; TU München; Einzelhandel<br />
Förderung: Haushalt<br />
Packaging provi<strong>des</strong> a means to maintain the quality<br />
of lightly processed fresh salads, reducing mechanical<br />
damage, water loss and respiration, and<br />
inhibiting browning and microbial decay due to a<br />
passively established low O2 and high CO2 content<br />
of the air (modified atmosphere packaging, MAP).<br />
Lightly processed products retain their physiological<br />
activity even in such a specific environment.<br />
Illumination and temperature within a display cabinet<br />
interactively affect this activity. Optimised illumination<br />
may improve quality maintenance of<br />
packed photosynthetic active salads, reducing<br />
senescence and decay processes.<br />
The effects of radiation and temperature on CO2-,<br />
O2- and ethylene contents within corn salad and<br />
Arugula packaging were studied by GC-analysis<br />
and the photosynthetic activity of single salad<br />
leaves was examined by gas exchange measurements<br />
and chlorophyll fluorescence analysis. The<br />
physiological activity of leaves within packages<br />
was non-invasively determined using a chlorophyll<br />
fluorescence image analysis system.<br />
Illumination helps to control the gas composition<br />
within the packaging. Even low light intensity effectively<br />
improved quality maintenance of the products.<br />
Higher photon fluence rates are not necessary<br />
but may increase temperature within the<br />
packaging, further reducing product quality. In<br />
contrast, illumination, optimised in quality and<br />
quantity, can help to retain value-adding substances<br />
and reduce senescence of fresh packed<br />
products (Fig. 5.4).<br />
II Fachlicher Teil 49<br />
Eine wichtige Möglichkeit der Qualitätserhaltung<br />
bei leichtverderblichen gartenbaulichen Produkten<br />
ist die geeignete Verpackung. Sie bietet Schutz vor<br />
mechanischer Belastung, reduziert den Wasserverlust<br />
und erhöht die Haltbarkeit <strong>des</strong> Produktes<br />
durch das Einstellen einer modifizierten Atmosphäre<br />
(MAP: modified atmosphere packaging). Erhöhter<br />
CO2-Gehalt und/oder erniedrigter O2-Gehalt<br />
reduzieren das Risiko von Verbräunung, verringern<br />
die Produktatmung und wirken bakterio- und<br />
fungistatisch. Auch verpackte frische Gemüse,<br />
Früchte oder Salate sind weiter physiologisch aktiv.<br />
Diese Aktivität wird von Umgebungsbedingungen<br />
wie Temperatur und Licht beeinflusst. Eine<br />
gezielte, optimierte Belichtung sollte sich positiv<br />
auf die Qualität photosynthetisch aktiver Produkte<br />
auswirken, den Alterungs- und Verderbsprozess<br />
verlangsamen und die Haltbarkeit von verpackten<br />
Blatt- und Mischsalat verlängern.<br />
Der Einfluss von photosynthetischer Strahlung und<br />
Produkttemperatur auf CO2-, O2- sowie Ethylengehalt<br />
in Feldsalat- und Rucolapackungen wurde<br />
mittels GC-Analyse untersucht, die Photosyntheseaktivität<br />
von Einzelpflanzen durch Gaswechselmessung<br />
und Chlorophyllfluoreszenzanalyse bestimmt<br />
und die physiologische Aktivität der verpackten<br />
Produkte mit einem Chlorophyllfluoreszenzbildanalysesystem<br />
gemessen. Mit Hilfe der<br />
Beleuchtung kann man die Gaszusammensetzung<br />
in der Verpackung von frischen grünen Salaten<br />
kontrollieren. Geringe Lichtintensitäten sind schon<br />
effektiv und beeinflussen die Qualitätserhaltung.<br />
Höhere Strahlungsstärken in den Verkaufsräumen<br />
und Kühltheken können die innere Qualität <strong>des</strong><br />
Frischproduktes negativ beeinflussen und sollten<br />
auch wegen der Erwärmung <strong>des</strong> Schaleninhalts<br />
vermieden werden. Eine Bestrahlung von optimaler<br />
Quantität und Qualität kann dagegen die Erhaltung<br />
wertgebender Inhaltsstoffe fördern und die<br />
Seneszenz der grünen Frischprodukte verlangsamen<br />
(Bild 5.4). /144/, /271/<br />
Bild 5.4: Einfluss von Belichtung auf<br />
die Qualität verpackter Rucolablätter<br />
(10 d Lagerung bei 20 °C). Die Qualität<br />
wurde durch Messung der potentiellen<br />
Photosyntheseeffizienz mit<br />
einem Chlorophyllfluoreszenzbildanalysesystem<br />
beurteilt.<br />
Fig. 5.4: Effects of illumination on the<br />
quality of packed Arugula during a<br />
ten-days storage at ca 20 °C. Quality<br />
was estimated measuring the potential<br />
photosynthetic efficiency with of a<br />
chlorophyll fluorescence imaging<br />
system<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
50<br />
Optische Eigenschaften gartenbaulicher Produkte<br />
(Projekt-Nr.: 6.16)<br />
Optical properties of horticultural products<br />
Bernd Herold (Abt. 6), Ingo Truppel (6), Manuela<br />
Zude (6), Alexander Rohrbach (6)<br />
Institut für Mikrotechnik Mainz (IMM) GmbH<br />
Förderung: Haushalt; BMBF<br />
Before introducing practicable spectral optical<br />
monitoring techniques into horticulture, several<br />
problems have to be solved yet. In past years, lowcost<br />
miniaturised spectrometer modules have been<br />
tested with respect to basic technical suitability to<br />
acquire relevant produce quality properties.<br />
A recently developed telemetric portable spectrometer<br />
with wireless data transfer was used in<br />
<strong>2003</strong> to analyse the fruit development and maturation<br />
directly on the tree before and during the fruit<br />
harvest period.<br />
The progress of fruit maturation can be evaluated<br />
by means of the change of fruit ground colour<br />
caused by the decrease in chlorophyll content.<br />
When measuring the spectral signature of light<br />
reflection on the fruit, this colour change can be<br />
very sensitively characterised by using the socalled<br />
red-edge of spectral curve in the wavelength<br />
range from 670 to 720 nm. The red-edge wavelength<br />
shifts with increasing maturity. The measure<br />
of this shift indicates the maturity progress. The<br />
maturation of identical fruits cv. ‘Elstar’ on the tree<br />
has been monitored over a period of about seven<br />
weeks. The example of ten fruits from a single tree<br />
showed a relatively wi<strong>des</strong>pread variation of the<br />
red-edge values, indicating strongly different fruit<br />
maturity stages (Fig. 5.5). This information can be<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
used for selective picking at optimum harvest date.<br />
Zur Einführung von praxisanwendbaren spektraloptischen<br />
Kontrollverfahren im Gartenbau sind<br />
eine Reihe von Problemen zu lösen. In den zurückliegenden<br />
Jahren wurden kostengünstige miniaturisierte<br />
Spektrometermodule hinsichtlich ihrer<br />
prinzipiellen technischen Eignung zur Erfassung<br />
qualitätsrelevanter Produkteigenschaften erprobt.<br />
Ein im vorletzten Jahr in Betrieb genommenes<br />
transportables Funkspektrometer wurde im Jahre<br />
<strong>2003</strong> getestet, um die Fruchtentwicklung und<br />
Fruchtreife von Äpfeln direkt am Baum bis zur<br />
Ernte zu analysieren.<br />
Der Reifeverlauf von Äpfeln kann an Hand <strong>des</strong><br />
Farbumschlags ihrer Grundfarbe beurteilt werden,<br />
welcher durch abnehmenden Chlorophyllgehalt<br />
bedingt ist. Misst man die spektrale Signatur der<br />
Lichtreflexion an der Frucht, so lässt sich dieser<br />
Farbumschlag mit Hilfe <strong>des</strong> sogenannten Rot-<br />
Wendepunkts der Kennlinie im Wellenlängenbereich<br />
von 670 bis 720 nm sehr sensitiv charakterisieren.<br />
Die Wellenlänge <strong>des</strong> Rot-Wendepunkts<br />
verschiebt sich mit zunehmender Reife stetig hin<br />
zu kleineren Werten. Das Maß dieser Verschiebung<br />
widerspiegelt den Reifefortschritt. Der Verlauf<br />
der Baumreife wurde an identischen Äpfeln der<br />
Sorte ‚Elstar’ über sieben Wochen verfolgt. Am<br />
Beispiel von zehn Früchten eines Baumes zeigte<br />
sich eine relativ breite Streuung der Rot-<br />
Wendepunkte, welche auf stark differierende Reifezustände<br />
schließen lässt (Bild 5.5). Diese Information<br />
kann für das selektive Pflücken zum optimalen<br />
Erntezeitpunkt genutzt werden. /6/, /30/,<br />
/31/, /47/, /48/, /57/, /66/, /139/, /140/, /141/, /143/,<br />
/169/ /191/, /203/, /204/, /267/, /268/, /269/, /270/,<br />
/332/, /363/, /393/, /398/<br />
Bild 5.5: Kennzeichnung<br />
<strong>des</strong> Verlaufs der Baumreife<br />
bei zehn Äpfeln der<br />
Sorte ‚Elstar’ während der<br />
Vorernte- und Erntezeit an<br />
Hand der Verschiebung<br />
<strong>des</strong> Rot-Wendepunkts (die<br />
Messungen erfolgten<br />
direkt am Baum mit Hilfe<br />
<strong>des</strong> Funkspektrometers)<br />
Fig. 5.5: Characterisation<br />
of the maturity development<br />
of ten apple fruits on<br />
the tree during pre-harvest<br />
and harvest period by<br />
means of the red-edge<br />
shift (measurements were<br />
carried out directly on the<br />
tree by using the telemetric<br />
spectrometer)
Messung von Fruchtpigmenten mit Hilfe der<br />
Fluoreszenzspektroskopie (Projekt-Nr.: 6.37)<br />
Determining fruit pigment contents with the<br />
help of fluorescence spectroscopy<br />
Janina S. Wulf (Abt. 6), Werner B. Herppich (6),<br />
Manuela Zude (6)<br />
HU Berlin; Katholieke Universiteit Leuven (B)<br />
Förderung: Marie-Curie-Stiftung; Haushalt<br />
During recent years, there has been a growing<br />
demand for objective quality monitoring along the<br />
supply chain. Recent methods are mostly <strong>des</strong>tructive,<br />
making a long-term investigation of the product<br />
quality impossible. In this context laserinduced<br />
fluorescence spectroscopy (LIFS) provi<strong>des</strong><br />
a means to non-<strong>des</strong>tructively follow quality<br />
changes of fruits during postharvest.<br />
Subsequent to previous experiments with fruit<br />
slices and suitable additives for ready-to-eat salads,<br />
LIFS was applied to sound fruits.<br />
The fluorescence spectrum of an apple consists of<br />
spectra of many interacting fluorescent fruit compounds.<br />
Each fluorescent molecule is characterized<br />
by a specific lifetime and emission spectrum.<br />
Using time-resolved readings, overlaid fluorescence<br />
signals can be separated. The 2 nd derivative<br />
of the fluorescence spectra were used for data<br />
analyses. Thus phenol peaks in the blue-green<br />
wavelength range and chlorophyll peaks in the red<br />
area became visible (Fig. 5.6). Due to the accumulation<br />
of UV-absorbing pigments (anthocyanins),<br />
the fluorescence of a red apple skin is less intense.<br />
Further measurements on standards and<br />
fruit tissue aim at determining single fruit pigments<br />
in the fluorescence spectrum. For this purpose<br />
present studies in cooperation with the Catholic<br />
University Leuven emphasize on phenolic compounds.<br />
Die Nachfrage nach einer objektiven Qualitätskontrolle<br />
bei Gartenbauprodukten in der Vermarktungskette<br />
ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen.<br />
Die bislang eingesetzten Methoden sind<br />
vorwiegend zerstörend und lassen somit keine<br />
Langzeituntersuchungen am Produkt zu. In diesem<br />
Zusammenhang soll mit Hilfe der laser-induzierten<br />
Fluoreszenzspektroskopie (LIFS) eine zerstörungsfreie<br />
Methode erarbeitet werden, um wertmindernde<br />
Stoffwechselreaktionen während der<br />
Nachernte und im Verarbeitungsprozess ermitteln<br />
zu können.<br />
Aufbauend auf vorangegangene Untersuchungen<br />
von Fruchtreaktionen an verarbeiteten Produkten<br />
und der durch entsprechende Additive beeinfluss-<br />
II Fachlicher Teil 51<br />
ten Fruchtqualität von Obstsalaten wurde LIFS<br />
zerstörungsfrei an ganzen Früchten (z.B. Äpfeln)<br />
erprobt.<br />
Das Fluoreszenzspektrum eines Apfels setzt sich<br />
aus den Spektren der einzelnen fluoreszierenden<br />
Fruchtkomponenten zusammen. Zudem zeichnet<br />
sich das Fluoreszenzsignal je<strong>des</strong> fluoreszierenden<br />
Moleküls durch eine spezifische Lebensdauer bei<br />
einem charakteristischen Emissionsspektrum aus.<br />
Die derzeit am <strong>ATB</strong> eingesetzte Methode der Fluoreszenzspektroskopie<br />
bietet die Möglichkeit zeitaufgelöster<br />
Messungen, mittels derer sich überlagernde<br />
Fluoreszenzsignale getrennt werden können.<br />
Bild 5.6: Fluoreszenzspektrum und zweite Ableitung<br />
gemessen an der roten und der grünen Apfelschale.<br />
Fig. 5.6: Fluorescence and 2 nd derivative of fluorescence<br />
spectra of red and green apple skin.<br />
Zur Bestimmung der jeweiligen Inhaltsstoffe werden<br />
die Fluoreszenzspektren mit Hilfe der Derivativ-Spektroskopie<br />
ausgewertet. Durch die zweite<br />
Ableitung werden Extremstellen im Spektrum<br />
sichtbar, die beispielsweise auf Phenole im blaugrünen<br />
und auf Chlorophylle im roten Wellenlängenbereich<br />
zurückgeführt werden können<br />
(Bild 5.6). Die Anhäufung von Anthocyanen als<br />
Schutz vor UV-Einstrahlung führt dabei zu deutlich<br />
geringerer Fluoreszenzintensität der sonnenexponierten<br />
(rot) Seite <strong>des</strong> Apfels. Weitere Versuchsreihen<br />
an Reinsubstanzen zielen auf die Bestimmung<br />
einzelner Fruchtpigmente mittels LIFS ab. In<br />
diesem Zusammenhang laufen derzeit Untersuchungen<br />
zu Phenolen in Zusammenarbeit mit der<br />
Katholischen Universität Leuven. /63/, /64/, /96/,<br />
/337/, /338/, /402/, /403/<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
52<br />
Arbeitsgebiet: "Bewertung und Optimierung<br />
verfahrenstechnischer Prozesse"<br />
Erfassung mechanischer Belastungen von<br />
Früchten (Projekt-Nr.: 6.38; 110/124)<br />
Acquisition of mechanical impacts on fruit<br />
Bernd Herold (Abt. 6), Ingo Truppel (6)<br />
deka Sensor + Technologie Teltow; teleBITcom<br />
Teltow<br />
Förderung: Haushalt; BMBF/PtJ<br />
Since several years, “electronic fruits” are used in<br />
order to objectively determine the sources of mechanical<br />
damages of susceptible horticultural products<br />
in harvest and post harvest handling technique.<br />
The disadvantage of existing “electronic<br />
fruits” is that they are different from real products in<br />
important parameters, and therefore, the acquired<br />
data are not directly transferable.<br />
The current research project is carried out together<br />
with two industrial partners and aims at the development<br />
of a method specifically adapted to the real<br />
produce to analyse the production technique. For<br />
this purpose, a miniaturised electronic data acquisition<br />
system is being developed that can be implanted<br />
directly into a real produce. The maximum<br />
dimensions of this implant should be 40 mm length<br />
and 12 mm width in order to fit it into a potato, an<br />
apple or a carrot. The specific weight should not<br />
differ from original product as well.<br />
Based on commercial components, a microprocessor<br />
controlled electronic unit was developed,<br />
that was implanted into a potato tuber (Fig. 5.7). It<br />
transmitted reliably the data under difficult conditions<br />
of potato grading and packaging to a portable<br />
receiver. Three-dimensional acceleration data are<br />
acquired with 3 kHz sampling rate and wirelessly<br />
transmitted in ISM band at 433 MHz. Transmitted<br />
data are stored and processed by a notebook PC.<br />
The data transmission to the receiver was maintained<br />
by expensive development of a specific<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
Implantiertes Sendermodul<br />
Implanted transmitter module<br />
hard and soft ware (diversity receiving, synchronising,<br />
data processing).<br />
Um die Ursachen für mechanische Beschädigungen<br />
empfindlicher gartenbaulicher Produkte in den<br />
Produktionsverfahren zu bestimmen, werden seit<br />
mehreren Jahren „elektronische Früchte“ verwendet.<br />
Nachteil bisheriger „elektronischer Früchte“<br />
ist, dass sie sich in wichtigen Parametern von realen<br />
Produkten unterscheiden und <strong>des</strong>halb die von<br />
ihnen erfassten Daten nicht direkt übertragbar<br />
sind.<br />
Im laufenden Projekt wird gemeinsam mit zwei<br />
Industriepartnern eine spezifisch dem Produkt<br />
angepasste Methode zur Analyse der Verfahren<br />
geschaffen. Hierzu wird ein miniaturisiertes elektronisches<br />
Datenerfassungs-System zur Erfassung<br />
von Stoßbelastungen entwickelt, welches direkt in<br />
ein reales Produkt implantiert werden kann. Um<br />
dieses Implantat ohne wesentliche Produktveränderung<br />
in eine Kartoffel, einen Apfel oder eine<br />
Möhre einpassen zu können, sollen die Abmessungen<br />
in der Länge 40 mm und in der Breite<br />
12 mm möglichst nicht überschreiten. Die Dichte<br />
soll ebenfalls nicht wesentlich vom Original abweichen.<br />
Auf der Grundlage kommerzieller Bausteine wurde<br />
eine mikroprozessorgesteuerte Elektronikeinheit<br />
entwickelt, welche in eine Kartoffel implantiert wurde<br />
(Bild 5.7) und die Daten auch unter den<br />
schwierigen Bedingungen der Kartoffelsortierung<br />
und -verpackung zuverlässig zu einem tragbaren<br />
Empfänger übertrug. Die Beschleunigungswerte<br />
werden dreidimensional mit einer Rate von 3 kHz<br />
erfasst und drahtlos im ISM-Band bei 433 MHz<br />
übertragen. Die vom Empfänger aufgenommenen<br />
Messdaten werden auf einem Notebook PC gespeichert<br />
und ausgewertet.<br />
Durch aufwendige Entwicklung einer speziellen<br />
Hard- und Software (Diversityempfang, Synchronisierung<br />
mittels PLL Schaltung, Auswertung) wurde<br />
die Datenübertragung zum Empfänger gesichert.<br />
/50/, 287/<br />
Bild 5.7: Kartoffelknolle mit<br />
implantiertem Sendermodul<br />
(links: fertig präpariert für<br />
Messlauf, rechts: aufgeschnitten,<br />
die Position <strong>des</strong><br />
Sendermoduls ist umrandet<br />
gezeigt)<br />
Fig. 5.7: Potato tuber with<br />
implanted transmitter module<br />
(left: prepared ready for<br />
measuring run, right: cut<br />
open, the border line shows<br />
the position of transmitter<br />
module)
Verfahrenstechnische Untersuchungen zur<br />
beschädigungsarmen Ernte, zum schonenden<br />
Transport und zur belastungsarmen Lagerung<br />
von Kartoffeln (Projekt-Nr.: 3.53)<br />
Process examinations of a gentle harvest,<br />
transport and storage of potatoes<br />
Pavel Maly (Abt. 3), Thomas Hoffmann (3)<br />
Schöpstal Maschinenbau GmbH; Friweika Weidensdorf<br />
e.G.; Grimme Landmaschinenfabrik<br />
GmbH & Co. KG;<br />
Förderung: Fa. Schöpstal Maschinenbau GmbH<br />
Markersdorf<br />
After the harvest, potatoes are usually filled on<br />
trailers or in storage boxes on trailers. The filling<br />
process causes mechanical loads and damages to<br />
the potatoes. In order to avoid the loads the potatoes<br />
have to be filled into the containers on the<br />
harvesting machine (Fig. 5.8). In an evaluation<br />
model filling variants were compared. In two examination<br />
years, a prototype potato harvester with<br />
storage boxes on the harvester was tested in practice.<br />
The small respiration intensity caused by box<br />
filling on the harvester is an indicator for a gentle<br />
handling of the tubers (Fig. 5.9).<br />
Nach der Ernte werden Kartoffeln vom Bunker der<br />
Kartoffelerntemaschine als lose Schüttung direkt<br />
auf das Transportmittel übergeben oder auf diesem<br />
in Großbehälter gefüllt. Mit jedem Umschlagvorgang<br />
treten in Abhängigkeit von der Fallhöhe<br />
und der Anzahl an Fallstufen mechanische Belastungen<br />
auf. Zur Verminderung der mit der Übergabe<br />
verbundenen Belastungen soll das Erntegut<br />
bereits auf der Erntemaschine in Großbehälter<br />
(Nutzmasse 4 t) gefüllt werden (Bild 5.8).<br />
Varianten<br />
Versions<br />
V3<br />
V2<br />
V1<br />
V0<br />
Erntemaschine mit Bunker + Transportmittel + Sektionslager<br />
harvester with bulk hopper, handling of the potatoes as bulk material<br />
Erntemaschine mit Bunker + Transportmittel mit Großbehälter<br />
harvester with bulk hopper, storage bins on trailers<br />
Erntemaschine mit Großbehälter<br />
h arvester with filling system for storage bins<br />
Handrodung<br />
harvest by a person<br />
4,16<br />
II Fachlicher Teil 53<br />
5,9<br />
In einem Variantenvergleich sollen die positiven<br />
Effekte der Behälterbefüllung auf einer modifizierten<br />
Erntemaschine (V1) gegenüber der bisherigen<br />
Behälterbefüllung auf dem Transportmittel (V2)<br />
gezeigt werden. Weiterhin ist die Behältertechnologie<br />
mit der konventionellen Loselagerung der<br />
Knollen im Flächenlager (V3) zu vergleichen.<br />
Die Bewertung der Befüllvarianten erfolgt u.a. anhand<br />
der Kriterien Atmungsintensität, Schwarzfleckigkeit,<br />
Arbeitszeitbedarf, Masseverluste, Belastungsintensität<br />
und Verfahrenskosten.<br />
In zwei Untersuchungsjahren ist der Prototyp der<br />
modifizierten Erntemaschine im Praxiseinsatz erprobt<br />
worden. Im Vergleich der drei Befüllvarianten<br />
führt die Befüllung auf der Erntemaschine (V1) zu<br />
den geringsten Belastungen, Atmungsintensitäten<br />
(Bild 5.9) und Masseverlusten. /22/<br />
Bild 5.8: Behälterbefüllung auf der Erntemaschine<br />
Fig 5.8: Box filling on the potato harvester<br />
7,53<br />
0 2 4 6 8<br />
Atmungsintensität [mgCO2/kg*h] Respiration rate [mgCO 2 /kg*h ]<br />
10<br />
11,93<br />
12<br />
Bild 5.9: Atmungsintensität<br />
5 Stunden nach<br />
der Ernte bei der Sorte<br />
Solara<br />
Fig. 5.9: Respiration<br />
rate of potatoes from<br />
different harvesting<br />
lines 5 hours after harvest<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
54<br />
Anwendung der Thermografie zur Optimierung<br />
der Belüftungssteuerung bei der Lagerhaltung<br />
landwirtschaftlicher Produkte<br />
(Projekt-Nr.: 110-126)<br />
Application of thermography to optimize climate<br />
control during storage of agricultural<br />
products<br />
Klaus Gottschalk (Abt. 3), Sabine Geyer (3), Hans<br />
Jürgen Hellebrand (2), Ralf Schlauderer (2), Horst<br />
Beuche (2), Ines Ficht (2), Helen Jacobs (2),<br />
Ingolf-Gerrit Richter (3)<br />
FRIWEIKA e. G. Weidensdorf/Remse; KTBL<br />
Dethlingen<br />
Förderung: BMBF/PtJ, Haushalt<br />
Measuring technique with thermography is applied<br />
as climate control component in potato storage.<br />
Especially for the economically and environmentally<br />
relevant free convective storage (FCS) climate<br />
control can be optimised by this technology for<br />
reaching uniform storage climate and for securing<br />
product quality. Infrared images (IR) record spaciously<br />
surface temperatures and, using film sequences,<br />
temperature changes caused by air flow<br />
development in the store. To validate IR images<br />
with respect to their capability for providing set<br />
point temperatures for climate control, temperatures<br />
inside the box stack were also recorded by<br />
conventional measuring technique. Conventional<br />
and IR-temperature data are saved in the potato<br />
box stack (Fig. 5.10) and transmitted online to the<br />
institute by means of a software package for distant<br />
data transfer developed at the <strong>ATB</strong>. All temperature<br />
data were used to <strong>des</strong>cribe a spatial<br />
model (3-D) visualizing the effects of ventilation on<br />
the temperatures of the surfaces and inside the<br />
box stack and are considered in a model calcula-<br />
8,5 m<br />
Belüftungsklappen<br />
Ventilation damper<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
18 m<br />
4<br />
3<br />
2<br />
Reihe/row<br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
Infrarot-Kamera<br />
/ Infrared camera<br />
tion. The interpretation of the infrared images requires<br />
special examinations. The high prime costs<br />
of thermography can be broken if the storage<br />
losses can be reduced by approx. 1.2 % in the 15<br />
kiloton potato store house with optimal climate<br />
control.<br />
Das thermographische Messverfahren wird als<br />
Klimasteuerungselement in der Kartoffellagerung<br />
eingesetzt. Speziell bei der ökonomisch und ökologisch<br />
interessanten freien konvektiven Lagerhaltung<br />
(FKL) soll mit Hilfe dieser Technologie die<br />
Klimaregelung so optimiert werden, dass ein ausgeglichenes<br />
Lagerklima sowie die Produktqualität<br />
gesichert wird. Infrarotbilder (IR) erfassen weiträumig<br />
Oberflächentemperaturen der Lagerkisten<br />
und mit Hilfe von Papiermarkern die Temperaturänderungen<br />
durch Luftströmungen. Zur Validierung<br />
der IR-Technik als Ist-Temperatur-Geber<br />
werden die Temperaturen im Stapelinneren zunächst<br />
noch durch konventionelle Messtechnik<br />
(Sensoren) ergänzt. Hierzu werden Temperaturdaten<br />
im 15kt-Großkistenlager bei FRIWEIKA gesammelt<br />
(Bild 5.10) und mit einer am <strong>ATB</strong> entwickelten<br />
Datenfernübertragungs-Software zum Institut<br />
online übermittelt. Aus den gewonnenen<br />
Temperaturdaten werden die Einflüsse der Strömungsverläufe<br />
auf die Temperaturverteilung im<br />
Lager ermittelt und in ein 3D-Modell zur Vorhersage<br />
der Temperaturverteilung im Stapelinneren<br />
aufgestellt.<br />
Bei der Auswertung der IR-Bilder müssen mehrere<br />
Faktoren berücksichtigt werden. Trotz hoher Anschaffungskosten<br />
kann sich die Investition der<br />
Kamera amortisieren, wenn in einem entsprechend<br />
großen Kartoffellager der durch Belüftungsfehler<br />
bedingte Schwund um 1,2 % reduziert werden<br />
kann. /129/, /258/, /355/<br />
Temperaturfühler zur Validierung<br />
Temperature sensors for validation<br />
Temperaturfühler der Steuerung<br />
Temperature sensors of climate control<br />
Temperatur-/Feuchtefühler<br />
Sensors for temperature and humidity<br />
Papiermarker/ paper marker<br />
Referenzplatte/ reference sheet<br />
Bild 5.10: Messstand im<br />
Großbehälterlager<br />
Fig.5.10: Measuring station at<br />
big box store of FRIWEIKA
Kurzzeitlagerung von Steinobst, Optimierung<br />
der Qualitätserhaltung (Projekt-Nr.: 6.36)<br />
Short-term storage of stone-fruit; optimization<br />
of quality maintenance<br />
Werner B. Herppich (Abt. 6), Manfred Linke (6),<br />
Martin Geyer (6), Bernd Herold (6), Klaus<br />
Gottschalk (3), Ralf Schlauderer (2)<br />
BSA Prüfstelle Marquardt; Praxisbetriebe<br />
Förderung: Haushalt<br />
Sweet cherries and plums can’t be stored for a<br />
longer period. Normally they are rapidly sold in the<br />
fresh-market. Nevertheless, short–term storage<br />
(up to 2 to 3 weeks) can help to reduce the negative<br />
effects of production peaks and extend season.<br />
This project aims to evaluate and to optimise<br />
existing storage systems and methods, also assessing<br />
their potential economic advantages. In<br />
addition, objective quality parameters will be refined<br />
by recent non-<strong>des</strong>tructive methods and advanced<br />
physical treatments to improve quality<br />
maintenance.<br />
High quality cherries, packed in small film-covered<br />
trays may provide future economic success on the<br />
local market and for the export. Only carefully<br />
sorted, ripe and sound fruits can be used for a<br />
high-quality brand. Additional quality-keeping<br />
treatments may be necessary. Because chemical<br />
additives are prohibited for fresh products, alternative<br />
physical approaches may provide a valid solution.<br />
The effects of short-term hot water dipping at<br />
two temperatures (50°C and 60°C) and of variable<br />
duration on quality maintenance of Kordia and<br />
Sam cherries were investigated. After treatment,<br />
the cherries were stored at 8°C for 8 days.<br />
Hot water treatment provided no advances if compared<br />
to carefully sorted fruits. In contrast, longer<br />
duration (120 and 180 s) of the dipping at the<br />
higher temperature resulted in a pronounced fruit<br />
browning and enhanced the depletion of organic<br />
acids. This increased the sugar-acid-ratio, which is<br />
an objective indicator of sensory quality (Fig.<br />
5.10). None of the cherry samples showed serious<br />
fungal infections. Nevertheless, short-term hot<br />
water dipping at moderate temperatures (e.g.<br />
50°C) may help to reduce fungal infections in seasons<br />
with a higher pathogenic pressure.<br />
Kirschen und Pflaumen sind nur für kurze Zeit<br />
haltbar und werden daher meist rasch im Frischmarkt<br />
verkauft. Dennoch ist eine kurze Lagerung<br />
(zwei bis drei Wochen) sinnvoll, um Produktionsspitzen<br />
abzufangen oder die Verkaufssaison zu<br />
verlängern. In diesem Projekt sollen aktuelle Lagersysteme<br />
(Kühlzellen, MAP, CA) bewertet und<br />
verbesserte Verfahrenslösungen für ein produktschonen<strong>des</strong><br />
ökonomisches Fruchthandling opti-<br />
II Fachlicher Teil 55<br />
miert werden. Die Erfassung objektiver Qualitätskriterien<br />
mit aktuellen zerstörungsfreien Methoden<br />
und die Untersuchung alternativer nachhaltiger<br />
Maßnahmen der Qualitätserhaltung sind ebenfalls<br />
Inhalte dieses Projektes.<br />
Kirschen von höchster Qualität, als kleinere Einheiten<br />
(z. B. 500 g) abgepackt und in Schalen foliert,<br />
könnten auf dem deutschen Markt und beim Export<br />
ein weiteres Marktsegment darstellen. Eine<br />
Prämiumqualität setzt eine sorgfältig sortierte,<br />
einwandfreie und saubere Ware voraus. Auch ist<br />
hier eine Verlängerung der Haltbarkeit durch weitere<br />
qualitätserhaltende Maßnahmen notwendig.<br />
Da keine chemischen Schutzmaßnahmen gestattet<br />
sind, bieten alternative Methoden wie die Heißwasserbehandlung<br />
eine mögliche Lösung. Bei<br />
Kirschen der Sorten Kordia und Sam wurde die<br />
Wirkung einer kurzzeitigen Heißwasserbehandlung<br />
bei unterschiedlichen Temperaturen (50°C und<br />
60°C) sowie unterschiedlicher Behandlungsdauer<br />
auf die Qualitätserhaltung untersucht. Die Kirschen<br />
wurden 8 Tage bei 8°C nachgelagert.<br />
Die Heißwasserbehandlung zeigte keine Vorteile<br />
gegenüber sorgfältig sortierten Kirschen. Statt<strong>des</strong>sen<br />
bewirkte eine längere Behandlung (120 bzw.<br />
180 s) bei der hohen Temperatur ein Verbräunen<br />
der Kirschen und einen verstärkten Abbau der<br />
Fruchtsäuren. Dies führt zu einem Anstieg <strong>des</strong><br />
Zucker-Säureverhältnisses (Bild 5.11), einem<br />
wichtigen objektiven Geschmacksindikator. Verschimmeln<br />
spielte hier keine Rolle. Allerdings sollte<br />
in Jahren mit höherem Pathogendruck eine<br />
kurzzeitige (60 s) Behandlung mit 50 bis 60°C<br />
heißem Wasser die Lagerfähigkeit von Kirschen<br />
erhöhen.<br />
Zucker-Säure-Verhältnis<br />
Sugar-acid ratio<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
Referenz/reference<br />
30 s<br />
60 s<br />
90 s<br />
120 s<br />
180 s<br />
50°C<br />
60°C<br />
0 2 4 6 8<br />
Lagerdauer (d)<br />
Duration of storage (d)<br />
Bild 5.11: Einfluss von Temperatur und Dauer der Heißwasserbehandlung<br />
auf das Zucker-Säureverhältnis von<br />
Kirschen der Sorte Sam während der Lagerung bei 8°C.<br />
Fig. 5.11: Effects of temperature and duration of a hot<br />
water treatment on the sugar-acid ratio of sweet cherries<br />
of the variety Sam during storage at 8°C.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
56<br />
Ein System zur online Stärkebestimmung bei<br />
Einzelknollen (Projekt-Nr.: 110/130)<br />
A system for the online starch determination in<br />
potato tubers<br />
Thomas Hoffmann (Abt. 3), Andree Jacobs (3),<br />
Ingolf-Gerrit Richter (3);<br />
Firma Select<br />
Förderung: BMBF/PtJ; Haushalt<br />
The starch content of single potato tubers can vary<br />
in a wide range from 10 % to 25 % for tubers from<br />
the same plant. The starch content affects the<br />
cooking behaviour, for instance the firmness or the<br />
consistence of the cooked potatoes. For a high<br />
quality of cooked potatoes it is necessary to classify<br />
the single tubers into different starch classes<br />
before cooking. The aim of the project is the development<br />
of a system for the online starch classification<br />
of single fresh potatoes.<br />
The starch content of potato tubers is related to the<br />
density of the tubers. For the calculation of the<br />
density the mass and the volume have to be<br />
measured. To determine the tuber mass we use a<br />
dynamic balance and a special pc-program<br />
(Fig. 5.12 ) for the mass estimation of the moving<br />
tubers. The volume is measured by using an optoelectronic<br />
sorting device from the project partner,<br />
the SELECT company. Considering the small<br />
mass and volume measuring errors, the classification<br />
of the potato tubers in 3 starch classes is possible.<br />
After two years of experiences in the laboratory,<br />
the next project step will be the scale up of<br />
the system.<br />
Auf Grund der biologischen Variabilität können<br />
Kartoffelknollen einer Warenpartie Stärkegehalte<br />
zwischen 10 % und 25 % aufweisen. Mit dem Stärkegehalt<br />
können sich die Kocheigenschaften wie<br />
z. B. das Bruchverhalten oder die Konsistenz der<br />
gegarten Knollen ändern. Um eine gleichbleibende<br />
Produktqualität der gegarten Kartoffeln erzielen zu<br />
können, müssen die Kartoffeln nach ihrem Stärkegehalt<br />
klassiert und getrennt verarbeitet werden.<br />
Ziel <strong>des</strong> Projektes ist die online-Stärkebestimmung<br />
von Einzelknollen. Dazu wird dynamisch die<br />
Masse der Einzelknolle (<strong>ATB</strong>) und optoelektronisch<br />
das Volumen (select) bestimmt und daraus<br />
die Knollendichte berechnet. Die Dichte steht in<br />
einem engen Verhältnis zum Stärkegehalt der<br />
Knolle.<br />
Zur genauen dynamischen Wägung der einzelnen<br />
Kartoffeln wurde eine Bandwaage eingesetzt. Um<br />
die Waage für die unruhig liegenden Kartoffeln bei<br />
hohem Massestrom einsetzen zu können, wurde<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
ein spezielles PC-Programm zur Messwertverrechnung<br />
erarbeitet (Bild 5.12). Für die Volumenbestimmung<br />
wurde ein optoelektronischer Verleseautomat<br />
der Firma Select weiterentwickelt.<br />
Knollenmasse [g]<br />
potato mass [g]<br />
218<br />
216<br />
214<br />
212<br />
210<br />
208<br />
206<br />
204<br />
202<br />
200<br />
Meßsignal<br />
measurement signal<br />
Tiefpass<br />
low-pass filter<br />
209,48 g<br />
Regressionsgleichung<br />
regression equation<br />
0 50 100 150 200 250<br />
Messdauer [ms]<br />
time [ms]<br />
Bild 5.12: Messwertverrechnung bei sich bewegenden<br />
Knollen<br />
Fig. 5.12: Program for the mass estimation of moving<br />
tubers<br />
Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass das<br />
Vereinzeln, Fördern und Wiegen der Kartoffeln im<br />
Labormaßstab bei ausreichend geringem Wägefehler<br />
gesichert werden kann. Zusammen mit den<br />
Ergebnissen zur Volumenbestimmung ist das Ziel,<br />
einen Gutstrom in drei Stärkeklassen zu teilen,<br />
erreichbar. Nach den Laboruntersuchungen folgt<br />
die Übertragung der Ergebnisse in eine Pilotanlage.<br />
/149/
Entwicklung von Waschdüsen für eine effizientere<br />
Wäsche von Gemüse und Speisekartoffeln<br />
(Projekt-Nr.: 6.28; 110-128)<br />
Development of cleaning nozzles in order to<br />
increase cleaning effectiveness in vegetables<br />
and potatoes<br />
Martin Geyer (Abt. 6), Ermyas Mulugeta (6)<br />
Lechler GmbH; Hagenlocher Landmaschinen;<br />
Hepro GmbH<br />
Förderung: BMBF/PtJ, Haushalt, Industrie<br />
By means of a standardised investigation procedure<br />
the spatial distribution of the water jet structure<br />
of washing nozzles and the effectiveness of<br />
the created water jet on the impact surface were<br />
established for practical operating conditions. The<br />
damage limits of vegetable tissue for different<br />
vegetable types while applying maximal impact<br />
pressure were considered. The BMBF-Project<br />
aims at establishing a general nozzle assessment<br />
key for vegetable washing, which shall provide for<br />
an assortment of spray nozzles that are optimally<br />
adjusted to product and dirt characteristics.<br />
The energetic view of droplets created within the<br />
water jet showed that the nozzle size together with<br />
the spray pressure, the nozzle angle and the<br />
stand-off distance vitally influence the jet parameters<br />
and, thus, they also influence the spatial efficiency<br />
of the jet on the impact surface.<br />
With respect to various economical and ecological<br />
aspects, the nozzles were compared among each<br />
other and evaluated according to their effectiveness<br />
and the water jet structure parameters in<br />
practical operating conditions. For an objective<br />
quantification of the mechanical load of the jet<br />
impact area, like for investigating the sensitivity<br />
limit of diverse types of vegetables, differentiated<br />
methods of measurement were used.<br />
By exchange of the currently used agricultural<br />
nozzles for optimal industrial nozzles the cleaning<br />
time as well as the number of nozzles required<br />
could be reduced by 75 % under similar operating<br />
parameters and same level of washing effect. Twomaterial<br />
nozzles have, thereby, the advantage that<br />
the water consumption can be significantly decreased<br />
by approximately 60 % (at air pressure p<br />
= 1 bar) through application of an optimal nozzle<br />
size.<br />
Mittels eines im Rahmen der Grundlagenforschung<br />
erarbeiteten standardisierten Prüfverfahrens wurde<br />
die räumliche Verteilung der Spritzstrahlstruktur<br />
von Waschdüsen und die Flächenleistung <strong>des</strong><br />
gebildeten Strahls unter der praxisbezogenen Variation<br />
der Betriebsbedingungen der Düsen bestimmt.<br />
Dabei wurden die Grenzen der Belastbarkeit<br />
von pflanzlichen Geweben einiger gartenbauli-<br />
II Fachlicher Teil 57<br />
cher Produkte durch überhöhte Strahldrücke berücksichtigt.<br />
Als Endergebnis soll ein allgemeiner<br />
Düsenbewertungsschlüssel für die Gemüsewäsche<br />
entstehen, der eine auf Produkt- und<br />
Schmutzeigenschaft angepasste Düsenauswahl<br />
ermöglicht.<br />
Die energetische Betrachtung der im Spritzstrahl<br />
gebildeten Tropfen ergab, dass die Düsengröße in<br />
Verbindung mit dem Spritzdruck, dem Düsenspritzwinkel<br />
und dem Abstand Düse-Produkt maßgeblich<br />
die Strahleigenschaften auf der Aufpralloberfläche<br />
und somit die Flächenleistung <strong>des</strong><br />
Strahls beeinflusst.<br />
Zur objektiven Quantifizierung der mechanischen<br />
Belastungen der Strahlaufpralldrücke bzw. der<br />
Ermittlung der Empfindlichkeitsgrenze verschiedener<br />
Gemüsearten wurden verschiedene Messmethoden<br />
eingesetzt. Im Hinblick auf ökonomische<br />
und ökologische Aspekte wurden die Düsen hinsichtlich<br />
ihrer Strahlstrukturparameter sowie der<br />
Effektivität unter den praxisbezogenen Betriebsbedingungen<br />
der Düsen verglichen und bewertet<br />
(Bild 5.13). Durch den Austausch der bisher verwendeten<br />
Agrardüsen durch optimale Industriedüsen<br />
könnte die Reinigungszeit bzw. die erforderliche<br />
Düsenanzahl bei gleicher Anordnung und<br />
gleichem Abstand, Spritzdruck und Reinigungsgrad<br />
um 75 % reduziert werden. Dabei haben<br />
Zweistoffdüsen den Vorteil, dass bei optimalen<br />
Wascheffekt die Wassermenge erheblich (bis zu<br />
60 % bei einem Luftdruck von 1 bar) verringert<br />
werden kann. /55/, /85/, /384/, /385/<br />
Abtragstiefe,<br />
mm<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Impact,<br />
MPa<br />
0,14<br />
0,105<br />
0,07<br />
0,035<br />
Uneffektiv Optimal Schädigend<br />
0<br />
0 20 40 60 80<br />
3 -2 -1<br />
VSD, mm mm s<br />
0 1E-3 3E-3 7E-3<br />
2 -2<br />
Gesamtimpuls pro mm und Sekunde, N mm<br />
0 1E-5 6E-5 1E-4<br />
2 -2<br />
Mittlerer Tropfenimpuls pro mm und Sekunde, N mm<br />
Bild 5.13: Zuordnung der Strahlstrukturparameter unterschiedlicher<br />
Düsen bei 5 bar zur optimalen und effektiven<br />
Wäsche leicht bis mäßig verschmutzter gartenbaulicher<br />
Produkte, Abstand Düse-Produkt (d) = 10±2 cm,<br />
Strahlwirkdauer (t) = 15 s<br />
Fig. 5.13: Assignment of jet structure parameters of<br />
different nozzles at 5 bar for optimal and effective washing<br />
of moderately soiled vegetable types, Stand-off distance<br />
(d): = 10±2 cm, Impact timing (t) = 15 s<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
58<br />
Ozontes Waschwasser zur Qualitätssicherung<br />
leichtverderblicher Produkte - Entwicklung<br />
einer Fuzzy Logic Steuerung <strong>des</strong> Waschprozesses<br />
(Projekt-Nr.: 110-129)<br />
Use of ozonated washing water for quality<br />
guarantee of perishable produce – development<br />
of washing process using a Fuzzy Logic<br />
System<br />
Matthias Plöchl (Abt. 2), Karin Hassenberg (2),<br />
Eleanor Molloy (2), Christine Idler (1), Martin<br />
Geyer (6)<br />
HAVITA Frischgemüse GmbH; BWT Wassertechnik<br />
GmbH<br />
Förderung: BMBF/PTJ; Haushalt<br />
The aim of the project is the minimisation of spoilage<br />
and of potential human pathogenic microorganisms<br />
on the surface of pre-packaged mixed<br />
lettuce, and, thus, to guarantee produce quality<br />
during the product’s shelf life. To realise this, a<br />
Fuzzy Logic System will be developed aiming at<br />
the conception of a vegetable washing process<br />
incorporating the use of ozonated water.<br />
During the project lifetime, the efficacy of ozonated<br />
water on four bacterial species, E. coli, B. cereus,<br />
S. choleraesuis and L. monocytogenes, on lettuce<br />
leaf surfaces was investigated. The effect of ozone<br />
on bacteria in monocultures as well as in combination<br />
was studied. Thus, the effect of synergy between<br />
bacteria was also taken into account.<br />
A further effect studied was the efficacy of ozone in<br />
one- and two-stage washing processes, in which<br />
ozone was applied initially in a single washing<br />
step, and then as the second step of the two-stage<br />
process.<br />
Ziel <strong>des</strong> Projekts ist eine Minimierung der Verderberreger<br />
und der potentiell human pathogenen<br />
Mikroorganismen auf der Oberfläche von abgepackten<br />
Mischsalaten sowie die Gewährleistung<br />
der Qualität <strong>des</strong> Salates während <strong>des</strong> Haltbarkeitszeitraumes.<br />
Dazu soll der Gemüsewaschprozess<br />
konzeptionell um einen Waschgang mit ozontem<br />
Wasser erweitert sowie eine Fuzzy Logic<br />
Steuerung für den Waschprozess entwickelt werden.<br />
Im Verlauf <strong>des</strong> 1. Projektjahres wurden Untersuchungen<br />
zum Ozonabbau in Wasser durchgeführt,<br />
die die Unbedenklichkeit für den Verbraucher belegten.<br />
Des weiteren konnten wir nachweisen,<br />
dass der Salat durch eine Ozonbehandlung nicht<br />
geschädigt wird. Parallel dazu wurde das Verhalten<br />
von E. coli, B. cereus, S. choleraesuis und L.<br />
monocytogenes in Keimsuspensionen gegenüber<br />
ozontem Wasser untersucht (Bild 5.14).<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
Im Verlauf dieses Projektjahres wurde die Effektivität<br />
von ozontem Wasser gegenüber den oben<br />
genannten Bakterien auf der Oberfläche von Salat<br />
untersucht. Dabei wurden sowohl der Effekt von<br />
ozontem Wasser auf einzelne Bakterienstämme<br />
untersucht, als auch die Wirkung bei Vorliegen<br />
einer Mischung aller 4 genannten Stämme. Dadurch<br />
sollten eventuell auftretende Synergieeffekte<br />
ermittelt werden. Die Vermutung, dass sich einzelne<br />
Stämme auf der Salatoberfläche anders verhalten<br />
als Keimmischungen, hat sich dabei bestätigt.<br />
Außerdem haben unsere Versuche ergeben, dass<br />
man aus dem Verhalten von Keimen in Lösung<br />
nicht auf das Verhalten derselben Keime auf der<br />
Salatoberfläche schließen darf.<br />
Des weiteren wurde festgestellt, dass ein dem<br />
Waschen mit ozontem Wasser vorgeschalteter<br />
Waschgang mit Leitungswasser die groben Verunreinigungen,<br />
die am Salat anhaften, entfernt, und<br />
die Ozonwirkung somit verbessert wird. /84/, /263/,<br />
/300/, /356/<br />
Bild 5.14: Inokulation eines Eisbergsalatblattes durch<br />
Eintauchen in Bakteriencocktail-Suspension<br />
Fig. 5.14: Inoculation of a Iceberg leaf through dipping<br />
into a bacterial “cocktail’ suspension
PC-Programm MELDOK 4.3 mit dem Schadbildkatalog<br />
(Projekt Nr.: 3.36)<br />
PC program MELDOK 4.3 including the program<br />
for quality defects<br />
Thomas Hoffmann (Abt. 3), Gerhard Wormanns<br />
(3), Andree Jacobs (3)<br />
BLE Bonn; VLK Bonn<br />
Förderung: Haushalt<br />
The PC program MELDOK (harmonized reporting<br />
documentation) developed at the <strong>ATB</strong> serves to<br />
collect and store data from official quality inspections<br />
of fruit, vegetables, citrus fruit, eggs and poultry<br />
on all trade levels. With this program, federal<br />
and state quality inspectors can examine agricultural<br />
products to ascertain their compliance with<br />
quality standards according to European (EG; Nr.<br />
1148/2001) or national regulations. In <strong>2003</strong>, the<br />
program version 4.3 was further developed, now<br />
including functions for risk analyses and the central<br />
database of companies.<br />
The first part of a special computer-program for<br />
quality defects of fruit, vegetables and potatoes<br />
was finished and supplied to the official quality<br />
inspections. Parts 2 and 3 are in process. Part 1<br />
contains approximately 770 pictures of quality<br />
defects of 14 agricultural products. The program<br />
supplies pictures for the 10 EU-defect types (skin<br />
and peel defects, disease, rot and physiological<br />
defects etc). Each picture of a quality defect is<br />
<strong>des</strong>cribed and commented (Fig. 5.15).<br />
II Fachlicher Teil 59<br />
Das PC-Programm MELDOK (vereinheitlichte Melde-Dokumentation)<br />
ist ein Programm zur einheitlichen<br />
Erfassung, Meldung und Auswertung von<br />
Daten der Qualitätskontrolle bei Obst, Gemüse,<br />
Zitrusfrüchten, Eiern und Geflügel auf allen Handelsstufen.<br />
Mit MELDOK sollen auf Kreis-, Lan<strong>des</strong>-<br />
und Bun<strong>des</strong>ebene alle qualitätsrelevanten Informationsanforderungen<br />
der Verordnung (EG) Nr.<br />
1148/2001, der EG-Verordnungen für Eier und<br />
Geflügel sowie nationaler Handelsnormen erbracht<br />
werden. Im Berichtsjahr wurde die Version 4.3<br />
entwickelt. Sie enthält die in allen EU-Mitgliedsstaaten<br />
verbindlich vorgeschriebene Risikoanalyse,<br />
einschließlich der zentralen Datenbank der<br />
Unternehmen.<br />
Hinzugekommen sind Funktionen zur Zusammenstellung<br />
und automatischen Meldung der geforderten<br />
Kontrolldaten an die Bun<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft<br />
und Ernährung (BLE) als koordinierende<br />
Behörde.<br />
Der 1. Teil <strong>des</strong> Schadbildkataloges mit Qualitätsmängeln<br />
bei Obst, Gemüse und Speisekartoffeln<br />
ist fertig gestellt und bun<strong>des</strong>weit an die Kontrollstellen<br />
ausgeliefert worden. Die Teile 2 und 3 werden<br />
voraussichtlich 2004 zur Verfügung stehen.<br />
Der Schadbildkatalog ist sowohl als Modul <strong>des</strong><br />
MELDOK-Programms als auch eigenständig nutzbar.<br />
Der 1. Teil enthält 770 Bilder zu Qualitätsmängeln<br />
von 14 ausgewählten Gutarten. Die Bilder<br />
dokumentieren Qualitätsmängel entsprechend den<br />
10 EU-Mängelgruppen (Haut- und Schalenfehler,<br />
Krankheit, Fäulnis und physiologische Mängel<br />
usw.). Jeder abgebildete Qualitätsmangel wird<br />
beschrieben und kommentiert (Bild 5.15).<br />
Bild 5.15: Hauptmaske <strong>des</strong> Schadbildkataloges<br />
Fig. 5.15: Main window of the program<br />
for quality defects<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
60<br />
Qualitätserhalten<strong>des</strong> Handling von Bioobst und<br />
Biogemüse im Einzelhandel und bei der Direktvermarktung<br />
(Projekt-Nr.: 6.42; 122)<br />
Quality maintenance of organic fruits and vegetables<br />
at retail and direct marketing<br />
Manfred Linke (Abt.6), Katrin Dumdei (6), Kathrin<br />
Müller (6), Christine Idler (1)<br />
HU Berlin; Bio Akademie, Langgöns<br />
Förderung: Haushalt; BMVEL/BLE<br />
Transpiration and degradation of compounds lead<br />
to quality loss of perishable horticultural crops in<br />
the postharvest chain, affecting the marketability<br />
rapidly. The objective of this study was to determine<br />
effects of different environmental conditions<br />
and various types of packaging (plastic boxes,<br />
cardboard boxes) on changes in postharvest quality<br />
of three organic produce such as tomatoes,<br />
strawberries and carrots.<br />
Taking strawberries as an example, the shelf life<br />
strongly depends on temperature and packaging.<br />
Fruits stored at a mean temperature of 19°C decayed<br />
faster than fruits held at 5°C.<br />
The higher air permeability of plastic boxes with<br />
polyethylene wrap (PE) had a positive effect on the<br />
shelf life of strawberries, but lead to an increase in<br />
the microbial activity (Fig. 5.16).<br />
Mangelnde Produktfrische stellt ein entscheiden<strong>des</strong><br />
Kaufhemmnis bei der Vermarktung von Bioobst<br />
und Biogemüse dar. Als zentraler Punkt aller<br />
Vermarktungsbemühungen wird die Optimierung<br />
der Ladengestaltung in Verbindung mit einem besonders<br />
sorgfältigen Handling der empfindlichen<br />
Produkte angesehen.<br />
Dazu verfügbare Informationen sind jedoch sehr<br />
allgemein formuliert, so dass die für ein qualitätserhalten<strong>des</strong><br />
Handling erforderlichen produkt- und<br />
prozessbezogenen Informationen bislang kaum<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Wasserverlust; water loss (%)<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
open carton and wrapped carton (500g), day: 20°C, night: 2°C<br />
advantages of wrapped cartons:<br />
- minimal water loss<br />
- turgescent sepals<br />
- existent fruit gloss<br />
- additionally day for sale<br />
fresh harvested<br />
open carton<br />
limit value for<br />
marketability<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90<br />
Zeit nach de Ernte; time after harvest (h)<br />
Im Rahmen <strong>des</strong> vom BMVEL geförderten Projektes<br />
wurden Qualitätsveränderungen von drei wichtigen<br />
Bioprodukten (Tomaten, Erdbeeren und<br />
Waschmöhren) in verschiedenen Verfahren der<br />
Aufbewahrung, Kurzzeitlagerung (nachts/Wochenende)<br />
und Verpackung untersucht, quantifiziert<br />
und produktoptimale Verfahren zur Handhabung<br />
während der Nachernte erarbeitet, sowie Resthaltbarkeiten<br />
bis zum Erreichen der Verderbgrenze<br />
bestimmt.<br />
Von besonderem wissenschaftlichen Interesse<br />
waren hierbei einzelne Aspekte der Haltbarkeit.<br />
Ein Arbeitspaket bezog sich auf äußere Produktparameter,<br />
die in engem Zusammenhang zum<br />
Wasserhaushalt der Produkte stehen. Ein weiterer<br />
Ansatz befasste sich mit dem Temperatur-<br />
/Zeitregime der inneren Abbauvorgänge (gemessen<br />
über die Atmungsaktivität) und damit mit Bestandteilen,<br />
die mit einer gesunden Ernährung in<br />
Zusammenhang stehen.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass sich Bioprodukte in<br />
ihrem Nachernteverhalten nicht grundlegend von<br />
konventionellen Produkten unterscheiden. Allerdings<br />
deuten die Versuchsreihen darauf hin, dass<br />
mikrobielle Aktivitäten einen weitaus größeren<br />
Einfluss auf die Nacherntequalität und Verkaufsfähigkeit<br />
von ökologisch erzeugten Produkten nehmen,<br />
als zunächst angenommen wurde.<br />
Anhand eines Erdbeerversuchs konnte u.a. gezeigt<br />
werden, dass die Wahl <strong>des</strong> Temperaturregimes<br />
einen wesentlichen Einfluss auf die Haltbarkeit<br />
ausübt. Erdbeeren, die bei einer mittleren<br />
Temperatur von 5°C aufbewahrt wurden, konnten<br />
im Vergleich zu Früchten, die bei 19°C gelagert<br />
wurden 54 Stunden länger frisch gehalten werden.<br />
Bei den Verpackungen zeigte sich, dass Früchte in<br />
folierten Schalen i.d.R. länger verkaufsfähig waren,<br />
aber aufgrund der erhöhten Feuchtigkeit in den<br />
Verpackungen durch Kondensation die Gefahr<br />
einer mikrobiellen Kontamination anstieg (Bild<br />
5.16). /118/, /162/, /245/, /295/<br />
wrapped carton<br />
Bild 5.16: Nachernteverhalten<br />
von Erdbeeren in unterschiedlichen<br />
Verpackungen<br />
Fig. 5.16: Shelf life of strawberries<br />
in different packaging units
Möglichkeiten zur Qualitätssicherung ökologisch<br />
erzeugter Gartenbauprodukte durch Koordinierung<br />
der Wertschöpfungsketten (Projekt<br />
Nr.: 6.41)<br />
Possibilities of quality protection of organic<br />
horticultural produce by coordination of value<br />
adding chains<br />
Martin Geyer (Abt. 6), Kathrin Müller (6)<br />
HU Berlin<br />
Förderung: Haushalt; BMVEL/BLE<br />
Post harvest losses, in particular of organic fruit<br />
and vegetables, are substantially. About 32 % of<br />
grown produce are lost in post harvest period.<br />
Among many other things, this can be attributed to<br />
problems of organisation and co-ordination in the<br />
delivering chains from grower to consumer. That’s<br />
why problem centred interviews were led with participants<br />
on different steps of different organic supply<br />
chains, with experts in Germany and supplementary<br />
also in Switzerland and in the Netherlands<br />
for finding out weak points related to quality and<br />
deducting references to improve the quality conservation<br />
in chains.<br />
As special weak points could be identified: the<br />
different views of quality of the participants, insufficient<br />
technical resources, less coordinated working<br />
process and the insufficient demand of the consumer.<br />
Solutions result from an increasing intensive communication<br />
and agreement of all participants, qualified<br />
employees on all steps, a common orientation<br />
of the working process on the need of a living,<br />
metabolising product and the protection of a closed<br />
cool chain. Necessary are also efforts to improve<br />
the demand of the consumer.<br />
Success in Switzerland is based on the clear position<br />
and the engagement of the food retail trade,<br />
as well as on structures, which make a stable balance<br />
of power between the participants and therefore<br />
a constructive dialogue possible.<br />
As special advantages of structures in the Netherlands<br />
are to be considered: the traditional professional<br />
production and the general effort of meeting<br />
and dialogue.<br />
Die Untersuchungen konzentrieren sich auf den<br />
besonderen Aspekt der Qualitätserhaltung ökologischer<br />
Produkte in der Nacherntephase entlang<br />
der gesamten Wertschöpfungskette.<br />
Die geschätzten Verluste von über 1/3 der Erntemengen<br />
können zu einem beträchtlichen Teil auf<br />
unorganisiertes, unkoordiniertes und dadurch wenig<br />
produktangepasstes Handeln der beteiligten<br />
II Fachlicher Teil 61<br />
Akteure zurückgeführt werden. Mittels qualitativer<br />
Interviews wurden Akteure typischer Lieferketten in<br />
Deutschland, und ergänzend dazu auch in der<br />
Schweiz und den Niederlanden, zu ihren Aktivitäten<br />
zum Qualitätserhalt befragt.<br />
Als besondere Schwachstellen konnten die verschiedenen<br />
Qualitätsbilder der Akteure, mangelhafte<br />
technische Ressourcen, wenig aufeinander<br />
abgestimmte Arbeitsabläufe sowie ungenügende<br />
Nachfrage durch den Verbraucher identifiziert werden.<br />
Lösungsansätze ergeben sich aus verstärkter<br />
Kommunikation und Absprache aller Marktbeteiligten,<br />
qualifizierten Mitarbeitern auf allen Ebenen,<br />
einer gemeinsamen Orientierung der Arbeitsabläufe<br />
an den Bedürfnissen eines lebendigen und<br />
stoffwechselnden Produktes inklusive der Sicherung<br />
einer geschlossenen Kühlkette. Als notwendig<br />
erachtet werden verstärkt Anstrengungen zur<br />
Förderung der Nachfrage.<br />
Schweizerische Erfolgsfaktoren sind die eindeutige<br />
Positionierung und das Engagement <strong>des</strong> LEH<br />
sowie Strukturen, die ein weitgehend ausgeglichenes<br />
Kräfteverhältnis der Kettenakteure und damit<br />
einen konstruktiven Dialog innerhalb der Ketten<br />
ermöglichen.<br />
Als besonderer Vorteil der niederländischen Strukturen<br />
wird die traditionell professionelle Produktion<br />
sowie auch hier das allseitige Bemühen um Dialog<br />
und Austausch angesehen. /304/<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
62<br />
Arbeitsgebiet: „Mensch und Arbeit“<br />
Bewertung von Arbeitsprozessen im Gartenbau<br />
mit Hilfe der dreidimensionalen Bewegungsanalyse<br />
(Projekt-Nr.: 6.32; 78)<br />
Work place <strong>des</strong>ign for horticultural harvest and<br />
post-harvest processes<br />
Martina Jakob (Abt. 6), Vladimir Ivanov (6), Martin<br />
Geyer (6)<br />
Förderung: Haushalt; DFG<br />
Horticultural work places can be objectively evaluated<br />
and <strong>des</strong>igned under ergonomic and economic<br />
aspects with a three-dimensional motion analysis<br />
system. A more detailed and objective comparison<br />
of different work place <strong>des</strong>igns is possible, looking<br />
at sum of motion, speed or acceleration of defined<br />
points on the worker’s body. The analyses of the<br />
data is done with a specific software which was<br />
continuously advanced within the past three years.<br />
It now offers a complex tool for many purposes of<br />
work place improvement. The year <strong>2003</strong> focussed<br />
on an ergonomic evaluation of two sitting work<br />
places on asparagus harvesting aids.<br />
In den vergangenen zwei Jahren konnten die<br />
Grundlagen für die arbeitswissenschaftliche Interpretation<br />
von aus Bewegungsanalysen stammenden<br />
3-D-Raumkoordinaten geschaffen werden. Die<br />
hierfür entwickelte Software wurde sukzessive in<br />
praxisnahen Versuchen erweitert und überprüft.<br />
Im Versuchsjahr <strong>2003</strong> lag der Schwerpunkt auf der<br />
Erarbeitung geeigneter Beurteilungskriterien zur<br />
ergonomischen Bewertung von Arbeitsplätzen.<br />
Ungünstige Körperhaltungen, repetitive und monotone<br />
Tätigkeiten sind kennzeichnend für die Arbeitsbedingungen<br />
von einfachen Ernte- und Aufbereitungstätigkeiten<br />
im Gartenbau und resultieren in<br />
einer hohen Belastung für die Arbeitskraft.<br />
In Zusammenarbeit mit dem Projekt zur Bewertung<br />
von Spargelernteverfahren wurden zwei Sitzarbeitsplätze<br />
auf dem Markt erhältlicher Spargelerntehilfen<br />
bewegungsanalytisch untersucht. Der für<br />
einen Sitzarbeitsplatz untypische Arbeitsbereich,<br />
nämlich der Spargeldamm, ist nur über Hilfen zu<br />
erreichen. Diese Hilfen sind bei den Sitzen unterschiedlich<br />
konstruiert und bestehen z.B. aus Knieschalen<br />
oder einer Lehne zur Oberkörperunterstützung<br />
(Knauf). Die Gültigkeit von Befragungen<br />
der Arbeitskräfte zum Komfortempfinden sollte<br />
anhand bewegungsanalytisch gewonnener Messgrößen<br />
überprüft werden.<br />
Über die bereits vorhandenen Kenngrößen hinaus<br />
wurden für die Auswertungssoftware Winkelfunktionen<br />
erarbeitet, die bei geeigneter Anbringung der<br />
Leuchtdioden eine automatische Körperhaltungsanalyse<br />
ermöglichen. Der daraus ermittelte Win-<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Qualität leichtverderblicher Produkte<br />
kelverlauf visualisiert und quantifiziert Harmonie<br />
und Effizienz in der Aufgabenausführung. Er kann<br />
auch auf mögliche von der Arbeit ausgehende<br />
Gesundheitsgefahren hindeuten.<br />
Der in Bild 5.17 dargestellte Verlauf <strong>des</strong> Oberkörperwinkels<br />
auf dem Sitz mit Oberkörperstütze (errechnet<br />
aus den an der Schulter, der Hüfte und<br />
dem Knie befestigten Leuchtdioden) zeigt einen<br />
deutlichen Unterschied abhängig von der Lage <strong>des</strong><br />
Spargels im Damm. Die rechts vom Körper liegenden<br />
Stangen zeigen die oberen drei Kurvenverläufe,<br />
der Knauf wird wie auf Bild 5.18 rechts umwunden.<br />
Die unteren sechs Kurven entsprechen<br />
dem linksseitigen Umwinden <strong>des</strong> Knaufes.<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
°<br />
Zeitverlauf/period of time<br />
Bild 5.17: Verlauf <strong>des</strong> Oberkörperwinkels bei einem<br />
Stechvorgang auf dem Sitz mit Knauf<br />
Fig. 5.17: Course of the upper body angle for cutting one<br />
spear on the seat with the upper body support<br />
Bild 5.18: Ernte<br />
auf dem Sitz mit<br />
Knauf<br />
Fig. 5.18: Harvest<br />
on the seat with<br />
the upper body<br />
support<br />
Die Auswertung der 3-D-Bewegungsdaten aus der<br />
Untersuchung der beiden Sitzplätze auf den Spargelerntehilfen<br />
zeigte deutliche Unterschiede in den<br />
Varianten auf. In der Gesamtbewertung erzielte<br />
der mit Kniepolstern ausgestattete Sitz die besseren<br />
Ergebnisse. Es wurden geringere Bewegungssummen<br />
aufgezeichnet, die Winkelverläufe zeigten<br />
eine größere Kongruenz und das Auftreten einer<br />
ungesunden Wirbelsäulenkrümmung war geringer.<br />
Die Ergebnisse stimmten mit der erfolgten Befragung<br />
der Probanden überein. /49/, /150/, /151/,<br />
/152/, /153/, /279/, /369/, /370/
Validieren und Bewerten verschiedener Ernte-<br />
und Aufbereitungsverfahren bei Spargel<br />
(Projekt-Nr. 6.35; 105)<br />
Evaluation of harvest and processing mechanisation<br />
of white asparagus<br />
Martin Geyer (Abt. 6), Sibylle Tischer (6), Martina<br />
Jakob (6)<br />
LVA Oppenheim; IGZ Großbeeren<br />
Förderung: Haushalt; BMVEL/BLE<br />
The increasing labor costs and the lack of labor<br />
supply have forced the asparagus farmers to introduce<br />
harvesting aids. Several self-driven machines,<br />
lifting and replacing the plastic film for up to<br />
5 rows, are available. The advantages of partly<br />
mechanized harvesting can be seen in the reduction<br />
of time, about 30 %, needed for harvest, in the<br />
improved organisation of the whole harvesting<br />
process, as well as in the load reduction for the<br />
workers through automatic plastic film handling,<br />
transport of boxes, reduced walking distances,<br />
partly automatic ridge care, partially existing seating<br />
facilities, the positive psychological effect of the<br />
machine on the working process and the weather<br />
protection. The use of harvesting aids is advisable<br />
for high yield, long ridges, "blind" cutting and not<br />
too heavy soil.<br />
Zur Reduzierung <strong>des</strong> Arbeitskräftebedarfs bei der<br />
Spargelernte werden verschiedene 1- bis 5-reihige<br />
teilmechanisierte Erntehilfen eingesetzt. Die Verfahren<br />
unterscheiden sich im Grad ihrer Mechanisierung.<br />
Generell ist das Folienhandling und der<br />
Transport der geernteten Spargelstangen automatisiert.<br />
Im Zeitraum <strong>2003</strong> wurden in verschiedenen<br />
Erwerbsanlagen vergleichende Arbeitsablaufanalysen<br />
der Stech- und der Ernteverfahren durchgeführt.<br />
Zeit h/ha / time h/ha<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
8,1 7,9<br />
6,5 6,4<br />
Handernte/<br />
basket<br />
10,1<br />
9,5<br />
Schiebew agen/<br />
pushcart<br />
II Fachlicher Teil<br />
5,4<br />
7,3<br />
einreihig/<br />
1-row<br />
Die Ermittlung <strong>des</strong> spezifischen Zeitbedarfs für das<br />
Stechen erbrachte für das Verfahren „blind“ gegenüber<br />
den Verfahren „teilblind“ und „freigraben“<br />
den größten Zeitvorteil. Der Zeitgewinn vermindert<br />
den Bedarf an AK/ha und ist Voraussetzung für<br />
den Einsatz eines teilmechanisierten Ernteverfahrens.<br />
Der Vergleich der Arbeitsabläufe zwischen Handernte<br />
und Teilmechanisierung verdeutlichte den<br />
zeitlichen Vorteil der Teilmechanisierung, insbesondere<br />
durch Wegfall <strong>des</strong> Folienhandlings bzw.<br />
der Transportarbeiten. Beim Vergleich <strong>des</strong> Arbeitsaufwan<strong>des</strong><br />
je Hektar für die verschiedenen<br />
Ernteverfahren zeigte sich ein deutlicher Vorteil<br />
von mehrreihigen Ernteverfahren mit großer Folienaushebelänge<br />
zur Handernte (Bild 5.19). Die<br />
in den Untersuchungen festgestellten Wartezeiten<br />
bei mehrreihigen Systemen konnten bei ungünstigen<br />
Konstellationen zwischen 8 % bis zu 50 % der<br />
Gesamtzeit betragen. Der Arbeitsablauf ist bei<br />
teilmechanisierten Ernteverfahren im Vergleich zur<br />
Handernte standardisierter, da der Bewegungsfluss<br />
durch die Maschine bestimmt wird.<br />
Am Saisonanfang sollte auf eine Mechanisierung<br />
verzichtet und exakt freigegraben werden. Wenn<br />
diese Phase beendet ist, kann teilmechanisiert<br />
geerntet und „blind“ gestochen werden. Bei geringen<br />
Erträgen im Saisonverlauf ist es vorteilhaft -<br />
soweit es die Spargelqualität zulässt - nur 1,5-<br />
oder 2-tägig zu ernten. /60/, /125/, /126/, /256/,<br />
/352/<br />
Ertrag/ yield<br />
9,6<br />
3,5<br />
100 kg/ha<br />
200 kg/ha<br />
300 kg/ha<br />
5,9<br />
mehrreihig/<br />
multi-row<br />
7,8<br />
Bild 5.19: Arbeitsaufwand<br />
ohne Wende- und Erholzeit<br />
für “blin<strong>des</strong>” Stechen mit<br />
verschiedenen Ernteverfahren<br />
Fig. 5.19: Total time without<br />
turning and recovery for<br />
cutting „blind“ with different<br />
harvesting aids<br />
63<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
64<br />
6 Verfahren zur Produktion und Nutzung<br />
nachwachsender Rohstoffe<br />
(Forschungsschwerpunkt 6)<br />
Processes for production and use of renewable<br />
raw materials<br />
(Koordinator: Eckart Kramer, Abt. 4)<br />
Im Arbeitsgebiet Biokonversion wurden im Berichtsjahr<br />
organisatorische, konzeptionelle sowie<br />
wissenschaftlich-technische Fortschritte erreicht.<br />
So wurden die Vorplanungen für die <strong>ATB</strong>-<br />
Pilotanlage zur Erzeugung von Milchsäure und<br />
ihren Folgeprodukten abgeschlossen. Der Baubeginn<br />
ist 2004 vorgesehen. Zur Praxisüberleitung<br />
hat sich eine Interessengemeinschaft gebildet und<br />
das Konzept einer komplexen „BioRaffinerie“ zur<br />
großtechnischen Erzeugung hochreiner Milchsäure<br />
und hochwertiger Folgeprodukte aus Roggen<br />
weiter entwickelt. Die Gemeinschaft aus juristischen<br />
und natürlichen Personen aus Forschung<br />
und Wirtschaft hat verschiedene Produktlinien<br />
einer BioRaffinerie technologisch und betriebswirtschaftlich<br />
bewertet sowie für die Vorzugsvariante<br />
eine umfassende Machbarkeitsstudie erarbeitet.<br />
Basierend auf „ordentlichen kaufmännischen<br />
Grundsätzen“, weist die Studie die Rentabilität <strong>des</strong><br />
Gesamtkonzeptes nach. Das Ministerium für<br />
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg hat die wirtschaftspolitische<br />
Bedeutung <strong>des</strong> Konzeptes festgestellt.<br />
Fortschritte wurden bei der weiteren Optimierung<br />
von Teilprozessen der Biokonversion erzielt. Der<br />
Forschungsansatz zur Reinigung von Milchsäure<br />
mit Membranen wurde auf Verunreinigungen aus<br />
Pflanzenpresssäften ausgedehnt, um diese als N-<br />
Quellen für Fermentationsprozesse zu nutzen.<br />
Erste hochreine Produktmuster werden 2004 dem<br />
Kooperationspartner IAP für die weitere Verarbeitung<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
Weiterhin konnten durch mikrobiologische screening-Verfahren<br />
neue Lactobacillus paracasei-<br />
Stämme identifiziert werden, welche höhere Ausbeuten<br />
in der Fermentation gewährleisten (phänotypische<br />
Optimierung). Diagnostische Methoden<br />
zur Identifizierung dieser Fermentationsstämme<br />
auf molekularer Ebene (genetischer „Fingerabdruck“)<br />
wurden erarbeitet. Zudem wurden die<br />
Grundlagen zur Entwicklung von gentechnisch<br />
veränderten Fermentationsstämmen und deren<br />
Nutzung in der Biokonversion am Beispiel der<br />
Produktion von artfremden, antibiotisch wirksamen<br />
Proteinen (Bacteriocine) in Escherichia coli etabliert.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe<br />
Auf dem Gebiet der Nutzung von Faserpflanzen<br />
wurden im letzten Jahr technische Optimierungen<br />
an der neu entwickelten Faseraufschlusslinie vorgenommen.<br />
Mit Hilfe eines Modells ließ sich die<br />
Trenngüte <strong>des</strong> neu gebauten „Kammschüttels“<br />
verbessern sowie das Abscheideverhalten systematisch<br />
beschreiben. Voruntersuchungen zur Steinerkennung<br />
sowie zu alternativen Schneidprinzipien<br />
werden mit Drittmittelfinanzierung 2004 fortgesetzt.<br />
Im Ergebnis umfangreicher Versuche im<br />
Großmaßstab wurde nachgewiesen, dass die Anlage<br />
verschiedene Bastfaserpflanzen in hoher<br />
Qualität aufschließt und eine hohe Faserausbeute<br />
auch unter Praxisbedingungen gewährleistet. Des<br />
weiteren wurde bei Untersuchungen zur Feucht-<br />
Konservierung und -Lagerung von Hanffasern eine<br />
Lösung für das Separieren hochwertiger Fasern<br />
vor der weiteren Verarbeitung entwickelt; das gesamte<br />
Verfahren wurde zum Patent angemeldet.<br />
Das Arbeitsgebiet der energetischen Nutzung<br />
nachwachsender Rohstoffe war im Berichtsjahr<br />
von arbeitsintensiven Grundlagenuntersuchungen<br />
sowie Vorbereitungen weiterer Versuche geprägt.<br />
So wurden umfangreiche Versuche zum Biogaspotenzial<br />
verschiedener Kulturpflanzen abgeschlossen.<br />
Nach abschließenden Bewertungen und ersten<br />
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen können<br />
sichere Anbauempfehlungen für bestimmte „Energiepflanzen“<br />
gegeben werden. Die Eignung von<br />
Biogas für den stabilen Betrieb zukünftiger dezentraler<br />
Brennstoffzellenkraftwerke ist Gegenstand<br />
neu begonnener Untersuchungen. Hierzu wurde<br />
eine Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle<br />
(PEMFC) in Betrieb genommen und erfolgreich<br />
getestet.<br />
Weiterhin wurden die umfangreichen Versuche zur<br />
Feldholzlagerung sowie zur Brikettierung pflanzlicher<br />
Reststoffe durch Pressen fortgesetzt. Neuere<br />
Modellannahmen zum Pressdruckbedarf für die<br />
Brikettierung von Reststoffen wurden hierbei durch<br />
umfassende Grundlagenuntersuchungen bestätigt.<br />
Des weiteren wurde nachgewiesen, dass sich der<br />
Gehalt an gesundheitsschädigenden Schimmelpilzen<br />
auf Feldholz durch Wahl der Lagerbedingungen<br />
signifikant verringern lässt. Zur Optimierung<br />
der Lagerbedingungen wurden funktionale Zusammenhänge<br />
für den Luftstömungswiderstand<br />
ermittelt, mit denen der Trocknungsverlauf von<br />
Holzhackgut optimiert werden kann.
Projekte zum Forschungsschwerpunkt 6<br />
Arbeitsgebiet: „Biokonversion“<br />
Gentechnische Optimierung der Bacteriocin-<br />
Synthese bei Milchsäurebakterien<br />
(Projekt-Nr. 1.29)<br />
Optimization and genetical engineering of bacteriocin<br />
synthesis in lactic acid bacteria<br />
Michael Klocke (Abt. 1)<br />
Technische Universität Berlin; Universität Potsdam<br />
Förderung: Haushalt<br />
Many microorganisms posses the ability to secrete<br />
antibiotic active pepti<strong>des</strong> (bacteriocins). In context<br />
with this project selected strains of Enterococcus<br />
faecium (e.g. strain 197a) were examined in order<br />
to characterize the production of their bacteriocins<br />
(= enterocins). Therefore a protocol for the preparation<br />
and purification of enterocins including a<br />
reversed phase HPLC were established. With this<br />
method two isoforms of enterocin B were isolated<br />
from the cell-free culture media of Ent. faecium.<br />
The dependence of enterocin B production on<br />
culture temperature as well as media additives<br />
such as detergents (e.g. Tween 80) were investigated.<br />
To avoid the problems caused by a culture-regime<br />
dependent enterocin production the genes for enterocins<br />
A, B and P were cloned into an expression<br />
vector and transformed into Escherichia coli. Successful<br />
expressions of recombinant enterocin A<br />
and P were obtained, the expression of enterocin<br />
B led to an inhibition of the host cells. Furthermore,<br />
a protocol for batch separation of recombinant<br />
enterocins was established.<br />
II Fachlicher Teil 65<br />
Zur Inhibierung konkurrierender Mikroorganismen<br />
können viele Bakterien antibiotisch wirksame Proteine<br />
(Bacteriocine) sekretieren. Im Rahmen dieses<br />
Projektes wurden die von ausgewählten<br />
Stämmen von Enterococcus faecium gebildeten<br />
Enterocine charakterisiert. Hierzu wurde ein Aufarbeitungsprotokoll<br />
mittels fraktionierter Ammoniumsulfat-Fällung<br />
und nachfolgender reverse phase<br />
HPLC etabliert (Bild 6.1). Mittels dieser Methode<br />
konnten aus Ent. faecium zwei Isoformen von Enterocin<br />
B isoliert werden. Die Beeinflussung der<br />
Produktion von Enterocin B durch Medienzusätze<br />
wie Tween 80 oder durch die Kultivierungstemperatur<br />
wurden untersucht. Während der Faktor<br />
Temperatur für die bakteriozide Aktivität ohne größere<br />
Bedeutung war, kann die Anwesenheit von<br />
Tween 80 das Aktivitätsspektrum in erheblichem<br />
Maße verändern.<br />
Weiterhin wurden die Gene für die Enterocin-<br />
Proteine, entA, entB und entP, isoliert und in einen<br />
Expressionsvektor kloniert. Die rekombinierten<br />
Vektoren wurden in Escherichia coli transformiert<br />
und zur Expression gebracht. Rekombinantes<br />
Enterocin-Protein konnte für alle drei Stämme<br />
nachgewiesen werden. Enterocin A und B erwiesen<br />
sich dabei als funktionell aktiv. Zur Aufreinigung<br />
der rekombinanten Proteine wurde ein Protokoll<br />
mit einem Verfahren zum Zellaufschluss<br />
sowie zur Reinigung über Cellulosepartikel etabliert.<br />
Bild 6.1: Reverse phase HPLC<br />
einer fraktionierten Ammoniumsulfat-Fällung<br />
zur präparativen Reinigung<br />
von Enterocinen mit nachfolgendem<br />
Inhibitionsassay zur Detektion<br />
der bakterioziden Aktivität: Es<br />
lassen sich zwei antibiotisch wirksame<br />
Fraktionen erkennen (RT max=<br />
29,8 bzw. 33,4 min).<br />
Fig. 6.1: Reverse phase HPLC of a<br />
fractioned ammonia sulfate precipitation<br />
for preparative purification<br />
followed by inhibition assays for<br />
detection of bacteriocide activity:<br />
Two fractions with bacteriocide<br />
activity were detected at retention<br />
time RTmax= 29,8 and 33,4 min.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
66<br />
Entwicklung diagnostischer PCR-Marker zur<br />
Diagnostik von biotechnologisch relevanten<br />
Mikroorganismen (Projekt-Nr. 1.38)<br />
Development of PCR-based assays for monitoring<br />
of biotechnological-relevant microorganisms<br />
Michael Klocke (Abt. 1)<br />
Hochschule Zittau/Görlitz (FH)<br />
Förderung: Haushalt<br />
The development of fermentation processes is<br />
tightly coupled with the application of new strains<br />
of microorganisms with well defined traits. Examples<br />
are the bioconversion of renewable materials<br />
to lactic acid through Lactobacillus paracasei (project<br />
1.36) as well as ensiling of plant biomass for<br />
forage purposes with the aid of a mixture from<br />
Lactobacillus plantarum and Lactobacillus rhamnosus<br />
(project 1.41). In context of these processes<br />
PCR-based assays for the detection and identification<br />
of process relevant microorganisms were developed.<br />
For fermentation strains of Lb. paracasei molecular<br />
fingerprints based on randomly amplified polymorphic<br />
DNA (RAPD) markers were generated<br />
(Fig. 6.2). Differential, strain specific PCR amplificates<br />
were cloned and sequenced in order to derive<br />
diagnostic PCR primers. These primers should<br />
enable the establishment of a more robust and<br />
specific PCR protocol for process control.<br />
For the bacteria Lb. plantarum and Lb. rhamnosus,<br />
common inoculants for ensiling purposes, 16S<br />
rDNA targeted PCR primers were developed. A<br />
PCR based assay for semi-quantitative detection<br />
of these species was established. This assay was<br />
applied in order to estimate the regime for the cocultivation<br />
in a single fermentation process of these<br />
bacteria instead of the recently applied time and<br />
cost intensive parallel cultivation).<br />
Die Entwicklung von Verfahren zur Fermentation<br />
ist eng gekoppelt mit der Verwendung von neuen<br />
Fermentationsstämmen mit bestimmten, stammspezifischen<br />
Eigenschaften. Beispielhaft hierzu ist<br />
die Biokonversion von nachwachsenden Rohstoffen<br />
zur Milchsäure mithilfe von Lactobacillus paracasei<br />
Stämmen (<strong>ATB</strong>-Projekt 1.36) oder die Silierung<br />
von pflanzlicher Biomasse zur Viehfuttererzeugung<br />
unter Verwendung von Starterkulturen<br />
von Lactobacillus plantarum und Lactobacillus<br />
rhamnosus (<strong>ATB</strong>-Projekt 1.41). Eine eindeutige<br />
Diagnostik dieser Stämme zur Prozesskontrolle,<br />
zur Stammhaltung oder zur Patentlegung ist mit<br />
konventionellen mikrobiologischen Nachweistechniken<br />
nur bedingt und wenn, dann nur äußerst<br />
arbeits- und zeitintensiv möglich. Im Rahmen <strong>des</strong><br />
Projektes P 1-38 sollen daher in enger Kooperati-<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe<br />
on mit den eingangs genannten Projekten Nachweissysteme<br />
für ausgewählte Fermentationsstämme<br />
unter Verwendung molekulargenetischer<br />
Markertechniken entwickelt werden.<br />
Für Fermentationsstämme von Lb. paracasei wurden<br />
zur Unterscheidung von anderen Lb. paracasei<br />
Stämmen Techniken zur Erzeugung von molekularen<br />
Fingerabdrücken mittels RAPD- (random<br />
amplified polymorphic DNA-) Markern etabliert.<br />
Insgesamt wurden 15 RAPD-Primer auf ihre Verwendbarkeit<br />
untersucht. Zur Entwicklung von optimierten<br />
Protokollen für die Polymerase-Kettenreaktion<br />
(= PCR) wurde weiterhin der Einfluß unterschiedlicher<br />
Parameter, wie z.B. Qualität und<br />
Quantität <strong>des</strong> DNA-Templates, auf das RAPD-<br />
Profil analysiert. Ein Protokoll zur Anwendung in<br />
der Prozesskontrolle wurde erarbeitet (Bild 6.2).<br />
Bild 6.2: Molekularer Fingerabdruck (RAPD) von verschieden<br />
Lb. paracasei-Stämmen. (H2O= Negativkontrolle<br />
ohne DNA-Template; St.= Größenstandard; bp=<br />
Basenpaare).<br />
Fig. 6.2: Molecular fingerprint based on randomly amplified<br />
polymorphic DNA markers of differnt strains of Lb.<br />
paracasei: (H 2O= negative control without DNA template;<br />
St.= DNA ladder; bp= base pairs).<br />
In einem weiteren Ansatz wurden für Lb. rhamnosus<br />
und Lb. plantarum anhand ihrer 16S rDNA<br />
Sequenzen artspezifische PCR-Primer entwickelt.<br />
Eine Methode zur semi-quantitativen Bestimmung<br />
dieser Arten via Multiplex-PCR wurde entwickelt.<br />
In einer Reihe von Assays wurde die Eignung dieser<br />
Primer für ein diagnostisches Nachweisverfahren<br />
untersucht. Ein Protokoll zur Anwendung wurde<br />
erstellt. In weiteren Arbeiten soll diese Methode<br />
zur Evaluierung eines Regimes zur parallelen Kultur<br />
dieser Stämme zur kostenkünstigen Erzeugung<br />
von Silage-Starterkulturen genutzt werden.
Grundlagen für Aufarbeitungsverfahren zur<br />
Herstellung hochreiner Milchsäure unter Berücksichtigung<br />
von Presssäften von Grünmassen<br />
(Projekt-Nr.: 1.43)<br />
Basics of down-streaming processes for the<br />
production of lactic acid of high-purity in consideration<br />
of press juices from green masses<br />
Winfried Reimann (Abt. 1)<br />
Förderung: EU (108 BESUB), Haushalt<br />
The aim of the project is to establish basics for the<br />
application of different processes of downstreaming<br />
for the production of lactic acid of highpurity<br />
after fermentation. Grains and green masses<br />
(press juices of lucerne and lupine) will be used for<br />
producing lactic acid within a fermentation process.<br />
Therefore a purification of lactic acid is necessary.<br />
As purification processes the application of several<br />
membrane techniques, e.g. ultrafiltration, diafiltration<br />
and electrodialysis with mono- and bipolar<br />
membranes, will be investigated.<br />
Bei der Fermentation zur Herstellung von Milchsäure<br />
aus Getreide unter Berücksichtigung von<br />
Presssäften von Grünmassen (Lupine, Luzerne)<br />
permeate flux l/m²*h; temperatue °C<br />
Permeatfluss l/m²*h; Temperatur °C<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
Fluss Temperatur Menge<br />
0<br />
0<br />
0 0,5 1<br />
Zeit h<br />
time hr<br />
1,5 2<br />
II Fachlicher Teil 67<br />
enthält die gewonnene Kulturfiltratlösung noch<br />
Inhaltsstoffe, die für bestimmte Einsatzgebiete der<br />
Milchsäure störend wirken. So wird zur Herstellung<br />
von Polylactiden eine hochreine Milchsäure benötigt,<br />
da Verunreinigungen sowohl die Dilactidsynthese<br />
als auch die Polymerisation stark beeinträchtigen.<br />
Als Maßstab für die Eignung fermentativ<br />
erzeugter Milchsäure dient für diesen Prozess<br />
kommerziell vertriebene Milchsäure mit Lebensmittelqualität.<br />
Deshalb besteht die Zielstellung darin,<br />
Grundlagen für den Einsatz verschiedener Aufarbeitungsverfahren<br />
wie Ultrafiltration, Diafiltration<br />
und Elektrodialyse mit mono- und bipolaren Membranen<br />
zur Herstellung hochreiner Milchsäure nach<br />
der Fermentation zu erarbeiten. Dazu erfolgen<br />
nach der Versuchsplanung experimentelle Versuchsdurchführungen<br />
im Labor- und Technikummaßstab<br />
mit chemischen Analysen der Aufarbeitungsprodukte.<br />
Die Untersuchungen wurden im September <strong>2003</strong><br />
begonnen. Erste Ergebnisse liegen zum Permeatfluss<br />
bei der Abtrennung der Biomasse durch<br />
Ultrafiltration aus der Fermentationsbrühe beim<br />
Einsatz von Luzernepresssaft vor (Bild 6.3). Mit<br />
einer organischen Hohlfasermembran wurde ein<br />
mittlerer Fluss von über 70 l/m²*h erzielt.<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
Permeatmenge l<br />
volume of permeate l<br />
Bild 6.3: Permeatfluss, Temperatur<br />
und Permeatmenge<br />
während der Abtrennung von<br />
Biomasse aus der Fermentationsbrühe<br />
durch Ultrafiltration<br />
unter Berücksichtigung<br />
von Luzernepresssaft in<br />
Abhängigkeit von der Zeit<br />
(Membran: MD 020 UP 03N;<br />
Druck: 1,5 bar)<br />
Fig. 6.3: Evolution of permeate<br />
flux, temperature and<br />
volume of permeate vs. time<br />
during separation of biomass<br />
from fermentation broth in<br />
consideration of press juice<br />
of lucerne by ultrafiltration<br />
(membrane:<br />
MD 020 UP 03N; pressure:<br />
1.5 bar)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
68<br />
Biochemikalien und Energie aus der nachhaltigen<br />
Nutzung von pflanzlichen Biomassen<br />
(Projekt-Nr.: 1.36/108)<br />
Biochemicals and energy from sustainable<br />
utilisation of herbaceous biomass (BESUB)<br />
Joachim Venus (Abt. 1)<br />
Biopos e.V. Teltow; BioRefinery.de Potsdam; Universität<br />
Heidelberg; The Icelandic Biomass Company<br />
Ltd. Reykjavik (Island); Agricultural Research<br />
Institute Reykjavik (Island), tetra Ingenieure GmbH<br />
Neuruppin; Beltra Forestry Ltd. Newport (Irland)<br />
Förderung: Haushalt; EU<br />
The aim of <strong>ATB</strong>’s research within this project is to<br />
create a new lactic acid production process using<br />
starchy crops (grains) and green plants (lucerne,<br />
lupine) as raw materials. The fermentation including<br />
all up- and down-stream steps will be adapted<br />
to an esterification process for producing ethyl<br />
lactate. The utilisation of by-products and wastes<br />
for energy generation will be integrated into the<br />
whole process. Mass and energy balances, cost<br />
estimation and recommendations for technological<br />
<strong>des</strong>ign of the integrated process will be given.<br />
Im Rahmen dieses Verbundprojektes wird am <strong>ATB</strong><br />
ein neues Verfahren zur fermentativen Herstellung<br />
von Milchsäure entwickelt, welches auf stärkehaltigen<br />
Pflanzen (Getreide) und Grünmassen (Luzerne,<br />
Lupine) als Rohstoffen basiert. Einschließlich<br />
aller up- und down-stream Prozesse wird die<br />
Fermentation an die Anforderungen einer nachfolgenden<br />
Veresterung zur Erzeugung von Ethyllactat<br />
angepasst. Die Verwendung von Nebenprodukten<br />
und Abfällen zur Energiegewinnung wird in den<br />
Gesamtprozess integriert, so dass auf Basis von<br />
Massen- und Energiebilanzen Abschätzungen zur<br />
Wirtschaftlichkeit und technischen Umsetzung <strong>des</strong><br />
Verfahrenskonzeptes möglich sind.<br />
Am Beginn einer jeden Verfahrensentwicklung für<br />
biotechnologische Prozesse steht die Auswahl<br />
eines geeigneten Biokatalysators (Mikroorganismen,<br />
Zellen, Enzyme). Im vorliegenden Fall wurde<br />
die Selektion und Charakterisierung von geeigneten<br />
Milchsäurebakterien durchgeführt, die anschließend<br />
auf ihre Eignung als zukünftige Produktionsstämme<br />
getestet wurden. In mehreren<br />
Schritten erfolgte die phänotypische Optimierung<br />
<strong>des</strong> aus dem Screening hervorgegangenen Stammes<br />
Lactobacillus paracasei 168 mit Festlegung<br />
der Fermentationsparameter (Temperatur, pH-<br />
Wert) sowie nachfolgender Variation der Substrate<br />
aus Getreide und Grünmassen. Die Entwicklung<br />
eines zunächst diskontinuierlichen Fermentationsprozesses<br />
schließt neben der mikrobiellen Stoff-<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe<br />
wandlung auch die Substratvorbereitung (Aufschluss<br />
stärkehaltiger Rohstoffe wie Getreide,<br />
Proteinextraktion aus Grünmassen) und die Aufarbeitungsstufen<br />
für das Produkt (Reinigung, Aufkonzentrierung<br />
der Milchsäure) ein. Für die Bewertung<br />
der Leistungsfähigkeit gibt es verschiedene<br />
Kenngrößen, die sowohl auf primären (z.B.<br />
erreichbare Endkonzentration an Milchsäure, Restkonzentration<br />
an Glucose, Fermentationsdauer)<br />
als auch sekundären Messwerten (z.B. Produktbildungs-,<br />
Wachstums- und Substratverbrauchsgeschwindigkeit,<br />
Produktivität) basieren. Im nachfolgenden<br />
Bild 6.4 sind typische Zeitverläufe für die<br />
drei wichtigsten Messgrößen einer Fermentation<br />
dargestellt.<br />
Bild 6.4: Konzentrations-Zeit-Verläufe für die Biomasse<br />
X, das Substrat S und das Produkt P<br />
Fig. 6.4: Concentration-time-course of the biomass X,<br />
the substrate S and the product P<br />
Ein wesentliches Ergebnis der bisherigen Untersuchungen<br />
besteht darin, dass sowohl die C- als<br />
auch die N-Quelle als Nährstoffgrundlage für die<br />
Milchsäurebakterien aus den Agrarrohstoffen bereitgestellt<br />
werden können. Die erreichbaren Ausbeuten<br />
an Milchsäure als Produkt sind mit denen<br />
auf Standardnährmedien vergleichbar, welche<br />
jedoch aus wirtschaftlichen Gründen für eine technische<br />
Umsetzung nicht verwendbar sind. /333/,<br />
/334/, /401/
Arbeitsgebiet: „Faseraufbereitung“<br />
Maschine für den Faseraufschluss von Hanf-<br />
und Flachsstroh mit integrierter Schäbentrennung<br />
(Projekt-Nr.: 3.47; 104)<br />
Fibre decortication machine for hemp and flax<br />
straw with integrated hurd separation<br />
Christian Fürll (Abt. 3), Friedrich Munder (3), Heinz<br />
Hempel (3)<br />
Kranemann Gartenbaumaschinen GmbH<br />
Förderung: Haushalt; BMWi/AiF<br />
A new machine line for processing of bast fibre<br />
plants was established in a pilot scale for testing<br />
the developed working principles in practical operation<br />
and to get ensured data of the process<br />
economy.<br />
Hemp, flax and linseed are processed with the<br />
same technology that suits both freshly harvested<br />
green and retted plants. The process inclu<strong>des</strong> all<br />
stages from the reception of the straw bales to the<br />
cleaned final products, which are fibres and<br />
shives.<br />
The fibre yield is 23 to 27 % in hemp, 27 to 30 %<br />
in flax and 17 to 23 % of linseed. The remaining<br />
shive content is less than 2 % mostly.<br />
The fibre length distribution varies in the range of<br />
10 to 250 mm (Fig. 6.5). A defined shortage of the<br />
fibres is possible in the range of 4 to 50 mm.<br />
Um gesicherte Daten zum Betrieb und zur Wirtschaftlichkeit<br />
zu ermitteln, wurde eine komplette<br />
Anteil der Fasern in der Längenklasse %<br />
Percentage of fibre in length class %<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
II Fachlicher Teil 69<br />
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290<br />
Mittlere Faserlänge der Klassen mm<br />
Mean fibre length of class mm<br />
Maschinenlinie zum Aufschluss von Bastfaserpflanzen<br />
im Pilotmaßstab eingerichtet. Hanf,<br />
Flachs und Ölleinen werden mit der gleichen Technologie<br />
verarbeitet, die sowohl für frisch geerntetes<br />
Faserpflanzenstroh als auch für geröstetes geeignet<br />
ist.<br />
Der Prozess enthält alle notwendige Stufen von<br />
der Annahme der Ballen bis zu den gereinigten<br />
Endprodukten, den Fasern und den Schäben. Die<br />
Faserausbeute beträgt 23 bis 27 % bei Hanf, 27<br />
bis 30 % bei Flachs und 17 bis 23 % bei Ölleinen.<br />
Die natürlichen mechanischen Eigenschaften der<br />
Fasern, wie die Feinheit, Zugspannung, Dehnung<br />
und Elastizitätsmodul werden durch die Verarbeitung<br />
nur unwesentlich beeinträchtigt.<br />
Die einstufige Reinigung reduziert den Restschäbengehalt<br />
von ungerösteten Fasern und von geröstetem<br />
Hanf auf weniger als 4% und der nachfolgende<br />
Sägezahnöffner bewirkt eine weitere<br />
Reinigung auf < 2 % Schäbengehalt.<br />
Die Länge der technischen Langfasern variiert in<br />
einem weiten Bereich. Eine typische Längenverteilung<br />
der Fasern ist im Bild 6.5 dargestellt. Diese<br />
erfüllt die Anforderungen der häufigsten technischen<br />
Anwendungen.<br />
Oft erfordern spezielle Anwendungsfälle ein weiteres<br />
Einkürzen der Fasern. Eine speziell hergerichtete<br />
Schneidmaschine schneidet die Fasern in<br />
eine definierte Nennlänge, die im Bereich von 4 bis<br />
50 mm einstellbar ist. /2/, /23/, /24/, /123/, /176/,<br />
/177/, /178/, /179/, /180/, /181/, /212/, /218/, /252/,<br />
/253/, /305/, /307/, /308/, /309/, /310/, /311/, /349/,<br />
/350/, /351/, /375/, /387/<br />
Hanf / Hemp<br />
Flachs / Flax<br />
Ölleinen / Linseed<br />
Mittlere Faserlänge<br />
Mean fibre length<br />
Hanf / Hemp: 118 mm<br />
Flachs / Flax: 72 mm<br />
Ölleinen / Linseed: 55 mm<br />
Bild 6.5: Längenverteilung<br />
der langen Fasern<br />
Fig. 6.5: Length distribution<br />
of long fibres<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
70<br />
Verfahrenstechnische Untersuchungen zur<br />
Reinigung von aufgeschlossenen Naturfasern<br />
(Projekt-Nr.: 3.34; 102)<br />
Process investigations into cleaning separated<br />
natural fibres<br />
Ralf Pecenka (Abt. 3), Christian Fürll (3)<br />
BTU Cottbus; TITK Rudolstadt; Diakonie Gotha<br />
Förderung: Haushalt, MWFK Brandenburg<br />
The technology of fibre separation from bast fibre<br />
straw such as hemp and flax has been investigated<br />
in a pilot plant. A new decortication principle<br />
using impact stress has been successfully realized<br />
in this plant. The practical operation has shown<br />
that the <strong>ATB</strong>-decorticator simplifies the cleaning<br />
process considerably. For detailed investigations<br />
of the cleaning process, an experimental comb<br />
shaker has been developed and is tested at present.<br />
A hurd content of approx. 7 mass-% has<br />
been obtained in cleaning tests at a mass throughput<br />
of 1.5 up to 2 t/h d.m. of decorticated hemp<br />
fibres with the comb shaker (respectively 3 t/h d.m.<br />
hemp straw for the decorticator). Furthermore, a<br />
machine model has been developed to predict the<br />
mass flow through the cleaning machine and the<br />
hurd content after cleaning (Fig. 6.6 and 6.7). This<br />
model is used for the optimisation of the machine<br />
<strong>des</strong>ign and to plan further experiments.<br />
Der praxisnahe Betrieb einer am <strong>ATB</strong> entwickelten<br />
Pilotanlage zur Fasergewinnung hat gezeigt, dass<br />
der Prallaufschluss eine Vielzahl von verfahrenstechnischen<br />
und ökonomischen Vorteilen bietet.<br />
Für die Faserreinigung sind insbesondere die bereits<br />
während der Entholzung stattfindende Vorreinigung<br />
<strong>des</strong> Faser-Schäben-Gemischs, der hervorragende<br />
Aufschlussgrad und die gute Auflockerung<br />
der Faserflocken hervorzuheben. Der Eingangsmassestrom<br />
für die Faserreinigung beträgt<br />
bis zu 1,8 t/h Faser-Schäben-Gemisch, bei einer<br />
Faserlänge von max. 30 cm. Untersuchungen zu<br />
verschiedenen Reinigungsverfahren ergaben,<br />
dass sich Zinkenschüttler (Kammschüttel) effizient<br />
als erste Reinigungsstufe einsetzen lassen. Deshalb<br />
wurde am <strong>ATB</strong> ein Versuchskammschüttel<br />
entwickelt, an der derzeit umfangreiche Untersuchungen<br />
zur konstruktiven Gestaltung, günstigen<br />
Betriebsbedingungen und dem Trennverhalten <strong>des</strong><br />
Faser-Schäben-Gemischs durchgeführt werden.<br />
Auf dieser Grundlage wurde ein Modell für den<br />
Massestrom und das Abscheideverhalten entwickelt,<br />
das die Planung weiterer Versuche zur Ermittlung<br />
optimaler Reinigungsbedingungen erleichtert.<br />
Wesentliche geometrische Modellparameter<br />
sind in Bild 6.6 dargestellt. Die Untersuchungen<br />
haben gezeigt, dass insbesondere der vorwärtsge-<br />
richtete Schüttelwinkel φ f, die Schüttelfrequenz f<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe<br />
und die Neigung γ <strong>des</strong> Gesamtsystems den Massestrom<br />
und das Reinigungsergebnis bestimmen.<br />
l<br />
h<br />
c<br />
1 2 3 n<br />
φ b φ f<br />
φ a<br />
s<br />
Bild 6.6: Geometrische Einflussfaktoren im Kammschüttel.<br />
Fig. 6.6: Geometrical boundaries in a comb shaker.<br />
Mit Hilfe <strong>des</strong> Maschinenmodells können Vorgaben<br />
für eine kostengünstige konstruktive Gestaltung<br />
von Kammschütteln in Abhängigkeit von der gewünschten<br />
Verarbeitungskapazität und <strong>des</strong> Restschäbengehalts<br />
nach der Reinigung erstellt werden.<br />
Die in Bild 6.7 dargestellten Ergebnisse eines<br />
Regressionsmodells für die Schäbenabscheidung<br />
über die Sieblänge der Kammschüttel zeigt bereits<br />
eine gute Übereinstimmung von Versuchsergebnissen<br />
und Modell.<br />
Bild 6.7: Restschäbengehalt in Abhängigkeit vom Schüttelwinkel<br />
der Zinken und der Sieblänge.<br />
Fig. 6.7: Hurd content in dependence on the shaking<br />
angle of the combs and the screen length.<br />
Mit der bestehenden Versuchseinrichtung kann ein<br />
Massestrom von 1,5 – 2 t/h verarbeitet werden. Bei<br />
der Reinigung von Hanffasern werden Restschäbengehalte<br />
von unter 7 M-% bei einem Faserfehlaustrag<br />
von ca. 5 M-% (Kurzfasern mit einer Faserlänge<br />
unter 1,5 cm) erzielt. /14/, /86/, /87/, /88/,<br />
/215/, /306/, /313/, /314/, /315/, /386/, /388/<br />
a<br />
γ
Konservierung und Lagerung von Hanffasern<br />
(Projekt-Nr: 1.28)<br />
Preservation and storage of hemp fibre<br />
Christine Idler (Abt. 1); Ralf Pecenka (3)<br />
Förderung: Haushalt<br />
The conventional production of hemp fibres is<br />
based on the retting. At the usual harvest date in<br />
September, weather conditions are often detrimental<br />
to processing of harvested hemp. At the Institute<br />
of Agricultural Engineering a weatherindependent<br />
postharvest technique is under investigation.<br />
The harvest of hemp by means of chopper<br />
followed by anaerobic storage is favourable for the<br />
farmer, because the weather risk can be avoided.<br />
Additional steps are the same as for ensiling.<br />
Für die Fasergewinnung existieren aufwendige<br />
Aufbereitungsverfahren. Sie haben alle zum Ziel,<br />
die Fasern von den Schäben (den Holzbestandteilen<br />
und sonstigen Pflanzenbestandteilen) zu trennen<br />
und beide Komponenten einzeln zu verwerten.<br />
Bei den gängigen Verfahren muss das Naturfaserstroh<br />
hierfür vor der Aufbereitung auf lagerfähige<br />
Feuchtegehalte heruntergetrocknet werden. Die<br />
Trocknung erfolgt allgemein auf dem Feld, wodurch<br />
die Qualität <strong>des</strong> Naturfaserstrohs stark von<br />
der Witterung abhängig ist.<br />
Ein Verfahren, bei dem diese Witterungsabhängigkeit<br />
ausgeschlossen wird, ist im <strong>ATB</strong> entwickelt<br />
Häckseln aus dem Bestand<br />
Harvesting by chopping<br />
Separieren entholzter Fasern<br />
Seperate decorticated fibres<br />
Bild 6.8: Ernte und Verarbeitung für Faserpflanzen<br />
Fig. 6.8: Harvest and processing for fibre plant<br />
II Fachlicher Teil 71<br />
und in der Offenlegungsschrift DE 197 56 046 A1<br />
(Patentanmeldung vom <strong>ATB</strong>) beschrieben worden.<br />
Bei diesem Nassverfahren wird Hanf bei der Ernte<br />
gehäckselt und anschließend konserviert. Das<br />
Trennen der Klebeverbindung zwischen Fasern<br />
und Schäben kann z.B. mit einer Scheibenmühle<br />
erfolgen, wobei bei diesem Verfahren die gesamte<br />
aufgefaserte Pflanzenmasse für die Herstellung<br />
von Produkten genutzt wird. Ungelöst blieb bisher<br />
das Separieren hochwertiger Fasern vor der weiteren<br />
Verarbeitung.<br />
In Weiterentwicklung dieses Verfahrens wurde<br />
eine neue Kombination geeigneter Verfahren zum<br />
Häckseln, zum Separieren feuchter Fasern aus<br />
dem Häckselgut und zur Konservierung <strong>des</strong><br />
verbleibenden Restfaser-Schäben-Gemischs erarbeitet<br />
und zum Patent angemeldet.<br />
Aus dem erntefrischen Häckselgut werden die<br />
freigelegten Fasern durch Sieb- oder Sichtverfahren<br />
getrennt und sowohl die Fasern, als auch das<br />
verbliebene Restfaser-Schäben-Gemisch getrennt<br />
verarbeitet (vgl. Bild 6.8).<br />
Ein effektives Separieren von Fasern aus dem<br />
Häckselgut kann vorzugsweise mit einem Zinkenschüttler<br />
realisiert werden. Das Verfahren kann<br />
allgemein für alle Naturfaserpflanzen angewendet<br />
werden. Das Restfaser-Schäben-Gemisch kann<br />
konserviert und zu Endprodukten wie Baustoffen,<br />
Dämmstoffen, Verbundwerkstoffen oder Verpackungsmaterialien<br />
verarbeitet werden.<br />
Trocknen der Fasern<br />
Fibre drying<br />
Konservieren Konservieren <strong>des</strong> <strong>des</strong> Rest-Faser-<br />
Rest-Faser-<br />
Schäben-Gemisches<br />
Schäben-Gemisches<br />
Preservation Preservation of of the the mixture mixture of<br />
of<br />
remaining remaining fibres fibres and and shives<br />
shives<br />
Verarbeitung zu Endprodukten<br />
Processing to end products<br />
Verarbeitung zu Endprodukten<br />
Processing to end products<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
72<br />
Arbeitsgebiet: „Energetische Nutzung“<br />
Untersuchungen zum Einsatz von Biogas in<br />
PEM-Brennstoffzellen (Projekt-Nr.: 3.42)<br />
Investigation of use of biogas in PEM fuel cells<br />
Volkhard Scholz (Abt. 3); Bernd Linke (1); Hans<br />
Jürgen Hellebrand (2)<br />
Förderung: Haushalt<br />
A test stand of a polymer electrolyte membrane<br />
(PEM) fuel cell for biogas was recently put into<br />
operation. This stand consists of two stacks, 200<br />
and 600 Wel, and of a steam reformer. It is equipped<br />
by comfortable measuring hardware and software<br />
(Fig. 6.9). The objective of this project is to<br />
prove that biogas fed PEM fuel cells are competitive<br />
to conventional combined heating power systems<br />
and to other types of fuel cells concerning<br />
energy efficiency, ecology and economy.<br />
Mitte <strong>des</strong> Jahres <strong>2003</strong> wurde im <strong>ATB</strong> eine Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle<br />
(PEM) für<br />
Biogas in Betrieb genommen. Die ersten Tests<br />
wurden erfolgreich durchgeführt. Dieser Laborversuchsstand,<br />
der gemeinsam mit der Fa. Schalt-<br />
und Regeltechnik GmbH Berlin konzipiert und<br />
aufgebaut wurde, besteht im wesentlichen aus<br />
zwei separaten Brennstoffzellenstacks zu 200 und<br />
600 Wel sowie einem in den USA entwickelten<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe<br />
Dampfreformer. Er ist mit umfangreicher Messtechnik<br />
und Software ausgestattet, die insgesamt<br />
60 Messgrößen aufzeichnet und auswertet und<br />
durch entsprechende Gasanalytik für Bio-, Reformat-<br />
und Abgas ergänzt wird (Bild 6.9). Das Biogas<br />
wird in dem institutseigenen Pilotfermenter<br />
erzeugt bzw. aus landwirtschaftlichen Biogasanlagen<br />
bezogen.<br />
Der verwendete Brennstoffzellentyp ist eine Niedertemperaturzelle<br />
(< 90 °C), die vergleichsweise<br />
geringe Kosten und ein sehr dynamisches Betriebsverhalten<br />
aufweist. Im Leistungsbereich<br />
< 100 kWel, wie er in landwirtschaftlichen Biogasanlagen<br />
vorherrscht, besitzen PEM-Brennstoffzellen<br />
zahlreiche Vorzüge, die einen Einsatz in mehrfacher<br />
Hinsicht lohnenswert erscheinen lassen.<br />
Ziel dieses Projektes ist es nachzuweisen, dass<br />
die PEM-Brennstoffzelle für die Verstromung von<br />
Biogas technisch geeignet ist und mittelfristig mit<br />
konventionellen Blockheizkraftwerken und anderen<br />
Brennstoffzellentypen energetisch, ökologisch und<br />
wirtschaftlich konkurrieren kann. Neben dem Wirkungsgrad<br />
der einzelnen Baugruppen und <strong>des</strong>sen<br />
Abhängigkeit von der Rohgaszusammensetzung<br />
(CH4, CO2, O2, H2O) soll auch der Einfluss der<br />
Spurengase, der sog. Brennstoffzellengifte (CO,<br />
H2S, COS, NH3 etc.), auf Reformer und Zellen<br />
ermittelt werden, um rückwirkend geeignete Gärsubstrate<br />
und Gärtechnologien identifizieren zu<br />
können. /59/, /100/, /223/<br />
Bild 6.9: PEM-Brennstoffzellen-<br />
Versuchstand für Biogas<br />
Fig. 6.9: PEM fuel cell test stand for biogas
Energielandwirtschaft – Potenzial und Risiko<br />
bei Biogas (Projekt-Nr.: 100)<br />
Energy farming – potential and risk of biogas<br />
Matthias Plöchl (Abt. 2), Monika Heiermann (2),<br />
Bernd Linke (1)<br />
Eco Naturgas GmbH Berlin<br />
Förderung: BMWI/AiF<br />
The aim of the project was the economic and ecological<br />
assessment of providing herbaceous cosubstrates<br />
for anaerobic digestion considering the<br />
conditions of the State of Brandenburg. There<br />
were three focuses:<br />
1. Lab-scale experiments in order to determine<br />
the methane yield of these co-substrates (batch<br />
approaches as well as continuous-flow approach)<br />
2. Cost analysis of cultivation, harvest and storage<br />
of these co-substrates<br />
3. Balancing greenhouse gases and energy fluxes<br />
of all process steps of provision<br />
The project was finished during the report period.<br />
Ziel <strong>des</strong> Projekts war eine ökonomische und ökologische<br />
Bewertung der Bereitstellung (Anbau,<br />
Bergung und Lagerung) pflanzlicher Kosubstrate<br />
zur Biogaserzeugung mittels Nassvergärung in<br />
landwirtschaftlichen Anlagen Brandenburgs. Dabei<br />
wurden drei Schwerpunkte beachtet:<br />
1. Laborversuche zur Ermittlung der Methanausbeuten<br />
pflanzlicher Kosubstrate (batch-<br />
Ansatz, kontinuierlicher Ansatz)<br />
2. Analyse der Kosten für Anbau, Bergung und<br />
Lagerung dieser Kosubstrate<br />
3. Bilanzierung der Stoff- und Energieflüsse für<br />
die drei Verfahrensabschnitte<br />
Das Projekt wurde im Berichtsjahr abgeschlossen.<br />
Die Gärversuche haben gezeigt, dass ein breites<br />
Spektrum anbauwürdiger Pflanzen zur Verfügung<br />
steht, welche als Kosubstrate die Biogasproduktion<br />
erheblich steigern können. In den Batchversuchen<br />
wurden für die eingesetzten Substrate Biogasausbeuten<br />
von 0,4 bis 1,0 m³⋅kg -1 oTS ermittelt.<br />
Bei einem durchschnittlichen Methangehalt von<br />
66 % werden somit 0,30 bis 0,66 m³ CH4⋅kg -1<br />
oTS erhalten. Raps hat mit weniger als 0,20 m³<br />
CH4⋅kg -1 oTS eine deutlich geringere Methanausbeute.<br />
Neben Raps bilden Hanf und Topinambur<br />
die geringste Menge Methan pro Einheit organischer<br />
Trockensubstanz. Die besten Ergebnisse<br />
werden mit Mais, Gras und Gerste erhalten. Roggen,<br />
Triticale und Luzerne liegen im Mittelfeld.<br />
Die zum Abschluss <strong>des</strong> Projekts durchgeführten<br />
kontinuierlichen Laborversuche haben den Batch-<br />
II Fachlicher Teil 73<br />
Versuchen vergleichbare Ergebnisse geliefert.<br />
Dies unterstreicht, dass Batch-Versuche eine adäquate<br />
Methode zur Feststellung der maximal möglichen<br />
Methanerträge von Substraten sind. Die<br />
kontinuierlichen Laborversuche finden unter idealen<br />
Bedingungen statt, d.h. optimal gerührt und mit<br />
niedriger Raumbelastung. Deshalb ist zu erwarten,<br />
dass unter Praxisbedingungen meist deutlich niedrigere<br />
Werte erreicht werden.<br />
Für die ökonomische Analyse wurde die derzeitig<br />
am weitesten verbreitete Produktions- und Nutzungsvariante<br />
gewählt: Nassvergärung von Gülle<br />
und Kosubstraten, anschließende Verbrennung im<br />
Blockheizkraftwerk und Einspeisung <strong>des</strong> erzeugten<br />
Stroms ins öffentliche Netz mit Erlösen, die<br />
sich nach dem EEG ergeben. Die Mittelwerte der<br />
Stromgestehungskosten liegen für alle untersuchten<br />
Fruchtarten in der Nähe <strong>des</strong> point of break<br />
even, d.h. in einigen Fällen kann unter Standardbedingungen<br />
ein Gewinn erzielt werden, für<br />
viele Fruchtarten müssen Optimierungspotenziale<br />
genutzt werden, um die Biogasproduktion und<br />
-nutzung wirtschaftlich sinnvoll durchzuführen.<br />
Aus der ökonomischen Analyse ergibt sich folgende<br />
Reihenfolge für die Einsatzwürdigkeit der untersuchten<br />
Kosubstrate (in der Regel als Silage):<br />
Gras (Silage vor Frischmasse), Gerste, Mais, Luzerne,<br />
Roggen, Triticale, Raps, Topinambur und<br />
Hanf.<br />
Die CO2-Äquivalent-Bilanz der Biogasproduktion<br />
und –nutzung ist im Vergleich zur Strom- und<br />
Wärmeproduktion aus fossilen Energiequellen als<br />
positiv zu bewerten: die Ökobilanz der Strom- und<br />
Wärmeproduktion aus Braunkohle kann mit etwa<br />
510 g CO2 eq⋅kWh -1 oder die von Erdgas in BHKW<br />
mit etwa 370 g CO2 eq⋅kWh -1 angesetzt werden. Im<br />
Vergleich dazu –600 g CO2 eq⋅kWh -1 im günstigsten<br />
Fall bei der Erzeugung von Energie aus ausschließlich<br />
Rindergülle (Jungmeier et al. 1999).<br />
Durch den Einsatz von Kosubstraten verschlechtert<br />
sich diese Bilanz. Für die gesamte Verfahrenskette<br />
der Kosubstratbereitung – Saatbettbereitung,<br />
Aussaat, Ernte, Bergung, Lagerung – ergeben sich<br />
Treibhausgasemissionen in der Größenordnung<br />
von 80 –130 g CO2 eq⋅kWh -1 elektrischer Energie.<br />
Ausnahmen hiervon bilden Topinambur mit knapp<br />
200 g CO2 eq⋅kWh -1 und Raps mit 430 g CO2<br />
eq⋅kWh -1 . Der kumulierte Energieaufwand für die<br />
Kosubstratbereitung variiert zwischen 0,8 und<br />
1,5 MJ⋅kWh -1 für die untersuchten Fruchtarten mit<br />
Ausnahme von 3,5 MJ⋅kWh -1 für Raps. Obwohl die<br />
ökologische Bewertung für die untersuchten Kosubstrate<br />
relativ ausgeglichen ist, kann Luzerne,<br />
Mais und Gerste der Vorzug gegeben werden.<br />
Eine eindeutig schlechte Bilanz liegt beim Einsatz<br />
von Raps als Kosubstrat vor. /3/, /131/, /132/,<br />
/133/, /264/, /265/, /296/, /317/, /357/<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
74<br />
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beim Einsatz<br />
landwirtschaftlicher Kosubstrate zur Biogasgewinnung<br />
(Projekt-Nr.: 2.35)<br />
Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe<br />
Zielsetzung <strong>des</strong> Projekts ist es, die ökonomischen<br />
Implikationen beim Einsatz von landwirtschaftlichen<br />
Kosubstraten in Biogasanlagen zu untersuchen.<br />
Economics of crops as co-substrates in biogas<br />
plants Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnun-<br />
Philipp Grundmann (Abt. 2), Monika Heiermann<br />
(2), Bernd Linke (1), Matthias Plöchl (2)<br />
Finanzierung: Haushalt<br />
The aim of the project is to examine the economic<br />
implications of co-substrates use in biogas plants.<br />
Since the economic results vary according to the<br />
assumptions made, the analysis is focused on the<br />
effects caused by variation ranges of cost factors.<br />
Preliminary results show that the average profitability<br />
of silages from perennial ryegrass, alfalfa,<br />
maize and barley is higher compared to the profitability<br />
of rapeseed, hemp and topinambur. Fresh<br />
rye and silages from rye and wheat show average<br />
profitability results. Sensibility analysis results<br />
(Figure 6.10) indicate that important cost reductions<br />
may be achieved by increasing system workloads<br />
and methane yields, improving generator<br />
efficiencies, as well as reducing the specific plant<br />
investments. Extending the lifespan of plant components,<br />
e.g. by stabilizing the production process,<br />
promises further cost reductions, especially when<br />
it comes to cost intensive and short-life technical<br />
plant components. The cost-effect of improvements<br />
in the biomass supply chain mainly depends<br />
on the quantity, the yield and the quality of biomass<br />
inputs.<br />
Volllaststunden /<br />
Workloads<br />
Wirkungsgrad /<br />
CHP Efficiency<br />
Methanertrag /<br />
Methane Yield<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Lebensdauer / Plant Lifespan<br />
3 €-Ct. kWh -1<br />
2 €-Ct. kWh -1<br />
1 €-Ct. kWh -1<br />
Biomassekosten / Biomass Costs<br />
gen sind in hohem Maße von den getroffenen Annahmen<br />
abhängig. Aus diesem Grund konzentriert<br />
sich die Analyse auf die durch die Einflussfaktoren<br />
verursachten Ergebnisspannen. Erste Berechnungen<br />
zeigen, dass die wirtschaftlichen Ergebnisse<br />
der Kosubstrate Weidelgras als Silage und Frischfutter,<br />
sowie Silage aus Luzerne, Mais und Gerste<br />
besser ausfallen als von Raps, Hanf und Topinambur.<br />
Ganzpflanzensilage aus Roggen und<br />
Triticale sowie Roggen Frischfutter liegen im<br />
durchschnittlichen Bereich. Die Ergebnisse der<br />
Sensibilitätsanalysen (Bild 6.10) deuten auf erhebliche<br />
Kosteneinsparungspotenziale vor allem in der<br />
Verbesserung der Verstromungswirkungsgrade, in<br />
der Steigerung der Methanerträge und besseren<br />
Anlagenauslastung, sowie in der Optimierung der<br />
spezifischen Aggregat- und Reaktorinvestitionen.<br />
Der Kosteneffekt bei einer Optimierung der Biomassebereitstellung<br />
hängt im wesentlichen von<br />
der eingesetzten Menge, dem Flächenertrag und<br />
der Qualität der eingesetzten Biomasse ab. /12/,<br />
/13/, /46/, /75/, /76/, /213/, /214/, /259/, /260/, /261/,<br />
/262/, /293/, /348/<br />
Reaktorinvestitionen /<br />
Reactor Investments<br />
30% Veränderung / Variation<br />
20% Veränderung / Variation<br />
10% Veränderung / Variation<br />
Aggregatinvestitionen /<br />
CHP Investments<br />
Biomasseertrag /<br />
Biomass Yield<br />
Bild 6.10 : Kosteneffekte aus<br />
der Optimierung kostenbestimmender<br />
Parametern bei<br />
Biogas<br />
Fig. 6.10 : Cost-effects resulting<br />
from parameter optimisations<br />
in biogas production<br />
using co-substrates
Verlustminimierte und humanhygienische Lagerung<br />
von Feldholz (Projekt-Nr. 3.48/106)<br />
Loss reduced and human hygienic storage of<br />
field wood<br />
Volkhard Scholz (Abt. 3), Christine Idler (1), Werner<br />
Daries (3)<br />
Büro für Holzschutz und Wohnraumhygiene Egert,<br />
Potsdam<br />
Förderung: BMVEL/FNR<br />
The storage of wood chips in unventilated piles<br />
may cause a high loss of dry matter and an increase<br />
of allergy-inducing mould. During long-term<br />
experiments with poplar and willow chips of different<br />
size only a low number of thermophilic mould<br />
species were found in piles of coarse chips and<br />
chunks. The number and species of spores in the<br />
atmosphere depend on the particle size too. Therefore<br />
appropriately mechanised technologies for<br />
harvest, storage and use of coarse chips and<br />
chunks should be developed (Table 6.1).<br />
Die optimalen Ernte- und Lagerungsbedingungen<br />
für die Nutzung von Feldholz zur Energiegewinnung<br />
werden in verschiedenen Versuchsansätzen<br />
untersucht. Ein Schwerpunkt in dem von der FNR<br />
geförderten Projekt ist die Identifizierung von<br />
Schimmelpilzen, die bei der Lagerung von unterschiedlich<br />
aufbereitetem Holz auftreten. Nach der<br />
Ernte im Februar 2002 sind verschiedene Versuche<br />
in Laborgefäßen (5 dm 3 ), in Laborsilos (1,5<br />
II Fachlicher Teil 75<br />
m 3 ), in Lagerboxen (10 m 3 ) sowie in Lagerhaufen<br />
(> 18 m 3 ) angesetzt worden. Vorwiegend wurde<br />
Pappelholz (NE 42 und Japan 105) verwendet und<br />
als Feinhackschnitzel (≤ 30 mm), Mittelhackschnitzel<br />
(31 - 50 mm), Grobhackschnitzel (51 - 100<br />
mm) sowie als Hackstücke (101 - 200 mm) gelagert.<br />
Kiefern-Mittelhackschnitzel und Weiden-<br />
Grobhackschnitzel (Salix Viminalis 21) wurden<br />
ebenfalls in die Untersuchungen mit einbezogen.<br />
Während der einjährigen Lagerung wurden Temperatur,<br />
Wassergehalt, Trockensubstanzverlust<br />
sowie Gehalt und Spezies von Schimmelpilzen im<br />
Material und in der Umgebungsluft bestimmt.<br />
Bei der Lagerung in Boxen konnte der Trend, der<br />
sich bereits in den vergangenen Lagerungsperioden<br />
abgezeichnet hatte, bestätigt werden. Im Gegensatz<br />
zu mesophilen Schimmelpilzen kann der<br />
Gehalt an thermophilen, also potentiell gesundheitsgefährdenden<br />
Schimmelpilzen, durch geeignete<br />
Aufbereitungstechnologien deutlich verringert<br />
werden. Der Gehalt an mesophilen Schimmelpilzen<br />
ist weniger beeinflussbar als die Zahl der thermophilen<br />
Pilze. Ähnliche Ergebnisse konnten auch<br />
bei der Bestimmung <strong>des</strong> Sporengehaltes in der<br />
Luft ermittelt werden. Mit der Veränderung der<br />
Anzahl der thermophilen Schimmelpilze ist auch<br />
eine Variation der Species verbunden. Während<br />
bei Feinhackschnitzeln sechs unterschiedliche<br />
thermophile Spezies nachweisbar waren, verringerte<br />
sich die Anzahl bei den Hackstücken auf<br />
drei. In allen Varianten konnte Aspergillus fumigatus<br />
nachgewiesen werden (Tabelle 6.1). /198/,<br />
/199/<br />
Tabelle 6.1: Anzahl und Arten thermophiler Schimmelpilze während der Lagerung von Pappelhackgut in regengeschützten<br />
Boxen<br />
Tab. 6.1: Content and kind of thermophilic mould during the storage of poplar in rain-protected boxes<br />
Hackformat<br />
Chip size<br />
Lagerungszeit<br />
Storage time<br />
Anzahl<br />
Number<br />
(in<br />
KbE/g<br />
FM)<br />
Thermophile Schimmelpilze, Thermophilic mould fungi<br />
Absidia<br />
Corymbifera <br />
Aspergillusfumigatus <br />
Aspergillus<br />
niger<br />
Spezies, Species<br />
Emericella<br />
nidulans<br />
Paecilomyces<br />
variotii<br />
Rhizomucorpusillus<br />
HS 23 2 Wochen 2,4⋅10 7 g g<br />
1 Monat 5,8⋅10 7 g g g g<br />
2 Monate 3,7⋅10 7 g g g g g<br />
3 Monate 1,5⋅10 8 g g<br />
4 Monate 5,5⋅10 7 g g g g<br />
6 Monate 1,9⋅10 7 g g g<br />
1 Jahr 1,4⋅10 6 g g<br />
HS 155 2 Wochen 1,5⋅10 3 g g<br />
1 Monat n.a. g<br />
2 Monate 1,2⋅10 3 g<br />
3 Monate 2,9⋅10 3 g<br />
4 Monate 3,4⋅10 3 g g<br />
6 Monate 1,5⋅10 3 g g<br />
1 Jahr 1,2⋅10 4 g<br />
Rhizopus<br />
microsporus<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
76<br />
Verfahrenstechnische Grundlagen zur Lagerung<br />
und Trocknung von Holzhackgut<br />
(Projekt-Nr.: 3.45)<br />
Thermo and fluid dynamic bases for drying and<br />
storage of chopped wood<br />
Jochen Mellmann (Abt. 3), Volkhard Scholz (3)<br />
Förderung: Haushalt<br />
The consumption of chopped wood for energy<br />
conversion by combustion has increased over the<br />
last few years. Therefore, the development of an<br />
economic and practicable technology for drying<br />
and storage is required. To avoid growth of mould<br />
and toxines, the harvested chopping good with a<br />
moisture content of about 50% has to be dried as<br />
fast, cheap and poor of losses as possible.<br />
To investigate the drying of chopped wood in a<br />
heap by natural convection and self heating, experiments<br />
on air flow within the bed material have<br />
been carried out. Therefore, the pressure drop<br />
over the hight of the bed was measured. From the<br />
results, the flow restistance parameter can be estimated<br />
in dependence on the type of wood, the<br />
particle diameter and other particle characteristics.<br />
Der zunehmende Verbrauch von Holzhackgut zur<br />
Energieumwandlung durch Verbrennung macht die<br />
Entwicklung eines wirtschaftlichen und praktikablen<br />
Verfahrens zur Trocknung und Lagerung notwendig.<br />
Um die Entwicklung von Pilzen und Toxinen<br />
zu vermeiden, muss das frische Erntegut möglichst<br />
schnell und verlustarm getrocknet werden.<br />
Als einfachstes Verfahren bietet sich die Trock-<br />
Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe<br />
nung durch natürliche Konvektion und Eigenerwärmung<br />
sowie die Lagerung in einer Holzhackgutmiete<br />
an. Zur Untersuchung der Trocknungsvorgänge<br />
wurde ein Versuchsaufbau bestehend<br />
aus fünf zylindrischen Behältern (Di = 1 m; h = 2<br />
m) verwendet. Neben der Holzart wurde die mittlere<br />
Korngröße der Hackschnitzel (dP,m = 20, 50, 80,<br />
150 mm) variiert. Der Ernte- und Einlagerungszeitpunkt<br />
lag im Frühjahr. Die Versuchsdauer betrug<br />
ca. 9 Monate.<br />
Zur Untersuchung der Strömungsverhältnisse innerhalb<br />
der Holzhackgut-Schüttung sind drei Versuchsreihen<br />
zu Beginn (B: 14.03.03), während (M:<br />
15.05.03) und am Ende <strong>des</strong> Lagerungszeitraums<br />
(E: 11.11.03) durchgeführt worden. Dazu wurden<br />
die Druckverluste ∆pV über der Schüttungshöhe H<br />
gemessen. Aufgrund von Setzungserscheinungen<br />
infolge Eigenlast und biologischer Abbauprozesse<br />
wurden diese auf die Schüttungshöhe bezogen.<br />
Der Luftvolumenstrom V & wurde mittels eines<br />
frequenzgesteuerten Ventilators eingestellt. Um<br />
auch für grobes Hackgut genügend Werte zu erhalten,<br />
wurde der Messbereich <strong>des</strong> Volumenstro-<br />
3<br />
mes auf 1200 m /h ausgedehnt. Die Ergebnisse<br />
sind im Bild 6.11 dargestellt. Die Messpunkte folgen<br />
dem bekannten funktionalen Zusammenhang<br />
zwischen Druckverlust und Strömungsgeschwindigkeit<br />
in Schüttungen mit annähernd quadratischem<br />
Verlauf (b = 1,6 ... 2,5). Aus den Ergebnissen<br />
lassen sich die Widerstandsbeiwerte der einzelnen<br />
Hackgutfraktionen bestimmen, die für Berechnungen<br />
zum Trocknungsverlauf benötigt werden.<br />
/278/<br />
Bild 6.11: Gemessene Druckverluste ∆p V über der Schüttungshöhe H in Abhängigkeit vom Luftvolumenstrom V L für<br />
verschiedene Pappel-Hackgutfraktionen d P,m<br />
Fig. 6.11: Pressure drop ∆p V in dependence on air flow rate V L measured over the bed hight H for different particle sizes<br />
d P,m of chopped poplar<br />
dP,m = 20, 50, 80 and 150 mm; begin (B: 14.03.<strong>2003</strong>), middle (M: 15.05.<strong>2003</strong>), end of experiment (E: 11.11.<strong>2003</strong>)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
L
Energetische Nutzung pflanzlicher Reststoffe<br />
(Projekt-Nr.: 3.40; 86)<br />
Energetic use of crop residues<br />
Volkhard Scholz (Abt. 3); Ehab El Saeidy (3)<br />
Menofiya University, Ägypten<br />
Förderung: Haushalt; Ministerium für Hochschulbildung<br />
und Forschung Ägypten<br />
Briquetting or pelletizing of crop residues may not<br />
only result in an improvement of physical properties<br />
but also - in case of cotton stalks - in an extermination<br />
of pests such as the Pink Bollworm.<br />
The objective of this project is to find the optimum<br />
operations and material parameters which ensure<br />
stable briquettes with a minimum energy input. So<br />
the influence of press diameter, particle size and<br />
moisture content of straw, hemp shives and cotton<br />
stalks on the density and stability of briquettes is<br />
determined by various measurements (Fig. 6.12).<br />
Durch Brikettieren und Pelletieren können die<br />
Transport- und Lagereigenschaften sowie das<br />
Verbrennungs- und Vergasungsverhalten von fasrigen<br />
und pulverförmigen Materialien erheblich<br />
verbessert werden. Bei Baumwollstängeln, deren<br />
brennstoffgerechte Aufbereitung der Hintergrund<br />
Trockenmasse-Rohdichte in g/cm³<br />
Dry matter density<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
Hanf ρ G, e = 0,88 g/cm³<br />
Stroh ρ G,e = 0,94 g/cm³<br />
II Fachlicher Teil<br />
0,0<br />
0 20 40 60 80 100 120 140 160<br />
Pressdruck in MPa<br />
P ressure<br />
dieses Projektes ist, wird ein weiterer Vorteil erwartet.<br />
Die beim Brikettieren auftretenden Drücke<br />
und Temperaturen töten den ertragsschädigenden<br />
Kapselwurm und <strong>des</strong>sen Eier ab und verhindern<br />
damit deren weitere Verbreitung.<br />
Das Ziel <strong>des</strong> Projektes ist es, die optimalen Betriebs-<br />
und Stoffparameter von faserigen Reststoffen,<br />
wie Getrei<strong>des</strong>troh, Hanfschäben und Baumwollstängel,<br />
zu ermitteln, bei denen stabile Briketts<br />
mit minimalem Energieaufwand hergestellt werden<br />
können. In umfangreichen experimentellen Untersuchungen<br />
wird daher der Einfluss von Partikelgröße,<br />
Wassergehalt, Brikettdurchmesser und<br />
Pressdruck auf Rohdichte und Bruchfestigkeit der<br />
Briketts bestimmt. Aus den Ergebnissen lassen<br />
sich u. a. die erforderlichen Min<strong>des</strong>t-Pressdrücke<br />
ableiten. Bei optimaler Materialfeuchte betragen<br />
sie für Hanfschäben und Strohhäcksel ohne Bindemittel<br />
ca. 40 bis 50 MPa, was einer Rohdichte<br />
von etwa 0,6 bis 0,7 g/cm³ entspricht. Die experimentellen<br />
Ergebnisse zeigen die Übereinstimmung<br />
mit einem kürzlich an der TU Chemnitz entwickelten<br />
Modellansatz (Bild 6.12). Die Untersuchungen<br />
sollen im Jahr 2004 mit einer Dissertation an der<br />
Humboldt-Universität zu Berlin abgeschlossen<br />
werden. /121/, /249/, /250/, /251/<br />
Brikett Ø 30 mm<br />
Feuchte 10 %<br />
Exp. Ergebnisse, Hanfschäben<br />
Modell nach Clauß, Hanfschäben<br />
Exp. Ergebnisse, Roggenstroh<br />
Modell nach Clauß, Roggenstroh<br />
77<br />
Bild 6.12: Dichte von Hanf- und<br />
Strohbriketts in Abhängigkeit vom<br />
Pressdruck im Vergleich zu rechnerischen<br />
Ergebnissen<br />
Fig. 6.12: Density of hemp and<br />
straw briquettes versus pressure<br />
compared to theoretical results<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
78<br />
Behandlung und Verwertung von Reststoffen und Abwässern<br />
7 Verfahren zur Behandlung und Verwertung<br />
von Reststoffen und Abwässern in der<br />
Landwirtschaft<br />
(Forschungsschwerpunkt 7)<br />
Processes of treatment and utilization of<br />
residues and wastewater in agriculture<br />
(Koordinator: Bernd Linke, Abt. 1)<br />
Die Entwicklung moderner und leistungsfähiger<br />
Verfahren zur Behandlung und Verwertung von<br />
Reststoffen und Abwässern ist für eine wettbewerbsfähige<br />
Landwirtschaft unverzichtbar geworden,<br />
um auf veränderte Rahmenbedingungen und<br />
neue Herausforderungen effektiv und flexibel reagieren<br />
zu können. So hat z.B. die Verabschiedung<br />
<strong>des</strong> Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien<br />
(EEG) einen deutlichen Impuls für den Bau<br />
landwirtschaftlicher Biogasanlagen gegeben. Die<br />
Vergütung <strong>des</strong> eingespeisten Stromes ist für zahlreiche<br />
Landwirte zu einer wichtigen Einnahmequelle<br />
geworden sind.<br />
Im Rahmen eines bun<strong>des</strong>weiten Messprogramms<br />
mit Beteiligung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> werden moderne Biogasanlagen<br />
nach substratspezifischen, verfahrenstechnischen<br />
und betriebswirtschaftlichen Parametern<br />
bewertet. Mittlerweile sind bun<strong>des</strong>weit durch<br />
die 4 begleitenden Forschungseinrichtungen mehr<br />
als 70 Anlagen untersucht worden. Betrachtet man<br />
den Anteil an Gülle an der Gesamtmasse an Substrat,<br />
das der Biogasanlage zugeführt wird, ergeben<br />
sich regional und historisch bedingt, größere<br />
Abweichungen. Ein relativ hoher Viehbestand im<br />
Raum Nordostdeutschland zeichnet für den hohen<br />
Anteil an Wirtschaftsdünger als Grundsubstrat<br />
verantwortlich. In den anderen Gebieten wird<br />
durch eine höhere Zugabemenge von Kosubstraten<br />
(Maissilage, Grassilage, Restfutter u.ä.)<br />
das energetische Potential der Biogasanlagen<br />
ausgeschöpft.<br />
Da in der Praxis meist Gemische aus Gülle, organischen<br />
Reststoffen und Energiepflanzen als Gärsubstrate<br />
zum Einsatz kommen und Rückschlüsse<br />
über die Biogasausbeuten der Einzelsubstrate<br />
nicht möglich sind, muss in Langzeitversuchen die<br />
Kinetik der Biogasbildung praxisrelevanter Substrate<br />
und deren Gemische untersucht werden.<br />
Dies ist unter definierten Laborbedingungen in<br />
quasi-kontinuierlichen Versuchen möglich. Beispielhaft<br />
kamen dabei Gülle, Rübensilage, Roggenschrot,<br />
Futtergräser und Gemische aus beiden<br />
Substraten zum Einsatz. Alle Versuche liefen zwischen<br />
200 und 250 Tagen bei 35°C Fermentationstem-peratur<br />
und wurden bei stabilen<br />
Betriebszuständen von mehreren Wochen ausgewertet.<br />
Bei den Versuchen zur Monovergärung lag<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
die oTS- Raumbelastung bei Gülle, Futtergräsern<br />
und Roggenschrot zwischen 0,7 und 1,4 kgm -3 d -1 ,<br />
während bei Rübensilage der Wert 2,7 kgm -3 d -1<br />
betrug. In Kofermentation mit Gülle wurde bei Roggenschrot<br />
und Rübensilage eine oTS-Raumbelastung<br />
von 2,2 kgm -3 d -1 und bei Futtergräsern von<br />
0,7-1,4 kgm -3 d -1 gefahren. Dabei zeigte sich, dass<br />
sich die oTS- Biogasausbeute aus Mischungen<br />
von Gülle und Energiepflanzen proportional zum<br />
oTS- Anteil der Einzelsubstrate verhielt.<br />
Eine aktuelle Fragestellung in der Praxis betrifft<br />
die Früherkennung kritischer Belastungszustände,<br />
die mit Hilfe eines Gassensorenarrays (elektronische<br />
Nase) zuverlässig detektiert werden sollen.<br />
Zum Erreichen <strong>des</strong> gestellten Zieles wurden verschiedene<br />
Belastungszustände unter Laborbedingungen<br />
eingestellt und Biogas, Biogaskondensat<br />
und Gärflüssigkeit mittels einer elektronischen<br />
Nase, die ein Gassensorarray aus zehn unterschiedlich<br />
selektiven Metalloxid-Sensoren aufweist,<br />
analysiert. Zur Auswertung der Messergebnisse<br />
diente ein Mustererkennungsverfahren. Die<br />
sich aus der Analyse <strong>des</strong> Gärsubstrates ableitenden<br />
Messwertmuster zeigten von den drei untersuchten<br />
Medien die mit Abstand deutlichste Korrelation<br />
mit den im Substrat vorliegenden Säurespektren.<br />
Für die Bereitstellung einer praxisreifen<br />
Lösung zur Früherkennung von Überlastungszuständen<br />
in Biogasanlagen sind jedoch noch weitere<br />
Arbeiten zur Kalibrierung und Validierung der<br />
Methode notwendig.<br />
Im Bereich der Abwasserbehandlung konzentrierten<br />
sich die Arbeiten auf die Entwicklung<br />
und Optimierung eines Membranbioreaktors, <strong>des</strong>sen<br />
Leistungsfähigkeit am Beispiel von Schlachthofabwasser<br />
nachgewiesen werden konnte. Bei<br />
einer CSB- Raumbelastung von 1,24 gl -1 d -1 wurden<br />
die vorgeschriebenen Einleitwerte in Gewässer für<br />
CSB, BSB5 und NH4-N unterschritten. Da sich die<br />
Applikationsmöglichkeiten von Membranen für<br />
Stofftrennungsprozesse ständig erweitern, sind<br />
Grundlagenuntersuchungen zur Ablagerung von<br />
organischen Stoffen an die Membran (Fouling)<br />
notwendig. Hierfür wurde bei der DFG ein Forschungsantrag<br />
eingereicht.<br />
Unter Berücksichtigung der in wenigen Jahrzehnten<br />
erschöpften schwermetallarme P-Verbindungen<br />
gewinnt die Nutzung von Phosphor aus Abwasser<br />
und Schlämmen zunehmend an Bedeutung.<br />
Für Klärschlamm eines Berliner Abwassers<br />
wurde ein Düngemitteltyp „Teilaufgeschlossenes<br />
Rohphosphat mit Magnesium“ ermittelt, für den<br />
sich interessante Vermarktungsmöglichkeiten und<br />
Einsatzbereiche in der Landwirtschaft eröffnen.
Projekte zum Forschungsschwerpunkt 7<br />
Wissenschaftliches Messprogramm zur Bewertung<br />
von Biogasanlagen im landwirtschaftlichen<br />
Bereich (Projekt-Nr.: 107)<br />
Scientific measuring program for the evaluation<br />
of biogas plants in the agricultural area<br />
Frank Melcher (Abt. 1); Bernd Linke (1)<br />
FAL Braunschweig; Technische Universität München,<br />
Bayrische Lan<strong>des</strong>anstalt für Landtechnik;<br />
Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaftliches Maschinen-<br />
und Bauwesen Hohenheim<br />
Förderung: BMVEL/FNR<br />
Within the scope of the scientific measuring<br />
program data of 70 agricultural biogas plants were<br />
collected and evaluated over a period of 2.5 years.<br />
Evaluation was performed by scientists of 4<br />
research institutes in the region north east (NO),<br />
north west (NW), south east (SO) and south west<br />
(SW) of Germany. The electrical power of the<br />
investigated plants varies from 20 to 850 KW. With<br />
respect to the portion of animal waste slurry on<br />
the whole input feed biogas plants in the region of<br />
north east digest lower portions of both organic<br />
residues and energy crops. This is due to the fact<br />
that in this region big animal plants are located<br />
compared to the farm size in the other regions<br />
(Fig. 7.1).<br />
Das wissenschaftliche Messprogramm beschäftigt<br />
sich seit 2,5 Jahren intensiv mit der Datenerfassung,<br />
Beprobung und Auswertung von Biogasanlagen<br />
im landwirtschaftlichen Bereich. Mittlerweile<br />
Anteil der Wirtschaftsdünger<br />
Anteil Gülle [%]<br />
an der Gesamtsubstratmenge Portion of slurry [%]<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
<strong>ATB</strong> 010<br />
<strong>ATB</strong> 018<br />
<strong>ATB</strong> 019<br />
<strong>ATB</strong> 020<br />
<strong>ATB</strong> 021<br />
<strong>ATB</strong> 022<br />
<strong>ATB</strong> 025<br />
FAL 008<br />
FAL 016<br />
II Fachlicher Teil 79<br />
FAL 026<br />
FAL 035<br />
FAL 048<br />
FAL 054<br />
sind bun<strong>des</strong>weit durch die 4 begleitenden Forschungseinrichtungen<br />
mehr als 70 Anlagen untersucht<br />
worden, 28 davon seit Sommer <strong>2003</strong> in der<br />
zweiten Messkampagne. Die Größenordnung der<br />
Anlagen, gemessen an ihrer elektrisch abgegebenen<br />
Leistung, schwanken dabei zwischen 20 und<br />
850 kW. Auswahlkriterien für die am Messprogramm<br />
teilnehmenden Betreiber von Biogasanlagen<br />
war ein Inbetriebnahmedatum innerhalb der<br />
letzten 2 Jahre sowie die Beschränkung der in die<br />
Anlagen zugeführten Substrate auf rein landwirtschaftlich<br />
anfallende Produkte. Ziel <strong>des</strong> Projekts ist<br />
es, eine realitätsnahe Bewertung von Biogasanlagen<br />
verschiedenster Bauart, Größe und Verfahrensauslegung<br />
auf Basis der gesammelten Messwerte<br />
und Analysen vornehmen zu können. Da<br />
allen beteiligten Unternehmen Anonymität zugesichert<br />
wurde, erfolgen die Auswertungen in den<br />
territorial zuständigen Institutionen über eine numerische<br />
Anlagenbezeichnung. Aus der Vielzahl<br />
der Auswertungen soll im Folgenden der Teilbereich<br />
der umgesetzten Substrate dargestellt werden.<br />
In Bild 7.1 wird der Anteil von Wirtschaftsdünger<br />
an der einfließenden Gesamtsubstratmenge<br />
dargestellt. Wie die Darstellung verdeutlicht,<br />
ergeben sich hier territorial und historisch<br />
bedingte, größere prozentuale Abweichungen. Ein<br />
relativ hoher Viehbestand im Raum Nordostdeutschland<br />
zeichnet für den hohen Anteil an Wirtschaftsdünger<br />
als Grundsubstrat verantwortlich. In<br />
den anderen Gebieten wird durch eine höhere<br />
Zugabemenge von Kosubstraten (Maissilage,<br />
Grassilage, Restfutter u.ä.) das energetische Potential<br />
der Biogasanlagen ausgeschöpft.<br />
FAL 060<br />
FAL 061<br />
ILT 006<br />
ILT 029<br />
ILT 039<br />
ILT 043<br />
ILT 044<br />
ILT 045<br />
UH 006<br />
NO SO<br />
NW SW<br />
Bild 7.1: Anteile an Wirtschaftsdünger an der Gesamtsubstratmenge <strong>des</strong> Zulaufs von Biogasanlagen in verschiedenen<br />
Regionen Deutschlands<br />
Fig. 7.1: Portion of animal waste slurries of the whole input of biogas plants in different regions of Germany<br />
UH 010<br />
UH 033<br />
UH 108<br />
UH 174<br />
UH 182<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
80<br />
Behandlung und Verwertung von Reststoffen und Abwässern<br />
Kinetik der Biogasbildung bei kontinuierlicher<br />
Nassvergärung von Feldfrüchten und organischen<br />
Reststoffen (Projekt Nr.: 1.35; 127)<br />
Kinetics of biogas production for anaerobic<br />
digestion of energy crops and organic wastes<br />
in continuous operating slurry digesters<br />
Bernd Linke (Abt. 1), Pia Mähnert (1), Hannelore<br />
Schelle (1), Monika Heiermann (2);<br />
HUB Berlin; Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft Güterfelde;<br />
Biotechnologie Nordhausen<br />
Förderung: Haushalt, BMVEL/FNR<br />
In order to increase the efficiency the majority of<br />
agricultural biogas plants digest mixtures of animal<br />
waste slurries, organic wastes and energy crops.<br />
The problem in practise is that biogas production is<br />
the result of all substrate components. Therefore<br />
an evaluation of biogas yield from the single substrates<br />
is impossible. To overcome this disadvantage<br />
long term semi-continuously lab-scale experiments<br />
were conducted. At organic loading<br />
rates (OLR) in the range of 0.7- 2.7 kgm -3 d -1 at<br />
35°C biogas production of animal waste slurries<br />
and energy crops such as fodder sugar beets silage,<br />
crushed rye grain, mixture of three cultivar<br />
fodder grasses, were studied both as single substrates<br />
and mixtures over a period of 200 to 250<br />
days. At steady state reactor performance the biogas<br />
production was evaluated. It could be shown<br />
that the VS-biogas yield from mixtures of energy<br />
crops and slurry is proportional to the VS-portion of<br />
the single substrates (Fig. 7.2). The methane content<br />
of the biogas for co-fermentation was about 60<br />
% and for mono-fermentation of energy crops and<br />
animal waste slurry it resulted to be approximately<br />
55-58 % and 65 % respectively.<br />
oTS-Biogasausbeute y (Nm 3 kg -1 )<br />
VS- biogas yield y (Nm 3 kg -1 )<br />
100<br />
1,2<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20 0<br />
1<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
oTS- Anteil von Gülle p G (Ma.%)<br />
VS- portion of animal waste slurry p G (mass %)<br />
0<br />
0 20 40 60 80<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
oTS- Anteil von Energiepflanzen p E (Ma.%)<br />
VS- portion of energy crops p E (mass %)<br />
Nach Erhebungen eines zur Zeit laufenden bun<strong>des</strong>weiten<br />
Meprogramms wird die Mehrzahl landwirtschaftlicher<br />
Biogasanlagen in Deutschland mit<br />
Gemischen aus Gülle, organischen Reststoffen<br />
oder Energiepflanzen beschickt. Durch diese Kofermentation<br />
lässt sich die Leistungsfähigkeit und<br />
damit die Wirtschaftlichkeit der Biogasproduktion<br />
verbessern. Da die in Praxisanlagen gemessene<br />
Biogasproduktion in der Regel keine Rückschlüsse<br />
über die den Einzelkomponenten zuzuordnende<br />
Biogasmenge erlaubt, wurden unter definierten<br />
Laborbedingungen quasi-kontinuierliche Langzeitversuche<br />
durchgeführt, bei denen beispielhaft<br />
Gülle, Rübensilage, Roggenschrot, Futtergräser<br />
und Gemische aus beiden Substraten zum Einsatz<br />
kamen. Bei den Versuchen zur Monovergärung lag<br />
die oTS-Raumbelastung (BR) bei Gülle, Futtergräsern<br />
und Roggenschrot zwischen 0,7 und 1,4<br />
kgm -3 d -1 , während bei Rübensilage der Wert für BR<br />
2,7 kgm -3 d -1 betrug. In Kofermentation mit Gülle<br />
wurde bei Roggenschrot und Rübensilage eine<br />
oTS-Raumbelastung von 2,2 kgm -3 d -1 und bei Futtergräsern<br />
von 0,7-1,4 kgm -3 d -1 gefahren. Alle Versuche<br />
liefen zwischen 200 und 250 Tagen bei<br />
35°C Fermentationstemperatur und wurden bei<br />
stabilen Betriebszuständen von mehreren Wochen<br />
ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass sich die oTS-<br />
Biogasausbeute aus Mischungen von Gülle und<br />
Energiepflanzen sich proportional zum oTS-Anteil<br />
der Einzelsubstrate verhielt (Bild 7.2). Der Methangehalt<br />
im Biogas bei Kofermentation betrug<br />
etwa 60 % während bei Monofermentation von<br />
Energiepflanzen und Gülle Werte zwischen 55 und<br />
58 % bzw. 60 und 65 % gemessen wurden. /159/,<br />
/160/, /165/, /216/, /217/<br />
100<br />
Bild 7.2: oTS-Biogasausbeute y<br />
bei unterschiedlichen oTS-Anteilen<br />
von Gülle p G und Energiepflanzen<br />
p E aus quasi-kontinuierlichen<br />
Langzeitversuchen, (�)<br />
Rübensilage, (�) Roggenschrot,<br />
(�) Mischung aus drei verschiednen<br />
Futtergrassorten<br />
Fig. 7.2: VS-biogas yield for different<br />
VS-portions of animal waste<br />
slurry p G and energy crops p E<br />
from semi-continuously experiments,<br />
(�) fodder sugar beets<br />
silage, (�) crushed rye grain, (�)<br />
mixture of three cultivar fodder<br />
grasses
Prozesssteuerung von Biogasanlagen mit Kofermentation<br />
(Projekt-Nr.: 110-133)<br />
Process control of biogas plants with cofermentation<br />
Bernd Linke (Abt. 1), Patrick Siegmund (1), Jan<br />
Mumme (1)<br />
Biotechnologie Nordhausen GmbH (BTN); WMA<br />
Airsense Analysentechnik GmbH Schwerin; Kuratorium<br />
für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft<br />
e.V. (KTBL) Darmstadt<br />
Förderung: BMBF/PtJ; Haushalt<br />
Overloading of agricultural biogas plants has been<br />
widely recognised as a serious problem in practice<br />
and resulted in reactor failure. In order to find a<br />
sensitive tool for early detection of a beginning<br />
acidification, the application of a portable electronic<br />
nose (PEN) from WMA airsense was tested. Anaerobic<br />
digestion was performed at different organic<br />
loading rates for both pig and cow slurry in<br />
lab scale experiments for co-digestion with energy<br />
crops and the organic fraction of municipal organic<br />
wastes. However, detection of biogas and precipitate<br />
of biogas did not prove successful. A promising<br />
method is the detection of volatile compounds<br />
with the PEN from digested slurry in the biogas<br />
fermenter, because propionic acid as a marker of<br />
acidification could be detected clearly (Fig. 7.3).<br />
Further experiments are required for calibration of<br />
the PEN with effluents from biogas plants in practise.<br />
Durch überhöhte Zugabe energiereicher Substrate<br />
(Energiepflanzen, Bioabfälle) kann es in landwirtschaftlichen<br />
Biogasanlagen zu einer irreversiblen<br />
Übersäuerung <strong>des</strong> Fermenterinhaltes kommen.<br />
Die nur sehr diskreten Anzeichen einer Fermenter-<br />
II Fachlicher Teil 81<br />
überlastung mit einer Verschiebung <strong>des</strong> Säurespektrums<br />
zu Gunsten der Propionsäure können in<br />
der Praxis bislang kaum erkannt werden. Ziel ist es<br />
daher, gemeinsam mit den Kooperationspartnern<br />
für die Betreiber von Praxisanlagen eine einfache<br />
und kostengünstige Methode zur Früherkennung<br />
von Überlastungszuständen in Biogasreaktoren zu<br />
entwickeln. Zum Erreichen <strong>des</strong> gestellten Zieles<br />
wurden unter Laborbedingungen unterschiedliche<br />
Belastungszustände mit Rinder- und Schweinegülle<br />
in Kofermentation mit Energiepflanzen und<br />
Bioabfällen eingestellt. Die Produkte Biogas, Biogaskondensat<br />
und Gärflüssigkeit wurden mittels<br />
einer elektronischen Nase, die ein Gassensorarray<br />
aus zehn unterschiedlich selektiven Metalloxid-<br />
Sensoren aufweist, analysiert. Zur Auswertung der<br />
Messergebnisse diente ein Mustererkennungsverfahren.<br />
Während die Messergebnisse aus den<br />
Medien Biogas und Biogaskondensat durch den<br />
Störeinfluss organischer bzw. anorganischer Begleitstoffe<br />
keine statistische Aussagekraft besaßen,<br />
zeigte das Messwertmuster der Gärflüssigkeit<br />
eine eindeutige Abhängigkeit zu <strong>des</strong>sen Säurespektrum<br />
(Bild 7.3). So ergaben zunehmende<br />
Gehalte an Propionsäure eine deutliche Verschiebung<br />
der Messwerte nach rechts im Koordinatensystem,<br />
parallel zur 1. Hauptachse. Essigsäure<br />
bewirkte dagegen nur eine schwache Verschiebung<br />
nach oben entlang der 2. Hauptachse. Vergleichsergebnisse<br />
aus der Analyse einer übersäuerten<br />
Fermentation mit Abfällen aus der Kartoffelverarbeitung<br />
bestätigen die Anwendbarkeit<br />
der Methode für ein breites Anwendungsspektrum.<br />
Um das Ziel der Bereitstellung einer praxisreifen<br />
Lösung zur Früherkennung von Überlastungszuständen<br />
in Biogasanlagen vollständig zu erreichen,<br />
sind jedoch noch weitere Arbeiten zur Kalibrierung<br />
und Validierung der Methode erforderlich.<br />
Bild 7.3: Musterdiagramm mit Analyseergebnissen<br />
einer ausgegorenen<br />
Rindergülle nach Zugabe von Propion-,<br />
Essig- und Phosphorsäure sowie<br />
<strong>des</strong> Ablaufs einer übersäuerten<br />
Fermentation mit Kartoffelabfällen<br />
Fig. 7.3: Plot of a pattern array from<br />
digested cow and potato waste slurry<br />
after addition of propionic-, acetic-<br />
and phosphoric acid<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
82<br />
Behandlung und Verwertung von Reststoffen und Abwässern<br />
Membranbioreaktor zur Aufbereitung von<br />
Schlachthofabwässern (Projekt-Nr.: 110-127)<br />
Membrane bioreactor for the treatment of<br />
wastewaters from slaughter houses<br />
Winfried Reimann (Abt. 1), Bernd Linke (1), Ralf<br />
Leszczynski (1)<br />
Institut für Membrantechnologie GmbH Oranienburg<br />
(UFI-TEC)<br />
Förderung: BMBF/PtJ; Haushalt<br />
The aim of this project is the development of a new<br />
cost-effective bench-scale process for the treatment<br />
of agricultural wastewaters, particularly of<br />
wastewater from slaughter houses, by means of a<br />
membrane bioreactor. The operation of the aerobic<br />
membrane bioreactors was conducted as sequencing-batch-reactor<br />
with the phases: feeding of<br />
wastewater, denitrification, nitrification, and discharge<br />
of the cleaned wastewater. The average<br />
concentration of the feed of wastewater was<br />
1737 mg COD/l, 782 mg BOD5/l, and 159<br />
mg NH4-N/l. At a hydraulic flow of 40 l/d, the concentrations<br />
of COD, BOD5 and NH4-N in the permeate<br />
were lower than the discharge consent conditions<br />
for cleaned wastewater (Fig. 7.4).<br />
Das Ziel <strong>des</strong> Projektes besteht in der Entwicklung<br />
eines neuen Verfahrens zur Aufbereitung von<br />
Schlachthofabwasser mit aeroben Membranbiore-<br />
concentration mg/l<br />
Konzentration mg/l<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
1566<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
843<br />
137<br />
COD BOD5 NH4-N<br />
45,8 1 2<br />
aktoren im Labormaßstab als Alternative zur konventionellen<br />
Lagerung und Ausbringung <strong>des</strong> Abwassers<br />
mit Gülle.<br />
Das Projekt wurde im Juni <strong>2003</strong> beendet. Die im<br />
Jahr 2002 erzielten Ergebnisse wurden im Jahr<br />
<strong>2003</strong> weiter konkretisiert. Die Laborversuchsanlage<br />
bestand aus zwei 60 l-Reaktoren, die mit<br />
einer intern angeordneten organischen Hohlfasermembran<br />
(Reaktor 1; Trenngrenze: 0,1 µm; Filterfläche:<br />
0,3 m²) und einer externen keramischen<br />
Rohrmembran (Reaktor 2; Trenngrenze wahlweise:<br />
0,1 µm, 0,14 µm und 0,2 µm; Filterfläche:<br />
0,2 m²) ausgestattet waren. Beide Reaktoren wurden<br />
in den gleichen Ablaufphasen Befüllen, Belüften,<br />
Umwälzen und Abzug in einem Block von 6<br />
Stunden betrieben.<br />
Das größte Problem beim Einsatz der Membranbioreaktoren<br />
stellte die Permeabilität der eingesetzten<br />
Membranen dar. Mit der extern angeordneten<br />
keramischen Membran konnte das Ziel <strong>des</strong><br />
Projektes erreicht und die Funktion <strong>des</strong> Reaktors<br />
nachgewiesen werden. Bei einer hydraulischen<br />
Belastung von 40 l/d, einer Raumbelastung von<br />
1,24 g CSB/ l*d und einer Schlammbelastung von<br />
0,18 g CSB/ l*d wurden die vorgeschriebenen<br />
Einleitwerte für CSB, BSB5 und NH4-N unterschritten<br />
(Bild 7.4). Das aufbereitete Abwasser<br />
war stets wasserklar und feststofffrei. Enterokokken<br />
und fäkalcoliforme Keime wurden durch die<br />
Membranen zu 100 % zurückgehalten. /321/, /390/<br />
110 25 10<br />
Abwasser Permeat Einleitwerte<br />
wastewater permeate min. requirements<br />
Bild 7.4: Konzentrationen ausgewählter<br />
Inhaltsstoffe vom Abwasser, vom<br />
Permeat und für den Einleitgrenzwert<br />
bei der Aufbereitung von Schlachthofabwasser<br />
mittels Membranbioreaktor<br />
bei einer mittleren hydraulischen Belastung<br />
von 40 l/d für einen Reaktor mit<br />
extern angeordnetem Rohrmembranmodul<br />
Fig 7.4: Concentrations of ingredients<br />
of wastewater, of permeate and for the<br />
minimum requirements for treatment of<br />
wastewater from slaughter house by<br />
means of a membrane bioreactor with<br />
an average hydraulic flow of 40 l/d for a<br />
reactor with a tube membrane module<br />
outside of the reactor
Grundlagen zum Einsatz von Membranverfahren<br />
bei der Aufbereitung schwach belasteter<br />
Abwässer (Projekt-Nr.: 1.37)<br />
Fundamentals for the application of membranebased<br />
processes for the treatment of lowcontaminated<br />
wastewaters<br />
Winfried Reimann (Abt. 1)<br />
Institut für Membrantechnologie GmbH Oranienburg<br />
(UFI-TEC)<br />
Förderung: Haushalt<br />
The production and processing of agricultural<br />
products generates wastewater that must be<br />
treated. The use of membrane separation processes<br />
represents an alternative to conventional<br />
cleaning methods. A still unsolved problem in the<br />
use of membrane technology is the depositing of<br />
organic substances (fouling) on the membrane<br />
surface and in its pores. There is a particular demand<br />
for research here, especially in the basic<br />
sector. First investigations have shown that the<br />
treatment of wastewater is determined essentially<br />
by different fractions of dissolved organic compounds<br />
in the wastewater. By using the process<br />
combination ultrafiltration and reverse osmosis for<br />
the treatment of wastewaters with a low level of<br />
organic contamination it is possible to obtain water<br />
with a quality that meets the minimum requirements<br />
for treated wastewater (Fig. 7.5).<br />
concentration mg/l<br />
Konzentration mg/l<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
COD<br />
110<br />
97<br />
793<br />
25<br />
BOD5<br />
914<br />
23<br />
459<br />
642<br />
10<br />
NH 4 -N<br />
II Fachlicher Teil 83<br />
2<br />
2<br />
Die Aufbereitung organisch belasteter Abwässer<br />
bis auf Vorfluter-Qualität erfolgt in der Regel nach<br />
dem Belebtschlammverfahren. Membranverfahren<br />
haben sich in vielen Bereichen der industriellen<br />
Abwasseraufbereitung etabliert und stellen eine<br />
Alternative zum herkömmlichen Belebungsverfahren<br />
dar. Ein noch ungelöstes Problem beim Einsatz<br />
der Membrantechnologie stellt die Ablagerung<br />
von organischen Stoffen (Fouling) auf der Membranoberfläche<br />
und in ihren Poren dar. Hierfür<br />
besteht besonderer Forschungsbedarf vor allem<br />
im Bereich der Grundlagen. Dazu sind Untersuchungen<br />
von Einflussfaktoren auf die Permeabilität<br />
und Selektivität von Membranen mit Modell-<br />
und Praxislösungen im Labor- und Technikummaßstab<br />
vorgesehen.<br />
Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass die<br />
Aufbereitung landwirtschaftlicher Abwässer durch<br />
Membranverfahren wesentlich durch den Anteil<br />
gelöster organischer Inhaltsstoffe im Abwasser<br />
bestimmt wird. Am Beispiel <strong>des</strong> Einsatzes der Ultrafiltration<br />
und nachgeschalteter Umkehrosmose<br />
wurde nachgewiesen, dass für gering belastetes<br />
Abwasser, das bei der Herstellung von Sanddornsaft<br />
anfällt, die vorgegebenen Grenzwerte zur<br />
Einleitung <strong>des</strong> aufbereiteten Abwassers in ein Gewässer<br />
eingehalten werden (Bild 7.5). Das aufbereitete<br />
Abwasser stellt somit ein hohes Potential<br />
für einen Wiedereinsatz dar.<br />
2 Abwasser<br />
wastewater<br />
Permeat UF<br />
permeate UF<br />
Permeat RO<br />
permeate RO<br />
Einleitwerte<br />
min. requirements<br />
Bild 7.5: Konzentrationen relevanter<br />
Inhaltsstoffe vom Abwasser, nach der<br />
Filtration (UF), nach der Umkehrosmose<br />
und für den Einleitungsgrenzwert bei<br />
der Aufbereitung von Abwasser aus<br />
der Herstellung von Sanddornsaft<br />
Fig.7.5: Concentrations of ingredients<br />
in wastewater, after ultrafiltration (UF),<br />
after reverse osmosis (RO) and for the<br />
minimum requirements for treatment of<br />
wastewater from production of sea<br />
buckthorn juice<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
84<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Behandlung und Verwertung von Reststoffen und Abwässern<br />
Umweltverträgliche und nachhaltige Nutzung<br />
der Nährstoffressource Phosphor<br />
(Projekt-Nr.: 1.34)<br />
Environmentally compatible and sustainable<br />
use of the nutrient phosphorus<br />
Jürgen Kern (Abt. 1), Ralf Schlauderer (2)<br />
Lan<strong>des</strong>anstalt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft<br />
Güterfelde; Berliner Wasserbetriebe<br />
Förderung: Haushalt<br />
Phosphorus is one of the most limited nutrient<br />
resources on earth which is essential for crop<br />
growth. Current economically exploitable phosphorous<br />
reserves which have low contents of heavy<br />
metals will be depleted in a few deca<strong>des</strong>. Therefore,<br />
new strategies for the recycling of phosphorus<br />
such as the recovery from sewage sludge are<br />
needed. The wastewater treatment at the plant<br />
Waßmannsdorf (Brandenburg) results in a sludge<br />
which primarily consists of magnesium ammonium<br />
phosphate (MAP). Although total phosphorus is<br />
only 12.6% its availability is relatively high compared<br />
to other phosphorus minerals. Following a<br />
sequential exctraction the solubility of phosphorus<br />
ranges between CaHPO4 x 2 H2O (Brushit) und<br />
Fe3(PO4)2 (Vivianit) (Fig. 7.6).The fertilising effect<br />
of MAP may open new ways for the agricultural<br />
plant production.<br />
Phosphor (P) ist einer der am stärksten limitierten<br />
Nährstoffe auf der Erde, die unabdingbar für das<br />
Pflanzenwachstum sind. Es kann davon ausgegangen<br />
werden, dass die wirtschaftlich erschließbaren,<br />
schwermetallarmen P-Vorkommen<br />
Fe3(PO 4) 2<br />
76,7%<br />
CaHPO 4 x 2 H 2O<br />
6,1%<br />
19,0%<br />
23,0%<br />
P ges = 17,3%<br />
22,9%<br />
P ges = 18,0%<br />
51,8%<br />
Ca 3(PO 4) 2<br />
89,7%<br />
bei dem prognostizierten Verbrauch in wenigen<br />
Jahrzehnten erschöpft sein werden. Daher gewinnen<br />
Recyclingprozesse, die qualitativ hochwertigen<br />
Phosphor - pflanzenverfügbar und arm an<br />
Schwermetallen - aus Abwässern bereitstellen,<br />
zunehmend an Bedeutung. Bei der Reinigung <strong>des</strong><br />
Berliner Abwassers wird in der Kläranlage Waßmannsdorf<br />
kein eisen- bzw. aluminiumhaltiges<br />
Fällungsmittel eingesetzt. Lediglich MgCl2 kommt<br />
zur Unterdrückung von Inkrustationen zum Einsatz.<br />
Dadurch ist P im anfallenden Faulschlamm<br />
weniger fest gebunden und landwirtschaftlich besser<br />
verwertbar. Der entstehende Schlamm besteht<br />
im Wesentlichen aus Magnesium-Ammoniumphosphat<br />
(MAP) mit einem P-Gesamtgehalt von<br />
12,6 %. Das ist im Vergleich zu anderen P-haltigen<br />
Mineralien wenig. Zur Einschätzung der Düngewirksamkeit<br />
ist allerdings die P-Löslichkeit ein geeigneterer<br />
Parameter. In einem sequentiellen Extraktionsverfahren<br />
zeigte MAP eine gute P-Löslichkeit<br />
in unterschiedlich starken Lösungsmitteln von<br />
Ammoniumchlorid bis zur Salzsäure (Bild 7.6).<br />
Auf der Grundlage der beiden leicht löslichen Fraktionen<br />
(NH4Cl und BD = Bicarbonat/Dithionit) reiht<br />
sich die Verfügbarkeit von P zwischen CaHPO4 x 2<br />
H2O (Brushit) und Fe3(PO4)2 (Vivianit). In Anlehnung<br />
an die Düngemittelverordnung wurden am<br />
Lan<strong>des</strong>amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft<br />
weitere Extraktionsverfahren eingesetzt,<br />
wonach das MAP dem Düngemitteltyp „Teilaufgeschlossenes<br />
Rohphosphat mit Magnesium“<br />
zugeordnet werden kann. Unter Berücksichtigung<br />
möglicher Schadstoffgehalte, können sich interessante<br />
Vermarktungsmöglichkeiten und Einsatzbereiche<br />
in der Landwirtschaft eröffnen. /282/, /283/<br />
P ges = 20,0%<br />
4,1% 5,2%<br />
MgNH 4PO 4 x 6 H 2O (MAP)<br />
0,9%<br />
7,0%<br />
17,1%<br />
31,6% NH4Cl<br />
44,3%<br />
P ges = 12,6%<br />
BD<br />
NaOH<br />
HCl<br />
Allgemeine<br />
Löslichkeitszunahme<br />
Increase<br />
of solubility<br />
Bild 7.6: Anteil löslicher P-Fraktionen am P-Gesamtgehalt verschiedener Mineralverbindungen nach sequentieller<br />
Extraktion<br />
Fig. 7.6: Solubility of phosphorus related to the total phosphorus in minerals after sequential extraction
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
Scientific Cooperation<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 85<br />
- „Prozesssteuerung von Biogasanlagen mit Kofermentation“<br />
(LINKE, BERND)<br />
1 Kooperationen mit Wissenschaftseinrichtungen<br />
Cooperation with Research Institutions<br />
„Wissenschaftliches Messprogramm zur Bewertung von<br />
Biogasanlagen im landwirtschaftlichen Bereich“<br />
Förderung: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe<br />
1.1 Mitarbeit an Verbundprojekten oder Kompetenznetzen<br />
(FNR)<br />
Förderkennzeichen: 00NR179<br />
Koordinator: WEIHLAND, PETER (FAL Braunschweig)<br />
BMBF-Kompetenznetz „ProSenso.Net“<br />
Verbundprojekt-Titel: „Verbesserung der Umweltverträglichkeit<br />
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren durch<br />
Entwicklung innovativer Sensorik und Gestaltung der<br />
Produktionsprozesse im Sinne eines integrierten Umweltschutzes“<br />
Mitarbeit <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> in 13 Teilprojekten mit über 20<br />
Industrie- und Forschungspartnern<br />
Förderung: BMBF<br />
Förderkennzeichen: 0339992<br />
Koordinator: KRAMER, ECKART (<strong>ATB</strong>)<br />
Partner im gemeinsamen Projekt:<br />
- Institut für Technologie und Biosystemtechnik, FAL<br />
Braunschweig<br />
(RIEGER, CHRISTA UND EHRMANN, THOMAS)<br />
- TUM, Bay. Lan<strong>des</strong>anstalt für Maschinen- und Bauwesen<br />
Hohenheim (KISSEL, RAINER UND GRONAUER,<br />
ANDREAS)<br />
- Lan<strong>des</strong>anstalt f. Landw. Maschinen- und Bauwesen<br />
Hohenheim (HELFFRICH, DOMINIC UND OECHSNER, HANS)<br />
- Institut für Agrartechnik Bornim (MELCHER, FRANK UND<br />
LINKE, BERND)<br />
Teilprojekte: „Tresternetz Berlin-Brandenburg, AG Biokonversion und<br />
- „Entwicklung und Evaluierung eines Sensors für die bioaktive Stoffe“<br />
Pflanzenmasseerfassung zur Ertragskartierung sowie Förderung: BMWi (AIF)<br />
zur teilflächenspezifischen Bestan<strong>des</strong>führung“<br />
Förderkennzeichen: 003803N<br />
(EHLERT, DETLEF)<br />
Koordinator: GEERHARDT, MAIKE (Institut für Agrar- und<br />
- „Messsystem zur Bewertung <strong>des</strong> Unkrautvorkommens“<br />
(LANGNER, HANS)<br />
- „Optimierung der Steuerung von modernen Beregnungsanlagen<br />
und die ökologische und ökonomische<br />
Bewertung großflächiger Bewässerung“<br />
(PLÖCHL, MATTHIAS)<br />
Stadtökologische Projekte)<br />
Partner im gemeinsamen Projekt:<br />
- Institut für Agrartechnik Bornim (LINKE, BERND)<br />
- Biowork GmbH (MÜLLER, WILFRIED)<br />
- Frankenförder Forschungsgesellschaft mbH<br />
(SPARBORTH, DOREEN)<br />
- LIVEN GmbH (LIENIG, FRANK)<br />
- „Miniaturisiertes Datenerfassungs-System zum Implantieren<br />
in Früchte und zur Messung ihrer mechanischen<br />
- Ökofeeding GmbH (HÄGER, HERMANN)<br />
Belastung durch Ernte- und Nachernteverfahren“<br />
„Land Use and Cover Change“<br />
(HEROLD, BERND) Förderung: Gemeinsames Projektnetzwerk von IGBP<br />
- „Optimierte Steuerung von Getreide-Schachttrock-<br />
(International Geosphere Biosphere Programme) und<br />
nern“<br />
IHDP (International Human Dimension Programme)<br />
(FÜRLL, CHRISTIAN)<br />
Koordinator: GEIST, BERND, Universitè Catholique Lou-<br />
- „Anwendung der Thermografie zur Optimierung der<br />
vain la Neuve, Belgien<br />
Belüftungssteuerung bei der Lagerhaltung landwirtschaftlicher<br />
Produkte“<br />
(GOTTSCHALK, KLAUS)<br />
- „Membranbioreaktor zur Aufbereitung von Schlachthofabwässern“<br />
(REIMANN, WINFRIED)<br />
- „Entwicklung von Waschdüsen für eine effizientere<br />
“Transition in agriculture and future land use pattens”<br />
Förderung: nicht gefördert<br />
Koordinator: BROUWER, FLOOR, Agricultural Economics<br />
Research Institute (LEI), Wageningen (NL)<br />
Partner im gemeinsamen Projekt:<br />
<strong>ATB</strong> (PLÖCHL, MATTHIAS) und 44 weitere Partner<br />
Wäsche von Gemüse und Speisekartoffeln“<br />
„Offenlandmanagement auf ehemaligen Truppen-<br />
(GEYER, MARTIN)<br />
übungsplätzen im pleistozänen Flachland Nord-Ost-<br />
- „Ozontes Waschwasser zur Qualitätssicherung leicht- Deutschlands: Naturschutzfachliche Grundlagen und<br />
verderblicher Produkte – Entwicklung einer Fuzzy Lo- praktische Umsetzung. Teilprojekt Sozioökonomie.“<br />
gic Steuerung <strong>des</strong> Waschprozesses“<br />
Förderung: Bun<strong>des</strong>ministerium für Bildung und For-<br />
(PLÖCHL, MATTHIAS)<br />
schung (BMBF)<br />
- „Entwicklung eines Echtzeitsensors für die Stärkebestimmung<br />
bei Kartoffeln als funktionaler Bestandteil eines<br />
optoelektronischen Verleseautomaten“<br />
(FÜRLL, CHRISTIAN)<br />
- „Prozesskontrolle der Qualität von frischem Obst und<br />
Gemüse mit Hilfe eines Multigas-Sensors“<br />
(HEROLD, BERND)<br />
Projektträger: dlr<br />
Förderkennzeichen: 01 LN 0008<br />
Koordinator: WIEGLEB, GERHARD, BTU Cottbus<br />
Partner im gemeinsamen Projekt:<br />
- Technische Universität Cottbus (WIEGLEB, GERHARD)<br />
- Universität Potsdam (WALLSCHLÄGER, DIETER)<br />
- Universität Freiburg (KONOLD, WERNER)<br />
- Naturkundemuseum Görlitz (XYLANDER, WILLI)<br />
- <strong>ATB</strong> (SCHLAUDERER, RALF; PROCHNOW, ANNETTE)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
86<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
„Scientific Network Agrorisks“ - RALA Agricultural Research Institute, Reykjavik ISL<br />
Förderung: EU-Antrag (EU FP6) in Vorbereitung<br />
(TÓMASSON, THORSTEINN)<br />
Koordinator: MYCZKO, ANDRZEY, IBMER, Poznan, Polen - Universität Heidelberg (WINK, MICHAEL)<br />
Partner im gemeinsamen Projekt:<br />
- BIOPOS e.V. Teltow (KAMM, BIRGIT)<br />
- Institut für Agrartechnik Bornim (BRUNSCH, REINER;<br />
- biorefinery.de GmbH Potsdam (KAMM, MICHAEL)<br />
BREHME, ULRICH)<br />
- Institut für Agrartechnik Bornim (VENUS, JOACHIM;<br />
- Schweden, Niederlande, Schottland, Polen, Ukraine,<br />
Tschechien, Litauen, Ungarn, Österreich, Russland, I-<br />
REIMANN, WINDFRIED; IDLER, CHRISTINE)<br />
talien, Bulgarien, Estland, Belgien<br />
“Renewable Energy Centre of Excellence and Competence<br />
(RECEPOL)”<br />
„ProInno Projekt: Maschine für den Faseraufschluss mit Förderung : EU FP6<br />
integrierter Schäbentrennung“ Förderkennzeichen : NNE5/2002/00004<br />
Förderung: Bun<strong>des</strong>ministerium für Wirtschaft und Tech- Koordinator: WISNIESWSKI, GRZEGORZ, EC Baltic Renenologiewable<br />
Energy Centre Warsaw, Poland<br />
Förderkennzeichen: KF 0096304KWZO<br />
Partner im gemeinsamen Projekt:<br />
Koordinator: FÜRLL, CHRISTIAN (<strong>ATB</strong>) - Institut für Agrartechnik Bornim (HOFFMANN, THOMAS)<br />
Partner im gemeinsamen Projekt: - ECBREC Warsaw/PL,<br />
- Fa. Kranemann Gartenbaumaschinen GmbH - Uni Twente/NL,<br />
- CRES Athen/Gr,<br />
„InnoRegio RIO Verbundprojekt: Entwicklung eines neu- - ECN Amsterdam/NL,<br />
artigen Grundkonzepts für eine Faseraufbereitungsanla- - Uni Vienna/AU,<br />
ge mit Prallaufschluss – Teilvorhaben: Entwicklung von - ESD Wiltshire/UK,<br />
Maschinen für die Aufbereitung von Naturfasern“<br />
- Universität Stuttgart/D,<br />
Förderung: BMBF (PtJ) - RNL Roskilde/DK,<br />
Förderkennzeichen: 03 I 4607A<br />
Koordinator: FÜRLL, CHRISTIAN (<strong>ATB</strong>)<br />
- Uni Cork/IR,<br />
Partner im gemeinsamen Projekt: Central and Eastern European Institutes of Agriaultural<br />
- Fa. Kranemann Gartenbaumaschinen GmbH<br />
Engineerings (CEEAgEng)<br />
Förderung: EU-Förderung angestrebt<br />
„Aufbau eines Brandenburger Kompetenzzentrums zur Korrdinator auf deutscher Seite: SCHOLZ, VOLKHARD, <strong>ATB</strong><br />
Technologie der Naturfasergewinnung“<br />
Potsdam<br />
Förderung: BMBF/MWFK<br />
Partner im geimensamen Projekt:<br />
Förderkennzeichen: 24#2598-04/305; 2000<br />
- die nationalen Agrartechnischen Institute von Ungarn,<br />
Koordinator: FÜRLL, CHRISTIAN (<strong>ATB</strong>)<br />
Tschechien, Polen, slowakei, Estland, Litauen, Lett-<br />
Partner im gemeinsamen Projekt:<br />
- Brandenburgische Technische Universität<br />
land, Rußland<br />
„Untersuchungen zur verlustminimierten und humanhy- 1.3 Kooperationen mit Universitäten, Hochschulen<br />
gienischen Lagerung von Feldholz“<br />
und außeruniversitären Forschungseinrichtun-<br />
Förderung: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe<br />
(FNR)<br />
gen<br />
Förderkennzeichen: 22013699 (99NR136)<br />
Koordinator: SCHOLZ, VOLKHARD<br />
a) National<br />
Partner im gemeinsamen Projekt: - Bayerische Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft (LfL),<br />
- Büro für Holzschutz und Wohnraumhygiene Potsdam<br />
- Institut für Landtechnik, Bauwesen und<br />
- Fa. Energieholz GmbH Zempow<br />
Umwelttechnik, Freising<br />
1.2 Mitarbeit in EU-Projekten und Netzwerken der<br />
EU<br />
EU CRAFT-Projekt BESUB: “Biochemicals and Energy<br />
from sustainable Utilization of herbaceous Biomass”<br />
Förderung : EU<br />
Förderkennzeichen: CRAF-1999-70986<br />
Koordinator: LEIFSSON, ASGEIR, Icelandic Biomass Company<br />
IBC<br />
Partner im gemeinsamen Projekt:<br />
- IBC The Icelandic Biomass Company, Hafnarfjoerdur<br />
ISL (LEIFSSON, ASGEIR)<br />
- tetra Ingenieure GmbH, Neuruppin (JEREMIAS, ERNST-<br />
PETER)<br />
- Beltra Forestry Ltd., New Port IRL (O’MALLEY, GEORGE)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
- Brandenburgische Technische Universität Cottbus<br />
(BTU)<br />
- Fakultät Umweltwissenschaften und Verfahrens-<br />
technik<br />
- Institut für Umwelttechnik<br />
- Institut für Verfahrenstechnik<br />
- Bun<strong>des</strong>forschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL),<br />
Braunschweig<br />
- Institut für Technologie und Biosystemtechnik<br />
- Fachhochschule Eberswalde<br />
- Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW),<br />
Berlin<br />
- Fachbereich 4<br />
- Fachhochschule Hannover<br />
- FB Bioverfahrenstechnik
- Fachhochschule Lausitz, Senftenberg<br />
- FB Bio-, Chemie- und Verfahrenstechnik<br />
- Fachhochschule Magdeburg, Stendal<br />
- Fachhochschule Osnabrück<br />
- Forschungsanstalt Geisenheim<br />
- Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften<br />
e.V., Finsterwalde<br />
- Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerforschung,<br />
Golm<br />
- Georg-August-Universität Göttingen<br />
- Fakultät für Agrarwissenschaften, Institut für Agri-<br />
kulturchemie<br />
- Hochschule Zittau/Görlitz (FH)<br />
- FG Biotechnologie<br />
- Humboldt Universität zu Berlin<br />
- Landwirtschaftlich Gärtnerische Fakultät<br />
- Institut für agrar- und stadtökologische Projekte<br />
- Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt<br />
e.V. (IGZ), Großbeeren<br />
- Lan<strong>des</strong>umweltamt Brandenburg, Cottbus<br />
- Landtechnik Weihenstephan<br />
- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung<br />
e.V. (ZALF), Müncheberg<br />
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />
- Institut für Acker- u. Pflanzenbau<br />
- Naturkundemuseum Görlitz<br />
- Naturstoffinnovationsnetzwerk Altmark e. V., Gardelegen<br />
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg<br />
- Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik<br />
Institut für Strömungstechnik und Thermodynamik<br />
Institut für Verfahrenstechnik<br />
- Technische Fachhochschule Berlin<br />
- Technische Universität Bergakademie, Freiberg<br />
- Technische Universität Berlin<br />
- Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebens-<br />
mittelchemie<br />
- Technische Universität Dresden<br />
- Technische Universität München<br />
- Wissenschaftszentrum Weihenstephan für<br />
Ernährung, Landnutzung und Umwelt<br />
- Department für Biogene Rohstoffe und<br />
Technologie der Landnutzung<br />
- FG Technik im Pflanzenbau<br />
- Lehrstuhl für Landmschinen, Garching<br />
- Tierärztliche Hochschule Hannover<br />
- Universität Potsdam<br />
- Institut für Chemie<br />
- Interdisziplinäres Forschungszentrum<br />
- Universität Bonn<br />
- Universität Freiburg<br />
- Universität Hamburg<br />
- Institut für Allgemeine Botanik und Botanischer<br />
Garten<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 87<br />
- Universität Heidelberg<br />
- Institut für Pharmazie und Molekulare<br />
Biotechnologie<br />
- Universität Hohenheim<br />
- Lan<strong>des</strong>anstalt für landwirtschaftliches Maschinen-<br />
und Bauwesen<br />
- Obstbauversuchsanlage Bavendorf<br />
- Universität Rostock<br />
- Universität Stuttgart<br />
- Institut für Energiewirtschaft und rationelle<br />
Energieanwendung<br />
b) International<br />
- Centro de Gerencia de Programas y Proyectos Priorizados,<br />
Havana, Cuba<br />
- Citrus Research and Education Center (CREC), Florida,<br />
USA<br />
- Department for Environmental Biotechnology, Tulln,<br />
Austria<br />
- Dept Food Engineering, Lund University, Lund,<br />
Schweden<br />
- EC Baltic Renewable Energy Centre EC BREC /<br />
IBMER, Warsaw, Poland<br />
- Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst- Wein-<br />
und Gartenbau, Wädenswil, Schweiz<br />
- Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich,<br />
Schweiz<br />
- Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Niederlande<br />
- GMIT Galway-Mayo Institute of Technology, Galway,<br />
Irland<br />
- Institut für Agrartechnik, Gödöllö, Ungarn<br />
- Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik der<br />
Russischen Akademie der Wissenschaften, Moskau,<br />
Russland<br />
- Institut National Agronomique Paris-Grignon, Abteilung<br />
Analytische Chemie, Paris, Frankreich<br />
- Institute for Building, Mechanisation and Electrification<br />
of Agriculture, Warsawa, Polen<br />
- Institute of Natural Fibres, Poznan, Polen<br />
- Instituto de Meteorologia Cuba, Havana, Cuba<br />
- Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Belgien<br />
- Tschechischen Universität für Landwirtschaft, Technischen<br />
Fakultät, Lehrstuhl Physik, Prag, Tschechische<br />
Republik<br />
- Newcastle University, School of Biology, Newcastle<br />
upon Tyne, Vereinigtes Königreich<br />
- Physics-Control Department, University of Horticulture<br />
and FoodTech. Budapest, Ungarn<br />
- RALA Agricultural Research Institute, Reykjavik,<br />
Island<br />
- Research Institute of Agricultural Engineering<br />
(VUZT), Praha, Czech Republic<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
88<br />
- Research Institute of Animal Production (VUZV),<br />
Nitra, Slowakei<br />
- Research Institute of Pomology and Floriculture,<br />
Skierniewice, Polen<br />
- Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft,<br />
Zollikofen, Schweiz<br />
- Szent István Universität, Gödöllö, Ungarn<br />
- Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais,<br />
Brasilien<br />
- Universität Campinas, Brasilien<br />
- Universität Guelph, Canada<br />
- Universität von Alberta, Edmonton, Canada<br />
- Universität Wageningen, Niederlande<br />
- University of Illinois, Department of Natural Resources,<br />
Urbana, Illinois, USA<br />
- University of Maryland, Chestertown, MD, USA<br />
- University Wageningen, Section Environmental<br />
Technology, Wageningen, Netherlands<br />
1.4 Gemeinsame Berufungen, Professuren und<br />
Privatdozenturen<br />
Prof. Dr. habil. Reiner Brunsch<br />
Honorarprofessur an der Humboldt-Universität zur Berlin<br />
PD Dr. habil. Karl-Heinz Dammer<br />
Privatdozent an der Martin-Luther-Universität Halle<br />
Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Fürll<br />
außerplanmäßiger Professor an der Universität Rostock<br />
PD Dr. sc. agr. Bernd Linke<br />
Privatdozent an der Humboldt-Universität zu Berlin<br />
PD Dr. rer. agr. Annette Prochnow<br />
Privatdozent an der Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Zaske<br />
Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zur Berlin<br />
1.5 Lehrtätigkeit<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät<br />
"Tierhaltungssysteme" , Pflichtmodul im Masterstudiengang<br />
Nutztierwissenschaften<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>, 1 SWS<br />
BRUNSCH, REINER<br />
"Umweltmonitoring", Wahlmodul im Masterstudiengang<br />
Nachhaltige Landnutzung<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 2 SWS<br />
BRUNSCH, REINER<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
„Nacherntetechnologie bei gartenbaulichen Produkten“<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/04, 2 SWS<br />
GEYER, MARTIN<br />
„Modellansatz REPRO zur Analyse und Bewertung<br />
von Umweltwirkungen landwirtschaftlicher Betriebssysteme“<br />
4 Stunden<br />
KALK, WOLF-DIETER<br />
„Biogas aus Energiepflanzen“<br />
Wintersemester, 4 Stunden<br />
LINKE, BERND<br />
„Bioverfahrenstechnik im Umweltschutz“ einschl.<br />
Blockpraktikum<br />
Wintersemester, 2 Semesterwochenstunden (SWS)<br />
LINKE, BERND<br />
„Spezielle Verfahrenstechnik“<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 2 SWS<br />
PROCHNOW, ANNETTE<br />
Universität Rostock<br />
„Verarbeitungstechnik – Verarbeitungsmaschinen“<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 3 SWS<br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
Universität Potsdam<br />
Vorlesung/Seminar „Angewandte Limnologie“<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, 2 SWS<br />
KERN, JÜRGEN; KNÖSCHE, RÜDIGER<br />
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät<br />
„Ökobilanzen in der Landwirtschaft“, Wahlfach im<br />
Diplomstudiengang „Geoökologie“<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 2 SWS<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
Brandenburgische Technische Universität Cottbus<br />
Seminar „Land use and habitat management by animals”<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, 2 SWS<br />
BERG, WERNER<br />
„Produktionsbauten im ländlichen Raum“ Wahlpflichtfach<br />
im Studiengang „Landnutzung und Wasserbewirtschaftung“<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 2 SWS<br />
BREHME, ULRICH<br />
Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik<br />
„Land- und Forsttechnik“, Pflichtfach im Studiengang<br />
Landnutzung und Wasserbewirtschaftung<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, 2 SWS<br />
EHLERT, DETLEF
Vorlesung „Kartoffellagerung“<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, 4 Stunden<br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Vorlesung "Energietechnik für den ländlichen Raum",<br />
Wahlpflichtfach im Studiengang "Landnutzung und<br />
Wasserbewirtschaftung"<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 2 SWS<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN; SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Vorlesung: „Ernte, Aufbereitung und Verarbeitung von<br />
Faserpflanzen“<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, 2 Doppelstunden<br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
Fakultät Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik<br />
„Life Cycle Assessment in Agriculture“ (LCA), Wahlmodul<br />
im B.Sc.-Studiengang „Environmental and Resource<br />
Management“<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, 2 SWS<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
Fakultät Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik<br />
Doktorandenseminar “Use of chemicals in Agriculture”<br />
(verantwortlich ERTEL, JÜRGEN)<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, 2 Stunden<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
Fakultät Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik<br />
Fachexkursion zu Jessener Frischgemüse Verarbeitungs<br />
GmbH, Wahlexkursion im B.Sc.-Studiengang<br />
„Environmental and Resource Management“<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, ganztägig<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
Fakultät Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik<br />
Fachexkursion zum Umweltbun<strong>des</strong>amt, Wahlexkursion<br />
im B.Sc.-Studiengang „Environmental and Resource<br />
Management“<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, ganztägig<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
Vorlesung „Mikrobiologie“<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 2 SWS<br />
VENUS, JOACHIM<br />
Fakultät Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik<br />
“Introduction to Environmental and Resource Management”,<br />
Pflichtmodul im B.Sc.-Studiengang “Environmental<br />
and Resource Management”<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/2004, 2 SWS<br />
WIEGLEB, GERHARD; SCHLAUDERER, RALF<br />
Universität Hohenheim<br />
„Entscheidungsmodelle und ökonomische Aspekte im<br />
Pflanzenschutz – Teilbereich Herbologie“<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 8 Stunden<br />
SCHWARZ, JÜRGEN<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 89<br />
TU Berlin<br />
Fakultät III – Prozesswissenschaften, Fachgebiet Lebensmittelbiotechnologie<br />
und -prozesstechnik,<br />
„Spezielle Prozesse der Obst- und Gemüseverarbeitung“<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>/04, 2 SWS<br />
SCHLÜTER, OLIVER<br />
andere Universitäten<br />
Szent István Universität, Gödöllö, Ungarn, Dept. of<br />
Physics and Process Control<br />
Vorlesung “Potato store climate control”<br />
Sommersemester, 4 x 2 Stunden<br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Fachhochschulen<br />
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW)<br />
Berlin<br />
„Mathematik für Medieninformatiker - Internationale Medieninformatik“<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 4 SWS<br />
MODEL, NIKOLAUS<br />
Technische Fachhochschule Berlin (TFH), Fachbereich<br />
- Elektrotechnik und Feinwerktechnik<br />
„Elektronische Messtechnik“,<br />
Sommersemester <strong>2003</strong>, 8 SWS Laborübungen<br />
Wintersemester <strong>2003</strong>, 2 SWS Vorlesungen und<br />
4 SWS Laborübungen<br />
LANGNER, HANS-RAINER<br />
1.6 Betreuung von Doktoranden, Diplomanden,<br />
Praktikanten und Lehrlingen<br />
Habilitanden<br />
ZUDE, MANUELA<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Fachgebiet Angewandte<br />
Pflanzenphysiologie<br />
Thema der Arbeit: “Non-<strong>des</strong>tructive sensing of fruit quality”<br />
Gutachter: SCHMIDT, UWE (HUB); LUEDDERS, PETER<br />
(em.); MILLER WILLIAM MM (CREC)<br />
Doktoranden<br />
(laufende Dissertationen)<br />
AGUSTINY, SYLVIA<br />
(seit 09/1999)<br />
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg<br />
Thema der Arbeit: „Untersuchungen zu Feststoffbewegung<br />
und Wärmeübergang in der Schüttung eines Drehrohrofens“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: MELLMANN, JOCHEN<br />
Betreuer der Universität: SPECHT, ECKEHARD<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
90<br />
AMER, BAHER MAHMOUD<br />
(seit 10/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt Universität zu Berlin<br />
Thema der Arbeit: “Drying of fruits under particular consideration<br />
of solar energy in Egypt”<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Betreuer der Universität: HAHN, JÜRGEN<br />
Finanzierung: Islamic Development Bank (IDB), Saudi<br />
Arabia<br />
EL SAEIDY, EHAB<br />
(seit 10/1999)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Thema der Arbeit: „Energetic use of solid farm residues<br />
in Egypt“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Betreuer der Universität: HAHN, JÜRGEN<br />
GATTNER, CHRISTIAN<br />
(seit 09/2002)<br />
Universität Rostock<br />
Thema der Arbeit: „Erfolgspotentiale und Probleme bei<br />
der Vermarktung von Dämmstoffen aus den nachwachsenden<br />
Rohstoffen Flachs und Hanf – Ansätze und<br />
Perspektiven vertikaler Kooperationen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: FÜRLL, CHRISTIAN<br />
Betreuer der Universität: TACK, FRITZ<br />
JAKOB, MARTINA<br />
(seit 15.10.2000)<br />
Humboldt Universität zu Berlin<br />
Thema der Arbeit: „Gestaltung von Mensch-Maschine-<br />
Systemen im gartenbaulichen Nachernteprozess, Promotion“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: GEYER, MARTIN<br />
Betreuer der Universität: BOKELMANN, WOLFGANG<br />
KREHL, INES<br />
(seit 08/2002)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Thema der Arbeit: "Früherkennung von Eutererkrankungen<br />
durch Überwachung der Na- und K-<br />
Ionenkonzentrationen in der Milch"<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: BRUNSCH, REINER<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: WENDT, KURT; KAUFMANN, OTTO<br />
LATSCH, ROY<br />
(seit 11/1999)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: Langfristige Umweltwirkungen von<br />
Verfahren für die großflächige Landschaftspflege<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PROCHNOW, ANNETTE<br />
Betreuer der Universität: HAHN, JÜRGEN<br />
LIU, XIAO YAN<br />
(seit 09/2001)<br />
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg<br />
Thema der Arbeit: Prozessmodellierung von Drehrohröfen<br />
– gekoppelte Berechnung von Feststofftransport<br />
und Wärmeübertragung<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: MELLMANN, JOCHEN<br />
Betreuer der Universität: SPECHT, ECKEHARD<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
LUCKHAUS, CHRISTOPH<br />
(seit 08/2001)<br />
Universität Stuttgart<br />
Thema der Arbeit: „Grundlagen eines Schemas zur Abschätzung<br />
<strong>des</strong> Biomassepotentials zur Biogasnutzung<br />
in tropischen und subtropischen Regionen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Betreuer der Universität: VOß, ALFRED<br />
MÄHNERT, PIA<br />
(seit 09/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich Gärtnerische<br />
Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Kinetik der Biogasgewinnung bei<br />
kontinuierlicher Nassvergärung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: LINKE, BERND<br />
Betreuer der Universität: HAHN, JÜRGEN<br />
MALÝ, PAVEL<br />
(seit 05/2002)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Thema der Arbeit: „Verfahrenstechnische Untersuchungen<br />
zur beschädigungsarmen Ernte, zum schonenden<br />
Transport und zur belastungsarmen Lagerung von Kartoffeln“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: HOFFMANN, THOMAS; FÜRLL,<br />
CHRISTIAN<br />
Bertreuer der Universität: PROCHNOW, ANNETTE<br />
MOHAMED AWAD<br />
(seit 10/<strong>2003</strong>)<br />
Universität Hohenheim<br />
Thema der Arbeit: “Environmental and Socio-economic<br />
Assessment of Land Reclamation around Lake Nasser”<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHLAUDERER, RALF<br />
Betreuer der Universität: DOPPLER, WERNER<br />
MOLLOY, ELEANOR<br />
(seit 09/2001)<br />
Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK<br />
Thema der Arbeit: “Influence of ozonated washing water<br />
on pathogens located on the surface of lettuce”<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Betreuer der Universität: BARNES, JEREMY<br />
MUMME, JAN<br />
(seit 09/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich Gärtnerische<br />
Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Optimierung und Bewertung von<br />
Verfahren zur Trockenfermentation landwirtschaftlicher<br />
Biomassen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: LINKE, BERND<br />
Betreuer der Universität: TÖLLE, REINER<br />
PECENKA, RALF<br />
(seit 01/2000)<br />
Brandenburgische Technische Universität<br />
Thema der Arbeit: „Reinigung von Naturfasern“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: FÜRLL, CHRISTIAN<br />
Betreuer der Universität: AY, PETER
PRYSTAV, WERNER<br />
(seit 08/2000)<br />
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg<br />
Thema der Arbeit: „Bewertung der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher<br />
Anbausysteme anhand von Nährstoff-,<br />
Humus- und Energiebilanzen am Beispiel eines Dauerfeldversuches<br />
und eines landwirtschaftlichen Betriebes“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: KALK, WOLF-DIETER<br />
Betreuer der Universität: CHRISTEN, OLAF<br />
RICHTER, SASCHA<br />
(seit 04/1998)<br />
Technische Universität Berlin, Institut für angewandte<br />
Informatik, Wissensbasierte Systeme<br />
Thema der Arbeit: „Wissensbasiertes System zur Einflussanalyse<br />
auf die Qualität von Agrarprodukten“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Betreuer der Universität: KONRAD, ERHARD<br />
ROHRBACH, ALEXANDER<br />
(seit 09/2002)<br />
Humboldt Universität zu Berlin Landwirtschaftl. –Gärt.<br />
Fakultät, Fachgebiet Technik im Gartenbau<br />
Thema der Arbeit: „Zerstörungsfreie Bestimmung der<br />
Kernobstreife am Baum und Fruchtalterung in der<br />
Nachernte mit Hilfe der spektralanalytischen Fruchtpigmenterfassung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: ZUDE, MANUELA<br />
Betreuer der Universität: SCHMIDT, UWE<br />
ROSE, SANDRA<br />
(seit 10/2002)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Thema der Arbeit: "Reduzierung der Belastung am Euter<br />
durch technische Veränderungen am Melkzeug"<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PROF. DR. BRUNSCH<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PROF. DR. BRUNSCH<br />
SCHURICHT, THOMAS<br />
(seit 01/1999)<br />
Technische Universität Braunschweig<br />
Thema der Arbeit: „Modellierung der Fliessvorgänge in<br />
Schüttgutsilos“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: FÜRLL, CHRISTIAN<br />
Betreuer der Universität: SCHWEDES, JÖRG<br />
WULF, JANINA<br />
(seit 08/2002)<br />
Humboldt Universität zu Berlin, Gartenbauwissenschaften<br />
Thema der Arbeit: „Fluoreszenzanalyse im Obstbau“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: ZUDE, MANUELA<br />
Betreuer der Universität: BOKELMANN, WOLFGANG<br />
Diplomanden<br />
ANDANDOAH, T. ERNESTINE<br />
(03/<strong>2003</strong>-08/<strong>2003</strong>)<br />
Brandenburgische Technische Universität Cottbus<br />
Thema der Arbeit: “Briquetting of Straw for Use as Biofuel”<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Betreuer der Universität: ETTEL, JÜRGEN<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 91<br />
BERGK, MARTINA<br />
(05/<strong>2003</strong>)<br />
Technische Universität Berlin – Fachgebiet Maschinen-<br />
und Energieanlagentechnik<br />
Thema der Arbeit: „Biomethanisierung von Roggenhydrolysat<br />
im kontinuierlichen Laborversuch zur Bestimmung<br />
relevanter Prozess- und Stoffparameter“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: LINKE, BERND<br />
Betreuer der Universität: ZIEGLER, FELIX<br />
BOCK, TOBIAS<br />
(Abschluss 11/<strong>2003</strong>)<br />
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin<br />
(FHTW – Berlin)<br />
Thema der Arbeit: „Einsatz von Membranverfahren zur<br />
Aufbereitung schwach belasteter Wasch- und Prozesswässer<br />
aus der Be- und Verarbeitung landwirtschaftlicher<br />
Produkte“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: REIMANN, WINFRIED<br />
Betreuer der Fachhochschule: KOHLMANN, JÜRGEN<br />
BOHLS, GABRIELE<br />
(seit 09/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Analyse und Bewertung von Stoffflüssen<br />
in einem langjährig biologisch-dynamisch bewirtschafteten<br />
Betrieb auf einem Brandenburger Sandstandort“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: KALK, WOLF-DIETER<br />
Betreuer der Universität: HOFFMANN, HEIDE<br />
BUHMANN, MARIE<br />
(Abschluss 01/03)<br />
B.Sc. Studentin<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Verfahren zur Offenhaltung <strong>des</strong> ehemaligen<br />
Truppenübungsplatzes Glau“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PROCHNOW, ANNETTE<br />
Betreuer an der Universität: PROCHNOW, ANNETTE<br />
DEMIR, CAGATAY<br />
(Abschluss 03/<strong>2003</strong>)<br />
Technische Universität Berlin.<br />
Thema der Arbeit: „Aufbau eines Web-Server-basierten<br />
Systems zur Visualisierung und Fernwirkung von Klimaprozessdaten<br />
für Kartoffellager“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Betreuer der Universität: KONRAD, ERHARD<br />
DÖRRIE, JULIA<br />
(Abschluss 07/<strong>2003</strong>)<br />
Fachhochschule Hannover<br />
Thema der Arbeit: „Wuchsstoffversorgung von Lactobacilius<br />
paracasei mit Gerstenhydrolysat und Luzerne-<br />
Grünmassen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: RICHTER, KLAUS<br />
Betreuer der Fachhochschule: OHLINGER, HANS-PETER<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
92<br />
DRENCKHAN, AXEL<br />
(seit 08/<strong>2003</strong>)<br />
M.Sc. Student<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Parameter der Biomethanisierbarkeit<br />
von Landschaftspflegeaufwuchs im Jahresverlauf“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: HEIERMANN, MONIKA<br />
EILERS, FALK<br />
(06/<strong>2003</strong>-10/<strong>2003</strong>)<br />
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW)<br />
Berlin, Fachbereich 4<br />
Thema der Arbeit: „Mathematische Modellierung der<br />
Warmluft-Getreidetrocknung unter Berücksichtigung<br />
<strong>des</strong> Wärme- und Stoffübergangs im Einzelkorn“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: MODEL, NIKOLAUS; MELLMANN,<br />
JOCHEN<br />
Betreuer an der Universität: SCHNEIDER, EKKEHARD<br />
FÜRSTENAU, STEFAN<br />
(seit 06/2002)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Bewertung <strong>des</strong> Abplaggens als Managementverfahren<br />
zur Offenhaltung ehemaliger Truppenübungsplätze“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PROCHNOW, ANNETTE<br />
Betreuer der Universität: PROCHNOW, ANNETTE<br />
HELLER, FELIX<br />
(seit 06/<strong>2003</strong>)<br />
Thema der Arbeit: „Untersuchung zur Nährstoffbilanz im<br />
Freiland-Winterquartier von Mutterkühen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: KALK, WOLF-DIETER<br />
Betreuer der Universität: BRUNSCH, REINER<br />
HIELSCHER-TÖLZER, CHRISTOPHER<br />
(07/2002-05/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt Universität zu Berlin Landwirtschaftl. -Gärt.<br />
Fakultät, Fachgebiet Technik im Gartenbau<br />
Thema der Arbeit: „Einsatzmöglichkeiten eines elektrochemischen<br />
Sensors im Obstlager“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: ZUDE, MANUELA<br />
Betreuer der Universität: SCHMIDT, UWE<br />
KAPHENGST, TIMO<br />
(seit 11/<strong>2003</strong>)<br />
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald<br />
Thema der Arbeit: „Ökonomische Bewertung von Projekten<br />
zur Entwicklung halboffener Weidelandschaften“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PROCHNOW, ANNETTE<br />
Betreuer der Universität: HAMPICKE, ULF<br />
KLUGE, LUTZ<br />
(seit 2002)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Thema der Arbeit: „Solare Wasseraufbereitung in der<br />
Landwirtschaft“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: ZASKE, JÜRGEN<br />
Betreuer der Universität: HAHN, JÜRGEN<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
LÄGEL, ANJA<br />
(seit 09/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Analyse und Bewertung von Energieflüssen<br />
in einem langjährig biologisch-dynamisch<br />
bewirtschafteten Betrieb auf einem Brandenburger<br />
Sandstandort“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: KALK, WOLF-DIETER<br />
Betreuer der Universität: HOFFMANN, HEIDE<br />
LANGNER, ULF<br />
(seit 08/<strong>2003</strong>)<br />
Arnhem Business School (Immatrikulation) und Technische<br />
Fachhochschule Wildau<br />
Thema der Arbeit: „Analyse <strong>des</strong> Einflusses der Prozess-<br />
und Logistikkette von Soja auf die Qualität von Futtermitteln,<br />
am Beispiel der Verarbeitung von Soja bei der<br />
WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: KRAMER, ECKART<br />
Betreuer der Hochschule: SONNTAG, HERBERT<br />
MÄHNERT, PIA<br />
(Abschluss 02/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Grassorten als Kosubstrate bei der<br />
Biomethanisierung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: HEIERMANN, MONIKA; PLÖCHL,<br />
MATTHIAS<br />
Betreuer der Universität: PROCHNOW, ANNETTE<br />
MEIERHÖFER, JOHANN<br />
(Abschluss 05/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Verfahrenstechnische Maßnahmen<br />
für faunaschonende Maßnahmen bei der Grünlandmahd“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PROCHNOW, ANNETTE<br />
Betreuer der Universität: PROCHNOW, ANNETTE<br />
OEY, MAILIN<br />
(05/<strong>2003</strong>)<br />
Technische Universität Berlin, FG Lebensmitteltechnologie<br />
Thema der Arbeit: „Methode zur Bestimmung der Knackigkeit<br />
von Einlegegurken“<br />
Betreuer im <strong>ATB</strong>: HEROLD, BERND<br />
Betreuer der Universität: KNORR, DIETRICH<br />
PISCHKE, FREDERIK<br />
(01/<strong>2003</strong>-06/<strong>2003</strong>)<br />
B.Sc. Student<br />
Brandenburgisch Technische Universität Cottbus<br />
Thema der Arbeit: “Traditional risk prediction and prevention<br />
strategies in the San Pedro catchment area of<br />
Bolivia “<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHLAUDERER, RALF<br />
Betreuer der Universität: SCHMIDT, MICHAEL
RUTHENBERG, CHISTIAN-MARTIN<br />
(Abschluss 07/<strong>2003</strong>)<br />
Fachhochschule Wismar<br />
Thema der Arbeit: „Naturfaseraufschluss und Faserreinigung“<br />
Betreuer: PECENKA, RALF<br />
Betreuer der Hochschule: GERATH<br />
SASSE, ANDREAS<br />
(seit 10/2002)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Angepasste Technik für die Pflege<br />
<strong>des</strong> Feuchtgebietes Zarth, Brandenburg“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PROCHNOW, ANNETTE<br />
Betreuer der Universität: PROCHNOW, ANNETTE<br />
Shouli Yusuf<br />
(Abschluss 05/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Gartenbauwissenschaften,<br />
Produktqualität/Qualitätssicherung<br />
Thema der Arbeit: „Effect of cold induced stress on<br />
postharvest quality of Asparagus officinalis L.”<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: HERPPICH, WERNER B.<br />
Betreuer der Universität: HUYSKENS-KEIL, SUSANNE<br />
WEINER, MICHAEL<br />
(05/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt Universität zu Berlin, Fachgebiet Technik im<br />
Gartenbau<br />
Thema der Arbeit: „Anwendung der Mikrotopografie zur<br />
Charakterisierung der Oberfläche gartenbaulicher Produkte“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: HEROLD, BERND<br />
Betreuer der Universität: SCHMIDT, UWE<br />
Praktikanten<br />
ANTONIEWICZ, KARSTEN<br />
(08.09.-26.09.<strong>2003</strong>, Vorstudienpraktikum)<br />
Thema der Arbeit: „Biogasgewinnung aus pflanzlichen<br />
Rohstoffen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHELLE, HANNELORE; REHDE,<br />
GIOVANNA<br />
BASTIAN, LISA<br />
(08. – 18.12.<strong>2003</strong>, Schülerpraktikum)<br />
Lenné Gesamtschule<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: WEGNER, GABRIELE<br />
BELOW, SEBASTIAN,<br />
(10/<strong>2003</strong>-04/2004)<br />
Universität Rostock<br />
Thema der Arbeit: „Entwicklung und Konstruktion eines<br />
Masseausgleichs für eine Kammschüttel“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PECENKA, RALF<br />
BRION-NEITZEL, SILKE<br />
(21.07.-12.09.<strong>2003</strong>)<br />
URANIA-Schulhaus GmbH-Potsdam<br />
Praktikum zur Ausbildung als Sekretariatsfachkauffrau<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: EHLERT, DETLEF; HAGER, REGINA<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 93<br />
BRÜNING, HOLGER,<br />
(01/<strong>2003</strong>-03/<strong>2003</strong>)<br />
Technische Universität Berlin<br />
Thema der Arbeit: „Mitarbeit bei der Konstruktion von<br />
Versuchseinrichtungen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PECENKA, RALF<br />
CORDES, SEBASTIAN<br />
(10/<strong>2003</strong>-04/2004)<br />
Universität Rostock<br />
Thema der Arbeit: „Schneideinrichtung für Faserpflanzen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: MUNDER, FRIEDRICH<br />
DARIES, RONALD<br />
(08/2002-06/<strong>2003</strong>)<br />
Fachhochschule Brandenburg<br />
Thema der Arbeit: „Durchführung und Auswertung von<br />
Feldholzlagerversuchen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Betreuer der Universität: GÖTZE, THOMAS<br />
DIETRICH, STEFAN<br />
(09/<strong>2003</strong>-10/<strong>2003</strong>)<br />
Universität Potsdam<br />
Thema der Arbeit: „Wirkung von Schutzstreifen zur<br />
Schonung von Wirbellosen bei der Grünlandmahd“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PROCHNOW, ANNETTE<br />
DOROTHY, DUODU<br />
(22.-26.09.<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: HERPPICH, WERNER B.<br />
Betreuer der Universität: HUYSKENS-KEIL, SUSANNE<br />
DRENCKHAN, AXEL<br />
(08/<strong>2003</strong>-09/<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Thema der Arbeit: „Beitrag zur ökonomischen Bewertung<br />
von Energieholz aus Kurzumtriebsplantagen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Betreuer der Universität: PROCHNOW, ANNETTE<br />
EILERS, FALK<br />
(10/2002-02/<strong>2003</strong>)<br />
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW)<br />
Berlin<br />
Thema der Arbeit: „Programmtechnische Bearbeitung<br />
(C ++ ) eines Getreidetrocknungsmodells (Maltry)“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: MODEL, NIKOLAUS<br />
FRITZ, KATHARINA<br />
(28.07.-15.08.<strong>2003</strong>, Schülerpraktikum)<br />
Thema der Arbeit: „Messungen zur Einzelkorn-<br />
Feuchteverteilung bei frisch geerntetem Getreide“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: MELLMANN, JOCHEN<br />
GEORGIEVA, TEODORA<br />
(03/<strong>2003</strong>-06/<strong>2003</strong>)<br />
Technische Universität Sofia, Bulgarien<br />
Thema der Arbeit: „Beitrag zur Entwicklung einer Methode<br />
zur Festigkeitsprüfung von Biomassebriketts“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Betreuer der Universität: BOYADJEV, ILIA<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
94<br />
GERSHOVSKA, VIOLETA<br />
(03.03.-25.7.<strong>2003</strong>)<br />
Technische Universität Sofia, Bulgarien.<br />
Thema der Arbeit: „(1) Abtrocknen von Kartoffeln, (2)<br />
Belastungssimulation mittels FEM“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: GOTTSCHALK, KLAUS<br />
GRUNE, DOROTHEA<br />
(01.09.-31.10.<strong>2003</strong>)<br />
Humboldt- Universität zu Berlin<br />
Landwirtschaftlich Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Belastungssteigerung bei der mesophilen<br />
und thermophilen Biogasbildung aus Brennereischlempe“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: LINKE, BERND<br />
Betreuer der Universität: TÖLLE, REINER<br />
HEUNSCH, MAIK,<br />
(05/<strong>2003</strong>)<br />
Universität Potsdam<br />
Thema der Arbeit: „Literaturrecherche zur Faserreinigung<br />
und Datenbankpflege“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PECENKA, RALF<br />
HRISTOV YASENOV, STOYAN<br />
(01.03.-30.06.<strong>2003</strong>)<br />
Technische Universität Sofia, Bulgarien<br />
Thema der Arbeit: „Entwicklung und Konstruktion von<br />
Versucheinrichtungen für die Faserprüfung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PECENKA, RALF<br />
JORDANOV, ALEXANDER<br />
(01.03.-30.06.<strong>2003</strong>)<br />
Technische Universität Sofia, Bulgarien<br />
Thema <strong>des</strong> Praktikums: „Thermodynamische Untersuchungen<br />
zur Getreidetrocknung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: MELLMANN, JOCHEN<br />
KLAMKE, HASSO<br />
(04/<strong>2003</strong>-05/<strong>2003</strong>, Schülerpraktikum)<br />
Schiller Gymnasium<br />
Thema der Arbeit: „Messungen und Versuchsauswertung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: KAULFUß, PETER<br />
KNAPIK, ALICA<br />
(20.07.-10.10.<strong>2003</strong>)<br />
Hochschule Zittau/Görlitz (FH)<br />
Thema der Arbeit: „Entwicklung diagnostischer PCR-<br />
Marker zur stammspezifischen Identifikation von Fermentationsstämmen<br />
bei Lactobacillus paracasei“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: KLOCKE, MICHAEL<br />
Betreuer der Fachhochschule: SCHUBERT, ROLAND<br />
KRALISCH, STEFANIE<br />
(03/<strong>2003</strong>)<br />
Brandenburgisch Technische Universität Cottbus<br />
Thema der Arbeit: „Algorithmen zur Berechnung umweltrelevanter<br />
Emissionen aus der Tierhaltung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: BERG, WERNER; SCHLAUDERER, RALF<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
LAURES, CHRISTINE<br />
(03/<strong>2003</strong>)<br />
Brandenburgisch Technische Universität Cottbus<br />
Thema der Arbeit: „Einführung in das Programm Umberto<br />
am Beispiel Karottenverarbeitung in Jessen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHLAUDERER, RALF; BERG, WERNER<br />
MARTHER, KATHRIN<br />
(03.02.-31.03.<strong>2003</strong>, Vorstudienpraktikum)<br />
Thema der Arbeit: „Biogas aus landwirtschaftlichen<br />
Reststoffen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHELLE, HANNELORE; CARLOW,<br />
GUNDULA<br />
MÜLLER, MICHAELA<br />
(16.06.-11.07.<strong>2003</strong>, Schülerpraktikum)<br />
OSZ – Werder<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: WEGNER, GABRIELE<br />
NEIDEL, MADELEINE,<br />
(07/03-09/03)<br />
Universität Potsdam<br />
Thema der Arbeit: „Qualitätsmanagement in der Faserreinigung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: PECENKA, RALF<br />
NYKYPORETS, MYKHAYLO<br />
(10/2002- 04/<strong>2003</strong>)<br />
Technische Universität Dresden<br />
Thema der Arbeit: „Konstruktion einer Mühle zum Zerkleinern<br />
von Feuchtgetreide“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: MUNDER, FRIEDRICH<br />
Betreuer der Universität: WAGNER<br />
PFEFFER, ANTJE<br />
(17.03.-21.03.<strong>2003</strong>)<br />
Fachhochschule Eberswalde<br />
Thema der Arbeit: „Bestimmung von Schimmelpilzen<br />
auf Holz“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: IDLER, CHRISTINE<br />
Betreuer der Fachhochschule: UNGER, WIBKE<br />
PLASWIG, MANDY<br />
(03.-07.02.<strong>2003</strong>, Schülerpraktikum)<br />
Oberstufenzentrum Werder<br />
Thema der Arbeit: „Bestimmung von Stoffkennwerten<br />
und Inhaltsstoffen an Kartoffeln“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: HOFFMANN, THOMAS<br />
SCHMERSAHL, RALF<br />
(03/<strong>2003</strong> - 10/<strong>2003</strong>)<br />
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin<br />
Thema der Arbeit: „Konzeption und Aufbau eines<br />
Brennstoffzellenversuchstan<strong>des</strong> für Biogas“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Betreuer der Universität: BALDAUF, CLAUDIA<br />
SCHULZE, DIANA<br />
(04.08.-12.09.<strong>2003</strong>)<br />
Technische Fachhochschule Berlin<br />
Thema der Arbeit: „Untersuchungen zum Einsatz von<br />
Modellsubstraten auf die Bildung von niederen Carbonsäuren<br />
(C2-C 6) bei der Biomethanisierung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: LINKE, BERND
SEILER, ROBERT<br />
(08/<strong>2003</strong>-02/2004)<br />
Fachhochschule Brandenburg<br />
Thema der Arbeit: „Experimentelle Arbeiten im Bereich<br />
Bioenergie“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Betreuer der Universität: MALESSA, REINER<br />
THIELE, MAIKE<br />
(16.06.-11.07.<strong>2003</strong>)<br />
Thema der Arbeit: „Isolierung von L. buchneri und Ermittlung<br />
<strong>des</strong> Säuerungsverhaltens in Luzernepresssaft“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: IDLER, CHRISTINE<br />
TRAUTMANN, MICHAEL<br />
(05.05.-04.07.<strong>2003</strong>, Vorstudienpraktikum)<br />
Thema der Arbeit: „Analysen zur Charakterisierung<br />
landwirtschaftlicher Güter“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHELLE, HANNELORE; REHDE,<br />
GIOVANNA<br />
TRAUTMANN, MICHAEL<br />
(16.06.–30.06.<strong>2003</strong>, Vorstudienpraktikum)<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: WEGNER, GABRIELE<br />
WEIS, DAVID<br />
(06/<strong>2003</strong>, Schülerpraktikum)<br />
Lenné-Gesamtschule<br />
Thema der Arbeit: „Messungen und Versuchsauswertung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: DARIES, WERNER<br />
Lehrlinge<br />
FELGENTREU, MIRIAM<br />
(seit 08/2001)<br />
Chemielaborantin<br />
Abteilung Bioverfahrenstechnik<br />
Betreuer: IDLER, CHRISTINE; KERN, JÜRGEN; RICHTER,<br />
KLAUS; WEGNER, GABRIELE<br />
SCHETTLER, JOANA<br />
(seit 08/2001)<br />
Chemielaborantin<br />
Abteilung Bioverfahrenstechnik<br />
Betreuer: IDLER, CHRISTINE; KERN, JÜRGEN; RICHTER,<br />
KLAUS; WEGNER, GABRIELE<br />
VOGEL, KAI<br />
(seit 08/2001)<br />
Schlosser<br />
Zentralwerkstatt<br />
Betreuer: BÄNSCH, DIETER<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 95<br />
1.7 Gastwissenschaftler und Stipendiaten am <strong>ATB</strong><br />
AMER, BAHER MAHMOUD<br />
Universität Kairo, Ägypten<br />
Thema: “Drying of fruits under particular consideration<br />
of solar energy use”<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Zeitraum: 01.10.2002 – 30.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DAAD<br />
APPIAH-NKANSAH, NANA BAAH<br />
Kwame Nrumah University Kumasi, Ghana<br />
Thema: „Bestimmumg <strong>des</strong> Wirkungsgra<strong>des</strong> ein PV<br />
Pumpe“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Zeitraum: 01.09.-31.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DAAD Bonn<br />
BARREIRO, PILAR<br />
Dpto. De Ingeneria Rural, ETSI Agronomos, Universidad<br />
Politecnica Madrid (UPM), Spanien<br />
Thema: „Modellierung der Mikrobenausbreitung in<br />
Fruchtcontainern auf Basis der Messdaten von Multigas-Sensoren“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: ZUDE MANUELA<br />
Zeitraum: 15.07. - 15.08.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: UPM<br />
BLOKHINA, IOULIA<br />
Russische Universität für Völkerfreundschaft Moskau<br />
Thema: „Untersuchungen zur Qualitätssicherung bei<br />
Kartoffeln“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: HOFFMANN, THOMAS<br />
Zeitraum: 01.07.-31.08.03<br />
Finanzierung: DAAD<br />
EL SAEIDY, EHAB<br />
Menofia University, Ägypten<br />
Thema: „Energetischen Nutzung von Farmreststoffen“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Zweitraum: 01.09.1999-31.03.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Ministerium für Bildung und Forschung<br />
Ägypten<br />
FEKETE, ANDRAS<br />
Physics & Control Department, SzIE University, Ungarn<br />
Thema: „Technische Anpassung von nicht-<strong>des</strong>truktiven<br />
Methoden zur Erfassung der Qualität von Paprika und<br />
Speisezwiebeln<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: ZUDE, MANUELA<br />
Zeitraum: 14.-21.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DAAD<br />
KIC, PAWEL<br />
Agraruniversität Prag, Tschechien<br />
Thema: „Technik und Technologien für umweltschonende<br />
und tiergerechte Nutztierhaltung“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: BRUNSCH, REINER<br />
Zeitraum: 19.12.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DAAD in Kooperation mit Humboldt-<br />
Universität zu Berlin<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
96<br />
KLAMKOWSKI, KRZYSZTOF<br />
Research Institute of Pomology, Polen<br />
Thema: „Nicht<strong>des</strong>truktive optische Messungen zur Bestimmung<br />
der Fruchtqualität bei Apfel“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: ZUDE, MANUELA<br />
Zeitraum: 10.08.-05.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DAAD<br />
MALÝ, PAVEL<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Thema: „Verfahrenstechnische Untersuchungen zur<br />
beschädigungsarmen Ernte, zum schonenden Transport<br />
und zur belastungsarmen Lagerung von Kartoffeln“<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: HOFFMANN, THOMAS; FÜRLL,<br />
CHRISTIAN<br />
Bertreuer der Universität: PROCHNOW, ANNETTE<br />
Zeitraum: seit 05/2002<br />
Finanzierung: Dritmittel Ma 115<br />
ÖZ, HYLIA<br />
Ege Universität Izmir, Türkei<br />
Thema: "Qualitätsgerechte Melkarbeit in verschiedenen<br />
Melksystemen"<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: BRUNSCH, REINER; BREHME, ULRICH;<br />
ROSE, SANDRA<br />
Zeitraum: 07-08/<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
PAZSICZKI, IMRE; RAGONCZA, ADAM, ZOLTAN, GULYAS<br />
Hungarian Institute of Agricultural Engineering Gödöllö,<br />
Ungarn<br />
Thema: "Einfluss verschiedener Abdeckmaterialien auf<br />
die Ammoniak- und Methanemissionen von Gülle bei<br />
der Lagerung"<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: BRUNSCH, REINER; BERG, WERNER<br />
Zeitraum: 23.-29.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMVEL – biaterale Zusammenarbeit<br />
PLIVA, PETR; CESPIVA, MIROSLAV; SOUCEK, JIRI; DEDINA,<br />
MARTIN<br />
Research Institute of Agricultural Engineering (VUZT)<br />
Prag, Tschechien<br />
Thema: "Reduction of the emission of greenhouse<br />
gases, ammonia and smells due to agricultural activities,<br />
especially animal husbandry"<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: MÜLLER, HANS-JOACHIM; BRUNSCH,<br />
REINER<br />
Zeitraum: 19.10. bis 25.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMVEL<br />
SERES, ISTVÁN<br />
Szent István Universität, , Gödöllö, Ungarn<br />
Thema: “Low-Air-Flow-Velocity-Sensor: prototyping and<br />
calibration”<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: GOTTSCHALK, KLAUS<br />
24.06.–04.07.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DAAD / Magyar-Német Kutatócserék<br />
VEGRICHT, JIRI UND MACHALEK, JOSEF<br />
Research Institute of Agricultural Engineering (VUZT)<br />
Prag, Tschechien<br />
Thema: "Research into the influence of milking machines<br />
on the quality in milking"<br />
Betreuer am <strong>ATB</strong>: BREHME, ULRICH<br />
Zeitraum: 13.-17.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMVEL<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
2 Sonstige Kooperationspartner<br />
Other Cooperations<br />
a) National<br />
- Ahlers. Sensors GbR mbH, Jena<br />
- Agrar GbR Frenzel & Schmidt, Wittbrietzen<br />
- AGRAR GbR Jähne – Marquardt, Nordwestuckermark<br />
- Agrar GmbH Flämingland, Blönsdorf<br />
- Agrarbetrieb Heinz Oevermann, Liessow<br />
- Agrargenossenschaft "Hoher Fläming" Rädigke<br />
- Agrargenossenschaft „Ländeken“ e.G., Meinsdorf<br />
- Agrargenossenschaft Bergland, Clausnitz<br />
- Agrargenossenschaft Burgberg e.G., Burgberg<br />
- Agrargenossenschaft Großhartmannsdorf e.G., Großhartmannsdorf<br />
- Agrargenossenschaft Niederschöna<br />
- Agrargesellschaft „Bergland“ Clausnitz e.G., Clausnitz<br />
- Agrargesellschaft Cahnsdorf-Duben GbR, Duben<br />
- Agrarprodukte Dedelow GmbH, Dedelow<br />
- Agrarprodukte Krumhermersdorf GmbH, Krumhermersdorf<br />
- Agrarprodukte Ludwigshof e.G., Ranis-Ludwigshof<br />
- AgriCo Lindauer Naturprodukte AGLindau, Lindau<br />
- AGROCOM GmbH & Co. Agrarsystem KG, Bielefeld<br />
- Amazonen Werke H. Dreyer GmbH & CO. KG, Hasbergen<br />
- Atofina Deutschland GmbH, Leuna<br />
- BEKON, Energy Technology GmbH, Landshut<br />
- Bio Akademie, Susanne und Leo Gärtner, Langgöns<br />
- Biogas Gropp GbR, Klockow<br />
- BIOPOS e.V., Teltow<br />
- biorefinery.de GmbH, Potsdam<br />
- Biotechnologie Nordhausen (BTN), Nordhausen<br />
- BIOWORK GmbH, Phöben<br />
- Brandenburger Pilzvertrieb GmbH, Brandenburg-<br />
Plaue<br />
- Bun<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft und Ernährung<br />
(BLE), Bonn<br />
- Bun<strong>des</strong>sortenamt, Prüfstelle Marquardt<br />
- Büro für Holzschutz und Wohnraumhygiene, Potsdam,<br />
Brandenburg<br />
- bwt Wassertechnik GmbH, Schriesheim<br />
- Centrum für Innovation und Technologie GmbH, Guben<br />
- Darnieder Stalltechnik & Agrarbedachungen GmbH &<br />
Co., Cottbus<br />
- Dawa-Agrar GmbH & Co. KG, Dahlenwarsleben<br />
- deka Sensor+Technologie GmbH, Teltow<br />
- Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, Potsdam
- Dienstleistungsgesellschaft Selbelang GbR, Selbelang<br />
- DLG, Groß-Umstadt<br />
- Dr. H. Strube, Schlanstedt<br />
- eco Naturgas GmbH, Potsdam<br />
- energiebüro, Berlin<br />
- Energieholz GmbH Zempow, Brandenburg<br />
- Energiezentrum Schwante GmbH, Schwante<br />
- Fa. Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH, Essen<br />
(Oldbg.)<br />
- Fa. Kranemann Gartenbaumaschinen GmbH, Blücherhof<br />
- Fachverband Biogas, Freising<br />
- Fachverband Landwirtschaftlicher Trockenwerke Land<br />
Brandenburg e.V., Berlin<br />
- Falkenthaler Rinderhof, Falkenthal<br />
- Förderverein für den landwirtschaftlichen Anbau von<br />
nachwachsenden Rohstoffen in Brandenburg e.V.<br />
(FNR), Nordwestuckermark<br />
- Förderverein für landwirtschaftlichen Anbau und industriellen<br />
Einsatz nachwachsender Rohstoffe in<br />
Brandenburg e.V. (FNR), Nordwestuckermark<br />
- Friweika e.G., Weidensdorf<br />
- FRUCHT-EXPRESS Import - Export, Groß Kreutz<br />
- GbR Hasenring, Edemissen<br />
- GbR Pietschmann, Niederjesar<br />
- Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG,<br />
Damme<br />
- Hagenlocher, Herrenberg-Gültstein<br />
- Havelobst, Obst und Gemüse Bochow e.G., Bochow<br />
- Havita Berlin Frischgemüse GmbH, Berlin<br />
- HEPRO GmbH, Delhbrück<br />
- Ing.-Büro Dipl.-Phys. Thomas Lung, Berlin<br />
- Ing.-Büro Dr.-Ing. Wilfried Eckhof, Ahrensfelde (b.<br />
Berlin)<br />
- Ing.-Büro R. Holz, Falkenhagen<br />
- Ingenieurbüro Ratzka, Ostrau<br />
- Ingenieurgesellschaft für Optoelektronik, Bilderkennung<br />
und Qualitätsprüfung mbH (select), Hartmannsdorf<br />
- Institut für Membrantechnologie GmbH UFI-TEC,<br />
Oranienburg<br />
- Jenasensoric e.V., Jena<br />
- KTBL-Versuchsstation, Dethlingen<br />
- Kuratorium f. Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft<br />
(KTBL) e.V., Darmstadt<br />
- Lan<strong>des</strong>amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft<br />
Referat Gartenbau, Großbeeren<br />
- Lan<strong>des</strong>amt für Geologie und Bergwesen Sachsen-<br />
Anhalt, Halle<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 97<br />
- Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft, Teltow/Ruhlsdorf<br />
- Lan<strong>des</strong>anstalt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft<br />
Brandenburg (LVL), Ruhlsdorf<br />
- Lan<strong>des</strong>anstalt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft,<br />
Güterfelde<br />
- Lan<strong>des</strong>forschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei<br />
Mecklenburg-Vorpommern, Dummerstorf<br />
- Landgut GmbH Staritz, Belgern<br />
- Landhandel GmbH Gransee (Getreide AG), Brandenburg<br />
- Landwirtschaftliche GmbH, Klein Rensleben<br />
- Landwirtschaftskammer Rheinland, Bonn<br />
- Lechler GmbH & CO KG, Metzingen<br />
- Lehmann Maschinenbau GmbH, Jocketa<br />
- Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung,<br />
Groß-Kreutz<br />
- Linde AG, Mainz<br />
- LVAT, Ruhlsdorf<br />
- Märkische Agrargenossenschaft, Mittenwalde<br />
- Max-Eyth-Gesellschaft im VDI, Programmausschuss<br />
Landtechnik für Profis, Düsseldorf<br />
- Milch- und Viehwirtschaft Ihlenfeld GmbH, Ihlenfeld<br />
- Müller Anlagenbau GmbH, Mihla<br />
- Müller Anlagenbau, Eisenach<br />
- Müller Elektronik GmbH Co., Salzkotten<br />
- Nuthequelle-Landwirtschaftliche Betriebsgesellschaft<br />
mbH, Niedergörsdorf<br />
- Obst- und Gemüsezentrale GmbH und Co., Werder<br />
(Glindow)<br />
- Obstgut Marquardt, Kleinert, Satzkorn<br />
- Obstversuchsanstalt der Landwirtschaftskammer<br />
Hannover, Jork<br />
- Ökotec- Biogas GmbH & Co.KG, Thallwitz<br />
- PAL-Anlagenbau GmbH, Abtshagen<br />
- Petkus Wutha Sortier- und Aufbereitungstechnik<br />
GmbH, Wutha-Farnroda<br />
- Pharmaplant GmbH, Artern<br />
- Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest e.G.,<br />
Münster<br />
- Regionale Entwicklungsbehörde Oberhavel, Brandenburg<br />
- Regionale Partnerschaft Uckermark-Barnim, Angermünde<br />
- Rhinmilch GmbH, Fehrbellin<br />
- Rinderhof Gorinsee GbR, Schönwalde<br />
- Rohlmann & Kuhn GbR Gröbers-Osmünde<br />
- SaaleOBST, Erzeuger- und Absatzgenossenschaft<br />
e.G., Schochwitz<br />
- Sächsische Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft, Köllitsch<br />
- Schalt- und Regeltechnik GmbH Berlin<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
98<br />
- Schöpstal Maschinenbau GmbH, Schöpstal<br />
- Schweineproduktion Burkersdorf GmbH, Burkersdorf<br />
- SL Schwanteland, Vehlefanz<br />
- Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt, Oppenheim<br />
- Storkower Geflügelmast GmbH, Storkow<br />
- Südzucker AG Mannheim-Ochsenfurt, Geschäftsbereich<br />
Landwirtschaft, Offenau<br />
- Täger Farny, Volkmarsdorf<br />
- teleBITcom GmbH, Kleinmachnow<br />
- tetra Ingenieure GmbH, Neuruppin<br />
- TEWS Elektronik, Hamburg, Hamburg<br />
- Thüringer Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft (TLL),<br />
Dornburg<br />
- Thüringer Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft, Clausberg<br />
- Tobipro GmbH, Tornitz<br />
- Toss Intelligente Messtechnik und Automatisierung<br />
GmbH, Potsdam<br />
- UIT Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH, Dresden<br />
- Umwelt- und Maschinentechnik GmbH, Jocketa, Thüringen<br />
- UP Umweltanalytische Produkte GmbH, Cottbus<br />
- Verband der Landwirtschaftskammern, Bonn<br />
- Volkswagen AG, Wolfsburg<br />
- Werder-Frucht Vermarktungsgesellschaft mbH, Werder<br />
(Glindow)<br />
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Oberhavel mbH,<br />
Germendorf<br />
- Wirtschaftshof Sachsenland GmbH, Chemnitz OT<br />
Röhrsdorf<br />
- WMA Airsense Analysentechnik GmbH, Schwerin<br />
- ZukunftsAgentur Brandenburg, Potsdam<br />
- Zwönitzer Agrargenossenschaft e.G., Zwönitz<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
b) International<br />
- Aprifel (staatliche Verbraucherorganisation), Paris,<br />
Frankreich<br />
- Adisseo France SAS, Paris, Frankreich<br />
- Beltra Forestry Ltd., New Port, Irland<br />
- Companhia Energética de Minas Gerais, Belo Horizonte,<br />
Brasilien<br />
- Creafill Innovative Fiber Solutions, Chestertown, MD,<br />
USA<br />
- Ecofibre Industries Ltd., Asgrove Brisbane, Australien<br />
- Engineered Solutions Ltd., Stamford, UK<br />
- ENTEC, Fussach, Österreich<br />
- Haras National, Avenches, Schweiz<br />
- IBC The Icelandic Biomass Company, Hafnarfjoerdur,<br />
Island<br />
- Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und<br />
Landentwicklung (ÖKL), Wien, Österreich<br />
- Pöttinger Maschinenfabrik GmbH, Österreich<br />
- swisspatat, Bern, Schweiz
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
3 Kurzübersicht der Forschungsvorhaben mit den Kooperationspartnern<br />
Table of Research Projects and Cooperation Partners<br />
Forschungsschwerpunkt 1: Grundlagen für eine nachhaltige Landbewirtschaftung bei unterschiedlicher Produktionsintensität<br />
Projekt<br />
Nr.<br />
Projektbezeichnung und Projektleiter Kooperationspartner<br />
80 Ökonomische Bewertung von Offenland-Management auf ehemaligen<br />
und in Nutzung befindlichen Truppenübungsplätzen im<br />
pleistozänen Flachland Nord-Ost-Deutschlands; SCHLAUDERER,<br />
RALF; HARNISCH, RICHARD; MÄHNERT, PIA; PROCHNOW, ANNETTE<br />
110-123 Optimierung der Steuerung von modernen Beregnungsanlagen<br />
und die ökol. und ökon. Bewertung großflächiger Bewässerung;<br />
PLÖCHL, MATTHIAS; KLAUSS, HILDE; DOMSCH, HORST<br />
6.40<br />
119<br />
Reduzieren <strong>des</strong> Frischwasserverbrauchs bei der Gemüsewäsche<br />
durch die Verwertung von aufbereitetem Waschwasser im geschlossenen<br />
Kreislauf; GEYER, MARTIN; PRYSTAV, WERNER<br />
2.23 Einfluss der Verfahrensgestaltung im Pflanzenbau und in der<br />
Tierhaltung auf Stoff- und Energieflüsse; KALK, WOLF-DIETER;<br />
VÖLKER, ULLRICH; BERG, WERNER, HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
2.31-I Stickstoffbilanz nachwachsender Rohstoffe auf sandigen Standorten;<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN; KERN, JÜRGEN; IDLER,<br />
CHRISTINE; SCHOLZ, VOLKHARD<br />
2.31-II Stickstoffumsätz auf sandigen Ackerböden; KERN, JÜRGEN;<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN; DOMSCH, HORST<br />
BTU Cottbus, Universität Potsdam, Universität<br />
Freiburg; Naturkundemuseum<br />
Görlitz<br />
Fa. Adcon Telemetry; Fa. Hydro Air; Fa.<br />
Toss; USDA ARS US Water Conservation<br />
Lab.<br />
Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft<br />
e.V. (INFA) an der FH Münster, Möhrenbetrieb<br />
Abenhardt in Datteln<br />
Universität Halle; LfL Güterfelde, Tu<br />
München<br />
Forschungsschwerpunkt 2: Teilflächenspezifische Bewirtschaftung und Nutzung von Satellitentechnik im Pflanzenbau<br />
Projekt<br />
Nr.<br />
Projektbezeichnung und Projektleiter Kooperationspartner<br />
101 Entwicklung einer low-input-Lösung für die teilflächenspezifische<br />
Bewirtschaftung im Betriebsmaßstab; DOMSCH, HORST<br />
4.32 Durchführung von Sensormessungen zur Variabilitätsbestimmung<br />
auf Ackerflächen und zur Stickstoffbedarfsermittlung;<br />
SCHWARZ, JÜRGEN<br />
4.31 Ökonomische und ökologisch Bewertung <strong>des</strong> Einsatzes von<br />
Sensoren zum teilflächenspezifischen Pflanzenschutz, SCHWARZ,<br />
JÜRGEN; SCHLAUDERER, RALF; DAMMER; KARL-HEINZ<br />
4.21 Einsatz eines Pendelsensors zur Heterogenitätsbestimmung von<br />
landwirtschaftlichen Nutzflächen; EHLERT, DETLEF<br />
110-121 Sensogestützte Applikation von Stickstoffdünger, Wachtumsreglern<br />
und Fungiziden; EHLERT, DETLEF; VÖLKER, ULRICH<br />
110-122 Messsystem zur Bewertung <strong>des</strong> Unkrautvorkommens;<br />
LANGNER, HANS-RAINER; BÖTTGER, HELMUT<br />
AgriCon Lindauer Naturprodukte AG in<br />
Lindau; Landwirtschaftliche Gesellschaft<br />
mbH Klein-Rodensleben; Dawa-Agrar<br />
GmbH &Co. KG in Dahlenwarsleben; Dr.<br />
Strube in Schlanstedt; Täger-Farny in<br />
Volkmarsdorf<br />
ZALF, Müncheberg; Südzucker AG<br />
Mannheim/Ochsenfurt<br />
Landwirtschaftliche Betriebe in den Neuen<br />
Bun<strong>des</strong>ländern<br />
Müller Electronik GmbH & Co., Salzkotten;<br />
Amazonen werke H. Dreyer GmbH<br />
& Co. KG, Hasbergen<br />
Firma Symacon Bildverarb. GmbH, Magdeburg;<br />
Müller Electronik GmbH & Co.,<br />
Salzkotten; FH Osnabrück, FB Elektrotechnik<br />
99<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
100<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
4.26 Untersuchungen zur Detektionsmöglichkeit von Krankheitsbefall<br />
in Getreide mittels Thermografie; DAMMER, KARL-HEINZ; BEUCHE,<br />
HORST; HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
4.27 Untersuchungen zur Nachweisbarkeit von Pilzinfektionen an<br />
Pflanzen mit Hilfe der Fluorenszenzspektroskopie; LANGNER,<br />
HANS-RAINER; HERPPICH, WERNER<br />
4.29 Untersuchungen zur Dynamik <strong>des</strong> Bestan<strong>des</strong>klimas und Infektionsgeschehens<br />
mit Pilzkrankheiten in heterogenen Getrei<strong>des</strong>chlägen;<br />
DAMMER, KARL-HEINZ<br />
4.30 Untersuchungen zur Optimierung <strong>des</strong> Einsatzes von Sensoren<br />
für die Erfassung von Boden- und Pflanzenparametern auf landwirtschaftlichen<br />
Nutzflächen; SCHWARZ, JÜRGEN; EHELRT, DETLEF<br />
BBA Außenstelle Kleinmachnow; Dienstleistungsgesellschaft<br />
für eine nachhaltige<br />
teilflächenspezifische Landbewirtschaftung<br />
(ntL) Hannover<br />
FH Brandenburg<br />
ProPlant GmbH; Dienstleistungsgesellschaft<br />
für eine nachhaltige teilflächenspezifische<br />
Landbewirtschaftung mbH<br />
HU Berlin; TU Berlin<br />
Forschungsschwerpunkt 3: Qualitätssicherung bei der Lagerung, Konservierung und Verabreichung von Futtermitteln<br />
für Nutztiere<br />
Projekt<br />
Nr.<br />
Projektbezeichnung und Projektleiter Kooperationspartner<br />
4.33 Entwicklung und Bewertung <strong>des</strong> Prinzips einer Bandmähmaschine;<br />
EHLERT, DETLEF<br />
1.40 Erhöhung der Stabilität von Grünfuttersilagen; IDLER, CHRISTINE;<br />
KLOCKE, MICHAEL; VENUS, JOACHIM<br />
1.30<br />
Lagern und Konservieren eiweißreicher, wirtschaftseigener<br />
Grundfuttermittel; IDLER, CHRISTINE<br />
3.50 Untersuchungen zur on-line-Messung der Siliergutdichte;<br />
MUNDER, FRIEDRICH; FÜRLL, CHRISTIAN<br />
110-125<br />
Optimierte Steuerung von Getreide-Schachttrocknern;<br />
MODEL, NIKOLAUS; MELLMANN, JOCHEN, JOST, OLIVER<br />
5.26 Untersuchungen <strong>des</strong> Fließverhaltens von landwirtschaftlichen<br />
Dickstoffen; TÜRK, MENO<br />
5.27 Verschleißeinfluss auf das Förderverhalten von Drehkolbenpumpen;<br />
TÜRK, MENO; ZENKE, THOMAS<br />
Niederschöna, Falkenthaler Rinderhof;<br />
Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br />
Oberhavel; Raiffeisenzentral-<br />
Genossenschaft Nord-West e.G.<br />
Lan<strong>des</strong>amt für Landwirtschaft Bereich<br />
Grünland und Futterweiden Paulinenaue;<br />
Groß Kreutz<br />
Fa. Tews, Hamburg<br />
Fa. Petkus Anlagenbau, Wutha<br />
Landeanstalt für Landwirtschaft (LfL)<br />
Groß Kreutz/Ruhlsdorf<br />
Vogelsang Maschinenbau GmbH,<br />
Essen; FHTW Berlin<br />
Forschungsschwerpunkt 4: Umweltverträgliche und tiergerechte Haltung von Rindern, Schweinen und Geflügel<br />
Projekt<br />
Nr.<br />
2.29<br />
09/02<br />
Projektbezeichnung und Projektleiter Kooperationspartner<br />
Untersuchung und Bewertung von Verfahren der Rinder- und der<br />
Schweinehaltung in Bezug auf Verbraucher- und Umweltschutz,<br />
Tiergerechtheit und ökonomische Konsequenzen; BERG WERNER;<br />
BRUNSCH, REINER; HÖRNIG, GÜNTER<br />
Einfluss verschiedener Abdeckmaterialien auf die Ammoniak- und<br />
Methanemissionen von Gülle bei der Lagerung; BRUNSCH REINER<br />
5.05 Lufttechnische Systeme zur Emissions- und Immissionsminderung<br />
aus der Tierhaltung; MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
36/01<br />
Reduction of the emission of greenhouse gases, ammonia and<br />
smells due to agricultural activities, especially animal husbandry;<br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
FAL Braunschweig, Ing.-Büro Dr. Eckhof<br />
VUZT Prag (CZ)
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
5.23 Analyse <strong>des</strong> Informationswertes und der Funktionalität verschiedener<br />
Systeme zur Erfassung von Tieraktivitäten; BREHME,<br />
2.30<br />
ULRICH<br />
Untersuchung <strong>des</strong> Anwendungspotenzials bildgebender Verfahren<br />
im NIR- und MIR-Bereich für das Management von Rinderherden;<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
5.28 Parameter der Mastitisprüfung bei Milchkühen – physiologische<br />
Zusammenhänge und analytische Möglichkeiten; BRUNSCH,<br />
REINER, KREHL, INES<br />
5.29 Reduzierung der Euterbelastung beim Melkprozess durch technische<br />
Veränderungen am Melkzeug; ROSE, SANDRA; BRUNSCH,<br />
REINER; SCHERPIN, EIKE<br />
37/01 Untersuchungen zum Einfluss der Melktechnik auf die Qualität<br />
<strong>des</strong> Melkens; BREHME, ULRICH; ROSE, SANDRA<br />
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft<br />
101<br />
Institute of Agriculture Engineering, Dep.<br />
Technical Systems in Agriculture (VUZT)<br />
Prag-Repy (Tschechien)<br />
Forschungsschwerpunkt 5: Qualität und Wettbewerbsfähigkeit bei der Ernte und in der Nachernteperiode leichtverderblicher<br />
Produkte<br />
Projekt<br />
Nr.<br />
Projektbezeichnung und Projektleiter Kooperationspartner<br />
6.22 Physiologischen Eigenschaften gartenbaulicher Produkte in der<br />
Nachernte; HERPPICH, WERNER B.; ZUDE, MANUELA; LINKE,<br />
MANFRED<br />
6.19 Festigkeitseigenschaften gartenbaulicher Produkte; OBERBARN-<br />
SCHEIDT, BERND; HEROLD; GEYER, MARTIN; HERPPICH, WERNER;<br />
ZUDE, MANUELA; HOFFMANN, THOMAS<br />
6.31 Grundlagen der Frischemessung von Gartenbauprodukten;<br />
LINKE, MANFRED, HERPPICH, WERNER<br />
6.33 Einfluss von Licht auf die physiologische Aktivität verpackter<br />
Blattgemüse; HERPPICH, WERNER B.<br />
6.16 Optische Eigenschaften gartenbaulicher Produkte; HEROLD,<br />
BERND, TRUPPEL, INGO; ZUDE, MANUELA; ROHRBACH, ALEXANDER<br />
6.37 Messung von Fruchtpigmenten mit Hilfe der Fluoreszenzspektroskopie;<br />
WULF, JANINA; ZUDE, MANUELA; HERPPICH, WERNER<br />
6.38<br />
110-124<br />
Erfassung mechanischer Belastungen von Früchten; HEROLD,<br />
BERND; TRUPPEL, INGO<br />
3.53 Verfahrenstechnische Untersuchungen zur beschädigungsarmen<br />
Ernte, zum schonenden Transport und zur belastungsarmen Lagerung<br />
von Kartoffeln; Maly, Pavel; HOFFMANN, THOMAS<br />
110-126<br />
5559<br />
TP06<br />
Anwendung der Thermografie zur Optimierung der Belüftungssteuerung<br />
bei der Lagerhaltung landwirtschaftlicher Produkte;<br />
GOTTSCHALK, KLAUS; GEYER, SABINE; HELLEBRAND, HANS JÜRGEN;<br />
SCHLAUDERER, RALF; BEUCHE, HORST; JACOBS, HELENE; RICHTER,<br />
INGOLF-GERRIT<br />
6.36 Kurzzeitlagerung von Steinobst, Optimierung der Qualitätserhaltung;<br />
HERPPICH, WERNER B.; LINKE, MANFRED; GEYER, MARTIN;<br />
HEROLD, BERND; GOTTSCHALK, KLAUS; SCHLAUDERER, RALF<br />
110-130 Entwicklung eines Echtzeitsensors für die Stärkebestimmung bei<br />
Kartoffeln als funktionaler Bestandteil eines optoelektionischen<br />
Verleseautomaten; HOFFMANN, THOMAS, JACOBS, ANDREE;<br />
RICHTER, INGOLF-GERRIT<br />
HU Berlin; Univ. Potsdam; IGZ; LVA Güterfelde;<br />
Praxisbetriebe; KU Leuven (B),<br />
Uni Lund (S); SzIE Univ. Budapest (H)<br />
Katholieke Universiteit Leuven (B); SzIE<br />
Univ. Budapest (H); Institut für Agrartechnik<br />
Gödöllö (H); Industriepartner<br />
IGZ Großbeeren/Erfurt; HU Berlin; Praxisbetriebe<br />
HU Berlin; TU München; Einzelhandel<br />
Institut für Mikrotechnik Mainz (IMM)<br />
GmbH<br />
HU Berlin; Katholieke Universiteit Leuven<br />
(B)<br />
deka Sensor+Technologie GmbH, Teltow;<br />
teleBITcom GmbH, Teltow<br />
Schöpstal Maschinenbau GmbH; Friweika<br />
Weidensdorf e.G.; Grimme Landmaschinenfabrik<br />
GmbH & Co. KG<br />
FRIWEIKA e. G. Weidensdorf/Remse;<br />
KTBL Dethlingen<br />
BSA Prüfstelle Marquardt; Praxisbetriebe<br />
Firma Select<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
102<br />
6.28<br />
110-128<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
Entwicklung von Waschdüsen für eine effizientere Wäsche von<br />
Gemüse und Speisekartoffeln; GEYER, MARTIN; MULUGETA;<br />
ERMYAS<br />
110-129 Ozontes Waschwasser zur Qualitätssicherung leichtverderblicher<br />
Produkte – Entwicklung einer Fuzzy Logic Steuerung <strong>des</strong> Wachprozesses;<br />
PLÖCHL, MATTHIAS; HASSENBERG, KARIN; MOLLOY,<br />
ELEANOR; IDLER, CHRISTINE; GEYER, MARTIN<br />
3.36 PC-Programm MELDOK 4.3 mit dem Schadbildkatalog;<br />
HOFFMANN, THOMAS; WORMANNS, GERHARD; JACOBS, ANDREE<br />
6.42<br />
122<br />
6.41<br />
121<br />
6.32<br />
78<br />
6.35<br />
105<br />
Qualitätserhalten<strong>des</strong> Handling von Bioobst und Biogemüse im<br />
Einzelhandel und bei der Direktvermarktung; LINKE, MANFRED;<br />
DUMDAI, KATRIN; MÜLLER, KATHRIN; IDLER, CHRISTINE<br />
Möglichkeiten zur Qualitätssicherung ökologischer erzeugter<br />
Gartenbauprodukte durch Koordinierung der Wertschöpfungsketten;<br />
GEYER, MARTIN; MÜLLER, KATHRIN<br />
Bewertung von Arbeitsprozessen im Gartenbau mit Hilfe der<br />
dreidimensionalen Bewegungsanalyse; JAKOB, MARTINA; IVANOV,<br />
VLADIMIR; GEYER, MARTIN<br />
Validierung und Bewertung verschiedener Ernte- und Aufbereitungsverfahren<br />
bei Spargel; GEYER, MARTIN; TISCHER, SIBYLLE;<br />
JAKOB, MARTINA<br />
Lechler GmbH & Co. KG, Metzingen;<br />
Hepro GmbH, Delbrück; Hagenlocher<br />
Landmaschinen, Herrenberg-Gültstein<br />
BWT Wassertechnik GmbH, Schriesheim;<br />
HAVITA Frischsalate GmbH, Berlin<br />
BLE Bonn; VLK Bonn<br />
Bio Akademie Susanne und Leo Gärtner,<br />
Langgöns<br />
HUB; FiBL Berlin e.V.; Öko-Landbau-<br />
Beratung Berlin Brandenburg e.V.; Bioland<br />
Erzeugerring Bayern e.V.; Fa. Terra<br />
Naturkost Frischdienst Berlin<br />
FAL Braunschweig; HU Berlin; Praxisbetriebe<br />
IGZ Großbeeren; LVA Oppenheim;<br />
Praxisbetriebe; Maschinenhersteller<br />
Forschungsschwerpunkt 6: Verfahren zur Produktion und Nutzung nachwachsende Rohstoffe<br />
Projekt<br />
Nr.<br />
Projektbezeichnung und Projektleiter Kooperationspartner<br />
1.29 Gentechnische Optimierung der Bacteriocin-Synthese bei Milchsäurebakterien;<br />
KLOCKE, MICHAEL<br />
1.38 Entwicklung diagnostischer PCR-Marker zur Diagnostik von biotechnologisch<br />
relevanten Mikroorganismen; Klocke, Michael<br />
1.43 Grundlagen für Aufbereitungsverfahren zur Herstellung hochreiner<br />
Milchsäure unter Berücksichtigung von Presssäften von<br />
Grünmassen; REIMANN, WINFRIED<br />
1.36<br />
108<br />
3.47<br />
104<br />
3.34<br />
102<br />
Biochemikalien und Energie aus der nachhaltigen Nutzung von<br />
pflanzlichen Biomassen; VENUS, JOACHIM<br />
Maschine für den Faseraufschluss von Hanf- und Flachsstroh mit<br />
integrierter Schäbentrennung; FÜRLL, CHRISTIAN, MUNDER,<br />
FRIEDRICH; HEMPEL, HEINZ<br />
Verfahrenstechnische Untersuchungen zur Reinigung von aufgeschlossenen<br />
Naturfasern; PECENKA, RALF, FÜRLL, CHRISTIAN<br />
1.28 Konservierung und Lagerung von Hanffasern; IDLER, CHRISTINE,<br />
PECENKA, RALF<br />
3.42 Untersuchungen zum Einsatz von Biogas in Polymer-Elektrolyt-<br />
Membran-Brennstoffzellen; SCHOLZ, VOLKARD; LINKE, BERND;<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
Institut für Lebensmitteltechnologie,<br />
Technische Universität Berlin; interdisziplinäres<br />
Forschungszentrum für Biopolymere,<br />
Universität Potsdam<br />
Hochschule Zittau/Görlitz (FH)<br />
IBC The Icelandic Biomass Company,<br />
Hafnarfjoerdur (ISL); tetra Ingenieure<br />
GmbH, Neuruppin; Beltra Forestry Ltd.,<br />
New Port (IRL); RALA Agricultural Research<br />
Institute, Reykjavik (ISL); Universität<br />
Heidelberg; BIOPOS e.V. Teltow;<br />
biorefinery.de GmbH Potsdam<br />
Kranemann Gartenbaumaschinen<br />
GmbH, Blücherhof<br />
BTU Cottbus; TITK Rudolstadt; Diakonie<br />
Gotha<br />
Faserinstitut Bremen e.V. – FIBRE
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
100 Energielandwirtschaft – Potenzial und Risiko bei Biogas; PLÖCHL,<br />
MATTHIAS; HEIERMANN, MONIKA; LINKE, BERND<br />
2.35 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beim Einsatz von Kosubstraten<br />
zur Biogasgewinnung; GRUNDMANN, PHILIPP; HEIERMANN,<br />
MONIKA; LINKE, BERND; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
3.48<br />
106<br />
Verlustminimierte und humanhygienische Lagerung von Feldholz;<br />
SCHOLZ, VOLKARD; IDLER, CHRISTINE; DARIES, WERNER<br />
3.45 Verfahrenstechnische Grundlagen zur Trocknung von Holzhackgut;<br />
MELLMANN, JOCHEN; SCHOLZ, VOLKHARD<br />
3.40<br />
86<br />
Energetische Nutzung von landwirtschaftlichen Reststoffen;<br />
SCHOLZ, VOLKARD; EL SAEIDY, EHAB<br />
ECO Naturgas GmbH Berlin<br />
Büro für Holzschutz und Wohnraumhygiene<br />
Egert, Potsdam<br />
El Menoufiya Universität, Egypt<br />
Forschungsschwerpunkt 7: Verfahren zur Behandlung und Verwertung von Reststoffen in der Landwirtschaft<br />
Projekt<br />
Nr.<br />
Projektbezeichnung und Projektleiter Kooperationspartner<br />
107 Wissenschaftliches Messprogramm zur Bewertung von Biogasanlagen<br />
im landwirtschaftlichen Bereich; Melcher, Frank; LINKE,<br />
BERND<br />
1.35 Kinetik der Biogasbildung bei kontinuierlicher Nassvergärung von<br />
Feldfrüchten und organischen Reststoffen; LINKE, BERND;<br />
MÄHNERT, PIA; SCHELLE, HANNELORE; HEIERMANN, MONIKA<br />
110-133 Prozesssteuerung von Biogasanlagen mit Kofermentation;<br />
LINKE, BERND; MUMME, JAN, SIEGMUND, PATRICK<br />
110-127 Membranbioreaktor zur Aufbereitung von Schlachthofabwässern;<br />
REIMANN, WINFRIED; LINKE, BERND; LESZCZYNSKI, RALF<br />
1.37 Grundlagen zum Einsatz von Membranverfahren bei der Aufbereitung<br />
schwach belasteter Abwässer; REIMANN, WINFRIED<br />
1.34 Umweltverträgliche und nachhaltige Nutzung der Nährstoffressource<br />
Phosphor; KERN, JÜRGEN; SCHLAUDERER, RALF<br />
103<br />
FAL Braunschweig; Bayrische Lan<strong>des</strong>anstalt<br />
für Landtechnik; Lan<strong>des</strong>anstalt für<br />
Landwirtschaftliches Maschinen- und<br />
Bauwesen<br />
HUB Berlin; Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft<br />
Güterfelde; Biotechnologie Nordhausen<br />
BTN Biotechnologie Nordhausen GmbH,<br />
Nordhausen; WMA Airsense Analysentechnik<br />
GmbH, Schwerin; Kuratorium für<br />
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft<br />
(KTBL) e.V., Darmstadt<br />
Institut für Membrantechnologie GmbH<br />
Oranienburg<br />
Institut für Membrantechnologie GmbH<br />
Oranienburg<br />
Lan<strong>des</strong>anstalt für Verbraucherschutz und<br />
Landwirtschaft Güterfelde; Berliner Wasserbetriebe<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
104<br />
4 Mitarbeit in Gremien und Gutachtertätigkeiten<br />
Collaboration in Scientific Committees and<br />
Boards, Appointed Experts<br />
4.1 Mitarbeit in KTBL- und DLG-Gremien<br />
KTBL<br />
KTBL- Arbeitsgruppe „Gute fachliche Praxis der Emissionsminderung“<br />
BERG, WERNER<br />
KTBL-Arbeitsgruppe "BVT in der Intensivtierhaltung"<br />
BRUNSCH, REINER<br />
KTBL-Arbeitsgruppe "Umweltschutz und Verfahrenstechnik"<br />
BRUNSCH, REINER<br />
KTBL-Arbeitsgemeinschaft "Technik und Bauwesen in<br />
der Nutztierhaltung"<br />
BRUNSCH, REINER; ZASKE, JÜRGEN<br />
KTBL-Arbeitsgemeinschaft „Technik in der Pflanzenproduktion“<br />
(Arge TP)<br />
Funktion: Mitglied<br />
EHLERT, DETLEF<br />
KTBL-Arbeitsgemeinschaft „Technik im Kartoffelbau“<br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
KTBL-Arbeitsgemeinschaft „Getreideaufbereitung“<br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
Neubesetzung der KTBL AG „Technik und Bauwesen<br />
im Gartenbau“<br />
GEYER, MARTIN<br />
KTBL-Arbeitsgemeinschaft "Reststoffe und Stoffströme<br />
(RST)"<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
KTBL-Arbeitsgruppe "Dieselverbrauch“<br />
KALK, WOLF-DIETER<br />
KTBL-TBG-Arbeitsgruppe "Traceability“ (beantragt,<br />
Gruppe in Gründung)<br />
Funktion: Mitglied<br />
KRAMER, ECKART<br />
KTBL-Arbeitsgruppe „Biogaserträge“<br />
LINKE, BERND<br />
KTBL-ATV-Arbeitsgruppe 7.2.29 „Wirtschaftsdünger,<br />
Abfälle und Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben“<br />
REIMANN, WINFRIED<br />
KTBL-Arbeitsgemeinschaft „Energie“<br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
KTBL Hauptausschuss<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
DLG<br />
DLG-Ausschuss „Technik in der tierischen Produktion"<br />
BREHME, ULRICH<br />
DLG-Prüfungskommission „Klauenbehandlungsstände"<br />
BREHME, ULRICH<br />
DLG-Prüfungskommision „Bodenbearbeitungsgeräte“<br />
DOMSCH, HORST<br />
DLG-Prüfungskommision „Sämaschinen“<br />
DOMSCH, HORST<br />
DLG-Prüfungskommission „DLG-Prüfung von Silo- und<br />
Stretchfolien“<br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
DLG-Prüfungskommission „DLG-Prüfung von Rundballenpressen“<br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
DLG-Prüfungskommission „DLG-Prüfung von Ladewagen“<br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
DLG-Arbeitsgruppe zur Erstellung der Arbeitsunterlage<br />
"Lüftung von Schweineställen"<br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
DLG-Prüfungskommission '"Schweinefütterung"<br />
TÜRK, MENO<br />
DLG-Mitglied<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
4.2 Mitarbeit in weiteren Gremien<br />
a) National<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, AG "Ethologie der Nutztierhaltung"<br />
BREHME, ULRICH<br />
MLUR Brandenburg, AG "Stallbau in der Nutztierhaltung"<br />
BREHME, ULRICH<br />
MLUR Brandenburg, WK "Tiergerechte und umweltschonende<br />
Haltung von Rindern, Schweine, Schafen,<br />
Ziegen, Pferden und Geflügel"<br />
BREHME, ULRICH<br />
ALB Niedersachsen, AG "Tierhaltung"<br />
BREHME, ULRICH<br />
VLK-Verband der Landwirtschaftskammern, Ausschuss<br />
"Landwirtschaftliches Bauen"<br />
BREHME, ULRICH
SAG "Ökologischer Landbau" <strong>des</strong> Senats der Bun<strong>des</strong>forschungsanstalten<br />
BRUNSCH, REINER<br />
Senat der Bun<strong>des</strong>forschungsanstalten<br />
<strong>ATB</strong>-Vertreter<br />
BRUNSCH, REINER<br />
Interdisziplinäre Initiative "Ländliche Räume" der Berlin-<br />
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften<br />
BRUNSCH, REINER<br />
Initiativgruppe für eine Forschungsplattform "Ländliche<br />
Räume Berlin-Brandenburg" beim MLUR Brandenburg<br />
BRUNSCH, REINER<br />
MLUR Brandenburg, Arbeitsgruppe "Tierhaltung"<br />
BRUNSCH, REINER<br />
Arbeitsgruppe "Zwischenruf" der Sektion E der WGL<br />
BRUNSCH, REINER<br />
Wissenschaftliche Gesellschaft der Milcherzeugerberater<br />
e. V. (WGM)<br />
Mitglied <strong>des</strong> wissenschaftlichen Beirates<br />
BRUNSCH, REINER<br />
MITGLIEDER<br />
ROSE, SANDRA, KREHL, INES<br />
"Precision Farming" – Arbeitskreis "Applikationstechnik"<br />
der Phytomedizinischen Gesellschaft<br />
Funktion: Arbeitsgruppenleiter<br />
DAMMER, KARL-HEINZ<br />
Bodenspezialisten der Bun<strong>des</strong>länder - Arbeitsgruppe<br />
innerhalb der Fachgruppe X<br />
"Bodenfruchtbarkeit und Agrarökologie“ <strong>des</strong> VDLUFA<br />
DOMSCH, HORST<br />
Beirat der DEULA SH GmbH Bildungszentrum – Außenstelle<br />
Hoppegarten<br />
DOMSCH, HORST<br />
Landtechnik-Tagung, VDI-Programmausschuss<br />
EHLERT, DETLEF<br />
Redaktionsbeirat Agrartechnische Forschung. Wissenschaftliche<br />
Zeitschrift agrartechnischer Forschungseinrichtungen<br />
EHLERT, DETLEF<br />
Wissenschaftlicher Beirat der Landtechnik. Fachzeitschrift<br />
Agrartechnik und ländliches Bauen<br />
EHLERT, DETLEF<br />
Wissenschaftlicher Beirat „Nachwachsende Rohstoffe“<br />
<strong>des</strong> MLUR Brandenburg<br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
Fachbeirat Abteilung Technik der Zeitschrift Gemüse<br />
GEYER, MARTIN<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 105<br />
VDI-MEG Arbeitskreis Arbeitswissenschaft im Landbau<br />
(AKAL)<br />
GEYER, MARTIN<br />
Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft<br />
(DGG)<br />
GEYER, MARTIN; HEROLD, BERND; HERPPICH, WERNER B.;<br />
ZUDE, MANUELA<br />
Fachverband Deutsche Speisezwiebel, Mitglied <strong>des</strong><br />
Wissenschaftlichen Beirates<br />
GEYER, MARTIN; OBERBARNSCHEIDT, BERND<br />
Energiestrategie Brandenburg 2010 – Arbeitsgruppe<br />
Land- und Forstwirtschaft<br />
Berater<br />
GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Gesellschaft Deutscher Chemiker<br />
HASSENBERG, KARIN<br />
Brandenburgische Energie Technologie Initiative (ETI),<br />
Arbeitskreis Biogas<br />
HEIERMANN, MONIKA; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
VDI (Verein Deutscher Ingenieure)<br />
Mitglied in der VDI-Gesellschaft Agrartechnik<br />
Leiter <strong>des</strong> Arbeitskreises Agrartechnik im VDI Berlin-<br />
Brandenburg<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft)<br />
Korrespondieren<strong>des</strong> Mitglied <strong>des</strong> Arbeitskreises Energie<br />
Mitglied im Fachverband Umweltphysik der DPG<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
Senatsarbeitsgruppe (SAG) „Klimaänderungen“ <strong>des</strong><br />
Senats der Bun<strong>des</strong>forschungsanstalten im Geschäftsbereich<br />
<strong>des</strong> Bun<strong>des</strong>ministeriums für Verbraucherschutz,<br />
Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
Deutsche Gesellschaft für Biophysik<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
Gesellschaft für Ökologie sowie Arbeitskreis „Wüstenökologie“<br />
und Arbeitskreis „Experimentelle Pflanzenökologie<br />
dieser Gesellschaft“<br />
HERPPICH, WERNER B.<br />
Deutsche Botanische Gesellschaft (DBG) sowie Sektion<br />
„Pflanzenphysiologie und Molekularbiologie“ dieser Gesellschaft<br />
HERPPICH, WERNER B.<br />
Vereinigung für angewandte Botanik e.V.<br />
HERPPICH, WERNER B.<br />
Union der deutschen Kartoffelwirtschaft (UNIKA), Fachkommission<br />
Qualitätssicherung<br />
HOFFMANN, THOMAS<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
106<br />
Kartoffel-Fachausschuss der zentralen Arbeitsgemeinschaft<br />
Kartoffelforschung e.V.<br />
HOFFMANN, THOMAS<br />
Arbeitsgruppe „EDV und Messtechnik in der Qualitätskontrolle<br />
von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln“ <strong>des</strong><br />
Verban<strong>des</strong> der Landwirtschaftskammern<br />
Koordinator<br />
HOFFMANN, THOMAS<br />
Arbeitsgruppe Qualitätskontrolle bei Speisekartoffeln<br />
HOFFMANN, THOMAS<br />
Senats-ad-hoc-Arbeitsgruppe „Mykotoxine“<br />
Ausschussmitglied<br />
IDLER, CHRISTINE<br />
Arbeitsgruppe “Mykotoxine im Land Brandenburg“<br />
Ausschussmitglied<br />
IDLER, CHRISTINE<br />
Verein der Freunde und Förderer <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> e.V.<br />
Vorstandsmitglied<br />
KRAMER, ECKART<br />
Richtlinienausschuss VDI 4630 „Vergärung organischer<br />
Stoffe“<br />
Ausschussmitglied<br />
LINKE, BERND<br />
Projektbegleitender Ausschuss zum BMBF-Verbundprojekt<br />
„Konzipierung, Erstellung und Betrieb einer Versuchsfermenteranlage<br />
zur Bearbeitung von Fragestellungen<br />
im Bereich Inputmaterialien und Mikrobiologie<br />
landwirtschaftlicher Biogasanlagen“; FKZ 0330151 ,<br />
PTJ<br />
Ausschussmitglied<br />
LINKE, BERND<br />
Projektbegleitender Ausschuss zum Projekt: Handreichung<br />
Biogas, FKZ 22027200, FNR<br />
Ausschussmitglied<br />
LINKE, BERND<br />
Brandenburgische Energie Technologie Initiative, Arbeitsgruppe<br />
Biogas<br />
Vorsitzender<br />
LINKE, BERND<br />
Fachverband Biogas<br />
LINKE, BERND<br />
Mitglied der Prüfungskommission Diplomarbeit Eilers,<br />
FHTW-Berlin; Oktober <strong>2003</strong><br />
MODEL, NIKOLAUS<br />
Mitglied der GIS-Initiative Berlin-Brandenburg<br />
MODEL, NIKOLAUS<br />
DIN-Arbeitsgruppe NABau-Arbeitsausschuss "Stallklima"<br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
Förderkreis Stallklima<br />
Beiratsmitglied<br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
Senatsarbeitsgruppe "Biodiversität"<br />
PLÖCHL, MATTHIAS<br />
VDI/MEG Arbeitskreis Umwelttechnik<br />
PLÖCHL, MATTHIAS<br />
DLG-Fachausschuss Landschaftspflege- und Kommunaltechnik<br />
PROCHNOW, ANNETTE<br />
Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung<br />
Vorstandsvorsitzende<br />
PROCHNOW, ANNETTE<br />
ATSAF-Arbeitsgruppe „Agrarforschung in den Transformationsländern<br />
Mittel- und Osteuropas“<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
Programmausschusses VDI-MEG Tagung “Landtechnik<br />
für Profis”<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
ETI (Energie Technologie Initiative Brandenburg)<br />
Arbeitsgruppe „Biofestbrennstoffe“<br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
FEE (Fördergesellschaft Erneuerbare Energien)<br />
Arbeitsgruppe „Biogene Gase und Brennstoffzellen“<br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
VDI-Gesellschaft Agrartechnik<br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Arbeitsgruppe „EDV und Messtechnik in der Qualitätskontrolle<br />
von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln“ <strong>des</strong><br />
Verban<strong>des</strong> der Landwirtschaftskammern<br />
Vorsitzender<br />
WORMANNS, GERHARD<br />
Arbeitsgruppe „Qualitätskontrolle bei Speisekartoffeln“<br />
WORMANNS, GERHARD<br />
Kartoffel-Fachausschuss der zentralen Arbeitsgemeinschaft<br />
Kartoffelforschung e.V.<br />
WORMANNS, GERHARD<br />
Arbeitskreis „Qualitätskontrolle bei Obst, Gemüse und<br />
Speisekartoffeln“ <strong>des</strong> Verban<strong>des</strong> der Landwirtschaftskammern<br />
Vorstandsmitglied<br />
WORMANNS, GERHARD<br />
Arbeitsgruppe „Schadbildkatalog für Obst, Gemüse und<br />
Speisekartoffeln“ der Verban<strong>des</strong> der Landwirtschaftskammern<br />
Vorsitzender<br />
WORMANNS, GERHARD
Verband der Kartoffel-Lager-, Abpack- und<br />
Schälbetriebe e.V.<br />
WORMANNS, GERHARD<br />
VDI-MEG<br />
Beirats-Mitglied<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
VDI-MEG AK Ehrungen<br />
Vorsitzender<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
VDI-MEG, AK Internationale Agrartechnische<br />
Zusammenarbeit<br />
Vorsitzender<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
VDI-MEG, AK Forschung und Lehre<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
Lan<strong>des</strong>vereinigung außeruniversitärer Forschung<br />
Brandenburg e. V. (LAUF)<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)<br />
Auswahlkommissionsmitglied<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
Leibniz-Gemeinschaft (WGL), Sektion E<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
Sektion „Pflanzenphysiologie und Molekularbiologie“ der<br />
Deutschen Botanischen Gesellschaft (DBG)<br />
ZUDE, MANUELA<br />
Fachbeirat Zeitschrift Frischelogistik<br />
ZUDE, MANUELA<br />
b) International<br />
AgEng Workgroup SIG AP-06 "Innovation technology<br />
for dairy farming"<br />
BREHME, ULRICH<br />
AgEng Workgroup "Smart Sensors in Livestock Monitoring"<br />
BREHME, ULRICH<br />
CIGR Working Group "Climatization of Animal Houses"<br />
BRUNSCH, REINER<br />
Programmausschuss der "Internationalen Tagung Bau,<br />
Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung"<br />
BRUNSCH, REINER<br />
Programmausschuss der "1. European Conference on<br />
Precision Livestock Farming" (1. ECPLF)<br />
BRUNSCH, REINER<br />
Deutscher Vertreter im "European Programme Committee<br />
of the ECPLF"<br />
BRUNSCH, REINER<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 107<br />
"World's Poultry Science Association" (WPSA) und<br />
"Deutsche Vereinigung für Geflügelwirtschaft e. V."<br />
BRUNSCH, REINER<br />
Working Group "Site Specific Weed Management" der<br />
European Weed Research Society<br />
DAMMER, KARL-HEINZ<br />
Scientific Panel of the 4th ECPA in Berlin<br />
DOMSCH, HORST<br />
Scientific Panel of the 4th ECPA in Berlin<br />
EHLERT, DETLEF<br />
European Federation of Chemical Engineering „Working<br />
Party on the Mechanics of Particulate Solids”<br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
FAO European Cooperative Research Network on Flax<br />
and other Bast Plants<br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
EurAgEng (Europäischer Verband der Agrartechnik-<br />
Ingenieure) Chairperson der Special Interestgroup (SIG)<br />
Fruit and Vegetable Production Engineering<br />
GEYER, MARTIN<br />
International Society for Horticultural Science ISHS,<br />
Working Group Vegetable Quality<br />
GEYER, MARTIN<br />
International Federation of Automatic Control (IFAC)<br />
Technical Commission, Technical area 4a (Modelling<br />
and Control in Agricultural Processes )<br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
International Society of Agromaterial Science and Engineering<br />
(ISASE)<br />
Leiter der Kommission für Mitgliedschaft<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
Federation of European Societies of Plant Physiology<br />
HERPPICH, WERNER B.<br />
International Society for Horticultural Science ISHS,<br />
Workgroup Modelling in Fruit Research and Orchard<br />
Management<br />
LINKE, MANFRED<br />
Local Organization Committee of the 19th International<br />
CODATA Conference<br />
The Information Society: New Horizons for Science ,<br />
Berlin, Germany – 7-10 November 2004<br />
MODEL, NIKOLAUS<br />
Scientific Committee zur Vorbereitung <strong>des</strong> Internationalen<br />
Symposiums vom 1.-4. Juni <strong>2003</strong> in Horsens (DK)<br />
"Gaseous and Odour Emissions from Animal Production<br />
Facilities"<br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
Land Use and Cover Change (LUCC)<br />
PLÖCHL, MATTHIAS<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
108<br />
EurAgEng (European Society of Agricultural Engineers),<br />
Special Interest Group Energy Systems and Rural Electricity<br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
FAO (Food and Agricultural Organisation)<br />
Working Group Integrated Energy Farms<br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
European Association for Potato Research EAPR<br />
WORMANNS, GERHARD<br />
Club of Bologna<br />
Full Member<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
EurAgEng<br />
Council Member<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
Russische Akadmie der Landwirtschaftswissenschaften<br />
Korrespondieren<strong>des</strong> Mitglied<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
International Society for Horticultural Science ISHS,<br />
Working Group Fruit Science<br />
ZUDE, MANUELA<br />
4.3 Gutachtertätigkeiten<br />
Gutachter für die EU Kommission<br />
Review project n° IST-2001-37306 SMARTSPECTRA<br />
gemäß Contract No. 154788 vom 25.09.<strong>2003</strong> (Laufzeit<br />
vom 03.10.-03.12.<strong>2003</strong>, First Review Meeting in Brüssel<br />
am 08.10.<strong>2003</strong>)<br />
HEROLD, BERND<br />
EU-Gutachter CRAF<br />
Brüssel, Belgien<br />
26. -30.05.<strong>2003</strong><br />
HERPPICH, WERNER, B.<br />
5 Besuche am Institut (Auswahl)<br />
Visits to the Institute (Selection)<br />
Januar<br />
PETER V. NIEWENHOVEN / HERR SPRINGER (4 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
und Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
17.01.<strong>2003</strong><br />
Pahren-Agrar (6 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
und Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
21.01.<strong>2003</strong><br />
LCDA Bar sur Aube, Thales Paris, Frankreich (5 Teilnehmer)<br />
Vorführung und Test der Faseraufschlussanlage<br />
23.01.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe (4 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
und Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
24.01.<strong>2003</strong><br />
Studenten der BTU Cottbus (10 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Abteilungen <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
31.01.20003<br />
HERR LÜTTEKEN, Firma Linde AG aus Mainz<br />
Januar <strong>2003</strong><br />
Februar<br />
AMSS Asphaltmischwerke Sächsische Schweiz GMBH<br />
(2 Teilnehmer)<br />
Trocknungsgenossenschaft Cotta e.G. Dohma,<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Naturfasern<br />
als Absorptionsmittel in Aspaltmischwerken<br />
03.02.<strong>2003</strong><br />
HEINZ-OLAF HENKEL, Präsident der Leibniz–<br />
Gemeinschaft, DR. JÖRG SCHNEIDER, Geschäftführer<br />
WGL, DR. MARKO HÄCKEL, WGL, KATARINA REICHE, MdB<br />
Vorstellung <strong>des</strong> Instituts; Round Table Gespräch u.a.<br />
mit den Themen: anwendungsorientierte Grundlagenforschung<br />
im Osten, Finanzsituation in Brandenburg,<br />
Kooperationen mit Hochschulen<br />
05.02.<strong>2003</strong><br />
IAN UND HANNAH ARBON<br />
Engineered Solutions, Stamford, UK<br />
19.02.<strong>2003</strong><br />
Canadian Embassy<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
u. Diskussion zu Produkten und zur Wirtschaftlichkeit<br />
unter Kanadischen Bedingungen<br />
19.02.<strong>2003</strong><br />
Hayleys Export LTD (3 Teilnehmer)<br />
Vorführung der Maschine zum Aufschluss von Kokosfasern<br />
26.02.<strong>2003</strong><br />
LESON, GERO, USA<br />
Internationale Forschungskooperation<br />
26.02.<strong>2003</strong><br />
März<br />
FRAU SCHULZ, ZAB<br />
Gespräche zu Patentverwertung<br />
04.03.<strong>2003</strong><br />
DR. PETRA RABE, 2. Geschäftsführer der HDV GmbH<br />
Besichtigung <strong>ATB</strong> und Fachgespräch<br />
05.03.<strong>2003</strong><br />
Universität Nowosibirsk/ HUB Berlin (18 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
und Diskussion zu Produkten und zur Wirtschaftlichkeit<br />
19.03.<strong>2003</strong>
MLUR und Partner (4 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
u, Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
21.03.<strong>2003</strong><br />
DR. ANDREAS LÖSSL, wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
Fakultät für Biologie, Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München<br />
Besichtigung <strong>ATB</strong> und Fachgespräch<br />
27.03.<strong>2003</strong><br />
APH Hinsdorf (5 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
u, Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
31.03.<strong>2003</strong><br />
Wissenschaftler der Universität Nowosibirsk, Russland,<br />
und der Humboldt-Universität zu Berlin (12 Personen)<br />
Vorstellung <strong>des</strong> Instituts, Sensortechnik für Präzisionslandwirtschaft,<br />
Biokonversion, Faseraufschluss<br />
19.03.<strong>2003</strong><br />
April<br />
Schulklasse (12. Schuljahr) der Voltaire–Gesamtschule<br />
Potsdam (22 Schüler)<br />
Stoffliche und energetische Nutzung von nachwachsenden<br />
Rohstoffen<br />
10.04.<strong>2003</strong><br />
Pahren-Agrar GmbH, (4 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
und Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
11.04.<strong>2003</strong><br />
GERHARD WILHELM, Geschäftsführer Ökotec GmbH &<br />
Co.KG<br />
Besichtigung <strong>ATB</strong> und Fachgespräch<br />
15.04.<strong>2003</strong><br />
Studenten der BTU Cottbus (9 Teilnehmer)<br />
Führung im Rahmen der Vorlesung Landnutzung und<br />
Wasserbewirtschaftung, Studiengang "Produktionsbauten<br />
im ländlichen Raum"<br />
24.04.<strong>2003</strong><br />
Fellerhof (2 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
und Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
30.04.<strong>2003</strong><br />
Mai<br />
Studenten <strong>des</strong> Diplomstudienganges Chemie <strong>des</strong> Chemischen<br />
Institutes der Universität Potsdam<br />
(10 Teilnehmer)<br />
Exkursion am <strong>ATB</strong>/Abt. 1 im Rahmen der wahlobligatorischen<br />
VL „Chemie Nachwachsender Rohstoffe“<br />
08.05.<strong>2003</strong><br />
Alberta Research Council, Edmonton, Canada, 2 Personen<br />
Besichtigung der Faseraufschlussanlage <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
12.05.<strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 109<br />
Kanadische Wirtschaftsdelegation<br />
Dr. Jürgen Quandt und John R. Mc Dougall, Alberta Research<br />
Council, Kanada; Dipl.-Ing. Rüdiger Albert,<br />
Centrum für Innovation und Technologie GmbH; Dr.<br />
Steffen Preusser, Canadian Embassy, Berlin<br />
Informationsbesuch zum Thema Faseraufschlusstechnik<br />
12.05.<strong>2003</strong><br />
PIECHATZEK, G., APH e.G. Hinsdorf GbR<br />
Beratung zur Konzeption einer Hanfaufschlussanlage<br />
21.05.<strong>2003</strong><br />
Studenten der HU-Berlin (15 Teilnehmer)<br />
Sensorpräsentation<br />
26.05.<strong>2003</strong><br />
Juni<br />
FRAU WICKLEIN, SPD, MdB, Mitglied <strong>des</strong> Forschungsausschusses<br />
und Mitarbeiter<br />
Vorstellung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong>; Diskussion über Kooperationen,<br />
Finanzen/Personal, Beziehungen zu MOE/EU,<br />
ECPA/ECPLF<br />
12.06.<strong>2003</strong><br />
GERHARD IHDE, Prokurist Agp Lübesse<br />
Besichtigung <strong>ATB</strong> und Fachgespräch<br />
13.06.<strong>2003</strong><br />
RYU, CHAN-SEOK<br />
Laboratory Field Robotics, Division of Environmental<br />
Science and Technology, Graduate School of Agriculture,<br />
University Kyoto, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502, Japan<br />
Besichtigung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong>, Precision agriculture und Reststoffverwertung<br />
13.06.<strong>2003</strong><br />
MLUR u. Gäste, SIMROCK u.a. (12 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
u. Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
18.06.<strong>2003</strong><br />
Exkursionsgruppe (41 Teilnehmer) im Rahmen der Europäischen<br />
Konferenzen zu Präzisionslandwirtschaft<br />
(4ECPA/1ECPLF)<br />
Demonstration moderner Sensortechnik<br />
19.06.<strong>2003</strong><br />
DR. NAIQIAN ZHANG, Kansas State University, USA;<br />
PROF. WANG MAOHUA, China Agricultural University, Bejing,<br />
China; Dr. Nug Wang, Mc Bill Universitty, Canada<br />
Vorstellung <strong>des</strong> Instituts, Information zu Sensortechnologie<br />
für Precision Farming, Qualitätsmanagement bei<br />
Obst und Gemüse, Fasertechnologie, Biokonversion<br />
20.06.<strong>2003</strong><br />
BTU Cottbus, Studiengang „Environment and Resource<br />
Management“ (10 Studenten)<br />
Vorstellung <strong>des</strong> Instituts, Fasergewinnung, Biogaserzeugung,<br />
Precision Farming , Nährstoffbilanzen, Mutterkuhhaltung,<br />
Pflanzenkläranlagen<br />
20.06.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
110<br />
Studenten der BTU Cottbus (20 Teilnehmer)<br />
Führung von Studenten <strong>des</strong> Studiengang „Environmental<br />
and Ressource Management“ (Wahlexkursion)<br />
20.06.<strong>2003</strong><br />
Canatex Greiz, AKE-Innotech, (2 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Diskussion zur<br />
Technologie, Erfahrungsaustausch<br />
26.06.<strong>2003</strong><br />
Universität Potsdam, Studienfach Umweltwissenschaften<br />
(21 Teilnehmer)<br />
Stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
27.06.<strong>2003</strong><br />
Bafa Malsch (2 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
u. Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
30.06.<strong>2003</strong><br />
Herr SCHNEIDER<br />
Firma Schneider Communications, Journal-Beitrag<br />
über Abt. 6 im Magazin für modernen Obstbau „innofrutta“<br />
1/<strong>2003</strong><br />
02.06.<strong>2003</strong><br />
Juli<br />
DLG-Ausschuss Futterkonservierung (32 Teilnehmer)<br />
Informationsbesuch zu Konservierung und Qualitätssicherung<br />
von Nahrungs- und Futtermitteln<br />
03.07.<strong>2003</strong><br />
Fernwärme Eisenkappel, Österreich (8 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
u. Diskussion zur Wirtschaftlichkeit sowie energetische<br />
Nutzung von Hanfschäben<br />
11.07.<strong>2003</strong><br />
August<br />
Akkreditierte Auslandskorrespondenten (24 Teilnehmer)<br />
Vorstellung <strong>des</strong> Instituts, Technologien der Qualitätssicherung,<br />
energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe,<br />
Precision Farming<br />
13.08.<strong>2003</strong><br />
Russische Delegation (11 Teilnehmer)<br />
ROSCONTRACT, Moskau<br />
Besichtigung der Faseraufschlussanlage <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
20.08.<strong>2003</strong><br />
Mitarbeiter <strong>des</strong> Umweltbun<strong>des</strong>amtes Berlin (35 Teilnehmer)<br />
Vorstellung <strong>des</strong> Institut, umweltwirksame Projekte<br />
27.08.<strong>2003</strong><br />
Amt für Wirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittel-<br />
Aufsicht, Berlin Zehlendorf (13 Teilnehmer)<br />
Institut allgemein, Lebens- und Futtermittelsicherheit,<br />
tiergerechte Nutztierhaltung<br />
27.08.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
PROF. DR.-ING. HABIL. JÜRGEN KOHLMANN<br />
Mitarbeiter an der Fachhochschule für Technik und<br />
Wirtschaft Berlin (FHTW – Berlin), Fachbereich 2 – Ingenieurwissenschaften<br />
II<br />
Besichtigung der Abt. 1 im Rahmen einer Diplomarbeit<br />
29.08.<strong>2003</strong><br />
Herr FÖRSTER, RBB Brandenburg<br />
zwecks Filmbeitrag zur Ausgründung der Firma CP,<br />
Ausstrahlung am 19.08.<strong>2003</strong> in der Sendung Wirtschaft-<br />
Aktuell<br />
August <strong>2003</strong><br />
September<br />
ANDREAS FRANK, Betreiber der Biogasanlage Agrargesellschaft<br />
Frank<br />
Besprechung über die Fördermöglichkeiten von Biogasanlagen<br />
02.09.<strong>2003</strong><br />
Universität Göttingen, Summerschool „Agriculture engineering“<br />
(23 Studenten)<br />
Thema: Bereitstellung und Nutzung biogener Energieträger<br />
03.09.<strong>2003</strong><br />
TECH, S. UND UNBEHAUN, H.<br />
Technische Universität Dresden<br />
Beratung zur Verarbeitung von Grünhanf<br />
04.09.<strong>2003</strong><br />
PROF. DR. B. K. BALA (2 Teilnehmer)<br />
Bangla<strong>des</strong>h Agricultural University, Mymensingh, Bangla<strong>des</strong>h;<br />
Department of Farm Power and Machinery<br />
Besichtigung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> und Vortrag über Trocknung<br />
landwirtschaftlicher Güter<br />
08.-10.09.<strong>2003</strong><br />
DR .WOLFGANG STEIGER, VW AG Wolfsburg,<br />
BERND KONITZKI UND BERND HÖHNE, MLUR<br />
Rundgang, Planung einer „Sun Fuel“-Verarbeitungsanlage<br />
in Brandenburg<br />
15.09.<strong>2003</strong><br />
PROF. DR. ROLAND SCHUBERT<br />
Hochschule Zittau/Görlitz (FH), FG Biotechnologie<br />
Fachgespräch<br />
17.09.<strong>2003</strong><br />
Absolventen der Humboldt-Universität zu Berlin<br />
(31 Teilnehmer)<br />
Energetische und stoffliche Nutzung nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
18.09.<strong>2003</strong><br />
DR. ANDRE SAYATZ, Rechtsanwalt Wirtschaftsrecht<br />
Kanzlei Baker & McKenzie<br />
Besprechung über Finanzierungsmöglichkeiten von Biogasanlagen<br />
24.09.<strong>2003</strong>
Chinesische Delegation (5 Personen)<br />
LIU JIAN, Vize-Agrarminister und Mitarbeiter, Ministry of<br />
Agriculture, Beijing, China;<br />
HEIDEMARIE WEIRAUCH, BMVEL<br />
Sensortechnik, Qualitätsmanagement, Biogas, Biokonversion<br />
22.09.<strong>2003</strong><br />
Ministry of Agriculture, Vizepresident, VR China,<br />
(6 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung und Präsentation<br />
22.09.<strong>2003</strong><br />
DR. JAKOB, ADISSEO<br />
France SAS, Paris<br />
Beratung über Zusammenarbeit 2004 zum Thema "Beeinflussung<br />
<strong>des</strong> Fließverhaltens von Flüssigfutter durch<br />
Enzyme"<br />
24.09.<strong>2003</strong><br />
Berufsschullehrer Landwirtschaft (11 Teilnehmer)<br />
Informationsveranstaltung im Rahmen der Weiterbildung<br />
von Berufsschullehrern LW in Brandenburg;<br />
Vorstellung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong>, Präzisionslandwirtschaft, energetische<br />
und stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe<br />
24.09.<strong>2003</strong><br />
PROF. MILAN MARTINOV, Universität Novi Sad, Serbien<br />
Montenegro; DR. SELIM ŠKALJIÉ, Universität Sarajevo,<br />
Bosnien-Herzegowina; PROF. VICTOR ROŞ, Technische<br />
Universität Cluj-Napoca, Romania<br />
Internationale Forschungskooperation<br />
26.09.<strong>2003</strong><br />
Oktober<br />
PETER WEIHLAND; CHRISTA RIEGER; THOMAS EHRMANN,<br />
Institut für Technologie und Biosystemtechnik, FAL,<br />
Braunschweig; HANS OECHNER UND DOMINIC HELFFRICH,<br />
Universität Hohenheim, Lan<strong>des</strong>anstalt f. Landw. Maschinen-<br />
und Bauwesen Hohenheim; RAINER KISSEL,<br />
Technische Universität München, Bay. Lan<strong>des</strong>anstalt für<br />
Landtechnik Weihenstephan<br />
BMP-Projekttreffen<br />
08.-09.10.<strong>2003</strong><br />
ETHZ Zürich / Tänikon (2 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung und Präsentation<br />
21.10.<strong>2003</strong><br />
Lenné–Akademie für Gartenbau und Gartenkultur<br />
(33 Personen)<br />
Öffentliche Vortrags- und Mitgliederversammlung der<br />
LAGG mit Besichtigung der Forschungseinrichtungen<br />
<strong>des</strong> Instituts<br />
22.10.<strong>2003</strong><br />
Faserverbund Russland/ Naturfaserverband Deutschland<br />
(25 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
und Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
22.10.03<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 111<br />
DR. MARIANNE LEUPIN, ETH Zürich<br />
DIPL.-ING. ERNST SPIESS, FAT Tänikon, Schweiz<br />
Besichtigung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong>, Planung weiterer Zusammenarbeit<br />
im Bereich Fasertechnologie<br />
22.10.<strong>2003</strong><br />
Wissenschaftlicher Beirat <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> (18 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung u. Präsentation<br />
29.10.<strong>2003</strong><br />
November<br />
Delegation aus China (9 Personen)<br />
Agrarministerium und nationale Umweltforschungsinstitute,<br />
Bejing, China; DR. HORLACHER, GTZ<br />
Vorstellung <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> und Projektpräsentationen zu Reduktion<br />
von Umweltbelastungen in der Landwirtschaft<br />
11.11.<strong>2003</strong><br />
YOSHISUKE KISHIDA, SHIN-NORINSHA Co., Japan<br />
Sensor- und Informationstechnologie, Qualitätssicherung<br />
bei leichtverderblichen Produkten, biogene Energieträger<br />
14.11.<strong>2003</strong><br />
Bauernverband Altenburgerland (14 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
und Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
18.11.<strong>2003</strong><br />
Gesellschaft für Anlagen und Brennstoffe GmbH<br />
(2 Personen)<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
und Diskussion zur Wirtschaftlichkeit<br />
24.11.<strong>2003</strong><br />
Akademie 2. Lebenshälfte (22 Personen)<br />
Vorstellung <strong>des</strong> Instituts und Informationen zu nachwachsenden<br />
Rohstoffe und biogenen Energieträger<br />
Besichtigung der Naturfaseraufbereitung, Präsentation<br />
26.11.<strong>2003</strong><br />
Dezember<br />
Ecofibre Industries Ltd., Asgrove Brisbane, Australien<br />
(2 Personen)<br />
Besichtigung der Faseraufschlussanlage <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> und<br />
Diskussion einer Neuinvestition<br />
01.12.<strong>2003</strong><br />
Fakultätsrat der LGF der HU Berlin (16 Personen)<br />
Vorstellung <strong>des</strong> Instituts im Rahmen einer Sitzung <strong>des</strong><br />
Fakultätsrates<br />
10.12.<strong>2003</strong><br />
Programmausschuss Landtechnik (14 Personen)<br />
Rundgang durch das Institut<br />
11.12.<strong>2003</strong><br />
WOLFGANG MÜLLER<br />
Lan<strong>des</strong>amt für Immissionsschutz Potsdam<br />
Besprechung über die Genehmigungsplanung der<br />
Biogasanlage Golzow<br />
18.12.<strong>2003</strong><br />
Naturfaserverband von Deutschland (20 Teilnehmer)<br />
Besichtigung der Faseraufschlussanlage <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
19.12.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
112<br />
6 Gastaufenthalte sowie Tagungs- und Konferenzteilnahme<br />
von Institutsmitarbeitern<br />
Research Visits, Participation in Meetings and<br />
Conferences by Staff Members<br />
a) National<br />
Landtechnik für Profis. MEG-VDI<br />
Magdeburg<br />
29.01.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
Rationalisierungs-Kuratorium Landwirtschaft, Jahrestagung<br />
Teutschenthal<br />
06.02.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
BREHME, ULRICH<br />
Energetische Nutzung von Getreide in Kleinfeuerungsanlagen.<br />
KTBL-Fachgespräch<br />
Petersberg-Almendorf bei Fulda<br />
12.02.-13.02.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Brandenburger Milchrindtagung<br />
Götz<br />
13.02.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
KREHL, INES; ROSE, SANDRA<br />
10. Freckenhorster Spargel-Tage<br />
Warendorf<br />
17.02.-19.02.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Veranstalter<br />
GEYER, MARTIN<br />
8. Internationale Fachtagung zum Thema Tierschutz<br />
Nürtingen<br />
19.02.-20.02.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
BREHME, ULRICH<br />
Unterfränkischen Spargeltagung<br />
Alitzheim b. Sulzheim Würzburg<br />
20.02.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Veranstalter<br />
GEYER, MARTIN<br />
BfR-Symposium „Molekularbiologische Methoden in<br />
der Lebensmittelmikrobiologie“<br />
Berlin<br />
20.02.-21.02.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
GEYER, MARTIN; IDLER, CHRISTINE; KLOCKE, MICHAEL<br />
40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung<br />
Freising-Weihenstephan<br />
26.02.–01.03.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
GEYER, MARTIN; HEROLD, BERND; HERPPICH, WERNER B.;<br />
TRUPPEL, INGO; ROHRBACH, ALEXANDER; JAKOB, MARTINA;<br />
ZUDE, MANUELA; HIELSCHER-TÖLZER, CHRISTOPHER<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
VLK-Tagung Landwirtschaftliches Bauen<br />
Bonn<br />
05.-06.03.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
BREHME, ULRICH<br />
38. Vortragstagung der Deutschen Gesellschaft für<br />
Qualitätsforschung e. V.<br />
Geisenheim<br />
13.03.-14.03.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
HERPPICH, WERNER B.<br />
Interne Arbeitssitzungen der VDI-GVC Fachausschüsse<br />
„Trocknungstechnik“ und „Wärme- und Stoffübertragung“<br />
Marburg<br />
17.03.-19.03.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMBF<br />
MELLMANN, JOCHEN<br />
KTBL-Arbeitsgemeinschaft "Technik und Bauwesen in<br />
der Nutztierhaltung"<br />
Bonn<br />
18.03.-19.03.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
BREHME, ULRICH<br />
9. Aachener Membran Kolloquium<br />
Aachen<br />
18.03.-20.03.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMBF PTJ<br />
REIMANN, WINFRIED<br />
Was wird aus Offenland? Szenarien für ehemalige und<br />
in Nutzung befindliche Truppenübungsplätze in Brandenburg<br />
und Sachsen<br />
Beelitz, Brandenburg<br />
24.03.-25.03.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Sächsische Lan<strong>des</strong>stiftung Natur und<br />
Umwelt, Akademie<br />
Lan<strong>des</strong>lehrstätte für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
„Oderberge Lebus“<br />
SCHLAUDERER, RALF; HARNISCH, RICHARD; PROCHNOW,<br />
ANNETTE; MÄHNERT, PIA<br />
6. Tagung „Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen<br />
Nutztierhaltung <strong>2003</strong>“<br />
Vechta<br />
25.03.-27.03.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
BERG, WERNER; KREHL, INES, ROSE, SANDRA, TÜRK,<br />
MENO, BRUNSCH, REINER; MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
Obstruktive Atemwegserkrankungen in der<br />
Landwirtschaft<br />
Berlin<br />
02.04.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
IDLER, CHRISTINE
„Nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft – Herausforderungen<br />
und Chancen in der Wertschöpfungskette“,<br />
Gemeinsame Tagung der DBU, DLG und BLL<br />
Osnabrück<br />
29.04.-30.04.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMBF<br />
KERN, JÜRGEN; VON HASELBERG, CHRISTIANE<br />
Internationales strategisches Netzwerk für die Agrarpflanzennutzung<br />
Cottbus<br />
13.05.-14.05.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
IDLER, CHRISTINE<br />
25. Mykotoxin-Workshop<br />
Gießen<br />
19.05.-21.05.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
IDLER, CHRISTINE<br />
EDV und Messtechnik in der Qualitätskontrolle von<br />
Obst, Gemüse und Speisekartoffeln<br />
Potsdam-Bornim<br />
03.04.-04.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
HEROLD, BERND<br />
Anbau und Nutzung schnellwachsender Baumarten<br />
Köllitsch<br />
12.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
IDLER, CHRISTINE<br />
Symposium Cloning in Biomedical Research and<br />
Reproduction<br />
Berlin<br />
14.06.-16.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
KLOCKE, MICHAEL<br />
4 th European Conference on Precision Agriculture<br />
1 st European Conference on Precision Livestock<br />
Farming<br />
Berlin<br />
15.06.-19.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
ZASKE, JÜRGEN; BRUNSCH, REINER; BREHME, ULRICH;<br />
EHLERT, DETLEF; DAMMER, KARL-HEINZ; DOMSCH, HORST<br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN; PLÖCHL, MATTHIAS;<br />
SCHAUDERER, RALF, ZIMMERMANN, HILDE<br />
Workshop Biogas<br />
Braunschweig<br />
17.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
LINKE, BERND<br />
Arbeitskreis Naturschutzökonomie<br />
Universität Göttingen<br />
24.06.-25.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMBF<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 113<br />
6. Köthener Rührer-Kolloquium<br />
Hochschule Anhalt Köthen<br />
25.06.-26.06.<strong>2003</strong><br />
VENUS, JOACHIM<br />
Membrantage, Bonn<br />
01.07.-02.07.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMBF PTJ<br />
REIMANN, WINFRIED<br />
International Workshop on Models for Plant Growth<br />
and Control of Product Quality<br />
Potsdam<br />
24.08.-28.08.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
LINKE, MANFRED<br />
Berliner Tage der Mikroskopie<br />
Berlin<br />
03.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
IDLER, CHRISTINE<br />
Mitgliederversammlung Sächsischer Qualitätskartoffelverband<br />
e.V.<br />
Nossen/Sachsen<br />
03.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Jahrestagung "Wissenschaftliche Gemeinschaft der<br />
Milcherzeugerberater"<br />
Haus Düsse, Bad Sassendorf<br />
9.09.-11.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
BRUNSCH, REINER; ROSE, SANDRA; KREHL, INES; BERG,<br />
WERNER; KREHL, INES<br />
115. VDLUFA Kongress<br />
Saarbrücken<br />
16.09.-18.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
IDLER, CHRISTINE<br />
14. Magdeburger Abwassertage<br />
Magdeburg<br />
18.09.-19.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
KERN, JÜRGEN<br />
VII. Lübecker Fachtagung für Umwelthygiene<br />
Lübeck<br />
24.09.-26.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
IDLER, CHRISTINE<br />
Statusseminar <strong>2003</strong> „HighTech-Innovationen für V<br />
erfahrensketten der Agrarproduktion“ zum BMBF-<br />
Förderschwerpunkt "Agrartechnik - Integrierter<br />
Umweltschutz in der Landwirtschaft", IHK Potsdam<br />
29.09.-30.09.<strong>2003</strong><br />
Fianzierung: Haushalt<br />
ANZAHL DER TEILNEHMER <strong>ATB</strong>: 35 PERSONEN<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
114<br />
14. Internationale Tagung „Moderne Getreidemahlprodukte<br />
mit kundengerechten Eigenschaften für Food<br />
und Non-food“<br />
IGV GmbH Bergholz-Rehbrücke<br />
29.09.-30.09.03<br />
VENUS, JOACHIM<br />
Tagung <strong>des</strong> Förderkreises Stallklima<br />
Göttingen<br />
30.09.-1.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM; BRUNSCH, REINER<br />
VLK-Tagung Landwirtschaftliches Bauen<br />
Grub<br />
01.10.-02.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
BREHME, ULRICH<br />
16. Herbstkolloquium der AG Ökologie und Umwelt der<br />
Deutsche Region der Internationalen Biometrischen<br />
Gesellschaft<br />
Berlin<br />
01.10.-02.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
IDLER, CHRISTINE<br />
„Biomasse-Vergasung – der Königsweg für eine<br />
effiziente Strom- und Kraftstoffbereitstellung“<br />
Leipzig<br />
01.10.-02.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
GRUNDMANN, PHILIPP<br />
1. Biomassetag Altmark<br />
Gardelegen<br />
06.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
LINKE, BERND<br />
DLG-Ausschusssitzung "Technik in der tierischen<br />
Produktion"<br />
Hellenhahn-Schellenberg<br />
08.10.-09.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
BREHME, ULRICH<br />
Brandenburger Fleischrindertag<br />
Fehrbellin<br />
21.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
ROSE, SANDRA<br />
Brandenburger Spargelseminar<br />
Seddin<br />
23.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Veranstalter<br />
GEYER, MARTIN<br />
Milchkonferenz "Wege einer rentablen Milchproduktion"<br />
Fehrbellin<br />
23.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
ROSE, SANDRA<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
5. Frische-Logistik-Tagung „Convenence und Fertiggerichte,<br />
logistische Anforderungen und Praktiken“<br />
Rotenburg an der Fulda<br />
27.10.-28.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
GOTTSCHALK, KLAUS; HERPPICH, WERNER B.<br />
Jahrestagung der Fachagentur für nachwachsende<br />
Rohstoffe<br />
Gülzow<br />
04.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Groß Kreutzer Schaftag<br />
Lan<strong>des</strong>amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft,<br />
06.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
Groß Kreutz<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
61. Internationale Tagung Landtechnik MEG, VDI<br />
Hannover<br />
07.11.-08.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
AGRITECHNICA <strong>2003</strong><br />
Hannover<br />
11.11.-15.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DLG<br />
GEYER, MARTIN<br />
Tagung „Biogas für alle – eine Stadt–Land–Partnerschaft“<br />
Potsdam<br />
17.11.-18.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
KLOCKE, MICHAEL<br />
Mittelfränkischer Spargeltag<br />
Rohr<br />
18.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Veranstalter<br />
GEYER, MARTIN<br />
Statusseminar Welternährung<br />
FAL Braunschweig<br />
20.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
SCHLAUDERER, RALF; BRUNSCH, RAINER<br />
„Ökologischer Gemüsebau- vom Feld bis zur<br />
Ladentheke“<br />
Berlin<br />
20.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMVEL<br />
DUMDEI, KATRIN; LINKE, MANFRED; MÜLLER, KATHRIN<br />
Workshop „Biokonversion nachwachsender Rohstoffe“<br />
<strong>des</strong> Netzwerkes BioRegioN<br />
Braunschweig<br />
25.11.<strong>2003</strong><br />
VENUS, JOACHIM
"Wirtschaftlichkeit der Rinderhaltung"<br />
Götz<br />
02.12.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
KREHL, INES; ROSE, SANDRA<br />
Tag der offenen Tür mit Fachvorträgen in der<br />
Sauenzuchtanlage<br />
Drewitz<br />
03.12.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
ROSE, SANDRA<br />
b) International<br />
Projektvorbereitung und Kontaktreise<br />
EU-Antrag IP BIOGA4FC<br />
Brüssel<br />
30.01.-31.01.03<br />
HEIERMANN, MONIKA; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Results of an advanced decortication technology for<br />
hemp, flax and linseed: International Conference of<br />
the ASAE, ICCHP, Louisville<br />
08.02.-14.02.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DFG<br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
Workshops zur Vorbereitung und Einreichung von<br />
EU-Projekten<br />
Universität Leuven, Kowi Brüssel<br />
13.02., 26.03., 15.04.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
KRAMER, ECKART; DAMMER, KARL-HEINZ<br />
International Symposium “Actual tasks on Agriculture<br />
Engeneering”<br />
Opatija, Kroatien<br />
24.02.-28.02.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
EHLERT, DETLEF<br />
Internationales Symposium "Gaseous and Odour<br />
Emissions from Animal Production Facilities"<br />
Horsens, Dänemark<br />
01.06.-04.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM, BRUNSCH, REINER; BERG,<br />
WERNER<br />
Citrus Research and Education Center<br />
Lake Alfred, FL, USA<br />
Arbeitsaufenthalt<br />
Finanzierung: durch den Gastgeber<br />
04.04.-19.04.<strong>2003</strong><br />
ZUDE, MANUELA<br />
Szent István Universität, Gödöllö, Ungarn<br />
Arbeitsaufenthalt<br />
22.04.–17.05.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Univ. Gödöllö / Haushalt<br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit 115<br />
“Results of the Advanced Technology for Processing<br />
of Natural Fiber Plants for Industrial Application”<br />
7 th Intern. Conference on Woodfibre.Plastics and other<br />
natural Fibers, Madison/Wisconsin<br />
15.05.-24.05.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DFG<br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
Institut für Landtechnik VUZT Prag (CZ)<br />
Arbeitsaufenthalt zum Thema "Melktechnik – Vakuumschwankungen<br />
in Melkanlagen", bilaterale Kooperation<br />
19.05.-23.05.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMVEL, Haushalt<br />
BREHME, ULRICH; ROSE, SANDRA<br />
BioPhys Spring <strong>2003</strong><br />
Tschechische Universität für Landwirtschaft (CZU)<br />
Prag, Tschechien<br />
29.05.-30.05.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: <strong>ATB</strong><br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
International Symposium on Gaseous and Odour<br />
Emissions from Animal Production Facilities<br />
Horsens, Denmark<br />
01.06.-04.06.<strong>2003</strong><br />
BERG, WERNER<br />
Field Robot Event<br />
University, Agrotechnology and food sciences<br />
Wageningen, Niederlande<br />
05.06.-06.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
LANGNER, HANS-RAINER<br />
Advanced Decortication Technology for Bast fibres<br />
and Coir, 7 th ICFPAM- Conference of the FAO<br />
Bucarest, Romania<br />
08.06.-16.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
EurAaEng Council Meeting, Palnung Ag Eng 2004<br />
Katholische Universität Leuven<br />
Belgien<br />
13.06.-14.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
Projektvorbereitung und Kontaktreise<br />
Stamford, UK<br />
24.06.-26.06.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Drittmittel<br />
HEIERMANN, MONIKA; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Nordic Association of Agricultural Scientists 22nd<br />
Congress “Nordic Agriculture in Global Perspective”<br />
Turku, Finnland<br />
30.06.-07.07.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
DAMMER, KARL-HEINZ, DOMSCH, HORST<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
116<br />
Operational experiences in bast fibre straw processing<br />
with the <strong>ATB</strong> pilot plant using advanced technologies for<br />
decortication and fibre cleaning. NJF’s 22nd Congress<br />
Turku, Finland<br />
01.07.-04.07.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
PECENKA, RALF<br />
International Conference on Quality in Chains,<br />
Wageningen, The Netherlands<br />
06.07.-09.07.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
LINKE, MANFRED<br />
4 th Plant Biomechanics Conference <strong>2003</strong><br />
East Lansing, MI, USA<br />
20.07.-25.07.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DFG<br />
HERPPICH, WERNER B.<br />
SziE Universität<br />
Budapest, Ungarn<br />
Arbeitsaufenthalt<br />
Finanzierung: DAAD<br />
20.06.-27.06.<strong>2003</strong><br />
ZUDE, MANUELA<br />
ASAE Annual International Meeting<br />
Las Vegas, Nevada<br />
27.07.-30.07.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMBF/BEO<br />
MULUGETA, ERMYAS<br />
IEA <strong>2003</strong> Ergonomics in the digital age<br />
Seoul, Korea<br />
24.08.-29.08.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
JAKOB, MARTINA<br />
Research Institute of Pomology and Floriculture<br />
Skierniewice, Polen<br />
Arbeitsaufenthalt<br />
Finanzierung: DAAD<br />
25.08.<strong>2003</strong>; 04.09.<strong>2003</strong><br />
ZUDE, MANUELA<br />
16 th World Congress International Ozone Association<br />
Las Vegas, USA<br />
31.08.-05.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMBF, DFG<br />
MOLLOY, ELEANOR; HASSENBERG, KARIN<br />
SzIE University<br />
Budapest Ungarn<br />
Arbeitsaufenthalt<br />
Finanzierung: DAAD Kooperation<br />
02.09.-26.09.<strong>2003</strong><br />
WULF, JANIENA<br />
Institute Nationale Agronomie (INA-PG)<br />
Paris, Frankreich<br />
Arbeitsaufenthalt<br />
seit 06.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: INA-PG<br />
ZUDE, MANUELA<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
3 rd Research and Development Conference of Central-<br />
and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering<br />
(CEEAgEng<br />
Gödöllö, Ungarn<br />
11.09.-13.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt und FNR<br />
BREHME, ULRICH; MELLMANN, JOCHEN; SCHOLZ,<br />
VOLKHARD; VON HASELBERG, CHRISTIANE<br />
International Conference New methods, means, and<br />
technologies for applications of agricultural products<br />
Lithuanian Institute of Agricultural Engineering<br />
Raudondvaris, Lithuania<br />
18.09.-19.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
EL SAEIDY, EHAB<br />
Advanced Technology for Processing of Natural Fiber<br />
Plants for Industrial Application:, New Methods, Means<br />
and Technologies for Application of Agricultural Products,<br />
Kaunas, Lituanian<br />
16.09.-21.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
XXX CIOSTA – CIGR V Conference<br />
“Management and technology applications to empower<br />
agriculture and agro-food systems”<br />
Turin, Italien<br />
22.09.-24.09.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt und BMBF<br />
BREHME, ULRICH; GEYER, MARTIN; PLÖCHL, MATTHIAS,<br />
ZIMMERMANN, HILDE<br />
Tagung "The 4 th International Symposium on Heating,<br />
Ventilating and Air-Conditioning"<br />
Beijing, China<br />
09.10.-11.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DFG<br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
First International Conference on Energy and Environment<br />
Hunan University, China<br />
11.10.-14.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DFG<br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
3 rd International Conference on Air Production from<br />
Agricultural Operations<br />
Raleigh, NC. USA<br />
12.10.-15.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DFG<br />
BERG, WERNER<br />
Research Institute of Pomology<br />
Arbeitsaufenthalt<br />
Skierniewice, Polen<br />
13.10.-31.10.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DAAD Austauschprogramm<br />
ROHRBACH, ALEXANDER
Congreso Internacional de Riego y Drenaje<br />
CubaRiego <strong>2003</strong><br />
Havana, Kuba<br />
20.10.-24.10.03<br />
Finanzierung: BMBF<br />
LUCKHAUS, CHRISTOPH; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Projektvorbereitung und Kontaktreise<br />
Havana, Kuba<br />
25.10.-02.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMBF<br />
LUCKHAUS, CHRISTOPH; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Meeting Club of Bologna<br />
EIMA Bologna, Italien<br />
15.11.-17.11.<strong>2003</strong><br />
ZASKE, JÜRGEN<br />
Universidade Federal de Viçosa<br />
Brasilien<br />
Forschungsaufenthalt im Rahmen das DAAD-<br />
Programms Integrierte Umwelttechnik<br />
26.10.-06.12.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DAAD<br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Anniversary of SziE University<br />
Budapest, Ungarn<br />
05.11.-07.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: DAAD Kooperation<br />
GEYER, MARTIN<br />
Results of an advanced decortication technology for bast<br />
fibres, Intern. Nordic Biofibre Conference, Copenhagen,<br />
11.11.-15.11-<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Veranstalter<br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
III Wissenschaftliche Zusammenarbeit<br />
Seminar für Biogasberater der Bun<strong>des</strong>länder von<br />
Österreich<br />
Klagenfurt<br />
17.11.-18.11.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: ÖKL (Österr. Kuratorium Landtechnik)<br />
LINKE, BERND<br />
Katholische Universität Leuven, Belgien<br />
Arbeitsaufenthalt<br />
Finanzierung: Marie-Curie Stiftung<br />
23.11.-06.12.<strong>2003</strong><br />
WULF, JANIENA<br />
Transition in Agriculture and Future Landuse Patterns<br />
Wageningen, Niederlande<br />
01.12.-03.12.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: LUCC, Haushalt<br />
PLÖCHL, MATTHIAS<br />
117<br />
Hungarian Institute of Agricultural Engineering (MIG)<br />
Gödöllö, Ungarn<br />
Einfluss verschiedener Abdeckmaterialien auf die Ammoniak-<br />
und Methanemissionen von Gülle bei der Lagerung<br />
Betreuer am MIG: PAZSICZKI, IMRE<br />
01.12.-05.12.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: BMVEL – bilaterale Zusammenarbeit<br />
BERG, WERNER; HÖRNIG, GÜNTER<br />
Advanced Technology for Decortication of Flax and<br />
other Bast Fibre plants: Processing of Bast fibre and<br />
Coir, Intern. Conference of the FAO on Flax and Allied<br />
Fiber Plants for Human Welfare, Cairo, Egypt<br />
06.12.-14.12.<strong>2003</strong><br />
Finanzierung: Haushalt<br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
118<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
Publication of Results<br />
1 Wissenschaftliche Veranstaltungen<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
VDI Kolloquium "Mitteleuropäische Landbewirtschaftung<br />
im Lichte von Klimaänderung und globalem Wandel"<br />
Potsdam-Bornim<br />
30.01.<strong>2003</strong>, 26 Teilnehmer<br />
Scientific Events Arbeitsgespräche zur Vorbereitung eines EU-Antrages<br />
Leuven und Brüssel<br />
1.1 Tagungen und Kongresse<br />
13.02. und 26.03.<strong>2003</strong>, ca. 25 Teilnehmer<br />
Scientific Meetings and Conferences<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: KRAMER, ECKART; DAMMER, KARL-HEINZ;<br />
GEYER, MARTIN<br />
„Workshop Computer-Bildanalyse in der Landwirtschaft“<br />
Bonn – Potsdam-Bornim,<br />
06.05.<strong>2003</strong>, 39 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referent: HEROLD, BERND<br />
"4 th European Conference on Precision Agriculture"<br />
"1 st European Conference on Precision Livestock Farming";<br />
gemeinsam mit dem ZALF Müncheberg<br />
Berlin, 15.-19.06.<strong>2003</strong>, ca. 450 Teilnehmer<br />
Referenten: ZASKE, JÜRGEN; BREHME, ULRICH;<br />
BRUNSCH, REINER; DOSMCH, DOMSCH; EHELRT, DETLEF;<br />
SCHWARZ, JÜRGEN; DAMMER, KARL-HEINZ<br />
9. Internationale Fachtagung "Energetische Nutzung<br />
nachwachsender Rohstoffe"; gemiensam mit der TU,<br />
Bergakadmie Freiberg<br />
Freiberg; 04.-05.09.<strong>2003</strong>, ca. 180 Teilnehmer<br />
Posterbeiträge: SCHOLZ, VOLKHARD; IDLER, CHRISTINE;<br />
DARIES, WERNER; LINKE, BERND<br />
Statusseminar <strong>2003</strong> „High-Tech Innovationen für Verfahrensketten<br />
der Agrarproduktion“<br />
IHK Potsdam; 29.-30.09.<strong>2003</strong>, ca. 120 Teilnehmer<br />
Referenten: KRAMER, ECKART; EHLERT, DETLEF;<br />
BÖTTGER, HARTMUT; HEROLD, BERND; ZUDE, MANUELA;<br />
HASSENBERG, KARIN; LINKE, BERND; MULUGETA; ERMYAS;<br />
GEYER, MARTIN<br />
Biogas für alle – Eine Stadt-Land-Partnerschaft<br />
Potsdam<br />
17.-18.11.<strong>2003</strong>, ca. 120 Teilnehmer<br />
Programmausschuss: HEIERMANN, MONIKA; PLÖCHL,<br />
MATTHIAS<br />
Referenten: MÄHNERT, PIA; GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Sektionsleitung: PLÖCHL, MATTHIAS<br />
1.2 Sonstige<br />
Others<br />
Kick-off Meeting „IP Biogas4FC (Projektvorschlag 6. FP-<br />
EU)“<br />
Potsdam<br />
09.-10.01.<strong>2003</strong>, 20 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: HEIERMANN, MONIKA; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium „Gentechnische Optimierung der Bacteriocin-Synthese“<br />
Potsdam-Bornim<br />
16.01.<strong>2003</strong>, 25 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referent: KLOCKE, MICHAEL<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
VDI Kolloquium "Cellulosefasern - Struktur und Eigenschaften<br />
bei der Compositherstellung"<br />
Potsdam-Bornim<br />
27.02.<strong>2003</strong>, 14 Teilnehmer<br />
“Meeting of Core Group IP BIOGAS4FC”<br />
Potsdam<br />
03.03.03, 8 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: HEIERMANN, MONIKA; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium "Untersuchung von Strömungsverlusten<br />
in Drehkolbenpumpen"<br />
Potsdam-Bornim<br />
06.03.<strong>2003</strong>, 25Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: TÜRK, MENO; ZENKE, THOMAS<br />
VDI Kolloquium "Thermographie in der Wissenschaft<br />
und Praxis"<br />
Potsdam-Bornim<br />
20.03.<strong>2003</strong>, 21 Teilnehmer<br />
VDI Kolloquium "Chloroplasten-Transformation zur Produktion<br />
von Kunststoffen und Pharmazeutika in Pflanzen"<br />
Potsdam-Bornim<br />
27.03.<strong>2003</strong>, 28 Teilnehmer<br />
VDI Kolloquium "Photobiologische Wasserstoffproduktion"<br />
Potsdam-Bornim<br />
10.04.<strong>2003</strong>, 21 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium "Reduzierung der Belastung <strong>des</strong> Euters<br />
durch technische Veränderungen am Melkzeug"<br />
Potsdam-Bornim<br />
24.04.<strong>2003</strong>, 20 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referent: ROSE, SANDRA<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium "Parameter der Mastitisprüfung bei<br />
Milchkühen – physiologische Zusammenhänge und analytische<br />
Möglichkeiten"<br />
Potsdam-Bornim<br />
15.05.<strong>2003</strong>, 20Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referent: KREHL, INES<br />
VDI Kolloquium "Modellierung der Temperaturdynamik in<br />
Spargeldämmen unter Folienabdeckung"<br />
Potsdam-Bornim<br />
22.05.<strong>2003</strong>, 13 Teilnehmer
<strong>ATB</strong>-Kolloquium "Einsatz der Thermografie im Kartoffel-<br />
Großkistenlager - Aufbau, Einsatz, Erfahrungen, Ausblick"<br />
Potsdam-Bornim<br />
05.06.<strong>2003</strong>, 19 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: GOTTSCHALK, KLAUS; GEYER, SABINE;<br />
HELLEBRAND, HANS-JÜRGEN; BEUCHE, HORST<br />
VDI-Kolloquium "Geophysikalische Techniken zur Bestimmung<br />
der Bodenwasserverteilung und -dynamik"<br />
Potsdam-Bornim<br />
12.06.<strong>2003</strong>, 16 Teilnehmer<br />
“Exkursion 1” anlässlich der 4th European Conference<br />
on Precision Agriculture – „Sensor development & scientific<br />
research for precision agriculture”<br />
<strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim<br />
19. 06. <strong>2003</strong>, ca. 40 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: DOMSCH, HORST; EHLERT, DETLEF;<br />
DAMMER, KARL-HEINZ; SCHWARZ, JÜRGEN<br />
Ehrenkolloquium für Dr. Richter<br />
Potsdam-Bornim<br />
25.06.<strong>2003</strong>, ca. 60 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: ZASKE, JÜRGEN; LINKE, BERND; KLOCKE,<br />
MICHAEL; VENUS, JOACHIM<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium "Einsatz von Infrarottechnik bei Rindern<br />
- eine neue Form der nicht-invasiven Tierdatengewinnung"<br />
Potsdam-Bornim<br />
03.07.<strong>2003</strong>, 23 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: HELLEBRAND, H.J.; BREHME, U.<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium „Optimierung <strong>des</strong> Waschprozesses für<br />
Gemüse“<br />
Potsdam-Bornim<br />
08.09.<strong>2003</strong>, 18 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: MULUGETA, ERMYAS; GEYER, MARTIN<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloqium „Dynamisches Wiegen als Bestandteil<br />
der online-Stärkebestimmung bei Kartoffeln“<br />
Potsdam-Bornim<br />
22.09.<strong>2003</strong>, 18 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referent : HOFFMANN, THOMAS<br />
VDI Kolloquium "Energetische Nutzung von Biomasse<br />
unter besonderer Berücksichtigung von Pflanzenöl"<br />
Potsdam-Bornim<br />
09.10.<strong>2003</strong>, 18 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium „Zerstörungsfrei Methoden zur Qualitätsbestimmung<br />
an gartenbaulichen Produkten“<br />
Potsdam-Bornim<br />
20.10.<strong>2003</strong>, 40 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: HEROLD, BERND; ZUDE, MANUELA;<br />
HERPPICH, WERNER B.; LINKE, MANFRED; TRUPPEL, INGO<br />
VDI-Kolloquium "Ein einfaches Verfahren zum Schälen<br />
von Kartoffeln"<br />
Potsdam-Bornim<br />
06.11.<strong>2003</strong>, 20 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referent: HOFFMANN, THOMAS<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium "Einsatz von Fußpedometern zur<br />
Brunsterkennung"<br />
Potsdam-Bornim<br />
13.11.<strong>2003</strong>, 21 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referent: BREHME, ULRICH<br />
119<br />
Ökologischer Gemüsebau – Vom Feld bis zur Ladentheke<br />
–„<br />
HU-Berlin<br />
20.11.<strong>2003</strong>, 40 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: DUMDEI, KATRIN; GEYER, MARTIN; LINKE,<br />
MANFRED; MÜLLER, KATHRIN<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium „CRAFT“<br />
Potsdam Bornim<br />
24.11.<strong>2003</strong>, 19 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referent: HERPPICH, WERNER B.<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium „Qualitätssicherung bei Bioprodukten“<br />
01.12.<strong>2003</strong>, 21 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referenten: MÜLLER, KATHRIN; DUMDEI, KATRIN<br />
VDI-Kolloquium "Werden künftige Traktoren voll gefedert<br />
sein?"<br />
Potsdam-Bornim<br />
04.12.<strong>2003</strong>, 22 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium „Wissenschaftliche Preise“<br />
Potsdam-Bornim<br />
08.12.<strong>2003</strong>, 16 Teilnehmer<br />
<strong>ATB</strong>-Referent: HERPPICH, WERNER B.<br />
Jahrestagung <strong>des</strong> Naturfaserverban<strong>des</strong> von Deutschland<br />
Potsdam-Bornim<br />
19.12.<strong>2003</strong>, 20 Teilnehmer<br />
2 Veröffentlichungen der Einrichtung<br />
Publications of the Institute<br />
Bornimer Agrartechnische Berichte<br />
(ISSN 0947-7314)<br />
Forschungsberichte <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
(ISSN 1430-9742)<br />
Zeitschrift „Agrartechnische Forschung“<br />
(ISSN 0948-7298)<br />
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
120<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
3 Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Vorträge der Mitarbeiter<br />
Scientific Publications of Staff Members<br />
3.1 Monografien<br />
a) nach Autorenschaft<br />
/1/ FÜRLL, C.; MELLMANN, J.; SCHOLZ, V.: Ursachenanalyse und technische Möglichkeiten zur Verringerung der Dioxinbildung<br />
bei der Grünfuttertrocknung. Fallstudie, Leibniz-Institut für Agrartechnik Bornim e.V., Potsdam, August<br />
<strong>2003</strong>, 33 Seiten<br />
/2/ MUNDER, F.: Processing of Natural Fiber Plants for Industrial Application, CRC approved book, Harworth Press.<br />
Inc. Michigan <strong>2003</strong><br />
/3/ PLÖCHL, M.; HEIERMANN, M.: Abschlussbericht Energielandwirtschaft – Potenzial und Risiko bei Biogas, PROINNO<br />
NO. KF0096301KWZ, Projektzeitraum: 01.03.2000–31.05.<strong>2003</strong><br />
b) nach Herausgeberschaft<br />
/4/ HARNISCH, R.: Sozioökonomische Aspekte zu Perspektiven <strong>des</strong> Offenlandmanagements. Bericht aus den sozioökonomischen<br />
Forschungen der BMBF-geförderten Verbundvorhaben <strong>des</strong> För<strong>des</strong>chwerpunktes Biotop- und Artenschutz/Integrierte<br />
Natuschutzforschung (01LN). Bornimer Agrartechnische Berichte Heft 33 (<strong>2003</strong>). 140 Seiten<br />
/5/ HEIERMANN, M.; PLÖCHL, M., Eds.: Biogas in der Landwirtschaft - Leitfaden für Landwirte und Investoren im Land<br />
Brandenburg, 2. überarbeitete Auflage. Potsdam (D), Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg (<strong>2003</strong>). 64 Seiten<br />
/6/ HEROLD, B.: Computer-Bildanalyse in der Landwirtschaft. – Workshop <strong>2003</strong> –. Bornimer Agrartechnische Berichte<br />
Heft 34 (<strong>2003</strong>). 79 Seiten<br />
3.2 Wissenschaftliche Aufsätze<br />
a) referiert<br />
/7/ Anders, K.; Prochnow, A.; Fürstenau, S.; Segert, A.; Zierke, I.: Offenlandmanagement durch kontrolliertes Brennen<br />
aus sozioökonomischer Perspektive. Naturschutz und Landschaftsplanung, Band 35, Heft 8: S. 242-246<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/8/ BRÜCKNER, R.; VERHÜLSDONK, B.; TÜRK, M.; ZENKE, T.: Berechnung verschleißabhängiger Kennlinien von schräg<br />
verzahnten Drehkolbenpumpen. Landtechnik (Kurzfassung). 58 (5): 304-305, <strong>2003</strong><br />
/9/ BRÜCKNER, R.; VERHÜLSDONK, B.; TÜRK, M.; ZENKE, T.: Berechnung verschleißabhängiger Kennlinien von schräg<br />
verzahnten Drehkolbenpumpen. Agrartechnische Forschung (Langfassung). 9 (5): 83-87, <strong>2003</strong><br />
/10/ EHLERT, D.; HAMMEN, V.; ADAMEK, R.: On-line Sensor Pendulum-Meter for Determination of Plant Mass. Kluwer<br />
Academic Publishers, Precision Agriculture (4): 139-148, <strong>2003</strong><br />
/11/ Gottschalk, K; Nagy, L.; Farkas, I.: Improved Climate Control for Potato Stores by using Fuzzy Controllers.<br />
COMPAG Computers and Electronics in Agriculture, Vol 40, Iss. 1-3, Oct <strong>2003</strong> , p. 127-140, <strong>2003</strong><br />
/12/ GRUNDMANN, P.: Ökonomische Bewertung von Ansätzen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Biogas<br />
(Kurzfassung) Landtechnik 58 (5) 314-315 (<strong>2003</strong>)<br />
/13/ GRUNDMANN, P.: Ökonomische Bewertung von Ansätzen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Biogas<br />
(Langfassung). Agrartechnische Forschung 9 (<strong>2003</strong>) Heft 5, S. 88–91<br />
/14/ GUSOVIUS H.J.; PECENKA R.; AY, P.; FÜRLL, C.: Aufbereitung und Nutzung von Faserpflanzen. Forum der Forschung,<br />
Wissenschaftsmagazin der BTUC. 7(<strong>2003</strong>)16: S. 143 - 148<br />
/15/ HARNISCH, R.; SCHLAUDERER, R.; PROCHNOW, A.; JESSEL, B.: Finanzierung <strong>des</strong> Naturschutzes auf ehemaligen<br />
Truppenübungsplätzen – Ökonomische Probleme der Erhaltung wertvoller Offenlandbiotope. Naturschutz und<br />
Landschaftsplanung 35 (9): S. 272-278 (<strong>2003</strong>)<br />
/16/ HELLEBRAND, H. J.; KERN, J.; SCHOLZ, V.: Long-term studies on greenhouse gas fluxes during cultivation of energy<br />
crops on sandy soils. Atmospheric Environment 37, <strong>2003</strong> (12), 1635-1644<br />
/17/ HEROLD, B.; OBERBARNSCHEIDT, B.; JAKOVÁC, F.; KOVÁCS, L.; BORSA, B.: Mathematical and Statistical Modelling of<br />
Impact Symptoms and Application to Tomato. International Journal of Horticultural Science 8 (3-4): 75-80 (2002)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/18/ KREIBICH, H.; KERN, J.: Nitrogen fixation and denitrification in a floodplain forest near Manaus, Brazil. Hydrol.<br />
Process. 17: 1431-1441 (<strong>2003</strong>)<br />
/19/ KREIBICH, H.; LEHMANN, J.; SCHEUFELE, G.; KERN, J.: Nitrogen availability and leaching during the terrestrial phase<br />
in a várzea forest of the Central Amazon floodplain. Biol. Fertil. Soils. 39: 62-64 (<strong>2003</strong>)<br />
/20/ LINKE, B.: Biogas aus Energiepflanzen (Kurzfassung). Landtechnik. 58 (5): 316-317, (<strong>2003</strong>)<br />
/21/ LINKE, B.: Biogas aus Energiepflanzen. Ergebnisse aus Langzeitversuchen im Labor (Langfassung). Agrartechnische<br />
Forschung 9 (<strong>2003</strong>) H. 5, S. 78-82<br />
/22/ MALY, P.; HOFFMANN, T.; FÜRLL, C.: Použití velkoobjemových palet při sklizni brambor. Mechanizace zemědělství<br />
9/<strong>2003</strong>, 24-28, <strong>2003</strong><br />
/23/ MUNDER,F.; FÜRLL, C., HEMPEL, H.: Advanced Decortication Technology for Bast fibres and Coir. Special issue of<br />
the Molecular Crystal @ Liquid Crystal,The Haworth Press, English / Hazleton, PA 18202, Dec <strong>2003</strong><br />
/24/ MUNDER,F.; FÜRLL,C., HEMPEL, H.: Advanced Decortication Technology for not retted Bast Fibres. Journal of<br />
Natural Fibers, The Haworth Press, English / Hazleton, PA 18202, <strong>2003</strong><br />
/25/ PROCHNOW, A.; MEIERHÖFER, J.: Befahrmuster bei der Grünlandmahd. Faunaschonung und Aufwendungen<br />
(Kurzfassung). Landtechnik, Band 58, Heft 4: S. 252-253 (<strong>2003</strong>)<br />
/26/ PROCHNOW, A.; MEIERHÖFER, J.: Befahrmuster bei der Grünlandmahd. Faunaschonung und Aufwendungen<br />
(Langfassung). Agrartechnische Forschung 9 (<strong>2003</strong>) H. 4, S. 36-43<br />
/27/ SCHLAUDERER, R.; PROCHNOW, A.: Ökonomische Aspekte <strong>des</strong> Offenlandmanagements. In: KONOLD, W. u. B.<br />
BURKART [Hrsg.], Offenland und Naturschutz. – Culterra, Schriftenreihe <strong>des</strong> Instituts für Lan<strong>des</strong>pflege, Band 31:<br />
S. 235-254 (<strong>2003</strong>)<br />
/28/ TÜRK, M.; ZENKE, T.; VERHÜLSDONK, B.; BRÜCKNER, R.: Verschleißeinfluss auf das Förderverhalten von Drehkolbenpumpen<br />
(Kurzfassung). Landtechnik. 58 (3): 210-211, <strong>2003</strong><br />
/29/ TÜRK, M.; ZENKE, T.; VERHÜLSDONK, B.; BRÜCKNER, R.: Verschleißeinfluss auf das Förderverhalten von Drehkolbenpumpen<br />
(Langfassung). Agrartechnische Forschung 9 (203) H. 3, S. 31-35<br />
/30/ ZUDE, M.: Comparison of indices and multivariate models to non-<strong>des</strong>tructively predict the fruit chlorophyll by<br />
means of visible spectrometry in apple fruit. Analytica Chimica Acta 481: 119-126 (<strong>2003</strong>)<br />
/31/ ZUDE, M.: Non-<strong>des</strong>tructive prediction of banana fruit qualitay using VIS/NIR spectroscopy. Fruits 58 (3): 135-142<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
b) nicht referiert<br />
/32/ BÖTTGER, H.; LANGNER, H.-R.: Neue Technik zur variablen Spritzmitteldosierung. Landtechnik 58 (3): 142-143,<br />
<strong>2003</strong><br />
/33/ BREHME, U.; BAHR, CLAUDIA; HOLZ, R.: Brunsterkennung von Rindern. Landtechnik. 58 (2):106-107, <strong>2003</strong><br />
/34/ BRUNSCH, R.; HÖRNIG, G.: Emissionen aus der Broilermast – Ergebnisse eines Langzeitmonitoring. Landtechnik.<br />
58 (1): 36-37<br />
/35/ BRUNSCH, R.; SCHOLZ, V.: Individuelle Wasserversorgung von Rindern an einer Photovoltaik-Weidezentrale.<br />
Landtechnik 58 (6): 396-397 (<strong>2003</strong>)<br />
/36/ DOMSCH, H.; KAISER, T.; WITZKE, K.: Elektrische Bodenleitfähigkeit und Nährstoffbeprobung – Untersuchungen in<br />
einer Altmoränenlandschaft. Landtechnik 58 (3): 140-141, <strong>2003</strong><br />
/37/ EHLERT, D.: Sensortechnik – Für Düngung und Pflanzenschutz. GIT Verlag, Lebensmittel Industrie (3): 16-17,<br />
<strong>2003</strong><br />
/38/ EHLERT, D.; VÖLKER, U.; ADAMEK, R.: Regelspurtiefen auf Getrei<strong>des</strong>chlägen. Landtechnik 58 (4): 240-241, <strong>2003</strong><br />
/39/ EHLERT, D.;VÖLKER, U.; DAMMER, K.-H.: Pendelsensor im Praxiseinsatz. Landtechnik 58 (1): 16-17, <strong>2003</strong><br />
/40/ FÜRLL, C.; HJORTAS, T.; ENSTADT, G.: Ergebnisse zur Konstruktion von Trockenmischfuttersilos. Schüttgut, 9(5):<br />
354-357(<strong>2003</strong>)<br />
/41/ FÜRLL, C.; SCHURICHT, T.: Lager- und Dosierbehälter für nachwachsende Brennstoffe. Aufbereitungs- Technik,<br />
44 (11-12): 46-52 (<strong>2003</strong>)<br />
/42/ GEYER, M.: Ernte- und Nacherntetechnologie am <strong>ATB</strong> in Potsdam. Forschungs-Report, Heft 1: 41 (<strong>2003</strong>)<br />
/43/ GEYER, M.; OBERBARNSCHEIDT, B.; HEROLD, B.: Mechanische Belastung gezielt reduzieren. Monatsschrift Gartenbau-Profi<br />
Sonderheft Zwiebel, Heft 1: 17-19 (<strong>2003</strong>)<br />
121<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
122<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/44/ GOTTSCHALK, K.: Klimaautomatisierung von Kartoffellagern. Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbeitung. 88 (4), S.<br />
4-8, <strong>2003</strong><br />
/45/ GOTTSCHALK, K.: Simulation <strong>des</strong> Lagerklimaverlaufs bei der Speisekartoffellagerung. Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbeitung.<br />
88 (5/6), S. 12-17, <strong>2003</strong><br />
/46/ GRUNDMANN, P: Ökonomische Bewertung von Ansätzen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Biogas.<br />
Landtechnik 58, Heft 5: S. 314-315 (<strong>2003</strong>)<br />
/47/ HEROLD, B.; OBERBARNSCHEIDT, B.; ZUDE, M.; GEYER, M.: Zerstörungsfreie Bestimmung der Glasigkeit von Speisezwiebeln.<br />
Landtechnik 58, (1): 34-35 (<strong>2003</strong>)<br />
/48/ HEROLD, B.; ZUDE, M.; GEYER, M.: In den Apfel gespäht. Forschungs-Report, Heft 1: 30-32 (<strong>2003</strong>)<br />
/49/ JAKOB, M.; GEYER, M.: Zur Gestaltung von Fließbandarbeitsplätzen. Landtechnik 58 (3): 138-139 (<strong>2003</strong>)<br />
/50/ KRAMER, E.; V. HASELBERG, C.: HighTech in der Agrarproduktion. Forschungs-Report (2): 55, <strong>2003</strong><br />
/51/ LATSCH, R.; PROCHNOW, A.; BERG, W.: Häcksler oder Ladewagen? Vergleich und Bewertung der Stärken und<br />
Schwächen beider Verfahren. Neue Landwirtschaft 11 (14): S. 54-57 (<strong>2003</strong>)<br />
/52/ LANGNER, H.-R.: Teilflächenspezifische Ausbringung von Fungiziden und Herbiziden. Landtechnik 58 (6): 384-<br />
385, <strong>2003</strong><br />
/53/ LANGNER, H.-R.; BÖTTGER, H.; EHLERT, D.: Anforderungen an die Dynamik teilflächenspezifischer Applikationstechnik.<br />
Landtechnik 58 (4): 244-245, <strong>2003</strong><br />
/54/ MÜLLER, H.-J.: Stallluftqualität und Emissionen. Landtechnik 58 (3): 198-199, <strong>2003</strong><br />
/55/ MULUGETA, E.; GEYER, M.; OBERBARNSCHEIDT, B.: Düsen für die Gemüsewäsche. Landtechnik 58 (4): 256-257<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/56/ OBERBARNSCHEIDT, B.; HEROLD, B.; GEYER, M.; BORSA, B.; KOVÁCS, L.; JAKOVÁC, F.: Fruchtbelastung beim Straßentransport<br />
von Tomaten in losen Schüttung. Landtechnik 58 (3): 136-137 (<strong>2003</strong>)<br />
/57/ ROHRBACH, A.; HEROLD, B.; ZUDE, M.: Zerstörungsfreie Apfelreifebestimmung. Landtechnik 58 (4): 254-255<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/58/ SCHLAUDERER, R.; PROCHNOW, A.; HARNISCH, R.: Offenlandmanagement auf ehemaligen Truppenübungsplätzen.<br />
Das Beispiel Döberitzer Heide. Landtechnik 6, S. 394-395 (<strong>2003</strong>)<br />
/59/ SCHOLZ, V.: Biogas in Brennstoffzellen. Nachwachsende Rohstoffe Nr. 30, BLT Wieselburg, Österreich <strong>2003</strong>, S.<br />
14<br />
/60/ SCHREINER, M.; SCHONHOF, I.; SCHMIDT, S.; WONNEBERGER, CH.; PASCHOLD, P.-J.; ZIEGLER, J.; ROHLFING, H.-R.;<br />
GEYER, M.; BOKELMANN, W.; BEESE, J.-P.: Deutscher Spargel bald in aller Munde. Forschungs Report Heft 1: 12-<br />
15 (<strong>2003</strong>)<br />
/61/ SCHWARZ, J.; KERSEBAUM, K.C.; WENDROTH, O.; REUTER, H.I.: Teilflächenspezifisches Stickstoffmanagement -<br />
Modellempfehlungen auf dem Prüfstand der Praxis. Landtechnik 58 (4): 246-247, <strong>2003</strong><br />
/62/ TÜRK, M.; ZENKE, T.; VERHÜLSDONK, B.; BRÜCKNER, R.: Sorgfältig untersucht. Spaltverluste in Drehkolbenpumpen.<br />
Verfahrenstechnik. Sonderausgabe Marktübersicht <strong>2003</strong>, S. 44-47<br />
/63/ WULF, J.S.; HERPPICH, W.B.; ZUDE, M.: Laser-induced fluorescence spectroscopy (LIFS) – A non-<strong>des</strong>tructive method<br />
to detect tissue browning. Acta Horticulturae 604 (2): 653-658 (<strong>2003</strong>)<br />
/64/ WULF, J.S.; ZUDE, M.: Druckstellen an Äpfeln und Verbräunung von Obstsalaten. Landtechnik 58 (6): 390-391<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/65/ ZUDE, M.; HIELSCHER-TÖLZER, CH.; HEROLD, B.: Wie reif ist die Frucht? Landtechnik 58 (3): 134-135 (<strong>2003</strong>)<br />
/66/ ZUDE, M.; WEGNER, G.: NIR-Spektralanalyse: Zerstörungsfreie Zuckerbestimmung bei Kirschen und Äpfeln.<br />
Schweizerische Zeitschrift für Obst und Weinbau 139: 15-17 (<strong>2003</strong>)<br />
3.3 Wissenschaftliche Beiträge zu Sammelwerken (Proceedings)<br />
a) referiert<br />
/67/ BERG, W.: Reducing Ammonia Emissions by Combining Covering and Acidifying Liquid Manure. 3 rd International<br />
Conference on Air Pollution from Agricultural Operations. Raleigh. NC. USA. 12 – 15 October <strong>2003</strong>, p. 174–182<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/68/ BERG, W.; BRUNSCH, R.; EURICH-MENDEN, B.; DÖHLER, H.; DÄMMGEN, U.; OSTERBURG, B.; BERGSCHMIDT, A.:<br />
Ammonia Emissions from German Animal Husbandry. 3 rd International Conference on Air Pollution from Agricultural<br />
Operations. Raleigh. NC. USA. 12 – 15 October <strong>2003</strong>, p. 131–138 (<strong>2003</strong>)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/69/ BERG, W.; CLEMENS, J.; HAHNE, J. et al.: Wirtschaftsdüngermanagement. In: aid (Hrsg.): Ammoniak-Emissionen<br />
in der Landwirtschaft mindern. Gute fachliche Praxis. Bonn, S. 41–48 (<strong>2003</strong>)<br />
/70/ BERG, W.; HÖRNIG, G. ; WANKA, U.: Ammoniak-Emissionen bei der Lagerung von Fest- und Flüssigmist sowie<br />
Minderungsmaßnahmen. In: Emissionen der Tierhaltung – Grundlagen, Wirkungen, Minderungsmaßnahmen.<br />
KTBL-Schrift 406: S. 151–162 (<strong>2003</strong>)<br />
/71/ BRUNSCH, R.: Verfahrenstechnische Beiträge zur Integration von Tier- und Umweltschutzzielen. Statusseminar<br />
Ressortforschung für den ökologischen Landbau, Braunschweig, 13.03.<strong>2003</strong>, Landbauforschung Völkenrode,<br />
Sonderheft 259, S. 70-74<br />
/72/ DOMSCH, H.; KAISER, T.; WITZKE, K.; ZAUER, O.: Empirical methods to detect management zones with respect to<br />
yield. In: Precision Agriculture, edit. by J. Stafford and A. Werner, Wageningen Academics Publishers (NL-ISBN<br />
9076998213), Berlin, <strong>2003</strong>, pp. 187-192<br />
/73/ EHLERT, D.; KRAATZ, S.; HORN, H.-J.: Improvement of the pendulum-meter for measuring crop biomass. In: Precision<br />
Agriculture, edit. by J. Stafford and A. Werner, Wageningen Academics Publishers (NL-ISBN<br />
9076998213), Berlin, <strong>2003</strong>, pp. 199-204<br />
/74/ GEYER, M.; HEROLD, B.; OBERBARNSCHEIDT, B.; BORDA, B.; KOVÁCS, L.; JAKOVÁC, F.: Detection of Mechanical<br />
Load and Damage of Industrial Tomatoes during Transport. In: VERLINDEN B.E. et al. (eds.): Proceedings of the<br />
International Conference Postharvest Unlimited, Acta Horiculturae 599, p 273-280 (<strong>2003</strong>)<br />
/75/ GRUNDMANN, P.: Comparative assessment of the potentials of cost reduction strategies in biogas production. In:<br />
New methods, means and technologies for application of agricultural products. Raudondvaris, Lithuania, 18.-<br />
19.09.<strong>2003</strong>. Institute of Agricultural Engineering LUA, Raudondvaris, Lithuania (ISBN 9986-732-19-0), p. 58-62<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/76/ GRUNDMANN, P.: Zur Wirtschaftlichkeit von Innovationen für eine wettbewerbsfähige Biogaswirtschaft. In: Ostbayerisches<br />
Technologie-Transfer-Institut e.V.: Zwölftes Symposium „Energie aus Biomasse“ – Biogas, Flüssigkraftstoffe,<br />
Festbrennstoffe. OTTI Kolleg, Bad Staffelstein (ISBN 3-934681-28-X), 20.-21.11.<strong>2003</strong>, S. 107-112<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/77/ HERPPICH, W.B.; HEROLD, B.; LANDAHL, S.; DE BAERDEMACKER, J.: Interactive Effects of Water Status and Produce<br />
Texture – an Evaluation of Non-Destructive Methods. In: VERLINDEN B.E. et al. (eds.): Proceedings of the<br />
International Conference Postharvest Unlimited Acta Horiculturae 599, p 281-288 (<strong>2003</strong>)<br />
/78/ HERPPICH, W.B.; HEROLD, B.; LINKE, M.; GEYER, M.; GÓMEZ GALINDO, F.: Dynamic Effects of Temperature and Water<br />
Status on the Texture of Radish and Carrots during Postharvest. Quality in Chains, 06.-09.07.<strong>2003</strong> Wageningen, The<br />
Netherlands, Proceedings of the International Conference on Quality in Chains, Eds. TIJSKENS & VOLLBREGT, Acta Horticulturae<br />
Number 604, Volume 2, p 647-652 (<strong>2003</strong>)<br />
/79/ KERN, J.: Seasonal efficiency of a constructed wetland for treating dairy farm wastewater. In: MANDER, Ü. and<br />
JENSEN P. (eds.): Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Cold Climates, WIT Press (ISBN 1-85312-<br />
651-9) Southampton, p. 197-214 (<strong>2003</strong>)<br />
/80/ KERSEBAUM, K.C.; LORENZ, K.; REUTER, H.I.; WENDROTH, O.; GIEBEL, A.; SCHWARZ J.: Site-specific nitrogen fertilisation<br />
recommendations based on simulation. In: Precision Agriculture, edit. by J. Stafford and A. Werner,<br />
Wageningen Academics Publishers (NL-ISBN 9076998213), Berlin, <strong>2003</strong>, pp. 309-314<br />
/81/ LINKE, M.; GEYER, M.: Postharvest Behaviour of Tomatoes in Dífferent Transport Packaging Units. In: VERLINDEN<br />
B.E. et al. (eds.): Proceedings of the International Conference Postharvest Unlimited Acta Horiculturae 599, p<br />
115-122 (<strong>2003</strong>)<br />
/82/ LINKE, M.; HERPPICH, W.B.; GEYER, M.: An integrated approach to indicate freshness of horticultural produce. Quality in<br />
Chains, 06.-09.07.<strong>2003</strong> Wageningen, The Netherlands, Proceedings of the International Conference on Quality in<br />
Chains, Eds. TIJSKENS & VOLLBREGT, Acta Horticulturae Number 604, Volume 2, p 539-543 (<strong>2003</strong>)<br />
/83/ MODEL N.; MELLMANN.J; MALTRY. W.: Mathematical modelling of mixed-flow grain drying. In: Proceedings of the<br />
3 rd CEE AgEng Research and Develop., Conf. of Central- and Eastern Europ., Gödöllö, 11-12 Sept. <strong>2003</strong>, Hungary;<br />
pp. 113-117.<br />
/84/ MOLLOY, E.; HASSENBERG, K.; PLÖCHL, M.; IDLER, C.; GEYER, M.; BARNES, J.: Use of Ozonated Washing Water for<br />
the Surface Decontamination of Perishable Produce. Proceedings of the International Conference Postharvest<br />
Unlimited. B. E. Verlinden, B. M. Nicolai and J. d. Baerdemaeker. Acta Horticulturae 599: 577-582 (<strong>2003</strong>)<br />
/85/ MULUGETA, E.; GEYER, M.: Optimization of washing processes for vegetable und potatoes –Development of washing<br />
nozzles in order to increase washing efficiency of vegetables and potatoes- ASAE Annual International Meeting, 27. –<br />
30.07.<strong>2003</strong>, Las Vegas, Nevada, CD Rom, Paper Number: 036118<br />
/86/ PECENKA R.; FÜRLL, C.: Efficient Cleaning Strategies for Bast Fibre Production to Reduce Raw Material Costs. In<br />
KTBL-Schrift 414: Biodegradable Materials and Natural Fibre Composites in Agriculture and Horticulture, <strong>2003</strong>,<br />
Darmstadt, p. 154 - 158<br />
123<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
124<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/87/ PECENKA R.; FÜRLL, C.: Operational experiences in bast fibre straw processing with the <strong>ATB</strong> pilot plant using advanced<br />
technologies for decortication and fibre cleaning. In: Proceedings of NJF’s 22nd Congress, Turku, July 1-<br />
4 <strong>2003</strong>, part 20: p. 17 - 21<br />
/88/ PECENKA R.; FÜRLL, C.: Investigation and optimisation of transport and separation processes in shaker cleaners<br />
for hemp fibre processing. In: Proceedings of the Conference Agricultural Engineering, Hannover, November 7-8<br />
<strong>2003</strong>, p. 391 - 396<br />
/89/ REUTER, H.I.; WENDROTH, O.; KERSEBAUM, K.C.; SCHWARZ, J.: MOSAIC: Crop yield observations - can landform<br />
stratification improve our understanding of crop yield variability? In: Precision Agriculture, edit. by J. Stafford and<br />
A. Werner, Wageningen Academics Publishers (NL-ISBN 9076998213), Berlin, <strong>2003</strong>, pp. 579-584<br />
/90/ SCHLAUDERER, R.; ACKERMANN, I.: Impacts on the availability of agricultural machinery at the farm level in Central<br />
and Eastern Europe. In: P. TILLACK and U. FIEGE (Eds): Agricultural Technology and Economic Development of<br />
Central and Eastern Europe. (Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, Institute<br />
of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO). Agri Media GmbH. Bergen. Vol. 16, p.<br />
154-160 (2002)<br />
/91/ TAPIA SILVA, O. ; MODEL, N.: Measurement and model supported alternative rain water management in urban areas<br />
of Berlin using Trackbed Naturation for Railway Tracks. In: Gnauck, A., Heinrich, R. (eds.): The Information<br />
Society and Enlargement of the European Union, 17 th International Conference Informatics for Environmental<br />
Protection Cottbus, Germany, September 24-26, <strong>2003</strong>, Metropolis-Verlag, Marburg, pp. 669-676<br />
/92/ TAPIA SILVA, O.; MODEL, N.: Development of one measurement and model supported alternative rain water management<br />
using Trackbed Naturation for Railway Tracks. In: Proceedings of the XI International Conference on<br />
Rainwater Catchment, August 25-26, Mexiko-City, Mexiko;, pp. 858-871<br />
/93/ VEGERICHT, J.; SCHLAUDERER, R.; KOVÁR, J.: The influence of economic environment on technological progress in<br />
cattle breeding in the transition period in Czech Republic after 1989. In: P. TILLACK and U. FIEGE (Eds): Agricultural<br />
Technology and Economic Development of Central and Eastern Europe. Studies on the Agricultural and<br />
Food Sector in Central and Eastern Europe, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe<br />
(IAMO). Agri Media GmbH. Bergen. Vol. 16, p. 77-84 (2002)<br />
/94/ WENDROTH, O.; EHLERT, D.; KERSEBAUM, K.C.; REUTER, H.I.; SCHWARZ, J.; GIEBEL, A.; HEISIG, M.: Analyse der<br />
räumlichen Variabilität ausgewählter Boden- und Pflanzenbestan<strong>des</strong>merkmale und ihrere Wechselwirkung auf<br />
Ackerflächen zur Vorbereitung der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung. In: Wissenschaftlicher Abschlussbericht<br />
für DFG, ZALF, Müncheberg, <strong>2003</strong>, S1-9<br />
/95/ WENDROTH, O.; KERSEBAUM, K.C.; REUTER, H.I.; GIEBEL, A.; WYPLER, N.; HEISIG, M.; SCHWARZ, J.; NIELSEN, D.R.:<br />
MOSAIC: Crop yield prediction - compiling several years´ soil and remote sensing information. In: Precision Agriculture,<br />
Wageningen Academics Publishers (NL-ISBN 9076998213), Berlin, <strong>2003</strong>, pp. 723-729<br />
/96/ WULF, J.; MULUGETA, E.; ZUDE, M.: Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy (LIFS) – infuencing Factors on Measurements-<br />
ASAE Annual International Meeting, 27.-30.07.<strong>2003</strong>, Las Vegas, Nevada, CD Rom, Paper Number:<br />
036117<br />
/97/ ZIMMERMANN, H.M.; PLÖCHL, M.; LUCKHAUS, C.; DOMSCH, H.: Selecting the optimum locations for soil investigations.<br />
In: Precision Agriculture, Wageningen Academics Publishers (NL-ISBN 9076998213), Berlin, <strong>2003</strong>, pp.<br />
759-764<br />
b) nicht referiert<br />
/98/ BAHR, CLAUDIA; BREHME, U.; KAUFMANN, O.; SCHEIBE, K.: Erfassung und Analyse räumlicher und zeitlicher Verhaltensmuster<br />
unter Nutzung von GPS- und GIS-Anwendungen im Precision Livestock Farming extensiv gehaltener<br />
Nutztiere. In: Tagungsband der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde e. V. und der Gesellschaft für Tierzuchtwissenschaft,<br />
Institut für Tierzucht und Haustiergenetik, Georg-August-Universität Göttingen (Hrsg.), <strong>2003</strong>, S.<br />
48-52<br />
/99/ BAHR, CLAUDIA; BREHME, U.; KAUFMANN, O.; SCHEIBE, K.: Erfassung und Analyse räumlicher und zeitlicher Verhaltensmuster<br />
unter Nutzung von GPS- und GIS-Anwendungen im Precision Livestock Farming extensiv gehaltener<br />
Nutztiere. In: Berichte der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, Band 16, Referate<br />
der 24. GIL-Jahrestagung in Göttingen, <strong>2003</strong>, S. 6-9<br />
/100/ BECKMANN, F.; SCHOLZ, V.: Test einer Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle für Biogas. In: Tagungsband<br />
der 2. Potsdamer Biogaskonferenz "Biogas für alle - eine Stadt-Land-Partnerschaft", 17.-18.11.<strong>2003</strong>, Potsdam,<br />
S. 72-90<br />
/101/ BERG, W.: Emissionsminderung durch die Kombination von Abdeckung und Absenkung <strong>des</strong> pH-Wertes von Gülle.<br />
Emission Reduction by a Combination of Covering and Acidifying Slurry. 6. Tagung „Bau, Technik und Umwelt<br />
in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung <strong>2003</strong>“. Vechta. 25.–27. März <strong>2003</strong>, S. 324–329 (<strong>2003</strong>)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/102/ BERG, W.; PAZSICZKI, I.: Reducing Emissions by Combining Slurry Covering and Acidifying. International Symposium<br />
on Gaseous and Odour Emissions from Animal Production Facilities. Horsens. Denmark. 1 – 4 June <strong>2003</strong>,<br />
p. 460–468 (<strong>2003</strong>)<br />
/103/ BOESS, J.; BENNE, I.; DOMSCH, H.; LÖSEL, G.; RÖTTGER, B.; SAUER, J.; SCHURICHT, R.; ZIEKUR, R.: Beitrag geophysikalischer<br />
Methoden zur Erstellung hochauflösender Bodenkarten für die teilflächen-spezifische Bewirtschaftung.<br />
In: Mitt. Dt. Geophys. Ges., Sonderband I, Jena, <strong>2003</strong>, S. 29-39<br />
/104/ BORSA, B.; KOVÁCS, L.; JAKOVÁC, F.; OBERBARNSCHEIDT, B.; HEROLD, B.; GEYER, M.: Simulation der mechanischen Belastung<br />
von Tomaten beim Lkw-Transport. 40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-<br />
01.03.<strong>2003</strong>, BDGL-Tagungsband 21 (<strong>2003</strong>), S. 91<br />
/105/ BORSA,B.- JAKOVÁC,F.-KOVÁCS,L.-LINKE, M.- OBERBARNSCHEIDT, B.-HEROLD,B.: A paprika egyes tulajdonságainak<br />
megváltozása szállítás-tárolás során. (Einige Eigenschaftsveränderungen vom Paprika beim Transport und Lagerung)<br />
XXVII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, 21.-22.01.<strong>2003</strong>, Gödöllő Ungarn, 2.kötet.p.166-9.<br />
/106/ BREHME, U.; AHLERS, D.; BEUCHE, H.; HASSELER, W.; STOLLBERG, U.: Infrarotthermografie – eine nicht-invasive, tiergerechte<br />
Diagnostikmethode zur Brunsterkennung bei Milchkühen. DVG-Tierschutztag, Fachgruppen "Tierschutzrecht"<br />
und "Tierzucht, Erbpathologie und Haustiergenetik", Nürtingen, 20./21.02.<strong>2003</strong>, Verlag DVG Service GmbH, Gießen,<br />
S. 163-169.<br />
/107/ BREHME, U.; AHLERS, D.; BEUCHE, H.; HASSELER, W.; STOLLBERG, U.: Is there a possibility of clinic application on infrared-thermography<br />
for diagnostics in oestrus detection in dairy cows? Programme book of joint conference of ECPA –<br />
ECPLF, Wageningen Academic Publishers, p. 710, Berlin, <strong>2003</strong><br />
/108/ BREHME, U.; AHLERS, D.; BEUCHE, H.; HASSELER, W.; STOLLBERG, U.: Is there a possibility of clinic application on infrared-thermography<br />
for diagnostics in oestrus detection in dairy cows? Academic Publishers: Proceedings 3 rd Research<br />
and Development Conference of Central- and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering, Hungarian Institute<br />
of Agricultural Engineering, Gödöllö (H), 11.-13.09.<strong>2003</strong>, p. 137-142.<br />
/109/ BREHME, U.; AHLERS, D.; BEUCHE, H.; HASSELER, W.; STOLLBERG, U.: Infrared-thermography for diagnostics in oestrus<br />
detection in dairy cows. XXX CIOSTA – CIGR V Proceedings, Vol. 3, Management and technology applications to<br />
empower agriculture and agro-food systems, Turin (I), 22.-24.09.<strong>2003</strong>, p. 1432-1439.<br />
/110/ BRUNSCH, R.: A new concept to control the indoor climate of broiler houses. In: Programme book of joint conference of<br />
ECPA – ECPLF, Wageningen Academic Publishers, p. 711, Berlin, <strong>2003</strong><br />
/111/ BRUNSCH, R.; HÖRNIG, G.: Zur Variation der Emissionen aus der Broilermast. 6. Internationale Tagung "Bau, Technik<br />
und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung", Vechta, 25.-27.03.<strong>2003</strong>, Tagungsband S. 311-316<br />
/112/ BRUNSCH, R.; MÜLLER, H.-J.: Investigations of Odour and Gaseous Emissions from an Experimental Chicken House.<br />
Proceedings "International Symposium on Gaseous and Odour Emissions from Animal Production Facilities". Horsens<br />
(DK), 1.-4. Juni <strong>2003</strong>, (ISBN 87-88976-66-1), p. 184-191<br />
/113/ BRUNSCH, R.; SCHLAUDERER, R.; ZASKE, J.: Leistungen moderner Agrartechnik zur globalen Ernährungssicherung.<br />
Statusseminar Welternährung, Braunschweig, 21.11.<strong>2003</strong>, Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 258, S. 23-24<br />
/114/ DAMMER, K.-H.; BÖTTGER, H.; EHLERT, D.: Sensor-controlled variable rate real-time application of herbici<strong>des</strong> and<br />
fungici<strong>des</strong>. In: Precision Agriculture, Wageningen Academics Publishers (ISBN 9076998213), pp. 129-134,<br />
Berlin, <strong>2003</strong><br />
/115/ DAMMER, K.-H.; EHLERT, D.: Sensor for a variable rate application of herbici<strong>des</strong> and fungici<strong>des</strong>. In: Proceedings<br />
of NJF´22 nd Congress “Nordic Agriculture in Global Perspective”, edit. by Niemeläinen, O. and Topi-Hulmi, M.,<br />
Turku, Finnland, <strong>2003</strong>, p. 172<br />
/116/ DOMSCH, H.; KAISER, T.: Generating field-scale soil maps based on surveying soil electrical conductivity. In: Proceedings<br />
of NJF´22 nd Congress “Nordic Agriculture in Global Perspective”, edit. by Niemeläinen, O. and Topi-<br />
Hulmi, M., Jokioinen, Turku, Finnland, <strong>2003</strong>, p. 393<br />
/117/ DOMSCH, H.; KAISER, T.; WITZKE, K.; SACHSE, H.: Kann die elektrische Bodenleitfähigkeit eine gezielte Bodenprobenentnahme<br />
unterstützen? In: Tagung Landtechnik <strong>2003</strong>, VDI-Berichte Nr. 1798, VDI-Verlag Düsseldorf, <strong>2003</strong>,<br />
S. 291-297<br />
/118/ DUMDEI, K.; KUHRMANN, D.: Möglichkeiten zur Verlängerung der Haltbarkeit von Ökoprodukten im Einzelhandel und<br />
bei der Direktvermarktung. Ökologischer Gemüsebau – Vom Feld bis zur Ladentheke -, HU Berlin, 20.11.<strong>2003</strong>, Arbeitsmappe,<br />
2 Seiten<br />
/119/ EHLERT, D.; ADAMEK, R.: Throughput measurement in forage harvesters. In: 31. Symposium “Actual Tasks on<br />
Agricultural Engineering”, Opatija, Croatia, <strong>2003</strong>, pp. 205-215<br />
/120/ EHLERT, D.; VÖLKER, U.; ALBERT, E.: Stickstoffdüngung. In: Zukunftsträchtiger Ackerbau-Systeme der computer-<br />
und GPS-gestützten teilflächenspezifischen Bewirtschaftung praxisnah bewertet. 1. Auflage, <strong>2003</strong>. Deutscher<br />
Bauernverlag GmbH (ISBN 3-9809218-0-8), Berlin: S. 93-108, <strong>2003</strong><br />
125<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
126<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/121/ EL SAEIDY, E.; SCHOLZ, V.; HAHN, J.: Energetic use of crop residues considering especially cotton stalks. In: Proceedings<br />
of the International Conference "New methods, means, and technologies for applications of agricultural<br />
products" Raudondvaris/Lithuania, 18.-19.09.03, S. 27-32<br />
/122/ EURICH-MENDEN, B.; DÖHLER, H.; DÄMMGEN, U.; LÜTTICH, M.; OSTERBURG, B.; BERGSCHMIDT, A.; BERG, W.; BRUNSCH,<br />
R.: A national inventory on ammonia emissions from agriculture for Germany. International Symposium on Gaseous<br />
and Odour Emissions from Animal Production Facilities. Horsens (DK), 01.-04.06.<strong>2003</strong>, Proceedings, p. 33-38.<br />
/123/ FÜRLL, C. MUNDER, F.; HEMPEL, H.: Untersuchungsergebnisse zur Erprobung der Faseraufschluss-Pilotanlage <strong>des</strong> Instituts<br />
für Agrartechnik Bornim. Tagungsband 4. Internationales Symposium „Werkstoffe aus Nachwachsenden Rohstoffen“,<br />
Erfurt, 11.-12.09.<strong>2003</strong>, S. 38<br />
/124/ GEYER, M.; FRICKE, A.; STÜTZEL, H.: Befahren und Bearbeiten <strong>des</strong> Bodens. Leitfaden zur Umweltbetriebsführung<br />
im Freiland-Gartenbau Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG): 29-40 (<strong>2003</strong>)<br />
/125/ GEYER, M.; TISCHER, S.; JAKOB, M.: Harvesting aids for white asparagus. In: PICCAROLO, P. (eds.): XXX CIOSTA-<br />
CIGRV Congress Proceedings, Volum 1, Turin, Italy, 22.-24.09.<strong>2003</strong> Management and technology applications to<br />
empower agriculture and agro-food systems (ISBN 88-88854-09-6), p 339-346<br />
/126/ GEYER, M.; JAKOB, M.; TISCHER, S.; ROHLFING, H.-J.: Bewertung verschiedener Erntverfahren für Bleichspargel. 13.<br />
Arbeitswissenschaftliches Seminar, Braunschweig, Landbauforschung Völkenrode FAL, 05.-06.03.2002, Agricultural<br />
Research Sonderheft 243 (<strong>2003</strong>), S. 47-51<br />
/127/ GEYER, M.; LINKE, M.: Der Einfluss von Transportverpackungen auf die Haltbarkeit von Gemüse in der Nachernte. 40.<br />
Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong>, BDGL-Tagungsband 21 (<strong>2003</strong>),<br />
S.178<br />
/128/ GIEBEL, A.; WENDROTH, O.; REUTER, H.I.; KERSEBAUM, K.C.; SCHWARZ, J.: MOSAIC - Spatial representativity of<br />
mineral soil nitrogen monitoring. In: Precision Agriculture, edit. by A. Werner and A. Jarfe, Wageningen Academics<br />
Publishers (NL-ISBN 9076998345), Berlin, <strong>2003</strong>, pp. 409-410<br />
/129/ GOTTSCHALK, K.; GEYER, S.; HELLEBRAND, H. J.; SCHLAUDERER, R.; BEUCHE, H.; FICHT, I.; JACOBS, H.; RICHTER, I.-<br />
G.; PETERS, R.; SCHORLING, E.; KERN. A.: Thermographie in der Kartoffellagerung. Statusseminar <strong>2003</strong> - High-<br />
Tech Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion. Potsdam 29.-30.09.<strong>2003</strong>, Tagungsband (Kurzfassungen),<br />
S. 25-26 (<strong>2003</strong>)<br />
/130/ HARNISCH, R.; SCHLAUDERER, R.; PROCHNOW, A.: Finanzierungsmöglichkeiten für den Naturschutz auf ehemaligen<br />
Truppenübungsplätzen. In: Bornimer Agrartechnische Berichte Heft 33, S. 83-95 (<strong>2003</strong>)<br />
/131/ HEIERMANN, M.; MÄHNERT, P.; LINKE, B.: Biogas aus Gras – Bewertung der Gräser zur Biogasgewinnung. Jahrestagung<br />
<strong>des</strong> Deutschen Grünlandverban<strong>des</strong>. Paaren/Glien, 30.05.<strong>2003</strong>, 7 pp. in Druck (<strong>2003</strong>)<br />
/132/ HEIERMANN, M.; PLÖCHL, M.: Pflanzliche Biomassen – ein großes Potenzial für die Biogasgewinnung. 16. Fachtagung<br />
Ackerbau- und Pflanzenbau „Ergebnisse und Ausblicke zum Pflanzenbau“. Güterfelde 12.11.<strong>2003</strong>, LVL<br />
Selbstverlag, S. 11-14 (<strong>2003</strong>)<br />
/133/ HEIERMANN, M.; PLÖCHL, M.; LINKE, B.: Mehr Biogas vom Acker. In: Landwirtschaft in den neuen Bun<strong>des</strong>ländern.<br />
neomedia, G. Poggemann (eds.), Neomedia Verlags GmbH, Reken (D), S. 21-23 (<strong>2003</strong>)<br />
/134/ HELLEBRAND, H. J.: Die Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI und der Arbeitskreis Agrartechnik im Bezirksverein<br />
Berlin-Brandenburg - Ein kurzer Rückblick. In: "Agrartechnik Tradition - Sachstand - Visionen", Hahn,<br />
J. u. Zaske, J. (Hrsg.), VDI-Verlag Düsseldorf, Fortschritt-Berichte VDI Reihe 14, Nr. 113, S. 163-166 (<strong>2003</strong>)<br />
/135/ HELLEBRAND, H. J.; BREHME, U.; BEUCHE, H.; STOLLBERG, U.; JACOBS, H.: Application of thermal imaging for cattle<br />
management. 1st European Conference on Precision Livestock Farming, Berlin/Germany June 15 to 19, <strong>2003</strong>,<br />
Programme book, Wageningen Academic Publishers <strong>2003</strong> (ISBN 9076998345), p. 761-763 (<strong>2003</strong>)<br />
/136/ HELLEBRAND, H. J.; BREHME, U.; STOLLBERG, U.; BEUCHE, H.; JACOBS, H.: Östrus- und Trächtigkeitsdiagnostik mittels<br />
Thermografie. 67. Physikertagung Hannover, 24.-28.März <strong>2003</strong>, Fachverband Umweltphysik, Verhandlungen<br />
der DPG 06/<strong>2003</strong> (ISSN 0420-0195), 184 (<strong>2003</strong>)<br />
/137/ HELLEBRAND, H. J.; DAMMER, K. H.; BEUCHE, H.; JACOBS, H.: Thermografieanwendung in der Pflanzenzustandsanalyse.<br />
67. Physikertagung Hannover, 24.-28.März <strong>2003</strong>, Fachverband Umweltphysik, Verhandlungen der<br />
DPG 06/<strong>2003</strong> (ISSN 0420-0195), 184 (<strong>2003</strong>)<br />
/138/ HELLEBRAND, H. J.; KERN, J.; SCHOLZ, V.; KAULFUSS, P.: Einfluss der Witterung auf die Lachgasemissionen und<br />
den Methanabbau sandiger Böden. 67. Physikertagung Hannover, 24.-28.März <strong>2003</strong>, Fachverband Umweltphysik,<br />
Verhandlungen der DPG 06/<strong>2003</strong> (ISSN 0420-0195), 184 (<strong>2003</strong>)<br />
/139/ HEROLD, B.; OBERBARNSCHEIDT, B.; ZUDE, M.; GEYER, M.: Zerstörungsfreie Bestimmung von Glasigkeit bei Speisezwiebeln.<br />
40. Garenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong>, BDGL-Tagungsband<br />
21 (<strong>2003</strong>), S. 188<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/140/ HEROLD, B.; OBERBARNSCHEIDT, B.; ZUDE, M.; HERPPICH, W.B.; GEYER, M.: Zustörungsfreie Bestimmung von Glasigkeit<br />
bei Speisezwiebeln. DGQ GDL XXXVIII. Vortragstagung „Die Qualität von Obst und Gemüse: Vom Rohstoff zum<br />
Produkt“ 13.-14.03.<strong>2003</strong> Geisenheim (<strong>2003</strong>), S. 40<br />
/141/ HEROLD, B.; TRUPPEL, I.: Mikroskopische 3D Oberflächenanalyse an landwirtschaftlichen Produkten. Computer-<br />
Bildanalyse in der Landwirtschaft, Bonn, 06.05.<strong>2003</strong>, Bornimer Agrartechnische Berichte Heft 34 (<strong>2003</strong>), S. 5-13<br />
/142/ HEROLD, B.; TRUPPEL, I.; HERPPICH, W.B.; GEYER, M.; KRISCHKE, G.: Elastizitätsprüfung zur Erkennung von hohlen Einlegegurken.<br />
DGQ GDL XXXVIII. Vortragstagung „Die Qualität von Obst und Gemüse: Vom Rohstoff zum Produkt“<br />
13.-14.03.<strong>2003</strong> Geisenheim (<strong>2003</strong>), S. 36-37<br />
/143/ HEROLD, B.; ZUDE, M.; HERPPICH, W.B.; LINKE, M.; GEYER, M.: Zerstörungsfreie Bestimmung der Qualität von<br />
Obst und Gemüse. Tagungsband 3. Frische-Logistik-Tagung, Krehfeld, 20.03.<strong>2003</strong>:<br />
/144/ HERPPICH, W. B.: Hat Licht Einfluss auf die Qualität von frischem, verpackten Rucola und Feldsalat? Tagungsband<br />
der 5. Frische-Logistik-Tagung, Convenence und Fertiggerichte, logistische Anforderungenund Praktiken.<br />
Rotenburg an der Fulda 27. - 28.10.<strong>2003</strong>: 43-54<br />
/145/ HERPPICH, W.B.; GOMEZ GALINDO, F.: Interactive effects of temperature and water status on the firmness of fresh radish<br />
and carrots. 40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong> BDGL-<br />
Tagungsband, 21 (<strong>2003</strong>), S. 187<br />
/146/ HERPPICH, W.B.; GOMEZ GALINDO, F.; SJÖHOLM, I.; ELIAS, L.; SMALLWOOD, M.; SOMMARIN, M.: Effects of coldacclimation<br />
on the storage potential of carrots. 40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan,<br />
26.02.-01.03.<strong>2003</strong> BDGL-Tagungsband 21 (<strong>2003</strong>), S. 37<br />
/147/ HERPPICH, W.B.; HEROLD, B.; GEYER, M.; LANDAHL, S.; DE BAERDEMAEKER, J.; FELFÖLDI, J.: Effects of water status on<br />
produce texture – an evaluation of non-<strong>des</strong>tructive methods. DGQ GDL XXXVIII. Vortragstagung „Die Qualität von<br />
Obst und Gemüse: Vom Rohstoff zum Produkt“ 13.-14.03.<strong>2003</strong> Geisenheim (<strong>2003</strong>), S. 38-39<br />
/148/ HILSCHER-TÖLZER,C.; HEROLD, B.; ZUDE, M.: Einsatz eines elektrochemischen Sensors in der Obstlagerung. 40. Gartenbauwissenschaftliche<br />
Tagung, Freising-Weihenstephan 26.02.-01.03.<strong>2003</strong>, BDGL-Tagungsband 21 (<strong>2003</strong>), S. 92<br />
/149/ HOFFMANN, T.; JACOBS, A.; POLLER, J.: Online Stärkebestimmung bei Kartoffeln. Statusseminar "High-Tech Innovationen<br />
für Verfahrensketten der Agrarproduktion", Tagungsband, Potsdam, 29.09.-30.09.<strong>2003</strong>, S. 26<br />
/150/ JAKOB, M.; GEYER, M.: Untersuchungen von Arbeitsabläufen im Gartenbau mit Hilfe der 3-D-Bewegungsanalyse. 13.<br />
Arbeitswissenschaftliches Seminar, Braunschweig, Landbauforschung Völkenrode FAL, 05.-06.03.<strong>2003</strong>, Agricultural<br />
Research Sonderheft 243 (<strong>2003</strong>), S. 41-45<br />
/151/ JAKOB, M.; GEYER, M.: Ergonomic evaluation of dynamic work processes in horticultural production systems. In:<br />
PICCAROLO, P. (eds.): XXX CIOSTA-CIGRV Congress Proceedings, Volum 3, Turin, Italy, 22.-24.09.<strong>2003</strong> Management<br />
and technology applications to empower agriculture and agro-food systems (ISBN 88-88854-09-6), p 1110-1117<br />
/152/ JAKOB, M.; GEYER, M.; IVANOV, V.: Ergonomische Bewertung von Arbeitsplätzen im dynamischen Arbeitsprozess. 40.<br />
Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong> BDGL-Tagungsband 21 (<strong>2003</strong>), S.<br />
30<br />
/153/ JAKOB, M.; GEYER, M.; BOKELMANN, W.: 3-D-motion analysis as a tool for objective ergonomic evaluation of dynamic<br />
horticultural work processes. Proceedings of the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association,<br />
Seoul, Korea, <strong>2003</strong><br />
/154/ KALK, W.-D.; BIERMANN, S.; HÜLSBERGEN, K.-J.: Analyse und Bewertung der Landnutzungsintensität mit Indikatoren<br />
zum Stoff- und Energiehaushalt landwirtschaftlicher Betriebe. In: FLADE, M.; PLACHTER, H.; HENNE, E. UND<br />
ANDERS, K. (eds.): Naturschutz in der Agrarlandschaft – Ergebnisse der Schorfheide-Chorin-Projektes. Quelle<br />
und Meyer (ISBN 3-494-01307-1), Wiebelsheim, S. 178-186 (<strong>2003</strong>)<br />
/155/ KALK, W.-D.; BRUNSCH, R.: Untersuchung zum Nährstoffaustrag auf Sandböden im Freiland-Winterquartier von Mutterkühen.<br />
In: 6. Internationale Tagung "Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung", Vechta,<br />
25.-27.03.<strong>2003</strong>, Tagungsband KTBL (ISBN 3-7843-2151-8) S. 103-108<br />
/156/ KALK, W.-D.; SCHLAUDERER, R.; VÖLKER, U.; EHLERT, D.: Ecological and economic assessment of sensor-based<br />
site-specific nitrogen fertilisation. In: Programme book of the joint conference of ECPA –ECPLF. Wageningen<br />
Academic Publischers (ISBN 9076998345), p. 453-454, Berlin, <strong>2003</strong><br />
/157/ KOVÁCS, L.-BORSA,B.- JAKOVÁC,F.-OBERBARNSCHEIDT, B.-HEROLD,B.: Egy ipari paradicsom érésfolyamata<br />
érésgyorsító hatására. (Der Reifeprozess einer Industrietomate mit der Behandlung von Ethrel) XXVII.Kutatási<br />
és Fejlesztési Tanácskozás, 21.-22.01.<strong>2003</strong>, Gödöllő Ungarn, 2.kötet.p.143-7<br />
/158/ KRAUSE, K.-H.; MÜLLER, H.-J.; LINKE, S.: Odour and Ammonia Emissions from different Livestock Buildings and the<br />
Dispersion of these Emissions in the Surroundings. Proceedings "International Symposium on Gaseous and Odour<br />
Emissions from Animal Production Facilities". Horsens (DK), 1.-4. Juni <strong>2003</strong>, (ISBN 87-88976-66-1), p. 368-377<br />
127<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
128<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/159/ LINKE, B.: Grundlagen und Verfahren der Biogasgewinnung. Naturstoff Innovationsnetzwerk Altmark e.V.: Biomasse-Allianz-Altmark,<br />
1. Biomassetag Altmark, Gardelegen, 6. Oktober <strong>2003</strong> (im Druck)<br />
/160/ LINKE, B.; HEIERMANN, M.; GRUNDMANN, P.; HERTWIG, F.: Grundlagen, Verfahren und Potenzial der Biogasgewinnung<br />
im Land Brandenburg. In: Biogas in der Landwirtschaft - Leitfaden für Landwirte und Investoren im Land<br />
Brandenburg. Herausgeber: Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg,<br />
Potsdam, S. 10-23, <strong>2003</strong><br />
/161/ LINKE, B.; GRUNDMANN, P; HEIERMANN, M.; HERTWIG, F.: Grundlagen, Verfahren und Potenzial der Biogasgewinnung<br />
im Land Brandenburg. In: Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong><br />
Brandenburg, Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Biogas in der Landwirtschaft. Potsdam, Mai <strong>2003</strong>, S.<br />
10–23 (<strong>2003</strong>)<br />
/162/ LINKE, M.: Frische und Qualitätserhaltung nach der Ernte: Maßnahmen und technische Lösungen. Ökologischer Gemüsebau<br />
– Vom Feld bis zur Ladentheke -, HU Berlin, 20.11.<strong>2003</strong>, Arbeitsmappe, 3 Seiten<br />
/163/ LINKE, M.; KLÄRING, H.-P.: Effects of different pre-harvest conditions on the postharvest keeping quality of tomatoes.<br />
International Workshop on Models for Plant Growth and Control of Product Quality - Abstracts, 24-28.08.<strong>2003</strong>, Potsdam,<br />
S. 32<br />
/164/ LINKE, M.; OBERBARNSCHEIDT, B.; HEROLD, B.; BORSA, B.; KOVACS, L.: Nachernteverhalten von ungarischem Paprika<br />
– Veränderung von Produkteigenschaften in verschiedenen Verpackungen. XXVII. Kutatási és Fejlesztési<br />
Tanácskozás, 21.-22.01.<strong>2003</strong>, Gödöllő Ungarn, 2.kötet: 4 Seiten<br />
/165/ MÄHNERT, P.; HEIERMANN, M.; LINKE, B.: Grasvergärung im Batch- und semikontinuierlichen Ansatz. In: Biogas für alle<br />
- eine Stadt-Land-Partnerschaft, 2. Biogaskonferenz am 17./18. November <strong>2003</strong>, Postdam, eco Naturgas Handels<br />
GmbH, Potsdam, S. 154-162<br />
/166/ MEIERHÖFER, J.; PROCHNOW, A.: Bewertung von Maßnahmen der Faunaschonung bei der Grünlandbearbeitung<br />
in einem Beispielsbetrieb. In: Tagung Landtechnik <strong>2003</strong>, VDI-Berichte 1798, VDI Verlag, Düsseldorf, S. 87-94<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/167/ MELLMANN, J.; FÜRLL, C.: Körnerkonservierung. In: Matthies, H.J.; Meier, F. (Hrsg.): Jahrbuch Agrartechnik,<br />
Band 15, VDMA Landtechnik/VDI-MEG/KTBL, <strong>2003</strong>, S. 155-158<br />
/168/ MÉSZÁROS, CS, J. BUZÁS, Á. BÁLINT, GOTTSCHALK, K. FARKAS, I.: Surface changes of the temperature and moisture<br />
level at coupled transport processes through porous media according to the wave approach of the irreversible<br />
thermodynamics. (Proceeding). 3rd Research and Development Conference of Central- and Eastern European<br />
Institutes of Agricultural Engineering" CEEAgeng)" Gödöllő, 11th and 13th September <strong>2003</strong>.<br />
/169/ MILLER, W.M.; ZUDE, M.: Non-<strong>des</strong>tructive brix sensing of Florida grapefruit and honey tangerine. Proc. Fla. State<br />
hort. Soc. 115: 56-60 (<strong>2003</strong>)<br />
/170/ MODEL, N.; MELLMANN, J.; MALTRY, W.: Mathematisches Modell <strong>des</strong> Getreidetrocknungsprozesses als Grundlage<br />
einer modell-basierten Automatisierungslösung. In: Tagungsband (38 Seiten) zum Statusseminar „High-Tech<br />
Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion“, Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong>, Seite 27-32<br />
/171/ MODEL, N.; MELLMANN, J.; MALTRY, W.: Mathematical modelling of mixed-flow grain drying. In: Proceedings of the<br />
3 rd CEE AgEng Research and Develop. Conf. of Central and Eastern Europ. Inst. Ag. Eng., Gödöllö, 11-13 Sept.<br />
<strong>2003</strong>, Hungary; pp. 113-117.<br />
/172/ MÜLLER, H.-J.: Geruchs- und Ammoniakemissionen aus der Schweine- und Geflügelhaltung. Tagungsband der 6.<br />
Tagung "Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung", Vechta, 25.-27.03.<strong>2003</strong>, (ISBN 3-<br />
7843-2151-8), S. 469-472<br />
/173/ MÜLLER, H.-J.; BRUNSCH, R.; HÖRNIG, G.; JELÍNEK, A.: Odour and Ammonia Emissions from Poultry Houses with different<br />
Keeping and Ventilation Systems. Proceedings "International Symposium on Gaseous and Odour Emissions from<br />
Animal Production Facilities". Horsens (DK), 1.-4. Juni <strong>2003</strong>, (ISBN 87-88976-66-1), p. 172-179<br />
/174/ MÜLLER, H.-J.; KRAUSE, K.-H.: New Ventilation Systems for Livestock Buildings. The 4 th International Symposium on<br />
HVAC. Beijing (China), 9.-11. Oktober <strong>2003</strong>, Volume I, (ISBN 7-302-07326-0), p. 93-100<br />
/175/ MÜLLER, M.; HOFFMANN, T.: Verbesserte Ernte- und Konservierungsmethoden von Getreide. In. Flade, M.; Plachter,<br />
H.; Henne, E.; Anders, K.: Naturschutz in der Agrarlandschaft. Quelle & Meyer Verlag Wiebelsheim, <strong>2003</strong>,<br />
S. 316<br />
/176/ MUNDER, F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: In ASAE: Results of an advanced decortication technology for hemp, flax<br />
and linseed: ICCHP, Louisville, Iowa, Feb. <strong>2003</strong>, p. 4<br />
/177/ MUNDER, F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: In USDA Forest Service and Forest Products Laboratory: Results of the Advanced<br />
Technology for Processing of Natural Fiber Plants for Industrial Application: Proceedings of 7 th Intern.<br />
Conference on Woodfibre.Plastics and other natural Fibers, Madison / Wisconsin, May <strong>2003</strong>. p. 11<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/178/ MUNDER, F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: In ICFPAM: Advanced Decortication Technology for Bast fibres and Coir:<br />
Proceedings of the 7 th ICFPAM- Conference of the FAO, Bucarest, Romania, June <strong>2003</strong>, p. 248<br />
/179/ MUNDER, F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: In EurAgEng: Advanced Technology for Processing of Natural Fiber Plants<br />
for Industrial Application: Proceedings of the Lithuaniae Academia Scientiarum of Int. Conference on New Methods,<br />
Means and Technologies for Application of Agricultural Products, Kaunas, Lituanian, 18-19 Sep <strong>2003</strong>, p.<br />
81-92<br />
/180/ MUNDER, F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: In: Royal Veterinary and Agricultural University of Denmark: Results of an advanced<br />
decortication technology for bast fibres: Proceedingd of the Intern. Nordic Biofibre Conference, Nov. <strong>2003</strong>,<br />
p. 6<br />
/181/ MUNDER, F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: In NRC, El Hariri: Advanced Technology for Decortication of Flax and other<br />
Bast Fibre plants: Processing of Bast fibre and Coir; Proceedings of the Intern. Conference of the FAO on Flax<br />
and Allied Fiber Plants for Human Welfare, Cairo, Egypt, Dec <strong>2003</strong>, p. 21<br />
/182/ PAZSICZKI, I.; BERG, W.: Studying Methods of Reduction the Gas Emission in the Framework of the German-<br />
Hungarian Joint Research. 3 rd Research and Development Conference of Central- and Eastern European Institutes<br />
of Agricultural Engineering. Gödöllö. Hungary. 11.–13.September <strong>2003</strong>, p. 161–166 (<strong>2003</strong>)<br />
/183/ PLÖCHL, M.: Technische Nutzung von Biogas. Biogas in der Landwirtschaft - Leitfaden für Landwirte und Investoren<br />
im Land Brandenburg, 2. überarbeitete Auflage. M. HEIERMANN and M. PLÖCHL. Potsdam, Ministerium für<br />
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg, S. 24-28 (<strong>2003</strong>)<br />
/184/ PLÖCHL, M.; SCHULZ, M.: Ökologische Bewertung der Biogaserzeugung und -nutzung. Biogas in der Landwirtschaft<br />
- Leitfaden für Landwirte und Investoren im Land Brandenburg, 2. überarbeitete Auflage. M. HEIERMANN<br />
and M. PLÖCHL. Potsdam, Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg,<br />
S. 40-43 (<strong>2003</strong>)<br />
/185/ PLÖCHL, M.: Modellierung der Ammoniakemissionen aus der Gülleausbringung mit dem Ziel der Verfahrensoptimierung<br />
- Modeling of ammonia emissions from slurry application with the aim to optimise the process. 6. Tagung:<br />
Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung <strong>2003</strong>. Kuratorium für Technik und<br />
Bau in der Landwirtschaft e. V. (KTBL). Münster-Hiltrup, KTBL-Schriften-Vertrieb im Landwirtschaftsverlag<br />
GmbH, S. 477-480 (<strong>2003</strong>)<br />
/186/ PLÖCHL, M.: The interaction of climate change, technological development and land use patterns. Transition in<br />
Agriculture and Future Land Use Patterns, Wageningen (NL), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,<br />
6 p. (<strong>2003</strong>)<br />
/187/ PLÖCHL, M.; ZIMMERMANN, H.: Optimisation of the water use efficiency of large-scale irrigation using fuzzy logic<br />
modelling and remote sensing. Management and technology applications to empower agriculture and agro-food<br />
systems- XXX Ciosta-CIGR V Congress Proceedings. P. Piccarolo. Turin (Italy), D.E.I.A.F.A. Universita degli<br />
Studi di Torino, p. 1202-1209 (<strong>2003</strong>)<br />
/188/ PLÖCHL, M.; ZIMMERMANN, H.; LUCKHAUS, C.: Improving data acquisition of soil and plant monitoring devices<br />
through soil heterogeneity scanning. Congreso Internacional de Riego y Drenaje CubaRiego <strong>2003</strong>. A. R. Rey<br />
Garcia. La Habana (Cuba), IIRD, 8 p. (<strong>2003</strong>)<br />
/189/ PROCHNOW, A.; SCHLAUDERER, R.: Ökonomische Bewertung von Verfahren <strong>des</strong> Offenlandmanagements auf<br />
Truppenübungsplätzen. In: Bornimer Agrartechnische Berichte Heft 33, S. 7-19 (<strong>2003</strong>)<br />
/190/ PROCHNOW, J.; DAMMER, K.-H.: Pflanzenschutz. In: Zukunftsträchtiger Ackerbau-Systeme der computer- und<br />
GPS-gestützten teilflächenspezifischen Bewirtschaftung praxisnah bewertet. 1. Auflage, <strong>2003</strong>. Deutscher Bauernverlag<br />
GmbH (ISBN 3-9809218-0-8), Berlin: S. 111-129, <strong>2003</strong><br />
/191/ ROHRBACH, A.; GEYER, M.; HEROLD, B.; ZUDE, M.: Spektralanalyse zur Bestimmung <strong>des</strong> optimalen Erntetermins. 40.<br />
Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong> BDGL-Tagungsband 21 (<strong>2003</strong>), S.<br />
107<br />
/192/ ROSE, SANDRA; BRUNSCH, R.: Kraftübertragung vom Melkzeug auf die Zitze. Dokumentation Statusseminar <strong>2003</strong>,<br />
High-Tech Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion, Potsdam, <strong>2003</strong>, im Druck<br />
/193/ SCHLAUDERER, R., PROCHNOW, A. HARNISCH, R, MÄHNERT, P. OEHLSCHLAEGER, S.: Ansätze für eine gesamtheitliche<br />
Bewertung <strong>des</strong> Offenlandmanagements auf ehemaligen Truppenübungsplätzen – anhand <strong>des</strong> Fallbeispiels<br />
Döberitzer Heide. VDI-MEG Tagung Landtechnik in Hannover. Proceedings. VDI-Verlag, Düsseldorf, S. 95-100<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/194/ SCHLAUDERER, R.: Finanzierungsmodelle für Großmaschinen. In: Conference “Agricultural Engineering for Professionals”.<br />
Tagung Magdeburg. VDI-Bericht Düsseldorf, 29. Januar <strong>2003</strong><br />
129<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
130<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/195/ SCHLAUDERER, R.; PROCHNOW, A.; HARNISCH, R.; MÄHNERT, P.; OEHLSCHLAEGER, S.: Ansätze für eine gesamtheitliche<br />
Bewertung <strong>des</strong> Offenlandmanagements auf ehemaligen Truppenübungsplätzen – anhand <strong>des</strong> Fallbeispiels<br />
Döberitzer Heide. VDI-MEG Tagung Landtechnik in Hannover. Proceedings. VDI-Verlag, Düsseldorf, S. 95-100<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/196/ SCHOLZ, V.; HELLEBRAND, H. J.: Clean energy from farmland - Long-term results of practically oriented field trials.<br />
In: ed. by ZENG, G.; HUANG, G.; YANG, Z.; JIANG, Y.; LIU, H.; CATANIA, P.; "Energy & Environment", Proceedings<br />
of the EnerEnv'<strong>2003</strong> Conference, October 11-14, <strong>2003</strong>, Changsha, China; Science Press Beijing - New York, p.<br />
445-450 (<strong>2003</strong>)<br />
/197/ SCHOLZ, V.; HELLEBRAND, H. J.: Ökologische Vorzüge <strong>des</strong> Anbaus schnellwachsender Baumarten. Symposium<br />
"Holz vom Feld für die energetische und stoffliche Nutzung", Facharbeitskreis Biomasse der Sächsischen Lan<strong>des</strong>anstalt<br />
für Landwirtschaft, Tagungsband, Köllitsch, 12. Juni <strong>2003</strong><br />
/198/ SCHOLZ, V.; HELLEBRAND, H.J.: Clean energy from farmland - Long-term results of practically oriented field trials.<br />
In: Proceedings of "1st Internat. Conference on Energy and Environment EnerEnv", Changsha, China, Science<br />
Press Beijing - New York, Oct. 11-14, <strong>2003</strong>, p. 445-450<br />
/199/ SCHOLZ, V.; HELLEBRAND, H.J.; HÖHN, A.: Umweltverträgliche Energie- und Industriepflanzenproduktion. In: Tagungsband<br />
zum 9. Internat. Kongress für "Nachwachsende Rohstoffe und Pflanzenbiotechnologie", Magdeburg,<br />
16.-17.06.<strong>2003</strong>; 11 S.<br />
/200/ SCHUMANN, D.; MILLER, H.; JÜRSCHIK, P.; SCHWARZ, J.; KERSEBAUM, H.C.; REUTER, H.I.; GIEBEL, A.; WENDROTH,<br />
O.: MOSAIC - On-farm-monitoring, geo-spatial-analysis, and deterministic geo-referenced modelling as an approach<br />
for spatial crop yield variability and site-specific management decisions. In: Precision Agriculture, edit. by<br />
A. Werner and A. Jarfe, Wageningen Academics Publishers (NL-ISBN 9076998345), Berlin, <strong>2003</strong>, pp. 567-568<br />
/201/ SCHWARZ, J.; KERSEBAUM, K.C.; REUTER, H.I.; WENDROTH, O.: Three years results with site-specific nitrogen fertilisation.<br />
In: Precision Agriculture, Wageningen Academics Publishers (NL-ISBN 9076998345), pp. 305, Berlin,<br />
<strong>2003</strong><br />
/202/ SERES, I.; FARKAS, I.; KOCSIS, L. GOTTSCHALK, K.: Development of a low range sensor for the use of natural air<br />
flow measurement. (Proceeding). 3rd Research and Development Conference of Central- and Eastern European<br />
Institutes of Agricultural Engineering" CEEAgeng)" Gödöllő, 11.-13.09.<strong>2003</strong>.<br />
/203/ TRUPPEL, I.: Tragbares funkangekoppeltes Minispektrometer. Computer-Bildanalyse in der Landwirtschaft, Bonn,<br />
06.05.<strong>2003</strong>, Bornimer Agrartechnische Berichte Heft 34 (<strong>2003</strong>), S. 56-69<br />
/204/ TRUPPEL, I.; HEROLD, B.; ZUDE, M.; GEYER, M.: Bestimmung der Apfelreifeentwicklung mit Telemetrie-<br />
Spektralfotometer. 40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong> BDGL-<br />
Tagungsband 21 (<strong>2003</strong>), S. 108<br />
/205/ VOSS, M.; OVER, B.; WIELAND, R.: Integration externer Modelle in das Modell “Klärschlammkataster”. In: GNAUCK, A.<br />
(ed.): Theorie und Modellierung von Ökosystemen. Workshop Kölpinsee 2001, Shaker Verlag (ISBN 3-8322-1316-3),<br />
Aachen, S. 201-211 (<strong>2003</strong>)<br />
/206/ WERNER, A.; ROTH, R.; KÜHN, J.; VOßHENRICH, H.-H.; SOMMER, C.; WENKEL, S.; BROZIO, S.; GEBBERS, R.; DAMMER,<br />
K.-H.; EHLERT, D.: Integrated management of soil and crop in precision agriculture. In: Precision Agriculture,<br />
edit. by A. Werner and A. Jarfe, Wageningen Academics Publishers (NL-ISBN 9076998345), Berlin, <strong>2003</strong>, pp.<br />
823-824<br />
/207/ ZIMMERMANN, H.; PLÖCHL, M.: Einfache und robuste Modellierung der Evapotranspiration mittels Fuzzy-Logik<br />
zum Einsatz in der landwirtschaftlichen Praxis. Tharandter Klimaprotokolle – Band 9: Bernhofer und Goldberg,<br />
Hrsg. Eigenverlag der technischen Universität Dresden, Dresden, 120-122 (<strong>2003</strong>)<br />
3.4 Wissenschaftliche Elektronische Veröffentlichungen<br />
/208/ BRÜCKNER, R.; VERHÜLSDONK, B.; TÜRK, M.; ZENKE, TH.: Calculating characteristic curves of helical toothed rotary<br />
lobe pumps considering wear (Kurzfassung). www.landtechnik-net.de Landtechnik 58 (5) 304-305 (<strong>2003</strong>)<br />
/209/ BRÜCKNER, R.; VERHÜLSDONK, B.; TÜRK, M.; ZENKE, TH.: Calculation of characteristic curves of celical toothed rotary<br />
lobe pumps considering wear (Langfassung). www.landtechnik-net.de Agrartechnische Forschung 9<br />
(<strong>2003</strong>) H. 5, S. E 80-E 85<br />
/210/ BRUNSCH, R.; HÖRNIG, G.: Emission from broiler fattening. www.landtechnik-net.de Landtechnik 58 (1) 36-37<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/211/ BRUNSCH, R.; SCHOLZ, V.: Individual water intake of cattle at photovoltaic pasture drinkers. www.landtechniknet.de<br />
Landtechnik 58 (6) 396-397 (<strong>2003</strong>)<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/212/ FÜRLL, C.; MUNDER, F.; HEMPEL, H.: Ergebnisse aus der Erprobung einer Pilotanlage zum Faseraufschluss. Tagungsband<br />
(CD),Innovationsforum „Internationales strategisches Netzwerk für die Agrarfaserpflanzennutzung“, Cottbus,<br />
13.-14.05.<strong>2003</strong><br />
/213/ GRUNDMANN, P.: Economic assessment of measures to improve biogas plant competitiveness (Kurzfassung).<br />
www.landtechnik-net.de Landtechnik 58 (5) 314-315 (<strong>2003</strong>)<br />
/214/ GRUNDMANN, P.: Assessment of the cost-reduction potential of different technology improvements for a competitive<br />
biogas production (Langfassung). www.landtechnik-net.de Agrartechnische Forschung 9 (<strong>2003</strong>) H. 5, S. E<br />
86-E 89<br />
/215/ GUSOVIUS, H.-J., PECENKA, R., FÜRLL, C.: Results of the test-run of the fibre-extraction pilot plant of the Institute<br />
of Agricultural Engineering Bornim as well as thoughts for an European project for a related qualitymanagement-system<br />
and corresponding test procedures. CD-ROM, First International Conference of the European<br />
Industrial Hemp Association (EIHA) <strong>2003</strong>, Hürth 23.-24.10.<strong>2003</strong><br />
/216/ Linke, B.: Biogas from energy crops (Kurzfassung). www.landtechnik-net.de Landtechnik 58 (5) 316-317 (<strong>2003</strong>)<br />
/217/ LINKE, B.: Biogas from energy crops (Langfassung). www.landtechnik-net.de Agrartechnische Forschung 9<br />
(<strong>2003</strong>) H. 5, S. E 75-E 79<br />
/218/ MUNDER, F.: CD of the INF Poznan/NRC: Advanced technology for decortication of flax and other bast fibre<br />
plants: Processing of bast fibre and coir; proceedings of the intern. Conference of the FAO on flay and allied fiber<br />
plants for human welfare,Cairo, Egypt, Dec <strong>2003</strong>,<br />
/219/ TÜRK, M.; ZENKE, TH.; VERHÜLSDONK, B.; BRÜCKNER, R.: Influence of mechanical wear on the pumping behaviour<br />
of rotary lobe pumps (Kurzfassung). www.landtechnik-net.de Landtechnik 58 (<strong>2003</strong>) Heft 3, S. 210-211 und<br />
/220/ TÜRK, M.; ZENKE, TH.; VERHÜLSDONK, B.; BRÜCKNER, R.: Influence of abrasive wear on pump behaviour of rotary<br />
lobe pumps (Langfassung). www.landtechnik-net.de Agrartechnische Forschung 9 (<strong>2003</strong>) H. 3, S. E 31-E 36<br />
/221/ WORMANNS, G. HOFFMANN, T.: Möglichkeiten und Grenzen einer objektiven Kochtypbestimmung bei Speisekartoffeln.<br />
25. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Kartoffelforschung e.V., Detmold, 14.-15.05.<strong>2003</strong>,<br />
http://www.agfdt.de/ie/index.htm<br />
/222/ ZASKE, J.: Mechanization and traceability of agricultural production: a challenge für the future. System integration<br />
and certification. The market demand for clarity and transparency – Part1“. CIGR electronic journal, Club of<br />
Bologna. Nov 16, 2002. Vol. V. February <strong>2003</strong> http://cigr-ejournal.tamu.edu/Volume5.html<br />
3.5 Wissenschaftliche Vorträge<br />
/223/ BECKMANN, F.; SCHOLZ, V.: Test einer Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle für Biogas. Vortrag auf 2.<br />
Potsdamer Biogaskonferenz "Biogas für alle - eine Stadt-Land-Partnerschaft", Potsdam, 17.-18.11.<strong>2003</strong><br />
/224/ BERG, W.: Emissionsminderung durch die Kombination von Abdeckung und Absenkung <strong>des</strong> pH-Wertes von Gülle.<br />
Emission Reduction by a Combination of Covering and Acidifying Slurry. 6. Tagung „Bau, Technik und Umwelt<br />
in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung <strong>2003</strong>“. Vechta, 25.–27.03.<strong>2003</strong><br />
/225/ BERG, W.: Reducing Ammonia Emissions by Combining Covering and Acidifying Liquid Manure. 3 rd International<br />
Conference on Air Pollution from Agricultural Operations. Raleigh. NC. USA, 12.–15.10.<strong>2003</strong><br />
/226/ BERG, W.; BRUNSCH, R.; EURICH-MENDEN, B.; DÖHLER, H.; DÄMMGEN, U.; OSTERBURG, B.; BERGSCHMIDT, A.: Ammonia<br />
Emissions from German Animal Husbandry. 3 rd International Conference on Air Pollution from Agricultural<br />
Operations. Raleigh. NC. USA, 12.–15.10.<strong>2003</strong><br />
/227/ BÖTTGER, H.; LANGNER, H.-R.: Erfahrungsbericht zur bildgestützten Unkrauterkennung mit einer 3-Chip-CCD-<br />
Kamera. Workshop- Anwendung der Computer-Bild-Analyse in der Landwirtschaft, Uni Bonn, 06.05.<strong>2003</strong><br />
/228/ BREHME, U.; AHLERS, D.; BEUCHE, H.; HASSELER, W.; STOLLBERG, U.: Infrarotthermographie eine nicht-invasive, tiergerechte<br />
Diagnostikmethode zur Brunsterkennung bei Milchkühen. 8. Internationale Fachtagung zum Thema<br />
Tierschutz, Nürtingen, 20./21.02.<strong>2003</strong><br />
/229/ BREHME, U.; AHLERS, D.; BEUCHE, H.; HASSELER, W.; STOLLBERG, U.: Is there a possibility of clinical application of infrared-thermography<br />
for diagnostics in oestrus detection in dairy cows? ECPA/ECPLF, Berlin, 15.-19.06.<strong>2003</strong><br />
/230/ BREHME, U.; AHLERS, D.; BEUCHE, H.; HASSELER, W.; STOLLBERG, U.: Is there a possibility of clinical application of infrared-thermography<br />
for diagnostics in oestrus detection in dairy cows? 3 rd Research and Development Conference<br />
of Central- and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering, Hungarian Institute of Agricultural<br />
Engineering Gödöllö (H), 11.-13.09.<strong>2003</strong><br />
/231/ BREHME, U.; AHLERS, D.; BEUCHE, H.; HASSELER, W.; STOLLBERG, U.: Infrared-thermography for diagnostics in oestrus<br />
detection in dairy cows. XXX CIOSTA-CIGR V Conference Management and technology applications to<br />
empower agriculture and agro-food systems, Turin, Grugliasco (I), 22.-24.09.<strong>2003</strong><br />
131<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
132<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/232/ BRUNSCH, R.: Verfahrenstechnische Beiträge zur Integration von Tier- und Umweltschutzzielen. Statusseminar<br />
Ressortforschung für den ökologischen Landbau, Braunschweig, 13.03.<strong>2003</strong>, Landbauforschung Völkenrode<br />
/233/ BRUNSCH, R.: A new concept to control the indoor climate of broiler houses. 1. European Conference of Precision<br />
Livestock Farming (ECPLF), 16.-18. Juni <strong>2003</strong>, Berlin<br />
/234/ BRUNSCH, R.; BREHME, U.; STOLLBERG, U.; HELLEBRAND, H. J.; BEUCHE, H.; JAKOBS, H.: Thermografie zur Gesundheits-,<br />
Trächtigkeits- und Östruskontrolle bei Rindern. DLG-Ausschusssitzung "Technik in der tierischen Produktion",<br />
Groß Umstadt, 11.-12.03.<strong>2003</strong><br />
/235/ BRUNSCH, R.; HÖRNIG, G.: Zur Variation der Emissionen aus der Broilermast. 6. Internationale Tagung "Bau,<br />
Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung", Vechta, 25.-27. März <strong>2003</strong><br />
/236/ BRUNSCH, R.; MÜLLER, H.-J.: Investigations of Odour and Gaseous Emissions from an Experimental Chicken House.<br />
"International Symposium on Gaseous and Odour Emissions from Animal Production Facilities". Horsens (DK), 1.-4.<br />
Juni <strong>2003</strong><br />
/237/ BRUNSCH, R.; MÜLLER, H.-J.: Geruchs- und Ammoniakemissionen aus Geflügelställen. Jahrestagung "Förderkreis<br />
Stallklima", Göttingen, 30.9.-1.10.<strong>2003</strong><br />
/238/ BRUNSCH, R.; SCHLAUDERER, R.; ZASKE, J.: Leistungen moderner Agrartechnik zur globalen Ernährungssicherung.<br />
Statusseminar Welternährung, Braunschweig, 21.11.<strong>2003</strong>, Landbauforschung Völkenrode<br />
/239/ BRUNSCH, R.; ZASKE, J.: High Tech und Nachhaltigkeit – ein Widerspruch? Workshop "Not- und Hilfsbüchlein für<br />
Optimum einer zukunftsorientierten Nutzung ländlicher Räume", Berlin, 3.-4.11.<strong>2003</strong><br />
/240/ DAMMER, K.-H.; BÖTTGER, H.; EHLERT, D.: Sensor-controlled variable rate real-time application of herbici<strong>des</strong> and<br />
fungici<strong>des</strong>. 4 th European Conference of Precision Agriculture, Berlin, 16.-18.06.<strong>2003</strong><br />
/241/ DAMMER, K.-H.; EHLERT, D.: Sensor for a variable rate application of herbici<strong>des</strong> and fungici<strong>des</strong>. Nordic Association<br />
of Agricultural Scientists 22 nd Congress, Turku, Finnland, 01.-04.07.<strong>2003</strong><br />
/242/ DOMSCH, H.; KAISER, T.: Generating field-scale soil maps based on surveying soil electrical conductivity. Nordic<br />
Association of Agricultural Scientists 22 nd Congress, Turku, Finnland, 01.-04.07.<strong>2003</strong><br />
/243/ DOMSCH, H.; KAISER, T.; WITZKE, K.; SACHSE, H.: Kann die elektrische Bodenleitfähigkeit eine gezielte Bodenprobenentnahme<br />
unterstützen? Tagung Landtechnik <strong>2003</strong>, Hannover, 07.- 08.11. <strong>2003</strong><br />
/244/ DOMSCH, H.; KAISER, T.; WITZKE, K.; ZAUER, O.: Empirical methods to detect management zones with respect to<br />
yield. 4 th European Conference of Precision Agriculture, Berlin, 16.-18. 06. <strong>2003</strong><br />
/245/ DUMDEI, K.; KUHRMANN, D.: Möglichkeiten zur Verlängerung der Haltbarkeit von Ökoprodukten im Einzelhandel<br />
und bei der Direktvermarktung. Ökologischer Gemüsebau - vom Feld bis zur Ladentheke, Berlin, 20.11.<strong>2003</strong><br />
/246/ EHLERT, D.: Entwicklung und Evaluierung eines Sensors für die Pflanzenmasseerfassung zur Ertragskartierung<br />
sowie zur teilflächenspezifischen Bestan<strong>des</strong>führung. Statusseminar „HighTech-Innovationen für Verfahrensketten<br />
der Agrarproduktion“, Potsdam, 29.-30. 09. <strong>2003</strong><br />
/247/ EHLERT, D.; ADAMEK, R.: Throughput measurement in forage harvesters. 31. Symposium “Actual Tasks on Agricultural<br />
Engineering”, Opatija, Croatia, 24.-28.02.<strong>2003</strong><br />
/248/ EHLERT, D.; KRAATZ, S.; HORN, H.-J.: Improvement of the pendulum-meter for measuring crop biomass. 4 th<br />
European Conference of Precision Agriculture. Berlin, 16.-18. 06. <strong>2003</strong><br />
/249/ EL SAEIDY, E.: Energetische Nutzung von landwirtschaftlichen Reststoffen. Vortrag auf Doktorandenseminar der<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, 23.01.03<br />
/250/ EL SAEIDY, E.: Nutzung von Ackerreststoffen als Energiequelle. Vortrag auf Kolloquium <strong>des</strong> Instituts für Pflanzenbauwissenschaften<br />
der Humboldt-Universität zu Berlin, 20.11.<strong>2003</strong><br />
/251/ EL SAEIDY, E.; SCHOLZ, V.; HAHN, J.: Energetic use of crop residues considering especially cotton stalks. Vortrag<br />
auf Internat. Conference "New methods, means, and technologies for applications of agricultural products" Raudondvaris/Lithuania,<br />
18.-19.09.<strong>2003</strong><br />
/252/ FÜRLL, C.; MUNDER, F.; HEMPEL, H.: Untersuchungsergebnisse zur Erprobung der Faseraufschluss-Pilotanlage <strong>des</strong><br />
Instituts für Agrartechnik Bornim. 4. Internationales Symposium „Werkstoffe aus Nachwachsenden Rohstoffen“, Erfurt,<br />
11.-12.09.<strong>2003</strong><br />
/253/ FÜRLL, C. MUNDER, F. HEMPEL, H.: Ergebnisse aus der Erprobung einer Pilotanlage zum Faseraufschluss. Innovationsforum<br />
„Internationales strategisches Netzwerk für die Agrarfaserpflanzennutzung“, Cottbus, 13.-14.05.<strong>2003</strong><br />
/254/ GEYER, M.; HEROLD, B.; HERPPICH, W.B.; ZUDE, M.; WIESNER, K.; WULF, J.S.; KALINOW, K.; FEKETE, A.; FELFÖLDI,<br />
J.; BARANYAI, L.; SZEPES, A.; MUHA, V.; BALLA, C.; ZSOM, T.; OLASZ, A.: Technical adaptation of quality monitoring<br />
methods of sweet pepper (paprika) and bulb onion. Anniversary of SziE University, Budapest, Ungarn, 05.-<br />
07.11.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/255/ GEYER, M.; LINKE, M.: Der Einfluss von Transportverpackungen auf die Haltbarkeit von Gemüse in der Nachernte.<br />
40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02. – 01.03.<strong>2003</strong><br />
/256/ GEYER, M.; TISCHER, S.; JAKOB, M.: Harvesting aids for white asparagus. XXX CIOSTA – CIGR V Conference,<br />
Turin, Italy 22. – 24.09.<strong>2003</strong><br />
/257/ GOTTSCHALK, K.: Simulation <strong>des</strong> Lagerklimaverlaufs bei der Kühlung und Lagerung von Kartoffeln und Obst. 5.<br />
Frische-Logistik-Tagung, Rotenburg a.d. Fulda, 27.-28.10. <strong>2003</strong>.<br />
/258/ GOTTSCHALK, K; HELLEBRAND, H.J.; SCHLAUDERER, R; GEYER, S.: “Anwendung der Thermographie zur Optimierung<br />
der Belüftungssteuerung bei der Lagerhaltung ldw. Produkte“, Statusseminar <strong>2003</strong> High Tech Innovationen<br />
für Verfahrensketten der Agrarproduktion, IHK Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/259/ GRUNDMANN, P.: Comparative assessment of the potentials of cost reduction strategies in biogas production. EurAgEng,<br />
Raundondvaris, 18.-19.09.<strong>2003</strong><br />
/260/ GRUNDMANN, P.: Zur Ökonomie von Biogas. 2. Potsdamer BiogasKonferenz. Potsdam, 17.-18.11.<strong>2003</strong><br />
/261/ GRUNDMANN, P.: Zur Wirtschaftlichkeit von Innovationen für eine wettbewerbsfähige Biogaswirtschaft. Zwölftes<br />
Symposium „Energie aus Biomasse“ – Biogas, Flüssigkraftstoffe, Festbrennstoffe. Bad Staffelstein, 20.-<br />
21.11.<strong>2003</strong><br />
/262/ GRUNDMANN, P.: Optimierungspotenziale bei der Biogasgewinnung aus wirtschaftlicher Sicht, Lan<strong>des</strong>anstalt für<br />
Verbraucherschutz und Landwirtschaft, Referat Acker- und Pflanzenbau, Brandenburg. 16. Fachtagung Acker-<br />
und Pflanzenbau „Ergebnisse und Ausblicke zum Pflanzenbau“. Güterfelde, Brandenburg, 13.11.<strong>2003</strong><br />
/263/ HASSENBERG, K.; MOLLOY, E.; PLÖCHL, M.; IDLER, C.; GEYER, M.: Ozontes Waschwasser zur Qualitätssicherung<br />
bei Salat. High-Tech Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion. IHK Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/264/ HEIERMANN, M.; MÄHNERT, P.; LINKE, B.: Biogas aus Gras – Bewertung der Gräser zur Biogasgewinnung. Jahrestagung<br />
<strong>des</strong> Deutschen Grünlandverban<strong>des</strong>. Paaren/Glien, 30.05.<strong>2003</strong><br />
/265/ HEIERMANN, M.; PLÖCHL, M.: Pflanzliche Biomassen – ein großes Potenzial für die Biogasgewinnung. 16. Fachtagung<br />
Ackerbau- und Pflanzenbau „Ergebnisse und Ausblicke zum Pflanzenbau“. LVL Güterfelde, 13.11.<strong>2003</strong><br />
/266/ HELLEBRAND, H. J.: Application of Thermal Imaging in Horticulture and Agriculture. BioPhys Spring <strong>2003</strong>. CZU<br />
Prag, 29.05.-30.05.<strong>2003</strong><br />
/267/ HEROLD, B.; GEYER, M.: Zerstörungsfreie Bestimmung der Glasigkeit – wie weiter? Tagung <strong>des</strong> Wissenschaftlichen<br />
Beirats <strong>des</strong> FV Dt. Speisezwiebel, Jülich, 09.-10.09.<strong>2003</strong><br />
/268/ HEROLD, B.; OBERBARNSCHEIDT, B.; ZUDE, M.; GEYER, M.: Zerstörungsfreie Bestimmung von Glasigkeit bei Speisezwiebeln.<br />
40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02. – 01.03.<strong>2003</strong><br />
/269/ HEROLD, B.; TRUPPEL, I.: Mikroskopische 3D Oberflächenanalyse an landwirtschaftlichen Produkten. Computer-<br />
Bildanalyse in der Landwirtschaft Workshop <strong>2003</strong>, Bonn, 06.05.<strong>2003</strong><br />
/270/ HEROLD, B; TRUPPEL, I.; ZUDE, M.; ROHRBACH, A.: Spektrometrische Bestimmung der Fruchtreifeentwicklung unter<br />
Feldbedingungen. EDV und Messtechnik in der Qualitätskontrolle von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln,<br />
Potsdam-Bornim, 03.-04.06.<strong>2003</strong><br />
/271/ HERPPICH, W.B.: Hat Licht Einfluss auf die Qualität von frischem, verpackten Rucola und Feldsalat? 5. Frische-<br />
Logistik-Tagung, Rotenburg an der Fulda, 27.-28.10.<strong>2003</strong><br />
/272/ HERPPICH, W.B.; GOMEZ GALINDO, F.: Interactive effects of temperature and water status on the firmness of fresh<br />
radish and carrots. 40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02. – 01.03.<strong>2003</strong><br />
/273/ HERPPICH, W.B.; GOMEZ, F.; SOMMARIN, M.; SMALLWOOD, M.; ELIAS, L.; SJÖHOLM, I.: Effects of cold-acclimation on<br />
the mechanical properties of carrots. 4 th Plant Biomechanics Conference <strong>2003</strong>, East Lansing, MI, USA, 20. -<br />
25.07.<strong>2003</strong><br />
/274/ HERPPICH, W.B.; HEROLD, B.; GEYER, M.; GOMEZ, F.: Interactive effects of temperature and water status on mechanical<br />
properties of radish and carrots tubers. 4 th Plant Biomechanics Conference <strong>2003</strong>, East Lansing, MI,<br />
USA, 20.-25.07.<strong>2003</strong><br />
/275/ HERPPICH, W.B.; LANDAHL, S.; HEROLD, B.; GEYER, M.; DE BAERDEMAEKER, J.: Water status and produce texture –<br />
a comprehensive evaluation of interactive effects. 4 th Plant Biomechanics Conference <strong>2003</strong>, East Lansing, MI,<br />
USA, 20.-25.07.<strong>2003</strong><br />
/276/ HOFFMANN, T.: Ernte und Konservierung von Mais. Vortragsreihe zur Landwirtschaftsausstellung „Agropanorama<br />
<strong>2003</strong>“, Agraruniversität Kaunas (Litauen), 02.05.-05.05.<strong>2003</strong><br />
/277/ IDLER, CH. ; SCHOLZ, V.: Quality of short rotation coppice during storage with special emphasis on humanpahogen<br />
fungi. International Conference on Crop Harvesting and Processing, Louisville, Kentucky, USA, 10.02.-<br />
12.02.<strong>2003</strong><br />
133<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
134<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/278/ IDLER, CH.; SCHOLZ, V.: Lösungsansätze für eine verlustlimitierende Lagerung von Feldholz. Vortrag auf Symposium<br />
"Holz vom Feld für die energetische und stoffliche Nutzung", Köllitsch, 12.06.<strong>2003</strong><br />
/279/ JAKOB, M.; GEYER, M.; BOKELMANN W.: 3-D-motion analysis as a tool for objective ergonomic evaluation of dynamic<br />
horticultural work processes. IEA <strong>2003</strong> Ergonomics in the digital age, Seoul Korea, 24.-29.08.<strong>2003</strong><br />
/280/ KALK, W. D.; HELLEBRAND, H. J.; HÜLSBERGEN, K.-J.: Kohlenstoffbilanzen landwirtschaftlicher Betriebe unterschiedlicher<br />
Produktionsintensität. Symposium "Biologische Senken für atmosphärischen Kohlenstoff in<br />
Deutschland". SAG Klimaänderungen, FAL Braunschweig, 04.-05.11.<strong>2003</strong><br />
/281/ KALK, W.-D.; BRUNSCH, R.: Untersuchung zum Nährstoffaustrag auf Sandböden im Freilandwinterquartier von<br />
Mutterkühen. 6. Tagung: Bau, Technik und Umwelt <strong>2003</strong> in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Vechta,<br />
25.-27.03.<strong>2003</strong><br />
/282/ KERN, J.: Umweltverträgliche und nachhaltige Nutzung der Nährstoffressource Phosphor. Gastvortrag im Kompetenzzentrum<br />
Wasser, Berlin, 19.11.<strong>2003</strong><br />
/283/ KERN, J.: Treatment of agricultural wastewater in a subsurface constructed wetland for the removal of faecal coliform<br />
bacteria. International Symposium on „Wastewater Hygienisation in Constructed Wetlands, Ponds and Related<br />
Systems“ UFZ, Leipzig, 06.11.-07.11.<strong>2003</strong><br />
/284/ KERN, J.; KNÖSCHE, R.: Landwirtschaft und Gewässerschutz im Land Brandenburg. DGL-Jahrestagung, Köln,<br />
29.09.-03.10.<strong>2003</strong><br />
/285/ KLAUSS, H.; PLÖCHL, M.: Einfache und robuste Modellierung der Evapotranspiration mittels Fuzzy-Logik zum<br />
Einsatz in der landwirtschaftlichen Praxis. 5. BioMet-Tagung. Dresden, 03.-05.12.<strong>2003</strong><br />
/286/ KLOCKE, M.: Molekulargenetische Methoden in der Bioverfahrenstechnik „Anwendung von PCR-ge-stützten<br />
Markertechniken zur Identifizierung von Lactobacilli“. <strong>ATB</strong>-Kolloquium, Potsdam-Bornim, 25.06.<strong>2003</strong><br />
/287/ KRAMER, E.: Stand "Prosenso.net". Netzwerke als Elemente zur Unterstützung komplexer Forschungsvorhaben.<br />
Statusseminar „HighTech-Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion“, Potsdam, 29.-30. 09. <strong>2003</strong><br />
/288/ KRAUSE, K.-H.; MÜLLER, H.-J.; LINKE, S.: Odour and Ammonia Emissions from different Livestock Buildings and the<br />
Dispersion of these Emissions in the Surroundings. "International Symposium on Gaseous and Odour Emissions<br />
from Animal Production Facilities". Horsens (DK), 1.-4. Juni <strong>2003</strong><br />
/289/ KREIBICH, H.; KERN, J.: Forest biological resources in the Amazon basin. International Conference and OECD<br />
Workshop, Philipps-Universität Marburg, 05.10.-08.10.<strong>2003</strong><br />
/290/ LANGNER, H.-R.: Bildverarbeitung in der Landwirtschaft-Einsatzmöglichkeiten und Beispiele. Fachkollogium<br />
„Bilddatenverarbeitung“, FH Brandenburg, 30.01.<strong>2003</strong><br />
/291/ LANGNER, H.-R.; BÖTTGER, H.: Messsystem zur Bewertung <strong>des</strong> Unkrautvorkommens. Statusseminar „HighTech-<br />
Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion“, Potsdam, 29.-30. 09. <strong>2003</strong><br />
/292/ LINKE, B.: Bioverfahrenstechnik am <strong>ATB</strong> – Ergebnisse und Ziele. <strong>ATB</strong>-Kolloquium, Potsdam-Bornim, 25.06.<strong>2003</strong><br />
/293/ LINKE, B.; GRUNDMANN, P.: Anaerobe Vergärung von Roggen in Landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Fachgespräch<br />
„Roggen als nachwachsender Rohstoff“. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Potsdam-Rehbrücke,<br />
05.-06.03 <strong>2003</strong><br />
/294/ LINKE, M.: Technische Maßnahmen zur Qualitätserhaltung von Obst und Gemüse. EDV und Messtechnik in der<br />
Qualitätskontrolle von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln, Potsdam-Bornim, 14.-15.10.<strong>2003</strong><br />
/295/ LINKE, M.: Frische und Qualitätserhaltung nach der Ernte – Maßnahmen und technische Lösungen. Ökologischer<br />
Gemüsebau - vom Feld bis zur Ladentheke, Berlin, 20.11.<strong>2003</strong><br />
/296/ MÄHNERT, P.; HEIERMANN, M.; LINKE, B.: Grasvergärung im Batch- und semikontinuierlichen Ansatz. 2. Potsdamer<br />
BiogasKonferenz. Potsdam, 17.-18.11.<strong>2003</strong><br />
/297/ MODEL N.; VÖLKER, U; MELLMANN, J.: Untersuchungen zur Prozesskette für Getreide. Kartographisches Kolloquium,<br />
7. Oktober <strong>2003</strong>, Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V. Sektion Berlin-Brandenburg Lan<strong>des</strong>vermessung<br />
und Geobasisinformation Brandenburg (LGB), Heinrich-Mann-Allee 103 Potsdam<br />
/298/ MODEL, N. ; MELLMANN, J. ; JOST, O. ;MALTRY, W : Modellgestützte Automatisierung von Dächerschachttrocknern.<br />
<strong>ATB</strong>-Institutskolloquium, 15.12.<strong>2003</strong><br />
/299/ MODEL, N.; VÖLKER, U.; MELLMANN, J.: Untersuchungen zur Prozesskette für Getreide. Kartographisches Kolloquium,<br />
Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V., Sektion Berlin-Brandenburg, Lan<strong>des</strong>vermessung und Geobasisinformation<br />
Brandenburg (LGB), Potsdam, 7. Oktober <strong>2003</strong><br />
/300/ MOLLOY, E.; HASSENBERG, K.; PLÖCHL, M.; GEYER, M.; IDLER, C.; BARNES, J.: Surface decontamination of fresh<br />
produce. 16 th World Congress International Ozone Association. Las Vegas (USA), 31.08.-05.09.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/301/ MOLLOY, E.; HASSENBERG, K.; PLÖCHL, M.; IDLER, CH.; GEYER, M.; BARNES, J.: Decontamination Of Fresh Produce<br />
Using Ozonated Water. 16. Ozone World Congress der IOA, Las Vegas, USA, 31.08.-05.09.<strong>2003</strong><br />
/302/ MÜLLER, H.-J.; BRUNSCH, R.; HÖRNIG, G.; JELÍNEK, A.: Odour and Ammonia Emissions from Poultry Houses with different<br />
Keeping and Ventilation Systems. "International Symposium on Gaseous and Odour Emissions from Animal<br />
Production Facilities". Horsens (DK), 1.-4. Juni <strong>2003</strong><br />
/303/ MÜLLER, H.-J.; KRAUSE, K.-H.: New Ventilation Systems for Livestock Buildings. The 4 th International Symposium on<br />
HVAC. Beijing (China), 9.-11. Oktober <strong>2003</strong><br />
/304/ MÜLLER, K.; STEINBORN, P.; BECKER, A.: Qualitätsrelevante Schwachstellen in den Lieferketten von Ökogemüse<br />
und Lösungsansätze. Ökologischer Gemüsebau - vom Feld bis zur Ladentheke, Berlin 20.11.<strong>2003</strong><br />
/305/ MUNDER, F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: Results of the Advanced Technology for Processing of Natural Fiber Plants<br />
for Industrial Application, 7 th Intern. Conference on Woodfibre.Plastics and other natural Fibers, Madison / Wisconsin,<br />
May <strong>2003</strong>.<br />
/306/ Munder, F; Fürll,C.; Hempel, H.: Ergebnisse zum Hanfaufschluss. Kolloquium <strong>des</strong> Naturstoffinnovationsnetzwerks<br />
Altmark, FH Magdeburg, 20.01.<strong>2003</strong><br />
/307/ MUNDER,F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: Results of an advanced decortication technology for hemp, flax and linseed:<br />
International Conference of the ASAE, ICCHP, Louisville Feb. <strong>2003</strong>,<br />
/308/ MUNDER,F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: Advanced Decortication Technology for Bast fibres and Coir, 7 th ICFPAM-<br />
Conference of the FAO, Bucarest, Romania, June <strong>2003</strong><br />
/309/ MUNDER,F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: Advanced Technology for Processing of Natural Fiber Plants for Industrial<br />
Application:, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, Kaunas, Lituanian,<br />
Sep <strong>2003</strong><br />
/310/ MUNDER,F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: Results of an advanced decortication technology for bast fibres, Intern. Nordic<br />
Biofibre Conference, Copenhagen, Nov. <strong>2003</strong><br />
/311/ MUNDER,F., FÜRLL, C., HEMPEL, H.: Advanced Technology for Decortication of Flax and other Bast Fibre plants:<br />
Processing of Bast fibre and Coir, Intern. Conference of the FAO on Flax and Allied Fiber Plants for Human Welfare,<br />
Cairo, Egypt, Dec. <strong>2003</strong><br />
/312/ PAZSICZKI, I.; BERG, W.: Studying Methods of Reduction the Gas Emission in the Framework of the German-<br />
Hungarian Joint Research. 3 rd Research and Development Conference of Central- and Eastern European Institutes<br />
of Agricultural Engineering. Gödöllö, Hungary, 11.–13.09.<strong>2003</strong><br />
/313/ PECENKA, R.: Modellierung <strong>des</strong> Transportverhaltens von Hanffaser-Schäben-Gemischen in der Naturfaserreinigung,<br />
<strong>ATB</strong>-Kolloquium, Potsdam-Bornim, 15.09.<strong>2003</strong><br />
/314/ PECENKA, R.; FÜRLL, C.: Operational experiences in bast fibre straw processing with the <strong>ATB</strong> pilot plant using<br />
advanced technologies for decortication and fibre cleaning. NJF’s 22nd Congress, Turku, July 1-4 <strong>2003</strong><br />
/315/ PECENKA, R.; FÜRLL, C.: Investigation and optimisation of transport and separation processes in shaker cleaners<br />
for hemp fibre processing. Conference Agricultural Engineering, Hannover, November 7-8 <strong>2003</strong><br />
/316/ PLÖCHL, M.: The interaction of climate change, technological development and land use patterns. Transition in<br />
Agriculture and Future Land Use Patterns, Wageningen (NL), 01.-03.12.<strong>2003</strong><br />
/317/ PLÖCHL, M.; HEIERMANN, M.: Der Einfluss von Düngung und Bearbeitung auf die Ökobilanz von Feldpflanzen zur<br />
Biogasproduktion. Symposium Biogas auf der Grünen Woche, Berlin, 21.01.<strong>2003</strong><br />
/318/ PLÖCHL, M.; ZIMMERMANN, H.: Optimisation of the water use efficiency of large-scale irrigation using fuzzy logic<br />
modelling and remote sensing. XXX CIOSTA-CIGR V Congress, Turin (Italy), 22.-24.09.<strong>2003</strong><br />
/319/ PLÖCHL, M.; ZIMMERMANN, H.: Optimierung der Steuerung moderner Beregnungsanlagen und die ökonomische<br />
und ökologische Bewertung großflächiger Bewässerung. High-Tech Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion,<br />
Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/320/ PLÖCHL, M.; ZIMMERMANN, H.; LUCKHAUS, C.: Improving data acquisition of soil and plant monitoring devices<br />
through soil heterogeneity scanning. Congreso Internacional de Riego y Drenaje CubaRiego <strong>2003</strong>. La Habana<br />
(Cuba), 20.-24.10.<strong>2003</strong><br />
/321/ REIMANN, W.; LINKE, B.; LESZCZYNSKI, R.: Membranbioreaktor zur Aufbereitung von Schlachthofabwässern. Statusseminar<br />
<strong>2003</strong>, High-Tech Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion, Potsdam, 29.09.-<br />
30.09.<strong>2003</strong><br />
/322/ RICHTER, K.: Kontinuierliche Erzeugung von Milchsäure – mikrobielle Leistungsgrenzen und Möglichkeiten ihrer<br />
technischen Nutzung. <strong>ATB</strong>-Kolloquium, Potsdam-Bornim, 25.06.<strong>2003</strong><br />
135<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
136<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/323/ SCHLAUDERER, R., PROCHNOW, A., WIEGLEB, G.: Ökonomische Bewertung <strong>des</strong> Offenlandmanagements ehemaliger<br />
Truppenübungsplätze. Arbeitskreis Naturschutzökonomie. Göttingen, 25.-26.06.<strong>2003</strong><br />
/324/ SCHOLZ, V.: Uso de bombas FV na agricultura (Einsatz von PV Pumpen in der Landwirtschaft). Vortrag auf Kolloquium<br />
<strong>des</strong> Instituts für Agrartechnik, Universidade Federal de Viçosa, Brasilien, 25.11.<strong>2003</strong><br />
/325/ SCHOLZ, V.; HELLEBRAND, H. J.: Clean energy from farmland - Long-term results of practically oriented field trials.<br />
EnerEnv'<strong>2003</strong> Conference, Changsha, China, 11.-14.10.<strong>2003</strong><br />
/326/ SCHOLZ, V.; HELLEBRAND, H. J.: Ökologische Vorzüge <strong>des</strong> Anbaus schnellwachsender Baumarten. Symposium<br />
"Holz vom Feld für die energetische und stoffliche Nutzung". Facharbeitskreis Biomasse der Sächsischen Lan<strong>des</strong>anstalt<br />
für Landwirtschaft, Köllitsch, 12.06.<strong>2003</strong><br />
/327/ SCHOLZ, V.; HELLEBRAND, H. J.; HÖHN, A.: Umweltverträgliche Energie- und Industriepflanzenproduktion. 9. Internationaler<br />
Kongress für nachwachsende Rohstoffe und Pflanzenbiotechnologie. Magdeburg, 16.-17.06.<strong>2003</strong><br />
/328/ SCHWARZ, J.: Informationsaustausch der Projektgruppen „Mosaik“ (Lüttewitz) und „Teilflächenspezifische Bewirtschaftung“<br />
(Gieshügel), Gieshügel, 09.07.<strong>2003</strong><br />
/329/ SCHWARZ, J.; KERSEBAUM, K.C.; REUTER, H.I.; WENDROT, O.: Three years results with site-specific nitrogen fertilisation.<br />
4 th European Conference of Precision Agriculture, Berlin, 16.-18. 06. <strong>2003</strong><br />
/330/ TAPIA O.; HENZE, H-J; MODEL, N.: Measurement and model supported alternative rain water management in urban<br />
areas of Berlin using Trackbed Naturation for Railway Tracks. 17 th International Conference Informatics for<br />
Environmental Protection September 24-26, <strong>2003</strong> Brandenburg University of Technology of Cottbus, Germany<br />
/331/ TAPIA O; MODEL, N.: Tapia Silva, F.O.; Model, N. [<strong>2003</strong>]: Development of one measurement and model supported<br />
alternative rain water management using Trackbed Naturation for Railway Tracks. XI International Conference<br />
on Rainwater Catchment in August (25. bis 26.) Mexiko<br />
/332/ TRUPPEL, I.: Tragbares funkangekoppeltes Minispektrometer. Computer-Bildanalyse Workshop <strong>2003</strong>, Bonn,<br />
06.05.<strong>2003</strong><br />
/333/ VENUS, J.: Biochemikalien und Energie aus pflanzlichen Biomassen – EU CRAFT Projekt BESUB. <strong>ATB</strong>-<br />
Kolloquium, Potsdam-Bornim, 25.06.<strong>2003</strong><br />
/334/ VENUS, J.: Fermentation von Getreide zu Polymilchsäure. 14. Internationale Tagung „Moderne Getreidemahlprodukte<br />
mit kundengerechten Eigenschaften für Food und Non-food“, IGV Potsdam-Rehbrücke, 29.09.-<br />
30.09.<strong>2003</strong><br />
/335/ WORMANNS, G; HOFFMANN, T.: Möglichkeit und Grenzen einer objektiven Kochtyp-Bestimmung bei Speisekartoffelpartien.<br />
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Kartoffelforschung, Detmold, 14.05.- 15.05.<strong>2003</strong><br />
/336/ ZIMMERMANN, H.; PLÖCHL, M.; LUCKHAUS, C.; DOMSCH, H.: Selecting the optimum locations for soil investigations.<br />
4 th European Conference on Precision Agriculture. Berlin, 15.-19.06.<strong>2003</strong><br />
/337/ ZUDE, M.: Rapid, diagnostic methods for monitoring agro-food products. INA-PG, Paris, France, 09.08. <strong>2003</strong><br />
/338/ ZUDE, M.: Non<strong>des</strong>tructive quality sensing of perishable produce. Journée de la Société Francophone Vitamines<br />
& Biofacteurs, Amphithéâtre Louis Charcot, Paris, 04.12.<strong>2003</strong><br />
/339/ ZUDE, M.; REISCH, R.; WIESNER, K.; LINKE, M.; HIELSCHER-TÖLZER, CH.; KEIL, T.; HEROLD, B.; AHLERS, H.: Prozesskontrolle<br />
der Qualität von frischem Obst und Gemüse mit Hilfe eines Multigas-Sensors. Seminar: High-Tech<br />
Innovation für Verfahrensketten der Agrarproduktion, IHK-Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
3.6 Wissenschaftliche Poster<br />
/340/ BAHR, CLAUDIA; BREHME, U.: Analysen von Tieraktivitätsmessungen mit Pedometern zur Einschätzung <strong>des</strong> Verhaltens<br />
von Mutterkühen im geburtsnahen Zeitraum. Internat. Tagung "Bau, Technik in der landwirtschaftlichen<br />
Nutztierhaltung", Vechta, 21.-23.03.<strong>2003</strong><br />
/341/ BERG, W.; PAZSICZKI, I.: Reducing Emissions by Combining Slurry Covering and Acidifying. International Symposium<br />
on Gaseous and Odour Emissions from Animal Production Facilities. Horsens, Denmark, 01.–04.06.<strong>2003</strong><br />
/342/ BORSA, B.; KOVÁCS, L.; JAKOVÁC , F.; OBERBARNSCHEIDT, B.; HEROLD, B.; GEYER, M.: Simulation der mechanischen<br />
Belastung von Tomaten beim Lkw-Transport. 40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-<br />
Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong><br />
/343/ BORSA,B.- JAKOVÁC,F.-KOVÁCS,L.-LINKE, M.- OBERBARNSCHEIDT, B.-HEROLD,B.: A paprika egyes tulajdonságainak<br />
megváltozása szállítás-tárolás során. (Einige Eigenschaftsveränderungen vom Paprika beim Transport und Lagerung)<br />
XXVII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő Ungarn, 21.-22.01.<strong>2003</strong><br />
/344/ BÖTTGER, H.; LANGNER, H.-R.: Messsystem zur Bewertung <strong>des</strong> Unkrautvorkommens. Statusseminar “HighTech-<br />
Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion”, -Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/345/ BÖTTGER, H.; LANGNER, H.-R.: Kameragesteuerte Herbizid im Echtzeitverfahren. Statusseminar “HighTech-<br />
Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion”, Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/346/ DAMMER, K.-H.: Teilflächenspezifischer Pflanzenschutz im Winterweizen. Agritechnica, DLG-Stand, Hannover,<br />
11. - 15.11.<strong>2003</strong><br />
/347/ EL SAEIDY, E.; SCHOLZ, V.; GRUNDMANN, P.: A New Technology of Energetic Use of Cotton Stalks Considering<br />
Phytosanitary Aspects. Deutscher Tropentag <strong>2003</strong>, Georg-August-Universität Göttingen, 08.-10.10.<strong>2003</strong><br />
/348/ ELSAEIDY, E; SCHOLZ, V.; GRUNDMANN, P.: Energetic Use of Crop Residues Considering especially Cotton<br />
Stalks. Deutscher Tropentag <strong>2003</strong>. Universität Göttingen, <strong>2003</strong><br />
/349/ FÜRLL, C.; MUNDER, F.; HEMPEL, H.: Gewinnung von Naturfasern durch Prallbeanspruchung. „Naturfaser-Forum“<br />
<strong>des</strong> regionalen Kompetenzzentrums für Nachwachsende Rohstoffe, Werlte/Kreis Emsland, 04.09.<strong>2003</strong><br />
/350/ FÜRLL, C.; MUNDER, F.; HEMPEL, H.: Pilotanlage für die Naturfasergewinnung. „Naturfaser-Forum“ <strong>des</strong> regionalen<br />
Kompetenzzentrums für Nachwachsende Rohstoffe, Werlte/Kreis Emsland, 04.09.<strong>2003</strong><br />
/351/ FÜRLL, C.; MUNDER, F.; HEMPEL, H.: Maschinenlinie für die Naturfasergewinnung. „Naturfaser-Forum“ <strong>des</strong> regionalen<br />
Kompetenzzentrums für Nachwachsende Rohstoffe, Werlte/Kreis Emsland, 04.09.<strong>2003</strong><br />
/352/ GEYER, M.; TISCHER, S.; JAKOB, M.: Evaluation of different harvesting aids for white asparagus. IEA <strong>2003</strong> Ergonomics<br />
in the digital age, Seoul Korea, 24.-29.08.<strong>2003</strong><br />
/353/ GIEBEL, A.; WENDROTH, O.; REUTER, H.I.; KERSEBAUM, K.C.; SCHWARZ, J.: MOSAIC: Spatial representativity of<br />
mineral soil nitrogen monitoring. 4 th European Conference of Precision Agriculture, Berlin, 16.-18. 06. <strong>2003</strong><br />
/354/ GÓMEZ, F.; KNUTSEN, S.H.; SOMMARIN, M.; SMALLWOOD, M.; HERPPICH, W.B.; SJÖHOLM, I.: Biochemical Aspects of<br />
Carrot Processing. Conference on Future Technologies for Food Production and Future Food Scientists,<br />
Gotemburg, Schweden, 02.-04.06.<strong>2003</strong><br />
/355/ GOTTSCHALK K; HELLEBRAND H.J.; BEUCHE H.; SCHLAUDERER R; GEYER S.; FICHT I.; JACOBS H.; RICHTER I.: „Thermographie<br />
als innovative Prozesssteuerung im Kartoffellager“, Statusseminar <strong>2003</strong> High Tech Innovationen für<br />
Verfahrensketten der Agrarproduktion, IHK Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/356/ HASSENBERG, K.; MOLLOY, E.; PLÖCHL, M.; IDLER, C.; GEYER, M.: Ozontes Waschwasser zur Qualitätssicherung<br />
bei Salat. High-Tech Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion. IHK Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/357/ HEIERMANN, M.; PLÖCHL, M.: Energielandwirtschaft. Fachtagung „Energie vom Acker - Alternative Produktionsfelder<br />
für die Landwirtschaft“ am <strong>ATB</strong> im Rahmen der Europäischen Biomassewoche der Regionen. Potsdam,<br />
02.10.<strong>2003</strong><br />
/358/ HELLEBRAND, H. J.; BREHME, U.; BEUCHE, H.; STOLLBERG, U.: Östrus und Trächtigkeitsdiagnostik mittels Thermographie.<br />
67. Jahrestagung der deutschen Physikergesellschaft, Hannover, 24.-28.03.<strong>2003</strong><br />
/359/ HELLEBRAND, H. J.; BREHME, U.; BEUCHE, H.; STOLLBERG, U.; JACOBS, H.: Application of thermal imaging for cattle<br />
management. 1 st European Conference on Precision Livestock Farming. Berlin/Germany, 15.-19.06.<strong>2003</strong><br />
/360/ HELLEBRAND, H. J.; DAMMER, K. H.; BEUCHE, H.; JACOBS, H.: Thermografieanwendung in der Pflanzenzustandsanalyse.<br />
67. Physikertagung Hannover, 24.-28.03.<strong>2003</strong><br />
/361/ HELLEBRAND, H. J.; KALK, W.-D.; SCHOLZ, V.: CO 2- und CH 4-Flussraten sandiger Böden. Symposium „Biologische<br />
Senken für atmosphärischen Kohlenstoff in Deutschland“. SAG Klimaänderungen, FAL Braunschweig, 04.-<br />
05.11.<strong>2003</strong><br />
/362/ HELLEBRAND, H.-J.; KERN, J.; SCHOLZ, V.; KAULFUSS, P. : Einfluss der Witterung auf die Lachgasemission und<br />
den Methanabbau sandiger Böden. 67. Physikertagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Hannover,<br />
24.03.-28.03.<strong>2003</strong><br />
/363/ HEROLD, B.; OBERBARNSCHEIDT, B.; ZUDE, M.; HERPPICH, W.B.; GEYER, M.: Zerstörungsfreie Bestimmung von<br />
Glasigkeit bei Speisezwiebeln. DGQ GDL Vortragstagung „Die Qualität von Obst und Gemüse: Vom Rohstoff<br />
zum Produkt“ Geisenheim 13.-14.03.<strong>2003</strong><br />
/364/ HEROLD, B.; TRUPPEL, I.; HERPPICH, W.B.; GEYER, M.; KRISCHKE, G.: Elastizitätsprüfung zur Erkennung von hohlen<br />
Einlegegurken. DGQ GDL Vortragstagung „Die Qualität von Obst und Gemüse: Vom Rohstoff zum Produkt“<br />
Geisenheim 13.-14.03.<strong>2003</strong><br />
/365/ HERPPICH, W.B.; GOMEZ GALINDO, F.; SJÖHOLM, I.; ELIAS, L.; SMALLWOOD, M.; SOMMARIN, M.: Effects of coldacclimation<br />
on the storage potential of carrots. 40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-<br />
Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong><br />
/366/ HERPPICH, W.B.; LINKE, M.; GEYER, M.; HEROLD, B.; GOMEZ GALINDO, F.: Dynamic effects of temperature and water<br />
status on postharvest texture of radish and carrot tubers. Quality in Chains, Wageningen, The Netherlands,<br />
06.-09.07.<strong>2003</strong><br />
137<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
138<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/367/ HIELSCHER-TÖLZER, CH.; HEROLD, B.; ZUDE, M.: Einsatz eines elektrochemischen Sensors in der Obstlagerung.<br />
40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong><br />
/368/ HOFFMANN, T.; WORMANNS, G.; JACOBS, A.; RICHTER, I.G.; FÜRLL, C.; OSTERER, A.; POLLER, J.: Ent-wicklung eines<br />
Echtzeitsensors für die Stärkebestimmung bei Kartoffeln. Statusseminar "High-Tech Innovationen für Verfahrensketten<br />
der Agrarproduktion", IHK Potsdam, 29.09.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/369/ JAKOB, M.; GEYER, M.: Ergonomic evaluation of dynamic work processes in horticultural production systems.<br />
XXX CIOSTA – CIGR V conference, Turin, Italy 22.-24.09.<strong>2003</strong><br />
/370/ JAKOB, M.; GEYER, M.; IVANOV, V.: Ergonomische Bewertung von Arbeitsplätzen im dynamischen Arbeitsprozess.<br />
40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong><br />
/371/ KALK, W.-D.; SCHLAUDERER, R.; VÖLKER, U.; EHLERT, D.: Ecological and economic assessment of sensor-based<br />
site-specific nitrogen fertilisation. 4 th European Conference of Precision Agriculture, Berlin, 16.-18. 06. <strong>2003</strong><br />
/372/ KERN, J.; KNÖSCHE, R.; DOMSCH, H.: Gewässerökologie und Landnutzung im Emster Quellgebiet. 4. Ökologie-<br />
Tage Brandenburg, Potsdam, 05.06.-06.06.<strong>2003</strong><br />
/373/ KOVÁCS, L.-BORSA,B.- JAKOVÁC,F.-OBERBARNSCHEIDT, B.-HEROLD,B.: Egy ipari paradicsom érésfolyamata<br />
érésgyorsító hatására. (Der Reifeprozess einer Industrietomate mit der Behandlung von Ethrel) XXVII.Kutatási<br />
és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő Ungarn, 21.-22.01.<strong>2003</strong><br />
/374/ KREHL, I.: Eutergesund oder euterkrank? Jahrestagung der wissenschaftlichen Gemeinschaft Milcherzeuger e.<br />
V., Bad Sassendorf, 9.11.<strong>2003</strong><br />
/375/ KÜHNE, G.; MÜLLER, M.; SCHWARZ, U.; FÜRLL, C.: Aufbereiten von konserviertem Hanf. „Naturfaser-Forum“ <strong>des</strong> regionalen<br />
Kompetenzzentrums für Nachwachsende Rohstoffe, Werlte/Kreis Emsland, 04.09.<strong>2003</strong><br />
/376/ LINKE, M.; HERPPICH, W.B.; GEYER, M.: An integrated approach to indicate freshness of horticultural produce.<br />
Quality in Chains, Wageningen, The Netherlands, 06.-09.07.<strong>2003</strong><br />
/377/ LINKE, M.; KLÄRING, H.-P.: Effects of different pre-harvest conditions on the postharvest keeping quality of tomatoes.<br />
International Workshop on Models for Plant Growth and Control of Product Quality, Potsdam, 24-28.08.<strong>2003</strong><br />
/378/ LINKE, M.; OBERBARNSCHEIDT, B.; HEROLD, B.; BORSA, B.; KOVACS, L.: Nachernteverhalten von ungarischem Paprika<br />
– Veränderung von Produkteigenschaften in verschiedenen Verpackungen. XXVII. Kutatási és Fejlesztési<br />
Tanácskozás, Gödöllő Ungarn, 21.-22.01.<strong>2003</strong><br />
/379/ LINKE, M.; OBERBARNSCHEIDT, B.; HEROLD, B.; BORSA, B.; KOVACS, L.: Nachernteverhalten von ungarischem Paprika<br />
– Veränderung von Produkteigenschaften in verschiedenen Verpackungen. Internationale Jahrestagung<br />
<strong>des</strong> FVMMI, Gödöllö, Ungarn <strong>2003</strong><br />
/380/ MODEL, N.; MELLMANN J.; JOST, O; MALTRY, W.: Optimierte Steuerung von Getrei<strong>des</strong>chachttrocknern, Statusseminar<br />
„High-Tech Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion“, IHK Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/381/ MODEL, N.; MELLMANN, J.; MALTRY, W.: Mathematical modelling of mixed-flow grain drying. 3 rd CEE AgEng Research<br />
and Develop. Conf. of Central- and Eastern Europ. Institutes of Ag. Eng., Gödöllö, Hungary,11.-12.<br />
09.<strong>2003</strong><br />
/382/ MODEL, N.; MELLMANN, J.; MALTRY, W.: Mathematical modelling of mixed-flow grain drying. 3 rd CEE AgEng Res.<br />
and Develop. Conf. of Central and Eastern Europ. Institutes of Ag. Eng., Gödöllö, Hungary, 11-13 Sept. <strong>2003</strong><br />
/383/ MÜLLER, H.-J.: Geruchs- und Ammoniakemissionen aus der Schweine- und Geflügelhaltung. 6. Tagung "Bau, Technik<br />
und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung", Vechta, 25.-27.03.<strong>2003</strong><br />
/384/ MULUGETA, E.; GEYER, M.: Zielgerichtete Düsenauswahl zur Verbesserung der Gemüsewäsche. Statusseminar<br />
<strong>2003</strong>, Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/385/ MULUGETA, E.; GEYER, M.: Vegetable washing using nozzles. ASAE Annual International Meeting, Las Vegas,<br />
Nevada, 27.-30.07.<strong>2003</strong><br />
/386/ PECENKA R.; FÜRLL, C.: Verfahrenstechnische Untersuchungen zur kostengünstigen Hanffaserreinigung und zur<br />
Modellierung <strong>des</strong> Massestroms in einem Kammschüttel. 4. Internationales Symposium „Werkstoffe aus Nachwachsenden<br />
Rohstoffen“, Erfurt, 11.-12.09.<strong>2003</strong><br />
/387/ PECENKA, R.; FÜRLL, C.; BRÜNING, H.: Leistungsfähige Reinigungsverfahren für die Naturfasergewinnung. „Naturfaser-Forum“<br />
<strong>des</strong> regionalen Kompetenzzentrums für Nachwachsende Rohstoffe, Werlte/Kreis Emsland,<br />
04.09.<strong>2003</strong><br />
/388/ PECENKA, R.; FÜRLL, C.: Leistungsfähige Reinigungsverfahren für die Naturfasergewinnung, Naturfaser-Forum<br />
<strong>2003</strong>, Wil<strong>des</strong>hausen, 04.09.<strong>2003</strong><br />
/389/ PLÖCHL, M.: Modellierung der Ammoniakemissionen aus der Gülleausbringung mit dem Ziel der Verfahrensoptimierung.<br />
6. Internationale Tagung Bau, Technik, Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Vechta,<br />
05.-07.03.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/390/ PLÖCHL, M.; ZIMMERMANN, H.: Optimierung der Steuerung moderner Beregnungsanlagen. Ökologietage Brandenburg<br />
IV. Potsdam, 05.-06.06.<strong>2003</strong><br />
/391/ REIMANN, W.; LINKE, B.; LESZCZYNSKI, R.: Membranbioreaktor zur Aufbereitung von Schlachthofabwässern. Statusseminar<br />
<strong>2003</strong>, High-Tech Innovationen für Verfahrensketten der Agrarproduktion, Potsdam, 29.09.-<br />
30.09.<strong>2003</strong><br />
/392/ REISCH, R.; AHLERS, H.; ZUDE, M.; HEROLD, B.; KEIL, T.: Innovationen für die Landwirtschaft. Seminar: High-Tech<br />
Innovation für Verfahrensketten der Agrarproduktion, IHK Potsdam, 29.-30.09.<strong>2003</strong><br />
/393/ ROHRBACH, A.; GEYER, M.; HEROLD, B.; ZUDE, M.: Spektralanalyse zur Bestimmung <strong>des</strong> optimalen Erntetermins.<br />
40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02.-01.03.<strong>2003</strong><br />
/394/ SCHOLZ, V.; IDLER, CH.; DARIES, W.: Trockenmasseverluste und Schimmelpilzentwicklung in Holzhackschnitzeln.<br />
9. Internationalen Fachtagung „ Energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe“, Freiberg, 04.09.-<br />
05.09.<strong>2003</strong><br />
/395/ SCHOLZ, V.; IDLER, CH.; DARIES, W.: Dry matter loss and fungi development in wood chip piles. 3 rd Research and<br />
Development Conference of Central- and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering, Gödöllõ,<br />
Hungary, 11.09.-12.09.<strong>2003</strong><br />
/396/ SCHOLZ, V.; IDLER, CH.; DARIES, W.: Verlustarme Lagerung von Feldholz-Hackgut. 9. Internationale Fachtagung<br />
"Energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe" Freiberg, 04.-05.09.<strong>2003</strong><br />
/397/ SCHUMANN, D.; MILLER, H.; JÜRSCHIK, P.; SCHWARZ, J.; KERSEBAUM, K.C.; REUTER, H.I.; GIEBEL, A.; WENDROTH,<br />
O.: MOSAIC: On-farm-monitoring, geo-spatial-analysis and deterministic geo-referenced modelling as an approach<br />
for spatial crop yield variability and site-specific management decisions. 4 th European Conference of<br />
Precision Agriculture, Berlin, 16.-18. 06. <strong>2003</strong><br />
/398/ TRUPPEL, I.; HEROLD, B.; ZUDE, M.; GEYER, M.: Bestimmung der Apfelreifeentwicklung mittels Telemetrie-<br />
Spektralfotometer. 40. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Freising-Weihenstephan, 26.02-01.03.<strong>2003</strong><br />
/399/ TÜRK, M.; ZENKE, T.; VERHÜLSDONK, B.; BRÜCKNER, R.: Spaltverluste in Drehkolbenpumpen. 6. Internationale Tagung<br />
"Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung", Vechta, 25.-27.03.<strong>2003</strong><br />
/400/ TÜRK, M.; ZENKE, T.; VERHÜLSDONK, B.; BRÜCKNER, R.: Spaltverluste in Drehkolbenpumpen. Chemie- und Biotechnologiemesse<br />
ACHEMA, Frankfurt/M., 19.-24.05.<strong>2003</strong><br />
/401/ VENUS, J.: Entwicklung neuer Prozesse zur biotechnischen Konversion von Agrarrohstoffen in hochwertige Produkte<br />
und Energie. Workshop „Biokonversion nachwachsender Rohstoffe“ <strong>des</strong> Netzwerkes BioRegioN, Braunschweig,<br />
25.11.<strong>2003</strong><br />
/402/ WULF, J.; HERPPICH, W.B.; LINKE, M.; ZUDE, M.: Laser-induced Fluorescence Spectroscopy. Quality in Chains,<br />
Wageningen Niederlande, 06.-09.07.<strong>2003</strong><br />
/403/ WULF, J.; MULUGETA, E.; ZUDE, M.: Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy (LIFS) –Influencing Factors on<br />
Measurements-. ASAE Annual International Meeting, Las Vegas, Nevada, 27.-30.07.<strong>2003</strong><br />
/404/ ZSOM, T.; SZEPES, A.; HERPPICH, W.B.; BALLA, CS.: Technical adaptation of quality monitoring methods of sweet<br />
pepper. 1st International Symposium on Recent Advances on Food Analysis, Prag, Tschechische Republik 05.-<br />
07.11.<strong>2003</strong><br />
4 Übersichtsbeiträge der Mitarbeiter<br />
General Publications of Staff Members<br />
4.1 Übersichts-Aufsätze<br />
/405/ BÖTTGER, H.; LANGNER, H.-R.: Spritzmittel variabel dosieren. Landwirtschaftliches Wochenblatt, Westfalen-<br />
Lippe (35): 56-57, <strong>2003</strong><br />
/406/ BREHME, U.; BÖHRNSEN, A.: Elektronisch Schritte zählen. Profi. H 9312 (2):74-76, <strong>2003</strong><br />
/407/ BREHME, U.; BRUNSCH, R.: Erfassen und werten. Bauernzeitung. 49. Woche:45-46, <strong>2003</strong><br />
/408/ BRUNSCH, R.: Präzisionstierhaltung wird fachübergreifend weiter entwickelt – neue Qualität <strong>des</strong> Managements.<br />
Neue Landwirtschaft <strong>2003</strong> (9): 56-59<br />
/409/ DAMMER, K.-H.: Bedarfsorientierte Applikation von Pflanzenschutzmitteln. Getreidemagazin 8 (1): 57-59, <strong>2003</strong><br />
/410/ DAMMER, K.-H.; WARTENBERG, G.; BÖTTGER, H.; SCHMIDT, H.: Der Sensor ersetzt das Auge. DLG Mitteilungen (1):<br />
40-43, <strong>2003</strong><br />
/411/ DOMSCH, H.: Wie beginnen? Kostengünstiger Einstieg in die teilflächenspezifische Bewirtschaftung. Neue<br />
Landwirtschaft (12): 46-48, <strong>2003</strong><br />
139<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
140<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/412/ DOMSCH, H.; KAISER, T.; WITZKE, K.; GIEBEL, A.: Der indirekte Weg – Elektrische Leitfähigkeit gibt auch Auskunft<br />
über andere Bodenmerkmale. Neue Landwirtschaft (5): 48-51, <strong>2003</strong><br />
/413/ DUMDEI, K.; MÜLLER, K.; LINKE, M.; GEYER, M.: Frisch vom Feld bis zur Theke. Bioland 5: 18 (<strong>2003</strong>)<br />
/414/ FÜRLL, C.: Kraftfuttersilos - Massen in Fluss. Landwirtschaftsblatt Weser-Ems, Nr. 49: 40-42, 05.12.<strong>2003</strong><br />
/415/ GEYER, M.: Agritechnica <strong>2003</strong> mit „Zentrum Freilandgemüse“ Qualität und Sicherheit bei Gemüse sind keine<br />
„Worthülsen“ Gemüse 11: 11-12 (<strong>2003</strong>)<br />
/416/ GEYER, M.: Vollmechanisch Spargelernten. Gemüse 11: 34-35 (<strong>2003</strong>)<br />
/417/ GEYER, M.; PASCHOLD, P.-J:. Goldmedaille auf der Agritechnica. Spargel & Erdbeer Profi 5: 10-12 (<strong>2003</strong>)<br />
/418/ GEYER, M.; TISCHER, S.; ROHLFING, H.-J.: Stechmethoden und Mechanisierung der Spargelernte. Gemüse 5: 29-<br />
31 (<strong>2003</strong>)<br />
/419/ GEYER, M.; TISCHER, S.; ROHLFING, H.-R.: Mechanisierte Ernte von Spargel. Spargel & Erdbeer Profi 2: 14-16<br />
(<strong>2003</strong>)<br />
/420/ GRUNDMANN, P; HANFF, H.: Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen. In: Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz<br />
und Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg, Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Biogas in der<br />
Landwirtschaft. Potsdam, Mai <strong>2003</strong>, S. 34–39 (<strong>2003</strong>)<br />
/421/ HEROLD, B.; GEYER, M.: Instrumente zur Qualitätskontrolle bei Früchten. Monatsschrift 03: 140-142 (<strong>2003</strong>)<br />
/422/ HEROLD, B.; OBERBARNSCHEIDT, B.; GEYER, M.: Glasigkeit bei Zwiebeln –Lässt sie sich mit zerstörungsfreier Methode<br />
bestimmen? – Gemüse 9: 28-30 (<strong>2003</strong>)<br />
/423/ HEROLD, B.; OBERBARNSCHEIDT, B.; GEYER, M.; BORSA, B.; KOVÁCS, L.; JAKOVÁC, F.: Verluste bei der Produktion<br />
von Industrietomaten durch mechanische Belastungen. Obst Gemüse Kartoffel Verarbeitung 4: 9-12 (<strong>2003</strong>)<br />
/424/ HOFFMANN, T.; JACOBS, A.: Das PC-Programmpaket MELDOK für die Qualitätskontrolle von Obst, Gemüse und<br />
Speisekartoffeln. Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbeitung, 88 (<strong>2003</strong>) 4, S. 13 - 17<br />
/425/ JAKOB, M.; RULLMANN, M.; GEYER, M.; KLEISINGER, S.: Liegend auf dem Gurkenflieger. Gemüse 10: 10-13 (<strong>2003</strong>)<br />
/426/ KRAMER, E.; V. HASELBERG, C.: Sensible Fühler für Feld und Stall. Neue Landwirtschaft (12): 70-73, <strong>2003</strong><br />
/427/ LATSCH, R.; PROCHNOW, A.; BERG, W.: Ladewagen wird oft unterschätzt – Verfahrensvergleich Futtererntetechnik.<br />
dlz agrarmagazin, H. 12/03, S. 30-34 (<strong>2003</strong>)<br />
/428/ LATSCH, R.; PROCHNOW, A.; BERG, W.: Häcksler oder Ladewagen? Vergleich und Bewertung der Stärken und<br />
Schwächen beider Verfahren. Neue Landwirtschaft, H. 11/03, S. 54-57 (<strong>2003</strong>)<br />
/429/ LINKE, B.: Energie aus der Landwirtschaft - umweltgerecht und ökonomisch? In: Umweltforschung in der Leibniz-<br />
Gemeinschaft - Qualität und Vielfalt. Herausgeber: Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, Bonn,<br />
S. 99-100, <strong>2003</strong><br />
/430/ LINKE, M.; GEYER, M.: Kunststoff oder Karton für Tomaten? Gemüse 7: 26-28 (<strong>2003</strong>)<br />
/431/ SCHLAUDERER, R.: Kaufen nicht um jeden Preis. Im Mähdrusch Kosten senken. Sonderbeilage Bauernzeitung<br />
Nr. 2/<strong>2003</strong><br />
/432/<br />
/433/ SCHLAUDERER. R.: Finanzierungsmodelle für Großmaschinen. Neue Landwirtschaft 1/<strong>2003</strong>, S. 72-75 (<strong>2003</strong>)<br />
/434/ SCHWARZ, J.; KERSEBAUM, K.C.; REUTER, H.I.; WENDROTH, O.: Stickstoff aus dem Rechner - Wie gut sind Rechenmodelle<br />
für die N-Teilflächendüngung? Neue Landwirtschaft (3): 49-51, <strong>2003</strong><br />
/435/ WORMANNS, G.; HOFFMANN, T.: Objektive Ermittlung <strong>des</strong> Kochtyps. Kartoffelbau 54 (<strong>2003</strong>) 9/10, S. 363 - 366<br />
/436/ WORMANNS, G.; HOFFMANN, T.: Elektronischer Schadbildkatalog auch für Speisekartoffeln. Kartoffelbau 54<br />
(<strong>2003</strong>) 11, S. 416 - 418<br />
4.2. Übersichts-Vorträge<br />
/437/<br />
BRUNSCH, R.; SCHLAUDERER, R.; ZASKE, J.: Internationale Forschungsarbeiten <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> Statusseminar. Beiträge<br />
der Ressortforschung zur Globalen Ernährungssicherung. FAL, Braunschweig, 20.11.<strong>2003</strong><br />
/438/ DAMMER, K.-H.: Herbizid- und Fungizidapplikation in Druschfrüchten. GPS- und computergestützter Ackerbau-<br />
Anwenderseminar, Belgern, 26.-27.11.<strong>2003</strong><br />
/439/ DOMSCH, H.: Das Prinzip der Messungen der scheinbaren elektrischen Leitfähigkeit und die Interpretation der<br />
Messergebnisse. GPS- und computergestützter Ackerbau–Anwenderseminar, Belgern, 26.-27.11.<strong>2003</strong><br />
/440/ DOMSCH, H.: Kartierung und Interpretation der elektrischen Bodenleitfähigkeit im Betrieb AgriCo Lindau, Sommertagung<br />
der Bodenspezialisten, Buhlendorf, 10.-12.06.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/441/ EHLERT, D.: Sensor und Satellitentechnik für Precision Farming - Mit Präzision über den Acker. Parlamentarischer<br />
Abend, Lan<strong>des</strong>vertretung Brandenburg in Berlin, 22.10.<strong>2003</strong><br />
/442/ EHLERT, D.: Leistungspotenziale der Sensortechnik bei Düngung und Pflanzen-schutz. DLG, Agritechnica, Hannover,<br />
09.11.<strong>2003</strong><br />
/443/ EHLERT, D.: Unterweisung der Standbetreuer zur technischen Funktion <strong>des</strong> Crop-Meter. Agrocom, Bielefeld,<br />
30.10.<strong>2003</strong><br />
/444/ EHLERT, D.: Unterweisung der Standbetreuer zur technischen Funktion <strong>des</strong> Crop-Meter. Müller-Elektronik, Salzkotten,<br />
30.10.<strong>2003</strong><br />
/445/ FÜRLL, C.: Forschungsergebnisse zur Naturfasergewinnung am <strong>ATB</strong> Bornim. Jahrestagung <strong>des</strong> Deutschen Naturfaserverban<strong>des</strong>,<br />
Potsdam-Bornim, 19.12 <strong>2003</strong><br />
/446/ GEYER, M.: So bleiben Obst und Gemüse länger frisch. Internationale Grüne Woche, Berlin 17.-26.01.<strong>2003</strong><br />
/447/ GEYER, M.: Erntehilfen eine sinnvolle Investition. Unterfränkischen Spargeltagung, Alitzheim b. Sulzheim Würzburg,<br />
20.02.<strong>2003</strong><br />
/448/ GEYER, M.: So bleiben Obst und Gemüse länger frisch. BUGA Rostock 22.05.<strong>2003</strong><br />
/449/ GEYER, M.: Lässt sich die Qualität von Obst und Gemüse messen? BUGA Rostock 22.05.<strong>2003</strong><br />
/450/ GEYER, M.: Aufbereitung von Gemüse. Spezialtechnik für den Gemüsebau, Quedlinburg 11.09.<strong>2003</strong><br />
/451/ GEYER, M.: Stand der mechanischen Ernte und Aufbereitung von Spargel. Brandenburger Spargelseminar, Seddin,<br />
23.10.<strong>2003</strong><br />
/452/ GEYER, M.: Spargelernte - Wie geht es weiter? Von der Handernte zum Vollernter. AGRITECHNICA <strong>2003</strong>, Hannover<br />
11.-15.11.<strong>2003</strong><br />
/453/ GEYER, M.: Bewertung von Ernte- und Sortierverfahren. Mittelfränkischer Spargeltag, Rohr, 18.11.<strong>2003</strong><br />
/454/ GEYER, M.: Nacherntebehandlung bei Gemüse. Arbeitskreis Gemüsebau, Nürnberg, 18.11.<strong>2003</strong><br />
/455/ GEYER, M.; LINKE, M.; KUHRMANN, D.: Einsatz <strong>des</strong> neuen Kühlmöbels mit Luftbefeuchtung Wascio im Einzelhandel.<br />
Präsentation vor Vertretern <strong>des</strong> Handels zum Frischhalten in Präsentationskühlmöbeln mit Verdunstungskühlung<br />
Wascio, in Potsdam, 04.03.<strong>2003</strong><br />
/456/ GEYER, M.; TISCHER, S.: Erntehilfen im Spargelanbau – Möglichkeiten & Grenzen -. 10. Freckenhorster Spargel-<br />
Tage, Warendorf, 17.-19.02.<strong>2003</strong><br />
/457/ GOTTSCHALK, K.: Allgemeine Aspekte der Lagerung insbesondere im Hinblick auf die schwierigen Erntebedingungen<br />
<strong>2003</strong>. Mitgliederversammlung Sächsischer Qualitätskartoffelverband e.V.. Nossen/Sachsen, 03.09.<strong>2003</strong><br />
/458/ HERPPICH, W.B.; ZUDE, M.; HEROLD, B.; GEYER, M.: Lässt sich die Qualität von Obst und Gemüse messen? Internationale<br />
Grüne Woche, Berlin, 17.-26.01.<strong>2003</strong><br />
/459/ HOFFMANN, T.: Ergebnisse der 1. Sitzung der Arbeitsgruppe "Risikoanalyse im Einzelhandel". 19. Beratung der<br />
Arbeitsgruppe EDV und Messtechnik in der Qualitätskontrolle von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln. Potsdam-Bornim,<br />
03.-04.06.<strong>2003</strong><br />
/460/ HOFFMANN, T.: JACOBS, A.: Weiterentwicklung von MELDOK 4.3. 20. Beratung der Arbeitsgruppe EDV und<br />
Messtechnik in der Qualitätskontrolle von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln. Potsdam-Bornim, 14.-15.10.<strong>2003</strong><br />
/461/ HOFFMANN, T.; WORMANNS, G.: Kartoffeln bei der Schwarzfleckigkeitskontrolle schneiden oder schälen. Tagung<br />
der Arbeitsgruppe Qualitätskontrolle bei Speisekartoffeln, Groß Lüsewitz, 11.-12.11.<strong>2003</strong><br />
/462/ HOFFMANN, T; WORMANNS, G.; JACOBS, A.: Das PC-Programmpaket MELDOK für die Qualitätskontrolle bei Obst,<br />
Gemüse und Speisekartoffel. Jahrestagung <strong>des</strong> KLAS-Verban<strong>des</strong>, Berlin, 25.-26.11.<strong>2003</strong><br />
/463/ HOFFMANN, T.: Entwicklung einer Methode zur Bestimmung <strong>des</strong> Kochtyps von Speisekartoffeln während der<br />
Vermarktung. Tagung der swisspatat (Dachorganisation der Schweizer Kartoffelwirtschaft), Zollikofen,<br />
06.05.<strong>2003</strong><br />
/464/ KRAMER; E.: "Prosenso.net". Netzwerk zur Unterstützung komplexer Forschungsvorhaben. <strong>ATB</strong> Potsdam-<br />
Bornim, 19.06.<strong>2003</strong><br />
/465/ KRAMER; E.: "Prosenso.net". Komplexe Forschungsvorhaben <strong>des</strong> <strong>ATB</strong>. Vortrag vor einer Wissenschaftsdelegation<br />
der VR China, <strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim, 20.06.<strong>2003</strong><br />
/466/ LINKE, B.: Grundlagen und Verfahren der Biogasgewinnung. 1. Biomassetag Altmark, Gardelagen, 06.10.<strong>2003</strong><br />
/467/ LINKE, B.: Grundlagen, Bemessung und Ergebnisse der Biogasgewinnung aus Energiepflanzen und organischen<br />
Reststoffen. Seminar für Biogasberater der Bun<strong>des</strong>länder von Österreich, Klagenfurt, 17.11.-18.11.<strong>2003</strong><br />
141<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
142<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/468/ LINKE, B.: Biogas - Energiereserve der Landwirtschaft - Grundlagen und Verfahren der Biogasgewinnung. Seminar<br />
der Brandenburgischen Landwirtschaftsakademie (BLAK), Heimvolkshochschule Seddin, 21.11.<strong>2003</strong><br />
/469/ LINKE, B.; GRUNDMANN, P.: Anaerobe Vergärung von Roggen in landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Fachgespräch<br />
Roggen als nachwachsender Rohstoff, Potsdam Rehbrücke, 05.03.-06.03.<strong>2003</strong><br />
/470/ MALY, P.; HOFFMANN, T.: Verfahrenstechnische Untersuchungen zur beschädigungsarmen Ernte, zum schonenden<br />
Transport und zur belastungsarmen Lagerung von Kartoffeln. Erweiterte Vorstandssitzung <strong>des</strong> KLAS-<br />
Verban<strong>des</strong>, Weidensdorf, 22.05.<strong>2003</strong><br />
/471/ MUNDER, F.: Effizienter Aufschluss von Naturfasern und Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verfahrens, Jahrestagung <strong>des</strong><br />
Naturfaserverbunds Deutschland, 19.12. <strong>2003</strong><br />
/472/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technology of the processing of natural fibres. Symposium bei LCDA Bar sur Aube,<br />
Frankreich, 06.03.<strong>2003</strong><br />
/473/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technologie zum Faseraufschluss und Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verfahrens. Präsentation<br />
für Peter van Nieuvenhoven, <strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim, 17.01.<strong>2003</strong><br />
/474/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technologie zum Faseraufschluss und Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verfahrens. Präsentation<br />
für Pahren-Agrar GmbH, <strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim, 21.01.<strong>2003</strong><br />
/475/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technology for processing of hemp and the economy of the process. Presentation<br />
to LCDA Bar sur Aube, Thales Paris, Frankreich, 23.01.<strong>2003</strong><br />
/476/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technologie zum Faseraufschluss und Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verfahrens. Präsentation<br />
für Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, Besichtigung, 24.01.<strong>2003</strong><br />
/477/ MUNDER, F.; FÜRLL, C.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technology for processing of hemp and the economy of the process.<br />
Presentation to Canadian Embassy, 19.02.<strong>2003</strong><br />
/478/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technology for processing of bast fibers and coir. Presentation to Hayleys Export<br />
LTD, 26.02.<strong>2003</strong><br />
/479/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technologie zum Faseraufschluss und zur Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verfahrens. Präsentation<br />
für Universität Nowosibirsk , 19.03.<strong>2003</strong><br />
/480/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technologie zum Faseraufschluss und zur Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verfahrens. Präsentation<br />
für APH Hinsdorf, 31.03.<strong>2003</strong><br />
/481/ MUNDER, F.; FÜRLL, C.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technologie zum Faseraufschluss und zur Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verfahrens.<br />
Präsentation für Fernwärme Eisenkappel, Österreich, 11.07.<strong>2003</strong><br />
/482/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technology for processing of bast fibers and coir. Presentation to Ministry of Agriculture,<br />
Vizepresident, VR China, 22.09.<strong>2003</strong><br />
/483/ MUNDER, F.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technologie zum Faseraufschluss und zur Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verfahrens. Präsentation<br />
für ETHZ Zürich / Tänikon, Schweiz, 21.10.<strong>2003</strong><br />
/484/ MUNDER, F.; FÜRLL, C.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technology for processing of flax. Presentation to Faserverbund Russland,<br />
22.10.<strong>2003</strong><br />
/485/ MUNDER, F.; FÜRLL, C.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technologie zum Faseraufschluss und zur Wirtschaftlichkeit <strong>des</strong> Verfahrens.<br />
Präsentation für Bauernverband Altenburgerland, 18.11.<strong>2003</strong><br />
/486/ MUNDER, F.; FÜRLL, C.; HEMPEL, H.: <strong>ATB</strong>-Technology for processing of hemp and flax and the economy of the<br />
process. Presentation to Ecofibre Industries Ltd., Australia, 01.12.<strong>2003</strong><br />
/487/ PROCHNOW, A.; SCHLAUDERER, R.: Wirtschaftliche Aspekte großflächiger Offenlandvorhaben. Tagung: Beweidung<br />
mit großen Wild- und Haustieren – Bedeutung für Offenlandmanagement und Märkte. Akademie für Natur-<br />
und Umweltschutz Baden Württemberg, Ministerium für Umwelt und Verkehr, Böblingen, 18.-19.03.<strong>2003</strong><br />
/488/ PROCHNOW, A.; SCHLAUDERER, R.: Ökonomische Bewertung von Offenlandverfahren - Was wird aus Offenland?<br />
Sächsische Lan<strong>des</strong>stiftung Natur und Umwelt Akademie, Lan<strong>des</strong>lehrstätte für Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Oderberge Lebus. Beelitz/Brandenburg, 24.-25.03.<strong>2003</strong><br />
/489/ PROCHNOW, A.; SCHLAUDERER, R.: Ökonomische Bewertung von Beweidungsverfahren auf ehemaligen Truppenübungsplätzen.<br />
Schneverdingen, 29.04.<strong>2003</strong><br />
/490/ PROCHNOW, A.; SCHLAUDERER, R.; HARNISCH, R.: Ökonomische Bewertung von Offenhaltungsverfahren – am<br />
Beispiel ehemaliger Truppenübungsplätze. Weidelandschaften und Wildnisgebiete – Vom Experiment zur Praxis.<br />
Lüneburg, 23.-26.09.<strong>2003</strong><br />
/491/ PROCHNOW, A.; LATSCH, R., BERG, W.: Silierverfahrensvergleich: Feldhäcksler und Ladewagen. DLG-<br />
Podiumsdiskussion. Agritechnica, Hannover, 12.11.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
/492/ ROSE, SANDRA; BRUNSCH, R.: Praxiswünsche bei der Weiterentwicklung automatischer Melksysteme. Workshop<br />
WGM-Jahrestagung, Haus Düsse, Bad Sassendorf, 11.09.<strong>2003</strong><br />
/493/ SCHLAUDERER, R.: Finanzierungsmodelle für Großmaschinen. VDI-MEG. Landtechnik für Profis. Magdeburg,<br />
29.01.<strong>2003</strong><br />
/494/ SCHOLZ, V.: Umweltverträglicher Anbau von Energiepflanzen auf sandigen Böden. Vortrag auf Informationsveranstaltung<br />
der Friedrich-Naumann-Stiftung "Energie vom Acker! Alternative Produktionsfelder für die Landwirtschaft",<br />
Potsdam, 02.10.<strong>2003</strong><br />
/495/ SCHWARZ, J.: „Precision Farming“. Vortrag vor Studenten der Universität Cottbus, <strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim,<br />
22.06.<strong>2003</strong><br />
/496/ VÖLKER, U.: Das Prinzip <strong>des</strong> Pendelsensors zur Biomassekartierung und die Interpretation der Messergebnisse.<br />
GPS- und computergestützter Ackerbau –Anwenderseminar, Belgern, 26.-27.11.<strong>2003</strong><br />
/497/ WORMANNS, G.: <strong>Jahresbericht</strong> der Arbeitsgruppe EDV-und Messtechnik. Tagung <strong>des</strong> Arbeitskreises „Qualitätskontrolle<br />
bei Obst, Gemüse und Speisekartoffeln“ <strong>des</strong> Verban<strong>des</strong> der Landwirtschaftskammern, Bonn,<br />
13.05.<strong>2003</strong><br />
/498/ WORMANNS, G.: Stand der Entwicklungen beim Schadbildkatalog. 20. Beratung der Arbeitsgruppe EDV und<br />
Messtechnik in der Qualitätskontrolle von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln. Potsdam-Bornim, 14.-15.10.<strong>2003</strong><br />
/499/ WORMANNS, G.; HOFFMANN, T.: Neues zur objektiven Bestimmung <strong>des</strong> Kochtyps bei Speisekartoffeln. Tagung<br />
der Arbeitsgruppe Qualitätskontrolle bei Speisekartoffeln, Groß Lüsewitz, 11.-12.11.<strong>2003</strong><br />
/500/ WORMANNS, G.; JACOBS, A.: Die Version 4.3 <strong>des</strong> PC-Programms MELDOK. 19. Beratung der Arbeitsgruppe EDV<br />
und Messtechnik in der Qualitätskontrolle von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln. Potsdam-Bornim, 03.-<br />
04.06.<strong>2003</strong><br />
/501/ ZASKE, J.: Künstliche Nasen und Thermokühe .... Verbraucherschutz, Lebensmittelqualität und -sicherheit. Moderne<br />
Agrartechnik bietet neue Lösungen. Potsdamer Köpfe – Sonntagsvorlesungen in Potsdam. 20. Juli <strong>2003</strong><br />
/502/ ZASKE, J.: Pflanzenbau und Landtechnik – eine fruchtbare Symbiose. Pressekonferenz VDI-LT am 09.11.<strong>2003</strong> in<br />
Hannover<br />
4.3 Übersichts-Poster<br />
/503/ DAMMER, K.-H.: Teilflächenspezifische Applikation von Pflanzenschutzmitteln. Brandenburg-Tag, LAUF-Stand,<br />
Potsdam, 06.09.<strong>2003</strong><br />
/504/ PECENKA, R.; FÜRLL, C.; BRÜNING, H.: Wirtschaftlicher Anlagenbetrieb in der Hanffasergewinnung,<br />
AGRITECHNIKA <strong>2003</strong>, Hannover, 09.-15.11.<strong>2003</strong><br />
/505/ ROSE, SANDRA: Alternative Leistungsförderer für Absetzferkel. Preisverleihung <strong>des</strong> Ministeriums für Landwirtschaft,<br />
Umwelt und Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg, Humboldt-Universität Berlin, 02.07.<strong>2003</strong><br />
/506/ ROSE, SANDRA: Kraftübertragung vom Melkzeug auf die Zitze. Jahrestagung WGM, Haus Düsse, Bad Sassendorf,<br />
09.-11.09.<strong>2003</strong><br />
143<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
144<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
5 Patente, Lizenzen, Ausgründungen Lizenzen<br />
Patents, Licences, Business Start-Ups Lizenzen MELDOK 4.3<br />
- Amt für Landwirtschaft Bützow<br />
Patente<br />
- Amt für ländliche Räume Kiel<br />
- Amt für Landwirtschaft u. Flurneuordnung Süd- Außenstelle<br />
Abdeckmaterial für flüssige Substanzen und Haufwerke<br />
Halle<br />
und Verfahren zu seiner Herstellung - Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion Koblenz<br />
Art: Internationale Patentanmeldung (PCT/EP03/00301) - Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Rhein-<br />
14.01.<strong>2003</strong><br />
land-Pfalz<br />
Erfinder: BERG, WERNER<br />
- Bezirksregierung Braunschweig<br />
- Bezirksregierung Hannover<br />
Einrichtung und Verfahren zur Erkennung grüner Pflanzen<br />
Deutsche provisorische Patentanmeldung<br />
- Bun<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft und Ernährung Bonn<br />
- Lan<strong>des</strong>amt für Ernährungswirtschaft und Jagd Nordrhein-<br />
Westfalen<br />
- Lan<strong>des</strong>amt für Landwirtschaft und Ernährung Frankfurt/O.<br />
Datum: 22.01.03<br />
- Landkreis Dahme-Spreewald<br />
Patent-Nr: 103 02579-0-52<br />
Erfinder: BÖTTGER, HARTMUT; LANGNER, HANS; SCHMIDT,<br />
HELMUT<br />
Einrichtung und Verfahren zum Messen von Pflanzenbeständen<br />
Deutsche provisorische Patentanmeldung,<br />
Datum: 02.10.03<br />
Patent-Nr: 103 46 541.3<br />
Erfinder: EHLERT, DETLEF; SCHMIDT, HELMUT<br />
- Landkreis Elbe-Elster<br />
- Landkreis Havelland<br />
- Landkreis Märkisch-Oderland<br />
- Landkreis Oberhavel<br />
- Landkreis Prignitz<br />
- Landkreis Teltow-Fläming<br />
- Landkreis Uckermark<br />
- Landwirtschaftskammer Saarbrücken<br />
- Landwirtschaftskammer Weser-Ems<br />
- Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz, Raumordnung<br />
Potsdam<br />
- Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährung<br />
GmbH Wien<br />
- Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährung<br />
GmbH Wien<br />
Verfahren zur Ernte, Konservierung, Aufbereitung und<br />
Verarbeitung von Naturpflanzen<br />
Deutsches Verfahrenspatent - Regierungspräsidium Gießen<br />
30.09.<strong>2003</strong> (Anmeldedatum)(10346365.8) - Sächsische Lan<strong>des</strong>anstalt f. Landwirtschaft<br />
Erfinder: FÜRLL, CHRISTIAN; IDLER, CHRISTINE.; PECENKA, - Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Berlin<br />
RALF; LINKE, BERND<br />
- Stadt Frankfurt (Oder)<br />
- Stadtverwaltung Cottbus, Veterinär- und Lebensmittelüber-<br />
Verfahren zur Aufbereitung von Naturfaserpflanzen,<br />
Patentanmeldung<br />
(AZ.:103 46 365.8) am 30.09.<strong>2003</strong>,<br />
wachungsamt<br />
- Stadtverwaltung Potsdam<br />
- Thüringer Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft<br />
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Oberspree -<br />
Institut für Agrartechnik Bornim<br />
Lausitz<br />
Erfinder: FÜRLL, CHRISTIAN; IDLER, CHRISTINE; PECENKA,<br />
RALF; LINKE, BERND<br />
HOFFMANN, THOMAS; WORMANNS, GERHARD<br />
Lizenzen Schadbildkatalog<br />
Verfahren und Vorrichtung zum Klassieren von Kartof- - Amt für ländliche Räume Kiel<br />
feln<br />
- Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Rhein-<br />
Patentanmeldung<br />
29.09.<strong>2003</strong><br />
(DE 103 45 613.9)<br />
Institut für Agrartechnik Bornim e.V.<br />
Erfinder: HOFFMANN, THOMAS<br />
land-Pfalz<br />
- Bayerischen Lan<strong>des</strong>anstalt für Ernährung<br />
- Bun<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft und Ernährung Bonn<br />
- Hessisches Lan<strong>des</strong>amt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft<br />
Wetzlar<br />
- Lan<strong>des</strong>amt für Ernährungswirtschaft und Jagd Nordrhein-<br />
Westfalen<br />
Verfahren und Schachttrockner zum Trocknen von rie- - Lan<strong>des</strong>amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft Frankselfähigen<br />
Schüttgütern<br />
furt/O.<br />
Verfahrenspatent<br />
eingereicht am 30.11.<strong>2003</strong><br />
(noch ohne Patentnummer)<br />
Institut für Agrartechnik Bornim<br />
- Landkreis Teltow-Fläming<br />
- Landwirtschaftskammer Saarbrücken<br />
- Landwirtschaftskammer Weser-Ems<br />
- Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-<br />
Württemberg<br />
Erfinder: MELLMANN, JOCHEN; JOST, OLIVER - Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz, Raumordnung<br />
Potsdam<br />
Verfahren und Einrichtung zum Schälen von Kartoffeln - Regierungspräsidium Gießen<br />
und anderen Knollenfrüchten<br />
Patent<br />
03.07.<strong>2003</strong><br />
(DE 102 30 627 C1)<br />
Institut für Agrartechnik Bornim e.V.<br />
Erfinder: KLUG, ANTON; HOFFMANN, THOMAS<br />
- Sächsische Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft<br />
- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Berlin<br />
- Stadt Frankfurt/Oder<br />
- Stadtverwaltung Schwerin<br />
- Thüringer Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft<br />
HOFFMANN, THOMAS; WORMANNS, GERHARD<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
Ausgründung<br />
BiogasBeratungBornim GmbH (B 3 ), Potsdam<br />
28.08.03<br />
AUSGRÜNDER: HEIERMANN, MONIKA; LUCKHAUS,<br />
CHRISTOPH; MELCHER, FRANK; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
6 Preise und Auszeichnungen<br />
Awards and Honors<br />
DIPL.-ING. JAN MUMME<br />
Max-Eyth-Nachwuchsförderungspreis <strong>2003</strong><br />
für eine herausragende Diplomabschlussarbeit<br />
23. Mai <strong>2003</strong><br />
DIPL.-ING. AGR. SANDRA ROSE<br />
Preis <strong>des</strong> Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und<br />
Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg<br />
für eine herausragende Diplomabschlussarbeit<br />
02. Juli <strong>2003</strong><br />
DR. RER. HORT. MANUELA ZUDE<br />
Technologie Transferpreis Brandenburg <strong>2003</strong> für die<br />
Entwicklung und Fertigung eines kommerziellen Gerätes<br />
zur Fruchtqualitätsbestimmung durch eine ausgegründete<br />
Firma<br />
12. Juni <strong>2003</strong><br />
7 Sonstige Veranstaltungen mit Praxisbezug<br />
Other Practice Related Events<br />
Einweisung der Kontrolleure für Obst, Gemüse und<br />
Speisekartoffeln der Landkreise von Brandenburg in die<br />
Neuentwicklungen beim PC-Programm MELDOK 4.3.<br />
<strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim<br />
28.01.<strong>2003</strong><br />
WORMANNS, GERHARD.; JACOBS, ANDREE.<br />
Sozioökonomische Bewertung Potenziale an verfügbaren<br />
Substraten aus dem Agrarbereich im Land Brandenburg<br />
Grüne Woche <strong>2003</strong>, Berlin<br />
Januar <strong>2003</strong><br />
GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Bericht aus der Arbeitsgruppe Precision Farming auf der<br />
Tagung <strong>des</strong> Arbeitskreises Applikationstechnik der<br />
Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft, Stein<br />
19.-20.03.<strong>2003</strong><br />
DAMMER, KARL-HEINZ<br />
Fachexkursion "Produktionsbauten in der Landwirtschaft",<br />
Studenten der BTU Cottbus,<br />
Moderation in Groß Kreutz, Blankenfelde<br />
24.04.<strong>2003</strong><br />
BREHME, ULRICH<br />
Fachdiskussion Versuchsergebnisse Pedometertest<br />
Tierärztliche Hochschule Hannover, Arbeitsbereich Bestandstiermedizin,<br />
04/<strong>2003</strong><br />
BREHME, ULRICH<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse 145<br />
19. Beratung der Arbeitsgruppe EDV und Messtechnik in<br />
der Qualitätskontrolle von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln.<br />
<strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim<br />
03.06. - 04.06.<strong>2003</strong><br />
WORMANNS, GERHARD<br />
Möhrenbetrieb TERRA Wiesenburg<br />
24.06.<strong>2003</strong><br />
GEYER, MARTIN<br />
Konzept zur Leistungssteigerung der Faseraufschlussanlage<br />
CanaTex Greiz,<br />
<strong>ATB</strong> Potsdam<br />
Juni <strong>2003</strong><br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
Feldtag – Vorstellung <strong>des</strong> Pendelsensors vor Brandenburger<br />
Landwirten<br />
Gölsdorf<br />
25.07.<strong>2003</strong><br />
EHLERT, DETLEF<br />
Beratung bei Obstanbauer der Region (Kleinert) Thema:<br />
Brixbestimmung<br />
02.09.<strong>2003</strong><br />
ZUDE, MANUAELA<br />
Beratungsgespräch<br />
SL Schwanteland<br />
09.09.<strong>2003</strong><br />
GEYER, MARTIN; SCHLÜTER, OLIVER<br />
Ringversuche mit<br />
1) Werder, Firma Werderfrucht GmbH<br />
18.08., 25.08., 04.09., 15.09.<strong>2003</strong><br />
2) Jork, Obstversuchsanstalt der Landwirtschaftskammer<br />
Hannover<br />
25.08.,15.09.<strong>2003</strong><br />
3) Skierniewice, Research Institute of Pomology and<br />
Floriculture<br />
18.08.,25.08.,04.09.,18.09.<strong>2003</strong><br />
4) Bavendorf, Obstbauversuchsanlage der Universität<br />
Hohenheim<br />
5) Wädenswil, Eidgenössische Forschungsanstalt für<br />
Obst-, Wein- und Gartenbau<br />
(bei den Orte 4 + 5 wurden die Versuche terminlich<br />
zusammengelegt)<br />
14./15.08., 26./27.08., 05./06.09., 16./17.09.<strong>2003</strong><br />
ZUDE, MANUELA; ROHRBACH, ALEXANDER; HEROLD, BERND<br />
Projektberatung – Schätzung von Vorhersagefunktionen,<br />
AG Biometrie und Statistik, Universität Halle, 10/<strong>2003</strong><br />
BREHME, ULRICH<br />
Informationsveranstaltung der Friedrich-Naumann-<br />
Stiftung und <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> "Energie vom Acker! Alternative<br />
Produktionsfelder für die Landwirtschaft"<br />
<strong>ATB</strong> Potsdam<br />
02.10.<strong>2003</strong><br />
SCHOLZ, VOLKHARD; FOLTAN, HELENE<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
146<br />
20. Beratung der Arbeitsgruppe EDV und Messtechnik in<br />
der Qualitätskontrolle von Obst, Gemüse und Speisekartoffeln<br />
<strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim<br />
14.10. - 15.10.<strong>2003</strong><br />
WORMANNS, GERHARD<br />
Möhrenversuch mit der Forschungsanstalt Geisenheim<br />
(Prof. Paschold)<br />
ab 15.10.-19.12.<strong>2003</strong> (tageweise)<br />
ZUDE, MANUAELA, ROHRBACH, ALEXANDER<br />
Sensorgestützte Herbizidapplikation. Fachgespräch mit<br />
Ing. Klem, K. und Dr. Spitzer, T. , Agricultural Reserarch<br />
Institute Kromeriz, Department of Integeted Plant Protection,<br />
Czech Republic,<br />
<strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim<br />
11.11.<strong>2003</strong><br />
DAMMER, KARL-HEINZ<br />
Stand und Aussichten der Naturfasergewinnung. Diskussion<br />
und Maschinenvorführung<br />
<strong>ATB</strong> Potsdam-Bornim<br />
17.11.<strong>2003</strong><br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
Arbeitsaufenthalt zum Thema "Melktechnik", Begutachtung<br />
der Anlage und Beratungsgespräch,<br />
Milchviehanlage Dabergotz<br />
09.12.<strong>2003</strong><br />
ROSE, SANDRA<br />
Spargelbetrieb Simianer<br />
12.12.<strong>2003</strong><br />
GEYER, MARTIN<br />
Arbeitsgespräche zur Bildung eines Verbun<strong>des</strong> zur industriellen<br />
Anwendung biotechnologischer Forschung im<br />
ländlichen Raum<br />
Viele Arbeitsgespräche im Jahresverlauf, an verschiedenen<br />
Orten<br />
KRAMER, ECKART; VENUS, JOACHIM; GRUNDMANN, PHILIPP<br />
8 Stellungnahmen, Gutachten und sonstige Ausarbeitungen<br />
Expert’s Reports, Advisory Opinions and Other<br />
Statements<br />
8.1 Beratung von Unternehmen<br />
Herdenmanagementberatung zum Pedometereinsatz,<br />
GbR Hasenring Edemissen, 01/<strong>2003</strong><br />
BREHME, ULRICH<br />
Bauberatung – Rekonstruktionsvorschläge für Stallhülle<br />
L 203 Carlowitz KG, Kühnitzsch, 02/<strong>2003</strong><br />
BREHME, ULRICH<br />
Ergebnisdiskussion Pedometerversuch und Versuchskonzeption<br />
Rohlmann & Kern GbR Gröbers-Osmünde,<br />
04/<strong>2003</strong><br />
BREHME, ULRICH<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
Bauberatung – Umbaukonzeption für MVA 1232 Vogtlandmilch<br />
Hartmannsdorf, 04/<strong>2003</strong><br />
BREHME, ULRICH<br />
Herdenmanagementberatung zum Pedometerversuch<br />
automatische Datenübertragung, GbR Pietschmann,<br />
11/<strong>2003</strong><br />
BREHME, ULRICH<br />
Fachdiskussion "Precision Farming", Kollegen der LfL<br />
Köllitsch, 03/<strong>2003</strong><br />
BREHME, ULRICH; BRUNSCH, REINER<br />
Beratung zu Melktechnikproblemen, Agrargenossenschaft<br />
Dabergotz, 09.12.<strong>2003</strong><br />
BRUNSCH, REINER; ROSE, SANDRA<br />
Stellungnahme für Institut für Innovations- und Umweltmanagment<br />
in Graz (A), November <strong>2003</strong><br />
DAMMER, KARL-HEINZ<br />
Beratung zum Ausbau eines Kistenlagers für Pflanzkartoffeln.<br />
Stoever Frischdienst GmbH & Co KG, Simmersdorf /<br />
Brandenburg, Januar <strong>2003</strong><br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Beratung zum Ausbau eines Kistenlagers für Pflanzkartoffeln.<br />
Weidaland Agrarhandel GmbH<br />
Nemsdorf-Göhrendorf / Sachsen., August <strong>2003</strong><br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Beratung zur Einführung einer Technologie zur Gewinnung<br />
von synthetischen Kraftstoffen aus Biomasse,<br />
MLUR, Brandenburg, 22.10.<strong>2003</strong><br />
GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Beratung zur ökonomischen Bewertung eines Bioraffinerie-Vorhabens<br />
in der Region Oberhavel, Brandenburg,<br />
Tetra-Ingenieure<br />
GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Beratung zur Schaffung eines Industrieparks am Standort<br />
Schwarze Pumpe, Firma AUTEV<br />
GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Beratung zur Errichtung einer Biogas – Trockenvergärungsanlage,<br />
Firma OWK<br />
GRUNDMANN, PHILIPP<br />
Planung <strong>des</strong> Baus einer Pflanzenkläranlage, Beratung<br />
der Agrargenossenschaft Stüdenitz, Juli <strong>2003</strong><br />
KERN, JÜRGEN<br />
Planung <strong>des</strong> Baus einer Pflanzenkläranlage, Beratung<br />
der Kranemann Gartenbaumaschinen GmbH, August<br />
<strong>2003</strong><br />
KERN, JÜRGEN<br />
Entwurf einer Rahmenvereinbarung zur Kooperation auf<br />
dem Gebiet „Bioraffinerie“. Partner: <strong>ATB</strong>, tetra, UIT,<br />
WfO, IAP.<br />
KRAMER, ECKART
Gutachten zum Betrieb einer Faseraufschlussanlage für<br />
Hanf,Cana Tex GmbH, Mylauer Str. 1, 07973 Greiz,<br />
Oktober <strong>2003</strong><br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
Stellungnahme für Institut für Innovations-u. Umweltmanagment<br />
in Graz (A), Oktober <strong>2003</strong><br />
LANGNER, HANS<br />
Ermittlung von Biogas- und Methanausbeuten in Laborversuchen:<br />
- Fa. Proma-Ingenieurbau GbR Burg, Sachsen-Anhalt,<br />
Februar <strong>2003</strong><br />
- Schweineproduktion Burkersdorf GmbH Frauenstein,<br />
Sachsen, Februar <strong>2003</strong><br />
- Osterhuber AGRAR GmbH Gut Ferdinandshof Wilhelmsburg,<br />
Mecklenburg-Vorpommern, März <strong>2003</strong><br />
- Farmatic Abwasser und Wassertechnik GmbH Erkner,<br />
Berlin, März <strong>2003</strong><br />
- BIO Work GmbH Werder/Havel OT Phöben, Brandenburg,<br />
März <strong>2003</strong><br />
- Reiner Jordan Einbeck Volksen, Sachsen-Anhalt, März<br />
<strong>2003</strong><br />
- Proma-Ingenieurbau GbR Burg, Sachsen-Anhalt, April<br />
<strong>2003</strong><br />
- Sonni Franello Tier- und Showprogramme Platschow,<br />
Brandenburg, April <strong>2003</strong><br />
- Landwirtschaftskammer Rheinland, Bonn, Rheinland-<br />
Pfalz, Mai <strong>2003</strong><br />
- Osterhuber AGRAR GmbH Gut Ferdiandshof Wilhelmsburg,<br />
Mecklenburg-Vorpommern, Mai <strong>2003</strong><br />
- Bioplan Phöben, Brandenburg, Mai <strong>2003</strong><br />
- Lehmann Maschinenbau GmbH Jocketa, Sachsen,<br />
August <strong>2003</strong><br />
- Dexheimer Umweltsysteme Frankenthal, August <strong>2003</strong><br />
- Biogran GmbH Hamburg, Skawina Polen, August <strong>2003</strong><br />
- Agrargenossenschaft Trebbin, Brandenburg, August<br />
<strong>2003</strong><br />
- Spradau GmbH Zehdenick, Brandenburg, September<br />
<strong>2003</strong><br />
- Proma Ingenieurbau GbR Burg, Sachsen-Anhalt, Oktober<br />
<strong>2003</strong><br />
- Ingenieurbüro Paulick Erkner, Brandenburg, Oktober<br />
<strong>2003</strong><br />
- Dr. Waldauer Gruber, Bonn, Nordrhein-Westfalen, Oktober<br />
<strong>2003</strong><br />
- Ing.-büro M. Belitz Pritzwalk, Brandenburg, Oktober<br />
<strong>2003</strong><br />
- Herr Schulze Dölgelin, Brandenburg, Oktober <strong>2003</strong><br />
- SNP Icker GmbH Belm-Icker, Niedersachsen, November<br />
<strong>2003</strong><br />
- Landwirtschaftskammer Rheinland, Bonn, Nordrhein-<br />
Westfalen, November <strong>2003</strong><br />
- SNP Icker GmbH Belm-Icker, Niedersachsen, Dezember<br />
<strong>2003</strong><br />
- Friweika Weidensdorf, Sachsen, Dezember <strong>2003</strong><br />
- Lan<strong>des</strong>amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft<br />
Güterfelde, Brandenburg, Dezember <strong>2003</strong><br />
- BEKON GmbH & Co.KG Landshut, Bayern, Dezember<br />
<strong>2003</strong><br />
- Unternehmensberatung Biogas Nauen, Brandenburg,<br />
Dezember <strong>2003</strong><br />
- Wildberger Schweinefleisch GmbH Wildberg, Brandenburg,<br />
Dezember <strong>2003</strong><br />
- BIO Work GmbH Werder, Brandenburg, Dezember<br />
<strong>2003</strong><br />
LINKE, BERND; SCHELLE, HANNELORE<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse 147<br />
Studie zur Wirksamkeit der Neuentwicklung der klimatisierten<br />
Verkaufstruhe der LINDE AG. Potsdam, März<br />
<strong>2003</strong>, S. 1-20 (+ 3 Anlagen)<br />
LINKE, MANFRED; GEYER, MARTIN; IDLER, CHRSITINE;<br />
KUHRMANN; DANIELA; MÜLLER KATRIN<br />
Versuchsprogramm zur Ursachenermittlung der Dioxinbildung<br />
bei der Grünfuttertrocknung im Trockenwerk<br />
Niemegk, Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz<br />
und Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg (MLUR),<br />
Oktober <strong>2003</strong><br />
MELLMANN, J.; JOST, O.<br />
Versuche zur Aufnahme <strong>des</strong> Ist-Zustan<strong>des</strong> der Trocknungsanlage<br />
im Heilpflanzen-Trockenwerk Rockendorf,<br />
Agrarprodukte Ludwigshof e.G., Thüringen, Dezember<br />
<strong>2003</strong><br />
MELLMANN, JOCHEN; JOST, OLIVER<br />
Informationen zum Emissionsverhalten von Putenställen.<br />
b&s-GmbH Leipzig, mehrfach im Jahr <strong>2003</strong><br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
Information zu Geruchsemissionswerten bei der Putenhaltung.<br />
Roman Koch, Fürstenfeldbruck, Januar <strong>2003</strong><br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
Stellungnahme zum Problem der Emission und Immission<br />
beim Vergleich zwischen Spaltenböden und Vollböden<br />
mit Faltschieber bei der Milchviehhaltung. Dr. Florian<br />
von Sothen, Bauernverband Schleswig-Holstein, Mai<br />
<strong>2003</strong><br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
Stellungnahme zur Auswirkung eines bepflanzten<br />
Schutzwalles auf die Immissionssituation der Sauenanlage<br />
Saubach. A + J Agrar GmbH & Co. KG Saubach,<br />
August <strong>2003</strong><br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
Stellungnahme zu "Geruchsprobleme mit Güllebehälter<br />
– Strohmulch-Abdeckung", Landwirt Heinrich Porth,<br />
Winsen/L., Dezember <strong>2003</strong><br />
MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
Konzept für eine kurzfristige Rationalisierung der Faseraufschlussanlage<br />
CanaTex Greiz mit dem Ziel Qualitätssicherung<br />
der Fasern und Erhöhung der Leistung,<br />
CanaTex Greiz, November <strong>2003</strong><br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
Fachtechnische Beschreibung zum BMU-Förderantrag<br />
Demonstrationsvorhaben EnergieZentrum Schwante,<br />
EnergieZentrum Schwante GmbH, Mai <strong>2003</strong><br />
PLÖCHL, MATTHIAS; LUCKHAUS, CHRISTOPH; BERGK,<br />
MARTINA<br />
Konzeption einer 2,5 MW-ORC-Anlage auf Biomassebasis<br />
für den Gutshof Langerwisch. Beratung im Auftrag<br />
von ETI Brandenburg, Januar-Mai <strong>2003</strong><br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Demonstrationsvorhaben - Biodiesel aus Russland. Beratung<br />
im Auftrag der Beratungs- und Service-<br />
Gesellschaft Umwelt mbH Berlin, Mai-Juli <strong>2003</strong><br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
148<br />
Entwicklung einer Drehkolben-Hochtemperatur-<br />
Entspannungsmaschine für Biomasse. Beratung im Auftrag<br />
der Verfahrenstechnik GmbH Britz,<br />
Juli-Oktober <strong>2003</strong><br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Ermittlung der optimalen Pelletierparameter von Klärschlamm-Stroh-Gemischen.<br />
Untersuchung im Auftrag<br />
der Anlagenbau-Verfahrenstechnik Unternehmensberatung<br />
GmbH Berlin, November-Dezember <strong>2003</strong><br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Bemessungskatalog Güllerohrleitungen, Beratung, Fa.<br />
P. Sauer, Werksvertretungen, Hösbach, April <strong>2003</strong><br />
TÜRK, MENO<br />
Bemessungskatalog Güllerohrleitungen, Beratung, Fa.<br />
Formatic Biogas Energy AG, Notorf, April <strong>2003</strong><br />
TÜRK, MENO<br />
Bemessung Güllerohrleitungen/Viskosität, Fa. Bio Energy<br />
Biogas GmbH, Bad Oeynhausen, August <strong>2003</strong><br />
TÜRK, MENO<br />
Bemessung Güllerohrleitungen/Verfahrensweise, Fa.<br />
Hidrostal GmbH, Wendlingen, September <strong>2003</strong><br />
TÜRK, MENO<br />
Rechenprogramm ROHRWIN, Einführung und Beratung<br />
Agricola, Ing.-Büro, Otice u Opavy (Tschechien), November<br />
<strong>2003</strong><br />
TÜRK, MENO<br />
8.2 Stellungnahmen, Gutachten und sonstige Ausarbeitungen<br />
für Behörden<br />
Mitglied der Berufungskommission für die Juniorprofessur<br />
"Precision Agriculture" an der Humboldt-Universität<br />
zu Berlin, 1. Halbjahr <strong>2003</strong><br />
BRUNSCH, REINER<br />
Zuarbeit für eine Verwaltungsanweisung <strong>des</strong> MLUR<br />
Brandenburg: „Ammoniakemissionen aus der Putenhaltung“.<br />
Mai bis Juli <strong>2003</strong><br />
BRUNSCH, REINER; MÜLLER, HANS-JOACHIM<br />
3 Stellungnahmen für BLE (BMVEL)<br />
Februar und Dezember <strong>2003</strong><br />
EHLERT, DETLEF; DOMSCH, HORST<br />
Fallstudie im Auftrag <strong>des</strong> Ministeriums für Landwirtschaft,<br />
Umweltschutz und Raumordnung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>:<br />
„Ursachenanalyse und technische Möglichkeiten zur<br />
Verringerung der Dioxinbildung bei der Grünfuttertrocknung.<br />
Brandenburg“<br />
August <strong>2003</strong><br />
FÜRLL, CHRISTIAN; MELLMANN, JOCHEN; SCHOLZ,<br />
VOLKHARD<br />
Stellungnahme zur EU-Vermarktungsnorm für Äpfel, Dezember<br />
<strong>2003</strong><br />
GEYER, MARTIN<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
Gutachten für Herrn Dr. Andreas Bertram, Professur<br />
„Technik im Gartenbau“ im Fachbereich Agrarwissenschaften<br />
der Fachhochschule Osnabrück<br />
GEYER, MARTIN<br />
Gutachten Diplomarbeit: C. Demir.<br />
Technische Universität Berlin<br />
April <strong>2003</strong><br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Gutachten für die BTU Cottbus, Diplomarbeit von Tangang<br />
Ernestine Andandoh "Briquetting of Straw for Use<br />
as Biofuel", November <strong>2003</strong><br />
HELLEBRAND, HANS JÜRGEN<br />
Zuarbeit für MLUR: „Mykotoxine - Gefahr unserer hochentwickelten<br />
Landwirtschaft?“, Mai <strong>2003</strong><br />
IDLER, CHRISTINE<br />
Erhebung zum Einsatz und zur Reinigungsleistung von<br />
Pflanzenkläranlagen in allen 14 brandenburgischen<br />
Landkreisen. Darstellung von Zwischenergebnissen für<br />
den Landkreistag Brandenburg und die unteren Wasserbehörden<br />
der Landkreise, April <strong>2003</strong><br />
KERN, JÜRGEN<br />
Bericht über das im Sommer 2002 mit der Universität<br />
Potsdam durchgeführte studentische Praktikum „Gewässerökologie<br />
und Landnutzung“, Aktenzeichen: 83/72-<br />
SOB 645 an das Lan<strong>des</strong>umweltamt Brandenburg sowie<br />
an das Lan<strong>des</strong>amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft,<br />
Potsdam und Güterfelde, Mai <strong>2003</strong><br />
KERN, JÜRGEN; KNÖSCHE, R.; WEITHOFF, G.<br />
Gutachten zur Diplomarbeit „Mathematische Modellierung<br />
der Warmluft– Getreidetrocknung unter Berücksichtigung<br />
<strong>des</strong> Wärme- und Stoffübergangs im Einzelkorn“<br />
von Herrn Falk Eilers zur Erlangung <strong>des</strong> akademischen<br />
Gra<strong>des</strong> eines Diplom-Wirtschaftsmathematiker (FH),<br />
(eingereicht an der Fachhochschule für Technik und<br />
Wirtschaft Berlin), August <strong>2003</strong><br />
MODEL, NIKOLAUS; MALTRY, WERNER<br />
Stellungnahme zum Antrag Dr. Augsten vom 29.09.03<br />
Umweltministerium Bonn<br />
23.10.<strong>2003</strong><br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
Gutachten zur Diplomarbeit von Ruthenberg, Ch.-M.:<br />
„Entwicklung geeigneter Messverfahren für die prozessbegleitende<br />
Beurteilung der Zusammensetzung von Faser-Schäben-Gemischen<br />
im Hanfaufschluss“, Juli <strong>2003</strong><br />
PECENKA, RALF<br />
Gutachten zur B.Sc-Arbeit von BUHMANN, MARIE<br />
(Abschluss 01/03)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Verfahren zur Offenhaltung <strong>des</strong> ehemaligen<br />
Truppenübungsplatzes Glau“<br />
PROCHNOW, ANNETTE
Gutachten zur Diplomarbeit von MÄHNERT, PIA<br />
(Abschluss 02/03)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema: „Grassorten als Kosubstrate bei der Biomethanisierung“<br />
PROCHNOW, ANNETTE<br />
Gutachten zur Diplomarbeit von MEIERHÖFER, JOHANN<br />
(Abschluss 05/03)<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-<br />
Gärtnerische Fakultät<br />
Thema der Arbeit: „Verfahrenstechnische Maßnahmen<br />
für faunaschonende Maßnahmen bei der Grünlandmahd.“<br />
PROCHNOW, ANNETTE<br />
Gutachten zur Eignung von Frederik Pischke für ein<br />
M.Sc. Programm an der Norwich University, UK, Mai<br />
<strong>2003</strong><br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
Gutachten zur B.Sc. Arbeit von Frederik Pischke: „Traditional<br />
risk prediction and prevention strategies in the San<br />
Pedro catchment area of Bolivia“, Juli <strong>2003</strong><br />
SCHLAUDERER, RALF<br />
Stellungnahme zum Projektantrag im Auftrag <strong>des</strong> Ministeriums<br />
für Wirtschaft <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg „Elektrische<br />
Energie aus Biomasse“, April 2002<br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
Gutachten zur Diplomarbeit von Herrn Hielscher-Tölzer<br />
ZUDE, MANUELA<br />
8.3 Sonstige Stellungnahmen und Gutachten<br />
Landwirtschaftsverlag MeLa, September <strong>2003</strong><br />
EHLERT, DETLEF<br />
103 Gutachten im Rahmen <strong>des</strong> VDI-Programmausschusses<br />
Landtechnik<br />
EHLERT, DETLEF<br />
Gutachten für Journal of Industrial Hemp “Engineering<br />
perspectives of hemp plant harvesting and processing in<br />
Canada – A review.”, Dezember <strong>2003</strong><br />
FÜRLL, CHRISTIAN<br />
Gutachten für die Zeitschrift „Arznei- und Gewürzpflanzen“,<br />
April <strong>2003</strong><br />
GEYER, MARTIN<br />
Gutachten für die Zeitschrift „Biosystems Engineering“,<br />
Juni <strong>2003</strong><br />
GEYER, MARTIN<br />
Stellungnahme zu Projektskizze 02UM032: „Kreislaufanlage<br />
Waschwasser Kartoffelindustrie“<br />
GEYER, MARTIN<br />
Gutachten für die Zeitschrift „Gartenbauwissenschaft“,<br />
Januar <strong>2003</strong><br />
GEYER, MARTIN; HERPPICH, WERNER B.<br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse 149<br />
Fachgutachten für die CZU Prag zur Publikation "Sorption<br />
Isotherm in Materials of Biological Origin - Mathematical<br />
and Physical Approach", März <strong>2003</strong><br />
HELLEBRAND, HANS-JÜRGEN<br />
2 Gutachten für die Zeitschrift „Biosystems Engineering“,<br />
Mai <strong>2003</strong><br />
HEROLD, BERND<br />
Gutachten für die Zeitschrift „Arznei und Gewürzpflanzen“,<br />
Februar <strong>2003</strong><br />
HERPPICH, WERNER, B.<br />
Gutachten für EJHS (European Journal of Horticultural<br />
Science), April <strong>2003</strong> und Oktober <strong>2003</strong><br />
HERPPICH, WERNER, B.<br />
Stellungnahme für Zeitschrift „Journal of Environmental<br />
Quality“, Dezember <strong>2003</strong><br />
LANGNER, HANS-RAINER<br />
Gutachten für Biosystem Engineering “Fixed Film Anaerobic<br />
Digestion of Flushed Dairy Manure after Primary<br />
Treatment: Wastewater Production and Characterisation,”<br />
, Juni <strong>2003</strong><br />
LINKE, BERND<br />
Gutachten für Agrartechnische Forschung „Monofermentation<br />
von Nahrungsmittelabfällen in Biogasanlagen –<br />
Laboruntersuchungen.“ , Dezember <strong>2003</strong><br />
LINKE, BERND<br />
Gutachten für 2 Beiträge zur Veröffentlichung in Acta<br />
Horticulturae zum International Workshop on Models for<br />
Plant Growth and Control of Product Quality, Potsdam, August<br />
<strong>2003</strong><br />
LINKE, MANFRED<br />
Gutachten für: Roy B. Dodd, Danny E. Akin: Recent Developments<br />
in Retting of Natural Fibers – Pro and Contra<br />
CRC Book: Natural Fibers, Biopolymers and their Biocomposites<br />
Editors: A. K. Mohanty, M. Misra, L.T: Drzal<br />
Harworth Press. Inc. Michigan<br />
August <strong>2003</strong><br />
MUNDER, FRIEDRICH<br />
9 Gutachten für INTAS (International Association for the<br />
promotion of co-operation with scientists from the New<br />
Independent States of the former Soviet Union) Call<br />
<strong>2003</strong><br />
PLÖCHL, MATTHIAS<br />
3 Stellungnahmen für Beiträge zur 9. Internat. Fachtagung<br />
"Energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe",<br />
Freiberg, Mai <strong>2003</strong><br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
15 Stellungnahmen für Beiträge zur Conference "New<br />
methods, means, and technologies for applications of<br />
agricultural products" Lithuania, September <strong>2003</strong><br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
150<br />
1 Gutachten für Beitrag in der Zeitschrift Agricultural Engineering<br />
Research Papers 35(3), Raudondvaris/Lithuania,<br />
Oktober <strong>2003</strong><br />
SCHOLZ, VOLKHARD<br />
9 Beteiligung an Messen und Ausstellungen<br />
Participation in Fairs and Exhibitions<br />
Internationale Grüne Woche Berlin, 17.01.-26.01.<strong>2003</strong><br />
- Sonderschau BMVEL „Bäuerliche Landwirtschaft“<br />
Thema: „Qualität bei Kartoffeln“<br />
Brandenburger Landwirtschaftsausstellung (BRALA),<br />
Paaren im Glien, Messestand Forschung in der Agrartechnik,<br />
29.05. - 01.06.<strong>2003</strong><br />
Potsdamer Jahr der Wissenschaften <strong>2003</strong><br />
Beteiligung am Wissenschaftsmarkt zum Brandenburgtag<br />
06.09.<strong>2003</strong>, Thema „Präzision auf dem Acker“<br />
Exponat Qualitätsanalyse von Früchten in Lagerräumen<br />
und Transportcontainer. Poster und Modell auf dem<br />
Chemieschiff „Jenny“ im Rahmen <strong>des</strong> Jahres der Chemie<br />
<strong>2003</strong> Wissenschaft im Dialog Juli bis September<br />
<strong>2003</strong><br />
AGRITECHNICA <strong>2003</strong> Hannover<br />
08.11.-15.11.<strong>2003</strong><br />
- Präsentation <strong>des</strong> Instituts in Halle Forschung und Wis<br />
senschaft<br />
- Ausstellungsstand zum Aufschluss von Naturfaserpflanzen<br />
und Biogas aus Energiepflanzen<br />
- Laborprüfstand Multispektralkamera zur Unkrautdetektion,<br />
DLG-Special Pflanzenschutz<br />
- Mitaussteller <strong>des</strong> CROP-Meter, versch. Hallen<br />
10 Öffentlichkeitsarbeit<br />
Public Relations<br />
10.1 Veranstaltungen<br />
Briefmarkenausstellung „Eisenrosse – klein aber zackig.<br />
Traktoren aus der Sowjetunion“<br />
Institut für Agrartechnik Bornim, 26.02.-31.03.<strong>2003</strong><br />
Teilnahme am Parlamentarischen Abend der Leibniz-<br />
Gemeinschaft, Berlin, 06.05.<strong>2003</strong><br />
Poster: Institut und „Fruchtqualität und -sicherheit“, Exponat:<br />
Reifesensor für Bananen<br />
Teilnahme am Parlamentarischen Abend von LAUF e.V.<br />
und Brandenburger Lan<strong>des</strong>rektorenkonferenz,<br />
Lan<strong>des</strong>vertretung Brandenburg in Berlin, 22.10.<strong>2003</strong><br />
Vortrag (EHLERT, DETLEF), Exponate (Schlepper mit Pendelsensor,<br />
künstliche Nase)<br />
Tag der offenen Tür zum Thema "Biomasse - Stoff- und<br />
Energielieferant der Zukunft", Institut für Agrartechnik<br />
Bornim, 4.10.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
10.2 Medienspiegel<br />
„Biogas sucht Anschluss“<br />
Sonne, Wind und Wärme<br />
Erscheinungstermin: 1/<strong>2003</strong><br />
„Pflanzliche Kosubstrate - Erntezeit bestimmt Biogasausbeute“<br />
energie pflanzen<br />
Erscheinungstermin: 1/<strong>2003</strong><br />
„Pflanzen zur Biogaserzeugung durchleuchtet, Raps<br />
schneidet schlecht ab“<br />
energie pflanzen<br />
Erscheinungstermin: 1/<strong>2003</strong><br />
„Pferd und Elch als Landschafspfleger“<br />
Berliner Zeitung<br />
Erscheinungstermin: 23.01.<strong>2003</strong><br />
„Innovationen auf der Fruitlogistica“<br />
RBB Berlin Fernsehen, Sendereihe Wissenschaft<br />
Sendetermin: 28.01.<strong>2003</strong><br />
„Energie aus Mist“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 26.02.<strong>2003</strong><br />
„Bio-Frische im Bild - Bunte Qualitätskontrolle“<br />
EVE Naturkost-Magazin<br />
Erscheinungstermin: 3/<strong>2003</strong>:<br />
„Innovative Agrartechnik schont Ressourcen“<br />
Europäischer Wirtschaftsdienst, Wa Nr. 7<br />
Erscheinungstermin: 01.04.<strong>2003</strong><br />
„Wälder und Wiesen - Die Rolle der Landschaftspflege“<br />
Deutschland-Radio Berlin, Sendereihe Zeitreisen<br />
Sendetermin: 05.04.<strong>2003</strong><br />
„Wasser sparen für die Zukunft“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin 09.04.<strong>2003</strong><br />
„Brandenburger Reifeprüfung“<br />
Die Zeit<br />
Erscheinungstermin: 22.05.<strong>2003</strong><br />
„Sensoren für Qualitätsbestimmung“<br />
NDR-InfoRadio, Sendung „Logo“<br />
Sendetermin: 25.04.<strong>2003</strong><br />
Institutsdarstellung im Rahmen <strong>des</strong> „Jahr der Wissenschaften<br />
Potsdam <strong>2003</strong>“ mit folgenden Beiträgen:<br />
- „Damit die Kühe lachen können“<br />
- „Engagement und auch viel Sorgen“<br />
- „Der Landwirt als Energiewirt“<br />
- „Die Elektronik lag im Zwiebelhaufen“<br />
- „Verbundprojekt mit langem Namen.“<br />
- „Leibniz ist Programm“<br />
Märkische Allgemeine Zeitung<br />
Erscheinungstermin: 10.06.<strong>2003</strong>
„Förderung für vermarktbare Produkte aus der Forschung<br />
– Technologietransferpreis an BTU Cottbus, Uni<br />
Potsdam und <strong>ATB</strong>“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 13.06.<strong>2003</strong><br />
„Hightech auf dem Bauernhof“<br />
Deutschlandradio „Forschung aktuell“<br />
Sendetermin 19.06.<strong>2003</strong><br />
„Lebensmittelqualität“<br />
RBB Berlin Hörfunk „Wissenschaft aktuell“<br />
Sendetermin: 21.06.<strong>2003</strong><br />
"Pappeln von der Plantage"<br />
Märkische Allgemeine Zeitung<br />
Erscheinungstermin: 22.06.<strong>2003</strong><br />
„Mit Chips Kartoffeln anbauen“<br />
Süddeutsche Zeitung<br />
Erscheinungstermin: 24.06.<strong>2003</strong><br />
„Hightech auf dem Acker“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 25.06.<strong>2003</strong><br />
„Designer-Sprit auf dem Weg zur Brennstoffzelle“<br />
Märkische Allgemeine Zeitung<br />
Erscheinungstermin: 15.07.<strong>2003</strong><br />
„Künstliche Nasen und Thermokühe – Agrarforscher aus<br />
Bornim. Sonntagsvorlesung Potsdamer Köpfe“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 18.07.<strong>2003</strong><br />
„Hightech für Obstbauern - Handschuh erkennt reife<br />
Früchte“<br />
Bild am Sonntag<br />
Erscheinungstermin: 27.07.<strong>2003</strong><br />
„Reife und Qualität von Apfel und Pfirsich – Instrumenten<br />
Handschuh entwickelt“<br />
aid Infodienst<br />
Erscheinungstermin: 31.07.<strong>2003</strong><br />
„Agrar-Elektronik – Handschuh prüft Reife von Früchten“<br />
P.M.<br />
Erscheinungstermin: 07/<strong>2003</strong><br />
„Forscher sitzen nicht mehr im Elfenbeinturm“<br />
Forum - Das Brandenburger Wirtschaftsmagazin<br />
Erscheinungstermin: 7-8/<strong>2003</strong><br />
„Tröpfchen gegen die Trockenheit - mit weniger Wasser<br />
mehr Feld bewässern“<br />
geoscience online/ Focus GeoAngewandt<br />
Erscheinungstermin: 01.08.<strong>2003</strong><br />
„Im Osten dreht die Sonne auf - Umwelt: Brandenburg<br />
droht ein ökologisches Desaster“<br />
VDI Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 08.08.<strong>2003</strong><br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse 151<br />
„Äpfel - Früchte der Forschung“<br />
Hamburger Abendblatt<br />
Erscheinungstermin: 18.08.<strong>2003</strong><br />
„Ausgründung der Firma CP“<br />
RBB Brandenburg Fernsehen, Wirtschaft-Aktuell<br />
Sendetermin: 19.08.<strong>2003</strong><br />
„Bornimer Landtechniker setzen auf Präzisionsberegnung“<br />
Eilbote<br />
Erscheinungstermin: 33. Wo. <strong>2003</strong><br />
„Innovationen für die Präzisions-Landwirtschaft“<br />
Profil online<br />
Erscheinungstermin: 02.09.<strong>2003</strong>:<br />
„Präzisionslandschaft – Zukunftstechnologie im Agrartechnik“<br />
DBU aktuell<br />
Erscheinungstermin: 09.09.<strong>2003</strong><br />
„Reifebestimmung mit „Röntgenblick“<br />
Besseres Obst<br />
Erscheinungstermin: 9/<strong>2003</strong><br />
“Der grüne Boom”<br />
3sat, hitech “die documentation”<br />
Sendetermin: 21.09.<strong>2003</strong><br />
„Hightech in der Agrarproduktion - Statusseminar stellt<br />
Innovationen in Pflanzenbau, Tierhaltung und Nachernte<br />
vor“<br />
Forschungs-Report<br />
Erscheinungstermin: Heft 2/<strong>2003</strong><br />
„Die Agrarforscher in Bornim öffnen am Sonnabend ihre<br />
Türen“<br />
Potsdamer Neuste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 02.10.<strong>2003</strong><br />
"Schweinegülle einmal anders"<br />
Institut für Agrartechnik stellt Biomasse-Projekte vor.<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 6.10.<strong>2003</strong><br />
„Brennende Pappeln – Agrarforscher auf der Suche<br />
nach Energiepflanzen“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 15.10.<strong>2003</strong><br />
„Reifeprüfung – Hightech-Schnüffler im Apfelbaum“<br />
RBB Brandenburg Fernsehen „Das Wissenschaftsmagazin“<br />
Sendetermin: 22.10.<strong>2003</strong><br />
„Briketts aus Baumwollstängeln – das Bornimer Institut<br />
für Agrartechnik (<strong>ATB</strong>) hilft bei der Lösung von Umweltproblemen<br />
im Nildelta“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 29.10.<strong>2003</strong><br />
„Institute von Schließung bedroht“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 05.11.<strong>2003</strong><br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
152<br />
„Präzisionsbewässerung auf dem Feld – Sensoren könnten<br />
den Ausweg aus der Dürre weisen“<br />
„Getreide schonender trocknen – Energiesparen<strong>des</strong> Verfahren<br />
ist Forschungsziel“<br />
Die Messe – Messejournal AGRITECHNICA ’03<br />
Erscheinungstermin: 11.11.<strong>2003</strong><br />
„Big Brother auf dem Acker sorgt für Durchblick“<br />
VDI Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 14.11.<strong>2003</strong><br />
„Mit Einsatz von ausgeklügelter Landtechnik lässt sich<br />
das Verbrauchervertrauen erhöhen“<br />
VDI Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 14.11.<strong>2003</strong>:<br />
„Auf dem Weg zum Bioenergieland“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 19.11.<strong>2003</strong><br />
„Knollen ohne Keime – wie Bornimer Agrarwissenschaftler<br />
die Lagerfähigkeit von Kartoffeln verbessern wollen“<br />
Berliner Zeitung Nr. 271<br />
Erscheinungstermin: 20.11.<strong>2003</strong><br />
„Diesel aus Raps“<br />
Potsdamer Neueste Nachrichten<br />
Erscheinungstermin: 25.11.<strong>2003</strong><br />
„Patent: Kartoffelschälmaschine“<br />
RBB Brandenburg, Fernsehen „Klartext Wirtschaft“<br />
Sendetermin: 25.11.<strong>2003</strong><br />
„Kartoffelschälmaschine“<br />
RBB Brandenburg Fernsehen „zibb“<br />
Sendetermin: 25.11.<strong>2003</strong><br />
„Kartoffel ohne Keime – gut gelagert im Großkistenlager“<br />
RBB Brandenburg Fernsehen „Brandenburg aktuell“<br />
Sendetermin: 23.12.<strong>2003</strong>, 19:30 Uhr<br />
„Präzision lohnt sich“<br />
DLG-Mitteilungen<br />
Erscheinungstermin: 12/<strong>2003</strong><br />
11 Qualifizierung von <strong>ATB</strong>-Mitarbeitern<br />
Further Training and Education of Staff Mem-<br />
bers<br />
Kurzlehrgang „Turbulenz“<br />
Lehrstuhl für Strömungmechanik (LSTM) Universität<br />
Erlangen, 07.-11.04.<strong>2003</strong><br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Diffpack Developer Training<br />
Fa. InuTech, Nürnberg, 03.-05.06.<strong>2003</strong><br />
GOTTSCHALK, KLAUS<br />
Tag der jungen Wissenschaft<br />
IGZ GROßBEEREN, 24.04.<strong>2003</strong><br />
HASSENBERG, KARIN<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
Fachtagung „Erfahrungen und Perspektiven im Einsatz<br />
von Biogas in Brandenburg“<br />
Grüne Woche, Berlin, 21.01.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA<br />
Jahrestagung <strong>des</strong> Deutschen Grünlandverban<strong>des</strong><br />
Paaren/Glien, 30.05.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA<br />
Anwenderforum Biodiesel<br />
ETI, IHK<br />
Potsdam, 08.07.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA<br />
Symposium „Biologische Senken für atmosphärischen<br />
Kohlenstoff in Deutschland“<br />
FAL<br />
Braunschweig, 04.-05.11.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA<br />
16. Fachtagung Acker- und Pflanzenbau „Ergebnisse<br />
und Ausblicke zum Pflanzenbau“<br />
Lan<strong>des</strong>amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft<br />
Güterfelde, 13.11.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA<br />
Arbeitstreffen ETI AK-Biogas<br />
LfL Groß-Kreutz, 28.10.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA<br />
1. Bioenergietag<br />
Steinhöfel, 12.08.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA; LUCKHAUS CHRISTOPH;<br />
PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Arbeitstreffen ETI AK-Biogas<br />
Dolgelin, 22.07.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA; M PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Präsentation <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>leitprojektes der ETI: TNS-<br />
Biogasanlage<br />
Pirow, 01.10.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Baulehrschau Fachtag „Biogas“<br />
Sächsische Lan<strong>des</strong>anstalt für Landwirtschaft, Köllitsch,<br />
12.11.<strong>2003</strong><br />
HEIERMANN, MONIKA; PLÖCHL, MATTHIAS<br />
Molekulare Nachweismethoden für pathogene Mikroorganismen<br />
in Lebensmitteln<br />
Oberschleißheim, 09.10.-10.10.<strong>2003</strong><br />
IDLER, CHRISTINE<br />
Moderne Standard- und Schnellmethoden in der Lebensmittelmikrobiologie<br />
Lemgo, 05.11.-07.11.<strong>2003</strong><br />
IDLER, CHRISTINE<br />
Anwendertreffen – TOC/TN-Analytik<br />
Berlin, 20.11.<strong>2003</strong><br />
JÄKEL, MANDY
Fortbildungsseminar „Mikrowellenbasierter Probenaufschluss“<br />
Rehbrücke, 18.03.<strong>2003</strong><br />
KNUTH, ULRIKE<br />
PO1B Lehren lernen/ Einführung i. d. Didaktik<br />
Berlin, 01.09.-03.09.<strong>2003</strong><br />
KRAMER, ECKART<br />
PO2 Workshop-Lehren lernen<br />
Berlin, 06.10.-07.10.<strong>2003</strong><br />
KRAMER, ECKART<br />
Workshop-Rückverfolgbarkeit von Produktströmen in der<br />
Mischfutterindustrie<br />
Braunschweig-Thune, 26.11.<strong>2003</strong><br />
KRAMER, ECKART<br />
Sprachkurs Englisch<br />
Malta, 26.6.-05.07.<strong>2003</strong><br />
KREHL, INES<br />
VDI-Workshop - Optische 3D-Messtechnik<br />
Magdeburg, 20.-21.11.<strong>2003</strong><br />
LANGNER, HANS-RAINER<br />
Anwendertreffen – TOC/TN-Analytik<br />
Berlin, 20.11.<strong>2003</strong><br />
REHDE, GIOVANNA<br />
Weiterbildung zum sicheren Umgang mit Informationstechnik<br />
im <strong>ATB</strong>, 11/12 <strong>2003</strong>, Referenten: ILTE, THOMAS;<br />
FRIESEL, SABINE<br />
Kurs 1: Erweiterte Grundrechte: Sicherheit elektronischer<br />
Informationen (106 Teilnehmer)<br />
Kurs 2: Sicherer Umgang mit HTTPS (10 Teilnehmer)<br />
Kurs 3: Fernzugriff und FTP (32 Teilnehmer)<br />
Kurs 4: Einsatz tragbarer Computer und Vollzugriff auf<br />
das System (19 Teilnehmer)<br />
Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)<br />
am <strong>ATB</strong><br />
Referent: SCHWARZ, JÜRGEN<br />
<strong>ATB</strong>-Potsdam, 05.12.<strong>2003</strong><br />
Plenarvortrag vor Wissenschaftlern <strong>des</strong> <strong>ATB</strong><br />
IV Veröffentlichung der Ergebnisse<br />
153<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
154<br />
V Organisation und Ausstattung <strong>des</strong> Instituts<br />
V Organisation und Ausstattung <strong>des</strong> Instituts<br />
1 Organisation<br />
Anschrift:<br />
Institut für Agrartechnik Bornim e. V. (<strong>ATB</strong>)<br />
Max-Eyth-Allee 100<br />
D-14469 Potsdam<br />
E-mail: atb@atb-potsdam.de<br />
Telefon: (0331) 5699-0<br />
Wissenschaftlicher Direktor:<br />
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Zaske<br />
Tel.: (0331) 5699-100<br />
E-mail: zaske@atb-potsdam.de<br />
Telefax: (0331) 5699-849<br />
Internet: http://www.atb-potsdam.de<br />
Verwaltungsleiter:<br />
Dr. agr. Ralf Habelt<br />
Tel: (0331) 5699-710<br />
E-mail: rhabelt@atb-potsdam.de<br />
Das <strong>ATB</strong> hat die Rechtsform eines eingetragenen Vereins (e.V.). Es ist Gründungsmitglied der Leibniz-<br />
Gemeinschaft, deren Hauptanliegen es ist, die Zusammenarbeit der Mitgliedseinrichtungen zu fördern und<br />
gemeinsame Interessen wahrzunehmen. Innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft gehört das <strong>ATB</strong> der<br />
Sektion E, Umweltwissenschaften, an.<br />
Das <strong>ATB</strong> ist ebenfalls Gründungsmitglied der Lan<strong>des</strong>vereinigung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen<br />
<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> Brandenburg e.V. (LAUF e.V.).<br />
Nachfolgende Übersicht stellt die Organe <strong>des</strong> Vereins dar.<br />
Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ <strong>des</strong> Vereins. Ihrer Beschlussfassung unterliegen u.a. der<br />
mittelfristige Forschungsrahmenplan und der Entwurf <strong>des</strong> Wirtschaftsplanes, weiterhin die Feststellung <strong>des</strong><br />
<strong>Jahresbericht</strong>es und der Haushaltsrechnung sowie die Entlastung <strong>des</strong> Vorstan<strong>des</strong>.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
V Organisation und Ausstattung <strong>des</strong> Instituts 155<br />
In allen wichtigen wissenschaftlichen Fragen wird das Institut vom Wissenschaftlichen Beirat beraten.<br />
Diese beinhalten z.B. die Erstellung der Forschungsrahmenpläne, der Forschungsprogramme sowie der<br />
<strong>Jahresbericht</strong>e. Er bewertet die Forschungsleistungen und die Arbeitsplanung. Regelmäßige inhaltliche Tagesordnungspunkte<br />
sind die Vorstellung und Bewertung der Forschungsarbeiten einer Abteilung und/oder<br />
eines Forschungsschwerpunktes, die Diskussion zur Umsetzung der Empfehlungen der Evaluierungsgremien<br />
sowie die Bewertung <strong>des</strong> Berichts <strong>des</strong> Vorstan<strong>des</strong> über die Aktivitäten <strong>des</strong> <strong>ATB</strong> im laufenden Jahr.<br />
Juristisch wird das Institut vom Vorstand vertreten, <strong>des</strong>sen Vorsitzender der Wissenschaftliche Direktor<br />
ist. Er leitet die Einrichtung im Rahmen der Vorgaben der Mitgliederversammlung. Der Vorstand hat insbesondere<br />
das jährliche Forschungsprogramm vorzustellen, den Entwurf <strong>des</strong> Wirtschaftsplanes zu erstellen<br />
sowie über die Einstellung der Angestellten und Arbeiter zu beschließen. Er führt auf der Basis <strong>des</strong> Organisationsplanes,<br />
der Satzung und der Geschäftsordnung die Geschäfte.<br />
Dem Kollegium gehören neben dem Vorstand und den Abteilungsleitern drei Wissenschaftler/-innen an, die<br />
für zwei Jahre aus dem Kreis aller Wissenschaftler gewählt werden. Es berät den Vorstand vor allem bei<br />
abteilungsübergreifenden wissenschaftlichen Angelegenheiten und anderen internen Arbeitsabläufen, insbesondere<br />
zum Forschungsprogramm <strong>des</strong> <strong>ATB</strong>, zur Durchführung abteilungsübergreifender integrierter Forschungsvorhaben,<br />
zum Bedarf an Personal- und Sachmitteln und zu deren Verteilung auf die Abteilungen,<br />
sowie zur Nutzung von gemeinschaftlichen Einrichtungen.<br />
Als Vertreter der Arbeiter und Angestellten <strong>des</strong> Instituts übt der Betriebsrat eine wichtige Beratungs- und<br />
Kontrollfunktion innerhalb <strong>des</strong> Instituts aus.<br />
Die fachliche Struktur <strong>des</strong> Instituts geht aus dem nachfolgenden Organisationsplan hervor.<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
156<br />
2 Abteilungen<br />
V Organisation und Ausstattung <strong>des</strong> Instituts<br />
Das Institut ist in sechs projektführende Abteilungen, den Bereich Verwaltung sowie zwei Stabsstellen gegliedert.<br />
Von den sechs projektführenden Abteilungen sind fünf verfahrensorientiert (Abt. 1, 3, 4, 5 und 6)<br />
und eine methodenorientiert (Abt. 2).<br />
Die Fachabteilungen haben den Auftrag, die fachliche und methodische Kompetenz in den jeweiligen Wissensgebieten<br />
sicherzustellen und weiterzuentwickeln, sowie diese bei Erfordernis durch externe Kooperationen<br />
zu verstärken. Die eigenen Forschungsarbeiten werden zunehmend in komplexe Vorhaben eingebunden.<br />
Darüber hinaus werden in allen Fachabteilungen die jeweils anerkannten Verfahren und Erkenntnisse<br />
der Technikbewertung berücksichtigt sowie aktuelle Methoden der mathematischen Modellierung und computergestützten<br />
Simulation angewendet.<br />
Die Verwaltung ist verantwortlich für Personalangelegenheiten, für Fragen der Wirtschafts- und Budgetplanung,<br />
Beschaffung und Buchhaltung sowie für die Zentralwerkstatt und Liegenschaften.<br />
Abteilung Bioverfahrenstechnik<br />
Leitung: PD Dr. agr. Dipl.-Ing. Bernd Linke<br />
Tel: (0331) 5699-110 E-mail: blinke@atb-potsdam.de<br />
24 Mitarbeiter, darunter 8 Wissenschaftler und Doktoranden<br />
- Mikrobiologie: Stammsammlung von Bakterien und Pilzen; Screening und Stammoptimierung; Anwendung<br />
mikrobieller Systeme bzw. ihrer Methoden in landwirtschaftlichen Prozessen; chemische, mikrobiologische<br />
und molekulargenetische Analytik<br />
- Biokonversion: enzymatische Rohstoffvorbehandlung; Prozessoptimierung und Reaktionskinetik (Modellbildung);<br />
Fermentationstechnik (batch, fed-batch, kontinuierlich) mit und ohne Biomasserückhaltung<br />
- Aufarbeitung: Zellmasse- und Produktabtrennung (Membrantrennprozesse); Produktreinigung; Konditionierung<br />
- Biogeochemie: Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphordynamik bei der Abwasserreinigung; Weiterentwicklung<br />
bewachsener Bodenfilter; umweltverträgliche Reststoffverwertung<br />
- Umweltbioverfahrenstechnik: Abwasserreinigung und Schlammbehandlung; Prozessoptimierung und<br />
Reaktionskinetik; Biogasgewinnung; Gasanalytik<br />
Labore und Geräte<br />
- Versuchsanlagen: Fermentoren, Membrantrennvorrichtungen<br />
- Analysengeräte: konventionelle Apparaturen, HPLC, Gaschromatographie, Ionenchromatographie, Elementaranalyse,<br />
Atomabsorptionsspektrometrie, Respirationsanalyse, Standardmethoden für mikrobiologische<br />
Arbeiten; u.a.<br />
- Fermentationslabor: Untersuchung der Wachstums- und Produktbildungskinetik in diskontinuierlichen<br />
und kontinuierlichen Fermentationssystemen<br />
- Biotechnikum: Optimierung und Maßstabsübertragung von Prozessen in den Bereichen Biokonversion,<br />
Produktaufbereitung, Reststoff- und Abwasserbehandlung. Erprobung von geschlossenen Verfahren und<br />
Herstellung von Produktmustern.<br />
- Genetisches Labor (S1): Entwicklung von DNA-Markern, Genetische Optimierung von Fermentationsstämmen,<br />
DNA-Analytik<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
Abteilung Technikbewertung und Stoffkreisläufe<br />
Leiter: PD Dr. rer. agr. Annette Prochnow<br />
Tel: (0331) 5699-210 E-mail: aprochnow@atb-potsdam.de<br />
25 Mitarbeiter, darunter 14 Wissenschaftler und Doktoranden<br />
V Organisation und Ausstattung <strong>des</strong> Instituts 157<br />
- Modellierung von Produktions- und Logistik-Systemen: Systemanalyse, Simulationsmodelle, Einsatz<br />
von neuronalen Netzen, mathematische Optimierungsverfahren, fuzzy logic; Bereiche: Logistik, Produktionstechnik,<br />
Umweltmanagement<br />
- Technikbegleitforschung: Stellungnahmen und Gutachten zu Bewertungsfragen, Folgenabschätzung,<br />
Technikwirkungsanalyse, partielle Wirtschaftlichkeitsanalysen, Marktstudien, Einsatzmöglichkeiten physikalischer<br />
Messtechnik<br />
- Stoff- und Energieströme: Spurengasanalytik, Methodische Fragen der Bilanzierung, betriebs- und produktbezogene<br />
Stoff- und Energiebilanzen<br />
Dienstleistungen:<br />
- Organisation einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildungsreihe am <strong>ATB</strong>, gemeinsam mit dem Qualifizierungsverein<br />
Land- und Forstwirtschaft Berlin-Brandenburg<br />
Abteilung Technik der Aufbereitung, Lagerung und Konservierung<br />
Leiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Fürll<br />
Tel.: (0331) 5699-310 E-mail:cfuerll@atb-potsdam.de<br />
31 Mitarbeiter, darunter 12 Wissenschaftler und Doktoranden<br />
- Aufbereitung und Lagerung: Zerkleinerungstechnik, Sortiertechnik, Schältechnik, Entstaubungstechnik,<br />
Schüttguttechnik, Technik für den Aufschluss und die Reinigung von Naturfasern, Verfahrenstechnik für<br />
die Getreidekonservierung<br />
- Qualitätssicherung empfindlicher Agrarprodukte: Qualitätsforschung (Schwerpunkt: Kartoffel), rechnergestützte<br />
Qualitätssicherungssysteme<br />
- Lagerklimatisierung, Strömungsmechanik, Datenbanken: Steuerung und Regelung mit Fuzzy Logik,<br />
numerische Strömungsberechnungen, Entwicklung von Datenbanken zur Qualitätssicherung, Entwicklung<br />
Neuronaler Netze (Bereiche: Qualitätssicherung)<br />
- Trocknungstechnik: Wärme- und Stoffaustausch bei der Trocknung, solar unterstützte Trocknung mit<br />
Wärmespeicherung<br />
- Energie in und aus der Landwirtschaft: Produktion und Nutzung nachwachsender Energierohstoffe,<br />
Landwirtschaftliche Energiebilanzen und –konzepte, Anwendung erneuerbarer Energie in der Landwirtschaft<br />
Abteilung Technik im Pflanzenbau<br />
Leiter: Dr.-Ing. Detlef Ehlert<br />
Tel.: (0331) 5699-410 E-mail: dehlert@atb-potsdam.de<br />
18 Mitarbeiter, darunter 7 Wissenschaftler<br />
- Bodenschonende Produktionsverfahren: Onland-Pflügen, Bodenbelastung durch Transportvorgänge,<br />
Kraftstoffverbrauchsmessungen, pfluglose Bewirtschaftung, Ermitteln von Bodenparametern (z.B. elektrische<br />
Leitfähigkeit, Durchdringungswiderstand)<br />
- Teilflächenspezifische Bewirtschaftung: Heterogenitätsbestimmung durch Fernerkundung, Offline-<br />
Bewirtschaftung, Pflanzenmasse- und Ertragskartierung, Unkrauterkennung, sensorgestützte Applikation<br />
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in Echtzeit, Bewertung betriebswirtschaftlicher Effekte<br />
- Informationsmanagement: Lokale Datenerfassung, Datenminimierung, Auswertung flächenbezogener<br />
Daten, Nutzung <strong>des</strong> Landwirtschaftlichen Bussystems<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
158<br />
Dienstleistungen:<br />
- Betreiben und Warten von Feldtechnik<br />
V Organisation und Ausstattung <strong>des</strong> Instituts<br />
- Beratung bei der Nutzung der Satellitenortungstechnik<br />
- Unterstützung der Zentralwerkstatt<br />
Abteilung Technik in der Tierhaltung<br />
Leiter: Prof. Dr. agr. habil. Reiner Brunsch<br />
Tel.: (0331) 5699-510 E-mail: rbrunsch@atb-potsdam.de<br />
17 Mitarbeiter, darunter 6 Wissenschaftler und Doktoranden<br />
- Stallklima/Emissionen: Stoffstromanalysen für Gase und Gerüche, Fest- und Flüssigmistbehandlung<br />
(Zusätze, Abdeckungen); Lüftungssysteme, Thermodynamik, Richtlinienarbeit<br />
- Prozessdatengewinnung am Tier: Sensorapplikationen zur Brunst- und Gesundheitsüberwachung bei<br />
Rindern, biologische Grundlagen der Nutztierhaltung<br />
- Fördertechnische Grundlagen landwirtschaftlicher Suspensionen: Stoffdatenbestimmung, Förderverhalten,<br />
Pumpenprüfung, Herstellung homogener Mischungen, Strömungstechnik, Rheologie<br />
- Milchgewinnung: Prozessnahe Erfassung der Milchqualität, Grundlagen zum euterschonenden Milchentzug,<br />
technologische Einordnung von Melkrobotern in Großbetrieben<br />
Abteilung Technik im Gartenbau<br />
Leiter: Dr. agr. Martin Geyer<br />
Tel.: (0331) 5699-610 E-mail: geyer@atb-potsdam.de<br />
26 Mitarbeiter, darunter 12 Wissenschaftler und Doktoranden<br />
- Ernte und Nacherntetechnologie für gartenbauliche Produkte: Bewertung und Entwicklung innovativer<br />
Verfahren für die Ernte und für die Nachernte gärtnerischer Produkte unter den Gesichtspunkten der Qualitätssicherung<br />
und der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe.<br />
- Physiologische und physikalische Produkteigenschaften: Meßverfahren und Methoden zur Bestimmung<br />
mechanischer und optischer Eigenschaften, zur Wasserzustands- und Frischebestimmung und zur<br />
zerstörungsfreien Qualitätsbestimmung und -kontrolle von Obst und Gemüse (u.a. Chlorophyllfluoreszenz-<br />
Bildanalyse, Laser Fluoroskop zur Aktivitätsmessung, NADP/H, spektrale Lichtreflexion und –transmission<br />
im VIS und NIR Bereich, Geruchsmessung, Oberflächentemperatur durch Thermografie, Atmungsmessung,<br />
Werkstoffprüfung, Stoßprüfung, Kontaktdruckverteilung mittels Foliensensoren, PC-Programme zur<br />
statistischen Auswertung der Meßdaten)<br />
- Verfahrenstechnik: Verfahren der Ernte und Aufbereitung von Obst und Gemüse; Reduzierung mechanischer<br />
Belastungen und Beschädigungen (Druckmeßkugel PMS-60, Beschleunigungserfassung IS100);<br />
Waschen von Gemüse (Hygiene; Wasser- und Schmutzwasseraufbereitung); Klimatechnische Optimierung<br />
von Nachernteprozessen; Qualitätssicherung im Handel<br />
- Mensch und Arbeit: Arbeitswissenschaften; Optimierung von ortsfesten Arbeitsplätzen; Mensch-<br />
Maschine Systeme (Bewegungsanalysesystem, Leistungsmeßtechnik, digitale Videoerfassung)<br />
Ausstattung<br />
- Analytische Labore für Qualitätsanalysen an frischen gartenbaulichen Produkten<br />
- Entwicklungslabor für elektronische Meßtechnik<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
Verwaltung<br />
Leiter: Dr. agr. Ralf Habelt<br />
Tel.: (0331) 5699-710 E-mail: rhabelt@atb-potsdam.de<br />
16 Mitarbeiter<br />
V Organisation und Ausstattung <strong>des</strong> Instituts 159<br />
- Personal: Personalwirtschaftliche Aufgaben, Personalwirtschaftliche und arbeitsrechtliche Grundsatzfragen,<br />
Gehaltsrechnung, Fort- und Weiterbildung<br />
- Haushalt: Wirtschafts- und Budgetplanung (jährlich), Grundsatzfragen der Wirtschaftsplanung und Beschaffung,<br />
Buchhaltung<br />
- Technik: Bau- und Instandsetzungsvorhaben, Raumbedarf und Sachmittelausstattung, Liegenschaftsverwaltung<br />
- Zentralwerkstatt: Bau von Versuchsständen, Modellen und Prototypen nach projektbezogenen Vorgaben,<br />
Unterstützung der Fachabteilungen bei arbeitsintensiven Versuchen, Bau-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten<br />
Im Rahmen der Infrastrukturmaßnahme (EU-Förderung aus dem Programm EFRE ) konnten <strong>2003</strong> im wesentlichen<br />
die Baumaßnahmen abgeschlossen werden. Dazu gehörten der Bau einer Leichtbauhalle, die<br />
Komplettsanierung eines Bürogebäu<strong>des</strong>, Dacheindeckung eines Hauses und der Beginn der Sanierung eines<br />
Aufbereitungstechnikums.<br />
Die Projektierungsleistungen für eine Pilotanlage zur Herstellung von Milchsäure und -derivaten aus nachwachsenden<br />
Rohstoffen wurden abgeschlossen. Die Haushaltsunterlage Bau wurde zu 11/<strong>2003</strong> fertiggestellt<br />
und zur Prüfung eingereicht.<br />
Stabsstelle 01 - Forschungskoordinierung<br />
Verantwortlich: Dr.-Ing. Eckart Kramer<br />
Tel.: (0331) 5699-810 E-mail: ekramer@atb-potsdam.de<br />
2 Mitarbeiter, darunter 1 Wissenschaftler<br />
- Forschungskoordinierung<br />
- Forschungsförderung<br />
- Technologietransfer<br />
- Controlling (Grundsätze)<br />
Stabsstelle 02 - Informationstransfer<br />
Leiter: Dr. agr. Martin Geyer (AL 6)<br />
Tel.: (0331) 5699-610 E-mail: geyer@atb-potsdam.de<br />
Leiter der Stabsstelle und 4 Mitarbeiter<br />
- Öffentlichkeitsarbeit: Herausgabe von institutseigenen Schriften (Bornimer Agrartechnische Berichte,<br />
Forschungsberichte, Tagungsbände, Redaktion der "Agrartechnischen Forschung“ mit Internet-Darstellung<br />
„Landtechnik-Net“) <strong>Jahresbericht</strong>e, Informationsbroschüren, Presse- und Medienarbeit, Kontakte zu anderen<br />
Einrichtungen, Redaktionsdienstleistungen. Planung und Organisation von wissenschaftlichen Tagungen<br />
und sonstigen Veranstaltungen.<br />
- Bibliothek: Sammlung und Ausleihe von Schriften zu ausgewählten Bereichen der Agrartechnik, Schriftenaustausch,<br />
Fernleihe, Literaturrecherchen<br />
- IT/Netzwerkadministration: Pflege und Erweiterung <strong>des</strong> institutsinternen Computernetzes und der externen<br />
Datenverbindungen, Organisation und Durchführung von Schulungen, IT-Konzeption<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong>
160<br />
3 Haushalt, Finanzen und Personal<br />
<strong>ATB</strong> - <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2003</strong><br />
V Organisation und Ausstattung <strong>des</strong> Instituts<br />
Das Institut erhält auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bun<strong>des</strong>republik Deutschland<br />
und dem Land Brandenburg, jeweils vertreten durch den Bun<strong>des</strong>minister bzw. den Minister für Ernährung<br />
Landwirtschaft und Forsten, von diesen institutionelle Zuwendungen zu gleichen Teilen als Fehlbedarfsfinanzierung<br />
im Rahmen <strong>des</strong> Wirtschaftsplanes.<br />
Im Jahr <strong>2003</strong> betrug die institutionelle Zuwendung 6.501.341 Euro.<br />
Weiterhin wurden für das Jahr <strong>2003</strong> Kofinanzierungsmittel für die EFRE Maßnahmen „Infrastruktur und Pilotanlage<br />
Milchsäure“ in Höhe von 152.260 Euro und EU Mittel von 120.996 Euro im Rahmen der Maßnahmen<br />
„Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Brandenburger Agrarforschungsstandorte entsprechend der<br />
Empfehlungen <strong>des</strong> Wissenschaftsrates der Bun<strong>des</strong>republik Deutschlands“ bereitgestellt.<br />
Der Stellenplan für das Jahr <strong>2003</strong> sieht 114 Stellen vor, darunter 35,5 Wissenschaftlerstellen.<br />
Im Jahr <strong>2003</strong> wurden mit 48 Drittmittelprojekten 2.425.170 Euro eingeworben, von folgenden Drittmittelgebern:<br />
EU-Projekte 30 TEuro<br />
Deutsche Forschungsgemeinschaft 112 TEuro<br />
Bun<strong>des</strong>- und Lan<strong>des</strong>ministerien 1.868 TEuro<br />
Industrie 109 TEuro<br />
KTBL und sonstige 306 TEuro<br />
Mit diesen Projektmitteln konnten durchschnittlich 41 weitere Mitarbeiter finanziert werden.<br />
4 Ausstattung<br />
Die wesentlichen Anschaffungen im Berichtsjahr waren:<br />
- Erneuerung und Erweiterung <strong>des</strong> Rechnernetzes<br />
- Labor-Brennstoffzelle für Biogas<br />
- Anschaffung von 2 PKW<br />
In der Fachbibliothek konnte der Bestand auf 25.404 gebundene Bände (Monographien und Zeitschriften)<br />
erweitert werden. Der laufend gehaltene Zeitschriftenbestand umfasst 115 Titel, der Gesamtbestand an<br />
Schriftenreihen 287. Im Jahre <strong>2003</strong> wurden 36 Literaturrecherchen angefertigt.